*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 10223 ***
Dies ist ein Zwischenstand (Oktober 2003) der Digitalisierung von
"Meyers Konversationslexikon" (4. Aufl., 1888-1890). Die
Digitalisierung wird unter
http://www.meyers-konversationslexikon.de
erarbeitet; dort kann man auch den jeweils aktuellen Stand einsehen und
selbst an der Arbeit teilnehmen.
Wenn Korrekturen vornehmen wollen, melden Sie sich bitte entweder bei
http://www.meyers-konversationslexikon.de an oder senden Sie jeweils
ein korrigierten Eintrag an Karl Eichwalder <[email protected]> zur
Einarbeitung. Beachten Sie bei Ihren Korrekturen, daß Sie die alte
Rechtschreibung beibehalten!
Die HTML-Formatierung ist bislang bewußt einfach gehalten, um so das
Korrigieren nicht unnötig zu erschweren.
Karl Eichwalder Oktober 2003
S.
Das im laufenden Alphabet nicht Verzeichnete ist im Register des
Schlußbandes aufzusuchen.
Sodbrennen (Magenbrennen, Pyrosis), Symptom des
chronischen Magenkatarrhs, besteht in einem brennenden Gefühl
im Schlund und Rachen; es beruht darauf, daß die sauren und
scharfen Flüssigkeiten und Gase, welche sich infolge des
chronischen Magenkatarrhs und der dabei stattfindenden abnormen
Verdauungsvorgänge im Magen bilden, durch Aufstoßen in
den Schlund, ja selbst bis in den Mund gelangen und auf die
Schleimhaut dieser Teile einen scharfen Reiz ausüben. Das S.
verschwindet mit dem Magenkatarrh. Zur augenblicklichen Milderung
eignet sich am meisten doppeltkohlensaures Natron, welches die
überschüssige Säure neutralisiert.
Soddoma (eigentlich Giovannantonio Bazzi), ital. Maler,
geb. 1477 zu Vercelli in Savoyen, bildete sich seit 1498 nach
Leonardo da Vinci in Mailand und kam 1501 nach Siena, wo er
verschiedene Fresken und Tafelbilder ausführte; 1505 malte er
einen großen Freskencyklus aus dem Leben des heil. Benedikt
für das Kloster Montoliveto und um dieselbe Zeit die
Kreuzabnahme, jetzt im Museum von Siena. 1507-1509 war er in Rom,
wo er im Vatikan malte; dann ging er wieder nach Siena, kehrte aber
1514 nach Rom zurück, wo er in der Villa Farnesina seine
berühmtesten Fresken malte, Alexander vor der Familie des
Dareios und seine Vermählung mit Roxane, ein Bild, das durch
Liebenswürdigkeit der Erfindung und Zartheit des Ausdrucks
bezaubert. Damals erhob ihn Leo X. für ein Bild der
Römerin Lucrezia in den Ritterstand. Im J. 1515 kam er nach
Siena zurück, wo er 1518 vier Fresken aus der Geschichte der
Maria im Oratorium von San Bernardino malte. Zwischen 1518 und 1525
scheint er sich in Oberitalien aufgehalten zu haben, wo er mehr von
der lombardischen Schule beeinflußt wurde. Von 1525 bis 1537
war er wieder in Siena ansässig, wo er seit 1525 die Fresken
aus dem Leben der heil. Katharina in der Kapelle der Heiligen in
der Kirche San Domenico, ein durch Tiefe und Wahrheit der
Empfindung ausgezeichnetes Hauptwerk des Künstlers, und
später mehrere Heiligengestalten, die Auferstehung Christi u.
a. im Stadthaus malte. Im J. 1542 war er zu Pisa thätig. Er
starb 15. Febr. 1549 in Siena. B. war ein Lebemann, dessen
exzentrisches Wesen (daher der Name S.) ihn nicht zu einem
sorgsamen Naturstudium und zu einer fleißigen
Durchführung seiner Bilder kommen ließ. Von seinen
Tafelbildern sind noch die heilige Familie mit Calixtus (im
Stadthaus zu Siena), die Anbetung der Könige (in Sant'
Agostino daselbst) sowie eine Prozessionsfahne mit der Madonna und
dem heil. Sebastian (in den Uffizien zu Florenz) hervorzuheben.
Vgl. Jansen, Leben und Werke des Malers G. Bazzi (Stuttg.
1870).
Soden, 1) Dorf und Badeort im preuß.
Regierungsbezirk Wiesbaden, Kreis Höchst, am Fuß des
Taunus und an der Linie Höchst-S. der Preußischen
Staatsbahn, 142 m ü. M., hat schöne Parkanlagen, einen
Kursaal, ein Badehaus, eine neue Trinkhalle und (1885) 1517 meist
evang. Einwohner. Die dortigen Heilquellen, 24 an der Zahl, sind
eisenhaltige Säuerlinge von 11-29,5° C. und werden
namentlich gegen chronisch-entzündliche Krankheiten der
Respirationsorgane, Skrofulose etc., die stärkern gegen
chronische Magenkatarrhe, Dyspepsie, Hämorrhoiden,
Menstruationsstörungen, Rheumatismus, Gicht etc. angewandt.
Besonders wichtig für Badezwecke ist der Solsprudel, dessen
stark gashaltiges Kochsalzwasser (1,5 Proz.) eine natürliche
Wärme von 31° C. besitzt. Die Zahl der Kurgäste
betrug 1885: 2132. S. war früher unmittelbares Reichsdorf.
Vgl. Thilenius, S. am Taunus, mit vergleichender Rücksicht auf
Ems, Kissingen etc. (2. Aufl., Frankf. 1874); Köhler, S. am
Taunus (2. Aufl., das. 1873); Haupt, S. am Taunus (2. Aufl.,
Würzb. 1883). -
2) Stadt im preuß. Regierungsbezirk Kassel, Kreis
Schlüchtern, zwischen Salza und Kinzig, 1 km von Station
Salmünster der Linie Hanau-Bebra-Göttingen der
Preußischen Staatsbahn, hat eine kath. Kirche, ein
Schloß, eine Sägemühle und
Parkettfußbodenfabrik, Schuhmacherei und (1885) 883 fast nur
kath. Einwohner. Die dortigen vier jod- und bromhaltigen Solquellen
von 12,5-13° C. werden vorzugsweise bei Skrofulose,
Unterleibsstockungen, chronischen
Gebärmutterentzündungen, alten Exsudaten etc. benutzt.
1885 ward dort auch ein an Kohlensäure reicher Säuerling
entdeckt und gefaßt. Dabei auf einer Anhöhe die
malerisch gelegenen Ruinen der Burg Stolzenberg. -
3) (Sooden) Flecken im preuß. Regierungsbezirk Kassel,
Kreis Witzenhausen, an der Werra und der Linie
Frankfurt-Bebra-Göttingen der Preußischen Staatsbahn,
der Stadt Allendorf (s. d.) gegenüber, hat eine evang. Kirche,
ein Salzwerk (schon 973 genannt) mit
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl., XV. Bd.
1
2
Soden - Sofala.
Solbad, eine Kinderheilanstalt und (1885) 758 evang. Einw. Vgl.
Sippell, S. an der Werra (Soden 1886).
Soden, Friedrich Julius Heinrich, Graf von,
Schriftsteller, geb. 4. Dez. 1754 zu Ansbach aus freiherrlichem
Geschlecht, wurde fürstlich branden-burgischer Regierungsrat,
später Geheimrat und preußischer Gesandter beim
fränkischen Kreis zu Nürnberg und 1790 in den
Reichsgrafenstand erhoben. Seit 1796 privatisierend, lebte er auf
seinem Gut Sassenfahrt am Main, führte 1804-10 die Leitung des
Bamberg-Würzburger Theaters, zog dann nach Erlangen und starb
13. Juli 1831 in Nürnberg. Als Schriftsteller hat er sich
durch Erzählungen (z. B. "Franz von Sickingen", 1808) und eine
beträchtliche Reihe dramatischer Arbeiten bekannt gemacht, von
welch letztern "Inez de Castro" (1784), "Anna Boley" (1794),
"Doktor Faust, ein Volksschauspiel" (1797), und "Virginia" (1805)
erwähnt seien. S. war auch als Übersetzer (Lope de Vega,
Cervantes) sowie als staatswissenschaftlicher Schriftsteller
thätig.
Söderhamn, Stadt im schwed. Län Gefleborg,
unweit des Bottnischen Meerbusens, an der Eisenbahn
Kilafors-Stugsund, hat lebhaften Handel mit Holz und Eisen und
(1885) 9044 Einw. S. ist Sitz eines deutschen Konsuls.
Söderköping, Stadt im schwed. Län
Ostgotland, am Götakanal, der 5 km davon in die Ostseebucht
Slätbaken mündet, einst ein ansehnlicher Ort, jetzt
unbedeutend, mit (1885) nur 1909 Einw.
Södermanland, Län im mittlern Schweden
(Swearike), zwischen der Ostsee im SO. und dem Mälar- und
Hjelmarsee im N., grenzt im Süden an Ostgotland, im W. an
Örebro, im N. an Westmanland, im NO. an das Län
Stockholm, welchem nur der nordöstliche Teil der alten
Landschaft S. zugeteilt ist, und hat ein Areal von 6841,4 qkm
(124,2 QM.). Es ist größtenteils Flachland, reich an
Seen und Wäldern (37 Proz. des Areals) und eine der
fruchtbarsten Provinzen des mittlern Schweden. Die Bewohner, deren
Zahl 1887: 152,296 betrug, treiben Ackerbau (1886 wurden 888,000 hl
Hafer, 435,000 hl Roggen, 116,000 hl Weizen geerntet), Viehzucht
(1884 zählte man 95,797 Stück Rindvieh) und Industrie in
Eisen, Wolle und Baumwolle. Das Län wird von der Westbahn
durchschnitten, an welche sich bei Flen nach Oxelösund und
Kolbäck führende Zweigbahnen und bei Katrineholm die
Ostbahn anschließt. Hauptstadt ist Nyköping.
Södertelge, Landstadt im schwed. Län Stockholm,
an der Bahn Stockholm-Gotenburg, zwischen dem Mälar und dem
kleinen See Maren, durchschnitten von dem Södertelgekanal,
welcher, 1819 eröffnet, von dem Mälar in den Maren und
von diesem in die Ostsee führt, hat ein Pädagogium, 2
mechanische Werkstätten, Zündhölzerfabrik, eine
Kaltwasserheilanstalt, ein Seebad und (1885) 3926 Einw.
Sodium, s. v. w. Natrium.
Sodom, alte Stadt Palästinas, im Thal Siddim, ging
nach mosaischem Bericht (1. Mos. 19, 24 ff.) mit dem benachbarten
Gomorra (s. d.) zu Abrahams Zeiten unter. Der Name hat sich in dem
des Salzbergs Usdum erhalten. Vgl. Totes Meer.
Sodoma, Maler, s. Soddoma.
Sodomie, s. Unzuchtsverbrechen.
Sodor und Man, engl. Bistum, welches jetzt nur die Insel
Man umfaßt, sich früher aber auch auf die Hebriden (die
Sodoreys der Normannen) erstreckte.
Soerabaya (spr. sura-), Stadt, s. Surabaja.
Soest, 1) (spr. sohst) Kreisstadt im preuß.
Regierungsbezirk Arnsberg, in einer fruchtbaren Ebene (Soester
Börde). Knotenpunkt der Linien S.-Nordhausen, Schwelm-S. und
S.-Münster der Preußischen Staatsbahn, 98 m ü. M.,
hat 6 evang. Kirchen (darunter die gotische, 1314 begonnene, 1846
restaurierte Wiesenkirche), einen kath. Dom, ein Gymnasium,
Schullehrerseminar, ein Taubstummen- und ein Blindeninstitut, ein
Rettungshaus, ein Amtsgericht, ein Puddel- und Walzwerk,
Fabrikation von Zucker, Nieten, Seife, Hüten und Zigarren,
Leinweberei, Gerberei, Bierbrauerei, Branntweinbrennerei, eine
Molkerei, Ziegeleien, Getreide- und Viehhandel, besuchte
Märkte, bedeutenden Acker- und Gartenbau und (1885) mit der
Garnison (eine Abteilung Feldartillerie Nr. 22) 14,846 meist evang.
Einwohner. - Im Mittelalter war S. eine der angesehensten und
reichsten Hansestädte mit reichsstädtischen Rechten und
einer Bevölkerung von 25-30,000 Seelen. Ihr Stadtrecht, Schran
(jus Susatense) genannt und zwischen 1144 und 1165 aufgezeichnet,
diente in vielen andern Städten, Lübeck, Hamburg etc.,
als Norm. Die Stadt galt als Hauptstadt des Landes Engern im
Herzogtum Sachsen. Nach Auflösung des letztern 1180
bemächtigte sich der Erzbischof von Köln derselben und
eignete sich das Schultheißenamt an. Dagegen stand den Grafen
von Arnsberg bis 1278 die Vogtei (Blutbann) in S. zu. Unter dem
Erzbischof Dietrich von Köln entzog sich die Stadt wegen zu
harten Drucks der erzbischöflichen Botmäßigkeit
wieder und begab sich 24. Okt. 1441 unter den Schutz Adolfs,
Herzogs von Kleve und Grafen von der Mark, was 1444 zu einer
langwierigen Belagerung der Stadt (Soester Fehde) führte, bei
welcher die dortigen Frauen sich durch Mut auszeichneten. Der
Streit endete infolge päpstlicher Entscheidung damit,
daß S. mit der Börde 1449 unter die Landeshoheit des
neuen Herzogs von Kleve, Johannes, kam. Vgl. Barthold, S., die
Stadt der Engern (Soest 1855); Schmitz, Denkwürdigkeiten aus
Soests Vorzeit (Leipz. 1873); Hansen, Die Soester Fehde (das.
1888); "Chroniken der deutschen Städte", Bd. 21; S. (das.
1889). -
2) (spr. suhst) Dorf in der niederländ. Provinz Utrecht,
Bezirk Amersfoort, am Eem und der Eisenbahn Utrecht-Kampen, mit
(1887) 3776 Einw. Dabei das Lustschloß Soestdyk, vom Prinzen
von Oranien (nachmals König Wilhelm III. von England) 1674
erbaut.
Soeste (spr. sohste), Fluß im Großherzogtum
Oldenburg, entspringt bei Kloppenburg, durchfließt das
Saterland und mündet links in die Leda.
Soeurs converses (franz., spr. ssör kongwérs,
bekehrte Schwestern), s. v. w. Beaten (s. d.).
Soeurs de la charité (franz., spr. ssör d' la
charité), s. v. w. Barmherzige Schwestern (s. d.).
Sofa, in den türk. Häusern die Vorhalle, von wo
man zu den verschiedenen Zimmern gelangt; dieselbe ist auf drei
Seiten mit Ruhesitzen versehen, woher die europäische
Bedeutung des Wortes stammt.
Sofála (arab., "Niederland"), geographische
Bezeichnung für das Küstenland Ostafrikas zwischen dem
Sambesi und der Delagoabai, bestehend aus einem flachen
Küstenstrich mit der vorliegenden Gruppe der Bazarutoinseln
und einem weiter zurückliegenden gebirgigen Teil. Zahlreiche
Flüsse, darunter Bazi, Sabia und Limpopo, münden hier in
den Ozean und überschwemmen alljährlich das Land. Der
Boden ist längs der Küste sehr fruchtbar und bringt
besonders Reis, Orseille, Indigo, Kautschuk, Zuckerrohr und
3
Soffariden - Sohar.
Kaffee hervor. Im Hinterland findet sich viel Gold, Kupfer,
Eisen, und die Kaffern, die Bewohner des Landes, bringen Elfenbein
an die Küste. Die Portugiesen, welche am Ende des 15. Jahrh.
diese Küste entdeckten, und zu deren Kolonie Mosambik dieselbe
jetzt gehört, trafen hier arabische, vom Sultan von Kilwa
abhängige Niederlassungen. Sie unterwarfen diese sowie die
benachbarten Kaffern und nannten die neue Besitzung Königreich
Algarve. Von ihren hier angelegten Militär- und
Handelsstationen S. und Inhambane unternahmen die Portugiesen
namentlich im 16. Jahrh. Züge nach den goldreichen
Kaffernstaaten Mokaranga und Monomotapa, welche als angeblich
mächtige und zivilisierte "Kaiserreiche" erschienen, in der
That aber nur barbarische Reiche waren. Im Hinterland von S. liegen
auch die Goldgruben von Manica sowie verschiedene 1871 von Karl
Mauch entdeckte Goldgruben und die Ruinen von Zimbabye (s. d.),
weshalb man schon im 16. Jahrh. das Salomonische Ophir hierher
verlegte, eine Ansicht, die mit mehr Kühnheit als
Begründung in neuerer Zeit wiederholt wurde. - Die Stadt S.,
am Kanal von Mosambik, seit 1505 im Besitz der Portugiesen, ist ein
armseliger, verfallener Ort, der kaum 1200 Einw. (darunter wenige
Weiße) zählt, aber doch Hauptort des gleichnamigen
Bezirks und Station für das submarine Kabel von Durban nach
Aden.
Soffariden, pers. Dynastie, s. Saffariden.
Soffionen (ital., "Blasebälge"), Name der
Dampfausströmungen der Borsäure (s. d.) in Toscana.
Soffítte (ital.), in der Baukunst die
ornamentierte Unteransicht eines Bogens, einer Hängeplatte,
einer Balkendecke etc.; eine in Felder geteilte oder mit
Getäfel gezierte Zimmerdecke; im Theaterwesen die über
der Bühne aufgehängten, den Himmel oder eine Decke
darstellenden Dekorationsstücke.
Sofi (arab., Sufi, Ssofi, Ssufi), s. Sûfismus.
Sófia (bulgar. Sredec), Hauptstadt des
Fürstentums Bulgarien, an der Eisenbahn von Konstantinopel
nach Belgrad und an der Bogana (Nebenflüßchen des Isker)
in einer prachtvollen, weiten Ebene, zwischen Balkan und Witosch,
580 m ü. M. gelegen. S., Mittelpunkt eines ansehnlichen
Straßennetzes, hat viele Moscheen (darunter als die
architektonisch bedeutendste die jetzt verfallene Böjük
Dschami), christliche Kirchen und Klöster; das sehenswerteste
Gebäude ist das große Bad bei der Moschee Baschi
Dschamisi, mit warmen Quellen. Doch entstehen gegenwärtig
viele Neubauten, und die alten Straßen werden reguliert und
gepflastert. Neu errichtet sind ein fürstlicher Palast, eine
Nationalbibliothek, eine Druckerei, Apotheken, Agenturen,
Gasthöfe, eine Post, eine Nationalbank mit einem Kapital von 2
Mill. Frank, ein wissenschaftlicher Verein u. a. 1887 zählte
es 30,428 Einw., darunter 5000 Juden, 2000 Türken und 1000
Zigeuner. S. hat starken Export von Häuten nach
Österreich und Frankreich, von Mais und Getreide. Es ist der
Sitz der bulgarischen Regierung, eines griechischen Metropoliten,
eines Kassations- und eines Appellhofs sowie eines deutschen
Berufskonsuls. - S. steht an der Stelle des alten Ulpia Serdica in
Obermösien (berühmt durch ein 344 daselbst gehaltenes
Konzil) und fiel 1382 in die Hände der Türken. Am 3. Jan.
1878 wurde die Stadt von den Russen unter Gurko besetzt.
Sofia-Expedition, 28. Juni bis 20. Okt. 1868, s. Maritime
wissenschaftliche Expeditionen.
Sofiero (Sophiero), königliches Lustschloß am
Öresund in Schweden, 6 km von Helsingborg; Sommersitz der
königlichen Familie.
Sofis (Safis, Sûfis), pers. Dynastie,
gegründet von Ismail, mit dem Beinamen Sofi, herrschte von
1505 bis 1735 über Persien (s. d., S. 873).
Sofismus, s. Sûfismus.
Söflingen, Marktflecken im württemberg.
Donaukreis, Oberamtsbezirk Ulm, an der Blau und der Linie
Ulm-Sigmaringen der Württembergischen Staatsbahn, hat eine
kath. Kirche, ein Forstamt, mechanische Weberei und (1885) 2501
Einw. S. war früher reichsunmittelbare Frauenabtei, kam 1802
an Bayern und 1810 an Württemberg.
Softa (pers.), in der Türkei ein der Wissenschaft
lebender, der Welt abgestorbener Besucher der Hochschulen (s.
Medresse). Die Softas rekrutieren sich jetzt aus den untersten
Volksschichten und haben mehrere Prüfungen zu bestehen, bis
sie den gesetzlichen Titel "Molla" (s. d.) erlangen, um dann als
Geistliche oder als Richter angestellt zu werden. Meist Gegner
aller europäisierenden Maßregeln, haben sie sich in der
Neuzeit auch zu politischen Demonstrationen verleiten lassen.
Sog, s. v. w. Kielwasser (s. d.).
Sogamoso, Stadt im Staat Boyacá der
südamerikan. Republik Kolumbien, am Chicamocha, 2506 m ü.
M., mit Hospital, lebhaftem Handel und (1870) 9553 Einw. Ehemals
war S. die Hauptstadt der theokratischen Regierung des Sugamuxi,
eines Hohenpriesters der Muisca oder Tschibtscha (s. d.).
Sogdiana, ehemals die nördlichste bis zum Jaxartes
reichende Satrapie des Perserreichs, mit der Hauptstadt Marakanda
(jetzt Samarkand).
Sögel, Dorf im preuß. Regierungsbezirk
Osnabrück, Kreis Lingen, am Hümmling, mit kath. Kirche,
Amtsgericht und (1885) 1100 Einw. Östlich das herzoglich
arenbergische Jagdschloß Klemenswerth.
Soggen, s. Salz, S. 238.
Soghum Kala, Stadt, s. Suchum Kalé.
Soglio (spr. ssolljo), s. Sils 3).
Sognefjord, tief einschneidender Fjord an der
Westküste Norwegens, über 200 km lang, endigt in einem
Seitenfjord, welcher den Namen Lysterfjord führt, ist kaum
irgendwo 7 km breit und fast überall von hohen, steilen
Felswänden umgeben. Die Landschaft, welche den S. umgibt, ist
die gebirgige Vogtei Sogn und gehört zu den wildesten Gegenden
des Landes. Die vom Hauptfjord abgehenden Seitenfjorde zeichnen
sich besonders durch ihre gewaltigen Umgebungen aus. So sind die
südlichen Zweige, der Aurlands- und der Näröfjord,
von Gebirgen umgeben, die sich von der See aus 1600-2000 m
senkrecht erheben. Im N. sendet der S. außer dem Lysterfjord
auch den Sogndalsfjord und den Fjärlandsfjord aus, von denen
der letztere bis zu den Gletschern des Jostedalsbrä
hineindringt, welche hier bis zu 65 m ü. M. herabsteigen.
Diese riesenhafte Schneemasse, die mit ihren Gletschern die
angrenzenden Thäler erfüllt, begrenzt den Fjord im N.,
während ihn im O. große, zu den Jotunfjelden (s. d.)
gehörige Gebirgsmassen von den angrenzenden Gegenden scheiden;
nur im Süden führt ein einziger Paß durch das
großartige Närödal, die Fortsetzung des
Näröfjords.
Sohair (Zuhair), berühmter arab. Dichter der
vormohammedanischen Zeit. Seine "Moallaka" ist einzeln
herausgegeben von Rosenmüller ("Analecta arabica", 2. Teil,
Leipz. 1826), übersetzt von Rückert ("Hamasa" I, Zugabe 1
zu Nr. 149); seine erhaltenen Gedichte s. bei Ahlwardt in den "Six
ancient poets" (Lond. 1870). Vgl. Kaab Ibn Sohair.
Sohar ("Glanz", auch S. hakadosch, der heilige S.,
genannt), das in unkorrektem Aramäisch in Form
1*
4
Sohar - Soiron.
eines Pentateuchkommentars abgefaßte Hauptwerk der Kabbala
(s. d.), das jahrhundertelang fast vergöttert wurde, aber
durch seine verworrene Vermischung von neuplatonischen,
gnostischen, Aristotelischen und jüdisch-allegorischen
Anschauungen die Entwickelung des Judentums sehr geschädigt
hat. Verfasser oder Redakteur des S. ist vermutlich der in der
zweiten Hälfte des 13. Jahrh. in verschiedenen Städten
Spaniens lebende Moses ben Schemtob de Leon und nicht Simon ben
Jochai (Mitte des 2. Jahrh. n. Chr.). Der S., der an einzelnen
Stellen eine Feindseligkeit gegen den Talmud zu erkennen gibt und
hin und wieder mit dem Christentum liebäugelt, besteht aus
drei Hauptteilen: 1) dem eigentlichen S., 2) dem treuen Hirten
(Raja mehemna) und 3) dem geheimen Midrasch (Midrasch neelam). Vgl.
Tholuck, Wichtige Stellen des rabbinischen Buches S. (Berl. 1824);
Joël, Die Religionsphilosophie des S. (Leipz. 1849); Jellinek,
Moses ben Schem-Tob de Leon und sein Verhältnis zum S. (das.
1851).
Sohar, Hafenstadt in der arab. Landschaft Oman, mit guter
Reede, einem festen Schloß, sorgfältig angebauter
Umgebung und ca. 24,000 Einw. (darunter eine Anzahl Juden mit
eigner Synagoge). Gewerbe, Weberei, Metallarbeiten blühen.
Sohl (ungar. Zólyom), ungar. Komitat am linken
Donauufer, grenzt an die Komitate Liptau, Gömör,
Neográd, Hont, Bars und Thúrócz, ist 2730 qkm
(49,7 QM.) groß, ganz von Gebirgen bedeckt, wird vom
Granfluß durchströmt, dessen Thal besonders fruchtbar
ist, und hat zahlreiche Gebirgsweiden. Die Einwohner (1881:
102,500, meist Slowaken) betreiben Rindvieh- und Schafzucht, etwas
Weinbau, lebhaften Bergbau auf Schwefel, Silber, Kupfer, Eisen,
Vitriol und Quecksilber sowie Fabrikation von Eisen- und
Töpferwaren, Tuch, Glas, Papier etc. Sitz des Komitats, das
seinen Namen von der bei Altsohl malerisch gelegenen Ruine S. an
der Mündung der Szlatina in die Gran erhielt, ist Neusohl.
Sohland, Dorf in der sächs. Kreis- und
Amtshauptmannschaft Bautzen, an der Spree und an der Linie
Bischofswerda-Zittau der Sächsischen Staatsbahn, hat eine
evang. Kirche, Hand- und mechan. Weberei, Säge- und
Mahlmühlen und (1885) 5126 Einw.
Sohle (Soole), Fisch, s. Schollen.
Sohlenbau, s. v. w. Strossenbau, s. Bergbau, 724.
Sohlengänger, Säugetiere, die mit der ganzen
Sohle auftreten, wie die Bären (s. Säugetiere, 345).
Sohlennähmaschine, s. Schuh.
Söhlig, im Bergwesen s. v. w. horizontal. Vgl.
Fallen der Schichten.
Sohn, jede Person männlichen Geschlechts im
Verhältnis zu ihren Erzeugern (Vater und Mutter). S.
Verwandtschaft.
Sohn, 1) Karl Ferdinand, Maler, geb. 10. Dez. 1805 zu
Berlin, erhielt von Schadow, dem er 1826 nach Düsseldorf
folgte, den ersten Unterricht in der Kunst und behandelte anfangs
mit Vorliebe antike Stoffe, dann auch Szenen aus neuern Dichtern,
wie Tasso, Goethe etc. Seine Hauptwerke, welche ihm in den 30er und
40er Jahren eine große Popularität einbrachten, sind:
Rinaldo und Armida, die Lautenschlägerin und der Raub des
Hylas (beide in der Nationalgalerie zu Berlin), Diana und
Aktäon, das Urteil des Paris, Romeo und Julie, die beiden
Leonoren, die Schwestern, die vier Jahreszeiten, Lurlei und
Darstellungen von sentimental-romantischen Situationen. S. war
Meister in Behandlung der Karnation und in der Darstellung von
Frauengestalten. Besonders ausgezeichnet war er im weiblichen
Bildnis. Er wurde 1832 Lehrer an der Düsseldorfer Akademie und
starb 25. Nov. 1867 während eines Besuchs in Köln. Als
Lehrer hat er einen großen Einfluß auf die Entwickelung
der Düsseldorfer Schule geübt. - Seine beiden Söhne
Richard S. (geb. 1834) und Karl S. (geb. 1845) haben sich als
Porträt- und Genremaler vorteilhaft bekannt gemacht.
2) Wilhelm, Maler, Neffe des vorigen, geb. 1830 zu Berlin, ging
1847 nach Düsseldorf und erhielt durch Karl S. seine
Ausbildung, die er durch Reisen ergänzte. Anfangs malte er
historische Bilder, wie: Christus auf stürmischer See (1853,
städtische Galerie in Düsseldorf, Christus am Ölberg
(1855, in der Friedenskirche zu Jauer in Schlesien), Genoveva
(1856); bald aber wandte er sich der Genremalerei zu. Seine
Verschiedenen Lebenswege, Gewissensfrage (1864, Galerie zu
Karlsruhe), besonders aber die Konsultation beim Rechtsanwalt
(1866, Museum in Leipzig) sind meisterhaft in der Charakteristik,
in der Zeichnung und der koloristischen Wirkung. Infolge des
Aufsehens, welches diese Gemälde machten, erhielt er den
Auftrag, für die preußische Nationalgalerie ein
großes Bild, die Abendmahlsfeier einer protestantischen
Patrizierfamilie, zu malen, das ihn noch beschäftigt. S. wurde
1874 Lehrer der Malerei an der Düsseldorfer Akademie. Seit
dieser Zeit hat er wenig geschaffen, desto ersprießlicher
aber als Lehrer gewirkt.
Soho, Vorstadt von Birmingham (s. d.), mit
berühmter, von Watt gegründeter Dampfwagenfabrik.
Sohrau, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Oppeln,
Kreis Rybnik, am Ursprung der Ruda und an der Linie Orzesche-S. der
Preußischen Staatsbahn, 283 m ü. M., hat eine
evangelische und eine kath. Kirche, eine Synagoge, ein Amtsgericht,
Eisengießerei und Eisenwarenfabrikation, Lein- und
Wollweberei, eine Dampf- und 3 Wassermühlen, Ziegeleien und
(1885) mit der Garnison (1 Eskadron Ulanen Nr. 2) 4450 meist kath.
Einwohner.
Söhre, bewaldete Berglandschaft im preuß.
Regierungsbezirk Kassel, rechts von der Fulda, südöstlich
von Kassel, besteht aus Buntsandstein und erreicht im Stellberg 482
m Höhe.
Soi-disant (franz., spr. ssoa-disang), sogenannt.
Soignies (spr. ssoanjih), Hauptstadt eines
Arrondissements in der belg. Provinz Hennegau, an der Senne und der
Eisenbahn Brüssel-Quiévrain (mit Abzweigung nach
Houdeng-Goegnies), hat mehrere Kirchen (darunter die romanische
Vincentiuskirche aus dem 12. Jahrh.) und Klöster, ein Rathaus
im spanischen Stil, eine höhere Knabenschule, Industrieschule,
ein geistliches Seminar, Zwirnfabrikation und (1887) 8683 Einw.
Hier 10. Juli 1794 siegreiches Gefecht der Franzosen gegen die
Niederländer.
Soirée (franz., spr. ssóareh), Abend;
Abendgesellschaft; S. dansante, Abendgesellschaft mit Tanz.
Soiron (spr. ssoaróng), Alexander von, bad.
Politiker, geb. 2. Aug. 1806 zu Mannheim, studierte in Heidelberg
und Bonn, widmete sich seit 1832 der advokatorischen Praxis erst zu
Heidelberg, dann zu Mannheim und ward 1834 daselbst
Oberhofgerichtsadvokat. Seit 1845 Abgeordneter der badischen
Zweiten Kammer, hielt er zur liberalen Opposition und nahm 1848 an
den Vorbereitungen zur Berufung des Vorparlaments regen Anteil. Er
ward auch in den Fünfzigerausschuß gewählt und
führte den Vorsitz darin. In der Nationalversammlung war er
geraume Zeit erster Vizepräsident und Vorsitzender des
Verfassungsausschusses. Er handhabte seine Ämter mit Energie
und Umsicht und zog sich dadurch den Haß
5
Soissonische Stufe - Soja.
der Linken zu. S. war ein tüchtiger Redner und
fleißiger Arbeiter. Auch am Erfurter Parlament nahm er teil.
Er starb 6. Mai 1855 in Heidelberg.
Soissonische Stufe (spr. ssoa-), s.
Tertiärformation.
Soissons (spr. ssoassóng),
Arrondissementshauptstadt im franz. Departement Aisne, an der Aisne
und der Nordbahn (mit Abzweigung nach Compiègne und Reims),
mit detachierten Forts umgebene Festung zweiten Ranges, hat mehrere
Überreste gallorömischer Architektur und bedeutende
Bauwerke aus dem Mittelalter, wie die schöne Kathedrale
(12.-13. Jahrh.), die Kirche St.-Léger, die Stiftskirche
St.-Pierre, die Reste der 1076 gegründeten Abtei St.-Jean des
Vignes, das Stadthaus u. a. S. hat ein Zivil- und Handelstribunal,
ein Collège, großes und kleines Seminar, eine
Zeichenschule, eine Bibliothek mit 30,000 Bänden, ein
Antikenmuseum, ein Taubstummeninstitut und (1886) 11,850 Einw.,
welche etwas Industrie und starken Handel mit landwirtschaftlichen
Produkten treiben. Es ist Bischofsitz. - Im Altertum hieß die
Stadt Noviodunum, später Augusta Suessionum (wovon der heutige
Name) und war die Hauptstadt der Suessionen im belgischen Gallien.
In S. war ein Palatium der römischen Kaiser, und es war die
letzte Stadt, welche die Römer in Gallien besaßen.
Aetius und Syagrius residierten daselbst, und letzterer wurde 486
von Chlodwig in der Nähe der Stadt geschlagen. In der
Merowingerzeit war es fast immer Residenz eines Teilreichs und war
auch nachher von Bedeutung. Hier fand 744 eine für Neustrien
wichtige Synode und 751 die Erhebung Pippins zum König statt;
hier mußte Ludwig der Fromme 833 Kirchenbuße thun. Seit
dem 9. Jahrh. Sitz eigner Grafen, ging S. durch Kauf und Heirat in
verschiedene Hände über und fiel 1734 an die
französische Krone. Als Knotenpunkt großer
Heerstraßen und Sperrpunkt der Nordbahn spielte S. in den
Kämpfen von 1814 und 1815 sowie 1870 eine große Rolle,
15. Okt. d. J. ward es nach dreitägiger Beschießung vom
Großherzog von Mecklenburg-Schwerin genommen. Die Geschichte
dieser Belagerung beschrieben Gärtner (Berl. 1874) und H.
Müller (das. 1875).
Soissons (spr. ssoassóng), 1) Charles von Bourbon,
Graf von, Sohn des Prinzen Ludwig I. von Condé (s. d.) aus
dessen zweiter Ehe mit Françoise von
Orléans-Longueville, durch welche die Grafschaft S. an das
Haus Bourbon-Condé kam, geb. 1566, stand in den
Hugenottenkriegen bald auf seiten des Hofs, bald auf seiten des
Königs Heinrich von Navarra, schloß sich 1588 an diesen
an, leistete ihm in der Schlacht bei Coutras nützliche Dienste
und starb 1. Nov. 1612.
2) Louis von Bourbon, Graf von, Sohn des vorigen, geb. 11. Mai
1604 zu Paris, folgte seinem Vater als Grand-Maître und
Gouverneur der Dauphiné. Schon im 16. Jahr unterstützte
er die Königin-Mutter Maria von Medici gegen ihren Sohn Ludwig
XIII., während er zugleich, um sich gefürchtet zu machen,
mit den Hugenotten unterhandelte. Als diese ihn mißtrauisch
von sich wiesen, kehrte er zur Partei des Königs zurück
und begleitete diesen im Feldzug von 1622 gegen die Protestanten.
Durch die Entdeckung der Verschwörung gegen Richelieu, an der
er teilgenommen hatte, kompromittiert, floh er nach Italien; Ludwig
XIII. rief ihn jedoch zurück und beauftragte ihn mit der
Belagerung von La Rochelle. 1630 kaufte S. die Grafschaft S. vom
Prinzen von Condé, begleitete den König nochmals nach
Italien und erhielt dann das Gouvernement von Champagne und La
Brie. In dem Feldzug von 1636 befehligte er ein kleines Korps an
der Aisne und Oise, wurde jedoch von den Spaniern zum Rückzug
nach Noyon gezwungen. Ein neuer, abermals vereitelter Anschlag zur
Ermordung Richelieus nötigte S. zur Flucht nach Sedan, wo er
sich mit dem Herzog von Bouillon, dem Herzog von Guise und den
Spaniern zum Kriege gegen den Minister verband. Ein
königliches Heer unter dem Marschall Châtillon wurde 6.
Juli 1641 bei Marfée in der Nähe von Sedan geschlagen,
S. aber im Gefecht erschossen. Mit ihm erlosch die Seitenlinie S.
des Hauses Bourbon-Condé; Besitz und Titel gingen auf den
zweiten Sohn seiner Schwester Maria über, die sich 1625 mit
dem Prinzen Thomas Franz von Savoyen-Carignan vermählt
hatte.
3) Eugène Maurice von Savoyen, Graf von, Sohn des Prinzen
Thomas Franz von Savoyen-Carignan, Neffe des vorigen, geb. 1635 zu
Chambéry, widmete sich in der Jugend dem geistlichen Stand,
nahm jedoch später Kriegsdienste und heiratete 1657 Olympia
Mancini (s. Mancini 1), die Nichte des Ministers Mazarin, der ihn
zum Generalobersten der Schweizer und zum Gouverneur der Champagne
ernannte. 1667 wohnte er dem Feldzug in Flandern bei, und 1672 ward
er von Ludwig XIV. zum Generalleutnant befördert, in welcher
Eigenschaft er sich in Holland und am Rhein auszeichnete. Er starb
7. Juni 1673. Sein jüngerer Sohn war der berühmte Prinz
Eugen (s. d.) von Savoyen; der ältere, Ludwig Thomas, setzte
die Linie Savoyen-S. fort, die mit dessen Enkel 1734 erlosch.
Soja Savi (Sojabohne), Gattung aus der Familie der
Papilionaceen, mit der einzigen Art S. hispida Mönch, einer
einjährigen, in Japan, Südindien und auf den Molukken
heimischen Pflanze. Sie hat einen bis 1 m hohen, aufrechten, etwas
windenden Stengel, langgestielte, dreizählige Blätter,
welche wie Stengel und Zweige dicht rotbraun behaart sind,
kurzgestielte Blütenträubchen mit kleinen, unscheinbaren,
blaßvioletten Blüten und sichelförmige,
trockenhäutige, rötlich behaarte, zwei- bis
fünfsamige, zwischen den Samen schwammig gefächerte
Hülsen. Man kultiviert die Sojabohne in zahlreichen
Varietäten und in sehr weiter Verbreitung in Asien. Sie geht
mit ihrer nördlichen Verbreitungsgrenze noch über den
Mais hinaus, besitzt ein großes Anpassungsvermögen an
Boden- und klimatische Verhältnisse, völlige
Immunität gegen Schmarotzerpilze und nie versagende
Fruchtbarkeit. Die früh reifenden Varietäten geben in
Mitteleuropa nach zahlreichen mehrjährigen Anbauversuchen sehr
befriedigende Resultate. Die Samen sind rundlich, länglich
oder nierenförmig, gelblich, braunrot, grünlich oder
schwarz, niemals gefleckt; sie enthalten neben etwa 7 Proz. Wasser
38 Proteinkörper, 17-20 Fett, 24-28 stickstofffreie
Substanzen, 5 Rohfaser und 4,5 Proz. Asche. Ihr Nährwert ist
mithin gegenüber den übrigen Hülsenfrüchten ein
sehr hoher, und namentlich tritt der bedeutende Fettgehalt hervor.
Auf letzterm beruht zum Teil die vielfache Verwendung der
wohlschmeckenden Samen in Japan, indem der fettige Brei fast allen
Gerichten statt der Butter zugesetzt wird; in China lebt ein
großer Teil der Bevölkerung von Sojagerichten; auch
bereitet man aus Sojabohnen durch einen Gärungsprozeß
eine pikante braune Sauce für Braten und Fische, welche in
Japan, China, Ostindien sehr beliebt ist und in England wie auf dem
Kontinent und in Nordamerika ebenfalls in den Handel kommt. Die
japanische Sojasauce ist die beste, sie besitzt nicht den
süßlichen Geschmack der chinesischen. Gute Sojasauce ist
tiefbraun, sirupartig und bildet
6
Sojaro - Sokrates.
beim Schütteln eine helle, gelbbraune Decke. Bei der
Benutzung darf den Speisen nur sehr wenig zugesetzt werden. In
Österreich hat man die Samen als gutes Kaffeesurrogat benutzt.
Vgl. Haberlandt, Die Sojabohne (Wien 1878); Wein, Die Sojabohne
(Berl. 1881).
Sojaro, Beiname von Bernardino Gatti (s. d.).
Sok, siamesische Elle, = 2 Kup à 12 Niuh oder Nid
à 4 Kabiet = ½ m.
Sokal, Stadt in Ostgalizien, am Bug und an der Eisenbahn
Jaroslau-S., mit Bezirkshauptmannschaft, Bezirksgericht,
Bernhardinerkloster, Wallfahrtskirche und (1880) 6725 Einw. Hier
1519 Niederlage der Polen gegen die Tataren.
Sokol (slaw.), Falke; übertragen s. v. w. Held,
wackerer Mann; in Böhmen und Mähren häufig auch Name
von Turnvereinen.
Sokolka, Kreisstadt im russ. Gouvernement Grodno, an der
Petersburg-Warschauer Eisenbahn, mit (1885) 4125 Einw., von denen
sich die Christen mit Landbau, die Juden mit Kramhandel
beschäftigen; kam bei der dritten Teilung Polens (1795) an
Preußen und 1807 an Rußland.
Sokolow, 1) Stadt in Galizien, Bezirkshauptmannschaft
Kolbuszow, hat ein Bezirksgericht und (1880) 4296 Einw. -
2) Kreisstadt im russisch-poln. Gouvernement Sjedletz, mit
(1885) 7083 Einw.
Sókoto (Soccatu, Sakatu), Reich der Fellata im
westlichen Sudân (Afrika), grenzt nördlich an die
Sahara, östlich an Bornu, westlich an Gando und umfaßt
den größten Teil des Haussalandes mit einem
Flächenraum von ca. 440,000 qkm (8000 QM.). Hauptstadt des
Landes und Residenz des Sultans ist Wurno mit 22,000 Einw. Der
Sultan von S. übt über Gando, Bautschi, Nupe und
Adamáua mehr ein geistliches als ein weltliches Regiment.
Dennoch empfängt er von diesen Staaten mäßigen
Tribut. Das Reich, welches unter den Sultanen Bello (1819 bis 1832)
und Atiku (1832-37) in ziemlicher Blüte stand, ist unter deren
Nachfolgern sehr in Verfall gekommen. Die Stadt S., ehemals
Hauptstadt des Reichs, am gleichnamigen Fluß (Nebenfluß
des Niger), ist mit einer Mauer umgeben, ziemlich
regelmäßig gebaut, hat einen großen
Residenzpalast, mehrere Moscheen, Fabrikation von Leder- u.
Baumwollwaren, Waffen, Werkzeugen etc. Ein aus Brasilien
zurückgekehrter Fulahsklave hat in der Nähe eine
Zuckerplantage und -Raffinerie angelegt. Arabische Kaufleute aus
Ghadames bewohnen ein besonderes Viertel, auch englische
Händler erscheinen jetzt daselbst. Clapperton gelangte 1824
als erster Europäer nach S. und starb 1827 in der Nähe
der Stadt. 1853 wurde es von Barth, 1880 von Flegel und 1885 von I.
Thomson besucht. Letzterer schloß namens der National African
Company mit dem Sultan einen Vertrag ab, wonach jener Gesellschaft
gegen eine jährliche Subsidie das Monopol des Handels und der
Mineralausbeute an den Ufern des Binue eingeräumt wurde. S.
Karte bei Guinea.
Sokotora (Socotra, verderbt aus dem griech. Dioskorides),
Insel im Indischen Ozean, 220 km östlich vom Kap Gardafui, der
Ostspitze Afrikas, 3579 qkm (65 QM.) groß mit 12,000 Einw.,
ist mit Ausnahme eines schmalen Küstenstrichs von hohen, bis
über 1360 m aufsteigenden Gebirgen erfüllt, nur in
einzelnen Thälern unweit der Küste fruchtbar, in welchen
vorzugsweise die nach der Insel benannte Aloe und Dattelpalmen
gedeihen, welche nebst Drachenblut, Schildpatt, Zibetkatzen etc.
ausgeführt werden. Die Bevölkerung ist ein Mischvolk von
Arabern, Somal, Negern und Indern. Ihre Hauptbeschäftigung
bilden Handel, Viehzucht (Kamele, Rinder, Schafe, Ziegen) und etwas
Ackerbau. Der Hauptort ist Tamarida an der Nordküste. - Von
den alten Kulturvölkern Dioskorides genannt und auch im
Periplus erwähnt, wurde die Insel im 15. Jahrh. von
Niccolò Conti und 1503 von Pereira besucht und 1506 von
Tristan da Cunha erobert. Doch stellte 1510 der arabische Scheich
von Keschin seine Autorität wieder her. Damals befand sich
eine im 4. Jahrh. von Arabien aus gegründete christliche
Gemeinde auf der Insel, die später den Arabern weichen
mußte. Von 1835 bis 1839 hielten englische Truppen die Insel
besetzt, 1876 schloß die englische Regierung mit dem Scheich
von Keschin einen Vertrag ab, wodurch sie das Vorkaufsrecht erwarb,
und 30. Okt. 1886 ließ der britische Resident in Aden die
Insel besetzen. Schweinfurth hat dieselbe 1881 erforscht. Vgl.
Robinson, Sokotra (Lond. 1878).
Sokrates, 1) der berühmteste unter den griechischen
Weisen, Sohn des Bildhauers Sophroniskos und der Hebamme
Phänarete, wurde um 469 v. Chr. zu Athen geboren. Er soll die
Kunst seines Vaters erlernt und auch eine Zeitlang ausgeübt
haben; eine Gruppe am Fuß der zur Akropolis führenden
Treppe galt für sein Werk. Zu seiner Lebensaufgabe machte er
den in Gestalt von Unterredungen und im Gegensatz zu den Sophisten
unentgeltlich erteilten Unterricht, zu welchem Zweck er seine
materiellen Bedürfnisse auf das äußerste
beschränkte und den Verkehr mit Jünglingen, deren Geburt
und Talent (wie bei Alkibiades und Kritias) vorhersehen
ließen, daß sie späterhin einen großen
Einfluß auf ihre Mitbürger üben würden, um sie
zu denkenden und charaktervollen Männern zu bilden, jedem
andern vorzog. Seine Tüchtigkeit bekundete sich jedoch nicht
bloß in diesen didaktischen, sondern auch in praktischen, auf
die Erfüllung seiner Bürgerpflichten, auch der
militärischen, gerichteten Bestrebungen. Obgleich dem Krieg
abhold, beteiligte er sich an drei Feldzügen und rettete in
der Schlacht bei Potidäa dem vom Pferd gestürzten
Alkibiades durch mannhafte Verteidigung das Leben. Gerade aber sein
Streben nach unabhängiger Tüchtigkeit im Treiben einer
korrumpierten Umgebung und seine Bemühungen, die Jugend von
den verderblichen Lehren sittlicher Zersetzung abzuziehen und
edlerer Geistesverfassung zuzuführen, zogen ihm Verfolgung zu.
S. wurde bezichtigt, die Jugend zu verderben und andre Götter
als die vom Staat anerkannten zu lehren. Als seine Ankläger
werden genannt: ein mittelmäßiger Dichter, Melitos, ein
Lederhändler und Demagog, Anytos, und ein Rhetor, Lykon. S.
verteidigte sich in mutvoller und seiner würdiger Weise, ohne
eine gewisse Reizung seiner Richter zu vermeiden. Nachdem er mit
ganz geringer Majorität verurteilt war und nun selbst dem
Herkommen gemäß einen Strafantrag zu stellen hatte,
lehnte er letzteres ab, indem er ironisch an Stelle der
vorzuschlagenden Strafe eine Belohnung seiner Verdienste durch
Erhaltung auf öffentliche Kosten im Prytaneion forderte.
Hierdurch erbittert, verurteilten ihn seine Richter mit
größerer Majorität zum Tode. Der religiöse
Gebrauch, dem zufolge niemand bis zur Rückkehr eines gerade um
diese Zeit nach Delos entsendeten heiligen Schiffs hingerichtet
werden durfte, gestattete ihm, noch 30 Tage zu leben. Während
dieser Zeit unterhielt er sich im Gefängnis mit einigen seiner
Anhänger über philosophische Gegenstände und
namentlich über den Tod. Das Anerbieten Kritons, ihm zur
Flucht zu verhelfen, lehnte er ab. Mit der größten
Gemütsruhe nahm er
7
Sokratik - Sol., Soland.
nach Ablauf der Frist den Schierlingstrank und starb so in einem
Alter von etwa 70 Jahren 399. Die große Bedeutung des S. ist
in der Anregung zu suchen, die er durch sein Leben und noch mehr
durch seinen Tod gab. Sein geistreichster und edelster
Schüler, Platon, hat in seinen Dialogen Charakter und
Gedankenkreis seines Meisters, wenn auch in einer freien, mit
dichtender Umbildung versetzten Form, so doch mit jener Wahrheit,
die auch der Dichtung innewohnt, dargestellt. Eine mehr
nüchterne, aber gerade darum wertvolle Auffassung des S.
findet sich in den "Memorabilien" Xenophons, der ebenfalls zu dem
Kreise seiner Vertrauten gehörte. Die Lehre des S. ist, da er
selbst nichts geschrieben hat, nur durch seine Schüler auf uns
gekommen. Als Philosoph kam derselbe mit seinen Zeitgenossen, den
Sophisten, darin überein, daß er, wie diese, den
Schwerpunkt des Unterrichts in die (lehrbare) Methode und den Zweck
desselben nicht, wie deren Vorgänger, die griechischen
Physiker und Naturphilosophen, in die Erkenntnis der Natur, sondern
in jene des dem Menschen Nützlichen als des für diesen
einzig Wissens- und Wünschenswerten legte, unterschied sich
aber von denselben dadurch, daß einerseits seine Methode
nicht, wie die der Sophisten, ein dialektisch-rhetorisches
Kunststück, um Wahres falsch, Falsches wahr scheinen zu
machen, sondern die dialektische Kunst, das Wahre als solches zu
finden und zu erkennen, anderseits sein Zweck nicht, wie bei jenen,
auf die Erkenntnis des Nützlichen als des Guten, sondern
vielmehr auf jene des Guten als des allein wahrhaft, bleibend und
allgemein Nützlichen gerichtet war. Um seiner Abwendung von
der Physik willen ist von ihm gesagt worden, daß er die
Philosophie vom Himmel auf die Erde zurückgeführt habe.
Seine Übereinstimmung mit den Sophisten hinsichtlich des
Wertes methodischen Denkens und praktischer Ziele hat bewirkt,
daß er von Fernstehenden (z. B. von Aristophanes in den
"Wolken") zu den Sophisten gerechnet, ja seiner dialektischen
Schärfe wegen als "Erzsophist" hingestellt worden ist. Die
Reinheit seiner nur auf Erkenntnis der Wahrheit abzielenden sowie
die Uneigennützigkeit seiner nur das Gute als Zweck
menschlichen Handelns zulassenden Denkweise haben gemacht,
daß er von den ihm Nahestehenden (von seinen Schülern,
insbesondere von Platon) als deren diametraler Gegensatz erkannt
und sein Bild als Ideal eines Weisen dem des Sophisten als des
Zerrbildes eines solchen entgegengestellt wurde. Jene Kunst des S.
bestand (nach Aristoteles) darin, einerseits von der Betrachtung
des Besondern zum Allgemeinen aufzusteigen (Induktion), anderseits
durch Ausscheidung des Unwesentlichen und Ungehörigen wie
durch Zusammenfassung des Wesentlichen und Unentbehrlichen zum
Begriff zu gelangen (Definition), welch letzterer, weil er der
Sache selbst entspricht, immer derselbe bleibt, während das
Allgemeine, weil es aus dem Besondern gewonnen worden ist, dieses
letztere sämtlich in sich begreift. Dieselbe wurde von S.,
hierin dem Beispiel der Sophisten folgend, in dialogischer Form,
durch geschicktes Fragen (erotematisch), aber zu dem Zweck, die
Wahrheiten an den Tag zu bringen (daher er sie selbst mit dem
Handwerk seiner Mutter, der mäeutischen oder Hebammenkunst,
verglich), und zugleich indirekt, d. h. in der Weise geübt,
daß der Fragende (obgleich der Wissende) sich unwissend
stellt und von dem Gefragten (als ob dieser wissend wäre)
belehrt zu werden vorgibt, während er diesen belehrt (daher
diese Form des erotematischen Unterrichts als "sokratische Ironie"
bezeichnet wird). Von diesem nur aus didaktischen Gründen
gewählten Schein des Nichtwissens verschieden ist das dem S.
gleichfalls in den Mund gelegte Eingeständnis wirklichen
Nichtwissens, der anspruchsvollen Vielwisserei der Sophisten
gegenüber, um derentwillen derselbe von dem delphischen Orakel
für den weisesten aller Menschen erklärt worden sein
soll. In Bezug auf die Tugend als Verwirklichung des Guten war S.
der Meinung, daß dieselbe lehrbar, d. h. durch richtige
Erkenntnis und Unterweisung zu bewirken sei, denn es sei
unmöglich, das Gute zu wissen, ohne es zu thun. In Bezug auf
den Inhalt des Guten aber liebte es S., sich auf sein von ihm
sogenanntes Dämonion als eine in seinem Innern sich
kundgebende Stimme zu berufen, welche zwar niemals ratend, aber
stets warnend sich vernehmbar mache, wenn er etwas Unrechtes zu
thun im Begriff sei. Unter den Schülern des S. haben die
sogen. Sokratiker einzelne Seiten seines Wesens (Eukleides und
Phädon in der megarischen und elischen Schule die
dialektische, Antisthenes und Aristippos in der cynischen und
kyrenäischen Schule die moralische) einseitig entwickelt,
während Platon allein die empfangenen geistigen und sittlichen
Anregungen zu einem das Ganze der Philosophie umfassenden
Gedankenbau ausbildete. Aus der antiken Litteratur über S.
sind die Platonischen Dialoge (insbesondere Kriton, Phädon und
die "Apologie") hervorzuheben. Vgl. Lasaulx, Des S. Leben, Lehre
und Tod (Münch. 1857); Volkmann, Die Lehre des S. (Prag 1861);
Alberti, Sokrates (Götting. 1869); Fouillée, La
philosophie de Socrate (Par. 1874, 2 Bde.); Grote, Plato and the
other companions of S. (4. Aufl., Lond. 1885, 3 Bde.); Zeller,
Philosophie der Griechen, 2. Teil, 1. Abteil. (4. Aufl., Leipz.
1889).
2) S. Scholasticus, Verfasser einer Kirchengeschichte in sieben
Büchern, der Fortsetzung des Werkes des Eusebios, welche von
306-439 reicht, geboren um 380 zu Konstantinopel war eigentlich
Sachwalter. Sein Werk ist herausgegeben unter andern von Hussey
(Oxf. 1853, 3 Bde.) und Bright (das. 1878).
Sokrátik (Sokratische Methode), die
"erotematische" Kunst (s. Erotema) oder die Kunst, durch geschickt
gestellte Fragen die passende Antwort hervorzulocken, welche
Sokrates selbst, auf den Beruf seiner Mutter anspielend, eine
geistige Hebammenkunst (s. Mäeutik) genannt und seine Schule
mit Rücksicht darauf, daß der Fragende sich unwissend
stellt, aber wissend ist, als sokratische Ironie bezeichnet hat.
Vgl. Sokrates 1) und Katechetik.
Sokratiker, Schüler, Anhänger des Sokrates.
Sokratischer Dämon (Dämonion) nannte Sokrates
selbst (Xenophon und Platon zufolge) das "höhere Wesen", von
dem er meinte, daß es ihm durch ein göttliches Geschenk
von Jugend auf beiwohne und sich ihm, wenn er oder seine Freunde
etwas Unrechtes zu thun im Begriff seien, als abratende, jedoch
niemals als zu etwas zuratende Stimme kundgebe, was zu mancherlei
Mißdeutungen (z. B. durch den Spiritismus) Anlaß
gegeben hat. Vgl. Volquardsen, Das Dämonium des Sokrates (Kiel
1862).
Sol, seit 1862 Rechnungseinheit in Peru, à 100
Centavos = 5 Frank; auch s. v. w. Sou (s. d.).
Sol, in der Musik, s. Solmisation.
Sol, bei den Römern der Sonnengott, s. Helios; in
der Alchimie das Gold.
Sol., Soland., bei naturwissenschaftl. Namen
Abkürzung für Daniel Solander, geb. 1736 in Norrland,
gest. 1782 als Unterbibliothekar des Britischen Museums zu London.
Weichtiere, Korallen.
8
Sola fide - Solario.
Sola fide (lat.), d. h. "allein durch den Glauben" werden
wir nämlich gerechtfertigt. Dieses von Luther in der Stelle
Röm. 3, 28, sinn-, aber nicht textgemäß
eingeschobene Sola wurde das Stichwort der lutherischen
Reformation.
Solamen miseris socios habuisse malorum (lat.), "es ist
ein Trost für die Unglücklichen, Leidensgenossen zu
haben".
Solanaceen, dikotyle Familie aus der Ordnung der
Tubifloren, einjährige und perennierende Kräuter und
Holzpflanzen mit wechselständigen, einfachen, oft in der
Blütenstandregion gepaarten Blättern ohne
Nebenblätter und mit meist vollständigen Blüten,
welche einzeln oder in Wickeln stehen, und deren Stiele häufig
scheinbar außerhalb der Blattachseln oder aus der Seite der
Internodien entspringen. Der Kelch ist verwachsenblätterig,
meist fünfspaltig oder -teilig, selten über der stehen
bleibenden Basis abfallend, meist bleibend und an der Frucht mehr
oder weniger vergrößert. Die regelmäßige
Korolle ist dem Blütenboden inseriert,
verwachsenblätterig, rad-, glocken-, trichter- oder
präsentiertellerförmig, mit meist fünfspaltigem
Saum, dessen Zipfel gefaltet, gedreht oder klappig liegen;
bisweilen ist die Blumenkrone zygomorph. Die fünf
Staubgefäße stehen in der Röhre der Blumenkrone
abwechselnd mit den Saumabschnitten derselben. Der
oberständige Fruchtknoten wird aus zwei schräg zur
Mediane gestellten Karpiden gebildet und ist zweifächerig oder
durch sekundäre Scheidewände unvollständig oder
vollständig vierfächerig und hat eine dicke zentrale, mit
zahlreichen amphitropen Samenknospen besetzte Placenta. Die Frucht
ist eine Beere oder eine Kapsel. Die mehr oder weniger
nierenförmigen Samen haben ein reichliches fleischiges
Endosperm und einen halb oder ganz kreisförmig
gekrümmten, seltener geraden Embryo. Die Familie zählt
über 1200 Arten, die zum größten Teil den Tropen
und demnächst den beiden gemäßigten Zonen
angehören. Mehrere enthalten narkotische Alkaloide und sind
wichtige Arznei- oder gefährliche Giftpflanzen (Hyoscyamus,
Datura, Atropa, Solanum, Nicotiana); andere, wie die Kartoffel
(Solanum tuberosum), sind namentlich wegen ihres Gehalts an
Stärkemehl wichtige Nutzpflanzen. Nur sehr wenige S. sind
fossil in Tertiärschichten gefunden worden (Solanites
Sap.).
Solanin C43H71NO16 findet sich in verschiedenen Arten der
Pflanzengattung Solanum, besonders reichlich in den Keimen,
welche Kartoffeln im Frühjahr im Keller treiben. Extrahiert
man diese mit säurehaltigem Wasser und fällt den Auszug
mit Ammoniak, so entzieht Alkohol dem Niederschlag das S. Dies
bildet farb- und geruchlose Kristalle, schmeckt bitter, etwas
brennend, ist sehr schwer löslich in Wasser und Äther,
leichter in Alkohol, schmilzt bei 235°, reagiert schwach
alkalisch und bildet mit Säuren zwei Reihensalze, von denen
die neutralen nicht kristallisieren, bitter und brennend schmecken,
in Wasser und Alkohol leicht, in Äther kaum löslich sind,
und aus deren Lösung Ammoniak amorphes S. fällt. Beim
Kochen mit verdünnten Säuren wird S. in Zucker und
Solanidin C25H41NO gespalten; letzteres kristallisiert, ist
flüchtig, reagiert stärker alkalisch und bildet
kristallisierbare Salze. S. ist stark giftig.
Solano (span.), ein im südlichen Spanien in der
Mancha und Andalusien, namentlich in Sevilla und Cadiz, meist von
Juni bis September auftretender, dem Scirocco ähnlicher, von
SO. und Süden kommender heißer Wind, welcher
erschlaffend und Schwindel erregend wirkt.
Solanum L. (Nachtschatten), Gattung aus der Familie der
Solanaceen, Kräuter, Sträucher oder kleine Bäume von
sehr verschiedenem Habitus, bisweilen kletternd, oft zottig,
sternfilzig oder drüsig behaart, auch stachlig, mit
abwechselnden, einzeln stehenden oder gepaarten, einfachen,
gelappten oder fiederschnittigen Blättern, gelben,
weißen, violetten oder purpurnen Blüten in achsel- oder
endständigen Trauben oder wickeligen Infloreszenzen und
gewöhnlichen, vom bleibenden Kelche gestützten, meist
kugeligen, vielsamigen Beeren. Etwa 700 Arten, meist in den
tropischen und subtropischen Klimaten, besonders Amerikas. S.
Dulcamara L. (Bittersüß, Alpranke, Mäuseholz,
Hundskraut, Stinkteufel, Teufelszwirn), Halbstrauch mit hin- und
hergebogenem, kletterndem oder windendem Stamm, länglich
eiförmigen, zugespitzten, am Grund oft herzförmigen oder
geöhrt dreilappigen Blättern, diesen
gegenüberstehenden, wickeligen, nickenden Infloreszenzen,
violetten Blüten und roten, länglichen Beeren,
wächst an feuchten Stellen in Europa, Asien, Nordamerika. Die
Stämme riechen beim Zerbrechen sehr widrig narkotisch, sind
nach dem Trocknen geruchlos, schmecken bitterlich, hintennach
süß; sie enthalten Solanin, Dulcamarin und Zucker; seit
dem 17. Jahrh. wurden sie medizinisch benutzt, sind jetzt aber
ziemlich obsolet. Die Beeren erzeugen Erbrechen und Durchfall. S.
esculentum Dun. (S. Melongena L. Eierpflanze, Melanganapfel), in
Ostindien, einjährig, mit krautartigem, bis 60 cm hohem,
stachligem oder wehrlosem Stengel, eirunden, ganzrandige oder
buchtig gezahnten, unbewehrten oder dornigen, unterseits filzigen
Blättern und lilafarbigen, großen Blüten,
trägt ovale, violette, gelbe oder weiße Früchte
(Aubergine, Albergine) von der Größe eines
Hühnereies, die als Zuthat an Saucen, Suppen, Ragouts etc.
oder geröstet gegessen werden. Man kultiviert sie in den
Tropen, in Spanien, Südfrankreich, um Rom, Neapel, in der
Walachei und der Levante. In Deutschland kommt diese Pflanze nur in
Töpfen oder auf warmen Rabatten, besser in Mistbeeten, vor. S.
nigrum L. (Hühnertod, Saukraut, s. Tafel "Giftpflanzen II"),
aus Amerika eingewandert, allenthalben auf bebautem Land, an Wegen,
auf Schutt, unbewehrt, mit eirunden, buchtig-gezahnten
Blättern, weißen, selten ins Violette spielenden
Blüten in kurz doldenartigen Wickeln und erbsengroßen,
schwarzen (auch grünen) Beeren, und das zottig oder dicht
behaarte S. villosum Lam. mit gelben und mennigroten (S. miniatum
Bernh.) Beeren, sind bekannte Giftpflanzen und enthalten Solanin.
S. Quitoense Lam. (Orange von Quito), ein bis 2 m hoher Halbstrauch
in Peru und Quito, trägt genießbare Früchte von der
Größe einer kleinen Orange, wird auch in England
kultiviert. Von S. anthropophagorum Seem., auf den Fidschiinseln,
wurden die Beeren als Würze bei den kannibalischen Mahlzeiten
der Eingebornen benutzt. Viele Arten werden als Blattzierpflanzen
kultiviert. Über S. tuberosum s. Kartoffel.
Solar (solarisch, lat.), auf die Sonne
bezüglich.
Solarchemie, die von Kirchhoff und Bunsen
begründete, auf Beobachtung des Sonnenspektrums beruhende
Untersuchung der chemischen Beschaffenheit der
Sonnenatmosphäre; s. Spektralanalyse.
Solario, Andrea, italien. Maler, geboren um 1460 zu
Mailand, bildete sich seit 1490 in Venedig bei G. Bellini und
später nach Leonardo da Vinci. Von 1507 bis 1509 war er in
Frankreich thätig. Er starb nach 1515. Seine Hauptwerke sind:
der Ecce homo und die Ruhe auf der Flucht (im Museum Poldi-
9
Solarlicht - Soleillet.
Pezzoli zu Mailand), die Madonna mit dem grünen Kissen und
die Schüssel mit dem Haupt Johannes' des Täufers (im
Louvre zu Paris) und die Salome (in der Galerie zu Oldenburg).
Solarlicht, veraltet s. v. w. elektrisches Licht.
Solarmaschine, s. v. w. Sonnenmaschine.
Solaröl, s. Mineralöle.
Solarstearin, aus Schweineschmalz abgeschiedenes festes
Fett, dient zu Kerzen.
Solawechsel, ein nur in einem einzigen Exemplar
ausgestellter Wechsel, im Gegensatz zu einem Wechsel, von welchem
noch ein oder mehrere Duplikate ausgefertigt werden (Prima-,
Sekunda-, Tertiawechsel etc.); auch s. v. w. eigner Wechsel (s.
Wechsel).
Solbad, ein Bad, welches in einem natürlichen, viel
Kochsalz, oft auch Jod und Brom enthaltenden Mineralwasser (s. d.)
oder statt des letztern in einer künstlich bereiteten
Lösung von Seesalz oder Mutterlaugensalz (Kreuznach,
Kösen) genommen wird. Über die Anwendung der
Solbäder und die Bereitung der künstlichen s. Bad, S.
221.
Solbrunnen, s. Salz, S. 237.
Sold, s. v. w. Lohn, Bezahlung für geleistete
Dienste, namentlich Kriegsdienste, abzuleiten vom lat. solidus, der
von Alexander Severus (222-235 n. Chr.) eingeführten
Goldmünze, welche den viermonatlichen Lohn des Kriegers
ausmachte. Daher Söldner, Scharen, welche um Lohn in
Kriegsdienste treten, wie im Altertum die Griechen, im Mittelalter
Deutsche und, bis in die Neuzeit, besonders die Schweizer (s.
Fremdentruppen). Nach dem Verfall des Heerbannes, der Lehnsfolge
und des Rittertums bildeten bis gegen Ende des 18. Jahrh. geworbene
Söldner die Masse der Heere. Geregelte Soldzahlung begann erst
mit dem Aufkommen der stehenden Heere. Bei dem ausgehobenen
Wehrpflichtigen ist S. die zum Unterhalt nötige Löhnung,
die, wie schon zu Gustav Adolfs Zeit, alle zehn Tage ausbezahlt
wird. Ihre Höhe beträgt in Deutschland für den
Gemeinen der Infanterie 35 Pf. auf den Tag, für Leute der
berittenen Waffen 5 Pf. mehr, für Gefreite je 5 Pf. mehr als
für Gemeine derselben Waffe. Bei den Griechen beginnt die
Soldzahlung unter Perikles, bei den Römern schon unter den
Königen, aber aus den Gemeindekassen, aus der Staatskasse erst
seit 406 n. Chr. halbjährlich oder jährlich; der bare S.,
das Salarium (Geld für Salz) eingerechnet, entsprach dem Lohn
der ländlichen Arbeiter. Bei den Deutschen beginnt die
Soldzahlung vereinzelt unter Karl d. Gr. und war durch die Hansa im
13. Jahrh., in England um 1050 vollständig entwickelt.
Soldanella L. (Troddelblume, Alpenglöckchen),
Gattung aus der Familie der Primulaceen, kleine, perennierende
Kräuter mit grundständigen, gestielten,
nierenförmigen Blättern, auf nacktem Schaft einzeln oder
doldig stehenden, nickenden, blauen, violetten oder rosenroten
Blüten und kegelförmig länglicher Kapsel. Vier Arten
auf den südeuropäischen Hochgebirgen. S. alpina L., mit
überhängenden, hellvioletten Blüten auf zwei- bis
vierblütigem Schaft. S. pusilla Baumg., mit großer,
rötlichweißer oder rosenroter, einzeln stehender
Blüte, wird, wie die vorige, gleich andern Alpenpflanzen
kultiviert.
Soldat, jede für Sold dienende Militärperson,
mit Ausnahme der Militärbeamten; insbesondere der Gemeine (s.
Militär). Der Name S. wurde im 16. Jahrh. aus dem
Italienischen (soldato) entlehnt und stammt vom lateinischen
solidus (s. Sold).
Soldatenhandel, das Vermieten von Truppen, namentlich
seitens der Fürsten deutscher Kleinstaaten, an fremde Staaten,
lediglich zum Zweck des Gelderwerbs, gleichgültig, ob zu
gunsten der Kasse des Staats oder des Fürsten. Hierin liegt
der Unterschied zwischen dem S. und den Subsidienverträgen
behufs Truppenstellung oder Lieferung von Subsidiengeldern; diesen
Verträgen liegt eine Staatsidee zu Grunde, die dem S. mangelt.
Der letztere hat seinen Ursprung bei den Handelsstaaten des
Altertums: Syrakus, Tarent, Karthago, und fand gleiche Anwendung in
Venedig, den Niederlanden und England, die alle zur Aufstellung
ihrer Heere der Werbung von Söldnern bedurften und (wie
England) noch bedürfen. Den S. begann Bernhard von Galen,
Bischof von Münster, 1665; ihm folgte Johann Georg III. von
Sachsen, der 1685 für 120,000 Thlr. 3000 Mann an Venedig zum
Krieg in Morea vermietete. Den höchsten Aufschwung nahm der S.
während der Kriege Englands gegen seine amerikanischen
Kolonien; etwa 30,000 Mann sind dazu aus Deutschland gestellt,
wofür dieses gegen 8 Mill. Pfd. Sterl. erhielt. Der Landgraf
Wilhelm VIII. von Hessen vermietete während des
österreichischen Erbfolgekriegs sowohl Truppen an England als
an Karl VII., also an die sich bekriegenden Gegner. Die
Fremdentruppen (s. d.), die Schweizerregimenter, die sich oft in
den feindlichen Parteien gegenüberstanden, gehören zum S.
Vgl. Jähns, Heeresverfassungen und Völkerleben (Berl.
1885); Winter, Über Soldtruppen (8. Beiheft zum
"Militärwochenblatt" 1884).
Soldatéska (ital.), das Soldatentum, mit dem
Nebenbegriff des Übermütigen und Eigenmächtigen.
Soldau (poln. Dzialdowo), Stadt im preuß.
Regierungsbezirk Königsberg, Kreis Neidenburg, am Flusse S.,
Knotenpunkt der Linie Allenstein-S. und der Eisenbahn
Marienburg-Mlawka, 157 m ü. M., hat eine evangelische und eine
kath. Kirche, eine Synagoge, Ruinen eines alten Ordensschlosses,
ein Amtsgericht, Spiritusfabrikation, Getreide- und Schweinehandel
und (1885) mit der Garnison (ein Füsilierbat. Nr. 44) 3122
meist evang. Einwohner. Hier 26. Dez. 1806 heftiges Gefecht
zwischen Franzosen (Ney) und Preußen (Lestocq).
Soldin, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk
Frankfurt, am Ausfluß der Miezel aus dem Soldinsee und an der
Eisenbahn Stargard i. P.-Küstrin, 76 m ü. M., hat Reste
einer Stadtmauer und einige Thore aus dem Mittelalter, eine
schöne evang. Kirche, ein Amtsgericht, Maschinenfabrikation, 3
Dampfschneidemühlen, eine Molkerei, Fischerei und (1885) 6198
meist evang. Einwohner. S. wird zuerst 1262 erwähnt. Hier
bestand 1298-1538 ein Kollegiat- oder Domstift der
Prämonstratenser.
Söldner, s. Sold.
Soldo (Mehrzahl Soldi), ital. Rechnungs- und
Kupfermünze, von welcher 20 auf die Lira gehen.
Sole (Soole), kochsalzhaltiges Wasser aus
natürlichen Salzquellen oder künstlich erzeugt (s.
Salz).
Solea (Soole), Zungenscholle, s. Schollen.
Solebai, die Reede von Southwold (s. d.).
Soleillet (spr. ssolläjäh), Paul, franz.
Afrikareisender, geb. 29. April 1842 zu Nîmes, bereiste 1865
Algerien, Tunesien und Tripolitanien, durchzog dann 1871 die
algerische Sahara und machte sich bekannt als einer der
Hauptagitatoren der transsaharischen Eisenbahn. 1873 unternahm er
eine Reise nach Tuat auf einer neuen, noch nicht begangenen Route,
durfte aber die Oase selbst nicht betreten und kehrte 1874 nach
Frankreich zurück. 1878 ging er über Senegambien nach
Segu am Niger und versuchte 1879 nach seiner Rückkehr im
Auftrag der französischen Regierung
10
Solenhofen - Solferino.
von St. Louis nach Timbuktu vorzudringen, wurde indessen bei
Schingit, in der Nähe von Adras, ausgeplündert und war
schon im Mai 1880 wieder in Paris. Im Juli d. J. versuchte er von
St. Louis aus abermals, aber wiederum vergeblich, nach Timbuktu zu
gelangen. Im Auftrag einer französischen Handelsgesellschaft
in Obok machte er 1882 einen kurzen Ausflug über Schoa nach
Kaffa und stand im Begriff, sich abermals nach Schoa zu begeben,
als er 10. Sept. 1886 in Aden starb. Er schrieb: "Exploration du
Sahara" (1876); "L'avenir de la France en Afrique" (1876);
"L'Afrique occidentale" (1877); "Les voyages et découvertes
de P. S., etc., racontés par lui-même" (1881); "Voyage
en Éthiopie 1882-1884" (1886); "Obock, le Choa, le Kaffa"
(1886); "Voyage a Ségou 1878-79" (hrsg. von Gravier, 1887).
Vgl. Gros, Paul S. en Afrique (Par. 1888).
Solenhofen, Dorf, s. Solnhofen.
Solenn (lat.), feierlich; Solennität,
Feierlichkeit.
Solenoglypha (Röhrenzähner), Unterordnung der
Schlangen (s. d., S. 501).
Solenoid (griech.), ein schraubenförmig gewundener
Draht, welcher, solange ihn ein galvanischer Strom
durchfließt, sich wie ein Magnet verhält, nämlich,
wenn beweglich aufgehängt, seine Längsachse in den
magnetischen Meridian einstellt, indem dasjenige Ende, an welchem
der Strom in der Richtung des Uhrzeigers kreist, sich nach
Süden wendet und deshalb Südpol des Solenoids genannt
wird, wogegen das andre nach N. weisende Ende Nordpol heißt.
Auch einem Magnet oder einem zweiten S. gegenüber verhält
sich ein S. wie ein Magnet. Vgl. Elektrodynamik und Magnetismus, S.
90.
Solenópsis, s. Ameisen, S. 452.
Solent, Meeresarm, welcher die engl. Insel Wight von
Hampshire trennt. Die westliche Einfahrt verteidigt Hurst
Castle.
Soleras, s. Jereswein.
Solesmes (spr. ssolähm), 1) Stadt im franz.
Departement Nord, Arrondissement Cambrai, an der Selle und der
Nordbahn, hat bedeutende Zuckerfabrikation, Woll- u.
Baumwollwebereien und (1886) 5728 Einw. -
2) Dorf im franz. Departement Sarthe, Arrondissement La
Flèche, mit Benediktinerkloster aus dem 12. Jahrh., einer
Klosterkirche aus dem 13. Jahrh. mit schönen Skulpturen und
795 Einw.
Soleure (spr. -löhr), franz. Name für
Solothurn.
Soleus (lat.), der Schollenmuskel (fälschlich
Sohlenmuskel) in der Wade.
Solfa (ital.), Tonleiter (vgl. Solmisation).
Solfatára (ital., franz. Soufrière,
Schwefelgrube), vulkan. Krater, dessen Schlot sich bei abnehmender
vulkanischer Thätigkeit allmählich verschloß und
nur noch Gase, Wasserdämpfe und Sublimationen von Schwefel aus
Spalten zu Tage treten läßt wodurch die Gesteine der
Kraterwände Zersetzungen erleiden und einen Überzug von
Schwefel erhalten. Die bekanntesten Solfataren sind in Italien.
Hier heißen so insbesondere drei kleine Seen in der Provinz
Rom, an der nach Tivoli führenden Straße, welche durch
einen Kanal mit dem Teverone in Verbindung stehen. Der Boden
exhaliert Schwefeldünste an mehreren eingebrochenen Stellen
ist trübes Schwefelwasser zu sehen. Von dem einen dieser Seen
werden Thermalbäder (Aquae Albulae) gespeist. Die S. von
Pozzuoli ist einer von den 27 Kratern, welche sich auf der schon
bei den Alten als Phlegräische Felder (s. d.) bezeichneten
vulkanischen Hügellandschaft im W. von Neapel befinden. Es ist
ein durch Einsturz des Kraters eines sich dicht über Pozzuoli
erhebenden Vulkans entstandenes fast kreisrundes Becken das rings
von den Kraterwänden umgeben und nur durch eine Bresche an der
Westseite zugänglich ist. An einigen Stellen ist der Boden
warm, an andern brennend heiß; heiße
Schwefeldämpfe strömen namentlich aus der sogen. Bocca
grande hervor. Die aufsteigenden Dünste werden zu Heilzwecken
benutzt, zu welchem Behuf Bretterhütten errichtet sind. Auch
der an den Wänden der Spalten abgelagerte Schwefel und der
durch Verbindung der porösen Kalke mit der Schwefelsäure
gebildete Gips werden industriell verwertet. Andre Solfataren
finden sich in Westindien (St. Vincent, Guadeloupe, Dominica, wo
die sogen. Grande Soufrière am 4. Jan. 1880 einen
großen vulkanischen Ausbruch hatte, etc.) und in Mexiko. Die
vielgenannte S. von Urumtsi in der Nähe der gleichnamigen
Stadt, am Nordhang des Thianschan (Westchina), ist wahrscheinlich
nur ein brennendes Kohlenlager. Vgl. Fumarolen.
Solfeggio (ital., spr. ssolféddscho. franz.
Solfège) Gesangsübung zur Ausbildung des Gehörs
und der Trefffähigkeit, musikalische Leseübung, am
Pariser Konservatorium der vorbereitende Elementarkursus für
alle Schüler, an vielen andern Anstalten leider
vernachlässigt. Die Solfeggien benannten Gesangsübungen
werden in der Regel auf die Tonnamen: ut (do), re, mi, fa, sol, la,
si gesungen und sind daher zugleich Vokalisationsübungen
(Vokalisen) und bei gesteigerter Schwierigkeit Koloratur- und
Vortragsübungen. Als Meister in der Solfeggienkomposition
stehen die Italiener, namentlich Porpora, Mazzoni, Crescentini,
Concone, obenan. Vgl. Gesang.
Solferino, rote Farbe, s. Anilin, S. 591.
Solferino, Marktflecken in der ital. Provinz Mantua,
Distrikt Castiglione, auf einer Anhöhe 3 Stunden westlich vom
Mincio und ebenso weit südlich vom
[siehe Graphik]
Kärtchen zur Schlacht bei Solferino (24. Juni 1859).
Gardasee, mit (1881) 1284 Einw., ehemals Sitz eines
Fürstentums, geschichtlich merkwürdig durch den
entscheidenden Sieg, welchen hier 24. Juni 1859 die
verbündeten Franzosen und Sardinier über die
Öster-
11
Solger - Soliman.
reicher erfochten. Die Österreicher hatten 21. Juni 1859
ihren Rückzug hinter den Mincio beendigt, am 23. aber, nachdem
der Kaiser, dem Heß zur Seite trat, den Oberbefehl
übernommen, mit 170,000 Mann wieder den Vormarsch in die
Lombardei begonnen. Auf diesem trafen sie 24. Juni früh auf
die gleichfalls vormarschierenden Alliierten (150,000 Mann). Es
entspann sich nun auf der ganzen Linie eine Reihe von
Einzelgefechten ohne Entscheidung, bis Napoleon gegen Mittag einen
energischen Angriff auf S., den Mittelpunkt und Schlüssel der
österreichischen Aufstellung, befahl. Verteidigung u. Angriff
leisteten das Äußerste. Um 3 Uhr erstürmten die
Franzosen endlich die österreichischen Stellungen von S. und
San Cassiano. Da ein Angriff Wimpffens auf den französischen
rechten Flügel von Niel zurückgewiesen wurde, traten die
Österreicher 4 Uhr den Rückzug an. Ein starkes Gewitter
mit Wolkenbruch verhüllte von 5 Uhr an diesen. Die Piemontesen
hatten mittlerweile die gefährlichste Aufgabe zu lösen:
sie sollten in der schmalen Ebene zwischen dem Nordabfall des
Hügellandes und dem Südufer des Gardasees östlich
gegen Peschiera vorgehen. General Benedek drängte sie bis
Rivoltella zwischen Desenzano und Sermione zurück und stellte
sich auf dem Plateau von San Martino auf, das gegen N. und W. steil
abfällt. Fünfmal stürmten die piemontesischen
Bataillone; aber so oft sie bis an den obern Rand gelangten, wurden
sie unter großen Verlusten zurückgeworfen. Erst am Abend
trat auch Benedek zögernd den Rückzug an. Die Schlacht
von S. war eine sehr blutige. Der Gesamtverlust der
Österreicher belief sich auf 22,350 Mann; die Franzosen
verloren 11,670, die Piemontesen 5521 Mann. Den Gefallenen ward
hier 1870 ein Denkmal errichtet.
Solger, Karl Wilhelm Ferdinand, Ästhetiker, geb. 28.
Nov. 1780 zu Schwedt in der Ukermark, studierte zu Halle und Jena
die Rechte und unter Schelling Philosophie, schloß sich am
letztern Ort und später in Berlin dem Kreis der Romantiker an,
wurde 1809 Professor der Ästhetik zu Frankfurt a. O., 1811 zu
Berlin, wo er 20. Okt. 1819 starb. Außer seinem in Form der
Platonischen Dialoge abgefaßten mystisch-dunkeln "Erwin. Vier
Gespräche über das Schöne und die Kunst" (Berl.
1815, 2 Bde.), in welchem er die ästhetischen Prinzipien der
romantischen Schule vertrat, der aber auch eindringlich auf Hegels
Ästhetik gewirkt hat, verfaßte er noch: "Philosophische
Gespräche" (das. 1817) und eine geschätzte
Übersetzung des Sophokles (das. 1808, 2 Bde.; 3. Aufl. 1837).
Seine "Nachgelassenen Schriften und Briefwechsel" wurden von Tieck
und Fr. v. Raumer (Leipz. 1826, 2 Bde.), seine "Vorlesungen
über Ästhetik" von Heyse (Berl. 1829) herausgegeben. Vgl.
Reinh. Schmidt, Solgers Philosophie (Berl. 1841).
Solicitor (engl., spr. ssollíssítör),
Anwalt, Sachwalter (s. Attorney); S. general (spr.
dschönnerel), der Obersachwalter der Krone in England.
Solid (lat.), fest, gediegen, zuverlässig;
Solidität, Festigkeit, Zuverlässigkeit.
Solidago L. (Goldrute), Gattung aus der Familie der
Kompositen, ausdauernde Kräuter mit abwechselnden,
ganzrandigen, oft gesägten Blättern, in Trauben oder
Rispen stehenden, kleinen Blütenkörbchen und
cylindrischen, gerippten Achenen mit einreihigem Pappus. Etwa 80
Arten, meist Nordamerikaner. S. canadensis L. (kanadische Goldrute,
Klapperschlangenkraut), in Nordamerika, mit bis 2,5 m hohem,
zottigem Stengel, lanzettförmigen, gesägten, scharfen
Blättern und gelben Blüten in zurückgebogenen,
einseitigen Trauben, welche wieder große Rispen bilden, wird
gegen den Biß der Klapperschlange gebraucht und häufig
als Zierpflanze kultiviert. Von S. Virga aurea L. (heidnisches
Wundkraut), in Europa, in Wäldern und Hainen, besonders an
trockenen Stellen, mit bis 1 m hohem Stengel, untern elliptischen,
gesägten, obern lanzettlichen, fast ganzrandigen Blättern
und gelben, traubigen oder rispig traubigen
Blütenständen, war das adstringierend aromatische Kraut
früher offizinell.
Solidarhaft (Solidarbürgschaft), im
Genossenschaftswesen die Haftpflicht des Einzelmitglieds für
die Verbindlichkeiten der Genossenschaft (s. Genossenschaften, S.
103).
Solidarisch (lat. in solidum), Bezeichnung für
diejenige Gemeinschaftlichkeit von Verbindlichkeiten und Rechten
(Solidarobligation), vermöge deren, wenn mehrere etwas zu
fordern haben, jeder das Ganze fordern kann und, wenn mehrere
verpflichtet sind, jeder das Ganze zu leisten schuldig ist (alle
für einen und einer für alle, samt und sonders, korreal).
Der Entwurf des deutschen bürgerlichen Gesetzbuchs spricht in
solchen Fällen von einem "Gesamtschuldverhältnis" und von
"Gesamtgläubigern" und "Gesamtschuldnern". Vgl.
Korrealverbindlichkeit.
Solidarität (lat.), völlige
Übereinstimmung, Einheit, z. B. der Interessen.
Solidarpathologie (lat.), s. Cellularpathologie und
Medizin.
Soli Deo gloria! (lat.), Gott allein die Ehre!
Solidieren (lat.), befestigen, sichern.
Solidungula, s. v. w. Einhufer.
Solidus, röm. Goldmünze, welche Kaiser
Konstantin d. Gr. um 312 an Stelle des bis dahin üblichen
Aureus (s. d.) einführte, und die seitdem nicht bloß die
allgemeine Reichsmünze war, sondern bald auch Geltung
über die ganze damals bekannte Welt erlangte. Der Wert betrug
1/72 Pfd = 4,55 g und war bisweilen durch die Zahl LXXII oder durch
die griechischen Zahlzeichen O B (d. h. 72) auf der Münze
ausgedrückt. Das gewöhnlichste Teilstück ist das
Drittel, der Tremissis oder Triens; selten sind Stücke von
1½, 2 und mehr Solidi (sogen. Medaillons). Der Name S.
("Ganzstück") erhielt sich noch lange für verschiedene
Geldwerte; schließlich ging er, da Feinheit und Kurswert der
Münzen immer mehr herabsanken, auf Kupfermünzen, wie den
italienischen Soldo und den französischen Sou, über.
Soligalitsch (Ssoligalitsch), Kreisstadt im russ.
Gouvernement Kostroma, an der Kostroma, mit (188^) 3303 Einw.,
entstand aus einem Kloster (1335 gegründet), in dessen
Nähe Salzquellen entdeckt wurden, und gehörte seit 1450
zum moskauischen Fürstentum. Die Salzgewinnung hat jetzt fast
ganz aufgehört; doch wird ein Brunnen, aus dem klares
bittersalziges Wasser hervorsprudelt, als Heilquelle benutzt.
Solikamsk (Ssolikamsk), Kreisstadt im russ. Gouvernement
Perm, unweit der Kama, hat 7 griechisch-russ. Kirchen, ein Kloster,
eine Stadtbank, wichtige Salinen (jährlich über 1 Mill.
Pud Salz) und (1885) 3901 Einw.
Soliloquium (lat.), Selbstgespräch, Monolog.
Soliman (Suleiman), Name von drei türk. Sultanen: 1)
S. I., Sohn Bajesids I., ließ sich nach der Gefangennehmung
seines Vaters bei Angora 1402 in Adrianopel zum Sultan ausrufen,
mußte aber mit seinem Bruder Musa um den Thron kämpfen,
wurde in Adrianopel eingeschlossen, auf der Flucht gefangen
genommen und seinem Bruder ausgeliefert, welcher ihn 1410
erdrosseln ließ.
12
Solimoes - Solis y Ribadeneira.
2) S. II., el Kanani ("der Große" oder "der
Prächtige"), Sohn Selims I., der berühmteste Sultan der
Osmanen, geb. 1496, war bei des Vaters Tod (22. Sept. 1520)
Statthalter von Magnesia, gab die durch seinen Vater eingezogenen
Güter an die Beraubten zurück und bestrafte mit Strenge
Staatsdiener, welche sich Unordnungen hatten zu schulden kommen
lassen. Die Verweigerung des bei einem Thronwechsel üblichen
Tributs gab ihm den Vorwand zu einem Feldzug gegen Ungarn, der ihm
den Besitz von Schabatz, Semlin und Belgrad verschaffte. Dann
rüstete er sich zur Eroberung der Insel Rhodos, welche nach
einer sechsmonatlichen Verteidigung am 25. Dez. 1522 durch Verrat
fiel. Hierauf zog er im April 1526 mit 100,000 Mann und 300 Kanonen
von neuem gegen Ungarn, und am 29. Aug. erfocht er den Sieg von
Mohács, worauf am 10. Sept. Pest und Ofen dem Sieger die
Thore öffneten. Nach Unterdrückung eines Aufstandes in
Kleinasien unternahm er zu gunsten Johann Zápolyas, Bans von
Siebenbürgen, den eine Partei zum Könige gewählt
hatte, 1529 einen dritten Feldzug nach Ungarn, nahm am 8. Sept.
Ofen und drang am 27. mit 120,000 Mann bis Wien vor, mußte
aber nach einem Verlust von 40,000 Mann am 14. Okt. die Belagerung
der Stadt aufgeben. Nun wandte er seine Waffen nach Osten. Bereits
im Herbst 1533 sandte er ein Heer unter dem Großwesir Ibrahim
nach Asien, wo die Festungen Ardschisch, Achlath und Wan fielen und
Persiens Hauptstadt Tebriz 13. Juli 1534 ihm ihre Thore
öffnete. Auch Bagdad ward noch in demselben Jahr besetzt und
hierauf von da aus das eroberte Land organisiert. Während
dessen hatte Solimans Marine unter Barbarossa den Spaniern 1533
Koron genommen und 1534 Tunis unterworfen, welches aber 1535 durch
Karls V. Expedition bald wieder verloren ging. 1541 unterwarf S.
über die Hälfte Ungarns, und Zápolyas Sohn
mußte sich mit Siebenbürgen begnügen. Endlich wurde
1547 ein fünfjähriger Waffenstillstand geschlossen, nach
welchem S. ein jährlicher Tribut von 50,000 Dukaten bewilligt
ward. Hierauf unternahm er einen zweijährigen Krieg gegen
Persien und erneuerte 1551 den Krieg in Ungarn. Erst 1562 kam mit
Ungarn ein Friede zu stande. Obschon über 70 Jahre alt,
unternahm S. 1566 einen abermaligen Heereszug gegen Ungarn, fand
aber vor Szigeth am 5. Sept. 1566 das Ende seines thatenreichen
Lebens. S. beschließt die Periode der Blüte der
osmanischen Herrschaft. Die Türken verehren in ihm ihren
größten Fürsten. Als Krieger ausgezeichnet und
glücklich, war er auch ein weiser Gesetzgeber und Staatsmann.
Er übte Gerechtigkeit, hielt die Beamten in Pflicht und
Gehorsam, beförderte Ackerbau, Gewerbfleiß und Handel
und war freigebig gegen Gelehrte und Dichter. Doch hielt er sich
nicht frei von Grausamkeit; so ließ er seiner Favoritin
Roxelane, einer gebornen Russin, zu Gefallen alle ihm von andern
Frauen gebornen Kinder umbringen, um ihrem Sohn Selim II. die
Nachfolge zu sichern.
3) S. III., Sohn Ibrahims, Bruder Mohammeds IV., geb. 1647,
folgte, nach dessen Absetzung von den Ulemas aus seiner
langjährigen Haft befreit, 1687, hatte mit Empörungen zu
kämpfen und führte den Krieg in Ungarn unglücklich,
bis er 1689 Mustafa Köprili zum Großwesir ernannte;
starb 1691.
Solimões, s. Amazonenstrom.
Solingen, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk
Düsseldorf, auf einer Anhöhe unweit der Wupper und an der
Linie Ohligswald-S. der Preußischen Staatsbahn, 216 m ü.
M., hat 2 evangelische und eine kath. Kirche, eine Synagoge, ein
Realprogymnasium, ein Kranken-, Armen- und Waisenhaus, ein
Amtsgericht, eine Handelskammer, eine Reichsbanknebenstelle, sehr
bedeutende Fabrikation von Eisen- und Stahlwaren, insbesondere von
trefflichen Säbel- und Degenklingen, Messern, Gabeln, Scheren,
chirurgischen Instrumenten etc., welche in die entferntesten
Länder ausgeführt werden, ferner Eisengießereien
und Fabriken für Patronentaschen, Helme, Zigarren etc. und
(1885) 18,641 meist evang. Einwohner. Die Entstehung der
Eisenindustrie soll unter Adolf IV. von Berg 1147 durch Damaszener
Waffenschmiede, nach andrer Annahme um 1290 durch eingewanderte
Steiermärker begründet worden sein. Erst 1359 wurde der
Herrenhof S. vom Grafen von Berg erworben und erhielt bald darauf
Stadtrecht. 1815 kam S. an Preußen. Vgl. Cronau, Geschichte
der Solinger Klingenindustrie (Stuttg. u. Leipz. 1885).
Solinus, Gajus Julius, röm. Schriftsteller,
wahrscheinlich aus dem 3. Jahrh. n. Chr., veranstaltete aus des
Plinius "Historia naturalis" einen Auszug, meist geographischen
Inhalts, der unter dem Titel: "Polyhistor" auf uns gekommen ist
(beste Bearbeitung von Th. Mommsen, Berl. 1864).
Soliped (lat.), Einhufer.
Solipsen (v. lat. solus, allein, und ipse, selbst, = S.
I.), satir. Name für die Jesuiten, insofern diese nur an sich
selbst zuerst denken. Vgl. Imhofer (Scotti), Monarchia Solipsorum
(Vened. 1645).
Solipsismus, in theoretischer Hinsicht der subjektive
Idealismus (Fichtes), weil das Ich aus sich allein die Welt
schafft, in praktischer Hinsicht der Egoismus, weil der Einzelne
handelt, als ob die Welt sein wäre; Solipsist, ein
Selbstsüchtiger.
Solis, Virgilius, Zeichner und Kupferstecher, geb. 1514
zu Nürnberg, bildete sich nach den Stichen der sogen.
Kleinmeister, verlor sich aber bald in charakterlose Manier, welche
den meisten seiner Kupferstiche (ca. 650) und Federzeichnungen
eigen ist. Er hat seine Motive mit Vorliebe aus der antiken
Mythologie und Geschichte gewählt, aber auch viele Bildnisse
und Szenen aus dem Leben seiner Zeit gezeichnet und gestochen.
Zuletzt schloß er sich ganz den Italienern an. Er starb 1.
Aug. 1562 in Nürnberg.
Solist (lat.), Solosänger.
Solis y Ribadeneira, Antonio de, span. Dichter und
Geschichtschreiber, geb. 28. Okt. 1610 zu Alcalá de Henares,
studierte in Salamanca die Rechte, begleitete später den
Grafen von Oropesa, Vizekönig von Navarra und später von
Valencia, als Sekretär und leistete in dieser Stellung
ausgezeichnete Dienste. Seine Talente erregten die Aufmerksamkeit
Philipps IV., der ihm eine Stelle im Staatssekretariat verlieh und
ihn später zu seinem eignen Sekretär machte. Dasselbe Amt
bekleidete S. auch bei der Königin-Regentin, die ihn
außerdem 1666 zum Chronisten von Indien ernannte. Nicht lange
darauf ließ er sich zum Priester weihen und starb 19. April
1686. Seine "Poesías varias" wurden von I. de Goyeneche
(Madr. 1692) herausgegeben, neuerdings auch in der "Biblioteca de
autores españoles" (Bd. 42) abgedruckt. Viel bedeutender ist
er aber durch seine "Comedias" und er kann als der letzte gute
Dramatiker im Nationalgeschmack betrachtet werden. Seine
Stücke zeichnen sich weniger durch Originalität der
Erfindung, die meistens nicht ihm gehört, als durch geschickte
Behandlung sowie große Reinheit und Eleganz der Sprache und
des Stils aus und wurden zu Madrid 1681 und 1732 gedruckt (eine
Auswahl auch im 47. Bande der genannten "Biblioteca"). Unter
denselben waren die Schauspiele: "El amor al uso" und
13
Solitär - Solmisation.
"El alcazar del segreto" sowie die nach Cervantes' schöner
Novelle bearbeitete "Gitanilla de Madrid" (auch von P. A. Wolff zu
seiner "Pretiosa" benutzt) besonders beliebt. Am berühmtesten
und außerhalb Spaniens am bekanntesten ist S. als
Geschichtschreiber durch seine "Historia de la conquista de Mejico"
(Madr. 1684; am besten, das. 1783-84, 2 Bde., u. öfter; auch
im 28. Bd. der "Biblioteca de autores españoles", 1853;
deutsch von Förster, Quedlinb. 1838), welche, wenn auch kein
kritisches Geschichtswerk im strengen Sinn des Wortes, doch wegen
der kunstreichen Darstellung und der geistvollen Betrachtungsweise
sowie wegen des Reichtums, der Eleganz und Klarheit der Sprache zu
den klassischen Werken der spanischen Litteratur gerechnet wird.
Noch hat man von S. eine Anzahl vortrefflich geschriebener Briefe,
die Mayans y Siscar in seiner Sammlung "Cartas morales etc." (Val.
1773, 5 Bde.) herausgab.
Solitär (franz. solitaire), Einsiedler,
einsiedlerisch lebender Mensch; ein einzeln stehender, funkelnder
Stern; ein einzeln gefaßter Diamant oder Edelstein von
besonderm Wert. Auch ein Geduldspiel für eine einzelne Person,
das sich vielfach in Kinderstuben findet, heißt S. Auf einem
Brett sind 37 Löcher in 7 Reihen so angebracht, daß die
1. und 7. Reihe je 3, die 2. und 6. je 5, die 3., 4. und 5. je 7
Löcher enthalten. In jedem Loch steckt ein leicht ausziehbarer
Stift. Das Spiel besteht darin, daß man einen Stift weglegt,
sodann immer einen Stift in gerader Linie über einen andern
wegsteckt und den übersprungenen herausnimmt. Um das Spiel zu
gewinnen, darf man zuletzt nur noch einen Stift im Brett behalten.
Solitärpflanzen, Pflanzen mit schönen Blättern etc.
zur Einzelstellung auf Rasen.
Solitüde (franz., "Einsamkeit"), öfters Name
von Lustschlössern. Besonders bekannt ist die S. bei
Stuttgart, 1763-67 von Herzog Karl erbaut und 1770-1775 Sitz der
durch Schiller berühmt gewordenen Karlsschule (s. d.).
Solium (lat.), s. v. w. Thron, ein hoher erhabener Sitz
mit Rücken- und Seitenlehnen. Auf einem solchen saß bei
den Römern der Pater familias, wenn er morgens seinen Klienten
Audienz gab.
Soljanka, russ. Gericht aus mit Zwiebeln gedämpftem
Sauerkraut, welches mit gebratenem Fleisch geschichtet, mit
Pfeffergurken, Pilzen, Würstchen bedeckt und im Ofen leicht
gebacken wird.
Soll, in der Buchhaltung (s. d., S. 564) s. v. w. Debet.
Solleinnahmen, Sollausgaben, erwartete, noch nicht erfolgte
Einnahmen und Ausgaben (Sollposten). Demgemäß spricht
man auch von einem Budgetsoll oder Etatsoll, während das
Kassensoll die Summe angibt, welche, entsprechend den Buchungen, in
der Kasse vorhanden sein soll.
Sölle, s. Riesentöpfe.
Sollen unterscheidet sich von Müssen wie das Sitten- vom
Naturgesetz dadurch, daß eine durch das erstere gebotene
Handlung unterlassen werden kann, aber nicht unterlassen werden
darf, ohne mißfällig zu werden, während von dem
durch das letztere vorgeschriebenen Geschehen keine Ausnahme
stattfinden kann.
Söller (v. lat. solarium), s. v. w. Saal oder
Vorplatz im obern Stockwerk eines Hauses; auch ein offener Gang
oder Altan um dasselbe.
Sollicitudo omnium ecclesiarum (lat.), die Bulle vom 7.
Aug. 1814, durch welche Papst Pius VII. den Jesuitenorden
wiederherstellte ; s. Jesuiten, 210.
Solling (Solinger Wald), ein den Weserbergen
angehöriger Bergzug in der preuß. Provinz Hannover und
im Herzogtum Braunschweig, fällt steil von Bodenfelde bis
Holzminden westlich zum Weserthal und östlich bei Einbeck zu
den Thälern der Leine und Elme ab. Der S., welcher im Moosberg
zu 513 m Höhe ansteigt, ist ganz bewaldet und besteht aus
Buntsandstein, der vielfach gebrochen wird (Höxtersandstein).
Mit dem S. schließt das durch die hessischen Länder nach
Süden bis zum Odenwald sich erstreckende Buntsandsteingebirge
im N. ab.
Sollizitieren (lat.), nachsuchen, inständig bitten;
Sollizitant, Bittsteller, Rechtssucher; Sollizitation, Gesuch;
Sollizitator, Anwalt.
Sollm., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung
für A. Sollmann, Lehrer in Koburg (Pilze).
Sollogub, Wladimir Alexandrowitsch, Graf, russ.
Schriftsteller, geb. 1814 zu St. Petersburg, studierte in Dorpat,
schlug dann die diplomatische Laufbahn ein und erhielt bei der
Gesandtschaft in Wien einen Posten. Später wurde er vom
Ministerium des Innern in den Süden Rußlands
abkommandiert, um statistische Nachrichten über die
südlichen Gouvernements zu sammeln. Nachdem er sich vom
Staatsdienst zurückgezogen, nahm er seinen Wohnsitz in Dorpat
und starb 17. Juni 1882 im Bad Homburg. Sein Hauptwerk ist
"Tarantas" (1845; deutsch, Leipz. 1847), eine mit trefflichem Humor
verfaßte Schilderung der verschiedenen Schichten der
Gesellschaft in der Provinz. Außerdem sind zahlreiche
Novellen und Erzählungen (darunter die rührende
"Geschichte zweier Galoschen" und "Die große Welt")
vorhanden, die von Phantasie und Beobachtungsgabe zeugen, wenn sie
auch der künstlerischen Tiefe ermangeln. Gelegentlich
versuchte sich S. auch als Theaterdichter (z. B. mit dem Lustspiel
"Der Beamte", 1857) und veröffentlichte "Erinnerungen an
Gogol, Puschkin und Lermontow" (deutsch, Dorp. 1883) u. a.
Solmisation, eine eigentümliche, Jahrhunderte
hindurch üblich gewesene Methode, die Kenntnis der Intervalle
und der Tonleitern zu lehren, welche auf Guido von Arezzo (um 1026)
zurückgeführt wird; sicher ist, daß sie um 1100
bereits sehr verbreitet war. Die S. hängt offenbar eng
zusammen mit der damals aufkommenden Musica ficta, d. h. dem
Gebrauch chromatischer, der Grundskala fremder Töne, und
verrät eine Ahnung von dem innersten Wesen der Modulation, d.
h. des Überganges in andre, transponierte Tonarten,
entsprechend unserm G dur, F dur etc., die nichts als Nachbildungen
des C dur auf andrer Stufe sind. Die sechs Töne C D E F G A
(Hexachordum naturale) erhielten nämlich die Namen ut, re, mi,
fa, sol, la (nach den Anfangssilben eines Johanneshymnus: ut queant
laxis resonare fibris mira gestorum famuli tuorum, sole polluti
labii reatum, sancte Ioannes); dieselben Silben konnten nun aber
auch von F oder von G aus anfangend zur Anwendung kommen, so
daß F oder G zum ut wurde, G oder A zum re etc. Da stellte
sich nun heraus, daß, wenn A mi war, der nächste Schritt
(mi-fa) einen andern Ton erreichte als das mi des mit G als ut
beginnenden Hexachords, d. h. die Unterscheidung des B von H (B
rotundum oder molle [b] und B quadratum oder durum [#], vgl.
Versetzungszeichen) wurde damit begreiflich gemacht. Jedes
Überschreiten des Tons A nach der Höhe (sei es nach B
oder H) bedingte nun aber einen Übergang aus dem Hexachordum
naturale entweder in das mit F beginnende (mit B molle [B], daher
Hexachordum molle) oder das mit G beginnende (mit B durum [H],
daher Hexachordum durum); im erstern Fall erschien der
Übergang von G nach A als sol-mi. im andern als sol-re. Vom
erstern stammt der Name S. Jeder
14
Solmona - Solms.
derartige Hexachordwechsel hieß Mutation. Die folgende
Tabelle mag das veranschaulichen:
[siehe Graphik]
Die geklammerten Vertikalreihen hier sind die Hexachorde: die
unterhalb mit # bezeichneten Reihen Hexachorda dura (mit h), die
mit b bezeichneten Hexachorda mollia (mit b), die ohne Abzeichen
naturalia (weder h noch b enthaltend). Die Horizontalreihen ergeben
die zusammengesetzten Solmisationsnamen der Töne (Gamma ut bis
e la). Zur bequemen Demonstration der S. bediente man sich der
sogen. Harmonischen Hand (s. d.). In Deutschland ist die S. nie
sehr beliebt gewesen; dagegen verdrängten in Italien und
Frankreich die Solmisationsnamen gänzlich die Buchstabennamen
der Töne, ja man bediente sich längere Zeit daselbst
sogar der zusammengesetzten Namen C solfaut, G solreut etc., weil
nämlich C im Hexachordum naturale ut, im Hexachordum durum fa
und im Hexachordum molle sol war etc. Der italienische Name Solfa
für Tonleiter sowie solfeggiare, solfeggieren (d. h. die
Tonleiter singen), kommt natürlich auch von der S. her.
Für das moderne System der transponierten Tonarten wurde die
S. unpraktikabel. Als man anfing, die zusammengesetzten
Solmisationsnamen zu schwerfällig und, was wichtiger ist,
nicht ausreichend zu finden (nämlich für die Benennung
der chromatischen Töne), und den einfachen Silben ut, re, mi,
fa, sol, la ein für allemal feststehende Bedeutung anwies, um
sie durch b und # beliebig verändern zu können, bemerkte
man, daß ein Ton (unser H) gar keinen Namen hatte; indem man
nun auch diesem Ton einen Namen gab, versetzte man der S. den
Todesstoß, denn die damit beseitigte Mutation war deren
Wesenskern. Einfacher wäre es freilich gewesen, zur schlichten
Buchstabenbenennung zurückzukehren, wie sie durch die
Schlüsselzeichen [Grafik] ein für allemal in unsrer
Tonschrift implizite enthalten ist. Statt dessen soll um 1550
Hubert Waelrant, ein belgischer Tonsetzer, die sogen. belgische S.
mit den sieben Silben: bo, ce, di, ga, lo, ma, ni (Bocedisation)
vorgeschlagen und eingeführt haben, während um dieselbe
Zeit der bayrische Hofmusikus Anselm von Flandern für H den
Namen si, für B aber bo wählte (beide galten nach alter
Anschauung für Stammtöne). Henri van de Putte (Puteanus,
Dupuy) stellte in seiner "Modulata Pallas" (1599) bi für H
auf, Adriano Banchieri in der "Cartella musicale" (1610) dagegen ba
und Pedro d'Urenna, ein spanischer Mönch um 1620, ni. Ganz
andre Silben wünschte Daniel Hitzler (1628): la, be, ce, de,
me, fe, ge (Bebisation), unserm A, B, C, D, E, F, G entsprechend,
und noch Graun (1750) glaubte mit dem Vorschlag von da, me, ni, po,
tu, la, be etwas Nützliches zu thun (Damenisation). Von allen
diesen Vorschlägen gelangte schließlich nur der zu
allgemeiner Geltung, die Silbe si für H (aber ohne bo für
B) zu setzen, und dies erklärt sich hinreichend daraus,
daß das si wie die übrigen Solmisationssilben dem
erwähnten Johanneshymnus entnommen ist (die Anfangsbuchstaben
der beiden Schlußworte: Sancte Ioannes).
Solmona, Kreishauptstadt in der ital. Provinz Aquila
(Abruzzen), in herrlicher Gebirgsgegend am Fluß Gizzio, an
der Eisenbahn Castellammare Adriatico-Aquila-Terni, ist
Bischofsitz, hat mehrere Kirchen (darunter San Pamfilo mit
schönem Portal), ein schönes Rathaus, eine alte
Wasserleitung, ein Gymnasium, technische Schule, Seminar, Papier-
und Walkmühlen, Fabrikation von Webwaren, Darmsaiten und
Konfitüren, Weinbau und (1881) 14,171 Einw. S. ist das alte
Sulmo, Ovids Geburtsort, wovon sich noch einzelne Baureste erhalten
haben.
Solms, altes gräfliches, zum Teil fürstliches
Geschlecht, dessen Stammschloß seit dem 14. Jahrh. Braunfels
in der Wetterau war, und das Marquard, Grafen von S. im Hessengau,
der 1129 erwähnt wird, zum ersten gewissen Stammvater hat.
1409 teilte sich das Geschlecht in die Linien S.-Braunfels und
S.-Lich. Erstere teilte sich wieder in drei Zweige, wovon nur noch
der Zweig Greiffenstein besteht, der 1693 den Namen Braunfels
annahm und 1742 in den Reichsfürstenstand erhoben ward. Die
zweite Linie teilte sich in zwei Hauptzweige: S.-Hohen-S.-Lich,
1792 in den Reichsfürstenstand erhoben, und S.-Laubach,
gräflich. Letzterer teilte sich wieder in zwei Unterlinien,
S.-Sonnenwalde und S.-Baruth; die letztgenannte wieder in zwei
Äste, S.-Rödelheim und Assenheim, in beiden Hessen
standesherrlich, und S.-Wildenfels mit den Nebenästen
S.-Wildenfels-Laubach und S.-Wildenfels zu Wildenfels. Die
Reichsunmittelbarkeit verloren die fürstlichen und
gräflichen Linien 1806. Den ansehnlichsten
zusammenhängenden Teil der Ländereien des Hauses besitzt
Georg, Fürst von S.-Braunfels (geb. 18. März 1836;
succedierte 7. März 1880 seinem Bruder, dem Fürsten
Ernst), nämlich unter preußischer Landeshoheit die
Ämter Braunfels, Greiffenstein, unter großherzoglich
hessischer die Ämter Hungen, Wölfersheim und Gambach,
unter württembergischer einen Teil von Limpurg-Gaildorf,
zusammen 514 qkm, mit welchen Besitzungen eine Virilstimme beim
Landtag der Rheinprovinz verbunden ist. Residenz ist Braunfels.
Dieser Linie gehörte auch der österreichische
Feldmarschallleutnant Prinz Karl zu S.-Braunfels (geb. 27. Juli
1812, gest. 13. Nov. 1875) an, der Sohn der in zweiter Ehe mit dem
Prinzen Friedrich Wilhelm (gest. 1814) vermählten Prinzessin
Friederike von Mecklenburg-Strelitz, Stiefbruder des Exkönigs
Georg von Hannover, auf den er in österreichischem Interesse
einwirkte; seine Söhne sind katholisch und stehen in
österreichischen Diensten. Der Fürst von
S.-Hohen-S.-Lich, Hermann, geb. 15. April 1838, besitzt unter
preußischer Landeshoheit das Amt Hohen-S. und unter
großherzoglich hessi-
15
Solnhofen - Solombala.
scher die Ämter Lich und Niederweisel, zusammen 220 qkm. Er
residiert zu Lich und ist erbliches Mitglied der
großherzoglich hessischen Ersten Kammer, wie er auch auf dem
Landtag der Rheinprovinz eine Virilstimme hat. Haupt der in
Preußen und Sachsen ansässigen, nicht standesherrlichen
Linie S.-Sonnenwalde ist Graf Theodor, geb. 6. Febr. 1814; sein
jüngerer Bruder, Graf Eberhard, geb. 2. Juli 1825, war 1878-87
deutscher Gesandter in Madrid und ist jetzt Botschafter in Rom.
Standesherr in der Linie S.-Laubach zu Rödelheim und Assenheim
ist Graf Maximilian, geb. 14. April 1826, der auf Grund seiner
Besitzungen im Groß Herzogtum Hessen erbliches Mitglied der
dortigen Ersten Kammer ist. Gleicherweise ist der Standesherr zu
S.-Laubach, Graf Friedrich, geb. 23. Juni 1833, erbliches Mitglied
der Ersten Kammer im Großherzogtum Hessen. Der Standesherr
von S.-Wildenfels zu Wildenfels, Graf Friedrich Magnus, geb. 26.
Juli 1847, der neben der Herrschaft Wildenfels unter königlich
sächsischer Landeshoheit im Großherzogtum Hessen und in
Sachsen-Weimar Besitzungen hat, ist erbliches Mitglied der Ersten
Kammer des Königreichs Sachsen. Das Haupt der Baruther Linie,
Graf Friedrich Hermann Karl Adolf, geb. 29. Mai 1821, erbliches
Mitglied des preußischen Herrenhauses, ward im April 1888 in
den Fürstenstand erhoben. Vgl. Graf zu S.-Laubach, Geschichte
des Grafen- und Fürstenhauses S. (Frankf. a. M. 1865).
Solnhofen (Solenhofen), Dorf im bayr. Regierungsbezirk
Mittelfranken, Bezirksamt Weißenburg, an der Altmühl und
der Linie München-Ingolstadt-Hof der Bayrischen Staatsbahn,
hat eine evang. Kirche, ein ehemaliges Benediktinerkloster von 743
und (1885) 1128 Einw. Berühmt sind die Solnhofener Schiefer,
womit man die obersten schieferigen Jurakalke bezeichnet, die
zwischen S. und Monheim und bis tief nach Schwaben hinein den
Jurakalk und Dolomit bedecken und in ausgedehnten Brüchen, die
bei S. ihren Mittelpunkt haben, für die verschiedensten
Zwecke: als lithographische Steine, zu Tischplatten, für
Kegelbahnen, Fußböden etc., verarbeitet werden. In ihnen
fand man die Überreste des ersten bekannten Vogels (s.
Archaeopteryx).
Solnhofener Schichten, s. Juraformation.
Solo (ital., "allein"), in der Musik Bezeichnung eines
Instrumentalstücks, welches allein, ohne Begleitung eines
andern Instruments, vorgetragen wird. Innerhalb der für
Orchester geschriebenen Werke bedeutet S. soviel wie eine sich
auffallend heraushebende, von einem einzelnen Instrument
ausdrucksvoll vorzutragende Stelle, die indes in der Regel von
andern Instrumenten begleitet wird. Wieder eine andre Nüance
der Bedeutung des Wortes ist die, daß es bei Instrumenten,
welche vielfach besetzt sind, als Gegensatz von Tutti gebraucht
wird; die Anweisung "S." im Parte der Violinen eines
Orchesterwerkes bedeutet, daß nur Ein Violinist (der
Konzertmeister) die Stelle spielen soll; der Wiedereintritt der
übrigen Geiger wird dann durch "Tutti" bezeichnet. In
demselben Sinn ist in Chorwerken S. der Gegensatz von "Chor" (vgl.
Ripieno). Tasto s. (t. s.) bedeutet in der
Generalbaßbezifferung, daß die übrigen Stimmen
pausieren und nur die Baßstimme selbst angegeben werden
soll.
Solo (ital., "allein"), im Kartenspiel entweder (z. B.
beim Skatspiel) ein Spiel, welches mit denjenigen Karten allein
gemacht wird, die man ursprünglich erhalten hat, oder ein
selbständiges Spiel mit deutscher Karte, dem L'hombre
nachgebildet. Zu diesem Spiel gehören vier Personen, welche
zunächst die vier Farben untereinander auslosen. Wer Eicheln
hat, gibt an, und Eicheln ist für die ersten 16 Spiele (eine
Tour) die Kouleur. In der nächsten Tour wird die Farbe des
zweiten Spielers Kouleur etc. Jeder erhält 8 Blätter.
Treffdame oder Eichelnober (Spadille), die Sieben der jedesmaligen
Trumpffarbe (Manille oder Spitze) und Pikdame oder Grünober
(Baste) sind beständige Trümpfe und rangieren in der
genannten Folge; der Wert der übrigen Karten ist der
natürliche. In Treff und Pik (Eicheln und Grün) sind 9,
in Coeur und Karo (Rot und Schellen) aber 10 Trümpfe
vorhanden. Es gibt im S. 4 Spiele: Frage, Groß-Casco
(Forcée partout, Respect), Solo und Klein-Casco
(Forcée simple). Die beiden Cascos sind Zwangsspiele: das
kleine muß, wenn alle 4 Personen gepaßt haben, der
Inhaber der Spadille machen; das große muß der Besitzer
von Spadille und Baste spielen, außer wenn er selbst oder ein
andrer S. hat. Frage und S. werden durch Frage und S. in Kouleur
überboten. Nur im S. spielt einer gegen drei; bei Casco oder
Frage nimmt sich der Meldende durch das sogen. Dausrufen einen
Gehilfen. Spielt jemand Frage, so wählt er eine Farbe zu
Trumpf und nennt zugleich ein Daus von einer andern Farbe. Wer
dieses Daus hat, ist Gehilfe; er darf dies aber nicht entdecken.
Spielt einer Casco, so ruft er ebenfalls ein Daus; den Trumpf macht
aber der aufgerufene Gehilfe. Zum Gewinn sind mindestens 5 Stiche
erforderlich; bei 4 Stichen ist das Spiel einfach verloren und bei
nur 3 Stichen "Codille". Vole, Tout, Wäsche oder Lese ist
gemacht, wenn der oder die Spieler alle 8 Stiche bekommen, eine
Revolte oder Devole, wenn sie gar keine bekommen, Remis, wenn jede
Partei 4 Stiche macht. Es gilt Matadorrechnung, wie im Skat. Das
Solospiel ist in vielfacher Weise erweitert und abgeändert
worden; eine interessante Abart ist das S. unter 5 Personen,
welches nach gleichen Regeln mit einer Karte von 5 Farben (40
Blättern) gespielt wird. Die hinzugefügte Farbe
heißt die blaue. Eine andre ist die mit dem Mediateur, wobei
von einem der Mitspieler ein Daus (As) gegen eine entbehrliche
Karte eingetauscht und dann S. gespielt wird.
Solo, Landschaft, s. Surakarta.
Solofänger, ein Windhund, der einen Hasen allein,
ohne Hilfe andrer Hunde, zu fangen vermag.
Solofra, Stadt in der ital. Provinz Avellino, am
Fuß des Monte Terminio, Station der Eisenbahn von Neapel nach
Avellino, hat bedeutende Fabrikation von Leder und Pergament,
Handel mit Wolle und gesalzenem Schweinefleisch und (1881) 5178
Einw.
Sologne (spr. ssolonnj), franz. Landstrich in den
Departements Cher, Loiret und Loir-et-Cher, 460,000 Hektar
groß und sprichwörtlich wegen seiner Unfruchtbarkeit,
enthält sandige Heiden, zahlreiche Teiche und Sümpfe (zu
deren Entwässerung in neuerer Zeit allerdings viel gethan
worden ist) und etwas Wald, produziert Buchweizen und Wein
(Solognewein), Schafe und eine eigne Rasse Pferde (Solognote).
Sololá, Departement im mittelamerikan. Staat
Guatemala, erstreckt sich an der Küste des Stillen Ozeans bis
auf die Hochebene und hat (1885) 76,342 Einw. In seiner Mitte liegt
der reizende Atitlansee (s. d.) und in dessen Nähe die
Hauptstadt S.
Solombala (Ssolombala), ehemaliger Kriegshafen im russ.
Gouvernement Archangel, am Weißen Meer, von Peter I.
angelegt, mit einer Admiralität, wurde 1862 als solcher
aufgehoben und bildet gegenwärtig eine Vorstadt von Archangel,
von welchem der Ort durch einen Arm der Dwina getrennt ist. S.
16
Solon - Solothurn.
hat 2 Kirchen, ein kath. Bethaus, eine Seemannsschule, eine
Schiffswerfte, einen geräumigen Kauffahrteihafen und gegen
11,000 Einw.
Solon, berühmter Gesetzgeber Athens, unter den
sieben Weisen Griechenlands der bedeutendste, geboren um 640 v.
Chr. zu Athen, Sohn des Exekestides, aus einem alten edlen
Geschlecht, welches Kodros unter seinen Ahnen zählte, widmete
sich dem Handel und ging frühzeitig auf Reisen. Zum erstenmal
trat er 604 öffentlich auf. Die Athener, eines langen
resultatlosen Kampfes mit Megara um Salamis müde, hatten ein
Gesetz gegeben, welches jeden mit dem Tod bedrohte, der eine
Erneuerung des Kampfes beantragen würde. S. erschien hierauf
in der Rolle eines Wahnsinnigen auf dem Markt, sang vom Stein des
Herolds herab eine von ihm verfertigte Elegie: "Salamis", und
entflammte dadurch die Kriegslust der Athener aufs neue in solchem
Grade, daß der Kampf wieder begonnen und mit der Eroberung
der Insel beendigt wurde. Nicht lange nachher (600) wurde auf
Solons Betrieb der erste Heilige Krieg gegen Krissa zum Schutz des
delphischen Heiligtums beschlossen. Athen selbst aber befand sich
um diese Zeit in einer bedenklichen Lage. Die Zerrüttung war
allgemein, und der Zwiespalt der Parteien drohte den Staat zu
untergraben. Da trat S. im entscheidenden Augenblick abermals als
Retter seiner Vaterstadt auf, bewirkte eine allgemeine Sühnung
des Volkes durch Epimenides und stiftete Frieden. Hierauf machte
er, um der wachsenden Not und Verarmung des niedern Volkes zu
steuern, durch die Seisachtheia (s. d.) dem Wucher ein Ende und
ermöglichte die Abwälzung der Schulden. 594 zum ersten
Archon gewählt, gab er dem Staat eine neue Verfassung. Seine
Absicht ging hierbei vornehmlich dahin, die bisher zwischen Adel
und Volk bestandene Kluft auszufüllen, die Anmaßung des
erstern zu brechen, die Entwürdigung der letztern zu
beseitigen, Standesvorrechte und Beamtenwillkür abzuschaffen
und eine nach den Leistungen abgestufte Beteiligung aller
Staatsbürger an der Staatsregierung einzuführen (s.
Athen, S. 1001). Seine Verfassung war also eine Timokratie. Ihren
Charakter und Zweck hat S. selbst am schönsten in den Versen
bezeichnet (nach der Übersetzung von Geibel):
So viel Teil an der Macht, als genug ist, gab ich dem Volke,
Nahm an Berechtigung ihm nichts, noch gewährt' ich zu
viel.
Für die Gewaltigen auch und die reicher Begüterten
sorgt' ich,
Daß man ihr Ansehen nicht schädige wider
Gebühr.
Also stand ich mit mächtigem Schild und schützte sie
beide,
Doch vor beiden zugleich schützt' ich das heilige
Recht.
Außerdem gab er dem Volk eine dessen ganzes Leben und
ganze Thätigkeit umfassende Gesetzgebung, deren segensreiche
Wirkungen seine Verfassung überdauert haben; sie gewöhnte
das Volk zu lebendiger, selbständiger Teilnahme am
öffentlichen Leben, hob die geistige Bildung und erzeugte
bewußte Sittlichkeit und edle Humanität in ihm. Die Sage
erzählt, daß S. die Athener verpflichtet habe,
während eines zehnjährigen Zeitraums an seiner
Gesetzgebung nichts zu ändern, und daß er eine Reise ins
Ausland deshalb gemacht habe, um nicht selbst Hand an die
Abänderung seiner Gesetze legen zu müssen. Er ging
zunächst nach Ägypten, wo er mit den Priestern von
Heliopolis und Sais Umgang hatte, dann nach Cypern und nach Sardes
zu Krösos, mit dem er nach der (historisch unmöglichen)
Sage die bekannte Unterredung über die Nichtigkeit
menschlicher Glückseligkeit hatte. Nach seiner Rückkehr
nach Athen suchte er vergeblich den von neuem ausbrechenden
Zerwürfnissen daselbst zu steuern und mußte noch sehen,
daß sich Peisistratos zum Tyrannen aufwarf. Er starb 559;
seine Gebeine sollen auf sein eignes Verlangen nach Salamis
gebracht und dort verbrannt, die Asche aber auf der ganzen Insel
umhergestreut worden sein. Als Sittenspruch wurde ihm beigelegt:
"Nichts zu viel". Als Dichter war er nicht minder ausgezeichnet wie
als Gesetzgeber. Seine Gedichte sind größtenteils
hervorgegangen aus dem Bedürfnis, seinen Mitbürgern die
Notwendigkeit der von ihm getroffenen Staatseinrichtungen
darzuthun. Die Fragmente derselben sind gesammelt von Bach (Bonn
1825), in Schneidewins "Delectus poesis Graecorum elegiacae"
(Göttingen 1838) und in Bergks "Poetae lyrici graeci". Ins
Deutsche übersetzte sie Weber in den "Elegischen Dichtern der
Hellenen" (Frankf. 1826). Die ihm von Diogenes Laertius beigelegten
Briefe an Peisistratos und einige der sieben Weisen sind
untergeschoben. Solons Leben beschrieb Plutarch. Vgl. Kleine,
Quaestiones de Solonis vita et fragmentis (Kref. 1832); Schelling,
De Solonis legibus (Berl. 1842).
Solothurn (franz. Soleure), ein Kanton der Schweiz, wird
im O. von Basel und Aargau, im Süden und W. von Bern, im N.
von Basel begrenzt und hat einen Flächengehalt von 784 qkm
(14,2 QM.). Abgesehen von den beiden Exklaven Mariastein und
Klein-Lützel, die auf bernischem Gebiet an der Elsässer
Grenze liegen, ist das Land von eigentümlich zerrissenen
Umrißformen und zerfällt zunächst in Anteile der
Schweizer Hochebene und in solche des Jura. Zu jenen gehören
das Aarethal von S., in welches die Thalebene der Großen Emme
ausmündet, und das Aarethal von Olten. Beide Thalstrecken
scheidet ein vorspringendes Stück des bernischen Ober-Aargaues
(Wangen-Wiedlisbach), und eine Jurakette, deren Häupter
Hasenmatt (1449 m), Weißenstein (1284 m) und Röthifluh
(1398 m) sind, schließt sie nach der Seite der jurassischen
Landschaften ab. In der Klus von Önsingen-Balsthal bricht die
Dünnern aus ihrem dem Aarelauf parallelen jurassischen
Hochthal hervor, um bei Olten in die Aare zu münden,
während ebenfalls bei Balsthal das jenem parallele Guldenthal
sich öffnet. Ein zweiter Jurazug, die Kette des Paßwang
(1005 m), führt von Mümliswyl hinüber in das
Birsgebiet (Schwarzbubenland). Das Klima gehört eher zu den
rauhen als milden, so daß das Land ohne Weinbau ist. Die
Volkszahl beläuft sich auf (1888) 85,720 Köpfe. Die
Solothurner, deutschen Stammes und katholischer Konfession (nur
21,898 Protestanten, vorwiegend im Bucheggberger Amt), gelten
für "ein gutmütiges, munteres und rechtschaffenes
Völkchen". Seit durch Referendum vom 4. Okt. 1874 die
Benediktinerabtei Mariastein und die beiden Chorherrenstifter von
Solothurn und Schönenwerd aufgehoben sind, besitzt der Kanton
noch drei Kapuziner- und drei Nonnenklöster. Die Katholiken
des Kantons sind der Diözese Basel zugeteilt, und seit
längerer Zeit ist die Stadt S. Bischofsitz. Einige Gemeinden
haben sich dem 1874 geschaffenen Nationalbistum angeschlossen. S.
ist ein vorzugsweise Ackerbau treibendes Ländchen, einer der
wenigen Schweizer Kantone, welche Getreide über den Bedarf
erzeugen; auch kommen Obst und Kirschwasser sowie (bei guter
Waldwirtschaft) Holz zur Ausfuhr. Rindvieh, meist vom Berner
Schlag, wird viel gehalten. Einige Käse kommen dem Emmenthaler
gleich; um Mümliswyl wird der "Geißkäse" bereitet.
Auch viele Schafe und Ziegen werden gehalten, Pferde weniger als
früher; hingegen besteht noch eine treffliche Schweinezucht.
Der Jura liefert Gips und trefflichen Kalkstein; in der Nähe
der Hauptstadt wird "Marmor"
17
Solothurn (Kanton und Stadt).
gebrochen und weithin versandt. Bohnerzlager finden sich bei
Matzendorf (seit 1877 so gut wie erschöpft). Gerlafingen hat
in neuerer Zeit Baumwollspinnerei (Derendingen) u.
Papierfabrikation eingeführt. Sonst besitzt die Gegend von
Olten-Schönenwerd eine rege Industrie: einen Eisendrahtzug,
eine große Maschinenbauwerkstätte, Strumpffabrikation u.
a. Die Bandweberei des Schwarzbubenlandes ist eine Dependenz von
Basel (s. d., S. 418). Ferner bestehen Glashütten,
Parkettfabriken etc. Wenn auch weder die Stadt S. noch Olten zu den
Handelsplätzen gehört, sind beide doch bedeutsame
Knotenpunkte im Schweizer Bahnnetz geworden. Im Kur- und
Touristenverkehr nimmt S. keine hervorragende Stelle ein; nur der
Weißenstein und Bad Lostorf sind stark besuchte Punkte. Die
heutige Volksschule gliedert sich, wie in den meisten Kantonen, in
eine allgemein verbindliche primäre und eine fakultative
sekundäre Stufe. Von humanitären Anstalten besitzt der
Kanton eine Irrenheilanstalt (Rosegg), die Dischersche
Rettungsanstalt Hofmatt und eine von Schwendimann dotierte
Blindenanstalt. Die öffentlichen Bibliotheken zählen ca.
85,000 Bände (die Stadtbibliothek Solothurns allein
40,000).
Die Verfassung des Kantons, 12. Dez. 1875 vom Volk angenommen,
23. Okt. 1887 revidiert, hat an die Stelle der
Repräsentativdemokratie das Referendum gesetzt.
Demgemäß unterliegen alle Gesetze und
Staatsverträge sowie alle neuen Ausgaben von höherm
Betrag und alle Staatsanleihen von mehr als einer halben Million
dem obligatorischen Referendum. Das Recht der Initiative ist
geregelt; ein Volksentscheid muß stattfinden, wenn eine
Anregung von 2000 Votanten eingereicht ist. Das Volk kann sowohl
Legislative als oberste Exekutive abberufen; eine Abstimmung
entscheidet, sobald die Abberufung von 4000 Votanten verlangt wird.
Der Kantonsrat, als gesetzgebende Behörde, wird vom Volk auf
vier Jahre gewählt. Die Exekutive übt ein Regierungsrat
von fünf Mitgliedern, welche das Volk auf vier Jahre
erwählt. Der Präsident führt den Titel Landammann.
Ein Obergericht, durch den Kantonsrat ebenfalls auf vier Jahre
ernannt, besteht aus sieben Mitgliedern. Im übrigen garantiert
die Verfassung alle in den Schweizer Kantonen üblichen
Grundrechte. Der Kanton ist in fünf Amteien eingeteilt, jede
mit Oberamtmann und Amtsgericht. Die Staatsrechnung für 1887
ergibt an Einnahmen 1,736,746 Frank, davon an Abgaben 611,581 Fr.;
die Ausgaben belaufen sich auf 1,865,956 Fr., wovon 333,558 Fr. auf
das Erziehungswesen entfallen. Zu Ende 1887 betrugen die Aktiva des
Staatsvermögens 13,245,122 Fr., die Passiva 10,079,000 Fr.,
also reines Staatsvermögen 3,166,122 Fr.; dazu die
Spezialfonds, 15 an Zahl, im Betrag von 3,685,089 Fr., zusammen
6,851,211 Fr.
Die gleichnamige Hauptstadt des Kantons, zu beiden Seiten der
Aare, Knotenpunkt der Bahnlinien Herzogenbuchsee-Biel,
Olten-Lyß und S.-Langnau, bietet außer dem
Ursusmünster (1773 von Pisoni vollendet) und dem Zeughaus nur
die eine Sehenswürdigkeit der Verena-Einsiedelei, mit einem
Felskirchlein und einer großen Felsenhöhle. Die Stadt
selbst hat sich in neuerer Zeit erweitert und verschönert und
besitzt eine Kantonsschule (Gymnasium und Industrieschule), eine
Stadtbibliothek mit einer Sammlung von Altertümern und
Münzen, eine Gemäldegalerie, 3 Bankinstitute (darunter
eine Notenbank mit 3 Mill. Fr. Kapital), Uhren-, Eisen-,
Zementfabrikation, Baumwollweberei, Marmorsteinbrüche und
(1888) 8305 Einw. (darunter ca. 2000 Protestanten). Entferntere
Punkte sind Zuchwyl, wo Kosciuszko begraben liegt, und der Kurort
Weißenstein. Vgl. Hartmann, S. und seine Umgebungen (Soloth.
1885).
[Geschichte.] Die Stadt S. (Salodurum) war schon zur
Römerzeit ein Knotenpunkt der großen Heerstraßen
Helvetiens. Im Mittelalter lehnt sich ihre Geschichte an das im 10.
Jahrh. entstandene Chorherrenstift des heil. Ursus an, das
ursprünglich alle Hoheitsrechte mit Ausnahme des Blutbanns
innehatte, von dem sich die Bürgerschaft aber allmählich
emanzipierte. Nach dem Aussterben der Zähringer (1218), welche
die Reichsvogtei besessen, wurde S. reichsunmittelbar; 1295
schloß es mit Bern ein ewiges Bündnis und hatte 1318
eine Belagerung durch Herzog Leopold auszustehen, weil es Friedrich
den Schönen nicht als König anerkannte. Ein Versuch des
verarmten Grafen Rudolf von Kyburg, sich der Stadt durch Verrat zu
bemächtigen, wurde glücklich vereitelt (Solothurner
Mordnacht, vom 10. zum 11. Nov. 1382) u. führte zu dem
Kyburger Krieg, in welchem Bern und S. das Grafenhaus vernichteten.
Als treue Verbündete Berns nahm S. an den Schicksalen der
Eidgenossen schon seit dem 14. Jahrh. Anteil, wurde aber infolge
des Widerstandes der "Länder" erst 22. Dez. 1481 gleichzeitig
mit Freiburg in den Bund aufgenommen, nachdem es sich durch Kauf
den größten Teil des heutigen Kantons als
Unterthanenland erworben. Gegen die Reformation verhielt sich S.
eine Zeitlang schwankend, aber nach der Schlacht von Kappel waren
die Katholiken im Begriff, die reformierte Minderheit mit den
Waffen zu vernichten, als der katholische Schultheiß Wengi
sich vor die Mündung der Kanonen stellte und durch seine
hochherzige Dazwischenkunft den blutigen Zusammenstoß
vermied. Doch blieb S. der Reformation verloren und schloß
sich 1586 dem Borromeischen Bund an. Dagegen hielt es sich fern von
dem Bunde der übrigen katholischen Orte mit Spanien (1587),
vornehmlich aus Ergebenheit gegen Frankreich, dessen Ambassadoren
S. zu ihrer regelmäßigen Residenz erwählt hatten.
Aus ihrem glänzenden Hofhalt und den reichlich
fließenden französischen Gnadengeldern schöpfte die
Stadt einen Wohlstand, den der Adel in höfischen
Festlichkeiten zu entfalten liebte. Auch in S. bildete sich
nämlich ein erbliches Patriziat aus, dessen Regiment erst 1798
mit dem Einrücken der Franzosen ein Ende nahm (1. März).
Die Mediationsakte erhob 1803 S. zu einem der sechs
Direktorialkantone mit einer Repräsentativverfassung. Nach dem
Einrücken der Österreicher bemächtigten sich die
noch lebenden Mitglieder der alten patrizischen Räte in der
Nacht vom 8. zum 9. Jan. 1814 des Rathauses, erklärten sich
für die rechtmäßige Regierung und schlugen eine
Erhebung der Landschaft mit bernischer Hilfe nieder; nur ein
Drittel des Großen Rats wurde dieser zugestanden. 1828 wurde
S. durch ein Konkordat der Kantone Bern, Luzern, Zug, S., Aargau
und Thurgau zum Sitz des neugegründeten Bistums Basel erhoben.
1830 mußte der Große Rat dem stürmischen Verlangen
der Landschaft nachgeben und vereinbarte mit den Ausschüssen
derselben eine neue Verfassung, welche, obwohl sie der Hauptstadt
noch 37 Vertreter auf 109 gewährte, 13. Jan. 1831 mit
großer Mehrheit angenommen wurde. Nach dem "Züricher
Putsch" wurde das Wahlvorrecht der Stadt beseitigt und die
Mitgliederzahl der Regierung vermindert, worauf die neue Verfassung
10. Jan. 1841 angenommen und das liberale Regiment durch
fortschrittliche Wahlen aufs neue befestigt wurde. Daher hielt sich
der Kan-
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl., XV. Bd.
2
18
Solotnik - Soltikow.
ton trotz seiner überwiegend katholischen Bevölkerung
zu den entschiedensten Gegnern des Sonderbundes und nahm die neue
Bundesverfassung 1848 mit großer Mehrheit an. Durch zwei
Verfassungsrevisionen (1851 und 1856) ward das lange festgehaltene
System der indirekten Wahlen und der Allmacht der Regierung auch in
Kommunalangelegenheiten beseitigt. Nachdem 1869 Referendum und
Initiative eingeführt worden waren, wurde 1875 die gesamte
Verfassung revidiert. Inzwischen war der Konflikt der Baseler
Diözesanstände gegen den in S. residierenden Bischof
Lachat ausgebrochen, in welchem S. sich der Mehrheit anschloß
und den Bischof nötigte, nach seiner Entsetzung seine
Amtswohnung zu räumen. Zugleich strengte die Regierung namens
der Stände einen Aufsehen erregenden Prozeß gegen Lachat
wegen stiftungswidriger Verwendung von bedeutenden Legaten an, der
1877 vom Obergericht zu ihren gunsten entschieden wurde. Eine Folge
dieses Konflikts war die Aufhebung einer Anzahl kirchlicher
Stiftungen, deren ca. 4 Mill. betragendes Vermögen zu Schul-
u. Krankenfonds verwendet wurde (18. Sept. 1874). Auch fand das
christkatholische Bistum staatliche Anerkennung in S., doch
vermieden sowohl die Regierung als die römisch-katholische
Geistlichkeit einen offenen Bruch, und die letztere unterwarf sich
auch 1879 der in der Verfassung vorgesehenen periodischen
Wiederwahl durch die Gemeinden. 1885 wurde der Friede mit der Kurie
durch Wiedererrichtung des Bistums Basel und des Domkapitels in S.
hergestellt, wo der neue Bischof Fiala seinen Sitz nahm. Da die
Regierung sich durch Beteiligung mehrerer ihrer Mitglieder an einem
Bankschwindel bloßstellte, trat sie 1887 zurück, und das
Volk beschloß 23. Okt. d. J. eine neue, rein demokratische
Verfassung. Vgl. Strohmeier, Der Kanton S. historisch,
geographisch, statistisch (St. Gallen 1836); Fiala, Geschichtliches
über die Schule von S. (das. 1875-1879, 4 Tle.); Amiet, S. im
Bunde der Eidgenossen (Soloth. 1881).
Solotnik, Gewicht in Rußland, = 1/96 Pfund = 96
Doli = 4,265 g.
Solotonoscha, Kreisstadt im russ. Gouvernement Poltawa,
am Flusse S., der dem Dnjepr zuströmt, mit 9 Kirchen,
Mädchenprogymnasium und (1885) 8417 Einw., die sich meist mit
Landwirtschaft beschäftigen. S. kam 1654 an Rußland.
Solotschow, Stadt im russ. Gouvernement Charkow, an der
Uda, mit (1885) 6584 Einw., die sich mit Garten- und Ackerbau,
Schuhmacherei, Kürschnerei und Viehhandel
beschäftigen.
Solowezk (Ssolowezk), russ. Inselgruppe im Weißen
Meer, im Eingang zum Onegabusen gelegen, zum Teil mit Tundren und
Gestrüppe bedeckt, zum Teil mit Birken und Kiefern bewachsen.
Auf der Hauptinsel liegt das reiche Solowjezkische Kloster, ein
berühmter, jährlich von ca. 8000 Pilgern besuchter
Wallfahrtsort, seit 1429 bestehend und aus Anlaß der
häufigen Überfälle von seiten der Schweden mit
betürmten Granitmauern umgeben. Die Mönche betreiben
Thransiederei und in dem an den Ufern schon sehr tiefen Meer
Herings-, Hausen- und Lachsfanng (vgl. die vortreffliche
Schilderung von Dixon in "New Russia").
Solowjew, 1) Sergei Michailowitsch, russ.
Geschichtschreiber, geb. 5. Mai 1820 zu Moskau, studierte daselbst
und brachte als Hauslehrer bei dem Grafen Stroganow die Jahre
1842-44 im Ausland, meist in Paris, zu. Nachdem er mit einer
Schrift: "Über die Beziehungen Nowgorods zu den
Großfürsten", die Magisterwürde und mit einer
andern: "Die Geschichte der Beziehungen zwischen den Fürsten
des Rurikschen Geschlechts", den Doktorgrad erlangt hatte, hielt er
Vorlesungen über Geschichte an der Moskauer Universität,
ward 1855 Dekan der philosophischen Fakultät und 1871 Rektor
der Universität Moskau. Daneben unterrichtete er die
Großfürsten in Petersburg in der Geschichte und versah
das Amt eines Direktors der Antiquitätensammlung im Kreml. Als
der Unterrichtsminister Tolstoi das freisinnige
Universitätsstatut abschaffen wollte, geriet S. in Streit mit
den Behörden und forderte 1877 seine Entlassung, die er auch
erhielt. Er starb 4. Okt. 1879 in Moskau. Außer zahlreichen
Aufsätzen über Geschichtswissenschaft und russische
Geschichte in periodischen Zeitschriften schrieb S.: "Historische
Briefe" (1858-59); "Schlözer und die antihistorische
Richtung"; "Die Geschichte des Falles von Polen" (1863; deutsch von
Spörer, Gotha 1865); "Kaiser Alexander I., Politik und
Diplomatie" (1877); "Lehrbuch der russischen Geschichte" (7. Aufl.
1879); "Populäre Vorlesungen über russische Geschichte"
(1874); "Kursus der neuen Geschichte" ; "Politisch-diplomatische
Geschichte Alexanders I." (1877) u. a. Sein Hauptwerk ist die
"Russische Geschichte von den ältesten Zeiten" (1851-80, Bd.
1-29, bis 1774 reichend).
2) Alexander Konstantinowitsch, russ. Revolutionär, geb.
1846, ward Lehrer, dann Amtsschreiber, ging 1878 nach Petersburg,
trat hier der nihilistischen Verschwörung bei und unternahm
14. April 1879 ein Attentat auf Kaiser Alexander II., indem er
fünf Revolverschüsse auf ihn abfeuerte, ohne ihn zu
verletzen; S. ward 10. Juni d. J. gehenkt.
Solözismus (griech.), Sprachfehler, besonders ein
auf die Konstruktion des Satzes bezüglicher. Die Alten
leiteten das Wort von dem Namen der athenischen Kolonie Soloi in
Kilikien ab, deren Einwohner ihren Heimatsdialekt rasch vergessen
und sich durch fehlerhafte Sprechweise ausgezeichnet haben
sollen.
Solpuga, Walzenspinne.
Solquellen, s. Salz (S. 237) und Mineralwässer.
Solsalz, aus Salzlösungen gewonnenes Kochsalz im
Gegensatz zum Steinsalz.
Solsona (das alte Setelsis), Bezirksstadt in der span.
Provinz Lerida, hat 2 Kastelle, eine Kathedrale,
Quincailleriefabriken, Baumwoll- und Leinweberei und (1878) 2413
Einw.
Solspindel, s. Gradierwage.
Solstitium (lat., "Sonnenstillstand"), s. Sonnenwenden;
solstitial, die Solstitien betreffend.
Solt, Markt im ungar. Komitat Pest mit (1881) 5692
ungarischen und serbischen Einwohnern.
Solta, österreich. Insel im Adriatischen Meer,
südlich von Spalato, 56 qkm groß, ist fruchtbar, hat
mehrere Häfen, eine Landwirtschaftsgesellschaft und in sechs
Ortschaften (1880) 2556 Einw.
Soltau, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk
Lüneburg, an der Linie Stendal-Langwedel der Preußischen
Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, Filz-,
Teppich-, Faßkräne- und bedeutende
Fruchtweinfabrikation, Honig- und Bettfedernhandel und (1885) 2827
Einw. S., schon 937 genannt, ist durch die Schlacht vom 28. Juni
1519 (beim Dorf Langeloh) in der Hildesheimer Stiftsfehde
bekannt.
Soltikow (Ssaltykow), russ. Adelsgeschlecht, welches auf
die Zeiten Alexander Newskijs zurückreicht und unter seinen
Gliedern viele Bojaren zählt. Praskowja Fedorowna S. ward die
Gemahlin des Zaren Iwan Alexejewitsch (gest. 1696) und dadurch
Mutter der Kaiserin Anna. Der General Se-
19
Soltyk - Somal.
men S., Gouverneur von Moskau, ward durch diese 1732 in den
russischen Grafenstand erhoben. Dessen Sohn, Graf Peter
Semenowitsch S., geb. 1700, führte im Siebenjährigen
Krieg seit 1759 den Oberbefehl über die russische Armee, trug
23. Juli 1759 bei Kai einen Sieg über den preußischen
General Wedel davon und gewann 12. Aug., nachdem er sich mit dem
österreichischen General Laudon vereinigt hatte, den
entscheidenden Sieg bei Kunersdorf über den König
Friedrich II. selbst. Dafür mit der Feldmarschallswürde
belohnt, ward er später Generalgouverneur in Moskau und starb
15. Dez. 1772. Nikolai Iwanowitsch S., geb. 24. Okt. 1736, wurde
1783 Erzieher des nachmaligen Kaisers Alexander I. und des
Großfürsten Konstantin, 1796 Feldmarschall und
Präsident des Kriegskollegiums, 1812 Präsident des
Reichsrats und 1813-15 Vorsitzender des Ministerkomitees. 1814 in
den Fürstenstand erhoben, starb er 28. Mai 1816 in Petersburg.
Sein ältester Sohn, Fürst Alexander S., war kurze Zeit
Minister des Äußern und starb 1837. Dessen Neffe,
Fürst Alexei S., machte sich durch seine Reisen in Persien
1838 und Ostindien 1841-46 bekannt, die er in "Voyages dans l'Inde"
(3. Aufl., Par. 1858) und "Voyage en Perse" (das. 1851)
beschrieb.
Soltyk, Roman, poln. General, geb. 1791 zu Warschau, Sohn
des Reichstagsmarschalls Stanislaus S. und der Prinzessin Karoline
Sapieha, besuchte die polytechnische Schule in Paris, trat 1807 als
Leutnant in die Fußartillerie des damaligen
Großherzogtums Warschau und machte 1809 den Feldzug gegen
Österreich mit. 1812 als Adjutant des Generals Sokolnicki in
den Generalstab Napoleons I. berufen, befehligte er in der Schlacht
bei Leipzig die Sachsen und geriet durch deren Übergang in die
Gefangenschaft der Alliierten. Wieder frei, verließ er den
Militärdienst und eröffnete in Warschau ein Eisenmagazin.
Seit 1822 beteiligte er sich an den geheimen politischen
Gesellschaften. Nach dem Ausbruch der Revolution vom 29. Nov. 1830
begab er sich nach Warschau, ward Generalkommandant der vier auf
dem rechten Weichselufer liegenden Woiwodschaften, organisierte
hier 47,000 Mann mobiler Nationalgarden und beantragte auf dem
Reichstag die Absetzung des Kaisers Nikolaus und die Erklärung
der Souveränität des Volkes (21. Jan. 1831). Während
der Belagerung Warschaus durch die Russen Befehlshaber der
Artillerie in der Stadt, widersetzte er sich aufs eifrigste der
Kapitulation Krukowieckis und hielt stand bis zum letzten
Augenblick, ging dann mit der Armee nach Plozk und übernahm
eine Sendung nach England und Frankreich, um dort eine Vermittelung
dieser Mächte für Polen nachzusuchen. Er starb am 22.
Okt. 1843 in St. Germain en Laye. Im Exil schrieb er den
"Précis historique, politique et militaire de la
révolution du 29 novembre" (Par. 1833, 2 Bde.; deutsch
bearbeitet von Elsner, Stuttg. 1834) und "Napoléon en 1812"
(Par. 1836; deutsch, Wesel 1837).
Soluntum (Solus), im Altertum befestigte Stadt auf
Sizilien, östlich von Palermo, phönikischen Ursprungs,
zur Zeit des Dionys (397 v. Chr.) mit den Karthagern verbündet
und im ersten Punischen Krieg erst nach dem Fall von Panormos zu
Rom übergehend, wahrscheinlich durch die Sarazenen
zerstört; jetzt Ruinen Solanto. Seit 1826 (in
größerm Maßstab seit 1863) werden hier, ½
Stunde Gehens von der Station Santa Flavia, Ausgrabungen
vorgenommen, durch welche bereits die meisten Straßen der
Stadt, viele Mosaikböden und mancherlei Skulpturen freigelegt
worden sind.
Solution (lat.), Lösung; solubel, löslich.
Solutivum (neulat.), Auflösungsmittel.
Solutum (lat.), Zahlung.
Solvabel (lat.), auflösbar; solvieren, lösen,
seiner Verbindlichkeit nachkommen; solvent, zahlungsfähig
(daher insolvent, zahlungsunfähig); Solvenz,
Zahlungsfähigkeit, im Gegensatz zu Insolvenz (s. d.).
Solventia (lat.), lösende Mittel, Expektoranzien,
welche eine Lösung des zähen Schleims bewirken, den
Auswurf befördern.
Solway Firth (spr. ssóllwe), Golf des Irischen
Meers, zwischen England und Schottland, schneidet in
nordöstlicher Richtung 56 km tief in das Land ein und
enthält viele Lachse und Heringe. Während der Ebbe kann
der obere Teil des S. fast trocknen Fußes durchkreuzt werden,
die Flut steigt aber rasch und mit großer Heftigkeit. In ihn
münden die Flüsse Cocker, Eden, Esk, Annan und Nith. Sein
oberes Ende überspannt ein Eisenbahnviadukt.
Solwytschegodsk (Ssolwytschegodsk), Kreisstadt im russ.
Gouvernement Wologda, an der Wytschegda, mit (1885) 1313 Einw.
Solzy (Ssolzy), Flecken im russ. Gouvernement Pskow,
Kreis Porchow, am Schelonj, mit (1885) 5903 Einw., welche lebhaften
Flachshandel nach Petersburg treiben.
Soma (griech.), Leib, Körper.
Soma (ital.), in der Lombardei s. v. w. Hektoliter.
Soma, in den Hymnen des Weda (s. d.) ursprünglich
der berauschende, mit Milch und Mehl gemischte und einige Zeit der
Gärung überlassene Saft einer Pflanze, der eine
begeisternde und heilende Wirkung auf Menschen und Götter
übt; besonders häufig wird der berauschende Einfluß
des Trankes auf den Gott Indra geschildert. Als die betreffende
Pflanze gilt heute eine Sarcostemma-Art (Asclepias acida), die
indes in südlichern Strecken wächst, als die Wohnsitze
des wedischen Volkes gelegen waren, so daß wahrscheinlich mit
den Sitzen auch die Pflanze gewechselt hat. Die begeisternde Macht
des Trankes führte bereits in indo-iranischer Zeit dazu, den
Saft als Gott S. zu personifizieren und ihm fast alle Thaten andrer
Götter zuzuschreiben. Bei den Ostiraniern steht dem Somakult
der ganz analoge Haomakult zur Seite. Vgl. Windischmann, Über
den Somakultus der Arier (Münch. 1847); Muir, Original
Sanskrit texts (Bd. 2, S. 469 ff., und Bd. 5, S. 258 ff.); Haug,
Essays on the sacred language etc. of the Parsis (2. Ausg., Lond.
1878, S. 282 ff.); Hovelacqe, L'Avesta (Par. 1880, S. 272 ff.).
Somain (spr. ssomäng), Stadt im franz. Departement
Nord, Arrondissement Douai, Knotenpunkt der Eisenbahnlinien
zwischen Douai und Valenciennes, mit bedeutenden Steinkohlengruben
und darauf gegründeter Industrie in Zucker, Leinwand, Glas,
Chemikalien und 1881) 4782 Einw.
Somal (Singular Somali), ein den Hamiten und zwar der
äthiopischen Familie derselben zugerechneter großer
Volksstamm, welcher das ganze östliche Horn Afrikas
östlich von den Galla und südlich von den Danakil
über den Dschubbfluß hinaus bis gegen den Tana bewohnt.
Sie zerfallen in drei voneinander unabhängige Stämme: die
Adschi von Tadschura am Golf von Aden bis Kap Gardafui, die Hawijah
an der Küste des Indischen Ozeans bis zur Stadt Obbia und die
Rahanwin im W. der Hawijah zwischen Dschubb und Webbi (s. Tafel
"Afrikanische Völker", Fig. 29 u. 30). Die ethnographische
Stellung der S. ist noch keine sichere; sie scheinen ein Mischvolk
zu sein, bei dem nach den physischen Eigenschaften
20
Somateria - Somerset.
einmal der nordostafrikanische Typus durchschlägt, dann
aber wieder eine Annäherung an das Semitische sich kundgibt.
Unzweifelhaft sind sie Verwandte der Abessinier und Galla. Als
fanatische Mohammedaner rühmen sie sich ihrer Herkunft aus
Arabien. Bemerkenswert ist die von Revoil bei Somalweibern
häufiger beobachtete Steatopygie (s. d.). Das Haar
läßt man lang wachsen, beizt es mit Kalk rötlich;
im Innern werden Perücken aus Schaffell getragen. Die Zahl der
S. (zu 5 Mill. geschätzt) ist nicht bekannt, da in den
eigentlichen Kern ihres Landes bis jetzt nur der Brite L. James
nebst Genossen eingedrungen ist. Die Sprache der S. gehört zu
dem äthiopischen (südlichen) Zweig des hamitischen
Sprachstammes (dargestellt von Prätorius in der "Zeitschrift
der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft", Bd. 24, 1870;
auch von Hunter: "Somal-Grammatik", Bombay 1880). Eine Schrift
besitzen die S. nicht. Der Charakter des Volkes ist nach der
Lebensweise verschieden. Die beduinischen S. sind leidenschaftlich,
verräterisch und grausam, der Wert eines Mannes wird bei ihnen
nach der Zahl seiner Mordthaten bemessen. Dagegen zeigen die
Bewohner der größern Ortschaften eine
verhältnismäßig nicht unbedeutende Bildung. Alle
aber sind stolz und freiheitliebend u. im allgemeinen Feinde der
Fremden. Sie leben meist in Monogamie, Sklaven sind nicht
häufig. Die Kinder beiderlei Geschlechts werden beschnitten,
die Mädchen bis zur Verheiratung vernäht. Bei der
Verheiratung wählt das Mädchen den Mann, letzterer
muß aber den Schwiegervater für dasselbe bezahlen. Auf
die Frauen fällt die ganze Arbeitslast. Als Kleidung dienten
früher Felle, jetzt ein der abessinischen Schama
ähnliches Baumwollentuch, auch tragen die Frauen Beinkleider,
Sandalen sind häufig in Gebrauch. Als Waffen dienen Lanzen,
runde Schilde, Messer, im Süden auch Schwerter, ferner Bogen
und vergiftete Pfeile. Die Wohnungen werden in den Städten aus
Steinen und Lehmziegeln, sonst aus Fachwerk und Strohmatten
errichtet; die nomadisierenden S. haben leicht abtragbare,
zeltähnliche Hütten. Die Nahrung besteht im Fleisch ihrer
Herden, in Sorghum, Mais, Milch, Butter sowie eingeführten
Datteln und Reis. Spirituosen und Schweinefleisch sind verboten.
Als Haustiere werden Kamele, Rinder (Zebu), Schafe, Ziegen, Pferde,
Esel gehalten. Gelegentlich jagt man Elefanten, Nashorn,
Büffel, Antilopen, Strauße. Den Toten zollt man viel
Verehrung. Die Stämme stehen unter Häuptlingen, die aber
wenig Macht haben. Die Gesellschaft zerfällt in drei Klassen:
die Saladin, die Reichen und Würdenträger; die Barkele
oder Beduinen und die Mödgan, letztere sind die Eisenarbeiter
und werden als Zauberer scheel angesehen. Eine Art Hörige sind
die Tomal, welche als Hirten, Kamelreiter u. a. dienen; eine Art
Zigeuner, verachtet, aber wegen ihrer Zaubereien gefürchtet,
sind die Jibbir. Bei allen hat die Blutrache Geltung. Das Somal-
oder Somaliland besteht aus einem schmalen, sandigen
Küstenstreifen, der an der Nordseite mehrere Häfen
(Zeila, Bulhar, Berbera, Las Gori, sämtlich in englischem
Besitz, ferner am Osthorn Bender Felek, Ras Felek) hat,
während die Ostküste ganz ohne Häfen verläuft
bis zu den im Besitz von Sansibar befindlichen: Warscheich,
Mogduschu, Merka, Barawa, Kismaju. Das Innere ist eine weite, von
einzelnen Höhenrücken unterbrochene Hochfläche, die
zum Teil aus großen wüsten Strichen mit hartem Boden
besteht. Die Wasserläufe, die das Land durchziehen, sind den
größten Teil des Jahrs trocken, nur der Dschubb
führt das ganze Jahr hindurch Wasser und ist auch eine
beträchtliche Strecke aufwärts bis Bardera, wo v. d.
Decken ermordet wurde, schiffbar; der nächstbedeutende Webi
erreicht die See nicht. Auf dem Hochland sind der Tug Dehr und Tug
Faf ihrer fruchtbaren Thalmulden wegen zu bemerken. Die hohe
Temperatur des Küstenstrichs wird durch heftige Seewinde sehr
gemildert; auf dem Hochland bilden 8° C. das Temperaturminimum
und 32° C. das Maximum. Mimosen, Calotropis procera, Euphorbien
und Koloquinten charakterisieren die Vegetation des Tieflandes,
während im Hochland Weihrauchbäume, alle Gummisorten,
Leuchtereuphorbien, im Webigebiet auch der Affenbrotbaum gedeihen.
Die Fauna bietet Wanderheuschrecken, giftige große Ameisen,
viele Bienen, Flußpferde und Krokodile, Strauße, alle
afrikanischen Katzen, große Antilopenherden, das Zebra und
den Wildesel. Vgl. Haggenmacher, Reise im Somaliland (Gotha 1876);
Révoil, La vallée du Darror. Voyage au pays
Çomalis (Par. 1882); Derselbe, Faune et flore des pays
Çomalis (das. 1882); Paulitschke, Beiträge zur
Ethnographie und Anthropologie der S., Galla und Harari (Leipz.
1886); James, The unknown horn of Africa (Lond. 1888).
Somateria, Eiderente.
Somátisch (griech.), körperlich.
Somatologie (griech.), die Lehre vom menschlichen
Körper, also besonders Anatomie.
Sombreréte, Bergstadt im mexikan. Staat Zacatecas,
2369 m ü. M., an der Eisenbahn von Zacatecas nach Durango,
1570 gegründet, hat eine höhere Schule und (1882) 5173
Einw.
Sombrerit, ein jüngst gebildeter, an Korallen
reicher Kalk, der durch überlagernden Guano teilweise
metamorphosiert worden ist und neben kohlensaurem Kalk und Thon
75-90 Proz. phosphorsauren Kalk enthält. Er findet sich auf
der Insel Sombrero. Die Amerikaner beuteten 1856 den S. aus und
brachten ihn als Dungmittel in den Handel, doch scheint das Lager
rasch erschöpft worden zu sein. Vgl. Guano.
Sombrero ("Hutinsel"), eine der Kleinen Antillen, 5 qkm
groß, zwischen den Jungferninseln und Anguilla gelegen, ist
ein Kalksteinfels, der schroff aus dem Meer aufsteigt, einen
Leuchtturm trägt, fast ohne Vegetation ist, aber seiner
Kalkbrüche halber doch einigen Wert besitzt; eine Zeit lang
lieferte die Insel den Sombrerit.
Sombreros (span.), breitrandige, leichte und dauerhafte
Hüte, aus Palmblättern gefertigt (s. Sabal).
Somerset (spr. ssommersset), 1) Grafschaft im
südwestlichen England, grenzt nordwestlich an den
Bristolkanal, wird zu Lande von den Grafschaften Gloucester, Wilts,
Dorset und Devon umschlossen und umfaßt 4248 qkm (77,1 QM.)
mit (1881) 469,109 Einw. Die Küste ist großenteils steil
und unzugänglich, hat aber teilweise auch schöne Buchten
mit niedrigem Landsaum; die bedeutendste derselben ist die
Bridgewaterbai. Im N. und W. ist die Grafschaft gebirgig und von
langen, jäh abfallenden Hügelketten (Mendip, Blackdown
und Quantock Hills) durchschnitten; an der Westgrenze gegen Devon
zu erhebt sich das Bergland Exmoorforest (509 m). Die bedeutendern
Flüsse sind: der Avon, welcher zum Teil die Nordgrenze bildet,
der Ex, Yeo, Axe, Brue und Parret. Der Boden ist teils steinig,
teils Heide, teils Marsch- und Moorland, im allgemeinen aber
fruchtbar, und namentlich ist die Thalebene von Taunton einer der
reichsten Bezirke von England. Das Klima ist gemäßigt.
Von der Oberfläche sind 22,1 Proz. unter dem Pflug, 60,5 Proz.
bestehen aus Weideland; 1888 zählte man 34,701 Ackerpferde,
217,728 Rinder 557,857 Schafe, 123,901 Schweine. Der Bergbau
Die Sonne.
Fig. 1. Die Sonne (photographiert von Rutherford).
Fig. 2. Sonnenflecke, beobachtet vom 10.-22. Mai 1868.
Fig. 4. Protuberanzen, beobachtet von Zöllner 1869.
Fig. 3. Totale Sonnenfinsternis am 18. Juni 1860, nach
Rümker, I-VI sind Koronastrahlen.
Fig. 5. Protuberanzen, beobachtet von Zöllner 1869.
Fig. 6. Protuberanzen, beobachtet von Secchi 1871.
21
Somerset (engl. Adelstitel).
liefert Steinkohlen, Eisen und Blei. Die Industrie erstreckt
sich auf die Herstellung von Tuch, Seide, Spitzen, Handschuhen,
Eisen und Stahl, Maschinen etc. Hauptstadt ist Taunton, die
größte Stadt aber Bath. -
2) Die nördlichste Niederlassung der britisch-austral.
Kolonie Queensland auf der Kap-York-Halbinsel, mit sicherm
Zufluchtshafen. Das früher hier bestehende
Regierungsetablissement wurde nach der Thursdayinsel und die hier
1872 errichtete Hauptstation der Londoner Missionsgesellschaft nach
der Murrayinsel (Neuguinea) verlegt.
Somerset (spr. ssómmersset) , engl. Adelstitel.
1397 erhielt das von den Plantagenets abstammende ältere Haus
Beaufort den Grafentitel und 1443 den Herzogstitel von S. Dies Haus
starb mit Edmund, dem vierten Herzog von S., der nach der Schlacht
bei Tewkesbury auf Eduards IV. Befehl enthauptet wurde, aus. Ein
natürlicher Sohn des dritten Herzogs Henry von S. nahm den
Familiennamen S. an, und dessen Nachkommen sind 1514 Grafen, 1642
Marquis von Worcester, 1682 aber wieder Herzöge von Beaufort
geworden, so daß die jüngern Söhne dieses
Herzogshauses Lords S. heißen. Unter ihnen ist hervorzuheben
Lord Granville Charles Henry S., geb. 27. Dez. 1792, unter
Liverpool Lord des Schatzes, unter Peel Domänenminister und
1841 Kanzler des Herzogtums Lancaster, gest. 23. Febr. 1848. Dessen
Oheim war Fitzroy James Henry S., später Lord Raglan (s. d.).
Den Titel Graf S. führte im 17. Jahrh. Robert Carr, Viscount
von Rochester, Graf von S., geb. 1590. Derselbe stammte aus einer
schottischen Adelsfamilie, kam als Page an den Hof Jakobs I.,
gewann durch seine Schönheit dessen Gunst, ward von ihm 3.
Nov. 1611 zum Viscount von Rochester erhoben und erhielt
großen Einfluß auf die britische Regierung. 1613
vermählte er sich mit Frances Howard, Gräfin von Essex,
deren Ehe mit dem Grafen von Essex zu diesem Zweck getrennt werden
mußte. Einen Gegner dieser Verbindung, Sir Thomas Overbury,
ließ der mächtige Günstling im Tower vergiften,
ward aber später durch George Villiers, nachmaligen Herzog von
Buckingham, aus des Königs Gunst verdrängt und samt
seiner Gemahlin als Mörder Overburys zum Tod verurteilt.
Nachdem beide mehrere Jahre im Gefängnis gesessen, woselbst S.
mit der Enthüllung von Geheimnissen drohte, die den König
kompromittieren würden, erhielten sie die Freiheit und lebten
seitdem in stiller Zurückgezogenheit. S. starb im Juli 1645.
Aus der Ehe seiner einzigen Tochter mit dem Herzog von Bedford
entsprang der unter Karl II. hingerichtete Lord William Russell (s.
d. 1). Schon im 16. Jahrh. war der Herzogstitel von S. an die
Familie Seymour (s. d.) gekommen. Der erste Herzog war Edward
Seymour. Derselbe erhielt bei der Vermählung Heinrichs VIII.
mit seiner Schwester Jane S. 1536 den Titel eines Viscount von
Beauchamp, wurde 1537 zum Grafen von Hertford ernannt, kämpfte
1544 in Schottland, verwüstete Leith und Edinburg und folgte
darauf dem König nach Frankreich, wo er Boulogne erobern half.
1547 ernannte ihn Heinrich VIII. zu einem der Geheimräte, die
während der Minderjährigkeit des jungen Eduard VI.,
seines Neffen, die Regierung führen sollten. Gleich in den
ersten Sitzungen des Geheimen Rats nach Heinrichs Tod ließ
sich aber Hertford zum Protektor des Königreichs und zum
Herzog von S. erheben und zugleich durch ein Patent des jungen
Königs die volle Regierungsgewalt übertragen. S. benutzte
seine Macht zuvörderst, um unter Cranmers Leitung die
Kirchenreformation durchzuführen. Dann unternahm er im August
1547 einen abermaligen Feldzug nach Schottland und brachte den
Schotten 10. Sept. die Niederlage bei Pinkey bei. Nach seiner
Rückkehr ließ er vom Parlament alle blutigen Gesetze
Heinrichs VIII. aufheben. Gleichwohl bildete sich allmählich
eine Partei gegen ihn, an deren Spitze die Grafen Southampton und
John Dudley, Graf von Warwick, später Herzog von
Northumberland, standen. Diesen Gegnern gelang es infolge des
Mißvergnügens über des Protektors kirchliche
Reformen und den Krieg mit Frankreich, in welchen sein schottischer
Feldzug die Nation verwickelte, den Herzog zu stürzen: der
Geheime Rat entschied sich gegen ihn, und S. wurde gefangen
gesetzt. Im November 1549 ward seine Sache vor das Parlament
gebracht, doch verurteilte ihn dieses bloß zu einer
Geldstrafe. Darauf trat S. wieder in den Rat ein; aber seine alte
Macht erlangte er nicht wieder, und seine Zerwürfnisse mit
Warwick dauerten trotz einer zwischen beiden geschlossenen
Familienverbindung fort. Nachdem sich Warwick des Königs
bemächtigt und die Staatsgewalt an sich gerissen, ließ
er S. 16. Okt. 1551 verhaften und beschuldigte denselben, ihm nach
dem Leben getrachtet und verräterische Anschläge auf die
Staatsgewalt gemacht zu haben. Von der Anklage des Verrats
freigesprochen, aber wegen Felonie verurteilt, da er einen Vasallen
des Königs habe ermorden wollen, ward S. 22. Jan. 1552 auf
Tower Hill enthauptet. Der Titel Herzog von S. erlosch darauf;
seine übrigen Titel und Güter hatte S. auf seine Kinder
zweiter Ehe übertragen lassen, nach deren Aussterben erst die
Nachkommenschaft aus erster Ehe folgen sollte. Sein Enkel William
Seymour ging 1610 eine heimliche Ehe mit Lady Arabella Stuart,
einer Verwandten König Jakobs I., ein und mußte deshalb
ins Ausland flüchten, während seine Gattin 1615 im Tower
starb. Gleichwohl bewies er sich nachmals als treuen Anhänger
der königlichen Sache, ward 1640 zum Marquis von Hertford
erhoben und 1660 nach Karls II. Restauration wieder mit dem Titel
eines Herzogs von S. ausgestattet. Er starb 24. Okt. 1660. Charles
Seymour, siebenter Herzog von S., geb. 12. Aug. 1662, spielte unter
Karl II., Wilhelm III., Anna und Georg I. als erster Peer des
Reichs eine hervorragende Rolle, trug durch seine Gemahlin, die
Erbin der Percy, wesentlich zum Sturz Marlboroughs bei, ward
Lord-Oberkammerherr und starb 2. Dez. 1748. Da sein einziger Sohn,
Algernon, achter Herzog von S., 7. Febr. 1750 ohne männliche
Nachkommen starb, trat jene frühere Klausel in Kraft, und die
Titel des Herzogs von S. und Lord Seymour gingen auf Sir Edward
Seymour, einen Nachkommen des Protektors aus erster Ehe, über,
welcher 15. Dez. 1757 starb. Dessen Urenkel Edward Adolphus, 12.
Herzog von S., geb. 20. Dez. 1804, trat 1834 für Totneß
ins Parlament. Als eifriger Whig ward er 1835 zum Lord des
Schatzes, 1839 zum Sekretär des indischen Amtes und 1841 auf
einige Zeit zum Unterstaatssekretär des Innern ernannt. Von
1849 bis Februar 1852 war er Oberkommissar der Wälder und
Forsten, zog sich aber durch Willkürlichkeiten viele Gegner zu
und wurde beim Wiedereintritt der Whigregierung 1855
übergangen, dagegen 1859 in das Whigministerium unter
Palmerston als erster Lord der Admiralität berufen, welches
Amt er bis 1866 verwaltete. Seitdem gehörte S. keiner
Regierung mehr an und starb 28. Nov. 1885 in London. Ihm folgte
sein Bruder Archibald (geb. 30. Dez. 1810) als 13. Herzog von
S.
22
Somersinseln - Somme.
Somersinseln (spr. ssömmers), s. Bermudas.
Somerville (spr. ssömmerwill), Stadt im
nordamerikan. Staat Massachusetts, dicht bei Cambridge und
Charlestown, und Wohnstadt von Boston, hat ein Irrenhaus und (1885)
29,992 Einw.
Somerville (spr. ssömmerwill), 1) William, engl.
Dichter, geb. 1677 (nicht 1692) zu Edston in Warwickshire, kam 1690
auf die Schule zu Winchester, wurde dann Fellow am New College zu
Oxford und lebte später als Friedensrichter auf dem von seinem
Vater ererbten Gut. Er starb am 19. Juli 1742. Sein Hauptwerk ist:
"The chace" (1735, mit kritischem Essay von Aikin 1796; neue Ausg.
1873), ein gefälliges didaktisch-deskriptives Gedicht in
reimlosen Versen, in welchen die Sportsmen besonders die
Sachkenntnis, die sich darin ausspricht, hervorheben. Seine "Works"
erschienen zu London 1742, 1776 u. öfter.
2) Mary, engl. Schriftstellerin im Fach der Physik und
Astronomie, Tochter des Vizeadmirals Sir William Fairfax, geb. 26.
Dez. 1780 zu Jedburg in Roxburghshire, wurde in der Nähe von
Edinburg erzogen und heiratete den Kapitän Samuel Greig, der
sie in den exakten Wissenschaften unterrichtete. Schon 1811 hatte
sie mehrere wissenschaftliche Probleme gelöst, 1826
veröffentlichte sie eine Arbeit über die magnetisierende
Kraft der Sonnenstrahlen; dann folgten unter dem Titel: "Mechanism
of the heavens" (Lond. 1831) eine Einleitung in das Studium der
Astronomie und "On the connexion of the physical sciences" (das.
1851; 10. Aufl., das. 1877), ihr Hauptwerk, welches wegen seiner
Tiefe und Klarheit außerordentlichen Beifall fand. S. wurde
1835 zum Mitglied der königlichen Gesellschaft der
wissenschaften ernannt. Sie vermählte sich nach dem Tod ihres
ersten Gatten mit dem Arzt William S., mit dem sie in London lebte.
1838 siedelte sie mit den Ihrigen nach Italien über, wo sie
1860 von neuem Witwe ward und 29. Nov. 1872 in Neapel starb. Von
ihren Werken sind noch die treffliche "Physical geography" (Lond.
1848, 2 Bde.; 7. Aufl. 1877; deutsch, Leipz. 1852) und "On the
molecular and microscopic science" (l869, 2 Bde.) zu erwähnen.
Vgl. ihre "Personal recollections from early life to old age"
(1873).
Somino (Ssomino), Flußhafen im russ. Gouvernement
Nowgorod, Kreis Ustjuschna, an der Somina, ist ein bedeutender
Stapelplatz, hauptsächlich für Getreide, Glas und
Metalle, wo alljährlich gegen 4000 Flußfahrzeuge
(Barken) ankommen und gegen 5000 abgehen.
Somma, 1) (S. Lombarda) Flecken in der ital. Provinz
Mailand, Kreis Gallarate, an der Simplonstraße und der
Eisenbahn von Mailand nach Arona, mit altem Kastell und (1881) 3422
Einw. Als Sehenswürdigkeit gilt eine uralte Cypresse von 28 m
Höhe.
2) (S. Vesuviana) Flecken in der ital. Provinz Neapel, am
nördlichen Abhang des Vesuvs, hat ein Schloß, Reste von
alten Stadtmauern, Weinbau und (1881) 4533 Einw. Hiernach ist auch
der nördliche Gipfel des Vesuvs "S." benannt.
Somma-Campagna, Dorf bei Custozza (s. d.).
Sommatino, Stadt in der ital. Provinz Caltanissetta, 368
m ü. M. auf einer Hochebene südlich von Caltanissetta
gelegen, mit Olivenkultur, Schwefelbergbau und (1881) 5375
Einw.
Sommation (franz.), die vor dem Zwangseinschreiten
erlassene Aufforderung oder gütliche Mahnung; diplomatisch s.
v. w. Ultimatum.
Somme (spr. ssomm, im Altertum Samara), Fluß im
nördlichen Frankreich, entspringt bei Font-S. unweit
St.-Quentin im Departement Aisne, fließt südwestlich,
wendet sich dann nordwestlich, tritt in das Departement S. ein,
wird bei Bray für kleinere, bei Amiens für
größere Fahrzeuge schiffbar und fällt nach einem
Laufe von 245 km unterhalb St.-Valéry mit breitem
Mündungsbecken in den Kanal (La Manche). Der Sommekanal
begleitet einen großen Teil ihres Laufs; außerdem steht
die S. noch durch den St.-Quentin-Kanal mit der Schelde und durch
den Crozatkanal mit der Oise in Verbindung.
Das Departement Somme, gebildet aus den ehemals zur Picardie
gehörigen Landschaften Santerre, Amiénais, Vimeux,
Ponthieu, Vermandois und Marquenterre, grenzt nördlich an das
Departement Pas de Calais, nordöstlich an das Departement
Nord, östlich an Aisne, südlich an Oise, südwestlich
an Niederseine, westlich an den Kanal (La Manche) und umfaßt
6161 qkm (111,89 QM.). Das Departement gehört zu den
fruchtbarsten des nördlichen Frankreich; es bildet eine weite,
nur gegen die Küste hin sandige Ebene, die sich namentlich um
den Sommebusen allmählich durch Anschwemmungen und
Eindeichungen vergrößert hat und noch
vergrößert; nur im SO. ist das Land von einzelnen
Ausläufern der Ardennen durchzogen. Bewässert wird das
Departement von der Authie, Maye, Somme mit ihren Nebenflüssen
und der Bresle. Das Klima ist kühl und feucht, im allgemeinen
aber gesund. Die Bevölkerung belief sich 1886 auf 548,982
Einw. und hat seit 25 Jahren um 24,000 Seelen abgenommen. Von der
Oberfläche kamen 1882 auf Äcker und Gärten 499,714
Hektar, Wiesen 21,596, Wälder 39,449, Heiden und Weiden 5553
Hektar. Der hoch entwickelte Ackerbau liefert Getreide über
den Bedarf (jährlich 7-8 Mill. hl), besonders: Weizen (2,8
Mill. hl), Hafer (3,4 Mill. hl), Halbfrucht, Gerste und Roggen,
Kartoffeln, viel Hülsenfrüchte, Gemüse, Hanf,
Flachs, Raps, andere Ölpflanzen und Zuckerrüben. Sehr
bedeutend ist ferner die Torfgewinnung (85,500 Ton.). Geringere
Ausdehnung hat die Viehzucht; doch ist die Zahl der Pferde (1882:
77,590), der Schafe (423,948) und namentlich des Geflügels
(1,8 Mill. Stück) immerhin ansehnlich. Einen
größern Holzbestand bildet nur der Wald von Crécy
im NW. Die Industrie ist sehr lebhaft. Ihre vorzüglichsten
Zweige sind die Spinnerei und zwar in Wolle (125,000 Spindeln),
Baumwolle (75,000 Spindeln), Flachs und Hanf (50,600 Spindeln) und
Seide (18,000 Spindeln) nebst der Schafwollkämmerei und
Zwirnerei; außerdem die Weberei (3400 mechanische und 10,500
Handstühle), insbesondere die Erzeugung von sogen. Articles
d'Amiens (Gewebe aus verschiedenen Stoffen), Tuch (besonders zu
Abbeville), Baumwollsamt, Teppichen etc. Neben der Textilindustrie
ist besonders wichtig die Rübenzuckerfabrikation (69
Etablissements mit 6600 Arbeitern, Produktion 970,000 metr. Ztr.);
ferner sind zu nennen die Eisengießerei, die Erzeugung von
Schlosserwaren und Maschinen, Seife, Kerzen, chemischen Produkten,
Papier, Bier und Branntwein. Von geringerer Wichtigkeit dagegen ist
der Handel, namentlich der Seehandel, da es dem Departement an
guten Häfen fehlt; er erstreckt sich auf die einheimischen
Ackerbau- und Industrieprodukte in der Ausfuhr, Wein, Holz, Kohlen
etc. in der Einfuhr. Das Departement wird von der Nordbahn
(Paris-Brüssel) durchschnitten, die hier von Amiens nach
Beauvais, Rouen, Abbeville, St.-Valéry, Tréport,
Boulogne und Doullens sowie nach Laon abzweigt. Es zerfällt in
fünf Arrondissement Abbeville, Amiens, Doullens, Montdidier
und Péronne. Hauptstadt ist Amiens.
23
Sommer - Sommersprossen.
Sommer, die Jahreszeit zwischen Frühling und Herbst,
astronomisch die Zeit vom längsten Tag bis zum darauf
folgenden Äquinoktium. Auf der nördlichen Halbkugel der
Erde beginnt der S., wenn die Sonne den Wendekreis des Krebses und
damit ihre größte nördliche Abweichung vom
Äquator erreicht hat (Sommersonnenwende, 21. oder 22. Juni),
und endet, wenn die Sonne auf ihrem Rückgang wieder den
Äquator erreicht hat (Herbstäquinoktium, 22. oder 23.
Sept.). Der S. der südlichen Hemisphäre dagegen
fällt auf unsern Winter und umfaßt den Zeitraum,
während dessen die Sonne von ihrer größten
südlichen Abweichung vom Äquator, also vom Wendekreis des
Steinbocks (Wintersonnenwende, 21. oder 22. Dez.), wieder zum
Äquator zurückkehrt (Frühlingsäquinoktium, 20.
oder 21. März). Auf der nördlichen Halbkugel ist der S.
um einige Tage länger als auf der südlichen, was davon
herrührt, daß die Erde während unsers
Frühlings und Sommers die von der Sonne entferntere
Hälfte ihrer Bahn durchläuft, in welcher, dem zweiten
Keplerschen Gesetz zufolge, ihre Geschwindigkeit eine geringere
ist. Der höhere Stand der Sonne, der ein mehr senkrechtes
Auftreffen der Strahlen bewirkt, sowie die längere Dauer des
Verweilens der Sonne über dem Horizont bewirken, daß
trotz des größern Abstandes der Sonne unser S.
wärmer ist als unser Winter; der Einfluß der
verschiedenen Entfernung der Sonne ist in Bezug auf die durch sie
bewirkte Erwärmung nicht bedeutend und wird erst merklich bei
Vergleichung der S. beider Hemisphären. Infolge der
stärkern Bestrahlung während des Sommers der
Südhalbkugel ist z. B. in Australien und Neuseeland
während des Sommers der Wechsel, wenn man aus dem Schatten in
die Sonne tritt, fühlbarer als bei uns. Im meteorologischen
Sinn rechnet man den S. bei uns vom 1. Juni bis 1. Sept., auf der
Südhalbkugel vom 1. Dez. bis 1. März. Die
größte Sommerwärme tritt etwa einen Monat nach dem
längsten Tag und zwar erst dann ein, wenn die Erwärmung
durch die Sonnenstrahlen gleich der Abkühlung durch die
Wärmeausstrahlung geworden ist. Daher ist der Juli der
wärmste Monat auf der nördlichen und der Januar auf der
südlichen Halbkugel, und damit dieser wärmste Monat in
die Mitte des Sommers fällt, ist die oben angegebene
Begrenzung desselben erforderlich. Vgl. Jahreszeiten.
Sommer, 1) Anton, thüring. Dialektdichter, geb. 11.
Dez. 1816 zu Rudolstadt, studierte 1835-38 in Jena Theologie,
übernahm 1847 die Leitung einer Töchterschule in seiner
Vaterstadt und daneben das Pfarramt zu Schaala und wurde 1864 zum
Garnisonprediger in Rudolstadt ernannt, wo er, halb erblindet und
seit 1881 Ehrenbürger, 1. Juni 1888 starb. Seine
gemütvollen "Bilder und Klänge aus Rudolstadt in
Volksmundart" (11. Aufl., Rudolst. 1886, 2 Bde.) haben vielen
Beifall gefunden.
2) Otto, Pseudonym, s. Möller 3).
Sommercypresse, s. Chenopodium.
Sömmerda, Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Erfurt, Kreis Weißensee, an der Unstrut, Knotenpunkt der
Linie Sangerhausen-Erfurt der Preußischen Staatsbahn u. der
Eisenbahn Großheringen-Straußfurt, 160 m ü. M.,
hat 2 evangelische und eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, Gewehr-,
Munitions-, Zündhütchen- und Eisenwarenfabrikation,
Eisengießerei und (1885) 4795 meist evang. Einwohner. S. war
Geburtsort und Wohnsitz von Dreyse (s. d.).
Sommerendivien, s. Lattich.
Sommerfäden, s. v. w. Alterweibersommer.
Sommerfeld, Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Frankfurt, Kreis Krossen, an der Lubis, Knotenpunkt der Linien
Berlin-S., S.-Breslau und S.-Liegnitz der Preußischen
Staatsbahn, 82 m ü. M., besteht aus der Stadt, 2
Vorstädten (Schönfeld und Hinkau) und 3 Kolonien (Karras,
Bornstadt und Klinge), hat 2 evang. Kirchen, ein Schloß, ein
Rettungshaus, ein Amtsgericht, eine Reichsbanknebenstelle,
bedeutende Tuchfabrikation, eine Hutfabrik, eine mechanische
Bandweberei, 3 Dampffärbereien, 2 Maschinenbauanstalten, eine
Flachsgarnspinnerei, Appretur- u. Karbonisieranstalten, Ziegeleien,
eine Ofenfabrik, Dampfschneidemühlen, Bierbrauereien u. (1885)
11,362 meist ev. Einw.
Sommerfrischen, die im Sommer zu benutzenden klimatischen
Kurorte (s. d.).
Sommergewächse, einjährige Pflanzen, s.
Einjährig.
Sommerkatarrh (Catarrhus aestivus), s. Heufieber.
Sommerkleid, s. Vögel.
Sommerkönig, Vogel, s. Laubsänger und
Goldhähnchen.
Sommerpappel, s. Lavatera.
Sommerpunkt, s. v. w. Sommersolstitium, s.
Sonnenwenden.
Sömmerring, Samuel Thomas von, Mediziner, geb. 28.
Jan. 1755 zu Thorn, studierte seit 1774 in Göttingen, ward
1778 Professor der Anatomie in Kassel, 1784 in Mainz, praktizierte
seit 1798 in Frankfurt a. M., wurde 1805 königlicher Leibarzt
in München, dann Geheimrat und in den Adelstand erhoben. 1820
kehrte er nach Frankfurt zurück, wo er 2. März 1830
starb. Seine Untersuchungen über Gehirn- und Nervensystem,
über die Sinnesorgane, über den Embryo und seine
Mißbildungen, über den Bau der Lungen, über die
Brüche etc. stellen ihn in die Reihe der ersten deutschen
Anatomen. Er konstruierte auch 1809 einen elektrischen Telegraphen,
bei welchem die Zeichen durch galvanische Zersetzung von Wasser
gegeben werden sollten, arbeitete über die Veredelung des
Weins, über die Zeichnungen, welche sich bei der Ätzung
des Meteoreisens auf demselben bilden, über die Sonnenflecke
etc. Er schrieb: "Vom Hirn- und Rückenmark" (Mainz 1788, 2.
Aufl. 1792); "Vom Bau des menschlichen Körpers" (Frankf.
1791-96, 6 Bde.; 2. Aufl. 1800; neue Aufl. von Bischoff, Henle u.
a., Leipz. 1839-45, 8 Bde.); "De corporis humani fabrica" (Frankf.
1794-1801, 6 Bde.); "De morbis vasorum absorbentium corporis
humani" (das. 1795); "Tabula sceleti feminini" (das. 1798);
"Abbildungen des menschlichen Auges" (das. 1801), "des menschlichen
Hörorgans" (das.1806), "des menschlichen Organs des Geschmacks
und der Stimme" (das. 1806), "der menschlichen Organe des Geruchs"
(1809). Sömmerrings Briefwechsel mit Georg Forster wurde von
Hettner (Braunschw. 1878) herausgegeben. Vgl. R. Wagner,
Sömmerrings Leben und Verkehr mit Zeitgenossen (Leipz.
1844).
Sommerschlaf s. Winterschlaf.
Sommersolstitium, s. Sonnenwenden.
Sommersporen, s. Pilze, S. 66, und Rostpilze, S. 989.
Sommersprossen (Sommerflecke, Ephelides), kleine,
rundliche, bräunliche Flecke, welche sich namentlich bei
blonden und rothaarigen Menschen, unter der Einwirkung des
Sonnenlichts und der Sonnenwärme, der Feuchtigkeit und des
Windes an den unbedeckten Stellen der Haut bilden. Die S. beruhen
auf der Ablagerung eines bräunlichen Pigments in den
oberflächlichen Hautschichten. Während des Win-
24
Sommerthürchen - Son.
ters blassen sie ab oder verschwinden auch ganz. Durch Mittel,
welche eine Abstoßung der Epidermis mit Einschluß ihrer
tiefern pigmenthaltigen Schichten bewirken, kann man die S.
vertreiben; sie kehren aber nach wenigen Wochen wieder, wenn die
Haut von neuem den erwähnten Schädlichkeiten ausgesetzt
wird. Auf diese Weise wirken die Lilionese und Umschläge mit
einprozentiger Lösung von Sublimat (Quecksilberchlorid,
höchst giftig!). Man läßt diese Umschläge nur
einige Stunden lang wirken und sorgt dafür, daß die mit
der Sublimatlösung befeuchteten Leinwandläppchen keine
Falten schlagen. Zeigt sich die Haut hiernach stärker
entzündet, so bedeckt man sie mit in Öl getränkten
Kompressen.
Sommerthürchen, Pflanze, s. Leucojum.
Sommertuch, s. Halbtuch.
Sommerwal, s. Finnfisch.
Sommerwurz, s. Orobranche.
Sommières (spr. ssommjähr), Stadt im franz.
Departement Gard, Arrondissement Nîmes, am Vidourle und an
der Eisenbahnlinie Lunel-Le Vigan (mit Abzweigung nach Nimes und
Les Mazes), hat ein altes Schloß, eine Brücke mit Turm,
eine reformierte Konsistorialkirche, Fabrikation von Likör,
Essenzen, Decken, Wollenstoffen, Hüten etc. und (1881) 3644
Einw.
Sommitäten (franz.), die Höchsten,
Vornehmsten.
Somnambulismus (lat.), im engern Sinn das "Umherwandeln
im Schlaf", das Schlafwandeln; dann das habituell gewordene, dem
Anschein nach mit Überlegung vor sich gehende, in Wahrheit
aber nur traumbewußte Verrichten von Handlungen während
des Schlafs, das Schlafhandeln; gewöhnlich rechnet man zum S.
auch diejenigen meist auf Selbsttäuschung oder Betrug
beruhenden Fälle, in welchen gewisse Personen Dinge oder
Ereignisse wahrzunehmen glauben oder vorgeben, welche mittels
gesunder Sinne nicht wahrzunehmen sind (das Hellsehen,
clairvoyance); endlich auch die Gesamtheit der noch vielfach
problematischen Erscheinungen des sogen. tierischen Magnetismus (s.
Magnetische Kuren und Hypnotismus). Die beiden ersten Arten des S.,
welche man gewöhnlich als Nachtwandeln bezeichnet,
charakterisieren sich besonders dadurch, daß bei mangelndem
klaren Bewußtsein Handlungen vorgenommen werden, welche den
Schein der Willkürlichkeit und Zweckmäßigkeit an
sich tragen. Das Nachtwandeln nimmt niemals einen tödlichen
Ausgang und stört den Fortgang der Körperentwickelung
nicht auf eine erhebliche Weise. Beim Traum wie beim Nachtwandeln
ist das dämmernde Selbstbewußtsein der Mittelpunkt,
worin sich die dunkeln und verworrenen Empfindungen der Sinne und
des Gemeingefühls, wenn nämlich solche noch zur
Wahrnehmung kommen, sammeln, während Reihen von Vorstellungen
und Willensantrieben auftreten, welche zu den mannigfaltigsten,
ihnen entsprechenden Bewegungen der Glieder sowie zu einem
völlig artikulierten und zusammenhängenden Sprechen
Veranlassung geben. Nur die höchsten Grade dieser
Erscheinungen kommen aber hier in Betracht, insofern bei ihnen die
charakteristischen Bedingungen des Schlafs nicht mehr vorhanden zu
sein scheinen. Dahin ist vor allem zu rechnen, daß die
Nachtwandler ungeachtet der größten Anstrengung beim
Erklettern von Fenstern, Dächern etc. nicht erwachen, was doch
der Fall sein würde, wenn bei ihnen, wie beim
gewöhnlichen Schlaf, die Fähigkeit zur Empfindung und
Bewegung in gleichem Maß ab- und zunähme. Vielmehr geben
sie bei äußerer ordentlicher Bethätigung ihres
ganzen Muskelsystems zuweilen eine so gänzliche
Empfindungslosigkeit kund, daß weder das stärkste Licht,
noch der Schall von lärmenden Instrumenten, noch die
schärfsten Gerüche, noch Verletzungen der Haut den
geringsten Eindruck auf sie machen. Auch haben die Reden des
Nachtwandlers nicht jenen Charakter der Zerfahrenheit und des
Unzusammenhängenden wie die des Träumenden, sondern meist
logischen Zusammenhang und bewegen sich, wie seine Handlungen,
größtenteils im Kreis früherer Erinnerungen. Nach
dem bisherigen Stand unsers Wissens unerklärlich ist der
angebliche, im Volksmund allgemein behauptete Einfluß des
Mondes auf die Nachtwandler, welcher zu der Bezeichnung Mondsucht
(Lunatismus) Veranlassung gegeben hat. Die oft erzählten Sagen
von Mondsüchtigen, welche auf Bäume, Dächer und
Türme gleichsam dem Mond entgegengeklettert seien etc., sind
noch zu wenig beglaubigt, als daß man sie unbedenklich gelten
lassen könnte. Erwähnung verdient noch, daß die
Nachtwandler ihre Bewegungen auch auf gefährlichen Wegen mit
der größten Sicherheit ausführen sollen, wobei das
Freibleiben von Schwindel eine wirksame Unterstützung
gewähren mag. Da das Nachtwandeln gewöhnlich einen
völlig konstitutionellen Zustand darstellt, welcher als
solcher das Individuum Jahrzehnte behaften kann, so läßt
es sich höchstens durch kräftige diätetische
Maßregeln mit einigem Erfolg bekämpfen. Zu letztern
würden vor allem angemessene Körperanstrengungen, um
einen möglichst festen und tiefen Schlaf zu bewirken, und
Vermeidung aller das Nervensystem stärker aufregenden
psychischen und physischen Reize, z. B. allzu reichliche
Abendmahlzeiten, zu rechnen sein. Entschieden abzuraten ist von den
gebräuchlichen Gewaltmitteln, wie z. B. den vor das Bett
gestellten Wassergefäßen, Prügeln u. dgl.
Jedenfalls hat man die Nachtwandler unter eine angemessene Aufsicht
zu stellen, damit sie in ihren Paroxysmen weder sich noch andern
Schaden zufügen können. Vgl. Magnetische Kuren.
Somnium (lat.), Traum.
Somnolénz (lat.), Schläfrigkeit,
schlafsüchtiger Zustand, leichtester Grad von
Betäubtheit.
Somnus (lat.), Gott des Schlafs, s. Hypnos.
Somogy (spr. schómodj, Sümeg), Komitat in
Ungarn, am rechten Donauufer zwischen dem Plattensee und der Drau,
hat 6531 qkm (118,6 QM.) Areal mit (1881) 307,448 meist
ungarischen, kath. Einwohnern. Es wird von zahlreichen kleinen
Flüssen bewässert, ist sehr fruchtbar und im Süden
an der Drau teilweise sumpfig; 1/3 des Gebiets bedeckt Wald. Sitz
des Komitats, das nach dem alten Schlosse Somogyvár benannt
ist und von der Donau-Draubahn, der Linie
Stuhlweißenburg-Kanizsa und der Fünfkirchen-Barcser Bahn
durchschnitten wird, ist Kaposvár.
Somorrostro, kleiner Ort in der span. Provinz Viscaya,
10km nordwestlich von Bilbao, berühmt wegen seiner reichen
Eisenminen.
Somosierra, Dorf in der span. Provinz Madrid, am
Südabhang des gleichnamigen Gebirges (Fortsetzung der Sierra
de Guadarrama), historisch merkwürdig durch das siegreiche
Gefecht Napoleons I. gegen die Spanier 30. Nov. 1808.
Somvix ("Oberdorf", rätoroman. Sumvigel), Ort im
schweizer. Kanton Graubünden, am Vorderrhein, 880 m ü. M.
gelegen, zum Bezirk Vorderrhein gehörig, mit (1880) 1235 Einw.
Gegenüber öffnet sich das alpine, vom Somvixer Rhein
durchströmte Val S. in das Hauptthal; es bildet den Zugang zu
dem (nicht fahrbaren) Paß Greina.
Son (Sona), Fluß in Britisch-Indien, entspringt in
Zentralindien am Gebirgsstock des Amarkantak
25
Sonate.
und fließt in nordöstlicher Richtung dem Ganges zu,
den er oberhalb Patna nach einem Laufe von 748 km erreicht. Im
Unterlauf ist er schiffbar und seit 1871 durch einen bei Dehri
vollendeten Querdamm, wodurch fünf Kanäle gespeist
werden, zur künstlichen Überflutung seiner Ufer
eingerichtet.
Sonate (ital. sonata, suonata), ein in der Regel aus drei
oder vier abgeschlossenen, aber durch innere Verwandtschaft unter
sich verbundenen Sätzen bestehendes Tonwerk von ganz
bestimmter Form, zunächst für ein Soloinstrument,
namentlich Klavier, Cello, Flöte, Violine, Orgel etc.,
bestimmt, jedoch, als Duo, Trio, Quartett etc., auch auf mehrere
Instrumente und, als Symphonie, sogar auf großes Orchester
übertragen. Der erste Satz ist der speziell für die S.
charakteristische und sie von der Suite, Serenade etc.
unterscheidende; seine Form ist die darum speziell so genannte
Sonatenform. Er beginnt entweder mit einer langsamen Einleitung
(Grave, Largo) oder gleich mit dem Hauptthema (Hauptsatz) in
bewegtem Tempo (Allegro), von welchem geschlossene, modulierende
(nicht in allzufern liegende Tonarten ausschweifende) Gänge
zum zweiten Thema (Nebensatz, Seitensatz) überleiten, das zwar
in gleichem Tempo, aber in längern Notenwerten, gesangartiger
gehalten ist. Steht der Hauptsatz in Dur, so pflegt der Seitensatz
auf der Tonart der Dominante zu stehen; steht er in Moll, so kommt
die Parallel-Durtonart oder Durtonart der kleinen Sexte (z. B. bei
A moll: F dur) oder auch eine verwandte Molltonart in Anwendung.
Entweder schließt nun der erste Teil hiermit ab, oder es
folgt noch ein kleiner Schlußsatz, der zum ersten Thema
zurückführt. Die Repetition (Reprise) der den ersten Teil
des Sonatensatzes konstituierenden Themata ist durchaus für
die Form charakteristisch, und Abweichungen sind selten und
bedeuten ein Zerbrechen der Form (Beethoven). Der nun folgende
zweite Teil (Durchführungssatz) besteht ausschließlich
in Verarbeitung des vorausgegangenen thematischen Materials (selten
bringt er noch ein selbständiges Thema) und leitet ohne
Wiederholung durch den sogen. Rückgang zum dritten Teil
über. Dieser bringt wieder das Hauptthema in der Haupttonart,
führt jedoch diesmal (mit oder ohne Gang) den Seitensatz und
etwanigen Schlußsatz gleichfalls in der Haupttonart oder
gleichnamigen Molltonart ein und beschließt entweder hiermit
das Tonstück, oder es folgt ihm noch ein besonderer Anhang
(coda), der hier meistens etwas länger ausgeführt ist als
im ersten Teil. Bildungen wie die der ersten Sätze der sogen.
Mondscheinsonate (Op. 27, Cis moll) oder der As dur-Sonate (Op. 26)
von Beethoven haben mit diesem Schema nichts zu thun. Beiden
Sonaten fehlt der eigentliche erste Satz; sie beginnen mit dem
langsamen, der in der Regel der zweite ist. Charakteristikum des
zweiten Satzes ist die langsame Bewegung (nur ausnahmsweise
vertauschen der langsame Satz und das gleich zu besprechende
Scherzo ihren Platz). Seine Form kann eine sehr verschiedenartige
sein. Ist er wie der erste mit zwei kontrastiernden Themata
ausgestattet, so ist das bewegtere das zweite; die Reprise und
Durchführung fallen weg, dagegen erscheint gern das Hauptthema
dreimal, meist mit immer gesteigerter Figuration. Oft begnügt
sich der Tonsetzer mit der Liedform, d. h. der Themataordnung
I-II-I. Sehr beliebt ist auch die Variationenform für den
zweiten Satz. Die Tonart des zweiten Satzes ist meist die der
Unterdominante. Der dritte Satz bringt Menuett oder Scherzo,
gewöhnlich wieder in der Haupt- oder doch in einer eng
verwandten Tonart. In ältern Sonaten fehlt Menuett oder
Scherzo gänzlich, so daß man gleich vom zweiten zum
letzten Satz, dem Finale, gelangt. Dieser steht bei
durchschnittlich schneller Bewegung immer in der Haupttonart,
verwandelt sie aber nicht selten aus Moll in Dur. Seine Form ist
entweder die Sonatenform, in der Regel ohne Reprise, aber mit
Durchführung, oder eine weit ausgesponnene Rondoform mit mehr
als zwei meist kurzen Themata. In seltenen Fällen läuft
er in eine Fuge aus. Beethoven handhabt die Form sehr frei und
beschränkt sich manchmal auf nur zwei Sätze und zwar
nicht nur in der kleinen S. (Sonatine), bei der das fast die Regel
ist, sondern auch in groß und ernst angelegten Werken (Op.
53, 54, 78, 90, 101, 111).
Geschichte. Sonata ("Klingstück") ist ursprünglich, d.
h. als die Anfänge einer selbständigen Instrumentalmusik
sich entwickelten (gegen Ende des 15. Jahrh.), eine ganz allgemeine
Bezeichnung für Instrumentalstücke und der Gegensatz von
Cantata ("Singstück"). Die ältesten Komponisten, welche
den Namen S. gebrauchten, waren Giovanni Croce (1580) und Andrea
Gabrieli, dessen "S. a 5 istromenti" (1586) leider nicht mehr zu
finden sind. Dagegen sind uns einige Sonaten von seinem Neffen
Giovanni Gabrieli erhalten (I597 und 1615). Diese ältesten
Sonaten sind Stücke für mehrere Instrumente (Violinen,
Violen, Zinken und Posaunen), und ihr Schwerpunkt liegt in der
Entfaltung harmonischer Fülle. Ihre praktische Bestimmung war
die, einem kirchlichen Gesangswerk als Einleitung vorausgeschickt
zu werden, die S. tritt in der Folge (völlig gleichbedeutend
mit Symphonia) als Einleitung der Kantate auf. Gegen Ende des 17.
Jahrh. begann man die Sonata da chiesa (Kirchensonate) von der
Sonata da camera (Kammersonate) zu unterscheiden. Die letztere
schied die Blasinstrumente aus und wurde schließlich die
Prärogative der Violine (Biber, Corelli), ja die alte Art der
für die Kirche bestimmten S. wurde gleichfalls nach Art der
Kammersonate zugestutzt und nur, statt mit Cembalo, mit der Orgel
begleitet. Neben beiden bestand die vielstimmige, besonders mit
Blasinstrumenten besetzte S. fort für Tafelmusik und
ähnliche weltliche Bestimmungen. Diese Sonaten, auch die
Corellischen und Biberschen, haben mit der neuern Sonatenform noch
wenig mehr gemeinsam als die Zusammensetzung aus mehreren Teilen
von verschiedener Bewegungsart, welche bereits I. Gabrieli seinen
letzten Sonaten gegeben hatte. Corelli schrieb sie viersätzig:
Adagio, Allegro, Adagio, Allegro. Die Übertragung des Namens
S. auf Klavierwerke ähnlicher Gestaltung ist das Werk Johann
Kuhnaus (s. d.). Die letzte Vollendung der Form der S., namentlich
ihres charakteristischen ersten Satzes, erfolgte durch Domenico
Scarlatti, J. S. Bach, Philipp Emanuel Bach, Joseph Haydn, Mozart
und Beethoven. Die Umbildung des Stils der S. ist nichts derselben
Eigentümliches, sondern geht parallel mit der Entwickelung der
Instrumentalmusik und insbesondere des Klavierstils überhaupt,
welcher nach J. S. Bach allgemein, aber schon früher in
ziemlich ausgedehntem Maß eine freiere (homophone) Setzweise
erfuhr. Die Form der S. wurde durch Haydn, Mozart und Beethoven auf
die Komposition für verschiedene Ensembles (Violine und
Klavier, Klavier, Violine und Cello, Streichtrio, Streichquartett
etc.) und für Orchester (Symphonie) übertragen. Nach
Beethoven haben die Form der S. mit besonderm Glück Franz
Schubert, Mendelsohn, Rob. Schumann und in neuester Zeit Johannes
Brahms, Joachim Raff, Anton Rubinstein, I. Rhein-
26
Sonatine - Sonett.
berger und Robert Volkmann behandelt. Vgl. Marx,
Kompositionslehre, Tl. 3 (5. Aufl., Leipz. 1868); Faißt,
Beiträge zur Geschichte der Klaviersonate (in der
"Cäcilia", Bd. 25 u. 26, Mainz 1847); Bagge, Geschichtliche
Entwickelung der S. (Leipz. 1880).
Sonatine, s. v. w. kleine Sonate, leichtverständlich
und leicht zu spielen; der erste Satz der S. hat entweder keine
oder nur eine sehr kurze Durchführung, die Zahl der Sätze
ist meist 2 oder 3 (vgl. Sonate).
Soncino (spr. ssontschino), Dorf in der ital. Provinz
Cremona, Kreis Crema, unweit des Oglio, hat ein altes Schloß,
bekannt durch die Gefangenschaft und den Tod (1259) des
Statthalters Ezzelino, Seidenbau und (1881) 3965 Einw.
Sond., bei botan. Namen Abkürzung für W.
Sonder, Apotheker in Hamburg (Algen, Kapflora).
Sonde (Specillum), dünnes, rundes, 12-28 cm langes
Stäbchen, gewöhnlich aus Stahl oder Silber, an der Spitze
abgerundet oder mit einem Knöpfchen oder Öhr versehen,
dient zur Untersuchung von Wunden, Geschwüren etc., zum
Einbringen von Scharpie oder Fäden oder als Leitungswerkzeug
für schneidende Instrumente, in welchem Fall es der Länge
nach gefurcht oder gerinnt ist (Hohlsonde). Im Seewesen ist S. s.
v. w. Senkblei.
Sonderbund, der Bund der sechs ultramontanen Kantone der
Schweiz (1845), der 1847 den Sonderbundskrieg zur Folge hatte. S.
Schweiz, S. 762.
Sonderburg, Kreisstadt in der preuß. Provinz
Schleswig-Holstein, auf der Insel Alsen und am Alsensund, über
welchen eine Schiffbrücke zum Festland führt, hat eine
evang. Kirche, ein Schloß, ein Realprogymnasium, ein
Amtsgericht, Eisengießereien, Dampfmahlmühlen,
Färbereien, ein Seebad, einen guten Hafen und (1885) mit der
Garnison (ein Füsilierbataillon Nr. 86) 5266 fast nur evang.
Einwohner. - S. war schon 1253 vorhanden, brannte 1864 während
der Belagerung der Düppeler Schanzen teilweise nieder und fiel
29. Juni d. J. mit dem Übergang der Preußen nach Alsen
in deren Hände. Die Festungswerke sind neuerdings aufgegeben.
Nach S. wird die apanagierte Linie der Herzöge von S. benannt
(s. Schleswig-Holstein, S. 524).
Sondereigen, gesondertes Privateigentum im Gegensatz zum
gemeinschaftlichen oder Gemeineigen.
Sondergut (Einhands-, Rezeptiziengut), das Vermögen
der Ehefrau, welches sie sich zur freien Verfügung
vorbehält (s. Güterrecht etc., S. 949).
Sonderland, Johann Baptist, Maler und Radierer, geb. 2.
Febr. 1805 zu Düsseldorf und an der Akademie daselbst sowie
auf Studienreisen in Paris, Holland und Frankfurt a. M. gebildet,
zeichnete sich in seinen Genrebildern durch Reichtum der Erfindung,
Lebendigkeit der Darstellung und naiven Humor aus. Unter dem Titel:
"Bilder und Randzeichnungen zu deutschen Dichtern" fertigte er eine
große Anzahl radierter Blätter sowie auch die
Illustrationen zu Reinicks "Malerliedern", zu "Münchhausen"
von Immermann etc. In den letzten Jahren seines Lebens wandte er
sich ausschließlich der Illustration zu und schuf eine
große Zahl von Aquarellkompositionen, Lithographien nach
eignen und fremden Originalen, Randzeichnungen etc. Er starb 21.
Juli 1878. Sein Sohn Friedrich S., geb. 20. Sept. 1836 zu
Düsseldorf ist ebenfalls ein begabter Maler, der besonders im
humoristischen Genre hervorragend ist.
Sonderling, Schmetterling, s. Aprikosenspinner.
Sondernachfolge, s. Rechtsnachfolge.
Sondershausen, Haupt- und Residenzstadt des
Fürstentums Schwarzburg-S., in der sogen. Unterherrschaft, am
Fuß der Hainleite, an der Wipper und der Linie
Nordhausen-Erfurt der Preußischen Staatsbahn, hat 3 Kirchen,
ein ansehnliches Residenzschloß mit Antiquitäten- und
Naturaliensammlung und schönem Garten, ein Gymnasium, eine
Realschule, ein Schullehrerseminar, ein Konservatorium, ein
Theater, ein Zeughaus, ein Landeskrankenhaus, Nadelfabrikation, 2
Dampfziegeleien, eine Dampfschneidemühle und (1885) 6336 meist
evang. Einwohner. S. ist Sitz der obersten Landesbehörden,
eines Landratsamtes und eines Amtsgerichts. Vor der Stadt liegt das
Loh, ein Vergnügungsort, und unweit von S. auf der Hainleite
das Jagdschloß Possen (s. d.).
Sondersieche, s. v. w. Aussätzige, s. Aussatz, S.
127.
Sondieren, mit dem Senkblei (Sonde) die Tiefe
ergründen; ausforschen, prüfen.
Sondrio, ital. Provinz im N. der Lombardei, begreift
großenteils das bis 1797 zu Graubünden gehörige
Veltlin, wird im N. von der Schweiz, im O. von Tirol und der
Provinz Brescia, im Süden von Bergamo und im W. von Como
begrenzt und umfaßt 3268, nach Strelbitsky 3123 qkm (56,7
QM.) mit (1881) 120,534 Einw. Das Land besteht der Hauptsache nach
aus den Thälern der obern Adda und der Mera, welche von
mehreren Gebirgsgruppen der Alpen (Bernina-, Ortler- und
Bergamasker Alpen) flankiert werden. Über das Gebirge
führen im W. der Splügen, im O. das Stilfser Joch; auch
münden hier die Straßen über den Maloja- und
Berninapaß. Der Boden ist großenteils Weide und Wald
(57,538 Hektar); das bebaute Land bringt Wein (1886: 119,200 hl,
doch gute Sorten), etwas Getreide, viel Kartoffeln, Obst etc.
hervor; das Mineralreich liefert Eisen, Blei und andre Metalle und
Mineralien. Neben dem sehr beschränkten Ackerbau, der Vieh-
und Seidenzucht und Holzgewinnung wird etwas Industrie
(Seidenfilanden, Baumwollspinnerei, Metallindustrie) und Handel
betrieben. Durch die Eisenbahnen Colico-Sondrio und
Colico-Chiavenna in Verbindung mit der Dampfschiffahrt am Comersee
ist die Provinz in neuester Zeit dem Weltverkehr näher
gerückt worden. Von Bedeutung sind endlich die ausgezeichneten
Mineralquellen (vor allen die zu Bormio). Doch genügen die
vorhandenen Erwerbsquellen nicht, so daß viele Bewohner
alljährlich auswärts Beschäftigung suchen
müssen. Die gleichnamige Hauptstadt, malerisch an der
Mündung des Mallero in die Adda und an der Bahn Colico-S.
gelegen, hat ein königliches Lyceum und Gymnasium, eine
technische Schule, ein Gewerbeinstitut, eine städtische
Bibliothek, ein Nationalkonvikt, ein großes Krankenhaus, ein
schönes Theater, ein ehemaliges Kloster (jetzt
Traubenkuranstalt), Ruinen eines Schlosses, Seidenindustrie,
Töpferei (aus dem im Val Malenco gebrochenen Lavezstein),
Handel und (1881) 3989 Einw. S. ist Sitz eines Präfekten.
Sonett (ital., Klanggedicht), kleines Gedicht von
bestimmter Form, bestehend aus 14 (in der Regel iambischen) Zeilen,
von denen die ersten 8 und die letzten 6 miteinander reimen und
zwar so, daß die 8 ersten, in zwei Strophen von je 4 Zeilen
zerfallend (Quaternarien oder Quatrains), nur zwei Reime haben,
welche je viermal anklingen und in dem Verhältnis der
Reimumschlingung zu einander stehen
27
Songarei - Sonnborn.
(abba abba), die 6 letzten dagegen, in zwei Strophen von je 3
Zeilen zerfallend (Terzinen), mit zwei oder auch drei
Reimklängen beliebig wechseln können (cdc ded, cde cde,
cde dce etc.). Das S. ist eine ebenso schöne wie kunstvolle,
aber auch schwierige Form für die reflektierende Lyrik, weil
sie nicht nur einen bedeutenden Reichtum an Reimen erfordert,
sondern auch die innere Gedankenordnung sich genau den Abteilungen
anschmiegen soll, nicht bloß so, daß mit der 4., 8. und
11. Zeile eine Sinnpause eintreten muß, sondern die Art des
Gedankenvortrags soll auch mit jeder neuen Strophe eine neue
Wendung nehmen. Unbedingt verpönt ist namentlich das
Herüberziehen des Satzes aus der 8. in die 9. Zeile.
Hervorgegangen aus der provencalischen Poesie, fand das S. in der
Mitte des 13. Jahrh. in die italienische Poesie Aufnahme. Die erste
regelmäßige Gestalt gab ihm Fra Guittone von Arezzo, die
höchste Vollendung Dante und Petrarca; im übrigen ist die
Zahl der italienischen Sonettendichter unendlich. In Frankreich
ward das S. erst im 16. Jahrh. wieder aufgenommen, aber als Bouts
rimés zum leeren Witz- und Reimspiel herabgewürdigt.
Auch in England, wohin es durch Howard Graf Surrey verpflanzt ward,
war es eine Zeitlang Modeform (Shakespeare). In Spanien haben sich
Boscau, Garcilaso de la Vega, Mendoza etc., in Portugal namentlich
Camoens als Meister des Sonetts ausgezeichnet. In der deutschen
Poesie finden sich Anklänge an das S. bereits bei Walther von
der Vogelweide. Eigentlich eingeführt ward es zuerst von
Weckherlin und Opitz (in Alexandrinern) und unter dem Namen
Klanggedicht bald mit Vorliebe (Gryphius, P. Fleming etc.)
bearbeitet. Später geriet es wieder in Vergessenheit, bis es
durch Bürger und dann durch die romantische Schule von neuem
aufgenommen und mit Eifer kultiviert wurde. Treffliche deutsche
Sonette haben Schlegel, Goethe, Rückert, Platen, Chamisso,
Herwegh, Geibel, Strachwitz u. a. geliefert. Sonettenkranz ist eine
Reihe von 15 Sonetten, von denen 14 durch ihre Anfangs- oder
Endzeilen das 15., das sogen. Meistersonett, bilden. Vgl.
Tomlinson, The sonnet, its origin, structure etc. (Lond. 1874);
Welti, Geschichte des Sonetts in der deutschen Dichtung (Leipz.
1884); Lentzner, Über das S. in der englischen Dichtung (Halle
1886).
Songarei, Land, s. Dsungarei.
Songhay, Negerstamm, s. Sonrhai.
Songka (Sangkoi oder Roter Fluß), Hauptfluß
der franz. Kolonie Tongking (Hinterindien), entspringt mit drei
westlichern und einer östlichen Quelle in den
Südabhängen der die chinesische Provinz Jünnan
durchziehenden hohen Gebirgskette. In China heißt er
Hongkiang, bei Laokai tritt er über die Grenze, bleibt wie
zuvor noch 140 km von Bergen eingefaßt und bildet zahlreiche
Stromschnellen. Später wird er ruhiger, nimmt rechts den
Hellen Fluß und links den Klaren Fluß auf und spaltet
sich unterhalb in zahlreiche Arme, von denen die linksseitigen mit
dem Thaibinh oder Bakha durch drei künstliche Kanäle und
andre Wasseradern in Verbindung stehen, so daß hier ein
mächtiges Delta gebildet wird, und ergießt sich in den
Meerbusen von Tongking. An einem Arm des Thaibinh liegt Haiphong,
der Haupthafen des Gebiets. Der S. wurde zuerst 1870 von Dupuis von
der chinesischen Stadt Manghao bis zu seinem Eintritt in die Ebene
und 1872 aufwärts bis Jünnan hinein befahren. Auch der
Klare Fluß ist bis zur chinesischen Grenze, der Schwarze
Fluß eine große Strecke aufwärts für leichte
Fahrzeuge befahrbar. Am rechten Ufer des S., 175 km von der
Mündung, liegt die Hauptstadt Hanoi, die im 8. Jahrh. noch am
Meer gelegen haben soll, ein Beweis für die rasche
Deltabildung des Flusses.
Sonica (franz.), wird in Hasardspielen von einer Karte
gesagt, die beim ersten Aufschlagen über Gewinn und Verlust
entscheidet; im weitern Sinn s. v. w.. sogleich, zu rechter
Zeit.
Soninke, Negerstamm, s. Serechule.
Sonklar, Karl, Edler von Innstädten,
österreich. Militär und Geograph, geb. 2. Dez. 1816 zu
Weißkirchen in der damaligen Militärgrenze, besuchte
1829-32 die mathematische Schule in Karansebes, an welcher er eine
Zeitlang auch Lehrer war, stand 1839-48 als Infanterieoffizier in
Agram, Graz und Innsbruck und benutzte seinen Aufenthalt in Graz
dazu, Studien über Physik und Chemie an der dortigen
Universität zu machen, wogegen er von Innsbruck aus
weitreichende Wanderungen in den Alpen machte. Von 1848 bis 1857
lebte er als Erzieher des Erzherzogs Karl Viktor in
Schönbrunn, wirkte seit 1857 als Lehrer der Geographie an der
Militärakademie in Wiener-Neustadt, aus welcher Stellung er
1872 als Generalmajor in den Ruhestand trat und seinen Aufenthalt
in Innsbruck nahm, wo er 10. Jan. 1885 starb. Seine ersten
Schriften: "Über Führung einer Arrieregarde" (1844),
"Über die Heeresverwaltung der alten Römer im Frieden und
Krieg etc." (Innsbr. 1847), waren rein militärischen
Charakters; später aber wandte er sich der Geographie zu und
hat auf dem Gebiet der Orographie die größten Erfolge
aufzuweisen. Als Anhänger K. Ritters war er bestrebt, die
Ursachen der Erscheinungen, welche unmittelbar zu beobachten er
seit 1857 jährlich Reisen in die Alpen (1870 nach Ungarn, 1875
nach Italien) unternahm, aufzuspüren und darzulegen. Als
Frucht dieser Einzelforschungen veröffentlichte er:
"Reiseskizzen aus den Alpen und Karpathen" (Wien 1857); "Die
Gebirgsgruppe der Hochschwab" (das. 1859); "Die Ötzthaler
Gebirgsgruppe" (Gotha 1860, mit Atlas); "Die Gebirgsgruppe der
Hohen Tauern" (Wien 1866); "Die Zillerthaler Alpen" (Gotha 1877).
Sein in mehrfacher Hinsicht grundlegendes Hauptwerk ist aber die
"Allgemeine Orographie oder Lehre von den Reliefformen der
Erdoberfläche" (Wien 1872). Noch veröffentlichte er
außer verschiedenen Lehrbüchern der Geographie, die
ebenfalls besonderes Gewicht auf die Darstellung des Erdreliefs
legen: "Die Überschwemmungen" (Wien 1883) und bearbeitete
für die vom Deutschen u. Österreichischen Alpenverein
herausgegebene "Anleitung zur wissenschaftlichen Beobachtung auf
Reisen" den Teil "Die Orographie u. Topographie, Hydrographie und
Gletscherwesen" (Münch. 1879). In der Kunstlitteratur
versuchte er sich durch eine "Graphische Darstellung der Geschichte
der Malerei" (Wien 1853).
Sonn., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung
für P. Sonnerat (spr. ssonn'ra), geb. 1749, Reisender, gest.
1814 in Paris (Zoologie, Botanik).
Sonnabend (d. h. der Abend vor dem Sonntag), der siebente
Tag der Woche im christlichen Kalender, der Sabbat im
jüdischen Kalender. An die letztere Bedeutung erinnern die
Namen Samstag im Deutschen, samedi im Französischen u. a.,
wogegen sich die römische Bezeichnung dies Saturni
(Saturnustag), im plattdeutschen Zaturdag, Saterdag sowie im
englischen Saturday erhalten hat.
Sonnblick, Berg, s. Rauriser Thal.
Sonnborn, Landgemeinde im preuß. Regierungsbezirk
Düsseldorf, Kreis Mettmann, an der Wupper
28
Sonne (Entfernung, Parallaxe, Größe,
Oberfläche).
und an den Linien Neuß-Schwelm und Düsseldorf-Schwelm
der Preußischen Staatsbahn, hat eine evangelische und eine
kath. Kirche, mechanische Weberei, eine Tapetenfabrik,
Kalksteinindustrie, Fabrikation landwirtschaftlicher Maschinen und
(1885) 7543 meist evang. Einwohner.
Sonne (hierzu Tafel "Sonne"), der Zentralkörper des
Planetensystems, zu dem die Erde gehört, an Volumen und Masse
weitaus der größte unter den Körpern dieses Systems
und für sie alle Quelle von Licht und Wärme.
[Entfernung von der Erde, Parallaxe.] Da die Erde sich in einer
Ellipse um die im Brennpunkt stehende S. bewegt, so ist die
Entfernung beider Himmelskörper voneinander veränderlich,
wie sich schon aus den zwischen 32' 36'' und 31' 32'' schwankenden
Werten des scheinbaren Halbmessers der S. ergibt. Die mittlere
Größe dieser Entfernung ist eins der wichtigsten
Elemente der Astronomie, denn sie bildet die Einheit, in welcher
man die Entfernungen der Weltkörper zunächst ermittelt.
Man bezeichnet sie gewöhnlich mit den Namen Sonnenweite,
Sonnenferne oder auch Erdweite. Dem dritten Keplerschen Gesetz
zufolge verhalten sich die dritten Potenzen der mittlern
Entfernungen zweier Planeten von der S. wie die Quadrate ihrer
Umlaufszeiten. Sind daher die letztern durch Beobachtung bekannt,
so kann man das Verhältnis zwischen den mittlern Entfernungen
berechnen. Ebenso läßt sich die Entfernung derjenigen
Fixsterne, bei denen die Bestimmung der jährlichen Parallaxe
(s. d.) gelungen ist, in Erdweiten angeben. Um nun die
Größe einer Erdweite in geographischen Meilen oder
Kilometern zu finden, muß die Parallaxe der S. bekannt sein.
Diese kann man aber, ihrer Kleinheit wegen, nicht direkt durch
Beobachtung von Sonnenhöhen an verschiedenen Punkten der Erde
finden; man bestimmt sie vielmehr indirekt, indem man die Parallaxe
und Entfernung der Planeten Mars und Venus in ihrem geringsten
Abstand von der Erde durch Beobachtung ermittelt. Dom. Cassini
leitete zuerst aus den Beobachtungen des Mars zur Zeit seiner
Opposition eine Parallaxe von 25'' ab, und da die Entfernung des
Mars von der Erde zur Zeit der Beobachtung 0,4 von der Entfernung
der Erde von der S. betrug, so ergab sich daraus die
Sonnenparallaxe = 0,4.25'' oder 10'', was eine Entfernung der S.
von 20,700 Erdhalbmessern gibt. Statt des Mars kann man auch die
Venus in ihrer Erdnähe beobachten. Dieselbe kehrt uns dann
ihre dunkle Seite zu und ist nur sichtbar, wenn sie vor der
Sonnenscheibe vorübergeht, wenn ein sogen. "Durchgang der
Venus durch die S." stattfindet. Halley machte zuerst (1677) auf
die Wichtigkeit der Venusdurchgänge für die Bestimmung
der Sonnenparallaxe aufmerksam und schlug eine hierzu geeignete
Beobachtungsmethode vor (1691 u. 1716). Seitdem sind alle
Venusdurchgänge (9. Juni 1761, 2. Juni 1769, 8. Dez. 1874 und
6. Dez. 1882) mit größter Sorgfalt beobachtet worden.
Aus den Beobachtungen von 1761 und 1769 hat Encke den Wert der
Sonnenparallaxe zu 8,57116'' bestimmt, was eine Entfernung der S.
gleich 24,043 Erdhalbmessern oder 20,682,000 geogr. Meilen gibt.
Bis Anfang der 60er Jahre galt dieser Wert als der
zuverlässigste. Eine neue Berechnung von Powalky, bei welcher
genauere Werte für die Längen einiger Beobachtungsorte
benutzt wurden, gab für die Sonnenparallaxe den
größern Wert 8,855''. Ferner berechnete Newcomb aus den
Beobachtungen des Mars zur Zeit seiner Opposition 1862, die nach
einem von Winnecke entworfenen Plan auf zahlreichen Sternwarten
angestellt wurden, den Wert 8,848''. Später hat Galle aus
Oppositionsbeobachtungen des Planeten Flora, der im Oktober und
November 1873 sich der Erde bis auf 0,87 Sonnenweiten näherte,
den Wert 8,873'' berechnet, fast übereinstimmend mit der Zahl
8,879, welche Puiseux aus den französischen Beobachtungen des
Venusdurchganges von 1874 abgeleitet hat. Leverrier hatte
früher aus den Störungen der Venus den Wert 8,95''
berechnet, und ähnliche Werte, sämtlich größer
als der Enckesche, sind von Hansen, Delaunay und Plana aus gewissen
Ungleichheiten der Mondbewegung gefunden worden. Endlich kann man
die Sonnenparallaxe auch finden, wenn man die Lichtgeschwindigkeit
unabhängig von astronomischen Beobachtungen bestimmt und die
sogen. Lichtgleichung, d. h. die Zeit, in welcher das Licht von der
S. zur Erde gelangt, oder auch den Aberrationswinkel (s. Aberration
des Lichts) kennt. Nach den neuesten Versuchen von Newcomb
beträgt aber die Lichtgeschwindigkeit im leeren Raum 299,860
km, und daraus ergibt sich mit Nyréns Wert der
Aberrationskonstanten (s. Aberration) eine Sonnenparallaxe von
8,794'', entsprechend einer Entfernung der S. von 149,61 Mill. km.
Da eine Bearbeitung der sämtlichen Beobachtungen der
Venusdurchgänge von 1874 und 1882 zur Zeit noch nicht
vorliegt, so bedient man sich gewöhnlich des Newcombschen
Wertes 8,85'' für die Sonnenparallaxe. Hiernach beträgt
die mittlere Entfernung der S. 23,307 Erdhalbmesser = 148,670,000
km = 20,036,000 geogr. Meilen. Das Licht braucht 8 Min. 18 Sek. zur
Zurücklegung dieses Wegs. Da die Exzentrizität der
Erdbahn ungefähr 1/60 beträgt, so wird die Entfernung im
Perihel um etwa 1/3 Mill. Meilen verkleinert, im Aphel um
ebensoviel vergrößert.
[Scheinbare und wahre Größe.] In mittlerer Entfernung
erscheint der Sonnenhalbmesser unter einem Winkel von 16' 1,8''
oder 961,8''; daraus berechnet sich der wahre Durchmesser der S. =
(961,8)/(8,85) = 108,556 Erddurchmessern = 1,387,600 km = 187,000
geogr. Meilen, also ungefähr 1 4/5 mal so groß als der
Durchmesser der Mondbahn. Ein Bogen auf der Mitte der S., der uns
unter einem Winkel von 1'' erscheint, hat eine Länge von 720
km, und selbst der feinste Spinnwebenfaden eines Mikrometers
verdeckt noch gegen 200km. Die S. hat 11,800 mal soviel
Oberfläche und 1,279,000 mal soviel Volumen als die Erde, 600
mal soviel als alle Planeten zusammen. Ihre Masse ist das 319,500
fache von der Erdmasse, mehr als das 700 fache aller
Planetenmassen. Die mittlere Dichte aber ist nur 0,253 oder
ungefähr 1/4 von der unsrer Erde, also 1,4 von der des
Wassers. Da die Schwerkraft an der Oberfläche eines
Himmelskörpers, abgesehen von den Wirkungen der
Zentrifugalkraft, proportional ist dem Produkt aus mittlerer Dichte
und Durchmesser, so ist dieselbe auf der S. 108,6.0,253 = 27,5 mal
so groß als bei uns, und während ein Körper auf der
Erde 4,9 m in der ersten Sekunde fällt, beträgt der
Fallraum auf der S. 135 m.
[Oberfläche.] Während bei Anwendung mäßiger
Vergrößerung die leuchtende Oberfläche der S. , die
Photosphäre, glatt und gleichförmig erscheint, erblickt
man sie durch Instrumente von großer Öffnung mit starker
Vergrößerung bei klarer und ruhiger Luft wie bedeckt mit
leuchtenden, in ein weniger helles Netzwerk eingebetteten
Körnern. Schon W. Herschel hat dieselben wahrgenommen und als
"Runzeln" bezeichnet, später hat sie Nasmyth mit
Weidenblättern, Secchi aber mit Reiskörnern verglichen.
Nach
29
Sonne (Flecke und Fackeln, Rotation).
Langley hat die Photosphäre ein wollig-wolkenartiges
Aussehen, aber neben den verwaschen wolkenartigen Gebilden
unterscheidet man noch zahlreiche schwache Fleckchen auf hellem
Grund, und unter günstigen Umständen lösen sich die
wolkenähnlichen Gebilde in eine Menge kleiner intensiv
leuchtender Körner auf, die in einem dunklern Medium
suspendiert erscheinen. Die erwähnten Fleckchen haben jetzt
das Aussehen von Öffnungen oder Poren, entstanden durch
Abwesenheit der weißen Wolkenknoten und Durchscheinen des
dunklern Grundes; der Durchmesser beträgt bei den deutlicher
wahrnehmbaren 2-4 Bogensekunden. Die hellen Knötchen oder
Reiskörner Secchis bestehen nach Langley aus Anhäufungen
kleiner Lichtpunkte von ungefähr 1/3'' Durchmesser. Janssen
hat Photographien der S. bis zu einem Durchmesser von 30cm und mehr
dargestellt, die unter der Lupe sehr deutlich die granulierte
Beschaffenheit der Photosphäre zeigen. An Stellen, wo die
Granulationen am deutlichsten ausgeprägt sind, besitzen die
Elemente alle eine mehr oder minder kugelförmige Gestalt, und
das um so mehr, je geringer ihre Größe ist. Der
Durchmesser dieser Kugeln ist sehr verschieden, von wenigen
Zehnteln der Bogensekunde bis zu 3 und 4''. Die ganze
Oberfläche der Photosphäre erscheint in eine Reihe von
mehr oder minder abgerundeten, oft fast geradlinigen, meist an
Vielecke erinnernden Figuren abgeteilt, deren Größe sehr
verschieden ist, oft einen Durchmesser bis zu 1' und darüber
erreicht. Während nun in den Zwischenräumen dieser
Figuren die einzelnen Körner bestimmt und gut begrenzt, obwohl
von sehr verschiedener Größe sind, erscheinen sie im
Innern wie zur Hälfte ausgelöscht, gestreckt oder
gewunden; ja, am häufigsten sind sie ganz verschwunden, um
Strömen von leuchtender Materie Platz zu machen, die an die
Stelle der Granulationen getreten sind. Janssen hat diese
Gestaltung als photosphärisches Netz bezeichnet.
[Sonnenflecke, Rotation.] Ferner bemerkt man auf der
Sonnenfläche schon bei schwachen Vergrößerungen
bald einzelne, bald in Gruppen zusammenstehende dunklere Stellen,
sogen. Sonnenflecke. Dieselben wurden zuerst 1610 von Fabricius
wahrgenommen, 1611 auch von Galilei und von Scheiner in Ingolstadt
entdeckt. Während ersterer die S. mit ungeschütztem Auge
beobachtete, wenn sie in der Nähe des Horizonts stand, wandte
Scheiner zuerst dunkel gefärbte Blendgläser an.
Gegenwärtig polarisiert man auch das Licht im Fernrohr durch
Reflexion und kann es dann durch abermalige Reflexion beliebig
abschwächen (Helioskop von Merz). Vielfach beobachtet man auch
das objektive Sonnenbild, das durch ein Äquatorial auf einer
weißen Fläche entworfen wird. Auch wendet man jetzt nach
dem Vorgang von Warren de la Rue häufig die Photographie an,
um getreue Abbildungen der Sonnenfläche mit ihren Flecken etc.
zu erhalten. Fig. 1 der Tafel "Sonne" zeigt den Anblick der S. nach
einer Photographie von Rutherfurd in New York 23. Sept. 1870.
Außer den Sonnenflecken zeigt dieselbe auch noch nach dem
Rand hin helle Adern, sogen. Fackeln, in Silberlicht glänzende
Streifen, die schon Galilei beobachtete. Die Sonnenflecke sind von
sehr verschiedener Größe, oft nur als dunkle Punkte
erkennbar, sogen. Poren, und oftmals 1000 Meilen und mehr im
Durchmesser haltend. Schwabe beobachtete im September 1850 einen
Fleck von 30,000 Meilen Durchmesser. Große Flecke von mehr
als 50'' = 4800 Meilen Durchmesser sind auch mit bloßem Auge
sichtbar, wenn man die S. durch dünnes Gewölk oder nahe
am Horizont oder auch ein berußtes Glas beobachtet, und es
sind solche schon vor Erfindung der Fernröhre, namentlich von
den Chinesen, vereinzelt gesehen worden. An den größern
Flecken unterscheidet man meist einen dunkeln Kern, den Kernfleck,
bisweilen mit noch dunklern Stellen, Dawes' Centra. Diese Kerne
sind umgeben mit einem matten, nach der leuchtenden
Sonnenfläche gut abgegrenzten Hof oder Halbschatten
(penumbra), ungefähr von der grauen Färbung der
Mondmeere. Doch sind auch bisweilen rötliche Färbungen
beobachtet worden, namentlich hat Secchi größere Flecke
wiederholt wie durch einen rötlichen Schleier gesehen. Nicht
selten fehlt übrigens die Penumbra, andre Male wieder der
Kernfleck.
Gleich die ersten Beobachter bemerkten, daß die
Sonnenflecke sich vom östlichen Rande der S. nach dem
westlichen bewegen, und erklärten diese Bewegung richtig durch
eine Rotation der S. um eine Achse. Die Bestimmung der Dauer der
Rotation ist aber mit Schwierigkeiten verbunden, einesteils wegen
der Veränderlichkeit, andernteils wegen der eignen Bewegung
der Flecke, die nach Laugier bisweilen über 100m in der
Sekunde beträgt. Verhältnismäßig nicht viele
Flecke behalten ihre Gestalt so lange, daß man sie
während mehrerer Rotationen verfolgen kann; viele ändern
von einem Tag zum andern ihre Gestalt teils durch Zerfallen (s.
Tafel, Fig. 2), teils durch Zusammenfließen mit andern
derart, daß sie nicht wieder zu erkennen sind; andre
verschwinden gänzlich, neue erscheinen. Das Auftreten neuer
Fleckengruppen wird meist vorher angezeigt durch ausgedehnte helle
Fackeln an der gleichen Stelle. Dessen ungeachtet hat man
zahlreiche Flecke durch mehrere Rotationen beobachtet. Man findet
nun, daß ein Fleck ungefähr 27½ Tage nach seinem
ersten Erscheinen sich wieder am Ostrand zeigt, und daraus ergibt
sich, mit Berücksichtigung der Bewegung der Erde, die wahre
Dauer einer Rotation der S. zu ungefähr 25½ Tagen. Die
genauere Bestimmung liefert aber für Flecke, die dem
Sonnenäquator nahe sind, eine kürzere Dauer als für
solche in höhern Breiten. Spörer fand z. B. für
1,5° heliographischer Breite 25,118 Tage, für 24,6°
aber 26,216 Tage. Es deutet dies auf eine Bewegung der Flecke
parallel zum Äquator. Außerdem aber ändern sich
auch die Breiten, es zeigen die meisten Flecke eine Bewegung vom
Äquator nach den Polen hin. Spörer vermutet, daß
diese Bewegungen mit Winden auf der S. zusammenhängen. Nach
seiner Bestimmung beträgt die Rotationszeit der S. 25,234
Tage, der Sonnenäquator ist um 6° 57' geneigt gegen die
Ekliptik, und die Länge seines aufsteigenden Knotens ist
74° 36'; Carrington hat 25,38 Tage, 7° 15' und 73° 57'
gefunden.
Bei der Rotation der S. zeigen die Flecke, den Regeln der
Perspektive entsprechend, gewisse regelmäßige
Formveränderungen: wenn ein Fleck sich vom Ostrand aus nach
der Mitte der S. bewegt, so wird seine Ausdehnung parallel zum
Äquator immer größer; entfernt er sich aber von der
Mitte, so wird sie immer kleiner, während gleichzeitig seine
Ausdehnung senkrecht zum Äquator ungeändert bleibt.
Wilson in Glasgow beobachtete 1769 an einem großen
Sonnenfleck, daß die Penumbra, als derselbe in der Mitte der
S. stand, links und rechts ungefähr gleich groß, vor-
und nachher aber, bei exzentrischer Stellung, allemal auf der dem
Rande der S. zunächst liegenden Seite sich am breitesten
zeigte. Wilson kam dadurch zu der Ansicht, daß die Penumbra
gebildet werde durch die trichterförmig nach unten
abfallenden, nur wenig leuchtenden Seitenwände einer
Öffnung in
30
Sonne (Korona, Protuberanzen etc.).
der Lichthülle der S., durch welche wir deren dunkeln Kern
erblicken. Daß der eigentliche Sonnenkörper dunkel sei,
hatte schon Dom. Cassini (1671) behauptet; Bode (1776) und
später W. Herschel haben der Wilsonschen Hypothese, daß
der dunkle Kern der S. zunächst von einer wenig leuchtenden,
wolkenähnlichen Hülle umgeben sei, über welche sich
die eigentliche Lichthülle ausbreite, allgemein Eingang
verschafft. Erst Kirchhoff (1861) machte darauf aufmerksam,
daß die leuchtende Hülle der S. unmöglich
bloß nach außen Licht und Wärme senden könne,
daß vielmehr auch die unter ihr liegende wolkenartige Schicht
und der Sonnenkörper selbst längst durch Leitung und
Strahlung erwärmt und ins Glühen versetzt worden sein
müßten. Aus diesen Gründen ist die Wilsonsche
Hypothese aufgegeben worden.
Die Sonnenflecke erscheinen nicht an allen Stellen der
Sonnenoberfläche in gleicher Häufigkeit. In der
Hauptsache sind sie beschränkt auf die Zonen zwischen 10 und
30° heliographischer Breite, die sogen. Königszonen. In
der Nähe des Sonnenäquators selbst sind sie nur
spärlich vorhanden, und ebenso finden sie sich selten jenseit
des 35. Breitengrads. Ferner sind die Sonnenflecke nicht zu allen
Zeiten gleich häufig, und es hat zuerst Schwabe 1843 aus
seiner seit 1826 fortgesetzten Beobachtung auf eine etwa
zehnjährige Periode der Häufigkeit geschlossen. Zu
allgemeiner Anerkennung gelangte diese Behauptung namentlich durch
die Diskussion älterer Fleckenbeobachtungen durch Wolf 1852.
Derselbe fand eine mittlere Dauer der Periode von 11 1/9 Jahren mit
Abweichungen von durchschnittlich 1 2/3 Jahren; etwa fünf
solcher Perioden bilden wieder eine größere Periode, die
durch die Höhe der Fleckenmaxima und die Tiefe der Minima
charakterisiert ist. Merkwürdig ist das 1852 von Sabine,
Gautier und Wolf erkannte Zusammentreffen der Sonnenfleckenperiode
mit derjenigen der erdmagnetischen Störungen und Variationen.
Später hat man auch in den Erscheinungen der Nordlichter, des
Regenfalls, der Stürme etc. dieselbe Periode zu erkennen
geglaubt; auch hatte schon W. Herschel einen Zusammenhang zwischen
der Häufigkeit der Sonnenflecke und der Fruchtbarkeit der
einzelnen Jahre zu erkennen geglaubt. Vgl. Hahn, Über die
Beziehungen der Sonnenfleckenperiode zu meteorologischen
Erscheinungen (Leipz. 1877); Fritz, Die Beziehungen der
Sonnenflecke zu den magnetischen und meteorologischen Erscheinungen
der Erde (Haarlem 1878).
[Korona und Protuberanzen.] Bei totalen Sonnenfinsternissen
erscheint der vor der S. stehende Mond rings umgeben mit einem
silberglänzenden, wallenden Lichtschimmer, aus dem einzelne,
oft wunderbar gekrümmte Strahlengruppen hervorschießen.
Es ist dies die sogen. Korona. Außerdem aber hat man auch
noch bei diesen Gelegenheiten eigentümliche rosenrote Gebilde
am Sonnenrand bemerkt, die bald wie Berge oder Flammen an der S.
haften, bald wie Wolken frei schweben, die Protuberanzen (vgl.
Tafel "Sonne", Fig. 3). Solche Protuberanzen sind bereits 1733 von
Vassenius in Gotenburg beobachtet und abgebildet worden; ihr
genaueres Studium beginnt aber erst mit der Sonnenfinsternis vom 8.
Juli 1842, wo Arago, Airy, Schumacher u. a. sie wahrnahmen; 1860
wurden sie bereits photographiert, und 1867 glückte es Rziha,
bei Ragusa eine Protuberanz während einer zehnzölligen
ringförmigen Finsternis zu beobachten. Endlich haben 1868
Lockyer, Janssen, Huggins und Zöllner Methoden angegeben, um
diese Gebilde auch bei vollem Sonnenschein zu beobachten. Als
Mittel hierzu dient das Spektroskop. Das Sonnenspektrum ist ein
kontinuierliches Spektrum, welches von zahlreichen dunkeln
(Fraunhoferschen) Linien unterbrochen wird, die genau dieselbe
Stelle einnehmen wie die hellen Linien in den Spektren
verschiedener Metalldämpfe. Kirchhoff zeigte, daß ein
jedes glühende Gas ausschließlich Strahlen von der
Brechbarkeit derer schwächt, die es selbst aussendet, so
daß die hellen Linien eines glühenden Gases in dunkle
verwandelt werden müssen, wenn durch dasselbe Strahlen einer
Lichtquelle treten, die hinreichend hell ist und an sich ein
kontinuierliches Spektrum gibt. Um also die dunkeln Linien des
Sonnenspektrums zu erklären, muß man annehmen, daß
die Sonnenatmosphäre einen leuchtenden Körper
umhüllt, der für sich allein ein kontinuierliches
Spektrum gibt. Die wahrscheinlichste Annahme scheint Kirchhoff die
zu sein, daß die S. aus einem festen oder
tropfbarflüssigen, in der höchsten Glühhitze
befindlichen Kern besteht, der umgeben ist von einer
Atmosphäre von etwas niedrigerer Temperatur. Durch das
erwähnte Zusammentreffen der Fraunhoferschen mit den hellen
Linien in den Spektren gewisser Metalldämpfe ist zugleich die
Anwesenheit der letztern in der Sonnenatmosphäre nachgewiesen,
und man hat auf diese Weise gefunden, daß Natrium, Calcium,
Baryum, Magnesium, Eisen, Chrom, Nickel, Kupfer, Zink, Strontium,
Kadmium, Kobalt, Wasserstoff, Mangan, Aluminium, Titan in der
Sonnenatmosphäre vorkommen; Wasserstoff und Eisendampf bilden
die Hauptgemengteile. Die Sonnenflecke zeigen nach Huggins und
Secchi dasselbe Spektrum wie die übrige Sonnenfläche, nur
sind die dunkeln Linien breiter; Secchi schließt daraus,
daß in ihnen die metallischen Dämpfe sich im Zustand
größerer Dichte befinden. Die Protuberanzen aber zeigen
ein Linienspektrum mit den hauptsächlichsten Linien des
Wasserstoffs und einigen Eisenlinien. Darauf beruht die
Möglichkeit, diese Gebilde bei hellem Sonnenschein selbst auf
der Sonnenscheibe zu beobachten. Man bringt nämlich im
Spektroskop eine größere Anzahl Prismen an, durch welche
das Spektrum des störenden Sonnenlichts so
vergrößert wird, daß es nicht mehr blendet;
dagegen bleibt die Protuberanz im Licht einer der hellen
Wasserstofflinien sichtbar, wenn man den Spalt weit öffnet
(Lockyer, Zöllner). Man weiß gegenwärtig, daß
die Protuberanzen in der Hauptsache aus glühendem Wasserstoff
bestehen, der in Massen von mannigfachster Form bis zur Höhe
von 1-3', ja in einzelnen Fällen bis über 4' Höhe
(23,000 geogr. Meilen) mit rasender Schnelligkeit (über 20
geogr. Meilen in der Sekunde) aufsteigt. Durch die Neigung der
obern Teile der Protuberanzen gibt sich eine in den höhern
Schichten der Atmosphäre herrschende Strömung nach den
Polen kund. Eine Hülle glühenden Wasserstoffgases umgibt
auch den ganzen Sonnenkörper, in der Fleckenregion fast zu
6000 Meilen, anderwärts nur etwa zu 1000 Meilen aufsteigend,
die sogen. Chromosphäre, welche namentlich in mittlern Breiten
zahlreiche haarförmige Hervorragungen zeigt. Die Korona
endlich gibt ein kontinuierliches Spektrum mit einigen hellen
Linien, darunter einer grünen Eisenlinie, die auch im
Nordlichtspektrum auftritt. Zwischen Protuberanzen und Fackeln
besteht eine enge Beziehung; es treten durchschnittlich die
schönsten Protuberanzen in der Region der Fackeln auf, und
Secchi versichert, noch niemals eine einigermaßen
glänzende Fackel am Sonnenrand selbst angetroffen zu haben,
ohne daselbst zugleich eine Protuberanz oder wenigstens eine
höhere Erhebung und
31
Sonneberg - Sonnenberg.
einen stärkern Glanz der Chromosphäre zu sehen.
Spörer hält die Protuberanzen für Vorläufer
später erscheinender Fleckengruppen. Fig. 4-6 auf Tafel
"Sonne" zeigen eine Anzahl Protuberanzen: Fig. 4 I eine Protuberanz
von 2' (11,500 geograph. Meilen) Höhe 3 Uhr 45 Min., II, III,
IV eine andre von 35 bis 40'' (3400-3800 Meilen) Höhe 6 Uhr 45
Min., 55 Min. und 57 Min.; Fig. 5 I 2. Juli 1869, 11 Uhr 35 Min.,
Höhe 65'' (6300 Meilen), II 4. Juli, 9 Uhr, Höhe 40''
(3800 Meilen), III und IV eine Protuberanz von 50-60'' (4800-5700
Meilen) Höhe 4. Juli, II Uhr 50 Min. und 12 Uhr 50 Min.
[Temperatur.] Über die Temperatur, welche auf der
Oberfläche der S. herrscht, gehen die Ansichten der Forscher
weit auseinander: während Zöllner aus theoretischen
Erwägungen über 27,000° C. findet, hat Secchi aus
aktinometrischen Messungen 5-6 Mill. Grad als untere Grenze
abgeleitet. Aus solchen Messungen haben aber anderseits Pouillet
und neuerdings wieder Vicaire und Violle bloß 1500°
gefunden. Diese verschiedenen Resultate sind Folge verschiedener
Annahmen des Wärmestrahlungsgesetzes, dessen Form uns freilich
nur innerhalb ziemlich enger Temperaturgrenzen sicher bekannt ist.
Licht- und Wärmestrahlung sind infolge der Absorption in der
Sonnenatmosphäre am Rand geringer als in der Mitte der
Sonnenscheibe. Secchi fand die Wärmestrahlung am Rand nur halb
so groß als in der Mitte, auch am Äquator bedeutender
als an den Polen. Langley hat 1874 diese ältern Beobachtungen
bestätigt gefunden. Die Flecke strahlen weniger Wärme aus
als die benachbarte Sonnenfläche (Henry 1845); doch gibt nach
Langley selbst ein Kernfleck noch mehr Wärme als ein gleich
großes, hell leuchtendes Randstück.
[Theorie der Sonne.] Nach Kirchhoffs Ansicht, die auch von
Spörer, Zöllner u. a. in der Hauptsache adoptiert worden
ist, besteht die S. aus einem in der höchsten Glühhitze
befindlichen Kern, der von einer Atmosphäre von niedrigerer
Temperatur umgeben ist. Die Sonnenflecke sind Wolken, die
Kernflecke werden durch tiefer liegende dichtere, die Höfe
durch darübergelagerte dünnere und ausgebreitetere Wolken
gebildet. Zöllner dagegen hält die Kernflecke für
Schlackenmassen, die sich auf der glühend flüssigen
Sonnenoberfläche durch Abkühlung gebildet haben und sich
auch infolge der in der Sonnenatmosphäre erzeugten
Gleichgewichtsstörungen von selbst wieder auflösen.
Diesen Anschauungen gerade entgegengesetzt, denkt sich Faye die
Sonnenmasse als einen gasförmigen, infolge seiner hohen
Temperatur in einem Zustand allgemeiner physischer und chemischer
Dissociation befindlichen Körper, an dessen durch Strahlung
etwas erkalteter Oberfläche sich chemische Verbindungen bilden
können, welche aber sofort wieder untersinken und durch neue
ersetzt werden; die Lichthülle oder Photosphäre ist daher
diese in beständiger Neubildung begriffene Oberfläche.
Wird diese Hülle an einer Stelle durch aufsteigende
Strömungen unterbrochen, oder werden Teile des Innern an die
Oberfläche gebracht, in denen der chemische (Verbrennungs-)
Prozeß nicht thätig ist, so haben wir den Anblick eines
Sonnenflecks. Während nach diesen und andern Theorien die S.
allmählich kälter wird, hat neuerdings William Siemens
("Die Erhaltung der Sonnenenergie", deutsch, Berl. 1885) eine
Theorie aufgestellt, nach welcher die von der S. ausgestrahlte
Energie derselben beständig wieder zugeführt wird. Vgl.
Faye, Sur la constitution physique du soleil (in den
"Comptes-rendus" 1865 ff.); Secchi, Die S. (deutsch von Schellen,
Braunschw. 1872); Young, Die S. (Leipz. 1883); kürzere
Darstellungen von Reis (das. 1869) und Hirsch (Basel 1874).
Sonneberg, Kreisstadt im Herzogtum Sachsen-Meiningen, 3
km lang, eng eingeklemmt zwischen Bergen an der Südseite des
Thüringer Waldes (der neue Stadtteil liegt in der Ebene), an
der Röthen, der Zweigbahn Koburg-S. (Werrabahn) und der
Sekundärbahn S.-Lauscha, hat eine schöne neue Kirche im
gotischen Stil, eine Wasserheilanstalt, blühende Industrie und
(1885) 10,247 Einw. S. ist namentlich berühmt als Mittelpunkt
der vielen umliegenden Fabrikorte, in welchen wie in der Stadt
selbst die sogen. Sonneberger Spielwaren (aus Holz und
Papiermaché), Attrappen, Masken, Glas-, Porzellan- und
Eisenwaren geliefert und von hier aus im Wert von jährlich 7,5
Mill. Mk. nach allen Weltgegenden hin versandt werden.
Außerdem liefert S. Farben, Schiefertafeln, Schieferstifte,
Schleif- und Poliersteine, Lederarbeiten etc. und hat Brauereien,
Masse-, Loh- und Schneidemühlen und Ziegelhütten. S. hat
ein Amtsgericht und eine Realschule und ist Sitz eines
Landratsamtes, eines Forstdepartements und eines Konsulats der
Vereinigten Staaten von Amerika. Vgl. Fleischmann, Gewerbe,
Industrie und Handel des meiningenschen Oberlandes (Hildburgh. 1876
ff.).
Sonnefeld, Flecken in Sachsen-Koburg, hat eine evang.
Kirche, ein Amtsgericht und 1180 Einw.; in der Umgegend
Verfertigung von Korbwaren.
Sonnemann (eigentlich Saul), Leopold, Journalist, geb.
29. Okt. 1831 zu Höchberg in Unterfranken von jüdischen
Eltern, wurde erst Kaufmann, gründete 1856 die in
Handelskreisen einflußreiche "Frankfurter Zeitung" und ist
seit 1867 alleiniger Eigentümer und Herausgeber derselben.
Auch war er Mitbegründer des volkswirtschaftlichen Kongresses
und langjähriger Referent über Bankwesen in demselben.
1871-76 und 1878-84 Mitglied des deutschen Reichstags, trat er, der
Haltung seiner Zeitung entsprechend, als Vertreter der deutschen
Volkspartei meist oppositionell auf, stimmte gegen die Annexion von
Elsaß-Lothringen, unterstützte die Beschwerden der
elsässischen Protestler und der Sozialdemokraten und
beteiligte sich positiv nur an der Beratung über das
Münz- und Bankgesetz sowie über den Zolltarif.
Sonnenbad, Bestrahlung des menschlichen Körpers
durch die Sonne zu Heilzwecken.
Sonnenbahn, s. v. w. Ekliptik (s. d.).
Sonnenbaum, s. Retinospora.
Sonnenberg, Franz Anton Joseph Ignaz Maria, Freiherr von,
Dichter, geb. 5. Sept. 1779 zu Münster, entwarf schon auf dem
Gymnasium in Münster nach Klopstocks "Messiade" den Plan zu
einem Epos: "Das Weltende" (Bd. 1, Wien 1801), das alle Fehler
einer wilden Phantasie, eines regellosen Umrisses und einer
schwülstigen Diktion vereinigt. Er studierte die Rechte, doch
nicht aus Neigung, lebte späterhin zurückgezogen in Jena
und arbeitete hier an einem zweiten Epos: "Donatoa", abermals einem
Gemälde des Weltuntergangs, welches dergestalt seine ganze
Seele erfüllte, daß er Schlaf und Speise, Umgang und
jede Lebensfreude dafür aufopferte. Er endete 22. Nov. 1805
freiwillig in Jena durch einen Sturz aus dem Fenster. Auch in
"Donatoa" (Rudolst. 1806, 2 Bde., mit Biographie von Gruber)
erscheint S. als ein Nacheiferer Klopstocks. Bei allen Fehlern in
Plan und Ausführung zeigen einzelne Stellen eine gewisse Kraft
und Hoheit und eine tiefe Innigkeit des Gemüts. Aus seinem
Nachlaß erschienen auch "Gedichte" (Rudolst. 1808).
32
Sonnenblume - Sonnenfinsternis.
Sonnenblume, s. Helianthus.
Sonnenblumenöl, fettes Öl, durch Pressen aus
den Samen von Helianthus annuus gewonnen (Ausbeute 15 Proz.), ist
hellgelb, schmeckt sehr rein, erstarrt bei -16°, trocknet,
dient als Speiseöl, zur Verfälschung des Baumöls,
zum Malen etc.
Sonnenburg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Frankfurt, Kreis Oststernberg, an der Lenze und dem Warthebruch,
hat eine evang. Kirche, ein Schloß aus dem 16. Jahrh. (einst
Sitz eines Johanniter-Herrenmeisters, jetzt Sitz des neuen
preußischen Johanniterordens), ein Johanniterkrankenhaus,
eine Strafanstalt, ein Amtsgericht, Seidenweberei, Filzfabrikation,
eine Bilderrahmen-, eine Messingstift- und eine
Blechemballagenfabrik, Ziegelbrennerei, Dampfmühle und (1885)
6226 meist evang. Einwohner.
Sonnendarre, s. Samendarre.
Sonnendistel, s. Carlina.
Sonnenfackeln, s. Sonne, S. 29.
Sonnenfels, Joseph von, Schriftsteller, geb. 1732 zu
Nikolsburg in Mähren, besuchte die dortige Schule der
Piaristen und wollte Mönch werden, wählte aber den
Soldatenstand und diente fünf Jahre im Deutschmeisterregiment
zu Klagenfurt und Wien, wo er seine Entlassung nahm. Hierauf
beschäftigte er sich in Wien mit Rechtsstudien und arbeitete
als Gehilfe bei einem höhern Justizbeamten. Zugleich suchte er
die Wiener mit der neuern deutschen Litteratur, die neben und nach
den Erzeugnissen der Gottschedschen Schule frisch aufgeschossen
war, bekannt zu machen, gründete zu diesem Behuf 1761 eine
Deutsche Gesellschaft in Wien, schrieb Wochenblätter ("Der
Mann ohne Vorurteile", 1773) und eiferte in gleicher Weise gegen
die Versunkenheit der Wiener Bühne, zu deren Reform er durch
seine "Briefe über die wienerische Schaubühne" (Wien
1768, 4 Bde.; Neudruck 1884) wesentlich beitrug, wie gegen die
Tortur, welche infolge seiner Schrift "Über Abschaffung der
Tortur" (Zürich 1775) in ganz Österreich wirklich
beseitigt wurde. S. hatte inzwischen (1763) die Professur der
politischen Wissenschaften an der Wiener Universität erhalten;
später wurde er von der Kaiserin Maria Theresia zum Rat, 1779
zum Wirklichen Hofrat bei der Geheimen böhmischen und
österreichischen Hofkanzlei und zum Beisitzer der Studien- und
Zensurkommission, endlich 1810 zum Präsidenten der k. k.
Akademie der bildenden Künste ernannt. Er starb 25. April
1817. Auch auf dem Gebiet des peinlichen Rechts, der Polizei und
des Finanzwesens hat er sich durch Anregung wesentlicher
Verbesserungen großes Verdienst erworben. Diesem Zweck
dienten namentlich das "Handbuch der innern Staatsverwaltung" (Wien
1798) und besonders die "Grundsätze der Polizei, Handlung und
Finanz" (das. 1804, 3 Tle.). Auf der Elisabethbrücke zu Wien
wurde seine Statue (von Hans Gasser) errichtet. Seine "Gesammelten
Schriften" erschienen Wien 1783-87, 13 Bände. Vgl. W.
Müller, Joseph v. S. (Wien 1882); Kopetzky, Joseph und Franz
v. S. (das. 1882); v. Görner, Der Hanswurststreit in Wien und
Joseph v. S. (das. 1885); Simonson, I. v. S. und seine
"Grundsätze der Polizei" (Leipz. 1885).
Sonnenferne und Sonnennähe, s. Aphelium.
Sonnenfinsternis, Himmelserscheinung, bei welcher die
Sonne für eine gewisse Gegend der Erde ganz oder teilweise
durch den Mond verdeckt wird. Der Name S. ist insofern unrichtig,
als die Sonne nicht verfinstert, wie der Mond bei einer
Mondfinsternis, sondern lediglich durch den Mond für das Auge
des Beobachters verdeckt wird. Während daher eine
Mondfinsternis überall, wo der Mond über dem Horizont
steht, in demselben Augenblick und in gleicher Größe
gesehen wird, wird eine S. an verschiedenen Orten zu verschiedenen
Zeiten und in verschiedener Form beobachtet. Eine S. kann nur zur
Zeit des Neumondes eintreten, und es würde bei jedem Neumond
eine solche stattfinden, wenn die Bahn des Mondes mit der Erdbahn
in einer Ebene läge. Da aber beide Ebenen einen Winkel von
5° 8' einschließen, so kann eine S. nur eintreten, wenn
sich der Mond als Neumond in der Nähe eines Knotens,
höchstens 19° 44' von demselben entfernt, befindet. Die
verschiedene Größe der Finsternis hängt davon ab,
in welchem Teil des Mondschattens sich der Beobachter befindet. Ist
in Fig. 1 S der Mittelpunkt der Sonne, M derjenige des Mondes, so
ist der kegelförmige Raum ABC der Kernschatten des Mondes;
innerhalb desselben ist die Sonne vollständig durch den Mond
verdeckt, die S. ist für einen Beobachter in diesem Raum
total. Damit eine solche S. eintrete, darf der Mond nicht über
13 1/3° vom Knoten entfernt sein; auch muß der Mond sich
nahezu in seiner Erdnähe befinden, denn sonst erreicht die
Spitze des Kernschattens die Erde gar nicht. Der Kernschatten ist
rings umgeben von dem Halbschatten, dessen kegelförmige Grenze
durch die Linien AD und BE angedeutet wird. Ein Beobachter
innerhalb dieses Raums sieht nur einen Teil der Sonne und zwar
einen um so größern, je näher dem Rand er steht.
Ein Beobachter in F, Fig. 2, sieht die Sonne, wie es bei K
angegeben ist; die Finsternis ist für ihn (in diesem
Augenblick) partiell. Befindet sich ferner der Beobachter auf der
Verlängerung der Linie SM, so ist für ihn die Finsternis
zentral, der Mondmittelpunkt geht über den Sonnenmittelpunkt
weg; vgl. Fig. 3 und 4, wo G den Beobachtungspunkt, L die S.
darstellt. In Fig. 3 liegt G im Kernschatten, der Mond
erscheint
33
Sonnenfisch - Sonnenkultus.
größer als die Sonne: die S. ist total. In Fig. 4
aber liegt G jenseit der Spitze des Kernschattens, der Mond
erscheint kleiner als die Sonne, und ein leuchtender Ring der
letztern umgibt ihn: die S. ist ringförmig. Jede totale S.
beginnt und endigt mit einer partiellen. Wenn man eine Finsternis
für einen bestimmten Ort schlechthin als partiell bezeichnet,
so bedeutet dies, daß auch zur Zeit der stärksten
Verdeckung noch ein Teil der Sonne sichtbar ist. Man gibt die
Größe einer S. in der Weise an, daß man den
scheinbaren Sonnendurchmesser in zwölf gleiche Teile, Zolle
genannt, teilt und angibt, wieviel solcher Teile bei der
stärksten Verfinsterung bedeckt werden; die S. K in Fig. 2 ist
also neunzöllig. Eine totale Finsternis ist nur von kurzer
Dauer, denn durch die vereinigte Wirkung der Erdrotation und der
Bewegung des Mondes werden schnell andre als die anfänglich
getroffenen Punkte der Erde in den Kernschatten des Mondes
geführt. Für einen einzelnen Ort und zwar am Äquator
kann sie höchstens 8 Minuten währen, und für die
ganze Erde ist ihre größte mögliche Dauer 4 Stunden
38 Minuten. Die Zone, innerhalb deren eine S. total ist, kann am
Äquator nur eine Breite von etwa 30 Meilen haben (gleich dem
Durchmesser des Kernschattens an dieser Stelle); in polaren
Gegenden der Erde dagegen kann diese Breite gegen 200 Meilen
erreichen. Die Längenausdehnung der Zone der Totalität
beträgt nicht selten Tausende von Meilen. Östlich und
westlich sowie nördlich und südlich von der schmalen Zone
der Totalität liegen diejenigen Gegenden, die von dem
Halbschatten des Mondes getroffen werden, in denen also die
Finsternis nur partiell und zwar um so unbedeutender ist, je mehr
ihr Abstand von jener Zone beträgt. Mit Einschluß der
partiellen Finsternis östlich und westlich von der
Totalitätszone kann eine S. im äußersten Fall eine
Gesamtdauer von etwa 7 Stunden haben. Unmittelbar vor und nach der
totalen Finsternis erscheint die Sonne als schmale Sichel, die aber
weniger als den Halbkreis umfaßt, weil der Mond
größer erscheint als die Sonne. Die Berge und
Thäler am Rande des Mondes sind dann selbst bei
mäßiger Vergrößerung mit einer sonst nie zu
erreichenden Schärfe sichtbar. Während der totalen
Finsternis selbst entsteht eine eigentümliche Dunkelheit, der
Himmel erscheint grünlichblau, einige der hellern Sterne
werden sichtbar; die schwarze Mondscheibe aber ist mit einem
lebhaft glänzenden, in heftiger Wallung begriffenen breiten
Lichtring, der Korona, umgeben, von welchem gelbe Strahlen
ausgehen. Auch gewahrt man am Rande des Mondes die Protuberanzen
(vgl. Sonne und Tafel "Sonne"). Partielle Sonnenfinsternisse sind
in der Regel nicht von besondern Erscheinungen begleitet; nur wenn
mehr als drei Viertel der Sonnenscheibe verfinstert werden, bemerkt
man eine Abnahme der Tageshelle. Die Sonnenfinsternisse sind im
allgemeinen häufiger als die Mondfinsternisse. Innerhalb 18
Jahren (der von den Chaldäern mit dem Namen Saros belegten
Periode von 18 Jahren 11 Tagen = 223 synodischen oder 242
Drachenmonaten) ereignen sich nur etwa 29 Mondfinsternisse, dagegen
40 Sonnenfinsternisse, für einen bestimmten Ort aber nur 9,
und unter diesen ist alle 200 Jahre ungefähr eine totale oder
ringförmige. Die letztern sind ungefähr gleich selten. -
über die Vorausbestimmung der Sonnenfinsternisse durch
Rechnung oder Zeichnung vgl. Drechsler, Die Sonnen- und
Mondfinsternisse (Dresd. 1858); Oppolzer, Kanon der Finsternisse
(hrsg. von der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien
1887).
Sonnenfisch (Zeus Cuv.), Gattung aus der Ordnung der
Stachelflosser und der Familie der Makrelen (Scomberoidei), Fische
mit länglich eirundem, hohem, seitlich stark
zusammengedrücktem Körper, vorstreckbarem Maul,
schwachen, nicht zahlreichen Zähnen, einfacher oder doppelter
Rückenflosse, unter oder vor den kleinen Brustflossen
stehender Bauchflosse und nackter oder mit kleinen Schuppen
bedeckter Haut. Sie bewohnen nur das Meer, besonders in niedern
Breiten. Der Heringskönig (Peters-, Christus-, Martinsfisch,
Z. faber L.), 1-1,25 m lang und 15-20 kg schwer, mit zwei
getrennten Rückenflossen, von denen die erste
verlängerte, in Fäden auslaufende Strahlen besitzt, zwei
getrennten Afterflossen, welche die Bildung der Rückenflosse
bis zu einem gewissen Grad wiederholen, großen Bauch-,
kleinen Brustflossen und gabelförmigen Stacheln auf der
Bauchschneide, ist im Norden graugelb, im Mittelmeer oft
goldfarben, mit einem runden, schwarzen Fleck auf jeder Seite,
bewohnt das Atlantische und das Mittelmeer, kommt nicht selten an
den englischen Küsten vor, bevorzugt die hohe See, lebt
einzeln, folgt aber den Zügen des Pilchards an die Küste,
nährt sich von Fischen, Sepien und Krustern und wird seines
schmackhaften Fleisches halber seit dem Altertum
geschätzt.
Sonnenflecke, s. Sonne, S. 29.
Sonnengeflecht, s. Plexus.
Sonnengläser, Scheiben aus dunkel gefärbtem
(London smoke) oder schwach versilbertem Glas, welche bei
Beobachtung der Sonne zur Dämpfung des Lichts am Okular des
Fernrohrs angebracht werden. Zur Beobachtung einer Sonnenfinsternis
ohne Fernrohr genügt ein Stück über einer Flamme
gleichmäßig angerußtes Fensterglas.
Sonnengold, Pflanze, s. Helichrysum.
Sonnengott, s. Apollon und Helios.
Sonnenherde, geheiligte Viehherde des Sonnengottes
(Helios). Es gab deren mehrere im Altertum, zu Erytheia, Apollonia
und auf Thrinakia. Am bekanntesten ist die letztere durch die
Odyssee geworden. Es waren sieben Herden Kühe und sieben
Herden Lämmer, jede zu 50 Stück, an denen der Sonnengott
seine Freude hatte; als die Gefährten des Odysseus, von Hunger
getrieben, einige derselben schlachteten, zürnte Helios
unversöhnlich und sendete Unheil. Wahrscheinlich werden durch
die 7*50 Kühe und Lämmer die Tage und Nächte des
Mondjahrs angedeutet. Auch der Stier des Minos auf Kreta
gehörte zu einer S. Der Gigant Alkyoneus hatte die Rinder des
Helios von Erytheia weggetrieben; Herakles erlegte ihn.
Sonnenjahr, die Zeit eines Umlaufs der Erde um die Sonne,
s. Jahr.
Sonnenkälbchen, s. Marienkäfer.
Sonnenkorn, s. Ricinus.
Sonnenkultus (Sonnenanbetung), die Verehrung der Sonne
als einer Licht und Wärme spendenden Gottheit, von deren
Wohlwollen alles Leben auf der Erde abhängt. Bei niedrig
stehenden Völkern äußert sich der S.
hauptsächlich nur in den Zeremonien, die bei
Sonnenfinsternissen zur Verscheuchung des Ungeheuers angewendet
werden, welches nach Ansicht derselben die Sonne zu verschlingen
droht, gewöhnlichen Gestalt eines Wolfs oder Dämons
gedacht, den man ebenso wie den Mondwolf mit Lärm, Geschrei
und Bogenschüssen zu verscheuchen sucht. Auf höherer
Stufe, die in der kulturgeschichtlichen Entwickelung in der Regel
mit der Kupfer- oder Bronzezeit zusammenfällt, fand der mit
Opfern und Zeremonien verknüpfte Kultus gewöhnlich in
Meyers Konv.- Lexikon, 4. Aufl., XV. Bd.
3
34
Sonnenlehen - Sonnenmikroskop.
Anlehnung an ein Sonnenepos statt, in welchem das Lichtprinzip
(Surya der Inder, Ormuzd der Perser, Izdubar oder Nimrod der
Assyrer, Osiris der Ägypter, Herakles der Phöniker und
ältern Griechen, Dionysos der spätern Griechen, Balder
der Germanen etc.) im Kampf mit den Mächten der Finsternis
(Ahriman, Typhon, Loki etc.) gedacht wurde, bald in Form einer
Siegesreise durch die zwölf Himmelszeichen (die zwölf
Thaten des Herakles), bald eines Einzelkampfes dargestellt, bei
welchem der Sonnengott zeitweise (im Winter) unterliegt, in Fesseln
geschlagen, gebunden und geschwächt, auch wohl
verstümmelt wird, weil seine Strahlen alsdann keine Kraft
haben, aber allmählich wieder erstarkt und über seine
Gegner siegt. Als die Hauptfeste dieses Kultus wurden die Zeit der
wieder erstarkenden Sonne, das alte Julfest, und das der
Sonnenstärke (Mittsommerfest) der germanischen Stämme
begangen. Einige Völker feierten auch Klagefeste zur Zeit der
verwundeten Sonne oder des absterbenden Naturlebens, die Adonis-,
Osiris- und Thammuzfeste der assyrischen, ägyptischen und
semitischen Völker, die Dionysien und Bacchusfeste der
Griechen und Römer, die sich in Frühlings- und
Herbstfeier schieden. Bei manchen Völkern, wie z. B. den
Persern, Altmexikanern und Peruanern, fand eine Verschmelzung des
Sonnen- und Feuerdienstes (s. d.) statt, und die Sonnenopfer
mußten an den Hauptfesten mit neuem oder Notfeuer (s. d.)
entzündet werden. In spätern Zeiten wurde der Sonnengott
dann auch wohl als Mittler- und Versöhnungsgott gefeiert,
namentlich im indischen Agni, im persischen Mithra und
griechisch-italischen Dionysos. Vielfach scheint dem ausgebildeten
S. ein Mondkultus mit nächtlichen Mysterien und weiblicher
Priesterschaft vorausgegangen zu sein, namentlich bei solchen
Völkern, wo das Mutterrecht (s. d.) galt und Frauen an der
Spitze der Gemeinwesen standen (Amazonenstaaten). Ein solcher
Kultus findet sich noch heute unter ähnlichen
Verhältnissen bei wilden Völkern Afrikas und Amerikas,
und da Ähnliches in der alten Welt stattgefunden, so
erklärt sich, weshalb die Sonnengottheiten zugleich als
Schützer des Vaterrechts und Unterdrücker der Amazonen
galten, namentlich Apollon, Herakles, Perseus und andre
Sonnenkämpfer. Vgl. Dupuis, L'origine de tous les cultes (Par.
1795, 3 Bde.; neue Ausg. 1835-37).
Sonnenlehen, ehedem Bezeichnung für Besitzungen, die
in niemandes Lehen, vielmehr im vollen Eigentum der Besitzer
standen, bei welchen aber die Sonne als Lehnsherrin fingiert
ward.
Sonnenmaschine, eine Kraftmaschine zur Umsetzung der von
der Sonne gespendeten Wärme in mechanische Arbeit. Der
Gedanke, die Sonnenwärme zur Arbeitsleistung heranzuziehen,
ist alt; doch war erst nach der Ausbildung der mechanischen
Wärmetheorie eine Beurteilung der von einer solchen Maschine
zu erwartenden Leistung möglich. Nach Versuchen von Pouillet,
Herschel und Ericsson beträgt die nutzbar zu machende
Wärmemenge der Sonne pro Quadratmeter der Erdoberfläche
zwischen dem Äquator und dem 43. Breitengrad etwa 10 Kalorien
pro Minute (1 Kalorie oder Wärmeeinheit ist die zur
Erwärmung von 1 kg Wasser um 1° C. erforderliche
Wärmemenge), also 1/6 Kalorie pro Sekunde. Da nun 1 Kalorie
einer Arbeitsmenge von 426 Meterkilogramm gleichwertig ist, so
erhält man pro Quadratmeter 1/6*426=71 Meterkilogramm pro
Sekunde oder 71/75 = 0,95 Pferdekräfte. Um die erforderlichen
Temperaturen zu erzielen, muß die Sonnenwärme mittels
großer Reflektoren konzentriert werden, wozu sich nach
Provostaye und Desains Silberspiegel am besten eignen, welche 92
Proz. der auffallenden Wärme zurückstrahlen. Ferner ist
es nötig, den mit der Sonnenwärme zu heizenden
Körpern (Dampfkesseln, Heiztöpfen) eine möglichst
gut wärmeabsorbierende Oberfläche zu geben (nach Melloni
absorbieren mit Lampenruß geschwärzte Metallflächen
unter Glasbedeckung die Wärmestrahlen am besten). Die bisher
zur Verwertung der Sonnenwärme benutzten Maschinen sind
Heißluft- oder Dampfmaschinen. Ericssons S. besteht aus einer
Heißluftmaschine (s. d.), deren Heiztopf in dem Brennpunkt
eines paraboloidisch gestalteten Brennspiegels liegt. Mouchot heizt
einen Dampfkessel mittels Sonnenstrahlen, indem er ihn in Gestalt
von kupfernen, mit Ruß überzogenen und von einer
Glasglocke überdeckten Röhren in den linearen Fokus eines
trichterförmigen, aus versilberten Blechplatten gebildeten
Reflektors stellt. Der ganze Apparat ist auf einem Gelenksystem so
angebracht, daß er mit seiner Achse leicht dem Lauf der Sonne
folgen kann. Dieser Kessel lieferte mit einem Sonnenrezeptor von
3,8 qm Bestrahlungsfläche zur Winterzeit in Algier 5100 Lit.
Dampf von normalem Druck = 3,1 kg Dampf, welcher ca. 2000 Kalorien
enthält, so daß pro Minute und pro Meter
Bestrahlungsfläche 2000/60.3,8 = 8 2/3 Kalorien oder 87 Proz.
der angegebenen 10 pro Quadratmeter Fläche disponibeln
Kalorien durch Dampfbildung nutzbar gemacht wurden, während
der Rest durch unvollständige Reflexion und Absorption
verloren ging. Eine mit dem Kessel betriebene kleine Dampfmaschine
leistete eine Arbeit von 8 Meterkilogramm pro Sekunde oder 8/75 =
ungefähr 1/9 Pferdekraft, während nach obigen Angaben in
der auf 3,8 qm Fläche fallenden Sonnenwärme 3,8.0,95 =
3,6 Pferdekräfte disponibel sind, so daß nur
8.100/75.3,6 = 3 Proz. der Sonnenwärme ausgenutzt werden.
Demnach wären für eine S. von nur 1 Pferdekraft 9.3,8 =
35 qm und für eine S. von 100 Pferdekräften 3500 qm
Bestrahlungsfläche erforderlich. Dieses ungünstige
Resultat rührt jedoch nicht von der Wärmeübertragung
her, die ja 87 Proz. der Wärme nutzbar macht, sondern ist in
der Natur der Dampfmaschine begründet, welche auch in der
besten Ausführung nur etwa 5-6 Proz. der Wärme eines
Brennmaterials in Arbeit verwandeln kann, während alle
übrige Wärme teils durch Strahlung, teils durch den
Schornstein, zum größten Teil jedoch durch den
abziehenden Dampf, bez. das Kondensationswasser verloren geht.
Solange es daher keine Maschine gibt, welche die Wärme
bedeutend besser ausnutzt als die Dampfmaschine, wird die S.
schwerlich, auch nicht in den für sie günstigsten
Tropenländern, eine nennenswerte Verwendung finden
können.
Sonnenmesser, s. v. w. Heliometer (s. d.).
Sonnenmikroskop, Vorrichtung, um vergrößerte
Bilder sehr kleiner Gegenstände auf einem Schirm, für
viele Zuschauer gleichzeitig sichtbar, zu entwerfen. Sein
wesentlichster Teil ist eine in die Röhre e (s. Figur, S. 35)
bei d eingeschraubte Konvexlinse von kurzer Brennweite, welche von
einem kleinen, gewöhnlich zwischen zwei Glasplatten
gefaßten und bei cc etwas außerhalb der Brennweite der
Linse d festgeklemmten Gegenstand auf einem Schirm ein riesiges
Bild entwirft. Da die Lichtmenge, welche von dem kleinen Gegenstand
ausgeht, sich auf die im Verhältnis enorm große
Fläche des Bildes verteilt, so begreift man, daß der
Gegenstand sehr hell erleuchtet sein muß, wenn das Bild nicht
zu lichtschwach
35
Sonnenorden - Sonnenthal.
ausfallen soll. Die starke Beleuchtung des Gegenstandes wird
bewirkt durch eine große Konvexlinse a am Ende des weiten
Rohrs, welches den Hauptkörper des Instruments ausmacht;
dieselbe sammelt unter Beihilfe der kleinern Linse b die zur
Beleuchtung bestimmten Lichtstrahlen aus dem kleinen Gegenstand.
Eine Zahnstange mit Trieb dient dazu, den Objektträger cc in
den Brennpunkt der Beleuchtungslinsen einzustellen, eine andre hat
den Zweck, durch Verschiebung der Fassung de das Bild genau auf den
Schirm zu bringen. Zur Beleuchtung wird entweder Sonnenlicht
benutzt, indem man die Vorrichtung als eigentliches "S." in die
Öffnung eines Fensterladens einsetzt und ihm durch einen
Spiegel (Heliostat, s. d.) die Sonnenstrahlen zuführt; oder
man beleuchtet das Mikroskop mit elektrischen. oder mit
Drummondschem Kalklicht (s. Knallgas), für welche Fälle
man ihm die überflüssigen Namen photoelektrisches
Mikroskop und Hydrooxygenmikroskop (Knallgasmikroskop) beigelegt
hat.
Sonnenorden, 1) Argentinischer S., Stifter und
Stiftungszeit unbekannt; das Ordenszeichen besteht in einer
goldenen Medaille, welche die Sonne, umgeben von einem
Lorbeerkranz, zeigt. - 2) Persischer Sonnen- und Löwenorden,
1808 von Schah Feth Ali gestiftet unter dem Namen
Nishan-i-Schir-u-Khorschid für Zivil- und
Militärverdienst, erhielt seine Organisation nach dem Muster
der französischen Ehrenlegion von Ferukchan und hat fünf
Klassen. Die Großkreuze tragen einen achtstrahligen
silbernen, brillantierten Stern, in der Mitte von einer dreifachen
Perlenreihe umgeben, das Bild des schwerttragenden Löwen,
stehend für Perser, liegend für Ausländer, mit der
aufgehenden Sonne; die zweite Klasse den siebenstrahligen Stern;
die dritte Klasse mit sechs Strahlen um den Hals; die vierte die
Dekoration mit fünf Strahlen und einer Rosette im Knopfloch
und die fünfte die fünfstrahlige Dekoration ohne Rosette.
Blau, Rot oder Weiß ist die Farbe des Bandes für die
Perser, Grün für die Ausländer.
Sonnenparallaxe, s. Parallaxe u. Sonne, S. 28.
Sonnenrauch, s. Herauch.
Sonnenring, s. Hof, S. 604 f.
Sonnenrisse, das Aufreißen der Rinde von
Bäumen im Frühling auf der Südseite, hervorgerufen
durch die starke Erwärmung und Austrocknung durch die Sonne,
wahrscheinlich nach vorangehenden Spätfrösten.
Sonnenröschen, s. Helianthemum.
Sonnenrose, s. Helianthus.
Sonnenscheibe, geflügelte (Tebta), ein in der
ägyptischen Architektur häufig angewandtes Symbol des
Gottes Horos von Apollinopolis magna (Edfu). Es findet sich zumeist
über den Thüren und Thoren der Tempel gleichsam als
Abwehr des Bösen ausgemeißelt. Um die Scheibe winden
sich gewöhnlich zwei Uräusschlangen, die Ober- und
Unterägypten symbolisieren (s. Abbild.). Die spätere Zeit
hat die Bedeutung, welche der geflügelten S. in den
Kämpfen des Horos gegen Seth beigelegt wurde, in einer Sage
weiter ausgebildet.
Sonnenschein, Franz Leopold, Chemiker, geb. 13. Juli 1817
zu Köln, erlernte daselbst die Pharmazie, errichtete in den
30er Jahren in Berlin ein kleines Laboratorium und bereitete in
Gemeinschaft mit einem Arzt andre Apotheker auf das Staatsexamen
vor. Gleichzeitig studierte er Chemie und habilitierte sich 1852
als Privatdozent. Er widmete sich speziell der analytischen Chemie
und entfaltete eine sehr ausgedehnte praktische Thätigkeit,
durch welche er ein Ansehen gewann wie kaum ein Chemiker vor ihm.
Viele technische Unternehmungen verdankten ihm hauptsächlich
ihren Erfolg. Die analytische und die gerichtliche Chemie
förderte er durch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen.
Er starb 26. Febr. 1879 als Professor an der Universität in
Berlin. Von seinen Schriften sind hervorzuheben: "Anleitung zur
chemischen Analyse" (Berl. 1852, 3. Aufl. 1858); "Anleitung zur
quantitativen chemischen Analyse" (das. 1864); "Handbuch der
gerichtlichen Chemie" (2. Aufl. von Clafsen, das. 1881) und
"Handbuch der analytischen Chemie" (das. 1870-71, 2 Bde.).
Sonnenscheinautograph, s. Insolation.
Sonnenstein, s. Adular, Bernstein (S. 785), Korund und
Oligoklas.
Sonnenstein, Schloß, s. Pirna.
Sonnensteine, s. Gräber, prähistorische.
Sonnenstich (Insolation, Heliosis), im weitern Sinn alle
Krankheitserscheinungen, welche durch anstrengende Bewegungen bei
hoher Wärme auftreten (s. Hitzschlag); im engern Sinn eine
Reihe von Erregungszuständen, Delirien mit Selbstmordideen,
welche bei marschierenden Soldaten in den Tropen unter Einwirkung
direkter Sonnenstrahlung beobachtet worden sind und als Wirkung der
strahlenden Wärme auf das Gehirn aufgefaßt werden. Vgl.
Jacubasch, S. und Hitzschlag (Berl. 1879).
Sonnensystem, die Gesamtheit der Weltkörper, welche
sich um die Sonne als Zentralkörper bewegen, mit
Einschluß der Sonne selbst. Vgl. Karte "Planetensystem".
Sonnentafeln, astronom. Tafeln, welche den Himmelsort der
Sonne für den Mittag jedes Tags angeben. Große
Verdienste um Herstellung guter S. erwarb sich der italienische
Astronom Carlini, dessen Werk (Mail. 1810) von Bessel durch
Korrektionstafeln noch mannigfach verbessert worden ist (1827).
Ältere Tafeln besitzen wir von Lacaille, Mayer, Zach (1804)
und Delambre (1805); die genaueren sind gegenwärtig die von
Hansen und Olufsen (Kopenh. 1853) und Leverrier (Par. 1858).
Sonnentag, s. Sonnenzeit.
Sonnentau, Pflanzengattung , s. Drosera.
Sonnentaugewächse, s. Droseraceen.
Sonnenthal, Adolf von, Schauspieler, geb. 21. Dez. 1834
zu Pest, mußte infolge plötzlicher Verarmung seiner
Eltern das Schneiderhandwerk ergreifen, wandte sich später,
seiner Neigung folgend und von Dawison ermuntert und
einigermaßen vorbereitet, zur Bühne und debütierte
1851 zu Temesvár als Phöbus im "Glöckner von Notre
Dame". 1852 ging er nach Hermannstadt, von hier 1854 nach Graz und
im Winter 1855-56 nach Königsberg, wo er mit solchem Erfolg
auftrat, daß Laube ihm ein Engagement am Wiener Burgtheater
antrug. Hier trat er im Mai 1856
36
Sonnentierchen - Sonnenzeit.
zum erstenmal (als Mortimer) auf, wurde nach drei Jahren auf
Lebenszeit engagiert und entwickelte sich unter Laubes Leitung zu
einem der bedeutendsten Künstler der Gegenwart. 1881
gelegentlich seines 25jährigen Dienstjubiläums durch
Verleihung des Ordens der Eisernen Krone in den Adelstand erhoben,
wurde er 1884 zum Oberregisseur ernannt und fungierte seit dem
Abgang des Direktors Wilbrandt (Juni 1887) bis Ende 1888 als
artistischer Leiter der Anstalt. Sonnenthals eigentliche
Stärke liegt im Schauspiel und im Lustspiel; als Darsteller
sogen. Salonrollen nimmt er unbestritten den ersten Platz ein. Aus
seinem vielseitigen Repertoire sind Ahasver, Hamlet, Narciß,
Mortimer, Graf Waldemar, Lord Rochester ("Waise von Lowood"),
Fürst Lübbenau ("Aus der Gesellschaft"), Fox, Bolz,
Ringelstern, Posa, Raoul Gérard ("Aus der komischen Oper"),
Gesandtschaftsattaché, Marcel de Prie ("Wildfeuer"),
König ("Esther"), auch Faust, Tell u. a. hervorzuheben. S. hat
auch einige französische Bühnenstücke, z. B. den
"Marquis von Villemer", gewandt und wirksam übertragen.
Sonnentierchen, s. Rhizopoden (2).
Sonnenuhr, eine Vorrichtung, welche die Zeit angibt
mittels der Lage des Schattens, den ein von der Sonne beschienener,
zur Weltachse paralleler Stab (Gnomon oder Weiser) auf eine in der
Regel ebene Fläche, das Zifferblatt, wirft. Nicht selten
bezeichnet man auch die ganze S. mit dem Namen Gnomon (s. d.). Die
einfachste S. ist die Äquinoktialuhr. Bei ihr ist die Ebene,
auf welche der Schatten fällt, senkrecht zum Stab, also
parallel zur Ebene des Äquators, und da die Sonne bei ihrer
scheinbaren täglichen Bewegung sich parallel zu dieser Ebene
bewegt, so rückt der Schatten um ebensoviel Grade auf der
Ebene weiter als die Sonne am Himmel; es entspricht einer jeden
Stunde ein Winkel von 15°. Man erhält das Zifferblatt,
wenn man um den Punkt, in welchem der Stab besestigt ist, einen
Kreis schlägt, denselben in 24 gleiche Teile teilt und die
Radien nach den Teilungspunkten zieht; dreht man nun noch die Ebene
so, daß der eine Radius in die Ebene des Meridians zu liegen
kommt, so fällt auf ihn der Schatten des Stabes mittags, auf
die beiden benachbarten vormittags 11 und nachmittags 1 Uhr etc.
Bei der Horizontaluhr liegt das Zifferblatt horizontal; die
Stundenlinie 12 Uhr liegt auch hier in der Ebene des Meridians,
aber die Winkel, welche die übrigen Stundenlinien mit dieser
ersten einschließen, sind nicht der Zeit proportional,
sondern wenn t diesen Winkel für die Aquinoktialuhr bedeutet
(also t = 15° für 1 Uhr, 30° für 2 Uhr), so
findet man für die geographische Breite ^|phi| den
entsprechenden Winkel u der Horizontaluhr mittels der Gleichung tan
u = sin ^|phi|. tan t. Man kann diesen Winkel auch einfach
konstruieren (s. Figur). Man mache OA = 1, AM = sin ^|phi| (z. B.
für Berlin = 0,798, weil ^|phi| = 52° 30'), errichte AB
rechtwinkelig auf O M und mache Winkel AMC = t; dann ist Winkel AOC
= u. Die Vertikaluhr hat ihr Zifferblatt in einer vertikalen Ebene,
die im einfachsten Fall von O. nach W. geht; die Stundenlinie 12
Uhr liegt in der Ebene des Meridians, und den Winkel u, den irgend
eine andre Stundenlinie mit der mittägigen einschließt,
berechnet man aus dem entsprechenden Winkel t der
Äquinoktialuhr mittels der Formel tan u = cos ^|phi| . tan t.
Man kann demnach u auch auf die in der Figur erläuterte Art
konstruieren, wenn man AM = cos ^|phi| (für Berlin = 0,609)
macht. Äquinoktial- und Horizontaluhren geben alle Stunden an,
solange die Sonne scheint; bei den erstern fällt der Schatten
im Sommerhalbjahr auf die obere, im Winterhalbjahr auf die untere
Seite des Zifferblatts, weshalb auch der Stab nach beiden Seiten
hin gehen muß. Eine Vertikaluhr der beschriebenen Art gibt
aber nur die Zeit von früh 6 bis abends 6 Uhr an.
Übrigens geben die Sonnenuhren nicht die im bürgerlichen
Leben übliche mittlere Zeit, sondern die wahre Sonnenzeit (s.
d.) an. Bei den neuern hemisphärischen Sonnenuhren zeigt ein
schattenwerfendes Fadenkreuz das ganze Jahr hindurch die Sonnenzeit
auf der in einer halben Hohlkugel angebrachten Teilung an. Vgl.
Littrow, Gnomonik (2. Aufl., Wien 1838); Goring, Die S. (Arnsb.
1864); Vidal, La gnomonique (Par. 1876); Mollet, Gnomonique
graphique (7. Aufl., das. 1884).
Sonnenvogel (Pekingnachtigall, Leiothrix luteus Scop.),
Sperlingsvogel aus der Familie der Lärmdrosseln (Timaliidae
Gray), von der Größe der Kohlmeise, oberseits
olivengraubraun, am Kopf gelblich, Kinn und Kehle orange,
unterseits gelblichweiß, an den Seiten graubräunlich, an
den Flügeln schwarz mit orange und am Schwanz braun und
schwarz, mit braunen Augen, korallenrotem Schnabel und
fleischbraunen Füßen, bewohnt dichte Wälder im
Himalaja zwischen 1500 und 2500 m Höhe und in
Südwestchina, nährt sich von allerlei Kerbtieren,
Früchten und Sämereien, ist sehr munter, hat einen
ansprechenden Gesang, legt 3-4 bläulichweiße, rot
getüpfelte Eier und wird in China und Indien seit langer Zeit,
jetzt auch bei uns vielfach als Stubenvogel gehalten und
gezüchtet. S. Tafel "Stubenvögel".
Sonnenweite, die mittlere Entfernung der Erde von der
Sonne, 148,670,000 km oder 20,036,000 geogr. Meilen; sie bildet die
Einheit, nach der man häufig die Entfernungen im Sonnensystem
mißt.
Sonnenwende, Name einiger Pflanzen, s. Cichorium und
Heliotropium.
Sonnenwenden (Solstitien, Solstitial- oder
Sonnenstillstandspunkte), die zwei um 180° voneinander
entfernten Punkte der Ekliptik, welche am weitesten, nämlich
23° 27½', vom Äquator entfernt sind. Der
nördlich vom Äquator gelegene ist der Anfangspunkt des
Sternzeichens des Krebses und heißt die Sommersonnenwende
oder das Sommersolstitium, weil der Durchgang der Sonne durch
denselben den Anfang des astronomischen Sommers der nördlichen
Erdhalbkugel bezeichnet; der südliche dagegen, der
Anfangspunkt des Steinbocks, wird die Wintersonnenwende, das
Wintersolstitium, genannt, weil dort die Sonne zu Anfang des
astronomischen Winters steht. Mit dem Namen S. (Solstitien)
bezeichnet man auch die Zeitpunkte, in denen die Sonne durch diese
Punkte geht; die durch die letztern gelegten Parallelkreise des
Himmels heißen Wendekreise. Vgl. Ekliptik.
Sonnenwendfeier, s. Johannisfest.
Sonnenzeit, die durch die scheinbare tägliche
Bewegung der Sonne bestimmte Zeit im Gegensatz zur Sternzeit, deren
Grundlage der Sterntag (s. Tag) bildet. Der wahre Sonnentag oder
die Zeit zwi-
37
Sonnenzirkel - Sonntag.
schen zwei aufeinander folgenden Kulminationen der Sonne
muß etwas länger sein als der Sterntag, weil die Sonne
unter den Fixsternen von W. nach O. geht; denn kulminiert heute die
Sonne gleichzeitig mit einem Fixstern, so wird sie morgen, wenn der
letztere wieder kulminiert, noch etwas östlich vom Meridian
stehen und diesen erst später erreichen. Die Bewegung der
Sonne in ihrem Parallelkreis bildet die Grundlage für die
Bestimmung der wahren S. Es ist wahrer Mittag, wenn die Sonne im
Meridian steht; nachmittags 1 Uhr, 2 Uhr etc., wenn die Sonne in
ihrem Parallelkreis 15°, 30° etc. westlich vom Meridian
steht. Diese wahre S. wird von den Sonnenuhren angegeben. Die Dauer
eines wahren Sonnentags ist aber im Lauf eines Jahrs
veränderlich, weil die Sonne nicht alle Tage um dasselbe
Stück am Himmel nach O. rückt; am größten, 24
Stunden 0 Minuten 30 Sekunden, ist sie 23. Dez., am kleinsten, 23
Stund. 59 Min. 39 Sek., Mitte September. Diese
Ungleichförmigkeit hat zwei Ursachen. Einmal bewegt sich die
Erde in ihrer elliptischen Bahn mit veränderlicher
Geschwindigkeit, in der Sonnennähe rascher als in der
Sonnenferne; dem entsprechend ist auch die scheinbare Bewegung der
Sonne in der Ekliptik ungleichförmig. Ferner sind aber auch
die verschiedenen Stücke der scheinbaren Sonnenbahn (Ekliptik)
ungleich geneigt gegen den Äquator. In der Nähe der
Solstitialpunkte liegt sie parallel zum Äquator, in den
Äquinoktien schneidet sie denselben unter 23½°; an
den letztern Punkten wird daher das Vorrücken nach O. (die
Vergrößerung der Rektaszension) nur einen Bruchteil der
scheinbaren Belegung in der Ekliptik betragen, während in den
Solstitien beide Bewegungen gleich sind. So wie die Sonnentage,
sind auch die einzelnen Stunden von ungleicher Länge. Deshalb
eignet sich die wahre S. nicht für die Zwecke des
bürgerlichen Lebens; man kann auch keine mechanischen Uhren
herstellen, welche dieselbe angeben. Andernteils würde es
unzweckmäßig sein, im bürgerlichen Leben nach
Sternzeit zu rechnen, da der Anfang des Sterntags bald auf den Tag,
bald auf die Nacht fällt. Deshalb rechnet man nach mittlerer
Zeit. Die Sonne braucht, um in der Ekliptik vom Frühlingspunkt
bis wieder zu demselben Punkt zu gelangen (tropisches Jahr)
366,2422 Sterntage; sie selbst geht in dieser Zeit einmal weniger
durch den Meridian als ein beliebiger Fixstern, und man teilt daher
diesen Zeitraum in 365,2422 gleich lange Abschnitte, die man
mittlere Tage nennt, und deren jeder wieder in 24 gleich lange
Standen zu 60 Minuten zu 60 Sekunden zerfällt. Da 365,2422
mittlere Tage = 366,2422 Sterntagen sind, so ist 1 mittlerer Tag =
1 Tag 3 Min. 56,55 Sek. Sternzeit und 1 Sterntag = 1 Tag weniger 3
Min. 55,91 Sek. mittlerer Zeit. Viermal im Jahr, nämlich 15.
April, 14. Juni, 31. Aug. und 24. Dez., fällt die wahre S. mit
der mittlern Zeit zusammen; in den Zwischenzeiten ist abwechselnd
die eine oder die andre voraus. Den Unterschied beider nennt man
die Zeitgleichung. Man gibt dieselbe in mittlerer Zeit an und zwar
positiv, wenn man sie zur wahren Zeit addieren muß, um die
mittlere zu finden, negativ, wenn sie zu subtrahieren ist. Gibt
also eine Sonnenuhr nachmittags 4 Uhr 30 Min. an, und ist die
Zeitgleichung +12 Min., so ist es nach mittlerer Zeit um 4 Uhr 42
Min.; wäre aber die Zeitgleichung -12 Min., so hätte man
erst 4 Uhr 18 Min. mittlere Zeit. Die astronomischen
Jahrbücher geben die Zeitgleichung für den wahren Mittag
eines bestimmten Meridians (das Berliner "Astronomische Jahrbuch"
für den Meridian von Berlin) von Tag zu Tag an. Statt dessen
findet man in den meisten Kalendern die mittlere Zeit im wahren
Mittag verzeichnet, die man durch Addition (bez. Subtraktion) der
Zeitgleichung zu 12 Uhr erhält; statt Zeitgleichung +12 Min.
30 Sek. findet man also mittlere Zeit im wahren Mittag 12 Uhr 12
Min. 30 Sek. Weitere Zahlenangaben erscheinen hier unnötig;
nur die größten Werte, welche die Zeitgleichung im Lauf
des Jahrs erreicht, mögen noch erwähnt werden,
nämlich:
+ 14 Min. 34 Sek. - 3 Min. 53 Sek.
am 12. Febr., 14. Mai,
+ 6 Min. 12 Sek. - 16 Min. 18 Sek.
am 26. Juni, 18. Nov.
Mit der Zeitgleichung im Zusammenhang steht noch der Umstand,
daß die Zeiten des Auf- und Unterganges der Sonne, die in
unsern Kalendern verzeichnet sind, nicht gleich weit von mittags 12
Uhr abstehen. So findet man z. B. für Leipzig 1. Juli den
Sonnenaufgang um 3 Uhr 50 Min. früh und den Untergang 8 Uhr 17
Min. abends angegeben; das Mittel aus beiden Zeiten ist 12 Uhr
3½ Min. mittags. Dies ist aber annähernd die Zeit des
wahren Mittags (12 Uhr 3 Min. 33 Sek.). Ganz genau gleich weit vom
wahren Mittag entfernt sind übrigens die Momente des Auf- und
Unterganges nicht wegen der ungleichen Bewegung der Sonne in der
Ekliptik. Vgl. Förster, Ortszeit und Weltzeit (Berl.
1884).
Sonnenzirkel, s. Kalender, S. 383.
Sonnewalde, Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Frankfurt, Kreis Luckau, hat eine Dampfbrauerei und (1885) 1152
Einw. Dabei das Schloß S. des Grafen von Solms.
Sonnino, Dorf in der ital. Provinz Rom, Kreis Frosinone,
in den Volsker Bergen gelegen, mit (1881) 3200 Einw., Geburtsort
des Kardinals Antonelli, war früher ein berüchtigtes
Räubernest und wurde deshalb 1819 teilweise zerstört.
Sonntag (Dies Solis), der Tag der Sonne (althochd.
Sunnentac, altnord. Sunnudaga, engl. Sunday, niederländ.
Sondag, schwed. Sondag, dän. Sondag), im Brauch der Kirche der
erste Tag der Woche und als Tag des Herrn (dies dominicus oder
dominica, woraus das franz. dimanche, das ital. domenica, das span.
und portug. domingo gebildet worden ist) zugleich der
wöchentliche Ruhe- und Feiertag der Christen. Wiewohl sich im
Neuen Testament kein bestimmtes Gebot für denselben findet
(doch vgl. 1. Kor. 16, 2; Offenb. 1, 10; Apostelgesch. 20, 7), ward
er schon im nachapostolischen Zeitalter als Auferstehungstag
Christi neben dem jüdischen Sabbat gefeiert, und zwar als
Freudentag. Mit dem Aufgeben der Heilighaltung des Sabbats trug man
viele der auf diesen bezüglichen Anschauungen auf den S.
über; doch datieren förmliche Verbote irdischer, nicht
ganz dringender Geschäfte an Sonntagen von seiten der
weltlichen Obrigkeit erst aus der Zeit Konstantins d. Gr., und
Kaiser Leo III. (717-741) untersagte endlich jegliche Arbeit an
diesem Tag. Die Reformatoren wollten den S., ohne Berufung auf ein
göttliches Gebot, bloß der Zweckmäßigkeit
wegen beobachtet wissen. Dagegen hat schon Beza die Ansicht
vertreten, daß der S. eine göttliche Einsetzung und an
die Stelle des jüdischen Sabbats getreten sei, und so hat sich
auf reformiertem Gebiet, besonders in England, Schottland und
Nordamerika, die strengste Form der Sonntagsfeier bis auf den
heutigen Tag erhalten, selbst wenn die bezüglichen Gesetze
nicht mehr aufrecht erhalten werden. In
38
Sonntagsbuchstabe - Sonometer.
Frankreich dagegen ist seit der großen Revolution der
Unterschied zwischen Sonn- und Wochentagen thatsächlich
aufgehoben worden. Auch in Italien sind alle auf Nichtbeobachtung
der Feiertage gesetzten Strafen gesetzlich beseitigt. Die neuere
Gesetzgebung in Deutschland, namentlich in Preußen, ist von
dem durch die Humanität gebotenen Gesichtspunkt ausgegangen,
daß der Staat alle offiziellen Amtshandlungen am S. zu
untersagen, bei seinen eignen Unternehmungen die Sonntagsarbeit zu
vermeiden und die Tagelöhner, Dienstboten und Fabrikarbeiter
gegen die Forderungen ihrer Herren vor Sonntagsarbeit zu
schützen hat. Die deutsche Gewerbeordnung (§ 136)
verbietet die Beschäftigung von jugendlichen Arbeitern an
Sonn- und Festtagen; auch können die Gewerbtreibenden die
Arbeiter an Sonn- und Festtagen zum Arbeiten nicht verpflichten
(§ 105). Auch die evangelische Kirche hat neuerdings ihre
Aufmerksamkeit wieder auf diesen Punkt gelenkt und ist dabei
vornehmlich dem Mißbrauch des Sonntags zu Vergnügungen
und Ausschweifungen entgegengetreten. Ein "internationaler
Kongreß für Sonntagsruhe" tagte 1877 in Genf, 1879 in
Bern. Die jetzt noch gewöhnlichen Namen der Sonntage kommen
teils von den Festen her, denen sie folgen, teils von den
Anfangsworten der alten lateinischen Kirchengesänge oder
Kollekten, welche meistens aus den Psalmen entlehnt waren. Unsre
Kalendersonntage sind: 1) ein S. nach Neujahr, der jedoch nur in
solchen Jahren eintritt, in welchen Neujahr auf einen der vier
letzten Wochentage fällt; 2) zwei bis sechs Sonntage nach
Epiphania (s. d.); 3) die Sonntage Septuagesimä,
Sexagesimä und Estomihi (Ps. 71, 3); 4) die Fastensonntage
Invokovit (Ps. 91, 15), Reminiscere (Ps. 25, 6), Okuli (Ps. 25,
15), Lätare (Jes. 66, 10), Judika (Ps. 43, 1) und der
Palmsonntag (s. d.); 5) sechs Sonntage nach Ostern: Quasimodogeniti
(1. Petr. 2, 2), Misericordias Domini (Ps. 23, 6, oder 89, 2),
Jubilate (Ps. 66, 1), Kantate (Ps. 96, 1), Rogate (Matth. 7, 7) und
Exaudi (Ps. 27, 7); 6) die Trinitatissonntage, deren Anzahl von dem
frühern oder spätern Eintritt des Osterfestes
abhängt und höchstens 27 beträgt; 7) die vier
Adventsonntage (s. Advent); 8) ein S. nach Weihnachten, welcher nur
dann eintritt, wenn das Weihnachtsfest nicht auf den Sonnabend oder
S. fällt. Vgl. Litteratur bei Kirchenjahr; ferner: Henke,
Beiträge zur Geschichte der Lehre von der Sonntagsfeier
(Stendal 1873); Zahn, Geschichte des Sonntags, vornehmlich in der
alten Kirche (Hannov. 1878); Rauschenbusch, Der Ursprung des
Sonntags (Hamb. 1887); Grimelund, Geschichte des Sonntags
(Gütersl. 1889); Lammers, Sonntagsfeier in Deutschland (Berl.
1882); "Gesetze und Verordnungen, betreffend die Ruhe an Sonn- und
Feiertagen" (das. 1886); über die Sonntagsfeier vom Standpunkt
der Gesundheitslehre die Schriften von Schauenburg (das. 1876) und
Niemeyer (das. 1877).
Sonntagsbuchstabe, s. Kalender, S. 383.
Sonntagsschulen, dem Wortlaut nach jede Schule, in
welcher am Sonntag unterrichtet wird, was vielfach in den
Fortbildungsschulen (s. d.) der Fall ist. Vorzugsweise bezeichnet
man aber mit dem Namen S. solche Anstalten, in welchen die Jugend
des niedern Volkes durch freiwillige Lehrer und Lehrerinnen der
gebildeten Stände im religiösen Interesse unterrichtet
wird. Solche Schulen gründete schon der Erzbischof Karl
Borromeo von Mailand (gest. 1584), und andre hervorragende
Männer der katholischen Kirche, namentlich J. B. de La Salle,
Stifter der christlichen Schulbrüder, folgten ihm darin. Doch
blieben diese Bestrebungen vereinzelt. Dagegen erwachte im letzten
Viertel des vorigen Jahrhunderts in England und Schottland ein
begeisterter Eifer für die Gründung von S., welcher sich
in alle Länder der angelsächsischen Zunge, besonders nach
Nordamerika, verbreitet hat. Nach einigen sollen die ersten
englischen S. von den Töchtern des Geistlichen More zu Hanham
bei Bristol, namentlich von der auch als Schriftstellerin bekannten
Hannah More, gegen 1780 eingerichtet worden sein. Gewöhnlich
wird Robert Raikes, ein reicher Buchdrucker in Gleucester (geb.
1735, gest. 1811), als erster Gründer der S. genannt. Er
gründete 1781 (1784) eine Sunday School in seiner Vaterstadt
und gab die Anregung zu der von William Fox gestifteten London
Sunday School Society (1785), welche in kurzer Zeit
außerordentliche Erfolge aufzuweisen hatte. In Deutschland
entstand 1791 eine Sonntagsschule in München; 1799
gründete Professor Müchler in Berlin eine solche für
Knaben, 1800 der jüdische Menschenfreund Samuel Levi eine
solche für Mädchen. Der Eifer für die S. nahm in
evangelisch-kirchlichen Kreisen seit 1864 noch einmal lebhaften
Aufschwung durch die Bemühungen des Amerikaners Albert
Woodruff aus Brooklyn sowie seiner deutsch-amerikanischen Freunde
Bröckelmann aus Heidelberg und Professor Schaff aus New York,
nachdem schon 1857 die Versammlung der Evangelischen Allianz in
Berlin auf diese bezeichnende Form englischer Kirchlichkeit von
neuem die Aufmerksamkeit gerichtet hatte. Da in Deutschland die
Ergänzung des öffentlichen Schulunterrichts durch private
Wohlthätigkeit im allgemeinen nicht Bedürfnis ist, haben
die S. hier mehr Wesen und Namen der Jugendgottesdienste
angenommen. An S. aller Art waren 1888 in Deutschland nach
glaubhafter Angabe 30,000 Lehrer und Lehrerinnen unter etwa 230.000
Kindern thätig.
Sonometer (Audiometer), ein von Hughes angegebener
Apparat zur Bestimmung der Empfindlichkeit des menschlichen Ohrs,
besteht aus einem Mikrophon (ein vertikal stehendes
Kohlenstäbchen, das mit seinen zugespitzten Enden zwei mit
Klemmschrauben versehene Kohlenstückchen berührt),
welches auf dem Sockel einer Pendeluhr steht und in den
Schließungsbogen einer Batterie aus drei Daniellschen
Elementen eingeschaltet ist; der galvanische Strom
durchfließt ferner zwei etwa 30 cm voneinander entfernte,
miteinander parallele Drahtrollen, deren eine mit einem Draht von
100 m, die andre mit einem Draht von 9 m Länge umwickelt ist.
Zwischen diesen beiden Rollen, auf einem Stab verschiebbar,
befindet sich eine dritte, auf welcher gleichfalls ein Draht von
100 m Länge aufgewunden ist, dessen Enden mit einem Telephon
verbunden sind. Die Drähte der beiden ersten Rollen sind so
gewickelt, daß sie in der mittlern Ströme von
entgegengesetzter Richtung induzieren. Verschiebt man die mittlere
Rolle so lange, bis die in ihr induzierten entgegengesetzten
Ströme gleiche Stärke besitzen, so heben sie sich auf,
und in dem Telephon wird das Ticken der Uhr nicht gehört.
Diese Stellung wird als Nullpunkt bezeichnet und der Abstand
zwischen demselben und der ersten Rolle auf dem Stab in 200 gleiche
Teile (Grade) eingeteilt. Verschiebt man nun die mittlere Rolle
gegen die erste hin, so hört man das Ticken der Uhr im
Telephon zuerst schwach und bei weiterer Verschiebung immer
stärker. Versuche an verschiedenen Personen lehrten, daß
beim ersten Grade das Ticken nur von einem äußerst
empfindlichen Gehörorgan wahrgenommen
39
Sonor - Sontag.
werden kann; die mittlere Empfindlichkeit des menschlichen Ohrs
entspricht den Graden 4-10; Personen, welche bei der Rollenstellung
200 den Schlag der Uhr nicht hören, müssen als absolut
taub angesehen werden.
Sonor (lat.), helltönend, wohlklingend.
Sonora, der nordwestlichste Staat der Republik Mexiko, am
Kalifornischen Meerbusen, umfaßt 197,973 qkm (3595,4 QM.).
Die Küstengegend ist meist flach und im NW. so sandig,
daß selbst die Viehzucht unmöglich wird; das Innere aber
besteht aus Gebirgsland, dicht bewaldet, von fruchtbaren
Thälern durchzogen und reich an Mineralschätzen. Die
wichtigsten Flüsse sind der Yaqui, der Mayo und der S., von
denen die beiden erstern das ganze Jahr durch Wasser haben, der
Sonora aber sich in den sandigen Ebenen von Siete Cerritos
verliert. Das Klima ist auch an der Küste gesund; nur in der
Nähe von den Sümpfen von Santa Cruz kommen Wechselfieber
vor. Von Juni bis zum August bläst gelegentlich der Viento
caliente. Im Innern trifft man alle Extreme der Temperatur, und in
den höher gelegenen Gegenden friert es vom November bis zum
März. Die Bevölkerung betrug 1882: 115,424 Seelen, zum
großen Teil Indianer, den Stämmen der Yaqui, Mayo, Seri,
Papayo, Opata und Apatschen angehörig. Ackerbau ist fast
überall nur bei künstlicher Berieselung möglich,
ergibt dann aber reichen Ertrag an Mais, Weizen, Zuckerrohr,
Bohnen, Baumwolle, Kaffee, Tabak, Indigo etc. Wein und alle Arten
von Obst gedeihen vortrefflich. Auch die Viehzucht ist von
Bedeutung. Die Austern- und Perlenfischerei wird mit Erfolg
getrieben. Der Bergbau beschäftigte 1878: 5600 Menschen und
ergab einen Ertrag von 1,640,272 Pesos, vornehmlich Gold und
Silber. Außerdem findet man aber auch Kupfer, Eisen (im N.),
Graphit (bei San José de la Pimas) und Steinkohlen (Santa
Clara). Die Industrie beschränkt sich auf Baumwollfabrikation
(4 Fabriken), Hut- und Schuhmacherei, Seifensiederei etc.
Hauptartikel der Ausfuhr sind Edelmetalle, Erze, Häute und
Hüte. Hauptstadt ist Hermosillo, wichtigster Hafen Guaymas. S.
Karte "Mexiko". - Die sonorischen Sprachen bilden nach den
Untersuchungen Professor Buschmanns einen weitverzweigten
Sprachstamm, der nicht allein in S., sondern im ganzen
nördlichen Mexiko sowie im südlichen Arizona und
Kalifornien herrscht; auch die Sprache der Schoschonen oder
Schlangenindianer im Felsengebirge, der Juta in Utah u. a.
gehören zu demselben. Vgl. Buschmann, Die Spuren der
aztekischen Sprache im nördlichen Mexiko; Derselbe, Die
Zahlwörter in den sonorischen Sprachen (in den "Abhandlungen
der Akademie der Wissenschaften", Berl. 1859 u. 1867).
Sonrhai (Songhay), Negerstamm im westlichen Sudân,
zu beiden Seiten des mittlern Niger, bildete ehemals ein
großes Reich, welches 1009 den Islam annahm, unter dem Sultan
Askia, einem der größten afrikanischen Eroberer,
mächtig erweitert, zu Ende des 15. Jahrh. das ganze innere
Nordafrika bis östlich zum Tschadsee umfaßte, Garo zur
Hauptstadt hatte und 1592 durch die Marokkaner zerstört wurde.
Zu ihm gehörte auch Timbuktu. Nach Barth besitzen die S.
feinere, edlere Züge von kleinern Umrissen, die Gestalten sind
schlank, die Beine wadenlos. Die Sprache der S. ist neuerdings von
Barth und Lepsius, ausführlicher von Fr. Müller
("Grundriß der Sprachwissenschaft", I, 2, Wien 1877)
dargestellt, der sie für völlig isoliert hält.
Sonsonate, Stadt im zentralamerikan. Staat Salvador, am
Rio Grande, in reizender, aber von Erdbeben oft heimgesuchter
Gegend, hat lebhaften Handel und (1878) 5127 Einw. Eisenbahnen
verbinden die Stadt mit den Häfen Acajutla und Libertad. S.
wurde 1524 von Pedro de Alvarado gegründet.
Sontag, 1) Henriette, Gräfin Rossi,
Opernsängerin, geb. 3. Jan. 1806 zu Koblenz, wo ihre Eltern
als Schauspieler wirkten, erhielt ihre musikalische Ausbildung im
Konservatorium zu Prag, debütierte daselbst in ihrem 15. Jahr
als Prinzessin in "Johann von Paris" mit großem Erfolg, ging
darauf mit ihrer Mutter nach Wien, wo sie an der Deutschen und
Italienischen Oper mitwirkte, ward 1824 am neuen
Königstädter Theater in Berlin engagiert und bald darauf
zur Hof- und Kammersängerin ernannt. Zwei Jahre später
trat sie ihre erste Reise nach Paris an, wo sie einen
unbeschreiblichen Enthusiasmus erregte und 1827 für zwei Jahre
Engagement annahm. Nachdem sie sich 1828 insgeheim mit dem Grafen
Carlo Rossi, damals Geschäftsträger des sardinischen Hofs
im Haag, verheiratet hatte, trat sie nur noch als
Konzertsängerin auf, besuchte als solche Petersburg und Moskau
und kehrte dann über Hamburg nach den Niederlanden
zurück, wo bald darauf die öffentliche Bekanntmachung
ihrer Heirat erfolgte. Bedeutende Vermögensverluste
veranlaßten sie, 1849 zur Bühne zurückzukehren, und
der Zauber ihrer Persönlichkeit, die ungeschmälerte
Frische und Lieblichkeit ihrer Stimme verschafften ihr überall
den frühern Beifall. 1853 unternahm sie eine Kunstreise nach
Amerika und feierte auch hier die glänzendsten Triumphe, starb
aber 17. Juni 1854 in Mexiko an der Cholera. Ihr Leichnam ward im
Kloster Marienthal bei Ostritz in der sächsischen Lausitz
beigesetzt. In ihrer Blütezeit besaß Frau S. neben der
äußersten Reinheit, Klarheit und Biegsamkeit der Stimme
eine unübertreffliche Leichtigkeit, Sauberkeit und Anmut des
Vortrags. Sie erschütterte nicht durch imponierende
Stimmfülle, bezauberte aber durch die Grazie ihres Gesanges,
besonders in Koloraturen, welche sie größtenteils mit
halber Stimme, aber mit der vollkommensten Deutlichkeit vortrug.
Namentlich im Sentimentalen und Scherzhaften war sie
unvergleichlich. Gundling hat ihr Jugendleben zu dem Kunstroman
"Henriette S." (Leipz. 1861, 2 Bde.) benutzt. In der
Selbstbiographie ihres Bruders sind zahlreiche sie betreffende
biographische Einzelheiten enthalten.
2) Karl, Schauspieler, Bruder der vorigen, geb. 7. Jan. 1828 zu
Dresden, begann seine Bühnenlaufbahn 1848 am dortigen
Hoftheater, war 1851-52 am Hofburgtheater in Wien thätig und
folgte dann einem Ruf nach Schwerin, wo er sieben Jahre lang die
ersten Helden- und Bonvivantrollen spielte. Im J. 1859 wurde er in
Dresden, 1862 in Hannover angestellt, wo er sich
ausschließlich dem Lustspiel widmete; seit 1877 gibt er nur
Gastrollen, die ihn wiederholt auch nach Nordamerika führten.
1885 siedelte er nach Dresden über. S. versteht seinen
Lebemännern und sogen. Chargen so drollige Züge zu
verleihen, daß sie eine unwiderstehliche Wirkung
ausüben. Zu seinen bedeutendsten Rollen gehören Doktor
Wespe, Orgon ("Tartüffe"), Petrucchio, Bolingbroke,
Königsleutnant, auch Nathan, Karlos u. a. S. hat sich auch als
Schriftsteller versucht; er veröffentlichte das
Theaterstück "Frauenemanzipation" (Hannov. 1875), das die
Runde über alle Bühnen machte, und ein sehr
rückhaltlos urteilendes autobiographisches Werk unter dem
Titel: "Vom Nachtwächter zum türkischen Kaiser" (3.
Aufl., Hannov. 1876), das Veranlassung zu seiner Entlassung aus dem
Verband des hannoverschen Hoftheaters (1877) wurde.
40
Sonthofen - Sophie.
Sonthofen, Flecken und Bezirksamtshauptort im bayr.
Regierungsbezirk Schwaben, an der Iller und der Linie
Immenstadt-Oberstorf der Bayrischen Staatsbahn, 742 m ü. M.,
hat eine kath. Kirche, ein Schloß, ein Amtsgericht, ein
Hüttenwerk, Baumwollweberei, sehr besuchte Viehmärkte und
(1885) 1819 Einw. Nordöstlich erhebt sich der Grünten (s.
d.).
Sontra, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Kassel,
Kreis Rotenburg, am Flüßchen S. und an der Linie
Frankfurt-Bebra-Göttingen der Preußischen Staatsbahn,
242 m ü.M., hat eine evang. Kirche, ein Schloß, ein
Amtsgericht, Branntweinbrennerei, Preßhefenfabrikation,
Schlauchweberei, Molkerei, Schwerspatmüllerei und (1885) 1945
Einw. Vgl. Collmann, Geschichte der Bergstadt S. (Kassel 1863).
Sontschi, chines. Stadt, s. Kutschun.
Sonus (lat.), Schall, Klang.
Soodbrot, s. Ceratonia.
Soole, s. Sole.
Soonwald, s. Hunsrück.
Soor, s. Schwämmchen.
Soor (Sohr, Sorr), Dorf südwestlich von Trautenau im
nordöstlichen Böhmen, ist durch zwei preußische
Siege berühmt geworden. Friedrich d. Gr. schlug hier 30. Sept.
1745 mit 19,000 Mann die Österreicher und Sachsen, welche,
32,000 Mann stark, vom Prinzen Karl von Lothringen befehligt
wurden; einem beabsichtigten Überfall der letztern auf das
preußische Lager von den Höhen von Burkersdorf aus kam
Friedrich durch einen Angriff auf diese zuvor, erstürmte sie
und sicherte sich dadurch den Rückzug durch das Gebirge nach
Schlesien. Bei dem zweiten Gefecht von Trautenau (s. d.), 28. Juni
1866 gegen Gablenz, ward das Dorf von der 1. preußischen
Gardedivision unter General Hiller v. Gärtringeu
erstürmt. Vgl. Kühne, Das Gefecht bei S. ("Kritische
Wanderungen" Heft 4 u. 5, 2. Aufl., Berl. 1887).
Soorpilz, s. Oidium.
Soovar, Ort, s. Sovar.
Sopha, s. v. w. Sofa.
Sopher (hebr., "Schreiber"), in älterer Zeit
Schriftgelehrter, heutzutage der Gesetzrollen-, Tefillin- und
Mesusotschreiber in größern jüdischen
Gemeinden.
Sophia (griech.), Weisheit.
Sophie (Sophia), weiblicher Name. Unter den
fürstlichen Trägern desselben sind hervorzuheben:
[Hannover.] 1) Kurfürstin von Hannover, geb. 14. Okt. 1630
im Haag als zwölftes Kind des flüchtigen
"Winterkönigs", Friedrichs V. von der Pfalz, und der Elisabeth
Stuart, fühlte sich im Haus ihrer kaltherzigen Mutter
höchst unglücklich, begab sich daher zu ihrem Bruder Karl
Ludwig, nachdem derselbe 1648 die Kurpfalz zurückerhalten
hatte, nach Heidelberg und vermählte sich 1658 mit dem Herzog
Ernst August von Hannover, der 1692 Kurfürst ward.
Hochmütigund hartherzig, verfolgte sie ihre Schwiegertochter
Sophie Dorothea von Celle (s. S. 2) mit unversöhnlichem
Haß und führte deren gerichtliche Scheidung herbei. Seit
23. Okt. 1698 Witwe, ward sie als Enkelin König Jakobs I. 22.
März 1701 zur Erbin von England erklärt, und nach ihrem
Tod (8. Juni 1714) bestieg ihr ältester Sohn, Georg Ludwig,
31. Okt. 1714 den Thron von Großbritannien. Mit ihren
pfälzischen Verwandten führte sie einen sehr lebhaften
Briefwechsel, so mit ihrem Bruder, dem Kurfürsten Karl Ludwig
(hrsg. von Bodemann in den "Publikationen aus den preußischen
Staatsarchiven", Bd. 26, Leipz. 1885), und ihrer Nichte Elisabeth
Charlotte von Orléans (hrsg. von Bodemann, das., Bd. 37,
1888; s. Elisabeth 3). Ihre Memoiren gab Köcher heraus (das.,
Bd. 4, 1879).
2) S. Dorothea, bekannt als Prinzessin von Ahlden, geboren im
Herbst 1666, war die einzige Tochter und Allodialerbin des Herzogs
Georg Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg-Celle und der Eleonore
d'Olbreuse (s. d.) und wurde 1682 mit dem Erbprinzen Georg Ludwig
von Hannover (später als Georg I. König von England)
vermählt. Vortrefflich gebildet und sehr schön, vermochte
sie doch nicht, ihren Gemahl, der den Haß seiner Mutter, der
Herzogin Sophie, gegen S., die Tochter der d'Olbreuse, geerbt
hatte, zu fesseln. Nachdem sie ihm einen Sohn, den nachmaligen
König Georg II., und eine Tochter, Sophie Dorothea (die
spätere Gemahlin König Friedrich Wilhelms I. von
Preußen, s. unten 5), geboren, sah sie sich nicht nur von ihm
oft rauh behandelt, sondern auch von der Mätresse ihres
Schwiegervaters Ernst August, der Gräfin von Platen, im
geheimen verfolgt. Denn da der Zweck der Heirat, die Vereinigung
Celles mit Hannover, nun gesichert war, legten der Kurfürst
Ernst August und seine Gemahlin Sophie ihrem Haß gegen ihre
Schwiegertochter keine Zügel mehr an. Unvorsichtige
Bevorzugung des Grafen Philipp Christoph von Königsmark (s. d.
2), der am Hof ihres Vaters als Page aufgewachsen war, gab dem
hannöverschen Hof den Vorwand, S. eines anstößigen
Verhältnisses mit Königsmark zu beschuldigen. Als S. den
Vater nicht für eine Lösung ihrer Ehe gewinnen konnte,
verabredete sie für den 2. Juli 1694 mit Königsmark die
Flucht nach Wolfenbüttel zu ihrem Verwandten, dem Herzog Anton
Ulrich. Am Abend des 1. Juli wurde Königsmark, als er aus den
Zimmern der Prinzessin kam, von dazu bestellten Leuten ermordet und
sein Leichnam im Schloß verborgen, die Prinzessin aber
hieraus verhaftet. Da sie jeden Versuch, eine Aussöhnung mit
ihrem Gemahl herbeizuführen, von sich wies, wurde die Ehe 28.
Dez. 1694 gelöst und die Prinzessin auf das Schloß
Ahlden verbannt, wo sie, allerdings unter Beobachtung der ihr
gebührenden Rücksichten, bis zu ihrem 13. Nov. 1726
erfolgenden Tod gefangen gehalten wurde. Daß sie ihrem Gatten
die Treue gebrochen, ist durchaus nicht erwiesen worden und ihr
Briefwechsel mit Königsmark, den Palmblad herausgab,
gefälscht. Vgl. Schaumann, S. Dorothea, Prinzessin von Ahlden,
und Kurfürstin Sophie von Hannover (Hannov. 1879).
[Österreich.] 3) Erzherzogin von Österreich, geb. 27.
Jan. 1805, Tochter des Königs Maximilian I. Joseph von Bayern
und Zwillingsschwester der Königin Maria von Sachsen,
vermählte sich 1824 mit dem Erzherzog Franz Karl von
Österreich und starb 28. Mai 1872. S. war die Mutter des
jetzigen Kaisers von Österreich, Franz Joseph, und
einflußreiche Gönner in der ultramontanen
Bestrebungen.
[Preußen.] 4) S. Charlotte, Königin von
Preußen, "die philosophische Königin", geb. 20. Okt.
1668 auf Schloß Iburg bei Osnabrück, Tochter des
Herzogs, spätern Kurfürsten Ernst August von Hannover und
der Sophie 1), lebte längere Zeit in Paris bei ihrer Tante,
der berühmten Pfalzgräfin Elisabeth Charlotte, wo sie
feine Sitte und Geschmack für Kunst sich aneignete,
während sie im Umgang mit Leibniz, dem Freund ihrer Mutter,
ihren lebhaften Geist auch in religiösen und philosophischen
Problemen übte, wurde 8. Okt. 1684 mit dem Kurprinzen
Friedrich von Brandenburg, spätern König Friedrich I.,
vermählt, dem sie nach seinem Regierungsantritt 1688 seinen
einzigen Sohn (den König Friedrich Wilhelm I.) gebar, lebte am
Hof ihres verschwenderischen und eiteln Gemahls der Pflege der
Künste und Wissenschaften, für welche sie auch Leib-
41
Sophienkirche - Sophokles.
niz nach Berlin zog, und erbaute sich in Lietzow das
Schloß Charlottenburg, wo sie einen eignen Hofhalt hattet
starb 1. Febr. 1705 in Hannover auf einer Reise nach den
Niederlanden. Vgl. Varnhagen v. Ense, Biographische Denkmale, Bd. 4
(3. Aufl., Leipz 1872).
5) S. Dorothea, Königin von Preußen, geb. 16.
März 1687, Tochter von Sophie 2) und des Königs Georg I.
von England und Nichte der vorigen, ward 28. Nov. 1706 mit dem
Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Preußen vermählt, dem
sie 24. Jan. 1712 als dritten Sohn (die zwei ersten starben
früh) Friedrich d. Gr., dann noch mehrere Kinder gebar. Eifrig
bemüht, die Beziehungen zwischen Preußen und
Hannover-England noch fester und inniger zu knüpfen, kam sie
wiederholt mit dem von Österreich beherrschten Gemahl in
Konflikt, namentlich als sie, um die englischen Heiraten des
Kronprinzen und der Prinzessin Wilhelmine zu stande zu bringen,
heimlich mit dem englischen Hofe verhandelte, und hatte von dem
Jähzorn und der rauhen Härte des Königs viel zu
leiden. Nach dessen Tod (31. Mai 1740) lebte sie im Schloß
Monbijou in Berlin und starb 28. Juni 1757.
[Rußland.] 6) S. Alexejewna, russ. Großfürstin,
geb. 27. Sept. 1657, Tochter des Zaren Alexei Michailowitsch aus
dessen erster Ehe mit Maria Miloslawskij und daher Halbschwester
Peters d. Gr., machte sich nach dem Tode des Zaren Feodor III. 1682
durch einen Aufstand der Strelitzen zur Regentin für ihre
Brüder, den blödsinnigen Iwan und den unmündigen
Peter, die gemeinschaftlich den Thron bestiegen. Ihre Regentschaft
währte von 1682 bis 1689. Sie maßte sich gegen das Ende
dieses Zeitraums den Titel einer "Selbstherrscherin" an. Es
mußte zu einem Konflikt zwischen ihr und Peter kommen.
Derselbe ließ sie endlich 1689 in das Jungfrauenkloster zu
Moskau bringen, wo sie 14. Juli 1704 starb.
Sophienkirche, s. Konstantinopel, S. 29.
Sophisma (griech.), Trugschluß, ein Schluß,
den man mittels der Kunst der Sophistik zieht.
Sophisten (griech.), zur Zeit des Perikles und Sokrates
eine Klasse von Philosophen, welche den Unterricht in der
Philosophie nicht als Sache der freien Mitteilung trieben, sondern
denselben, meist von Ort zu Ort reisend, um Geld erteilten. Die
Sophistik, welche Platon und Aristoteles als die Kunst, mit
Hintansetzung ernsten wissenschaftlichen Sinnes den leeren Schein
des Wissens zu erregen, bezeichnen, entwickelte sich zunächst
aus dem Streben, dem Gedanken und der Sprache durch Biegsamkeit und
Gewandtheit für politische Zwecke die möglichste Kraft,
nicht sowohl der Überzeugung als der Überredung, zu
geben. Ihre Bedeutung für die Geschichte der Philosophie
beruht vorzugsweise darauf, daß sie in ihrem übrigens
durch mannigfache Kenntnisse und zum Teil durch glänzende
Talente unterstützten Streben, die Haltbarkeit alles durch
Überlegung zu erreichenden Wissens durch die Überlegung
selbst zu untergraben und die Festigkeit sittlicher
Überzeugung aufzulösen, für Sokrates und seine
Nachfolger die Veranlassung wurden, die Probleme der Wissenschaft
tiefer aufzufassen, als es bisher geschehen war. Die S. waren meist
Lehrer der Rhetorik, erniedrigten aber die Redekunst zu
bloßer Deklamation ebenso für wie wider jeden beliebigen
Gegenstand. Je ausschließlicher sich die Sophistik dieser
Richtung hingab, um so mehr verfiel sie in ein gehaltloses, nur auf
Beifall und Gewinn gerichtetes Wesen und endigte mit frivoler
Ableugnung jeder sittlichen Verbindlichkeit und mit spottender
Ableitung des Guten und Gerechten aus dem gebietenden Belieben der
Mächtigen. Wissenschaftlich knüpften die einen, wie
Gorgias (s. d.), an die eleatische Schule, die andern, wie
Protagoras (s. d.), an die Heraklitische an. Jene gaben den Eleaten
darin recht, daß das Viele nicht, aber darin unrecht,
daß das Eine sei; denn wäre dies, so müßte es
irgendwo sein. Dann aber wäre es nicht das Einzige: also sei
überhaupt Nichts (metaphysischer Nihilismus). Diese stimmten
mit den Herakliteern darin überein, daß alle Dinge
veränderlich seien, gingen aber dadurch über dieselben
hinaus, daß auch das Wissen veränderlich sei: also gebe
es überhaupt kein Wissen (logischer Nihilismus). Die
berühmtesten S. außer Gorgias und Protagoras waren:
Prodikos, Hippias, Thrasymachos, Kritias u. a. Vgl. Wecklein, Die
S. (Würzb. 1866).
Sophistik (Sophisterei, griech.), die Kunst der Sophisten
im schlimmen Sinn des Wortes; dann überhaupt die Kunst, durch
Zweideutigkeiten, trügerische Schlüsse (Sophismen) und
halb wahre Argumente Scheinbeweise herzustellen; s. Sophisten.
Sophokles, der gefeiertste tragische Dichter des griech.
Altertums, geb. 496 v. Chr. im attischen Kolonos, Sohn des
Sophillos, des wohlhabenden Besitzers einer Waffenfabrik, erhielt
eine sorgfältige Bildung in den musischen Künsten und
soll 480 den Siegesreigen nach der Schlacht bei Salamis
angeführt haben. Gleich bei seinem ersten Auftreten als
tragischer Dichter im Alter von 28 Jahren (468) gewann er den Sieg
über den 30 Jahre ältern Äschylos, um fortan den
ersten Rang in der Tragödie bis in sein hohes Alter zu
behaupten. Er hat über 20 mal den ersten, nie aber den dritten
Preis erhalten. Anders als Euripides beteiligte er sich am
politischen Leben und bekleidete mehrere Ämter; so war er 440
mit Perikles Befehlshaber der Flotte gegen Samos. Daß er im
hohen Alter von seinem Sohn Iophon, der gleichfalls als Tragiker
geachtet war, wegen Unfähigkeit, sein Vermögen zu
verwalten, vor Gericht gezogen sei, aber durch Vorlesung seines
"Ödipus auf Kolonos" seine völlige Freisprechung erwirkt
habe, scheint eine unbegründete Sage zu sein, wie sich auch
mancherlei Sagen an seinen 405 erfolgten Tod, der nach dem Zeugnis
eines Zeitgenossen seinem Leben entsprechend ein schöner war,
und sein Begräbnis anknüpften. Auf seinem Grab stand eine
Sirene als Sinnbild des Zaubers der Poesie. Die Athener errichteten
ihm später, wie Äschylos und Euripides, ein ehernes
Standbild im Theater. S. galt schon im Altertum für den
Vollender und Meister der Tragödie. Er erweiterte die
dramatische Handlung durch Einführung eines dritten
Schauspielers und durch die Beschränkung des Chors, dem er
anderseits eine kunstreichere Ausbildung gab, wie er auch sein
Personal auf 15 Mitglieder vermehrte. Indem er die Komposition der
Äschyleischen Tetralogie (s. d.) verließ, gestaltete er
jede Tragödie zu einem einheitlichen Kunstwerk mit einer in
sich abgeschlossenen Handlung, die er im einzelnen aufs
kunstvollste motivierte, namentlich aus dem Charakter der
handelnden Personen. Ganz besonders zeigt sich seine Kunst in der
scharfen, bis ins einzelnste sorgfältig durchgeführten
Charakteristik der Personen, in der er die Mitte hält zwischen
der übermenschlichen Erhabenheit des Äschylos und der
Neigung des Euripides, das gewöhnliche Leben zu kopieren. Mit
dem erstern hat er die tiefe Frömmigkeit gemein, die jedoch
bei ihm auf einer erheblich mildern Anschauung von der Stellung der
Götter zu den Menschen beruht. Die dem Wesen des S.
eigentümliche Anmut zeigt sich auch in der Sprache, deren
Süßigkeit von den Alten allgemein gerühmt
42
Sophonias - Sopran.
wird, und die in ihrer edlen Einfachheiten der Mitte zwischen
dem großartigen Pathos des Äschylos und der Glätte
und dem rhetorischen Schmuck des Euripides steht. S. gehört zu
den fruchtbarsten Dichtern. Außer Päanen, Elegien,
Epigrammen und einer prosaischen Schrift über den Chor hat er
123-130 Dramen verfaßt, von denen uns über 100 durch
Titel und Bruchstücke bekannt, aber nur 7 vollständig
erhalten sind: "Aias", "Antigone", "König Ödipus",
"Ödipus auf Kolonos", "Elektra", "Trachinierinnen" (Tod des
Herakles), "Philoktetes". Dieselben gehörten, mit Ausnahme der
"Trachinierinnen", unter die berühmtesten des S. Von ihnen
wurde "Antigone" 442, "Philoktet" 410, "Ödipus auf Kolonos"
erst nach dem Tode des Dichters von seinem gleichnamigen Enkel 401
auf die Bühne gebracht; die Abfassungszeit der übrigen
ist nicht genau bekannt. Namentlich die "Antigone" und der
"Ödipus auf Kolonos" wurden in neuester Zeit durch deutsche
Übersetzungen und die Musikbegleitung von
Mendelssohn-Bartholdy für die moderne Bühne bearbeitet
und seit 1841 (zuerst in Berlin) mit Beifall aufgeführt.
Gesamtausgaben, außer der Editio princeps, einer Aldina
(Vened. 1502), besorgten namentlich Brunck (Straßb. 1786-89,
4 Bde.), Erfurdt (Leipz. 1802-11, 6 Bde.; Bd. 7 von Heller u.
Döderlein, 1825; kleinere Ausg. von G. Hermann, 3. Aufl., das.
1830-51, 7 Bde.), Schneider (Weim. 1823-30, 10 Bde.), Wunder (4.,
zum Teil 5. Ausg., Leipz. 1847-1879, 2 Bde.), Dindorf (3. Aufl.,
Oxf. 1860, 8 Bde.; auch in dessen "Poetae scenici graeci", 5.
Aufl., Leipz. 1869), Schneidewin u. Nauck (zum Teil schon 9. Aufl.,
Berl. 1880, 7 Bde.), Nauck (das. 1868), Bergk (neue Aufl., Leipz.
1868), Wolff und Bellermann (5 Stücke, zum Teil in 4. Aufl.,
das.). Von Bearbeitungen einzelner Stücke sind hervorzuheben:
"Aias" von Lobeck (3. Aufl., Berl. 1866), M. Seyffert (das. 1866);
"Antigone" von Böckh (mit Übersetzung, neue Ausg., Leipz.
1884), Meineke (Berl. 1861), M. Seyffert (das. 1865), Schmidt (Jena
1880); "König Ödipus" von Elmsley (Cambr. 1811, Leipz.
1821), Herwerden (Utr. 1866); "Ödipus auf Kolonos" von Reisig
(Jena 1820), Elmsley (Oxf. 1823, Leipz. 1824), Mineke (Berl.1864);
"Philoktetes" von Buttmann (das. 1822) und M. Seyffert (das. 1867);
"Elektra" von O. Jahn (3. Aufl. von Michaelis, Bonn 1882);
"Trachinierinnen" von Blaydes (Jena 1872). Die Fragmente der
übrigen Stücke des S. sind gesammelt von Nauck in
"Fragmenta tragicorum graecorum" (2. Aufl., Leipz. 1889). Ausgaben
der Scholien zu sämtlichen Stücken besorgten Elmsley und
Dindorf (3. Aufl., Oxf. 1860) und Papageorg (Leipz. 1888). Ein
treffliches "Lexicon Sophocleum" hat Ellendt (2. Aufl. von Genthe,
Berl. 1872, 2 Bde.) veröffentlicht, ein gleiches auch Dindorf
(Leipz. 1871). Von den Übersetzungen der Sophokleischen Dramen
nennen wir die von Solger (3. Aufl., Berl. 1837, 2 Bde.), Donner
(10. Aufl., Leipz. 1882), Thudichum (3. Aufl., das. 1875), Hartung
(das. 1853), Minckwitz (neue Aufl., Stuttg. 1869), W. Jordan (Berl.
1862, 2 Bde.), Viehoff (Hildburgh. 1866), Scholl (Stuttg. 1869-71),
Bruch (Bresl. 1879), Prell-Erckens (Leipz. 1883), Wendt (Stuttg.
1884, 2 Bde.) und Türkheim (das. 1887, 2 Bde.). Wilbrandt
veröffentlichte "Ausgewählte Dramen des S. und Euripides,
mit Rücksicht auf die Bühne bearbeitet" (Nördlingen
1866). Eine berühmte Statue des Dichters, ein griechisches
Originalwerk von höchstem Kunstwert (in Terracina
aufgefunden), befindet sich im Lateran zu Rom. Vgl. Lessing, Leben
des S. (in dessen Werken); Schöll, S., sein Leben und Wirken
(Frankf. 1842); Patin, Études sur les tragiques grecs, Bd.
2: Sophocle (5. Aufl., Par. 1877).
Sophonias, s. Zephanja.
Sophonisbe (Sophonibe), Tochter des karthag. Feldherrn
Hasdrubal, Sohns des Gisgo, ausgezeichnet durch Schönheit,
Geist und Vaterlandsliebe, ward früh mit Masinissa (s. d.)
verlobt, aber dann mit König Syphax von Numidien
vermählt, um denselben für Karthago zu gewinnen. Nach der
Niederlage und Gefangennahme des Syphax (203 v. Chr.) fiel sie
Masinissa in die Hände, der sich sofort mit ihr
vermählte, um sie der Gewalt der Römer zu entziehen; als
aber Scipio, den Einfluß der unversöhnlichen Feindin
Roms auf Masinissa fürchtend, ihre Auslieferung forderte,
trank sie heldenmütig den ihr von Masinissa gereichten
Giftbecher. Vielfach dramatisch behandelt, so von Lohenstein
(1666), Hersch (1859), Geibel (1873), Roeber (1884) u. a.
Sophora L., Gattung aus der Familie der Papilionaceen,
Bäume und Sträucher, selten Kräuter, in den
tropischen und gemäßigten Gegenden der Alten und Neuen
Welt, mit unpaarig gefiederten Blättern, weißen, gelben,
selten violetten Blüten in endständigen Trauben oder
Rispen und mehr oder weniger gestielten, rosenkranzartigen,
dickschaligen, nicht aufspringenden Hülsen. S. japonica L.;
ein hoher Baum mit fein gefiedertem Laub, 11-13 unterseits
graugrün behaarten Blättchen mit krautartiger Borste,
endständigen Blütenrispen, weißlichen Blüten
und etwas fleischiger Hülse, wächst in China und Japan
und wird bei uns in Gärten kultiviert. Das sehr feste Holz
enthält einen stark riechenden, scharfen Stoff, der bei
Verwundungen mancherlei Übel hervorrufen kann; auch wirken
alle Teile des Baums purgierend. In China kultiviert man ihn in
großem Maßstab, weil die getrockneten Blüten
(Waifa) zum Gelb- und Grünfärben benutzt werden. - S.
tinctoria, s. Baptisia.
Sophron, griech. Mimendichter, aus Syrakus, älterer
Zeitgenosse des Euripides, verfaßte prosaische Dialoge in
dorischem Dialekt, teils ernsthaften, teils spaßhaften
Inhalts, welche Szenen des Volkslebens aufs treueste schilderten.
Trotz der prosaischen Form wurden seine Mimen von den Alten als
Dichtungen betrachtet. Platon, durch den sie in Athen zuerst
bekannt wurden, schätzte sie überaus und benutzte sie zur
dramatischen Einkleidung seiner Dialoge; Theokrit nahm sie in
seinen Idyllen zum Vorbild, und auch die Grammatiker schenkten
ihnen wegen ihrer volkstümlichen Sprachformen besondere
Beachtung. Die Dürftigkeit der erhaltenen Bruchstücke
(zuletzt gesammelt von Botzon, Marienburg 1867) verstattet weder
von Inhalt noch Ausführung eine Anschauung. Vgl. die Schriften
von Grysar (Köln 1838), Heitz (Straßb. 1851) und Botzon
(Lyck 1856).
Sophronisten (griech.), Sittenmeister, bei den Griechen
Beamte, welche das sittliche Verhalten der Jünglinge in den
Gymnasien zu überwachen hatten.
Sophrosyne (griech.), s. v. w. weise Mäßigung,
eine der vier Haupttugenden der Platonischen Ethik und zwar
diejenige, welche sich auf die Begierden der sinnlichen Natur des
Menschen bezieht.
Sopor (lat.), s. Schlafsucht.
Sopran (ital. Soprano, lat. Supremus, Discantus, Cantus,
franz. Dessus. engl. Treble), die höchste aller Gattungen der
Singstimmen, von der Altstimme dadurch verschieden, daß ihr
Schwerpunkt nicht wie bei dieser in dem sogen. Brustregister,
sondern in der Kopfstimme liegt. Der S. ist entweder eine
Frauen-,
43
Sopranschlüssel - Sorben.
Knaben- oder Kastratenstimme; die grausame, naturwidrige
Kastration (s. d.) erzeugte Sopranstimmen von dem Timbre der
Knabenstimme und der mächtigen Lungenkraft des Mannes. In der
päpstlichen Kapelle und auch anderweit wurden statt der
Kastraten, die nur zeitweilig zugelassen wurden, und statt der
Knaben, welche die schwierige Mensuraltheorie nicht schnell genug
zu erlernen vermochten, im 15.-17. Jahrh. sogen. Falsettisten
(Tenorini, Alti naturali) zur Ausführung der Sopranparte
verwendet, die darum verhältnismäßig tief
geschrieben wurden, um die Stimmen nicht allzu schnell zu
ruinieren. Der Normalumfang des Soprans ist vom (eingestrichenen)
c' bis zum (zweigestrichenen) a''; das Brustregister erstreckt sich
auf die Töne von f' oder fis' abwärts, die Kopfstimme
beinahe auf den ganzen Umfang, höchstens versagen c' und d'.
Es sind also dann die Töne d' bis fis' beiden Registern
gemein, d. h. können auf beide Weise hervorgebracht werden.
Bis zum a'' läßt sich so ziemlich jede normale
Sopranstimme ausdehnen, hohe Soprane singen bis c''',
phänomenale bis fis''', g''', ja c'''' (z. B. Lucrezia
Agujari, gest. 1783). Vgl. Mezzosopran.
Sopranschlüssel, s. v. w. Diskantschlüssel.
Sopratara (ital.), s. Tara.
Sora, Kreishauptstadt in der ital. Provinz Caserta, am
Garigliano, Bischofsitz, mit Seminar, Gewerbeschule, Resten von
Mauern des antiken S. und der mittelalterlichen Burg Sorella,
Tuchfabrikation, Papiermühlen und (1881) 5411 Einw.
Sorácte (jetzt Monte Sant' Oreste), berühmter
Berg, 45 km nördlich von Rom, die höchste Spitze eines
sich zwischen der Via Flaminia und dem Tiber hinziehenden
Bergrückens. Auf seinem Gipfel stand im Altertum ein
berühmter Tempel des Apollon (daher dessen Beiname Soranus),
dem daselbst Feste seltsamer Art gefeiert wurden. Am Abhang des
Bergs befanden sich warme Quellen; an seinem Fuß lag ein
Heiligtum der Feronia. Der S. ist 692 m hoch und gewährt
besonders mit Schnee bedeckt einen pittoresken Anblick (candidus
Soractes bei Horaz). Karlmann, der Bruder Pippins, gründete
748 am Ostabhang des S. das Kloster des heil. Silvester.
Sorano, Ortschaft in der ital. Provinz Grosseto, mit
Mineralquellen und (1881) 1217 Einw. Dazu gehört Sovana
(Soana), ein vormals bedeutender, aber schon seit langer Zeit wegen
des ungesunden Klimas verlassener Ort, mit Bistum (Sitz in
Pitigliano) und großer Kathedrale, Geburtsort Papst Gregors
VII. In der Nähe zahlreiche etruskische Gräber und die
Trümmer des alten Saturnia.
Soranus, Beiname des Apollon (s. Soracte).
Sorata, Revado de (Ilampu), nächst dem Aconeagua
höchster Berg des amerikan. Kontinents, erhebt sich als
vulkanischer Kegel auf der östlichen Umwallung (Cordillera
Real) der Hochebene von Bolivia in Südamerika, im O. des
Titicacasees, und überragt das Plateau um 2700 m, indem er bis
6544 m aufsteigt.
Sorau, 1) Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk
Frankfurt, Knotenpunkt der Linien Sommerfeld-Iegnitz, S.-Sagan und
S.-Kottbus der Preußischen Staatsbahn, 160 m ü. M.,
besteht aus dem Schloßbezirk, mit dem alten Schloß (von
1207) und dem daneben erbauten neuen Schloß (von 1716, jetzt
Lokal der Behörden) nebst der Peterskirche (um 1200 erbaut),
und der eigentlichen Stadt. Von hervorragenden Gebäuden sind
zu nennen: die evangelische Hauptkirche (aus dem 14. Jahrh., 1870
restauriert), die Schloß- und Klosterkirche (1728 neugebaut)
und die Gräbigerkirche (seit 1874 den Altlutheranern
eingeräumt), das Rathaus, das Krankenhaus und das
Waldschloß (von 1557). Öffentliche Plätze sind: der
Kaiserplatz mit dem Kriegerdenkmal und der Bismarckplatz. Die
Bevölkerung beträgt (1885) 13,665 Seelen, meist
Evangelische, welche Tuch-, Leinwand- und Damastweberei,
Färberei, Druckerei, Wachslicht-, Ziegel- u.
Drainröhrenfabrikation, Porzellanmalerei, Kunst- und
Handelsgärtnerei betreiben. Für den Handelsverkehr
befinden sich dort eine Handelskammer und eine
Reichsbanknebenstelle. S. hat ein Gymnasium, eine Webschule, ein
Amtsgericht, eine Oberförsterei, eine Irrenanstalt und ein
Waisenhaus. In der Umgegend zahlreiche Braunkohlengruben. - S. ist
wendischen Ursprungs und erhielt 1260 Stadtrecht. Damals
gehörte es den Burggrafen von Dewin, 1355 kam es an die
Burggrafen von Biberstein, welche auch die Umgebung der Stadt, die
Herrschaft S., erwarben. Diese fiel, nachdem sie 1490-1512 zu
Sachsen gehört hatte, nach dem Aussterben der Burggrafen von
Biberstein 1551 an König Ferdinand I. von Böhmen, der sie
1557 nebst der Herrschaft Triebel an den Bischof von Breslau,
Balthasar von Promnitz, verkaufte. Der letzte Sprößling
dieses Hauses überließ beide 1765 gegen eine Leibrente
von 12,000 Thlr. an Kursachsen, von dem sie 1815 an Preußen
kamen. Vgl. Worbs, Geschichte der Herrschaft S. und Triebel (Sor.
1826); Saalborn, Beiträge zur Geschichte von S. (das. 1876,
Heft 1). -
2) Stadt, s. Sohrau.
Sorauer, Paul, Botaniker, geb. 9. Juni 1839 zu Breslau,
erlernte daselbst die Gärtnerei, hörte gleichzeitig
botanische Vorlesungen, ging zu weiterer praktischer Ausbildung
nach Berlin, Brüssel, Paris und London, lebte ein Jahr in
Donaueschingen und studierte dann 1864-68 in Berlin
Naturwissenschaft, besonders Botanik. Er arbeitete als Assistent in
Karstens pflanzenphysiologischem Institut und widmete seine
Untersuchungen von nun an ausschließlich der Phytopathologie.
Er begann Vorlesungen über diese Disziplin am
landwirtschaftlichen Institut in Berlin, ging aber bald als
Assistent zu Hellriegel in Dahme und folgte 1871 einem Ruf an das
pomologische Institut in Proslau. Hier errichtete er die erste dem
Gartenbau speziell gewidmete botanische Versuchsstation und suchte
namentlich die bis dahin fast unbeachtet gebliebenen nicht
parasitären Krankheiten der Pflanzen zu erforschen. Er
schrieb: "Handbuch der Pflanzenkrankheiten" (2. Aufl., Berl. 1887,
2 Bde.; dazu der "Atlas", 1887 ff.); "Die Obstbaumkrankheiten"
(das. 1878); "Untersuchungen über die Ringelkrankheit und den
Rußtau der Hyazinthen" (Leipz. 1878); "Die Schäden der
einheimischen Kulturpflanzen durch Schmarotzer etc." (Berl.
1888).
Sorben (Sorbenwenden), slaw. Volk, welches im 6. Jahrh.
n. Chr. das Gebiet zwischen Saale und Elbe in Besitz nahm. Schon im
7. Jahrh. den Franken unterthan, fielen die S. 631 unter ihrem
Herzog Dervan ab und schlossen sich an Samo von Böhmen an.
Nicht Karl d. Gr., der 782 ein Heer gegen sie aussandte, sondern
erst Heinrich I. gelang um 928 ihre völlige Unterwerfung; auf
ihrem Gebiet entstanden die Marken Zeitz und Merseburg,
während das nördliche Sorbenland zur Mark Lausitz
geschlagen wurde. Unter Otto I. brach sich das Christentum unter
den S. allmählich Bahn, besonders seitdem die Bistümer
Merseburg und Zeitz 968 als Mittelpunkte der Mission gegründet
worden waren. Die S. verschmolzen teils mit den deutschen
Einwanderern, teils zogen sie sich in die jetzigen beiden Lausitzen
zurück, wo sie noch heute die ländliche Bevölkerung
bilden. Über die Sprache der S. s. Wendische Sprache.
44
Sorbett - Sorby.
Die Haupterzeugnisse ihrer Litteratur findet man verzeichnet in
den "Jahrbüchern für slawische Litteratur" (hrsg. von
Jordan, Leipz. 1843-48; fortgesetzt von Schmaler, Bautz.
1852-56).
Sorbett (arab.), s. Scherbett.
Sorbonne, die altberühmte Theologenschule in Paris,
deren Gründung auf Robert von Sorbon (gest. 1274), den
Hofkaplan Ludwigs des Heiligen, zurückgeführt wird; die
Bestätigungsbulle Clemens' IV. datiert von 1268.
Ursprünglich ein Alumnat für arme Studierende der
Theologie, gelangte die S. (welchen Namen die Anstalt erst seit dem
14. Jahrh. erhielt) durch berühmte Lehrer, welche an ihr
wirkten, sowie durch reiche Ausstattung gegenüber andern
ähnlichen Kollegien zu immer größerm Ansehen. In
ihrem Haus fanden regelmäßig die Sitzungen der
theologischen Fakultät der Pariser Universität statt, so
daß es seit dem Ende des 15. Jahrh. üblich wurde, diese
Fakultät selbst mit dem Namen S. zu bezeichnen. An diesen
Namen knüpfen sich daher die wichtigsten Entscheidungen,
welche vom Mittelalter bis zur Neuzeit für Gestaltung des
Katholizismus in Frankreich ausschlaggebend waren. Aber als
Vorkämpferin des Gallikanismus (s. d.) und Feindin des
Jesuitenordens, dessen Einführung in Frankreich (1562) sie
vergeblich zu verhindern suchte, verlor die S. allmählich an
Einfluß und Ansehen in dem selben Maß, als die Macht
der Päpste wuchs. Vollends war es um ihren Ruhm geschehen, als
sie sich im Sinn beschränkter Orthodoxie in einen erbitterten
Kampf mit den freisinnigen Schriftstellern des 18. Jahrh.
einließ (vgl. Voltaires "Tombeau de la S."). Durch die
Dekrete der Nationalversammlung von 1789 und 1790 wurden ihre
ausgedehnten, prächtigen Gebäude (1635-53 vom Kardinal
Richelieu errichtet) als Nationalgut eingezogen, 1808 aber der
neuen kaiserlichen Universität wieder übergeben. Jetzt
bilden sie den Mittelpunkt des Quartier latin und beherbergen die
theologische, die historisch-philologische und die
naturwissenschaftliche Fakultät der Pariser Universität.
Vgl. Duvernet, Histoire de la S. (deutsch, Straßb. 1792, 2
Bde.); Franklin, La S. (2. Aufl., Par. 1875); Méric, La S.
et son fondateur (das. 1888).
Sorbus L. (Eberesche), Gattung aus der Familie der
Rosaceen, Bäume von mittlerer Höhe, häufiger
Sträucher, mit einfachen, gelappten oder gefiederten
Blättern, in einfachen oder zusammengesetzten Trauben- oder
Scheindolden stehenden Blüten und beerenartiger Apfelfrucht
mit dünnhäutigen Fruchtfächern. I.
Apfelbeersträucher (Adenorrhachus Dec.), Sträucher mit
einfachen, auf der Mittelrippe oft mit Drüsen besetzten
Blättern, einfachen Doldentrauben, weißen, an der Basis
nicht bewimperten oder behaarten Blumenblättern, fünf
Griffeln. Rotfrüchtiger Apfelbeerstrauch (S. arbutifolia L.),
in Nordamerika, 1-2 m hoher Strauch mit aufrecht abstehenden
Zweigen, länglich ovalen, unterseits behaarten Blättern
und roten, behaarten Früchten, färbt sich im Herbst
intensiv rot, wird als Zierstrauch angepflanzt. Ein Bastard dieser
Art mit S. Aria ist S. heterophylla Rchb., mit sehr
veränderlichen, ganzen, eingeschnittenen, meist mehr oder
weniger gefiederten, unterseits graufilzigen Blättern,
vielblütigen Doldentrauben und schwarzroten Früchten. II.
Ebereschen (Aucuparia Med.), Sträucher und Bäume mit
gefiederten Blättern, zusammengesetzten, rispenartigen
Doldentrauben, an der Basis mit einigen abfallenden Härchen
besetzten Blumenblättern, zwei oder drei Griffeln und glatten
Früchten. S. aucuparia L. (gemeine Eberesche, Vogelbeerbaum,
Quitzstrauch), ein mittelhoher Baum mit gefiederten, wenigstens auf
der Unterseite lange Zeit wollig behaarten Blättern,
gesägten Blättchen, weißen, unangenehm riechenden
Blüten und roten Früchten, wächst in Europa und
Nordasien bis in die subarktische Zone, im Süden auf dem St.
Gotthard bis zur Grenze der Fichte. Die Eberesche gehört zu
unsern schönsten Gehölzen und eignet sich trefflich zu
Anpflanzungen in Gärten und an Wegen. Das ziemlich harte Holz
wird von Tischlern, Büchsenschäftern und Wagnern benutzt;
die Früchte dienen zum Vogelfang (aucupium, daher der Name),
besonders für Drosseln (Drosselbeere), auch als Futter
für Federvieh und Schafe, zur Darstellung von
Äpfelsäure, Branntwein, Essig etc. III. Mehlbirn (Aria
Host.), Sträucher und Bäume mit einfachen, unten filzigen
Blättern, Blüten in Doldentrauben,
zurückgeschlagenen Blumenblättern, wolligen Griffeln und
Früchten. S. Aria Crtz. (gemeine Mehlbirn, Mehlbaum,
weißer Elsbeerbaum, Alzbeere, Arlesbeere), ein 9-12 m hoher
Baum mit rundlichen oder länglichen, doppelt gesägten
oder eingeschnittenen, unterseits weißfilzigen Blättern,
in verästelten Doldentrauben stehenden, weißen
Blüten und rundlichen, rotorangen, punktierten, süß
säuerlichen Früchten, findet sich in Mittel- und
Südeuropa und im Orient, in der untern Alpenregion bis 1700 m,
nördlich bis zum Harz, liefert Nutzholz; er wird in mehreren
Varietäten in den Gärten kultiviert. Ein Bastard mit S.
torminalis ist S. latifolia Pers., mit länglich
breiteiförmigen, am Rand lappigen, gesägten, unterseits
graufilzigen Blättern, großer, filziger Doldentraube und
ovalrunden, rotorangen, gelb punktierten Früchten. IV.
Elsbeerbäume (Torminaria Ser.), Bäume mit gelappten,
unbehaarten Blättern, Doldentrauben, flachen, etwas
bärtigen Blumenblättern, zwei Griffeln, unbehaarten
Früchten. S. torminalis L. (Elsebeerbaum, Atlasbeerbaum), ein
mittelhoher Baum mit eirunden, tief und ungleich gelappten,
ungleich scharf gesägten, unbehaarten Blättern, filziger
Doldentraube, weißen Blüten und graubraunen, weiß
punktierten Früchten, ist in Mitteleuropa einheimisch, bei uns
nördlich bis zum Harz, liefert genießbare Früchte
u. Nutzholz (Atlasholz). V. Speierling (Cormus Spach), mit
gefiederten Blättern, an der Basis wolligen
Blumenblättern und fünf meist einsamigen, im
Querdurchschnitt spitzen Fruchtfächern. S. domestica L.
(Speierling, Sperber-, Spierlingsvogelbeere), ein großer Baum
mit gefiederten Blättern, gesägten, unterseits meist
weißlich behaarten Blättchen, kleinen Blüten in
endständiger Doldentraube und birn- oder apfelförmigen,
orangegelben Früchten, welche durch Liegen weich und
wohlschmeckend werden, wächst in Italien, Frankreich und dem
westlichen Nordafrika, wird in Süddeutschland in Gärten
kultiviert und findet sich bei uns verwildert bis zum Harz.
Sorby, Henry Clifton, Naturforscher, geb. 10. Mai 1826 zu
Woodbourne bei Sheffield, widmete sich naturwissenschaftlichen
Studien auf seinem Gut Broomfield bei Sheffield und erreichte
bedeutende Erfolge namentlich durch Anwendung mikroskopischer
Forschungen auf physikalische Gegenstände und physikalischer
Methoden aus geologische Probleme. Er wies zuerst auf die
mikroskopische Untersuchung der Kristalle und Gesteine und auf die
Wichtigkeit derselben für theoretische Schlußfolgerungen
hin und veröffentlichte seine ersten darauf bezüglichen
Arbeiten 1858 im "Quarterly Journal of the Geological Society". Er
wandte auch zuerst die Spektralanalyse
45
Sordid - Soria.
bei mikroskopischen Untersuchungen an und konstruierte ein
Spektroskop zur Analyse gefärbter Flüssigkeiten, welches
seitdem weite Verbreitung gefunden hat.
Sordid (lat.), schmutzig, unflätig, geizig;
Sordidität, schmutziges Wesen, Geiz.
Sordino (ital.), s. Dämpfer.
Sordo (ital.), musikal. Bezeichnung: gedämpft.
Sordun, Name eines im 17. Jahrh. gebräuchlichen
Holzblasinstruments und einer veralteten Orgelstimme von
gedämpftem Klang.
Soredien (griech.), s. Flechten, S. 353.
Sorel, Stadt in der britisch-amerikan. Provinz Quebec, am
St. Lorenzstrom, an der Mündung des Richelieu, hat Handel,
Fischerei und (1881) 5791 Einw.
Sorel, 1) (Soreau) Agnes, die Geliebte König Karls
VII. von Frankreich, geboren um 1409 zu Fromenteau in Touraine von
adligen Eltern, kam als Ehrendame der Herzogin von Anjou, Isabella
von Lothringen, 1431 (also erst nach dem Tode der Jungfrau von
Orléans) an den französischen Hof und fesselte durch
ihre Schönheit und Geistesbildung den König so sehr,
daß er sie zur Ehrendame der Königin ernannte und ihr
das Schloß Beauté an der Marne schenkte, daher ihr
Name Dame de Beauté. Obwohl sie ihren Einfluß auf den
König nie mißbrauchte und selbst die Achtung der
Königin genoß, hatte sie doch viel von der Roheit des
Dauphins, nachmaligen Königs Ludwig XI., zu leiden. Nachdem
sie seit 1442 zu Loches in der Zurückgezogenheit gelebt,
ließ sie die Königin wieder an den Hof kommen. Um dem
König stets nahe zu sein, begab sie sich nach dem Schloß
Masmal la Belle, wo sie aber schon 9. Febr. 1450 starb. Sie
hinterließ dem König drei Töchter. Vgl.
Steenackers, Agnes S. et Charles VII (Par. 1868).
2) Albert, franz. Schriftsteller, geb. 13. Aug. 1842 zu Honfleur
(Calvados), war 1866 im Auswärtigen Ministerium angestellt,
begleitete 1870 die Delegation nach Tours und Bordeaux, ward 1872
Professor der diplomatischen Geschichte in Paris und 1876
Generalsekretär des Präsidiums des Senats. Außer
vielen Artikeln in der "Revue des Deux Mondes" und andern
Zeitschriften schrieb er die Romane: "La grande falaise" (1872) und
"Le Docteur Egra" (1873) und die historischen Werke: "Le
traité de Paris du 20 nov. 1815" (1873); "Histoire
diplomatique de la guerre franco-allemande" (1875, 2 Bde.);
"Laquestion d'Orient au XVIII. siècle" (1878); "Essais
d'histoire et de critique" (1882); "L'Europe et la
Révolution française" (1885-87, 2 Bde.);
"Montesquieu" (1887), und in Gemeinschaft mit Funck-Brentano:
"Précis du droit des gens" (2. Aufl. 1887).
Soresina, Stadt in der ital. Provinz Cremona, an der
Eisenbahn von Treviglio nach Cremona, hat Seiden- und Weinkultur,
Bereitung von Senf und Konfitüren, Handel und (1881) 6765
Einw.
Sorex, Spitzmaus.
Sorèze (spr. ssorähs), Flecken im franz.
Departement Tarn, Arrondissement Castres, pittoresk durch Lage und
Bauart und berühmt durch ein Collège der Benediktiner,
mit (1881) 1348 Einw. In der Nähe eine große
Stalaktitengrotte und das Bassin von St.-Ferréol des Canal
du Midi.
Sorgh, Hendrik Martensz, niederländ. Maler, geboren
um 1611 zu Rotterdam, war dort Schüler des Willem Buyteweck
und starb daselbst um 1670. Er hat biblische Darstellungen in
genrehafter Auffassung (z. B. die Anbetung der Hirten, in
Petersburg, die Parabel vom Weinberg des Herrn, in Dresden) und
Genrebilder aus dem Volksleben (Fisch- und Gemüsemärkte,
Interieurs mit Figuren), aber auch Marinen und Flußufer
gemalt, die zum Teil den Einfluß von C. Saftleven zeigen und
sich durch Feinheit der Färbung und Lebendigkeit der
Darstellung auszeichnen.
Sorghum Pers. (Mohrenhirse), Gattung aus der Familie der
Gramineen, in wärmern Ländern heimische große,
breitblätterige Gräser mit markigem Stengel,
reichverzweigten, derbästigen Rispen mit elliptischen bis
kugelig elliptischen Ährchen, lederigen, schwach behaarten, an
der Spitze gezähnelten, selten begrannten Hüllspelzen,
tief ausgerandeten, begrannten oder grannenlosen Deckspelzen und
mehligen Samen. S. vulgare Pers. (Mohren-, Moorhirse, Kafferkorn,
Negerkorn, Durrha, Dari, Dara, Doura [S. tartaricum]),
einjähriges Gewächs mit knotig gegliedertem, bis 5 m
hohem Halm, eirund-ovaler, zusammengezogener, fast
kolbenförmiger Rispe und braunen, braunroten oder schwarzen
Spelzen, stammt vielleicht aus Indien, kam zu Plinius' Zeit nach
Europa, im 13. Jahrh. nach Italien und im 16. Jahrh. als
sarazenische Hirse nach Frankreich. Sie wird jetzt als
Charakterpflanze Afrikas an der West- und Ostküste, in der
Nordhälfte bis Timbuktu, in Abessinien bis 2500 m ü. M.
als Brotkorn gebaut, auch in Polen, Ungarn, Dalmatien, Portugal,
Italien, in Arabien, Ostindien und Turkistan in mehreren
Varietäten kultiviert. In Afrika liefert sie unter allen
Brotfrüchten die reichsten Erträge. Man bereitet aus den
Körnern auch Grütze, ein berauschendes Getränk und
Essig und verarbeitet sie in Belgien, Irland, Schottland in den
Brennereien; außerdem dienen sie, wie auch die Halme mit den
Blättern, als Viehfutter; aus den entkernten Blütenrispen
macht man die sogen. Reisbesen (Besenkraut). S. saccharatum Pers.
(Zuckermoorhirse, Himalajakorn), 3-3,75 m hoch, mit
quirlästiger Rispe mit überhängenden Ästen, aus
Ostindien und Arabien stammend, wird in China, Südafrika und
dem südlichen Nordamerika sehr ausgedehnt kultiviert. 1857
importierte man nach Amerika den ersten Samen, und 1863 waren schon
250,000 Acres mit S. (Imphee) bebaut, aus dessen Stengeln man
Zucker gewann. Als indisches Futter-Sorgho (indisches Korn) wurde
die Pflanze auch bei uns zum Anbau als Grünfutter empfohlen;
sie gibt hohen Ertrag, ist aber unsicherer als Mais und verlangt
heiße Sommer zu ihrem Gedeihen. Vgl. Collier, S., its culture
etc. (Lond. 1884).
Sorgues (spr. ssorgh), Flecken im franz. Departement
Vaucluse, Arrondissement Avignon, am gleichnamigen Fluß,
welcher seinen Ursprung in der wasserreichen Quelle Vaucluse (s.
d.) hat und nach 40 km langem Lauf in den Rhône mündet,
und an der Eisenbahn Lyon-Marseille (Abzweigung nach Carpentras)
gelegen, hat Weinbau, Seidenspinnerei, Fabrikation von chemischen
Produkten und (1881) 2977 Einw.
Soria, span. Provinz in der Landschaft Altkastilien,
grenzt im N. an die Provinz Logroño, im O. an Saragossa, im
Süden an Guadalajara, im W. an Segovia u. Burgos und hat ein
Areal von 10,318 qkm (187,4 QM.). Das Land ist im ganzen ein
Hochplateau, welches im N. von Berggruppen des Iberischen
Gebirgssystems (darunter Pico de Urbion, 2252 m, Sierra del
Moncayo, 2349 m), im südlichen Teil von den Ausläufern
des Kastilischen Scheidegebirges eingeschlossen wird. Das Zentrum
der Provinz bildet das Becken des obern Duero, welcher hier den
Rituerto und Ucero aufnimmt. Einige Wasserläufe im
östlichen Teil, darunter der Jalon, fließen dem Ebro zu.
Im N. finden sich große Kiefernwaldungen, sonst aber herrscht
Mangel an Bäumen, dafür jedoch sehr reicher Graswuchs auf
den öden Hochflächen. Das Klima ist
46
Soria - Sosh.
in den Thälern mild, auf den Gebirgen rauh. Die sehr
spärliche, arme Bevölkerung betrug 1878: 153,652 Seelen,
demnach nur 15 pro QKilometer (1886 auf 162,000 Seelen
geschätzt). Die wichtigsten Produkte sind: Schafe, Pferde,
Maulesel, Getreide, Wein (geringe Qualität), Öl, Flachs
und Hanf; das Mineralreich bietet wohl Erze, welche aber nicht
abgebaut werden, dann Salz und Gips. Hauptbeschäftigung bildet
Vieh-, besonders Schafzucht, daneben kommen höchstens noch
Weberei und Gerberei in Betracht. Die Südostecke der Provinz
wird von der Spanischen Ostbahn (Madrid-Saragossa) durchschnitten.
Die Provinz umfaßt fünf Gerichtsbezirke (darunter Burgo
de Osma und Medinaceli). - Die gleichnamige Hauptstadt, rechts am
Duero, mit zinnengekrönten Mauern umgeben und von einem
hochgetürmten Schloß überragt, hat (1886) 5834
Einw. u. ist Sitz des Gouverneurs.
Soria, Fabrikstadt im mexikan. Staat Guanajuato, bei
Celayo, hat eine Baumwollspinnerei u. -Weberei und eine
Kasimirfabrik.
Soriano, Departement des südamerikan. Staats
Uruguay, 9223 qkm (151,2 QM.) groß mit (1885) 24,988 Einw.,
am Uruguay, ist malerisch gelegen und hat viel Viehzucht (Schafe,
Rinder). Hauptstadt ist Mercedes am Rio Negro, 30 km oberhalb
dessen Mündung in den Paraguay, mit 4000 Einw.; der
älteste Ort aber ist Soriano, an der Mündung des
genannten Flusses, 1624 gegründet, mit 600 Einw.
Soriano nel Cimino (spr. tschi-), Dorf in der ital.
Provinz Rom, Kreis Viterbo, am Fuß des Monte Cimino, hat
Ringmauern und (1881) 4601 Einw.
Soringaöl (Sorinjaöl), s. Behenöl.
Soristan, s. v. w. Syrien.
Sorites (griech., Kettenschluß), ein aus mehreren
Schlüssen zusammengesetzter Schluß, dessen Erfindung
gewöhnlich dem Eubulides zugeschrieben wird. Derselbe
entsteht, indem zwei Schlüsse enthymematisch, d. h. durch
Hinweglassung entweder des Ober- (Aristotelischer S.) oder des
Untersatzes (Goclenianischer S.), abgekürzt und so verbunden
werden, daß sie alle einen gemeinschaftlichen
Schlußsatz erhalten; z. B.: die Gestirne sind Körper;
alle Körper sind beweglich; alles Bewegliche ist
veränderlich; alles Veränderliche ist vergänglich:
also sind die Gestirne vergänglich (Krug).
Sorlingues (spr. ssorlängh), s. Scillyinseln.
Sorö, dän. Amt auf der Insel Seeland, 1475 qkm
(26,8 QM.) mit (1880) 87,509 Einw. Die gleichnamige Hauptstadt in
schöner Lage am Sorösee und an der Eisenbahn von
Kopenhagen nach Korsör, mit berühmter Akademie und (1880)
1464 Einw. Die Akademie (jetzt gelehrte Schule und
Erziehungsanstalt), eine der reichsten Stiftungen des Landes, wurde
1586 aus den Einkünften der 1161 hier gegründeten
Cistercienser-Mönchsabtei gestiftet und 1822 neu organisiert.
Von den großartigen alten Klostergebäuden ist nur noch
die Kirche (mit den Grabmälern mehrerer dänischer
Könige und Ludwig Holbergs) vorhanden.
Sörö, norweg. Insel an der Küste des
Nördlichen Eismeers, unweit der Stadt Hammerfest, 971 qkm
(17,6 QM.) groß.
Sorocaba, Stadt in der brasil. Provinz São Paulo,
am gleichnamigen Nebenfluß des Tieté, in fruchtbarer
Gegend, hat vielbesuchte Maultier-, Pferde- und Rindviehmärkte
und 3000 Einw. 5 km nördlich davon liegen die Eisenhütten
von Ipanema.
Soroki (Ssoroki), Kreisstadt im russ. Gouvernement
Bessarabien, rechts am Dnjestr, hat 2 Kirchen und (1885) 11,876
Einw., welche Handel mit Tabak, Wein und Getreide treiben. An der
Stelle von S. stand einst Olchionia, ein Handelsplatz der Genuesen.
Im Bukarester Traktat 1812 kam S. an Rußland.
Sorr, Dorf in Böhmen, s. Soor.
Sorrénto, Stadt in der ital. Provinz Neapel, Kreis
Castellammare, in reizender Lage auf der Nordseite der Halbinsel
von S., welche den Golf von Neapel von dem von Salerno trennt, an
der landschaftlich schönen Straße von Castellammare nach
Massa, von Orangen- und Olivenhainen, Wein-, Obst- und
Maulbeerpflanzungen umgeben, ist Sitz eines Erzbischofs, hat Reste
von römischen Bauwerken, eine Kathedrale, ein Seminar,
Seebäder, Schiffahrt und Handel (in der Marina von S. sind
1886: 91 Schiffe mit 38,025 Ton. angelaufen), Seidenindustrie,
Fabrikation von Holzmosaikwaren und (1881) 6089 Einw. Die
schöne Lage und das herrliche Klima machen es zum
Lieblingsaufenthalt der Fremden auch im Sommer (zahlreiche Hotels
und Villen). Einen malerischen Anblick gewährt die Küste
ringsumher durch ihre jäh niederstürzenden, 30-60 m hohen
Felswände mit Höhlen und tiefen Einkerbungen. Die
Umgebung der Stadt enthält zahlreiche schöne Punkte (wie
das ehemalige Kloster Deserto, der Arco naturale, die Punta della
Campanella etc.). S., im Altertum Surrentum, war eine uralte,
anfänglich etruskische Stadt Kampaniens, später
römische Kolonie und ist Geburtsort Torquato Tassos, welchem
hier ein Denkmal errichtet worden ist.
Sört (Saird), Hauptort eines Liwa im
asiatisch-türk. Wilajet Bitlis, zwischen dem Bitlis Su und dem
östlichen Tigris (Schatt), ist Sitz eines nestorianischen
Bischofs, hat einige Moscheen und 5000 Einw.
Sorte (franz.), Art, Gattung, besonders von Waren oder
Geld; Sortenzettel, s. Bordereau.
Sortes ("Lose"), bei den Römern Losorakel, von denen
sich besonders die zu Antium, Cäre und Präneste
großen Ansehens erfreuten. Die letztern wurden geleitet durch
den Willen der Fortuna Primigenia (s. d.) und bestanden aus sieben
eichenen, mit alten Schriftzügen versehenen Stäbchen,
welche, nachdem der Befragende sich mit Gebet und Opfer an die
Göttin gewendet hatte, ein Knabe mischte, um sodann eins davon
zu ziehen. Mit Unrecht führen den Namen S. Praenestinae einige
inschriftlich erhaltene Prophezeiungen (vgl. Preller-Jordan,
Römische Mythologie, Bd. 2, S. 190). S. nannte man dann auch
die als Prophezeiungen verwendeten Stellen eines Buches (z. B. der
Bibel), welche durch Aufschlagen ermittelt wurden, oder auch auf
Blätter geschriebene Verse (namentlich des Vergil), die man
zog.
Sortie (franz., spr. ssortih), Ans-, Weggang; Ausfall,
Ausfallthor; s. de bal, leichter Damenumhang.
Sortieren (franz.), nach Sorten ordnen.
Sortiment (franz. assortiment), Sammlung von
Gegenständen derselben Gattung, aber von den verschiedensten
Arten, besonders in gehöriger Abstufung der Güte (vgl.
Assortiment); Sortimentshandel, s. Buchhandel, S. 574.
Sortita (ital.), die Eintrittsarie der Primadonna in der
italienischen Oper früherer Zeit, auf welche die Komponisten
großen Fleiß verwandten, um sie zu einer dankbaren und
brillanten Nummer zu gestalten.
Sorus (lat.), Fruchthäufchen, s. Farne, S. 51.
Sosandra, mutmaßlicher Beiname der Aphrodite, von
welcher Kalamis (s. d.) eine berühmte Statue (auf der
Akropolis zu Athen) gemacht hatte.
Sosh (Ssosh), Nebenfluß des Dnjepr in
Rußland, durchfließt die Gouvernements Smolensk und
Mohilew und ist durch seine Schiffbarkeit für den Handel
wichtig.
47
Sosier - Sottie.
Sosier (Sosii), Name einer Buchhändlerfirma im alten
Rom, zur Zeit des Augustus, welche einen großen, von Horaz
rühmend erwähnten Betrieb hatte; deshalb typischer Name
für angesehene Buchhändler.
Sosiphanes, griech. Tragiker der sogen. Pleias, aus
Syrakus, lebte um 300 v. Chr. und soll 73 Tragödien
geschrieben haben, von denen aber nur geringe Fragmente (bei Nauck:
"Tragicorum graecorum fragmenta", 2. Aufl., Leipz. 1889) erhalten
sind.
Sositheos, griech. Tragiker der sogen. Pleias, aus
Alexandria in Troas, lebte um 280 v. Chr. zu Athen und Alexandria
in Ägypten und gilt als Wiederhersteller des Satyrspiels. Von
seinen Dramen sind nur spärliche Fragmente erhalten (bei
Nauck: "Tragicorum graecorum fragmenta", 2. Aufl., Leipz.
1889).
Sosna (Ssosna), Fluß im russ. Gouvernement Orel,
fließt zwischen waldlosen, steilen Ufern hin und mündet
von rechts in den Don; 220 km lang.
Sosniza (Ssosniza), Kreisstadt im russ. Gonvernement
Tschernigow, unweit der Mündung der Ubeda in die Desna, hat 5
Kirchen, ein Stadtkrankenhaus und (1885) 6774 Einw., welche sich
vornehmlich mit Ackerbau und Tabaksanpflanzung beschäftigen.
Ursprünglich eine Stadt des Tschernigower Fürstentums,
stand S. lange unter polnischer Herrschaft, bis es 1686 die Russen
wieder in Besitz nahmen.
Sóso, afrikan. Stadt, s. Saria.
Sosos, griech. Mosaikkünstler, der wahrscheinlich
zur Zeit der Attaliden zu Pergamon thätig war. Dort befand
sich sein berühmtes Werk mit den vier trinkenden oder sich
sonnenden Tauben auf dem Rand eines Wassergefäßes, aus
natürlichen Steinen zusammengesetzt, wovon sich eine
römische Nachbildung im kapitolinischen Museum zu Rom
befindet.
Sospel (ital. Sospello), Stadt im franz. Departement
Seealpen, Arrondissement Nizza, in einem tiefen Thal an der Bevera
und an der Straße zum Col di Tenda, hat Reste alter
Befestigungen und (1881) 3097 Einw.
Sospirante (ital.), seufzend.
Sospiro (ital., franz. soupir, "Seufzer"), in der
Notenschrift s. v. w. Viertelpause.
Sospita (auch Sispita, Sospes, Sispes, "Erretterin,
Heilbringerin"), Beiname besonders der Juno, als welche sie
namentlich in Lanuvium, aber auch in Rom verehrt wurde, angethan
mit Ziegenfell, welches ihr zugleich als Helm und als Panzer
diente, gebogenen Schnabelschuhen, Schild und Spieß. Eine
vorzügliche Statue derselben enthält das vatikanische
Museum zu Rom.
Sospität (lat.), Wohlsein, Wohlstand.
Sostenuto (ital.), s. v. w. gehalten, eine
Tempobezeichnung, die etwa mit Andante oder Adagio
übereinstimmt, zu welchen beiden es auch als Zusatz
auftritt.
Sotades, griech. Dichter, aus Maroneia in Thrakien, lebte
in Alexandria unter Ptolemäos Philadelphos (um 280 v. Chr.)
und soll auf Geheiß des Königs, dessen Ehe mit seiner
leiblichen Schwester Arsinoe er verspottet hatte, ersäuft
worden sein. Er verfaßte im ionischen Dialekt und einem
eigentümlichen nach ihm benannten Metrum (Sotadeen,
Grundschema: ^^^^^^^^^^^^^^) boshafte Spottgedichte und
mythologische Travestien zum Teil unzüchtigen Inhalts, welche
auf mündlichen Vortrag unter mimischer Tanzbegleitung
berechnet waren. Diese sogen. Sotadische Dichtgattung fand
zahlreiche Nachahmer. Vgl. Sommerbrodt, De phlyacographis Graecorum
(Bresl. 1875).
Soetbeer (spr. söt-), Adolf, deutscher
Nationalökonom, geb. 23. Nov. 1814 zu Hamburg, studierte
Philologie, wurde infolge seiner Schrift "Des Stader Elbzolls
Ursprung, Fortgang und Bestand" 1840 Bibliothekar der
Kommerzbibliothek und 1843 Sekretär und Konsulent der
Kommerzdeputation in Hamburg. Die Universität Kiel ernannte
ihn zum Ehrendoktor der Rechte. 1872 siedelte er nach
Göttingen über, wo er zum Honorarprofessor und Geheimen
Regierungsrat ernannt wurde. S. hat seit vielen Jahren eifrig
für eine deutsche Münzreform auf Grundlage der
Goldwährung gewirkt; auch der Münzgeschichte, der
Statistik der Flußschiffahrt, den Handelsverträgen
widmete er ein reges Interesse. Er übersetzte Mills
"Politische Ökonomie" (4. Ausg., Leipz. 1881, 3 Bde.), schrieb
Kommentare zum deutschen Münzgesetz und dem deutschen
Bankgesetz (Erlang. 1874-76) und veröffentlichte
außerdem: "Edelmetallproduktion und Wertverhältnis
zwischen Gold und Silber seit der Entdeckung Amerikas" (Gotha 1879)
und "Materialien zur Erläuterung und Beurteilung der
wirtschaftlichen Edelmetallverhältnisse und der
Währungsfrage" (2. Ausg., Berl. 1886).
Soteira (griech., "Retterin"), Name der Göttinnen,
welche als Schützerinnen eines Landes galten, z. B. der
Artemis in Korinth, der Athene in Athen.
Soter (griech., "Erhalter, Retter"), Beiname aller Stadt
und Land beschützenden Götter, des Zeus, Helios, Apollon,
Dionysos, Asklepios, Poseidon, Herakles etc.; auch Beiname vieler
Könige und Kaiser.
Soteriologie (griech.), die Lehre von Christus als dem
Erlöser (Soter).
Sothisperiode (Hundssternperiode), s. Periode.
Sotnie (russ.), bei den Kosaken s. v. w. Kompanie oder
Eskadron; Sotnik, der Kommandant einer S.
Soto, 1) (Sotus) Dominico de, gelehrter kathol. Theolog,
geb. 1494, war Dominikaner, beteiligte sich 1545-47 am Konzil von
Trient, war 1547-50 Beichtvater Karls V. und lebte später zu
Salamanca, wo er 1560 starb. Unter seinen Schriften ward namentlich
die "De justitia et jure" (Salam. 1556) dadurch berühmt,
daß sie dem Volk das Recht vindiziert, einen tyrannischen
Fürsten abzusetzen. Auch bekämpfte S. als einer der
ersten den Negerhandel.
2) Hernando de, span. Seefahrer, geboren um 1496 zu Villanueva
in Estremadura, machte erst Entdeckungsreisen auf Cuba, ward
Gouverneur von Santiago de Cuba, erbaute das 1528 von
französischen Seeräubern zerstörte Havana wieder,
begleitete dann 1532 Pizarro auf seiner Unternehmung gegen Peru und
kundschaftete das Land aus, zeigte sich human und mild und suchte
vergeblich Atahualpas Hinrichtung zu hindern, unternahm 1539 die
Eroberung Floridas und kam auf einer seiner Expeditionen 25. Juni
1542 um. Vgl. Garcilaso de la Vega, Historia del adelantado H. de
S. (Madr. 1723).
Sotteville (spr. ssott'wil, S. lès Rouen), Dorf im
franz. Departement Niederseine, links an der Seine, Rouen
gegenüber, an der Eisenbahn Paris-Le Havre, hat
Eisenbahnwerkstätten der Ostbahn, Baumwollspinnerei und
-Weberei, Fabriken für Chemikalien, Seilerwaren, Öl,
Seife etc. und (1886) 13,628 Einw.
Sottíe (franz. sotie, von sot, "Narr"),
Narrenspiel, Name einer Art dramatischer Possen oder Satiren,
welche wie die Moralitäten und Farcen den Anfangszeiten des
französischen Dramas angehörten, und deren Personen
Narren waren. Sie wurden von den Enfants sans souci (s. d.), dann
auch von den Mitgliedern der Bazoche (s. d.) aufgeführt und
zeichneten sich besonders durch die Plumpheit ihrer Rollen und
kühn tadelnde Sprache aus. Seit Gringore (s. d.),
48
Sottise - Söul.
der viele solcher Stücke schrieb, meist mit typischen
Narrenfiguren, wie le prince Sot, la mère Sotte etc., wurden
sie ausgeführter und erhielten eine politisch- oder
kirchlich-satirische Zuspitzung. In der ersten Hälfte des 17.
Jahrh. verschwanden die Sottien allmählich von der Bühne
wie von der Straße. In Deutschland, wohin sich dieselben von
Frankreich aus auch verbreiteten, verschmolzen sie mit den
Fastnachtsspielen (s. d.).
Sottise (franz.), Albernheit; beleidigende Rede.
Sottovoce (ital., spr. ssottowohtsche), mit
gedämpfter Stimme, halblaut.
Sou (franz., spr. ssu. früher Sol), franz.
Kupfermünze, ehedem die Basis der französischen
Münzrechnung, 20 Sous = 1 Livre; jetzt das 1/20-Frank- oder
5-Centimesstück.
Soubise (spr. ssubihs'), Zwiebelpüree; à la
S., mit Zwiebelpüree.
Soubise (spr. ssubihs'), altes franz. Geschlecht, dessen
Güter und Titel 1575 durch die Verheiratung der Erbtochter des
Hauses, Catherine de Parthenay, mit dem Vicomte René II. von
Rohan auf das Geschlecht der Rohans übergingen.
Merkwürdig sind die beiden aus dieser Ehe entsprossenen und
als Kriegshäupter der Hugenotten berühmten Söhne:
der Herzog Henri von Rohan (s. d.) und Benjamin von Rohan, Baron
von Frontenai, als Erbe seiner Mutter Herr von S., geb. 1583. Er
focht schon unter Moritz von Oranien in den niederländischen
Feldzügen und schloß sich 1615 der Partei des Prinzen
Condé an. In den Religionskriegen, die unter Ludwig XIII.
1621 wieder begannen, führte er das Kommando über die
Hugenotten in den Provinzen Poitou, Bretagne und Anjou mit vieler
Umsicht und bewies besondere Tapferkeit bei der Verteidigung von
St.-Jean d'Angely, mußte aber 1622 vor der feindlichen
Übermacht nach La Rochelle zurückweichen. S.
bemächtigte sich darauf der Inseln Ré und Oleron
(Anfang 1625) sowie in dem Hafen Blavet an der bretagnischen
Küste der königlichen, aus 15 großen Schiffen
bestehenden Flotte. Dagegen mißlang seine Expedition nach der
Landschaft Médoc. Am 15. Sept. 1625 schlug ihn der Herzog
von Montmorency auf der Höhe der Insel Ré und vertrieb
ihn aus Oleron. S. unternahm darauf eine zweite Reise nach England,
wo er Karl I. bewog, nacheinander drei ansehnliche Flotten dem
bedrängten La Rochelle zu Hilfe zu schicken; gleichwohl fiel
dies letzte Bollwerk der Hugenotten. Obschon in den Frieden vom 29.
Juni 1629 eingeschlossen, blieb S. dennoch in England, um von hier
aus die Sache der Protestanten zu fördern. Er starb 9. Okt.
1642 in London, ohne Kinder zu hinterlassen. Die Güter und
Titel des Hauses S. erbte einer seiner Seitenverwandten,
François von Rohan. Ein Nachkomme dieses letztern war
Charles von Rohan, Prinz von S., Pair und Marschall von Frankreich,
geb. 16. Juli 1715; er begleitete Ludwig XV. als dessen Adjutant in
den Feldzügen von 1744 bis 1748 und nötigte 1746 Mecheln
zur Kapitulation, infolgedessen er 1748 zum Maréchal de Camp
und 1751 zum Gouverneur von Flandern und Hennegau ernannt wurde.
Bei Beginn des Siebenjährigen Kriegs mit dem Kommando
über ein Korps von 24,000 Mann betraut, eroberte er Wesel,
besetzte Kleve und Geldern und vereinigte sich mit der deutschen
Reichsarmee, um Sachsen von den Preußen zu säubern. In
Gotha aber im September von Seydlitz beim Diner im Schloß
überfallen, ergriff er eiligst die Flucht, und 5. Nov. erlitt
er bei Roßbach eine schimpfliche Niederlage. Gleichwohl
verlieh ihm Ludwig XV. das Portefeuille des Kriegsministers und
sandte ihn 1758 mit dem Herzog von Broglie wieder auf den
Kriegsschauplatz in Deutschland. Wiewohl zwischen beiden
fortwährende Eifersucht herrschte, errangen sie 10. Okt. 1758
bei Lutternberg doch einen Sieg, infolge dessen Hessen in ihre
Hände fiel. S. erhielt daher den Marschallsstab und behielt
das Kommando bis zum Friedensschluß von 1763. Nach dem Tode
der Pompadour fand er eine ebenso starke Stütze an der
Dubarry. Als Ludwig XV. starb, war er der einzige von den
Hofleuten, welcher den Leichnam bis zu seiner Bestattung nicht
verließ; dieser Zug der Ergebenheit bewog Ludwig XVI., S. die
Stelle im Ministerrat zu lassen. Er starb 4. Juli 1787, und mit ihm
erlosch die Linie von Rohan-S.
Soubrette (franz., spr. ssu-), Rollenfach der
französischen und deutschen Bühne. Eigentlich Zofe,
Kammerjungfer, mit dem Nebenbegriff der List und Verschmitztheit,
bezeichnet S. jetzt eine muntere oder komische jugendliche
Mädchenrolle und ist besonders in der modernen Operette u.
Posse zu Bedeutung gelangt.
Souche (franz., spr. ssuhsch), "Stumpf" am Stammregister
oder Juxtabuch (s. d.).
Souches (spr. ssuhsch), Louis Rattuit, Graf von,
kaiserlicher Feldherr, geb. 1608 zu La Rochelle als Sohn eines
protestantischen Edelmanns, verließ Frankreich nach dem
Hugenottenkrieg 1629 und begab sich erst in schwedische, dann in
kaiserliche Kriegsdienste, zeichnete sich im
Dreißigjährigen Krieg, insbesondere als tapferer
Verteidiger Brünns gegen die Schweden (1645), dann gegen die
Türken aus, eroberte 1664 Neutra, kämpfte bei St.
Gotthardt mit, ward Kammerherr, Hofkriegsrat und
Feldmarschallleutnant, befehligte 1674 die Kaiserlichen in den
Niederlanden, schadete aber den Unternehmungen der Verbündeten
durch sein verdächtiges, aus seinem Starrsinn und seiner
Unbotmäßigkeit erklärliches Zaudern, namentlich in
der Schlacht bei Senesse, so daß er abberufen wurde, und
starb 1682 in Mähren.
Soufflé (franz., Omelette soufflée),
Eierauflauf.
Soufflet (franz., spr. ssufla, Blasebalg), faltige
Seitenwände an Koffern etc., welche die
Vergrößerung des Raums ermöglichen.
Souffleur (franz., spr. ssuflör, "Einblaser"), am
Theater diejenige Person, welche, unter einem in der Mitte des
Proszeniums auf dem Podium angebrachten Kasten sitzend,
während der Vorstellung das Stück aus dem Buch abliest,
um dem Gedächtnis der Schauspieler zu Hilfe zu kommen.
Soufflieren, einem das zu Sagende zuflüstern, den S.
machen.
Soufflot (spr. ssufloh), Jacques Germain, franz.
Architekt, geb. 1713 zu Irancy bei Auxerre, studierte in Rom,
erbaute dann in Lyon das Hospital und ging 1750 zum zweitenmal nach
Italien. Nach seiner Rückkehr begann er sein Hauptwerk, die
Kirche Ste.-Geneviève in Paris (jetzt Panthéon),
deren großartige Kuppel zu den schönsten der Welt
gehört. Er erbaute auch die Sakristei und die Schatzkammer von
Notre Dame in Paris und starb 1781 daselbst.
Souffrance (franz., spr. ssufrangs), Leiden; auch s. v.
w. streitiger Posten (in einer Rechnung).
Souillac (spr. ssnják), Stadt im franz.
Departement Lot, Arrondissement Gourdon, an der Dordogne, mit
Handelsgericht, schöner Kirche (12. Jahrh.), Gewehrfabrik,
Gerberei, Färberei und (1881) 2749 Einw.
Söul, Hauptstadt des Königreichs Korea, am
rechten Ufer des Hanflusses, 45 km (nach dem Stromlauf 120 km) von
dessen Mündung in das Gelbe Meer, unter 37° 31'
nördl. Br. und 127° 19' östl. L. v. Gr., hat 150,000,
mit Einschluß der weithin sich erstreckenden
49
Soulagieren - Soult.
Vorstädte 300,000 Einw. Von Ausländern zählte man
1887: 619 (300 Chinesen, 263 Japaner, 26 Amerikaner, 11 Deutsche, 8
Engländer etc.). Die eigentliche Stadt liegt 5 km vom
Fluß, in einem Becken, das auf drei Seiten von Höhen
eingefaßt wird, an denen die Stadtmauer hinläuft, durch
welche vier den Haupthimmelsrichtungen entsprechende Thore
führen. Im Zentrum der Stadt steht ein hölzerner Turm,
dessen Glocke das Zeichen zum Öffnen und Schließen der
Thore gibt. Die Straßen sind eng und schmutzig, nur drei
können von Wagen benutzt werden; die Häuser sind niedrig
und ärmlich, auch die auf weiten, von Mauern umschlossenen
Plätzen erbauten Wohnungen der Vornehmen kaum besser. Die
weiten Plätze sind öde; einen Garten besitzt nur der
König, dessen Palastgebäude mit großem
Exerzierplatz, Teichen etc. 2,6 qkm bedecken und von einer 12 m
hohen Mauer eingefaßt werden, durch welche drei Thore
führen. S. ist Residenz des Königs und Sitz der Regierung
sowie der diplomatischen Vertreter Deutschlands, Englands, Japans,
Chinas, Rußlands und der Vereinigten Staaten von Nordamerika.
Die Industrie war früher weit bedeutender; nennenswerte
Produkte sind: Seide, Papier, Matten, Fächer, Dachziegel,
Tabak, Bürsten.
Soulagieren (franz., spr. ssulasch-), erleichtern,
helfen, erquicken; Soulagement (spr. ssulaschmáng),
Linderung, Unterstützung, Erleichterung.
Soulary (spr. ssu-), Josephin, eigentlich Joseph Marie,
franz. Dichter, geb. 23. Febr. 1815 zu Lyon, trat schon mit 16
Jahren in das Militär, wo er bis 1836 blieb. Schon von hier
aus schickte er an den "L'Indicateur de Bordeaux" seine poetischen
Versuche mit der Unterschrift "S. grenadier". 1840 erhielt er bei
der Präfektur des Rhônedepartements eine Anstellung.
Seine Dichtungen sind: "A travers champs" (1838); "Le chemin de
fer" (1839); "Les Éphémères" (2 Serien, 1846
und 1857); "Sonnets humoristiques" (Lyon 1857), welche J. Janins
Bewunderung erregten; "Les Figulines" (1862); "Les diables bleus"
(1870); "Pendant l'invasion"(1871); "La chasse aux mouches d'or"
(1876); "Les rimes ironiques" (1877), ein Lustspiel in Versen: "Un
grand homme qu'on attend" (1879) und "Promenade autour d'un tiroir"
(1886). Eine Sammlung seiner "OEuvres poetiques" erschien 1872-83
in 3 Bänden. Vgl. Mariéton, Jos. S. et la
Pléiade lyonnaise (Par. 1884).
Soulié (spr. ssu-), Melchior
Frédéric, franz. Novellist und Bühnendichter,
geb. 23. Dez. 1800 zu Foix, war eine Zeitlang Advokat, sodann
Steuerbeamter, später Dirigent einer Tischlerei und erhielt
endlich eine Stelle als Unterbibliothekar am Arsenal. Mit dem Jahr
1829 warf er sich ganz in die Romantik und lieferte nun eine lange
Reihe von Dramen und Melodramen, von denen aber nur das Shakespeare
nachgeahmte Trauerspiel "Roméo et Juliétte", die
Schauspiele: "Clotilde" und "La closerie des genêts"
bemerkenswert sind. Andre erschienen gesammelt als "Drames inconnus
(1879, 4 Bde.). Von seinen meist auf Erfolg beim großen
Publikum berechneten historischen und sonstigen Romanen sind
hervorzuheben: "Les deux cadavres". "Le magnétiseur", "Le
vicomte de Breziérs", "Le comte de Toulouse",
hauptsächlich aber "Le lion amoureux" und "Les mémoires
du diable", sorgfältige psychologische Studien, welche durch
dramatische Lebendigkeit, phantastische Situationen und
blühenden Feuilletonstil das Publikum fesselten. S. starb 23.
Sept. 1847 in Bièvre bei Paris. Vgl. Champion, Fréd.
S. (Par. 1847).
Soulouque (spr. ssuluhk), Faustin, als Faustin I. Kaiser
von Haïti, geb. 1782 als Negersklave im Distrikt Petit Goyave
auf der Insel Haïti, erhielt 1793 nach Aufhebung der Sklaverei
seine Freiheit, wurde 1804 Bedienter des Generals Lamarre,
später dessen Adjutant, 1810 unter dem Präsidenten
Pétion Leutnant, 1820 unter Boyer Hauptmann. 1843 zum
Obersten befördert und dann zum General und Oberbefehlshaber
der Präsidialgarde ernannt, erhielt er 1846 die Kommandantur
von Port au Prince und ward 1. März 1847 vom Senat zum
Präsidenten der Republik erwählt, wiewohl er weder lesen
noch schreiben konnte. Im höchsten Grad argwöhnisch und
besonders die über seine Unwissenheit und seinen Aberglauben
spottenden Mulatten fürchtend, schürte er den Haß
des schwarzen Pöbels gegen die Mulattenbourgeoisie und
ließ unter dem Vorwand einer Verschwörung derselben vom
16. April 1848 an in Port au Prince ein viertägiges Blutbad
unter denselben anrichten. Darauf votierte die
Repräsentantenkammer 3. Dez. 1848 dem Diktator ihren Dank,
daß er das Vaterland und die Verfassung gerettet habe. Ein
Feldzug gegen die "rebellischen Mulatten" von San Domingo im
März 1849 endete mit einem schmählichen Rückzug.
Gleichwohl veranstaltete man im August 1849 zu Port au Prince eine
Petition an die Kammern, wodurch das haïtische Volk aus
Dankbarkeit S. den Kaisertitel übertrug; der Senat willigte
ein, und zu Weihnachten 1850 ließ er sich als Faustin I.
öffentlich als erblicher Kaiser krönen. Eine nochmalige
feierliche Krönung erfolgte 18. April 1852. Sein Hofstaat
wurde nach französischem Muster kopiert, und auch seine
Staatseinrichtungen waren eine Karikatur der Napoleonischen. Nach
seiner Thronbesteigung stiftete er zwei Orden, nämlich den
Orden des heil. Faustin für Militärpersonen und den
Ehrenlegionsorden für Zivilisten. Seine wiederholten Versuche,
San Domingo zu unterwerfen, scheiterten kläglich. Im Innern
herrschte er verschwenderisch und grausam, so daß die
Erbitterung gegen ihn schließlich allgemein wurde. Als
General Geffrard 22. Dez. 1858 zu Gonaïves die Republik
proklamiert hatte und S. gegen ihn auszog, ging der
größte Teil seiner Truppen zu den Insurgenten über.
Am 15. Jan. 1859 wurde S. in seiner Hauptstadt Port au Prince durch
Verrat gefangen; doch schonte man sein Leben und ließ ihn
nach Jamaica übersiedeln. Nach dem Sturz Geffrards 1867
erhielt er die Erlaubnis zur Rückkehr in die Heimat und starb
4. Aug. d. J. in Petit Goyave.
Soult (spr. ssult), Nicolas Jean de Dieu, Herzog von
Dalmatien, franz. Marschall, geb. 29. März 1769 zu St.-Amans
la Bastide (Tarn) als Sohn eines Landmanns, trat 1785 als Gemeiner
in das Regiment Royal-Infanterie, ward 1791 Offizier, bald darauf
Kapitän und zeichnete sich unter Custine und Hoche aus. 1794
zum Brigadegeneral ernannt, focht er 1796 und 1797 am Main und
Rhein, befehligte 1799 eine Brigade in der Avantgarde unter
Lefebvre bei der Donauarmee und erwarb sich hierauf als Führer
einer Division besonders in der Schlacht von Stockach (25.
März) hohen Ruhm. Dafür zum Divisionsgeneral ernannt und
zu der Armee in der Schweiz unter Masséna versetzt,
unterwarf er die widerspenstigen kleinen Kantone, überfiel,
während Masséna die Russen schlug, die
Österreicher und verfolgte auch die russischen
Heerestrümmer. 1800 übernahm er unter Massénas
Oberkommando den Befehl über den rechten Flügel der
italienischen Armee und wurde, bei einem Ausfall aus Genua schwer
ver-
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl., XV. Bd.
4
50
Soultz - Soust de Borkenfeldt.
wundet, gefangen. Nach der Schlacht von Marengo in Freiheit
gesetzt, erhielt er den Oberbefehl in Piemont, wo er mit kluger
Mäßigung die ausbrechenden Aufstände zu
dämpfen wußte. 1802 wurde er zum Generalobersten der
Konsulargarde ernannt und befehligte von 1803 bis 1805 die Truppen
im Lager von Boulogne. Bei Napoleons I. Thronbesteigung ward er zum
Marschall erhoben. 1805-1807 befehligte er das 4. Armeekorps bei
Austerlitz, Jena und Eylau. Nach dem Tilsiter Frieden zum Herzog
von Dalmatien ernannt, erhielt er 1808 das Kommando der
Zentralarmee in Spanien. Er bestand hier 16. Juni 1809 gegen das
britische Heer den blutigen Kampf bei Coruña,
überschritt Anfang März den Minho und trieb das
britisch-portugiesische Heer bis Porto zurück. An Jourdans
Stelle zum Generalstabschef der Armee in Spanien ernannt, schlug er
12. Nov. 1809 die spanische Armee bei Ocaña, nahm 1810
Sevilla und trieb die Spanier nach Cadiz zurück. Am 11.
März 1811 eroberte er Badajoz und lieferte 16. Mai den
Engländern und Portugiesen die Schlacht bei Albuera. 1813
übernahm er in der Schlacht bei Großgörschen an
Bessières' Stelle das Kommando über die Gardeinfanterie
und befehligte bei Bautzen das Zentrum, ward aber dann wieder nach
Bayonne geschickt, um Wellingtons weiterm Vordringen Schranken zu
setzen. Er drang Ende Juli von neuem in Spanien ein, ward aber bei
Cubiry (27. Juli) mit großem Verlust zurückgeschlagen.
Ein zweiter Versuch des Vordringens (Ende August) endete mit seiner
Niederlage bei Irun und seinem Rückzug nach Bayonne. Obwohl er
27. Febr. 1814 die Schlacht bei Orthez verlor, lieferte er
Wellington noch 10. April mit kaum 20,000 Mann die blutige Schlacht
von Toulouse. Erst am 12. räumte er Toulouse und schloß,
indem er sich zugleich dem König von Frankreich unterwarf, am
19. einen Waffenstillstand. Er wurde von Ludwig XVIII. zum
Gouverneur der 13. Militärdivision, 3. Dez. 1814 aber an
General Duponts Stelle zum Kriegsminister ernannt. Als Napoleon 1.
März bei Fréjus landete, dankte S. ab; er zog sich auf
ein Landgut bei St.-Cloud zurück, erschien erst nach
mehrmaliger Aufforderung bei Napoleon und übernahm 11. Mai die
Stelle eines Generalstabschefs. Er befand sich in den Schlachten
von Ligny und Waterloo an Napoleons Seite, übernahm, als
dieser in Laon die Armee verließ, das Oberkommando derselben
und leitete den Rückzug bis Soissons. Durch die
königliche Ordonnanz vom 12. Jan. 1816 aus Frankreich
verbannt, ging er nach Düsseldorf. 1819 erhielt er die
Erlaubnis zur Rückkehr und ward sei 1821 wieder unter den
Marsch allen aufgeführt und 1827 zum Pair erhoben. Von Ludwig
Philipp 18. Nov. 1830 zum Kriegsminister ernannt, behauptete er
sich beinahe vier Jahre (bis 1834) auf seinem Posten und erhielt
auch im Mai 1832 die Präsidentschaft im Kabinett. Im Mai 1839
übernahm er nach Molés Sturz von neuem das
Präsidium im Kabinett zugleich mit dem Portefeuille des
Auswärtigen, doch scheiterte dieses liberale Ministerium schon
im Januar 1840 an der Dotationsfrage. Nach Thiers' Rücktritt
ließ sich S. 29. Okt. 1840 nochmals zur Übernahme des
Portefeuilles des Kriegs und der Präsidentschaft bewegen,
legte aber 1846 ersteres und 1847 letztere nieder und ward zum
Maréchal général de France ernannt. Er starb
26. Nov. 1851 auf seinem Schloß in St.-Amans. Seine wertvolle
Gemäldesammlung, die er in den spanischen Feldzügen
zusammengeraubt, trug bei der Versteigerung fast 1½ Mill.
Frank ein. S. war ohne höhere Bildung, besaß aber um so
mehr natürlichen Scharfblick, große Bravur und
glühenden Ehrgeiz. Er galt für den besten Taktiker unter
Napoleons Generalen. Die 1816 geschriebenen Memoiren des Marschalls
gab sein Sohn heraus (I. Teil: "Histoire des guerres de la
Révolution", 1854, 3 Bde.). Vgl. Combes, Histoire
anecdotique de Jean de Dieu S. (Par. 1870). - Sein Sohn Hector
Napoléon S., Herzog von Dalmatien, geb. 1801, diente unter
der Restauration im Generalstab und betrat 1830 die diplomatische
Laufbahn. Er war erst französischer Gesandter in den
Niederlanden, dann zu Turin und bekleidete seit 1844 dieselbe
Stelle zu Berlin. Vor der Februarrevolution Mitglied der Zweiten
Kammer, trat er 1850 in die Legislative und verfocht hier die Sache
der Orléans. Nach dem Staatsstreich vom 2. Dez. 1851 trat er
ins Privatleben zurück und starb 31. Dez. 1857. Des Marschalls
Bruder, Pierre Benoît S., geb. 20. Juli 1770 zu St.-Amans,
schwang sich in den Kriegen der Republik und des Kaiserreichs
ebenfalls zu höhern Chargen empor und starb als
Generalleutnant 7. Mai 1843 in Tarbes.
Soultz, Stadt, s. Sulz.
Soumet (spr. ssuma), Alexandre, franz. Dramatiker, geb.
8. Febr. 1788 zu Castelnaudary, folgte frühzeitig seiner
Neigung zur Poesie und begründete seinen Ruhm 1814 durch die
rührende Elegie "La pauvre fille". Er besang nacheinander das
Kaiserreich, die Restauration und die Juliregierung und wurde von
allen belohnt; 1815 erhielt er von der Akademie Preise für die
Gedichte: "La découverte de la vaccine" und "Les derniers
moments de Bayard", trat 1824 in die Akademie und starb 30.
März 1845 als Bibliothekar in Compiègne. Am meisten
berühmt ist er wegen seiner Tragödien und Epen. In der
Mitte stehend zwischen Klassizität und Romantizismus, hat er
eine gewisse Mittelmäßigkeit nie überschritten;
doch wußte er sich durch kluges Eingehen auf die Ideen und
den Geschmack seiner Zeit großen Erfolg zu sichern. Von
seinen Tragödien sind zu nennen: "Clytemnestre" und
"Saül" (1822), Jeanne d'Arc" (1825), "Élisabeth de
France" (1828, eine lächerliche Bearbeitung von Schillers "Don
Karlos"), "Une fête de Néron" (1829) und einige andre,
an denen seine Tochter mitgearbeitet hat. Unter seinen Epen ist
bemerkenswert "La divine épopée" (1840, 2 Bde.; 2.
Aufl. 1841), die ab er weit hinter ihrem Vorbild, der
"Göttlichen Komödie", zurückbleibt. Das Thema ist
die Erlösung der Hölle durch Christus, aber die
Gedankenarmut sucht er durch wilde Phantasien und abgeschmackte
Ungeheuerlichkeiten zu verdecken. Einzelnes Gute findet sich in dem
Epos "Jeanne d'Arc" (1845). Außerdem schrieb er:
"L'incrédulité", Gedicht (1810); "Les scrupules
littéraires de Madame de Staël" (1814) u. a.
Souper (franz., spr. ssupeh), Abend-, Nachtessen;
soupieren, zu Abend essen. S. de Candide, Gastmahl, bei dem die
Gäste betrunken gemacht werden, um dann im Spiel etc.
ausgeplündert zu werden (nach Voltaires "Candide", 2).
Soupir (franz., spr. ssupihr. "Seufzer"), s. Sospiro.
Source (franz., spr. ssurs), Quelle, Ursprung.
Sourdeval (spr. ssurd'wall), Marktflecken im franz.
Departement Manche, Arrondissement Mortain, an der Bahnlinie
Montsecret-S., hat Granitbrüche, Fabrikation von Metallwaren,
Papier etc., Pferdehandel und (1881) 1534 Einw.
Sous bande (franz., spr. ssu bangd), unter Kreuz- oder
Streifband.
Soust de Borkenfeldt, Adolphe van, belg. Dichter und
Kunsthistoriker, geb. 6. Juli 1824 zu Brüssel,
51
Soutache - Southey.
gest. 23. April 1877 als Chef der Abteilung für die
schönen Künste im Ministerium des Innern daselbst. Von
seinen Dichtungen, welche der vlämischen Bewegung in seinem
Vaterland wie der Wiedergeburt des Deutschen Reichs galten, sind zu
nennen: "Rénovation tlamande", "Venise sauvée" und
"L'année sanglante" (Lond. 1871, unter dem Pseudonym Paul
Jane; deutsch von Dannehl, Bresl. 1874); von seinen
kunstgeschichtlichen und kunstkritischen Büchern:
"Études sur l'état présent de l'art en
Belgique" (1858) und "L'école d'Anvers".
Soutache (franz., spr. ssutásch), Litzenbesatz;
soutachieren, mit Litzenbesatz verzieren.
Soutane (franz., spr. ssu-), ein von den katholischen
geistlichen nicht im Amt getragener, langer, eng anliegender Rock
mit engen Ärmeln, von oben bis unten durch dicht gesetzte
Knöpfe verschlossen, bei Kardinälen hochrot, bei
Bischöfen und Hausprälaten des Papstes violett, beim
Papst weiß, bei allen übrigen Geistlichen schwarz; von
derselben Farbe der dazu gehörende Gürtel. Die erst
angehenden Kleriker pflegen die kürzere Soutanelle zu
tragen.
Soutenieren (franz., spr. ssu-), (aufrecht) halten,
stützen, unterstützen; bewähren, behaupten.
Souterrain (franz., spr. ssuterrang), das zum Teil in den
Erdboden versenkte Geschoß eines Hauses, zu Wohnungen,
Geschäfts- und Wirtfchaftsräumen dienend. Im ersten Fall
muß es eine lichte Höhe von mindestens 2,6 m besitzen,
wovon 1,6 m über dem Erdboden sich befinden müssen; auch
soll es nach Süden oder SO. gelegen und zum Schutz gegen
Bodenfeuchtigkeit mit Isolierschichten versehen sein.
Souterraine, La (spr. ssuterrähn), Stadt im franz.
Departement Creuse, Arrondissement Guéret, an der Sedelle
und der Eisenbahn Orléans-Limoges, in einer an
römischen Ruinen und vorhistorischen Denkmälern reichen
Gegend, mit befestigtem Thor, einer Kirche aus dem 12. Jahrh.,
Fabrikation von Holzschuhen und Faßdauben, Tuch,
Bierbrauerei, Handel mit Vieh, Wein und Likör und (1881) 2978
Einw., von denen namentlich viele als Maurer periodisch
auswandern.
Southampton (spr. ssauthammt'n), Stadt in Hampshire
(England), auf einer durch den Zusammenfluß des Itchin und
Test gebildeten Halbinsel, im Hintergrund der Southampton Water
genannten, 16 km tiefen Bucht, an deren Mündung die Insel
Wight liegt. Von den alten Stadtmauern sind noch Reste und ein Thor
(Bargate) übrig, aber die Stadt hat sich bedeutend über
dieselben ausgedehnt. Unter den gottesdienstlichen Gebäuden
ist die normännische St. Michaeliskirche die älteste; ihr
schlanker Turm dient den Seefahrern als Merkmal. Das Spital Domus
Dei, aus der Zeit Heinrichs III., ist eins der ältesten
Englands. S. besitzt im Hartley Institution eine Schule für
Wissenschaft und Kunstgewerbe mit Museum (seit 1872), eine
Seeschule und die Zentralstelle der großbritannischen
Landesaufnahme (Ordnance Survey Office). Im N. liegen zwei Parke,
in deren einem ein Denkmal des geistlichen Liederdichters Watts
steht, der, ebenso wie der Seeliederdichter Dibdin, hier geboren
wurde. Die Bevölkerung der Stadt ist rasch gewachsen; sie
betrug 1831 erst 19,324, 1881 aber 60,051 Seelen. Die Industrie
beschränkt sich fast nur auf Maschinen- und Schiffbau. S. ist
vorwiegend Handelsstadt, und seine trefflichen Docks (25,5 Hektar
Wasserfläche) lassen zu jeder Zeit die größten
Schiffe zu. Es ist Haupthafen für den Postdampferverkehr mit
Ostindien (die Peninsular and Oriental Company hat ihre Werfte
hier), mit Afrika, Südamerika und Westindien, der Iberischen
Halbinsel und durch Vermittelung der Bremer Dampfer auch mit
Nordamerika. Zum Hafen gehörten 1887: 328 Schiffe (100
Dampfer) von 73,970 Ton. Gehalt. Den Wert der Einfuhr schätzte
man im genannten Jahr auf 6,719,110 Pfd. Sterl., den der Ausfuhr
auf 2,640,935 Pfd. Sterl. S. ist Sitz eines deutschen Konsuls. In
der Nähe Southamptons liegt die malerische Ruine von Netley
Abbey (s. d.) und gegenüber der von Wilhelm dem Eroberer
angelegte New Forest. Vgl. Davies, History of S. (1883).
South Bend (spr. ssauth), Stadt an der Nordgrenze des
nordamerikan. Staats Indiana, am schiffbaren St. Josephsfluß,
mit zahlreichen Mühlen, dem katholischen Notre
Dame-Collège und (1880) 13,280 Einw.
Southcott (spr. ssauth-), Johanna, Schwärmerin, die
einige Zeit in London die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich
zog. Geb. 1750, gab sie sich 1801 für das in der Offenbarung
Johannis (12, 1) erwähnte Sonnenweib aus und betrieb nebenbei
einen gewinnreichen Handel mit Siegeln, welche die Kraft haben
sollten, die ewige Seligkeit zu verleihen. Schon über 60 Jahre
alt, behauptete sie 1814, mit dem wahren Messias schwanger zu sein,
und fand mit dieser Behauptung bei Tausenden Glauben, der selbst
dadurch nicht bei allen Anhängern (Neuisraeliten, Sabbatianer)
erschüttert ward, daß sie 27. Dez. starb, ohne
überhaupt schwanger gewesen zu sein. Vgl. Fairburn, The life
of J. S. (Lond. 1814).
Southend (spr. ssauth-), beliebtes Seebad in der engl.
Grafschaft Essex, links an der Mündung der Themse, mit 2 km
langer Landebrücke und (1881) 7979 Einw.
Southey (spr. ssauthí), Robert, engl.
Geschichtschreiber und Dichter, als solcher zur "Seeschule" zu
zählen, geb. 12. Aug. 1774 zu Bristol, Sohn eines
Leinwandhändlers, besuchte die Westminsterschule, die er aber
nach vier Jahren wegen eines Artikels gegen die körperliche
Züchtigung auf englischen Schulen, den er in der von ihm
begründeten Zeitschrift "Flagellant" erscheinen ließ,
verlassen mußte. Er studierte in Oxford Theologie, ohne als
Unitarier Aussicht auf ein Kirchenamt zu haben. Seine exzentrischen
Ansichten führten ihn mit Coleridge zusammen, dessen Plan, in
Amerika einen freien Staat zu gründen, seinen Beifall fand.
Die ihn damals beherrschenden Ideen spiegeln sich in der
Tragödie "Wat Tyler", die ohne seine Zustimmung
veröffentlicht, von ihm selbst später verworfen ward, wie
er überhaupt bald von den Extremen zurückkam. Ein Band
Gedichte (1794) machte keinen Eindruck, mehr das Epos "Joan of
Arc", das von reicher Phantasie, aber auch von jugendlicher
Überspannung zeugt. In Bristol hielt er, um sein Leben zu
fristen, geschichtliche Vorträge, bis ihn sein Oheim im
November 1795 mit sich nach Lissabon nahm. Vor der Abreise
vermählte sich S. heimlich mit Miß Fricker. Nach sechs
Monaten kehrte er zurück und widmete sich in London dem
Rechtsstudium und angestrengter litterarischer Thätigkeit.
1800 finden wir ihn wieder in Portugal, dann aber lebte er in Greta
bei Keswick in Cumberland, nur 1802 als Sekretär des Kanzlers
der Schatzkammer von Irland, Carry, etwa auf Jahresfrist abwesend.
1807 erlangte er eine Staatspension und wurde 1813 poet-laureate.
Seit 1839 infolge einer Lähmung bewußtlos, starb er 21.
März 1843. Seine litterarische Thätigkeit ist
bewunderungswürdig: er schrieb 109 Bände und 52 Artikel
zum "Annual Review", 3 zum "Foreign Quarterly", 94 zum "Quarterly
Revier", und stets machte er umfassende Studien zu seinen Arbeiten.
Das 1801 veröffentlichte epische Gedicht "Thalaba, the
destroyer" ist eins
4*
52
South Paß City - Souvestre.
arabische Erzählung in reimlosen Versen (deutsch zum Teil
von Freiligrath); 1804 folgten: "Metrical tales", 1805 "Madoc",
eine wallisische Sage behandelnd; 1810 "The curse of Kehama", seine
größte Dichtung, eine auf Hindusagen beruhende
phantastische Erzählung; 1814 "Roderick, the last of the
Goths", ein wieder in Blankversen abgefaßtes Gedicht, das die
Zerstörung des Westgotenreichs durch die Araber besingt. Unter
Southeys kleinern Gedichten zeichnen sich die Balladen aus (z. B.
"Mary, the maid of the inn"); als Hofpoet verherrlichte er im
"Carmen triumphale" Wellingtons Siege und dichtete Oden aus den
Prinz-Regenten und die alliierten Monarchen. Die "Vision of
judgment" (1821) ward von Byron, der darin das Haupt der
"satanischen Schule" heißt, schonungslos gegeißelt.
Bedeutend ist S. als Biograph und Geschichtschreiber. Stilistisch
vollendet ist das oft aufgelegte "Life of Nelson" (1813; deutsch,
Stuttg. 1837), dem sich "Lives of the British admirals" (4 Bde.)
und "Life of Vesley" (1820; deutsch, Hamb. 1841) anreihen. Auch
hinterließ er eine "History of Brazil" (1810-19, 3 Bde.) und
eine "History of the Peninsular war" (1823-28, 2 Bde.) sowie
religiöse, soziale und politische Schriften. Hierher
gehören: "The book of the church" (3. Aufl. 1825), "Letters
from England by Don Manuel Espriella" (1807, 3 Bde.), "Colloquies
on the progress and prospects of society" (1829, 2 Bde.); ferner:
"The Doctor", die beste seiner Prosaschriften, voll scharfsinniger
Gedanken und Bemerkungen (1834-37, 5 Bde.; neue Ausg. 1856), und
"Omniana" (1812, 2 Bde.). Die Diktion ist überall klar und
kräftig; Parteilichkeit und starke Subjektivität wirken
indessen oft störend. Endlich gab er die "Select works of
British poets from Chaucer to Jonson" (1836) sowie Umarbeitungen
mittelalterlicher Romane (z. B. "Amadis of Gaul", 1803, 4 Bde.)
heraus. Southeys "Poetical works" erschienen gesammelt in 11
Bänden London 1820, in 10 Bänden 1854, in 1 Band l863.
Vgl. "Life and correspondence of R. S." (hrsg. von seinem Sohn
Charles Cuthbert S., neue Ausg. 1862, 6 Bde.), seinen Briefwechsel
mit Karoline Bowles (1881) und die Biographien Southeys von Browne
(Lond. 1859), Dowden (das. 1880) und Dennis (Boston 1887).
South Paß City (spr. ssauth paß ssitti),
Hauptort des Bergbaubezirks am Sweetwater (Nebenfluß des
Platte) im nordamerikan. Territorium Wyoming, beim 2280 m hohen
South Paß.
Southport (spr. ssauth-), beliebtes Seebad in Lancashire
(England), 25 km nördlich von Liverpool (das "englische
Montpellier"), mit allen Annehmlichkeiten für Badegäste,
als Wintergarten, Aquarium, Landungsbrücke (1 km lang),
großer Markthalle, Konzertsaal etc. und (1881) 32,206 Einw.
Dicht dabei Birkdale mit 8706 Einw.
Southsea (spr. ssauth-ssih), Vorstadt von Portsmouth (s.
d.), der Insel Wight gegenüber, mit Fort, wird als Seebad viel
besucht.
Southwark (spr. ssáthärk), Stadtteil Londons,
der City gegenüber, mit der ihn vier Brücken verbinden,
hat (1881) 99,252 Einw. (als parlamentarischer Wahlbezirk aber
221,946). In ihm liegen die bemerkenswerte St. Saviour's-Kirche,
die Zentralstation der Londoner Feuerwehr, die Hopfen- und
Malzbörse, die Brauerei von Barclay u. Perkins etc.
Southwell (spr. ssauth-), Stadt in Nottinghamshire
(England), mit Kathedrale und (1881) 2866 Einw.
Southwold (spr. ssauth-), Flecken in der engl. Grafschaft
Suffolk, mit (1881) 2107 Einw. Auf der Reede bei S. (der sogen.
Solebai) 7. Juni 1672 Seeschlacht zwischen der englischen Flotte
unter dem Herzog von York (nachmaligem König Jakob II.) und
der holländischen unter de Ruyter.
Soutien (franz., spr. ssutjang), Stütze,
Unterstützung, Rückhalt; im Militärwesen s. v. w.
Unterstützungstrupp, die hinter einer ausgeschwärmten
Schützenlinie geschlossen zurückbleibende
Truppenabteilung, welche nach Erfordernis in das
Schützengefecht einzugreifen hat; s. auch
Sicherheitsdienst.
Soutmann (spr. saut-), Peter, niederländ. Maler und
Kupferstecher, geboren um 1590 zu Haarlem, bildete sich bei Rubens
in Antwerpen, nach dessen Gemälden und Zeichnungen er eine
Anzahl von Radierungen (vier Jagden, der wunderbare Fischzug, das
Abendmahl nach Leonardo da Vinci) fertigte, und welchem er auch bei
der Ausführung seiner Bilder half, und soll von 1624 bis 1628
als Hofmaler des Königs in Polen thätig gewesen sein.
Seit 1628 war er wieder in Haarlem ansässig, wo er eine
Werkstatt von Kupferstechern gründete, die unter seiner
Leitung nach eignen und fremden Zeichnungen, besonders nach Rubens,
stachen. S. selbst schloß sich in Haarlem mehr dem Frans Hals
an, in dessen Art er mehrere Bildnisse und Schützenstücke
malte und dekorative Malereien im Huis ten Bosch im Haag
ausführte. Er starb 16. Aug. 1657.
Souvenir (franz., spr. ssuw'nihr), Andenken, Geschenk zum
Andenken; auch s. v. w. Notizbuch.
Souveraind'or (spr. ssuwerän-), früher für
die österreich. Niederlande geprägte Goldmünze,
22¼ Karat sein, im Wert von 14,224 Mk.
Souverän (franz. souverain, v. mittellat. superanus,
"zuoberst befindlich"), höchst, oberst, oberherrlich,
unabhängig. So spricht man von einem souveränen Urteil,
von welchem es keine Berufung an ein höheres Gericht gibt;
einem souveränen Heilmittel, das unfehlbar gegen ein
bestimmtes Leiden wirkt; von souveräner Verachtung etc.
Namentlich aber wird im Staats- und Völkerleben der Inhaber
der höchsten Gewalt im Staat, welche von keiner andern Macht
abhängig ist, als S. und jene höchste Machtvollkommenheit
(Staatshoheit) selbst als Souveränität bezeichnet; daher
Souveränitätsrechte, s. v. w.. Hoheitsrechte (s. Staat).
Vgl. Suzeränität.
Souvestre (spr. ssuwéstr), Emile, franz. Roman-
und Bühnendichter, geb. 15. April 1806 zu Morlaix
(Finistère), ließ sich 1836 dauernd in Paris nieder,
machte sich zuerst durch Schilderungen der Bretagne: "Le
Finistère en 1836", "La Bretagne pittoresque" (1841),
bekannt und lieferte dann eine große Anzahl Romane, auch
Dramen und Vaudevilles, welche ein reiches Talent für
Beobachtung, aber wenig Erfindungskraft bekunden. In seinen Romanen
tritt die -philosophierende oder moralisierende (d. h. die den
Gegensatz zwischen arm und reich in sozialistischer Schärfe
hervorhebende) Richtung zu stark hervor. Hervorzuheben sind davon:
"Riche et pauvre" (1836); "Les derniers Bretons" (1837); "Pierre et
Jean" (1842) "Les Réprouvés et les Élus"
(1845); "Confessions d'un ouvrier" (1851); die von der Akademie
gekrönten: "Un philosophe sous les toits". "Au coin du feu"
und "Sous latonnelle" (1851); "Le memorial de famille" (1854).
Seine dramatischen Dichtungen, wie "Henri Hamelin", "L'oncle
Baptiste", "La Parisienne", "Le Mousse" etc., bilden den Gegensatz
zu Scribes Stücken, indem sie nicht, wie diese, die reichen,
sondern vorwiegend die besitzlosen Klassen als
Hauptrepräsentanten der Moral darstellen. Noch sind seine
geistvollen "Causeries historiques et lit-
53
Souvigny - Sozialdemokratie.
téraires" (1854, 2 Bde.) zu erwähnen. S. starb 5.
Juli 1854 in Paris. Eine Gesamtausgabe seiner auch teilweise ins
Deutsche übersetzten Werke erschien in der "Collection
Lévy" (60 Bde.).
Souvigny (spr. ssuwinji), Stadt im franz. Departement
Allier, Arrondissement Moulins, an der Eisenbahn
Moulins-Montluçon, mit alter gotischer Kirche (früher
Begräbnisort der Fürsten von Bourbon), Glasfabrikation,
Weinbau und (1881) 1943 Einw.
Souza (spr. ssusa), Adelaïde Marie Emilie,
Gräfin von Flahaut, dann Marquise von S., geborne Filleul,
franz. Schriftstellerin, geb. 14. Mai 1761 zu Paris, heiratete 1784
den Grafen Flahaut, floh, nachdem derselbe 1793 guillotiniert
worden, mit ihrem Sohn (dem nachherigen Adjutanten Napoleons I. und
spätern General Flahaut) nach England und ward dort durch
Mangel zur Schriftstellerei getrieben. So entstanden ihre
"Adèle de Sénanges" (Lond. 1794, 2 Bde.) und der
Roman "Émile et Alphonse" (Hamb. 1799, 3 Bde.). Nach ihrer
Rückkehr nach Paris heiratete sie 1802 den portugiesischen
Gesandten José Maria de S.-Botelho, der sich durch
Herausgabe einer Prachtausgabe der "Lusiaden" (Par. 1817) um die
Litteratur seines Vaterlandes verdient gemacht hatte. Es erschienen
darauf nacheinander: "Charles et Marie" (1802); "Eugène de
Rothelin" 1808, 2 Bde.); "Eugène et Mathilde" (1811, 3
Bde.); "Mademoiselle de Tournon" (1820, 2 Bde.); "La comtesse de
Fargy" (1823, 4 Bde.) u. a. S. starb 16. April 1836 in Paris. Man
rühmt ihren Schriften treffende Schilderung der
Leidenschaften, gute Beobachtung, klaren und geistreichen Stil und
äußerste Delikatesse in Situationen und Worten nach.
Ihre "OEuvres complètes" erschienen 1811-22, 6 Bde.; Auswahl
1840 u. öfter.
Sóvár (Soóvár, Salzburg),
Dorf im ungar. Komitat Sáros, südlich von Eperies, mit
(1881) 1307 slowakischen und deutschen Einwohnern, großem
Salzsiedewerk, Forst- und Bergamt. Der Sóvárer
Gebirgszug der Karpathen erstreckt sich zwischen der Tarcza und
Topla von Bartfeld in südlicher Richtung bis an die Tokayer
Berge (die Hegyalja). Vgl. Gesell, Geologische Verhältnisse
des Steinsalzbergbaugebiets von S. (Pest 1886).
Sovereign (spr. ssowwerin), seit 1816 ausgeprägte
brit. Goldmünze, = 1 Pfund Sterling (s. d.).
Sovrano, frühere lombardisch-venez. Goldmünze
von 40 Lire austriache, = 28,4548 Mk.
Sow., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung
für James Sowerby (s. d.).
Sowerby (spr. ssauerbi), zwei aneinander stoßende
Städte (S. und S. Bridge), im westlichen Yorkshire (England),
am Calder, südwestlich von Halifax, mit Baum- und
Kammwollspinnerei, chemischen Fabriken, Wachstuchfabrikation und
(1881) 14,903 Einw.
Sowerby (spr. ssauerbi) James, Naturforscher und Maler,
geb. 21. März 1757 zu London, besuchte die königliche
Akademie, widmete sich dann aber den Naturwissenschaften, speziell
der Botanik und Malakozoologie. Er starb 25. Okt. 1822 in Lambeth.
Von seinen Arbeiten sind hervorzuheben: "Coloured figures of
English Fungi" (Lond. 1797-1809, 3 Bde. u. Supplement); "English
botany" (das. 1790-1814, 36 Bde. mit 2592 kolorierten Tafeln;
Supplement 1831 ff.; 3. Aufl. von Syme, 1863-72, 11 Bde.); "Mineral
conchology" (das. 1841, 6 Bde.; deutsch von Desor und Agassiz). Die
letzten beiden großen Werke setzte sein Sohn James de Carle
S., geb. 1787, gest. 1854, fort. Dieser gab auch heraus: "The ferns
of Great Britain" (mit Johnson, Lond. 1855); "The fern-allies"
(das. 1856); "Grasses of Great-Britain" (das. 1857-58, neue Ausg.
1883); "British wild flowers" (mit Johnson, das. 1863; neue Ausg.
1882); "Useful plants of Great Britain" (das. 1862). Sein zweiter
Sohn, George Brettingham S., geb. 1788 zu London, gest. 1854,
schrieb "The genera of recent and fossil shells" (Lond. 1820-24, 2
Bde. mit 264 kolorierten Tafeln); auch beteiligte er sich mit
Vigors und Horsfield an der Herausgabedes "Zoological Journal".
Dessen gleichnamiger Sohn, geb. 1812, gleichfalls ein bedeutender
Konchyliolog, schrieb: "Conchological illustrations" (Lond.
1841-45, 6 Bde.); "Conchological manual" (das. 1839, neue Ausg.
1852); "Thesaurus conchyliorum" (das. 1842-70, 30 Tle.); "Popular
British conchology" (das. 1853); "Illustrated index of British
shells" (das. 1859, 2. Aufl. 1887) etc.
Sowinski, Leonard, poln. Dichter und Litterarhistoriker,
geb. 1831 zu Berezowka in Podolien, studierte zu Kiew, verbrachte
später sechs Jahre in der Verbannung zu Kursk, lebte seit 1868
in Warschau; starb 23. Dez. 1887 auf dem Gut Statkowce in
Wolhynien. In seinen lyrischen Gedichten (Posen 1878, 2 Bde.)
bekundet S. schwungvolle Phantasie. Weniger Anklang fand sein
Trauerspiel "Na Ukrainie" (Wien 1873). Mit seiner großen
"Geschichte der polnischen Litteratur" (Wilna 1874-78, 5 Bde.; die
ersten Bände mit Benutzung der Vorträge von Professor
Zdanowicz) hat sich S. eine der ersten Stellen unter den polnischen
Literarhistorikern erworben.
Soyaux (spr. ssoajoh), Hermann, Botaniker und Reisender,
geb. 4. Jan. 1852 zu Breslau, erlernte die Gärtnerei,
studierte 1872 Botanik in Berlin und war 1873-76 als Mitglied der
Loango-Expedition in Westafrika für die Deutsche Afrikanische
Gesellschaft thätig. 1879 ging er im Auftrag des
Wörmannschen Hauses in Hamburg nach Gabun, um dort
Kaffeeplantagen anzulegen, kehrte 1885 nach Berlin zurück und
trat in den Dienst des Deutschen Kolonialvereins, für den er
1886 nach Südbrasilien ging, um die dortigen Verhältnisse
zu studieren. Er nahm dort den untern Camaquam auf, in dessen
Nähe eine deutsche Kolonie (San Feliciano) gegründet
werden sollte, und kehrte dann nach Deutschland zurück. Er
schrieb: "Aus Westafrika" (Leipz. 1879, 2 Bde.) und "Deutsche
Arbeit in Afrika" (das. 1888).
Soyeuse (spr. ssoajöhs'), vegetabilische Seide, s.
Asclepias.
Soyons amis, Cinna! (franz., spr. ssoajóng-samih,
ssinna!), "Laß uns Freunde sein, Cinna." Citat aus Corneilles
"Cinna", Akt 5, Szene 3.
Sozialaristokratie, s. Aristokratie.
Sozialdemokratie, diejenige sozialistische Richtung und
Partei, welche für die Klasse der Lohnarbeiter die Herrschaft
in einem demokratischen Staat erstrebt, um die sozialistischen
Ideen und Forderungen verwirklichen zu können. Der
Begründer der S. ist der Franzose Louis Blanc (s. d. und
Sozialismus). Die von ihm in den 40er Jahren in Paris
gegründete Arbeiterpartei war die erste sozialdemokratische.
Dieselbe erlangte vorübergehend einen Einfluß auf die
Politik in Frankreich dadurch, daß zwei ihrer Führer, L.
Blanc und Albert, nach der Februarrevolution 1848 Mitglieder der
provisorischen Regierung wurden; sie wurde mit andern radikalen
Parteien in der Junischlacht 1848 besiegt. In Deutschland war der
von F. Lassalle (s. d.) 23. Mai 1863 gegründete Allgemeine
Deutsche Arbeiterverein die erste Organisation der S. Der einzige
statutarische Zweck dieses Vereins, der sich zu dem sozialistischen
Programm
54
Sozialdemokratie (Entwickelung in Deutschland).
Lassalles bekannte, war die "friedliche und legale" Agitation
für das damals noch nicht in Deutschland bestehende
allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht mit geheimer Abstimmung.
Der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein, welcher unter der
Präsidentschaft Lassalles nur einige tausend Mitglieder
zählte und nach Lassalles Tod (31. Aug. 1864) unter
unbedeutenden Führern (Bernhard Becker, Försterling,
Mende, Tölcke u. a.) sich in verschiedene, sich gegenseitig
bekämpfende Parteien spaltete, gelangte erst zu
größerer Bedeutung, seit das von Lassalle geforderte
Wahlgesetz 1867 durch Bismarck das Wahlgesetz für den
Reichstag des Norddeutschen Bundes geworden war und der begabte
Litterat J. B. v. Schweitzer 1867 die Leitung übernahm. Als
Führer der Lassalleaner in den Reichstag des Norddeutschen
Bundes gewählt, vertrat v. Schweitzer dort mit andern
Sozialdemokraten die Sache der S. Schon unter seiner
Präsidentschaft wurde das ökonomische und politische
Programm des Vereins erweitert. In dem Verein vertraten Hasenclever
und Hasselmann eine radikalere Richtung, diese siegte, und 1871
wurde v. Schweitzer als ein bezahlter Agent der preußischen
Regierung verdächtigt und aus dem Verein gestoßen. Unter
der Führung jener beiden Männer nahm die Mitgliederzahl,
nachdem inzwischen das Wahlgesetz für den Norddeutschen Bund
auch das für das Deutsche Reich geworden war, in kurzer Zeit
enorm zu (1873 hatte der Verein schon über 60,000 Mitglieder
und in 246 Orten Lokalvereine), wurde aber auch das
ökonomische und politische Parteiprogramm radikaler
(Ausdehnung des aktiven und passiven Wahlrechts für alle
Staats- und Gemeindewahlen auf alle Altersklassen vom 20. Jahr ab,
Abschaffung der stehenden Heere, Abschaffung aller indirekten
Steuern und Einführung einer progressiven Einkommensteuer mit
Freilassung der Einkommen unter 500 Thlr. und mit einem
Steuerfuß von 20-60 Proz. für Einkommen über 1000
Thlr., Abschaffung der Gymnasien und höhern Realschulen,
Unentgeltlichkeit des Unterrichts in allen öffentlichen
Lehranstalten etc.). Hauptblatt des Vereins war der Berliner
"Sozialdemokrat". Die Forderungen und ganze Art der Agitation
näherten sich immer mehr dem Programm und der Agitationsweise
einer zweiten sozialdemokratischen Partei, welche unter dem
Einfluß von Karl Marx und der internationalen
Arbeiterassociation im August 1869 Wilhelm Liebknecht und August
Bebel gegründet hatten. In der internationalen
Arbeiterassociation war seit 1866 die erste internationale und
zugleich eine radikale und revolutionäre sozialdemokratische
Partei entstanden (s. über deren Programm, Organisation und
Agitation die Art. Internationale und Sozialismus). Liebknecht und
Bebel, Anhänger der Internationale, setzten, nachdem sie sich
lange vergeblich bemüht hatten, den Allgemeinen Deutschen
Arbeiterverein in das Lager der Internationale
hinüberzuführen, auf einem allgemeinen
Arbeiterkongreß in Eisenach im August 1869 die Gründung
einer zweiten Partei, der sozialdemokratischen Arbeiterpartei,
durch, welche sich ausdrücklich als deutscher Zweig der
Internationale konstituierte. Die neue Partei, vortrefflich
organisiert und dirigiert (Hauptorgan der Leipziger "Volksstaat"),
entfaltete namentlich seit Anfang der 70er Jahre eine
außerordentliche Rührigkeit, im Mai 1875 vereinigte sie
sich mit dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein auf dem
Kongreß in Gotha (22.-27. Mai) zur sozialistischen
Arbeiterpartei Deutschlands. Das Parteiprogramm (s. d. im Art.
Sozialismus), ein radikal-sozialistisches, stimmte in allen
wesentlichen Punkten mit dem frühern Eisenacher Programm von
1869 überein. Der "Volksstaat" (später "Vorwärts")
wurde das Hauptorgan. Die Partei nahm bei der fast vollen Freiheit,
die man ihr gewährte, einen großen Aufschwung. Nach dem
Jahresbericht von 1877 verfügte sie über 41 politische
Preßorgane mit 150,000 Abonnenten, außerdem über
15 Gewerkschaftsblätter mit etwa 40,000 Abonnenten und ein
illustriertes Unterhaltungsblatt, "Die Neue Welt", mit 35,000
Abonnenten. Ein Hauptagitationsorgan waren die besoldeten,
redegewandten Agitatoren (1876: 54 ganz besoldete, 14 zum Teil
besoldete) und die nicht besoldeten "Redner" (1876. 77). Bei den
Reichstagswahlen stimmten für sozialdemokratische Kandidaten
1871: 124,655, 1874: 351,952, 1877: 493,288 (s. unten). Die ganze
Agitation war seit 1870 eine entschieden revolutionäre, mit
diabolischem Geschick wurden in ihrer Presse die radikalen
sozialistischen und politischen Anschauungen der S. erörtert
und in den Arbeiterkreisen der Klassenhaß geschürt und
revolutionäre Stimmung gemacht. Nachdem die Reichsregierung,
um dieser Agitation, welche zu einer ernsten Gefahr für den
sozialen Frieden und das gemeine Wohl geworden war, wirksam
entgegentreten zu können, im Reichstag vergeblich eine
Verschärfung des Strafgesetzbuchs versucht hatte, griff man
nach den Attentaten von Hödel und Nobiling auf Kaiser Wilhelm
(11. Mai und 2. Juni 1878), in denen man eine Folge jener Agitation
erkennen mußte, zu dem Mittel eines Ausnahmegesetzes gegen
die S., und es erging das zunächst nur bis 31. März 1881
gültige Reichsgesetz vom 21. Okt. 1878 "gegen die
gemeingefährlichen Bestrebungen der S." Es wollte verhindern
die gefährliche, das öffentliche Wohl schädigende
sozialdemokratische Agitation, insbesondere Bestrebungen
sozialdemokratischer, sozialistischer oder kommunistischer Art,
welche, auf den Umsturz der bestehendem Rechts- oder
Gesellschaftsordnung gerichtet, diesen direkt bezwecken oder in
einer den öffentlichen Frieden, insbesondere die Eintracht der
Bevölkerungsklassen, gefährdenden Weise zu Tage treten.
Es verbot bei Strafe daher Vereine, Versammlungen, Druckschriften
dieser Art sowie die Einsammlung von Beiträgen zu diesen
Zwecken; Personen, welche sich die sozialdemokratische Agitation
zum Geschäft machen, können aus bestimmten Landesteilen
oder Orten ausgewiesen, Wirten, Buchhändlern etc. kann aus dem
gleichen Grunde der Betrieb ihres Gewerbes untersagt werden. Auch
kann über Bezirke und Orte, in welchem durch
sozialdemokratische Bestrebungen die öffentliche Sicherheit
bedroht erscheint, der sogen. kleine Belagerungszustand mit
Beschränkung des Versammlungsrechts und Ausweisung
ansässiger Personen verhängt werden. Das Gesetz wurde
1880 bis zum 30. Sept. 1884, dann bis 30. Sept. 1886, hierauf bis
30. Sept. 1888 und darauf nochmals bis 30. Sept. 1890
verlängert. Das Gesetz hat nicht die Partei beseitigt, auch
nicht die Zahl der Stimmen für sozialdemokratische Kandidaten
bei den Reichstagswahlen auf die Dauer verringert (1881: 311,961,
1884: 549,990, 1887: 763,128); aber es hat die in hohem Grad
gefährliche und gemeinschädliche Art der Agitation, wie
sie früher in der sozialdemokratischen Presse betrieben wurde,
verhindert. In der deutschen S. sonderte sich seit 1878 immer
entschiedener unter der Führung von Most und Hasselmann eine
radikale Anarchistenpartei ab, deren Hauptorgan 1879 die von Most
in London herausgegebene "Freiheit" wurde, und deren Mitglieder
auch in Deutschland und Österreich eine Reihe von Attentaten
gegen Beamte und von Raubmorden
55
Soziale Frage - Sozialismus.
ausführten. Das Hauptorgan der deutschen S. und der ihr
verbündeten internationalen S. wurde der seit Oktober 1879 in
Zürich erscheinende "Sozialdemokrat". Zu einer definitiven
Spaltung zwischen den Anarchisten und der sogen.
gemäßigten, aber noch immer radikalen und
revolutionären Bebel-Liebknechtschen Partei kam es auf dem
Kongreß in Wyden (Schweiz) im August 1880, auf dem aber auch
die "gemäßigte" Richtung aus dem Gothaer Programm in dem
Satz, daß die sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands mit
allen gesetzlichen Mitteln ihre Ziele erstreben wolle, das Wort
"gesetzlichen" strich. Das radikale sozialistische Programm, wie es
in den statutarischen Bestimmungen und
Kongreßbeschlüssen der Internationale und in dem Gothaer
Programm von 1875 festgesetzt wurde, ist im wesentlichen das
Programm der Sozialdemokraten in allen Ländern, wo die S.
besteht und organisiert ist, und dies ist außer in
Deutschland heute namentlich in Österreich, Frankreich,
Italien, Spanien, Belgien, Dänemark und in Nordamerika der
Fall. Vgl. Mehring, Die deutsche S. (3. Aufl., Brem. 1879); weitere
Litteratur bei Internationale und Sozialismus.
Soziale Frage, s. Arbeiterfrage.
Soziale Republik, der von den Sozialdemokraten
angestrebte Freistaat mit Beseitigung der kapitalistischen
Produktionsweise und jeglichen Klassenunterschiedes. S.
Sozialdemokratie.
Sozialismus (lat.), nach dem in der Wissenschaft noch
heute üblichsten, auch in der deutschen Gesetzgebung und im
großen Publikum herrschenden Sprachgebrauch die Bezeichnung
für eine bestimmte Richtung, ein bestimmtes System zur
Lösung der Arbeiterfrage (s. d.). Dieser S. unterscheidet sich
scharf von dem Kommunismus (s. d.), obschon er mit demselben manche
Grundanschauungen teilt, namentlich den Glauben an die unbedingte
Lösung dieser Frage, die ausschließliche
Zurückführung der für sie in Betracht kommenden
Übelstände auf verkehrte menschliche Einrichtungen und
die Forderung einer gänzlichen Umgestaltung des
Wirtschaftsorganismus, der Rechtsordnung und des Staatswesens der
Kulturvölker, nach welcher unter Beseitigung der individuellen
wirtschaftlichen Freiheit die Gesamtheit die Verantwortlichkeit und
Sorge für die ökonomische und soziale Lage der Einzelnen
zu übernehmen habe. Die ihm eigentümlichen, von allen
andern sozialpolitischen Richtungen (s. Arbeiterfrage)
verschiedenen Anschauungen und praktischen Forderungen haben sich
erst allmählich in der Geschichte des S. klarer und
schärfer herausgebildet. Dieselben sind heute folgende: der
Kernpunkt der sozialen Frage ist ihm die ungerechte Verteilung der
Güter, und diese führt er vorzugsweise auf die
Einrichtung des privaten Grundeigentums und Erbrechts und auf die
freie individualistische und kapitalistische Produktionsweise mit
der Trennung von Unternehmern und Lohnarbeitern, mit dem Eigentum
der erstern an den Produktionsmitteln und der Herrschaft des
"ehernen Lohngesetzes" über die letztern zurück. Er
vertritt die falsche Ansicht der ältern englischen
Nationalökonomen, daß allein die Arbeit Werte erzeuge,
und behauptet, daß infolge jener Ursachen die bisherige
Vermögensbildung und die heutige Verteilung der neu
produzierten Güter auf einer Ausbeutung der Lohnarbeiter durch
Unternehmer, Grundeigentümer und Kapitalisten, mit andern
Worten der Nichtbesitzenden durch die besitzende Klasse beruhe.
Diese ungerechte Verteilung ist ihm die wesentliche Ursache des
Proletariats und aller andern Übelstände in den untern
Volksklassen. Beseitigung dieser Übelstände erwartet er
nicht wie der Kommunismus von der völligen Gleichheit aller,
aber doch von einer sehr starken Ausgleichung der ökonomischen
und sozialen Unterschiede und von einer gesellschaftlichen
Verfassung, in welcher allein die Arbeit einen Anspruch auf
Einkommen und Vermögen gibt. Das Einkommen soll nur noch
Arbeitsertrag sein. Bekämpft wird deshalb das private
Grundeigentum, das Erbrecht und die Kapitalrente (Kapitalzins und
Kapitalgewinn). Jene beiden Rechtsinstitutionen sollen durch
Gesetz, diese Einkommensart soll durch eine neue Organisation der
Produktion: die sozialistisch-genossenschaftliche
("kollektivistische") Produktionsweise, abgeschafft werden. Das
Wesen dieser besteht darin, daß nur noch in
genossenschaftlichen Kollektivunternehmungen in
planmäßiger Regelung (Beseitigung der Lohnarbeit und
soziale Organisation der Arbeit) produziert wird, in welchen das
Eigentum an den Produktionsmitteln (Grundstücken und
Kapitalien) Kollektiveigentum der Gesellschaft ist und der Ertrag
nur an die Arbeiter und gerecht verteilt wird (Beseitigung des
Einkommens aus Kapital und Grundstücken und des "ehernen
Lohngesetzes"). Diese Umwandlung der bisherigen Produktionsweise in
die sozialistische und die planmäßige Regelung der
letztern soll durch den Staat geschehen.
Die Manchesterschule (s. d.) bezeichnet als S. jede direkte
Mitwirkung des Staats zur Lösung der sozialen Frage,
insbesondere jede staatliche Maßregel, welche zum Schutz der
Arbeiter die persönliche Freiheit in der Gestaltung der
Arbeitsvertragsverhältnisse einschränkt. Daher kam es,
daß, als Anfang der 70er Jahre Professoren der
Nationalökonomie eine solche Mitwirkung des Staats forderten,
Vertreter der Freihandelsschule (H. B. Oppenheim u. a.) ebendiese
Forderungen sozialistische und, weil dieselben von den Inhabern
akademischer Katheder ausgingen, letztere Kathedersozialisten (s.
d.) nannten. Andre nennen noch allgemeiner S. jede Richtung, welche
für die Volkswirtschaft im Gegensatz zu dem Individualismus
(s. d.) das soziale Prinzip betont und für die
Wirtschaftspolitik als Ausgangspunkt und Ziel nicht das Individuum
mit ihm zugeschriebenen Trieben und Rechten (wie es die
naturrechtliche Wirtschaftstheorie oder der Smithianismus thut),
sondern die Gesellschaft nimmt. Im folgenden ist von dem S. im
obigen Sinn die Rede.
Als eine selbständige Wirtschaftstheorie ist dieser S. ein
Produkt des 19. Jahrh.; als sein Begründer gilt mit Recht der
französische Graf Saint-Simon, der auch zuerst die Lösung
der sozialen Frage als die große Aufgabe der modernen
Gesellschaft hinstellte. Die Vertreter des S. stimmen in den oben
erwähnten allgemeinen Grundanschauungen überein, im
einzelnen aber gehen sie in ihren Ansichten wie in ihren
Forderungen wieder weit auseinander, so daß man deshalb
verschiedene sozialistische Systeme oder Theorien (insbesondere die
des Saint-Simonismus, von Ch. Fourier, L. Blanc, F. Lassalle, K.
Marx) unterscheidet. Saint-Simon (s. d. 2) hat seine
sozialistischen Anschauungen nicht zu einem geschlossenen System
entwickelt. Das geschah erst durch seine Schüler (die
Saint-Simonisten), vor allen durch den hervorragendsten derselben,
Bazard (s. d.). Dieselben nannten nach ihrem Lehrer und Meister
dies System den Saint-Simonismus. Die soziale Frage betrachten sie
nicht nur als eine ökonomische, sondern ebensosehr als eine
moralische, religiöse und politische, da es sich in ihr um
eine Reform aller Verhältnisse des Volkslebens
56
Sozialismus (Saint-Simon, Fourier, Louis Blanc).
handle. Von der Ansicht ausgehend, daß die Arbeit die
Quelle aller Werte sei, sehen sie das Hauptunrecht in Staat und
Gesellschaft darin, daß der nützlichste Stand, der der
Arbeiter (industriels), den letzten Rang einnehme, zum weitaus
größten Teil mißachtet, in traurigster Lage und
politisch ohne Einfluß sei. Es sei deshalb eine neue
Organisation der Gesellschaft zu bilden, in welcher die Klasse der
Besitzenden und der "légistes" (Beamten, Gelehrten,
Advokaten) wie die militärische Gewalt dem arbeitenden Teil
der Gesellschaft untergeordnet sei, so daß an die Stelle der
bisherigen feudalen Organisation des Staats eine "industrielle"
trete, die zugleich das ideale Ziel Saint-Simons erreiche, "allen
Menschen die freieste Entfaltung ihrer Fähigkeiten zu
sichern". Erziehung und Ausbildung sollen auf der Grundlage einer
neuen Religion, eines neuen Christentums der Bruderliebe und
werkthätigen Moral, die wirtschaftliche Thätigkeit durch
eine Änderung der Rechtsordnung umgestaltet werden. Um eine
gerechte volkswirtschaftliche Verteilung herbeizuführen,
müsse die Arbeit zum einzigen Eigentumstitel gemacht und eine
Verteilung nach dem Prinzip organisiert werden: "Jedem nach seiner
Fähigkeit, und jeder Fähigkeit nach ihren Werken". Vor
allem sei das Erbrecht der Blutsverwandtschaft abzuschaffen und
durch ein Erbrecht des Verdienstes zu ersetzen. Die Güter der
Einzelnen sollten nach ihrem Tode der Gesamtheit zufallen, der
Staat als Vertreter derselben der Erbe sein und nun die ihm
anfallenden Güter denjenigen zuweisen, die sie am besten zum
Wohl des Ganzen gebrauchen würden. Außerdem sollten
Staatsbanken zur leichtern Gewährung eines billigen Kredits
gegründet werden. Der Unterricht sollte ein unentgeltlicher,
öffentlicher und zwar der allgemeine theoretische ein gleicher
für alle (mit besonderer Berücksichtigung der moralischen
Ausbildung), der professionelle aber ein den individuellen
Fähigkeiten entsprechender sein. - Die Saint-Simonisten haben
später die Bazardsche Erbrechtsreform auf die Forderung hoher
progressiver Erbschaftssteuern und Aufhebung des Erbrechts in den
weitern Verwandtschaftsgraden beschränkt.
Gleichzeitig mit Saint-Simon, aber völlig unabhängig
von ihm, entwickelte Ch. Fourier (s. d.) ein sozialistisches
System, das durch seine Schüler, besonders durch V.
Considérant (s. d.), um die Mitte der 30er Jahre in
Frankreich allgemeiner bekannt wurde. Im Gegensatz zu Saint-Simon
konstruierte er seine neue sozialistische Gesellschaftsordnung bis
ins einzelne. Er stützt dieselbe auf eine eigentümliche
wissenschaftlich unhaltbare Psychologie und auf eine eingehende
Kritik der ökonomischen Zustände seiner Zeit, die neben
vielem Falschen wertvolle Wahrheiten enthält. Diese
Zustände erscheinen ihm von Grund aus schlecht, weil die
große Masse des Volkes, durch eine kleine Zahl ausgebeutet,
eine elende Existenz führe und keine Freude an der Arbeit und
am Dasein haben könne. Er findet es völlig verkehrt,
daß die Produktion eine individualistische (in
Einzelunternehmungen) mit freier Konkurrenz sei. Durch die Existenz
der vielen kleinen Unternehmungen finde eine ungeheure
Verschwendung in der Benutzung der Arbeitsmittel und -Kräfte
statt; würde nur in großen genossenschaftlichen
Unternehmungen produziert, so könnte mit gleichem Aufwand viel
mehr produziert und bei gerechter Verteilung ein höheres
Genußleben für die Arbeiter herbeigeführt werden.
Sie bewirke weiter eine solche Ausdehnung der Arbeitsteilung,
daß die meisten Menschen keine Abwechselung bei der Arbeit
hätten und diese dadurch, statt zu einer Freude, zu einer Last
und für viele zu einer unerträglichen Last und Qual
werde. Sie veranlasse endlich auch die Existenz einer großen
Zahl an sich völlig überflüssiger Kaufleute und
dadurch eine unnötige Verteurung der Produkte. Fourier findet
ebenso die bestehende Art der Konsumtion in den Einzelwirtschaften
völlig unwirtschaftlich. Er fordert deshalb eine
genossenschaftliche Produktion und Konsumtion in großen
Verbänden, die, etwa 300-400 Familien umfassend,
möglichst alle Genußmittel für die Mitglieder
herstellen, jedenfalls Landwirtschaft und Gewerbe betreiben, in
einem großen Gebäude (Phalanstère) alle ihre
Wohnungen und Arbeitsräume einrichten, in wenigen Küchen
die Speisen für alle bereiten und zugleich für die
Vergnügungen und den Unterricht sorgen. Er entwirft den Plan
dieser sozialen Wirtschaftsorganismen, von ihm Phalangen genannt,
im einzelnen und sucht nachzuweisen, daß sie, richtig
organisiert, eine Garantie dafür bieten, daß jeder durch
seine Arbeit die Mittel erlange, ein behagliches Genußleben
zu führen, dabei an derselben Frende habe und für alle
aus der freien naturgesetzlichen Entfaltung der Triebe die Harmonie
der Triebe sich ergebe, die nach Fouriers Philosophie die
Glückseligkeit der Menschen sei. Die Gründung der
Phalangen soll aber nicht durch staatlichen Zwang, sondern durch
den freien Willen der Einzelnen erfolgen. Fourier trug sich mit der
überspannten Hoffnung, daß, wenn nur erst eine Phalange
gebildet worden, die Phalangen sich allmählich über die
ganze Welt verbreiten würden. Fourier stellte zuerst die
Abschaffung der Lohnarbeit und Gründung großer
Produktiv- und Konsumgenossenschaften als die Panacee für die
soziale Frage auf.
Eine neue Ausbildung erfuhr der S. durch Louis Blanc (s. d.),
zuerst in dessen kleiner Schrift über "Die Organisation der
Arbeit" (1839). Auch er will die Lohnarbeit durch
Produktivgenossenschaften beseitigen. Aber seine
Produktivgenossenschaften sind wesentlich andrer Art als die
Fourierschen Phalangen, und die Gründung derselben fordert er
vom Staat. Wie bei dem bisherigen Wirtschaftssystem der große
Unternehmer den kleinen, das große Kapital das kleine
unterdrücke, so könne der Staat, als der
größte Kapitalist, durch die Gründung von
größern Unternehmungen als die bestehenden in der Form
von Produktivgenossenschaften alle, auch die größten
Unternehmer allmählich konkurrenzunfähig machen und so
ohne Zwang und Gewalt der höchste Ordner und Herr der
Produktion werden. Wenn dies geschehen, habe er es in der Hand,
durch die Regelung der innern Organisation dieser Genossenschaften
und der Art der Ertragsverteilung den arbeitenden Klassen die
genügende materielle Existenz zu sichern. Louis Blanc denkt
sich dann die Entwickelung für die gewerbliche Produktion in
drei Stadien. In dem ersten gründe der Staat die Ateliers
sociaux für die verschiedenen Industriezweige, zunächst
als Staatsunternehmungen; nach einiger Zeit aber wandle er sie um
in reine Produktivgenossenschaften, überlasse die Verwaltung
den Mitgliedern und beschränke sich nur auf die gesetzliche
Regelung der Organisation und der Gewinnverteilung. Diese
Genossenschaften würden sofort die bessern Arbeitskräfte
an sich ziehen und mit geringern Kosten produzieren, zumal wenn sie
gleichzeitig große Konsumgenossenschaften errichten
würden. Die bestehenden Unternehmungen würden gezwungen
werden, entweder den Betrieb einzustellen, oder sich in solche
Genossenschaften umzuwandeln. In dem zweiten Stadium sollen dann,
damit keine Konkurrenz unter den Genossenschaften entstehe, die
Ge-
57
Sozialismus (Lassalle, Karl Marx).
nossenschaften gleichartiger Produktionszweige sich zu
größern Genossenschaften associieren, bis in jedem nur
eine Landesgenossenschaft existiere. Im dritten associieren sich
auch diese, so daß schließlich eine große
Produktivgenossenschaft produziere, deren Organisation und
Gewinnverteilung das Staatsgesetz regele. Eine Reform der Erziehung
(mit obligatorischem und unentgeltlichem Unterricht) würde
diese Entwickelung sichern. Um auch die Landwirtschaft zu
reformieren, soll das Erbrecht der Seitenverwandten fortfallen, an
ihrer Stelle soll die Gemeinde erben und mit dem ihr so anfallenden
Vermögen ähnlich verwaltete landwirtschaftliche
Produktivgenossenschaften gründen. Da von der herrschenden
Gesellschaft mit monarchischer Staatsform eine Lösung dieser
Aufgaben nicht zu erwarten sei, so müsse zunächst der
Staat in eine sozialdemokratische Republik umgewandelt werden, in
welcher die untern Klassen, im Besitz der Herrschaft, dann auf dem
vorgezeichneten Weg vorgehen könnten.
Diese Ideen wurden in den 40er Jahren das Programm der
französischen Sozialisten, an deren Spitze Louis Blanc stand.
Er ist der Gründer der Sozialdemokratie, d. h. derjenigen
Partei, welche für die Klasse der Lohnarbeiter die Herrschaft
in einer demokratischen Republik erstrebt, um im Besitz dieser
Herrschaft das sozialistische Programm zu verwirklichen.
Modifiziert wurde dies Programm durch die Beschlüsse des
Arbeiterparlaments, welches 1848 nach der Februarrevolution, von
der provisorischen Regierung einberufen, im Palais Luxembourg unter
dem Vorsitz von Louis Blanc tagte. Nach denselben sollte ein eignes
Ministerium (ministère du progrès) die sozialistische
Reform herbeiführen: zunächst die Bergwerke und
Eisenbahnen für den Staat ankaufen, das Versicherungswesen in
Staatsanstalten zentralisieren, große Warenhallen und
Vorratshäuser zu entgeltlicher Benutzung errichten, die
französische Bank in eine Staatsbank umwandeln und mit dem
Reinertrag aus diesen Geschäften industrielle und
landwirtschaftliche Genossenschaften nach dem Plan Louis Blancs mit
einigen Abänderungen desselben gründen. Zur Beseitigung
einer verderblichen Konkurrenz sollte für alle Produkte durch
gesetzliche Feststellung des auf die Kosten zu schlagenden Gewinns
ein Normalpreis vorgeschrieben werden.
Eine andre Modifikation gab dem Blancschen S. Ferdinand Lassalle
(s. d.). Er betrachtet die soziale Frage als Einkommensfrage,
hervorgerufen durch die ungerechte Verteilung des Ertrags der
Unternehmungen infolge des "ehernen Lohngesetzes" der freien
Konkurrenz, nach welchem der Lohn stets um einen Punkt oszilliere,
bei welchem er den Arbeitern nur die notdürftig Befriedigung
der Existenzbedürfnisse gestatte. Die Lösung sieht er in
der Beseitigung dieser Lohnregulierung und Abschaffung der
Lohnarbeit durch Produktivassociationen mit Hilfe des Staats. Aber
dieser soll nicht, wie Louis Blanc will, dieselben gründen und
ihre Organisation wie die Art der Gewinnverteilung bestimmen,
sondern der Staat soll nur freiwillig sich bildende mit seinem
Kredit unterstützen, wobei er zur Wahrung seines Interesses
sich die Genehmigung der Statuten und eine Kontrolle der
Geschäftsführung vorbehalten könne. Darin stimmt
Lassalle wieder mit Louis Blanc überein, daß, um diese
Staatsunterstützung zu erreichen, der Arbeiterstand sich zum
herrschenden im Staat machen müsse. Er wähnte, daß
die Einführung des allgemeinen, gleichen und direkten
Wahlrechts mit geheimer Abstimmung demselben in Deutschland zu
dieser Herrschaft verhelfen würde, und forderte deshalb die
deutschen Arbeiter auf, ihre ganze Agitation zunächst nur auf
dieses Ziel zu richten.
Derjenige, der in neuerer Zeit den S. eigentlich allein in
umfassender Weise und wirklich wissenschaftlich zu begründen
versucht, ihm zugleich die radikalste Ausdehnung gegeben hat, ist
Karl Marx (s. d.). In seinem Hauptwerk: "Das Kapital", sucht er
nachzuweisen, daß die Verteilung in der bisherigen
Volkswirtschaft eine durchaus ungerechte sei, denn das Kapital
entstehe und vermehre sich nur dadurch, daß es einen
möglichst großen Teil des Arbeitsprodukts in sich
aufsauge; die Arbeit, nicht das Kapital setze dem Produkt Wert zu,
der Arbeiter leiste stets mehr, als ihm im Lohn vergolten werde,
der ihm nicht bezahlte Mehrwert seiner Leistung aber falle dem
Eigentümer der Produktionsmittel zu und vermehre das Kapital.
Marx folgert daraus die Ungerechtigkeit eines Einkommens aus
Kapital- und Grundbesitz. Weiter sucht er zu erweisen, daß
aus der gegenwärtigen kapitalistischen Produktionsweise die
sozialistisch-kooperative notwendig entstehen müsse.
Zunächst würden in dem freien Konkurrenzkampf die
Produktionsmittel sich in den Händen einer immer kleinern
Anzahl konzentrieren, dadurch aber der Zustand für die
Arbeiter endlich so unerträglich werden, daß dieselben,
ihre Macht benutzend, die wenigen Expropriateure einfach
expropriieren und, geschult und organisiert durch den bisherigen
kapitalistischen Produktionsprozeß, auf der Grundlage
gemeinsamen Eigentums an den Produktionsmitteln in den schon
bestehenden großen Unternehmungen weiter produzieren, den
Ertrag derselben, entsprechend seiner ökonomischen Natur als
Arbeitsertrag, aber fortan nur nach Maßgabe der
Arbeitsleistungen verteilen würden. Besser indes sei es,
diesen Expropriations- und Produktionsumwandlungsprozeß zu
beschleunigen. Die praktischen Konsequenzen hat dann der Agitator
Marx gezogen und in den Beschlüssen der von ihm
gegründeten und geleiteten internationalen Arbeiterassociation
(vgl. Internationale) sowie in dem Programm der heutigen deutschen
Sozialdemokratie, dessen geistiger Urheber er ist, zum Ausdruck
gebracht. Von diesen Beschlüssen sind für die
sozialistischen Bestrebungen insbesondere charakteristisch die der
Kongresse in Brüssel und Basel. Auf dem Kongreß in
Brüssel (1868) wurde die Abschaffung des Kapitaleinkommens und
der Grundrente, die Gründung von Produktivgenossenschaften mit
Kollektiveigentum an den Produktionsmitteln und von besondern
Kreditanstalten für dieselben, die Umwandlung aller
Transportanstalten in Staatsanstalten, aller Bergwerke, Wälder
und landwirtschaftlichen Grundstücke in Staatseigentum, mit
Überweisung der letztern an Arbeitergesellschaften zur
Benutzung, in das Programm aufgenommen. Der Kongreß in Basel
(1869) sprach sich für die Abschaffung des privaten
Grundeigentums und für die Bebauung des Bodens durch
solidarisierte Gemeinden sowie für die Abschaffung des
Erbrechts aus. Das sozialistisch-politische Programm der deutschen
Sozialdemokratie (sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands)
lautet nach der Fassung des Gothaer Kongresses von 1875:
"1) Die Arbeit ist die Quelle alles Reichtums und aller Kultur,
und da allgemein nutzbringende Arbeit nur durch die Gesellschaft
möglich ist, so gehört der Gesellschaft, d. h. allen
ihren Gliedern, das gesamte Arbeitsprodukt, bei allgemeiner
Arbeitspflicht, nach gleichem Recht jedem nach seinen
vernunftgemäßen Bedürfnissen. In der heutigen
Gesellschaft sind die Arbeitsmittel Monopol der Kapitalistenklasse;
die hierdurch bedingte Abhängigkeit der Arbeiterklasse ist die
Ursache des Elends und der Knechtschaft in allen Formen. Die
Befreiung der Arbeit erfordert die
58
Sozialismus (Rodbertus; Umsturzbestrebungen in der
Gegenwart).
Verwandlung der Arbeitsmittel in Gemeingut der Gesellschaft und
die genossenschaftliche Regelung der Gesamtarbeit mit
gemeinnütziger Verwendung und gerechter Verteilung des
Arbeitsertrags. Die Befreiung der Arbeit muß das Werk der
Arbeiterklasse sein, der gegenüber alle andern Klassen nur
eine reaktionäre Masse sind. 2) Von diesen Grundsätzen
ausgehend, erstrebt die sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands
(die hier ursprünglich im Programm enthaltenen Worte: 'mit
allen gesetzlichen Mitteln' wurden später gestrichen) den
freien Staat und die sozialistische Gesellschaft, die Zerbrechung
des ehernen Lohngesetzes durch Abschaffung des Systems der
Lohnarbeit, die Aufhebung der Ausbeutung in jeder Gestalt, die
Beseitigung aller sozialen und politischen Ungleichheit. Die
sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, obgleich zunächst
im nationalen Rahmen wirkend, ist sich des internationalen
Charakters der Arbeiterbewegung bewußt und entschlossen, alle
Pflichten, welche derselbe den Arbeitern auferlegt, zu
erfüllen, um die Verbrüderung aller Menschen zur Wahrheit
zu machen. Die sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands fordert,
um die Lösung der sozialen Frage anzubahnen, die Errichtung
von sozialistischen Produktivgenossenschaften mit Staatshilfe unter
der demokratischen Kontrolle des arbeitenden Volkes. Die
Produktivgenossenschaften sind für Industrie und Ackerbau in
solchem Umfang ins Leben zu rufen, daß aus ihnen die
sozialistische Organisation der Gesamtheit entsteht. 3) Die
sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands fordert als Grundlagen
des Staats: a) Allgemeines, gleiches, direktes Wahl- und Stimmrecht
mit geheimer, obligatorischer Stimmabgabe aller
Staatsangehörigen vom 20. Lebensjahr an für alle Wahlen
und Abstimmungen in Staat und Gemeinde. Der Wahl- oder
Abstimmungstag muß ein Sonntag oder Feiertag sein. d) Direkte
Gesetzgebung durch das Volk; Entscheidung über Krieg und
Frieden durch das Volk. c) Allgemeine Wehrhaftigkeit, Volkswehr an
Stelle der stehenden Heere. d) Abschaffung aller Ausnahmegesetze,
namentlich der Preß-, Vereins- und Versammlungsgesetze,
überhaupt aller Gesetze, welche die freie
Meinungsäußerung, das freie Denken und Forschen
beschränken. e) Rechtsprechung durch das Volk; unentgeltliche
Rechtspflege. f) Allgemeine und gleiche Volkserziehung durch den
Staat; allgemeine Schulpflicht; unentgeltlicher Unterricht in allen
Bildungsanstalten; Erklärung der Religion zur
Privatsache."
Das Programm enthält außerdem noch eine Reihe von
Forderungen, die indes ausdrücklich als Forderungen "innerhalb
der heutigen Gesellschaft" bezeichnet werden und nicht mehr
spezifisch sozialistische sind. Mit diesem Programm stimmt im
wesentlichen überein das Programm des Parti ouvrier socialiste
révolutionnaire français von 1880, welches die Basis
der gegenwärtigen sozialistischen Bewegung in Frankreich ist
und in der Hauptsache auch von den spanischen und italienischen
Sozialisten angenommen wurde, ebenso das Programm der
sozialistischen Arbeiterpartei von Nordamerika von 1877 (weiteres
hierüber bei Zacher, s. Litteratur).
In Deutschland entstand Mitte der 70er Jahre neben der
Sozialdemokratie vorübergehend eine konservative
sozialistische Richtung, der sogen. Staatssozialismus, deren
politischer Grundgedanke ein Bündnis der Monarchie mit dem
vierten Stand war, um die vermeintliche Herrschaft der Bourgeoisie
und des Kapitals zu brechen, die berechtigten Forderungen der
Arbeiterklasse durch eine sozialistische Organisation der
Volkswirtschaft zu befriedigen und damit zugleich die Machtstellung
der Monarchie zu befestigen. Das unklare sozialistische Programm
(s. dasselbe in Nr. 23 des "Staatssozialist" vom 1. Juni 1878)
dieser Richtung, die wenige Anhänger fand, und deren
Hauptvertreter unter andern Pastor R. Todt ("Der radikale deutsche
S. und die christliche Gesellschaft. Aufl., Wittenb. 1878) und der
Schriftsteller Rudolf Meyer waren (Organ: "Der Staatssozialist.
Wochenschrift für Sozialreform", 1877 ff.), stützt sich
auf die sozialistischen Anschauungen von J. K. Rodbertus (s. d.),
der die Berechtigung eines Einkommens aus Besitz, der "Rente"
(Grundrente wie Kapitalrente), bestritt und den Kernpunkt der
sozialen Frage in dem angeblichen "Gesetz" sah, daß, wenn der
Verkehr in Bezug auf die Verteilung der Nationalprodukte sich
selbst überlassen bleibe, bei steigender Produktivität
der gesellschaftlichen Arbeit der Lohn der arbeitenden Klassen ein
immer kleinerer Teil des Nationalprodukts werde, daß der
relative Lohn der Arbeit in dem Verhältnis sinke, als sie
selbst produktiver werde, und daß folglich die Kaufkraft der
Mehrzahl der Gesellschaft immer kleiner werde. Die Lösung der
Frage erblickte Rodbertus darin, daß den Arbeitern ein mit
der steigenden nationalen Produktivität mitsteigender
Arbeitslohn gesichert würde, und er glaubte, dieselbe - ohne
daß man dem Grund- und Kapitaleigentum von seinem heutigen
Grundrenten- und Gewinnbetrag etwas fortnehme, sondern nur
verhindere, daß auch für alle Zukunft, wie bisher, das
Plus einer steigenden nationalen Produktion der Grundrente und dem
Kapitalgewinn zuwachse - durch eine Reihe von Vorschlägen
gefunden zu haben, deren wichtigste sind: der Staat solle
zunächst für jedes "Gewerk" einen normalen Zeitarbeitstag
und einen normalen Werkarbeitstag festsetzen und den Lohnsatz
für den letztern mit periodischen Revisionen bestimmen, bez.
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer unter seiner Autorität
festsetzen lassen. Sodann soll "der normale Werkarbeitstag zu
Werkzeit oder Normalarbeit erhoben und nach solcher Werkzeit oder
Normalarbeit (nach solcher in sich ausgeglichener Arbeit) nicht
bloß der Wert des Produkts jedes Gewerks normiert, sondern
auch der Lohn in jedem Gewerk als Quote dieses nach Normalarbeit
berechneten Produktwerts fixiert und bezahlt werden".
In der Geschichte der sozialistischen Agitation ist die Phase
des friedlichen, doktrinären S. und die des gewaltsamen,
praktischen S. zu unterscheiden. In jener, welcher die
Thätigkeit Saint-Simons und Fouriers und ihrer Schüler
angehört, war die Bewegung eine wesentlich theoretische und
friedliche. Jene Sozialisten erhofften auf friedlichem Weg die
allmähliche Verwirklichung ihrer Ansichten. Sie wandten sich
deshalb nur an die Gebildeten, nicht an diejenigen Klassen, deren
Besserung sie wollten, und wenn auch ihre Äußerungen
nicht frei waren von Anklagen gegen die bestehenden Einrichtungen
und Zustände, so enthielten sie doch nur selten Anklagen gegen
Personen und gegen die besitzenden Klassen. Diesen friedlichen
Charakter verliert aber die sozialistische Agitation seit Louis
Blanc und im Verlauf der Zeit mehr und mehr. Neue sozialistische
Systeme und Forderungen werden aufgestellt nicht mehr als
wissenschaftliche Theorien, sondern als Programme praktischer
Agitationsparteien. Die Vertreter derselben wenden sich nun mit
ihren Lehren direkt an die untern Volksklassen, um sie zum S. zu
bekehren und für dessen Durchführung zu gewinnen; sie
werden Arbeiteragitatoren. Ein Hauptmittel ihrer Agitation wird es,
bei den untern Klassen die Gefühle der Erbitterung und des
Hasses nicht bloß gegen die bestehenden Zustände des
öffentlichen Lebens, sondern auch gegen die Träger der
Staatsgewalt und gegen die besitzenden Klassen zu erzeugen. Das
ökonomische sozialistische Programm wurde hiermit ein
radikaleres, und da es durch den Staat verwirklicht werden sollte,
wurde die Bewegung eine politische. Da man sich sagen mußte,
daß die bestehenden Staaten die sozialistischen Wünsche
nicht erfüllen würden, wurde die Erlangung der Herrschaft
im Staat für die Lohnarbeiterklasse in das Programm
aufgenommen und das praktische Ziel. Die sozialistische
59
Soziallast - Spach.
Partei wurde eine sozialdemokratische. Naturgemäß
gesellten sich nun weitere politische Forderungen (betreffend die
Verfassung des Staats, das Wahlrecht, das Gerichts-, Schul- und
Militärwesen etc.) hinzu, und wie das ökonomische wurde
auch das politische Programm, namentlich seit der Gründung der
Internationalen Arbeiterassociation, immer radikaler. Man machte
auch kein Hehl daraus, daß allein die Revolution der
Sozialdemokratie zum Sieg verhelfen könne, und sprach es offen
aus, daß man nicht zaudern würde, zu diesem Mittel zu
greifen, wenn man nur die Möglichkeit des Gelingens sähe.
Daher entstand nun eine Art der Agitation, die nur die Vorbereitung
zur Revolution war. Und deshalb ist diese Partei auch die Gegnerin
einer starken, mächtigen Staatsgewalt in den bestehenden
Staaten, deshalb bekämpft sie vor allem das stehende Heer,
deshalb ihre ausgesprochene Feindschaft gegen die Religion, nicht
bloß gegen die Kirche. Der ganze Charakter, den die Bewegung
angenommen, zwang und zwingt die Staaten zu einem entschiedenen
Vorgehen gegen dieselbe, wie es das Deutsche Reich in dem Gesetz
vom 21. Okt. 1878 (s. Sozialdemokratie) und andre Staaten in andrer
Weise gethan haben. In neuester Zeit ist in der Sozialdemokratie
eine noch radikalere Richtung in den Anarchisten hervorgetreten,
die, ohne ein neues sozialistisches Programm aufzustellen, den
sofortigen Umsturz alles Bestehenden mit allen nur möglichen
Mitteln will, inzwischen aber die Beseitigung der Gegner durch Mord
empfiehlt (s. Anarchie).
Vgl. außer den im Art. "Kommunismus" (S. 990) angegebenen
Werken von Stein, Sudre, Hildebrand, Marlo, Schäffle, Meyer:
L. Reybaud, Études sur les réformateurs (6. Aufl.,
Par. 1849, 2 Bde.); E. Jäger, Der moderne S. (Berl. 1873);
Derselbe, Geschichte des S. in Frankreich (das. 1876, Bd. 1);
Schuster, Die Sozialdemokratie (2. Aufl., Stuttg. 1876); Mehring,
Die deutsche Sozialdemokratie (3. Aufl., Brem. 1879); v. Scheel,
Unsre sozialpolitischen Parteien (Leipz. 1878); Schäffle,
Quintessenz des S. (8. Aufl. 1885); E. de Laveleye, Le socialisme
contemporaine (4. Aufl., Par. 1889; deutsch, Tübing. 1884);
Zacher, Die rote Internationale (Berl. 1884); Kleinwächter,
Grundlagen und Ziele des sogen. wissenschaftlichen S. (Innsbr.
1885); Adler, Geschichte der ersten sozialpolitischen
Arbeiterbewegung in Deutschland (Bresl. 1885); Zander, Die
sozialpolitischen Gesetze des Deutschen Reichs (Kattowitz 1887);
Dawson, German socialism (Lond. 1888); Semler, Geschichte des S.
und Kommunismus in Nordamerika (Leipz. 1880); "S. und Anarchismus
in England und Nordamerika während der Jahre 1883-86" (Berl.
1887); v. Scheel, S. und Kommunismus, in Schönbergs "Handbuch
der politischen Ökonomie" (2. Aufl., Tübing. 1885, Bd. 1,
S. 107 ff.); Schönberg, Gewerbliche Arbeiterfrage (ebenda, Bd.
2).
Soziallast (Societätslast), Genossenschaftssteuer,
in süddeutschen Gemeinden eine Steuer, welche zur Abwendung
besonderer Nachteile oder zur Erreichung besonderer Vorteile
einzelner Einwohner oder Besitzer oder einzelner Klassen von
solchen bestimmt ist. Vgl. Gemeindehaushalt, S. 68.
Sozialpolitik, der Inbegriff der auf Besserung der
sozialen Verhältnisse, vorzüglich auf Regelung der
Arbeiterfrage, gerichteten Bestrebungen und Maßregeln,
insbesondere derjenigen des Staats. Während der Sozialismus
die gesellschaftliche Verfassung von Grund aus ändern will,
hält die heutige praktische S. an der gegebenen sozialen und
Eigentumsordnung grundsätzlich fest und will auf deren Boden
durch die Arbeiterschutzgesetzgebung (s. Fabrikgesetzgebung), durch
die Arbeiterversicherung (s. d.), durch entsprechende
Steuerverteilung, Verwaltungsmaßnahmen verschiedener Art etc.
die Lage der untern Klassen verbessern und die durch Privateigentum
und freien Wettbewerb sich bildenden Klassengegensätze
mildern. In diesem Sinn wirkt der Verein für S., welcher 1872
zu Eisenach gegründet wurde und bis zur Neuzeit für
Vorbereitung von seither in Gesetzgebung und Verwaltung
eingetretenen Änderungen thätig gewesen ist (vgl.
Kathedersozialisten). Über die verschiedenen sozialpolitischen
Richtungen der Gegenwart s. Arbeiterfrage.
Sozomenos, Salamanes Hermias, Kirchenhistoriker, geboren
um 400 n. Chr. bei Gaza in Palästina, trat als Sachwalter in
Konstantinopel auf und starb nach 443. Er schrieb unter Benutzung
des Sokrates eine Fortsetzung der Kirchengeschichte des Eusebios
(von 323 bis 439), herausgegeben von Valesius (Par. 1668) und
Hussey (Lond. 1860 u. 1874 ff.).
Sozopolis (türk. Sizebolu), Stadt in Ostrumelien, an
der Südseite des Golfs von Burgas, mit guter Reede, auf einem
Vorgebirge, Sitz eines griechischen Erzbischofs, hat ca. 2000
griech. Einwohner, welche Handel (vorzüglich mit Holz)
treiben; hieß im Altertum und bis 430 n. Chr. Apollonia.
Sp., auch Spach, bei botan. Namen für Eduard Spach,
geb. 1801 zu Straßburg, gest. 1879 als Oberaufseher der
Herbarien des Jardin des plantes in Paris.
Spaa (Spa), Flecken in der belg. Provinz Lüttich,
Arrondissement Verviers, in waldiger Gebirgsgegend, an der
Staatsbahnlinie Gouvy-Pepinster, hat Fabrikation von lackierten
Holzwaren (bois de Spa), Wollkratzen und Spindeln, Gerbereien,
Eisenhämmer, Hochöfen, eine höhere Knabenschule und
(1887) 7278 Einw., ist aber namentlich berühmt durch seine
Mineralquellen, von denen die stärkste (Pouhon) in der Stadt,
15 außerhalb derselben liegen. Die wichtigsten der letztern
sind: Géronstère, Sauvenière, die beiden
Tonnelets, Groesbeck, Barisart, Nivesé und Marie-Henriette.
Sie besitzen eine Temperatur von 9-10° C. und gehören zu
den alkalisch-eisenhaltigen Säuerlingen, weshalb sie
namentlich gegen Hypochondrie, Hysterie, Verschleimung,
Magenleiden, Nervenschwäche empfohlen und jährlich von
11-12,000 Kurgästen aus allen Weltgegenden, insbesondere aus
England, besucht werden. S. besitzt daher auch viele prächtige
Gebäude, mit allem Komfort eingerichtete Gasthäuser,
glänzende Etablissements für Vergnügungen und
reizende Spaziergänge. Das Wasser des Pouhon wird unter dem
Namen Spaawasser weithin versendet. Vgl. Scheuer, Traité des
eaux de S. (2. Aufl., Brüssel 1881).
Spaargebirge, Höhenzug auf dem rechten Elbufer bei
Meißen in Sachsen, 199 m hoch. Hier wird der beste
Meißener Wein gebaut.
Spaccaforno, Stadt in der ital. Provinz Syrakus
(Sizilien), Kreis Modica, mit (1881) 8588 Einw. In der Nähe
das sogen. Troglodytenthal (Valle d'Ispica) mit vielen oft in drei
Geschossen übereinander in den Fels gehauenen, teilweise sehr
schwer zugänglichen Höhlen, welche der
ursprünglichen Bevölkerung wahrscheinlich zu Wohnungen
dienten.
Spaccio (ital., spr. spattscho), Absatz, Vertrieb.
Spach (spackig), vor Trockenheit geborsten (Holz).
Spach, Ludwig Adolf, elsäss. Geschichtsforscher,
geb. 27. Sept. 1800 zu Straßburg, studierte daselbst
60
Spachtel - Spalato.
1820-23 die Rechte, ward dann Erzieher in Paris, Rom und der
Schweiz, 1840 Archivar des Departements Niederrhein und daneben
1848-54 Schriftführer des protestantischen Direktoriums und
1872 Honorarprofessor an der Universität. Er starb 16. Okt.
1879 in Straßburg. Er schrieb: "Histoire de la Basse-Alsace"
(1859); "Lettres sur les archives départementales du
Bas-Rhin" (Straßb. 1861); "Inventaire sommaire des archives
départementales du Bas-Rhin" (das. 1863 ff., 3 Bde.). Seine
zahlreichen kleinern Arbeiten (darunter die "Biographies
alsaciennes", 3 Bde.) erschienen gesammelt als "OEuvres choisies"
(Nancy 1869-71, 5 Bde.). In deutscher Sprache veröffentlichte
er: "Moderne Kulturzustände im Elsaß" (Straßb.
1872-74, 3 Bde.); das Drama "Heinr. Waser" (das. 1875); "Zur
Geschichte der modernen französischen Litteratur" (das. 1877);
"Dramatische Bilder aus Straßburgs Vergangenheit" (das. 1876,
2 Bde.). Unter dem Pseudonym Louis Lavater verfaßte er
mehrere Romane: "Henri Farel" (1834), "Le nouveau Candide" (1835),
"Roger de Manesse" (1849). Vgl. Kraus, Ludw. S. (Straßb.
1880).
Spachtel, s. v. w. Spatel.
Spack, s. v. w. Steinsalz, s. Salz, S. 236.
Spada (ital.), Schwert, Degen.
Spada, Palast in Rom, s. Rom, S. 908.
Spadicifloren (Kolbenblütler), Ordnung im
natürlichen Pflanzensystem unter den Monokotyledonen,
charakterisiert durch einen meist kolbenförmigen
Blütenstand, der häufig von einem großen
Hüllblatt umgeben ist und zahlreiche kleine Blüten
trägt, welche gewöhnlich eingeschlechtig, ein- oder
zweihäusig sind und kein oder doch kein blumenkronartig
gefärbtes Perigon besitzen; die Samen enthalten Endosperm,
welches den kleinen, geraden Keimling umgibt. Die Ordnung besteht
aus den Familien: Aroideen, Pandaneen, Cyklantheen, Palmen und
Typhaceen.
Spadille (franz., spr. -dihj), die höchste
Trumpfkarte im L'hombrespiel (Pik-As) und in dem diesem nach
gebildeten Solospiel (Eichel-Ober).
Spadix (lat.), Kolben, s. Blütenstand, S. 80.
Spado (lat.), ein Verschnittener, Eunuch.
Spagat (Spaget, v. ital. spaghetto), in Österreich,
Bayern etc. s. v. w. Kanzleibindfaden.
Spagirisch (ital.), s. v. w. alchimistisch.
Spagniolgeschmack, s. Firnewein.
Spaguolette (ital., spr. spanjo-), spanischer Drehriegel,
Riegelstange am Fenster; auch s. v. w. spanische Zigarrette.
Spaguoletto (spr. spanjo-), Maler, s. Ribera.
Spagnuólo (spr. spanj-), Maler, s. Crespi 3).
Spahi (türk., pers. Sipahi, "Krieger, Heer"), in
Mittelasien der dem Fürsten zur Stellung von Soldaten
verpflichtete Adel, welche Bezeichnung später auf die Soldaten
selbst überging, woraus die englischen Sepoys (s. d.)
entstanden. S. hießen in der Türkei die von den
Lehnsträgern zu stellenden Reiter, später war es die
Bezeichnung der irregulären türkischen Reiterei, welche
gleichzeitig mit den Janitscharen (s. d.) entstand und den Kern der
türkischen Reiterei bildete. S. heißen die 4
französischen Reiterregimenter, von denen 3 zu 6 Eskadrons in
Algerien und 1 zu 3 Eskadrons in Tunis stehen. Sie wurden um 1834
aus Eingebornen gebildet und sind heute organisiert und bewaffnet
wie die übrige französische Kavallerie, aber von
französischen Offizieren befehligt.
Spaichingen, Oberamtsstadt im württemberg.
Schwarzwaldkreis, an der Prim und der Linie Rottweil-Immendingen
der Württembergischen Staatsbahn, 659 m ü. M., hat eine
kath. Kirche, ein Gewerbemuseum, ein Amtsgericht, ein Revieramt,
ein Hauptsteueramt, Zigarren-, Trikot-, Schuh- und Holzwaren- und
Uhrenfabrikation, Klavier- und Orgelbau, Buchdruckerei,
Bierbrauerei und (1885) 2441 meist kath. Einwohner. Nahebei der
Dreifaltigkeitsberg mit Wallfahrtskirche.
Spalatin, Georg Burkhardt, Beförderer der
Reformation, geb. 1484 zu Spalt im Bistum Eichstätt (daher
sein Name), lag seit 1499 in Erfurt, gleichzeitig mit Luther,
humanistisch-philosophischen Studien ob, ward 1502 Magister zu
Wittenberg, studierte dann in Erfurt noch die Rechte und Theologie,
wurde 1509 Erzieher von Johann Friedrich, dem nachherigen
Kurfürsten von Sachsen, 1514 ernannte ihn Friedrich der Weise
zu seinem Hofkaplan, dann zu seinem Geheimschreiber und zum
Bibliothekar an der Universität Wittenberg. S. war seitdem der
vertrauteste Diener des Kurfürsten, den er fast zu allen
Reichstagen begleitete, und dessen Beziehungen zu Luther er fast
ausschließlich vermittelte; seine nicht hoch genug
anzuschlagenden Verdienste um die deutsche Reformation sind bisher
noch viel zu wenig gewürdigt. Johann der Beständige, der
ihn ebenso wie sein Vorgänger zu schätzen wußte,
ernannte ihn 1525 zum Ortspfarrer und Superintendenten von
Altenburg. 1530 begleitete S. den Kurfürsten zum Augsburger
Reichstag. Von 1527 bis 1542 entwickelte er eine bedeutende
Thätigkeit bei der Organisation der evangelischen Kirche der
sächsischen Lande. Er starb 16. Jan. 1545 in Altenburg. S.
schrieb die Biographien von Friedrich dem Weisen (hrsg. von
Neudecker und Preller, Weim. 1851) und Johann dem Beständigen;
"Christliche Religionshändel oder Religionssachen", von
Cyprian irrig "Annales Reformationis" (Leipz. 1718) genannt, und
eine Geschichte der Päpste und Kaiser des
Reformationszeitalters. Seine meist im Archiv zu Weimar liegenden
Briefe sind noch ungedruckt. Vgl. J. Wagner, G. S. und die
Reformation der Kirchen und Schulen in Altenburg (Altenb. 1830);
Seelheim, G. S. als sächsischer Historiograph (Halle 1876);
Burkhardt, Geschichte der sächsischen Kirchen- und
Schulvisitationen von 1524 bis 1545 (Leipz. 1879).
Spálato (slaw. Spljet), Stadt in Dalmatien,
halbmondförmig auf der Südseite einer Halbinsel im Grund
einer Bucht des Adriatischen Meers gelegen, die schönste und
volkreichste Stadt des Landes, teilt sich in die Altstadt, die
Neustadt und vier Vorstädte. Öffentliche Plätze
sind: der Domplatz (Piazza del Tempio) und der Herrenplatz. Die
Stadt ist reich an antiken Baudenkmälern. Den ganzen Raum der
Altstadt nahm der umfangreiche Palast des Kaisers Diokletian ein,
von dessen südlicher Fronte namentlich ein 125 m langes
Peristyl mit Vestibulum erhalten ist (s. Tafel "Baukunst VI", Fig.
12 u. 13), welches gegenwärtig den Domplatz bildet. Die an
demselben gelegene Kathedrale (das ehemalige Diokletianische
Mausoleum), ein wohlerhaltener römischer Gewölbebau,
bildet außen ein mit korinthischen Säulen geziertes
Achteck, innen eine Rotunde mit Kuppel. Beim Eingang steht eine
ägyptische Sphinx, und neben dem Dom erhebt sich ein
imposanter Glockenturm aus dem 15. Jahrh. Der
gegenüberstehende Äskulaptempel dient jetzt als
Taufkapelle und ist gleichfalls sehr gut erhalten. Außerdem
sind die Trümmer der Diokletianischen Wasserleitung
bemerkenswert. Auf der Ostseite der Stadt erhebt sich das Fort
Grippi. S. zählt (1880) mit den Vorstädten 14,513 Einw.
Der Hafen ist etwas versandet und wird
61
Spalding - Spaltbarkeit.
durch einen Damm gegen die Südwinde geschützt. 1886
sind daselbst 1814 beladene Schiffe mit 286,366 Ton. eingelaufen.
Die Stadt treibt Wein-, Öl- und Gemüsebau, Fabrikation
von Likören (Rosoglio und Maraschino), Seiler- und Teigwaren,
Seife, Ziegeln, Kalk und Zement, ferner Schiffbau,
Küstenschiffahrt, lebhaften Handel mit Wein und Vieh sowie
auch Durchfuhrhandel und Niederlagsverkehr nach Bosnien und der
Herzegowina. S. besitzt eine Gasanstalt, eine Filiale der
Österreichisch-Ungarischen Bank, 2 Lokalbanken und ist der
Ausgangspunkt der Dalmatischen Eisenbahn nach Siveric mit
Abzweigung nach Sebenico. Es ist Sitz einer Bezirkshauptmannschaft,
eines Kreis- und Bezirksgerichts, einer Finanzbezirksdirektion,
eines Hauptzoll- und Hauptsteueramtes, eines Hafenkapitanats, einer
Handels- und Gewerbekammer, eines deutschen Konsuls, eines Bischofs
(bis 1807 Erzbischofs) und Kathedralkapitels und hat 8
Klöster, ein Diözesanseminar, ein Obergymnasium, eine
Oberrealschule, Knaben- und Mädchenschule, Lehr- und
Erziehungsanstalt der Barmherzigen Schwestern, Kinderbewahranstalt,
ein Krankenhaus, Findelhaus, Theater, Museum für
Altertümer (insbesondere die Ausgrabungen aus Salonä
enthaltend). Am Fuß des Bergs Marian (170 m, schöner
Überblick) sind zu Bädern benutzte kalte Schwefelquellen.
- In den oben erwähnten Kaiserpalast zog sich Diokletian nach
seiner Abdankung zurück. Als im 6. und 7. Jahrh. das
benachbarte Salonä (s. d.) zerstört worden war, bauten
sich dessen Einwohner innerhalb der Residenz Diokletians an, und so
entstand eine kleine Stadt, welche anfangs Palatium, dann Spalatium
(Salonae Palatium) hieß, woraus dann der Name S. entstand.
Die um die Mitte des 17. Jahrh. errichteten Festungswerke sind bis
auf das Fort Grippi unter der französischen Herrschaft
abgetragen worden. Vgl. Lanza, Dell' antico palazzo di Diocleziano
in S. (Triest 1855); Hauser, S. und die römischen Monumente
Dalmatiens (Wien 1883).
Spalding, Stadt in Lincolnshire (England), am schiffbaren
Welland, Hauptort des "Holland" genannten Distrikts der Fens (s.
d.), hat lebhaften Handel mit Wolle, Vieh und Kohlen und (1881)
9260 Einw.
Spalding, 1) Johann Joachim, protest. Theolog, geb. 1.
Nov. 1714 zu Tribsees in Schwedisch-Pommern, ward 1749 Prediger zu
Lassahn, 1757 erster Prediger zu Barth, 1764 Propst an der
Nikolaikirche in Berlin und später auch Oberkonsistorialrat,
in welcher Stellung er für religiöse Aufklärung
wirkte, bis ihn 1788 das Wöllnersche Religionsedikt (s. d.)
veranlaßte, seine Stelle niederzulegen. Er starb 26.
März 1804 in Berlin. Unter seinen Schriften sind als typisch
für seine Zeit noch heute hervorzuheben: "Gedanken über
den Wert der Gefühle in dem Christentum" (Leipz. 1761, 5.
Aufl. 1785); "Über die Nutzbarkeit des Predigtamts" (1772, 3.
Aufl. 1791). Seine Autobiographie erschien Halle 1804.
2) Georg Ludwig, Philolog, Sohn des vorigen, geb. 8. April 1762
zu Barth, vorgebildet in Berlin, studierte seit 1780 in
Göttingen und Halle, ward 1787 Professor am Grauen Kloster und
Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Berlin und starb 7.
Juni 1811 in Friedrichsfelde bei Berlin. Er schrieb: "Vindiciae
philosophorum megaricorum" (Halle 1792), gab Demosthenes' "In
Midiam" (Berl. 1794; neubearbeitet von Buttmann, das. 1823) heraus
und machte sich namentlich um Quintilian verdient ("Quintiliani
opera", Leipz. 1798-1816, 4 Bde.; Bd. 5 von Zumpt, 1829; Bd. 6:
"Lexicon" von Bonnel, 1834). Vgl. Walch, Memoria Spaldingii (Berl.
1821).
Spalier (franz. espalier, ital. spaliéra,
Baumgeländer), Latten- und Drahtwerk, woran Weinstöcke
und Obstbäume in die Breite gezogen und mit den Ästen und
Zweigen angebunden werden; wird gewöhnlich an sonnigen
Wänden angebracht. Am besten benutzt man hierzu verzinkten
Eisendraht, der durch verzinkte Eisenstützen festgehalten,
durch sogen. Drahtspanner (s. d.) angezogen, bez. (über
Winter) nachgelassen wird.
Spalierbaum, s. Obstgarten, S. 312.
Spallanzani, Lazzaro, Naturforscher, geb. 12. Jan. 1729
zu Scandiano im Herzogtum Modena, studierte zu Bologna
Naturwissenschaft, ward 1756 Professor zu Reggio, später in
Modena und Pavia, bereiste die Schweiz, den Orient und einen Teil
Deutschlands und starb 11. Febr. 1799 in Pavia. Er lieferte 1785 in
seiner Arbeit über die Zeugung den experimentellen Nachweis
der Befruchtung der Eier durch die Samenkörper, machte auch
Untersuchungen über die Reproduktion und die Fortpflanzung der
Frösche, über die Infusionstierchen, über einen
eigentümlichen Sinn der Fledermäuse, über die
Wirkung des Magensafts und den Blutkreislauf und beschrieb die
naturhistorischen Merkwürdigkeiten der von ihm bereisten
Länder. Er schrieb: "Opuscoli di fisica animale e vegetabile"
(Mod. 1780, 2 Bde): "Viaggi alle due Sicilie ed in alcune parti
degli Apennini" (Pavia 1792, 6 Bde.; deutsch, Leipz. 1795, 4 Bde.);
"Expériences pour servir à l'histoire de la
génération des animaux et des plantes" (Genf 1786).
1889 wurde ihm in Scandiano ein Denkmal errichtet.
Spalmadores (Kujun-Adassi, "Schaf-Inseln"), kleine
türk. Inselgruppe in der gleichnamigen Meerenge zwischen der
Insel Chios und der Westküste von Kleinafien (im Altertum
Önussä).
Spalmeggio (spr. -meddscho), ein Nebel, s. Bora.
Spalt, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Mittelfranken,
Bezirksamt Schwabach, an der Fränkischen Rezat u. der Linie
Georgensgmünd-S. der Bayrischen Staatsbahn, 362 m ü. M.,
hat 3 Kirchen, Bierbrauerei, starken Hopfenbau und (1885) 2060
meist kath. Einw.
Spaltbarkeit der Mineralien, die Eigenschaft, in
bestimmten Richtungen geringere Grade der Kohärenz zu besitzen
als in den übrigen dazwischenfallenden Richtungen, so
daß selbst bei unbedeutender Größe trennender
Kräfte senkrecht zu diesen Richtungen der Minima der
Kohärenz Spaltbarkeitsflächen
(Blätterdurchgänge) erzeugt werden können. Die
Flächen, welche durch die S. erzeugt werden, stehen im engsten
Zusammenhang mit den morphologischen Eigenschaften der Mineralien
und gehören ausnahmslos einer Figur an, die demselben
Kristallsystem zuzuzählen ist, in welchem die betreffende
Spezies kristallisiert. So ist der tesseral kristallisierende
Bleiglanz in drei aufeinander senkrechten Richtungen, den sechs
Würfelflächen entsprechend, spaltbar, der tesserale
Flußspat in vier (oktaedrischen) Richtungen, der hexagonale
Kalkspat nach den Flächen eines Rhomboeders und zwar derart,
daß diese durch Spaltung erhaltenen Formen, abgesehen von der
Zugehörigkeit zum gleichen System, von der äußern
Begrenzung der Individuen unabhängig ist. So erhält man
durch Zertrümmerung von Kalkspat Rhomboeder, sei der Kristall
selbst ein Rhomboeder oder ein Skalenoeder oder eine hexagonale
Säule. Diesem Zusammenhang zwischen Spaltungsform und
Kristallsystem entsprechend, können zu Blättchen teilbare
Mineralien (monotome) nicht dem tesseralen System angehören,
da in diesem eine der Monotomie entsprechende Kristallform (ein
Flächenpaar)
62
Spaltfrüchte - Spangenberg.
nicht möglich ist. Aus gleichem Grund können
quadratisch oder hexagonal kristallisierende Mineralien nur
senkrecht zur kristallographischen Hauptachse (optischen Achse)
monotom spaltbar sein, während in dem rhombischen und den
klinoedrischen Systemen Monotomie nach mehr denn einer Richtung
möglich ist. Die Leichtigkeit, charakterisierende Formen
selbst bei äußerlich mangelnder
Gesetzmäßigkeit der Begrenzung darstellen zu
können, macht die S. für die Bestimmung der
Mineralspezies sehr wertvoll.
Spaltfrüchte (Schizocarpia), s. Frucht, S. 755.
Spaltfüßer (Entomostraca), s. Krebstiere,
177.
Spalthufer, s. v. w. Wiederkäuer.
Spaltöffnungen (Stomata), s. Epidermis.
Spaltpilze, s. Pilze I., S. 68.
Spaltschnäbler (Fissirostres), nach Cuvier u. a.
Familie aus der Ordnung der Sperlingsvögel, mit kurzem,
dreieckigem, flachem, bis weit hinter die Augen gespaltenem
Schnabel. Hierher gehört die Gattung Schwalbe u. a.
Spaltung (Kirchenspaltung), s. Schisma.
Spampanaten (ital.), Aufschneidereien.
Spanböden, s. v. w. Sparterie, s. Geflechte.
Spandau (Spandow), Stadt (Stadtkreis) und Festung im
preuß. Regierungsbezirk Potsdam, am Einfluß der Spree
in die Havel und an den Linien Berlin-Buchholz und Berlin-Lehrte
der Preußischen Staatsbahn, 32 m ü. M., hat 2
evangelische und eine kath. Kirche (unter jenen die Nikolaikirche
aus dem 14. Jahrh.), ein Gymnasium, ein Amtsgericht, eine
Militärschießschule, ein Krankenhaus, 2 Hospitäler,
ein Militärlazarett, ein Zentralfestungsgefängnis,
Geschützgießerei, Pulver-, Munition- und
Gewehrfabrikation, eine Artilleriewerkstatt, ein
Feuerwerkslaboratorium (sämtlich Staatsanstalten), einen
großen Pferdemarkt und (1885) mit der Garnison (4. Gardereg.
zu Fuß, 3. Gardegrenadierreg., 2 Bat.
Gardefußartillerie und ein Trainbat. Nr. 3) 32,009 meist
evang. Einwohner. Durch zahlreiche Neubauten und die Anlage von
detachierten Forts ist S. zum Schutz von Berlin in eine Festung
ersten Ranges umgewandelt. In der Citadelle steht der Juliusturm
mit dem deutschen Reichskriegsschatz (s. d.). - S., eine der
ältesten Städte der Mittelmark, empfing schon 1232
Stadtrecht und war später mehrfach Residenz der
Kurfürsten von Brandenburg. Nachdem es schon 1319-50 mit einer
Mauer umgeben war, wurden die Festungswerke 1626-48 verstärkt
und 1842 bis 1854 zeitgemäß umgebaut. 1631-34 wurde S.
von Georg Wilhelm den Schweden eingeräumt, 25. Okt. 1806 von
Beneckendorf an die Franzosen übergeben. Am 26. April 1813
ergab es sich nach kurzer Blockade dem preußischen General v.
Thümen. Vgl. Krüger, Chronik der Stadt und Festung S.
(Spand. 1867); Kuntzemüller, Geschichte der Stadt und Festung
S. (das. 1881).
Spandrille, in der Baukunst ein Zwickel zwischen einem
Bogen und dessen rechtwinkeliger Einfassung (s. vorstehende
Abbildung).
Spange, Nadel, Schmucknadel (s. Fibel), ursprünglich
zur Befestigung des Mantels oder Gürtels dienend; dann auch im
weitern Sinn für Brosche, Armband etc. gebraucht. Über
vorhistorische Spangen s. Metallzeit.
Spangenberg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Kassel, Kreis Melsungen, an der Pfiefe und der Linie
Treysa-Leinefelde der Preußischen Staatsbahn, 264 m ü.
M., hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, eine
Oberförsterei, Zigarren- und Peitschenfabrikation, Ziegeleien
und (1885) 1676 Einw. Dabei das gleichnamige Bergschloß, das
zur kurhessischen Zeit als Staatsgefängnis benutzt wurde,
jetzt aber leer steht. S., ursprünglich einem Zweig der Herren
v. Treffurt gehörig, wurde 1347 hessisch.
Spangenberg, 1) August Gottlieb, der zweite Stifter der
Evangelischen Brüderunität, geb. 1704 zu Klettenberg in
der Grafschaft Hohenstein, ward auf der Universität Jena
gebildet und 1732 Adjunkt der theologischen Fakultät zu Halle
sowie Inspektor des dortigen Waisenhauses. Nachdem er 1743 aus
Halle auf Befehl des Königs vertrieben war, schloß er
sich der Brüdergemeinde an, machte mehrere Missionsreisen in
Europa und Amerika, wurde 1762 nach Zinzendorfs Tode dessen
Nachfolger als Bischof und starb 18. Sept. 1792 in Berthelsdorf. Er
schrieb das "Leben Zinzendorfs" (Barby 1772, 2 Bde.) und "Idea
fidei fratrum, oder kurzer Begriff der christlichen Lehre in der
Brüdergemeinde" (das. 1779). Vgl. Ledderhose, Leben
Spangenbergs (Heidelb. 1846); Knapp, Beiträge zur
Lebensgeschichte Spangenbergs (1792; hrsg. von Frick, Halle
1884).
2) Ernst Peter Johannes, gelehrter Jurist, geb. 6. Aug. 1784 zu
Göttingen, studierte daselbst die Rechte, habilitierte sich
1806, trat aber dann zur richterlichen Laufbahn über und ward
1811 Generaladvokat bei dem kaiserlichen Gerichtshof zu Hamburg,
1814 Assessor bei der Justizkanzlei in Celle, 1816 Hof- und
Kanzleirat an diesem Gerichtshof, 1824 Oberappellationsgerichtsrat
und 1831 Beisitzer des königlichen Geheimratskollegiums zu
Hannover. Er starb 18. Febr. 1833 in Celle. Während der
westfälischen Herrschaft schrieb er mehrere auf das
französische Recht bezügliche Werke, wie die
"Institutiones juris civilis Napoleonei" (Götting. 1808) und
den "Kommentar über den Code Napoléon" (das. 1810-1811,
3 Bde.). Von seinen übrigen zahlreichen Schriften nennen wir:
"Einleitung in das Römisch-Justinianeische Rechtsbuch"
(Hannov.1817); "Die Minnehöfe des Mittelalters" (Leipz. 1821);
"Beiträge zu den deutschen Rechten des Mittelalters" (Halle
1822); "Jakob Cujas" (Leipz. 1822); "Juris romani tabulae
negotiorum sollemnium" (das. 1822); "Die Lehre von dem
Urkundenbeweise" (Heidelb. 1827, 2 Abtlgn.). Von Strubes
"Rechtlichen Bedenken" besorgte S. eine neue Ausgabe (Hannov.
1827-28, 3 Bde.), wie er auch Hagemanns "Praktische
Erörterungen aus allen Teilen der Rechtsgelehrsamkeit" (Bd.
8-10, 1829-37) fortsetzte. Noch sind von ihm zu erwähnen:
"Sammlung der Verordnungen und Ausschreiben für sämtliche
Provinzen des hannoverschen Staats bis zur Zeit der Usurpation"
(Hannov. 1819-25, Tl. 1-3 und Tl. 4 in 4 Abtlgn.); "Neues
vaterländisches Archiv" (Lüneb. 1822-32, 22 Bde.);
"Kommentar zur Prozeßordnung für die Untergerichte des
Königreichs Hannover" (Hannov. 1829-1830, 2 Abtlgn.); "Das
Oberappellationsgericht in Celle" (Celle 1833).
3) Louis, Maler, geb. 1824 zu Hamburg, war anfangs Architekt und
Eisenbahntechniker und wid-
63
Spangenhelm - Spanien.
mete sich erst nach 1845 der Landschafts- und Architekturmalerei
in München bei E. Kirchner und in Brüssel. Nach
längern Studienreisen durch Frankreich, England, Italien und
Griechenland ließ er sich 1857 in Berlin nieder. Seine
Landschaften, deren Motive teils Norddeutschland, teils
Griechenland und Italien entlehnt sind, zeichnen sich durch
großartige und strenge Auffassung mit Neigung zum Stilisieren
und bei meist ernster Stimmung aus. Die hervorragendsten derselben
sind: Akrokorinth, die Akropolis von Athen, Bauernhof in Oldenburg,
der Regenstein im Harz, norddeutscher Eichenwald, Neptuntempel und
Basilika in Pästum, Theater des Herodes Atticus in Athen,
Motiv aus dem Engadin, Torfmoor in Holstein. In der technischen
Hochschule zu Charlottenburg hat er eine Reihe von
Wandgemälden mit berühmten Baudenkmälern des
Altertums ausgeführt.
4) Gustav, Maler, Bruder des vorigen, geb. 1. Febr. 1828 zu
Hamburg, hatte 1844 den ersten Zeichenunterricht bei H. Kauffmann
in Hamburg, besuchte 1845-48 die Gewerbe- und Zeichenschule in
Hanau unter Th. Plissier, lebte 1849-51 in Antwerpen, wo er die
Akademie jedoch nur kurze Zeit besuchte, und ging 1851 nach Paris,
wo er bei Couture und dem Bildhauer Triqueti arbeitete, sich aber
vorwiegend durch das Studium der Meister der deutschen Renaissance
(Dürer und Holbein) bildete. Nachdem er noch ein Jahr in
Italien zugebracht (1857-1858), ließ er sich in Berlin
nieder, wo er als Professor lebt. Von seinen frühern Bildern
sind zu nennen: das geraubte Kind, der Rattenfänger von
Hameln, St. Johannisabend in Köln, Walpurgisnacht. Seinen Ruf
begründete S. jedoch erst durch seine Historienbilder, die im
Anschluß an die altdeutschen Meister sich durch klare
Komposition, Korrektheit der Zeichnung und fleißige
Durchführung des Einzelnen auszeichnen. Luthers Hausmusik,
Luther als Junker Georg, Luther die Bibel übersetzend (1870,
Berliner Nationalgalerie), Luther und Melanchthon, Luther im Kreise
seiner Familie musizierend und Luthers Einzug in Worms sind die
Hauptbilder dieser Reihe. Den Höhepunkt seines Schaffens
erreichte er in dem tief ergreifenden Zug des Todes (1876, in der
Berliner Nationalgalerie), mit Figuren in der Tracht der
Renaissance, welcher ihm die große goldene Medaille
einbrachte. Hinter diesem Hauptwerk blieben seine spätern
Schöpfungen (am Scheideweg, das Irrlicht, die Frauen am Grab
Christi) an Tiefe der Empfindung und Gedankeninhalt zurück.
Für das Treppenhaus der Universität Halle führte er
einen Cyklus von die vier Fakultäten versinnlichenden
Wandgemälden aus, wofür er 1888 zum Ehrendoktor der
Philosophie promoviert wurde.
5) Paul, Maler, geb. 26. Juli 1843 zu Güstrow
(Mecklenburg), bildete sich an der Akademie zu Berlin, bei
Professor Stesseck daselbst und bei Stever in Düsseldorf, dann
ein Jahr lang in Paris, machte Reisen nach Spanien und Italien und
ließ sich 1876 in Berlin nieder, wo er als Porträtmaler
thätig ist und namentlich in Damenbildnissen durch geschicktes
Arrangement und glänzende koloristische Behandlung des
Stofflichen Hervorragendes leistet.
Spangenhelm, s. Helm, S. 363.
Spangrün, s. Grünspan.
Spanheim, 1) Ezechiel, namhafter Staatsmann und
Rechtsgelehrter, geb. 7. Dez. 1629 zu Genf, wo sein Vater Friedrich
S. (gest. 1648 in Leiden) Professor der Theologie war, studierte
hier und in Leiden, wurde 1651 Professor der Beredsamkeit in seiner
Vaterstadt und Mitglied des Großen Rats, später Erzieher
der Söhne des Kurfürsten von der Pfalz, mit denen er
Italien u. Sizilien bereiste. 1665 wurde er kurpfälzischer und
zugleich brandenburgischer Resident in England, trat dann ganz in
die Dienste des Kurfürsten von Brandenburg, ging 1680 als
außerordentlicher Gesandter nach Paris, wo er neun Jahre
verweilte, und ward dann zum Staatsminister ernannt. Er nahm 1697
teil an den Friedensverhandlungen zu Ryswyk und ging darauf von
neuem als Gesandter nach Paris, 1702 als außerordentlicher
Gesandter nach London, wo er 7. Nov. 1710 starb. S. besaß
eine umfassende Gelehrsamkeit im Gebiet der Staaten- und
Rechtsgeschichte und im Münzwesen des Altertums. Seine
Hauptwerke sind: die "Dissertationes de usu et praestantia
numismatum antiquorum" (beste Ausgabe, Lond. u. Amsterd. 1706-16, 2
Bde.) und die Schrift "Orbis romanus" (Lond. 1704, Halle 1728).
Wegen der sachlichen Erläuterungen sind seine Ausgaben des
Julianus (Leipz. 1696) und Kallimachos (Utr. 1697, 2 Bde.) sowie
die französische Übersetzung der "Imperatores" des
Julianus (beste Ausg., Amsterd. 1728) schätzenswert. Auch
lieferte er Kommentare zu mehreren Komödien des Aristophanes
(Amsterd. 1710). Seine wertvolle Bibliothek wurde von Friedrich I.
angekauft und der königlichen Bibliothek in Berlin
einverleibt.
2) Friedrich, Kirchenhistoriker, Bruder des vorigen, geb. 1632
zu Genf, studierte in Leiden und erhielt nach Vollendung seiner
Studien 1656 eine Professor der Theologie zu Heidelberg, 1670 zu
Leiden, wo er 1701 starb. Er hat sich als Polemiker und Forscher im
Fach der Kirchengeschichte bekannt gemacht. Seine Werke erschienen,
mit Ausnahme der in französischer Sprache geschriebenen, in 3
Bänden (Leid. 1701-1703).
Spani, Prospero, ital. Bildhauer, s. Clementi 1).
Spanien (hierzu die Karte "Spanien und Portugal", bei den
Alten auch Iberien, bei den Griechen Hesperien genannt, span.
España, franz. l'Espagne, lat. Hispania),
westeuropäisches Königreich, erstreckt sich, den bei
weitem größten Teil der Pyrenäischen Halbinsel
einnehmend, zwischen 36-43° 47' nördl. Br. und 9° 22'
westl. - 3° 20' östl. L. v. Gr.
Übersicht des Inhalts.
Seite
Grenzen, Küsten.................63
Bodengestaltung.................64
Gewässer........................65
Klima...........................65
Vegetation, Tierwelt............66
Areal und Bevölkerung...........66
Bildungsanstalten...............67
Land- und Forstwirtschaft.......68
Bergbau und Hüttenwesen.........70
Industrie.......................71
Handel und Verkehr..............72
Wohlthätigkeitsanstalten........73
Staatsverfassung................73
Verwaltung......................74
Rechtspflege....................74
Finanzen........................75
Heer und Flotte.................75
Wappen, Orden...................75
Geograph.-statist. Litteratur...76
Geschichte......................76
S. grenzt gegen N. an Frankreich (durch die Pyrenäen davon
geschieden), an die Republik Andorra und an den Viscayischen
Meerbusen, gegen W. an das Atlantische Meer und an Portugal,
während es im übrigen vom Atlantischen Ozean und vom
Mittelländischen Meer bespült wird. Der nördlichste
Punkt Spaniens ist die Estaca de Vares, der westlichste das Kap
Toriñana, beide in Galicien, der südlichste die Punta
Marroqui bei Tarifa, der östlichste das Kap de Creus. Die
größte Ausdehnung von N. nach Süden beträgt
856 und von O. nach W. 1020 km. Die Grenzentwickelung beläuft
sich auf 3340 km. Die Nordküste verläuft fast geradlinig,
bildet nur zwischen Gijon und Aviles sowie zwischen Rivadeo und La
Coruña bedeutendere Vorsprünge gegen N. und zeichnet
sich vor den übrigen Küsten des Landes durch Schroff-
63a
Karte Spanien und Portugal.
64
Spanien (Bodengestaltung).
heit und Unzugänglichkeit aus, indem hier die Gebirge fast
überall dicht ans Meer heranrücken. Zugänglich ist
sie nur an den Mündungen der Flüsse und der tief in das
Land einschneidenden Meeresarme (rias), welche namentlich an der
Küste von Galicien häufig auftreten. Auch die
Westküste Spaniens trägt im ganzen diesen Charakter; doch
ist sie viel zugänglicher als jene, weil hier die Gebirge nur
in den Kaps bis an das Meer herantreten und sich im Hintergrund der
Rias gewöhnlich Ebenen befinden. Die Süd- und
Ostküste läßt dagegen eine Anzahl weiter, flacher
Meerbusen und dazwischen befindliche, in felsige Vorgebirge endende
Landvorsprünge erkennen, ist also gegliederter als die Nord-
und Westküste und durch sichere Häfen zugänglich.
Die wichtigsten Buchten der Südküste sind von W. nach O.
die Golfe von Cadiz, Malaga und Almeria sowie die Bucht von
Cartagena, an der Ostküste die Bai von Alicante und der Golf
von Valencia.
Bodengestaltung.
Was die Bodengestaltung anlangt, so besteht die Pyrenäische
Halbinsel zum großen Teil aus einem das Zentrum derselben
einnehmenden Plateau oder Tafelland von trapezoidaler Gestalt, das
ein Areal von etwa 231,000 qkm (4200 QM.) bedeckt und ringsum von
Gebirgen umwallt ist, auch mehrere Gebirgsmassen auf seiner
Oberfläche trägt. Dieses zentrale Tafelland gehört
ganz und gar zu S. und besteht aus zwei großen Plateaus,
einem höhern nördlichen und einem etwas niedrigern
südlichen. Ersteres umfaßt die Hochebenen von Leon und
Altkastilien, letzteres die von Neukastilien, Estremadura und die
nördliche Hälfte von Murcia. Beide Plateaus sind durch
einen hohen, von ONO. nach WSW. sich erstreckenden Gebirgszug
(Kastilisches Scheidegebirge) größtenteils voneinander
geschieden. Nach O. ansteigend, senken sie sich nach W., so
daß die Hauptflüsse westlichen Lauf haben, im
nördlichen Plateau der Duero, im südlichen der Tajo und
Guadiana, zwischen welchen beiden Flüssen sich in der
westlichen Hälfte des Plateaus das ziemlich bedeutende
Gebirgssystem von Estremadura erhebt. Die Hochebene von
Altkastilien und Leon hat eine mittlere Höhe von 810, die von
Neukastilien und Estremadura von 784 m. Die vier Abhänge des
zentralen Tafellandes zeigen sehr verschiedene Gestaltung. Der
steil ins Meer abstürzende Nordabhang wird vom Kantabrischen
Gebirge, der westlichen Fortsetzung der Pyrenäen, gebildet und
ist sehr schmal. Weit breiter ist der östliche oder iberische
Abhang, der in mehreren terrassenartigen Absätzen in die
Tiefebene von Aragonien und zum Golf von Valencia abfällt und
bloß stellenweise isolierte Gebirgsmassen aufweist. Eine
ähnliche, wenn auch weniger deutlich ausgeprägte
Terrassenbildung zeigt der südliche oder bätische Abhang,
welcher bloß gegen O. (in den Provinzen Murcia und Alicante)
bis an die Küste des Mittelmeers herantritt, im übrigen
in die Tiefebene Niederandalusiens und zu den Küsten des
Atlantischen Meers absinkt. Derselbe wird ganz von den welligen
Bergen der Sierra Morena eingenommen, welche sich über die
Hochebenen Neukastiliens und Estremaduras nur als niedrige
Gebirgskette erhebt. Der westliche oder lusitanische Abhang, der
breiteste und eigentümlichste, gehört
größtenteils Portugal an. Im ganzen lassen sich sechs
voneinander fast unabhängige Gebirgssysteme unterscheiden,
nämlich: das pyrenäische System, das iberische System
oder das östliche Randgebirge des Tafellandes, das zentrale
System oder das Kastilische Scheidegebirge, das Gebirgssystem von
Estremadura oder das Scheidegebirge zwischen Tajo und Guadiana, das
marianische System oder das südliche Randgebirge des
Tafellandes und das bätische System oder die Bergterrasse von
Granada (mit der Sierra Nevada, der höchsten Erhebung der
Halbinsel). Die eingehendere Beschreibung dieser Gebirgssysteme
findet sich in den Artikeln Pyrenäen, Kantabrisches Gebirge,
Iberisches Gebirge, Sierra Morena, Sierra Nevada etc. Zwischen dem
iberischen und pyrenäischen Gebirgssystem breitet sich das
ausgedehnte Ebrobassin oder das iberische Tiefland aus. Dasselbe
erstreckt sich von NW. nach SO. und mißt gegen 300 km in der
Länge und gegen 150 km in der Breite. Es zerfällt in eine
nordwestliche kleinere und eine südöstliche
größere Abteilung, welche, durch Höhenzüge
voneinander getrennt, bei Tudela ineinander übergehen.
Während das obere Bassin ein eigentliches Plateau bildet,
dessen tiefste Punkte noch eine absolute Höhe von mehr als 300
m haben, trägt das untere Ebrobassin, wenigstens in seiner
letzten Hälfte, wo es sich bedeutend erweitert, mehr den
Charakter eines Tieflandes, dessen tiefste Punkte, z. B. die
Salzseen von Bajaraloz, ungefähr 100 m ü. M. liegen.
Beide Bassins enthalten neben höchst fruchtbaren Strecken auch
weite öde Steppengebiete. Zwischen dem bätischen und
marianischen Gebirgssystem breitet sich das bätische Tiefland
oder das Bassin des Guadalquivir aus, welches sich von ONO. nach
WSW. erstreckt, 330 km lang und bis 90 km breit ist und ebenfalls
in zwei Hauptabteilungen zerfällt: das kleine Becken des obern
Guadalquivir und das fünfmal so große Bassin des
mittlern und untern Guadalquivir. Während jenes ein
entschiedenes Plateau ist, das sich bis 475 m ü. M. erhebt und
nicht tiefer als bis 160 m herabsinkt, bildet das letztere oder
Niederandalusien ein Flachland, welches durch den Jenil in zwei
ungleiche Stücke geteilt wird. Das östliche kleinere
Stück, die Campiña de Cordova bildet eine hügelige
Fläche mit bis über 130 m ansteigenden Punkten; das
restliche größere, die Ebene von Sevilla, ein
eigentliches Tiefland, dessen Boden sich nirgends über 80 m
ü. M. erhebt. Das Bassin des Ebro und das des Guadalquivir
sind alte Meeresgolfe und daher mit brackischen
mitteltertiären Ablagerungen erfüllt. Durch jenes werden
die Pyrenäen (s. d.) mit ihrem Terrassenabfall nach Katalonien
und Aragonien, durch dieses die Gebirge von Granada mit der Sierra
Nevada in der Art vom Hauptkörper des spanischen Hochlandes
getrennt, daß dieselben nur an ihren Enden mit ihm durch
Berg- und Plateaulandschaften in Verbindung stehen.
Was die geognostische Beschaffenheit des Landes betrifft, so
spielen die plutonischen Eruptivgesteine und die ältern oder
primären Sedimentärgesteine eine hervorragende Rolle,
namentlich in der südwestlichen Hälfte der Halbinsel, wo
Granit, Gneis und andre kristallinische Gesteine, Thonschiefer und
Grauwacke fast ausschließlich vorherrschen, während in
der nordöstlichen Hälfte die jüngern Sedimente
vorwiegend sind. Nur in der Pyrenäenkette und längs der
Küste von Katalonien (zwischen dem Golf von Rosas und
Barcelona) treten Gneis und kristallinische Sedimentärgesteine
wieder in bedeutender Mächtigkeit auf. Unter den
sekundären Sedimenten erscheinen die Glieder der Kreide-, der
jurassischen und der Triasperiode am meisten verbreitet. Die
Kreideformation umfaßt namentlich den größten Teil
der Kantabrischen Kette, der Pyrenäischen Terrasse und den
Nordrand des nördlichen Tafellandes und tritt
Spanien (Gewässer, Klima).
65
außerdem am Ost- und Südrand des Plateaus von
Altkastilien und im westlichen Teil des zentralen Gebirgssystems
sowie im nordwestlichen Randgebirge der Terrasse von Granada auf.
Die ältern Sekundärformationen, wie die Gesteine der
Steinkohlenformation, treten nur in geringem Umfang und zerstreut
auf. Gleichwohl besitzt S. so gewaltige Steinkohlenbecken,
daß, wenn dieselben gehörig aufgeschlossen wären,
das Land nicht nur keiner fremden Kohlen mehr bedürfte,
sondern sogar bedeutende Mengen ausführen könnte. Am
meisten ist die Steinkohlenformation in Asturien, Leon und
Altkastilien entwickelt. Eine ungeheure Verbreitung haben dann
wieder die tertiären und diluvialen Ablagerungen, die nicht
nur den bei weitem größten Teil der beiden
Zentralplateaus, sondern auch die Becken des Ebro, des
Guadalquivir, des mittlern Guadiana und des untern Tajo
erfüllen. Diese Ablagerungen enthalten sehr viel Salz.
Vulkane, aber schon seit vorgeschichtlicher Zeit erloschen, finden
sich vereinzelt, z. B. bei Rio Tinto, Ciudad Real in der Mancha,
Gerona etc. Sehr verbreitet, besonders in der südwestlichen
Hälfte (z. B. Estremadura), sind Eruptionen der
verschiedenartigsten Porphyre und Grünsteine, daher auch das
häufige Vorkommen metamorphosierter Gesteine, im SW.
namentlich metamorphischer Schiefer. Über den Reichtum
Spaniens an Erzen und Mineralien s. den Abschnitt "Bergbau und
Hüttenwesen" (S. 70).
Gewässer.
In hydrographischer Hinsicht zerfällt das Land in das
Gebiet des Atlantischen Ozeans und das des Mittelmeers, welch
letzterm sein östliches Dritteil angehört. Die
Wasserscheide zwischen beiden Gebieten beginnt auf den Parameras
von Reinosa am Südrand der Kantabrischen Kette, wo die
Quellbäche des Ebro und des in den Duero sich
ergießenden Pisuerga nicht 10 km weit voneinander entfernt
auf einer vollkommen ebenen Fläche entspringen, und endigt an
der Meerenge von Gibraltar, indem sie über den Kamm des
iberischen Gebirgszugs (Sierra de la Demanda, Pico de Urbion,
Sierra del Moncayo, die Parameras von Molina) bis zur Sierra de
Albarracin läuft, dann das Plateau von Neukastilien schneidet
und über die Sierra de Alcaraz und das Gebirge von Segura auf
die Plateaus der Terrasse von Granada übergeht, deren
östliches Randgebirge ihr letztes Stück bildet. Der
westlichen Abdachung zum Atlantischen Ozean gehören an: der
Duero, Tajo, Guadiana und Guadalquivir, der östlichen zum
Mittelmeer der Ebro. Unter den zahlreichen Küstenflüssen
zeichnen sich die der Nordküste dadurch aus, daß sie
trotz ihrer unbedeutenden Länge in ihrem untersten Lauf
schiffbar sind. Die beträchtlichsten sind von O. nach W.:
Bidassoa, Orio, Deva, Nervion, Besaya, Nalon, Navia, Rivadeo,
Landrone, Mandeo und Allones. Die Flüsse der Westküste
sind zwar länger, doch meist gar nicht schiffbar; die
bedeutenden sind: der Tambre, Ulla und besonders der Minho
(Miño). Die Südküste hat zwar viele Flüsse,
doch nur einen einzigen im untersten Lauf schiffbaren, nämlich
den Guadalete; außerdem verdienen noch der Odiel und Rio
Tinto Erwähnung sowie zwischen der Meerenge von Gibraltar und
dem Kap Palos: der Guadiaro, Guadalhorce, Rio de Almeria,
Almanzora. Auch die lange Ostküste hat nur zwei schiffbare
Küftenflüsse aufzuweisen, den Segura und Llobregat.
Nächstdem sind zu nennen: der Jucar, Turia oder Guadalaviar,
Millares (Mijares), Tordera, Ter und Fluvia. Größere
Seen gibt es nur an der Süd- und Südostküste,
nämlich die Strandseen Albusera und Mar Menor und die Laguna
de la Janda in der Nähe der Meerenge von Gibraltar. Kleinere
Seen sind: die wegen ihrer mephitischen Ausdünstung
berüchtigte Laguna de la Nava bei Palencia, die salzhaltige
Laguna de Zoñar in der bätischen Steppe und die
gleichfalls salzige Laguna de Gallocanta im Süden von Daroca
am Ostabhang des Tafellandes. Sehr zahlreich sind die
Mineralquellen; von 1500, die S. besitzt, sind aber erst etwa 325
untersucht. Die kälteste ist die Schwefelsaline zu Loeches in
Neukastilien (15° C.), die heißeste die Fuente de Leon zu
Mombuy in Katalonien (70° C.).
Klima.
Die eigentümliche Plastik des Landes hat eine große
Verschiedenheit des Klimas zur Folge. Es lassen sich drei
klimatische Zonen unterscheiden: eine mitteleuropäische oder
kältere gemäßigte Zone, zu welcher der
größte Teil der Nordküste, die nördlichen
Gegenden der Hochebene von Leon und Kastilien und das Plateau von
Alava gehören; eine afrikanische oder subtropische, welche
Andalusien bis zur Sierra Morena, Granada, die
südöstliche Hälfte von Murcia und den
südlichsten Teil von Valencia begreift, und eine
südeuropäische oder wärmere gemäßigte
Zone, welche alles übrige Land umfaßt. In der
mitteleuropäischen Zone haben die Litoral- und tiefer
gelegenen Gegenden ein sehr angenehmes Klima, indem die Temperatur
selbst im heißesten Sommer nicht leicht über +33° C.
steigt, an den kältesten Wintertagen kaum unter -3° sinkt
und Frost und Schneefall nur vorübergehend auftreten. Die
Atmosphäre ist meist feucht, Regen besonders im Herbst und
Frühling häufig. Die Thäler der Nordküste
gehören zu den gesündesten Gegenden Europas. Ein ganz
andres Klima herrscht auf den Hochflächen des altkastilischen
Tafellandes; hier sind heftiger Frost und starker Schneefall schon
im Spätherbst keine Seltenheit, und während des Winters
ist durch Schneemassen oft wochenlang alle Kommunikation
unterbrochen. Im Frühling bedecken kalte Nebel oft tagelang
das Land, und im Sommer herrscht glühende Hitze, die selten
durch Regen gemäßigt wird. Dabei sind in jeder
Jahreszeit Stürme häufig. Erst die von Regengüssen
begleiteten Äquinoktialstürme bringen dem Plateauland
angenehme Witterung. Von Ende September bis November ist der Himmel
fast stets unbewölkt, und die Fluren bedecken sich mit
frischem Grün; doch oft schon im Oktober machen
Frühfröste diesem zweiten Frühling ein Ende. Einen
Gegensatz zu diesem der Gesundheit sehr nachteiligen Klima bieten
die innerhalb der südeuropäischen Zone gelegenen
Küstenstriche dar, namentlich die Flußthäler
Südgaliciens, wo ein gleichmäßiges, mildes
Küstenklima herrscht, indem die mittlere Temperatur des
Sommers ungefähr +20°, die des Winters +16°
beträgt und Frost und Schnee selten, Regen und Tau häufig
sind. Die Ebenen und Thäler der Südost- und Ostküste
haben im allgemeinen ein dem des südlichen Frankreich
entsprechendes, nur wärmeres Küstenklima, doch nicht ohne
bedeutende und häufige Temperaturschwankungen. Die
afrikanische Zone der Halbinsel ist dadurch ausgezeichnet,
daß in ihren Tiefebenen, Küstengegenden und tiefen
Thälern Schnee und Frost fast unbekannte Erscheinungen sind,
indem die Temperatur höchst selten bis 3° sinkt. Die
heißesten Gegenden sind die Südostküste bis
Alicante sowie die angrenzenden Ebenen, Hügelgelände und
Plateaus von Murcia und Ostgranada. Weit gemäßigter sind
die Küstengegenden Niederandalusiens. Der glühend
heiße, alle Vegetation versengende Solano (Samum) sucht
am
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl., XV. Bd.
5
66
Spanien (Pflanzen- und Tierwelt, Areal und
Bevölkerung).
häufigsten die südöstlichen Küstenstriche
heim. Im übrigen ist das Klima in den niedern Gegenden der
afrikanischen Zone ein angenehmes Küstenklima mit einer
mittlern Temperatur, die nicht leicht über +24,5° steigt
oder unter +12° C. fällt. Der eigentliche Frühling
beginnt hier Ende Februar und dauert an der Küste bis Mitte
Mai, im Innern bis Anfang Juni. Während des Sommers
vertrocknet auch hier die Vegetation, wie auch die
Äquinoktialregen einen zweiten Frühling hervorzaubern,
welcher aber nicht schnell verfließt, wie im Plateauland,
sondern durch den minder blütenreichen Winter, fast die
angenehmste Jahreszeit jener Gegenden, in den eigentlichen
Frühling übergeht. Die Ebenen und Küstengegenden der
afrikanischen Zone haben folglich acht Monate Frühling und
vier Monate Sommer. Was die eigentlichen Gebirgsgegenden anlangt,
so lassen sich hier fünf Regionen unterscheiden: die untere
oder warme (bis 800 m) mit 27-17° mittlerer Temperatur, die
Bergregion (800-1600 m) mit 16-9°, die subalpine Regton
(1600-2000 m) mit etwa 8-4°, die alpine Region (2000-2500 m)
mit 3°-0, die Schneeregion (2500-3500 m) mit einer mittlern
Jahrestemperatur von wahrscheinlich unter 0. In den Pyrenäen
findet sich ewiger Schnee nur in der Zentral- und östlichen
Kette, wo die Grenze desselben auf der spanischen Seite bei 2780 m
liegt. In der Sierra Nevada, dem höchsten Gebirge Spaniens,
nimmt man die Schneelinie am Nordabhang bei 3350, am Südabhang
bei 3500 m an, weshalb hier bloß die höchsten Gipfel,
und auch diese sparsam, mit ewigem Schnee bedeckt sind.
Pflanzen- und Tierwelt.
Die Verschiedenheit des Klimas und der Bodengestaltung hat eine
große Mannigfaltigkeit der Flora und Fauna zur Folge.
Hinsichtlich des Charakters der Vegetation zerfällt S. in
folgende fünf Vegetationsregionen: 1) die nördliche oder
mitteleuropäische mit mitteleuropäischer Flora (Eichen,
Buchen, edle Kastanien, Erlen, Ulmen, Obst- und
Walnußbäume, Getreide- und Gemüsebau; Weinbau nur
in günstigen Lagen); 2) die peninsulare oder zentrale (Alpen-
und Pyrenäenpflanzen, Heiden mit Cistineen, Thymian und andern
Labiaten, Ginster, Centaureen, Disteln, Artemisien, hier und da
ausgedehnte Nadelwälder sowie Bestände von
immergrünen Eichen und Kastanien); 3) die westliche oder
atlantische, im N. mit vorwiegend mitteleuropäischer, im S.
mit bereits an Afrika erinnernder Vegetation (Ölbaum,
Orangen-, Feigen- und Mandelbaum, Weinbau, Lorbeer, Cypresse,
Agave, indische Feige, Dattel- und Zwergpalme, Johannisbrotbaum,
Cistusheiden mit Myrten, Pistazien und andern immergrünen
Sträuchern; in der Bergregion Eichen, Kastanien, Wacholder,
Obstbau, Alpentristen); 4) die östliche oder mediterrane
(Labiatenheiden und öde Steppen, Gehölze von
immergrünen Eichen und von Kiefern, Ölbaum, Wein-und
Weizenbau, Maulbeer-, Feigen- und Mandelbaum, Pfirsisch- und
Aprikosenbaum, Walnußbaum, Mais, Hanf, Flachs; im Süden
Orangen-, Johannisbrotbaum, Dattel- und Zwergpalme, Artischocken-
und Melonenbau, in den sumpfigen Niederungen Reis); 5) die
südliche oder afrikanische Region bis zur Höhe von ca.
630 m, charakterisiert durch das Vorherrschen solcher Pflanzen,
welche Nordafrika, Sizilien, Ägypten, Syrien, Kleinasien etc.
eigentümlich sind, und durch die Kultur subtropischer und
tropischer Gewächse (Zuckerrohr, Baumwolle, Batate,
Kochenillekaktus etc.). Nicht minder mannigfaltig und ausgezeichnet
ist die Tierwelt, die außer Arten der unter entsprechender
Breite gelegenen Länder Europas und außer einer Menge
der Halbinsel eigentümlicher zahlreiche Vertreter der Fauna
Afrikas, ja selbst des Orients und Innerasiens aufweist. Die
europäische Zone, im allgemeinen der mitteleuropäischen
Vegetationsregion entsprechend, wird charakterisiert durch
mitteleuropäische Tiere (darunter der Wolf,
Siebenschläfer, Schneehase, die Gemse, Wildkatze, der
Pyrenäensteinbock, der Bartgeier, Aasgeier etc.). Die mittlere
oder südeuropäische Zone, die zentrale westliche und
östliche Vegetationsregion umfassend, weist ein buntes Gemisch
europäischer und afrikanischer Tierformen (Pantherluchs,
Genettkatze, Ichneumon, südliche Geier-, Adler- und
Falkenarten, Schrei- und Klettervögel etc., zahlreiche
Schmetterlinge, Skorpione etc.) auf. Die südliche oder
afrikanische Zone zeigt viele echt afrikanische Tierformen
(darunter der nordafrikanische Affe am Gibraltarfelsen, das
Dromedar, afrikanische Vögel, Chamäleon etc.) neben
andern nur im südlichsten Europa vorkommenden oder auch S.
eigentümlichen (spanischer Steinbock auf der Sierra Nevada,
spanischer Hase, Flamingo etc.).
Bevölkerungsverhältnisse.
Das Areal von S. und zwar des europäischen Mutterlandes mit
Einschluß der Balearen und der Kanarischen Inseln sowie der
nordafrikanischen Besitzungen beträgt 504,552 qkm (9163,6
QM.). Die Bevölkerung bezifferte sich nach dem letzten Zensus
vom 31. Dez. 1877 auf 16,634,345 Einw., deren Verteilung auf die
einzelnen Provinzen aus nebenstehender Tabelle ersichtlich ist.
Die Vermehrung der spanischen Bevölkerung ist eine sehr
schwache; sie belief sich gegenüber der im J. 1857
vorgenommenen ersten ordentlichen Volkszählung, welche
15,464,340 Einw. ergab, 1877 nur auf 1,170,005 Seelen oder pro Jahr
kaum auf 0,4 Proz. Der Grund liegt, abgesehen von den vielfachen
Kriegen, welche S. im Innern und in den Kolonien zu bestehen hatte,
in einer beträchtlichen Auswanderung, insbesondere nach
Südamerika und nach Algerien (Provinz Oran). Für Ende
1886 wurde die Bevölkerung mit 17,358,404 Einw. berechnet.
Bemerkenswert in der Verteilung der Bevölkerung ist, daß
die Dichtigkeit derselben vom Zentrum gegen die Peripherie hin
zunimmt. Die schwächste relative Bevölkerung weisen die
Provinzen Ciudad Real und Cuenca auf (13 und 14 Einw. auf das
QKilometer), am dichtesten bevölkert (über 100 Einw. auf
das QKilometer) sind Barcelona und Pontevedra. Nach dem Geschlecht
entfallen auf je 1000 männliche Personen 1044 weibliche. Nach
dem Geburtsland waren von der (1877) anwesenden Bevölkerung
geboren: in S. 16,591,796, in Frankreich 17,657, in Portugal 7941,
in Großbritannien 4771, in Italien 3497, in Deutschland
952.
Die spanische Nation ist ein Gemisch verschiedener
Völkerschaften. Zu den alten Iberern gesellten sich anfangs
Kelten, dann Phöniker und Karthager, hierauf Römer, dann
Goten; später mischten sich Juden, Berber und Araber (diese
insbesondere in Andalusien, Murcia und Valencia), endlich auch
Neger (aus Marokko und weiterher) bei. Die herrschende Sprache ist
die kastilische; daneben wird das Katalonische (ein dem
Provençalischen verwandtes Idiom) in Katalonien, Valencia
und den Balearen, das Baskische (in den baskischen Provinzen und in
Navarra) und das Galicische (welches sich dem Portugiesischen sehr
nähert) gesprochen. Die spanische Sprache ist übrigens
als Weltsprache in Mittel- und Südamerika stark verbreitet und
gewinnt dadurch immer wachsende Bedeutung.
67
Spanien (Volkscharakter, geistige Kultur).
Areal Spaniens.
Einwohner
Provinzen QKilometer QMeilen Ende 1877 Ende 1886 auf 1 qkm
Alava . . 3045 55,3 93538 99034 33
Albacete. . 14863 269,9 219058 221894 15
Alicante . . 5660 102,8 411565 423808 75
Almeria . . 8704 158,1 349076 358486 41
Avila . . 7882 143,2 180436 193565 25
Badajoz. . 21894 397,6 432809 469952 21
Barcelona . 7691 139,7 836887 861212 112
Burgos . . 14196 257,8 332625 351293 25
Caceres . . 19863 360,8 306594 329707 17
Cadiz¹ . . 7342 133,3 429206 433516 59
Castellon . 6465 117,4 283981 298965 46
Ciudad Real 19608 356,1 260358 285341 15
Cordova . . 13727 249,3 385482 406059 30
Coruña . . 7903 143,5 596436 623575 79
Cuenca . . 17193 312,3 236253 245112 14
Gerona . . 5865 106,5 299702 309992 53
Granada . 12768 231,9 479066 480594 38
Guadalajara 12113 220,0 201288 207030 17
Guipuzcoa . 1885 34,2 167207 181673 97
Huelva . . 10138 184,1 210447 227116 22
Huesca . . 15149 275,1 252239 263634 17
Jaen. . . 13480 244,8 423025 436184 32
Leon ... 15377 279,3 350210 378098 25
Lerida . . 12151 220,7 285339 290856 24
Logroño . . 5041 91,6 174425 179897 36
Lugo ... 9881 179,5 410810 429430 43
Madrid . . 7989 145,1 594194 590065 74
Malaga. . 7349 133,5 500322 522376 71
Murcia . . 11537 209,5 451611 462039 40
Navarra. . 10506 190,8 304184 321015 30
Orense . . 6979 126,8 388835 399552 57
Oviedo . . 10895 197,9 576352 596856 55
Palencia . 8434 153,2 180771 190724 23
Pontevedra. 4391 79,8 451946 467289 106
Salamanca 12510 227,2 285695 311428 25
Santander . 5460 99,2 235299 248753 46
Saragossa . 17424 316,5 400587 401386 23
Segovia . . 6827 124,o 150052 160111 23
Sevilla . . 14062 255,4 506812 526864 37
Soria . . 10318 187,2 153652 162555 16
Tarragona . 6490 117,9 330105 345601 53
Teruel . . 14818 269,1 242165 250823 17
Toledo . . 15257 277,1 335038 357886 23
Valencia . 10751 195,3 679046 692245 64
Valladolid . 7569 137,5 247458 261254 35
Viscaya . . 2165 39,3 189954 204043 94
Zamora . . 10615 192,8 249720 274312 26
Zusammen : 492230 8939,9 16061860 16733200 34
Balearen . 5014 91,o 289035 311652 62
Kanarische Inseln 7273 132,1 280974 311030 43
Spanien: 504517 9163,o 6631869 17355882 34
In Nordafrika² 35 0,6 [ 2476 2522 72
Totalsumme: 504552 9163,6 16634345 17358404 34
1 Mit Ceuta. - 2 Ohne Ceuta, welches zu Cadiz gehört.
Die Kolonien oder überseeischen Besitzungen (s. Karte
"Kolonien" mit Tabelle), nur noch ein geringer Überrest von
den unermeßlichen Gebieten, welche S. einst beherrschte,
umfassen zur Zeit
in Amerika: QKilom. QMeilen Einw.
Cuba. ........ 118833 2158,13 1521684
Puerto Rico ...... 9315 169,17 754313
in Asien:
Philippinen ...... 293726 5334,37 5559020
Sulu-Inseln . ..... 2456 44,60 75000
in Ozeanien :
Marianen ....... 1140 20,72 8665
Karolinen ....... 700 12,71 22000
Palau ... 750 13,62 14000
in Afrika (Guinea):
Fernando Po, San Juan etc. 2200 39,95 68656
Zusammen: 429120 7793,27 8023383
Die Spanier sind im allgemeinen ein körperlich
wohlgebildetes Volk, meist mittlerer Statur, hager, mit schwarzem
Haar. Die Frauen zeichnen sich durch feurige Augen und anmutiges
Wesen aus, entwickeln sich sehr frühzeitig, altern aber auch
bald. Der Spanier ist nüchtern, mäßig, mutig, voll
Nationalstolz, aber auch rachgierig, bigott und träge.
Nationalkleid der Männer ist der rund geschnittene, den ganzen
Körper umhüllende spanische Mantel (capa), das der Frauen
die Mantilla, welche mit einem Kamm am Kopf befestigt und über
der Brust gekreuzt wird. Die vorherrschende Farbe der Kleidung ist
die schwarze. Im übrigen wechselt die Tracht in den einzelnen
Provinzen bedeutend. Die höhern Stände haben
gegenwärtig meist die französische Mode angenommen.
Hauptvergnügen sind der Tanz, der mit Gesang oder
Kastagnetten, Tamburin und Guitarre begleitet wird, und die
Stiergefechte. Was die Konfession betrifft, so waren 16,603,959
Katholiken, 6654 Protestanten, 4021 Israeliten, 9645 Rationalisten,
271 Mohammedaner, 209 Buddhisten etc. Nach der Staatsverfassung
gilt die römisch-katholische Religion als Staatskirche; doch
darf niemand wegen seiner Konfession und wegen der Ausübung
seines Kultus, sofern die christliche Moral nicht darunter leidet,
behelligt werden. Für die Leitung der geistlichen
Angelegenheiten der katholischen Kirche gibt es in S. 9
Erzbischöfe (zu Toledo, Primas von S., Burgos, Granada,
Santiago, Saragossa, Sevilla, Tarragona, Valencia und Valladolid)
und 45 Suffraganbischöfe. Bischöfliche Jurisdiktion
übt auch der Patriarch von Indien aus, indem derselbe
Generalvikar des Heers und der Flotte ist. Der unterstehende Klerus
beziffert sich mit ca. 40,000 Weltgeistlichen, 800 Mönchen und
13,000 Nonnen. Eigentliche Mönchsklöster bestehen nicht
mehr, da dieselben bereits 1841 gesetzlich aufgehoben wurden. Es
sind nur 41 Häuser solcher religiöser Orden geblieben,
welche sich der Heranbildung von Missionären, dem
Jugendunterricht oder der Krankenpflege widmen. Protestantische
Gemeinden gibt es 60.
Bildungsanstalten.
In Bezug auf die geistige Kultur steht das spanische Volk trotz
seiner Begabung wegen des mangelhaften Volksunterrichts noch auf
einer tiefen Stufe, was darin seine Erklärung findet,
daß bis 1808 das öffentliche Unterrichtswesen ganz in
den Händen des Klerus war. Für den Elementarunterricht
bestehen (1881) 29,828 Volksschulen. Der Schulbesuch ist
obligatorisch. Während 1797 nur 393,126 Kinder die Volksschule
besuchten, stieg diese Zahl allmählich, namentlich infolge der
gesetzlichen Reformen der Jahre 1838, 1847 und 1857, auf 663,711 im
J. 1848, auf 1,046,558 im J. 1861 und auf 1,769,608 im J. 1881.
Normalschulen bestehen zur Heranbildung von Lehrern 47, für
Lehrerinnen 29. Zu den Sekundärschulen gehören die seit
1845 anstatt der frühern Lateinschulen bestehenden Institute
(institutos de segunda enseñanza), in welchen in einem
sechsjährigen Kursus die humanistischen und Realstudien
betrieben werden. Solcher Institute gibt es 61 mit ca. 35,000
Schülern. Neben ihnen bestehen die Colegios,
Privatvorbereitungsschulen zu den Universitäts- und
Spezialstudien. Universitäten hat S. 10: zu Madrid, Barcelona,
Granada (jede mit 5 Fakultäten, für Philosophie und
Litteratur, exakte Wissenschaften, Pharmazie, Medizin, Rechte), zu
Salamanca, Sevilla, Valencia (jede mit 4 Fakultäten, die
obigen ohne Pharmazie), Santiago und Saragossa (je 3
Fakultäten, erstere für Medizin, Pharmazie und Rechte,
letztere für Philosophie, Medizin und Rechte), Valladolid (2
Fakul-
68
Spanien (Landwirtschaft).
täten, für Medizin und Rechte), Oviedo (eine Fakultut,
für Rechte). Alle Universitäten zählen zusammen 475
Professoren und Dozenten und gegen 16,000 Studierende. Mit 7
Universitäten ist je eine Notariatsschule verbunden.
Höhere technische Lehranstalten sind: eine Architekturschule,
eine Schule für Handel und Industrie und eine Ingenieurschule
für Wege-, Kanal- und Hafenbau in Madrid; ferner eine Schule
für industrielle Technik in Barcelona. Zu den Fachschulen
gehören: die theologischen Seminare in den Bischofsitzen, die
königliche Schule für Diplomatik in Madrid, die neun
nautischen Schulen, die königliche Agrikulturschule in Madrid,
die königliche Forstingenieurschule im Escorial, die
landwirtschaftliche Schule in Cordova, die Lehranstalten für
Tierheilkunde in Madrid, Cordova, Leon und Saragossa, die
königliche Bergwerksingenieurschule in Madrid, die
Steigerschule in Almaden, die königliche Schule der
schönen Künste, die Nationalschule für Musik und
Deklamation (beide in Madrid), die Provinzialschulen für
schöne Künste in Barcelona, Sevilla, Valencia und
Valladolid, die Akademien für den Generalstab in Madrid,
für die Artillerie zu Segovia, für das Ingenieurkorps in
Guadalajara, für die Kavallerie in Valladolid, die allgemeine
Militärakademie in Toledo, die Seeschule in Ferrol. Zu den
Beförderungsmitteln der intellektuellen Bildung gehören
außerdem acht Akademien (davon sieben zu Madrid) und die
öffentlichen Bibliotheken, von denen die Nationalbibliothek zu
Madrid und die des Escorial die hervorragendsten sind. Die
bedeutendsten historischen und Kunstsammlungen sind: die
königliche Rüstkammer, das königliche Münz- und
Antiquitätenkabinett, das königliche Museum für
Gemälde und Skulpturen, das Nationalmuseum für
Gemälde und das naturhistorische Museum, sämtlich zu
Madrid. Botanische Gärten sind zu Madrid und Valencia, ein
astronomisch-meteorologisches Observatorium besitzt Madrid.
Land- und Forstwirtschaft etc.
Unter den Nahrungszweigen der Bevölkerung von S. nimmt der
Betrieb der Landwirtschaft die erste Stelle ein. Dabei steht aber
die Bodenbehandlung noch auf einer sehr unbefriedigenden Stufe. Die
Düngung ist eine ganz primitive, und auch in Bezug auf
landwirtschaftliche Geräte und Betriebsart haben die
Erfahrungen und Verbesserungen der Neuzeit fast gar keinen Eingang
gefunden. Zu Anfang des 19. Jahrh. war noch ein sehr großer
Teil vom Grund und Boden im Besitz der Toten Hand, d. h. des
Klerus, der Gemeinden, der milden Stiftungen und des Staats. Der
Verkauf der Kirchengüter wurde bereits 1820 und 1841
angeordnet sowie durch das Gesetz vom 1. Mai 1855 bestätigt,
welches überhaupt allen Grundbesitz und alle Grundzinsen der
Toten Hand der Veräußerlichkeit unterwirft. Die Bauern
sind persönlich frei und teils Eigentümer ihrer in der
Regel kleinen Grundstücke, teils Erbpachter. Der produktive
Boden umfaßt im ganzen 79,6 Proz. der Gesamtfläche, und
zwar kommen 33,8 Proz. auf Äcker und Gärten, 3.7 auf
Weinland, 1,6 auf Olivenpflanzungen, 19,7 auf natürliche
Wiesen und Weiden und 20,8 Proz. auf Wald. Der Boden bedarf in S.
zur Ertragsfähigkeit in der Regel künstlicher
Bewässerung, zu welchem Behuf großartige Anlagen teils
durch die Regierung, teils durch Vereine, teils durch große
Grundbesitzer und Kommunen hergestellt worden sind; gleichwohl
machen die bewässerten Ländereien nur einen kleinen Teil
der produktiven Bodenfläche aus. Am besten angebaut ist der
Boden in den Provinzen Palencia, Pontevedra, Coruña,
Valladolid und Barcelona, am wenigsten in den Provinzen Oviedo,
Huelva, Almeria und Santander. Die spanischen Staatsökonomen
unterscheiden in S. sieben Kulturregionen, nämlich die Region
des Zuckerrohrs, der Orangen, des Ölbaums, des Weinstocks, der
Cerealien, der Wiesen und Triften, der Heiden. Der Getreidebau ist
zwar fast überall ein wichtiger Zweig der Landwirtschaft, am
bedeutendsten aber auf den Ebenen beider Kastilien, in Leon und im
Guadalquivirbecken. Die jährliche Getreideproduktion
beläuft sich bei einer guten Mittelernte auf nachfolgende
Mengen:
Weizen ..... 61142000 hl
Hafer ...... 4481000 hl
Roggen ..... 11629000 hl
Mais ....... 13173000 hl
Gerste ..... 27792000 hl
Reis ....... 1212000 hl
Am meisten wird Weizen gebaut, Roggen und Gerste besonders in
den nördlichen, Mais in den südlichen Provinzen. In
letztern kommen an verschiedenen Orten, aber vereinzelt, Reisfelder
vor, während sie in der Provinz Valencia eine
Hauptnahrungsquelle bilden. Einen Exportartikel bildet Weizenmehl,
insbesondere für die Provinz Valladolid. Der Anbau von
Kartoffeln ist minder bedeutend (18,3 Mill. hl Ertrag), jener von
Hülsenfrüchten dagegen sehr ausgedehnt, indem Erbsen und
Bohnen eine Lieblingsspeise der Spanier bilden und in großen
Mengen als Feldfrüchte gezogen werden (Ertrag an Kichererbsen
2,354,000hl). Kein Staat in Europa produziert so mannigfache Arten
von Gemüse wie S., wo die gartenmäßige Kultur
insbesondere in der Provinz Valencia betrieben wird. Außer
den gewöhnlichen Küchengewächsen werden kultiviert:
spanischer Pfeffer, der Liebesapfel (Lycopersicum esculentum) im
großen, die Wassermelone, die Schlangengurke, der
Kalebassenkürbis, stellenweise die tropische Batate (Batatas
edulis) und die Erdnuß (Cyperus esculentus). Die
verbreiterten Gartengewächse sind: Kohl, Salat, Zwiebeln,
Knoblauch, Gurken, Artischocken, Erdbeeren. Gemüse und
Gartenfrüchte geben auch einen nicht unbedeutenden
Exportartikel ab. Die Runkelrübe kennt man dagegen nur als
Viehfutter. Die Handelsgewächse des Landes sind: Hanf (am
besten in Granada und Murcia), Flachs, Waid, Safran,
Süßholz, Zuckerrohr, welches an der südlichen und
östlichen Küste, namentlich in der Provinz Malaga, gebaut
wird, und zwar infolge gesetzlichen Schutzes in steigendem
Maß, Raps in den nördlichen Provinzen, Kümmel in
der Mancha; ferner Senf, Mohn, Sesam, Rizinus und andre
Ölpflanzen. Die Baumwollstaude, welche noch vor 30 Jahren
einen Ausfuhrartikel für die Balkarischen Inseln bildete, wird
gegenwärtig fast gar nicht mehr kultiviert. Der Tabaksbau ist
untersagt. Espartogras (s. d.), das im Süden Spaniens unweit
der Seeküste ohne irgend eine Pflege reichlich wächst,
wird zu verschiedenen Flechtwerken, Seilen, Lauftüchern,
Bundschuhen etc. sowie zur Papierfabrikation verwendet und in
großen Mengen exportiert (jährlich ca. 400,000 metr.
Ztr.). Ein wichtiger Zweig der Bodenkultur ist die Fruchtbaumzucht.
Neben den mitteleuropäischen Obstarten, Wal- und
Haselnüssen findet man die schönsten Kastanienwälder
und die verschiedenartigsten Südfrüchte (Orangen,
Zitronen, Granaten, Feigen, Mandeln, Datteln, Johannisbrot,
indische Feigen, Bananen) nicht nur längs der Küste und
in den südlichen Provinzen, sondern auch in den warmen
Flußthälern des Nordens. Die Südfrüchte sowie
die Wal- und Haselnüsse bilden einen ergiebigen
Ausfuhrartikel. 1886 wurden an Orangen 816,666, Zitronen 73,493,
Mandeln 27,730 und Haselnüssen 40,090 metr. Ztr. ex-
69
Spanien (Viehzucht, Jagd, Fischerei, Forstwesen).
portiert. Ausgedehnte Landstriche sind namentlich im Süden
der Olivenkultur eingeräumt, welche einen wichtigen
Exportartikel liefert. Doch steht das spanische Öl wegen
schlechter Behandlung der Frucht in geringem Preis und wird
großenteils erst im Ausland, namentlich in Frankreich,
raffiniert. Die Produktion, welche vornehmlich in Andalusien,
Murcia, Valencia, Aragonien und Katalonien vertreten ist, ergibt in
günstigen Jahren ca. 2,5 Mill. hl Öl; die Ausfuhr
beträgt im Durchschnitt der letzten Jahre 250,000 metr. Ztr.
In den letzten Jahren hat sich der Anbau von Cacahuetes oder Mani,
einer Art Pistazie, aus der ein billiges und brauchbares Öl
bereitet wird, zu einem besondern Zweig der landwirtschaftlichen
Thätigkeit in der Provinz Valencia herausgebildet. Wichtige
Bodenkulturzweige sind noch die in großem Maßstab
betriebene Maulbeerbaum- und die Weinkultur. Durch die
geographische Lage und durch die klimatischen Verhältnisse
begünstigt, bringt das Land die feurigsten Weine in allen
Abarten und in großer Menge hervor. Der durchschnittliche
Ertrag beläuft sich auf mehr als 20 (1887: 28) Mill. hl. Die
berühmtesten Weine sind die andalusischen, insbesondere die
von Jeres de la Frontera, Puerto de Santa Maria und Malaga. Der
Export dieser Weine geht hauptsächlich nach England und
Amerika. Von den katalonischen Weinen sind nur die Sorten von Reus
und Tarragona vorzüglich, von den Valenciaweinen die roten
Benicarloweine geschätzt. Die Alicantiner Weine sind sehr fein
und ziemlich alkoholreich. Die kastilischen Weine, darunter der
ausgezeichnete Manchawein (Valdepeñas), werden meist im
Inland konsumiert. Die Aragonweine sind am dunkelsten, feinsten und
am wenigsten säuerlich. Vorzügliche Weingegenden sind
außerdem: Südnavarra, das untere Duerothal, Viscaya,
Orense, die Gegend von Plasencia und die Serena in Estremadura,
endlich Mallorca (vgl. Spanische Weine). Großen Absatz finden
die spanischen Weine seit den letzten Jahren in Frankreich, wo die
durch die Reblaus und durch die schlechten Ernten verursachten
Ausfälle außer durch italienische auch durch spanische
Weine (meist aus den nordöstlichen Provinzen) gedeckt werden.
Im ganzen werden jährlich über 7 Mill. hl, davon gegen 6
Mill. nach Frankreich, exportiert. Daneben bilden auch frische
Trauben einen Ausfuhrartikel (1886: 192,000 metr. Ztr.). Von
Wichtigkeit ist ferner die Kultur der Rosinen, namentlich werden
Rosinen aus den Provinzen Alicante (Denia) und Malaga ins Ausland,
hauptsächlich nach England und Nordamerika, geführt
(1886: 384,460 metr. Ztr.). Die hervorragendsten Futterkräuter
sind Luzerne und Esparsette. Eigentliche Wiesen gibt es nur in den
nördlichen Provinzen und in den höhern Gebirgsgegenden.
Viel ausgedehnter ist das Weideland in solchen Strecken, welche
auch zum Ackerbau oder zur Forstkultur geeignet wären, jedoch
vorzugsweise zur Zucht von Schafen dienen, wie in Estremadura,
Niederandalusien, Aragonien, Altkastilien und Leon.
Von großer Bedeutung ist die Viehzucht. Man zählte
1878 in S. 460,760 Pferde, 941,653 Maultiere, 890,982 Esel,
2,353,247 Rinder, 16,939,288 Schafe, 3,813,006 Ziegen, 2,348,602
Schweine. Die früher so berühmte, dann in Verfall
geratene Pferdezucht hat einen neuen Aufschwung genommen. Die
besten Pferde sind die andalusischen und unter diesen wieder die
von Cordova. Indessen reicht die Zahl der gezüchteten Pferde
für den Bedarf des Landes nicht aus. Auf die Zucht der
Maultiere und Esel, welche nicht nur die bevorzugtesten Haustiere
sind, sondern auch in Menge ausgeführt werden, wird
große Sorgfalt verwendet. Die Zucht des Rindviehs
zerfällt in die der zahmen Rinder und die der zu den
Stiergefechten erforderlichen wilden Stiere, welche auf einsamen,
hoch gelegenen Triften und in den Gebirgen, namentlich in Navarra,
in der Sierra Guadarrama, Sierra Morena und am Guadalquivir, gehegt
werden. Das zahme Rindvieh ist nicht sehr groß, aber stark
und gut gebaut; das beste wird in den nördlichen Provinzen
gezüchtet, wo auch allein Milch-, Butter- und
Käsewirtschaft getrieben wird. Die spanische Schafzucht, einst
die erste der Welt und Quelle ungeheurer Einkünfte, ist, wenn
auch immer noch ansehnlich, von der andrer Länder
überflügelt worden und in Abnahme begriffen. Die Ursache
hiervon ist besonders darin zu suchen, daß die Regierung
behufs der Hebung der Agrikultur 1858 die lästige Bestimmung
aufhob, daß von den Grundbesitzern, durch deren Gebiet die
Herden (von und nach den Winterquartieren in Estremadura) ziehen,
eine Schaftrift von 90 Schritt Breite zu beiden Seiten der
Straße freigelassen werden mußte. Gegenwärtig
muß, soweit das Wandern mit Schafherden noch besteht,
für die Benutzung der Weiden ein Pachtgeld gezahlt werden. Die
Mehrzahl der Merinoherden gehört nämlich großen
Grundbesitzern von Leon, Altkastilien und Niederandalusien. Der
Wollertrag der spanischen Schafe ist zwar sehr gesunken (auf ca. 20
Mill. kg, und zwar nur zum geringern Teil feine und brauchbare
Wolle); doch bildet Schafwolle noch immer einen Exportartikel
(1886: 92,000 metr. Ztr.). Wichtig ist die Hämmelzucht,
vorzüglich für Niederaragonien, wo sich stets Käufer
aus ganz S. zusammenfinden. Die Ziegenzucht ist besonders in den
Gebirgsgegenden heimisch und Ziegenkäse ein wichtiger
Gegenstand des innern Handels, während die Felle in Menge
exportiert werden. Schweinezucht wird überall, im
größten Maßstab jedoch in Estremadura betrieben.
Treffliche Schinken sowie Würste und Borsten gelangen zur
Ausfuhr. Schweine- und Ziegenhäute werden in S. allgemein zu
Weinschläuchen, welche inwendig ausgepicht werden,
verarbeitet. In den Provinzen Murcia und Cadiz kommen auch Kamele
(1878: 1597 Stück) vor. Beträchtliche Ausfuhr von Vieh
findet nach Portugal und England statt. Von Federvieh werden
vornehmlich Hühner, in Estremadura und Andalusien auch
Truthühner gezüchtet; von geringem Belang ist die
Bienenzucht, von Wichtigkeit dagegen die (früher allerdings
noch bedeutendere) Seidenzucht, die namentlich in Valencia und
Murcia ihren Sitz hat (s. unten). Die Kochenillezucht (1820 in
Südspanien eingeführt) wird jetzt um Malaga und Motril in
größerm Maßstab betrieben.
Jagd und Fischerei sind in S. frei, doch wird erstere nicht
besonders eifrig getrieben; das häufigste Haarwild sind
Kaninchen, das meiste Federwild Rebhühner. Der Fang von
Thunfischen, Sardinen, Sardellen und Salmen und das
Einräuchern derselben beschäftigt an den Küsten von
Viscaya, Galicien, Andalusien, Valencia und Katalonien Tausende von
Menschen und liefert bedeutende Mengen für den Export. Auch
die Korallenfischerei an der Küste von Andalusien hat sich in
neuester Zeit gehoben. Die Waldwirtschaft steht in S. noch auf
einer niedrigen Stufe. Der Holzboden nimmt zwar über 20 Proz.
des gesamten Areals ein; doch sind infolge der
Vernachlässigung der Kultur, der unbeschränkten
Brennholznutzung, der Schädigung der Wälder durch Hirten
und Herden und der planlosen Ausnutzung der Privat- und
Staatsforsten nur etwa 9 Proz. noch wirklich mit Holz
bestanden.
70
Spanien (Bergbau und Hüttenwesen).
Das wichtigste Nadelholz ist die Kiefer, die vorzüglichsten
Laubhölzer sind: die Eiche, Rotbuche, Kastanie, die
Rüster und der Ölbaum, welcher besonders in Andalusien
ganze Wälder bildet. Nach Gesetz vom 19. Febr. 1859 soll von
den Staats-, Kommunal- und Körperschaftsforsten ein Teil
(3½ Mill. Hektar) verkauft, der andre Teil (6½ Mill.
Hektar) aber regelmäßig bewirtschaftet werden. Zu diesem
Zweck ist das Land in zehn Forstdistrikte eingeteilt worden; auch
besteht eine königliche Forstingenieurschule im Escorial. Sehr
gesegnet mit Waldungen ist Katalonien, wo (insbesondere im
Monsenygebirge) die gewinnreichsten Holzgattungen, wie Kastanien
(zu Faßdauben vorzüglich geeignet),
Walnußbäume (zu Holzreifen verwendet) und Korkeichen, am
besten gedeihen, welch letztere wegen des Korks, des als
Gerbmaterial geschätzten Bastes und des sich zu Kohlen
trefflich eignenden Astholzes einen reichlichen Ertrag liesern.
Außer in Katalonien findet man diese Baumgattung in
Estremadura, Andalusien und Valencia. Die jährliche Produktion
an Korkplatten beträgt 520,000 metr. Ztr., der Export von
Pfropfen durchschnittlich 1010 Mill. Stück, an Platten und
Tafeln 25,000 metr. Ztr. Nebenprodukte der Wälder sind:
Sumachrinde (als Gerbmaterial), Ladanbalsam, eßbare Eicheln,
Maronen, Beeren, Arzneikräuter etc.
Bergbau und Hüttenwesen.
S. ist ein an Metallen und Erzen außerordentlich reiches
Land und könnte in seinem Bergbau und Hüttenwesen eine
Quelle großen Nationalreichtums finden, wenn ersterer
rationell betrieben und entsprechend ausgebeutet würde. Das
Bergwesen untersteht dem Ministerium für Volkswirtschaft,
resp. der bei demselben errichteten Junta für dasselbe. Nach
dem Gesetz vom 6. Juli 1859 wurde das Land in 17 Minendistrikte
eingeteilt, von denen jeder unter einem königlichen
Bergingenieur steht, und in Madrid auch ein Oberbergamt
eingerichtet. Laut des genannten Gesetzes hat sich der Staat die
Ausbeutung der meisten Bergwerke, sämtlicher Salzbergwerke und
Salinen (ausgenommen die in den baskischen Provinzen) reserviert.
Durch die finanzielle Notlage wurde indessen die Regierung in
neuerer Zeit genötigt, sich des größten Teils des
Staatseigentums und so auch des Montanbesitzes zu
entäußern, so daß jetzt nur noch die
Quecksilbergruben von Almaden und einige Salinen Staatseigentum
sind. Im ganzen Land gibt es etwa 6000 Minen aller Art, wozu noch
die aus alter Zeit, teilweise von den Römern,
zurückgelassenen Schlackenhaufen als Ausbeutungsobjekte
kommen. Bei der Gewinnung von Erzen u. Metallen sind über
45,000 Arbeiter beschäftigt. Der Bergbau und
Hüttenbetrieb ergaben nach der letzten Erhebung (1883)
folgende Mengen: Silber 540 metr. Ztr., Quecksilber 16,670,
Roheisen 1,422,240, Kupfer 321,560, Blei 993,120, Zink 68,430,
Kohle 10,707,500, Salz 6,750,000, Schwefel 11 1,290 metr. Ztr.
Bemerkenswert ist jedoch, daß das Hüttenwesen mit dem
Bergbau nicht gleichen Schritt hält, und daß ein
großer Teil der gewonnenen Erze nach England und andern
Ländern exportiert wird und häufig in verhütteter
Form wieder ins Land zurückkehrt. So wurden 1886: 49,2 Mill.
metr. Ztr. Erze (davon 41,8 Mill. Eisenerz und 6,7 Mill. Kupfererz)
ausgeführt. Was die einzelnen Produktionszweige betrifft, so
wird Gold gegenwärtig nur in den Arsenikgruben bei Culera
(Katalonien), in kleinern Quantitäten auch aus dem Sande des
Flusses Sil gewonnen. Ebenso ist die Produktion von Silber
herabgegangen, wenngleich mehrere Bergwerke hierfür bestehen,
von welchen jene in den westlichen Abhängen der Sierra
Almagrera (Provinz Almeria), die von Hiende la Encina (Provinz
Guadalajara) und die von Farena (Provinz Tarragona) die
mächtigsten sind. In den Quecksilbergruben von Almaden (12
Minen) sind über 3000 Arbeiter beschäftigt. Der Export
beträgt durchschnittlich 11,000 metr. Ztr. An Eisenerz birgt
S. in vielen Provinzen, besonders in Viscaya (zu Somorrostro),
Guipuzcoa (Irun), Navarra (Lesaca, Vera), Santander, Oviedo und
Granada, reiche Schätze, die aber nicht gehörig
ausgenutzt werden. Die bedeutendsten Hüttenwerke befinden sich
in den Provinzen Viscaya, Navarra, Oviedo, Sevilla, Malaga u. a. An
Kupfer besitzt die Provinz Huelva in den Minen von Rio Tinto,
Tharsis und andern schon von den Karthagern u. Römern
bearbeiteten Bergwerken unerschöpfliche Lager. Die Minen von
Rio Tinto (s. d.) wurden 1873 von der spanischen Regierung (um 96
Mill. Frank) an ein Syndikat von Londoner und Bremer Firmen
verkauft; Tharsis gehört bereits seit längerer Zeit einer
englischen Aktiengesellschaft. Hinsichtlich der Bleiproduktion
überragt S. alle andern Staaten Europas. Die Hauptsitze
für diesen Bergbau und Hüttenbetrieb sind: die Provinzen
Murcia (bei Cartagena 76 Werke mit 150 Hochöfen und 1500
Arbeitern), Almeria (Bleiminen der Sierra Gador, Sierra Almagrera,
Alhamilla etc.; 13 Schmelzwerke bei Garrucha) und Jaen (Linares und
Baylen). Der Export an metallischem Blei betrug 1886: 1,150,000
metr. Ztr. Für den Zinkbergbau sind die Hauptsitze: die
Provinzen Santander, Guipuzcoa, Murcia, Granada, Malaga und
Almeria. Die Verhüttung ist von geringem Umfang; die
gewonnenen Erze werden größtenteils nach Belgien und
andern Ländern exportiert. Die wichtigsten Kohlendistrikte
sind in der Provinz Oviedo, dann in Burgos und Soria, Leon und
Palencia, Teruel und Santander. Die jährliche Produktion ist
von 355,000 metr. Ton. im J. 1861 gegenwärtig auf mehr als 1
Mill. metr. T., größtenteils Steinkohle, gestiegen,
wobei immer noch eine überwiegende Einfuhr englischer Kohle
(1886: 1,4 Mill. metr. T.) stattfindet. An Salz ist S. überaus
reich. Dasselbe ist kein Monopolgegenstand; es gibt zwar staatliche
Etablissements dafür, welche in 20 Haupt- und 12
Unteranstalten zerfallen, aber ebensowohl befassen sich mit der
Salzgewinnung und zwar aus Seewasser u. aus Bergsalinen viele
Private, die aus Anlaß des Betriebs nur der gewöhnlichen
Industrialsteuer unterworfen sind. Steinsalzminen gibt es zu
Cardona (Provinz Barcelona), Pinoso (Provinz Alicante), Gerry y
Villanova (Provinz Gerona), Minglanilla (Provinz Cuenca) u. a. O.
Seesalz wird am meisten in den Lagunen der Bai von Cadiz und an den
Ufern des untern Guadalquivir ausgebeutet, ferner auf der Insel
Iviza, aus den Lagunen von Torrevieja (Provinz Alicante, in der
Regie des Staats) etc. Der gesamte Salzexport beträgt
jährlich 2,5 Mill. metr. Ztr. Manganerz (Braunstein) wird am
meisten in der Provinz Huelva zu Tage gefördert, doch droht es
infolge des Raubbaues bald gänzlich zu versiegen. Alaungruben
finden sich an vielen Orten; Schwefel wird besonders in Murcia und
Ostgranada, Schwefelkies in der Provinz Huelva (namentlich in den
schon erwähnten Gruben von Rio Tinto und Tharsis mit
fortwährend steigendem Export), Asphalt in der Provinz Alava,
Antimon in Saragossa, Ciudad Real und bei Cartagena, außerdem
Graphit, Bergöl, Naphtha und Phosphorit (letzteres für
die Agrikultur äußerst wichtige Material in 9 Minen der
Provinz Caceres mit einer durchschnittlichen Ausbeute von 1,8 Mill.
metr. Ztr.) gewonnen.
71
Spanien (Industrie).
Industrie.
Die spanische Industrie nimmt zwar noch lange nicht den Platz
ein, der ihr in anbetracht der reichen Hilfsquellen und der
günstigen kommerziellen Lage des Landes gebührt; doch hat
dieselbe in neuester Zeit einen bedeutenden Aufschwung genommen.
Die industriellsten Provinzen sind: Barcelona, Gerona, Tarragona,
Guipuzcoa und Viscaya, nächst diesen Valencia, Murcia,
Alicante, Almeria, Granada, Sevilla, Malaga, Galicien, Asturien,
Santander, Madrid und Ciudad Real. Was die einzelnen
Industriezweige betrifft, so wird die Verfertigung von Eisen- und
Stahlwaren am ausgedehntesten in Katalonien, in den baskischen
Landschaften und in den Provinzen Malaga und Sevilla betrieben.
Guten Ruf hat das Land in der Erzeugung von Handwaffen, wofür
Fabriken zu Toledo, Oviedo und Plasencia (Guipuzcoa) bestehen;
berühmt sind insbesondere die Klingen von Toledo. Ein
großes Etablissement ist auch die Nationalfabrik zu Trubio
(Oviedo) für Eisengußwaren und Artilleriematerial. Neben
den Eisenwaren produziert S. viel Kupfer- und Bleiwaren, Messing
namentlich zu San Juan de Alcaraz (Provinz Albacete), Bronzewaren
zu Barcelona, Eibar (Guipuzcoa) und in Navarra, Schmucksachen und
Filigranarbeiten. Der Maschinenbau hat seine Hauptsitze zu
Barcelona (4 große Werkstätten mit ca. 1700 Arbeitern),
Sevilla, Malaga, Madrid und Valladolid, der Schiffbau zu Barcelona,
Cartagena, Cadiz und Santander, die Verfertigung von chirurgischen
und Präzisionsinstrumenten zu Madrid. Musikinstrumente, und
zwar Pianos, werden zu Barcelona, Sevilla, Saragossa und
Valladolid, Guitarren zu Murcia, Streichinstrumente vorzugsweise zu
Palma fabriziert. Für Porzellan bestehen zwei Fabriken,
für Steingut- und Fayenceerzeugung ein ansehnliches
Etablissement zu Sevilla und weitere Unternehmungen in den
Provinzen Valencia, Madrid und Castellon. Die Fabrikation
feuerfester Thonwaren steht zu Barcelona auf einer Höhe,
welche einen nicht unbedeutenden Export nach den Häfen des
Mittelmeers bis nach Konstantinopel zuläßt. Eine
wichtige Industrie ist auch die Erzeugung von Ziegelfliesen,
glasierten Platten und Mosaikfußböden, welche namentlich
als Hausindustrie Tausende von Arbeitskräften, insbesondere in
der Provinz Valencia, beschäftigt und einen wesentlichen
Exportartikel liefert. Hydraulischer Kalk (Zement) wird nur in
Guipuzcoa in einer Menge von jährlich ca. 100,000 metr. Ztr.
erzeugt. S. liefert gutes Glas in ziemlich großer Menge, aber
hauptsächlich nur für den inländischen Bedarf,
während der Export nach den Kolonien ein geringer ist;
geschliffene Glaswaren werden eingeführt. Die Glasindustrie
wird an vielen Orten, insbesondere in Badalona, Murcia, Cadalso
(Madrid) und Gijon, betrieben. Die Verarbeitung des Korks zu
Pfropfen, Platten und Tafeln bildet einen ergiebigen Industriezweig
in der Heimat des Rohstoffs, der Provinz Gerona (Exportwert 1886
über 17 Mill. Pesetas). Tischlerwaren werden zu Madrid und
Barcelona verfertigt, ohne daß jedoch in feinern Artikeln die
ausländische Industrie vom Markt verdrängt wäre.
Bedeutend ist namentlich für die Hausindustrie die Stroh- und
Binsenflechterei. Die Lederindustrie Spaniens stand in
früherer Zeit auf einer viel höhern Stufe als dies
gegenwärtig der Fall ist, obschon das Land noch immer durch
die Erzeugung von Saffian und Korduan hervorragt und gewisse
Quantitäten von Leder ausführt. Die besten Fabrikate
kommen von Cordova, Barcelona, Toledo, Burgos und aus den
baskischen Provinzen. Insbesondere ist S. die Heimat der
kunstvollsten Riemerartikel (Sättel und Reitzeuge). Die
Seidenindustrie, für welche alle klimatischen Bedingungen
vorhanden sind, ist durch die Seidenraupenkrankheit sehr
beeinträchtigt worden und beschränkt sich
gegenwärtig hauptsächlich auf die Provinzen Murcia,
Valencia und Sevilla, in welchen übrigens die Seidenspinnerei
ein vorzügliches Erzeugnis liefert. Die Produktion an
Seidenkokons beträgt etwas über 1 Mill., an Rohseide
durchschnittlich 85,000 kg. Die Seidenweberei war in frühern
Jahrhunderten blühend und wird gegenwärtig noch, ohne den
Bedarf zu decken, fabrikmäßig zu Madrid, Valencia,
Barcelona, Granada, Sevilla und Toledo betrieben. Die
Schafwollweberei macht große Fortschritte, arbeitet jedoch
bloß für den einheimischen Markt, wobei ihr das Ausland
Konkurrenz bietet. Der Hauptsitz ist Katalonien, namentlich
Barcelona, Tarrasa, Sabadell, Manresa u. a. O. Barcelona zeichnet
sich auch in der Fabrikation von Shawls und Möbelstoffen durch
gediegene Leistungen aus. Gute Tuche und Flanelle werden in Alcoy,
Palencia, Bejar (Provinz Salamanca) etc. erzeugt. Valencia und
Murcia liefern Decken aus Streich- und Kammgarn, welche den
Bewohnern zur Bekleidung, zum Schmuck und zum Tragen der Utensilien
unentbehrlich sind. Verhältnismäßig günstig
entwickelt ist die spanische Baumwollindustrie. Während die
Spinnerei 1834 erst 600,000 Feinspindeln zählte, hob sich
diese Ziffer 1881 auf 1,835,000. Der Baumwollkonsum betrug im
Durchschnitt der letzten Jahre 490,000 metr. Ztr. Die
größte Bedeutung hat die Baumwollindustrie für
Katalonien. Barcelona versteht mit gewebten und bedruckten Stoffen
(Indiennes) fast alle spanischen Kolonien. Außerdem ist diese
Industrie noch in den baskischen Provinzen, in Malaga, Santander,
Valladolid und den Balearen vertreten, obgleich immer noch ein
Import (Garne 1886 für 2,1, Gewebe für 11,4 Mill.
Pesetas) notwendig ist. Die Flachsspinnerei macht gute
Fortschritte. Die Leinweberei arbeitet für die
Bedürfnisse des eignen Landes und exportiert nach den Kolonien
und Brasilien, wogegen aber auch ein Import aus
Großbritannien und Irland stattfindet. Die Sitze dieser
Industrie sind: die Landschaften Katalonien, Aragonien, Kastilien,
Galicien u. Navarra. Die Espartoweberei, welche in Murcia, Alicante
u. a. O. betrieben wird, liefert verschiedene Waren, als:
Überzieher für Bergleute, Teppiche, Lauftücher etc.
In Leinen- und Hanfgarn fand in den letzten Jahren ein Import von
durchschnittlich 42,000 metr. Ztr., an Geweben ein solcher von 6300
metr. Ztr. statt. Färberei und Druckerei sind alte und
wichtige Zweige der spanischen Industrie, zumal in Katalonien und
in den baskischen Provinzen. Die Spitzenmanufaktur ist gleichfalls
sehr alt und im Fortschreiten begriffen; ihre Heimat ist
Katalonien. Maschinenspitzen werden zu Barcelona, Mataro u. a. O.
erzeugt. Handschuhe liefern Madrid und Valladolid, Wirkwaren
Barcelona. Die Industrie in Schuhwaren schwingt sich auf den
Balearen sichtlich empor (Export über Barcelona nach den
spanischen Kolonien). Für den Konsum der spanischen
Landbevölkerung werden auch Schuhwaren aus Hanf (Alpargatas)
an vielen Orten gefertigt. Neu aufstrebende Industrien sind die
Fächerfabrikation in Valencia und die Knopffabrikation in
Madrid. In der Papierfabrikation findet der Maschinenbetrieb immer
weitere Verbreitung. Es gibt bereits ca. 40 Papierfabriken (zu
Barcelona, Tolosa etc.), während die Zahl der
Papiermühlen mit Büttenbetrieb immer mehr abnimmt. Ein
Hauptartikel der
72
Spanien (Handel, Schiffahrt).
Papierfabrikation ist das Zigarrettenpapier (namentlich in
Alcoy). Bedeutend ist die Industrie in Nahrungs- u.
Genußmitteln. Es bestehen 18 Raffinerien für
Kolonialzucker (Barcelona, Malaga und Umgebung, Granada und
Almeria; Produktion jährlich ca. 150,000 metr. Ztr.),
zahlreiche Schokoladefabriken, so zu Madrid und Umgebung,
Barcelona, Saragossa, Ciudad Real, Leon, Astorga, Oviedo, Malaga
etc., mehrere Fabriken für konservierte und kandierte
Früchte, einige große Fabriken für Fisch- und
Fleischkonserven (in Guipuzcoa und Coruña) und mehrere
Unternehmungen für Maccaroni- und Teigwarenerzeugung (in
Malaga). Weizenmehl wird von Santander aus nach den spanischen
Kolonien verschifft (in den letzten Jahren durchschnittlich 275,000
metr. Ztr.). Erwähnenswert sind ferner: die Spirituserzeugung
aus Wein und dessen Rückständen, die Fabrikation von
Likören (besonders Anislikör in der Provinz Albacete) und
die Bierbrauerei in den größern Städten. Die
Tabaksfabrikation ist Staatsmonopol, welches aber seit 1887
verpachtet ist, und beschäftigt große Etablissements zu
Madrid, Sevilla, Santander, Gijon, Coruña, Valencia und
Alicante. Die erforderlichen Blätter kommen
größtenteils aus den überseeischen Kolonien (Cuba,
Puerto Rico, Philippinen), teilweise auch aus Deutschland. Doch
werden daneben Massen von fremden Zigarren eingeschmuggelt. Endlich
sind noch die Zinnobererzeugung, die Fabrikation von Seife
(Katalonien und Andalusien, insbesondere Malaga), Kerzen und
verschiedenen Chemikalien, die Buchdruckerei und Lithographie
(Hauptort Madrid) hervorzuheben. In ganz S. besteht schon seit
geraumer Zeit Gewerbefreiheit. Es gibt daher keine Innungen und
Zünfte, sondern bloß Vereinigungen (gremios) von
Handwerkern und Gewerbtreibenden zu irgend einem gemeinsam besser
als einzeln zu erreichenden Zweck. Zur Beförderung der
Industrie und der Gewerbe dienen außer den Handelskammern (s.
unten): der Industrieverein zu Madrid, die Gewerbevereine in
verschiedenen Städten und die technischen
Unterrichtsanstalten.
Handel und Verkehr.
S. hat eine für den Handel, namentlich den Welthandel,
äußerst günstige Lage, und geraume Zeit war der
spanische Handel einer der umfangreichsten der Welt. Wenn er in der
Gegenwart kaum noch an das erinnert, was er einst gewesen, so sind
daran einerseits die äußern und innern Kriege,
anderseits aber die Vernachlässigung der natürlichen
Hilfsquellen des Landes schuld. Das Zentrum des gesamten innern
Handels bildet Madrid. Nächstem sind Valladolid, Palencia,
Burgos, Oviedo, Vitoria, Saragossa und Granada die wichtigsten
Plätze des Binnenhandels. In betreff des äußern
Handels zerfällt S. in mehrere selbständige Zollgebiete,
nämlich: das Festland mit den Balearen, die Kanarischen
Inseln, die Provinzen in Amerika, die Besitzungen in Asien und
Ozeanien, die Insel Fernando Po mit deren Dependenzen, die
nordafrikanischen Besitzungen. Jedes dieser Zollgebiete hat seinen
besondern Tarif; die nordafrikanischen Häfen sind zu
Freihäfen erklärt worden. In dem Zollgebiet des
spanischen Festlandes und der Balearen wurde ein Tarif 5. Okt. 1849
eingeführt, seitdem aber vielfach modifiziert und namentlich
durch die abgeschlossenen Handelsverträge ermäßigt.
So hat S. 1861 mit Marokko, 1862 mit der Türkei, 1864 mit
China, 1865 mit Frankreich, dann seit 1870 mit den meisten andern
europäischen Staaten und mit Siam Handels- und
Schiffahrtsverträge abgeschlossen, darin
Einfuhrzollbegünstigungen für fremde Produkte zugestanden
und sich zugleich verpflichtet, diese Zollsätze in einem
spätern Termin noch weiter herabzusetzen. Die finanzielle Lage
und der Vorgang der übrigen Kontinentalstaaten auf dem Weg des
Schutzzollsystems veranlaßten jedoch auch S., zur
Erhöhung der Einfuhrzollsätze mittels neuer Tarife (1882
und 1886) zu schreiten und in diesem Sinn modifizierte
Handelsverträge mit den übrigen Staaten
abzuschließen. Bemerkenswert für den auswärtigen
Handel Spaniens ist, daß von seiten Portugals und von
Gibraltar aus starker Schleichhandel (von letzterm Punkt namentlich
mit englischen Waren) getrieben wird. Der Gesamtwert der Ein- und
Ausfuhr Spaniens (und zwar des Festlandes mit Einschluß der
Balearen) betrug in den letzten Jahren in Millionen Pesetas (1
Peseta = 80 Pfennig):
Jahr Einfuhr Ausfuhr Jahr Einfuhr Ausfuhr
1882 816,7 765,4 1885 764,8 698,0
1883 893,4 719,5 1886 855,2 727,3
1884 779,6 619,2 1887 811,2 722,2
Der auswärtige Handel von S. bewegt sich hauptsächlich
auf dem Seeweg. Auf den Landhandel kamen nämlich vom gesamten
Warenverkehr des letztgenannten Jahrs nur 16, auf den Seehandel
dagegen 84 Proz. Die Hauptartikel des auswärtigen Handels sind
in der Ausfuhr (mit Angabe des Wertes 1887 in Millionen Pesetas):
Wein (281,7), Erze (86,7), Blei (22,0), Rosinen (22,2), Vieh
(12,4), Kork (16,8), Orangen (15,4), Schafwolle (14,1),
Olivenöl (9,7, 1885: 40,0), Schuhwaren (12,4), Esparto (8,9),
Weintrauben (9,7), Weizenmehl (5,2), Konserven (6,9), Eisen und
Eisenwaren (10,4); in der Einfuhr: Weizen (62,8), Baumwolle (62,5),
Spiritus (45,0), Holz (35,3), Tabak (30,3), Fische (29,8), Zucker
(29,7), Mineralkohle (25,6), Schafwollwaren (24,9), Maschinen
(20,1), Häute und Felle (19,4), andre Cerealien (17,5), Vieh
(17,1), Eisen und Eisenwaren (16,9), Chemikalien (15,8), Kakao
(13,6), Flachs- und Hanfgarn (13,3). Was die einzelnen Länder
betrifft, welche an dem auswärtigen Handel Spaniens
partizipieren, so kommt der Hauptanteil auf Frankreich (234,7 Mill.
Pesetas in der Einfuhr und 308,9 Mill. in der Ausfuhr) und
Großbritannien (114,0, resp. 184,6 Mill. Pesetas). Hieran
reihen sich die Vereinigten Staaten von Nordamerika (99,6 und 21,9
Mill.), Cuba (37,3 und 61,0 Mill.), Deutschland (82,9 und 9,6
Mill.), Belgien, Portugal, Italien, die Philippinen, Puerto Rico,
Argentinien, Niederlande, Norwegen etc.
Die Schiffahrt Spaniens zeigt im letzten Jahrzehnt einen
kräftigen Aufschwung. Die Zahl der Häfen an der
spanischen Küste und auf den Balearen beträgt 116, wovon
56 auf die Küste des Atlantischen Meers, 60 auf die des
Mittelmeers kommen. Die wichtigsten von erstern sind: Bilbao,
Santander, Gijon, Ferrol (Kriegshafen), Coruña, Vigo, Huelva
und Cadiz; von letztern: Malaga, Almeria, Cartagena, Alicante,
Valencia-Grao, Tarragona und Barcelona; auf den Balearen und
Pithyusen: Palma, Mahon und Iviza. In den letzten Jahrzehnten sah
man die Notwendigkeit der Herstellung sicherer und verbesserter
Hafenanlagen ein. Demgemäß wurden auch die Arbeiten,
zunächst in Alicante, Barcelona, Cartagena, Tarragona und
Valencia-Grao, in Angriff genommen und großenteils bereits
durchgeführt. Die Zahl der im Betrieb befindlichen
Leuchttürme beträgt 198. In dem Leuchtturm auf Kap
Machichaco in Viscaya besteht eine Schule für
Leuchtturmwächter. Die Handelsmarine Spaniens zählte
Anfang 1884: 1544 Segelschiffe mit 308,779 Registertonnen und 282
Dampfer
73
Spanien (Eisenbahnen etc., Münzen, Wohlthätigkeits- u.
Strafanstalten, Staatsverfassung).
mit 200,100 Ton., zusammen 1826 Seeschiffe mit 508,879 T. Die
Schiffahrtsbewegung sämtlicher Häfen Spaniens bezifferte
sich 1887 in Registertonnen:
Eingelaufen Ausgelaufen
Spanische Schiffe 4264482 4420130
Fremde Schiffe 6900494 6696443
Zusammen: 11164976 11116573
Hierzu Küstenschiffahrt (1885) 5661952 5237227
Die Binnenschiffahrt ist in S. von geringem Belang. Unter den
Strömen ist ein einziger, welcher bei hohem Wasserstand
streckenweise befahren werden kann, nämlich der Ebro, auf
welchem flache Fahrzeuge dann bis Saragossa, wohl auch bis in die
Provinz Navarra gelangen können. Der Guadalquivir, Guadiana
und Minho sind nur ein Stück von der Mündung an hinauf
für größere Schiffe fahrbar, der erstgenannte
für Seeschiffe bis Sevilla; dieselben kommen daher bei der
Binnenschiffahrt nicht in Betracht. Die übrigen Ströme
sind, soweit sie S. angehören, so voller Sandbänke,
Löcher und Strudel, daß sie sich gar nicht zur
Schiffahrt eignen. Unter den Kanälen steht der unter Karl V.
begonnene Kaiserkanal von Aragonien obenan, 119 km lang, 3,35 m
tief und an der Oberfläche 23,5 m breit, außer zur
Schiffahrt auch zur Bewässerung dienend. Im 18. Jahrh. wurden
drei schiffbare Kanäle hergestellt, worunter der 160 km lange
Kastilische, der bei Alar del Rey aus dem Pisuerga ausgeht und
unweit Simancas an demselben Fluß endigt, der wichtigste ist.
Der Manzanareskanal (von Toledo nach Madrid, 14 km) sowie der
Canale Nuevo, bei Amposta aus dem Ebro ausgehend und in San Carlos
de la Rapita nach 11 km Länge endigend, werden zur Schiffahrt
wenig benutzt. Aus diesem Jahrhundert datieren der Guadarramakanal
(17 km) und der Murciakanal (28 km). Neuerlich hat eine
Aktiengesellschaft auch die Kanalisierung des Ebro bis Saragossa
unternommen. Die Gesamtlänge aller schiffbaren Kanäle und
Flüsse Spaniens beträgt ungefähr 700 km.
Die erste Eisenbahn, von Barcelona nach Mataro (28 km), wurde
28. Okt. 1848 dem Verkehr übergeben. Seitdem entwickelte sich
das Eisenbahnnetz Spaniens in folgender Progression: 1855: 595 km,
1865: 5226 km, 1876: 5796 km, 1886: 9185 km. Die
hauptsächlichsten Linien sind: Die Spanische Nordbahn von
Madrid über Irun an die französische Grenze, mit
Zweiglinien nach Zamora, Salamanca, Segovia und Santander. An die
Nordbahn schließen sich die Nordwestliche oder Galicische
Eisenbahn mit den Linien Palencia-Coruña, Monforte-Vigo und
Leon-Gijon, dann die Eisenbahn Tudela-Bilbao, welche die Nordbahn
bei Miranda kreuzt. Eine wichtige Linie ist im NO. die Eisenbahn
von Saragossa nach Pamplona, welche einen Zweig zur Nordbahn nach
Alsasua entsendet. Von Madrid laufen außer der
ersterwähnten Bahn noch die Eisenbahn über Saragossa nach
Barcelona und die nach Alicante aus, welche beide miteinander durch
die Küstenbahn über Tarragona und Valencia nach Almansa
in Verbindung stehen, und wovon die erstere mehrere Zweiglinien in
Katalonien und die Linie über Portbou nach Frankreich, die
letztere die Zweiglinien nach Toledo und Cartagena entsenden. An
die Eisenbahn Madrid-Alicante schließen sich endlich die
andalusischen Bahnen nach Cadiz, Malaga und Granada sowie die
Eisenbahn über Ciudad Real und Badajoz nach Portugal an. Von
Madrid nach Lissabon führt außerdem die neue direkte
Linie über Talavera. Auch die Insel Mallorca hat ihre
Eisenbahn Palma-Manacor. Die Ausführung der einzelnen
Eisenbahnlinien erfolgte durch Privatgesellschaften, meist mit
englischen Kapitalien. Pferdebahnen bestehen zu Madrid, Barcelona
und Valencia-Grao. Auch auf den arg vernachlässigten
Straßenbau hat man in neuerer Zeit große Summen
verwendet; die Gesamtlänge der fertigen Straßen
beträgt gegenwärtig ca. 19,000 km. Weitere 3000 km sind
teils im Bau, teils projektiert. Am meisten leidet noch das Zentrum
des Landes durch Mangel an Verkehrswegen. Auch auf Vizinalwege wird
wenig Bedacht genommen. Das spanische Staatstelegraphenwesen
umfaßte 1886 ein Netz von 17,840 km Linien mit einem
Betriebspersonal von 3540 Individuen. Der Korrespondenzverkehr
ergab 2,8 Mill. Depeschen. Dem Postwesen standen 1886: 2655
Anstalten mit einem Personal von 7112 Individuen zur
Verfügung. Der Briefpostverkehr umfaßte 111 Mill.
Stück. Seit 1886 sind 15 Handels-, Industrie- und
Schiffahrtskammern errichtet worden. Banken mit dem Rechte der
Notenemission bestanden früher in den meisten
größern Städten. Durch das Gesetz vom 19. März
1874 wurde jedoch die Kreditzirkulation in einer einzigen Bank, der
Bank von S. (Grundkapital 100 Mill. Pesetas) in Madrid,
konzentriert und zu ihren gunsten die Aufhebung aller andern
Zettel- und Diskontobanken angeordnet. Die meisten derselben haben
sich zu Filialen der Bank von S. umgestaltet. Außerdem gibt
es eine größere Anzahl von selbständigen
Kreditinstituten, zahlreiche Sparkassen, Leihhäuser,
Börsen in allen großen Handelsplätzen etc. Die
berühmtesten Messen sind die von Talavera de la Reina in
Neukastilien, Palencia, Valladolid, Medina de Rioseco und Soria in
Altkastilien, Puenta de la Reina, Estrella und Corella in Navarra,
Granollers und Tarrasa in Katalonien, Ronda und Puerto de Santa
Maria in Andalusien; Hauptwollmärkte die von Cuenca in
Neukastilien und Bejar in Leon. Münzeinheit ist seit 1871 die
Peseta à 100 Centimos = 1 Frank = 4 Reales de vellon
(Kupferreal). Die gangbaren Münzsorten sind in Gold: der
Golddoblon = 100 Realen = 21,06 Mk., der Goldthaler (escudo de oro)
= 40 Realen = 8,42 Mk., der halbe Goldthaler (coronilla) = 20
Realen; in Silber: der Duro oder spanische Thaler (peso fuerte, im
Ausland Piaster genannt) = 20 Realen = 4,20 Mk., der halbe Duro
oder Escudo (medioduro, escudo) = 10 Realen, die Peseta = 4 Realen,
die halbe Peseta = 2 Realen, der einfache Real (real de vellon).
Das einzige Papiergeld des Landes sind gegenwärtig die Noten
der Bank von S., deren höchste Abschnitte aber nicht auf mehr
als 1000 Pesetas lauten dürfen. In Bezug auf Maß und
Gewicht ist seit 1855 gesetzlich das metrische System
eingeführt.
Ungemein groß ist die Zahl der
Wohlthätigkeitsanstalten, deren man bereits 1859: 1028
zählte, worin 455,290 Individuen verpflegt wurden. Die Straf-
und Besserungsanstalten zerfallen in Zuchthäuser für
männliche Verbrecher und Korrektionshäuser für
Weiber. Die schwersten Verbrecher werden in den an die Stelle der
ehemaligen Galeeren getretenen Zuchthäusern in Ceuta,
Alhucemas, Melilla und Peñon de Velez untergebracht.
Staatsverfassung und Verwaltung.
Das Grundgesetz der gegenwärtigen Staatsverfassung des
Königreichs S. bildet die Konstitution vom 30. Juni 1876.
Hiernach ist S. eine eingeschränkte Monarchie,
gegenwärtig unter der Dynastie Bourbon. Als Thronfolgeordnung
gilt die kognatische, wonach das weibliche Geschlecht in Bezug auf
die Succession gleiches Recht mit dem männlichen besitzt und
nur die Nähe der Linie darüber entscheidet, wer
nachfol-
74
Spanien (Staatsverwaltung, Rechtspflege).
gen soll, so daß ein näher verwandter weiblicher
Abkömmling einem entfernter verwandten männlichen
vorangeht, in der erbenden Linie aber der jüngere Prinz vor
der ältern Prinzessin den Vorzug hat. Die
Successionsfähigkeit ist von dem römisch-katholischen
Glaubensbekenntnis abhängig. Die Großjährigkeit
tritt mit dem vollendeten 16. Jahr ein. Wenn die Erbfolge einen
noch minderjährigen Succedenten trifft, oder wenn der Monarch
durch längere Zeit verhindert ist, selbst zu regieren, so
tritt im ersten Fall eine Vormundschaft, in beiden Fällen eine
Regentschaft ein, deren Bestellung durch die Volksvertretung
erfolgt. Gegenwärtiger König ist Alfons XIII.,
nachgeborner Sohn Alfons' XII., geb. 17. Mai 1886. Regentin ist
seine Mutter Marie Christine. Der König, bez. Regent übt
die gesetzgebende Gewalt gemeinsam mit den Cortes aus, welche sich
in zwei Kammern gliedern: den Senat und den Kongreß der
Deputierten. Der Senat wird gebildet: von den Senatoren
vermöge eignen Rechts; von den Senatoren, welche von der Krone
auf Lebenszeit ernannt werden; von den Senatoren, welche durch die
Provinzialvertretungen und die Höchstbesteuerten gewählt
werden und sich alle fünf Jahre zur Hälfte erneuern.
Senatoren von Rechts wegen sind: die großjährigen
Söhne des Königs und des Thronfolgers; die Granden von
S., welche eine jährliche Rente von 60,000 Pesetas
genießen; die Generalkapitäne des Heers und die Admirale
der Flotte; die Erzbischöfe; die Präsidenten des
Staatsrats, des obersten Gerichtshofs, des Rechnungshofs, des
obersten Kriegs- und des obersten Marinerats, wenn sie sich zwei
Jahre im Amt befinden. Die vom König ernannten oder von den
Provinzialvertretungen u. den Höchstbesteuerten gewählten
Senatoren müssen bestimmten Klassen des Beamtenstandes, der
Armee, des Klerus angehören oder eine jährliche Rente von
20,000 Pesetas beziehen. Die Zahl der Senatoren kraft eignen Rechts
und der vom König ernannten Senatoren darf zusammen 180 nicht
übersteigen, und dieselbe Zahl entfällt auf die
gewählten Senatoren. Jeder Senator muß Spanier und 35
Jahre alt sein. Der Kongreß der Deputierten setzt sich aus
denjenigen Mitgliedern zusammen, welche von den Wahljunten auf
fünf Jahre, im Verhältnis von einem Deputierten auf
40,000 Einw., gewählt werden. Um zum Deputierten gewählt
zu werden, sind die spanische Staatsbürgerschaft, der
weltliche Stand, die Großjährigkeit und der Genuß
aller bürgerlichen Rechte erforderlich. Das passive Wahlrecht
ist durch keinen Zensus, das aktive Wahlrecht seit der Wahlreform
vom 20. Juli 1877 durch einen solchen von 25 Pesetas
beschränkt. Die Cortes versammeln sich alle Jahre. Der
Präsident und die Vizepräsidenten der Zweiten Kammer
werden von der Kammer gewählt, die der Ersten Kammer vom
König ernannt. Der König und jede der beiden legislativen
Körperschaften besitzen das Recht der Initiative zu den
Gesetzen. Finanzgesetze müssen zuerst dem Kongreß der
Deputierten vorgelegt werden. Der Kongreß besitzt das Recht
der Ministeranklage, wobei der Senat als Gericht fungiert. Die
Abgeordneten erhalten keine Vergütung oder Diäten. Die
Staatsbürgerrechte entsprechen den in den übrigen
repräsentativen Monarchien gewährleisteten Grundrechten.
Die Staatsbürger teilen sich dem Stand nach in Adel,
Geistlichkeit, Bürger und Bauern, welche Stände aber vor
dem Gesetz gleich sind. Der Adel zerfällt in den hohen, der
sich wieder in Grandes und Titulados teilt, und in den niedern der
Hidalgos oder Fidalgos. Die "Grandeza" wird gegenwärtig vom
König teils als persönliche Auszeichnung, teils erblich
erteilt und führt das Prädikat "Exzellenz". Die Titulados
sind Familien, welche von alters her den stets nur auf den
ältesten Sohn übergehenden Titel Herzog, Marquis, Graf,
Visconde oder Baron führen. Der äußerst zahlreiche
niedere Adel zerfällt in Ritter- und Briefadel. Aber weder der
hohe noch der niedere Adel hat irgend welche politische Vorrechte.
Das Prädikat "Don", früher nur dem hohen Adel zustehend,
wird jetzt jedem gebildeten Mann gegeben. Die Gemeindeverfassung
datiert in ihrer jetzigen Form von 1845 und ist, wie auch die
Provinzialverfassung, im wesentlichen der französischen
nachgebildet. In jeder Provinz sind Provinzialdeputationen
eingesetzt, deren Mitglieder von den Gemeindevertretungen
gewählt werden. Jede Gemeinde von mindestens 30 Mitgliedern
hat ihre eigne Gemeindevertretung (ayuntamiento), welche auf zwei
Jahre gewählt wird, und welcher der Alkalde, der zugleich
Friedensrichter ist, präsidiert. Die Alkalden werden von den
Gemeinden alljährlich neu gewählt, aber von der Regierung
bestätigt.
An der Spitze der gesamten Staatsverwaltung steht der
Ministerrat (consejo de ministros), dem der königliche
Staatsrat (consejo de estado) zur Seite steht. Der Staatsrat
besteht aus 33 Räten, die vom König ernannt werden, und
den Ministern, berät in seinen den Ministerien entsprechenden
Sektionen Regierungsmaßregeln und entscheidet über
Kompetenzkonflikte zwischen Gerichts- und Verwaltungsbehörden.
Königliche Ministerien sind: das Ministerium des
Äußern (zugleich für die Angelegenheiten des
königlichen Hauses), das Ministerium der Gnaden und Justiz
(auch für den Kultus), das Kriegsministerium, das
Marineministerium, das Finanzministerium, das Ministerium des
Innern (ministerio de la gobernacion, auch für das Eisenbahn-,
Post- und Telegraphenwesen), das Ministerium für die
Volkswirtschaft (ministerio de fomento, für Landwirtschaft,
Bergbau, Industrie, Handel, Bauten und Unterrichtswesen) und das
Ministerium der Kolonien (ministerio de ultramar). Selbständig
ist der Rechnungshof. Zur Leitung der Provinzialverwaltung stehen
an der Spitze der 49 Provinzen für die gesamte innere und
Steuerverwaltung die Gouverneure, welchen die
Provinzialdeputationen und deren permanente Kommissionen beigegeben
sind. Ferner bestehen in jeder Provinz eine Sanitätsjunta und
eine Hauptpostverwaltung. Die Polizei wird in den Gemeinden von den
Alkalden, in größern Städten von besondern
Polizeikommissaren, unter Aufsicht des Gouverneurs, gehandhabt.
Für die Militärverwaltung sind 16 Generalkapitanate und
unter diesen Provinzialmilitärgubernien, für die Marine 3
Departements (Generalkapitanate) errichtet. Die Kolonialverwaltung
besteht für jede Kolonie aus einer Regierung mit dem
Generalkapitän, dem obersten Militärkommandanten und
einem Zivilgouverneur, welch letzterer unmittelbar vom König
dependiert. Der Volksvertretung ist keine Beteiligung dabei
eingeräumt.
Die Gerichtsverfassung beruht auf Öffentlichkeit und
Mündlichkeit des Verfahrens und Geschwornengerichten.
Römisches Recht und Landrecht bilden die Grundlage des
Rechtswesens; die in den baskischen Provinzen bisher geltenden
Sonderrechte (fueros) wurden 1876 aufgehoben. Die unterste Instanz
bilden die Alkalden der Gemeinden als Friedensrichter.
Außerdem bestehen noch 500 Untergerichtsbezirke (partidos)
mit je einem Gerichtshof erster Instanz. Diese sind verteilt unter
15 Ober- oder Appellations-
75
Spanien (Finanzen, Heer und Flotte, Wappen, Orden etc.).
gerichtshöfe (audiencias territoriales). Die oberste
Instanz bildet der höchste Gerichtshof zu Madrid. In
Preßprozessen erkennen Geschwornengerichte. Außer
diesen ordentlichen Gerichten bestehen noch: geistliche und
Militärgerichte, das Tribunal de hacienda publica in
Steuersachen, Handelsgerichte, Berggerichte sowie Gerichte für
das Post- und Straßenwesen. Das spanische
Zivilgerichtsverfahren ist jetzt auch in den Kolonien Cuba und
Puerto Rico eingeführt.
Finanzen.
Die Budgetvoranschläge für das Finanzjahr
1888/89 ergaben (in Pesetas):
A. Einnahmen.
Direkte Steuern 310 983 000
Indirekte Steuern 314 294 394
Zölle 172 993 000
Staatsmonopole 21 198 038
Nationalgüter 7 944 000
Staatsschatz 24 255 500
Zusammen 851 667 932
B. Ausgaben.
Zivilliste 9 350 000
Portes 1 940 205
Staatsschuld 279 099 611
Gerichtshöfe 1 361 276
Pensionen 50 593 826
Ministerpräsidium 1 148 959
Auswärtiges 5 300 620
Gnaden und Justiz 59 092 859
Krieg 154 720 262
Marine 26 683 627
Inneres 31 186 581
Öffentliche Arbeiten u. Unterricht 100 385 507
Finanzen 20 826 781
Verwaltung der Steuern 106 967 871
Zusammen: 848 657 985
Die Staatsschuld, welche in den 70er Jahren bereits einen Stand
von 12,000 Mill. Pesetas überschritten hatte, wurde seither
durch eine umfassende Konversion um mehr als die Hälfte
verringert; am 1. Jan. 1887 belief sie sich schon wieder auf ein
Kapital von 6334 Mill. Pesetas; die Jahreszinsen betrugen 238 Mill.
Pesetas.
Meer und Flotte.
Das Kriegswesen Spaniens ist nach der Beendigung des
Bürgerkriegs in den Jahren 1877 und 1878 neu organisiert
worden. Hiernach besteht in S. das System der allgemeinen
Wehrpflicht, jedoch mit Loskauf (für gebildete junge Leute vom
Dienst in der aktiven Armee) und Stellvertretung (unter
Brüdern). Die Militärpflicht beginnt mit dem 20.
Lebensjahr und dauert 12 Jahre (3 Jahre in der aktiven Armee, 3
Jahre in der Reserve derselben und 6 Jahre in der zweiten Reserve).
Die Ergänzung der Kriegsflotte erfolgt nach denselben
Prinzipien aus der seemännischen Bevölkerung. Die
Kolonialtruppen werden teils durch die Bewohner der
überseeischen Besitzungen, teils durch die Ausgehobenen im
Mutterland ergänzt. Die Truppen des Heers sind: a) Infanterie:
61 Linienregimenter zu 2 Bataillonen und 21 Jägerbataillone,
alle diese zu je 4 Feld- und 2 Depotkompanien, 140
Reservebataillone und 140 Depotbataillone zu 6 Kompanien (davon 2
in Kadrestärke), 31 Disziplinarbataillone; b) Kavallerie: 1
Eskadron königlicher Garden, 28 Regimenter (8 Ulanen-, 14
Jäger-, 4 Dragoner- und 2 Husarenregimenter) zu 4 Eskadrons,
28 Reserveregimenter; c) Artillerie: 5 Regimenter zu 4 Batterien
Korpsartillerie, 5 Regimenter zu 6 Batterien Divisionsartillerie, 1
reitende Batterie, 2 Gebirgsartillerieregimenter (zu 6
Bataillonen), 1 Regiment Belagerungsartillerie (mit 4 Batterien), 9
Bataillone Festungsartillerie, 7 Reserveregimenter; die Batterie
zählt im Frieden 4, im Krieg 6 Geschütze; d)
Ingenieurtruppen: 4 Regimenter Sappeure und Mineure (zu 2
Bataillonen), 4 Reserveregimenter, 1 Pontonierregiment, 1
Eisenbahn- und 1 Telegraphenbataillon; e) die Guardia civil
(Gendarmerie), die Karabiniere (Zoll- und Grenzwache) und die
Provinzialmiliz auf den Kanarischen Inseln - letztere mit 7
Bataillonen). Der Friedens- und Kriegsstand betragen:
im Frieden
Infanterie 83 808 Mann
Kavallerie 14 364 -
Artillerie 11 340 -
Ingenieurtruppen 4 279 -
Andre Formationen 2 422 -
Zusammen: 116 213 Mann
im Krieg
Infanterie 734 679 Mann
Kavallerie 21 452 -
Artillerie 30 355 -
Ingenieurtruppen 7 163 -
Andre Formationen 9 538 -
Zusammen: 803 187 Mann
Die Kavallerie verfügt im Frieden über 10,233, im
Krieg über 17,205 Pferde, die Artillerie zählt im Frieden
392, im Krieg 460 Geschütze. Hierzu kommen dann die Guardia
civil mit 15,302 und die Karabiniere mit 10,940 Mann sowie die
selbständigen Kolonialtruppen (39,924 Mann). Die Kriegsflotte
ist verhältnismäßig sehr bedeutend an Zahl der
Schiffe, doch entspricht nur der geringste Teil derselben den
modernen Anforderungen an gefechtstüchtige Schiffe. Es ist
deshalb der Plan einer Reorganisation der Flotte beschlossen und
der Bau einer Anzahl neuer Schlachtschiffe, Kreuzer, Kanonen- und
Torpedoboote teils in Angriff, teils in Aussicht genommen worden.
Ende 1886 umfaßte die Flotte:
4 Panzerschiffe 74 Kanonen 13 300 Pferdekr.
13 Torpedoboote 4 Kanonen 10 444 Pferdekr.
11 Kreuzer u. Korvetten 94 Kanonen 38 135 Pferdekr.
63 andre Dampfer 95 Kanonen 11 775 Pferdekr.
20 Schulschiffe u. Hulks 246 Kanonen 13 000 Pferdekr.
Zusammen:
111 Fahrzeuge 513 Kanonen 86 654 Pferdekr.
Die Bemannung beträgt 14,000 Köpfe; außerdem
bestehen 3 aktive und 3 nicht aktive Regimenter Marineinfanterie
(zu 2 Bataillonen), die aktiven mit 7033 Mann; hierzu kommen 400
Maschinisten, 180 Bootsleute, 1500 Arsenalarbeiter etc.
Wappen, Orden.
Das königliche Wappen (s. Tafel "Wappen") besteht aus einem
in vier Felder abgeteilten Schild mit einem Mittelschild, welcher
durch das Wappen des Hauses Bourbon-Anjou, drei goldene Lilien im
blauen Feld, gebildet wird. Das erste Quartier enthält die
Wappen von Kastilien (drei goldene Türme im roten Feld) und
Leon (ein gekrönter roter Löwe im silbernen Feld) und
zwar doppelt, indem es kreuzweise in Felder abgeteilt ist. Zwischen
seinen beiden untersten Feldern befindet sich das Wappen von
Granada, ein aufgesprungener Granatapfel im roten Felde. Das
zweite, der Quere nach gespaltene Quartier enthält die Wappen
von Aragonien (vier rote Pfähle im goldenen Feld) und des
Königreichs beider Sizilien. Das dritte, ebenfalls geteilte
Quartier zeigt oben das Wappen des Erzhauses Österreich, unten
das der alten Herzöge von Burgund, das vierte Quartier aber
das neuburgundische Wappen, unten das Wappen von Brabant. Der ganze
Wappenschild ist mit der Kette des Goldenen Vlieses umgeben und mit
der königlichen Krone bedeckt; als Schildhalter dienen zwei
aufrechte Löwen. Als gewöhnliches Wappen dient bloß
der Wappenschild von Kastilien und Leon mit dem Wappen von
Bourbon-Anjou im Mittelschild. Die Landesfarben sind Rot und Gelb.
Die Flagge (s. Tafel "Flaggen") ist in drei horizontale Streifen,
zwei rote und einen gelben (in der Mitte), geteilt, die
königliche mit dem Wappen im Mittelstreifen versehen. S. hat
zehn Ritterorden: den Orden des Goldenen Vlieses (toison de oro),
1431 gestiftet, in einer Klasse, nur für Souveräne,
Prinzen und Granden von S.; den Orden Karls III. (s. Tafel
"Orden"), 1773 gestiftet, in drei Klassen; den Damenorden der
Königin Maria Luise, 1792 gestiftet, in einer Klasse; den
amerikanischen Orden Isabellas der Katholischen, 1815 gestiftet, in
drei Klassen; den Militärorden von San Fernando, 1815 ge-
76
Spanien (geographisch-statistische Litteratur; Geschichte).
stiftet, in fünf Klassen; den Militärorden von St.
Hermenegild, gleichfalls 1815 gestiftet, in drei Klassen; den
Militärorden von Santiago, 1175 gestiftet, in vier Klassen;
den Militärorden von Calatrava, 1058 gestiftet, in einer
Klasse; den Militärorden von Alcantara, 1177 gestiftet, in
drei Klassen; den Orden von Montesa, 1319 gestiftet, in einer
Klasse. Außer diesen Orden bestehen noch mehrere Ehrenzeichen
für Militärs. Königliche Residenz ist Madrid. Den
Mai pflegt der Hof nach altem Herkommen in Aranjuez, den Sommer in
San Ildefonso (La Granja), den Herbst im Escorial und in Pardo
zuzubringen.
[Litteratur.] M. Willkomm in Stein-Hörschelmanns "Handbuch
der Geographie" (Leipz. 1862); Derselbe, Die Pyrenäische
Halbinsel (Prag 1884); Carrasco, Geografia general de España
(Madr. 1861 ff.); Coello, Reseña geografica de España
(das. 1859); Mingotey Tarazona, Geografia de España y sus
colonias (das. 1887); "Diccionario geografico-historico de
España por la Real Academia de la historia" (das. 1802-46, 8
Bde.); Madoz, Diccionario geografico-historico-estadistico de
España (das. 1846-50, 16 Bde.); Mariana y Sanz, Diccionario
geografico, estadistico, municipal de España (Valencia
1886); Martinez Alcubilla, Diccionario de la administracion
española (4. Aufl., Madr. 1886 ff.); Cuendias, S. und die
Spanier (Brüssel 1851); v. Minutoli, S. und seine
fortschreitende Entwickelung (Berl. 1852); Leftgarens, La situation
économique et industrielle de l'Espagne en 1860 (Par. 1860);
Garrido, Das heutige S. (deutsch von A. Ruge, Leipz. 1863);
Davillier, L'Espagne (Par. 1873, illustriert von Doré);
Simons, S. in Schilderungen (illustr. von Wagner, Berl. 1880);
Lauser, Aus Spaniens Gegenwart. Kulturskizzen (Leipz. 1872);
Parlow, Kultur und Gesellschaft im heutigen S. (das. 1888); die
Reiseschilderungen von v. Minutoli, Huber, Cook, O'Shea, Th.
Gautier, E. Qninet, Boissier, v. Rochau, Willkomm, v.Quandt,
Ziegler, Roßmäßler, Wachenhusen, Hackländer,
v. Wolzogen, W. Mohr (Köln 1876, 2 Bde.), Lauser (Berl. 1881),
de Amicis (deutsch, Stuttg. 1880), Bark (Berl. 1883), Passarge
(Leipz. 1884), Th. v. Bernhardi (Berl. 1886), Parlow (Wien 1889);
Reisehandbücher von Murray (6. Aufl., Lond. 1882), O'Shea (6.
Aufl., Edinb. 1878), Roswag (Madr. 1879), Germond de Lavigne (3.
Aufl. 1880); die amtlichen Publikationen ("Annuario estadistico de
España", die Handels- und Schiffahrtsausweise, "Guia oficial
de España"); das "Boletin de la Sociedad geografica de
Madrid"; Vizaino, Atlas geografico español (Madr. 1860);
eine topographische Karte wird auf Grund der Landesvermessung unter
Leitung von Ibanez seit 1878 veröffentlicht; bis zu ihrer
Vollendung dient Coello, Atlas de España (1 : 200,000), als
offizielle Karte; geologische Übersichtskarten lieferte F. de
Botella (1:1,000,000, 1875, und 1:2,000,000, 1880).
Geschichte.
[Die Zeit der Römer und Westgoten.]
Die Ureinwohner der Pyrenäischen Halbinsel waren die
Iberer, von denen die ganze Halbinsel Iberien hieß. Mit ihnen
verschmolzen die in vorhistorischer Zeit über die
Pyrenäen aus Gallien eingewanderten Kelten nach langen
Kämpfen zu dem Volk der Keltiberer. Um 1100 v. Chr. siedelten
sich Phöniker an der Südküste an; unter ihren
Kolonien war Cadiz (Gades) die berühmteste. Sie nannten das
Land nach dem im Thal des Bätis (Guadalquivir) wohnenden Volk
der Turdetaner Tarschisch (griech. Tartessos). Später setzten
sich Griechen an der Ostküste fest. Nach dem ersten Punischen
Krieg eroberten die Karthager 237-219 den Süden und Osten der
Halbinsel; Neukarthago (Cartagena) wurde ihre wichtigste
Niederlassung. In dem zweiten Punischen Krieg aber, der zum Teil in
S. geführt wurde, verloren sie diese Besitzungen wieder (206).
Die Römer suchten nun das ganze Land unter ihre
Botmäßigkeit zu bringen, was ihnen jedoch erst nach 200
jährigen blutigen Kämpfen gelang. Namentlich die
Keltiberer und die Lusitanier (unter Viriathus) leisteten
hartnäckigen Widerstand, und die Kantabrer wurden erst 19 v.
Chr. unter Augustus bezwungen, der S. anstatt wie bisher in zwei
Provinzen (Hispania citerior und H. ulterior) in drei, Lusitania,
Baetica und Tarraconensis, einteilte, von welch letztern
größten Provinz unter Hadrianus die neue Provinz
Gallaecia et Asturia abgezweigt wurde. Nur die Basken behaupteten
in ihren Gebirgen ihre Unabhängigkeit. Da die Römer das
Land mit vielen Militärstraßen durchzogen und zahlreiche
Soldatenkolonien anlegten, so wurde S. sehr rasch romanisiert, bald
ein Hauptsitz römischer Kultur und eins der blühendsten
Länder des römischen Weltreichs, dem es mehrere seiner
tüchtigsten Kaiser (Trajan, Hadrianus, Antoninus, Marcus
Aurelius, Theodosius) u. angesehene Schriftsteller (Seneca,
Lucanus, Martialis, Flavius, Quintilian u. a.) gab. Handel und
Verkehr blühten, Gewerbe und Ackerbau standen auf einer hohen
Stufe der Vervollkommnung, und die Bevölkerung war eine
äußerst zahlreiche. Frühzeitig gewann auch das
Christentum hier Anklang und breitete sich trotz blutiger
Verfolgungen mehr und mehr aus, bis es durch Konstantin auch hier
herrschende Religion ward.
Zu Anfang des 5. Jahrh., als der innere Verfall des
römischen Reichs auch seine äußere Macht
erschütterte, drangen die germanischen Völkerschaften der
Alanen, Vandalen und Sueven verwüstend in S. ein und setzten
sich in Lusitanien, Andalusien und Galicien fest, während die
Römer sich noch eine Zeitlang im östlichen Teil der
Halbinsel behaupteten. 415 erschienen die Westgoten (s. Goten, S.
537), anfangs als Bundesgenossen der Römer, in S. und
verdrängten bald die andern germanischen Stämme; ihr
König Eurich entriß den Römern auch den letzten
Rest ihres Gebiets, und Leovigild unterwarf nach gänzlicher
Unterjochung der Sueven 582 die ganze Halbinsel der westgotischen
Herrschaft. Sein Sohn und Nachfolger Reccared I. trat mit seinem
Volk vom arianischen zum katholischen Glauben über (586) und
bahnte dadurch die Verschmelzung der Goten mit den Römern zu
einem romanischen Volk an. Allerdings hatte dieser Schritt noch die
andre Folge, daß die katholische Geistlichkeit
übermäßige Macht erlangte und im Bund mit dem Adel
die sich schon befestigende Erblichkeit der Krone verhinderte, um
bei der Wahl jedes neuen Oberhauptes die königliche Gewalt
möglichst einzuschränken. Als 710 König Witiza von
dem Klerus und dem Adel unter Führung des Grafen Roderich
gestürzt und getötet wurde, riefen seine Söhne die
Araber von Afrika zu Hilfe, welche 711 unter Tarik bei Gibraltar
landeten und dem westgotischen Reich nach fast 300jähriger
Dauer durch den Sieg bei Jeres de la Frontera (19.-25. Juli d. J.)
ein Ende machten. Fast ganz S. wurde in kurzer Zeit von den Arabern
erobert und ein Teil des großen Kalifats der Omejjaden.
Herrschaft der Araber.
Die Araber (Mauren) verfuhren in der ersten Zeit sehr schonend
gegen die alten Einwohner und ließen
77
Spanien (Geschichte bis 1118).
ihr Eigentum, ihre Sprache und Religion unangetastet. Ihre
Herrschaft erleichterte den untern Klassen sowie den zahlreichen
Juden ihre Lage, und der Übertritt zum Islam verschaffte den
hart bedrückten Leibeignen die ersehnte Freiheit. Aber auch
viele Freie und Angesehene traten zum Islam über; denen, die
Christen blieben, wurden bloß Steuern auferlegt. Den
aufreibenden Zwistigkeiten und blutigen Fehden, welche Ehrgeiz und
Herrschsucht der arabischen Häuptlinge in dieser entfernten
Provinz des Kalifats hervorriefen, machte 755 der bei der
Vernichtung durch die Abbassiden einzig übriggebliebene
Sproß der Omejjaden, Abd ur Rahmân, ein Ende, welcher
nach S. flüchtete und hier, vom Volk mit Jubel
begrüßt, ein eignes Reich mit der Hauptstadt Cordova,
das sogen. Kalifat von Cordova, gründete, welches er auch bis
zu seinem Tod (788) behauptete und auf seine Nachkommen vererbte.
Obwohl diese ebenfalls wiederholte Empörungen der Statthalter
und andre durch Thronansprüche und Abgabendruck hervorgerufene
Unruhen zu bekämpfen hatten, so konnten sie doch Künste
und Wissenschaften pflegen und die friedliche Entwickelung von
Gewerbe, Handel und Ackerbau schützen. Wohlstand und Bildung
mehrten sich, und Cordova ward ein glänzender Herrschersitz.
Unter Abd ur Rahmân III. (912-961) erreichten arabische Kunst
und Wissenschaft in S. ihre höchste Blüte. Volkreiche
Städte schmückten das Land; das Gebiet des Guadalquivir
soll allein 12,000 bewohnte Orte gezählt haben. Cordova hatte
113,000 Häuser, 600 Moscheen, darunter die prachtvolle
Hauptmoschee, und herrliche Paläste, darunter den Alkazar; mit
Cordova wetteiferten andre Städte, wie Granada mit der
Alhambra, Sevilla, Toledo u. a. In gleichem Sinn wie Abd ur
Rahmân III. regierte sein als Dichter und Gelehrter
ausgezeichneter Sohn Hakem II. (961-976), wogegen unter dem
schwachen Hischam II. (976-1013) das Kalifat zu sinken begann. Es
gelang den Arabern nicht, mit den altspanischen Einwohnern sich zu
verschmelzen und ein Staatswesen mit feststehenden gesetzlichen
Ordnungen zu begründen. Despotismus und Anarchie wechselten
miteinander ab: bald zerriß der ganze Reichsverband, wenn die
Statthalter und hohen Befehlshaber den Gehorsam verweigerten; bald
lag das Land blutend und demütig zu Füßen des
Herrschers, wenn diesem die Unterdrückung der Empörer
mittels fremder Söldnerscharen gelungen war. Das Volk verfiel
in Genußsucht und Verweichlichung und ließ willenlos
alles über sich ergehen. Der berühmteste unter den
kriegerischen Statthaltern Hischams II. war Mansur, der ebenso
kunstsinnig und klug wie tapfer und gewaltthätig den Staat mit
unumschränkter Macht leitete, Santiago, den heiligen
Apostelsitz Galiciens, zerstörte (994) und die Christen in
vielen blutigen Fehden überwand, bis er endlich an den Wunden,
die er in der heißen Schlacht am Adlerschloß (Kalat
Nosur) unweit der Quellen des Duero in kühnem Handgemenge
empfangen, in den Armen seines Sohns Abd al Malik Modhaffer starb
(1002). Nach dem Tode dieses (1008), der mit gleicher Kraft wie
sein Vater regierte, machten die Statthalter ihr Amt erblich und
gründeten sich unabhängige Herrschaften; um den Thron
wurde mit wilder Erbitterung gekämpft, und der letzte
omejjadische Kalif, Hischam III., wurde 1031 durch einen Aufstand
in Cordova gestürzt. Diesen Zustand benutzend, griffen die
christlichen Spanier die Araber immer erfolgreicher an und
drängten sie allmählich in den südlichen Teil der
Halbinsel zurück.
Das Emporkommen christlicher Königreiche.
Nur in den nördlichen Gebirgen, in Asturien, hatten Scharen
flüchtiger Westgoten ihre Unabhängigkeit behauptet und
sich unter der Herrschaft des tapfern Pelayo (Pelagius) vereinigt,
der, ein Nachkomme des westgotischen Königs Receswinth, 718
(oder 734) ein arabisches Heer besiegt haben und darauf zum
König ausgerufen worden sein soll; er wird deshalb el
restaurador de la libertad de los Españoles genannt. Sein
durch Wahl erhobener zweiter Nachfolger, Alfons I. (739-757), auch
ein Abkömmling jenes Westgotenkönigs und Sohn des Herzogs
Peter von Kantabrien, vereinigte dieses Land mit Asturien. Alfons
II. (791-842) drang auf seinen verheerenden Streifzügen gegen
die Araber bis zum Tajo vor und eroberte das Baskenland im Osten,
Galicien bis zum Minho im Westen. Gleichzeitig wurde im Nordosten
Spaniens von den Franken die Spanische Mark gegründet und die
Herrschaft des Christentums in Katalonien durch zahlreiche
Einwanderer gesichert. In den fast ununterbrochenen Kämpfen
mit den Ungläubigen bildete sich ein christlicher Lehnsadel,
welcher durch ritterliche Tapferkeit zugleich Ruhm, weltlichen
Besitz und das ewige Seelenheil zu erlangen strebte. So bildeten
sich nördlich vom Duero und Ebro allmählich vier
christliche Ländergruppen, welche sich durch feste
Institutionen, Reichstage, Gesetzsammlungen und den Ständen
zugesicherte Rechte (Fueros) zu konsolidieren bemüht waren: 1)
im Nordwesten Asturien, Leon und Galicien, welche nach
vorübergehenden Teilungen im 10. Jahrh. unter Ordoño
II. und Ramiro II. zu dem Königreich Leon vereinigt wurden,
das 1057 nach kurzer Unterwerfung unter Navarra von Sancho Mayors
Sohn Ferdinand mit den neuen Eroberungen im Süden als
Königreich Kastilien verbunden wurde; 2) das Baskenland,
welches mit benachbartem Gebiet von Sancho Garcias zum
Königreich Navarra erhoben wurde, unter Sancho Mayor (1031-35)
das ganze christliche Gebiet Spaniens beherrschte, 1076-1134 mit
Aragonien vereinigt, seitdem aber wieder selbständig war; 3)
das Gebiet am linken Ebro, Aragonien, seit 1035 selbständiges
Königreich; 4) die aus der Spanischen Mark entstandene
erbliche Markgrafschaft Barcelona oder Katalonien.
Trotz dieser Zersplitterung zeigten sich die christlichen Reiche
den Arabern gewachsen. Als nach dem Untergang der Dynastie der
Omejjaden (1031) das Araberreich in mehrere Teile unter besondere
Dynastien in Sevilla, Toledo, Valencia und Saragossa zerfallen war,
gerieten 1085 Toledo, das Haupt von S., dann Talavera, Madrid und
andre Städte in die Gewalt der Christen. Die vom Emir von
Sevilla zu Hilfe gerufenen Almorawiden aus Afrika befestigten zwar
den Islam durch ihre Siege bei Salaca (1086) und bei Ucles (1108)
und rissen die Herrschaft über das arabische S. an sich; aber
der Glaubenseifer und Kampfesmut der Christen erhielt durch die
gleichzeitige Bewegung der Kreuzzüge ebenfalls einen neuen
Aufschwung. Alfons I. von Aragonien, der durch seine
Vermählung mit Urraca, der Erbtochter von Kastilien,
zeitweilig (bis 1127) dies Reich mit Aragonien vereinigte und sich
Kaiser von Hispanien nannte, eroberte 1118 Saragossa und machte es
zu seiner Hauptstadt. Auch nach der Trennung von Kastilien und
Aragonien blieben beide Reiche zum Kampf gegen die Ungläubigen
verbunden, und letzteres Reich ward durch die Vereinigung mit
Katalonien infolge der Heirat der aragonischen
78
Spanien (Geschichte bis 1479).
Erbtochter Petronella mit Raimund Berengar II. von Barcelona
1137 bedeutend vergrößert und gekräftigt. Nun
erlangten die Christen bald völlig die Oberhand über die
Araber. Als die Herrschaft der Almorawiden in Afrika 1147 von den
Almohaden gestürzt wurde, riefen jene, um sich in S. zu
behaupten, die Christen zu Hilfe, welche sich Almerias und Tortosas
bemächtigten. Gegen die Almohaden, welche auch das
südliche S. unter ihre Gewalt brachten, bewährten
besonders die spanischen Ritterorden ihre glaubensmutige Tapferkeit
und machten die Niederlage bei Alarcos (1195) durch den
glänzenden Sieg bei Naves de Tolosa (16. Juli 1212) wieder
gut, welcher den Sturz der Almohadenherrschaft zur Folge hatte. In
Andalusien gründete Aben Hud (Motawakkel) eine Dynastie,
welche sich unter den Schutz der Abbassiden von Bagdad stellte; in
Valencia regierte eine andre arabische Dynastie. Durch die Schlacht
bei Merida (1230) wurde Estremadura den Arabern entrissen; nach dem
Sieg bei Jeres de la Guadiana (1233) eroberte Ferdinand III. von
Kastilien 1236 Cordova, 1248 Sevilla und 1250 Cadiz. Die Moslemin
wanderten zu Tausenden nach Afrika oder nach Granada und Murcia
aus, aber auch diese Reiche mußten die Oberherrschaft
Kastiliens anerkennen. Die unter kastilischer Herrschaft
zurückgebliebenen Mohammedaner nahmen mehr und mehr die
Religion und die Lebensformen der Sieger an, und zahlreiche
vornehme Araber traten nach empfangener Taufe in den spanischen
Adel ein.
Kastilien und Aragonien.
Wie sehr durch die Siege Ferdinands III. die Macht Kastiliens
(s. d.) gestiegen war, so blieb es doch auch nicht von innern
Wirren verschont, welche namentlich unter dem Beschützer der
Künste und Wissenschaften, König Alfons X., dem Weisen
(1252-84), das Reich zerrütteten und die Macht des Adels
vermehrten. Auch unter Sancho IV. (1284-95), Ferdinand IV.
(1295-1312) und Alfons XI. (1312-50) dauerten die Zwistigkeiten in
der Königsfamilie fort. Ordnung und Zucht lösten sich
auf, das königliche Ansehen schwand, die Krongüter wurden
entfremdet, Gemeinden, Korporationen und mächtige Edelleute
griffen zur Selbsthilfe und befreiten sich von jeder Obrigkeit.
Dennoch errangen die Kastilier über die Araber große
Erfolge; sie erfochten 1340 den glänzenden Sieg bei Salado und
schnitten durch Eroberung von Algeziras Granada von der Verbindung
mit Afrika ab, so daß dessen Fall nur eine Frage der Zeit
war. Auch das Reich Aragonien (s. d.) nahm einen mächtigen
Aufschwung. Jakob I. (Jaime), der von 1213 bis 1276 regierte,
unterwarf 1229-33 die Balearen, 1238 Valencia und drang erobernd in
Murcia ein; sein Sohn Pedro III. (1276-85) entriß 1282 den
Anjous die Insel Sizilien; Jakob II. (1291-1327) eroberte Sardinien
und setzte 1319 auf dem Reichstag zu Tarragona die Unteilbarkeit
seines Reichs fest. Freilich mußten die aragonischen
Könige diese Eroberungen mit großen Zugeständnissen
an die Stände (Cortes) erkaufen, besonders durch das
Generalprivilegium von Saragossa (1283), welches Aragonien fast in
eine Republik verwandelte. In beiden Reichen war unter den
Ständen der Klerus der mächtigste: jeder Sieg über
die Ungläubigen vermehrte seine Rechte und seinen Reichtum,
durch prunkvollen Kultus und phantastische Mystik bemächtigte
er sich des Volksgeistes und pflanzte ihm einen
verfolgungssüchtigen Religionsfanatismus ein. Der hohe Adel
maßte sich das Recht an, dem König die Treue aufzusagen;
nicht bloß er, auch die niedern Adligen waren steuerfrei.
Aber auch Städte und Landgemeinden erhielten ihre verbrieften
Sonderrechte (Fueros). In Aragonien waren die Rechte der
Unterthanen dem König gegenüber durch den Gerichtshof der
Justicia geschützt. Die Stände traten in beiden Reichen
zu Reichstagen (Cortes) zusammen, welche über Wohlfahrt und
Sicherheit des Reichs, Gesetzgebung und Besteuerung berieten.
Handel und Gewerbe standen in den volkreichen Städten unter
dem Schutz weiser Gesetze; an den Höfen wurde die Dichtkunst
der Troubadoure gepflegt.
Am besten wurden die Dinge in Aragonien geordnet, von Pedro IV.
(1336-87) nach dem Sieg über die Union von Epila (1348) auch
das Waffenrecht des Adels beseitigt, und daher kam es, daß in
diesem Reich nach dem Erlöschen der alten Dynastie mit Martin
(1395-1410) die kastilische Dynastie, welche mit Ferdinand I.
(1412-16) den Thron bestieg, die Herrschaft auch über die
Nebenlande: Balearen, Sardinien und Sizilien, behauptete und auf
kurze Zeit auch Navarra wieder erwarb. In Kastilien dagegen waren
der hohe Adel und die Ritterorden von Santiago, Calatrava und
Alcantara übermächtig. Mit Hilfe der Städte, welche
eine Verkaufs- und Verbrauchssteuer, die Alcavala, bewilligten,
suchte sich das Königtum eine freiere, unabhängigere
Stellung gegenüber der Feudalaristokratie zu verschaffen. Aber
Peter der Grausame (1350-69) machte den Erfolg dieser
Bemühungen durch seine wilde Leidenschaft und grausame
Tyrannei wieder zu nichte. Er wurde 1366 von seinem Halbbruder
Heinrich von Trastamara mit Hilfe französischer
Söldnerscharen vertrieben und, nachdem ihn der schwarze Prinz
durch einen Zug über die Pyrenäen wieder auf den Thron
erhoben, durch die Niederlage bei Montiel (14. März 1369) von
neuem gestürzt und kurz darauf ermordet. Heinrich II.
(1369-79), welcher Viscaya erwarb, und Johann I. (1379-90)
schwächten das Königtum durch unglückliche Versuche,
Portugal zu erobern, welches 1385 in der Schlacht bei Aljubarrota
seine Unabhängigkeit siegreich verteidigte. Heinrich III.
(1390-1406) stellte die Ordnung wieder her und nahm die Kanarischen
Inseln in Besitz. Von neuem wurde jedoch Kastilien zerrüttet
unter der langen, aber schwachen Regierung Johanns II. (1406-54);
das Unternehmen seines Günstlings de Luna, ein absolutes
Königtum zu errichten, endete mit dessen Sturz (1453). Der
steigenden Verwirrung unter Heinrich IV. (1454-74) wurde endlich
durch die Thronbesteigung seiner Schwester Isabella ein Ende
gemacht. Dieselbe besiegte den König Alfons von Portugal, der
als Gemahl der unechten Tochter Heinrichs IV., Johanna Beltraneja,
auf Kastilien Anspruch machte, 1476 bei Toro und zwang ihn zum
Frieden von Alcantara; darauf unterjochte sie die ihr feindliche
Partei der Großen mit Waffengewalt. Und als König
Ferdinand von Sizilien, mit dem sie sich 1469 vermählt hatte,
durch den Tod seines Vaters Johann II. von Aragonien 1479
König dieses Reichs geworden war, wurde durch Vereinigung der
kastilischen und der aragonischen Krone das Königreich S.
geschaffen.
Spanien als Weltmacht.
Die Thronbesteigung des Königspaars Ferdinand und Isabella
bewirkte aber nicht nur die Vereinigung der zwei Hauptreiche der
Halbinsel, sondern auch ihre staatliche Reorganisation und die
Begründung einer machtvollen Königsgewalt in derselben.
Vor allem in Kastilien war der unbotmäßige Adel ein
Haupthindernis für Aufrechterhaltung von
79
Spanien (Geschichte bis 1570).
Recht und Frieden. Um diese zu sichern, wurde die "heilige
Hermandad", alte Verbrüderungen einzelner Städte zu
gegenseitigem Schutz gegen Gewaltthaten, wieder belebt und zu einem
Verein (Junta) der Städte und Landschaften zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
umgeschaffen, welcher 2000 berittene Gendarmen und zahlreiches
Fußvolk zur Verfügung hatte, um die 1485 erlassene
Gerichtsordnung durchzuführen. Die Großen wurden
gezwungen, die geraubten Güter herauszugeben und den Fehden zu
entsagen. Der Adel mußte sich den königlichen
Gerichtshöfen beugen und auf alle königlichen Vorrechte,
auch auf die hohen Staatsämter, welche jetzt nur nach
Verdienst verliehen wurden, verzichten. Indem Ferdinand sich zum
Großmeister der drei Ritterorden erwählen ließ,
machte er sie zu Werkzeugen der Krone; die hohe Geistlichkeit wurde
der königlichen Jurisdiktion unterworfen. Die Verwaltung wurde
vorzüglich organisiert, die königlichen Einkünfte
vermehrt, Künste und Wissenschaften gepflegt. Die Inquisition,
welche in dem fanatischen Glaubenseifer des Volkes eine
Hauptstütze fand, wütete nicht nur gegen Juden, Morisken
und ketzerische Christen, sondern war auch ein Schreckmittel in der
Hand der Krone, um Adel und Volk in Furcht und Unterwürfigkeit
zu halten und jede freiheitliche Bewegung zu unterdrücken. Die
zahlreichen Juden (160,000) wurden 1492 aus dem Reich vertrieben
und die alleinige Herrschaft des Kreuzes auf der Iberischen
Halbinsel durch die Eroberung von Granada (2. Jan. 1492) vollendet.
Die gleichzeitige Entdeckung Amerikas eröffnete der spanischen
Nation ein unermeßliches Feld ruhmvoller zivilisatorischer
Thätigkeit und die Aussicht auf einen glänzenden
Aufschwung des Handels und Gewerbes. Die militärische
Tüchtigkeit der spanischen Heere bewährte sich zuerst in
den Kämpfen um Italien, wo 1504 Neapel unter spanische
Herrschaft gebracht wurde.
Erbin Ferdinands und Isabellas wurde die älteste Tochter,
Johanna, welche mit ihrem Gemahl Philipp I., dem Sohn des deutschen
Kaisers Maximilian I., nach Isabellas Tod (1504) zunächst in
Kastilien zur Regierung kam; mit Philipp bestieg das Haus Habsburg
den spanischen Thron. Als Philipp 1506 jung starb und Johanna
wahnsinnig wurde, ward zum Vormund ihres Sohns Karl von den
kastilischen Ständen Ferdinand erklärt, welcher 1509 Oran
eroberte und 1512 Navarra mit seinem Reich vereinigte. Nach
Ferdinands Tod (1516) übernahm Kardinal Jimenez die
Regentschaft bis zur Ankunft des jungen Königs Karl I.,
welcher 1517 selbst die Regierung antrat und den verdienten
Staatsmann sofort entließ. Da Karl 1519 auch zum deutschen
Kaiser (Karl V.) gewählt wurde und deshalb schon 1520 Spanien
wieder verließ, brach der Aufstand der Comuneros aus, welcher
sich die Verteidigung der volkstümlichen Institutionen
Spaniens gegen die absolutistischen Gelüste Karls und seiner
niederländischen Räte zum Ziel setzte. Als die Comuneros
aber einen durchaus demokratischen Charakter annahmen und, seitdem
sie siegreich um sich griffen, eine völlige Umwälzung der
Dinge anstrebten, wurden sie durch den Sieg des Adelsheers bei
Villalar (21. April 1521) und durch die Hinrichtung ihres
Führers Padilla unterdrückt. Karl V. erließ zwar
nach seiner Rückkehr (Juli 1522) eine allgemeine Amnestie,
benutzte aber den durch die Bewegung erregten Schrecken des Adels
und der Städte, um, ohne die Formen und Institute der alten
Volksfreiheit geradezu zu beseitigen, doch sie so eng zu begrenzen,
daß die Cortes zu einem Widerstand gegen den Willen der Krone
unfähig wurden, der Adel in einer übertriebenen
Loyalität seine erste Pflicht sah und auch das Volk dem
Königtum und seinen Weltherrschaftsplänen bereitwillig
folgte. Ohne Zögern bewilligten fortan die Cortes die Gelder
für die Kriege Karls V. gegen Frankreich, für die
Unternehmungen gegen die seeräuberischen Mauren in Afrika,
für die Unterdrückung des Schmalkaldischen Bundes in
Deutschland. Für die Begründung einer habsburgischen
Weltmacht und die Ausbreitung des römisch-katholischen
Glaubens kämpften die spanischen Heere am Po, an der Elbe, in
Mexiko und Peru. Dem Stolz der Spanier schmeichelte es, die
gebietende Macht in Europa zu sein, ihrem Glaubenseifer, für
die Ausrottung der Ketzerei, wie früher des Islam, zu
streiten. Erfüllt von dem Ideal eines Siegs des wahren
Glaubens durch Spaniens Macht, ließ das Volk die Wurzeln
seiner Kraft verdorren. Mit Beifall sah es zu, wie die
unglücklichen Morisken bedrückt und außer Landes
getrieben, Tausende von Landsleuten von der Inquisition auf den
Scheiterhaufen geschleppt, jede freie geistige Regung
unterdrückt, jeder Widerstand gegen die unbeschränkte
Königsgewalt niedergeschlagen ward, wie Gewerbe, Handel und
Ackerbau durch ein willkürliches Steuersystem zu Grunde
gerichtet wurden, um die Kriegskosten aufzubringen. Nicht
bloß der Adel, auch Bürger und Bauern drängten sich
zum Kriegsdienst; wer nicht in den Krieg zog, suchte in einem
Staatsamt, wie gering es auch war, ein bequemes Brot; der
bürgerliche und bäuerliche Erwerb wurde verachtet. Die
Kirche bestärkte das Volk in dieser Sinnesrichtung und beutete
sie zu ihrer Bereicherung aus; immer mehr Grund und Boden fiel an
die Tote Hand und ward Weideland oder blieb öde und unbebaut,
wogegen die Kirchen und Klöster den Bettelstolz durch ihre
Almosen nährten. Der Handel ging an die Fremden über,
welche S. und seine Kolonien für sich ausbeuteten.
Als Karl V. 1556 die Regierung niederlegte, wurden die
österreichischen Besitzungen des Hauses Habsburg und die
Kaiserkrone von S. wieder getrennt, das in Europa nur die
Niederlande, die Franche-Comté, Mailand, Neapel, Sizilien
und Sardinien behielt. Indes das Ziel der spanischen Politik blieb
dasselbe und wurde mit noch mehr Fanatismus und mit noch
rücksichtsloserer Vergeudung der Volkskraft verfolgt. S. wurde
der Mittelpunkt einer mit großartigen Machtmitteln ins Werk
gesetzten katholischen Reaktionspolitik, welche den Sieg des
römischen Papismus zugleich über Türken und Ketzer
erstreiten wollte. Zu diesem Zweck unterdrückte Philipp II.
(1556-98) den Rest der politischen Freiheiten und unterwarf alle
Stände einem unumschränkten Despotismus. Durch das
furchtbare Werkzeug der Inquisition wurde jeder
Unabhängigkeitssinn erstickt. Die drückenden
Maßregeln gegen die Morisken reizten diese 1568 zu einem
gefährlichen Aufstand, der erst 1570 nach den blutigsten
Kämpfen erstickt wurde. 400,000 Morisken wurden aus Granada
nach andern Teilen des Reichs verpflanzt, wo sie zu Grunde gingen.
Die unaufhörlichen Kriege zehrten nicht nur die reichen
Einkünfte der Kolonien auf, sondern zwangen den König,
auf immer neue Mittel zu sinnen, seine Einnahmen zu vermehren;
jedes Eigentum (außer dem der Kirche) und jedes Gewerbe wurde
mit den drückendsten Steuern belegt, Schulden aller Art
aufgenommen, aber nicht bezahlt, die Münze verschlechtert,
Ehren und Ämter verkäuflich gemacht, schließlich
sogen. Donativen, Zwangsanleihen, den
80
Spanien (Geschichte bis 1746).
Einwohnern abgefordert. Dabei hatte die spanische
Reaktionspolitik nicht einmal Erfolge aufzuweisen. Wohl bedeckten
sich die spanischen Regimenter auf allen Schlachtfeldern mit Ruhm
durch ihre Kriegskunst und Tapferkeit, aber sie verfielen auch in
eine schreckliche moralische Verwilderung. Zwar siegte Juan
d'Austria 1571 bei Lepanto über die türkische Seemacht;
aber der Sieg wurde nicht benutzt, sogar Tunis ging wieder
verloren. Albas Schreckensregiment in den Niederlanden rief deren
Verzweiflungskampf hervor, welcher ungeheure Summen verschlang und
Spaniens See- und Kolonialmacht einen tödlichen Schlag
versetzte. Der Versuch, England der katholischen Kirche wieder zu
unterwerfen, scheiterte 1588 mit dem Untergang der großen
Armada. Die Einmischung in die Religionswirren Frankreichs hatte
nur die Einigung und Kräftigung dieses Staats zur Folge. Die
widerrechtliche Besetzung Portugals 1580 schädigte dies Land
außerordentlich, brachte aber S. keinen Nutzen. Als Philipp
II. 1598 starb, war die Bevölkerung auf 8¼ Mill.
zurückgegangen, die eine Steuerlast von 280 Mill. Realen
aufzubringen hatten. Dagegen hatte das Land 750 Bistümer,
gegen 12,000 Klöster und 400,000 Geistliche, ferner 450,000
Beamte; außer diesen und dem verarmten Adel gab es fast nur
noch Bettler, welche sich von den Almosen der Kirche nährten.
Gleichwohl täuschte die glänzende Machtstellung, welche
S. in Europa an der Spitze der katholischen Gegenreformation
einnahm, die Regierung wie das Volk gänzlich über die
wirkliche Lage. Von dem unerschütterten Selbstgefühl und
der Begeisterung der Nation für ein ideales Ziel, die Macht
und Einheit der Kirche, zeugt der außerordentliche
Aufschwung, welchen am Anfang des 17. Jahrh. Dichtkunst, Malerei
und Baukunst in S. nahmen.
Verfall des Reichs unter den letzten Habsburgern.
Unter der Regierung des schwachen Königs Philipp III.
(1598-1621), welcher sich ganz von seinem Günstling Lerma
beherrschen ließ, wurden zwar die auswärtigen Kriege
ohne Thatkraft geführt, 1609 sogar mit den Niederlanden ein
Waffenstillstand geschlossen; aber durch das Gnadenedikt vom 22.
Sept. 1609 wurden 800,000 Morisken vertrieben, und das fruchtbare
Valencia verödete völlig. Philipp IV. (1621-65), welcher
einen prächtigen Hof hielt und die Kunst pflegte und
unterstützte, nahm die kriegerische Politik Philipps II.
wieder auf. Im Bund mit Österreich wollte er die
Alleinherrschaft des Papsttums wiederherstellen und ein
habsburgisches Weltreich errichten. Der Krieg mit den freien
Niederlanden begann von neuem. Im Dreißigjährigen Krieg
kämpften wieder spanische Truppen in Deutschland und Italien,
und der spanische Gesandte in Wien hatte in deutschen
Angelegenheiten die entscheidende Stimme. Aber auf einmal brach das
glänzende Gebäude schmählich zusammen, und es ergab
sich, daß die Weltmacht Spaniens nur trügerischer Schein
gewesen. Die offene Verletzung der provinzialen Sonderrechte durch
den allmächtigen Minister Olivarez rief 1640 einen Aufstand in
Katalonien hervor, dem der Abfall Portugals und Empörungen in
andern Provinzen folgten. Portugal konnte gar nicht, Katalonien
erst nach 13jährigem Kampf bezwungen werden. Das hierdurch
tief getroffene S. war nun dem mächtig emporstrebenden
Frankreich nicht mehr gewachsen. Nach 80jährigem Kampf
mußte es 1648 im Frieden zu Münster die
Unabhängigkeit der Vereinigten Niederlande und in Deutschland
die Gleichberechtigung der Ketzer anerkennen. Im Pyrenäischen
Frieden 1659 verlor es Roussillon und Perpignan sowie einen Teil
der Niederlande an Frankreich, Dünkirchen und Jamaica an
England. Als nach dem Tod Philipps IV. der schwächliche Karl
II. (1665-1700) den Thron bestieg, erhob der französische
König Ludwig XIV. als Gemahl von Philipps Tochter Maria
Theresia Erbansprüche auf die spanischen Niederlande und wurde
im sogen. Devolutionskrieg nur durch das Eingreifen der
Tripelallianz daran verhindert, sich derselben ganz zu
bemächtigen; im Frieden von Aachen 1668 erhielt er zwölf
niederländische Festungen, im Frieden von Nimwegen wiederum
eine Anzahl fester Plätze und die Franche-Comté; mitten
im Frieden bemächtigte er sich 1684 Luxemburgs. S., welches
einst ganz Europa mit seinen Heeren beherrscht hatte, über die
Schätze beider Indien gebot, konnte jetzt seine Grenzen nicht
mehr verteidigen und war auf den Beistand der früher so
erbittert bekämpften Ketzer angewiesen. Die Seemacht war
völlig zu Grunde gegangen, so daß S. seinen eignen
Handel nicht zu beschützen vermochte, die Häfen
verödeten, die Bevölkerung sich von den schutzlosen
Küsten ins Innere zurückzog, Westindien ungestraft von
den Flibustiern geplündert und gebrandschatzt wurde. Am Ende
der Regierung Karls II. war die Bevölkerung auf 5,700,000
Seelen herabgesunken, von zahllosen Ortschaften war die
Bevölkerung verschwunden, ganze Landstriche glichen
Wüsten. Die Staatseinkünfte verminderten sich trotz des
härtesten Steuerdrucks und fast räuberischer
Finanzmaßregeln so, daß der König seine
Dienerschaft nicht mehr bezahlen konnte, oft nicht einmal seine
Tafel. Weder Beamte noch Soldaten wurden besoldet. Aus Geldmangel
kehrte man in vielen Provinzen zum Tauschhandel zurück. Dies
war die Lage Spaniens, als die spanischen Habsburger nach
200jähriger Herrschaft 3. Nov. 1700 mit Karl II. erloschen,
dies das Resultat ihrer selbstmörderischen
katholisch-absolutistischen Politik.
Spanien unter den Bourbonen bis zur französischen
Revolution.
Durch den Streit, der zwischen Österreich und Frankreich
über die Thronfolge in S. entstand, ward S. in einen
verderblichen Krieg verwickelt (s. Spanischer Erbfolgekrieg). Es
verlor in demselben zwar seine europäischen Nebenlande und
Gibraltar, jedoch der Sieg des bourbonischen Prätendenten
über den habsburgischen in S. selbst war für das Land ein
Gewinn, weil er die Möglichkeit einer Regeneration versprach.
Der neue König, Philipp V. (1700-1746), obwohl selbst von
keiner großen Bedeutung, brachte doch aus seiner Heimat ein
ganz andres Regierungssystem und neue Kräfte in das
zerrüttete Staatswesen. Die Fremden, Franzosen und Italiener,
welche Philipp an die Spitze der Behörden und des Heers
stellte, und unter denen Alberoni hervorragte, führten nun,
wenn auch in etwas gewaltsamer Weise und in nur beschränktem
Umfang, die Grundsätze der französischen Staatsverwaltung
durch: alle die einheitliche Staatsgewalt hemmenden
Mißbräuche wurden beseitigt, Handel und Gewerbe,
Wissenschaft und Kunst gefördert, die Privilegien der
Provinzen aufgehoben, eine einheitliche Besteuerung und
Steuererhebung eingerichtet. Die wohlthätigen Folgen einer
zwar unumschränkten, aber thätigen und verständigen
Königsmacht zeigten sich auch überraschend schnell. Aber
als sie auch die Herrschaft der Kirche anfocht und deren
Mißbräuche abschaffen wollte, stieß die Regierung
beim Volk auf allgemeinen energischen Widerstand, dem Philipp V.
unter dem Einfluß seiner zweiten Gemahlin, Elisabeth Farnese,
nachgab; die Hierarchie feierte einen glänzenden Triumph, und
die Kurie und die Inquisition
81
Spanien (Geschichte bis 1808).
herrschten nach wie vor in S. Ebenso verderblich wurde für
das wieder erstarkende Land der Rückfall in die alte
Eroberungspolitik, welche sich besonders auf Erwerbung spanischer
Besitzungen für spanische Infanten richtete. In der That
wurden im polnischen und österreichischen Erbfolgekrieg (1738
und 1748) Neapel und Parma als bourbonische Sekundogenituren
gewonnen. Aber sie waren mit der Zerrüttung der Finanzen und
dem Stocken aller Reformen teuer erkauft. Gleichwohl war die einmal
gegebene Anregung nicht fruchtlos: das Volk war wenigstens aus
seiner Apathie aufgerüttelt und wendete sich wieder der Arbeit
und wirtschaftlichen Unternehmungen zu.
Die Regierung des schwächlichen, hypochondrischen Ferdinand
VI. (1746-59) war segensreich, weil sie sparsam und friedliebend
war. In materieller Beziehung nahm das Land einen bedeutenden
Aufschwung. Die Staatseinnahmen stiegen von 211 auf 352 Mill.,
trotz der erheblichen Steuererleichterungen, und obwohl die
Verwaltung verbessert und reichlicher ausgestattet, eine stattliche
Flotte geschaffen und die Zinsen der Staatsschuld bezahlt wurden,
hatte man fast 100 Mill. jährlichen Überschuß. Wenn
auch die Geistlichkeit noch 180,000 Personen zählte und ein
Einkommen von 359 Mill. besaß, so ward ihre Macht durch das
Konkordat von 1753 doch nicht unerheblich beschränkt,
namentlich aber der finanziellen Ausbeutung des Landes durch die
Kurie ein Ende gemacht. Einen bedeutenden Fortschritt aber in der
Entwickelung zum modernen Staat bezeichnete die Regierung Karls
III. (1759-88), des Stiefbruders Ferdinands VI., der, obwohl
strenggläubig, doch vom damals herrschenden
Staatsbewußtsein erfüllt und S. den andern Staaten
ebenbürtig zu machen bestrebt war. Ihm standen bei seinen
Reformen drei bedeutende Staatsmänner, Aranda, Floridablanca
und Campomanes, zur Seite. Die unglückliche Beteiligung
Spaniens am Krieg Frankreichs gegen England 1761-62 infolge des
nachteiligen bourbonischen Familienvertrags störte anfangs die
Reformthätigkeit. Diese erhielt indessen eine wesentliche
Förderung 1767 durch die Ausweisung der Jesuiten. Nun konnten
eine Menge Mißbräuche und Übergriffe der
Geistlichkeit beseitigt oder beschränkt und ein erfreuliches
Zusammenwirken des Staats und der Kirche hergestellt werden,
welches auf Bildung und Gesittung des Volkes einen höchst
heilsamen Einfluß ausübte. Viele Reformen blieben
freilich auf dem Papier stehen, da es bei der beispiellosen
Versunkenheit Spaniens in Ackerbau, Gewerbe und Unterricht an allen
Voraussetzungen ihrer Durchführbarkeit fehlte. Die
30jährige angestrengteste Thätigkeit der Regierung, die
Verwendung ungeheurer Summen auf Ansiedelungen, Bergwerke,
Fabriken, Straßen etc., die Freigebung des Handels mit
Amerika brachten daher nur zum Teil Früchte. Die
Bevölkerung war 1788 erst auf 10,270,000 Seelen gestiegen, die
Einnahmen auf 400 Mill. Realen. Der zweite unglückliche Krieg
gegen England (1780-83), in den S. durch den Familienvertrag
verwickelt wurde, verschlang solche Summen, daß ein
verzinsliches Papiergeld ausgegeben werden mußte. Die
unleugbaren Fortschritte in Volksbildung und Volkswohlfahrt
hätten aber doch bei dem frischen Geist, bei der zugleich
patriotischen und freiheitlichen Bewegung, von denen die Nation
durchweht war, wohl günstige und dauernde Ergebnisse zur Folge
gehabt, wenn S. eine längere Reformperiode vergönnt
gewesen wäre. Die vielversprechenden Anfänge gingen aber
unter Karls III. Nachfolger Karl IV. (1788-1808) völlig zu
Grunde, und S. wurde durch eine heillose, verbrecherische Politik
dem Untergang nahegebracht.
Spanien während der Revolutionszeit.
Karl IV., ein gutmütiger, aber unfähiger Fürst,
wurde ganz beherrscht von seiner klugen und entschlossenen, jedoch
sittenlosen Gemahlin Marie Luise von Parma, welche durch
Günstlingswirtschaft und Verschwendung die Staatsverwaltung
und die Finanzen in Verwirrung brachte und ihrem Geliebten Godoy,
dem Friedensfürsten, den herrschenden Einfluß, endlich
nach Beseitigung Floridablancas und Arandas im November 1792 auch
die oberste Leitung der Staatsgeschäfte verschaffte. Nachdem
S. dem Sturz der Bourbonen in Frankreich unthätig zugesehen,
ward es 1793 doch durch die Hinrichtung Ludwigs XVI. und die
Insulten des Konvents veranlaßt, Frankreich den Krieg zu
erklären, welcher mit einer so beispiellosen Unfähigkeit
geführt wurde, daß er trotz der Schwäche der
Franzosen und trotz der Opferwilligkeit der Nation mit einer
feindlichen Invasion in Navarra, die baskischen Provinzen und
Aragonien endete. Die Gunst der Umstände verschaffte S. noch
den vorteilhaften Frieden von Basel (22. Juli 1795), der ihm nur
die Abtretung von San Domingo auferlegte. Aber es geriet durch
denselben in völlige Abhängigkeit von Frankreich, welche
der leichtfertige Godoy durch den Vertrag von San Ildefonso (27.
Juni 1796) besiegelte. Derselbe zwang S., das kaum die Kosten des
letzten Kriegs hatte aufbringen können, zum Krieg mit England,
und gleich die erste Schlacht beim Kap St. Vincent (14. Febr. 1797)
zeigte die Unbrauchbarkeit der spanischen Flotte. Dazu unternahm
Godoy 1801 in französischem Interesse noch einen ruhmlosen
Krieg gegen Portugal. Im Frieden von Amiens (23. März 1802)
mußte S. zwar an England bloß Trinidad abtreten; aber
seine Herrschaft in den amerikanischen Kolonien war
erschüttert, seine Finanzen zerrüttet; das Defizit belief
sich trotz Papiergelds und andrer verderblicher Maßregeln
1797 auf 800 Mill., 1799 sogar auf 1200 Mill. Das Kriegsministerium
verbrauchte für ein Heer von 50,000 Mann 935 Mill., da die
Zahl der Oberoffiziere übermäßig war; 1802 wurden
auf einmal 83 Generale ernannt. Der Hof nahm allein 105 Mill. in
Anspruch, während das Volk infolge von Pest und
Mißernten darbte. Die Korruption am Hofe verbreitete sich
bald über das ganze Land; die edelsten Patrioten wurden mit
brutaler Gewaltthätigkeit verfolgt, dagegen war man gegen rohe
Pöbelexzesse schwach und nachgiebig.
Trotz dieser Zustände stürzte Godoy durch einen neuen
ungünstigen Vertrag mit Frankreich (9. Okt. 1803) das
finanziell erschöpfte S. in einen Krieg mit England, in
welchem bei Finisterre (22. Juli) und bei Trafalgar (20. Okt. 1805)
Spaniens letzte Flotte zu Grunde ging. Das Volk ließ dies
alles geduldig über sich ergehen und wankte nicht in seiner
unbedingten Loyalität; die Entrüstung richtete sich nur
gegen den schamlosen Günstling Godoy, der in seiner
Verblendung sich sogar mit der Hoffnung schmeichelte, Regent von S.
zu werden oder sich die Königskrone von Südportugal aufs
Haupt zu setzen. Als er, um dies letztere zu erreichen, sich mit
Frankreich im Vertrag von Fontainebleau (27. Okt. 1807) zu einem
Kriege gegen Portugal verband und Napoleon französische
Truppen über die Pyrenäen in S. einrücken
ließ, kam es 18. März 1808 in Aranjuez zu einer Erhebung
des Volkes gegen Godoy. Derselbe wurde gestürzt, und unter dem
Eindruck der Wut des erbitterten Volkes ließ sich der
König bewegen, 19. März zu gunsten seines Sohns, des
Infanten Ferdinand, abzu-
82
Spanien (Geschichte bis 1812).
danken; derselbe hielt 24. März als Ferdinand VII. seinen
Einzug in Madrid. Karl IV. nahm aber kurz darauf in einem Schreiben
an Napoleon seine Thronentsagung als erzwungen zurück, und der
französische Kaiser entbot nun die spanische
Königsfamilie nach Bayonne, wo Ferdinand nach längerm
Sträuben 5. Mai auf die Krone zu gunsten seines Vaters
verzichtete, dieser aber sofort seine Rechte an Napoleon abtrat.
Nun wurde dessen Bruder Joseph, König von Neapel, 6. Juli im
Beisein einer Junta von spanischen und amerikanischen Abgeordneten
in Bayonne zum König von S. ernannt und hielt, nachdem er und
die Junta 7. Juli die neu entworfene Verfassung beschworen hatten,
20. Juli seinen Einzug in Madrid. Karl IV. ließ sich in
Compiègne, Ferdinand VII. in Valençay nieder.
Wenn Napoleon auch die königliche Familie leicht beseitigt
hatte, so sah er sich doch bald in seiner Erwartung, auch S. rasch
nach französischem Vorbild umgestalten und seinen Interessen
dienstbar machen zu können, getäuscht. Das spanische Volk
war nicht im stande, die wohlthätigen Wirkungen der
französischen Staatsumwälzung zu würdigen; es
füllte dagegen tief die ihm zugefügte Schmach der
Fremdherrschaft. Edle und unedle Gefühle, Nationalstolz und
wilder Fremdenhaß, patriotische Begeisterung und
religiöser Fanatismus, stachelten es zum Widerstand auf; die
beispiellose Erregtheit der Nation ließ die Schwäche der
eignen Mittel und die ungeheure Übermacht des Gegners ganz
vergessen, so daß niemand am Sieg zweifelte. Der geringe
Kulturstand des Landes, der Mangel an Ordnung und Sicherheit im
Staatswesen, welcher bisher geherrscht hatte, machten die
völlige Auflösung aller Verhältnisse weniger
fühlbar und ermöglichten so die mehrjährige Dauer
eines verzweifelten Widerstandes, den ein höher kultiviertes
Land nur wenige Monate hätte aushalten können. Bereits 2.
Mai 1808, bei der Kunde von Ferdinands Entführung nach
Bayonne, war in Madrid ein Volksaufstand ausgebrochen, den die
Franzosen erst nach vielem Blutvergießen zu unterdrücken
vermochten. Nun erhoben sich auch die Provinzen, zuerst Asturien;
Provinzialjunten bildeten sich, die Guerillas bewaffneten sich in
den Gebirgen, und alle Anhänger der Franzosen (Josefinos oder
Afrancesados) wurden für Feinde des Vaterlandes erklärt.
Zwar hatten die Franzosen beim ersten Zusammentreffen mit einer
spanischen Feldarmee 14. Juli bei Rioseco glänzend gesiegt;
aber Monceys Angriff auf Valencia wurde zurückgeschlagen, und
eine Expedition des Generals Dupont endete mit seiner Umzingelung
und der Kapitulation von Baylen (20. Juli 1808). Die tapfere
Verteidigung Saragossas, die Räumung Madrids durch Joseph und
der allgemeine Rückzug der Franzosen vermehrten die
Begeisterung. Zugleich war Wellington mit einem englischen Korps in
Portugal gelandet und hatte die Franzosen zum Abzug gezwungen. Zwar
behaupteten diese, namentlich so oft Napoleon selbst sich an ihre
Spitze stellte, in S. in offenem Felde die Oberhand; sie siegten
bei Burgos (10. Nov.), Espinosa (10. u. 11. Nov.) und Tudela (23.
Nov.) und zogen 4. Dez. wieder in Madrid ein, wo 22. Jan. 1809
Joseph von neuem seine Residenz aufschlug. Die Expedition des
englischen Generals Moore in Galicien scheiterte. Allein nun nahm
der Krieg immer mehr den Charakter des furchtbarsten Volkskampfes
an und wurde durch die im Sept. 1808 in Aranjuez errichtete
Zentraljunta einheitlich geleitet. Diese beging zwar manche Fehler,
griff oft in höchst verkehrter Weise in die Kriegsoperationen
ein und setzte tüchtige Generale ab, gab aber durch den Aufruf
zum Guerillakrieg (28. Dez. 1808) dem Kampf den für die
Franzosen so verderblichen Charakter des kleinen Kriegs. In diesem
kamen die Vorzüge der Spanier, verwegener Mut, unbändige
Leidenschaftlichkeit und große Ausdauer in Strapazen und
Entbehrungen, recht zur Geltung; die fortwährenden kühnen
Unternehmungen der Guerillas rieben die Kräfte der Franzosen
auf und entrissen ihnen die Früchte ihrer Siege im offenen
Felde. Die Franzosen siegten 27. März 1809 bei Ciudad Real,
28. März bei Medellin, und die Zentraljunta mußte nach
Sevilla flüchten. Zwar wurde Soult im Mai 1809 von Wellington
aus Portugal vertrieben und mußte Galicien und Asturien
räumen, worauf Wellington in S. eindrang und die Franzosen 27.
und 28. Juli bei Talavera schlug; doch mußte er sich vor
einem neuen französischen Heer nach Portugal
zurückziehen, und der spanische General Vanegas wurde 11. Aug.
bei Almonacid, der englische General Wilson in den Engpässen
bei Baros geschlagen. Im Januar 1810 waren die Franzosen Herren von
Andalusien, und nach der Einnahme von Ciudad Rodrigo und Almeida
drang Masséna im August mit 80,000 Mann in Portugal ein, um
die Engländer wieder ins Meer zu werfen. Die Sache der Spanier
schien hoffnungslos verloren. Namentlich die höhern,
wohlhabendern Volksklassen schlossen sich immer zahlreicher dem
bonapartistischen König an. Die Zentraljunta, deren
Unfähigkeit das Mißgeschick der spanischen Heere
hauptsächlich verschuldet hatte, wurde 2. Febr. 1810 in Cadiz,
wohin sie von Sevilla geflüchtet war, zur Abdankung und
Einsetzung einer Regentschaft gezwungen, in welcher der
Radikalismus die Oberhand bekam.
Schon 28. Okt. 1809 hatte die Zentraljunta die Cortes
zusammenberufen. Diese, unter den größten
Schwierigkeiten und nur zum Teil gewählt, zum Teil kooptiert,
traten 24. Sept. 1810 in Cadiz zusammen und nahmen unter den
Kanonen der französischen Batterien, welche die Isla de Leon
umringten, bedroht von der in der überfüllten Stadt
wütenden Pest, das große Werk der Reform des verrotteten
Staatswesens in die Hand. Unerfahren, teilweise von den radikalen
Ideen der französischen Revolution beherrscht, zum Teil in den
altspanischen Vorurteilen befangen, schwankten die Cortes unter
leidenschaftlichen, erbitterten Debatten zwischen den
entgegengesetztesten Beschlüssen: man proklamierte die
Volkssouveränität und das allgemeine Stimmrecht und hob
die Grundherrlichkeit auf, wagte aber nicht, die Inquisition oder
die Rechte des Adels und der Kirche anzutasten. Im ganzen aber war
die Verfassung vom 18. März 1812 eine sehr liberale. Trotz des
hitzigen Parteikampfes bewährten die Cortes in der Hauptsache,
im Kampf gegen den verhaßten Feind, eine große
Einmütigkeit und aufopfernde Thätigkeit. Die Illusionen
der verblendeten Nationaleitelkeit wurden zerstört, die
Schäden der Verwaltung aufgedeckt, das korrumpierte Beamtentum
in heilsamen Schrecken versetzt. Die Truppen wurden verstärkt,
geschult und gut verpflegt und ihre nützliche Verwendung
dadurch gesichert, daß die Cortes Wellington, der 1811 in den
Linien von Torres Vedras bei Lissabon sich so lange behauptet
hatte, bis Masséna abziehen mußte, zum
Oberbefehlshaber sämtlicher Streitkräfte in S. ernannten.
Im Jan. 1812 eroberte Wellington Ciudad Rodrigo und 7. April
Badajoz, schlug 22. Juli die Franzosen unter Marmont bei Salamanca
und zog 12. Aug. in Madrid ein. Zwar mußte er sich vor der
Übermacht der bedeutend verstärkten Franzosen aufs
83
Spanien (Geschichte bis 1823).
neue nach der portugiesischen Grenze zurückziehen, und
Madrid wurde zum letztenmal von den Franzosen besetzt; aber die
Katastrophe in Rußland veränderte auch die Lage der
Dinge in S. Soult wurde zu Anfang 1813 abberufen, Suchet
räumte Valencia im Juli; schon 27. Mai hatte König Joseph
Madrid für immer verlassen und sich mit der französischen
Armee auf Vittoria zurückgezogen. Hier wurde dieselbe von
Wellington 21. Juni 1813 gänzlich geschlagen. Die Franzosen
zogen sich über die Pyrenäen zurück, und Wellington
rückte 9. Juli in Frankreich ein. Spaniens Unabhängigkeit
war hiermit hergestellt.
Die Reaktion unter König Ferdinand VII.
Die ordentlichen Cortes, welche im Oktober 1813 in Cadiz
zusammengetreten waren, aber im Januar 1814 ihren Sitz nach Madrid
verlegten, erließen, obwohl die Servilen (Konservativen) die
Mehrheit hatten, 3. Febr. 1814 eine Einladung an Ferdinand VII.,
sich nach Madrid zu begeben und die Verfassung von 1812 zu
beschwören; den Vertrag des Königs mit Napoleon I. (13.
Dez. 1813 in Valençay abgeschlossen), der seine Herrschaft
in S. herstellte, aber den französischen Einfluß
sicherte, erkannten sie nicht an. Ferdinand betrat 24. März
1814 in Gerona den spanischen Boden und nahm 4. Mai von Valencia
aus vom Thron Besitz, weigerte sich aber, die Verfassung
anzuerkennen, nachdem General Elio mit 40,000 Mann sich ihm
angeschlossen, und ließ 11. Mai die Cortes durch Truppen
auseinander jagen. Dennoch begrüßte ihn das Volk mit
Jubel, als er 14. Mai in Madrid einzog; denn er war als Gegner des
verhaßten Godoy noch immer populär. Zwar versprach er in
einem Manifest vom 24. Mai Amnestie und die Verleihung einer
Verfassung; doch wurden diese Versprechungen nicht gehalten. Alle
Offiziere bis zum Kapitän und alle Beamten bis zum
Kriegskommissar herab, welche Joseph gedient hatten, wurden mit
Weib und Kind auf Lebenszeit verbannt. Die Liberalen, wenn sie auch
durch aufopfernde Vaterlandsliebe im Befreiungskampf sich
ausgezeichnet hatten, wurden geächtet oder in den Kerker
geworfen, zwei Generale, Porlier und Lacy, die für die
Verfassung ihre Stimmen erhoben, hingerichtet. Jesuiten,
Klöster und geheime Polizei wurden wiederhergestellt. Dabei
fehlte es der Regierung doch an Stärke und Beständigkeit.
Von 1814 bis 1819 lösten 24 Ministerien einander ab. Der
König, unwissend, charakterlos, von launischer, feiger
Despotenart, ließ sich ganz von einer gewissenlosen Kamarilla
beherrschen, welche jeden durch die Zerrüttung des
Staatswesens gebotenen und von den Großmächten dringend
angeratenen Reformversuch vereitelte. S. war daher nicht im stande,
die abgefallenen Kolonien in Amerika wieder zu unterwerfen, und
verlor seinen ganzen Besitz auf dem Festland von Süd- und
Mittelamerika; Florida in Nordamerika trat es 1819 für 5 Mill.
Dollar freiwillig an die Union ab.
Die Gewaltthätigkeit und der Hochmut der unfähigen
Regierung erstickten die frühere Anhänglichkeit an das
Königtum, und erbitterte Feindschaft gegen dasselbe oder
gleichgültiger Pessimismus traten an ihre Stelle. Besonders in
dem durchaus vernachlässigten Heer wuchs die Unzufriedenheit
und kam unter den für die Überfahrt nach Amerika
bestimmten Truppen zum Ausbruch: 4 Bataillone unter dem
Oberstleutnant Riego proklamierten 1. Jan. 1820 zu San Juan die
Verfassung von 1812 und setzten aus der Isla de Leon eine
Regierungsjunta ein, die einen Aufruf an das spanische Volk
erließ. Mehrere Provinzen schlossen sich der Empörung
an, angesehene Generale, wie O'Donnell und Freire, vereinigten sich
mit Riego, als derselbe auf Madrid marschierte. Als auch in Madrid
das Volk sich erhob, beschwor der König 9. März die
Verfassung von 1812, hob die Inquisition aus und berief die Cortes
zum 9. Juli 1820. Die Liberalen hatten in denselben die Mehrheit,
und einer ihrer Führer, Arguelles, ward Präsident des
Ministeriums. Doch traten sie gemäßigt auf, suchten die
zügellose Freiheit der Zeitungen und Klubs durch ein
Preß- und Vereinsgesetz zu beschränken und
begnügten sich, die Majorate, Fideikommisse und Klöster
(bis auf 14) aufzuheben und die Besteuerung der Geistlichkeit
(148,290 Personen, ohne die Nonnen, darunter bloß 16,481
eigentliche Pfarrer) durchzuführen. Der erbittertste Feind der
neuen Regierung war der König selbst, der im geheimen
Einverständnis mit mehreren reaktionären Schilderhebungen
in der Provinz, so der "apostolischen Junta", war und alle
positiven Maßregeln der Minister und der Liberalen in den
Cortes nach Möglichkeit vereitelte, wodurch der Einfluß
der Exaltados (Radikalen) wuchs; die extremste Partei derselben,
die Descamizados, forderte durch ihre Zügellosigkeit eine
Reaktion heraus. Die Anarchie wurde noch durch die Finanznot
vermehrt, der auch die Einführung einer direkten Steuer und
der Verkauf der Nationalgüter nicht abzuhelfen vermochten; die
Schuldenlast stieg auf 14 Milliarden. Als die Exaltados bei den
Wahlen für die neuen Cortes, die 1. März 1822
eröffnet wurden, die Mehrheit erlangten, wählten sie
Riego zum Präsidenten und überschwemmten das Land mit
einer Masse von Reformgesetzen, die bei der Stimmung der Masse nie
verwirklicht werden konnten.
Nachdem ein vom Hof angestifteter Versuch der Garden, 7. Juli
1822 vom Prado aus Madrid zu überrumpeln, vom Volk vereitelt
worden war, wandte sich der König im geheimen an die Heilige
Allianz um Hilfe gegen die Revolution. Auf dem Kongreß zu
Verona (Herbst 1822) wurde eine bewaffnete Intervention in S.
beschlossen, welche Frankreich auszuführen übernahm. Die
Gesandten von Frankreich, Österreich, Rußland und
Preußen forderten von der spanischen Regierung und den Cortes
die Herstellung der königlichen Souveränität und
verließen, als dies 9. Jan. 1823 abgelehnt wurde, den
spanischen Hof. Im April rückte die französische
Interventionsarmee, 95,000 Mann unter dem Herzog von
Angoulême, über die Grenze. Die schlecht organisierten
Streitkräfte der Spanier leisteten geringen Widerstand. Von
einer Erhebung des Volkes gegen die Franzosen war nichts zu
spüren, da diesmal die Geistlichkeit für sie war und
ihren Vormarsch unterstützte. Schon 11. April flüchteten
die Cortes mit dem König aus Madrid, wo der Herzog von
Angoulême 24. Mai unter dem Jubel des Volkes einzog und eine
Regentschaft unter dem Herzog von Infantado einsetzte, die sofort
das Werk der Restauration mit Verfolgung der Liberalen begann.
Überall erhob sich das Volk, vom Klerus aufgehetzt, für
den absoluten König; die meisten spanischen Generale
kapitulierten mit den Franzosen. Diese schlossen Cadiz, wohin sich
im Juni die Cortes mit dem König zurückgezogen hatten, zu
Wasser und zu Land ein, eroberten das Außenfort Trocadero
(31. Aug.), bombardierten die Stadt (23. Sept.) und bereiteten
alles zum Sturm vor, als die Cortes 28. Sept. dem König die
absolute Gewalt zurückgaben und sich auflösten; die
meisten Mitglieder und Beamten der liberalen Regierung, über
600 Personen, flüchteten ins Ausland, bevor die Franzosen 3.
Okt. Cadiz besetzten. Auch die letzten von den Libe-
6*
84
Spanien (Geschichte bis 1841).
ralen noch behaupteten Städte, Barcelona, Cartagena und
Alicante, ergaben sich im November, und Angoulême kehrte nach
Frankreich zurück; doch blieben 45,000 Mann Franzosen unter
Bourmont bis 1828 im Land zum Schutz der neuen Regierung.
Ferdinands VII. erste Regierungshandlung nach seiner Befreiung
aus der Gewalt der Cortes war eine Proklamation vom 10. Okt. 1823,
welche alle Akte der konstitutionellen Regierung vom 7. März
1820 bis 1. Okt. 1823, "indem er während dieses Zeitraums der
Gewalt beraubt gewesen sei", für null und nichtig
erklärte, dagegen alle Beschlüsse der Madrider
Regentschaft genehmigte. Alle Anhänger der Liberalen wurden
als "Feinde des Königs" der Rache der Glaubensbanden
preisgegeben, welche die abscheulichsten Gewaltthaten
verübten. Die apostolische Junta, an deren Spitze des
Königs Bruder Don Karlos stand, und welche die Hierarchie, vor
allem die Inquisition, herstellen wollte, erlangte eine solche
Macht, daß sie eine Art Nebenregierung bildete und alle
Minister, die sich ihrem Willen nicht fügten, wie Zea-Bermudez
(1824-25), auch den absolutistisch gesinnten Infantado (1825-26)
stürzte. Die apostolische Partei war um so siegesgewisser, als
bei dem Alter des kinderlosen Königs ihr Haupt, Don Karlos,
der mutmaßliche Thronfolger war. Als ihre Anhänger im
August 1827 in Katalonien indes eine bewaffnete Schilderhebung
versuchten, schritt der König mit Strenge gegen sie ein und
vermählte sich nach dem Tod seiner dritten Gemahlin 10. Dez.
1829 mit der Prinzessin Christine von Neapel, die 10. Okt. 1830
eine Tochter, Isabella, gebar. Schon 29. März l830 hatte
Ferdinand VII. eine Pragmatische Sanktion erlassen, welche das 1713
in S. von den Bourbonen eingeführte Salische Gesetz aufhob und
im Einklang mit den altkastilischen Rechten die weibliche
Thronfolge einführte. Eine Verschwörung der bitter
enttäuschen Anhänger des Don Karlos gegen das Leben des
Königspaars wurde entdeckt und vereitelt, ein dem schwer
erkrankten König im September 1832 abgepreßter Widerruf
der Pragmatischen Sanktion von demselben nach seiner Genesung
für ungültig erklärt. Im Oktober 1832 ward Christine
zur Regentin ernannt, berief Zea-Bermudez an die Spitze des
Ministeriums, erließ eine Amnestie und versammelte die
Cortes, welche 20. Juni 1833 Isabella als Thronerbin den Eid der
Treue leisteten. Somit gelangten, als nach dem Tod Ferdinands VII.
(29. Sept. 1833) Isabella II. unter der Vormundschaft ihrer Mutter
Christine den Thron bestieg, die Liberalen wieder zur
Herrschaft.
Der Karlistenkrieg und die Regentschaft.
Don Karlos hatte von Portugal aus, wo er bei Dom Miguel Zuflucht
und Beistand gefunden hatte, schon 29. April 1833 Protest gegen die
neue Thronfolgeordnung erhoben und nach Ferdinands Tod sich als
Karl V. zum König proklamiert. Ihm schlossen sich außer
der apostolischen Partei besonders die baskischen Provinzen und
Navarra an, deren aus uralten Zeiten bestehende Freiheiten
(Fueros), zu denen freilich auch Mißbräuche, wie der
Schmuggel, gehörten, von den Liberalen angefochten worden
waren. Die Erhebung der Karlisten begann im Oktober 1833 mit der
Einsetzung einer Junta und der allgemeinen Volksbewaffnung, welche
Zumala-Carreguy leitete. Derselbe treffliche Feldherr verschaffte
den Karlisten im Gebirgskrieg immer mehr Erfolge und
bemächtigte sich eines Teils von Katalonien. Auch Don Karlos,
nach dem Sturz Dom Miguels aus Portugal vertrieben, erschien in den
aufständischen Provinzen. Der Bürgerkrieg nahm bald einen
grausamen Charakter an, und seitdem Mina die Mutter des
Karlistengenerals Cabrera hatte erschießen lassen, wurden die
Gefangenen auf beiden Seiten nicht mehr geschont. Die Christinos
(Anhänger der Regentin) welche an Machtmitteln den Karlisten
bei weitem überlegen waren, da ihrer Regierung der
größte Teil des Landes, der Armee und der Beamten,
namentlich die Bevölkerung der Städte und die zahlreichen
amnestierten Spanier (50,000 Personen) anhingen, würden den
Karlistenaufstand ohne große Schwierigkeiten haben
unterdrücken können, wenn sie sich nichts durch
Zwistigkeiten geschwächt hätten. Die Progressisten, wie
sich jetzt die vorgeschrittenen Liberalen nannten, waren mit der
nenen Verfassung, welche nach der Entlassung von Zea-Bermudez (15.
Jan. 1834) der neue Minister Martinez de la Rosa gegeben hatte, dem
Estatuto real (mit zwei Kammern, den Proceres und den
Procuradores), nicht zufrieden und verlangten die Herstellung der
Verfassung von 1812. Alle weitern Zugeständnisse der Regentin,
welche auf den Beistand der Liberalen angewiesen war, genügten
nicht; die Progressisten veranstalteten 1836 in zahlreichen
Städten Aufstände, bei denen die Verfassung von 1812
ausgerufen wurde. Schließlich, 12. Aug. 1836, empörte
sich auch eins der in San Ildefonso liegenden Milizregimenter, zog
nach dem Palast La Granja, wo die Königin Christine sich
aufhielt, und zwang sie, die Konstitution von 1812 anzunehmen. Der
Minister Isturiz, ein Moderado, floh, Quesada wurde vom Pöbel
ermordet. Der neue Ministerpräsident Calatrava berief zum 24.
Okt. 1836 die Cortes, welche 1837 die Verfassung von 1812 im
gemäßigten Sinn revidierten.
Der Zwiespalt im liberalen Lager ermutigte die Karlisten zu
kühnen Unternehmungen: nach seinem Sieg bei Huesca (24. Mai
1837) überschritt Don Karlos den Ebro und bedrohte Madrid,
während gleichzeitig in Andalusien ein karlistischer General
Gomez, bedenkliche Fortschritte machte. Dieser wurde von Narvaez
besiegt; im Norden errang Espartero den entscheidenden Sieg von
Huerta del Rey (14. Okt.); und brachte nach und nach die
nördlichen Provinzen in seine Gewalt. Denn auch bei den
Karlisten war Zwietracht zwischen einer Hofkamarilla unter der
Prinzessin von Beira, Don Karlos' zweiter Gemahlin, und dem
Oberbefehlshaber Maroto, der sogar 20. Febr. 1839 mehrere
Häupter der Kamarilla erschießen ließ. Um sich vor
der Rache seiner Gegner zu schützen, schloß Maroto 31.
Aug. 1839 mit Espartero den Vertrag von Vergara, nach welchem er
mit 50 Karlistenchefs die Waffen streckte. Don Karlos trat 15.
Sept. auf französisches Gebiet über; ihm folgte 6. Juli
1840 Cabrera, welcher in Niederaragonien und Katalonien den
Widerstand noch fortgesetzt hatte. Den baskischen Provinzen wurden
die Fueros von den Cortes bestätigt. Im Spätsommer 1840
war ganz S. der Königin Isabella unterworfen und der
Karlistenkrieg beendet.
Durch seine Erfolge im Karlistenkrieg hatte Espartero so
großes Ansehen erlangt, daß die Regentin, welche durch
Bestätigung des von den konservativen Cortes beschlossenen
Ayuntamiento- (Gemeinde-) Gesetzes eine Erhebung der Progressisten
in Madrid hervorgerufen hatte, ihn im September 1840 zum
Ministerpräsidenten ernennen mußte und 12. Okt. abdankte
und sich nach Frankreich einschiffte, als Espartero ihr ein
unannehmbares Regierungsprogramm vorlegte. Dieser war nun 8. Mai
1841 zum Regenten gewählt. Aber trotz seiner Popularität,
und
85
Spanien (Geschichte bis 1868)
obwohl er eifrig und mit Erfolg bemüht war, das materielle
Wohl des Landes zu fördern, hatte er doch unaufhörlich
mit den Ränken seiner Gegner, der Regentin und der Moderados
(Konservativen), der Unbotmäßigkeit seiner eignen
Anhänger, der Progressisten, und Aufständen
(Pronunciamentos) ehrgeiziger Offiziere zu kämpfen. Im Juni
1843 brach eine allgemeine Empörung aus, der sich sogar die
Radikalen anschlossen, und vor der Espartero nach England
flüchten mußte. Nachdem die den Moderados
angehörige Mehrheit der Cortes 8. Nov. 1843 die noch nicht
14jährige Königin Isabella für volljährig
erklärt hatte, übernahm Bravo Murillo, dann (1844)
Esparteros Nebenbuhler Narvaez die Leitung des Ministeriums; die
Königin Christine wurde zurückgerufen und die Verfassung
im Mai 1845 in reaktionärem Sinn geändert; für die
Cortes ward ein hoher Zensus eingeführt, der Senat von der
Krone auf Lebenszeit ernannt, die katholische Religion als
Staatsreligion proklamiert.
Die Regierung der Königin Isabella.
Narvaez veruneinigte sich schon 1846 mit den Cortes und trat
zurück, worauf die Königin Isturiz in das Kabinett
berief. Die Errichtung einer festen, zielbewußten Regierung
wurde durch die Vermählung Isabellas II. erschwert. Der Plan,
dieselbe mit dem Grafen von Montemolin, Don Karlos' Sohn, zu
verheiraten und dadurch die Legitimität der Dynastie
außer Frage zu stellen, wurde durch Ludwig Philipp von
Frankreich vereitelt, der einem seiner Söhne zur Herrschaft in
S. verhelfen wollte. Das Ränkespiel der "spanischen Heiraten"
endete damit, daß Ludwig Philipp, durch ein England gegebenes
Versprechen gebunden, seinen Sohn, den Herzog von Montpensier,
nicht mit Isabella, sondern mit deren Schwester, der Infantin
Luise, vermählte, aber, um indirekt seinen Zweck doch zu
erreichen, durchsetzte, daß Isabella mit ihrem Vetter Franz
d'Assisi, einem körperlich und geistig schwachen Prinzen, eine
Ehe schließen mußte, die jede Hoffnung auf Leibeserben
ausschloß. Indes Isabella, den ihr aufgedrungenen Gemahl
verachtend und über die Schranken der Sitte sich
hinwegsetzend, erwählte sich Günstlinge, von denen sie
zahlreiche Kinder gebar, welche die eigennützigen Berechnungen
der Familie Orléans zu Schanden machten. Diese
Günstlinge, in deren Wahl Isabella allmählich von Serrano
auf Marfori herabsank, beuteten ihre Stellung aufs schamloseste
für Befriedigung ihres Ehrgeizes und ihrer Habsucht aus, und
so wurde in dem sonst so loyalen Volk das moralische Ansehen des
Königtums durch die lasterhafte, heuchlerische Aufführung
des Hofs vernichtet. Die Regierung des unglücklichen Landes
ward zu einem unwürdigen Intrigenspiel in der vertrauten
Umgebung der Monarchin, durch welches trotz mehrjähriger
Aufrechterhaltung der äußern Ruhe die wenigen
Fortschritte in der geistigen und materiellen Entwickelung des
Landes gefährdet und die sittlichen Grundlagen des
Staatswesens untergraben wurden. Die Minister wechselten so oft,
daß S. 1833-58 nicht weniger als 47 Ministerpräsidenten,
61 Auswärtige, 78 Finanz- und 96 Kriegsminister hatte.
Nach der kurzen Regierung der Progressisten unter Serrano stand
1847-51 Narvaez an der Spitze des Ministeriums, der, obwohl
Moderado, doch mit Mäßigung vorging und nicht nur die
Ruhe aufrecht hielt, sondern auch den nationalen Wohlstand
förderte. Sein Nachfolger Bravo Murillo (1851-52) erzeugte
jedoch durch den Plan, die Verfassung in absolutistisch-klerikalem
Sinn umzugestalten, eine Aufregung, welche sich 1854 in
Pronunciamentos zahlreicher Generale äußerte.
Schließlich kam es in Madrid zu einem Aufstand, welchen die
Königin nur durch die Berufung Esparteros zum
Ministerpräsidenten (Juli 1854) beschwichtigen konnte. Nachdem
er das Gesetz über den Verkauf der National- und
Kirchengüter der Königin 1855 abgerungen hatte, wurde
Espartero 14. Juli durch O'Donnell gestürzt, der nach
Unterdrückung eines Aufstandes in Madrid (16. Juli) die
Nationalgarde entwaffnete, die Verfassung vom Mai 1845 herstellte
und den Verkauf der Kirchengüter sistierte. Zwischen
O'Donnell und Narvaez wechselte nun eine Reihe von Jahren die
Herrschaft: ersterer, 1855-56, 1858-63 und 1865-1866 oberster
Minister, früher selbst Progressist, wollte sich auf eine
Mittelpartei, die "liberale Union", stützen, stieß
jedoch bei allen seinen Vorschlägen und Maßregeln auf
das unüberwindliche Mißtrauen seiner ehemaligen
Parteigenossen und suchte sich daher durch Erfolge auf dem Gebiet
der auswärtigen Politik zu befestigen. Diesem Zweck sollte der
Krieg mit Marokko (s. d., S. 277) 1859-60 dienen, in welchem
O'Donnell indes nur kriegerische Lorbeeren, keine
wesentlichen Vorteile gewann. 1861 wurde San Domingo auf Haïti
wieder mit S. vereinigt, und im Bund mit England und Frankreich
schritt S. Ende 1861 gegen Mexiko ein, das für die Verletzung
spanischer Interessen die Genugthuung verweigerte; doch zog sich
der spanische Befehlshaber Prim 1862 vom Unternehmen zurück,
als er die eigennützigen Absichten der Franzosen erkannte (s.
Mexiko, S.566). Ein Konflikt mit Peru und Chile (s. d., S. 1022),
der 1866 zu einer förmlichen Kriegserklärung Perus,
Chiles, Bolivias und Ecuadors an S. (14. Jan.) führte, endete
nach der erfolglosen Beschießung Valparaisos (31. März)
und Callaos (2. Mai) ohne Ergebnis. San Domingo wurde 1865 wieder
aufgegeben. Unter diesen Umständen konnte sich
O'Donnell, obwohl er mehrere Militärrevolten
niederschlug und auch einen Landungsversuch des karlistischen
Prätendenten, des Grafen von Montemolin (1. April 1860),
vereitelte, auf die Dauer nicht behaupten. Wenn O'Donnell
nicht im stande war, die Ruhe aufrecht zu erhalten, so zog die
Königin Isabella Narvaez vor, dessen moderadistische Gesinnung
der ihrigen mehr entsprach. Narvaez, 1856-57, 1864-65 und 1866-68
Ministerpräsident, begünstigte den Klerus,
unterdrückte die Preß- und Vereinsfreiheit und schritt,
besonders in seinem letzten Ministerium, mit rücksichtsloser
Strenge gegen die Häupter der Progressisten und der liberalen
Union ein. Rios Rosas, Serrano u. a. wurden verhaftet, andre, wie
O'Donnell, Prim, flüchteten in das Ausland. Die Cortes,
deren Wahlen in S. die Regierung allerdings stets beherrscht, gaben
zur Aufhebung der konstitutionellen Freiheiten und zur
Verhängung des Belagerungszustandes bereitwilligst ihre
Zustimmung, und Isabella war des Siegs der klerikalen Richtung so
sicher, daß sie sogar ihre Absicht, für die weltliche
Herrschaft des Papstes mit der Macht Spaniens einzutreten, offen
äußerte.
Narvaez starb plötzlich 23. April 1868. Sein Nachfolger
Gonzalez Bravo mußte den Günstling Isabellas, Marfori,
in das Ministerium aufnehmen. Nachdem im Juli eine unionistische
Verschwörung, deren Ziel die Erhebung Montpensiers auf den
Thron war, entdeckt und ihre Häupter, die angesehensten
Generale, wie Serrano, Dulce u. a., nach den Kanarischen Inseln
deportiert worden waren, begab sich die Königin nach San
Sebastian, um von hier aus mit Napoleon die Besetzung Roms durch
spanische Trup-
86
Spanien (Geschichte bis 1874).
pen zu verabreden. Inzwischen aber vereinigten sich die liberale
Union, die Progressisten und die Republikaner zu einer gemeinsamen
Erhebung gegen die Mißregierung Isabellas. Die unionistischen
Generale wurden von den Kanarischen Inseln durch einen Dampfer
abgeholt und nach Cadiz gebracht, wo auch Prim erschien und die
Flotte unter Admiral Topete 18. Sept. 1868 die Absetzung Isabellas
verkündete. Der Aufruhr verbreitete sich rasch über ganz
S. General Pavia sammelte die treu gebliebenen Truppen und
rückte den Aufständischen nach Andalusien entgegen, ward
aber 28. Sept. bei Alcolea in der Nähe von Cordova geschlagen.
Serrano hielt 3. Okt. seinen Einzug in Madrid, während
Isabella 30. Sept. nach Frankreich floh.
Anarchie und Bürgerkrieg.
Die Unionisten und die Progressisten unter Prim bildeten nun
eine provisorische Regierung unter Serranos Vorsitz, welche sofort
den Jesuitenorden aufhob, die Klöster beschränkte und
volle Preß- und Unterrichtsfreiheit einführte; das Volk
schwelgte im Genuß der Freiheit und ergoß sich in
Lobreden auf die Helden der glorreichen Revolution. Die
konstituierenden Cortes, welche nach einem neuen Gesetz
gewählt wurden, traten 11. Febr. 1869 zusammen: die Unionisten
zählten nur 40 Mitglieder, womit ihr Thronkandidat Montpensier
beseitigt war, die Republikaner 70; die Progressisten hatten die
Mehrheit. Auch diese wünschten die Errichtung einer
konstitutionellen Monarchie und brachten 1. Juni 1869 eine
monarchisch-konstitutionelle Monarchie in den Cortes zur Annahme.
Doch lehnte König Ferdinand von Portugal 6. April die ihm
angebotene spanische Krone ab, ebenso der junge Herzog von Genua,
so daß die Cortes die Einsetzung einer Regentschaft
beschlossen und Serrano 18. Juni zum Regenten ernannten. Die
Ungewißheit über die politische Gestaltung des Landes
ermutigte Don Karlos, den Enkel des ältern Don Karlos, im Juli
den spanischen Boden zu betreten und mit Hilfe der Geistlichkeit in
den Nordprovinzen karlistische Aufstände zu erregen,
während in mehreren Städten, namentlich in Barcelona, die
Republikaner sich erhoben. Endlich gelang es dem
Ministerpräsidenten Prim, den Erbprinzen Leopold von
Hohenzollern zur Annahme der Krone zu bewegen, und 4. Juli 1870
beschlossen Regent und Ministerium, dessen Kandidatur den Cortes
vorzuschlagen. Der unerwartete Einspruch Frankreichs vereitelte
dieselbe, da der Erbprinz 12. Juli auf seine Kandidatur
verzichtete, um nicht Ursache eines großen Kriegs zu werden.
Als der deutsch-französische Krieg dennoch ausbrach, verhielt
sich die spanische Regierung, welche sich sofort mit dem Verzicht
des Prinzen einverstanden erklärt hatte, streng neutral. An
Stelle des Hohenzollern gewann Prim in dem Herzog Amadeus von
Aosta, zweitem Sohn des Königs Viktor Emanuel von Italien,
einen neuen Thronkandidaten, der 16. Nov. von den Cortes mit 191
gegen 98 Stimmen zum König gewählt wurde.
An demselben Tag, an welchem König Amadeus in Cartagena
landete, 30. Dez. 1870, starb Marschall Prim, der 27. Dez. in
Madrid von Meuchelmördern tödlich verwundet worden war.
Damit verlor der junge Herrscher seine festeste Stütze.
Dennoch trat er 2. Jan. 1871 die Regierung an und beauftragte
Serrano mit der Bildung eines Kabinetts. Die Granden gaben Amadeus
ihre Geringschätzung in schroffster Weise zu erkennen; eine
Anzahl Offiziere verweigerte den Eid. Die Wahlen für die
Cortes im März ergaben eine knappe Mehrheit für die
Regierung; unter der Opposition befanden sich 60 Republikaner und
65 Karlisten, welche den König aufs heftigste angriffen. Dabei
war unter den Anhängern des Königs keine Einigkeit:
Serrano wurde von dem ränkevollen Zorrilla, einem radikalen
Progressisten, schon im Juli aus dem Ministerium gedrängt, der
sich aber auch nur bis zum Oktober an der Spitze der Regierung
behauptete. Der konservative Progressist Sagasta, seit Ende 1871
Ministerpräsident, erlangte nach der Auflösung der Cortes
bei den Neuwahlen im April 1872 eine Mehrheit und machte im Juni
wieder Serrano Platz, der gegen die Karlisten mit Erfolg
gekämpft, ihnen aber in der Konvention von Amorevieta (24. Mai
1872) Amnestie gewährt hatte, um die Ruhe in S. herzustellen.
Hierfür verlangte er vom König außerordentliche
Vollmachten, die derselbe jedoch auf Anstiften Zorrillas
verweigerte. Dieser trat 16. Juni wieder an die Spitze des
Kabinetts, vermochte aber weder den Parteikämpfen in den neuen
Cortes, in denen die ministerielle Mehrheit immer deutlicher ihre
republikanischen Grundsätze kundgab, noch den Aufständen
im Land ein Ende zu machen. Überzeugt, daß er keine
feste Autorität in dem unterwühlten Land gewinnen
könne, dankte Amadeus 10. Febr. 1873 ab und begab sich
über Lissabon nach Italien zurück.
Die Cortes erklärten sofort mit 256 gegen 32 Stimmen S.
für eine Republik und erwählten Figueras zum
Präsidenten, einen föderalistischen Republikaner, der die
Befugnisse der Zentralregierung und der Cortes auf das Notwendigste
beschränken, den Provinzen, Städten und Gemeinden aber
möglichst ausgedehnte Autonomie gewähren wollte. Der Eid
und die Konskription für die Armee wurden abgeschafft. Nachdem
die Anhänger des Einheitsstaats verjagt worden waren, errangen
die Föderalisten bei den Corteswahlen 10. Mai eine
erdrückende Mehrheit. Figueras erschien dieser nicht extrem
genug, und Pi y Margall trat an seine Stelle, unter dem
völlige Anarchie eintrat. Im Norden breiteten sich die
Karlisten wieder aus; der Prätendent Don Karlos nahm in
Estella sein Hauptquartier. In den großen Städten des
Südens, wie Malaga, Cadiz, Sevilla und Cartagena, suchten die
roten Kommunisten (Intransigenten) durch sofortige Verwirklichung
der Föderativrepublik ihre Herrschaft zu begründen,
proklamiertem die Autonomie Andalusiens, errichteten
Wohlfahrtsausschüsse und bemächtigten sich mehrerer
Kriegsschiffe. Die Cortes sahen nun die Notwendigkeit ein,
Karlisten und Intransigenten energisch zu bekämpfen. Zu diesem
Zweck trat der bisherige Föderalist Castelar 9. Sept. an die
Spitze der Regierung, vertagte die Cortes, nachdem er sich zu
Ausnahmemaßregeln hatte ermächtigen lassen, suspendierte
21. Sept. die konstitutionellen Garantien und verkündete die
Kriegsgesetze in voller Strenge. Sevilla, Malaga und Cadiz wurden
sofort unterworfen, Cartagena mußte aber regelrecht belagert
werden und ergab sich erst 12. Jan. 1874. Im Norden machten die
Karlisten immer größere Fortschritte, und das Gebaren
der Cortes, die nach ihrem Zusammentritt (2. Jan. 1874) Castelar
jeden Dank für seine energische Thätigkeit verweigerten
und ihn zum Rücktritt zwangen, ließ das Schlimmste
befürchten: da ließ Serrano 3. Jan. durch den General
Pavia die Versammlung auseinander sprengen und trat als
Präsident der Exekutivgewalt an die Spitze einer neuen
Regierung, die sich vor allem die Beendigung des Karlistenkriegs
zum Ziel setzte. Der Kampf drehte sich um Bilbao, das die Karlisten
seit dem Dezember 1873 belagerten. Zwar zwang Ser-
87
Spanien (Geschichte bis 1885).
rano sie im Mai, die Belagerung aufzugeben; doch schlugen sie
die Regierungstruppen unter Concha 25. bis 27. Juni bei Estella,
und Don Karlos' Bruder drang wiederholt über den Ebro, im Juli
sogar bis Cuenca vor. Endlich bereitete Serrano für Anfang
1875 einen energischen konzentrischen Angriff auf die Karlisten vor
und verstärkte die Armee auf 80,000 Mann, als auch er
plötzlich gestürzt wurde.
Die Regierung Alfons' XII. Neueste Zeit.
Nachdem die Versuche, einen fremden Fürsten auf den
spanischen Thron zu erheben, gescheitert waren, das Experiment mit
der Republik S. völliger Anarchie überliefert, Don Karlos
aber durch seine enge Verbindung mit dem Ultramontanismus und seine
barbarische Kriegführung sich unmöglich gemacht hatte,
blieb nur der älteste Sohn Isabellas, Alfons, der durch den
Verzicht seiner Mutter vom 25. Juni 1870 Erbe der
Thronansprüche der jüngern bourbonischen Linie geworden
war, als Kandidat der gemäßigt Liberalen für den
Thron übrig. Seine Erhebung erschien besonders den Offizieren
als die einzige Rettung aus dem Chaos, und im Einverständnis
mit den einflußreichsten Generalen proklamierte Martinez
Campos 29. Dez. 1874 in Sagunto Alfons XII. als König von S.
Die Nordarmee und die Garnison von Madrid erklärten sich
für ihn, und Serrano legte sein Amt ohne Widerstandsversuch
nieder. Das Haupt der alfonsistischen Partei, Canovas del Castillo,
wurde an die Spitze eines liberal-konservativen Ministeriums
berufen, welches der König nach seinem Einzug in Madrid (14.
Jan. 1875) bestätigte. Die neue mit Notabeln vereinbarte
Verfassung hob zwar die Geschwornengerichte, die Zivilehe und die
Lehrfreiheit auf und machte dem Klerus noch einige andre
Zugeständnisse, um dem Karlismus den Boden zu entziehen; doch
versprach sie, ehrlich und mit Mäßigung gehandhabt, eine
friedliche und freiheitliche Entwickelung. Der Karlistenkrieg wurde
nun von den Generalen Quesada und Moriones nach einem
systematischen Plan und mit ausreichenden Streitkräften
geführt und durch die Eroberung von Vittoria (8. Juli 1875),
von Seo de Urgel (26. Aug.) und Estella (19. Febr. 1876)
glücklich beendet; Don Karlos trat 28. Febr. im Thal von
Roncesvalles auf französisches Gebiet über. Die Fueros
der baskischen Provinzen wurden aufgehoben. Die 20. Jan. 1876
gewählten neuen Cortes, in denen die Regierung eine starke
Mehrheit hatte, wurden 15. Febr. vom König eröffnet und
genehmigten 24. Mai die neue Verfassung. Der finanziellen
Zerrüttung beschloß der Finanzminister durch Suspension
der Zinszahlung für die Staatsschulden bis 1. Jan. 1877, von
da ab durch nur partielle Zahlung abzuhelfen. Der Aufstand in Cuba
(s. d., S. 358) wurde Anfang 1878 endlich auch beschwichtigt,
allerdings nur durch den Vertrag von Tanjon (10. Febr. 1878), in
welchem General Martinez Campos den Insurgenten Amnestie, Aufhebung
der Sklaverei und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Insel
zugestehen mußte. Da Canovas sich weigerte, dies letztere
Zugeständnis vor den Cortes zu vertreten, trat er im März
1879 zurück und überließ die Leitung des
Ministeriums Martinez Campos, der jedoch die Genehmigung der von
ihm vorgeschlagenen Reformen für Cuba nicht erreichte und
daher schon 7. Dez. 1879 seine Entlassung nahm. Canovas, wieder
Ministerpräsident, brachte 1880 ein Gesetz über die
Aufhebung der Sklaverei in Cuba in den Cortes durch; aus
Rücksicht auf die spanischen Finanzen blieben aber die
Ausfuhrzölle daselbst sowie die Monopole zu gunsten des
spanischen Handels und Gewerbes bestehen.
Da Martinez Campos nach seinem erfolglosen Ministerium zu den
Gegnern Canovas übertrat, so bildete sich in den Cortes aus
den Parteien der Konstitutionellen und Zentralisten eine
einflußreiche liberal-dynastische Opposition unter
Führung Sagastas, der König Alfons XII., um sich die
Liberalen nicht zu entfremden, im Februar 1881 die Führung der
Geschäfte übertrug; Sagasta wurde Ministerpräsident,
Martinez Campos Kriegsminister. Das neue Ministerium löste die
Cortes auf und erlangte bei der Macht der Regierung über die
Wahlen eine bedeutende Majorität in der Kammer wie im Senat.
Der Finanzminister Camacho nahm sofort eine Umwandlung der
teilweise hohe Zinsen tragenden Staatsschulden in eine einheitliche
vierprozentige Staatsschuld vor und sicherte eine Reform des Tarifs
durch einen Handelsvertrag mit Frankreich (1882). Gleichwohl konnte
sich Sagasta nicht lange behaupten, auch nachdem er im Januar 1883
sein Kabinett in liberalem Sinn umgestaltet hatte. Aus der Mitte
der Konstitutionellen selbst wurde, besonders durch Serrano, das
Verlangen nach durchgreifenden Reformen, namentlich aber nach
Wiederherstellung der Verfassung von 1869, laut, das zu
erfüllen Sagasta sich entschieden weigerte; im August 1883
brachen in Badajoz, Barcelona, Seo de Urgel und andern Garnisonen
des Nordens Soldatenaufstände aus, bei welchen die Republik
mit der Verfassung von 1869 ausgerufen wurde. Der König
beschloß, nachdem die Aufstände unterdrückt waren,
die dynastische Linke in die Regierung zu ziehen, und berief im
Oktober 1883 Posada Herrera an die Spitze eines neuen Ministeriums,
das eine Verfassungsrevision mit Einführung der Zivilehe, der
Geschwornengerichte und des allgemeinen Stimmrechts versprach.
Dasselbe scheiterte aber an der Opposition Sagastas, dessen
Adreßentwurf, welcher die Politik der dynastischen Linken
entschieden tadelte, im Januar 1884 von den Cortes angenommen
wurde. Der König übertrug daher wieder den
Liberal-Konservativen unter Canovas das Ministerium.
Alfons XII. erstrebte neben dem Ziel, im Innern die monarchisch
gesinnten Parteien zu versöhnen und auf dem Boden der
konstitutionellen Monarchie zu vereinigen, in der auswärtigen
Politik die Wiederherstellung von Spaniens Ansehen und
Einfluß in Europa. Zu diesem Zweck widmete er sich mit Eifer
der Wiederherstellung und Verbesserung seiner Streitmacht zu Land
und zur See; ferner suchte er eine Anlehnung an die
mitteleuropäischen Mächte und unternahm im Sommer 1883
eine Reise nach Österreich und Deutschland, wo er bei den
Kaisermanövern in Homburg von Kaiser Wilhelm mit besondern
Ehren aufgenommen und zum Chef eines Ulanenregiments ernannt wurde.
Er wurde deswegen auf seiner Rückreise durch Frankreich in
Paris 29. Sept. aufs gröblichste beschimpft, aber durch einen
begeisterten Empfang in Madrid (2. Okt.) dafür
entschädigt. Ein Besuch des deutschen Kronprinzen in S. im
November bekundete die Achtung, die der König in Deutschland
genoß. Mitten in eine Gärung, welche ein schreckliches
Erdbeben in Andalusien, der Ausbruch der Cholera und die
Einführung der drückenden Verbrauchssteuern 1885 im
spanischen Volk erzeugt hatten, fiel wie ein zündender Funke
im September die Nachricht, daß ein deutsches Kriegsschiff
auf den Karolinen (s. d.) die deutsche Flagge geheißt habe:
nicht bloß der Madrider Pöbel ließ sich zu
Wutausbrüchen gegen Deutschland und seine Gesandtschaft in
Madrid hinreißen, sondern auch die Führer der Parteien,
namentlich der von je zu Frankreich hinneigenden Ra-
88
Spanierfeige - Spanische Litteratur.
dikalen, ja selbst die Minister ergingen sich, um ihre
Popularität zu vermehren, in kriegerischen Prahlereien und
Drohungen. Nur der König blieb fest in seinem Widerstand gegen
eine verhängnisvolle Überstürzung und
ermöglichte hierdurch eine ehrenvolle Verständigung mit
Deutschland. Leider starb er schon 25. Nov. 1885.
Alfons XII. hinterließ als Witwe seine zweite Gemahlin,
Maria Christine, eine österreichische Erzherzogin, welche
sofort als Regentin proklamiert wurde und 17.Mai 1886 einen Sohn,
Alfons XIII., gebar. Die Veränderungen auf dem Thron vollzogen
sich, abgesehen von einigen durch Zorrilla angestifteten
republikanischen Militärrevolten in Cartagena und Madrid und
von Ränken Montpensiers, die aber wirkungslos blieben, ohne
Störung. Canovas hielt es für nützlich, die
liberalen Parteien für die Erhaltung der Dynastie zu
interessieren, und empfahl daher der Regentin, an seiner Stelle
Sagasta zum Ministerpräsidenten zu ernennen (27. Nov.).
Derselbe verschaffte sich durch Neuwahlen die Mehrheit in den
Cortes, welche 10. Mai 1886 eröffnet wurden, die
Einführung von Geschwornengerichten genehmigten (7. Mai 1887)
und die Beratung der vom Kriegsminister Cassola vorgelegten
Heeresreform mit allgemeiner Wehrpflicht in Angriff nahmen. Die
Einnahmen wurden durch Verpachtung der Postdampferlinien und des
Tabaksmonopols vermehrt. Die Regentin verstand es, durch ihr
würdiges und kluges Benehmen die Achtung und Liebe des Volkes
in demselben Grad zu gewinnen wie ihr verstorbener Gemahl. Spaniens
Zustände sind indes noch durchaus unfertig. Der alte klerikale
Absolutismus ist zwar durch die Unfähigkeit seiner Vertreter
und das Eindringen liberaler Ideen äußerlich
gestürzt und lebensunfähig, aber im Geiste des Volkes so
wenig überwunden und vertilgt, daß sich auch keine
liberale Regierung auf die Masse des Volkes selbst stützen
kann, sondern die Hilfe der Parteiführer und ehrgeizigen
Generale in Anspruch nehmen muß, die wieder ihren
Schützling ausnutzen, diskreditieren und schließlich ins
Verderben fortreißen. Im Bund mit andern Parteien ist jede
Partei im stande, nach einigen Jahren das herrschende Regiment zu
stürzen.
[Litteratur.] Lembke, Geschichte von S. (Bd. 1, Hamb. 1831; Bd.
2 u. 3 von Schäfer, Gotha 1844-1861; fortgesetzt von
Schirrmacher, das. 1881 ff.); Lafuénte, Historia general de
España (Madr. 1850-66, 30 Bde.; neue Ausg., Barcelona 1888,
22 Bde.); Cavanilles, Historia de España (Madr. 1861-65, 5
Bde.); Rico y Amat, Historia politica e parlamentaria de
España (das. 1860-62, 3 Bde.); Alfaro, Compendio de la
historia d'España (5. Aufl., das. 1869); Rosseeuw
Saint-Hilaire, Histoire d'Espagne (Par. 1836-79, 14 Bde.);
Gebhardt, Historia general de España (Madr. 1864, 7 Bde.);
Havemann, Darstellungen aus der innern Geschichte Spaniens, 15.-17.
Jahrh. (Götting. 1850); Fapia, Historia de la civilisazion
d'España (Madr. 1840, 4 Bde.); Montesa u. Manrique, Historia
de la legislazion etc. de España (das. 1861-64, 7 Bde.);
Aschbach, Geschichte der Omaijiden in S. (2. Aufl., Wien 1860, 2
Bde.); Derselbe, Geschichte Spaniens und Portugals zur Zeit der
Herrschaft der Almorawiden und Almohaden (Frankf.1833-37, 2 Bde.);
Dozy, Histoire des Musulmans de l'Espagne (Leid. 1861, 4 Bde.;
deutsch, Leipz. 1873); Derselbe, Recherches sur l'histoire et
la littérature de l'Espagne pendant le moyen-âge
(3. Aufl., Leid. 1881, 2 Bde.); Prescott, History of Ferdinand and
Isabella (deutsch, Leipz. 1842); Derselbe, History of the reign of
Philipp II. of Spain (deutsch, das. 1856-59, 5 Bde.); Häbler,
Die wirtschaftliche Blüte Spaniens im 16. Jahrhundert (Berl.
1888); "Actas de las cortes de Castilla 1563-1713" (Madr. 1861-85);
Morel-Fatio, L'Espagne au XVI. et au XVII. siècle
(Heilbr. 1878); Baumgarten, Geschichte Spaniens zur Zeit der
französischen Revolution (Berl. 1861); Derselbe, Geschichte
Spaniens vom Ausbruch der französischen Revolution bis auf
unsre Tage (Leipz. 1865-71, 3 Bde.); Arteche y Moro, Guerra de la
independencia 1808-14 (Madr. 1868-83, Bd. 1-5); Hubbard, Histoire
contemporaine de l'Espagne (Par. 1869 bis 1883, 6 Bde.);
Lauser, Geschichte Spaniens vom Sturz Isabellas bis zur
Thronbesteigung Alfonsos (Leipz. 1877, 2 Bde.); Borrego, Historia
de las cortes de España durante el siglo XIX (Madr. 1885);
Cherbuliez, L'Espagne politique 1868-73 (Par. 1874); Leopold,
Spaniens Bürgerkrieg (Hannov. 1875); de Castro, Geschichte der
spanischen Protestanten (deutsch, Frankf. 1866); Wilkens,
Geschichte des spanischen Protestantismus im 16. Jahrhundert
(Gütersl. 1887); Kayserling, Geschichte der Juden in S. (Berl.
1861-67, 2 Bde.); Solvay, L'art espagnol (Par. 1886).
Spanierfeige (indische Feige), s. Opuntia.
Spaniol, feiner span. Schnupftabak, wird aus
Havanablättern bereitet und mit einer roten Erde gefärbt;
auch die Raupe des Frostschmetterlings.
Spaniolgeschmack (Spagnialgeschmack), s. Firnewein.
Spanische Artischocke, s. Cynara.
Spanische Fliege, s. Kantharide.
Spanische Kreide, s. Speckstein.
Spanische Kresse, s. v. w. Tropaeolum.
Spanische Litteratur. Die spanische Nationallitteratur,
hervorgegangen aus dem durch heldenhafte Anstrengung erstarkten
eigentümlichen Selbstgefühl eines Volkes, dessen
Phantasie in den Erinnerungen einer thatenreichen Vergangenheit
schwelgte, und durch Reichtum und Originalität der Produktion
auf allen Gebieten der Dichtkunst gleich ausgezeichnet, reicht in
ihren Anfängen bis in die Zeit zurück, wo sich nach der
Eroberung des Landes durch die Araber die ersten christlichen
Staaten im Norden der Halbinsel gebildet hatten. Von der alten
echten Volksdichtung haben sich jedoch nur wenige Denkmäler
und auch diese nicht in ihrer ursprünglichen Gestalt erhalten
können, da sie Jahrhunderte hindurch nur im Munde des Volkes
und in diesem stets sich verjüngend und verändernd
fortlebte und erst aufgezeichnet wurde, als auch die Kunstpoesie
diese Lieder ihrer Beachtung wert fand, d. h. zu Anfang des 16.
Jahrh. Diese ältesten spanischen Volkslieder, bekannt unter
dem Namen Romanzen, waren epischen oder episch-lyrischen Charakters
und hatten hauptsächlich die Thaten der Helden in dem
großen National- und Glaubenskampf gegen die Araber zum
Inhalt. Unter diesen Romanzen sind diejenigen, welche die Thaten
und Schicksale des Cid el Campeador (gest. 1099) feierten,
vorzugsweise berühmt. Die frühsten auf uns gekommenen
Schriftdenkmäler rühren aus dem 13. Jahrh. her, und mit
dieser Zeit beginnt die erste Periode der spanischen
Litteratur.
Erste Periode.
Die s. L. erscheint in dieser Periode, welche bis zu der
Regierung Johanns II. von Kastilien (1406) reicht, als
volkstümlich-nationale mit vorherrschend epischer und
didaktischer Richtung. Das älteste auf uns
89
Spanische Litteratur (bis zum 15. Jahrhundert).
gekommene Werk derselben ist das "Poema del Cid", ein
größtenteils auf alten Volksdichtungen beruhendes Epos
in Form und Geist der französischen Chansons de geste, welches
in oft sehr malerischer Darstellung und kräftigen Zügen,
wenn auch in noch ziemlich roher Form die Thaten und Abenteuer des
Nationalhelden schildert. Verschieden von ihm ist die
"Crónica rimada del Cid" (s. Cid Campeador). Außerdem
gehören hierher als frühste Erzeugnisse spanischer
Kunstpoesie unter dem Einfluß der kirchlich-ritterlichen
Zeitideen: das "Poema de los Reyes Magos" und die Legende von der
Maria Egipciaca aus dem 13. Jahrh.), die Heiligen- und
Marienlegenden des Geistlichen Gonzalo de Berceo (gestorben um
1270), die Bearbeitung der ritterlichen Irrfahrten Alexanders d.
Gr. ("Poema de Alexandro Magno") von Juan Lorenzo Segura, die
spanische Bearbeitung des Romans "Apollonius von Tyrus" sowie die
"Votos de pavon" (ebenfalls noch aus dem 13. Jahrh.) und ein
chronikenartiges Gedicht, das die Thaten des Grafen Fernan
Gonzalez, des Stifters von Kastiliens Größe, besingt
(aus dem 14. Jahrh.). Diese Gedichte sind teils in einreimigen
Alexandrinerstrophen, teils in den nationalen Grundrhythmen der
Redondilien (s. d.) abgefaßt. Noch in das 14. Jahrh. ist wohl
auch die Abfassung der längern, epenartigen Romanzen von Karl
d. Gr. und seinen Paladinen zu setzen. Neben diesen vorwiegend
epischen Dichtungen begann sich während der Regierung Alfons
des Weisen von Kastilien (1252-84) eine didaktische Richtung der
Litteratur zu entwickeln, deren Hauptrepräsentant König
Alfons selber war. Er ließ die Landesgesetze aus der
lateinischen Sprache in die Landessprache bertragen, und auf seine
Veranlassung geschah die Abfassung einer Weltchronik und der
Geschichte der Kreuzzüge ("La gran conquista de Ultramar"),
abgedruckt in der "Biblioteca de autores españoles", Bd. 44)
sowie einer spanischen Chronik, der berühmten "Crónica
general" (Vallad. 1604), ebenfalls in kastilischer Sprache. So
wurde Alfons der eigentliche Schöpfer der spanischen Prosa.
Von poetischen Werken schreibt man ihm außer dem sogen.
"Libro de las querellas", von dem sich nur einige Bruchstücke
erhalten haben, ein didaktisches Gedicht alchimistischen Inhalts,
das "Libro del tesoro o del candado", zu, das jedoch nach einigen
spätern Ursprungs ist. Am wichtigsten sind seine in
galicischer Sprache verfaßten und provençalischen
Mustern nachgebildeten "Cantigas", Loblieder auf die Jungfrau
Maria, welche zum großen Teil in sechs- bis
zwölfzeiligen Versen bestehen und durch ihre Form die
spätere Kunstlyrik der Spanier vorbereiten. Alfons' Beispiel
wirkte ermunternd auf seine Nachfolger. Sein Sohn Sancho IV.,
genannt der Tapfere (gest. 1295), schrieb ein
moralisierend-philosophisches Werk: "Los castigos e documentos",
das Lebensregeln für seinen Sohn Ferdinand IV. enthielt, und
des letztern Sohn Alfons XI., genannt der Gute (gest. 1350), gilt
für den Verfasser einer Reimchronik in Redondilienstrophen,
wie er auch mehrere Werke in kastilischer Prosa abfassen
ließ, namentlich ein Adelsregister ("Becerro") und ein
Jagdbuch ("Libro de monterias", hrsg. von Navarro 1878) sowie
mehrere Chroniken (Ferdinands des Heiligen, Alfons' des Weisen,
Sanchos des Tapfern etc., abgedruckt in dem Werk "Cronicas de los
Reyes de Castilla etc.", Bd. 1, Madr.1876). Der hervorragendste
unter den fürstlichen Autoren jener Zeit ist der Infant Don
Juan Manuel (gest. 1347), am bekanntesten durch sein Werk "El conde
Lucanor" oder "Libro de Patronio", eine zum Teil aus orientalischen
Quellen geschöpfte Rahmenerzählung, in welcher dem Grafen
Lucanor sein Ratgeber Patronio moralische und politische
Ratschläge in Form von Novellen erteilt (s. Manuel 3). Bei
weitem der genialste Dichter jener Periode war aber der Erzpriester
von Hita, Juan Ruiz (gest. 1351), Verfasser eines
merkwürdigen, allegorisch-satirischen Werkes in
Alexandrinerversen ("Libro de cantares"), worin in der Weise Juan
Manuels Fabeln, Schwänke und Geschichten, fromme und
Liebeslieder etc. aneinander gereiht sind, denen eine gemeinsame
Erzählung zu Grunde liegt, nur daß hier der Schwerpunkt
weniger in der moralischen Tendenz als in der naiv anmutigen und
kunstvollen Darstellung liegt. Ein didaktisches Gedicht mit
eingewebten lyrischen Partien ist auch das wieder zumeist in
Alexandrinern abgefaßte Buch über das Hofleben ("Rimado
de palacio") des alten Chronisten und als Übersetzer des
Livius berühmten Pedro Lopez de Ayala (gest. 1407). Ebenso
macht sich in den Gedichten des Rabbi Don Santo, genannt "der Jude
von Carrion", welcher für den König Peter den Grausamen
von Kastilien Ratschläge und Lebensregeln in Versen
abfaßte, in dem Gedicht vom Totentanz: "Danza general de la
muerte", der ältesten Dichtung dieser Art, in der spanischen
Nachahmung der lateinischen "Rixa animae et corporis" u. a. die
didaktische Richtung geltend. Sämtliche bisher genannte
Gedichte sind in Bd. 57 ("Poetas castellanos, anteriores al siglo
XV") sowie die hauptsächlichsten Prosawerke in Bd. 51
("Escritores en prosa, anteriores al siglo XV") der erwähnten
"Biblioteca de autores españoles enthalten. Die Ausbildung
der damaligen historischen Prosa bekunden die Chroniken Ayalas,
Juan Nuñez de Villaizans, die Prosachronik vom Cid, die
Reisebeschreibung Ruy Gonzalez de Clavijos u.a. Auch die Abfassung
des "Amadis von Gallien" (s. Amadisromane), des Ahnherrn der
zahllosen spanischen Ritterromane, gehört dem Schluß
dieser Periode an.
Zweite Periode.
Mit der Regierung Johanns II. von Kastilien (1406-54) begann die
zweite Periode der spanischen Nationallitteratur, welche bis zur
Regierung Karls V., somit bis zum Schluß des Mittelalters,
reicht. Der Sinn für die alten Volkspoesien war
allmählich erloschen, und es kam eine reflektierte Dichtkunst,
eine höfische Kunstlyrik nach dem Muster der Troubadourpoesie
zur Entwickelung, welch letztere in limousinischer Mundart an den
Höfen der Grafen von Barcelona und der Könige von
Aragonien schon längst blühte. Zu der bereits
vorherrschenden didaktischen Richtung gesellten sich gelehrte,
mythologische und allegorische Elemente, die schlichten Reime der
Vorzeit wurden mit verschlungenen Versmaßen vertauscht, und
spitzfindige Geistesspiele und überflüssiger Schmuck
traten an die Stelle der edlen Einfalt, welche die alten Poesien
auszeichnete. Die Dichter dieser neuen Richtung gehörten fast
alle den Hofkreisen an, und ihre Werke tragen einen gemeinsamen
konventionellen Charakter. Der Horizont ihrer immer wiederkehrenden
poetischen Ideen war ein enger, auf den Kreis höfischer
Galanterie beschränkter und eine gewisse Monotonie daher die
unausbleibliche Folge dieser Armut an Ideen und Anschauungen. Zu
den hervorragendsten und einflußreichsten unter diesen
Hofdichtern gehörten: Don Enrique de Aragon, Marques de
Villena (gest. 1434), Verfasser didaktisch-allegorischer Dichtungen
und einer Abhandlung über die Dichtkunst: "La gaya
cienzia"
90
Spanische Litteratur (15. und 16. Jahrhundert).
und sein Schüler Marques de Santillana (gest. 1458), der
die ersten spanischen Sonette dichtete. Neben diesen sind
hervorzuheben: Juan de Mena (gest. 1456; "El laberinto"), Jorge
Manrique (gest. 1479), Macias, genannt "der Verliebte", der in
galicischer Sprache dichtete, und sein Freund Juan Rodriguez del
Padron, der auch eine Novelle: "El siervo", hinterließ;
ferner: Garci-Sanchez de Badajoz, Alonzo de Cartagena (eigentlich
Alfonso de Santa Maria), Diego de San-Pedro (um 1500), besonders
durch seinen halb metrischen, halb prosaischen Roman "El carcel de
Amor" berühmt, Fernan Perez de Guzman (gest. 1470), Verfasser
geistlicher Lieder, doch mehr noch als Geschichtschreiber
hervorragend, Alvarez Alfonso de Villasandino, Francisco Imperial
u. a. Die Werke dieser und vieler andrer Dichter sind gesammelt in
den sogen. "Cancioneros" (Liederbüchern), namentlich im
"Cancionero general" (zuerst Valenc. 1511), während die Werke
eines andern Dichterkreises, der sich um König Alfons V. von
Aragonien scharte, in dem "Cancionero de Lope de Stuniga" enthalten
sind (s. Cancionero). Sehr bemerkenswert ist die Ausbildung der
spanischen Prosa in diesem Zeitraum. Eine Anzahl wichtiger
Chroniken behandelt die Geschichte nicht nur der verschiedenen
Regenten, sondern auch bedeutender Privatpersonen. Unter diesen
sind das Leben des Feldherrn Pero Niño, Grafen von Buelna,
von Gutierre Diez de Game, die Geschichte des Connétable
Alvaro de Luna, von unbekanntem Verfasser (1546), die spanische
Chronik des Diego de Valera besonders bemerkenswert. Beachtung
verdienen namentlich auch die biographischen Werke des genannten F.
P. de Guzman ("Generaciones y semblanyas", Biographien
berühmter Zeitgenossen) und des Hernando del Pulgar ("Los
claros varones de Castilia", 1500), in denen sich bereits ein
nennenswerter Fortschritt vom Chronikenstil zu pragmatischer
Darstellung zeigt. Von Pulgar, dem hervorragendsten Prosaisten der
Periode, hat sich auch eine Anzahl Briefe erhalten, die, wie der
gleichfalls erhaltene und anziehende, aber wegen seiner Echtheit
angefochtene Briefwechsel des Leibarztes Johanns II., F. Gomez de
Cibdareal, einen nicht geringen Begriff vom Briefstil der damaligen
Zeit geben. Einen schätzenswerten Beitrag zur Sittengeschichte
gab Alfonso Martinez de Toledo, Erzpriester von Talavera, in seinem
"Corbacko" (zuerst 1499), einem Werk über die Sitten der
Weiber von schlechtem Lebenswandel. Endlich fallen in diese Periode
auch die ersten Anfänge des spanischen Dramas, das sich aus
ländlichen Festspielen und den in Kirchen aufgeführten
Mysterien (s. Auto) entwickelte. Hierher gehören die zum Teil
geistlichen Schäferspiele (Eklogen) des Juan del Encina (gest.
1534), die Komödien Gil Vicentes (gest. um 1540), eines
Portugiesen, der aber zum Teil in kastilischer Sprache schrieb,
ferner der so berühmt gewordene dramatische Roman "Celestina"
(in 21 Akten) von Fernando de Rojas (1500), der vielfache
Nachahmungen hervorrief, und die von der Inquisition nachher
verbotenen Schauspiele von Bartolome de Torres Naharro (in
"Propaladia", 1517), die sich durch phantasievolle Erfindung und
gewandten Versbau auszeichnen und in der Entwickelung des
spanischen Theaters einen merklichen Fortschritt bekunden.
Dritte Periode.
Die dritte Periode reicht von der Begründung der spanischen
Universalmonarchie durch Karl V. im Anfang des 16. Jahrh. bis zum
Schluß des 17. Jahrh. und begreift die allseitige
Entwickelung und höchste Blüte der spanischen Litteratur
sowie deren allmählichen Verfall, so gleichen Schritt haltend
mit der Entwickelung der politischen und sozialen Zustände des
Reichs. Alles, was in der vorigen Periode sich vorbereitet hatte,
kam in dieser zur Entwickelung, besonders infolge der politischen
Verbindung Spaniens mit Italien, das seit der Eroberung Neapels
durch Ferdinand de Cordova (1504) fast ein Jahrhundert hindurch
einen sehr bemerkbaren Einfluß äußerte.
Altklassische und italienische Muster, die italienischen
Versmaße, die Formen des Sonetts, der Stanze (ottave rime),
Terzinen, Kanzonen etc. fanden in Spanien Nachahmung, ohne
daß dabei die spanische Poesie, welche nach wie vor eine
durchaus volkstümliche Grundlage hatte, ihres nationalen
Charakters verlustig ging. Überdies stand der italienischen
Schule eine streng an den Nationalformen haltende Partei
gegenüber, bis sich die schroffen Einseitigkeiten beider
Parteien allmählich abgeschliffen hatten und aus der
Verschmelzung beider nun in ihrer Art vollendete Kunstwerke
hervorgingen. Der erste Dichter, welcher sich nach italienischen
und altklassischen Mustern bildete, war Juan Boscan Almogaver aus
Barcelona (gest. 1543); ihm ebenbürtig zur Seite standen sein
Freund Garcilaso de la Vega aus Toledo (gest. 1536), der Petrarca
der kastilischen Poesie genannt, und Diego Hurtado de Mendoza
(gest. 1575), Dichter vortrefflicher Episteln, auch Verfasser des
Schelmenromans "Lazarillo de Tormes" und sonst als Gelehrter und
Staatsmann gleich ausgezeichnet. Von großem Einfluß
wurde der in kastilischer Mundart schreibende Portugiese Jorge de
Montemayor (gest. 1561), der mit seiner "Diana" den (halb aus
Prosa, halb aus Versen bestehenden) Schäferroman
einführte, und mit dem sein Landsmann Sa de Miranda (gest.
1588) sowie Pedro de Padilla in der pastoralen Poesie wetteiferten.
Als Dichter schwungvoller, rhythmisch vollendeter Oden
glänzten daneben Hernando de Herrera (gest. 1597) und Luis
Ponce de Leon (gest. 1591), dem die Verbindung altklassischer
Korrektheit mit tief religiösem Gefühl am
vorzüglichsten gelang. Außerdem sind Hernando de
Acuña (gest. 1580), welcher zwischen dem italienischen und
dem Nationalstil die rechte Mitte zu treffen wußte, und der
Lieder- und Madrigalendichter Gutierre de Cetina (gest. 1560) als
begabte Anhänger der neuen Schule zu erwähnen. An der
Spitze der Gegner des italienischen Stils und der Verteidiger der
altspanischen Naturpoesie stand Cristoval de Castillejo (gest.
1556), dessen Romanzen und erotische Volkslieder echte
Heimatlichkeit atmen, während seine Satiren oft zu sehr
übertreiben. Unter seinen Parteigängern sind Antonio de
Villegas und Gregorio Silvestre namhaft zu machen, die sich durch
zierlichen Versbau auszeichneten, aber Castillejo nicht entfernt
gleichkamen. Endlich sei noch Francisco de Aldana (1578 in der
Schlacht bei Alcazarquivir gefallen) erwähnt, dem die
Zeitgenossen wegen der Hoheit seiner Gesinnung und seiner
bilderreichen und glühenden Sprache den Beinamen des
Göttlichen gaben. Nicht gleichen Schritt mit den lyrischen
Produktionen hielt die epische Poesie der Spanier, deren
Gestaltungskraft auf diesem Gebiet sich in dem Heldengedicht vom
Cid erschöpft zu haben schien. Von den vielen neuern epischen
Versuchen im 16. Jahrh., zu denen der Kriegsruhm Karls V. und die
Entdeckung von Amerika Anlaß gaben, den "Caroleen" und
"Mexikaneen", ist nur eine zu nennen, welche sich durch echt
epischen Geist und epische Unmittelbarkeit auszeichnet: die
"Arau-
91
Spanische Litteratur (16. Jahrhundert).
cana" des Alonso de Ercilla (gest. 1595), in welche der
Verfasser einen Teil seiner eignen Lebensgeschichte verflochten
hat. Mit dem neubelebten Nationalbewußtsein war dabei auch
bei den Kunstdichtern ein historisches oder ästhetisches
Interesse an den alten Volksromanzen erwacht, die neu aufgezeichnet
und gesammelt wurden. Auf diese Weise entstanden von der Mitte des
16. bis zur Mitte des 17. Jahrh. eine Reihe von Romanzensammlungen
("Romanceros"), die allerdings neben den echten alten epischen
Volksromanzen eine Unzahl gemachter chronikenartiger oder rein
lyrischer Produkte, Werke von Gelehrten und Kunstdichtern,
enthalten. Die reichhaltigste dieser Sammlungen ist der 1604
erschienene Romancero general" (s. Romanze).
Befruchtend wirkten die epischen Elemente der alten
Volksromanzen in Verbindung mit der kunstmäßig
ausgebildeten Lyrik auf die Entwickelung der Comedia, des
nationalen Dramas, des eigentlichen sprechenden Ausdrucks des
poetischen Lebens der Nation. Dieses hatte gleich beim Beginn
seiner Entwickelung in den bereits früher erwähnten
Dichtern Naharro und Gil Vicente die Repräsentanten der
Hauptrichtungen gefunden, die später eingeschlagen wurden,
indem der erstgenannte mehr idealisierend zu den phantasiereichen
Schöpfungen der heroischen Verwickelungs- und
Intrigenstücke (comedias de ruido, comedias de capa y espada)
anregte, der letztere aber der Vorläufer jener Dramatiker
wurde, welche in der Darstellung des Volkslebens in seiner
Wirklichkeit ihre Aufgabe suchten. Letztern schlossen sich
zunächst Lope de Rueda (um 1560), Verfasser der Stücke:
"Comedia de las engañas" und "Eufemia", und Alonso de la
Vega sowie die zahlreichen Verfasser der sogen. Vor- und
Zwischenstücke (loas, pasos, farsas, entremeses, sainetes und
comedias de figuron) an. Neben diesen Gattungen bestanden die
geistlichen Schauspiele, aus denen zunächst das spanische
Drama hervorgegangen ist, fort und bildeten sich in der Folge nach
verschiedenen Richtungen, als Autos sacramentales
(Fronleichnamsspiele) und Autos al nacimiento (zur Feier der Geburt
Christi), selbständig aus (s. Auto). Die gelehrten
Klassizisten versuchten zwar um die Mitte des 16. Jahrh. durch
Übersetzung und Nachbildung antiker Stücke auch das
spanische Drama nach den Mustern des klassischen Altertums
umzugestalten, und mehrere Dramatiker, z. B. Geronimo Bermudez, der
unter dem Namen Antonio de Silva Tragödien mit Chören
schrieb, schlossen sich dieser antikisierenden Richtung an; allein
sie vermochten die volle originale Entwickelung des spanischen
Dramas nicht zu hemmen, und die begabtesten Dichter folgten bald
ausschließlich der nationalen Fahne. Zu diesen gehörten
namentlich: Juan de la Cueva (um 1580), Verfasser der Komödie
"El infamador", der in seinem Buch "Exemplar poetico" auch eine
spanische Poetik aufstellte, Rey de Artieda, Dichter der "Amantes
de Teruel", eines Stücks von hoher Schönheit, und
Cristoval de Virues (gest. 1610), dessen Tragödien (besonders
"Semiramis" und "Cassandra") wahres tragisches Pathos und ein
kräftiger, ungezwungener Dialog nachzurühmen sind.
Die Entwickelung der spanischen Prosa blieb im 16. Jahrh. hinter
den poetischen Fortschritten nicht zurück; durch das immer
allgemeiner werdende Studium des Altertums gewann dieselbe an
Klarheit, Kraft und Eleganz. Der erste, welcher sie auch für
didaktische Werke, für die Darstellung philosophischer
Gedanken und Betrachtungen mit Erfolg anwandte, war Fernan Perez de
Oliva (gest. 1534), der Verfasser des gediegenen Werkes "Dialogo de
la dignidad del hombre", zu welchem Francisco Cervantes de Salazar
eine nicht minder treffliche Fortsetzung lieferte, und seinem
Beispiel folgte eine große Anzahl von Schriftstellern, von
denen nur Antonio de Guevara (gest. 1545) mit seinem Hauptwerk:
"Relox de principes, o Marco Aurelio". einer Art didaktischen
Romans, und seinen (zum größern Teil erdichteten)
"Epistolas familiares" erwähnt sei. Auf dem Gebiet der
Geschichtschreibung gab man den alten Chronikenstil jetzt
gänzlich auf und suchte die historische Kunst in pragmatischer
Darstellung und schöner Form den Griechen und Römern
abzulernen. Dieses Bestreben zeigt sich bereits bei den
Historiographen Karls V., Pero Mexia und Juan Ginez de Sepulveda
(gest. 1574), entschiedener aber noch bei den eigentlichen
Vätern der spanischen Geschichtschreibung: Geronimo Zurita aus
Saragossa (gest. 1580), Verfasser der wichtigen "Anales de la
corona de Aragon", welche später in dem Dichter Bartol.
Leonardo Argensola einen Fortsetzer fanden, und Ambrosio de Morales
(gest. 1591), der die von Florian de Ocampo begonnene Geschichte
Kastiliens mit Umsicht und Kritik weiterführte. Als das erste
spanische Geschichtswerk aber von klassischem Wert muß die
Geschichte des Rebellionskriegs von Granada ("Historia de la guerra
de Granada") des oben als Dichter erwähnten Diego de Mendoza
(gest. 1575) genannt werden. Weiter sind zu erwähnen die
Berichterstatter über die Neue Welt: Fernandez de Oviedo, der
eine "Historia general y natural de las Indias" (1535) schrieb, und
der edle Las Casas (gest. 1566), dessen "Historia de las Indias"
1876 zum erstenmal veröffentlicht wurde, namentlich aber der
Jesuit Juan de Mariana (gest. 1623), Verfasser einer "Historia de
España", die bis zur Thronbesteigung Karls V. (1516) reicht
und rhetorische Kraft mit Anschaulichkeit der Charakteristik und
freimütiger Gesinnung verbindet. Eine Stelle in der spanischen
Literaturgeschichte beanspruchen auch die nach seiner Flucht aus
Spanien geschriebenen, in klassischem Stil abgefaßten Briefe
des berühmten Geheimschreibers Philipps II., Antonio Perez
(gest. 1611), denen man die der heil. Teresa de Jesus (gest. 1582),
obschon ihrer Art nach ganz verschieden von jenen, an die Seite
stellen kann; ebenso die asketischen und religiösen
Erbauungsbücher von Fray Luis de Leon (Klostername des
Dichters Ponce de Leon) und dem Kanzelredner Fray Luis de Granada
(gest. 1588), die Schriften ähnlicher Art von San Juan de la
Cruz und Malonde Chaide ("La conversion de Madalena") u. a. Auch
der erste spanische Versuch eines historischen Romans, die
vortreffliche "Historia de las guerras civiles de Granada" von G.
Perez de Hita (um 1600), fällt in diese Zeit. In ihrer
höchsten Vollendung zeigte sich aber die kastilische Sprache
erst in dem größten und tiefsinnigsten Schriftsteller
Spaniens, Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), der alle
Richtungen der Zeit in sich vereinigte, aber über denselben
stand und nicht nur in seinem unübertroffenen satirisch -
komischen Roman "Don Quijote", der dem herrschenden Unwesen der
Ritterromane den Todesstoß versetzte, und in seinen "Novelas"
Meisterleistungen aufstellte, sondern auch den Schäfer- und
den Liebesroman kultivierte und sogar auf dramatischem Gebiet mit
seiner "Numancia" und den "Entremeses" Werke von nationaler
Bedeutung schuf.
Mit dem 17. Jahrh., in das Cervantes' "Don Qui-
92
Spanische Litteratur (17. Jahrhundert).
jote" (1604) überleitet, tritt das spanische Drama in die
Periode seiner höchsten und glänzendsten Entwickelung,
die bis fast zum Ausgang des Jahrhunderts dauert, und die
übergroße Zahl von Bühnendichtern, welche diese
Zeit aufzuweisen hat, teilt sich in zwei große Gruppen, als
deren Mittelpunkt zwei der größten und fruchtbarsten
dramatischen Genien aller Zeiten: Lope de Vega Carpio (1562-1635)
und Calderon de la Barca (1600-1681) glänzen. Von den
Anhängern des ältern Lope nennen wir als die
bedeutendsten: Perez de Montalvan (gest. 1638), Verfasser des lange
Zeit beliebten Schauspiels "Los amantes de Teruel" (ein Stoff, den
früher bereits Artieda behandelt hatte) sowie geschichtlicher
Dramen, mit trefflicher Charakterschilderung (z. B. "Juan
d'Austria") und höchst eigentümlicher Autos ("Polifema");
Tarrega ("La enemiga favorable"); Guillen de Castro (gest. 1638),
dessen Hauptwerk: "Las mocedades del Cid", das Vorbild von
Corneilles "Cid" war; Gabriel Tellez, als Dichter den Namen Tirso
de Molina führend (gest. 1648), nach Lope, der fruchtbarste
spanische Schriftsteller, Verfasser von "El burlador de Sevilla",
der ersten Dramatisierung der Don Juan Sage; Juan Ruiz de Alarcon
(gest. 1639), ein origineller Dichter voll glühender Phantasie
und plastischer Kraft, dessen "Tejedor de Segovia" und "Ganar
amigos" unter die Meisterstücke der heroisch-romantischen
Gattung gehören (sein Lustspiel "La verdad sospechosa" wurde
das Vorbild von Corneilles "Menteur"); ferner: Luis Velez de
Guevara (gest. 1646), der die Erscheinungen des äußern
Lebens in wirkungsvoller Weise darzustellen weiß und
besonders durch sein Drama "Mas pesa el rey que la sangre", eine
Verherrlichung der Lehnstreue, berühmt ist; Antonio Mira de
Mescua (um 1630), dessen "Esclavo del demonio" Calderon in seiner
"Andacht zum Kreuz" benutzt hat, u. a. Viele vortreffliche
Stücke stammen auch aus der Zeit des Lope, deren Verfasser
unbekannt geblieben sind, und die gewöhnlich unter dem Titel:
"Comedias famosas par un ingenio de esta corte" angezeigt wurden;
am meisten Aufsehen unter denselben erregte "El diablo prediador".
Die genannten Dichter, ausgezeichnet durch reiche Erfindungsgabe
und geniale Konzeption, sind denn die eigentlichen Schöpfer
des spanischen Dramas, und sie schufen dasselbe aus rein nationalen
Elementen, aus volkstümlicher Begeisterung und frischer,
glühender Phantasie. Da bei Calderon zu dieser
Originalität und sprudelnden Fülle noch die
künstlerische Reflexion und die sorgsamere Ausführung im
einzelnen hinzukamen, so erreichte in ihm das spanische Drama den
Gipfel der Vollendung. Die namhaftesten unter seinen Zeitgenossen
und Nachfolgern sind: Agostin Moreto (gest. 1668), der weniger
durch die Originalität und Kühnheit der Erfindung als
durch sorgfältige Entwickelung fein ausgearbeiteter
Entwürfe glänzt (Hauptwerk: "El valiente justiciero");
Francisco de Rojas (um 1650), der sowohl im Intrigenstück als
in der Tragödie Ausgezeichnetes leistete (am populärsten:
"Del rey abajo niguno", eine Schilderung des Konflikts zwischen
Königstreue, Ehre und Liebe); Matos Fragoso, durch
liebenswürdige Wärme der Darstellung und Eleganz des
Stils ausgezeichnet (bestes Drama: "El villana en su rincon", eine
gelungene Bearbeitung des gleichnamigen Stückes von Lope), und
Juan Bautista Diamant e (blühte um 1674), dessen
geschichtliche Dramen (z. B. "El hijo, honrador de su padre", das
die Geschichte des Cid zum Vorwurf hat, und "Judia de Toledo")
historischer Geist und feines Verständnis beleben; Juan de la
Hoz Mota, dessen Lustspiel "El castigo de la miseria" allezeit ein
Stolz der Spanier war; der oben genannte, auch als Dramendichter
ausgezeichnete Historiker Antonio de Solis (gest. 1686), von dessen
heroischen Schauspielen besonders "El alcasar del secreto" und die
"Gitanella de Madrid" zu den Lieblingsstücken damaliger Zeit
gehörten; Antonio Enriquez Gomez (um 1650), Verfasser
zahlreicher Komödien sowie lyrischer Gedichte und satirischer
Charakterbilder in Prosa (s. unten); Agustin de Salazar (gest.
1675), der sich wenigstens in einigen seiner Dramen, wie "Elegir al
enemigo", und in dem feinen Sittengemälde "Segunda Celestina"
als echter Dichter bewährte; Antonio de Leyba, Fernando de
Zarate, Cristoval de Monroy, Geronimo de Cuellar u. v. a. Der
Reichtum der spanischen Bühne jener Zeit ist in der That
unübersehbar, und die ungeheure Wirkung, welche dieselbe
dauernd ausübte, lag darin, daß es der Geist und die
Seele des ganzen Volkes waren, welche in ihren Schöpfungen
pulsierten und sie zum Gemeingut dieses Volkes machten. Gegen den
Ausgang des Jahrhunderts beginnt die dramatische Poesie endlich zu
ermatten, aber selbst die bereits der Verfallzeit angehörenden
Schauspiele von Franc. Bances Cándamo (gest. 1709; "Por su
rey y por su dama", "Esclavo en grillos de oro "), Cañizares
(gest. 1750), der mit sogen. Comedias de figuron (worin irgend eine
lächerliche Figur den Mittelpunkt bildet) seine Haupterfolge
erzielte, und Antonio Zamora (gest. 1730) atmen immer noch echt
spanischen Geist. Mit dem durchaus volkstümlichen Drama konnte
sich die gelehrte Kunstpoesie im 17. Jahrh. weder an vielseitiger
Ausbildung noch an Beliebtheit messen.
Die phantasievolle Weise Lope de Vegas hatte in der Lyrik
Eingang gefunden, wurde jedoch bald von einzelnen Dichtern durch
gezierte und schwülstige Wendungen und Ausdrücke bis zur
Karikatur verzerrt, und an die Stelle der Gedanken und Empfindungen
traten leeres Gepränge hochtönender Worte, abenteuerliche
und gesuchte Bilder und Gleichnisse und geschraubte, in erhabene
Dunkelheit gehüllte Phrasen. Der Hauptträger dieser
geschmacklosen Richtung war Don Luis de Gongora (gest. 1627), der
Erfinder des sogen. Estilo culto und Begründer einer besondern
Dichterschule, der Gongoristen oder Kulturisten, die mit der Zeit
einen verderblichen Einfluß auf den Geschmack der Zeit
ausübte, und als deren ausgezeichnetstes Mitglied der durch
sein tragisches Geschick bekannte Graf von Villamediana (ermordet
1621) zu nennen ist. Von den Gongoristen unterschieden sich die
sogen. Konzeptisten insofern, als sie das Hauptgewicht auf den
gedanklichen Inhalt der Dichtung legten, der sich nicht selten ins
Mystische verlor; an ihrer Spitze standen Felix de Arteaga (gest.
1633) und Alonso de Ledesma (gest. 1623; "El monstruo imaginado").
Die talentvollern Dichter gehörten gleichwohl zu den Gegnern
Gongoras, obschon auch sie der herrschenden Mode
Zugeständnisse machen mußten, so die beiden Brüder
Lupercio Leonardo und Bartolome de Argensola (gest. 1613 und 1631),
zwei Lyriker, die, Horaz und den Italienern nacheifernd, klassische
Korrektheit des Stils mit poetischem Gefühl und
glücklichem Darstellungstalent verbinden; Estevan Manuel de
Villegas (gest. 1669), als der erste unter den erotischen Dichtern
anerkannt; Francisco de Rioja (gest. 1659), Verfasser
vortrefflicher Lieder und Oden; Juan de Arguijo (um 1620), ein
zartsinniger Sonettensän-
93
Spanische Litteratur (17. und 18. Jahrhundert).
ger, besonders bekannt durch sein Gedicht auf seine Leier;
ferner Juan de Jauregui (gest. 1641), der Übersetzer von
Tassos "Aminta" und Verfasser einer Dichtung: "Orfeo", in fünf
Gesängen; Francisco de Borja, Principe de Esquilache (gest.
1658), mehr durch seine Romanzen und kleinern lyrischen Gedichte
als durch seine größern Werke ("Napoles recuperada")
hervorragend; Vicente Espinel (gest. 1634), der teils in
italienischen Silbenmaßen, teils im altspanischen Stil
dichtete, auch eine neue Art eigentümlich gereimter Dezimen
(die sogen. Espinelen) einführte. Vorzugsweise in der
pastoralen und der epischen Dichtung glänzte Bernardo de
Balbuena (gest. 1627), Verfasser des romantischen Heldengedichts
"Bernardo" und des Schäferromans "El seglo de oro",
während die "Selvas danicas" des Grafen Bernardino de
Rebolledo (gest. 1676), eine Art Epos, worin die ganze Geschichte
und Geographie Dänemarks versifiziert vorgetragen wird, und
andre ähnliche Werke desselben Verfassers das Herabsinken der
spanischen Poesie zu nüchternem Formenwesen kennzeichnen. Als
trefflicher Lyriker, namentlich durch burleske Lieder und Romanzen
("Jacaras") glänzte ferner Francisco Gomez de Quevedo (gest.
1645), der auch auf andern Gebieten zu den ersten und geistvollsten
Autoren gehört (s. unten). Von den übrigen Dichtern seien
noch flüchtig erwähnt: der humoristische und schalkhafte
Balthasar de Alcazar (gest. 1606), Martin de la Plaza, der
heldenhafte Gonzalo de Argote y Molina, Sänger patriotischer
Lieder, auch Geschichtschreiber; Francisco de Figueroa, genannt der
"spanische Pindar"; Luis Barahona de Soto, Verfasser der "Lagrimas
de Angelica", einer eleganten und langweiligen Fortsetzung des
"Rasenden Roland", die ungewöhnlichen Beifall fand; Francisco
de Medrano, Luis de Ulloa, der schon als Dramatiker erwähnte
Agustin de Salazar (gest. 1675), der sich durch seine "Cythara de
Apolo" als blinder Anhänger des "Estilo culto" bewies; Agustin
de Tejada, Pedro Soto de Rojas, Lopez de Zarate (gest. 1658),
Verfasser des Epos "La invencion de la cruz"), die Nonne Ines de la
Cruz aus Mexiko u. a. Eine Sammlung lyrischer Gedichte des 16. und
17. Jahrh., deren wesentliche Vorzüge in der hohen metrischen
Ausbildung der Formen und der durchdachten, fein zugespitzten
Konzeption bestehen, enthält Bd. 42 der "Biblioteca de autores
españoles".
Auf dem Gebiete der Prosa traten nach den glänzenden Werken
des Cervantes nur Leistungen von geringerm Belang hervor. Der
Ritterroman war, besonders in den zahllosen Nachahmungen des
"Amadis", zur Karikatur herabgesunken; auch der Schäferroman,
obwohl noch von zahlreichen Schriftstellern, darunter von Lope de
Vega ("Arcadia"), Luis Galvez de Montalvo ("Filida") u. a.,
kultiviert, verlor mehr und mehr in der Meinung des Publikums. Bei
weitem größern Beifall fanden die Schilderungen der
Sitten und gesellschaftlichen Verhältnisse der Gegenwart,
denen sich die vorzüglichsten Autoren jetzt mit Vorliebe
zuwandten und zwar teils in Form kleinerer Novellen, in welcher
Gattung Cervantes den Ton angegeben hatte, dem Geronimo Salas
Barbadillo (gest. 1630), die Dramatiker Tirso de Molina
("Cigarrales de Toledo") und Perez de Montalvan ("Para todos")
nebst einer ganzen Reihe anderer, wie Francisco Santos Vargas,
Ribera, Prado etc., darunter auch zwei Frauen: Mariana de Carbajal
(um 1633) und Maria de Zayas (um 1650), mit mehr oder minder
Glück nacheiferten; teils in jenen berühmten
Schelmenromanen nach dem Muster des "Lazarillo de Tormes" von
Mendoza (s. oben), so in der witzigen "Historia del gran
Tacaño" von Quevedo, in "Marcos de Obregon" von Vicente
Espinel, in "Vida y hechos del picaro Gusman del Alfarache" von
Mateo Aleman, in der "Picara Justina" von Franc. Lopez de Ubeda
(Andres Perez), in der "Vida de Don Gregorio Guadaña" von
Ant. Enriquez Gomez; in der berüchtigten Selbstbiographie von
Estevanillo Gonzalez (1646) u. a. Eine dritte Reihe von
Darstellungen des spanischen Lebens bilden die Erzählungen in
jenem burlesk-phantastischen Stil, der zuerst von Quevedo in seinen
fein, aber bitter satirischen "Sueños" und den witzigen
"Cartas del caballero de la tentenaza" aufgebracht, dann von Velez
de Guevaraz in seinem "Diablo cojuelo" u. a. weiter ausgebildet
wurde. Mit der Zeit litt indessen auch die Prosa durch den
Einfluß der Gongoristen und sank zu den Bizarrerien des
Estilo culto herab; unter den Schriftstellern dieser Schule ist der
bekannteste der Jesuit Baltazar Gracian (gest. 1658), von dessen
Schriften besonders der "Criticon", eine Allegorie auf das
menschliche Leben in Novellenform, und der einst vielbewunderte
"Oraculo manual", eine Zusammenstellung von Regeln der
Weltklugheit, zu erwähnen sind. Die Geschichtschreibung, deren
Ausbildung durch religiösen und politischen Druck in jeder
Weise behindert war, hat nach Mariana nur noch zwei Schriftsteller
von Bedeutung aufzuweisen: Francisco Manuel de Melo (gest. 1665),
der die Geschichte des Kriegs in Katalonien schrieb, und den schon
als Dramatiker erwähnten Antonio de Solis, Verfasser einer
Geschichte der Eroberung von Mexiko, die wie ein Heldengedicht in
Prosa gemahnt, aber an Befangenheit des Urteils und Mangel an
Objektivität leidet.
Vierte Periode.
Die vierte Periode, welche von der Thronbesteigung der Bourbonen
(1701) bis auf unsre Zeit reicht, ist charakterisiert durch die
Herrschaft des französischen Kunstgeschmacks und die
schließliche Wiedergeburt der spanischen Litteratur, die sich
durch Verschmelzung der nationalen Elemente mit der
modern-europäischen Bildung allmählich vollzog. Nachdem
die Litteratur lange Zeit in derselben Art von Marasmus gelegen, in
welchen die ganze Nation seit dem Tode des letzten und
unfähigsten Habsburgers, Karls II., unter dessen Regierung der
letzte Schimmer von Spaniens ehemaliger Größe
verschwand, versunken war, kam gegen die Mitte des 18. Jahrh. durch
die bourbonische Dynastie ein neuer Geist, der französische,
über die Pyrenäen, der bei der Verwilderung und
Erschöpfung des alten Nationalgeschmacks als ein
Regenerationsmittel bald Einfluß gewinnen mußte.
Eingang verschaffte ihm namentlich Ignacio de Luzan (gest. 1754),
der in seiner Schrift "La Poetica" (1737) die
französisch-klassische Kunstlehre erörterte und damit
sofort begeisterte Anhänger fand. Unter ihnen haben namentlich
die Gelehrten L. J. Velasquez (gest. 1772) in seinen "Origenes de
la poesia castellana" (1754) und Gregorio de Mayans (gest. 1782) in
"Retorica" (1757) die Theorie Luzans weiter entwickelt.
Gleichzeitig wirkte der Benediktinermönch Benito Geronimo
Feyjoo (gest. 1764) durch seine "Cartas eruditas y curiosas"
für Aufklärung des verdummten Volkes und Reform der
Wissenschaften, während etwas später unter der
aufgeklärten Regierung Karls III. José Franc. de Isla
(gest. 1781) in dem satirischen Roman "Fra Gerundio de Campazas"
sogar gegen die Mißbräuche der Kirche zu Felde zog.
Inzwischen war auch eine Reaktion des alten Nationalgeistes
gegen
94
Spanische Litteratur (18. und 19. Jahrhundert).
die Bestrebungen der Neuerer, der Gallizisten, eingetreten, und
als Hauptverfechter desselben trat jetzt, wenn auch mehr
theoretisch als durch eigne Schöpfungen, der patriotische,
aber blind eifernde Garcia de la Huerta (gest. 1787) auf.
Gleichzeitig wußten Lopez de Sedano durch seinen "Parnas
español", eine Sammlung der bemerkenswertesten Dichtungen
des 16. und 17. Jahrh., und Tomas Antonio Sanchez durch eine
Auswahl der ältesten spanischen Dichtungen sowie Sarmiento
durch seine "Historia de la poesia español" die absolute
Herrschaft der Gallizisten zu verhindern und das Interesse für
heimische Poesie wieder anzuregen. Als der erste bedeutendere
Schriftsteller der französischen Richtung ist Nicolas Fernando
Moratin (gest. 1780) zu nennen, der als Epiker wie namentlich als
dramatischer Dichter thätig war; aus der großen Menge
von Dramatikern der nationalen Richtung ragt indessen nur der
fruchtbare Ramon de la Cruz (gest. 1795), besonders durch seine von
genialem Humor erfüllten Sainetes (Zwischenspiele),
glänzend hervor. Bald bildete sich wieder eine Dichterschule,
nach ihrem Hauptsitz die "Schule von Salamanca" genannt, die eine
vermittelnde Stellung einnahm, insofern ihre Mitglieder gegen die
Anforderungen des Zeitgeistes nicht blind, aber doch patriotisch
genug waren, um neben den modernen fremden auch die einheimischen
Muster der guten Zeit zu berücksichtigen. Das eigentliche
Haupt dieser Schule war Juan Melendez Valdes (gest. 1817), der die
Nation wieder zu enthusiasmieren wußte und auch das
philosophische Element in die spanische Dichtung aufnahm; zu ihren
Anhängern gehörten: Nicasio Alvarez Cienfuegos (gest.
1809), ein Dichter zarter und anmutiger Liebeslieder; José
Iglesias de la Casa (gest. 1791), besonders im Epigramm und in
kleinen satirischen Gedichten ausgezeichnet; Tomas de Iriarte
(gest. 1791), der die Fabel in die spanische Dichtkunst
einführte und darin in Felix Maria de Samaniego (gest. 1801)
einen glücklichen Nachfolger fand; ferner die schon
ältern José de Cadalso (gest. 1782), Verfasser der
Satire "Los eruditos á la violeta" und der "Cartas
Marruecas", und der Staatsmann und Patriot Gaspar Melchior de
Jodellanos (gest. 1811), ein hochbegabter Schriftsteller und reiner
Charakter, der auf die Wiedergeburt der spanischen Litteratur von
großem Einfluß war. Auch Pablo Forner (gest. 1797), der
Pater Diego de Gonzales (gest. 1794), Leon de Arroyal, Graf
Noroña u. a., die zum Teil auch die Italiener nachahmten,
dürfen der Dichterschule von Salamanca beigezählt werden.
Strenger am französischen System hielt der talentvolle Leandro
Fernandez de Moratin (der jüngere, 1760-1828), besonders in
seinen Lustspielen ("El si de las niñas"), die sich, wie
auch seine übrigen Werke (Oden, Sonette, Epigramme, das Idyll
"La ausencia" etc.) durch Anmut der Schreibart und Feinheit des
Geschmacks auszeichen und mit verdientem Beifall aufgenommen
wurden.
Die verhängnisvollen Ereignisse des 19. Jahrh., der
Unabhängigkeitskrieg gegen die Besitzergreifung Spaniens durch
Napoleon und die diesem folgenden Aufstände, übten
einerseits einen nachteiligen Einfluß auf die Litteratur, da
sie die Muße zu litterarischen Arbeiten nahmen und die
politischen Kämpfe und Debatten einen großen Teil der
vorhandenen Talente verzehrten; anderseits wirkte aber der durch
den Unabhängigkeitskrieg errungene Sieg über die
französische Usurpation wie in politischer, so auch in
litterarischer Hinsicht belebend, und der politische Anteil an der
Regierung, den die Nation durch die innern Umwälzungen errang,
trug zu ihrer allseitigern Geistesentwickelung bei und gab der
Litteratur wieder eine mehr patriotische und selbständige
Haltung. Von den Schriftstellern und Gelehrten, welche sich an den
politischen Kämpfen beteiligten, sei hier nur an Antonio de
Capmany (gest. 1813), der staatsrechtliche Schriften sowie eine
"Filosofia de elocuencia" und den "Tesoro de prosadores
españoles" herausgab, den Nationalökonomen Florez
Estrada und die Publizisten Donoso Cortes, Conde de Toreno und
José de Lara (gest. 1837), erinnert, welch letzterer, einer
der vorzüglichsten Schriftsteller Spaniens (auch unter dem
Namen Figaro bekannt), seine Zeit mit all ihren Erscheinungen auf
dem Gebiet des politischen wie des sozialen Lebens einer strengen
Kritik im Gewand originellen Humors und treffender Satire unterzog,
aber auch als Dichter sich auf dem Felde des Romans und des Dramas
("Macias", "No mas mostrador") berühmt machte. In der
poetischen Litteratur traten jetzt hauptsächlich zwei Parteien
einander gegenüber: die Klassiker, d. h. diejenigen, welche
sich noch immer der französisch-klassischen Regel unterwarfen,
andernteils aber auch solche, welche von dem Zurückgehen zur
alten spanischen Nationalpoesie das Heil der Dichtkunst erwarteten,
und die Romantiker, welche entweder fessellos den Antrieben ihres
Genius folgten, oder sich der neu französischen Richtung
anschlossen. Als Dichter der klassischen Richtung sind zu nennen:
Manuel José Quintana (gest. 1857), Verfasser des
Trauerspiels "Pelayo" (1805) und trefflicher Oden (aber auch als
Historiker geschätzt); die Lyriker Juan Bautista de Arriaza
(gest. 1837) und José Somoza; Juan Maria Maury, Verfasser
anmutig-einfacher Romanzen wie auch größerer epischer
Gedichte; Felix José Reinoso (gest. 1842), der sich durch
das Epos "La inocencia perdida" und kleinere Poesien einen Namen
erwarb; José Joaquin Mora, durch seine satirischen Fabeln
und Romanzen ausgezeichnet; Serafin Calderon (gest. 1867), ein
leidenschaftlicher Anhänger der alten Nationalpoesie ("Poesias
di un solitario"); Lopez Pelegrin; Tom. José Gonzalez
Carvajal (gest. 1834; "Libros poeticos de Santa Biblia") u. a.
Viele der neuern Dichter schwankten auch zwischen der klassischen
und romantischen Richtung, so: Alberto Lista (gest. 1848), gleich
ausgezeichnet als Dichter und Mathematiker ("Poesias sagradas",
"Poesias filosoficas", Romanzen etc.); der gefeierte Staatsmann
Angelo de Saavedra, Herzog von Rivas (gest. 1865), der von der
klassischen Schule zu den Romantikern überging, Verfasser der
Ode "El desterrado", der Dichtung "Florinda" sowie des
Romanzencyklus "El moro exposito", und Francisco Martinez de la
Rosa (gest. 1862), in der lyrischen und didaktischen Dichtung wie
im beschreibenden Epos ("Saragosa") und gleich Saavedra auch im
Drama (s. unten) hervorragend; ferner Nicasio Gallego (gest. 1853),
berühmt durch seine ergreifenden Oden und Elegien; der
Fabeldichter Pablo de Jerica, der Lyriker José Maria Roldan
(gest. 1828), Manuel de Arjona, Verfasser trefflicher Fabeln,
Epigramme und scherzhafter Erzählungen, Francisco de Castro u.
a. An der Spitze der Romantiker steht José Zorrilla (geb.
1818), der populärste Dichter des modernen Spanien, der sich
von der Poesie der Zerrissenheit und des Schmerzes zu einer heitern
Auffassung des Lebens durchgearbeitet und auf fast allen Gebieten
der Dichtkunst (wir erinnern nur an seine "Cantos del trovador" und
sein Drama "Don Juan Tenorio") Vortreffliches geleistet
95
Spanische Litteratur (19. Jahrhundert).
hat. Neben ihm sind zu nennen: der exzentrische José de
Espronceda (gest. 1842), ein Dichter der Verzweiflung ("El
condenado á la muerte", "El mendiande", "El estudiante" u.
a.); der schwermütige Nicomedes Pastor Diaz, dem die
süßesten und erhebensten Töne zu Gebote stehen;
José Bermudez de Castro, in dessen Dichtungen ("El dia de
difuntos") sich wieder alle Schauer der Romantik finden; der
phantastisch-fromme Jacinto Salas y Quiroja; der Staatsmann
Patricio de la Escosura (gest. 1878), ein schwungvoller Lyriker des
Weltschmerzes ("El bulto vestido de negro capuz"), dessen Talent
sich aber noch glänzender in seinen historischen Romanen zeigt
(s. unten); der sinnige Lieder- und Romanzendichter Francisco
Pacheco u. a. Von den Dichtern der neuesten Zeit errangen vor
andern Ramon de Campoamor (geb. 1817), der Verfasser der tief
poetischen Gedichtsammlung "Doloras". aber auch dramatischer
Arbeiten, eines Epos: "Colon", und reizender "Novellen in Versen",
und der "Poeta del pueblo", Antonio de Trueba (gest. 1889), mit
seinem "Libro de los cantares" verdienten Beifall. Neben ihnen
teilen sich Villergas, Campo-Arano, Enrique Gil, Gaspar Bueno
Serrano und besonders Ventura Ruiz Aguilera (gest. 1881), Dichter
berühmter "Elegias" und der "Legenda de Noche-Buena", sowie
Gaspar Nuñez de Arce (geb. 1834), Verfasser des Gedichts "El
vertigo" und der "Vision de Fray Martin", in die Gunst des
Publikums. Auch José Selgas, Manuel del Palacio, Adolfo
Becquer und Curros Enriquez ("Aires da minha terra") müssen
als Lyriker genannt werden. Als Satiriker fand José Gonzalez
de Tejada, als Fabeldichter Miguel Augustin Principe und F.
Baëza Anerkennung. Auch ein moderner "Romancero
español" von verschiedenen Verfassern ist erschienen (1873).
Eine gediegene Blütenlese aus den Werken der Dichter des 19.
Jahrh. bietet der "Tesoro de la poesia castellana", Bd. 3 (Madr.
1876).
Was das Drama betrifft, so war seit den 30er Jahren die
Herrschaft des klassischen Geschmacks, der durch Moratin den
jüngern für einige Zeit zur allgemeinen Geltung gelangt
war, im Sinken begriffen, und das spanische Theater trat in ein
Stadium, welches ein Gemisch der extremsten Gegensätze bot.
Namentlich ließ man sich von dem Taumel der sogen.
romantischen Schule in Frankreich mit fortreißen, deren
Mißgebilde man in Übersetzungen oder in noch krassern
Nachbildungen mit Vorliebe auf die heimische Bühne brachte.
Erst allmählich klärte sich das Chaos, die Besonnenern
kehrten zu den altklassischen Formen zurück, die sie mit den
Anforderungen der modernen Zeit zu vereinen suchten, und wenn sich
auch die spanische Bühne bis auf den heutigen Tag noch nicht
völlig zur Selbständigkeit in einer bestimmten Richtung
hervorgearbeitet hat, so gewinnen doch würdige, aus edlem
Streben hervorgegangene Originalproduktionen immer mehr die
Oberhand. Unter den Klassikern ragt vor allen Manuel Breton de los
Herreros (1800-1873) hervor, der fruchtbarste Bühnendichter
des modernen Spanien, unter dessen den verschiedensten dramatischen
Gattungen angehörenden Arbeiten die Charakterkomödien, in
welchen er das Leben der Mittelklassen Spaniens schildert, den
obersten Rang einnehmen. Unter seinen zahlreichen Nachahmern ist
Tomas Rodriguez Rubi (geb. 1817) der begabteste. Zu den
Anhängern der klassischen Schule gehörten auch die
Lustspieldichter Francisco de Burgos (gest. 1845) und Manuel
Eduardo Gorostiza (geb. 1790); ferner Juan Eugenio Hartzenbusch
(1806-80), einer der bedeutendsten Tragiker der Neuzeit, Verfasser
des Dramas "Los amantes de Teruel", dem sich seine spätern
Arbeiten würdig anreihen. Von großer
Bühnengewandtheit zeugen die Stücke von Antonio Garcia
Gutierrez (gest. 1884), den besonders die Tragödie "El
Trovador" berühmt machte. Eine zwischen der klassischen und
romantischen Richtung hin- und herschwankende Stellung nimmt der
oben als Lyriker genannte Martinez de la Rosa ein, der Verfasser
reizender und belieber Lustspiele ("La niña en casa y la
madre en la máscara" und "Los zelos infundados"), dessen
dramatische Begabung sich aber noch glänzender in seinen
historischen Tragödien ("La conjurazion de Venecia") zeigt.
Unter den vorzugsweise tragischen Dichtern ist der bedeutendste
Antonio Gil y Zarate (1793-1861), der, seinen Prinzipien nach
Anhänger des Klassizismus, in der Praxis später zu den
Romantikern überging, und unter dessen Stücken besonders
"Carlos II el hechizado", "Rosmunda" und "Guzman el bueno"
hervorzuheben sind. Entschieden romantische Richtung verfolgen in
ihren dramatischen Arbeiten der schon genannte A. de Saavedra,
Herzog von Rivas, Verfasser des Lustspiels "Solaces de un
prisionero" und des Dramas "Don Alvaro", und José Zorrilla,
der Lieblingsdramatiker der Nation, von welchem wir hier nur "El
zapatero y el rey" und die Bearbeitung der Don Juan-Sage: "Don Juan
Tenorio", erwähnen wollen. Von den übrigen Dramatikern,
besonders der neuesten Zeit, seien hier noch angeführt:
Ventura de la Vega (gest. 1865), Gertrudis de Avellaneda (gest.
1873; "Leoncia", "El principe de Viana"), der schon als Lyriker
erwähnte Campoamor ("Dies irae", "Cuerdos y locos", "El
honor"), Adelardo Lopez de Ayala (gest. 1879; "El hombre de
estado", "El tanto por ciento", "Consuelo"), Luis Martinez de
Eguilaz (geb. 1833; "La cruz del matrimonio"), José
Echegaray (geb. 1832; "La esposa del vengador", "En el seno de la
muerte", "El gran galeoto"), Nuñez de Arce ("Dendras de
honra", "El haz de leña"), Francisco Camprodon (gest. 1870;
"Flor de un dia") und Tamayo y Baus ("La rica hembra"),
vorzugsweise Dichter, welche das moderne Leben bald in
realistischer, bald in idealistischer Auffassung zur Darstellung
brachten. Sehr beliebt sind in der Neuzeit die echt spanischen, dem
Volksleben abgesehenen Possen (Sainetes), wie "La banda del rey"
von Emilio Alvarez u. a. Eine gediegene Auswahl moderner Dramen
erschien unter dem Titel: Joyas del teatro español del siglo
XIX" (Madr. 1880-82).
Im Vergleich mit der dramatischen Litteratur blieb das Gebiet
des Romans lange Zeit vernachlässigt; erst in der letzten Zeit
begann man dasselbe wieder eifriger anzubauen. Zunächst
folgten Übersetzungen und Nachahmungen französischer und
englischer Werke, dann aber auch spanische Originalromane und zwar
in solcher Fülle, daß gegenwärtig auch bei den
Spaniern der Roman, als das "Epos unsrer Zeit", nebst der Novelle
zur Lieblingsform litterarischer Produktion geworden und in
verschiedenen Formen ausgebildet ist. Besondere Pflege erfuhr der
historische und Sittenroman, als deren Hauptrepräsentanten
unter den bereits angeführten Autoren genannt werden
müssen: Larra ("El doncel de Don Enrique el Doliente"),
Escosura ("El conde de Candespina" und "Ni rey, ni roque"),
José de Espronceda ("Don Sancho Salaña"), Serafin
Calderon ("Christianos y Moriscos"), Martinez de la Rosa ("Isa-
96
Spanische Litteratur (Philosophie, Theologie, Rechts- u.
Staatswissenschaft).
bel de Solis") und Gertrudis de Avellaneda ("Dos mugeres").
Ungemeinen Erfolg hatten auf diesem Gebiet außerdem Fernan
Caballero (Cäcilia de Arrom, gest. 1877), die Begründerin
des realistischen Romans in Spanien, und Antonio de Trueba (gest.
1889) mit seinen zahlreichen Erzählungen ("Cuentos
campesinos", "Cuentos populares" etc.); ebenso Vicente Perez
Escrich ("Cura de la Aldea", "La muger adultera", "Los angeles de
la tierra" etc.), Manuel Fernandez y Gonzales (gest. 1888; "Los
Mondes de las Alpujarras", "La virgen de la Palma" etc.) und Pedro
Antonio de Alarcon (geb. 1833; "Sombrero de tres picos" und "El
escandalo"), denen wir aus neuester Zeit noch als die namhastesten
Erzähler anreihen: Juan Valera ("Pepita Jimenez", "Doña
Luz"), José Selgas ("La manzana de oro", "Dos rivales"),
Cespedes, Perez Galdos, der den historischen Roman kultiviert,
Castro y Serrano, Escamilla, die Schriftstellerinnen: Maria del
Pilar Sinués, Angela Grassi und Faustina Saez de Melgar
("Inés"). Als interessanter Sittenschilderer bewährte
sich Ramon de Mesonero (gest. 1882) in den Werken: "Manual de
Madrid", "Escenas matritenses" u. a. Im übrigen wurde die
spanische Prosa durch eine Reihe ausgezeichneter Historiker (s.
unten) und berühmter Redner und Publizisten (wie Jovellanos,
Augustin Arguelles, Alcalá-Galiano, Donoso Cortes, Martinez
de la Rosa, Emilio Castelar u. a.) wie durch die kritischen
Arbeiten eines Gallardo, Salva, Lista, Hermosilla, Marchena etc. in
ihrer Ausbildung wesentlich gefördert. Groß ist auch die
Zahl der Zeitschriften und Revuen, die, teils
politisch-belletristischen, teils wissenschaftlichen Inhalts, in
den letzten Jahrzehnten in Spanien aufgetaucht sind, und von denen
hier als die reichhaltigsten und gediegensten nur die "Revista de
España", "Revista Contemporanea" und "Revista Europea"
genannt seien.
Wissenschaftliche Litteratur.
Die wissenschaftlichen Leistungen vermochten sich in Spanien
nicht so glänzend zu gestalten wie die Nationallitteratur.
Insbesondere konnte sich in den philosophischen Wissenschaften ein
freier, selbständiger Geist nie entwickeln, weil geistiger und
weltlicher Despotismus höchstens ein scholastisches Wissen im
Dienste der positiven Theologie und Jurisprudenz duldete. Die
Philosophie ist fast bis auf die neuesten Zeiten auf der
niedrigsten Stufe, der scholastisch-empirischen, stehen geblieben;
nur Dialektik, Logik und mittelalterlicher Aristotelismus wurden
etwas kultiviert, da diese Disziplinen den Theologen als Waffe zur
Verteidigung ihrer dogmatischen Subtilitäten dienen
mußten. Erst im 19. Jahrh. hat auch Spanien einen wirklichen
Philosophen hervorgebracht, Jayme Balmes (gest. 1848), der
schöne Darstellungsgabe mit metaphysischem Tiefsinn verband,
im wesentlichen aber ebenfalls noch auf scholastischem Boden stand.
Eine rege Thätigkeit entfaltete Spanien in den letzten
Jahrzehnten in der Aneignung philosophischer Meisterwerke des
Auslandes durch Übertragung und Bearbeitung; so
übersetzte M. de la Ravilla den Cartesius und Kant, Patricio
de Azcarate den Leibniz, und Sans del Rio verpflanzte die
Krausesche Philosophie nach Spanien, die daselbst zahlreiche
Anhänger fand. Auch Hegel ist viel bearbeitet worden, seitdem
Castelar für ihn in Spanien Boden geschaffen. Von
philosophischen Schriftstellern der Neuzeit sind sonst zu nennen:
Lopez Muños, der Lehrbücher über Psychologie,
Moralphilosophie und Logik schrieb; Mariano Perez Olmedo, Eduardo
A. de Bessón ("La lógica en cuadros sinopticos"),
Giner de los Rios u. a. - Die wissenschaftliche Theologie blieb
infolge der Unbekanntschaft mit philosophischer Spekulation starrer
Dogmatismus im theoretischen, Kasuistik und Askese im praktischen
Teil. Das ganze Mittelalter hindurch galt in der Theologie die
scholastische Weisheit des Isidorus Hispalensis als erste
einheimische Autorität. Im 15. und 16. Jahrh. machten zwar die
Kardinäle Torquemada, der Großinquisitor, und Jimenez,
der Regent, Miene, das Bibelstudium zu fördern, und sogar
Philipp II. unterstützte die von einem Spanier, Arias
Montanus, in Angriff genommene Antwerpener Polyglotte. Aber im
grellen Kontrast zu dieser wenn auch vornehmlich des litterarischen
Ruhms wegen entwickelten, doch immerhin verdienstlichen
Thätigkeit steht es, wenn der Versuch, die Bibel dem Volk
selbst zugänglich zu machen, sogar an einem so
strenggläubigen Priester wie Luis de Leon durch die
Inquisition mit Kerker bestraft ward. Nur in der mystischen Askese
und in der Homiletik hat die gläubige Begeisterung der Spanier
Ausgezeichnetes geleistet. Hierher gehören unter andern die
homiletischen Schriften des Antonio Guevara (gest. 1545) und Luis
de Granada (gest. 1588) sowie die mystisch-asketischen des
Karmelitermönchs Juan de la Cruz (gest. 1591) und der heil.
Teresa de Jesus (gest. 1582). Erst in den neuern Zeiten durften die
trefflichen Bibelübersetzungen von Torres Amat, von Felipe
Scio de San Miguel und Gonzalez Carvajal an die Öffentlichkeit
treten und in einzelnen kirchenhistorischen und kirchenrechtlichen
Abhandlungen tolerantere Ansichten verbreitet werden, wie in den
Schriften von I. L. Villenueva, Blanco White (Leucado Doblado), I.
Romo u. a. Sogar eine "Historia de los protestantes etc." (Cad.
1851; deutsch, Frankf. 1866), von Adolfo de Castro verfaßt,
wagte sich ans Licht, der sich neuerdings eine "Historia de los
heterodoxos españoles" von Menendez Pelayo (1880 ff.)
anschloß. Dagegen veröffentlichte Orti y Lara eine
Verherrlichung der Inquisition ("La inquisicion"). Auf
theologisch-philosophischem Gebiet erlangten neuerdings der Bischof
von Cordova, Ceferino Gonzalez, und der Erzbischof von Valencia, A.
Monescillo, bedeutenden Ruf.
Auch im Fach der Rechts- und Staatswissenschaften ermangelte es
an einer philosophischen Grundlage und an Freiheit der Diskussion.
An Gesetzsammlungen und gesetzgeberischer Thätigkeit war in
Spanien nie Mangel. Die ältesten Rechtsbücher, wie das
"Fuero Juzgo" (Madr. 1815), reichen bis in die Zeit der
Gotenherrschaft zurück; dann sind besonders des Königs
Alfons X., des Weisen, legislatorische Arbeiten zu nennen: die
"Leyes de las siete partidas" und das "Fuero real" (hrsg. Von der
Akademie der Geschichte, das. 1847; neuerdings kommentiert von
Jimenez Torres, das. 1877). Eine Sammlung aller spanischen
Gesetzbücher mit den Kommentaren der berühmtesten
Rechtsgelehrten erschien unter dem Titel: "Los codigos
españoles concordados y anotados" (Madr. 1847, 12 Bde.); die
"Fueros" (Munizipalgesetze) begann Munoz zu sammeln (das. 1847).
Wertvolle Arbeiten über die spanische Rechtsgeschichte
lieferten Montesa und Manrique, auch Benvenido Oliver, der speziell
das katalonische Recht behandelte, während Soler und Rico y
Amat ihre Aufmerksamkeit der Geschichte des öffentlichen
Lebens zuwendeten. Selbst die Rechtsphilosophie fand Bearbeiter in
Donoso Cortes und Alcalá-Galiano sowie neuerdings in
Clemente Fernandez
97
Spanische Litteratur (Geschichte, Geographie).
Elias und F. Giner, die freiern Ansichten Bahn brachen. Eine
Philosophie des Familienrechts und Geschichte der Familie schrieb
Manuel Alonso Martinez. In ironischem Gegensatz zu dem von jeher in
Spanien herrschenden schlechten Staatshaushalt steht die seit der
Mitte des 18. Jahrh. mit Vorliebe betriebene theoretische
Bearbeitung der Nationalökonomie; bereits zu Anfang des 19.
Jahrh. konnte Semper die Herausgabe einer "Biblioteca
española economico-politica" unternehmen. Außer den im
18. und zu Anfang des 19. Jahrh. berühmt gewordenen
Schriftstellern Campomanes, Jovellanos, Cabarrus, wovon die beiden
letztern klassisches Ansehen erhalten haben, haben sich später
aus diesem Gebiet besonders Canga-Arguelles (gest. 1843) und Florez
Estrada (gest. 1853; "Curso de economia politica") ausgezeichnet.
Als hervorragende Arbeiten über Fragen des öffentlichen
Wohls werden die einer Frau, Arenal de Garcia Carrasco (in den
"Publicaciones" der königlichen Akademie), gerühmt.
Besonders fleißig ist von den Spaniern das Gebiet der
Geschichte bearbeitet worden. Von den alten Chroniken, zu denen man
sich seit Alfons X. der Landessprache bediente, und den
übrigen Geschichtswerken der frühern Zeit, in welchen
sich mit der stilistischen Vervollkommnung allmählich auch der
Sinn für pragmatische Auffassung entwickelte, wurden die
wichtigsten schon oben bei der Nationallitteratur erwähnt. Im
18. Jahrh. zeichneten sich der Marques de San Felipe (gest. 1726),
der eine Geschichte des spanischen Erbfolgekriegs schrieb, Henrique
Florez (gest. 1773; "España sagrada"), Juan Bautista
Muñoz (gest. 1799) durch seine Geschichte der Entdeckung und
Eroberung Amerikas ("Historia de nuovo mundo") und Juan Franc.
Masdeu (gest. 1817; "Historia critica de España") aus. Im
19. Jahrh. glänzten zunächst Juan Antonio Conde (gest.
1820), Verfasser der berühmten "Historia de la dominacion de
los Arabes en España", und Manuel José Quintana
(gest. 1857) durch seine "Vidas de Españoles celebres",
während der vielverfolgte Verfasser der Geschichte der
spanischen Inquisition, Llorente (gest. 1823), sein Werk im Ausland
und in französischer Sprache schreiben mußte. Besonderes
Lob verdient die Thätigkeit der königlichen Akademie der
Geschichte, die außer ihren "Memorias" zahlreiche
Quellenschriften herausgab, an die sich dann andre
Urkundensammlungen, namentlich die von Navarrete, Salva und
Barranda begonnene, von Fuensanta del Valle, J. Sancho Rayon und
Fr. de Zabalburu fortgeführte "Coleccion de documentos
ineditos para la historia de España" (bis 1888: 91 Bde.),
reihten. Am meisten wurde auch später die vaterländische
Geschichte bearbeitet, so namentlich von Modesto Lafuente (gest.
1866), dessen "Historia general de España" alle frühern
derartigen Werke übertrifft, von Zamorro y Caballero, Alf.
Espinosa, Alfaro, Rico y Amat, Antonio Cavanilles (gest. 1864),
dessen vortreffliche "Historia de España" leider unvollendet
blieb, u.a. An diese Werke schließen sich die Arbeiten
über die spanische Kulturgeschichte von Tapia ("Historia de la
civilisacion de España"), Fernan Gonzalo Moron, Ramon de
Mesonero Romanos, Ad. de Castro (über die Kultur Spaniens im
17. Jahrh.) u. a. sowie zahlreiche, zum Teil vorzügliche
Provinzial- und Lokalgeschichten, z. B. die "Historia de
Cataluña" von Balaguer, die "Historia de la villa de Madrid"
von Sanguineti etc. Auch die Geschichte der ehemals spanischen
Kolonien hat neuerdings Bearbeiter gefunden, z. B. an Torrente ("La
revolucion moderna hispano-americana"), Mora ("Mexico y sus
revoluciones"), Pedro de Angelis u. a., wie denn auch eine
Urkundensammlung über die Entdeckung und Eroberung derselben
veröffentlicht wird. Von den zahlreichen sonstigen
Spezialwerken seien nur erwähnt: Maldonados klassische
"Historia de la guerra de independencia de España" (1833),
des Grafen von Toreno "Historia del levantamiento etc. de
España" (1835), Carvajals "La España de los Borbones"
(1843), San Miguels "Historia de Felipe II" (1844), Gomez Arteches
"Historia de la guerra civil" (1868 ff.), Barrantes "Guerras
piraticas de Filipinas", Amador de los Rios' "Historia de los
Judios de España", Castelars "La civilisacion en los cinco
primeros siglos del cristianismo" und "Historia del movimiento
republicano en Europa" u. a. Auf dem Gebiet der Literaturgeschichte
behauptet Amador de los Rios (gest. 1878) mit seiner
(unvollendeten) "Historia critica de la literatura española"
(1860 ff.) die erste Stelle, wenn sie auch den wissenschaftlichen
Anforderungen der Neuzeit nicht voll gerecht wird. Andre
Übersichtswerke sowie Einzelstudien, zum Teil sehr
verdienstlicher Art, liegen aus neuerer Zeit vor von J. Moratin
("Origenes de teatro español"), Lista y Aragon ("Ensayos
literarios criticos"), Gil y Zarate ("Manual de literatura"),
Martinez de la Rosa ("La poesia didactica, la tragedia y la comedia
española"), Fernandez Guerra y Orbe ("Juan Ruiz de
Alarcon"); von Abelino de Orihuela ("Poetas españoles y
americanos del siglo XIX"), Mila y Fontanals ("De la poesia heroico
popular castellana"), Balaguer ("Historia de los trovadores"),
Valera ("Historia de la literatura española"), Canalejas,
Revilla ("Principios de la literatura española"), Perojo,
Espino ("Ensayo critico-historico del teatro español"),
Villaamil y Castro, Valdes y Alas, Menendez Pelayo ("Historia de
las ideas esteticas en España") u. a. In Bezug auf
Kunstgeschichte und Archäologie sind in erster Linie die
Arbeiten von Cean-Bermudez und P. Madrazo hervorzuheben; daneben
verdienen Contreras, Manjarres, Hurtado Villaamil etc., nicht
minder die Veröffentlichungen der königlichen Akademie
der schönen Künste, das von Rada y Delgado herausgegebene
"Museo español de antiguedades", welches die
interessantesten Kunst- und archäologischen Gegenstände
der Halbinsel reproduziert, und die "Monumentos arquitectonicos de
España" ehrende Erwähnung. - Neben der Geschichte fand
auch die Geographie bei den Spaniern sorgfältige Pflege, wozu
sie beizeiten durch ihre Eroberungen in fremden Weltteilen und ihre
Entdeckungsreisen veranlaßt wurden. Aus früherer Zeit
ist vor allem die vortrefflich geschriebene "Historia de los
descubrimientos y viajes de los Españoles" von Navarrete
anzuführen; aus der neuern seien die Schriften von
Miñano, Fuster und die lexikalischen Arbeiten von Pascal
Madoz und Mariana y Sanz sowie die "Geografia de España" von
Mingote y Tarazona erwähnt. Anthropologische Schriften gab
neuerdings Fr. Maria Tubino heraus.
Eine umfassende Sammlung spanischer Schriftsteller von den
ältesten Zeiten bis auf unsre Tage ist die von Rivadeneyra
herausgegebene "Biblioteca de autores españoles" (Madr.
1846-80, 70 Bde.); eine Sammlung meist neuerer belletristischer
Werke enthält die "Coleccion de autores españoles" (bis
jetzt 48 Bde., Leipz. 1860-86). Für die Herausgabe alter und
seltener Werke sorgten vorzugsweise die "Coleccion de bibliofilos
españoles" (bis 1879: 19 Bde.) und die "Coleccion de libros
españoles
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl., XV. Bd.
7
98
Spanische Mark - Spanischer Erbfolgekrieg.
raros y curiosos" (bis jetzt 16 Bde., Madr. 1871-1884). Auf dem
Gebiet der Bibliographie sind, von ältern Werken abgesehen,
besonders Ferrer del Rios' "Galeria de la literatura
española" (Madr. 1845), Ovilo y Oteros' "Manual de biografia
y de bibliografia de los escritores del siglo XIX" (Par. 1859, 2
Bde.) und Gallardos (von Zarco del Valle und Rayon vermehrter)
"Ensavo de una biblioteca española de lihros raros" (Madr.
1863-66, 2 Bde.) sowie das "Diccionario bibliografico historico"
von Muñoz y Romero (das. 1865), das "Diccionario general de
bibliografia española" von D. Hidalgo (1864-79, 6 Bde.) und
das "Boletin de la libreria" (Madr., seit 1874) namhaft zu
machen.
Vgl. Bouterwek, Geschichte der spanischen Poesie und
Beredsamkeit (Götting. 1804; span. Ausgabe, Madr. 1828, 3
Bde.), fortgesetzt von Brinckmeier: "Die Nationallitteratur der
Spanier seit Anfang des 19. Jahrhunderts" (Götting. 1850);
Brinckmeier, Abriß einer dokumentierten Geschichte der
spanischen Nationallitteratur bis zu Anfang des 17. Jahrhunderts
(Leipz. 1844); Clarus, Darstellung der spanischen Litteratur im
Mittelalter (Mainz 1846, 2 Bde ); Ticknor, Geschichte der
schönen Litteratur in Spanien (3. Aufl., New York 1872, 3
Bde.; deutsch von Julius, Leipz. 1852, 2 Bde.; Supplementband von
Wolf, das. 1867); v. Schack, Geschichte der dramatischen Litteratur
und Kunst in Spanien (2. Ausg., Frankf. 1854, 3 Bde.;
Nachträge, das. 1855); Lemcke, Handbuch der spanischen
Litteratur (das. 1855-56, 3 Bde.); Wolf, Studien zur Geschichte der
spanischen und portugiesischen Nationallitteratur (Berl. 1859);
Dohm, Die spanische Nationallitteratur (das. 1867); Hubbard,
Histoire de la littérature contemporaine en Espagne (Par.
1875).
Spanische Mark, Land zwischen Frankreich und Spanien, das
jetzige Katalonien, Navarra und einen Teil von Aragonien, etwa bis
zum Ebro, umfassend, ward 778 von Karl d. Gr. erobert, 781 von den
Arabern wieder besetzt, 801-811 von Ludwig dem Frommen von neuem
erobert und dann durch Grafen verwaltet. Die Hauptstadt war
Barcelona.
Spanische Ohren, s. Hörmaschinen.
Spanische Leiter (friesische Reiter), etwa 4 m lange, 25
cm starke Balken (Leib), durch welche kreuzweise an beiden Seiten
zugespitzte Latten (Federn) gesteckt sind, die so nahe aneinander
stehen, daß niemand zwischen ihnen durchkriechen kann. Sie
wurden früher zum Sperren von Eingängen und Brücken
in Festungen verwendet.
Spanischer Erbfolgekrieg 1701-1714. Da mit dem Tode des
kinderlosen Königs Karl II. von Spanien das Erlöschen
des habsburgischen Stammes in diesem Land in Aussicht stand, so war
die spanische Thronfolge ein Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit
für die europäische Diplomatie bereits seit der Mitte des
17. Jahrh. Von drei Seiten wurden Ansprüche auf die Nachfolge
erhoben. Ludwig XIV. von Frankreich, welcher bereits 1667 die
spanischen Niederlande als Erbe seiner Gemahlin in seinen Besitz zu
bringen versucht hatte, verlangte den Thron für seinen Enkel
Philipp von Anjou, den zweiten Sohn des Dauphin, weil er (Ludwig
XIV.) ein Sohn der spanischen Infantin Anna von Österreich,
Tochter Philipps III. von Spanien, und seine Gemahlin die
älteste Tochter des spanischen Königs Philipp IV. war;
Kaiser Leopold I., ebenfalls Enkel Philipps III. und Gemahl der
jüngern Tochter Philipps IV. Margareta-Theresia stützte
seine Ansprüche für seinen zweiten Sohn, Karl, teils auf
diese verwandtschaftlichen Beziehungen, welche denen Ludwigs XIV.
vorangingen, weil dessen Gemahlin ihren Erbansprüchen bei
ihrer Vermählung entsagt hatte, teils auf die
Erbansprüche des Hauses Habsburg auf die spanische Monarchie.
Außerdem wurden auch für den Kurprinzen Joseph Ferdinand
von Bayern, dessen Mutter Maria Antonia eine Tochter Leopolds I.
und seiner spanischen Gemahlin war, Ansprüche auf den
spanischen Thron erhoben, welche namentlich von den
Seemächten, an deren Spitze Wilhelm III. von Oranien stand,
begünstigt wurden, da diese die spanische Monarchie weder an
Frankreich noch an Österreich fallen, höchstens die
italienischen Nebenlande an sie verteilen wollten, wie auch ein
Teilungsvertrag vom 11. Okt. 1698 festsetzte. König Karl II.
ernannte den bayrischen Prinzen testamentarisch zu seinem
Nachfolger in allen damals spanischen Landen. Als letzterer 6.
Febr. 1699 plötzlich starb, schlossen Wilhelm III. und Ludwig
XIV. (2. März 1700) einen neuen Teilungsvertrag, wonach der
Erzherzog Karl die spanische Krone, Philipp von Anjou Neapel,
Sizilien, Guipuzcoa und Mailand erhalten sollte. Da aber Leopold I.
diesem Vertrag seine Zustimmung verweigerte, so hielt sich auch
Ludwig XIV. nicht an ihn gebunden. Am Hof zu Madrid wirkte der
kaiserliche Gesandte Graf Harrach für den Erzherzog Karl, der
französische Gesandte Marquis v. Harcourt für Philipp von
Anjou. Letzterer trug endlich den Sieg davon, denn Karl II. setzte
durch Testament vom 2. Okt. 1700 Philipp von Anjou zum Erben der
gesamten spanischen Monarchie ein. Nach Karls II. Tod (1. Nov.
1700) ergriff Philipp V. sofort Besitz von dem spanischen Thron und
zog schon 18. Febr. 1701 in Madrid ein. Anfangs erhob nur Kaiser
Leopold Protest hiergegen und traf Anstalt zum Beginn des Kriegs in
Italien. Erst als Ludwig XIV. deutlich seine Absicht kundgab, die
Erwerbung der spanischen Monarchie zur Erhöhung von
Frankreichs Machtstellung zu verwerten und den Schiffen der
Seemächte die Häfen Südamerikas und Westindiens zu
verschließen, als französische Truppen die
holländischen Besatzungstruppen aus den Festungen der
spanischen Niederlande vertrieben und der französische
König nach Jakobs II. Tode dessen Sohn als König Jakob
III. von Großbritannien anerkannte, kam 7. Sept. 1701
zwischen dem Kaiser und den Seemächten eine Tripelallianz zu
stande, welcher dann auch das Deutsche Reich und Portugal
beitraten. Zwar starb König Wilhelm III. 19. März 1702,
indes blieben sowohl England unter Königin Anna, welche von
Marlborough und seiner Gemahlin beeinflußt wurde, als die von
dem Ratspensionär Heinsius geleiteten Niederlande seiner
Politik getreu. Frankreich hatte nur die Kurfürsten von Bayern
und Köln sowie den Herzog Viktor Amadeus II. von Savoyen zu
Verbündeten.
Der Krieg wurde 1701 durch den kaiserlichen Feldherrn Prinz
Eugen von Savoyen in Italien eröffnet. Eugen schlug Catinat 9.
Juli bei Carpi, den an Catinats Stelle getretenen unfähigen
Villeroi 1. Sept. bei Chiari und nahm 1. Febr. 1702 den letztern
durch einen Überfall in Cremona gefangen. Dem neuen
französischen Feldherrn Vendôme gelang es indes, die
Fortschritte der Kaiserlichen in Italien zu hemmen, auch nachdem
1703 der Herzog von Savoyen auf die Seite des Kaisers
übergetreten war. Am Niederrhein behauptete inzwischen der
große englische Feldherr Marlborough die Oberhand gegen die
Franzosen: er eroberte die Festungen an der Maas und das ganze
Kurfürstentum Köln. Am obern Rhein hatte der Prinz Ludwig
von Baden, dem der Marschall Villars gegenüberstand, 9. Sept.
1702 Landau er-
99
Spanischer Erbfolgekrieg.
obert und Villars, der bei Hüningen über den Rhein
ging, zum Rückzug genötigt; aber 1703 eroberten die
Franzosen Breisach (7. Sept.) und Landau (17.Nov.); ferner
vereinigte sich 12. Mai 1703 der Kurfürst von Bayern bei
Tuttlingen mit Villars, und beide drangen in Tirol ein. Zwar wurden
sie durch die Erhebung der Tiroler unter großem Verlust
wieder zurückgetrieben; aber da der ungeschickte
österreichische General Styrum sich 20. Sept. bei
Höchstädt schlagen ließ und 13. Dez. Augsburg sich
ergeben mußte, so endete der Feldzug für die
Verbündeten im ganzen nicht günstig. Landau und Breisach
gingen wieder an die Franzosen verloren. Auch fiel Anfang 1704
Nassau in die Hände des Kurfürsten, und der Kaiser, der
gleichzeitig einen Aufstand in Ungarn zu bekämpfen hatte, sah
sich schon in seinen Erblanden bedroht.
Da trat 1704 die entscheidende Wendung ein. Prinz Eugen, den der
Kaiser an die Spitze des Hofkriegsrats gestellt hatte, faßte
den Plan, durch einen kombinierten Angriff der beiden
verbündeten Heere die bayrisch-französische Macht zu
vernichten. Marlborough ging bereitwilligst auf diesen Plan ein und
zog in Eilmärschen vom Niederrhein nach Schwaben. Markgraf
Ludwig und er vereinigten ihre Truppen bei Ulm, nötigten durch
Wegnahme der Verschanzungen auf dem Schellenberg bei
Donauwörth (2. Juli) den Kurfürsten und den
französischen General Marsin zum Rückzug nach Augsburg,
und nachdem einerseits Tallard sich mit letzterm, anderseits Eugen
sich mit Marlborough vereinigt hatte (während der Markgraf von
Baden Ingolstadt belagerte), erlitt 13. Aug. 1704 das
französisch-bayrische Heer bei Höchstädt (Blenheim)
eine entscheidende Niederlage und verlor gegen 30,000 Mann an Toten
und Verwundeten; Tallard selbst und 15,000 Mann wurden gefangen.
Der Kurfürst mußte flüchten. Als Leopold I. 5. Mai
1705 starb, setzte sein Sohn Joseph I. den Kampf mit Energie fort.
Er beschwichtigte den ungarischen Aufstand, erwirkte die
Achtserklärung gegen die beiden wittelsbachischen
Kurfürsten und bemächtigte sich nach blutiger
Unterdrückung einer Volkserhebung der bayrischen Lande. Am 23.
Mai 1706 erfocht Marlborough bei Ramillies einen glänzenden
Sieg über die Franzosen unter Villeroi, besetzte Löwen,
Mecheln, Brüssel, Gent und Brügge und ließ
überall Karl III. als König ausrufen. Als infolge dieser
Niederlage Vendôme aus Italien nach den Niederlanden berufen
wurde, erhielt dadurch Eugen die Möglichkeit, von Verona aus
dem von den Franzosen belagerten Turin zu Hilfe zu eilen und nach
seiner Vereinigung mit dem Herzog von Savoyen den vereinigten
französischen Generalen Marsin, Herzog von Orléans und
La Feuillade 7. Sept. vor Turin eine gänzliche Niederlage
beizubringen, infolge deren die Franzosen gemäß der
sogen. Generalkapitulation vom 13. März 1707 ganz Italien
räumen mußten. Nur am Oberrhein gelang es Villars, nach
dem Tode des Markgrafen Ludwig (Januar 1707) die von den
Reichstruppen besetzten Stollhofener Linien zu durchbrechen und das
südwestliche Deutschland brandschatzend zu durchziehen. Selbst
in Spanien, wo die überwiegende Mehrheit der Nation dem
bourbonischen König Philipp V. anhing, gelang es dem
habsburgischen Prätendenten, vorübergehende Erfolge zu
erringen. Gleich im Anfang des Kriegs wurde von den Engländern
und Holländern eine im Hafen von Vigo liegende spanische
Flotte zerstört; 1703 trat König Dom Pedro II. von
Portugal dem großen Bündnis bei, und 1704 erschien
Erzherzog Karl in Spanien, während die Engländer (3. Aug.
1704) Gibraltar eroberten. Wirklich gelang es Karl, 1705 sich zum
Herrn von Valencia, Katalonien und Aragonien zu machen; 2. Juli
1706 wurde sogar Madrid von einem vereinigten
englisch-portugiesischen Heer unter Galloway und Las Minas besetzt;
allein da den Operationen der Verbündeten der Zusammenhang
fehlte, so waren diese Erfolge nicht von Dauer, Madrid ging bald
wieder verloren, und nach dem Sieg des Marschalls Berwick über
das englisch-portugiesische Heer bei Almanza (25. April 1707)
fielen auch die südlichen Provinzen in die Hände Philipps
V.
Obwohl die Verbündeten auch auf den übrigen
Kriegsschauplätzen 1707 keine großen Erfolge errangen,
machte sich in Frankreich die Erschöpfung der Hilssmittel
schon so sehr geltend, daß Ludwig XIV. den Seemächten
den Verzicht auf Spanien anbot und nur die italienischen Lande
für seinen Enkel beanspruchte. Indes noch war Marlboroughs
Einfluß in England maßgebend, überdies hofften die
Engländer, Spanien unter Karl III. zu ihrem
ausschließlichen Nutzen merkantil ausbeuten zu können.
Die Seemächte waren mit Österreich darüber
einverstanden, daß man nicht bloß aus dem Erwerb der
ganzen spanischen Monarchie für Österreich bestehen,
sondern auch die Lage benutzen müsse, um Frankreichs
Vorherrschaft für immer zu brechen. Der Erfolg schien dies
Vorhaben zu begünstigen. Ein Versuch, den ein starkes
französisches Heer unter dem Herzog von Burgund und
Vendôme 1708 unternahm, um die spanischen Niederlande
wiederzuerobern, wurde durch den Sieg Eugens und Marlboroughs bei
Oudenaarde (11. Juli) vereitelt und ganz Flandern und Brabant von
neuem unterworfen. Ludwig XIV. war jetzt sogar bereit, aus
Grundlage des völligen Verzichts auf Spanien über einen
Frieden zu verhandeln. Auch als die Verbündeten die
Rückgabe des Elsaß mit Straßburg, der
Freigrafschaft, der lothringischen Bistümer forderten, war der
französische Gesandte im Haag, Torcy, noch zu Unterhandlungen
bereit. Erst die Zumutung, seinen Enkel selbst durch
französische Truppen aus Spanien vertreiben zu helfen, wies
Ludwig XIV. mit Entschiedenheit zurück. Der Krieg in den
Niederlanden wurde wieder aufgenommen; die blutige Schlacht bei
Malplaquet (11. Sept. 1709) blieb zwar unentschieden, die
furchtbaren Verluste der Franzosen in derselben erschöpften
aber ihre Kräfte. Gleichzeitig siegte in Spanien der
österreichische General Starhemberg bei Almenara 27. Juli und
Saragossa 20. Aug., und Karl zog 28. Sept. in Madrid ein.
Da, als Frankreichs Niederlage unabwendbar schien, als der
Übermut der Verbündeten keine Grenzen mehr kannte, traten
unerwartete Ereignisse ein, welche einen Umschwung zu gunsten
Ludwigs XIV. zur Folge hatten. Am 10. Dez. 1710 errang
Vendôme einen glänzenden Sieg über Starhemberg bei
Villa Viciosa. Wichtiger war noch, daß in England das
Whigministerium durch ein Toryministerium verdrängt wurde,
welches den Frieden möglichst rasch herzustellen
wünschte, und daß 17. April 1711 Kaiser Joseph I. starb.
Da nun dessen Bruder, der Prätendent für Spanien, als
Karl VI. Kaiser wurde, so fürchteten die andern Mächte,
das Haus Habsburg möchte durch die Vereinigung
Österreichs mit Spanien zu mächtig werden. Zunächst
knüpften die Engländer mit Ludwig XIV. geheime
Unterhandlungen an. Am 8. Okt. 1711 wurden die Präliminarien
zu London unterzeichnet und trotz aller Gegenbemühungen des
Kaisers 29. Jan. 1712 der Friedenskongreß zu Utrecht
eröffnet. Marlborough wurde durch den Grafen Ormond, einen
eifrigen Jakobiten, ersetzt, und dieser gewährte dem
Prinzen
100
Spanischer Hopfen - Spanische Sprache.
Eugen nicht die nötige Unterstützung, so daß der
Marschall Villars bei Denain 27. Juli 1712 wieder einige Erfolge
über Eugen und die Holländer davontrug. Als Philipp V. 5.
Nov. 1712 auf die Erbfolge in Frankreich für sich und seine
Nachkommen feierlichst verzichtete und diese Urkunde von Ludwig
XIV. bestätigt, also eine Union Spaniens mit Frankreich
für die Zukunft verhindert wurde, schlossen England und bald
auch die Niederlande mit Frankreich Waffenstillstand, dem am 11.
April 1713 der förmliche Abschluß des Friedens zu
Utrecht folgte, dem auch Portugal, Savoyen und Preußen
beitraten; Kaiser und Reich weigerten sich, ihn anzuerkennen. Die
Bedingungen dieses Friedens waren folgende: Philipp V. erhält
Spanien mit den außereuropäischen Besitzungen, welches
aber nie mit Frankreich vereinigt werden darf; Frankreich erkennt
die Thronfolge in England an und tritt an dieses die
Hudsonbailänder, Neufundland und Neuschottland ab; von Spanien
erhält England Gibraltar und Menorca sowie beträchtliche
Handelsvorteile im spanischen Amerika, Preußen bekommt das
Oberquartier von Geldern und Neuchâtel mit Valengin, Savoyen
eine Anzahl Grenzfestungen und die Insel Sizilien, Holland die
sogen. Barrierefestungen (s. Barrieretraktat) und einen
günstigen Handelsvertrag. So von den Verbündeten
verlassen, konnten der Kaiser und Prinz Eugen nichts mehr
ausrichten, zumal die Reichsfürsten sich sehr saumselig und
unzuverlässig zeigten. Der Marschall Villars nahm 20. Aug.
1713 Landau, brandschatzte die Pfalz und Baden und eroberte 16.
Nov. Freiburg i. Br., worauf er Eugen Friedensunterhandlungen
anbot, welche auch 26. Nov. 1713 zu Rastatt eröffnet wurden.
Am 7. März 1714 wurde der Friede zwischen Frankreich und dem
Kaiser zu Rastatt abgeschlossen. Um auch das Deutsche Reich in den
Frieden aufzunehmen, fand ein Kongreß zu Baden im Aargau
statt, wo der Rastatter Friede mit wenigen Änderungen 7. Sept.
d. J. angenommen wurde. Hiernach bekam der Kaiser die spanischen
Niederlande, Neapel, Mailand, Mantua und Sardinien; Frankreich
behielt von seinen Eroberungen nur Landau; die Kurfürsten von
Bayern und Köln wurden in ihre Länder und Würden
wieder eingesetzt. Vergeblich verwendete sich der Kaiser für
die treuen Katalonier, welche sich Philipp V. nicht unterwerfen
wollten; seine Bemühungen waren fruchtlos, Barcelona wurde 11.
Sept. 1714 von dem Marschall von Berwick erobert, und die
Katalonier verloren ihre alten Vorrechte und ständischen
Freiheiten. Vgl. v. Noorden, Europäische Geschichte im 18.
Jahrhundert, 1. Teil: Der spanische Erbfolgekrieg (Düsseld.
1870-82, 3 Bde.); Lord Mahon, History of the war of the succession
in Spain (Lond. 1832); de Reynald, Louis XIV et Guillaume III.
Histoire des deux traités de partage et du testament de
Charles II. (das. 1883, 2 Bde.); Courcy, La coalition de 1701
contre la France (Par. 1886, 2 Bde.); Parnell. The war of
succession in Spain 1702-1711 (Lond. 1888); Arneth, Prinz Eugen von
Savoyen (Wien 1858, 3 Bde.); die Memoiren des Herzogs von
Marlborough (s. d. 1).
Spanischer Hopfen, s. Origanum.
Spanischer Kragen, s. Paraphimose.
Spanischer Pfeffer, s. Capsicum.
Spanischer Tritt, Reitkunst, s. Passage.
Spanische Spitzen, Spitzen aus Gold- und Silberdraht, mit
Perlen und bunter Seide untermischt.
Spanische Sprache. Die s. S. gehört zu den romanischen
Sprachen und ist demnach eine Tochtersprache des Lateinischen,
die aber von den verschiedenen Völkern, die im Lauf der
Jahrhunderte die Pyrenäische Halbinsel beherrschten, viele
Elemente in sich aufgenommen hat. Die Ureinwohner Spaniens, im
Norden die Kantabrer, im Süden die Iberer, vermischten sich
frühzeitig mit keltischen Stämmen, daher der Name
Keltiberer. Ihre nationale Eigentümlichkeit und Sprache gingen
in den römisch-germanischen Eroberungen und Einwanderungen
fast gänzlich unter, und nur an den Pyrenäen bewahrten
einige kantabrische Stämme ihre Sitte und Sprache vor
Vermischung mit fremden Elementen. Diese in den baskischen
Provinzen fortlebenden Überreste der alten spanischen
Volkssprache sind unter dem Namen der baskischen Sprache, von den
Einheimischen Escuara genannt, bekannt (s. Basken). In den
übrigen Teilen Spaniens bildete sich, wie in den andern
romanisierten Ländern, aus der Lingua latina rustica, der
römischen Volkssprache, die zugleich mit der römischen
Herrschaft in die Pyrenäische Halbinsel eindrang, eine
nationale Umgangs- und Volkssprache mit eigentümlichen
Provinzialismen, welche, als mit dem Verfall des römischen
Reichs und nach dem Einfall der germanischen Völker auch die
politische und litterarische Verbindung mit Rom sich lockerte, nach
und nach die allein übliche und allgemein verstandene wurde.
Die den Römern in der Herrschaft folgenden Westgoten nahmen
mit der römischen Sitte auch diese Sprache an und machten sie
so sehr zu ihrer eignen, daß sie nur die zur Bezeichnung der
ihnen eigentümlichen Staats- und Kriegsinstitutionen, Waffen
etc. nötigen Wörter aus ihrer Muttersprache beibehielten.
Diese also ganz aus römischen Elementen hervorgegangene und
nur mit einem germanischen Wörtervorrat bereicherte spanische
Volkssprache erhielt einen neuen Zusatz durch die Araber, mit denen
die spanischen Goten fast 800 Jahre um den Besitz des Landes
kämpften. Aber auch die Araber trugen nur zur Bereicherung des
Sprachstoffs, besonders in Bezug auf Industrie, Wissenschaften,
Handel etc., bei und modifizierten höchstens
einigermaßen die Aussprache, ohne den
organisch-etymologischen Bau der Sprache wesentlich zu
verändern. Die ältesten Spuren des Spanischen finden sich
in Isidorus' "Origines"; die ältesten Denkmäler aber
gehören der zweiten Hälfte des 12. Jahrh. an. Unter den
spanischen Dialekten ward der kastilische am frühsten zur
Schriftsprache ausgebildet, und wie die Kastilier den Kern der
Nation ausmachten, ihre Litteratur die volkstümlichste
Entwickelung nahm, so wurde auch ihre Mundart die herrschende und
endlich die fast ausschließliche Schriftsprache in Spanien,
so daß sie die eigentliche s. S. geworden ist. Dieselbe wird
gegenwärtig, außer in Spanien und den zugehörigen
Inseln, noch in den ehemals spanischen Ländern
Südamerikas, in Zentralamerika und Mexiko sowie zum Teil in
den spanischen Kolonien (Cuba, Manila etc.) gesprochen. Ihr
Alphabet ist das lateinische. Die Vokale lauten ganz wie im
Deutschen. Von den Konsonanten werden folgende eigentümlich
ausgesprochen: c (ß gelispelt), ch (tsch), g vor e und i (ch
rauh wie in Sprache), j (immer wie ch rauh), ll (lj), ñ
(nj), z (immer wie ß gelispelt). Wie die Italiener die zu
starke Aussprache der Römer milderten, so machten sie die
Spanier noch rauher. Sie vervielfältigten noch die
Aspirationen auf x, j, g, h und f. Der schon ziemlich stark
aspirierte Laut im Lateinischen verwandelt sich im Spanischen in
den noch stärker aspirierten Laut h (lat. facere, span. hacer,
machen); an die Stelle des mouillierten l tritt das
101
Spanisches Rohr - Spanishtown.
stark aspirierte j (lat. Filius, span. hijo, Sohn), pl ward
durch das mouillierte ll ersetzt (lat. planus, span. llano, eben),
und für ct wird immer ch genommen (lat. factus, dictus, span.
hecho, dicho, gemacht, gesagt). J ist, seitdem x nach der neuern
Orthographie (von 1815) seinen Kehllaut verloren hat, der
Hauptkehlkonsonant der spanischen Sprache geworden; man schreibt
jetzt allgemein Don Quijote, Mejico statt Don Quixote, Mexico.
Gesetzgeber für die s. S. ward die Grammatik der spanischen
Akademie (zuerst 1771). Neuere Hilfsmittel zur Erlernung derselben
sind für Deutsche die Grammatiken von Franceson (4. Aufl.,
Berl. 1855), Fuchs (das. 1837), Kotzenberg (2. Aufl., Brem. 1862),
Brasch (Hamb. 1860), Pajeken (2. Aufl., Brem. 1868), Lespada (2.
Aufl., Halle 1873), Montana (2. Aufl., Stuttg. 1875), Funck (8.
Aufl., Frankf. 1885), Schilling (2. Aufl., Leipz. 1884), Wiggers
(2. Aufl., das. 1884). Die vorzüglichsten
Wörterbücher lieferten: die spanische Akademie (Madr.
1726-39, 6 Bde.; hrsg. von V. Salvá, 12. Aufl., Par. 1885)
und Dominguez (6. Ausg., Madr. 1856, 2 Bde.); ein neues begann R.
Cuervo (das. 1887 ff., 6 Bde.). Für Deutsche sind zu
empfehlen: Franceson (12. Aufl., Leipz. 1885), Kotzenberg (Brem.
1875), Booch-Arkossy (6. Aufl., Leipz. 1887, 2 Bde.), Tollhausen
(das. 1886). Den Versuch eines etymologischen Wörterbuchs
machten Covarrubias (Madr. 1674), Cabrera (das. 1837), Monlau (2.
Aufl., das. 1882), R. Barcia (das. 1883, 5 Bde.) und L. Eguilaz
(Granada 1880). Wichtige Beiträge zur Etymologie enthält
Diez' "Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen" (4.
Aufl., Bonn 1878). Die historische Grammatik der spanischen Sprache
behandelt Diez' "Grammatik der romanischen Sprachen" (5. Aufl.,
Bonn 1882) und P. Försters "Spanische Sprachlehre" (Berl.
1880). Die Orthographie wurde von der Akademie in einem besondern
"Tratado" (zuletzt Madr. 1876) festgestellt.
Spanisches Rohr (Stuhlrohr, Rotang, Rattans), die
schlanken Stämme und Triebe mehrerer Arten der Palmengattung
Calamus (s. d.), werden in allen Wäldern des Indischen
Archipels, besonders auf Borneo, Sumatra und der Malaiischen
Halbinsel, gewonnen und, nachdem sie durch eine Kerbe in einem Baum
gezogen und dadurch von Oberhaut, Blättern und Stacheln
befreit worden, in Bündeln von 100 Stück in den Handel
gebracht. Die größte Verwendung findet das Spanische
Rohr in China und Japan, wo man es zu unzähligen
Gebrauchsgegenständen verarbeitet, auch als Tauwerk auf
Schiffen benutzt. Man unterscheidet wohl helleres, dünnes Rohr
als weibliches (Bindrotting) von dem stärkern, dunklern mit
enger stehenden Knoten als männlichem (Handrotting); letzteres
wird auch zu Spazierstöcken benutzt. Das sogen. gereinigte
Spanische Rohr ist durch Schaben oder durch Schleifen auf besondern
Maschinen von den Knoten befreit. In den europäischen
Hafenstädten verarbeitet man es durch Zerschneiden, Spalten,
Hobeln und Ziehen zu Stuhl- und Korsettrohr, Rieten für
Webstühle etc. Die dünnsten, schnurenförmigen
Streifen heißen Schnur- oder Putzrohr und werden in der
Putzmacherei benutzt. Stuhlrohr wird oft durch Schwefeln gebleicht.
Sehr viel Rohr wird für die Korbmacherei gefärbt,
lackiert und vergoldet. Abfälle dienen als Polster- und
Scheuermaterial. Durch besondere Bearbeitung gewinnt man aus
Spanischem Rohr ein Fischbeinsurrogat, das Wallosin, zu
Schirmstäben.
Spanische Wand, eine bewegliche Schutzwand, welche aus
einem hölzernen oder metallenen Gestell besteht, über
welches Zeug, Tapeten, Leder u. dgl. gespannt ist; findet als
Bettschirm, zur Scheidung von Räumen, als Schutzwand gegen
Wind u. dgl. Verwendung. Das Holz wird bisweilen mit Lack
überzogen und bunt bemalt oder vergoldet.
Spanische Weide, s. v. w. Ligustrum.
Spanische Weine, zum Teil vorzügliche Weine, welche
dem Burgunder, Roussillon und Languedoc vergleichbar sind und diese
selbst in mancher Hinsicht übertreffen; seit dem Altertum
berühmt, behaupteten sie im ganzen Mittelalter ihr
Übergewicht und besitzen es heute noch in verschiedenen
Ländern, wie in England und Nordamerika. Alle spanischen
Provinzen treiben Weinbau, doch sind die Produkte der
nördlichen kaum über ihre Grenzen hinaus bekannt. Im
allgemeinen leidet der spanische Weinbau durch die Indolenz und
Nachlässigkeit der Produzenten, und die gewöhnlichen
spanischen Weine stehen sehr tief unter der Erwartung, zu welcher
Klima und Lage berechtigen. Die südspanischen Weine
müssen für den Export, namentlich über See, mit
Spiritus versetzt werden, den man vielfach ebenfalls aus Most
bereitet. Die vorzüglichsten spanischen Weine sind
Likörweine, und unter diesen ist der berühmteste der
weiße Jereswein (Sherry), demselben schließen sich an:
die ebenbürtigen, sehr süßen Pajareteweine (von
denen der beste auch Malvasier heißt); der Malagawein (s.
d.), der berühmte Likörwein Tinto di Rota (Tintillo),
stark, mit vieler Wärme, sehr dunkel, süß und
tonisch wirkend; die Manzanillaweine mit starkem Geruch und
Geschmack nach Kamillen, von den Barros und Arenas zwischen Jeres
und San Lucar, der Montilla (der dem Amontillado-Sherry den Namen
gegeben hat), der Rancio von Peralta in Navarra, der Alicante (vino
generoso) aus Valencia, ein renommierter Magenwein, mit sehr
ausgesprochenem aromatischen Boukett, der bei uns als "echter
Malaga" meist arzneilich benutzt wird, der Pedro Ximenez von
Vittoria in Viscaya, der dunkel granatfarbige Grenacho vom Campo di
Carinena in Aragonien, der Muskat von San Lucar in Andalusien, der
Moscatel von Fuencaral in Neukastilien, der Malvasia von Pollentia
auf Mallorca, die Muskatweine von Borja in Aragonien und von Sitges
in Katalonien. Gewöhnliche markige Rotweine nach Art der
französischen liefert Spanien nur wenige von hervorragendem
Werte. Der beste ist der von Olivanza in Estremadura, der
Valdepeñas in Kastilien, der Manzanores aus der Mancha,
einer der leichtesten und angenehmsten spanischen Weine etc. Aus
dem nordöstlichen Spanien wird Ebro-Port vielfach für
echten Portwein verkauft; er ist aber rauher, minder
körperreich und geistig.
Spanische Wicke, Pflanze, s. Lathyrus.
Spanischfliegenpflaster, s. Kantharidenpflaster.
Spanischfliegensalbe, s. Kantharidensalbe.
Spanischgelb, s. v. w. Auripigment.
Spanischweiß, s. v. w. Wismutweiß.
Spanish stripes (spr. spännisch streips),
hellfarbige leichte Tuche aus Zephyrwolle, die in Deutschland
für den Export nach Asien fabriziert werden.
Spanishtown (spr. spännischtaun, Santiago de la
Vega), Hauptstadt der britisch-westind. Insel Jamaica in
fruchtbarer Alluvialebene, am Cobre und 8 km vom Hafen von Kingston
gelegen, mit (1880) 8000 Einw. Um den King's Square, in dessen
Mitte eine Statue Lord Rodneys steht, liegen das Ständehaus,
der Palast des Gouverneurs und die Regierungsgebäude, alle in
altkastilischem Stil. S. wurde 1534 von Diego Kolumbus
gegründet.
102
Spanner - Sparbutter.
Spanner (Geometridae, Phalaenidae), Familie aus der
Ordnung der Schmetterlinge, Insekten von mittlerer oder geringerer
Größe, mit schmächtigem, zartem Körper,
großen, breiten, meist matt und trübe gefärbten, in
der Ruhe flach ausgebreiteten Flügeln, borstenförmigen,
häufig gekämmten Fühlern, schwach entwickelter
Rollzunge und meist wenig hervortretenden Tastern, ruhen am Tag an
versteckten Orten und fliegen des Nachts. Die Raupen zeichnen sich
durch den eigentümlichen spannenmessenden Gang aus, wie ihn
der Mangel der vordern Bauchfußpaare bedingt. Sie bilden beim
Gehen eine Schleife nach oben und ruhen auch oft in dieser
Stellung, oder indem sie sich nur mit den Afterfüßen an
einem Zweig festhalten und ihren dünnen, glatten Körper
frei in die Luft erheben. Sie verpuppen sich in einem lockern
Gespinst über oder in der Erde, auch wie die Tagfalter oder
ohne Gespinst in der Erde. Man kennt gegen 1800 Arten aus allen
Weltteilen, von denen viele bei massenhaftem Auftreten
schädlich werden. Der große Frostspanner
(Blatträuber, Waldlindenspanner, Hibernia defoliaria L., s.
Tafel "Schmetterlinge II"), 4-4,5 cm breit, auf den
weißgelben Vorderflügeln mit zwei sattbraunen Binden und
rotgelben Flecken, zuweilen ganz rotgelb, auf den
Hinterflügeln weißlich, schwärzlich bestäubt,
fliegt im Oktober und November, vorherrschend im mittlern und
südöstlichen Deutschland. Das ungeflügelte,
ockergelbe, schwarz gefleckte Weibchen steigt am Stamm empor, wird
hier befruchtet und legt 400 Eier einzeln oder in kleinen Gruppen
an Knospen von Obstbäumen, Buchen, Eichen, Birken, welche die
lichtgelbe Raupe mit rotbraunem Rückenstreif und Kopf
während ihrer Entfaltung ausfrißt. Sie verpuppt sich im
Juli in einer mit wenigen Seidenfäden ausgekleideten
Erdhöhle. Eine zweite gelbe Art (H. aurantiaria L., s. Tafel
"Schmetterlinge II") fliegt gleichzeitig. Der kleine Frostspanner
(Blütenwickler, Obst-, Winterspanner, Reifmotte, Larentia
[Cheimatobia, Acidalia] brumata L., s. Tafel "Schmetterlinge II"),
2-2,4 cm breit, auf den Vorderflügeln licht graugelb, fein
gewässert und mit dunklern Wellenlinien gezeichnet, auf den
Hinterflügeln weißlichgelb mit schwarzen
Randpünktchen, fliegt im November und Dezember. Das graue
Weibchen, das zum Fliegen untaugliche Stümpfe mit dunkler
Querbinde besitzt, legt seine Eier an die Knospen von
Obstbäumen, Eichen, Buchen und andern Laubbäumen, auch an
Rosen; die gelblichgrüne Raupe, mit zwei weißen
Rückenlinien und hellbraunem Kopf, erscheint im ersten
Frühjahr, bespinnt die Knospen, welche sie ausfrißt, und
ist der gefährlichste Feind für unsre Obstbäume. Sie
verpuppt sich im Juni in einem losen Kokon flach unter der
Erdoberfläche. Als Gegenmittel benutzt man fußtiefes
Umgraben des Bodens um die Baumstämme, Anlegen von
Papierringen um den Stamm, welche mit Teer oder besser mit dem
sogen. Brumataleim bestrichen sind, gut anschließen und von
Oktober bis Dezember klebrig erhalten werden müssen, um das am
Stamm aufsteigende Weibchen zu fangen. Der Kiefernspanner
(Föhrenspanner, Spanner, Fidonia piniaria L., s. Tafel
"Schmetterlinge II"), 3,5 cm breit, mit schwarzbraunen
Flügeln, die beim Männchen ein hellgelbes oder
weißliches, beim Weibchen ein hoch rotgelbes Mittelfeld
besitzen, fliegt im Mai und Juni im Kiefernwald und legt seine Eier
besonders im Stangenholz an die Nadeln. Die gelblichgrüne
Raupe, mit weißem Mittelstrich, dunkeln Seitenstreifen und
gelben Streifen über den Füßen, erscheint im Juli,
frißt den Stumpf der zur Hälfte abgebissennen Nadeln und
verpuppt sich im Oktober unter Moos und Streu am Fuß des
Baums. Als Gegenmittel ist nur das Aufsuchen der Puppen
erfolgreich. Der Stachelbeerspanner (Harlekin, Zerene grossulariata
L.), 4 cm breit, mit goldgelbem, schwarzfleckigem Leib,
weißen, schwarz gefleckten Flügeln, von denen die
vordern an der Wurzel gelb sind und zwischen zwei Punktreihen eine
goldgelbe Mittelbinde besitzen; er fliegt im Juli und August, das
Weibchen legt die Eier in kleinen Gruppen an die Blätter von
Stachel- und Johannisbeersträuchern, Pflaumen,
Aprikosenbäumen, Weiden, Kreuzdorn. Die oberseits weiße,
schwarz gefleckte, unterseits dottergelbe Raupe erscheint im
September, überwintert unter Laub, frißt im
nächsten Jahr bis Juni und verpuppt sich unter einigen
Fäden an einem Blatt oder Zweig. Der Birkenspanner (Amphidasys
betularia L., s. Tafel "Schmetterlinge II"), 5 cm breit,
milchweiß, schwarz gesprenkelt, findet sich überall in
Europa, seine einem dürren Zweig ähnliche Raupe lebt auf
Birken, Ebereschen und andern Laubhölzern, zieht aber die
Eiche vor und verpuppt sich im September oder Oktober in der Erde.
Der Schmetterling fliegt im Mai und Juni. Vgl. Guenée,
Species général des Lépidoptères, Bd. 9
u. 10 (Par. 1857).
Spannkraft, s. Dampf und Gase.
Spanntag, die Leistung eines Gespanns Zugtiere in einem
Arbeitstag; z. B. 1 Hektar wurde gepflügt in zwei Spanntagen
und zwei Knechtstagen heißt: die Fertigung der Arbeit
erforderte die Thätigkeit zweier Gespanne und zweier
Knechte.
Spannung, der Zustand eines elastischen Körpers, in
welchem seine Teilchen durch eine von außen wirkende Kraft
aus ihrer ursprünglichen Lage gebracht sind und in dieselbe
zurückkehren, sobald die Kraft aufhört zu wirken (s.
Elastizität), daher das Kraftmaß, mit welchem eiserne
Konstruktionsteile auf Druck oder Zug in Anspruch genommen werden.
Elektrische S., s. Elektrizität; S. der Gase und Dämpfe
ist das Streben derselben nach Ausdehnung, wodurch sie auf die sie
umgebenden Körper einen Druck ausüben (s. Gase und
Dampf).
Spannnngsenergie, s. Kraft, S. 133.
Spannungsgesetz, Voltasches, s. Galvanismus, S. 877.
Spannungsirresein, s. Katatonie.
Spannungskoeffizient, s. Ausdehnung, S. 111.
Spannungsreihe, s. Elektrische S.
Spannweite (Spannung, Sprengung), die Entfernung der
Widerlager eines Gewölbes von einander, auch die Tragweite der
Balkendecken oder die lichte Tiefe eines Raums (Zimmertiefe).
Spanten, die Rippen eines Schiffs (s. d., S. 455).
Sparadrap (franz., spr. -drá), s.
Bleipflaster.
Sparagmit, s. Grauwacke.
Sparassis Fr. (Strunkschwamm), Pilzgattung aus der
Unterordnung der Hymenomyceten, mit fleischigem, vertikal
aufrechtem, strauchartig ästigem Fruchtkörper, dessen
Äste blattförmig zusammengedrückt und auf ihrer
ganzen glatten Oberfläche mit dem Hymenium überzogen
sind. S. crispa Fr. (echter Ziegenbart) besitzt einen in der Erde
verborgenen, dicken, fleischigen Stamm, welcher oben in zahlreiche
gelappte, gekräuselte Äste übergeht und daher einen
rundlich kopfförmigen Rasen bildet, wächst auf Sandboden
in Nadelwäldern im mittlern und nördlichen Europa und ist
sehr wohlschmeckend.
Sparbanken, s. Sparkassen.
Sparbutter, s. v. w. Kunstbutter, s. Butter, S. 697.
103
Spargel - Sparkassen
Spargel (Asparagus L.), Gattung aus der Familie der
Asparageen (Smilaceen), ausdauernde Kräuter od.
Halbsträucher mit sehr verzweigten, oft windenden Stengeln,
sehr kleinen, schuppenförmigen, fleischigen bis häutigen
Blättern u. in den Achseln derselben mit Büscheln
kleiner, meist nadelartiger, steriler, blattartiger Zweige,
kleinen, zwitterigen oder diözischen Blüten auf
gegliedertem Stiel und kugeliger, häufig nur einsamiger Beere.
Etwa 100 Arten in den warmen und gemäßigten Regionen,
die meisten am Kap. Der gemeine S. (A. officinalis L.) treibt aus
dem Rhizom fleischige, saftige, mit fleischigen Niederblättern
spiralig besetzte, weißliche oder blaßrötliche
Sprosse, die sich über der Erde in dem verzweigten,
grünen, 0,6-1,5 m hohen, glatten Stengel verlängern. Die
blattartigen Zweige sind nadelförmig, glatt, die Beeren
scharlachrot. Der S. wächst in Süd- und Mitteleuropa,
Algerien und Nordwestasien, besonders an Flußufern, und wird
in mehreren Varietäten als Gemüsepflanze kultiviert. Er
verlangt eine warme Lage und einen lockern, sandigen Boden, der
nötigen Falls drainiert werden muß, da auch nur im
Winter bleibende Nässe verderblich wirkt. Zur Anlage der
Spargelbeete hebt man vor Eintritt des Winters die Erde 1,9 m breit
und einen Spatenstich tief aus, gräbt dann Rinder- oder
Hofmist und zwar doppelt soviel wie zu einer gewöhnlichen
starken Düngung unter und steckt in Entfernungen von 0,6-0,9 m
Pfähle, an welchen man von der ausgegrabenen oder von andrer
guter Erde Hügel macht, deren Spitze den obern Rand des Beets
erreichen kann. Auf diesen Hügeln breitet man die ein- bis
zweijährigen Spargelpflanzen (Klauen) sorgfältig aus und
bedeckt sie mit Erde. Vorteilhaft ist eine weitere Mistbedeckung
des ganzen Beets, welche nur die Köpfe der Hügel
freiläßt, worauf man dann das Ganze so weit mit Erde
bedeckt, daß die Köpfe der Pflanzen etwa 3 cm tief zu
liegen kommen. Im Herbst schneidet man die Stengel 16 cm hoch ab,
lockert das Beet und bedeckt es 8-10 cm hoch mit altem Mist. Im
Frühjahr wird das Gröbere fortgenommen und der Rest mit
Erde mehrere Zentimeter hoch bedeckt. Im dritten Jahr erhöht
man die Beete mit fetter, sandiger Erde so stark, daß die
Pflanzen 16 cm tief liegen. Man kann jetzt anfangen, S. zu stechen;
doch ist es besser, nur einzelne Stengel und nur bis Anfang Juni
fortzunehmen. Die Beete geben dann 25 Jahre lang guten Ertrag; man
braucht sie nur im Frühjahr zu lockern und im Herbst stark mit
Mist, im Sommer mit Jauche, im Frühjahr mit Asche und Kali zu
düngen. Der S. enthält 2,26 Proz. eiweißartige
Körper, 0,31 Fett, 0,47 Zucker, 2,80 sonstige stickstofffreie
Substanzen, 1,54 Cellulose, 0,57 Asche, 92,04 Proz. Wasser; er
wirkt harntreibend, in größern Mengen genossen als
Aphrodisiakum und erzeugt wohl auch Blutharnen. Früher war die
Wurzel offizinell; die Samen hat man als Kaffeesurrogat verwertet.
Columella gedenkt in seinem Buch "De re rustica" auch des Spargels.
Andre Spargelarten hat man als Zierpflanzen benutzt; interessant
ist der blätterlose, dornige Asparagus horridus, in Spanien
und Griechenland. Vgl. Göschke, Die rationelle Spargelzucht
(3. Aufl., Berl. 1889); Burmester u. Bültemann, Spargelbau
(Braunschw. 1880); auch die Schriften von Brinckmeier (Ilmenau
1884) und Kremer (Stuttg. 1887).
Spargelerbse, s. Tetragonolobus.
Spargelfliege, s. Bohrfliege.
Spargelklee, s. v. w. Luzerne, s. Medicago; auch s. v. w.
Tetragonolobus.
Spargelkohl (Broccoli), s. Kohl.
Spargelstein, spargelgrüner Apatit (s. d.).
Spargilium (lat.), Spreng-, Weihwedel.
Spargiment (ital.), ausgestreutes Gerücht;
Umständlichkeit, sich sperrendes Zieren.
Sparherd, s. Kochherde, S. 906.
Spark, s. Spergula.
Sparkalk, s. Gips, S. 355.
Sparkarten, s. Sparkassen, S. 104.
Sparkassen (Sparbanken, engl. Saving banks, spr. ssehwing
bänks) sind Kreditanstalten, welche den Zweck haben, weniger
bemittelten Leuten die sichere Ansammlung und zinstragende Anlegung
kleiner erübrigter Geldsummen zu ermöglichen und
hierdurch den Spartrieb in weitern Kreisen des Volkes zu pflegen
und zu fördern. Dadurch, daß diese Kassen ihren Inhabern
grundsätzlich oder gesetzlich keinen Gewinn abwerfen sollen,
unterscheiden sich dieselben von andern ähnlich eingerichteten
Kreditanstalten. Solche Kassen sind (und zwar vorzugsweise von
Gemeinden als Gemeindeanstalten oder in der Art, daß die
Gemeinde die Bürgschaft für die Kasse übernahm und
die Verwaltung derselben unter die Aufsicht der
Gemeindebehörden stellte, später auch von
Privatgesellschaften und Fabrikanten) seit dem vorigen Jahrhundert
in großer Zahl ins Leben gerufen worden. Die erste wurde 1765
zu Leipzig als "Herzogliche Leihkasse" errichtet. Hierauf folgte
1778 eine von einer Privatgesellschaft in Hamburg gegründete
Anstalt, welcher zuerst der Name Sparkasse beigelegt wurde; ferner
die in Oldenburg 1786, Kiel 1796 sowie in Bern und Basel. Die erste
englische Sparkasse wurde 1798 in London von einer
Privatgesellschaft als Wohlthätigkeitsanstalt errichtet; in
Frankreich folgte Paris 1818, in Preußen Berlin in demselben
Jahr, in Österreich Wien 1819, in Schweden Stockholm 1821, in
Italien Venetien und die Lombardei 1822 und 1823, von welcher Zeit
ab die S. sich rasch in den europäischen Kulturländern
verbreiteten. Damit diese Anstalten ihren Zweck möglichst
vollständig erfüllen, und um zu verhüten, daß
dieselben nicht zu sehr von bemittelten Klassen benutzt werden, ist
eine obere Grenze für die jeweilig erfolgende einzelne
Einlage, dann auch eine solche für das Gesamtguthaben
festgesetzt, welche nicht überschritten werden darf. Der
geringste Betrag der Einlagen ist in Deutschland meist auf 1 Mk.
bemessen. Jeweilig nach Ablauf eines Jahrs werden die inzwischen
aufgewachsenen und nicht erhobenen Zinsen dem Kapital zugeschlagen.
Jeder Einleger erhält ein Sparkassenbuch, in welchem die
Einlagen fortlaufend vermerkt und erfolgende Rückzahlungen
abgeschrieben werden. Kleinere Summen werden sofort
zurückgezahlt, für größere dagegen ist eine
verschieden bemessene Kündigungsfrist angesetzt. Das
Gesamtguthaben wird gegen Rückgabe des Sparkassenbuchs
zurückgezahlt. Da S. viel dazu benutzt werden, um für
bestimmte Zwecke Summen anzusparen, so hat man auch Vorsorge
getroffen, daß Rückzahlungen nur zu bestimmten Zeiten
erfolgen, so bei den Mietsparbüchern am ortsüblichen
Mietzahlungstag. Kuntze (Plauen) empfiehlt zu dem Zweck die
Einführung von "gesperrten Sparkassenbüchern" mit festen
Rückzahlungsfristen. Um die Benutzung der S. auch für
solche zu erleichtern, welche nach andern Orten verziehen, wurde
die Bildung von Kommunalverbänden derart befürwortet,
daß jede Kasse die Einlagebücher andrer übernehmen
und weiterführen soll, indem die Einlagen Abziehender an die
Sparkasse des neuen Aufenthaltsortes überwiesen werden. Da
nach den meisten Statuten Aus-
104
Sparkassen.
zahlungen ohne Prüfung der Berechtigung des Inhabers
stattfinden, so ist zum Schutz gegen Verluste durch Diebstahl eine
sorgfältige Aufbewahrung der Sparkassenbücher geboten.
Als S. pflegt man auch solche Kassen zu bezeichnen, welche in
Wirklichkeit nur Einzahlungs- oder Markenverkaufsstellen sind.
Letztere dienen dem Zwecke, ganz kleine Summen anzusammeln, um
dieselben, wenn sie eine gewisse Höhe erreicht haben, an andre
Kreditanstalten oder sogen. Hauptsparkassen abzuführen, welche
werbende Anlegung und Verwaltung besorgen. Diese Verwaltung ist in
verschiedenen Ländern gesetzlich geregelt, so in Frankreich
l822 und 1835; in Preußen durch ein Regulativ von 1838,
welches dem Gedanken der Selbstverwaltung in weitem Maß
Rechnung trägt, jedoch mit der Maßgabe, daß ebenso
wie in Bayern, Baden, Sachsen etc. die Statuten der
öffentlichen, unter Staatsaufsicht zu stellenden S. der
staatlichen Genehmigung bedürfen; in England seit 1817, wo man
den Charakter der S. gesetzlich dadurch gewahrt hat, daß den
Leitern derselben (trustees) der Bezug einer Entschädigung
oder eines Gewinns untersagt wurde. Die deutschen S. legen die
ihnen anvertrauten Summen teils gegen Hypotheken auf
Grundstücke und Gebäude an, die Gemeindesparkassen
insbesondere gegen im Gemeindebezirk oder in dessen näherer
Umgebung bestellte Hypotheken, teils kaufen sie sichere
Wertpapiere, dann geben sie auch Darlehen gegen Wechsel und
Faustpfand, endlich auch bis zu einer bestimmten Summe gegen
Handschein und höhern Zins unter Gestellung eines Bürgen.
Die englischen S. kaufen meist Staatspapiere an. Die
französischen S. sind gesetzlich gehalten, die Einlagen bei
der staatlichen Caisse des dépôts et consignations im
Kontokorrentverhältnis zu hinterlegen; ihre Forderungen bilden
daher, soweit sie nicht in Bezugsrechte auf ewige Renten
umgewandelt werden, einen Teil der schwebenden Schuld des Staats.
Durch diese Zentralisierung des Sparkassenwesens ist zwar letzteres
außerordentlich vereinfacht; die einzelnen S. tragen mehr den
Charakter einfacher Zahlungs- und Rechnungsstellen. Dagegen
können durch die enge Beziehung zu den schwebenden Schulden,
den S., wie dies schon in Frankreich der Fall gewesen,
Verlegenheiten erwachsen. Überhaupt bedürfen die S.,
sobald sie nur gut verwaltet werden, weniger einen Rückhalt
durch wechselseitige Verbindung oder durch Gründung einer Art
Zentralsparkasse, weil bei denselben nicht wie bei Banken in
schlechten Zeiten die Rückforderungen anzuschwellen pflegen.
Die in einzelnen Ländern vorkommende Verbindung von S. mit
Pfandhäusern ist nicht zweckmäßig, weil in guten
Zeiten mehr Geld den S. zuströmt und die Pfandhäuser
keine Gelegenheit haben, dasselbe unterzubringen, während in
schlechten Zeiten der Geldbedarf der Pfandhäuser durch die S.
nicht gedeckt werden kann. Ihre Verwaltungskosten decken die S.
dadurch, daß sie einen niedrigern Zins geben, als sie
erhalten. Überschüsse werden zunächst zur Bildung
eines Reservefonds, dann für gemeinnützige Zwecke
(Altersprämien für treue Dienstboten etc.) verwandt. Bei
Gemeindesparkassen ist vielfach (so in Preußen, Baden) zu
derartigen Verwendungen staatliche Genehmigung erforderlich.
Schon 1798 tauchte in England der Gedanke auf, S. mit Schulen zu
verbinden; derselbe wurde 1834 an der Stadtschule zu Le Mans
verwirklicht. Dann bestanden schon Anfang dieses Jahrhunderts
eigentliche Schulsparkassen in Thüringen (Apolda) und am Harz
(Goslar). Seit 1866 wirkte Professor F. Laurent (s. d.) zu Gent in
unermüdlicher Weise für Einführung solcher Schul-
oder Jugendsparkassen. Den Erfolgen, welche er erzielte, ist es zu
verdanken, daß diese Kassen in Belgien, Frankreich, England
u. Italien, wo ihnen durch das Gesetz vom 27. Mai 1875 große
Vergünstigungen zugestanden wurden, dann in Österreich
und in einigen Teilen von Deutschland (besonders im Königreich
Sachsen, dann in Schleswig-Holstein) große Verbreitung
gefunden haben. Bei diesen Kassen sammelt der Lehrer die
Beiträge der Kinder, bis dieselben einen Betrag von der
Höhe erreicht haben, daß die Einlage in eine
öffentliche Sparkasse erfolgen kann. Nun kann, während
die Ersparnisse der einzelnen Kinder hierfür noch nicht
genügen, doch die Gesamtsumme zureichen und einstweilen
verzinslich angelegt werden. Der auf diesem Weg erzielte Gewinn
kann zur Deckung kleiner Verwaltungskosten, für
Prämiierung von Schülern oder auch zur Verteilung nach
Maßgabe der Einlagen verwandt werden. Durch die
Schulsparkassen soll der Trieb zum Sparen und zur
Selbstbeherrschung schon in der frühen Jugend gerade in den
Kreisen geweckt und genährt werden, für deren Lage diese
Tugenden von der höchsten Bedeutung sind. Dagegen sind die
Schulsparkassen besonders in deutschen Lehrerkreisen einem
großen Widerstand begegnet. Man machte gegen dieselben
geltend, daß gerade bei den untern Klassen den Kindern gar
keine Möglichkeit zum Sparen geboten sei, und daß diese
Anstalten die schlimmern Leidenschaften der Habsucht und des Neides
bereits bei den Kindern entflammten und großzögen.
Nach einer Mitteilung des Vereins für Jugendsparkassen gab
es in Deutschland 1881: 842 Kassen in 157 Städten und 548
Dörfern. Es waren an denselben beteiligt: 1250 Lehrer und
61,940 Schüler mit 640,000 Mk. Einlagen. Man zählte
in
Frankreich Kassen Bücher Einlagen
1877 8033 176040 2,98 Mill. Frank
1881 14372 302841 6,40 " "
1885 23222 488624 11,29 " "
Italien Lehrer Schüler Bücher Einlagen
1876 522 11935 7289 32049 Lire
1880 3240 40956 19056 174597 "
1885 3451 65062 376345 "
Ungarn Schulen Lehrer Schüler Einlagen
1880 141 222 7333 54647 Guld.
1882 354 565 19273 114734 "
1886 581 926 28256 113264 "
Vgl. Laurent, Conférence sur l'épargne (1866);
Wilhelmi, Die Schulsparkassen (Leipz. 1877); A. de Malarce, Die
Schulsparkasse (Berl. 1879); Elwenspöck, Die Jugendsparkasse
(Memel 1879); Senckel, Jugend- und Schulsparkassen (Frankf. a. O.
1882); Derselbe, Zur Sparkassenreform (1884).
Um in weitern Kreisen der Bevölkerung die Ansammlung von
ganz kleinen Beträgen zu ermöglichen, werden in
Deutschland seit 1880, damals angeregt durch Kaufmann Schwab in
Darmstadt, Pfennigsparkassen nach dem Vorbild der englischen Penny
saving banks gegründet. Es sind dies einfache Sammelstellen
für Beträge von 10 Pfennig und weniger, für welche,
wenn eine Summe von 1 Mk. erreicht ist, ein Sparkassenbuch von der
Hauptsparkasse ausgestellt wird. Die Ansammlung erfolgt unter
Verwendung von Sparmarken und Sparkarten oder Sparbüchern. Die
Marken, meist in gleicher Höhe, oft auch in verschiedenen
Wertstufen, werden gewöhnlich durch Vermittelung von
Ladengeschäften verkauft und auf den vorbezeichneten Stellen
der Sparkarten aufgeklebt. Sobald letztere ausgefüllt sind,
werden dieselben an bestimmten Stellen oder
105
Sparkassenversicherung - Sparrenkopf.
auch nur bei der Hauptsparkasse gegen Quittung eingeliefert. Den
Zwecken besonderer Kreise dienen die Fabriksparkassen (s. d.);
dagegen sind für die allgemeinste Verbreitung bestimmt die
seit 1861 in mehreren Ländern eingeführten Postsparkassen
(s. d.). Es wurden gezählt an S. (ohne Postsparkassen):
Einleger Einlagen Auf ein Buch
Mill. Mk. Mark
Großbritannien und Irland (1885) .... - 927 -
Italien (1885) .... 1189167 764 642
Österreich (1886) ... 2018695 1792 887
Frankreich (1885) ... 4926391 1770 359
Schweiz (1886) .... 745335 411 495
Es war in
die Zahl das Guthaben durchschnittlich
der Einleger der Einleger auf ein Buch
(Konten) Mark Mark
Preußen 1874 2061199 987237180 478
" 1885 4209453 2260933912 537
Bayern 1874 299277 70253440 235
" 1885 464545 130859355 282
Sachsen 1874 686733 232203831 338
" 1884 1199556 4076210 0 340
Baden 1874 141781 83297384 588
" 1884 215646 175727111 815
Hessen 1874 84491 40225356 476
" 1884 160745 90588725 564
Meiningen 1885 33525 18200000 543
Ein Einleger (Sparkassenbuch) kam in
Bayern (1885) auf 11,6 Einw. = auf 100 Einw. 8,6 Sparer
Baden (1884) " 7,1 " = " 100 " 13,5 "
Preußen (1886) " 6,4 " = " 100 " 14,8 "
Hessen (1884) " 5,9 " = " 100 " 16,8 "
Sachsen (1884) " 2,7 " = " 100 " 37,7 "
Auf den Kopf der Bevölkerung entfiel ein Einlagebetrag:
1885 in Bayern von 24,7 Mk., in Preußen von 79,8 Mk.,
1884 in Hessen von 94,7 Mk., in Baden von 109,7 Mk., in Sachsen von
128,0 Mk. Während im Königreich Sachsen auf 84 qkm eine
Sparkasse entfällt, gehören in Preußen 289, in
Bayern 273, in England 493, in Österreich 914 und in Italien
951 qkm dazu. Vgl. Hermann, Über S. (Münch. 1835); Vidal,
Des caisses d'épargne (Par. 1844); Konst. Schmidt und
Brämer, Das Sparkassenwesen in Deutschland (Berl. 1864);
Lewins, History of banks for savings in Great Britain and Ireland
(Lond.1866); "Verhandlungen des 14. volkswirtschaftlichen
Kongresses in Wien 1873"; Engel, Ein Reformprinzip für S. (in
der "Zeitschrift des Preußischen Statistischen Büreaus"
1868); "Statistique internationale des caisses d'épargne"
(bearbeitet von Bodio, Rom 1876); die Verhandlungen des Pariser
Kongresses für Wohlfahrtseinrichtungen (1878); "Beiträge
zur Statistik der S. im preußischen Staat" (Berl. 1876);
Selle, Die preußischen S. (Lüdenscheid 1879); Spittel,
Die deutschen S. (Gotha 1880); Kuntze, S. und Gemeindefinanzen
(Berl. 1882); Bahrt, Die Kontrolle und Hilfseinrichtungen bei S.
(2. Aufl., Leipz. 1882); Seedorff, Die Sparkassenbuchführung
(Hannov. 1887); Thiele, Die städtische Sparkasse zu Berlin in
ihrer Einrichtung (Berl. 1887). Seit 1876 erscheint in Wien als
Organ für internationales Sparkassenwesen die von C. Menzel
geleitete "Österreichisch-Ungarische Sparkassenzeitung".
Sparkassenversicherung, Bezeichnung der Geschäfte
einer als Nebenbranche von einigen
Lebensversicherungsgesellschaften eingeführten Art Sparkasse
(s. d.), welche gegen Leistung einer bestimmten Reihe von
Jahreseinzahlungen nach Ablauf festgesetzter Zeit ein bestimmtes
Kapital zu gewähren hat, und welcher alle Merkmale der
Versicherung fehlen, wenn nicht, wie das ausnahmsweise bei der
Einrichtung der Lebensversicherungsgesellschaft Friedrich Wilhelm
der Fall ist, ausbedungen wird, daß zwar das Kapital erst
nach Ablauf bestimmter Jahre ausgezahlt werde, die
Jahreseinzahlungen aber aufhören sollen, wenn der Versicherte
etwa vorher sterben würde. In diesem Falle liegt eine
Verbindung von Sparkasse mit der Versicherung vor (vgl.
Versicherung).
Sparks, Jared, nordamerikan. Geschichtschreiber, geb. 10.
Mai 1789 zu Willington im Staat Connecticut, war eine Zeitlang
Prediger einer Unitariergemeinde zu Boston, redigierte von 1823 bis
1830 die Vierteljahrsschrift "North American Review", ward 1839
Professor der Geschichte an der Harvard-Universität zu
Cambridge im Staat Massachusetts und war 1849-52 deren
Präsident; starb 14. März 1866 daselbst. Unter seinen
zahlreichen Schriften sind hervorzuheben: "Life of John Ledyard"
(Cambr. 1828; deutsch, Leipz. 1829); "Diplomatic correspondence of
the American revolution" (Boston 1829-31, 12 Bde.); "Life of
Governeur Morris" (das. 1832, 3 Bde.); "Life of Washington, with
diaries" (1839, 2 Bde.; deutsch von Raumer, Leipz. 1839); "Library
of American biography" (New York 1834-47, 25 Bde.) und
"Correspondence on the American revolution" (das. 1853, 4 Bde.).
Auch gab er die Werke G. Washingtons (New York 1834-38, 12 Bde.,
mit Biographie) und Benj. Franklins (1836-40, 10 Bde.) heraus und
führte dessen Selbstbiographie bis zu dessen Tod fort
(Sonderausg. 1844). Vgl. Mayer, Memoir of Jared S. (Baltimore
1867); Ellis, Memoir of J. S. (Cambr. 1869).
Sparmarken, s. Sparkassen, S.104, und Postsparkassen.
Sparmotor, s. Feuerluftmaschinen.
Sparnacum, früherer Name von Epernay (s. d.).
Sparprämie, s. Arbeitslohn, S. 759.
Sparr, altes märk. Adelsgeschlecht, das noch jetzt
in einem gräflichen Zweig in Pommern blüht; besonders im
17. Jahrh. war es zahlreich, und viele Offiziere in den Heeren
verschiedener Monarchen gingen aus ihm hervor. Bemerkenswert: Otto
Christoph, Freiherr von S., brandenburg. Generalfeldmarschall, geb.
1605 zu Prenden bei Bernau, trat 1626 in das kaiserliche Heer unter
Wallenstein, kämpfte von 1638 bis 1648 als Oberst eines
Regiments meist am Rhein, ward 1648 kurkölnischer
Generalfeldwachtmeister und nahm Lüttich ein. Er trat 1649 in
die Dienste des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg,
dessen Heer, namentlich die Artillerie, er organisierte, entschied
30. Juli 1656 durch seinen Angriff auf die polnische Reiterei den
Sieg bei Warschau, ward 1657 Generalfeldmarschall, befehligte die
brandenburgischen Hilfstruppen in der Schlacht bei St. Gotthardt;
starb 9. Mai 1668. Er errichtete in der Marienkirche zu Berlin das
schöne Denkmal am Erbbegräbnis seiner Familie mit seinem
eignen knieenden Standbild. Im J. 1889 ward das 16.
preußische Infanterieregiment nach ihm benannt. Vgl. v.
Mörner, Märkische Kriegsobersten des 17. Jahrh. (Berl.
1861).
Sparren, s. Dachstuhl; in der Heraldik s.
Heroldsfiguren.
Sparrenkopf, das freie, meist profilierte Ende eines
Sparrens, s. Dachstuhl; in der antiken Baukunst die unter der
Hängeplatte des Gebälks befindlichen Kragsteine oder
Konsölchen.
106
Sparrm. - Sparta.
Sparrm., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung
für A. Sparrmann, geb. 1747, Begleiter Cooks, gest. 1787 als
Professor in Upsala (Zoolog).
Sparta, im Altertum Hauptstadt der peloponnes. Landschaft
Lakonien, lag auf den letzten Ausläufern des Taygetos und
dicht am rechten Ufer des Eurotas, mit dem sich hier die
Flüßchen Önos und an der Südseite der Stadt
Knakion und Tiasa vereinigten, und bestand aus verschiedenen
weitläufigen, gartenreichen Quartieren, welche zusammen einen
Umfang von etwa 9 km hatten. Die Einwohnerzahl mag sich zur Zeit
der Blüte auf 40-50,000 belaufen haben. Früher hatte die
Stadt gar keine Mauern, da die Bürger ihr als solche dienen
sollten; erst der Tyrann Nabis legte eine Mauer an, die zwar bald
darauf von den Achäern zerstört, aber auf Befehl der
Römer wiederhergestellt und noch in byzantinischer Zeit
erneuert wurde. S. hatte auch keine eigentliche Akropolis, sondern
diesen Namen führte nur einer der Hügel der Stadt, auf
dessen Spitze neben andern der Tempel der Athene Chalkioikos stand.
Von den einzelnen Quartieren (Komen) wird Pitana im NO. als das
schönste genannt. Hier war die Agora mit den
Versammlungsgebäuden der Gerusia und der Ephoren, der von der
persischen Beute erbauten persischen Halle und dem großen,
mit weißem Marmor überkleideten Theater, von welchem
sich noch einige Überreste erhalten haben. Andre Plätze
im W. der Stadt, an der Straße nach Messene, waren der Dromos
mit 2 Gymnasien und der mit Platanen bepflanzte Platanistas, wo die
Jünglinge zu ringen pflegten. Die Stadt hatte außer den
angeführten noch zahlreiche andre Tempel und Monumente, welche
Pausanias nennt, deren Lage sich aber heute nicht mehr nachweisen
läßt. Überreste alter Bäder finden sich
nordwestlich und südöstlich vom Theater, Reste einer
alten Brücke über den Eurotas an der heutigen
Straße nach Argos und Tegea. Erst die Anlage der Stadt
Misthra (s. d.), westlich von S., veranlaßte ihre
Verödung. Die jetzige Stadt S. (s. Sparti), erst 1836
gegründet, nimmt den südlichen Teil des alten S. ein.
[Geschichte.] Als älteste Einwohner werden die Pelasger
genannt; frühzeitig gründeten die Phöniker
Niederlassungen an der Küste Lakoniens, um die dort
häufigen Purpurschnecken zu sammeln. Diesen folgten
kleinasiatische Griechen, Leleger genannt, und Einwanderer von
Norden her. Die durch die Einwanderungen vermehrte und
veränderte Bevölkerung wird in der ältesten
Überlieferung unter dem Namen "Achäer"
zusammengefaßt. Ihr sagenhaftes Herrschergeschlecht waren die
Tyndariden, dann die Atriden (der Atride Menelaos). Infolge der
Dorischen Wanderung (1104 v. Chr.) kam S. an die Dorier (s. d.).
Nach der gewöhnlichen Sage fiel Lakonien den beiden
Söhnen des Aristodemos, Eurysthenes und Prokles, zu. In
Wirklichkeit war die erste dorische Eroberung eine
unvollständige. Die Achäer behaupteten sich in einem
großen Teil Lakoniens; die Dorier setzten sich zunächst
bloß am rechten Ufer des Eurotas fest, wo sie als feste
Niederlassung S. gründeten. Von hier aus breiteten sie sich
allmählich über die übrigen Gemeinden aus und
vermischten sich mit den Achäern, deren ursprüngliche
Ebenbürtigkeit auch daraus sich ergibt, daß eins der
spartanischen Königsgeschlechter, die Agiaden, achäisch
war. Diese unfertigen Zustände stürzten den Staat in eine
Verwirrung, aus der ihn erst die Gesetzgebung des Lykurgos (s. d.),
welche freilich so, wie sie bestand, nicht auf einmal angeordnet,
sondern allmählich entstanden ist, herausriß. Dieser
stellte den innern Frieden her und begründete danach eine neue
Staatsordnung auf der Vorherrschaft und strengen Organisation der
dorischen Bevölkerung, der Spartiaten. Diese wurden in der
Mitte des Landes vereinigt und 4500 (später 9000) gleiche
Ackerlose unter sie verteilt, über welche sie weder durch Kauf
oder Verkauf, noch durch Schenkung oder Testament frei
verfügen durften. Sie waren in die drei Phylen der Hylleer,
Pamphyler und Dymanen, diese wieder in zehn Oben geteilt und an
Rang und Rechten einander gleich. Außer den Spartiaten gab es
noch zwei untergeordnete Klassen der Bevölkerung,
Periöken und Heloten. Die Periöken (Lakedämonier)
waren persönlich frei, aber ohne Anteil am Stimmrecht in der
Volksversammlung und an den Ehrenrechten, leisteten Zins an den
Staat und wurden mit den Spartiaten zur Verteidigung des
Vaterlandes aufgeboten. Die Heloten waren Leibeigne des Staats und
wurden hauptsächlich dazu verwandt, die Ländereien der
Spartiaten zu bebauen und letztere im Krieg als Leichtbewaffnete zu
begleiten. Zur Zeit der Blüte Spartas zählte man an
Einwohnern ungefähr 40,000 Spartiaten, 120,000 Periöken
und 200,000 Heloten. Die Verfassung war eine aristokratische. An
der Spitze des Staats standen die zwei Könige. Ihnen zur Seite
stand der Rat der Alten, die Gerusia, mit Einschluß der
beiden Könige, die aber nur je eine Stimme hatten, aus 30
Mitgliedern, den Ältesten der Oben, bestehend. Die
Volksversammlung (Agora) hatte nur die Anträge des Rats der
Alten (später auch der Ephoren) entweder anzunehmen oder zu
verwerfen, nicht aber selbst Anträge zu stellen. Die
Könige gelangten nach Erbrecht und Erstgeburt zur Regierung.
Durch Wohnung, Ländereien, ihnen zukommende Lieferungen von
Opfervieh und Beute etc. vor allen andern Bürgern
ausgezeichnet, waren sie Oberpriester, Feldherren und Richter. Aber
ihre Macht, in älterer Zeit nicht genau begrenzt, war
späterhin, namentlich nach dem Aufkommen der Ephoren (s. d.)
seit den Messenischen Kriegen, sehr beschränkt.
Möglichste Gleichheit der Bürger, kriegerische
Tüchtigkeit und ausschließliches Interesse derselben
für des Staats Macht und Ruhm hervorzubringen, war der Zweck
der Lykurgischen Gesetzgebung. Der Spartiate gehörte nicht
sich, sondern dem Staat an; daher war das Leben ein fast durchaus
öffentliches: Jagden, Leibesübungen, Teilnahme an den
Volksversammlungen, an Opfern und feierlichen Chören,
Zuschauen bei den gymnastischen Spielen der Jugend u. dgl.
füllten, wenn nicht Krieg war, die Zeit des Tags aus. Gewerbe
und Künste, Schiffahrt und Handel zu treiben, galt eines
Spartiaten für unwürdig. Bereicherung durch Handel war
durch das Gesetz, bloß eiserner Münzen sich zu bedienen,
ausgeschlossen. Auch die Erziehung war durchaus Sache des Staats,
öffentlich und gemeinschaftlich und bildete ein künstlich
gegliedertes System; ihr vorherrschender Zweck war körperliche
Kräftigung und Abhärtung, selbst bei der weiblichen
Jugend, und Gewöhnung an streng militärischen Gehorsam.
Durch Übung in der Kürze des Ausdrucks (Lakonismus)
gewann der junge Spartiate jene Intensität und Sammlung des
Geistes, jene gedrungene und kernige Persönlichkeit, die ihn
auszeichnete; durch Erlernung dorischer Nationallieder wurde
Begeisterung für das Vaterland geweckt. Damit nicht von
außen Gefährliches sich einschleiche, durfte kein
Spartaner ohne ausdrückliche Erlaubnis ins Ausland reisen;
Fremde wurden nur eingelassen, wenn sie mit den Behörden zu
verhandeln hatten, und durften nicht länger als nötig
verweilen. Der
107
Sparta (Geschichte).
Staat wachte über Einfachheit in dem Bau und der
Einrichtung der Häuser, über die Kleidung, über die
Zucht der Frauen, selbst über die Musik. Die Männer
(immer je 15) mußten sich, um jeden Luxus im Essen zu
verhindern, zu gemeinsamen einfachen Mahlzeiten (Pheiditien oder
Syssitien) vereinigen. Die Ehe war geboten, und es fand
öffentliche Anklage statt gegen die, welche gar nicht,
spät oder unpassend sich verehelichten. Eine kinderlose Ehe
wurde gar nicht als solche angesehen, sondern ihre Auflösung
vom Staat verlangt. Mißgestaltete und schwächliche
Kinder wurden, nachdem sie den Ältesten des Geschlechts
vorgezeigt worden waren, in den Schluchten des Taygetos ausgesetzt,
d. h. als Periökenkinder erzogen, während Kinder von
Periöken und Heloten, wenn sie spartiatische Erziehung
genossen und von einem Spartiaten adoptiert waren, mit Erlaubnis
der Könige in die Doriergemeinde aufgenommen werden konnten;
dieselben hießen Mothaken. Durch das Übergewicht der
dorischen Spartiaten wurde Lakonien erst zu einem dorischen Staat
gemacht. Das gesteigerte Stammesgefühl traf zusammen mit der
nur auf kriegerische Tüchtigkeit und Thatkraft gerichteten
Lebensordnung, um den Eroberungsgeist in den Spartanern zu erwecken
und zu nähren.
Der erneuerte Kampf mit den alten Einwohnern hatte die
völlige Unterwerfung derselben zur Folge. Durch
Grenzstreitigkeiten entstanden die Kriege mit Messenien (s. d.),
die mit der Unterjochung dieses Landes endigten. Langwierige Kriege
hatte S. mit Arkadien zu führen. Erst um 600 v. Chr. gewannen
die Spartaner die Oberhand und zwangen Tegea zur Anerkennung ihrer
Hegemonie, die sich damals bereits über den größten
Teil des Peloponnesos erstreckte. Die Olympischen Spiele waren das
gemeinschaftliche Fest der unter Spartas Oberhoheit vereinigten
Staaten. Mit Klugheit und Umsicht waren die Spartaner darauf
bedacht, durch Erhaltung der alten staatlichen Ordnungen in den
Nachbarländern, namentlich durch Bekämpfung der Tyrannis,
ihren politischen Einfluß zu befestigen, und wurden hierbei
von der delphischen Priesterschaft unterstützt. Beim Beginn
der Perserkriege scharte sich ganz Griechenland um die Spartaner,
welche den Oberbefehl führten, aber sich in denselben wenig
Ruhm erwarben; aus Eifersucht auf Athen nahm S. am Kampf bei
Marathon nicht teil, und nur gezwungen schlug es die Schlacht bei
Salamis; sein Glanzpunkt war die Aufopferung des Leonidas und
seiner Dreihundert bei den Thermopylen. Die Fortführung des
Kampfes in größerm Maßstab und die Gründung
eines großen hellenischen Gemeinwesens unter spartanischer
Hegemonie vertrug sich nicht mit der auf strenge Abgeschlossenheit
berechneten Verfassung Spartas. So überließ es, wenn
auch von Neid erfüllt, die Führung der Griechen im
Seekrieg den kühnern thatkräftigern Athenern, zumal es
von innern Erschütterungen heimgesucht wurde. Einen Aufstand
der Arkadier und der mit diesen verbündeten Argiver
dämpfte S. zwar glücklich; aber ein Aufstand der
Messenier (464-455) lähmte des Staats Kraft im Innern und
zwang ihn sogar, bei Athen Hilfe zu suchen. Als S. ein Hilfskorps,
welches Kimon von Athen 461 zuführte, schimpflich
zurückschickte, entstand offener Bruch zwischen beiden
Staaten. Um den Athenern im Norden ein Gegengewicht zu beschaffen,
stellte S. durch den Sieg bei Tanagra 457 Thebens Hegemonie in
Böotien her. Die Schlacht bei Önophyta vernichtete aber
diese wieder, und 450 ward unter dem Einfluß friedfertig
gesinnter Staatsmänner ein fünfjähriger
Waffenstillstand und 445 ein 30jähriger Friede zwischen Athen
und S. geschlossen, in welchem beide Staaten sich den Besitz ihrer
Hegemonie garantierten. Der tiefer liegende Gegensatz jedoch
zwischen dem ionischen und dem dorischen, dem demokratischen und
aristokratischen Element sowie der Neid der auf Athens Macht und
Blüte eifersüchtigen Verbündeten Spartas, namentlich
Korinths und Thebens, ließen es zu keiner dauernden
Versöhnung kommen, und im Peloponnesischen Krieg (431-404)
fand der schroffe Gegensatz seinen Ausdruck. S. ging aus demselben
als Sieger und scheinbar mächtiger hervor, als es je zuvor
gewesen war. Alle frühern Bundesgenossen Athens waren ihm
zugefallen; aber im Innern geschwächt und durch Beseitigung
weiser Gesetze der Grundlagen seiner Verfassung beraubt, verstand
es nicht, den gewonnenen Besitz mit Mäßigung und
Klugheit zu behaupten. Gewalt und Treulosigkeit waren die
Grundsätze der Politik eines Lysandros und Agesilaos.
Überall wurden unter Spartas bewaffnetem Schutz oligarchische
Verfassungen eingerichtet, die feindlichen Parteien mit blutiger
Gewalt unterdrückt. Ein Hauptziel der spartanischen Politik
war die Wiedergewinnung der kleinasiatischen Küste, welche im
Peloponnesischen Krieg den Persern preisgegeben worden war. Deshalb
unterstützten die Spartaner den jüngern Kyros gegen
Artaxerxes und sandten 399 Thimbron, dann Derkyllidas und zuletzt
Agesilaos mit Heeresmacht nach Kleinasien. Aber die glänzenden
Erfolge des letztern vermochten nicht, die Stellung Spartas im
Mutterland zu sichern. Auf Anstiften der Perser verbündeten
sich Athen, Theben, Korinth, Argos u. a. gegen S., und es entstand
395 der sogen. Korinthische Krieg (s. d.), den S. durch den mit
Persien vereinbarten Antalkidischen Frieden (387) beendete. Es gab
die kleinasiatischen Griechen den Barbaren preis und hoffte, durch
das Verbot aller Bünde zwischen griechischen Staaten seine
Herrschaft dauernd zu begründen. Es zwang Theben, seine
Städte freizugeben, Argos, seine Besatzung aus Korinth
zurückzuziehen, und schaltete im Peloponnes als
unumschränkter Herr. Die Besetzung der Kadmeia in Theben (382)
führte jedoch den Sturz von Spartas unwürdiger
Gewaltherrschaft herbei. Theben erkämpfte sich 379 seine
Freiheit und die Hegemonie über Böotien wieder. In dem
Kampf, den S. nunmehr gegen Athen und Theben unternahm, verlor es
an ersteres seine Herrschaft zur See, und die Schlacht bei Leuktra
(371) erschütterte auch seine Macht zu Lande für immer.
Epameinondas verwüstete 369 Lakonien, vernichtete seine
Hegemonie über den Peloponnes, machte Messenien
selbständig und brachte so S. an den Rand des Verderbens, aus
dem es auch der Tod des Epameinondas nicht erretten konnte.
Die von Lykurg gegebene Verfassung war im Lauf der Zeit
untergraben worden, und der Verkehr mit dem üppigen Persien
und dem asiatischen Griechenland hatte verderbend auf die
einheimische Sitte eingewirkt. S. wurde eine der reichsten
Städte Griechenlands. Infolge der immerwährenden Kriege
sank aber die Zahl der männlichen Bevölkerung, und zur
Zeit des Aristoteles stellte es nicht viel über 1000 Hopliten.
Wenn dieser Stand der Bevölkerung von selbst die
Vermögensgleichheit aufheben mußte, so wurde diese
Störung noch mehr gefördert durch das Gesetz des Ephoren
Epitadeus, welches durch Schenkung oder Testament frei über
das Ackerlos zu verfügen gestattete. Die Verfassung ging
allmählich in eine engherzige, selbstsüchtige Oligarchie
über. Im Innern krank und seiner Bundesgenossen beraubt,
108
Sparta, Herzog von - Spartieren.
konnte sich S. seit der Schlacht bei Leuktra nie wieder zu
seinem frühern Einfluß erheben. Alexander d. Gr.
versagten sie zwar die Heeresfolge, aber König Agis II. machte
330 einen fruchtlosen Versuch, die makedonische Herrschaft zu
stürzen. Die Spartaner mußten sogar, um sich gegen neue
Angriffe des Demetrios (296) und des Pyrrhos (272) zu
schützen, ihre Stadt stark befestigen. Die Spartiaten
würdigten sich zu Mietlingen des Auslandes herab. Zur Zeit des
Königs Agis III. war ihre Zahl auf 700 geschmolzen. Die
schwindende Volkszahl und die überhandnehmende Sitte der
Mitgiften machten das Mißverhältnis im Besitz immer
größer. Agis' III. (244-240) Versuch, die Lykurgische
Verfassung wiederherzustellen, scheiterte. Kleomenes III. begann
nach seinem ruhmreichen Kriege gegen die Achäer 226 seine
Reformen mit dem Sturz der Ephoren und der Verbannung der
oligarchischen Gegner. Ohne weiteres Hindernis wurden die Schulden
getilgt, die Bürgerschaft durch Aufnahme von Periöken auf
4000 gebracht, die Ländereien unter sie neu verteilt und die
Lykurgische Zucht wieder eingeführt. Auch die Hegemonie im
Peloponnes und in Griechenland wollte Kleomenes seinem Vaterland
wieder erkämpfen, und schon war er nach der Eroberung von
Argos nahe daran, an die Spitze des Achäischen Bundes zu
treten, als Antigonos Doson, von Aratos herbeigerufen, 221 in der
Schlacht bei Sellasia die Macht des kaum verjüngten Staats
brach. S. mußte sich an Antigonos ergeben, der sofort die
Reformen wieder aufhob und das Ephorat wiederherstellte. Der Staat
trat dem Achäischen Bund bei, behielt aber im übrigen
seine Unabhängigkeit. In dem Usurpator Machanidas (211-207)
erhielt S. seinen ersten Tyrannen; er hob das Ephorat auf, trat als
unumschränkter Herr auf und machte sich an der Spitze seiner
Söldnerscharen im Peloponnes furchtbar, doch fiel er schon 207
gegen Philopömen bei Mantineia. Die Regierung seines
Nachfolgers Nabis (206-192) war eine fast ununterbrochene Reihe von
Kriegen und ein Gewebe von verräterischer Politik. Nach der
Ermordung des Nabis durch die Ätolier (192) gewann
Philopömen S. wieder für den Achäischen Bund, aber
der alte Haß der Spartaner gegen die Achäer blieb. Als
S. 188 vom Bund abfiel und sich unter römischen Schutz
stellte, rückte Philopömen vor S., ließ die
Häupter der Empörung hinrichten, die Mauern
niederreißen und die fremden Söldner sowie die von den
Tyrannen unter die Bürger aufgenommenen Heloten entfernen. S.
mußte nun achäische Einrichtungen annehmen. Rom sah zu,
wie sich die Achäer und Spartaner gegenseitig durch ihre
Streitigkeiten entkräfteten, bis der geeignete Zeitpunkt zum
Eingreifen gekommen war. Nach der Vernichtung des Achäischen
Bundes und der Unterwerfung von ganz Griechenland (146) teilte S.
das ziemlich leidliche Los der übrigen griechischen Staaten;
ja, es soll den Spartanern von den Römern besondere Ehre zu
teil geworden sein: sie blieben frei und leisteten keine andern als
Freundschaftsdienste. Unter den Kaisern nach Augustus blieb den
Lakedämoniern kaum noch ein Schatten von Freiheit. Die
Lykurgischen Einrichtungen bestanden noch bis ins 5. Jahrh. fort;
erst das Christentum verdrängte die letzten Reste derselben.
Vgl. Manso, Sparta (Leipz. 1800-1805, 3 Tle.); O. Müller, Die
Dorier (2. Aufl., Bresl. 1844, 2 Bde.); Lachmann, Die spartanische
Staatsverfassung in ihrer Entwickelung und ihrem Verfall (das.
1836); Trieber, Forschungen zur spartanischen Verfassungsgeschichte
(Berl. 1871); Gilbert, Studien zur altspartanischen Geschichte
(Götting. 1872); Busolt, Die Lakedämonier und ihre
Bundesgenossen (Leipz. 1878, Bd. 1); E. v. Stern, Geschichte der
spartanischen und thebanischen Hegemonie (Dorp. 1884);
Fleischanderl, Die spartanische Verfassung bei Xenophon (Leipz.
1888).
Sparta, Herzog von, Titel des griech. Kronprinzen
Konstantin (geb. 2. Aug. 1868), des ältesten Sohns des
Königs Georg von Hellas.
Spartacus, Anstifter des Sklavenkriegs und Führer in
demselben, 73-71 v. Chr., Thraker von Geburt, früher ein
freier Mann, ward römischer Sklave und kam in die
Gladiatorenschule zu Capua. Er entfloh 73 aus dieser mit etwa 70
Genossen, brachte am Vesuv einem Legaten des Prätors P.
Varinius eine völlige Niederlage bei, schlug noch zwei andre
Legaten und dann auch den Prätor selbst, worauf durch den
allgemeinen Zulauf von Sklaven sich bald ein Heer von mehr als
100,000 Mann um ihn sammelte. Mit diesen trat er 72 den Marsch nach
Norden an, um sie über die Alpen nach ihrer Heimat, Gallien
und Thrakien, zurückzuführen. Ein Teil des Heers, der
sich unter Führung des Crixus von ihm trennte, wurde am Berge
Garganus in Apulien geschlagen; er selbst aber brachte den beiden
Konsuln des Jahrs, Gnäus Lentulus und L. Gellius, die ihm den
Weg verlegen wollten, schwere Niederlagen bei und schlug auch den
Prokonsul Gajus Cassius bei Mutina. Nun wurde er aber von seinem
Heer, in dem die Beutelust von neuem erwachte, genötigt,
wieder nach Süden umzuwenden. In Rom aber beauftragte man 71
den Prätor M. Licinius Crassus mit Führung des Kriegs.
Diesem gelang es, S. in der Südwestspitze von Italien
einzuschließen; er bahnte sich zwar durch seine Tapferkeit
den Weg durch die feindlichen Linien, aber nun wurde ein Teil des
Heers, der sich wiederum von ihm getrennt hatte, geschlagen und
völlig aufgerieben, und er selbst ward von seinen Leuten wider
seinen Willen zur Schlacht gezwungen, in der er unterlag und tapfer
kämpfend fiel; 60,000 Sklaven sollen darin getötet und
6000 Gefangene auf der Straße zwischen Capua und Rom
gekreuzigt worden sein. Pompejus, von Spanien zurückkehrend,
vertilgte den letzten Rest der Sklaven.
Spartel, Kap (Cabo Espartel, Râs Ischberdil),
Vorgebirge an der Küste Marokkos, am Westeingang der
Straße von Gibraltar, 314 m hoch, bildet die Nordwestspitze
von Afrika. Es ist das Cotes promontorium der Alten.
Sparten ("die Gesäeten"), im griech. Mythus die aus
den von Kadmos gesäeten Drachenzähnen entsprossenen
geharnischten Männer und ihre Nachkommen (s. Kadmos); auch
dichterischer Name für die gesamten Thebaner.
Sparterie (franz.), Flechtwerk, s. Geflechte.
Sparti (Neu-Sparta), Hauptstadt des griech. Nomos
Lakonia, 1836 auf der Stelle von Alt-Sparta durch
Übersiedelung der Bewohner von Misthra (s. d.) gegründet,
Sitz eines Erzbischofs, mit einem Gymnasium, kleinem
Altertümermuseum, regelmäßigen Straßen und
gleichförmigen, dem Klima wenig angemessenen, meist
zerstreuten Häusern, schön, aber ungesund gelegen. S.
hatte 1879 mit dem Nachbardorf Psychiko zusammen 3595 Einw.
Spartianus, Älius, einer der Scriptores historiae
Augustae (s. d.), lebte gegen Ende des 3. Jahrh. n. Chr. unter
Diokletian, Verfasser der Biographien der Kaiser Hadrian, Verus,
Julian, Septimius Severus, Pescennius Niger, Caracalla und
Geta.
Spartiaten, die dorischen Vollbürger in Sparta.
Spartieren (ital.), das Umschreiben der in Stim-
109
Spartium - Spateisenstein.
men gedruckten oder geschriebenen ältern Kompositionen in
moderne Partitur (spartito).
Spartium L. (Besenginster, Pfriemen), Gattung aus der
Familie der Papilionaceen, Sträucher mit langen,
rutenförmigen, eckig gefurchten Ästen, wenig zahlreichen
gedreiten, am obern Teil auch einfachen Blättern und
gestielten Blüten in Trauben oder Ähren. S. scoparium L.
(Sarothamnus vulgaris Wimm., Besenpfriemen, Besenkraut), ein 3 m
hoher Strauch, bisweilen mit echtem Stamm, ziemlich gerade
aufsteigenden, grünen Ästen, kleinen, rundlichen,
behaarten Blättchen, goldgelben Blüten in Trauben und
schwärzlichen Hülsen, in Mitteleuropa, liefert in den
Ästen Material zu Besen; auch hat man die Blüten zum
Färben und die Knospen als Kapernsurrogat benutzt. Er gedeiht
vortrefflich auf sandigem, schlechtem Boden und wird auf solchem
bisweilen als Futterpflanze, zu forstlichen Zwecken und als Hecke
angepflanzt; anderseits wird er im Forstbetrieb auch ein
lästiges Unkraut. Mehrere Varietäten kultiviert man als
Ziersträucher. Ein in der Pflanze enthaltenes Alkaloid,
Spartein, wird bei Herzschwäche und organischen Herzfehlern
wie Digitalis benutzt. S. junceum L. (Sparthiantus junceus Lk.,
wohlriechende Pfriemen, Binsenpfriemen, spanischer Ginster), ein
hoher Strauch mit wenigen einfachen, sehr schmalen Blättern,
gelben, wohlriechenden Blüten in schlaffer Ähre und
langen, schmalen Hülsen, in den Mittelmeerländern,
liefert in den zähen, biegsamen Ästen Material zu
Flechtwerk, außerdem Bastfasern zu Geweben. Als Zierstrauch
hält er bei uns nur schwierig aus. Schon im Altertum wurde
diese Pflanze zu Schiffsseilen, Decken, Schuhen benutzt, auch die
Faser zu Geweben verarbeitet.
Spartivénto, Kap (im Altertum Herculis
promontorium), die Südspitze des italienischen Festlandes im
Ionischen Meer; zwischen hier und Melito landete Garibaldi 25. Aug.
1862.
Sparto, s. Esparto.
Spasimo di Sicilia (ital.), die nach dem Kloster Santa
Maria dello Spasimo in Palermo benannte, jetzt im Museum zu Madrid
befindliche Kreuztragung Christi von Raffael (s. d., S. 551).
Spask, 1) Kreisstadt im russ. Gouvernement Rjäsan,
am Spaskischen See im Thal der Oka, ein armer Ort mit (1885) 4383
Einw. -
2) Kreisstadt im russ. Gouvernement Kasan, an der Besdna
(Nebenfluß der Wolga), mit Getreidehandel und (1885) 3227
Einw. -
3) Kreisstadt im russ. Gouvernement Tambow, am Stadenez, hat
einige Fabrikthätigkeit, Handel mit Getreide, Hanf, Flachs,
Leinsaat, Pottasche, Borsten, Wolle und Leder (nach Moskau, Rybinsk
und Rostow) und (1885) 5484 Einw.
Spasmus (griech.), Krampf; daher spasmodisch, spastisch,
s. v. w. krampfhaft.
Spasowicz (spr. -witsch), Wladimir, poln.
Litterarhistoriker, geb. 16. Jan. 1829 zu Rzeczyca (Gouvernement
Minsk), studierte in Petersburg die Rechte, war bis 1862 Professor
des Strafrechts an der dortigen Universität, dann Dozent an
der Rechtsschule daselbst. Infolge seines "Lehrbuchs des
Kriminalrechts" (Petersb. 1863, russ.) verlor er jedoch diese
Stelle und wirkt seit 1866 als namhafter Advokat in Petersburg,
besonders bekannt durch sein Auftreten als Verteidiger in den
Hochverrats- und Nihilistenprozessen. S. ist seit 1876 Herausgeber
der in Warschau erscheinenden Monatsschrift "Ateneum",
verfaßte in der "Geschichte der slawischen Litteraturen" von
Pipin den die polnische Litteratur betreffenden Teil (deutsch,
Leipz. 1883) und schrieb zahlreiche Monographien über dieses
Fach. S. gilt als das Haupt einer Partei, welche eine
polnisch-russische Verständigung auf liberaler Grundlage
anstrebt; dafür wirbt er namentlich, allerdings mit geringem
Erfolg, in der 1883 von ihm begründeten polnischen
Wochenschrift "Kraj", die in Petersburg erscheint.
Spat, alte bergmännische Bezeichnung für
Mineralien mit deutlicher Spaltbarkeit.
Spat (Spath), chronische Gelenkentzündung mit
Knochenauflagerung (Exostose, Spaterhöhung) an der innern
Seite des Sprunggelenks und zwar an den beiden untern
Artikulationen desselben. Bei vielen Pferden entsteht der S. als
eine unbedeutende Abnormität, welche den Gebrauch nicht
beeinträchtigt. Oft aber bedingt derselbe eine Lahmheit, wobei
der leidende Schenkel schneller und etwas zuckend gehoben, weniger
weit nach vorn und nicht so fest aufgesetzt wird. Dieser abnorme
Gang wird bei fortgesetzter Bewegung weniger merklich, tritt aber,
nachdem das Pferd einige Zeit ruhig gestanden, sofort wieder
hervor. Nach und nach steigert sich das Lahmgehen, das Tier tritt
bei beginnender Bewegung nur mit der Spitze des Hufs auf und hinkt
oft die ersten Schritte auf drei Beinen. Manchmal läßt
dieses Lahmgehen nach Jahresfrist von selbst nach und hört
wohl auch ganz auf, doch nicht, ohne eine gewisse Steifigkeit im
Sprunggelenk zu hinterlassen. Der Knochenauswuchs entwickelt sich
zuweilen erst einige Wochen nach Beginn des Lahmgehens. An der
innern Sprunggelenkfläche, nahe dem Schienbein, als kleine,
kaum bemerkbare Erhöhung sitzend, nimmt er nach und nach an
Umfang und Höhe zu, und zwar fühlt er sich, als mit dem
Knochen in Verbindung stehend, hart an. Bei einigen Pferden beginnt
der S. mit einer intensiven Entzündung der Gelenkkapsel, so
daß die Tiere eine Zeitlang noch keine Spaterhöhung,
wohl aber die Symptome der Spatlahmheit bekunden (unsichtbarer S.).
Bei längerer Dauer des Lahmgehens tritt oben am Schenkel in
der Regel Schwund ein. Der S. entwickelt sich vorzugsweise bei
jungen Tieren zwischen dem 3. und 6. Jahr, selten später, und
zwar besonders infolge von übermäßigen
Anstrengungen. Schwäche der Sprunggelenke disponiert dazu.
Vollständige Heilung ist insofern nicht möglich, als sich
die zerstörte Gelenkfläche nicht wiederherstellen und die
vorhandene Knochenauflagerung nicht beseitigen läßt. Nur
dem Lahmgehen kann abgeholfen werden und zwar durch Anwendung eines
scharfen Pflasters oder des Brenneisens, vorzugsweise aber durch
die Operation des Spatschnitts; nach jeder Behandlung muß dem
Tier ununterbrochene mehrwöchentliche Ruhe gegönnt
werden. Vgl. Dieckerhoff, Pathologie und Therapie des S. (Berl.
1875).
Spataugenkalk, s. Kreideformation, S. 183.
Spateisenstein (Eisenspat, Siderit, vulgär:
Stahlstein, Flinz), Mineral aus der Ordnung der Carbonate,
kristallisiert rhomboedrisch, oft mit sattelförmig oder
linsenartig gekrümmten Flächen (s. Tafel "Mineralien und
Gesteine", Fig. 3), findet sich häufig derb in klein- und
großkörnigen Aggregaten, selten in kleintraubigen und
nierenförmigen Gestalten (Sphärosiderit), häufig in
dichten und feinkörnigen, thonhaltigen Varietäten, welche
teils in runden oder ellipsoidischen Nieren, teils in stetig
fortsetzenden Lagen und zuweilen rogensteinähnlich ausgebildet
sind (thoniger Sphärosiderit). Er ist durchscheinend,
gelblichgrau bis erbsengelb, mit Glas- bis Perlmutterglanz,
während die Zersetzung, namentlich die sehr gewöhnliche
Umwandlung in Brauneisenstein, dunklere Farbennüancen und
Undurchsichtigkeit erzeugt
110
Spatel - Specht.
(Blau-, Braunerz). Härte 3,5-4,5, spez. Gew. 3,7-3,9. S.
ist wesentlich kohlensaures Eisenoxydul FeCO3 mit 48,3 Proz. Eisen,
enthält aber ganz gewöhnlich Mangan, Magnesium, Calcium
und Zink nicht sowohl als Verunreinigungen wie als isomorphe
Beimischungen, durch welche Übergänge zu den mit S.
isomorphen Mineralspezies Manganspat, Magnesit, Kalkspat und
Zinkspat gebildet werden. Solche Mittelspezies sind: Oligonspat
(mit bis 20 Proz. Mangan), Sideroplesit (mit 6-7 Proz. Magnesium),
Pistomesit (mit 12 Proz. Magnesium), Zinkeisenspat (mit 14-20 Proz.
Zink). Kommt im thonigen Sphärosiderit außer Thon noch
Kohle hinzu (Kohleneisenstein, Blackband der Engländer), so
entstehen schwarze, glanzlose, gewöhnlich dickschieferige
Massen mit 35-78 Proz. Eisencarbonat. Der Verwitterung zu
Eisenhydroxyd ist der S. so leicht ausgesetzt, daß
gewiß viele Brauneisensteine auf diesem Weg entstanden sind,
wie denn sehr häufig das Ausgehende von
Spateisensteingängen als den Atmosphärilien
zugänglich in Brauneisenstein umgewandelt ist. S. bildet
Gänge, Nester und Lager in verschiedenen Formationen; der
(echte) Sphärosiderit tritt als Zersetzungsprodukt in
Hohlräumen basaltischer Gesteine, der thonige S. in
Flözen, meist der Steinkohlenformation, dem Rotliegenden oder
der Braunkohlenformation angehörig, auf. Hauptfundorte
für kristallisierten und derben S. sind: Lobenstein im
Reußischen, Freiberg in Sachsen, Klausthal am Harz,
Müsen bei Siegen, Eisenerz in Steiermark, Hüttenberg in
Kärnten; des Sphärosiderits: Steinheim bei Hanau und
Dransberg bei Göttingen; des thonigen Spateisensteins und des
Kohleneisensteins: Westfalen, Banat, England und Schottland. Alle
Varietäten des Spateisensteins (mit Ausnahme des nur in
kleinen Mengen vorkommenden echten Sphärosiderits) sind
höchst wichtige Eisenerze; sie sind das Haupterz in
Steiermark, bei Müsen etc.; thonige Sphärosiderite und
namentlich Kohleneisensteine, für welche die enge
Verknüpfung mit dem zur metallurgischen Verwendung notwendigen
Brennmaterial besonders günstig ins Gewicht fällt, werden
in Westfalen, Belgien, England, Schottland verhüttet.
Spatel (Spachtel, franz. Amassette), ein kleiner Spaten;
ein messerklingenartiges, vorn abgestumpftes Werkzeug zum
Umrühren von Flüssigkeiten, zum Streichen von Pflastern,
zum Verkitten von Fugen etc.; auch Malerinstrument, womit die
Farben auf dem Mahlstein oder auf der Palette zusammengescharrt und
gemischt, auch bisweilen zur Erzielung einer pastosen Wirkung
direkt auf die Leinwand aufgetragen werden.
Spatenkultur, die Bearbeitung des Bodens mit dem Spaten,
der Grabgabel oder Haue, besonders gebräuchlich im Garten,
aber auch auf dem Acker (Feldgärtnerei), wo sie höhern
Ertrag gewährt als die Bearbeitung mit dem Pflug, aber auch
mehr Zeit und Kraft in Anspruch nimmt und daher nur da vorteilhaft
ist, wo der Bauer mit seiner Familie die Feldarbeit allein zu
bewältigen vermag, bei großer Ertragsfähigkeit des
Bodens oder bei hohem Preis der Bodenprodukte. In
größern Wirtschaften wird S. nur ausnahmsweise, z. B.
beim Möhrenbau, angewandt.
Spatenrecht (Spaderecht, Spatelandsrecht, Jus
ligonarium), s. Deich, S. 622.
Spätgang, der Gang des Wildes gegen Morgen über
den gefallenen Tau.
Spätgeburt, eine Geburt, resp. ein Kind, welches
nach dem Ablauf der gewöhnlichen Schwangerschaftsdauer, d. h.
nach 280 Tagen, vom Tag der Befruchtung an gerechnet, geboren wird.
Nach den vorliegenden Beobachtungen kann die S. bis vier Wochen
nach dem normalen Termin erfolgen, ist jedoch ziemlich selten. Die
S. gilt im Todesfall des Erzeugers unter Umständen nach
römischem Recht nicht als ehelich; doch ist diese Regel nur
eine Praesumtio juris und läßt Gegenbeweis zu, der durch
ärztliches Gutachten zu begründen sein wird.
Spatha (griech.), s. v. w. Blütenscheide, s.
Blütenstand, S. 79.
Spatha (lat.), eine Art Schwert (s. d.).
Spatium (lat.), Raum, Zwischenraum; auch s. v. w. Frist,
z. B. S. deliberandi, Bedenkzeit. In der Buchdruckerei heißen
Spatien die feinsten Ausschließungen (s. Buchdruckerkunst, S.
558); in der Musik der Raum zwischen den einzelnen Linien des
Notenliniensystems.
Spatula, s. Enten, S.671.
Spatz, s. Sperling.
Spavénta, Bertrando, ital. Philosoph, geb. 1817 in
einem Dorf der Provinz Chieti, widmete sich mit Eifer dem Studium
der deutschen Sprache und Philosophie, wurde 1859 zum Professor der
Philosophie an der Universität zu Modena, 1860 an der zu
Bologna ernannt und trat zuerst hervor mit der Schrift "La
filosofia di Kant e la sua relazione colla filosofia italiana"
(Turin 1860), in welcher er den Nachweis zu führen suchte,
daß Rosmini trotz seiner polemischen Stellung zu Kant doch im
Wesen seiner Spekulation und in deren Ergebnissen mit dem
Kritizismus des deutschen Philosophen zusammenhänge. Nachdem
er noch "Carattere e sviluppo della filosofia italiana" (Mod. 1860)
veröffentlicht, erhielt er 1861 eine Professur der Philosophie
zu Neapel, die er noch heute bekleidet. Sein energisches Eintreten
für die deutsche Philosophie und die Kritik, die er an den
philosophischen Systemen seiner eignen Nation übte, hatten ihm
namentlich in orthodoxen Kreisen zahlreiche Gegner erweckt. Er
antwortete diesen in einer Einleitung, die er seinen
öffentlichen Vorträgen in Neapel vorausschickte und die
er dann auch 1862 im Druck veröffentlichte. Bald danach
erschien sein Hauptwerk: "La filosofia di Gioberti" (Neap. 1863).
Hierauf folgten die kleinern Abhandlungen: "Le prime categorie
della logica di Hegel" (Neap. 1864); "Spazio e tempo nella prima
forma del sistema di Gioberti" (das. 1865); "Il concetto dell'
opposizione e lo Spinozismo" (das. 1867); "La scolastica e
Cartesio" (das. 1867); "Saggi di critica filosofia, politica e
religiosa" (Studien über Giordano Bruno, Campanella, Mamiani
etc., das. 1867). Spaventas eignes System ("Principj di filosofia",
Neap. 1867) steht im wesentlichen auf dem Standpunkt Hegels, dessen
entschiedenster Vorkämpfer in Italien er mit Augusto Vera bis
heute geblieben ist. Er veröffentlichte noch: "Paolottismo,
positivismo, razionalismo" (Bolog. 1868); "Studî sull' etica
di Hegel" (Neap. 1869); "Idealismo o realismo" (das. 1874); "La
legge del più forte" (das. 1874). Viermal wurde S. ins
italienische Parlament gewählt. Vgl. Siciliani, Gli Hegeliani
in Italia (Bolog. 1868). -
Sein Bruder Silvio, eine Zeitlang Minister der öffentlichen
Arbeiten des Königreichs Italien, beschäftigte sich
ebenfalls mit deutscher Philosophie.
Speaker (engl., spr. spih-), Sprecher, im englischen
Parlament Vorsitzender des Unterhauses.
Specht, Friedrich August Karl von,
Militärschriftsteller, geb. 23. Sept. 1802 zu Brandenburg,
trat nach sehr ungenügender Erziehung mit 14 Jahren in den
kurhessischen Militärdienst, wurde 1822 Leutnant, kam 1847 als
Hauptmann in den General-
111
Spechte - Spechter.
stab, machte 1849 den Feldzug gegen Dänemark mit und wurde
nach Beendigung desselben zum Oberstleutnant, 1854 zum Generalmajor
befördert. Infolge einer Duellaffaire mit dem General v.
Haynau 1863 wurde S. als Kommandant nach Fulda versetzt. 1866 zur
Disposition gestellt, lebte er bis 1872 in Marburg und Eisenach, wo
er 12. Juli 1879 starb. Er galt als Hauptvertreter der liberalen
Partei in Hessen, gehörte auch 1850 zu den verfassungstreuen
Offizieren und forderte damals seinen Abschied. Er schrieb: "Das
Königreich Westfalen und seine Armee im Jahr 1813 sowie die
Auflösung desselben durch den russischen General Czernicheff"
(Kass. 1848); "Geschichte der Waffen" (Berl. 1868-77, 3 Bde.; Bd. 4
u. 5 noch unvollendet); "Das Festland Asien-Europa und seine
Völkerstämme, deren Verbreitung, der Gang ihrer
Kulturentwickelung mit besonderer Berücksichtigung der
religiösen Ideen" (das. 1879).
Spechte (Picidae), Familie aus der Ordnung der
Klettervögel, gestreckt gebaute Vögel mit starkem,
geradem, meißelförmig zugeschärftem, auf dem
Rücken scharfkantigem Schnabel, welcher meist so lang oder
länger als der Kopf ist, dünner, langer, platter,
horniger, weit vorstreckbarer Zunge mit kurzen Widerhaken am Ende,
mittellangen, etwas abgerundeten Flügeln, unter deren
Schwingen die dritte und vierte am längsten sind,
keilförmigem Schwanz, dessen Steuerfedern steife, spitze
Schaftenden besitzen, kurzen, starken Füßen mit langen,
paarig gestellten Zehen und großen, starken, scharfen,
halbmondförmigen Nägeln. S. sind mit Ausnahme Neuhollands
über alle Erdteile verbreitet. Sie leben ungesellig in
Wäldern, Baumpflanzungen und Gärten, scharen sich nur
ausnahmsweise, besonders in der Strich- und Wanderzeit, zu starken
Gesellschaften, vereinigen sich aber bisweilen mit kleinen
Strichvögeln, denen sie zu Führern werden. Sie bewegen
sich fast nur kletternd, hüpfen auf dem Boden ungeschickt und
fliegen ungern weit. Sie suchen ihre Nahrung, die
hauptsächlich aus Kerbtieren besteht, hinter Baumrinde, welche
sie, an den Bäumen aufwärts kletternd, mit dem Schnabel
abmeißeln. Einige fressen auch Beeren und Sämereien und
legen selbst Vorratskammern an. Die Stimme ist ein kurzer,
wohllautender Ruf; mit dem Schnabel bringen sie außerdem ein
im Wald weithin schallendes Knarren hervor, vielleicht um Kerbtiere
aufzuscheuchen und hervorzulocken, vielleicht als Herausforderung
zu Kampf und Streit. Sie nisten stets in selbstgezimmerten, nur mit
einigen Spänen ausgekleideten Baumhöhlen und legen 3-8
weiße Eier, welche von beiden Geschlechtern ausgebrütet
werden. Die S. gehören durch Vertilgung schädlicher
Insekten, und indem sie in morschen Bäumen Höhlungen als
Niststätten für Höhlenbrüter erzeugen, zu den
nützlichsten Waldvögeln. Sie wählen zur Herstellung
des Brutraums regelmäßig nur Bäume mit morschem
Kern, fressen freilich Waldsämereien, Ameisen, auch wohl
Bienen und berauben bisweilen junge Stämmchen ringsum der
Rinde; doch kommt dies gegenüber dem großen Nutzen,
welchen sie gewähren, kaum oder nur unter besondern
Verhältnissen in Betracht.
Der Schwarzspecht (Luderspecht, Holz-, Hohlkrähe,
Tannenroller, Dryocopus martius Boie), 50 cm lang, 75 cm breit,
mattschwarz, am Oberkopf (Männchen) oder Hinterkopf (Weibchen)
rot, mit gelben Augen, hellgrauem Schnabel und grauen
Füßen, findet sich in Mittel- und Nordeuropa und in ganz
Asien südlich bis zum Himalaja in großen Waldungen,
weniger in gut geordneten Forsten, als Standvogel, ist bei uns
selten geworden und meidet die Nähe menschlicher Wohnungen. Er
ist sehr munter und gewandt, fliegt besser als die andern Arten,
nährt sich besonders von Roßameisen und ihren Puppen
sowie von allen Larven, die im Nadelholz leben, und meißelt,
um diese zu erlangen, oft große Stücke aus den
Bäumen und Stöcken heraus. Die Bruthöhle wird meist
in Buchen und Kiefern angelegt und ist etwa 40 cm tief bei 15 cm
Durchmesser; im April legt das Weibchen 3-5 porzellanweiße
Eier, s. Tafel "Eier I".
Der Buntspecht (Rot-, Schildspecht, Dendrocopus major Koch, s.
Tafel "Klettervögel"), 25 cm lang, 48 cm breit, ist oberseits
schwarz, unterseits gelbgrau, mit gelblichem Stirnband,
weißen Wangen, Halsstreifen, Schulterflecken und
Flügelbändern, schwarzen Streifen an der Halsseite, am
Hinterkopf und Unterbauch rot; die Augen sind braunrot, Schnabel
und Füße grau. Er findet sich in Europa und Nordasien,
besonders in Kiefernwäldern, erscheint im Herbst und Winter in
den Gärten und streift dann auch mit Meisen und andern
Vögeln umher; er nährt sich von allerlei Kerbtieren,
besonders von den unter der Rinde der Nadelhölzer lebenden
Käfern, von Nüssen und Beeren, namentlich auch von
Fichten- und Kiefernsamen, zu dessen Gewinnung er oft in einen Ast
ein Loch hackt, um den Zapfen darin festzuklemmen. Zur Anlegung
seiner Bruthöhle bevorzugt er weiche Holzarten, doch beginnt
er viele Höhlungen auszuarbeiten, bevor er eine einzige
vollendet. Er legt 4-6 weiße Eier. In der Gefangenschaft ist
er sehr unterhaltend und gewöhnt sich bald an ein
Ersatzfutter.
In den Laubwaldungen der Ebene gesellt sich zu ihm der etwas
kleinere Mittelspecht (Dendrocopus medius Koch), welcher fast
ausschließlich von Kerbtieren lebt, und ebendaselbst findet
sich auch der Kleinspecht (Grasspecht, Sperlingsspecht, Piculus
minor Koch) von nur 16 cm Länge, welcher wohl
ausschließlich Kerbtiere frißt und am liebsten in
Weiden brütet. In der Gefangenschaft ist auch er sehr
unterhaltend.
Der Grünspecht (Grasspecht, Picus viridis L.), 31 cm lang,
52 cm breit, ist auf der Oberseite hochgrün, auf der
Unterseite hell graugrün, im Gesicht schwarz mit rotem
(Männchen) Wangenfleck, am Oberkopf und Nacken rot, am
Bürzel gelb, Ohrgegend, Kinn und Kehle weißlich, die
Schwingen sind braunschwarz, gelblich oder bräunlichweiß
gefleckt, die Steuerfedern grüngrau, schwärzlich
gebändert; die Augen sind bläulichweiß, Schnabel
und Füße bleigrau. Er bewohnt Europa und Vorderasien,
bevorzugt Gegenden, in denen Baumpflanzungen mit freien Strecken
wechseln, schweift im Winter weit umher, erscheint auch oft in
Gärten, bewegt sich mehr und geschickter als die andern S. am
Boden, hämmert weniger an Bäumen als die andern S., sucht
viele Würmer und Larven auf dem Boden, bevorzugt die rote
Ameise, plündert Bienenstöcke, frißt auch zuweilen
Vogelbeeren. Er legt 6-8 weiße Eier (s. Abbildung auf Tafel
"Eier I", Fig. 3 u. 4). In der Gefangenschaft ist er
stürmisch, unbändig und schwer zu erhalten. Vgl.
Malherbe, Monographie des Picides (Par. 1859, 4 Bde.); Sundevall,
Conspectus avium Picinarum (Stockh. 1866); Altum, Unsre S. und ihre
forstliche Bedeutung (Berl. 1878); Homeyer, Die S. und ihr Wert in
forstlicher Beziehung (2. Aufl., Frankf. 1879).
Spechter, altdeutsches Trinkgefäß von hoher,
cylindrischer Form aus grünem Glas, mit und ohne Fuß.
Ursprünglich glatt und mit farbiger Emailmalerei verziert,
wurden die S. auch in eiserne Modelle geblasen, wodurch sie mit
parallelen oder spiralförmigen Streifen gerieft wurden oder
auch vier-
112
Spechthausen - Speckstein.
eckige, in Reihen angeordnete Erhöhungen erhielten (s.
Abbildung). Erst später wurden Buckel und Knöpfe
angeschmelzt.
[Spechter.]
Spechthausen, Fabrikort im preuß. Regierungsbezirk
Potsdam, Kreis Oberbarnim, südwestlich von Eberswalde, hat
eine Papierfabrik, in welcher der größte Teil der
deutschen Staatspapiere angefertigt wird, u. (1885) 275 Einw.
Spechtmeise, s. Kleiber.
Spechtwurzel, s. Dictamnus.
Special, Species (lat.), s. Spezial, Spezies.
Species facti (lat., Thatbericht), Erzählung des
Thatbestandes bei einem Rechtsfall, namentlich der bei einer
militärgerichtlichen Untersuchung von dem mit Strafgewalt
ausgestatteten Vorgesetzten des Angeschuldigten an den
Gerichtsherrn erstattete Bericht, welcher die dabei in Betracht
kommenden Thatumstände darlegt.
Specifica (lat.), s. Spezifische Arzneimittel.
Specimen (lat.), Probe, Probearbeit.
Speck (Lardum), das feste und derbe Fett, welches sich
zwischen der Haut und dem Fleisch mancher Tiere, namentlich der
Schweine (im geräucherten Zustand wichtiger Handelsartikel),
dann auch der Robben und Walfische (dient zur Darstellung von
Thran) ansetzt.
Speckbacher, einer der Anführer des Tiroler
Aufstandes von 1809, geb. 13. Juli 1767 auf dem Hof Gnadenwald,
zwischen Innsbruck und Hall, verbrachte seine Jugend teils als
Wildschütz, teils als Landwirt und kämpfte schon 1797,
1800 und 1805 gegen die Franzosen; vom Gut seiner Frau hieß
er der "Mann vom Rinn". Einer der Vertrauten des Sandwirts Hofer,
überfiel er 12. April 1809, am Tag des Ausbruchs der
Insurrektion, die bayrische Garnison zu Hall, nahm mit dem dortigen
Kronenwirt Joseph Straub die von Innsbruck entkommene bayrische
Kavallerie gefangen, focht hierauf in den Treffen vom 25. und 29.
Mai, welche Tirol zum zweitenmal befreiten, bei der Blockade von
Kufstein in den Treffen vom 4., 6. und 7. Aug., einen
zehnjährigen Sohn an der Seite, und in der Schlacht am Isel
13. Aug., nach welcher der Marschall Lefebvre Tirol räumen
mußte. Nachdem sich auch das Salzburger Gebirgsland erhoben,
errang S. im September bei Lofer und Luftenstein bedeutende
Vorteile, ward aber l6. Okt. bei Melleck geschlagen, wobei sein
Sohn in Gefangenschaft fiel. S. floh darauf von Alp zu Alp, verbarg
sich eine Zeitlang unter Schnee und Eis in einer Höhle und war
dann sieben Wochen lang in seinem eignen Stall verborgen, bis er
endlich im Mai 1810 über die Gebirge nach Wien gelangte. Hier
erhielt er die Pension eines Obersten und den Auftrag, die für
die Tiroler im Temesvárer Banat neugestiftete Kolonie
Königsgnad einzurichten, die aber bald bei der Ungunst der
Verhältnisse ein klägliches Ende nahm. Nach dem Ausbruch
des Kriegs von 1813 wagte er sich wieder nach Tirol und leistete
hier, obwohl es zu keiner entscheidenden Waffenthat kam, treffliche
Dienste. Dafür zum Major ernannt, starb er 28. März 1820
in Hall und ward 1858 in der Innsbrucker Hofkirche neben Hofer und
Haspinger beigesetzt. Vgl. Mayr, Der Mann vom Rinn und die
Kriegsereignisse in Tirol (Innsbr. 1851); Knauth, Jos. S., der
Jugend erzählt (Langensalza 1868).
Speckentartung, s. Amyloidentartung.
Speckkäfer (Dermestini Latr.), Käferfamilie aus
der Gruppe der Pentameren, kleine Käfer von länglich oder
kurz ovalem Körper mit kurzen, zurückziehbaren, gekeulten
Fühlern, gesenktem, mehr oder weniger einziehbarem Kopf, meist
einem einzelnen Stirnauge und kurzen, einziehbaren Beinen, leben
auf Blüten oder in morschen Bäumen, die meisten aber an
toten Tierstoffen, welche von den Larven benagt werden. Man trifft
sie daher besonders in naturhistorischen Sammlungen und Pelzlagern,
wo sie oft großen Schaden anrichten. Beim Angreifen stellen
sie sich durch Anziehen der Beine und Fühler tot. Die Larven
sind langgestreckt, cylindrisch oder breit gedrückt, an der
Oberfläche mit langen, aufgerichteten, nach hinten
gewöhnlich zu dichten Büscheln vereinigten Haaren
besetzt, mit kurzen Fühlern, meist sechs Nebenaugen und kurzen
Beinen, nähren sich von abgestorbenen tierischen Stoffen; bei
der Verpuppung platzt ihre Haut nur auf dem Rücken und bleibt
als Puppenhülse bestehen. Der S. (Dermestes lardarius L.), 7,6
mm lang, schwarz, auf den Flügeldecken mit breiter,
hellbrauner, schwarz gepunkteter Querbinde, überall in
Häusern, auf Taubenschlägen, in Sammlungen und im Freien
an Aas. Ebendaselbst findet sich seine unterseits weiße,
oberseits braune Larve. Der Pelzkäfer (Attagenus pellio L.),
4-5 mm lang, schwarz oder pechbraun, oberhalb schwarz behaart, mit
je einem weißhaarigen Punkt auf den Flügeldecken, findet
sich in Blüten des Weißdorns, der Doldenpflanzen etc.,
auch in Häusern, wo die Larve besonders Pelz- und
Polsterwaren, wollene Teppiche etc. zerstört. In Sammlungen
hausen am schlimmsten die Larven des Kabinettkäfers (Anthrenus
museorum L), 2,5 mm lang, dunkelbraun, mit drei undeutlichen,
graugelben Flügelbinden, und des A. varius Fab., gelb, mit
drei weißlichen Wellenbinden. Der Himbeerkäfer (Byturus
tomentosus L.), 4 mm lang, durch dicht anliegende Behaarung
gelbgrau, an Fühlern und Beinen rotgelb, legt seine Eier an
unreife Himbeeren, in welchen sich die dunkelgelbe, auf dem
Rücken braungelbe, am Hinterleibsende in zwei nach oben
gekrümmte, braunrote Dornspitzchen auslaufende Larve
(Himbeermade) entwickelt. Sie verpuppt sich in Holzritzen in einer
elliptischen Hülle, und die Puppe überwintert.
Speckkrankheit, s. v. w. Amyloidentartung.
Speckleber, s. Leberkrankheiten, S. 599.
Speckmaus, s. v. w. gemeine Ohrenfledermaus.
Speckmelde, s. Mercurialis.
Speckmilz, s. Milzkrankheiten.
Specköl, s. v. w. Schmalzöl, s. Schmalz.
Speckstein (Steatit, Schmeerstein), Mineral aus der
Ordnung der Silikate (Talkgruppe), bildet die
kryptokristallinischen Varietäten des Talks (s. d.). Was als
sogen. Specksteinkristalle beschrieben worden ist, sind
Afterkristalle nach Quarz, Dolomit, Spinell etc. Der S. findet sich
derb, eingesprengt, die nierenförmigen oder knolligen Massen
sind weiß mit rötlichen, grünlichen und gelblichen
Nüancen, matt, nur im Striche glänzend, an den Kanten
durchscheinend. Er fühlt sich fettig an, hängt aber nicht
an der Zunge. Die geringe Härte (1,5) des ungeglühten
Materials steigert sich nach dem Glühen bis zu der
Fähigkeit, Glas zu ritzen. Spez. Gew. 2,6-2,8. S. ist ein
Magnesiumsilikat H2Mg3Si4O12. Er bildet bei Göpfersgrün
unweit Wunsiedel im Fichtelgebirge ein Lager zwischen
Glimmerschiefer und Granit, welche Gesteine sich an der Grenze
gegen den S. in einer eigentümlichen halben Umwandlung zu S.
befinden, die theoretisch ebenso schwierig zu erklären ist wie
die
113
Speckter - Spee.
Entstehung der meisten der oben erwähnten Pseudomorphosen.
Außerdem findet sich S. bei Lowell in Massachusetts und bei
Briançon. S. ist schneidbar und wird auf der Drehbank zu
Pfeifenköpfen, säurefesten Stöpseln etc.
verarbeitet. Er dient auch zum Zeichnen auf Tuch, Seide und Glas
(spanische, Briançoner, venezianische, Schneiderkreide), zum
Entfetten von Zeugen, zur Darstellung von Schminke, als
Poliermaterial für Spiegel, als Einstreupulver in Stiefel und
Handschuhe, als Schmiermittel von Maschinenteilen, als Zusatz zur
Porzellanmasse und Seife, gebrannter S. zu Lavagasbrennern und zu
Wasserleitungsröhren. Abfall von der Verarbeitung wird zu
Gabbromasse benutzt. Chinesischer S., s. Agalmatolith.
Speckter, 1) Erwin, Maler, geb. 18. Juli 1806 zu Hamburg,
bildete sich in München unter Cornelius und widmete sich seit
1824 in Italien vorzugsweise der religiösen Malerei. Doch
malte er auch Landschaften mit Staffage und Architekturen und
hinterließ eine bedeutende Anzahl von Zeichnungen. Er starb
23. Nov. 1835. Aus seinem Nachlaß erschienen die "Briefe
eines deutschen Künstlers aus Italien" (Leipz. 1846, 2
Bde.).
2) Otto, Zeichner und Radierer, Bruder des vorigen, geb. 9. Nov.
1807 zu Hamburg, machte sich zuerst durch Lithographien (unter
andern den Einzug Christi von Overbeck) bekannt und widmete sich
dann der Illustration von Büchern durch Arabesken, Vignetten
und Figurenbilder. So illustrierte er: Luthers "Kleinen
Katechismus"; Böttigers "Pilgerfahrt der Blumengeister"; Kl.
Groths "Quickborn"; Eberhards "Hannchen und die Küchlein";
Reuters "Hanne Nüte"; den "Gestiefelten Kater" u. a. Die
größte Verbreitung fanden seine Bilder zu Heys "50
Fabeln für Kinder". Er starb 29. April 1871 in Hamburg.
Spectator (lat., auch engl., spr. specktéhter,
"Zuschauer"), Titel einer berühmten von Addison (s. d.)
herausgegebenen Wochenschrift.
Speculum (lat.), Spiegel; in der Chirurgie meist
röhrenförmiges, vorn oder seitlich offenes Instrument,
welches in Körperhöhlen eingeführt wird, um tiefere
Teile der Besichtigung und Behandlung zugänglich zu machen, z.
B. der Mutterspiegel, Ohren-, Kehlkopfspiegel etc.
Spedition (ital. Spedizione. franz. Expedition),
Beförderung von Waren, die nicht direkt an ihren
Bestimmungsort verladen werden; dann überhaupt die
Übernahme und Ausführung von Aufträgen zur Besorgung
der Versendung von Gütern; Speditionshandel, der
gewerbsmäßige Betrieb solcher Geschäfte. Ein
derartiger Gewerbebetrieb heißt Speditionsgeschäft; doch
wird der letztere Ausdruck auch für den einzelnen Vertrag
gebraucht, welchen jemand gewerbsmäßig abschließt,
um im eignen Namen für fremde Rechnung Güterversendung
durch Frachtführer (Eisenbahnen, Fuhrleute, Lastboten,
Flußschiffer, Fährenbesitzer etc.) oder Schiffer, d. h.
Seeschiffsführer, ausführen zu lassen. Wer
Speditionsgeschäfte gewerbsmäßig ausführt,
heißt Spediteur (franz. expéditeur, entrepreneur,
commissionnaire pour le transport). Derselbe haftet für jeden
Schaden, welcher aus der Vernachlässigung der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns bei der Empfangnahme und Aufbewahrung des
Gutes, bei der Wahl der Frachtführer, Schiffer oder
Zwischenspediteure und überhaupt bei der Ausführung der
von ihm übernommenen Versendung der Güter entsteht. Er
hat nötigen Falls die Anwendung dieser Sorgfalt zu beweisen.
Das französische Recht läßt ihn sogar unbedingt bis
an die Grenze der "höhern Gewalt" (s. d.) haften. Dagegen hat
er eine Provision (Speditionsprovision, Speditionsgebühren,
Spesen) sowie die Erstattung dessen zu fordern, was er an Auslagen
und Kosten oder überhaupt zum Zweck der Versendung als
notwendig oder nützlich aufgewendet hat. Wegen dieser
Forderungen sowie wegen der dem Versender auf das Gut geleisteten
Vorschusse hat er ein Pfandrecht an dem Gut, sofern er dasselbe
noch in seinem Gewahrsam hat oder in der Lage ist, darüber zu
verfügen. Geht das Speditionsgut durch die Hände mehrerer
Spediteure (Zwischenspediteure), um an den
auftragsmäßigen Bestimmungsort zu gelangen, so hat der
nachfolgende Spediteur das Pfandrecht nicht bloß für die
bei ihm erwachsenen, sondern auch für die bei dem
vorausgehenden Spediteur bereits entstandenen Kosten geltend zu
machen. Dem letzten Spediteur (Abrollspediteur) liegt daher die
Geltendmachung des Pfandrechts im Interesse aller Kosten ob, die
bei sämtlichen Spediteuren entstanden, welche mit dem
Speditionsgut befaßt worden sind. Der Spediteur kann
übrigens den Transport des Gutes auch selbst übernehmen,
selbst ausführen oder durch seine Angestellten ausführen
lassen, wofern ihm dies vertragsmäßig nicht
ausdrücklich untersagt ist. Das Speditionsgeschäft,
welches sonst mit dem Kommissionsgeschäft (s. d.) verwandt
ist, geht alsdann in das Frachtgeschäft über, und der
Spediteur kann neben den Speditionskosten auch die Fracht in Ansatz
bringen. Vgl. Deutsches Handelsgesetzbuch, Art. 379 bis 389; Code
de commerce, Art. 96-102.
Spee, Friedrich von, Dichter, aus dem adligen Geschlecht
der S. von Langenfeld, geb. 22. Febr. 1591 zu Kaiserswerth am
Rhein, wurde im Jesuitengymnasium zu Köln erzogen, trat 1610
selbst in den Jesuitenorden und lehrte dann mehrere Jahre hindurch
in Köln schöne Wissenschaften, Philosophie und
Moraltheologie. Im Auftrag seines Ordens ging er 1627 nach Franken,
wo er die Obliegenheit hatte, die zum Tod verurteilten
vermeintlichen Hexen und Zauberer auf dem letzten Gang zu
begleiten. Aus den tief erschütternden Erkenntnissen dieses
Berufs, die sein Haar ergrauen machten, erwuchs seine Schrift
"Cautio criminalis s. Liber de processu contra sagas" (Rinteln 1631
u. öfter, auch ins Holländische und Französische
übersetzt), worin er zuerst den Hexenwahn im katholischen
Deutschland mutvoll und nachdrücklich bekämpfte.
Später wurde S. nach Westfalen gesendet, um hier die
Gegenreformation durchzuführen. Sein Wirken war erfolgreich,
aber für ihn selbst unheilvoll: es wurde ein Mordanfall auf
ihn gemacht, der ihn elf Wochen in Hildesheim ans Krankenbett
fesselte. 1631 nach Köln zurückberufen, war er wieder als
Professor der Moraltheologie thätig und kam zuletzt nach
Trier, wo er an einem Fieber, das er sich im Lazarett bei der
Pflege der Kranken zugezogen, 7. Aug. 1635 starb. Seine erst nach
seinem Tod erschienene Sammlung geistlicher Lieder:
"Trutz-Nachtigall" (Köln 1649; neue Ausgabe von Brentano,
Berl. 1817; von Balke, Leipz. 1879; von Simrock, Heilbr. 1875)
gehört trotz mannigfaltiger Nachahmung der manieristischen
Italiener, die der Zeit eigentümlich war, nach Inhalt und Form
zu den besten Leistungen der deutschen Litteratur des 17. Jahrh.
und atmet die milde, schlichte Frömmigkeit und Innigkeit des
Dichters. Weniger bedeutend ist sein in Prosa geschriebenes, aber
mit schönen Liedern durchwebtes "Güldenes Tugendbuch"
(Köln 1647; neue Ausg., Freiburg 1887). Vgl. Diel, F. v. S.
(Freiburg 1872).
114
Speech - Speichern.
Speech (engl., spr. spihtsch), Sprache, Rede.
Speed (engl., spr. spihd'), Geschwindigkeit, z. B. eines
Eisenbahnzugs, eines Pferdes etc.
Speer, Urwaffe der Germanen, symbolisch das Zeichen der
Macht, aus welchem das Zepter hervorging. Der S. diente zum
Stoß, vorzugsweise zum Wurf (Wurfspeer) und bestand aus einer
Holzstange mit 30-40 cm langer, breiter, zweischneidiger
Eisenspitze. Um 600 n. Chr. wurde der S. Ger genannt und war auch
Waffe der Reiter. Die langobardischen Reiter waren berühmte
Gerwerfer; das 841 bei Fontenay veranstaltete Speerrennen war der
Ursprung der Hastiludien. Später entstanden aus dem S. der
Spieß und die Pike (s. d.).
Speer, Berg, s. Appenzeller Alpen.
Speerfeier (Speerfreitag), s. Lanzenfest.
Speerkies, s. Markasit.
Speerreiter, s. Lanciers.
Speetonclay (spr. spiht'n-kleh). s. Kreideformation, S.
183.
Speiche, Teil eines Rades, s. Rad; in der Anatomie einer
der Unterarmknochen, s. Arm.
Speichel (Saliva), das Sekret der Speicheldrüsen (s.
d.). Der S. reagiert alkalisch und enthält durchschnittlich
0,5 Proz. feste Bestandteile. Unter den letztern sind
hervorzuheben: Mucin, Eiweißstoffe und ein diastatisches
Ferment, das Ptyalin (Speichelstoff), welches Stärkemehl in
Zucker überführt. Er ist in den Speicheldrüsen oder
deren Ausführungsgängen nicht frei enthalten, sondern
entsteht erst aus einer von den Speicheldrüsen gelieferten
Muttersubstanz bei Zutritt der Luft. Die Speichelabsonderung
erfolgt nur, wenn die an die Speicheldrüsen tretenden Fasern
des sympathischen Nervs und des Angesichtsnervs direkt oder
reflektorisch gereizt werden. Je nach den Drüsen, welche den
S. liefern, unterscheidet man Parotidenspeichel,
Submaxillarspeichel und Sublingualspeichel. In der Mundhöhle
findet sich ein Gemisch dieser verschiedenen Speichelarten mit
Mundschleim vor; es wird als gemischter S. bezeichnet. Mit der
Speichelbildung gehen morphologische Veränderungen der
Drüsenzellen Hand in Hand; weiter ist mit ihr eine so
bedeutende Wärmebildung verknüpft, daß das mit
großer Heftigkeit der Drüse entströmende
venöse Blut nicht selten um 1-1,5°C. wärmer ist als
das Karotidenblut. Die in 24 Stunden abgesonderte Menge des
Speichels bei erwachsenen Menschen wird auf 1,5 kg geschätzt.
Eine zeitweise verstärkte Sekretion wird meist auf
reflektorischem Weg durch besondere Einflüsse hervorgerufen,
zunächst als Folge von Reizungen der Geschmacksnerven durch in
die Mundhöhle eingeführte Geschmacksstoffe, ferner als
Folge von Reizungen der Tastnerven der Mundhöhle, der
Geruchsnerven und Magennerven. Auch beim Kauen und Sprechen sowie
durch die dem Brechakt vorausgehenden heftigen Bewegungen der Mund-
und Schlundmuskeln wird die Speichelabsonderung vermehrt. Endlich
geschieht dies auch durch die Vorstellung von Speisen, besonders
bei Hungernden, sowie krankhafterweise durch gewisse Arzneimittel
etc. (s. Speichelfluß). Der S. löst die löslichen
Substanzen der Nahrungsmittel auf, mischt sich mit den trocknen
Speisen zu einem feuchten Brei und macht diese zum Abschlucken wie
für die Magenverdauung geeignet; endlich wirkt er durch seinen
Gehalt an Ptyalin verdauend auf die Kohlehydrate (s.
Verdauung).
Speichelbefördernde Mittel (Ptyalagoga, Salivantia),
Arzneimittel, welche eine vermehrte Speichelabsonderung bewirken.
Hierher gehören die Quecksilberpräparate, Gold, Jod,
Blei, Spießglanz, Kupfer, Arsenik, Chlormittel,
Königswasser und vor allem das Pilokarpin (s. Pilocarpus).
Speicheldrüsen (Glandulae salivales), die
drüsigen Organe zur Absonderung des Speichels (s. d.), also
sowohl Bauch- als Mundspeicheldrüsen, im engern Sinn
gewöhnlich nur die letztern. Diese liegen durchaus nicht immer
im oder am Mund, sondern bei niedern Tieren zuweilen weit nach
hinten in der Brust, ergießen jedoch ihre Absonderung stets
in den Mund oder wenigstens in den Anfang der Speiseröhre.
Manchmal sind sie zu mehreren Paaren vorhanden und haben dann auch
wohl zum Teil die Bestimmung als Giftdrüsen. Bei den
Vögeln und Säugetieren kann man, abgesehen von der
Bauchspeicheldrüse (s. d.), fast allgemein drei Gruppen von S.
unterscheiden: die Unterzungen-, Unterkiefer- und
Ohrspeicheldrüsen (s. d.). Doch fehlen sie den Walen
gänzlich, den Robben nahezu, sind dagegen bei Pflanzenfressern
am stärksten entwickelt. S. auch Tafel "Mundhöhle etc.",
Fig. 1.
Speicheldrüsenentzündung, s.
Ohrspeicheldrüsenentzündung.
Speichelfluß (Salivatio, Ptyalismus), krankhaft
vermehrte Absonderung des Speichels, kommt bei allen
Entzündungszuständen der Mundschleimhaut in mehr oder
minder hohem Grad vor, ferner bei Vorhandensein von
Geschwüren, namentlich Krebsen der Zunge und Wange, ganz
besonders aber nach übermäßiger Einführung von
Quecksilber in den Organismus. Am häufigsten werden solche
Menschen vom S. ergriffen, welche viel mit
Quecksilberpräparaten umzugehen haben und in einer mit
Quecksilberdämpfen geschwängerten Atmosphäre atmen
(z. B. die Bergleute in Quecksilberminen, die Arbeiter in
Spiegelfabriken). Auch die unvorsichtige und
übermäßige Anwendung von Quecksilberpräparaten
zu medizinischen Zwecken kann S. hervorrufen. S. wird ferner
erzeugt durch den Genuß einer Abkochung von
Jaborandiblättern oder des in denselben enthaltenen Alkaloids
Pilokarpin. S. wird herabgesetzt bei Entzündungs- und
Verschwärungszuständen durch fleißige
Ausspülung des Mundes mit desinfizierenden Wässern:
Lösung von chlorsaurem und übermangansaurem Kali u.
dgl.
Speichelstoff, s. Speichel.
Speichern (Spicheren), Pfarrdorf im deutschen Bezirk
Lothringen, Kreis Forbach, hat 880 Einw. Hier fand 6. Aug. 1870
eine Schlacht zwischen Deutschen und Franzosen statt. Nach dem
unbedeutenden Gefecht bei Saarbrücken 2. Aug. hatte das 2.
französische Korps (Frossard) auf den Höhen von S.,
südlich von Saarbrücken, ein Lager aufgeschlagen und die
natürliche Verteidigungsfähigkeit seiner Stellung noch
durch Schützengräben und Batterieeinschnitte
künstlich erhöht; namentlich der festungsartige Rote Berg
und das massive Dorf Stieringen-Wendel waren vortreffliche, kaum
angreifbare Stützpunkte der Stellung. Dennoch griffen die
Vortruppen der ersten und zweiten deutschen Armee, als sie 6. Aug.
die Saar überschritten, diese Stellung an, zuerst die Brigade
François von der 14. Division (Kameke), dann die 5., 13. und
16. Division; General v. François erstürmte den Roten
Berg mit dem 39. und 74. Regiment, fand dabei aber selbst den Tod.
Die brandenburgischen Regimenter der 5. Division eroberten die
waldigen Hänge rechts und links am Roten Berg, während
gleichzeitig Stieringen-Wendel den Franzosen entrissen wurde.
Hierauf trat Frossard, der vergeblich auf Hilfe, namentlich vom 3.
Korps (Bazaine), gewartet, den Rückzug nach Saargemünd
an.
115
Speidel - Speier.
Sein Verlust belief sich auf 320 Tote, 1660 Verwundete und 2100
Gefangene, zahlreiches Lagergerät und Armeevorräte. Die
Preußen verloren 850 Tote und 4000 Verwundete.
Speidel, Wilhelm, Klavierspieler und Komponist, geb. 3.
Sept. 1826 zu Ulm, erhielt seine Ausbildung am Münchener
Konservatorium, bereiste darauf als Virtuose alle
größern Städte Deutschlands, ward 1854
Musikdirektor in seiner Vaterstadt und drei Jahre später
Lehrer an dem von ihm mitbegründeten Konservatorium in
Stuttgart, in welcher Stellung er bis 1874 thätig war. Im
genannten Jahr begründete er ein eignes Musikinstitut, nahm
aber 1884 seine Thätigkeit am Konservatorium wieder auf.
Zugleich ist er seit 1857 Dirigent des Stuttgarter Liederkranzes.
Als Komponist hat sich S. durch zahlreiche Klavierwerke (Trios,
Sonaten, Charakterstücke), Lieder, Männer- und gemischte
Chöre sowie Orchestersachen vorteilhaft bekannt gemacht. -
Sein Bruder Ludwig, geb. 11. April 1830 zu Ulm, ist namhafter
Feuilletonist und Theaterkritiker an der "Neuen Freien Presse" in
Wien.
Speier (Speyer), ehemals reichsunmittelbares Bistum im
oberrheinischen Kreis, umfaßte 1542 qkm (28 QM.) mit 55,000
Einw. Der Bischof hatte ein Einkommen von 300,000 Gulden und im
Reichsfürstenrat auf der geistlichen Bank zwischen den
Bischöfen von Eichstätt und Straßburg seinen Sitz,
auf den oberrheinischen Kreistagen die zweite Stelle. Er war
Suffragan des Erzbistums Mainz. Der fränkische König
Dagobert I. soll zu Anfang des 7. Jahrh. das Bistum S. neu
errichtet haben, doch ist erst Bischof Principius zwischen 650 und
659 urkundlich beglaubigt. Durch den Revolutionskrieg kamen 661 qkm
(12 QM.) am linken Rheinufer an Frankreich, später an Bayern,
der Rest am rechten Ufer, mit der ehemaligen bischöflichen
Residenz Bruchsal, 1803 an Baden. Durch das Konkordat von 1817
wurde das Bistum wiederhergestellt und der Erzdiözese Bamberg
überwiesen; sein Sprengel erstreckt sich über die
bayrische Rheinpfalz. Vgl. Remling, Geschichte der Bischöfe zu
S. (Mainz 1852-54, 2 Bde. und 2 Bände "Urkundenbuch");
Derselbe, Neuere Geschichte der Bischöfe zu S. (Speier
1867).
Speier (Speyer), Hauptstadt des bayr. Regierungsbezirks
Pfalz und ehemalige freie Reichsstadt, an der Mündung des
Speierbachs in den Rhein, Knotenpunkt der Linien
Schifferstadt-Germersheim und S.-Heidelberg der Bayrischen
Staatsbahn, 105 m ü. M., hat breite, aber
unregelmäßige Hauptstraßen und trotz ihres hohen
Alters doch im allgemeinen nur wenige altertümliche
Gebäude. Das merkwürdigste unter denselben ist der Dom,
dessen Bau von Konrad II., dem Salier, 1030 begonnen und 1061 unter
Heinrich IV., der 1064 noch die Afrakapelle hinzufügte,
vollendet ward. Er ist im Rundbogenstil von roten Sandsteinquadern
aufgeführt, hat eine Länge von 147 m, eine Breite im
Querschiff von 60 m und 4 Türme. Das 12 Stufen über das
Schiff sich erhebende Königschor enthält die
Grabmäler von acht deutschen Kaisern (Konrad II., Heinrich
III., Heinrich IV. u. Heinrich V., Philipp von Schwaben, Rudolf von
Habsburg, Adolf von Nassau und Albrecht I.) und das der Bertha, der
Gemahlin Heinrichs IV., das der Beatrix, der zweiten Gemahlin
Friedrichs I., sowie ihrer Tochter Agnes. Das Innere schmücken
prachtvolle Fresken (32 große Kompositionen, 1845-54 von
Schraudolph ausgeführt). In der Vorhalle (Kaiserhalle) sind
seit 1858 die acht großen Standbilder der hier begrabenen
Kaiser aufgestellt (größtenteils von Fernkorn
ausgeführt). Die untere Kirche (Krypte) stützen massive
niedrige Säulen. In den Anlagen um den Dom sind der Domnapf,
welcher früher vor dem Dom stand und den bischöflichen
Immunitätsbezirk begrenzte, die Antikenhalle, ehemals eine
Sammlung römischer Altertümer bergend, der Ölberg
(eine mit eingemeißelten bildlichen Darstellungen der Leiden
Christi, Blätterwerk und anderm Zierat geschmückte
Steinmasse), das Heidentürmchen, dessen Unterbau
wahrscheinlich aus der Römerzeit stammt, die
Kolossalbüste des Professors Schwerd und die des frühern
Regierungspräsidenten v. Stengel hervorzuheben. Nachdem der
Dom schon 1159 und 1289 durch Feuersbrünste gelitten, wurde er
6. Mai 1540 von einem bedeutenden Brand heimgesucht, aber binnen 18
Monaten wiederhergestellt. Die ärgste Zerstörung
richteten indessen die Franzosen 31. Mai 1689 an: eine Feuersbrunst
zerstörte die drei westlichen Türme und das Gebäude
selbst bis auf die Umfassungsmauern, sogar die alten
Kaisergräber wurden aufgerissen und die Gebeine umhergestreut.
Erst in den Jahren 1772-84 ward der Dom wieder aufgebaut, aber
schon 1794 von den Franzosen abermals demoliert und in ein
Heumagazin verwandelt. Nachdem durch den König Maximilian I.
seine Herstellung erfolgt war, konnte er 19. Mai 1822 wieder
eingeweiht werden. Später wurden auch die westlichen
Türme mit dem Umbau und Neubau der Fassade wieder ersetzt und
der alte Kaiserdom wieder eingeweiht. Außer dem katholischen
Dom hat S. noch 2 evangelische und 2 kathol. Kirchen. Aus alter
Zeit stammen noch: das Altpörtel (Alta porta), bereits 1246
erwähnt, jetzt Stadtturm mit Uhr, und die Überreste eines
alten Judenbades sowie des Retschers, eines alten, wohl
bischöflichen Palastes, der 1689 mit der sogen. Neuen Kirche,
dem Gymnasium etc. zerstört wurde. Gegenwärtig wird der
Bau einer neuen Kirche (Retscher- oder Protestationskirche)
vorbereitet. Das alte Kaufhaus, ein prächtiger Bau und
früher das Haus der Münzer, ist im alten Stil
wiederhergestellt und um ein Stockwerk erhöht und enthält
jetzt das Oberpostamt. Die Einwohnerzahl betrug 1885 mit der
Garnison (3 Pionierkompanien Nr. 2) 16,064 (darunter ca. 8100
Katholiken, 7400 Evangelische und 532 Juden). Die Industrie
beschränkt sich auf Buntpapier-, Tabaks-, Zigarren-, Leim-,
Zucker-, Bleizucker- und Essigfabrikation, Bierbrauerei, Gerberei,
Ziegelsteinbrennerei, Wein- und Tabaksbau, Schiffahrt etc. Der
lebhafte Handel wird unterstützt durch eine
Reichsbanknebenstelle, eine Filiale der Bayrischen Notenbank und
andre Geldinstitute. S. ist Sitz einer Kreisregierung, eines
Bezirksamtes, Amtsgerichts, Oberpostamtes, Forstamtes, eines
Bischofs, eines evangelischen Konsistoriums etc., hat ein
Gymnasium, eine Realschule, ein Lehrerseminar, eine
Präparandenschule, ein bischöfliches Klerikal- und ein
Knabenseminar, ein Waisenhaus, eine Erziehungsanstalt für
verwahrloste Kinder, eine Diakonissenanstalt etc. Ferner befinden
sich dort ein städtisches Museum, eine Bildergalerie, eine
Bibliothek und ein botanischer Garten mit Baumschule. - S. ist das
römische Noviomagus, die Stadt der Nemeter, und hieß
seit dem 7. Jahrh. Spira. Um 30 v. Chr. wurde die Stadt
[Abb.: Wappen von Speier.]
116
Speierbach - Speiseröhre.
von den Römern erobert und befestigt. Von den Alemannen zu
Ende des 3. und Anfang des 4. Jahrh. mehrmals zerstört, wurde
sie von den Kaisern Konstantin und Julian wiederhergestellt, hatte
aber im 5. Jahrh. von den Einfällen der Vandalen und Hunnen
wieder viel zu leiden. Im 6. Jahrh. ging die Stadt an die Franken,
843 an das ostfränkische Reich über. Neben dem
bischöflichen Schultheißen, dem die niedere
Gerichtsbarkeit zustand, hatte hier bis 1146 ein königlicher
Burggraf seinen Sitz. Damals ging auch dies Amt auf den Bischof
über, bis es zu Anfang des 13. Jahrh. wieder von der Stadt
erworben wurde, was dann zu langwierigen Streitigkeiten mit dem
Bischof führte. Nachdem schon Heinrich V. eine Ratsverfassung
gegeben hatte, welche Philipp von Schwaben 1198 bestätigte,
schwang sich S. im 13. Jahrh. zur freien Reichsstadt empor, erwarb
jedoch kein Gebiet und zählte im 14. Jahrh. kaum 30,000 Einw.
Als Sitz des Reichskammergerichts, das 1513 nach S. kam und, nur
zeitweilig verlegt, bis 1689 hier seinen Sitz hatte, erhielt die
Stadt großen Ruf. Als Reichsstadt hatte sie unter den
Reichsstädten der rheinischen Bank den fünften Platz,
auch Sitz und Stimme auf den oberrheinischen Kreistagen. Unter den
Reichstagen, welche zu S. (meist in einem Gebäude des
Ratshofs) gehalten wurden, sind besonders die von 1526 (vgl.
Friedensburg, Der Reichstag zu S. 1526, Berl. 1887) und von 1529
wichtig, von denen der erste die Ausführung des Wormser Edikts
vertagte, der zweite die Einigung der Evangelischen zu einer
Protestationsschrift (daher "Protestanten") veranlaßte.
Städtetage haben 1346 und 1381 stattgefunden. Der Friede zu S.
1544 enthielt den Verzicht des Hauses Habsburg auf die Krone von
Dänemark-Norwegen. Im Dreißigjährigen Krieg wurde
die Stadt 1632-35 abwechselnd von den Schweden, den Kaiserlichen
und den Franzosen erobert. Durch Kapitulation wurde sie 1688
wiederum an die Franzosen übergeben, die sie aber 1689 (im
Mai) beim Anrücken der Alliierten wieder räumten, nachdem
sie die Festungswerke geschleift und die Stadt zum Teil
niedergebrannt hatten. Anfang Oktober 1792 wurde die Stadt von den
Franzosen unter Custine eingenommen und gebrandschatzt. Von 1801
bis 1814 war S. die Hauptstadt des franz. Depart. Donnersberg,
wurde aber 1815 bayrisch. Vgl. Geissel, Der Kaiserdom zu S. (Mainz
1826-28, 3 Bde.); Zeuß, Die freie Reichsstadt S. vor ihrer
Zerstörung (Speier 1843); Remling, Der Speierer Dom (Mainz
1861); Derselbe, Der Retscher in S. (das. 1858); Weiß,
Geschichte der Stadt S. (Speier 1877); Hilgard, Urkunden zur
Geschichte der Stadt S. (Straßb. 1885).
Speierbach, Flüßchen im bayr. Regierungsbezirk
Pfalz, entspringt auf dem Oselkopf unweit Kaiserslautern und
fällt bei Speier in den Rhein. Hier im spanischen
Erbfolgekrieg Sieg der Franzosen unter Tallard über das zum
Entsatz von Landau ausgesandte niederländische Hilfskorps
unter dem Grafen von Nassau-Weilburg und dem Erbprinzen von Hessen
(15. Nov. 1703). Die Redensart: "Revanche für S." wird auf
letztern zurückgeführt, der damit Tallard
begrüßt haben soll, als dieser später nach der
Schlacht bei Höchstädt gefangen vor ihn geführt
wurde.
Speierling, s. Sorbus.
Speigatten, Löcher in der Schiffswand, durch welche
das Wasser vom Deck nach der See abfließen kann; auch die
Öffnungen in den Verbandteilen eines Schiffs, durch welche das
Leckwasser nach den Pumpen geleitet wird.
Speik, blauer, s. Primula.
Speischlange, s. Brillenschlange.
Speise, ein auf Hüttenwerken bei Schmelzprozessen
entstehendes, aus Arsen- und Antimonmetallen bestehendes Produkt
von weißer Farbe und größerer Dichtigkeit als
diejenige der Leche (s. Lech), unter welchen sich die S. bei
gleichzeitiger Entstehung beider Produkte absetzt. Zur
Speisebildung, d.h. zur Verbindung mit Arsen und Antimon, sind
besonders Nickel, Kobalt und Eisen geneigt; doch finden sich in den
Speisen auch Gold, Silber und Kupfer. Dieselben werden entweder
absichtlich erzeugt (Nickel- und Kobaltspeisen), oder sie fallen
als Nebenprodukte (Kupfer- und Bleispeise), die man ungern sieht,
weil sich aus denselben die nutzbaren Metalle meist nur mit
größeren Verlusten darstellen lassen. Glockenspeise
nennt man die zur Glockengießerei angewendete Legierung (s.
Glocken). S. auch s. v. w. Mauerspeise, s. Mörtel.
Speiseapparate, s. Dampfkesselspeiseapparate.
Speisebrei, s. Chymus.
Speisegesetze, die vom mosaischen und talmudischen Gesetz
gegebenen, die Reinheit und durch diese die Heiligkeit der
Israeliten bezweckenden religiösen Vorschriften hinsichtlich
der Nahrungsmittel. Der Pentateuch gibt 3. Mos. 11 und 5. Mos. 14
als reine, zum Genuß erlaubte Tiere an: 1) von den
Vierfüßern die, welche gespaltene Klauen haben und
wiederkäuen, 2) von den Wassertieren nur die Fische, welche
Schuppen und Floßfedern haben, verbietet dagegen die
Raubvögel und Kriechtiere. Von Insekten ward die Heuschrecke
gegessen. Verboten war und ist ferner der Blutgenuß, der
Gebrauch des für den Altar bestimmten Opferfettes, die
Vermischung von Fleisch mit Milch oder Butter (gegründet auf
die Bibelstelle: "Du sollst das Lämmlein nicht in der Mutter
Milch kochen"), das Genießen eines Gliedes eines noch
lebenden Tiers. Die Schenkel der Vierfüßer dürfen
erst gebraucht werden, nachdem die Spannader daraus entfernt ist
(1. Mos. 32, 32). Säugetiere und Vögel müssen nach
besonderm Ritus (s. Schächten) geschlachtet, ihr Fleisch
muß vor dem Gebrauch zur Entfernung des Bluts entadert
(geporscht, getriebert), in Wasser gelegt und gesalzen (koscher
gemacht) werden. Von neugeerntetem Getreide durfte vor Ablauf des
Tags, an welchem ein Omer (Mäßchen) Gerste von derselben
Ernte im Tempel geweiht worden, nichts genossen werden. Verboten
war auch der Genuß von Trauben und andern Fruchtgattungen,
welche vermischt gepflanzt worden waren, von allen Früchten,
welche ein Baum in den ersten drei Jahren trug, von Wein, der den
Götzenbildern als Opfer dargebracht worden war, und vom
gesäuerten Brot während des Passahfestes. Alle diese S.
waren bei den Talmudisten Gegenstand einer sehr komplizierten
Kasuistik.
Speisepumpe, s. Dampfkesselspeiseapparate.
Speiseröhre (Schlund, Oesophagus), derjenige Teil
des Vorderdarms, welcher die Verbindung zwischen Mund und Magen
herstellt und die Speisen in letztern zu befördern hat. Bei
den Fischen ist sie sehr weit und geht allmählich in den Magen
über; ähnliches gilt von manchen Amphibien und Reptilien;
bei den Vögeln ist gewöhnlich ein Teil von ihr zur
Bildung eines Kropfes (s. d.) erweitert; dagegen findet bei
Säugetieren eine scharfe Trennung derselben vom Magen statt.
Beim Menschen (s. Tafel "Eingeweide II", Fig. 1 und 3, und
"Mundhöhle", Fig. 2) speziell ist sie ein häutiger, etwa
fingerdicker, aber stark ausdehnbarer Kanal, dessen Wände
platt aufeinander liegen, wenn nicht gerade ein Bissen durch ihn
hindurchgeht. Zwischen der Luftröhre und der
117
Speisesaft - Spektralanalyse.
Wirbelsäule tritt die S. in den Brustraum ein, läuft
neben der rechten Seite der absteigenden Brustaorta bis zum
Zwerchfell und gelangt durch einen Spalt des letztern in der
Höhe des neunten Brustwirbels in die Bauchhöhle, wos ie
sich zum Magen erweitert. Die S. besteht aus einer Schleimhaut und
einer umgebenden Muskelhaut. Krankheiten der S. sind selten, meist
mit Schlingbeschwerden und Schmerzen im Rücken verbunden.
Leichtere Entzündungen kommen vor als Fortsetzungen eines
Rachenkatarrhs oder entzündlicher Mundkrankheiten, z. B. der
Schwämmchen. Schwere Entzündungen der Schleimhaut treten
ein bei Vergiftungen mit ätzenden und scharfen Substanzen
(Ätzkali, Schwefelsäure etc.) und beim Genuß sehr
heißer Speisen. Die wichtigste Krankheit der S. ist der
Krebs, welcher in der S. stets primär unter der Form des
sogen. Kankroids auftritt und zwar am häufigsten am Eingang
vom Schlund zur S., am Eingang der S. zum Magen und zwischen diesen
beiden Orten an der Engigkeit im mittlern Dritteil, wo der linke
Bronchus die S. kreuzt (s. Tafel "Halskrankheiten", Fig. 4). Der
Krebs ist selten eine umfängliche Geschwulst, welche die S.
bis zum Verschluß verengert, meist ist er als fressendes
Geschwür vorhanden, welches zwar gleichfalls Verengerungen
bedingt, außerdem aber noch dadurch gefährlich wird,
daß die Wand der immerhin nicht sehr dicken Röhre
durchbrochen werden kann. Hierbei kommt es leicht vor, daß
eine freie Verbindung mit einem Brustfellsack hergestellt wird, so
daß die verschluckten Speisen in diesen gelangen und
tödliche Brustfellentzündung veranlassen; ferner sind
Fälle beobachtet worden, in denen die Luftröhre oder ein
Bronchus geschwürig zerstört und die Speisen direkt in
die Lungen geschluckt wurden, in noch andern bewirkte eine krebsige
Durchwachsung der Aorta plötzlichen Tod durch Blutsturz. Eine
Heilung des Krebses der S. kommt nicht vor. In den Fällen,
deren Hauptsymptom die Striktur (Verengerung) ist, muß, wie
bei Narbenschrumpfung nach Ätzung, die Behandlung in
vorsichtiger Erweiterung der Striktur durch Bougies und in
Ernährung durch die Schlundsonde bestehen. Fremde Körper
in der S. bilden nicht selten Gelegenheit zu operativem
Einschreiten. Man muß versuchen, diese mit geeigneten
Instrumenten, "Münzenfänger" etc., herauszuholen, oder
sie in den Magen hinabstoßen. Nur in verzweifelten
Fällen schreitet man zur Eröffnung der S. durch den
Speiseröhrenschnitt (griech. Ösophagotomie), indem man
von außen durch die Haut und Muskeln des Halses die
Speiseröhre eröffnet. Diese Operation ist schwierig und
nicht gefahrlos; sie wird auch ausgeführt, wenn nach
Schwefelsäure- oder Laugevergiftungen oder im Gefolge
krebsiger Zerstörungen solche Verengerungen der
Speiseröhre entstanden sind, daß nicht einmal
flüssige Nahrung in den Magen gelangt und der Tod durch
Verhungern droht.
Speisesaft, s. Chylus.
Speiseventil etc., s. Dampfkesselspeiseapparate.
Speisewalzen, an Maschinen die das Material
zuführenden Walzenpaare.
Speisewasser, das zur Versorgung eines Dampfkessels
dienende Wasser.
Speiskobalt (Smaltin, Smaltit), Mineral aus der Ordnung
der einfachen Sulfuride, kristallisiert regulär, findet sich
auch derb, eingesprengt und in mannigfaltig gruppierten Aggregaten,
ist zinnweiß bis grau, mitunter bunt angelaufen oder durch
beginnende Zersetzung zu Kobaltblüte an der Oberfläche
rot gefärbt. Härte 5,5, spez. Gew. 6,4-7,3, besteht aus
Kobaltarsen CoAs2 mit 28,2 Proz. Kobalt, enthält aber meist
auch Eisen, Nickel und Schwefel. In bestimmten Varietäten wird
der Gehalt an Nickel so bedeutend, daß dieselben eher dem
Chloanthit (s. d.) zuzuzählen sein würden, während
man die eisenreichen als graue Speiskobalte (Eisenkobaltkiese) von
den weißen als den wesentlich nur Kobalt führenden
trennt. Ein bis zu 4 Proz. Wismut enthaltendes Mineral wird als
Wismutkobaltkies unterschieden. S. kommt meist auf Gängen,
seltener auf Lagern der kristallinischen Schiefer und der
Kupferschieferformation vor und ist das wichtigste Erz zur
Blaufarbenbereitung, wobei Nickel und weißer Arsenik als
Nebenprodukte gewonnen werden. Hauptfundorte sind: Schneeberg,
Annaberg und andre Orte im sächsisch-böhmischen
Erzgebirge, Richelsdorf und Bieber in Hessen, Dobschau in Ungarn,
Allemont in Frankreich, Cornwall und Missouri.
Speiteufel, Pilz, s. Agaricus III.
Speke (spr. spihk), John Hanning, engl. Reisender, geb.
14. Mai 1827 zu Jordans bei Ilchester in Somerset, stellte sich die
Aufgabe, die Nilquellen aufzufinden, und unternahm 1854 mit Burton
die Bereisung des Somallandes, wobei er von den Eingebornen schwer
verwundet wurde. Im folgenden Jahr beteiligte er sich an dem
Krimkrieg; später (1857-59) treffen wir ihn mit Burton wieder
in Afrika, wo er Ende Juli 1858 den Ukerewe oder Victoria Nyanza
entdeckte. Mit J. A. Grant unternahm er 1860 von Sansibar aus eine
neue Reise, von der er 1863 wieder zu Gondokoro am obern Nil
eintraf, und die ihm die Überzeugung brachte, daß der
Weiße Nil den Ausfluß jenes Sees bilde. S. ist somit
als der Entdecker der Nilquellen anzusehen. Er starb 15. Sept. 1864
durch einen unglücklichen Schuß auf der Jagd bei Bath in
England. Die Resultate seiner Reisen sind niedergelegt im "Journal
of the discovery of the source of the Nile" (Lond. 1863, 2 Bde.;
deutsch, Leipz. 1864, 2 Bde.).
Spektabilität (v. lat. spectabilis, "ansehnlich"),
auf einigen Universitäten Titel der Dekane der philosophischen
Fakultät.
Spektakelstück (Ausstattungs- oder
Sonntagsstück), jedes mit Zügen, Tänzen, Gefechten
etc. ausgestattete Schauspiel, dessen Wirkung vorzüglich auf
die große Masse des Publikums berechnet ist.
Spektral (lat.), auf das Spektrum (s. d.)
bezüglich.
Spektralanalyse (hierzu Tafel "Spektralanalyse"),
Untersuchung des Spektrums des von einem Körper ausgesendeten
oder von ihm durchgelassenen Lichts in der Absicht, die stoffliche
Beschaffenheit des Körpers zu ergründen. Zur Beobachtung
des Spektrums dienen die verschiedenen Arten der Spektroskope. Im
Bunsenschen Spektroskop (Fig. 1, S. 118) steht ein Flintglasprisma
P, dessen brechender Winkel 60° beträgt, mit vertikaler
brechender Kante und in der Stellung der kleinsten Ablenkung auf
einem gußeisernen Stativ. Gegen das Prisma sind drei
horizontale Röhren A, B und C gerichtet. Die erste (A), das
Spaltrohr oder der Kollimator, trägt an ihrem dem Prisma
zugekehrten Ende eine Linse a (Fig. 2), in deren Brennpunkt sich
ein vertikaler Spalt l befindet, der vermittelst einer in Fig. 1
sichtbaren Schraube enger oder weiter gestellt werden kann; die von
einem Punkte des erleuchteten Spalts ausgehenden Lichtstrahlen
werden durch die Linse a, weil sie aus deren Brennpunkt kommen, mit
der Achse des Rohrs A parallel gemacht, treffen, nachdem sie durch
das Prisma abgelenkt worden, ebenfalls unter sich parallel auf die
Objektivlinse b des Fernrohrs B und werden durch diese in ihrer
Brennebene rv in dem Punkt r ver-
117a
Spektralanalyse
Spektren der Fixsterne und Nebelflecke, verglichen mit dem
Sonnenspektrum und den Spektren einiger Nichtmetalle.
Spektren der Alkali- und Erdalkali-Metalle. Nach Bunsen und
Kirchhoff.
118
Spektralanalyse (Apparatbeschreibung).
einigt. Sind die durch den Spalt einfallenden Strahlen homogen
rot, so entsteht bei r ein schmales rotes Bild des vertikalen
Spalts; gehen aber auch violette Strahlen von dem Spalt aus, so
werden diese durch das Prisma stärker abgelenkt und erzeugen
ein violettes Spaltbild bei v. Dringt weißes Licht, das sich
bekanntlich (s. Farbenzerstreuung) aus unzählig vielen
verschiedenfarbigen und verschieden brechbaren Strahlenarten
zusammensetzt, durch den Spalt ein, so legen sich die unzählig
vielen entsprechenden Spaltbilder in ununterbrochener Reihenfolge
nebeneinander und bilden in der Brennebene des Objektivs ein
vollständiges Spektrum r v, welches nun durch das Okular o wie
mit einer Lupe betrachtet wird. Im Spektrum des Sonnenlichts oder
Tageslichts (s. die Tafel) gewahrt man mit großer
Schärfe die Fraunhoferschen Linien (s. Farbenzerstreuung). Um
das Spektrum mit einer Skala vergleichen zu können, trägt
ein drittes Rohr C (das Skalenrohr) an seinem äußern
Ende bei s eine kleine photographierte Skala mit durchsichtigen
Teilstrichen, an seinem innern Ende dagegen eine Linse c, welche um
ihre Brennweite von der Skala entfernt ist. Durch eine Lampenflamme
wird die Skala erleuchtet. Die von einem Punkte der Skala
ausgehenden Strahlen, durch die Linse c parallel gemacht, werden an
der Oberfläche des Prismas auf die Objektivlinse o des
Fernrohrs reflektiert und von dieser in dem entsprechenden Punkt
ihrer Brennebene vereinigt. Durch das Okular schauend, erblickt man
daher gleichzeitig mit dem Spektrum ein scharfes Bild der Skala,
das sich an jenes wie ein Maßstab anlegt. Die Skala ist
willkürlich festgestellt. Eine von Willkür freie Skala
müßte nach den Wellenlängen der verschiedenfarbigen
Strahlen eingeteilt sein. Da aber die Wellenlängen für
die Fraunhoferschen Linien bekannt sind, so kann man für jedes
Spektroskop mit willkürlicher Skala leicht eine Tabelle oder
eine Zeichnung entwerfen, aus welcher für jeden Teilstrich die
zugehörige Wellenlänge abgelesen werden kann.
Die unmittelbare Vergleichung zweier Spektren verschiedener
Lichtquellen wird durch das Vergleichsprisma (Fig. 3)
ermöglicht, ein kleines gleichseitiges Prisma a b, welches,
indem es die untere Hälfte des Spalts m n verdeckt, in diese
kein Licht der vor dem Spalt aufgestellten Lichtquelle F (Fig. 1),
wohl aber durch totale Reflexion auf dem Weg L r t (Fig. 4) das
Licht der seitlich aufgestellten Lichtquelle L (f, Fig. 1)
eindringen läßt. Man erblickt alsdann im Gesichtsfeld
unmittelbar übereinander die Spektren beider Lichtquellen.
Läßt man Tageslicht auf das Vergleichsprisma fallen, so
können die Fraunhoferschen Linien seines Spektrums gleichsam
als Teilstriche einer Skala dienen. Wegen der Ablenkung, die das
Prisma hervorbringt, bilden Spaltrohr u. Fernrohr des Bunsenschen
Spektroskops einen dieser Ablenkung entsprechenden Winkel
miteinander, u. die Visierlinie des Instruments ist geknickt. Durch
passende Zusammensetzung von Flint- und Crownglasprismen kann man
aber sogen. geradsichtige Prismenkombinationen (à vision
directe) herstellen, durch welche die Ablenkung der Strahlen, nicht
aber die Farbenzerstreuung aufgehoben wird, und mit ihrer Hilfe
geradsichtige Spektroskope konstruieren, welche die Lichtquelle
direkt anzuvisieren erlauben. Ein solches ist das in Fig. 5 in
natürlicher Größe dargestellte Browningsche
Taschenspektroskop; s ist der Spalt, C die Kollimatorlinse, p der
aus 3 Flint- und 4 Crownglasprismen, die mittels Ka-
[Fig. 1.]
Fig. 1 u. 2. Bunsens Spektroskop.
119
Spektralanalyse (Ergebnisse und praktische Verwendung).
nadabalsams aneinander gekittet sind, zusammengesetzte
Prismenkörper und O die Öffnung fürs Auge.
Eine vollständigere Ausbreitung des Farbenbildes, als durch
ein solches einfaches Spektroskop möglich ist, wird erzielt
durch eine Reihe hintereinander gestellter Prismen. Schon Kirchhoff
bediente sich eines zusammengesetzten Spektroskops mit vier
Flintglasprismen. Littrow zeigte, daß man die Wirkung eines
jeden Prismas verdoppeln kann, indem man die Strahlen mittels
Spiegelung durch dieselbe Prismenreihe wieder zurücksendet;
dabei werden die Prismen unter sich u. mit dem Beobachtungsfernrohr
durch einen Mechanismus derart verbunden, daß sie sich, wenn
das Fernrohr auf irgend eine Stelle des Spektrums gerichtet wird,
von selbst (automatisch) auf die kleinste Ablenkung für die
betreffende Farbe einstellen. Vorteilhaft wendet man statt
einfacher Prismen Prismensätze an, welche bei
größerer Dispersion kleinere Ablenkung und geringern
Lichtverlust geben. Zur Beobachtung der Protuberanzen, der Flecke,
der Chromosphäre, der Korona etc. der Sonne hat man besondere
Spektroskope, welche statt des Okulars an das astronomische
Fernrohr angeschraubt werden, so daß das von dem Objektiv
desselben entworfene Sonnenbild auf die Spaltfläche des
Spektroskops fällt und der Spalt auf beliebige Teile dieses
Sonnenbildes eingestellt werden kann. Da das Bild eines Fixsterns
im Fernrohr nur als ein Lichtpunkt erscheint, so würde sein
Spektrum einen sehr schmalen Streifen bilden, in welchem, weil die
Ausdehnung in die Breite fehlt, dunkle Linien nicht wahrgenommen
werden könnten; dieselben werden jedoch wahrnehmbar bei
Anwendung einer geeigneten Cylinderlinse, welche das schmale
Spektrum in die Breite dehnt. Das Prisma der Spektroskope kann auch
durch ein Gitter (s. Beugung) ersetzt werden (Gitterspektroskope).
Das Taschenspektroskop von Ladd unterscheidet sich von dem
Browningschen bloß dadurch, daß es statt des
Prismensatzes ein photographiertes Gitter enthält.
Weißglühende feste Körper sowie die hell
leuchtenden Flammen der Kerzen, Lampen und des Leuchtgases, in
welchen feste Kohlenteilchen in weißglühendem Zustand
schweben, geben kontinuierliche Spektren, in welchen alle Farben
vom Rot bis zum Violett vertreten sind. Die Spektren glühender
Gase und Dämpfe dagegen bestehen aus einzelnen hellen Linien
auf dunklem oder schwach leuchtendem Grunde, deren Lage und
Gruppierung für die chemische Beschaffenheit des
gasförmigen Körpers charakteristisch ist. Bringt man z.
B. in die schwach leuchtende Flamme eines Bunsenschen Brenners eine
in das Öhr eines Platindrahts (Fig. 1) eingeschmolzene Probe
eines Natriumsalzes (etwa Soda oder Kochsalz), so färbt sich
die Flamme gelb, und im Spektroskop erblickt man eine schmale gelbe
Linie am Teilstrich 50 der Skala. Diese Linie ist für das
Natrium charakteristisch und verrät die geringsten Spuren
dieses Elements; noch der dreimillionste Teil eines Milligramms
Natriumsalz kann auf diesem Weg nachgewiesen werden. Von
ähnlicher Empfindlichkeit ist die Reaktion des Lithiums,
dessen Spektrum durch eine schwache orangegelbe und eine intensiv
rote Linie sich kennzeichnet. Kalisalze geben ein schwaches
kontinuierliches Spektrum mit einer Linie im äußersten
Rot und einer andern im Violett. Bunsen, welchem mit Kirchhoff das
Verdienst gebührt, die S. zu einer chemischen
Untersuchungsmethode ausgebildet zu haben, fand auf
spekralanalytischem Weg die bis dahin unbekannten Metalle Rubidium
und Cäsium auf, und andre Forscher entdeckten mittels
derselben Methode das Thallium, Indium und Gallium. Die Temperatur
der Bunsenschen Flamme, in welcher die Salze der Alkali- und
Erdalkalimetalle leicht verdampfen, reicht zur Verflüchtigung
andrer Körper, namentlich der meisten schweren Metalle, nicht
aus. In diesem Fall bedient man sich des Ruhmkorffschen
Funkeninduktors, dessen Funken man zwischen Elektroden, welche aus
dem zu untersuchenden Metall verfertigt oder mit einer Verbindung
desselben überzogen sind, überschlagen läßt.
Auch die Spektren der schweren Metalle sind durch
charakteristische, oft sehr zahlreiche helle Linien ausgezeichnet;
im Spektrum des Eisens z. B. zählt man deren mehr als 450. Um
Salze, die in Flüssigkeiten gelöst sind, im
Induktionsfunken zu glühendem Dampf zu verflüchtigen,
bringt man ein wenig von der Flüssigkeit auf den Boden eines
Glasröhrchens, in welchen ein von einer Glashülle
umgebener Platindraht eingeschmolzen ist, der mit seiner Spitze nur
wenig über die Oberfläche der Flüssigkeit
hervorragt; der Induktionsfunke, welcher zwischen diesem und einem
zweiten von oben in das Röhrchen eingeführten Platindraht
überschlägt, reißt alsdann geringe Mengen der
Lösung mit sich und bringt sie zum Verdampfen. Um ein Gas
glühend zu machen, läßt man die Entladung des
Induktionsapparats mittels der eingeschmolzenen Drähte a und b
durch eine sogen. Geißlersche Spektralröhre (Fig. 6)
gehen, welche das Gas in verdünntem Zustand enthält.
Befindet sich z. B. Wasserstoffgas in der Röhre, so leuchtet
ihr mittlerer enger Teil mit schön purpurrotem Lichte, dessen
Spektrum aus drei hellen Linien besteht, einer roten, welche mit
der Fraunhoferschen Linie C, einer grünblauen, die mit F, und
einer violetten, die nahezu mit G zusammenfällt. Viel
komplizierter ist das Spektrum des Stickstoffs, welches aus sehr
zahlreichen hellen Linien und Bändern besteht.
Eine wichtige technische Anwendung hat die S. bei der
Gußstahlbereitung durch den Bessemer-Prozeß gefunden.
Die aus der Mündung des birnförmigen Gefäßes,
in welchem dem geschmolzenen Gußeisen durch einen
hindurchgetriebenen Luftstrom ein Teil seines Kohlenstoffs entzogen
wird, hervorbrechende glänzende Flamme zeigt im Spektroskop
ein aus hellen farbigen Linien bestehendes Spektrum, welches im
Lauf des Prozesses sich ändert, und an dem gesteigerten Glanz
gewisser grüner Linien den Augenblick erkennen
läßt, in welchem die Oxydation des Kohlenstoffs den
gewünschten Grad erreicht hat und der Gebläsewind
abgestellt werden muß. Auch die dunkeln Absorptionsstreifen
auf hellem Grund,
120
Spektralanalyse (Bedeutung für die Astronomie etc.).
welche farbige Körper im Spektrum des durchgelassenen
Tages- oder Lampenlichts hervorbringen, sind für die chemische
Beschaffenheit dieser Körper charakteristisch und gestatten,
dieselben spektralanalytisch zu erkennen. Das Spektroskop kann
daher in vielen Fällen dazu dienen, die Echtheit oder
Verfälschung von Nahrungsmitteln, Droguen etc. nachzuweisen.
Das Mikrospektroskop, ein mit einem Prismensatz ausgerüstetes
Mikroskop, gestattet, diese Untersuchungsmethode auf die kleinsten
Mengen anzuwenden. Auch in die gerichtliche Medizin hat die S.
Eingang gefunden, weil sie die geringsten Mengen Blut nachzuweisen
vermag.
Die spektroskopische Untersuchung der Absorptionsspektren kann
sogar dazu dienen, die Menge der in einer Lösung enthaltenen
färbenden Substanz zu ermitteln (quantitative S.). Zu diesem
Zweck besteht der Spalt (nach Vierordt) aus einer obern und untern
Hälfte, deren jede unabhängig von der andern enger und
weiter gemacht werden kann. Tritt nun z. B. durch die obere
Hälfte des Spalts das ungeschwächte Licht, durch die
untere das durch die absorbierende Substanz gegangene Licht ein, so
erblickt man im Gesichtsfeld unmittelbar übereinander zwei
Spektren und bewirkt nun durch Verengerung der obern
Spalthälfte, daß irgend eine Farbe in beiden Spektren
die gleiche Helligkeit zeigt. Die Lichtstärken dieser Farben
in den beiden Strahlenbündeln verhalten sich dann umgekehrt
wie die durch Mikrometerschrauben zu messenden Spaltbreiten. Die
absorbierende Wirkung einer und derselben gelösten Substanz
steigt aber mit der Konzentration; man kann daher aus der durch ein
solches Spektrophotometer bewirkten Messung der Lichtstärken
unter Berücksichtigung des bekannten Absorptionsgesetzes auf
die Menge der Substanz schließen. Bei andern
Spektrophotometern (Glan) wird die Schwächung des einen
Strahlenbündels durch Polarisation bewirkt.
Schon Fraunhofer hatte beobachtet, daß die helle gelbe
Linie des Natriumlichts dieselbe Stelle im Spektrum einnimmt wie
die dunkle Linie D des Sonnenlichts. Kirchhoff zeigte nun,
daß ein gas- oder dampfförmiger Körper genau
diejenigen Strahlengattungen absorbiert, welche er im
glühenden Zustand selbst aussendet, während er alle
andern Strahlenarten ungeschwächt durchläßt. Bringt
man z. B. eine Spiritusflamme, deren Docht mit Kochsalz eingerieben
ist, zwischen das Auge und ein Taschenspektroskop und blickt durch
letzteres nach einer Lampenflamme, so sieht man das umgekehrte
Spektrum des Natriums, d. h. die Natriumlinie erscheint dunkel auf
hellem Grund, weil die Natriumflamme für Strahlen von der
Brechbarkeit derer, welche sie selbst aussendet, undurchsichtig,
für alle andern Strahlen aber durchsichtig ist. Bei genauer
Vergleichung der Fraunhoferschen dunkeln Linien mit den hellen
Linien irdischer Stoffe stellte sich nun heraus, daß eine
sehr große Anzahl jener mit diesen genau übereinstimmt;
so hat z. B. jede der mehr als 450 hellen Linien des Eisens ihr
dunkles Ebenbild im Sonnenspektrum. Es erscheint demnach Kirchhoffs
Schluß berechtigt, daß die Sonne ein glühender
Körper ist, dessen Oberfläche, die Photosphäre,
weißes Licht ausstrahlt, welches an und für sich ein
kontinuierliches Spektrum geben würde, und daß die
Photosphäre rings von einer aus glühenden Gasen und
Dämpfen bestehenden Hülle von niedrigerer Temperatur (der
Chromosphäre) umgeben ist, durch deren absorbierende Wirkung
die Fraunhoferschen Linien hervorgebracht werden. Die S. des
Sonnenlichts gibt uns demnach Aufschluß über die
chemische Zusammensetzung der Sonnenatmosphäre. Die
vergleichenden Untersuchungen über die Spektren der Sonne und
irdischer Stoffe sind in ausgedehnten sorgfältigen Zeichnungen
niedergelegt; diejenige Kirchhoffs stellt das prismatische Spektrum
dar und ist auf eine willkürliche Skala bezogen. Später
hat Angström unter Mitwirkung von Thalen ein 3,5 m langes Bild
des Gitterspektrums entworfen, in welches die Linien nach ihren
Wellenlängen eingetragen sind. Für die brechbaren Teile
des Spektrums vom Grün an und insbesondere auch für die
ultravioletten Strahlen erhält man das Spektralbild statt
durch mühsame Zeichnung leicht auf dem Weg der Photographie.
Besonders schön und ausgedehnt ist die von Rowland mit Hilfe
eines Reflexionsgitters hergestellte Photographie des Spektrums.
Den ultraroten Teil des Spektrums hat Becquerel unter Zuhilfenahme
von Phosphoreszenz gezeichnet, und Abney ist es gelungen, auch die
roten und ultraroten Strahlen zu photographieren. - Außer den
unzweifelhaft der Sonne angehörigen Spektrallinien gewahrt man
im Sonnenspektrum noch andre dunkle Linien, welche erst durch die
absorbierende Wirkung der Erdatmosphäre entstanden sind und
deshalb atmosphärische Linien heißen. Die
Fraunhoferschen Linien A und B erscheinen um so dunkler, je tiefer
die Sonne steht, und verraten dadurch ihren irdischen Ursprung;
nach Angström rühren sie wahrscheinlich von der
Kohlensäure unsrer Atmosphäre her. Andre dunkle Linien
und Bänder zwischen A und D, namentlich ein Band unmittelbar
vor D, sind dem Wasserdampf der Atmosphäre zuzuschreiben. Man
nennt sie Regenbänder, weil sie durch ihr Dunklerwerden
bevorstehende Niederschläge ankündigen. - Der Mond und
die Planeten, welche mit erborgtem Sonnenlicht leuchten,
müssen natürlich ebenfalls die Fraunhoferschen Linien
zeigen. Das Spektrum des Mondes stimmt mit demjenigen der Sonne
vollkommen überein, ein neuer Beweis dafür, daß der
Mond keine Atmosphäre hat. Venus, Mars, Jupiter und Saturn
dagegen lassen in ihren Spektren deutlich den Einfluß ihrer
Atmosphären erkennen, welche unzweifelhaft Wasserdampf
enthalten. Die Spektren der Fixsterne zeigen, ähnlich
demjenigen unsrer Sonne, dunkle Linien, welche jedoch unter sich
und von denen im Sonnenspektrum zum Teil verschieden sind. Im
Aldebaran z. B. vermochte Huggins Natrium, Magnesium, Calcium,
Eisen, Wismut, Tellur, Antimon, Quecksilber und Wasserstoff
nachzuweisen, wovon weder Wismut noch Tellur auf unsrer Sonne
vorkommen; Beteigeuze enthält dieselben Elemente wie
Aldebaran, mit Ausnahme von Quecksilber und Wasserstoff. Auch die
Farben der Sterne erklären sich aus der Beschaffenheit ihres
Spektrums. Von den beiden Sternen z. B., welche den Doppelstern
ß [beta] im Schwan bilden, erscheint der eine gelbrot, weil
dunkle Linien hauptsächlich im Blau und Rot seines Spektrums
auftreten, der andre blau, weil das Rot und Orange seines Spektrums
mit dicht gedrängten dunkeln Linien erfüllt ist.
Über die Einteilung der Fixsterne nach ihrem spektralen
Verhalten s. Fixsterne, S. 325. Als im Mai 1866 der bisher nur
teleskopisch sichtbare Stern T im Sternbild der Nördlichen
Krone fast plötzlich bis zur zweiten Größe
aufleuchtete, zeigte sein Spektrum auf kontinuierlichem, mit
dunkeln Linien durchzogenem Grund mehrere helle Linien, von denen
zwei (C und F) dem Wasserstoff angehörten, und welche nach
zwölf Tagen, nachdem der Stern von der zweiten bis zur achten
Größe herabgesunken war, wieder verschwunden waren. Das
Aufleuchten des Sterns erklärt sich demnach
121
Spektralapparate - Spekulation.
durch einen vorübergehenden Ausbruch glühenden
Wasserstoffs. Über die Spektren der Kometen und Nebelflecke s.
d.
Wenn eine Lichtquelle mit großer Geschwindigkeit, welche
mit derjenigen des Lichts vergleichbar ist, sich uns nähert
oder von uns entfernt, so müssen von jeder homogenen
Lichtsorte, welche sie aussendet, im ersten Fall mehr, im letzten
Fall weniger Schwingungen pro Sekunde auf das Auge oder das Prisma
treffen, als wenn die Lichtquelle stillstände. Da aber die
Farbe und die Brechbarkeit eines homogenen Lichtstrahls durch die
Anzahl seiner Schwingungen bedingt sind, so muß jene im
erstern Fall etwas erhöht, im letztern Fall etwas erniedrigt
sein, d. h. die Spektrallinie, welche dieser Strahlenart
entspricht, wird nach dem violetten Ende des Spektrums verschoben
erscheinen, wenn die Lichtquelle sich nähert, dagegen nachdem
roten Ende, wenn die Lichtquelle sich entfernt. Man nennt diesen
Satz, welcher für jede Wellenbewegung gilt und für
Schallschwingungen direkt nachgewiesen ist, das Dopplersche
Prinzip. Als Huggins die Linie F des Siriusspektrums mit der
gleichnamigen Wasserstofflinie einer Geißlerschen Röhre
verglich, konstatierte er eine meßbare Verschiebung der
erstern gegen die letztere nach dem roten Ende hin und berechnete
daraus, daß sich der Sirius mit einer Geschwindigkeit von 48
km pro Sekunde von der Erde entfernt. In dieser Weise können
mittels des Spektroskops Bewegungen wahrgenommen und gemessen
werden, welche in der Gesichtslinie selbst auf uns zu oder von uns
weg gerichtet sind, während ein Fernrohr nur solche Bewegungen
wahrzunehmen gestattet, welche senkrecht zur Gesichtslinie
erfolgen. So hat Lockyer aus den eigentümlichen Verschiebungen
und Verzerrungen, welche die dunkle Linie F des Sonnenspektrums und
die helle Linie F der Chromosphäre bisweilen zeigen, den
Schluß ziehen können, daß in der
Sonnenatmosphäre Wirbelstürme wüten, deren
Geschwindigkeit gewöhnlich 50-60, ja manchmal 190 km
beträgt, während die heftigsten Orkane unsrer
Erdatmosphäre höchstens eine Geschwindigkeit von 45 m in
der Sekunde erreichen. Vgl. Schellen, Die S. (3. Aufl., Braunschw.
1883); Roscoe, Die S. (deutsch von Schorlemmer, 2. Aufl., das.
1873); Zech, das Spektrum und die S. (Münch. l875); Vogel,
Praktische S. irdischer Stoffe (2.Aufl., Nördling. 1888);
Lockyer, Das Spektroskop (deutsch, Braunschw. 1874); Derselbe,
Studien zur S. (deutsch, Leipz. 1878); Vierordt, Quantitative S.
(Tübing. 1875); Klinkerfues, Die Prinzipien der S. und ihre
Anwendung in der Astronomie (Berl. 1878); Kayser, Lehrbuch der S.
(das. 1883).
Spektralapparate (lat.), optische Apparate zur Erzeugung
und Beobachtung des Spektrums: Spektrometer und Spektroskop.
Spektralfarben, die Farben des Spektrums (s. d.).
Spektrometer (lat.-griech.), Apparat zur genauen Messung
der Ablenkung der verschiedenen homogenen farbigen Strahlen eines
durch ein Prisma oder Gitter entworfenen Spektrums. Das
Meyersteinsche S. (s. Figur) ist ähnlich eingerichtet wie das
Bunsensche Spektroskop (s. Spektralanalyse), und die Wirkungsweise
der entsprechenden Teile ist die nämliche. Das Spaltrohr und
das Fernrohr sind nach der Mitte des Tischchens gerichtet, auf
welchem das Prisma (oder das Gitter etc.) aufgestellt wird. Zwei
geteilte Kreise, ein kleinerer und ein größerer, sind
unabhängig voneinander um ihre vertikalen Achsen drehbar; der
letztere dreht sich mit dem Fernrohr und gestattet, an den
feststehenden Nonien die jeweilige Ablenkung der am Fadenkreuz des
Fernrohrs erscheinenden Spektrallinie abzulesen, während der
erstere. das Prisma tragende durch eine Klemme festgehalten wird.
Läßt man dagegen den größern Kreis
feststehen, während man durch das ebenfalls feststehende
Fernrohr das an einer Prismenfläche gespiegelte Spaltbild
anvisiert, und dreht nun den kleinern Kreis samt dem von ihm
getragenen Prisma, bis das an der zweiten Prismenfläche
gespiegelte Spaltbild am Fadenkreuz erscheint, so erfährt man
aus der Drehung, welche man am Nonius des kleinern Kreises abliest,
den brechenden Winkel des Prismas; das S. spielt in diesem letztern
Fall die Rolle eines Reflexionsgoniometers (s. Goniometer). Das
Instrument liefert demnach bequem und sicher die beiden Daten, den
brechenden Winkel und die kleinste Ablenkung, welche zur Berechnung
der Brechungsverhältnisse (s. Brechung des Lichts)
erforderlich sind. Vgl. Meyerstein, Das S. (2. Aufl., Götting.
1870).
[Abb: Meyersteins Spektrometer.]
Spektrophon (lat.-griech.), s. Radiophonie.
Spektroskop (lat.-griech.), s. Spektralanalyse.
Spektrum (lat., "Gespenst"), das Farbenbild, in welches
zusammengesetztes Licht durch Dispersion mittels eines Prismas oder
durch Beugung ausgebreitet wird; s. Farbenzerstreuung,
Spektralanalyse.
Spekulation (lat.) hat in den verschiedenen
philosophischen Schulen eine verschiedene Bedeutung, indem man
darunter bald ein streng begriffmäßiges
(wissenschaftliches) Denken und Erkennen, bald ein von
vernünftigem Reflektieren absehendes visionäres Schauen
versteht. In letzterer Bedeutung nahmen die S. zuerst die
Neuplatoniker und neuerlich die Schulen des transcendentalen und
absoluten Idealismus auf. Die Hegelsche Schule versteht unter S.
dasjenige Denken, welches streng methodisch alle Gegensätze
und Widersprüche in den Begriffen in höhere Einheiten
aufzulösen sucht. Herbart stellt der spekulativen Philosophie
die Aufgabe, die in der Erfahrung enthaltenen Widersprüche
darzulegen und mittels logischer Bearbeitung der Begriffe zu
beseitigen. - Im gewöhnlichen Leben, insbesondere im Handel,
nennt man S. jede auf die Durchführung sol-
122
Spekulationsverein - Spencer.
cher Unternehmungen gerichtete Erwägung, bei welchen der
erwartete Gewinn durch Eintritt oder Ausbleiben von Ereignissen
bedingt ist, die von dem Willen des Unternehmers (Spekulanten)
selber unabhängig sind. Eine jede Unternehmung beruht mehr
oder weniger auf spekulativer Grundlage, und die S. ist als eine
Berücksichtigung zukünftiger Möglichkeiten an und
für sich eine unerläßliche Bedingung geordneter
Bedarfsdeckung und eines geregelten Wirtschaftslebens. Zu
unterscheiden von der soliden S. ist das Spekulationsmanöver,
welches unter Benutzung monopolistischer Stellung durch Aufkauf und
"Erwürgen" (Vorschreibung harter Bedingungen für
bedrängte Schuldner) oder auch durch betrügerische
Anpreisung, unzulässige Verteilung zu hoher Dividenden etc.
die Preise künstlich zu verändern sucht.
Spekulationspapiere sind solche Wertpapiere, welche starken
Kursschwankungen unterworfen und daher zur Gewinnerzielung aus Kauf
und Verkauf sehr geeignet sind. Über Spekulationskauf vgl.
Börse, S. 235.
Spekulationsverein (franz. Association en participation),
s. Gelegenheitsgesellschaft.
Spekulativ (lat.), auf Spekulation gerichtet,
bezüglich, begründet; spekulieren, sich mit Spekulationen
beschäftigen.
Spello, Stadt in der ital. Provinz Perugia, Kreis
Foligno, an der Eisenbahn Florenz-Foligno-Rom, mit 2 alten Kirchen
(mit Gemälden von Pinturicchio und Perugino), einem
Konviktkollegium und (1881) 2419 Einw.; das alte Hispellum, wovon
noch ansehnliche Reste vorhanden sind.
Spelt, s. Spelz.
Spelter, s. v. w. Zink.
Spelunke (lat.), Höhle; höhlenartige, dunkle,
versteckte Räumlichkeit.
Spelz (Spelt, Dinkel, Dinkelweizen, Triticum Spelta L.),
Pflanzenart aus der Gattung Weizen, mit vierseitiger, wenig
zusammengedrückter, lockerer Ähre, meist
vierblütigen Ährchen und breit eiförmigen,
abgeschnittenen, zweizähnigen Deckspelzen, gibt beim Dreschen
nicht Körner, sondern nur die von der Spindel abgesprungenen
Ährchen (Vesen). Der Dinkel, aus Mesopotamien und Persien
stammend, wurde schon von den alten Griechen kultiviert und ist die
Zea der Römer, wird auch seit alter Zeit in Schwaben und der
Schweiz als Brotfrucht gebaut (der Lech scheidet ziemlich scharf
das Roggen- vom Spelzland). Er ist dem Weizen in mancher Hinsicht
vorzuziehen, hat aber trotzdem wenig Verbreitung gefunden, weil die
Vesen besondere Mahleinrichtungen fordern und das Dinkelbrot schon
am dritten Tag Risse bekommt. Der S. enthält im Mittel 11,02
Proz. eiweißartige Körper, 2,77 Fett, 66,44
Stärkemehl und Dextrin, 5,47 Holzfaser, 2,21 Asche und 12,09
Proz. Wasser. Das Amelkorn (Gerstendinkel, Reisdinkel, Zweikorn,
Emmer, Ammer, Sommerspelz, T. amyleum Ser., T. dicoccum Schrk.),
mit zusammengedrückter, dichter Ähre, zweizeilig
stehenden, meist vierblütigen Ährchen mit zwei
Körnern und zwei Grannen und schief abgeschnittenen, an der
Spitze mit einem eingebogenen Zahn, auf dem Rücken mit
hervortretendem Kiel versehenen Deckspelzen, wird im Dinkelgebiet
und in Südeuropa seit alters her hauptsächlich als
Sommerfrucht gebaut und liefert vortreffliche Graupen und
vorzügliches Pferdefutter, aber rissiges Gebäck. Das
Einkorn (Peterskorn, Blicken, Pferdedinkel, in Thüringen
Dinkel, T. monococcum L.), mit zusammengedrückter Ähre,
meist dreiblütigen, reif nur einkörnigen, eingrannigen
Ährchen und an der Spitze mit einem geraden, zahnförmigen
Ende des Kiels und zwei seitlichen geraden Zähnen versehenen
Deckspelzen, wird im Gebirge auf magerm Boden gebaut, gibt dort nur
das dritte Korn und wird als treffliches Pferdefutter verwertet.
Einkorn ist das in der Bibel vorkommende Kussemeth, aus welchem
Syrer und Araber ihr Brot machten. Es hat wenig Verbreitung
gefunden.
Spelzblütige, s. Glumifloren.
Spelzen, die Deckblätter der Ährchen (s. d.),
besonders bei den Gräsern.
Spencemetall (Eisenthiat), ein von Spence angegebenes
zusammengeschmolzenes Gemisch von Schwefeleisen, Schwefelzink,
Schwefelblei mit Schwefel, ist metallähnlich, dunkelgrau, fast
schwarz, vom spez. Gew. 3,5-3,7; es ist sehr zäh, etwas
elastisch, die Zugfestigkeit beträgt 45 kg pro 1 qcm, es
leitet die Wärme schlecht und schmilzt bei 156-170°. Auf
der Bruchfläche ist es dem Gußeisen ähnlich, und
der Ausdehnungskoeffizient scheint sehr klein zu sein. Beim
Erstarren dehnt es sich wie Wismut und Letternmetall aus, liefert
sehr scharfe Abgüsse und eignet sich zur Verbindung von Gas-
und Wasserröhren. Im Vergleich mit andern metallischen
Substanzen widersteht das S. den Säuren und Alkalien sehr gut,
auch nimmt es hohe Politur an und verliert diese nicht unter dem
Einfluß der Witterung. Es läßt sich auch sehr gut
bearbeiten, und bei seinem niedrigen Preis und dem geringen
spezifischen Gewicht stellt sich die Benutzung ungemein billig. Da
es von Wasser nicht angegriffen wird, eignet es sich
vorzüglich zur Herstellung von Wasserzisternen, wegen des
schlechten Wärmeleitungsvermögens zur Bekleidung von
Wasserröhren, die es auch vor Rost schützt. In chemischen
Fabriken dürfte das S. vielfach als Surrogat des Bleies
verwendbar sein; auch eignet es sich als Verbindungsmittel für
Eisen mit Stein oder Holz, zum hermetischen Verschluß von
Flaschen und Büchsen, zum Einhüllen von Früchten und
Lebensmitteln, zu Zeugdruckwalzen, Zapfenlagern, Gußformen,
als Unterlage von Klischees etc. S. bildet auch ein gutes Material
für Kunstguß und Klischees, es gibt die feinsten Details
außerordentlich scharf wieder, und durch geeignete Behandlung
kann man den Gegenständen eine dunkelblaue Farbe oder eine
Gold- oder Silber- oder eine der grünen Bronzepatina
ähnliche Farbe geben. Die Gußformen können aus
Metall, Gips, selbst aus Gelatine bestehen, da das S. schnell genug
erstarrt, um einen scharfen Abguß zu liefern, bevor noch die
Form zerstört wird.
Spencer, 1) Georg John, Graf, engl. Bibliophile, geb. 1.
Sept. 1758 als Sohn des Lords S., der 1761 zum Viscount Althorp und
1765 zum Grafen S. erhoben wurde, machte seine Studien auf der
Universität zu Cambridge, bereiste dann Europa und wurde nach
seiner Rückkehr in das Parlament gewählt. Nach dem Tod
seines Vaters trat er 1783 in das Oberhaus ein, wurde 1794 zum
ersten Lord der Admiralität ernannt, zog sich dann 1801 mit
Pitt zurück, übernahm aber in Fox' und Grenvilles
Ministerium auf kurze Zeit von neuem das Staatssekretariat des
Innern und lebte seitdem in Zurückgezogenheit, bis er 10. Nov.
1834 starb. Durch Ankauf der Büchersammlung des Grafen von
Rewiczki 1789 hatte er den Grund zu einer Bibliothek gelegt, die er
in der Folge durch umfassende und kostspielige Neuerwerbungen zur
größten und glänzendsten Privatbüchersammlung
von ganz Europa erhob. Sie zählt über 45,000 Bände
und befindet sich zum größ-
123
Spencer-Churchill - Spener.
ten Teil auf dem Stammsitz der Familie zu Althorp in
Northamptonshire, der Rest in London. Über den Reichtum
derselben an ältesten Buchdruckereierzeugnissen und ersten
Klassikerausgaben vgl. Dibdin, Bibliotheca Spenceriana (Lond. 1814,
4 Bde.). Auch eine reichhaltige Gemäldesammlung hatte S.
angelegt, welche Dibdin in Bd. 1 seines Werkes "Aedes Althorpianae"
(Lond. 1822) beschreibt, während er in Bd. 2 als Nachtrag zu
der "Bibliotheca Spenceriana" eine Beschreibung der kostbarsten,
1815-1822 noch angeschafften alten Drucke gibt.
2) John Charles, Graf von, brit. Staatsmann, bekannter unter dem
Namen Lord Althorp, geb. 30. Mai 1782, trat nach Vollendung seiner
Studien zu Cambridge 1803 ins Unterhaus und war unter Fox und
Grenville Lord des Schatzes. Er stand auf seiten der Whigs. Im
Ministerium Grey (1830) wurde er Kanzler der Schatzkammer und galt
in allen finanziellen und staatswirtschaftlichen Fragen als
Autorität. Er legte auch 2. Febr. 1833 dem Unterhaus die
irische Kirchenreformbill vor, welche der Appropriationsklausel
wegen im Kabinett selbst eine Spaltung hervorrief. Als er 1834
durch den Tod seines Vaters Mitglied des Oberhauses ward,
mußte er sein Schatzkanzleramt niederlegen und widmete sich
fortan landwirtschaftlicher Beschäftigung. Später trat er
zu der Anticornlawleague. Er starb 1. Okt. 1845. Vgl. Le Marchant,
Memoirs of John Charles Viscount Althorp, third Earl of S. (Lond.
1876).
3) Frederick, vierter Graf von, Bruder des vorigen, geb. 14.
April 1798, trat in den Marinedienst, zeichnete sich in der
Schlacht von Navarino aus, erbte 1845 Titel und Güter seines
Bruders, war vom Juli 1846 bis September 1848 Lord-Oberkammerherr,
avancierte 1852 zum Konteradmiral und übernahm Anfang 1854 als
Nachfolger des Herzogs von Norfolk das Amt eines Lord-Steward; er
starb 27. Dez. 1857.
4) John Poynty, fünfter Graf von, brit. Staatsmann, Sohn
des vorigen, geb. 27. Okt. 1835, erzogen zu Harrow und Cambridge,
war bis zum Tod seines Vaters (27. Dez. 1857) für Northampton
Mitglied des Unterhauses, wo er sich der liberalen Partei
anschloß, und trat dann in das Oberhaus ein. Von 1859 bis
1861 war er Oberkammerherr (groom of the stole) des Prinzen Albert
und bekleidete dann von 1862 bis 1867 das gleiche Amt in der
Hofhaltung des Prinzen von Wales. Als im Dezember 1868 Gladstone
ein neues Ministerium bildete, wurde S. zum Vizekönig von
Irland ernannt, nahm aber im Februar 1874 beim Sturz der liberalen
Partei seine Entlassung. Im neuen Gladstoneschen Kabinett (1880-85)
erhielt er erst das Amt eines Präsidenten des Geheimen Rats,
dann 1882 das des Vizekönigs von Irland und übernahm 1886
auf kurze Zeit wieder das Präsidium des Geheimen Rats.
5) Herbert, engl. Philosoph, geb. 1820 zu Derby, wurde von
seinem Vater, einem Lehrer der Mathematik, und seinem Oheim Thomas
S., einem liberalen Geistlichen, erzogen, zuerst Zivilingenieur,
sodann Journalist und (von 1848 bis 1859) Mitarbeiter an dem von J.
Wilson herausgegebenen "Economist", an der "Westminster" und
"Edinburgh Review" und andern Zeitschriften, endlich
philosophischer Schriftsteller und Begründer eines eignen
Systems, das er als Evolutions- oder Entwickelungsphilosophie
bezeichnete. Seine erste bedeutende Schrift war eine Statistik der
Gesellschaft unter dem Titel: "Social statics" (1851, 1868) nebst
einem Auszug daraus: "State education self defeating" (1851),
welcher die "Principles of psychology" (1855) folgten; 1860 begann
er nach dem Vorbild von Comtes "Cours de philosophie positive" eine
zusammenhängende Folge von philosophischen Werken ("System of
synthetic philosophy"), in welchen "nach ihrer natürlichen
Ordnung" die Prinzipien der Biologie, Psychologie, Sociologie und
Moral entwickelt werden sollen. Die bisher erschienenen Bände
derselben umfassen: "First principles" (1862, 5. Aufl. 1884;
deutsch von Vetter, Stuttg. 1876-77), "Principles of biology"
(1865, 2 Bde.), eine Umarbeitung der "Principles of psychology"
(1870; 3. Aufl. 1881, 2 Bde.), "Principles of sociology" (1876-79,
2 Bde.; deutsch von Vetter, Stuttg. 1877 ff.), "Ceremonial
institutions" (1879), "Political institutions" (1882),
"Ecclesiastical institutions" (1885) und "The data of ethics"
(1879). Außerdem veröffentlichte S.: "Education:
intellectual, moral and physical" (1861, 16. Aufl.1885; deutsch von
Schultze, 3. Aufl., Jena 1889); "Essays, scientific, political and
speculative" (1858 bis 1863, 2 Bde.; 4. Aufl. 1885, 3 Bde.);
"Classification of the sciences" (1864, 3. Aufl. 1871); "Recent
discussions in science, philosophy and morals" (1871); "Study of
sociology" (1873, 14. Aufl. 1889; deutsch von Marquardsen, Leipz.
1875, 2 Bde.); "Descriptive sociology" (mit Callier, Scheppig und
Duncan, 1873 ff, 6 Bde.); "The rights of children and the true
principles of family government" (1879) u. a. Vgl. Fischer,
Über das Gesetz der Entwickelung auf physisch-ethischem Gebiet
mit Rücksicht auf Herbert S. (Würzb. l875); Guthrie, On
Spencer's unification of knowledge (Lond. 1882); Michelet, Spencers
System der Philosophie (Halle 1882).
Spencer-Churchill, s. Marlborough 3-6).
Spencer-Gewehr, s. Handfeuerwaffen, S. 107.
Spencergolf, großer, tief in das Land eindringender
Golf der Kolonie Südaustralien, zwischen der Eyria- und der
Yorkehalbinsel. Seine Küsten enthalten eine Reihe
mittelmäßiger Häfen, der bedeutendste an seiner
Nordspitze ist Port Augusta, nächstdem Port Pirie, Port
Broughton und Wallaroo. An seinem Südwestende bildet Port
Lincoln einen der vortrefflichsten Häfen der Welt, leider
bietet aber das Land in seiner Umgebung dem Ansiedler sehr
wenig.
Spendieren (ital.), freigebig sein, zum besten geben,
schenken; spendabel, freigebig.
Spener, Philipp Jakob, der Stifter des Pietismus, geb.
13. Jan. 1635 zu Rappoltsweiler im Oberelsaß, widmete sich zu
Straßburg theologischen Studien, war 1654-56 Informator
zweier Prinzen aus dem Haus Pfalz-Birkenfeld und besuchte seit 1659
noch die Universitäten Basel, Genf und Tübingen. Der
Aufenthalt in Genf war insofern für seine spätere
Entwickelung von Bedeutung, als er hier zu Labadie (s. d.) und
damit zum reformierten Pietismus in Beziehung trat. Aber sein
Interesse galt damals mehr der Heraldik; Früchte seiner darauf
bezüglichen Studien waren: "Historia insignium" (1680) und
"Insignium theoria" (1690), welche Werke in Deutschland die
wissenschaftliche Behandlung der Heraldik begründeten. 1663
ward S. Freiprediger zu Straßburg, 1664 daselbst Doktor der
Theologie, 1666 Senior der Geistlichkeit in Frankfurt a. M. In
dieser Stellung begann er, durchdrungen von dem Gefühl,
daß man in Gefahr stehe, das christliche Leben über dem
Buchstabenglauben zu verlieren, seit 1670 in seinem Haus mit
einzelnen aus der Gemeinde Versammlungen zum Zweck der Erbauung
(collegia pietatis) zu halten, welche 1682 in die Kirche verlegt
wurden. Seine reformatorischen Ansichten vom Kirchentum sprach er
aus in seinen "Pia desideria, oder herz-
124
Spengel - Spenser.
liches Verlangen nach gottgefälliger Besserung der wahren
evangelischen Kirche" (Frankf. 1675; neue Ausg., Leipz. 1846) und
in seiner "Allgemeinen Gottesgelahrtheit" (Frankf. 1680), wozu
später noch seine "Theologischen Bedenken" (Halle 1700-1702, 4
Bde.; in Auswahl das. 1838) kamen. Der große Streit über
den Pietismus (s. d.) war schon entbrannt, als S. 1686
Oberhofprediger in Dresden wurde. Bald ward er in denselben
persönlich verwickelt, als er gegenüber dem Hamburger
Prediger Mayer und dessen Genossen seine Freunde in Schutz nahm.
1695 entbrannte der Kampf zwischen S. und dem Pastor Schelwig in
Danzig, der jenem nicht weniger als 150 Häresien vorwarf.
Unterdessen aber war S. mit der theologischen Fakultät in
Leipzig und später auch mit dem Kurfürsten Johann Georg
III., dem er als Beichtvater in einem Briefe Vorstellungen wegen
seines Lebenswandels gemacht, zerfallen und hatte 1691 einen Ruf
als Propst und Inspektor der Kirche zu St. Nikolai und Assessor des
Konsistoriums nach Berlin angenommen, wo er seine Wirksamkeit unter
fortdauernden Angriffen seitens der orthodoxen Lutheraner
fortsetzte. Leider fehlte es ihm an Energie, um sich scharf gegen
die Ausschreitungen seiner Gesinnungsgenossen, insbesondere gegen
die Visionen und Offenbarungen des pietistischen Frauenkreises in
Halberstadt, auszusprechen. Während die 1694 gestiftete
Universität Halle ganz unter seinem Einfluß stand,
ließ die theologische Fakultät zu Wittenberg 1695 durch
den Professor Deutschmann 264 Abweichungen Speners von der
Kirchenlehre zusammenstellen, und letzterm gelang es nicht, durch
seine "Aufrichtige Übereinstimmung mit der Augsburger
Konfession" die Gegner zu beschwichtigen. Selbst nach seinem Tod
(5. Febr. 1705) wurde der Streit bis gegen die Mitte des
Jahrhunderts fortgeführt. Behauptete doch der Rostocker
Professor der Theologie, Fecht, daß man S. wegen seiner
"unmäßigen und unersättlichen Neuerungslust" nicht
als einen "Seligen" bezeichnen dürfe. Vgl. Hoßbach,
Phil. Jak. S. und seine Zeit (3. Aufl., Berl. 1861); Thilo, S. als
Katechet (das. 1840); Ritschl, Geschichte des Pietismus, Bd. 2
(Bonn 1881).
Spengel, Leonhard, Philolog, geb. 24. Sept. 1803 zu
München, gebildet daselbst, studierte, nachdem er die
Prüfung für das Lehramt am Gymnasium glänzend
bestanden, seit 1823 in Leipzig und Berlin, wurde 1826 Lektor, 1830
Professor an dem alten Gymnasium seiner Vaterstadt und war daneben
seit 1827 Privatdozent an der Universität und zweiter Vorstand
des philologischen Seminars. 1842 ging er als ordentlicher
Professor nach Heidelberg, kehrte 1847 als solcher nach
München zurück und starb dort hochgeehrt 9. Nov. 1880. Er
war seit 1835 Mitglied der bayrischen, seit 1842 auch der
preußischen Akademie der Wissenschaften. Seine litterarische
Thätigkeit erstreckte sich besonders auf die griechische
Rhetorik und Aristoteles. Von den Arbeiten der erstern Art nennen
wir: "????????
?????? s. artium scriptores ab initiis
usque ad editos Aristotelis de rhetorica libros" (Stuttg. 1828),
"Anaximenis ars rhetorica" (Zürich u. Winterthur 1844),
"Rhetores graeci" (Leipz. 1853-56, 3 Bde.); von denen der letztern:
"Aristotelische Studien" (Münch. 1864-68, 4 Tle.),
"Aristotelis Ars rhetorica" (Leipz. 1867, 2 Bde.) sowie "Alexandri
Aphrodisiensis quaestionum naturalium et moralium ad Aristotelis
philosophiam illustrandam libri IV" (Münch. 1842), "Incerti
auctoris paraphrasis Aristotelis elenchorum sophisticorum" (das.
1842), "????????
?????????
??????????
??? ???
'????????????
??????????
??????? ??
???
??????" (das. 1859),
"Themistii Paraphrases Aristotelis librorum" (Leipz. 1866, 2 Bde.),
"Eudemi Rhodii Peripatetici fragmenta quae supersunt" (Berl. 1866,
2. Ausg. 1870). In seinen vielseitigen Aufsätzen, die meist in
den "Abhandlungen der bayrischen Akademie" erschienen sind, hat er
sich auch um die herculaneischen Rollen sowie um die richtige
Beurteilung einzelner Autoren gegenüber einer
übertriebenen Lobpreisung große Verdienste erworben. Von
anderweitigen Ausgaben sind hervorzuheben: "M. Terentii Varronis de
lingua latina libri" (Berl. 1826; neu hrsg. von seinem Sohn Andreas
S., das. 1885); "C. Caecilii Statii deperditarum fabularum
fragmenta" (Münch. 1829). Vgl. Christ, Gedächtnisrede auf
Leonh. v. S. (Münch. 1881).
Spengler (Spängler), s. v. w. Klempner.
Spengler, Lazarus, geistlicher Liederdichter, geb. 1479
zu Nürnberg, ward nach beendeten Rechtsstudien 1507
Ratsschreiber daselbst, that viel für Durchführung des
Reformationswerks in seiner Vaterstadt und ward von derselben zum
Reichstag nach Worms sowie zu dem nach Augsburg gesandt; starb 7.
Sept. 1534. Von ihm sind die Lieder: "Durch Adams Fall ist ganz
verderbt" und "Vergebens ist all Müh' und Kost". Sein Leben
beschrieben Engelhardt (Bielef. 1855) und Pressel (Elbers.
1862).
Spennymoor (spr. -muhr), Stadt in der engl. Grafschaft
Durham, südlich von Durham, mit Kohlengruben, Eisenhütten
und (1881) 5917 Einw.
Spenser, Edmund, engl. Dichter, geb. 1553 zu London,
vielleicht aus vornehmer, sicher unbemittelter Familie, studierte
bis 1576 im Pembroke College zu Cambridge, lebte dann in einer der
herrlichen Grafschaften des Nordens und kam 1578 nach London, wo er
mit Sir Philip Sidney und durch diesen mit dem Grafen von Leicester
bekannt wurde. Er scheint sich um ein Hofamt beworben, auch, wie
eine Stelle in seinem "Mother Hubbard's tale" zeigt, die
Enttäuschungen des Hoflebens gekostet zu haben. 1580
begleitete er den Statthalter von Irland, Lord Grey, als
Sekretär nach Dublin. Sie blieben nur zwei Jahre, doch erhielt
S. 1586 in der Grafschaft Cork Landgebiet und lebte fortan, wenige
Besuche in London abgerechnet, ausschließlich dort auf
Kilcolman Castle, meist als Beamter der Regierung, zuletzt als
Clerk des Rats von Munster thätig. Mit den Verhältnissen
der Insel vertraut, schrieb er 1596 für die Regierung das
dialogische "A view of the present state of Ireland". Dem bald
darauf ausbrechenden Aufstand fiel er zum Opfer: sein Haus wurde
verbrannt, er selbst gezwungen, mit seiner Familie nach London zu
fliehen. Hier starb er 13. Jan. 1599 und ward in der
Westminsterabtei begraben, wo ihm die Gräfin Dorset 1620 ein
Denkmal setzte. Seinen Ruhm dankt S. zwei größern
Dichtungen. "The shepherd's calendar", Ph. Sidney gewidmet,
umfaßt zwölf Hirtengedichte, jedes einem Monat
entsprechend; die Schäfer klagen ihren Liebesschmerz,
erörtern religiöse Fragen, preisen die Königin. "The
Faery Queen" ist ein romantisch-allegorisches Epos nach dem Muster
Ariosts und Tassos. Die 3 ersten Bücher erschienen 1590 und
wurden der Königin gewidmet, welche die vielen Schmeicheleien
des Dichters mit einer jährlichen Pension von 50 Pfd. Sterl.
erwiderte. Die nächsten 3 Bücher wurden 1596
veröffentlicht. Es sollten noch 6 andre folgen, doch blieb zu
ihrer Abfassung dem Dichter weder Ruhe noch Zeit; nur Fragmente
sind erhalten. Jedes Buch beschreibt ein Abenteuer, das ein Ritter
am Hof der Feenkönigin besteht, und feiert gleichzeitig die
Thaten irrender Ritterschaft
125
Spenzer - Spergula.
und den Triumph einer Tugend. Aber die Allegorie geht noch
weiter: unter der Maske der Feen und Ritter verbirgt der Dichter
Personen seiner Zeit. Das Metrum ist die sogen. Spenserstanze (s.
Stanze), die Sprache schwungvoll, doch nicht frei von Archaismen.
Außer diesen Werken schrieb S. Elegien, Sonette und Hymnen.
Die beste Ausgabe seiner Werke lieferte Collier (Lond. 1861, 5
Bde.). Vgl. Craik, S. and his poetry (Lond. 1871, 3 Bde.); Dean
Church, E. S. (2. Aufl., das. 1887).
Spenzer (Spencer, Spenser), nach seinem Erfinder, Lord
Spencer (unter Georg III.), benanntes eng anschließendes
Ärmeljäckchen.
Speranskij, Michael, Graf, russ. Staatsmann und
Publizist, geb. 1. Jan. 1772 zu Tscherkutino im Gouvernement
Wladimir, besuchte die geistliche Akademie zu Petersburg, war
1792-97 an derselben Professor der Mathematik und Physik und ward
1801 vom Kaiser Alexander I. zum Staatssekretär beim Reichsrat
ernannt. In dieser Stellung verfaßte er die wichtigsten
Staatsschriften jener Periode, organisierte 1802 das Ministerium
des Innern, sodann auch den Reichsrat neu und trat 1808 an die
Spitze der Gesetzkommission, welche ihm einen festern
Geschäftsgang verdankt. 1808 ward er Kollege des
Justizministers und Staatsrat und 1809 zum Wirklichen Geheimen Rat
ernannt, 1812 aber auf Verdächtigungen hin zuerst nach Nishnij
Nowgorod, dann nach Perm in die Verbannung geschickt. Schon 1814
ward er aber in den Staatsdienst zurückberufen und erhielt das
Gouvernement der Provinz Pensa und 1819 das Generalgouvernement von
Sibirien. Hier wirkte er besonders segensreich für das
Schicksal der Verbannten und Angesiedelten, bis er im März
1821 zum Mitglied des Reichsrats ernannt wurde. Kaiser Nikolaus
beauftragte ihn mit der Sammlung des russischen Gesetzbuchs. Dies
veranlaßte ihn zu dem gediegenen "Précis de notions
historiques sur la réformation du corps de lois russes,
etc." (Petersb. 1833). Zuletzt in den Grafenstand erhoben, starb er
23. Febr. 1839 in Petersburg. Vgl. M. Korff, Leben des Grafen S.
(St. Petersb. 1861, 2 Bde.; russisch).
Seine Tochter Elisabeth von Bagrejew-S., geb. 17. Dez. 1799 zu
Petersburg, hat sich als Schriftstellerin bekannt gemacht. Sie
folgte 1812 ihrem Vater in die Verbannung nach Nishnij Nowgorod
sowie 1819 nach Sibirien und verheiratete sich dort mit Herrn v.
Bagrejew, mit dem sie nach Petersburg zurückkehrte. Zur
Ehrendame der Kaiserin Elisabeth ernannt, wurde sie der Mittelpunkt
eines auserlesenen Kreises von Gelehrten, Künstlern und
Staatsmännern, zog sich aber nach dem Tod ihres Vaters (1839)
auf ihre Güter in der Ukraine zurück. Der Tod ihres
einzigen Sohns veranlaßte sie zu einer Pilgerfahrt nach
Jerusalem, die sie in dem Werk "Les pelerins russes" (Brüssel
1854, 2 Bde.) beschrieb. Sie starb 4. April 1857 in Wien. Sie
schrieb noch: "Méditations chrétiennes"; "La vie de
château en Ukraine"; Briefe über Kiew, kleine
Erzählungen u. a. Vgl. Duret, Un portrait russe (Leipz.
1867).
Speránza (ital.), Hoffnung (als Zuruf
üblich).
Speratus, Paul, Beförderer der Reformation und
geistlicher Liederdichter, geb. 13. Dez. 1484, aus dem
schwäbischen Geschlecht der von Spretten, studierte zu Paris
und in Italien Theologie und wirkte für Verbreitung der
Reformation in Augsburg, Würzburg, Salzburg und seit 1521 in
Wien, von wo er sich, infolge einer Predigt über die
Mönchsgelübde nicht mehr vor dem Ketzergericht sicher,
zuerst nach Ofen, dann nach Iglau begab. Hier wie dort vertrieben,
kam er 1524 nach Wittenberg, wo er Luther in seiner Sammlung
deutscher geistlicher Lieder unterstützte. 1525 ward er
Hofprediger beim Herzog Albrecht von Preußen in
Königsberg und 1529 Bischof von Pomesanien, als welcher er
sich um die Organisation des evangelischen Kirchenwesens in
Preußen verdient machte. Er starb 17. Dez. 1551 in
Marienwerder. Von ihm stammt unter andern das Lied "Es ist das Heil
uns kommen her etc." Sein Leben beschrieben Cosack (Braunschw.
1861), Pressel (Elberf. 1862), Trautenberger ("S. und die
evangelische Kirche in Iglau", Brünn 1868).
Sperber (Nisus Cuv.), Gattung aus der Ordnung der
Raubvögel, der Familie der Falken (Falconidae) und der
Unterfamilie der Habichte (Accipitrinae), Vögel mit
gestrecktem Leib, kleinem Kopf, zierlichem, scharfhakigem,
undeutlich gezahntem Schnabel, bis zur Schwanzmitte reichenden
Flügeln, in denen die vierte und fünfte Schwinge die
längsten sind, langem, stumpf gerundetem Schwanz und hohen,
schwachen Läufen mit äußerst scharf bekrallten
Zehen. Beide Geschlechter sind gleich gefärbt. Der S.
(Finkenhabicht, Schwalben-, Sperlings-, Stockstößer,
Sprinz, Schmirn, N. communis Cuv., s. Tafel "Raubvögel"),
(Weibchen) 41 cm lang, 79 cm breit, oberseits schwärzlich
aschgrau, unterseits weiß mit rostroten Wellenlinien und
Strichen, fünf- bis sechsmal schwarz gebändertem und an
der Spitze weiß gesäumtem Schwanz, blauem Schnabel mit
gelber Wachshaut, goldgelbem Auge und blaßgelben
Füßen, findet sich in Europa und Mittelasien, streicht
im Winter umher und geht bis Nordafrika und Indien. Er bewohnt
besonders Feldgehölze, oft in der Nähe von Ortschaften,
kommt auch in die Städte, hält sich meist verborgen, geht
hüpfend und ungeschickt, fliegt aber schnell und gewandt; er
ist ungemein mutig und dreist und verfolgt alle kleinen Vögel,
welche ihn als ihren furchtbarsten Feind fliehen, wagt sich aber
auch an Tauben und Rebhühner. Er nistet in Dickichten nicht
sehr hoch über dem Boden, am liebsten auf Nadelhölzern
und legt im Mai oder Juni 3-5 weiße, graue oder
grünliche, rot und blau gefleckte Eier (s. Tafel "Eier I"),
welche das Weibchen allein ausbrütet. Der S. ist ein sehr
schädlicher Raubvogel und verdient keine Schonung. In der
Gefangenschaft wird er durch seine Scheu, Wildheit und
Gefräßigkeit abstoßend; im südlichen Ural, in
Persien und Indien aber ist er ein hochgeachteter Beizvogel.
Sperberfalke, s. v. w. Habicht.
Sperberkraut, s. Sanguisorba.
Sperbervogelbeere, s. Sorbus.
Spercheios, Fluß, s. Hellada.
Sperenberg, Dorf im preuß. Regierungsbezirk
Potsdam, Kreis Teltow, am Ursprung der Notte, 42 km südlich
von Berlin, durch eine Militäreisenbahn mit der Bahnlinie
Berlin-Dresden verbunden, hat eine evang. Kirche, bedeutende
Gipssteinbrüche, Gipsmühlen und (1885) 971 Einw. 1867
ward hier unter dem Gips ein Steinsalzlager in einer Tiefe von 89 m
erbohrt; die Bohrungen setzte man bis zu einer Tiefe von 1334 m
fort, ohne das untere Ende des Lagers zu erreichen.
Wärmemessungen, welche man im Bohrloch anstellte, ergaben bei
fast stetiger Zunahme in der Tiefe 51° C. Eine Ausbeutung des
Steinsalzlagers ist für die nächste Zeit nicht in
Aussicht gestellt. 4 km südlich von S., durch Eisenbahn
verbunden, ein großer Artillerieschießplatz.
Spergula L. (Spergel, Spörgel, Spark,
Knöterich), Gattung aus der Familie der Karyo-
26
Sperling - Sperlingsvögel.
phyllaceen, ein- oder zweijährige, zweigabelig oder
wirtelig ästige Kräuter mit scheinbar
quirlständigen, fädigen Blättern, endständigen,
ausgespreizten Doldentrauben und fünfklappiger Kapsel mit
runden, geflügelten Samen. Der gemeine Spergel (Ackerspergel,
Mariengras, S. arvensis L.), bisweilen 60-90 cm hoch, mit
unterseits längsfurchigen Blättern, weißen
Blüten und schwarzen, warzigen, schmal berandeten Samen,
wächst bei uns auf sandigen Feldern im Getreide, erreicht
zumal auf Leinfeldern eine bedeutende Größe und wird
besonders in dieser Varietät (S. maxima) am Niederrhein und im
Münsterland seit mehreren Jahrhunderten gebaut. Er gedeiht in
gutem Sandboden bei hinreichender Feuchtigkeit vortrefflich und
eignet sich auch auf geringem Boden noch zur Weide. Er nimmt den
Boden nicht in Anspruch, verbessert ihn vielmehr, bleibt als
Brachfrucht für Futter nicht über zwei Monate im Acker,
gibt vorzügliches Futter für Kühe, als Heu auch
für Schafe und wird von Pferden in jeder Beschaffenheit gern
gefressen. Das Spergelheu ist dem besten Wiesenheu gleich zu
achten, auch die Spergelsamen haben nicht unbedeutenden
Nährwert. Die Aussaat pro Hektar beträgt 19-20 kg, der
Ertrag 8-12 hl Samen oder 1500-2000 kg Kraut; ein Hektoliter wiegt
58-62 kg; die Keimfähigkeit der Samen dauert drei Jahre.
Sperling (Spatz, Passer L.. Pyrgita C.), Gattung aus der
Ordnung der Sperlingsvögel, der Familie der Finken
(Fringillidae) und der Unterfamilie der eigentlichen Finken
(Fringillinae), meist gedrungen gebaute, sehr einfach gefärbte
Vögel mit starkem, dickem, kolbigem Schnabel, welcher an
beiden Kinnladen etwas gewölbt ist, kurzen, stämmigen
Füßen mit schwachen Nägeln und mittellangen Zehen,
kurzen, stumpfen Flügeln, unter deren Schwingen die zweite bis
vierte die Spitze bilden, und kurzem oder mittellangem, am Ende
wenig oder nicht ausgeschnittenem Schwanz. Der Haussperling (P.
domesticus L.), 15-16 cm lang, 24-26 cm breit, ist auf dem Scheitel
graublau, auf dem Mantel braun mit schwarzen Längsstrichen,
auf den Flügeln mit gelblichweißer Querbinde, an den
Wangen grauweiß, an der Kehle schwarz, am Unterkörper
hellgrau. Das Auge ist braun, der Schnabel schwarz, im Winter
hellgrau, der Fuß gelbbräunlich. Beim Weibchen ist Kopf
und Kehle grau, und über dem Auge verläuft ein blaß
graugelber Streifen. Der S. bewohnt den ganzen Norden der Alten
Welt südlich bis Nordafrika und Südasien, ist in
Nordamerika, Australien, Neuseeland und auf Java akklimatisiert,
hält sich überall zu den Menschen und nistet auch stets
in unmittelbarer Nähe der Ortschaften, bez. in den
Häusern selbst, soweit ihm dadurch Gelegenheit zu sorgenloser
Ernährung geboten wird, und entfernt sich kaum jemals weit von
der Ortschaft, in welcher er geboren wurde. Er ist einer der
klügsten Vögel und durch den Verkehr in der Nähe des
Menschen nur noch listiger, verschlagener geworden. Seine
Bewegungen sind ziemlich plump, auch sein Flug weder geschickt noch
ausdauernd. Höchst gesellig, trennt er sich nur in der
Brutzeit in Paare, und oft steht ein Nest dicht neben dem andern.
Er brütet mindestens dreimal im Jahr, das erste Mal schon im
März, baut ein kunstloses Nest in Höhlungen in
Gebäuden, Baumlöchern, Starkasten, Schwalbennestern, im
Unterbau der Storchnester, im Gebüsch und auf Bäumen und
legt 5-8 bläulich- oder rötlichweiße, braun und
aschgrau gezeichnete Eier, welche Männchen und Weibchen 13 bis
14 Tage bebrüten. Die Jungen schlagen sich sofort nach dem
Ausfliegen mit andern in Trupps zusammen, welche bald zu
Flügen anwachsen, denen sich nach der Brütezeit auch die
Alten zugesellen. Der S. nährt sich vorzugsweise von
Sämereien, besonders Getreide, beißt die Knospen der
Obstbäume ab, benascht auch das Obst und kann bei massenhaftem
Auftreten in Kornfeldern, Getreidespeichern und Gärten und
auch dadurch recht schädlich werden, daß er Stare,
Meisen und andre nützliche Vögel verdrängt. Hier und
da, besonders in Italien, wird er gern gegessen. Der Feldsperling
(Holz-, Wald-, Rohr-, Bergsperling, P. montanus L.), etwas kleiner
als der vorige, am Oberkopf rotbraun, an der Kehle schwarz, auch
mit schwarzem Zügel und Wangenfleck, sonst am Kopf weiß,
auf der Unterseite hellgrau, auf den Flügeln mit zwei
weißen Querbinden, bewohnt Mittel- und Nordeuropa,
Mittelasien und Nordafrika, dringt bis über den Polarkreis
vor, ersetzt in Indien, China, Japan den Haussperling und ist in
Australien und auf Neuseeland akklimatisiert worden. Er bevorzugt
das freie Feld und den Wald und kommt nur im Winter auf die
Gehöfte. Er nistet zwei- bis dreimal im Jahr in
Baumlöchern, legt 5-7 Eier, welche denen des Haussperlings
ähnlich sind, und erzeugt mit dem letztern angeblich
fruchtbare Junge.
Sperlingskauz, s. Eulen, S. 906.
Sperlingsstößer, s. Sperber.
Sperlingsvögel (Passeres, hierzu Tafeln
"Sperlingsvögel I u. II"), die artenreichste Ordnung der
Vögel, Nesthocker von gewöhnlich kleinem Körper, mit
Schnabel ohne Wachshaut und mit Wandel-, Schreit- oder
Klammerfüßen. Sie leben meist in Gesträuch und auf
Bäumen, fliegen vortrefflich und bewegen sich auf dem Boden
hüpfend, seltener schreitend. Ihre Nester sind meist kunstvoll
gebaut; gebrütet wird ein- bis dreimal im Jahr und zwar von
beiden Geschlechtern. Viele S. sind an dem untern Kehlkopf der
Luftröhre (s. Vögel) mit einem besondern Singapparat
versehen, welcher aus zwei Paar Stimmbändern und einer Anzahl
zu ihrer Regulierung dienender Muskeln besteht und in verschiedenem
Maß ausgebildet ist. Man teilt nach diesem Charakter die S.
wohl in Singvögel (Oscines) und Schreivögel (Clamatores)
ein. Sehr verschieden ist der Schnabel geformt, bald breit, flach
und tief gespalten, bald kegelförmig, bald dünn und
pfriemenförmig etc. - Die Anzahl der lebenden Arten
beträgt gegen 5700, die in 870 Gattungen und 51 Familien
gestellt werden; fossile S. sind nur aus den jüngsten
Schichten (Diluvium) bekannt. Ganz oder nahezu kosmopolitisch sind
nur wenige Familien (Schwalben, Raben, Bachstelzen, Drosseln); in
Südamerika findet sich fast ein Drittel aller Arten vor. Die
Gruppierung der Familien ist bei den Autoren mehr oder weniger
willkürlich, da die natürlichen
Verwandtschaftsbeziehungen noch nicht bekannt sind; es genügt
daher hier eine Aufzählung der wichtigsten.
1) Drosseln (Turdidae), Körper kräftig, Kopf
groß, Hals kurz, Schnabel gerade, mit seichter Kerbe vor der
Spitze, Flügel mittellang. Etwa 25 Gattungen mit 230 Arten;
fehlen in Neuseeland. Man zerfällt sie in mehrere
Unterabteilungen: Wasserstare, Drosseln und Spottdrosseln.
2) Sänger (Sylviidae), Schnabel dünn,
pfriemenförmig, Flügel mittellang, Gefieder weich,
Außenzehe meist lang. Über 70 Gattungen mit etwa 650
Arten; fehlen in Amerika südlich von Brasilien. Von den 7
Unterfamilien sind bemerkenswert die Flüevögel,
Sänger (Laubsänger, Gartensänger, Goldhähnchen
und Grasmücke), Schilfsänger, Nachtigallen (Nachtigall,
Rotkehlchen, Blaukehlchen und Rotschwanz) und Steinschmätzer
(Steinschmätzer, Steindrossel und Wiesenschmätzer).
Letztere beiden Gruppen werden vielfach zu den Drosseln
gerechnet.
126a
Sperlingsvögel I.
126b
Sperlingsvögel II.
127
Sperma - Sperrgetriebe.
3) Zaunkönige oder Schlüpfer (Troglodytidae), Schnabel
schlank, pfriemenförmig, Flügel kurz, gerundet, Lauf
lang. Etwa 20 Gattungen mit über 90 Arten; hauptsächlich
in Amerika verbreitet.
4) Baumläufer (Certhiidae), Schnabel schlank und lang,
Hinterzehe lang und scharf bekrallt, Schwanz zuweilen mit
Stemmfedern, die beim Klettern an den Bäumen Verwendung
finden. 5 Gattungen mit 17 Arten; hauptsächlich in Europa und
Asien.
5) Spechtmeisen (Sittidae), ähnlich den vorigen, doch
Schwanz stets weich. 6 Gattungen mit über 30 Arten; fehlen in
Mittel- und Südamerika sowie im tropischen Afrika
(Kleiber).
6) Meisen (Paridae), Schnabel kurz, fast kegelförmig,
Flügel und Schwanz mittellang. 14 Gattungen mit über 90
Arten; zahlreich in der Alten Welt und in Nordamerika.
7) Pirole (Oriolidae), Schnabel lang, kegelförmig,
Flügel lang, Schwanz mittellang. 5 Gattungen mit 40 Arten; in
der Alten Welt.
8) Fliegenfänger (Muscicapidae), Schnabel kurz, hakig,
Flügel lang. Über 40 Gattungen mit gegen 280 Arten;
fehlen in Amerika gänzlich.
9) Würger (Laniidae), Körper kräftig, Schnabel
hakig, stark gezahnt, Schwanz meist lang. Räuberische
Vögel; etwa 20 Gattungen mit 150 Arten, fehlen nur in
Süd- und Mittelamerika sowie auf Neuseeland; am zahlreichsten
in Afrika.
10) Raben oder Krähen (Corvidae), Körper sehr
kräftig, Schnabel stark und groß, am Grund mit
Bartborsten, Flügel mittellang, Füße groß. 30
Gattungen mit etwa 200 Arten; fast kosmopolitisch (fehlen nur auf
Neuseeland). Von den 5 Unterfamilien sind bemerkenswert die
Häher und Raben (Tannenhäher, Elster und Rabe).
11) Paradiesvögel (Paradiseidae), Schnabel lang, schlank,
Flügel und Schwanz mittellang, jedoch einzelne Flügel-
oder Schwanzfedern oft enorm verlängert, Füße
kräftig, Zehen groß. Etwa 20 Gattungen mit über 30
Arten; nur in Australien und auf den benachbarten Inseln
(Paradiesvögel und Kragenvogel).
12) Honigsauger (Meliphagidae), Schnabel meist lang und spitz,
Flügel mittellang, Schwanz lang und breit, Füße
kurz, Zunge vorstreckbar, an der Spitze pinselförmig. Holen
aus den Blumen Insekten und Nektar hervor. Über 20 Gattungen
mit 140 Arten; nur in Australien und den benachbarten Inseln sowie
Polynesien.
13) Sonnenvögel (Nectariniidae), Schnabel lang, spitz,
Flügel kurz, Füße ziemlich lang, Zunge
vorstreckbar, röhrenförmig. Lebensweise wie bei der
vorigen Familie. 11 Gattungen mit über 120 Arten; in den
heißen Gegenden der Alten Welt.
14) Seidenschwänze (Ampelidae), Schnabel kurz, Flügel
ziemlich lang. 4 Gattungen mit 8 Arten; Europa, Nordasien, Nord-
und Mittelamerika.
15) Schwalben (Hirundinidae), Schnabel ziemlich kurz, mit sehr
weiter Spalte, Flügel lang, Schwanz gabelig, Zehen meist lang.
9 Gattungen mit über 90 Arten; kosmopolitisch, sogar im hohen
Norden.
16) Stärlinge oder Trupiale (Icteridae), Schnabel lang,
kegelförmig, Flügel spitz, Schwanz lang, abgerundet,
Füße stark, mit langer Hinterzehe, Gefieder meist
schwarz mit gelb oder orange. 24 Gattungen mit 110 Arten; nur in
Amerika (Trupial, Kuhvogel).
17) Tanagriden oder Tangaren (Tanagridae), Schnabel mit Zahn,
Flügel mittellang, Beine kurz, Hinterzehe lang. Fruchtfresser.
Über 40 Gattungen mit gegen 300 Arten; in ganz Süd- sowie
dem östlichen Teil von Nordamerika.
18) Finken (Fringillidae), Schnabel meist kegelförmig,
stets am Grund mit einem Wulst, Flügel und Schwanz mittellang,
Beine meist kurz. Über 80 Gattungen mit gegen 500 Arten, die
in eine Anzahl Unterfamilien verteilt werden; fehlen nur in
Australien, den benachbarten Inseln und Polynesien. Bemerkenswert
sind die Ammern, Kreuzschnäbel, Gimpel (Girlitz und
Kanarienvogel), Finken (Kernbeißer, Sperling, Fink, Leinfink,
Hänfling, Stieglitz, Zeisig und Grünfink) und
Papageifinken (Kardinal).
19) Webervögel oder Weberfinken (Ploceidae), Schnabel
stark, kegelförmig, Flügel meist mittellang, Schwanz
meist kurz, bauen vielfach beutelförmige Nester. Etwa 30
Gattungen mit 250 Arten; in den Tropen Asiens und Afrikas sowie in
Australien und Polynesien, aber nicht auf Neuseeland.
20) Stare (Sturnidae), Schnabel ziemlich, lang, stark,
Flügel lang, spitz, Schwanz meist lang, Beine kräftig,
Hinterzehe lang. Etwa 30 Gattungen mit 130 Arten; in der Alten
Welt, mit Ausnahme jedoch des australischen Festlandes (Star,
Madenhacker und Hirtenstar).
21) Lerchen (Alaudidae), Schnabel mittellang, gerade,
Flügel lang und breit, Schwanz kurz, Hinterzehe mit langer,
gerader Kralle. 15 Gattungen mit 110 Arten; fast nur in der Alten
Welt mit Ausnahme Australiens, besonders in Südafrika.
22) Bachstelzen (Motacillidae), Schnabel schlank, ziemlich lang,
Flügel und Schwanz lang. 9 Gattungen mit 80 Arten; mit
Ausnahme Polynesiens überall verbreitet.
23) Königswürger (Tyrannidae), Schnabel stark, lang
und breit, Flügel lang, spitz, Beine stark. Über 70
Gattungen mit gegen 330 Arten; nur in Amerika.
23) Schwätzer oder Schmuckvögel (Cotingidae), Schnabel
ziemlich groß, Spitze hakig, Flügel lang, spitz, Beine
kurz. Etwa 30 Gattungen mit über 90 Arten; in den Tropen
Amerikas, hauptsächlich in den Wäldern des
Amazonenstroms.
24) Leierschwänze (Menuridae), Schnabel mittellang,
Flügel kurz, Beine lang, Schwanz mit sehr langen Federn, von
denen die äußern leierartig geschwungen sind. Nur die
Gattung Menura mit 2 Arten; im südlichen und östlichen
Australien.
Sperma (griech.), Same; S. ceti, Walrat.
Spermatien, bei Rostpilzen, Kernpilzen und Flechten in
besondern Behältern, den Spermagonien, entstehende sehr
kleine, häufig stabförmige oder ovale Zellen, welche in
der Regel nicht keimfähig sind und bisweilen, z. B. bei den
Flechten, die Rolle männlicher Befruchtungselemente spielen.
Auch bei den Florideen unter den Algen kommen S. vor, sie entstehen
hier als kugelige oder birnförmige, unbewegliche Körper
in den Antheridien und haften bei der Befruchtung dem weiblichen
Organ an (vgl. Algen und Pilze).
Spermatitis (griech.), Samenstrangsentzündung.
Spermatophoren (griech., Samenpatronen), Portionen von
Samenfäden, in besonderer, oft sehr komplizierter
Umhüllung, welche bei manchen Tieren, wie
Kopffüßern, Grillen etc., vom Männchen gebildet
werden und bei der Begattung in die Weibchen gelangen, in deren
Geschlechtsorganen die Umhüllung platzt oder sich
auflöst, so daß die Samenfäden frei werden.
Spermatorrhöe (griech.), s. v. w.
Samenfluß.
Spermatozoiden (Spermatozoen, Antherozoiden, griech.,
Samentierchen, Samenfäden), die geformten Elemente des
männlichen Befruchtungsstoffs bei den Tieren; s. Same. - In
der Botanik bewegliche, in den männlichen Geschlechtsorganen
bei vielen Thallophyten, allen Muscineen und den
Gesäßkryptogamen entstehende Formelemente von
verschiedener Gestalt, welche aus besondern Mutterzellen austreten,
sich mittels Wimpern im Wasser frei bewegen und zuletzt in die
Eizelle der weiblichen Geschlechtsorgane eindringen, um dieselbe zu
befruchten (s. Algen, Moose und Gefäßkryptogamen).
Spermestes, Amadine; Spermestinae, s. v. w.
Prachtfinken.
Spermogonium (lat.), bei Rostpilzen, Kernpilzen und
Flechten Behälter, die in ihrer Höhlung an besondern
Fäden kleine, häufig stabförmige oder ovale Zellen,
die Spermatien (s. d.), abschnüren.
Spermöl, s. v. w. Walratöl.
Spermophilus, Zieselmaus.
Sperrfort, s. Festung, S. 186.
Sperrgesetz, Zollgesetz, welches dann erlassen wird, wenn
eine Zollerhöhung in Aussicht steht, zur Verhütung einer
größern Einfuhr von Waren, welche durch das
bevorstehende Gesetz mit einem Zoll oder mit einem höhern Zoll
belegt werden sollen; auch Bezeichnung für das sogen.
Brotkorbgesetz (s. d.).
Sperrgetriebe (Schaltwerk), ein Mechanismus zur
Hervorbringung einer ruck- oder absatzweise erfolgenden Bewegung
derart, daß zwischen zwei Bewegungsperioden eine
unbeabsichtigte Bewegung entweder nur nach einer bestimmten
Richtung oder
128
Sperrgut - Spessart.
[Fig. 1. Laufendes Sperrgetriebe.]
nach jeder Richtung hin ausgeschlossen ist (einseitige,
bez. vollständige Sperrung). S., bei welchen nur eine
einseitige Sperrung stattfindet, heißen laufende S., solche
mit vollständiger Sperrung dagegen ruhende S. Ein laufendes S.
in seiner einfachsten Form zeigt Fig. 1. Dasselbe besteht aus einem
Sperrrad S, in dessen Zähne die um einen festen Punkt drehbare
Sperrklinke K (Sperrhebel, Sperrkegel, Sperrzahn) unter der
Einwirkung einer Feder so eingreift, daß das Rad zwar in der
Pfeilrichtung herumgedreht werden kann (wobei die Sperrklinke
über die schrägen Flächen der Zähne
hinweggleitet), an einer Drehung nach der andern Seite jedoch durch
die einfallende und sich gegen die geraden Zahnflächen
stemmende Sperrklinke gehindert wird. Um die Achse des Rades S ist
noch ein Hebel drehbar, der mit einer Sperrklinke K1 versehen ist.
Wird der Hebel an seinem Griff H hin u. her bewegt, so gleitet bei
der dem Pfeil entgegengesetzten Bewegung die Klinke K1 über
die Zähne des nach derselben Richtung hin durch die Klinke K
gesperrten Rades S hinweg. Bei einer darauf folgenden Drehung des
Hebels H in der Richtung des Pfeils fällt jedoch seine Klinke
K1 in das Sperrrad ein u. nimmt dasselbe mit herum. Derartige
laufende S. haben eine außerordentlich große
Verbreitung, ganz besonders als Vorrichtungen zum Vorrücken
des Werkzeugs gegen das Arbeitsstück oder umgekehrt, ferner
bei Zählwerken, Hubzählern, Rechenstiften, als
Aufziehvorrichtung, bei Musikwerken, als Hebewerkzeug bei
Wagenwinden etc.
Als ein ruhendes S. zeigt sich das sogen. Einzahnrad (Fig. 2).
Hierbei ist S ein Sperrrad, welches zur Sperrung mit
kreisförmigen Ausschnitten k versehen ist, während
zwischen je zwei derselben eine Zahnlücke l zur Fortbewegung
angebracht ist. In die Ausschnitte k legt sich eine genau
hineinpassende Scheibe E, die im allgemeinen am Rand glatt
bearbeitet ist und nur an einer Stelle einen Zahn mit zwei
benachbarten Lücken hat (daher der Name Einzahnrad). Das
Sperrrad wird so lange an jeder Bewegung nach rechts oder links
verhindert werden, als sich der kreisförmige Teil von E in
einem der Ausschnitte k befindet. Sobald man jedoch die Scheibe E
so dreht, daß der Zahn z mit der benachbarten (linken oder
rechten) Lücke des Rades S in Eingriff kommt, so bewegt sich S
nach rechts oder links um einen Ausschnitt herum, wird jedoch im
nächsten Augenblick durch die in den Ausschnitt eintretende
Peripherie von E wieder festgehalten. Dieses Einzahnrad findet
unter anderm Verwendung an den Federgehäusen der Federuhren
als Schutzvorrichtung gegen das übermäßige
Aufziehen, wobei zwischen zwei der Lücken l die Radperipherie
voll kreisförmig stehen gelassen ist, so daß das Rad
nach rechts und links immer nur bis zu dieser Stelle gedreht werden
kann. In etwas abgeänderter Form erscheint das Einzahnrad als
sogen. Johanniterkreuz. Hierbei wird der Zahn z durch einen zur
Ebene des Rades E senkrecht stehenden Stift ersetzt, welcher in
entsprechende Schlitze des Rades S greift.
[Fig. 2. Ruhendes Sperrgetriebe.]
Sind vier solche Schlitze vorhanden, so erhält Rad S das
Aussehen eines Johanniterkreuzes. Statt des einen Zahns z
können auch mehrere nebeneinander liegende Zähne
angebracht sein, für welche dann im Rad S eine entsprechende
Anzahl nebeneinander liegender Lücken l vorhanden sein
muß. Auf dem Prinzip des Einzahnrades beruhen die sogen.
französischen Schlösser, nur wird hier zur Sperrung nicht
die ungezahnte Peripherie von E, sondern ein besonderer Sperrzahn
(die sogen. Zuhaltung) benutzt, welcher jedesmal von dem den Zahn z
ersetzenden Schlüssel erst ausgehoben sein muß, bevor
die Bewegung von S (welches bei Schlössern in der Regel durch
einen geradlinig geführten Riegel ersetzt ist) erfolgen
kann.
Sperrgut, s. Maßgüter und Gut, S. 946.
Sperrsystem, das staatswirtschaftliche System, welches
durch Verbote, hohe Zölle etc. das Inland gegen fremde
Länder absperrt.
Sperrventil, in der Orgel eine Klappe im Hauptkanal,
welche den Zugang des Windes zum Windkasten völlig absperrt
und durch einen besondern Registergriff regiert wird.
Sperrvögel (Hiantes Brehm), Ordnung der Vögel:
Schwalben, Segler, Nachtschwalben, Schwalme.
Sperrzeug, s. Jagdzeug.
Spervogel, Dichter des 12. Jahrh., wahrscheinlich
bürgerlichen Standes und aus Oberdeutschland gebürtig.
Die Handschriften unterscheiden einen ältern und einen
jüngern S., ohne jedoch ihre Gedichte zu trennen. Letztere
bestehen in Liedern (Weihnachts- und Osterlieder), lehrhaften
Sprüchen, Fabeln etc. (hrsg. von Gradl, Prag 1869). Vgl.
Henrici, Zur Geschichte der mittelhochdeutschen Lyrik (Berl.
1876).
Spes, bei den Römern Personifikation der "Hoffnung",
besonders auf Ernte- und Kindersegen; ward dargestellt als ein
schlankes Mädchen, auf den Zehen leicht hinschwebend, in der
Rechten eine Blume, im Typus den altertümlichen Bildern der
voll gekleideten Aphrodite gleichend, zur Seite die Krähe, das
Symbol der langen Dauer. Eine inschriftlich gesicherte Statue der
S. besitzt die Villa Ludovisi in Rom.
Spesen (ital.), Auslagen, Unkosten; im engern Sinn
allerlei Nebenkosten, wie diejenigen an Abgaben, Sensarie,
Provision, Verpackung etc. Im weitern Sinn überhaupt alle
Ausgaben, welche einem Handelsgeschäft erwachsen, wie
Handlungsspesen (Ausgaben an Lohn, Miete etc.), Reisespesen; so
insbesondere auch die Auslagen und Gebühren, welche für
die Besorgung fremder Geschäfte berechnet werden, wie
namentlich die S. des Spediteurs (s. Spedition), dessen
darüber ausgestellte spezifizierte Rechnung Spesennota genannt
wird, und die sogen. Inkassospesen, welche für das
Einkassieren einer fremden Forderung in Ansatz kommen. Von
Spesennachnahme spricht man, wenn Spesen des Spediteurs nach
Herkommen oder Verabredung vom Frachtführer, der den
Weitertransport besorgt, erhoben und von diesem dann bei
Ablieferung des Gutes eingezogen werden.
Spessart (Speßhart, im Nibelungenlied Spechteshart,
"Spechtswald"), Waldgebirge im westlichen Deutschland, liegt
innerhalb des Bogens, welchen der Main von der Mündung der
Fränkischen Saale und der Sinn bei Gemünden bis zur
Mündung der Kinzig bei Hanau macht, und wird im N. durch die
Kinzig vom Vogelsberg und im NO. durch die Sinn von der Rhön
geschieden. Seine äußersten Verzweigungen erstrecken
sich bis gegen Salmünster, Schlüchtern und Brückenau
hin. Er gehört größtenteils zum bayrischen
Regierungsbezirk Unterfranken, zum Teil auch
129
Spessartin - Spezia.
zum preußischen Regierungsbezirk Kassel und erscheint als
waldiges Massengebirge mit abgerundeten, wenig über die
Gesamthöhe sich erhebenden Kuppen. Der Hauptrücken zieht
sich von Süden, Miltenberg gegenüber, 75 km lang nach N.
bis zur Quelle der Aschaff in der Gegend von Schlüchtern und
steigt zu einer Höhe von 450-600 m an. Hier sind der
Engelsberg bei Großheubach (mit Kapuzinerkloster) und der 615
m hohe Geiersberg, die höchste Erhebung des ganzen Gebirges,
nördlich vom Rohrbrunner Paß, durch welchen die
Straße von Aschaffenburg nach Würzburg führt,
während die Eisenbahn das Gebirge weiter nördlich von
Aschaffenburg ostwärts nach Gemünden durchschneidet. Die
Hauptmasse des Spessarts besteht aus Granit, Gneis und
Glimmerschiefer mit aufgelagertem roten und gefleckten Sandstein.
An den untern Abhängen bebaut, ist der S. auf den Höhen
mit prachtvollem Eichen- und Buchenwald bedeckt. Der
äußere Saum längs des Mains, namentlich im W., wird
als Vorspessart, das innere, aus dicht zusammenschließenden
Bergen bestehende Waldgebirge, welches keine breite Bergebene
aufweist, als Hochspessart, die plateauartige Absenkung gegen die
Kinzig und Kahl hin, welche auch das sogen. Orber Reisig (s. d.),
mehrere mit Eichengebüsch bedeckte Anhöhen, bis zur Stadt
Orb umfaßt, als Hinterspessart bezeichnet. Die Bewohner
beschäftigen sich viel mit Verarbeitung des Holzes, namentlich
zu Faßdauben. Der Bergbau ist nicht bedeutend. Eine Saline
ist zu Orb in Betrieb; auch gibt es mehrere Glashütten. Auf
der Scheide der nach W. und O. dem S. entfließenden
Gewässer zieht sich vom Engelsberg über den Geiersberg
bis zum Orber Reisig der uralte Eselspfad (ähnlich dem
Rennstieg im Thüringer Wald). Unter den zahlreichen
Bächen des Spessarts sind die Sinn, Lohr, Hafenlohr, Elsawa,
Aschaff, Bieber und Kahl die ansehnlichsten. Erst neuerdings ist es
dem Spessartklub gelungen, die Aufmerksamkeit der Reisenden auf die
Schönheiten dieses bisher wenig besuchten Gebirges
hinzulenken. Vgl. Behlen, Der S. (Leipz. 1823-27, 3 Bde.); Schober,
Führer durch den S. etc. (Aschaffenb. 1888); Herrlein, Sagen
des S. (2. Aufl., das. 1885): Welzbacher, Spezialkarte vom S.,
1:100,000 (5. Aufl., Frankf. 1885).
Spessartin, s. Granat.
Spetsä (Spezzia, Petsa, im Altertum Pityussa), eine
zum griech. Nomos Argolis und Korinth gehörige Insel,
östlich am Eingang des Golfs von Nauplia, 17 qkm (0,30 QM.)
groß, mit steinigem, wenig fruchtbarem Boden und (1879) 6899
Einw. Auf der Nordostküste liegt der gleichnamige Hauptort,
mit guter Reede, einer Marineschule und (1879) 6495 Einw.
Südlich von S. die unbewohnte Insel Spetsopulon (2 qkm), wo
die Venezianer 1263 über die Griechen siegten.
Speusippos, griech. Philosoph, Schwestersohn des Platon,
geboren zwischen 395 und 393 v. Chr., trat nach Platens Tod (347)
an dessen Stelle in der Akademie, zog sich aber nach acht Jahren
wieder zurück und machte seinem Leben freiwillig ein Ende
(jedenfalls vor 334). In seiner Lehre sich im ganzen eng an Platon
anschließend, soll er nur darin von ihm abgewichen sein,
daß er zwei Kriterien der Wahrheit, eins für das
Denkbare und eins für das sinnlich Wahrnehmbare, aufstellte.
Seine zahlreichen Schriften sind sämtlich verloren gegangen.
Vgl. Fischer, De Speusippi Atheniensis vita (Rastatt 1845);
Ravaisson, Speusippi placita (Par. 1838).
Spey (spr. speh), Fluß in Schottland, entspringt
auf dem Grampiangebirge in der Landschaft Badenoch, fließt
durch ein wildromantisches Thal und mündet bei Garmouth in die
Nordsee. Er ist 154 km lang, wird aber erst kurz vor seiner
Mündung schiffbar.
Speyer, Stadt, s. Speier.
Spezereien (ital. spezierie, franz. épiceries),
Gewürzwaren, würzige, wohlriechende Pflanzenstoffe.
Spezia, Kreishauptstadt in der ital. Provinz Genua, im
Hintergrund des tiefen Golfs von S., Station der Eisenbahn
Genua-Pisa, ist der seit 1861 im Bau begriffene große
Kriegshafen Italiens an herrlicher Bucht, welche die ganze
italienische Flotte aufnehmen kann, und deren Höhen nebst der
am Eingang liegenden Insel Palmaria mit starken Forts besetzt sind.
Der Hafen umfaßt 4 große Docks, 2 innere Hafenbassins,
Schiffswerften und ein Arsenal. Auch befinden sich hier eine
große Eisengießerei, Kabelfabrik,
Maschinenbauwerkstätte, Bleiweiß-, Leder- und
Segeltuchfabriken u. a. Der Handelshafen ist gleichfalls
vortrefflich (1887 liefen 2585 Schiffe von 362,627 Ton. ein) und
bedarf zu seiner Belebung nur der Vollendung der in Angriff
genommenen Eisenbahn über die Apenninen nach Parma. Die Stadt
hat (1881) 19,864 Einw. Sie ist Sitz eines
Marinedepartementkommandos, eines Hafenkapitanats, mehrerer
Konsulate (darunter auch eines deutschen) und hat eine Schule
für Nautik und Schiffbau, ein Lyceum und Gymnasium und eine
technische Schule. Wegen seines milden Klimas, seiner Seebäder
und seiner herrlichen Umgebung ist S. von Fremden (auch im Winter)
viel besucht. Am Hafen befinden sich schöne Promenaden. Hier
(im Fort Varignano) wurde Garibaldi 1862 nach seiner Verwundung am
Aspromonte und 1867 nach der verunglückten Unternehmung wider
Rom eine Zeitlang gefangen gehalten. Die Umgegend liefert
treffliches Olivenöl; westlich von S., bei Vernazzo,
wächst der berühmte Wein Cinque-Terre. Östlich von
S. liegen die Ruinen der alten Stadt Luna, nach welcher der Golf im
Altertum Portus Lunae hieß.
[Situationsplan von Spezia.]
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl., XV. Bd.
130
Spezial - Spezifisches Gewicht.
Spezial (lat.), das Einzelne, Besondere betreffend, meist
in Zusammensetzungen gebraucht, z. B. Spezialkarte (im Gegensatz zu
General-); als Hauptwort s. v. w. Vertrauter, Busenfreund, auch
Spezereihändler. Spezialien, Einzelheiten, besondere
Umstände.
Spezialakten, s. Generalien.
Spezialetat, s. Etat.
Spezialhandel, s. Handelsstatistik, S. 99.
Spezialinquisition, s. Strafprozeß.
Spezialisation (lat.), in der Morphologie die Ausbildung
der Organe für einen besondern, beschränktern
Wirkungskreis, um die dafür passende Arbeit in höherer
Vollkommenheit zu liefern. Im Gegensatz hierzu steht eine
allgemeinere, noch den verschiedensten Zwecken dienstbare,
ursprüngliche Organisation. Die S. prägt sich am meisten
in den Sinnesorganen, dem Gebiß und in der Bildung der
Endgliedmaßen aus. So sind die fünfgliederigen
Füße der Vierfüßer, solange Finger und Zehen
frei sind, in der Regel zu den verschiedensten Thätigkeiten
als Greif-, Schreit-, Kletterfüße etc. brauchbar; sind
dagegen die Zehen durch Flug- oder Schwimmhaut (z. B. bei
Fledermäusen und Robben) verbunden oder vermindert sich die
Zehenzahl (bei den Huftieren) auf zwei oder ein Glied, so haben wir
spezialisierte Organe, die nur noch als Flug-, Schwimm- und
Lauffüße brauchbar sind, aber diese Arbeit dafür in
höchster Vollkommenheit leisten. Vgl. Arbeitsteilung.
Spezialisieren (franz.), im einzelnen und besondern
anführen, bestimmen.
Spezialist (franz.), einer, der einem besondern Fach der
Wissenschaft sich ausschließlich widmet, z. B. ein
Spezialarzt für Halsleiden etc.
Spezialität (lat.), Einzelheit, Besonderheit;
Spezialfach eines Wissens oder einer Thätigkeit. Im Pfandrecht
versteht man unter dem Prinzip der S. den Grundsatz, wonach nur an
bestimmten einzelnen Vermögensgegenständen und nicht an
dem ganzen Vermögen einer Person ein Pfandrecht bestellt
werden kann (s. Hypothek).
Spezialmandat (Spezialvollmacht), s. Mandat.
Spezialtarife, s. Eisenbahntarife.
Spezialwaffen (Spezialtruppen), ein nicht feststehender
Begriff, durch den meist die Waffen außer Infanterie und
Kavallerie bezeichnet werden.
Speziell (lat.), s. v. w. spezial (s. d.), besonders,
einzeln, im Gegensatz zu generell und universell.
Spezies (lat. species), Erscheinungsform, Gestalt, Bild,
Schein (z. B. sub specie, unter dem Schein; sub utraque specie,
unter beiderlei Gestalt); in der Naturwissenschaft s. v. w. Art; in
der Technik und Pharmazie Bezeichnung für Waren, Gewürze,
Spezereien, besonders Mischungen aus zerschnittenen vegetabilischen
Substanzen, wie Species aromaticae, aromatische Kräuter (s.
d.), S. ad decoctum lignorum, Holztrank (s. d.), S. laxantes
St.-Germain, St.-Germainthee (s. Sennesblätter), S.
pectorales, Brustthee (s. d.); in der Arithmetik (vier S.)
Bezeichnung der vier Grundrechnungsarten: Addition, Subtraktion,
Multiplikation u. Division; auch s. v. w. Speziesthaler.
Spezieskauf, Kauf genau bestimmter einzelner
Gegenstände; s. Gattungskauf.
Speziesthaler (Spezies, harter Thaler), in mehreren
Staaten, zuletzt noch in Österreich, ausgeprägte
Silbermünze. Der österreichische S. war bis zur
Münzkonvention von 1857 die Einheit der österreichischen
Münze, = 2 Konventionsgulden = 4,20 Mark; 10
österreichische S. = 1 kölnische Mark fein Silber. Der
dänische S. = 4,551 Mark. In Norwegen ist der S. derselbe wie
in Dänemark, er wird seit 1. Jan. 1874 zu 4 Kronen à 30
Skillinge oder à 100 Öre = 400 Öre gerechnet.
Spezifikation (lat.), Aufzählung von Einzelheiten,
die ein Ganzes bilden; in der Rechtssprache die Verfertigung einer
neuen Sache aus einem vorhandenen Stoff und zwar so, daß sich
der letztere nicht wiederherstellen läßt.
Spezifisch (lat.), in der Physik Bezeichnung einer
Eigenschaft, welche einem bestimmten Stoff seiner Natur nach
zukommt, eigen ist, z. B. spezifisches Gewicht, spezifische
Wärme, spezifisches Volumen.
Spezifische Arzneimittel (Specifica), besonders wirksame
Mittel, von denen man früher annahm, daß sie die als
Einheit gedachte Krankheit bekämpften und nur auf die
erkrankten Organe wirkten, während man jetzt weiß,
daß auch diese Arzneien auf alle Gewebe Einfluß
üben und nur einzelne derselben besonders stark betreffen. Als
s. A. gelten Quecksilber gegen Syphilis, Chinin gegen Wechselfieber
etc.
Spezifische Energie, s. Sinne, S. 993.
Spezifisches Gewicht (Dichte, Dichtigkeit) eines
Körpers ist die Zahl, welche angibt, wie vielmal der
Körper schwerer ist als ein gleiches Volumen Wasser von 4°
C. Man findet demnach das spezifische Gewicht eines Körpers,
wenn man sein absolutes Gewicht durch das Gewicht eines gleichen
Volumens Wasser dividiert. Bezeichnet man mit s das spezifische
Gewicht des Körpers, mit p sein absolutes Gewicht und mit v
das absolute Gewicht eines gleich großen Raumteils Wasser, so
ist s = p/v, folglich auch v = p/s und p = v s. Wenn, wie bei dem
metrischen Maßsystem, das Gewicht der Volumeinheit Wasser zur
Gewichtseinheit gewählt ist (1 g = dem Gewicht von 1 ccm
Wasser bei 4° C.), so drückt die Zahl v, welche das
Gewicht des gleichen Wasservolumens (in Grammen) angibt, zugleich
das Volumen des Körpers (in Kubikzentimetern) aus. Wir
können daher obige Beziehungen auch wie folgt aussprechen: man
findet das spezifische Gewicht eines Körpers, wenn man sein
absolutes Gewicht durch sein Volumen dividiert; man findet sein
Volumen, indem man das absolute durch das spezifische Gewicht
dividiert; das absolute Gewicht eines Körpers ergibt sich,
wenn man sein Volumen mit seinem spezifischen Gewicht
multipliziert. Das spezifische Gewicht eines Körpers kann
demnach auch bezeichnet werden als das Gewicht der Volumeneinheit.
Um das spezifische Gewicht eines Körpers zu bestimmen, braucht
man nur nebst seinem absoluten Gewicht noch sein Volumen oder, was
dasselbe ist, das Gewicht eines gleich großen Volumens Wasser
zu ermitteln. Bei Flüssigkeiten geschieht dies mit Hilfe des
Pyknometers (Tausendgranfläschchens, Dichtigkeitsmessers),
eines 8-20 ccm fassenden Glasfläschchens (Fig.1), dessen
eingeriebener Stöpsel aus einem Stück
Thermometerröhre verfertigt ist, damit bei etwaniger
Erwärmung ein Teil der Flüssigkeit durch die feine
Öffnung austreten könne, ohne den Stöpsel zu heben
oder das Gefäß zu gefährden. Wägt man das
tarierte Fläschchen zuerst mit der Flüssigkeit, deren s.
G. bestimmt werden soll, sodann mit Wasser gefüllt, so
erfährt man das spezifische Gewicht durch Division des ersten
Gewichts durch das zweite. Auch zur Bestimmung des spezifischen
Gewichts fester Körper kann das Pyknometer gebraucht werden.
Man wägt zuerst das Fläschchen mit Wasser gefüllt,
legt den in
131
Spezifisches Gewicht.
Stückchen von Schrotgröße zerkleinerten
Körper auf die nämliche Wagschale und bestimmt sein
absolutes Gewicht. Wirft man nun die Stückchen in das
Fläschchen, so muß notwendig so viel Wasser
ausfließen, als von den hineingeworfenen Stückchen
verdrängt wird, und man erfährt nun durch eine abermalige
Wägung, wieviel ein dem Volumen der Körperstückchen
gleiches Volumen Wasser wiegt. Eine andre gleichfalls
vorzügliche Methode der Bestimmung des spezifischen Gewichts
gründet sich auf das sogen. Archimedische Prinzip, wonach
jeder in eine Flüssigkeit getauchte Körper so viel von
seinem Gewicht verliert, wie die verdrängte
Flüssigkeitsmenge wiegt. Man bedient sich hierzu der sogen.
hydrostatischen Wage (s. Hydrostatik, S.842), deren eine Wagschale
kürzer aufgehängt und unten mit einem Häkchen
versehen ist, woran man mittels eines möglichst dünnen
Drahts den zu untersuchenden Körper aufhängt, um ihn
zuerst wie gewöhnlich in der Luft und dann, nachdem er in ein
untergestelltes Gefäß mit Wasser eingetaucht ist,
nochmals im Wasser zu wägen. Die Gewichte, welche man im
letztern Fall von der ersten Wagschale wegnehmen oder auf die
kürzer aufgehängte Wagschale zulegen muß, um das
gestörte Gleichgewicht wiederherzustellen, geben das Gewicht
der verdrängten Wassermenge an, mit welchem man nur in das
absolute Gewicht des Körpers zu dividieren braucht, um sein s.
G. zu erfahren. Ist der Körper in Wasser löslich, so
taucht man ihn in eine andre Flüssigkeit, in welcher er sich
nicht löst, und bestimmt seinen Gewichtsverlust; ist das
spezifische Gewicht derselben bekannt, so findet man durch eine
einfache Rechnung den Gewichtsverlust, welchen er im Wasser
erlitten haben würde. Einen Körper, welcher spezifisch
leichter ist als Wasser und daher in demselben nicht untertaucht,
verbindet man mit einem schwerern Körper, dessen
Gewichtsverlust bereits bestimmt ist. Auch das spezifische Gewicht
von Flüssigkeiten läßt sich mittels der
hydrostatischen Wage leicht finden. Man bringt nämlich einen
unter der kürzern Wagschale aufgehängten beliebigen
Körper, z. B. ein Glasstück, in der Luft durch eine auf
die andre Wagschale gelegte Tara ins Gleichgewicht und bestimmt nun
seinen Gewichtsverlust zuerst in der zu untersuchenden
Flüssigkeit und dann in Wasser; jener Verlust, durch diesen
dividiert, gibt das gesuchte spezifische Gewicht. Der
Gewichtsverlust, welchen ein und derselbe Körper in
verschiedenen Flüssigkeiten erleidet, ist dem spezifischen
Gewicht offenbar proportional. Auf diesen Satz gründet sich
die Mohrsche Wage (Fig. 2), welche das spezifische Gewicht von
Flüssigkeiten sehr rasch und bequem zu bestimmen erlaubt. An
dem einen Arm des Wagebalkens hängt mittels eines feinen
Platindrahts das Senkgläschen A, ein zugeschmolzenes, zum Teil
mit Quecksilber gefülltes oder ein kleines Thermometer
enthaltendes Glasröhrchen, welches durch die Wagschale B
gerade im Gleichgewicht gehalten wird. Die Gewichte bestehen aus
hakenförmig gebogenen Messingdrähten P, von denen zwei
jedes genau so viel wiegen, wie der Gewichtsverlust des
Senkgläschens im Wasser ausmacht, während ein drittes
1/10 P, ein viertes 1/100 P wiegt. Der Wagebalken, an welchem das
Senkgläschen hängt, ist in 10 gleiche Teile geteilt. Will
man nun das spezifische Gewicht einer Flüssigkeit bestimmen,
so bringt man dieselbe in das Standgefäß CC und taucht
das Senkgläschen in sie ein. Ist die Flüssigkeit z. B.
konzentrierte Schwefelsäure, so muß man, um das
Gleichgewicht herzustellen, das eine Gewicht P an das Ende h des
Wagebalkens, das andre Gewicht P bei 8, das Gewicht 1/10 P bei 4
und das Gewicht 1/100 P wieder bei 8 anhängen und hat hiermit
das spezifische Gewicht der Schwefelsäure = 1,848 gefunden.
Über die Bestimmung des spezifischen Gewichts durch
Aräometer, welche sich ebenfalls auf das Archimedische Prinzip
gründen, s. d. In einer zweischenkeligen Röhre
(kommunizierende Röhren) b e d (Fig.3) halten sich zwei
Flüssigkeiten das Gleichgewicht, wenn ihre von der
Trennungsschicht a c aus gerechneten Höhen a b und c d sich
umgekehrt verhalten wie ihre spezifischen Gewichte; alsdann
üben sie nämlich auf die im gleichen Niveau gelegenen
Querschnitte a und c, unterhalb welcher die Flüssigkeitsmenge
a e c für sich schon im Gleichgewicht ist, gleichen Druck aus.
Befindet sich z. B. in dem einen Schenkel und in der Biegung
Quecksilber, im andern Schenkel Wasser, so ist im Fall des
Gleichgewichts die Höhe c d der Quecksilbersäule 13,6mal
geringer als diejenige der Wassersäule a b, woraus sich die
Zahl 13,6 als s. G. des Quecksilbers ergibt. Darauf gründet
sich Musschenbroeks Aräometer (Hygroklimax), welches in der
Form, die Ham ihm gegeben hat, in Fig. 4 dargestellt ist. Zwei
Glasröhren sind oben durch eine Metallröhre, an die ein
mit einem Hahn verschließbares, nach oben gerichtetes
Röhrchen angesetzt ist, verbunden und tauchen mit ihren
offenen Enden in zwei Gläser, deren eins Wasser, das andre die
zu untersuchende Flüssigkeit enthält. Verdünnt man
durch Saugen an dem Röhrchen die innere Luft und
schließt den Hahn, so werden die Flüssigkeiten durch den
äußern Luftdruck in die Röhren gehoben, und man
kann ihre Höhen, nachdem mittels Schrauben die
Flüssigkeitsoberflächen in den Gläsern auf das
gleiche Niveau gebracht sind, an der Skala ablesen; die Höhe
der Wassersäule, durch die Höhe der andern
Flüssigkeit-
[Fig. 2. Mohrsche Wage.]
[Fig. 3. Kommunizierende Röhren.]
[Fig. 4. Musschenbroeks Aräometer.]
132
Spezifisches Gewicht - Spezifische Wärme.
säule dividiert, gibt das spezifische Gewicht der letztern.
Über die Bestimmung des spezifischen Gewichts
pulverförmiger Körper s. Stereometer.
Um das spezifische Gewicht eines Gases zu bestimmen, wird ein
Glasballon von 8-10 Lit. Inhalt, dessen Hals mittels einer
Messingfassung, die durch einen Hahn verschließbar ist, auf
die Luftpumpe geschraubt werden kann, möglichst luftleer
gepumpt und nun gewogen. Alsdann füllt man ihn bei 0° mit
dem trocknen Gas und wägt ihn nochmals. Der Unterschied der
beiden Gewichte ist das Gewicht des Gases bei 0° und dem gerade
herrschenden Barometerstand und braucht nur durch das zuvor genau
ermittelte Volumen des Ballons dividiert zu werden, um das
spezifische Gewicht des Gases für diesen Druck zu liefern. Mit
Hilfe des Mariotteschen Gesetzes kann daraus leicht das spezifische
Gewicht bei dem Normalbarometerstand von 760 mm gefunden werden.
Überhaupt müssen bei der Bestimmung des spezifischen
Gewichts der Gase Temperatur, Druck und andre Umstände
sorgfältige Berücksichtigung finden. Um die Korrektion
wegen des Gewichtsverlustes, welchen der Ballon durch die umgebende
atmosphärische Luft erleidet, zu umgehen, hing Regnault an den
andern Wagebalken einen ganz gleichen Glasballon, dessen
äußeres Volumen dem des ersten vollkommen gleich gemacht
war. Da die spezifischen Gewichte der Gase, auf Wasser bezogen,
durch sehr kleine Zahlen ausgedrückt sind, so nimmt man
für sie gewöhnlich die Luft als Einheit. Ein sehr
sinnreiches Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Gewichte der
Gase wurde von Bunsen auf den Satz gegründet, daß die
Ausströmungsgeschwindigkeit der Gase den Quadratwurzeln aus
ihren spezifischen Gewichten umgekehrt proportional sind, oder, was
dasselbe ist, daß ihre spezifischen Gewichte sich verhalten
wie die Quadrate der Ausströmungszeiten gleicher Volumina. Das
Gas befindet sich in der Glasröhre A A (Fig. 5), die sich oben
in ein Röhrchen B verengert, in welches bei v ein dünnes
Platinplättchen mit einer feinen Öffnung eingeschmolzen
ist, aus der nach Wegnahme des Stöpsels s das Gas
ausströmt. Die Röhre A A wird, während der
Stöpsel aufgesetzt ist, so tief in das Quecksilber des
Standgefäßes C C hinabgedrückt, daß die
Spitze r des gläsernen Schwimmers D D genau im Niveau des
Quecksilbers erscheint. Wird nun der Stöpsel weggenommen, so
beginnt das Gas auszuströmen, und man braucht nun nur die Zeit
zu beobachten, welche von der Wegnahme des Stöpsels an
vergeht, bis die am Schwimmer angebrachte Marke t das
Quecksilberniveau erreicht hat. Hat man z. B. auf diese Weise
gefunden, daß gleiche Raumteile von atmosphärischer Luft
und von Knallgas bez. 117,6 und 75,6 Sekunden zum Ausströmen
gebrauchen, so ist das spezifische Gewicht des Knallgases, auf Luft
bezogen, = 75,6² : 117,6² = 0,413.
Über die Bestimmung des spezifischen Gewichts der
Dämpfe s. Dampfdichte.
[Fig. 5. Bunsens Apparat zur Bestimmung des spezifischen
Gewichts der Gase.]
Spezifische Wärme (Wärmekapazität), die
Wärmemenge, welche 1 kg eines Körpers bedarf, um sich um
1° C. zu erwärmen. Gleiche Massen verschiedener Stoffe
erfordern für die gleiche Temperaturerhöhung einen sehr
ungleichen Aufwand von Wärme. Will man z. B. 1 kg Wasser und 1
kg Quecksilber von 0° auf 100° erwärmen, so bemerkt
man leicht, daß bei gleicher Wärmezufuhr das Quecksilber
viel rascher die gewünschte Temperatur erreicht als das
Wasser. Ja sogar, wenn man von beiden Flüssigkeiten je 1 Lit.
nimmt, also dem Gewicht nach 13,6mal soviel Quecksilber als Wasser,
wird man bei jenem mit einer Heizflamme das Ziel schneller
erreichen als bei diesem mit zwei ebensolchen Flammen. Erkaltet ein
warmer Körper wieder auf seine ursprüngliche Temperatur,
so gibt er die Wärmemenge, welche er vorher zu seiner
Erwärmung verbraucht hatte, an seine Umgebung wieder ab; man
wird daher, indem man diese Wärmeabgabe beobachtet, zugleich
den zur Erwärmung nötigen Wärmebedarf kennen lernen;
alle Verfahrungsarten zur Ermittelung der "spezifischen Wärme"
der Körper beruhen in der That aus der Bestimmung der beim
Erkalten abgegebenen Wärmemenge. Erwärmen wir drei gleich
schwere Kugeln von Kupfer, Zinn und Blei in siedendem Wasser auf
100° u. bringen sie rasch auf eine Wachsscheibe, so fällt
die Kupferkugel sehr bald durch das Loch, das sie aufgeschmolzen
hat, die Zinnkugel dringt tief in die Scheibe ein, während die
Bleikugel nur ganz wenig einsinkt. Es ist hierdurch
augenfällig, daß das Kupfer die größte
Wärmemenge abgegeben hat und demnach unter diesen Metallen die
größte s. W. besitzt, das Zinn eine mittlere, das Blei
die kleinste. Genaueres über das Verhältnis der
spezifischen Wärmen dieser Körper erfahren wir jedoch
durch diesen Versuch nicht; hierzu wäre es notwendig, die
abgegebenen Wärmemengen wirklich zu messen, d. h. in
"Wärmeeinheiten "auszudrücken. Als Einheit der
Wärmemenge oder Wärmeeinheit hat man diejenige
Wärmemenge festgesetzt, welche erforderlich ist, um 1 kg
Wasser um 1° C. zu erwärmen, oder, was dasselbe ist, man
hat die s. W. des Wasser = 1 angenommen. Vorrichtungen zur Messung
von Wärmemengen nennt man Kalorimeter. Um die s. W. eines
Körpers nach dem Schmelzverfahren zu bestimmen, kann das
Eiskalorimeter von Lavoisier und Laplace (Fig. 1) dienen. Dasselbe
besteht aus drei sich der Reihe nach umhüllenden
Blechgefäßen, von denen das innerste c siebartig
durchlöchert ist oder auch nur aus einem Drahtkorb besteht.
Der Zwischenraum a a zwischen dem äußersten und mittlern
Gefäß sowie der hohle Deckel des letztern
[Fig. 1 Eiskalorimeter von Lavoisier und Laplace.]
133
Spezifische Wärme.
werden mit Eisstücken gefüllt, die dazu dienen, die
Wärme der äußern Umgebung von dem Raum b b zwischen
dem mittlern und innersten Gefäß, der ebenfalls mit
Eisstücken gefüllt ist, abzuhalten; das in dem Raum a a
durch die äußere Wärme erzeugte Schmelzwasser
fließt durch den Hahn d ab. Bringt man nun einen Körper
von bekanntem Gewicht und bekannter Temperatur (z. B. eine in den
Dämpfen siedenden Wassers auf 100° erhitzte eiserne Kugel)
in das innerste Gefäß, so wird derselbe, indem er von
dieser Temperatur auf 0° erkaltet, eine gewisse Menge Eis
schmelzen, welche man durch Wägung des durch den Hahn e
abgelaufenen Schmelzwassers ermittelt. Da man nun weiß,
daß zur Schmelzung von 1 kg Eis 80 Wärmeeinheiten
erfordert werden (s. Schmelzen), so kann man leicht die
Wärmemenge berechnen, welche jener Körper bei seinem
Erkalten abgegeben hat, und erfährt sonach auch die
Wärmemenge, welche derselbe für 1 kg und für 1°
C. enthielt, d. h. seine s. W. Das weit genauere Eiskalorimeter von
Bunsen gründet sich auf die Thatsache, daß beim
Schmelzen des Eises eine Zusammenziehung stattfindet, indem das
entstandene Schmelzwasser einen kleinern Raum einnimmt als das Eis
(s. Ausdehnung). In das weitere Glasgefäß W (Fig. 2),
welches sich unten in das umgebogene und wieder aufsteigende
Glasrohr Q Q fortsetzt, ist das Probierröhrchen w
eingeschmolzen; das Gefäß W wird mit luftfreiem Wasser
gefüllt, welches durch das im untern Teil von W und in der
Röhre befindliche Quecksilber Q Q abgesperrt ist. Indem man
tief erkalteten Weingeist durch das Proberöhrchen strömen
läßt, umkleidet sich dasselbe mit einer Eishülle E.
Wirft man nun einen auf bekannte Temperatur erwärmten
Körper in das Proberöhrchen, welches etwas Wasser von
0° enthält, so wird etwas Eis geschmolzen, infolge der
eintretenden Raumverminderung tritt mehr Quecksilber in das
Gefäß W, und in dem engen Glasröhrchen q, welches
mittels eines Korks in das Rohr Q eingesetzt ist, zieht sich der
Quecksilberfaden zurück; aus der Größe seiner
Verschiebung ergibt sich die Menge des entstandenen Schmelzwassers
und demnach auch die von dem Körper an das Eis abgegebene
Wärmemenge.
Vermischt man 1 kg Wasser von 10° mit 1 kg Wasser von
50°, so zeigt die Mischung, wenn alle Wärmeverluste
vermieden wurden, die mittlere Temperatur von 30°. Das eine
Kilogramm Wasser gab nämlich, indem es von 50° auf 30°
erkaltete, die 20 Wärmeeinheiten ab, welche notwendig waren,
um das andre Kilogramm Wasser von 10° auf 30° zu
erwärmen. Mischt man dagegen 1 kg Wasser von 10° mit 1 kg
Terpentinöl von 60°, so zeigt das Gemisch nur etwa
24°. Um die 14 Wärmeeinheiten zu liefern, welche zur
Erwärmung des einen Kilogramms Wasser von 10° auf 24°
erforderlich waren, mußte also das Kilogramm Terpentinöl
um 36° erkalten; umgekehrt werden diese 14 Wärmeeinheiten
auch wieder hinreichen, um 1 kg Terpentinöl um 36° zu
erwärmen. Zur Erwärmung von 1 kg Terpentinöl um
1° sind daher 14/36 oder 0,4 Wärmeeinheiten erforderlich,
oder 0,4 ist die s. W. des Terpentinöls. Um dieses
Mischungsverfahren mit der erforderlichen Genauigkeit
auszuführen, bediente sich Regnault der in Fig. 3 gebildeten
Vorrichtung. Der obere Teil wird von drei einander umhüllenden
Blechcylindern gebildet, deren innerster A oben durch einen Kork,
in welchem ein Thermometer steckt, unten durch einen leicht
abnehmbaren Blechdeckel verschlossen ist. In der Mitte von A
hängt an einem durch den Kork gehenden Faden ein
ringförmiges Drahtkörbchen, welches den zu untersuchenden
Körper, entweder in Stücken oder in dünnwandige
Glasröhrchen eingeschmolzen, aufnimmt und in seiner innern
Höhlung das Gefäß des Thermometers
einschließt. In den Raum B wird aus einem seitlich
aufgestellten Dampfkessel durch die Röhre a Wasserdampf
eingeleitet, welcher den Körper auf 100° erwärmt und
durch die Röhre c wieder abströmt. Ist diese Temperatur
erreicht, so wird nach Wegnahme des untern Deckels das
Drahtkörbchen in das mit einer gewogenen Wassermenge
gefüllte Wasserkalorimeter D herabgelassen und die
Mischungstemperatur beobachtet, woraus sich die von dem Körper
an das Wasser abgegebene Wärmemenge und sonach auch seine s.
W. leicht ableiten läßt. Durch einen mit kaltem Wasser d
d angefüllten Blechmantel ist das Kalorimeter D vor
Erwärmung von dem Dampfkessel oder dem Dampfraum B B her
geschützt.
Ein drittes Verfahren zur Bestimmung der spezifischen
Wärme, das besonders von Dulong und Petit angewendete
Abkühlungsverfahren, gründet sich auf den Satz, daß
ein erwärmter Körper im luftleeren Raum, wo er nur durch
Wärmestrahlung sich abkühlen kann, unter sonst gleichen
äußern Umständen um so langsamer erkaltet, eine je
größere Wärmemenge er enthält; bei gleicher
Temperaturerniedrigung verhalten sich hiernach die von
verschie-
[Fig 2. Eiskalorimeter von Bunsen.]
[Fig. 3. Wasserkalorimeter von Regnault.]
134
Spezifizieren - Sphaerococcus.
denen Körpern abgegebenen Wärmemengen wie die
Abkühlungszeiten.
Die spezifischen Wärmen der Körper nehmen mit
höherer Temperatur zu, indem sie sich einem festen Endwert
nähern; zwischen 0° und 100° ist indessen die
Änderung so gering, daß man die s. W. innerhalb dieser
Grenzen als unveränderlich betrachten kann.
Die spezifischen Wärmen einiger Grundstoffe sind:
Aluminium 0,214
Schwefel 0,203
Eisen 0,114
Kupfer 0,095
Zink 0,095
Silber 0,057
Zinn 0,056
Jod 0,054
Antimon 0,051
Quecksilber 0,033
Platin 0,032
Blei 0,031
und diejenigen einiger Flüssigkeiten:
Alkohol 0,566
Glycerin 0,555
Benzin 0,392
Chloroform 0,233
Die s. W. des Eises ist 0,505.
Dulong und Petit entdeckten das wichtige Gesetz, daß die
spezifischen Wärmen der festen chemischen Elemente
(Grundstoffe) sich umgekehrt verhalten wie ihre Atomgewichte, so
daß das Produkt aus Atomgewicht und spezifischer Wärme
für alle diese Körper unveränderlich das
nämliche und zwar nahezu gleich 6 ist. Das Dulong-Petitsche
Gesetz läßt sich sonach auch folgendermaßen
aussprechen: die durch die Atomgewichte ausgedrückten Mengen
der festen Elemente bedürfen zu gleicher
Temperaturerhöhung gleich großer Wärmemengen, oder:
die Atomwärmen der Grundstoffe sind gleich. Neumann wies
ferner nach, daß auch die spezifischen Wärmen chemischer
Verbindungen von ähnlicher Zusammensetzung im umgekehrten
Verhältnis der Atomgewichte stehen, und Kopp stellte den Satz
auf, daß die Molekularwärme einer chemischen Verbindung
gleich der Summe der Atomwärmen ihrer Elemente sei (vgl.
Wärme).
Die luftförmigen Körper bedürfen zur
Erwärmung gleicher Raumteile auch gleicher Wärmemengen;
und da nach dem Gesetz von Avogadro alle Gase bei gleichem Druck
und gleicher Temperatur in gleichen Raumteilen gleich viele
Moleküle enthalten, so folgt, daß alle Gase gleiche
Molekularwärme haben. Eine gegebene Gewichtsmenge eines Gases
verbraucht bei gleicher Temperaturerhöhung eine
größere Wärmemenge, wenn sie bei gleichbleibendem
Druck sich ausdehnt, als wenn sie unter Steigerung des Drucks ihren
Rauminhalt unverändert beibehält, d. h. die s. W. bei
konstantem (unverändertem) Druck ist größer als
diejenige bei konstantem Volumen; für atmosphärische Luft
beträgt jene 0,2377, diese 0,1686. Für alle Gase ist das
Verhältnis der spezifischen Wärme bei konstantem Druck zu
derjenigen bei konstantem Volumen das gleiche, nämlich = 1,41
(vgl. Wärme).
Spezifizieren (lat.), im einzelnen angeben.
Speziös (lat.), in die Augen fallend, von
schöner Erscheinung; auch s. v. w. durch den Schein
täuschend, scheinbar.
Spezzia, Insel, s. Spetsä.
Sphacelarieen, Familie der Algen aus der Ordnung der
Fukoideen; s. Algen (11), S. 345.
Sphacelia, s. Mutterkorn.
Sphacelus, feuchter Brand, s. Brand, S. 313.
Sphagnaceen, Ordnung der Moose (s. d., S. 791).
Sphagnum Ehrh. (Torfmoos), Moosgattung aus der Ordnung
der Sphagnaceen, charakterisiert durch aufrechte, cylindrische,
beblätterte Stengel mit zweierlei Zweigen: gerade abwärts
gerichteten, dem Stengel dicht anliegenden und schief abstehenden
oder aufrechten, an der Spitze des Stengels schopfartig
gehäuften. Die weiblichen Blüten stehen endständig
auf aufrechten Zweigen, die männlichen
kätzchenförmig an den Spitzen schiefer Zweige. Mit den
auch sonst ähnlichen Laubmoosen stimmt die Gattung in der mit
einem Deckel aufgehenden Büchse überein, unterscheidet
sich aber durch den Mangel der Borste und durch die an der Spitze
zerreißende, daher die Büchse anfangs scheidenartig
umgebende Haube. Die Blätter bestehen aus großen,
leeren, lufthaltigen, mit Verdickungsfasern versehenen, durch weite
Poren nach außen geöffneten Zellen, zwischen denen sehr
enge, chlorophyllhaltige Zellen liegen, daher diese Moose von
bleicher Farbe sind und vermittelst der porösen Zellen, wie
ein Schwamm, Wasser einsaugen. Es sind ansehnliche,
weißliche, bräunliche oder rötliche, in hohen,
elastisch schwammigen Polstern wachsende Moose, welche in einigen
20 Arten über die Erde verbreitet sind und zu den wichtigsten
Torfpflanzen gehören, indem sie von der Ebene bis in die
alpinen Gebirgshöhen, auf Torfsümpfen, in morastigen
Wäldern und auf feuchten Felsen gesellig in ausgedehnten
Beständen wachsen und wesentliche Erzeuger des Torfs sind. Sie
erhalten in Wäldern und Gebirgen die Feuchtigkeit des Bodens.
Die häufigsten der zwölf deutschen Arten sind das
kahnblätterige Torfmoos (S. cymbifolium Ehrh.), mit
kahnförmigen, an der Spitze kappenförmigen
Zweigblättern, und das spitzblätterige Torfmoos (S.
acutifolium Ehrh.), mit lang zugespitzten, an der Spitze gestutzten
und gezahnten, länglich-eiförmigen Blättern. Vgl.
Warnstorff, Die europäischen Torfmoose (Berl. 1881).
Sphakioten, Volksstamm, s. Kreta.
Sphakteria (jetzt Sphagia), griech. Insel im Ionischen
Meer, an der Westküste von Messenien (Bai von Pylos), 5 km
lang, schmal und felsig. Während des Peloponnesischen Kriegs
wurde S. 425 v. Chr. von 420 Spartanern besetzt, aber nach
72tägiger Verteidigung den Athenern unter Kleon
übergeben, wobei 292 Spartaner in deren Gewalt fielen.
Sphalerit, s. Zinkblende.
Sphäre (griech.), Kugel; in der Geometrie die
Kugeloberfläche (daher Sphärik, die Lehre von den Figuren
auf der Kugel); in der Astronomie s. v. w. Himmelskugel,
Weltkörper, dann Kreis, Kreisbahn (der Planeten); bildlich s.
v. w. Bereich, Geschäfts-, Wirkungskreis, Erkenntniskreis;
Lebensstellung.
Sphärenmusik, s. Harmonie der Sphären.
Sphärisch, auf der Kugel, eine Figur auf der
Oberfläche einer Kugel gelegen.
Sphärischer Exzeß, s. Kugel.
Sphärístik (griech.), Kunst des Ballspiels
(s. d.).
Sphaerococcus Grev. (Knopftang), Algengattung aus der
Familie der Florideen, mit meist dichotom verzweigtem, rundem oder
zusammengedrückt linealischem, knorpeligem oder heutigem
Thallus und eingesenkten, aber knopf- oder warzenförmig
hervorragenden Früchten (Cystokarpien), ist gegenwärtig
nach dem innern Bau der letztern in eine Anzahl Gattungen zerteilt
worden. Chondrus crispus Lyngb. (S. crispus Ag., gemeiner
Knorpeltang, Gallertmoos, Carragaheenmoos, irländisches
Perlmoos), 7-32 cm lang, 0,2-2,7 cm breit, zusammengedrückt
linealisch oder keilförmig, an den Spitzen wiederholt dichotom
geteilt und kraus, knorpelig, rot oder violett, wächst an
Steinen in den europäischen Meeren, wird vorzüglich an
den Küsten der nördlichen Länder gesammelt und
getrocknet als Carragaheen (s. d.) in den Handel gebracht. Aus
Gracilaria lichenoides Ag. (S. lichenoides Ag., Ceylonmoos), mit
7-11 cm langem, zwirnfadendickem, dichotom ästigem,
gallertigem Thallus, im Indischen Meer, auf Ceylon und Java,
bereiten die Japaner eins ihrer gewöhnlichsten
Nahrungsmittel
135
Sphäroid - Sphinx.
(Dschin-Dschen). Dasselbe gilt von den ähnlichen Arten:
Euchema spinosum Ag. (S. spinosus Ag.), E. gelatinae Ag. (S.
gelatinus Ag.) und E. speciosum Ag., in den Meeren Indiens und
Australiens, welche auch nach Europa (s. Agar-Agar) in den Handel
kommen. Auch Gracilaria lichenoides, im Indischen Meer und im
Stillen Ozean, wird gegessen.
Sphäroid (griech., "kugelähnlich"), bei den
alten Geometern der Körper, welcher durch Umdrehung einer
Ellipsenfläche um eine der beiden Achsen erzeugt wird. Ist a
die halbe Rotationsachse, b die andre Halbachse (vgl. Ellipse), so
ist das Volumen des Körpers = 3/4 a² b ^? (^? =
3,1416, vgl. Kreis), gleichgültig, ob a größer oder
kleiner als b ist. Schon Archimedes hat dies bewiesen.
Gegenwärtig nennt man den Körper (und ebenso die ihn
begrenzende Fläche) ein Rotationsellipsoid (vgl.
Ellipsoid).
Sphäroidaler Zustand, s. Leidenfrostscher
Tropfen.
Sphärolithe, die kugeligen Aggregate, welche in
vielen Gesteinen eine besondere kugelige oder sphärolithische
Struktur hervorrufen, und die man, je nachdem sie selbst
strukturlos sind oder eine radialfaserige Zusammensetzung erkennen
lassen, und je nach der Natur der gruppierten Elemente mit
verschiedenen Namen (Kumulite, Globosphärite,
Belonosphärite, Felsosphärite, Granosphärite)
belegt. Tafel "Mineralien und Gesteine" zeigt in Fig. 16 und 17
sphärolithische Struktur in körnigem und in glasigem
Gestein. Speziell nennt man S. die kugeligen, aber schon deutlich
kristallinischen Ausscheidungen in gewissen Perlsteinen (s. d.),
von den aus bloßer Glasmasse bestehenden kugeligen
Körnern der meisten Perlsteine zu unterscheiden. Gesteine,
welche fast nur aus solchen Sphärolithen zusammengesetzt sind
und beinahe gar keine glasige Zwischenmasse erkennen lassen,
heißen Sphärolithfels. Lokal und genetisch sind
dieselben mit den Pechsteinen oder den Perlsteinen eng
verknüpft.
Sphärolithischer Aphanit, s. Blatterstein.
Sphärologie (griech.), Kugellehre, Lehre von der
Kugelgestalt der Weltkörper.
Sphärometer (griech., "Kugelmesser"), Instrument zur
Bestimmung der Gestalt der Linsengläser und zur Messung der
Dicke dünner Blättchen, welche die bekannten farbigen
Erscheinungen im polarisierten Licht zeigen, besteht nach der ihm
von Cauchoix gegebenen Einrichtung im wesentlichen aus einer mit
einem Dreifuß verbundenen Mikrometerschraube, deren
kreisförmiger Kopf eine Teilung besitzt.
Sphärometrie (griech.), Kugelmessung.
Sphäropleen, Ordnung der Algen (s. d., S. 343).
Sphärosiderit, s. Spateisenstein.
Sphen, s. Titanit.
Sphendone (griech.), Schleuder; auch eine in der Mitte
breite Haarbinde der griechischen Frauen, die dergestalt um den
Kopf gebunden wurde, daß das Haar ringsum in Ringeln
herabfiel.
Sphenoide, vierflächige Kristallgestalten, Hemieder
der quadratischen oder rhombischen Pyramide; vgl. Kristall, S.
232.
Sphenophyllum, s. Lykopodiaceen, S. 6.
Sphingidae (Schwärmer), Familie aus der Ordnung der
Schmetterlinge (s. d.).
Sphinkter (griech.), Schließmuskel (s. d.).
Sphinx, Schmetterlingsgattung aus der Familie der
Schwärmer (Sphingidae oder Crepuscularia), zu welcher der
Windig, Liguster-, Kiefernschwärmer u. a. gehören.
Sphinx, Name oft kolossaler Steinbilder, gewöhnlich
aus Granit oder Porphyr, auch Kalkstein, von Löwengestalt mit
Menschenkopf, liegend auf Postament, die Vorderbeine vorwärts
gestreckt, die Hinterbeine untergeschlagen. Diese phantastischen
Gebilde stammen aus dem Orient: aus Assyrien (Palast zu Nimrud und
Portal von Chorsabad) und insbesondere aus Ägypten. Hier
standen sie meist am Eingang des Tempels, doch auch einzeln. Die
ägyptischen Sphinxbilder sind immer männlichen
Geschlechts und dienen meist zur Darstellung eines Königs,
weshalb sie die Uräusschlange vor der Stirn tragen. Die
kolossalste ist die S. bei den Pyramiden von Gizeh, aus dem Felsen
gehauen, 55 m lang, an 20 m hoch, aus der ältesten Zeit der
ägyptischen Geschichte vor Cheops stammend (s. Tafel "Baukunst
III", Fig. 1). Diese merkwürdige Bildung entsprach demselben
Hang zum Mystizismus, der auch die Götterbilder mit
Tierköpfen versah. Auch bei den Sphinxen beschränkte man
sich nicht auf Mischung der Löwengestalt mit der menschlichen,
sondern setzte auch wohl Widder- (Kriosphinxe, s. Tafel
"Bildhauerkunst I", Fig. 2) und Sperberköpfe auf. Im
allgemeinen betrachtete man die Sphinxe als die mystischen
Hüter und Schutzgeister der Tempel und Totenwohnungen. Ganze
Alleen von riesigen Sphinxen führten oft zum Eingang des
Tempels. Mannigfaltiger nach Gestalt und Bedeutung erscheinen die
Sphinxe in Griechenland, wo sie immer als weibliche Gestalten
aufgefaßt werden. Ursprünglich ein geflügelter
Löwenkörper mit Kopf und Brust einer Jungfrau (s.
Abbildung), wurden sie später von Dichtern und Künstlern
in den abenteuerlichsten Gestalten dargestellt, z. B. als Jungfrau
mit Brust, Füßen und Krallen eines Löwen, mit
Schlangenschweif, Vogelflügeln, oder vorn Löwe, hinten
Mensch, mit Geierkrallen und Adlerflügeln, und zwar nicht
immer liegend, sondern auch in andern Stellungen. Berühmt ist
die thebaische S. im böotischen Mythus, Tochter des Typhon und
der Schlange Echidna, welche jedem, der ihr nahte, das Rätsel
aufgab: Welches Geschöpf geht am Morgen auf vier
Füßen, am Mittag auf zweien, am Abend auf dreien? Wer es
nicht lösen konnte, mußte sich vom Felsen in den Abgrund
stürzen. Ödipus deutete es richtig auf den Menschen,
worauf sich die S. vom Berg herabstürzte. Von der griechischen
Kunst aus der ägyptischen und orientalischen frühzeitig
übernommen und eigentümlich (immer weiblich) umgebildet,
galt hier die S. als Sinnbild des unerbittlichen Todesgeschicks und
ward daher auf Gräbern oft dargestellt (vgl. Bachofen,
Gräbersymbolik der Alten, Bas. 1859). Auch an altchristlichen
Kirchen kommen die Sphinxe manchmal vor. Wieder angewendet wurden
sie von der Spätrenaissance, insbesondere häufig aber von
der Barockkunst, die mit denselben Eingänge zu Palästen,
Gärten u. dgl. verzierte.
[Sphinx (Berliner Museum).]
136
Sphragid - Spiegel.
Sphragid, s. Bolus.
Sphragistik (griech.), Siegelkunde, s. Siegel.
Sphragmit, s. Grauwacke.
Sphygmograph (griech., "Pulsschreiber"), Instrument, mit
Hilfe dessen sich die Pulsbewegung bleibend in Gestalt einer Kurve
darstellen läßt, an welcher man alle
Eigentümlichkeiten der Pulsbewegung genau studieren kann. Bei
allen Sphygmographen setzt die abwechselnd sich ausdehnende und
kontrahierende Arterie ein kleines Plättchen in Bewegung,
welches wiederum aus einen langen Hebelarm wirkt. Dieser Hebelarm
schreibt die Bewegung der Arterienwand in vergrößertem
Maßstab auf einen Streifen Papier, welcher durch ein Uhrwerk
in gleichmäßige Bewegung versetzt und vor der Spitze des
Hebelarms vorbeigeführt wird. Auf dem Papier bilden sich die
Pulsbewegungen in Gestalt einer je nach der Art des untersuchten
Pulses mannigfach modifizierten Wellenlinie ab. Kennt man die
Geschwindigkeit, mit welcher das Papier an der Hebelspitze
vorübergeht, so kann man die Dauer einer Pulswelle berechnen;
außerdem kann man an der Kurve das allmähliche An- und
Absteigen der Pulswellen, ihre Aufeinanderfolge etc. genau
verfolgen. Für physiologische Forschungen ist der S. ein ganz
unentbehrliches Hilfsmittel. Vgl. Dudgeon, The s., its history and
use (Lond. 1882).
Sphygmophon (griech.), ein mit galvanischer Batterie und
Telephon verbundener federnder Stromunterbrecher welcher, auf die
Arterie gesetzt, den Pulsschlag u. seine Modifikationen laut
hörbar macht.
Sphyrna, Hammerfisch.
Spiauter (Spialter, holländ.), s. v. w. Zink.
Spica (lat.), Ähre, eine Form des Blütenstandes
(s. d.); spicatus, in eine Ähre zusammengestellt.
Spiccato (ital.), deutlich gesondert (musikal.
Vortragsbezeichnung).
Spicheren, s. Speichern.
Spicilegium (lat.), Ährenlese.
Spicknadel, eine Nadel mit zweimal gespaltenem Kopf,
dient zum Einziehen von Speckstreifen in Braten (Spicken).
Spicknarden, s. Valeriana.
Spicula (lat.), s. Ährchen.
Spiegel, Körper mit glatter Oberfläche, welche
zur Erzeugung von Spiegelbildern benutzt werden. Man unterscheidet
Planspiegel mit vollkommen ebener und Konvex- und Konkavspiegel mit
gekrümmter Spiegelfläche, wendet aber im
gewöhnlichen Leben meist Planspiegel an. Als solche benutzte
man im Altertum, zum Teil schon in vorgeschichtlicher Zeit, runde,
polierte, gestielte Metallscheiben aus Kupfer (Ägypter,
Juden), Bronze (Römer, besonders brundusische S.), Silber,
Gold (seit Pompejus, Gold auch schon bei Homer). Manche Legierungen
geben eine besonders stark spiegelnde Oberfläche und werden
deshalb als Spiegelmetall (s. d.) zusammengefaßt. Auch
Glasspiegel kamen früh in Gebrauch; man benutzte dazu
obsidianartige, dunkle, undurchsichtige Massen mit glatter,
polierter Oberfläche, welche in die Wand eingelassen wurden.
Vielleicht aber kannte man schon zur Zeit des Aristoteles
Glasspiegel, deren Rückseite mit Blei und Zinn belegt war.
Sichere Nachrichten über diese S. hat man indes erst aus dem
13. Jahrh. Man schnitt sie in Deutschland aus Glaskugeln, die
inwendig mit geschmolzener Bleiantimonlegierung überzogen
worden waren. Im 14. Jahrh. kamen die mit Blei-, dann mit
Zinnamalgam belegten ebenen S., wie wir sie jetzt benutzen, in
Gebrauch. Zur Darstellung derselben breitet man auf einer
horizontalen, ebenen Steinplatte ein Blatt kupferhaltige Zinnfolie
(Stanniol) aus, dessen Größe die des Spiegels etwas
übertrifft, übergießt es 2-3 mm hoch mit
Quecksilber, welches mit dem Zinn ein Amalgam bildet, schiebt die
polierte und sorgfältig gereinigte Glasplatte so über die
Zinnfolie, daß ihr Rand stets in das Quecksilber taucht,
beschwert sie dann mit Gewichten, gibt der Steinplatte eine ganz
geringe Neigung, damit das überschüssige Quecksilber
abfließt, und legt den S. nach 24 Stunden mit der
Amalgamseite nach oben auf ein Gerüst, welches man
allmählich mehr und mehr neigt, bis der S. schließlich
senkrecht steht. Nach 8-20 Tagen ist er verwendbar. 50 qdcm
erfordern 2-2,5 g Amalgam, welches aus etwa 78 Zinn und 22
Quecksilber besteht. In neuerer Zeit benutzt man vielfach
Silberspiegel, d. h. auf der Rückseite versilbertes
Spiegelglas, wie es zuerst von Drayton 1843 vorgeschlagen wurde.
Zur Versilberung sind viele Vorschriften gegeben worden; doch
beruhen alle darauf, daß man eine Silberlösung mit einem
reduzierend wirkenden Körper vermischt und mit der zu
versilbernden Glasfläche in Berührung bringt. Das Silber
schlägt sich dann auf das Glas nieder und wird zum Schutz mit
einem Anstrich aus Leinölfirnis und Mennige überzogen,
auch wohl zunächst galvanisch verkupfert. Bei Herstellung
größerer S. gießt man die
Versilberungsflüssigkeit auf die Glasplatte, welche auf einem
gußeisernen Kasten liegt, der mit Wasser gefüllt ist und
eine Dampfschlange enthält, um die Platte erwärmen zu
können. Kleinere Platten stellt man je zwei mit dem
Rücken aneinander reihenweise in die
Versilberungsflüssigkeit. Auf 1 qm Glas kann man 29-30 g
Silber ablagern. Diese Silberspiegel, deren Fabrikation erst seit
1855 durch Petitjean und Liebig, welche zweckmäßige
Versilberungsflüssigkeiten angaben, praktische Bedeutung
gewann, sind billiger als die belegten; größere aber
sind schwer herzustellen, und über die längere
Haltbarkeit fehlen noch Erfahrungen. Man hat auch Platinspiegel
hergestellt, für welche man nur auf einer Seite geschliffenen
Glases bedarf. Man trägt die Mischung von Platinchlorid mit
Lavendelöl, Bleiglätte und borsaurem Bleioxyd auf das
Glas auf und brennt das ausgeschiedene Metall ein. Da das Platin an
der Luft nicht anläuft, so halten sich diese S. sehr gut, und
der Metallüberzug ist so dünn, daß das Glas
durchsichtig bleibt. Über Herstellung etc. des Spiegelglases
s. Glas, S.322. Vgl. Benrath, Glasfabrikation (Braunschw. 1875);
Cremer, Fabrikation der Silber- und Quecksilberspiegel (Wien 1887).
- Die für die Toilette der Frauen bestimmten Handspiegel des
Altertums wurden am Griff und auf der Rückseite der Scheibe
künstlerisch verziert, auf letzterer bei den Griechen,
Römern etc. meist mit eingravierten mythologischen u.
genrehaften Darstellungen geschmückt (Fig. 1-3). Antike S.
sind
[Fig. 1-3. Römische Handspiegel.]
137
Spiegel - Spiegelinstrumente.
zahlreich in den verschütteten Vesuvstädten und in den
Gräbern gefunden worden. Eine Spezialität bilden die
etruskischen S., welche ebenfalls mit Darstellungen aus dem
etruskischen Götterkreis und mit Inschriften versehen sind
(Fig. 4). Sie wurden von E. Gerhard ("Die etruskischen S.", Berl.
1843-68, 4 Bde.; fortgesetzt von Klügmann und Körte 1884
ff.)beschrieben. Die antike Grundform des Handspiegels erhielt sich
das ganze Mittelalter und die Folgezeit hindurch bis jetzt. Nur
wurde die Spiegelfläche nicht bloß oval, sondern auch
rund, viereckig und vielseitig gestaltet, von einem mehr oder
minder reichverzierten Rahmen eingefaßt und in der
Rückseite mit Schnitzwerk, Reliefarbeit etc. geschmückt.
Die Einfassung des Handspiegels, dessen Spiegelfläche anfangs
noch meist aus Metall, dann aus Glas bestand, wurde in Holz,
Elfenbein, Metall und andern Materialien ausgeführt. Zur
Renaissancezeit trugen die Damen Handspiegel am Gürtel. Im
Mittelalter kamen auch Taschenspiegel und S. zum Aufhängen an
Wänden auf, die seit dem 16. Jahrh. immer größer
wurden und sich nach der Erfindung des Spiegelglases (1688) zu den
von der Decke bis zum Fußboden reichenden Trümeaus
entwickelten. Im Mittelalter waren Venedig und Murano die
Hauptsitze der Spiegelfabrikation, welche die ganze kultivierte
Welt mit venezianischen Spiegeln versorgten. Die Einrahmung der
Wandspiegel, welche anfangs durch gekehlte Leisten, später
durch reich ornamentiertes Schnitzwerk erfolgte, wurde ein
besonderer Zweig der Möbeltischlerei. Doch wurden früher
und werden gegenwärtig noch in Venedig und Murano Wandspiegel
mit Rahmen aus geschliffenem und geblasenem Glas angefertigt.
Solche Rahmen werden häufig aus naturalistischen farbigen
Blumen (Rosen u. dgl.) und Rankenwerk gebildet.
In übertragenem Sinn bezeichnet S. überhaupt jede
glatte, glänzende Fläche (z. B. Eis-, Wasserspiegel);
sodann in der Weidmannssprache den hellen Fleck um das Weidloch der
Hirsche und Rehe, auch den weißen oder metallglänzenden
Fleck auf den Flügeln der Enten sowie den weißen
Schulterfleck des Auer- und Birkwildes; ferner einen Teil der
Hinterseite des Schiffs (s. Heck); in der Struktur des Holzes die
Markstrahlen (s. Holz, S. 669) etc. Da endlich der S. als Symbol
der Selbstprüfung und des Gewissens, als Emblem der Wahrheit
dient, so ist das Wort auch häufig als Titel für
belehrende Schriften, besonders moralischen, pädagogischen und
politischen Inhalts, worin Musterbilder zur Nacheiferung
aufgestellt werden, verwendet worden, z. B. Fürstenspiegel,
Jugendspiegel, Ritterspiegel, Laienspiegel, die Gesetzsammlungen
Sachsenspiegel und Schwabenspiegel etc.
[Fig.4. Etruskischer (sogen. Semele-) Spiegel]
Spiegel, medizinisches Instrument, s. Speculum.
Spiegel, Friedrich (von), namhafter Orientalist, der
bedeutendste Kenner des Zendavesta, geb. 11. Juli 1820 zu
Kitzingen, widmete sich in Erlangen, Leipzig und Bonn
orientalischen Sprachstudien, durchforschte 1842-47 die
Bibliotheken zu Kopenhagen, London und Oxford und ist seit 1849
Professor der orientalischen Sprachen an der Universität
Erlangen. Nachdem er durch seine Ausgaben des "Kammavâkya"
(Bonn 1841) und der "Anecdota palica" (Leipz. 1845) dem Studium der
damals noch wenig bekannten Pâlisprache und des
südlichen Buddhismus einen wesentlichen Dienst geleistet
hatte, konzentrierte er seine Forschungen auf die iranischen
Sprachen und die Zoroastrische Religion und lieferte namentlich
eine kritische Ausgabe der wichtigsten Teile des Zendavesta samt
der alten Pehlewiübersetzung derselben und eine
vollständige Verdeutschung, die erste wissenschaftliche
Übertragung dieses wichtigen Religionsbuchs (Leipz. 1852-63, 3
Bde.), der er einen "Kommentar über das Avesta" (das. 1865-69,
2 Bde.) und eine "Grammatik der altbaltrischen Sprache" (das. 1867)
folgen ließ. Außerdem veröffentlichte er eine
"Chrestomathia persica" (Leipz. 1845), die erste "Grammatik der
Pârsisprache" (das. 1851), eine "Einleitung in die
traditionellen Schriften der Parsen" (das. 1856-60, 2 Bde.), "Die
altpersischen Keilinschriften im Grundtext, mit Übersetzung,
Grammatik und Glossar" (das. 1862, 2. Aufl. 1881), "Erân, das
Land zwischen dem Indus und Tigris" (Berl. 1863), "Arische Studien"
(Leipz. 1873). Gewissermaßen das Fazit all seiner Forschungen
zieht er in seiner "Erânischen Altertumskunde" (Leipz.
1871-78, 3 Bde.), welcher die "Vergleichende Grammatik der
alterânischen Sprachen" (das. 1882) und das Werk "Die arische
Periode und ihre Zustände" (das. 1887) folgten. Zahlreiche
kleinere Arbeiten, z. B. über die iranische Stammverfassung,
über das Leben Zoroasters u. a., veröffentlichte er in
den Abhandlungen der königl. bayrischen Akademie, in den
"Beiträgen zur vergleichenden Sprachforschung", in der
"Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft" und
andern Zeitschriften.
Spiegelberg, Otto, Mediziner, geb. 9. Jan. 1830 zu Peine
in Hannover, studierte am Collegium Carolinum zu Braunschweig, dann
in Göttingen, habilitierte sich 1853 daselbst als Privatdozent
und ging dann auf eine längere Studienreise nach England. 1861
folgte er einem Ruf als Professor der Geburtshilfe und
Gynäkologie nach Freiburg, 1864 nach Königsberg und 1865
nach Breslau, wo er 10. Aug. 1881 starb. Er begründete mit
Credé das "Archiv für Gynäkologie" und schrieb ein
großes "Lehrbuch der Geburtshilfe" (2. Aufl., Lahr 1880).
Spiegelbergs Verdienste bestehen in der Einführung der
Errungenschaften der neuern Gynäkologie in die Praxis, in der
sichern Diagnostik, in der präzisen Indikationenstellung und
der Anbahnung radikaler operativer Heilung von bis dahin für
schwer oder nicht heilbar erachteten Krankheiten, wodurch er die
Gynäkologie zur erfolgreichen Nebenbuhlerin der Chirurgie
erhob.
Spiegelfasern, s.v.w. Markstrahlen, s. Holz, S. 669.
Spiegelgranaten, kleinere Granaten, welche in
größerer Zahl mit Einem Wurf aus großen
Mörsern geworfen wurden.
Spiegelinstrumente, Vorrichtungen zum Messen von Winkeln
mit gewöhnlich zwei Spiegeln, von denen der eine nur halbhoch
(zum Durchsehen, Okularspiegel), der andre in ganzer Fläche
(Objektivspiegel) mit Amalgam belegt ist. Entweder stehen beide
fest einander schräg gegenüber auf der hohen Kante, oder
der eine ist drehbar. Der vom Beobach-
138
Spiegelkreis - Spiegelung.
tungsobjekt B ausgehende Strahl trifft den Objektivspiegel, wird
von ihm in den Okularspiegel und von diesem in das dem
Okularspiegel gegenübergestellte Beobachterauge O gelenkt. Bei
parallelen Spiegelflächen sind Eingangsstrahl (in den
Objektivspiegel) und Ausgangsstrahl (aus dem Okularspiegel ins
Auge) ebenfalls parallel, der Winkel beider Strahlen gleich Null,
d. h. man sieht durch den Glasteil des Okularspiegels das Objekt B
im Original und darunter im Spiegelteil desselben Spiegels dasselbe
Objekt im Bild. Sind die Spiegelflächen divergierend gestellt,
so bilden Ein- und Ausgangsstrahl einen doppelt so großen
Winkel als die beiden Spiegel. Man kann, auf diesem Satz
fußend, also den Winkel AOB messen, welchen die Sehstrahlen
des Auges O direkt über den Okularspiegel nach einem Objekt A
mit dem eingespiegelten Objekt B bilden (wobei das Instrument
selbst im Vergleich zu der Länge der Absehlinien im Feld als
unendlich klein, gleich einem Punkt O gedacht werden kann, d. h.
die Parallaxe des Instruments fällt weg). Es kommt also darauf
an, den Divergenzwinkel beider Spiegel oder, wenn einer davon
feststeht, den Achsendrehungswinkel des andern zu kennen; dies
geschieht mittels eines an der Achse befestigten Radius (Alhidade),
der an einem Gradbogen der Grundfläche des Instruments entlang
geführt wird.
1) Unvollkommene S. Beide Spiegel stehen in Kapsel fest, so
daß ? AOB nur = 1 Rechten ist, so haben wir den a)
einfachen Winkelspiegel oder Spiegelwinkel; zum Absehen und
Abstecken rechter Winkel (z. B. Ordinatenabsteckung von einer
Grundlinie aus); b) Spiegelrichtmaß (équerre à
miroir): Mehrere Spiegel sind so vereinigt, daß man 15°,
30, 45, 60, 90° absehen kann. Das Instrument muß dicht
ans Auge gehalten werden, ohne es zu drehen, und ist zu beobachten,
ob die Objektpunkte A und B genau im Okularspiegel senkrecht
untereinander erscheinen A (Original)/B (im Spiegelbild). [A
über B]
2) Vollkommene S. a) Ist der auf dem "Körper" angebrachte
Gradbogen ein Sechstelkreis, so haben wir den Spiegelsextanten (s.
d.), analog den Spiegelquadranten, -Oktanten, und bei Vollkreisen
den Spiegelkreis. b) Ist mit der die Objektivspiegeldrehung
anzeigenden Alhidade mittels mechanischer Konstruktion ein Lineal
so verbunden, daß man im stande ist, unmittelbar nach der
Messung mit dem so geöffneten Instrument den gemessenen Winkel
auch graphisch aufzutragen, so haben wir den Reflektor;
verschiedene Konstruktionen sind: der Douglassche, besser der
Hornersche Reflektor, doch beide nur zum Krokieren geeignet. c) Ist
nur für graphische Auftragung gesorgt, während der
Gradbogen zum Ablesen wegfällt, so erscheint der graphische
Spiegelwinkel. Sollen mit diesen Instrumenten nicht nur
Horizontalwinkel, sondern auch Vertikalwinkel gemessen werden, so
muß die eine Absehlinie entweder in eine natürliche
Horizontfläche (Wasserspiegel) gelegt, oder ein
künstlicher Horizont (Quecksilber) zur Kontrolle des
wagerechten Winkelschenkels geschafft werden (z. B. bei den
Polhöhemessungen, zur Ermittelung der geographischen Breite,
oder bei Höhenmessungen). Vielfache Mängel der Spiegel
haben dazu geführt, auch gut geschliffene Glasprismen, welche
eine totale Reflexion hervorbringen, statt der Spiegel zu verwenden
(Prismeninstrumente). Dazu gehören: der Prismenkreis von
Pistor, der jetzt viel statt des Sextanten verwendet wird, das
Winkelprisma von Ertel, das Prismenkreuz von Bauernfeind.
Spiegelkreis, s. Prismenkreis und Spiegelinstrumente.
Spiegelmetall, Kupferzinnlegierungen (Bronze), welche
sich durch weiße Farbe, Härte und höchste
Politurfähigkeit auszeichnen. Ein altrömisches S.
enthielt 71-72 Kupfer, 18-19 Zinn, 4-4,5 Antimon und Blei, ein
chinesischer Metallspiegel 80,8 Kupfer, 9,1 Blei, 8,4 Antimon. Ein
S. von unübertrefflich weißer Farbe erhält man aus
gleichen Teilen Platin und Stahl, ein andres platinhaltiges S.
besteht aus 350 Kupfer, 165 Zinn, 20 Zink, 10 Arsen, 60 Platin.
Vgl. Bronze, S. 460.
Spiegelrichtmaß, s. Spiegelinstrumente.
Spiegelrinde, Eichenrinde, die noch nicht mit Borke
bedeckt ist.
Spiegelsextant, Instrument zu Höhen- und
Distanzmessungen, besteht aus einem Kreissektor von etwas über
60°, um dessen Mittelpunkt sich eine Alhidade dreht. Diese
trägt an dem einen Ende über dem Mittelpunkt des
Kreissektors einen Spiegel, welcher senkrecht auf der Ebene des
Sektors steht. Ein andrer, kleinerer Spiegel steht gleichfalls
senkrecht auf der Ebene des Sektors und ist zugleich so an dem
Sextanten befestigt, daß er mit dem großen Spiegel
parallel steht, wenn die Alhidade auf den Nullpunkt der Teilung
weist. Die obere Hälfte des letztern Spiegels ist nicht mit
Amalgam belegt, so daß ein Lichtstrahl von einem entfernten
Objekt durch den Spiegel unmittelbar in das Auge des Beobachters
oder in das gewöhnlich dabei angebrachte kleine Fernrohr,
statt dessen für nahe Gegenstände eine bloße
Röhre ohne Gläser gebraucht wird, gelangt. Will man den
Winkelabstand zweier Objekte messen, so visiert man mit dem
Fernrohr durch den zweiten Spiegel nach dem einen Objekt und bringt
durch Drehung der Alhidade das Spiegelbild des andern Objekts in
dem ersten Spiegel auf den zweiten, bis beide Objekte in derselben
Richtung stehen. Sobald sie sich im Fernrohr decken, ist der
Winkel, welchen beide Spiegel miteinander machen, oder der Bogen,
welchen die Alhidade durchlaufen hat, gleich der Hälfte des
gesuchten Winkels, den beide Gegenstände im Auge des
Beobachters machen. Der Bequemlichkeit halber ist aber der Umfang
des Spiegelsextanten in halbe Grade geteilt, welche für ganze
Grade gerechnet werden. Die erste Idee zu diesem dem Seefahrer
unentbehrlichen Instrument verdankt man Newton; Hadley aber brachte
den ersten Spiegelsextanten wirklich zu stande, daher er auch als
dessen Erfinder gilt. Praktisch ist der durch Breithaupt
verbesserte englische Dosensextant. Eine Verbesserung des
Spiegelsextanten ist der Reflexionskreis, welcher statt des
Kreissektors einen ganzen Kreis von 15-25 cm Durchmesser und statt
des zweiten Spiegels ein Prisma enthält. Bei Steinheils
Prismenkreis sind beide Spiegel durch Prismen ersetzt. Auf
demselben Prinzip beruhen der veraltende katoptrische Zirkel und
die Reflektoren (s. Spiegelinstrumente).
Spiegelteleskop, s. v. w. katoptrisches Fernrohr. s.
Fernrohr, S. 151.
Spiegelung, regelmäßige Zurückwerfung
(Reflexion) des Lichts. Fällt ein Lichtstrahl fn (Fig. 1) auf
einen Spiegel s s' (so nennt man jede glatte Fläche), so wird
ein Teil desselben in ganz bestimmter Richtung n d von der
Fläche in den vor ihr befindlichen Raum zurückgeworfen.
Um die Richtungen des einfallenden (fn) und des
zurückgeworfenen Strahls (nd) bequem zu bezeichnen, denkt man
sich auf der spiegelnden Fläche in dem Punkt n, wo der
einfallende Strahl dieselbe trifft, eine Senkrechte, das
Einfallslot, errichtet. Die durch den einfallenden Strahl und das
Einfallslot gelegte Ebene (die Ebene der
139
Spiegelung.
Zeichnung), welche senkrecht steht auf der spiegelnden
Fläche, heißt die Einfallsebene; sie wird, weil sie
stets auch den zurückgeworfenen Strahl enthält, auch
Zurückwerfungs- oder Reflexionsebene genannt. Die Richtungen
des einfallenden und des zurückgeworfenen Strahles werden
bestimmt durch den Einfallswinkel (Inzidenzwinkel) i und den
Zurückwerfungswinkel (Reflexionswinkel) r, welche jeder dieser
Strahlen mit dem Einfallslot bildet. Der Zurückwerfungswinkel
ist stets dem Einfallswinkel gleich. Ein auf einen Spiegel
senkrecht auffallender Strahl (p n) wird in sich selbst (nach n p)
zurückgeworfen.
Aus diesem Gesetz folgt unmittelbar, daß alle Strahlen
(lr, lr'... Fig. 2), welche, von einem hellen Punkt l ausgehend,
auf einen ebenen Spiegel (Planspiegel) treffen, von demselben so
zurückgeworfen werden (rs, r's'...), als kämen sie von
einem Punkt l', welcher auf der von dem Lichtpunkt aus auf den
Spiegel gezogenen Senkrechten lpl' ebenso weit hinter der
spiegelnden Ebene liegt, wie der Lichtpunkt l vor derselben. Ein
Auge, das sich vor dem Spiegel (z. B. in s'') befindet,
empfängt daher die zurückgeworfenen Strahlen gerade so,
als ob der Punkt l', von dem sie auszugehen scheinen, selbst ein
heller Punkt wäre; es sieht in (d. h. hinter) dem Spiegel in
der Richtung s''l' den Punkt l' als Bild des vor dem Spiegel
befindlichen Punktes l. Jedem Punkt eines leuchtenden oder
beleuchteten Gegenstandes entspricht in derselben Weise ein
Bildpunkt hinter dem Spiegel, und aus der Gesamtheit aller
Bildpunkte entsteht das Spiegelbild des Gegenstandes, welches
diesen mit einer Treue nachahmt, die sprichwörtlich geworden
ist. Um dieses Bild im Geist (oder in einer Zeichnung) zu
entwerfen, denke man sich von jedem Punkte des Gegenstandes eine
Senkrechte auf die Spiegelebene gezogen und hinter derselben um
ebensoviel verlängert, als jener Punkt vor ihr liegt. Wir
sehen daher, wenn wir in einen Spiegel blicken, unser eignes Bild,
getreu in Größe, Gestalt und Farbe, ebenso weit hinter
dem Spiegel, als wir selbst vor demselben stehen; aber völlig
gleich ist das Spiegelbild seinem Original doch nicht; denn
könnten wir die Person, welche aus dem Spiegel herausschaut,
hinter demselben hervortreten lassen, so würden wir bemerken,
daß sie unsre rechte Hand an ihrer linken Seite hat, und
daß überhaupt unsre rechte Seite ihre linke Seite ist,
und umgekehrt. Ebenso werden die Buchstaben in dem Spiegelbild
eines Buches von rechts nach links gehen und nicht von links nach
rechts wie in dem Buch selbst.
Da die zurückgeworfenen Strahlen von dem Bild hinter einem
Spiegel gerade so ausgehen wie von einem wirklich dort befindlichen
Gegenstand, so kann jedes Spiegelbild einem zweiten Spiegel
gegenüber wieder die Rolle eines Gegenstandes spielen; bei
Anwendung zweier Spiegel, deren spiegelnde Flächen einander
zugewendet sind, entstehen daher außer den beiden
unmittelbaren Spiegelbildern (erster Ordnung) noch solche zweiter,
dritter und höherer Ordnung, welche aber wegen der
Lichtverluste bei den wiederholten Zurückwerfungen immer
lichtschwächer werden. Bringt man z. B. eine brennende Kerze
zwischen zwei einander parallel gegenüberhängende
Spiegel, so erblickt man in jedem eine unabsehbare Reihe von
Kerzenflammen, welche sich in unendlicher Ferne zu verlieren
scheint. Die Zahl der Bilder wird eine begrenzte, wenn die beiden
Spiegel einen Winkel miteinander bilden (Winkelspiegel, Fig. 3).
Die Spiegel MO und RN liefern von dem zwischen ihnen befindlichen
Gegenstand A die Bilder erster Ordnung B und B1. Indem das Bild B
hinter dem ersten Spiegel seine Strahlen dem zweiten Spiegel
zusendet, entwirft dieser ein Bild zweiter Ordnung C1 und ebenso
der erste Spiegel ein Bild C des Bildes B1. Damit ist aber für
den in der Zeichnung angenommenen Winkel von 72° die Anzahl der
Bilder erschöpft. Ein zwischen die Spiegel blickendes Auge O
sieht die Bilder nebst dem Gegenstand auf einem um den
Kreuzungspunkt der beiden Spiegel beschriebenen Kreis
regelmäßig angeordnet, und zwar trifft auf jeden
Winkelraum, welcher dem Winkel der beiden Spiegel gleich ist, je
ein Bild. Das Auge O sieht daher den Gegenstand so vielmal, als
dieser Winkel in dem ganzen Umfang enthalten ist. Auf die
regelmäßige Anordnung der Bilder der Winkelspiegel
gründet sich die anmutige Wirkung des Kaleidoskops (s.
d.).
Eine kugelförmig gekrümmte Schale, welche auf ihrer
Innenseite glatt poliert ist, bildet einen Hohlspiegel
(Konkavspiegel). Der Mittelpunkt der Hohlkugel, von welcher die
Schale ein Abschnitt ist, heißt der Krümmungsmittelpunkt
oder geometrische Mittelpunkt und jede durch ihn gezogene gerade
Linie eine Achse desselben; unter ihnen wird diejenige, welche die
Schale in ihrem mittelsten tiefsten Punkte (dem optischen
Mittelpunkt des Spiegels) trifft, als Hauptachse bezeichnet. Jeder
längs einer Achse sich fortpflanzende Strahl (Achsenstrahl)
trifft senkrecht auf den Spiegel und wird daher in sich selbst
zurückgeworfen. Läßt man ein Bündel paralleler
Sonnenstrahlen (Fig. 4) auf einen Hohlspiegel fallen, so werden
dieselben in Form eines Lichtkegels zurück-
[Fig. 1. Zurückwerfung des Lichts.]
[Fig. 2. Entstehung des Bildpunktes bei einem ebenen
Spiegel.]
[Fig. 3. Winkelspiegel.]
140
Spiegelung.
geworfen, dessen Spitze F vor dem Spiegel auf der mit den
einfallenden Strahlen parallelen Achse liegt. Dieser Punkt F, durch
welchen sämtliche auf den Spiegel parallel mit der Achse
treffende Strahlen hindurchgehen, heißt der zu dieser Achse
gehörige Brennpunkt. Auf einem Papierblättchen, welches
man an seine Stelle bringt, erscheint er als weißer Fleck von
blendender Helligkeit, bis das Papier unter der kräftigen
Wärmewirknng der vereinigten Strahlen Feuer fängt und
dadurch zeigt, daß der Name "Brennpunkt" ein wohlverdienter
ist. Wegen dieser Wirkung nennt man den Hohlspiegel auch
Brennspiegel. Der Brennpunkt liegt auf jeder Achse gerade in der
Mitte zwischen dem Spiegel und dessen Krümmungsmittelpunkt,
oder die Brennweite ist die Hälfte des Kugelhalbmessers.
Jeder Strahl, welcher nicht durch den Kugelmittelpunkt (C, Fig.
4) geht, trifft schräg auf die Spiegelfläche und wird so
zurückgeworfen, daß er mit dem an seinem Einfallspunkt
auf der Spiegelfläche errichteten Einfallslot beiderseits
gleiche Winkel bildet. Das Einfallslot ist aber jedesmal der vom
Krümmungsmittelpunkt zum Einfallspunkt gezogene
Kugelhalbmesser. Man bemerkt nun leicht, daß die
Kugelhalbmesser, d. h. die Einfallslote, in demselben Maße
stärker zur Achse geneigt sind, als die Punkte des Spiegels,
zu denen sie gehören, weiter von der Achse abstehen. Deshalb
muß auch jeder mit der Achse parallele Strahl in dem
Maße stärker gegen die Achse zu aus seiner
ursprünglichen Richtung abgelenkt werden, als er weiter
entfernt von der Achse auf den Spiegel trifft. Aus diesem
Verhalten, welches die Fig. 4 deutlich wahrnehmen läßt,
erklärt es sich, warum sämtliche auf den Hohlspiegel
parallel zur Achse treffende Strahlen nach der Zurückwerfung
durch einen und denselben Punkt gehen müssen. Befindet sich im
Brennpunkt F eine Lichtquelle, so werden ihre auf den Spiegel
treffenden Strahlen, indem sie dieselben Wege in entgegengesetzter
Richtung einschlagen, parallel zu der Achse zurückgeworfen.
Fällt von einem Lichtpunkt a (Fig. 5), der zwischem dem
Brennpunkt F und dem Kugelmittelpunkt C liegt, ein
Strahlenbüschel auf den Spiegel, so treffen die einzelnen
Strahlen jetzt minder schräg auf den Spiegel, als wenn sie aus
dem Brennpunkt kämen, und werden daher auch weniger stark von
der Achse weggelenkt; sie laufen daher nach der Zurückwerfung
nicht mit der Achse parallel, sondern schneiden sie jenseit des
Mittelpunktes C und zwar, da ihre Ablenkung um so größer
ist, je weiter der getroffene Spiegelpunkt von der Achse absteht,
in einem einzigen Punkt A, welchen man das Bild des Punktes a
nennt. Bringt man nach A einen Lichtpunkt, so müssen seine
Strahlen, indem sie sich auf denselben Bahnen in entgegengesetzter
Richtung bewegen, im Punkt a zusammentreffen. Die Punkte a und A
gehören also in der Weise zusammen, daß jeder das Bild
des andern ist, und heißen deshalb zusammengehörige oder
konjugierte Punkte. Ist ein Lichtpunkt (A, Fig. 6) um weniger als
die Brennweite F vom Spiegel entfernt, so vermag dieser die zu
stark auseinander fahrenden Strahlen nicht mehr in einem vor dem
Spiegel gelegenen Punkt zu vereinigen, sondern die
zurückgeworfenen Strahlen gehen jetzt auseinander, jedoch so,
als ob sie von einem hinter dem Spiegel gelegenen Punkt a
ausgingen. Da umgekehrt Strahlen, welche nach dem hinter dem
Spiegel gelegenen Punkt a hinzielen, im Punkt A vor dem Spiegel
vereinigt werden, so sind auch in diesem Fall die Punkte A und a
als zusammengehörige (konjugierte) zu betrachten.
Da jedem Punkt eines leuchtenden oder beleuchteten Gegenstandes,
der sich vor einem Hohlspiegel befindet, ein auf der
zugehörigen Achse gelegener Bildpunkt entspricht, so entsteht
aus der Gruppierung sämtlicher Bildpunkte ein Bild des
Gegenstandes. Befindet sich z. B. ein Gegenstand A B (Fig. 7)
zwischen dem Brennpunkt F und dem Krümmungsmittelpunkt C, so
liegt das Bild des Punktes B auf der Achse B C in b, dasjenige des
Punktes A auf der Achse A C in a u.s.f. Es entsteht daher jenseit C
ein umgekehrtes vergrößertes Bild a b. Wäre a b ein
Gegenstand, welcher um mehr als die doppelte Brennweite vom Spiegel
entfernt ist, so würde derselbe ein umgekehrtes verkleinertes
Bild in A B zwischen dem Brennpunkt F u. dem Kugelmittelpunkt C
liefern. Man erkennt aus der Zeichnung, daß Bild u.
Gegenstand einander ähnlich sind, u. daß ihre
Größen sich zu einander verhalten wie ihre Abstände
vom Spiegel. Je weiter sich der Gegenstand vom Spiegel entfernt,
desto näher rückt sein Bild dem Brennpunkt. Das Bild
eines unermeßlich weit entfernten Gegenstandes, z. B. eines
Gestirns, entsteht im Brennpunkt selbst. Der helle Fleck im
Brennpunkt eines Hohlspiegels, auf den man die Sonnenstrahlen
fallen läßt (s. oben), ist eigentlich nichts andres als
ein kleines Bild der Sonne.
Diese Bilder unterscheiden sich nun sehr wesentlich von den
Bildern, welche die ebenen Spiegel liefern. Sie entstehen
nämlich dadurch, daß die von einem jeden Punkte des
Gegenstandes ausgehenden Strahlen in einem Punkt vor dem Spiegel
wirklich vereinigt oder gesammelt werden; ein solches Bild kann
daher auf einem Schirm aufgefangen werden und erscheint auf
demselben, nach allen Seiten hin sichtbar, wie ein in den zartesten
Farben ausgeführtes Gemälde. Bilder dieser Art nennt man
deswegen
[Fig. 4. Brennpunkt eines Hohlspiegels.]
[Fig. 5. Reeller Bildpunkt.]
[Fig. 6. Virtueller Bildpunkt.]
[Fig. 7. Entstehung eines reellen Bildes bei einem
Hohlspiegel.]
141
Spiegelversicherung - Spiel.
wirkliche (reelle) oder Sammelbilder. Die Bilder der ebenen
Spiegel dagegen entstehen durch Strahlen, welche vor dem Spiegel
auseinander gehen und sich zerstreuen, indem sie von hinter der
Spiegelfläche liegenden Punkten auszugehen scheinen, und
werden nur gesehen, wenn diese Strahlen unmittelbar in das Auge
dringen. Sie werden daher scheinbare (virtuelle) oder
Zerstreuungsbilder genannt. Auch die reellen Bilder der
Sammelspiegel (so nennt man häufig die Hohlspiegel)
können ohne Auffangsschirm unmittelbar wahrgenommen werden,
wenn man das Auge in den Weg der Strahlen bringt, welche nach der
Vereinigung von den Punkten des Bildes aus wieder auseinander
gehen. Das Bild scheint alsdann vor dem Spiegel in der Lust zu
schweben.
Sammelbilder liefert ein Hohlspiegel nur von Gegenständen,
welche um mehr als die Brennweite von ihm abstehen. Von einem dem
Spiegel nähern Gegenstand (A B, Fig. 8) kann derselbe, weil
die von jedem Punkt kommenden Lichtstrahlen nach der
Zurückwerfung auseinander gehen, nur noch ein scheinbares Bild
(a b) entwerfen, welches einem in den Spiegel blickenden Auge
aufrecht hinter der Spiegelfläche und größer als
der Gegenstand erscheint. Die Figur zeigt den Gang der
Lichtstrahlen im gegenwärtigen Fall. Wegen dieser
vergrößernden Wirkung werden die Hohlspiegel auch
Vergrößerungsspiegel genannt und zu Zwecken der Toilette
(als Rasierspiegel) verwendet.
Jede auf der äußern gewölbten Seite polierte
Kugelfläche bildet einen Konvexspiegel oder
Zerstreuungsspiegel. Da ein solcher die von einem Punkt (B, Fig. 9)
ausgehenden Strahlen stets so zurückwirft, daß sie von
einem hinter dem Spiegel liegenden Punkt b noch stärker als
vorher auseinander gehen, so kann derselbe von einem Gegenstand A B
nur ein scheinbares oder Zerstreuungsbild a b liefern, welches
hinter dem Spiegel in aufrechter Stellung gesehen wird. Da das Bild
stets kleiner ist als der Gegenstand, so nennt man die
Konvexspiegel auch Verkleinerungsspiegel und verwendet sie ihrer
niedlichen Bilder wegen als Taschentoilettenspiegel. - Bezeichnet a
die Entfernung des Lichtpunktes, b diejenige des Bildpunktes von
einem Konkav- oder Konvexspiegel und f seine Brennweite, so gilt
die Gleichung: 1/a + 1/b = 1/f. Hieraus ergibt sich, wenn der
Bildpunkt virtuell ist, die Größe b negativ; für
Konvexspiegel ist die Brennweite f negativ zu nehmen, für
Hohlspiegel positiv. Alles von den kugelförmig gekrümmten
oder sphärischen Spiegeln bisher Gesagte gilt jedoch nur, wenn
ihre Öffnung klein ist. Bei Hohlspiegeln von
größerer Öffnung werden z. B. die parallel zur
Achse in der Nähe des Randes auffallenden Strahlen nach einem
Punkte der Achse gelenkt, welcher dem Spiegel näher liegt als
der für die näher der Mitte auffallenden Strahlen
gültige Brennpunkt, ein Fehler, der dadurch vermieden werden
kann, daß man dem Spiegel eine parabolische Gestalt gibt. Man
nennt daher diesen Fehler die "Abweichung wegen der Kugelgestalt"
oder die sphärische Aberration. Die Lehre von der S.
(Reflexion oder regelmäßigen Zurückwerfung) des
Lichts wird Katoptrik genannt. Über Brennlinie s. d. Über
die Erklärung der S. aus der Wellenbewegung s. d.
[Fig. 8. Entstehung eines virtuellen Bildes bei einem
Hohlspiegel.]
[Fig. 9. Konvexspiegel.]
Spiegelversicheruug, s. Glasversicherung.
Spiegelversuch, s. Fresnels Spiegelversuch.
Spiegelwinkel, s. Spiegelinstrumente.
Spiek, Pflanze, s. Spik.
Spiekeroog, Insel in der Nordsee, an der Küste von
Ostfriesland, zum preuß. Regierungsbezirk Aurich, Kreis
Wittmund gehörig, 14 qkm groß, hat hohe Dünen,
Viehzucht, Seehundsfang, Fischerei, ein aufblühendes Seebad
und (1885) 243 evang. Einwohner. Vgl. Nellner, Die Nordseeinsel S.
(Emden 1884).
Spiel, eine Beschäftigung, die um der in ihr selbst
liegenden Zerstreuung, Erheiterung oder Anregung willen, meist mit
andern in Gemeinschaft, vorgenommen wird. Man teilt die Spiele am
besten ein in Bewegungsspiele, zu denen unter andern die Ball-,
Kugel-, Kegel- und Fangspiele gehören, und in Ruhespiele, die
solche zur Schärfung der Beobachtung und der Aufmerksamkeit,
zur Betätigung von Witz und Geistesgegenwart, also die meisten
unsrer sogen. Gesellschaftsspiele, dazu Karten-, Brettspiele, das
Schach u. a., umfassen. Glücksspiele (s. d.), um Gewinn
betrieben, fallen nicht unter diesen Begriff des Spiels. Wenngleich
manche Spiele über viele Völker der Erde verbreitet sind,
so ist doch im ganzen die Art der Spiele eines Volkes bezeichnend
für seinen Charakter wie für seine Bildungsstufe. Das S.
beruht daher meist auf volkstümlicher oder örtlicher
Sitte; es kann aber auch pädagogisch und planmäßig
zur Förderung leiblicher oder geistiger Kräfte benutzt
werden. Der Wert des Spiels in letzterer Hinsicht, den schon
Gesetzgeber und Philosophen des Altertums erkannt hatten, ist
besonders durch die von Rousseau, den Philanthropisten, Pestalozzi
und Fröbel (s. Kindergärten) ausgehenden erzieherischen
Bestrebungen zur Geltung gekommen. Die Bewegungsspiele hat auch die
Turnkunst, insbesondere das Schulturnen, in ihren Bereich gezogen.
Großer Wert wird diesen Spielen in England beigelegt, wo an
allen Unterrichts- und Erziehungsanstalten bis zu den
Universitäten hinauf Wettspiele im Schwange sind. In
Deutschland hat der preußische Kultusminister von
Goßler der Sache der Jugendspiele durch seinen Erlaß
vom 27. Okt. 1882 erfreulichen Aufschwung gegeben. Vgl. Schaller,
Das S. und die Spiele (Weim. 1851); Lazarus, Über die Reize
des Spiels (Berl. 1883); insbesondere die Spielsammlung von Guts
Muths (7. Aufl., hrsg. von Schettler, Hof 1885); Jakob,
Deutschlands spielende Jugend (3. Aufl., Leipz. 1883); Kohlrausch
und Marten, Turnspiele, Wettkämpfe, Turnfahrten (3. Aufl.,
Hannov. 1884); Kupfermann, Turnunterricht und Jugendspiele (Bresl.
1884); Georgens, Das S. und die Spiele der Jugend (Leipz. 1884);
Köhler, Die Bewegungsspiele des
142
Spiel - Spielhagen.
Kindergartens (8. Aufl., Weim. 1888); Wagner,
Illustriertes Spielbuch für Knaben (10. Aufl., Leipz. 1888);
Gayette-Georgens, Neues Spielbuch für Mädchen (Berl.
1887); Wolter, Das S. im Hause (Leipz. 1888). Über
Gesellschafts- u. Unterhaltungspiele im allgemeinen vgl.
Alvensleben, Handbuch der Gesellschaftsspiele (8. Aufl., Weim.
1889); "Encyklopädie der Spiele" (3. Aufl., Leipz.1878);
Georgens, Illustriertes Familien-Spielbuch (das. 1882). - Bei den
Alten nahmen die großen öffentlichen Kampfspiele (s. d.)
die oberste Stelle ein, aber auch gesellige Spiele hatten sie in
nicht geringer Zahl, namentlich die Griechen, so bei Gelagen den
Weinklatsch (s. Kottabos), das bei Griechen und Römern sehr
beliebte Ballspiel (s. d.) und Würfelspiel (s. Würfel),
das Richterspiel der Kinder etc. Ein Brettspiel (petteia), nach der
Sage eine Erfindung des Palamedes, erscheint bereits bei Homer als
Unterhaltung der Freier in Ithaka ("Odyssee", I, 107); doch fehlt
uns nähere Kunde über die Art der griechischen
Brettspiele. Unserm Schach- oder Damenspiel scheint das sogen.
Städtespiel ähnlich gewesen zu sein. Von den
verschiedenen Gattungen der römischen Brettspiele sind
einigermaßen bekannt der ludus latrunculorum
(Räuberspiel), eine Art Belagerungsspiel, wobei die Steine in
Bauern und Offiziere geteilt waren und es galt, die feindlichen
Steine zu schlagen oder festzusetzen, und der ludus duodecim
scriptorum, das S. der 12 Linien, bei welchem auf einem in zweimal
12 Felder geteilten Wurfbrett das Vorrücken der 15 je
weißen und schwarzen Steine durch die Höhe des jedem Zug
vorangehenden Würfelwurfs bestimmt wurde. Sehr beliebt war im
Altertum das Fingerraten, noch heute in Italien verbreitet als
Moraspiel (s. Mora). Vgl. Grasberger, Erziehung und Unterricht im
klassischen Altertum (Würzb. 1864-81, 3 Tle.); Becq de
Fouqiers, Les jeux des anciens (2. Aufl., Par. 1873); Ohlert,
Rätsel und Gesellschaftsspiele der alten Griechen (Berl.
1886); Richter, Die Spiele der Griechen und Römer (Leipz.
1887). - Aus der deutschen Vorzeit wird als vornehmstes Volksspiel
der Schwerttanz erwähnt, neben welchem Steinstoßen,
Speerwerfen, Wettlaufen beliebt waren. Auch das Kegeln und das
stets mit Leidenschaft betriebene Würfelspiel sind uralt.
Während das Landvolk an diesen Spielen festhielt, wandten sich
die höfischen Kreise der Ritterzeit vorwiegend den
Kampfspielen zu, aus denen sich unter fremdem Einfluß die
eigentlichen Ritterspiele (Tjost, Buhurt, Turnier) entwickelten.
Daneben wurde das Ballspiel (von der weiblichen Jugend) und als
beliebteste Verstandesspiele das Brettspiel und das Schachspiel
(seit dem 11. Jahrh.) eifrig betrieben. In der spätern Zeit
des Mittelalters trat, namentlich in den Städten, das Spielen
um Geld in den Vordergrund. Vgl. Schultz, Das höfische Leben
im Mittelalter, Bd. 1 (2. Aufl., Leipz. 1889); Kriegk, Deutsches
Bürgertum im Mittelalter (Frankf. 1868 u. 1871); Weinhold, Die
deutschen Frauen im Mittelalter (2. Aufl., Wien 1882).
Spiel (Stoß), in der Jägersprache der Schwanz
des Fasans sowie des Auer- und Birkwildes.
Spielart, s. Art.
Spielbanken, s. Glücksspiele.
Spielbein, s. Standbein.
Spielberg, 1) ehemalige Festung, s. Brünn. -
2) Berg im Frankenjura, s. Hahnenkamm.
Spielhagen, Friedrich, hervorragender
Romanschriftsteller, geb. 24. Febr. 1829 zu Magdeburg als Sohn
eines preußischen Regierungsrats, verbrachte seine Jugend in
Stralsund und ward an diesem Teil der Ostseeküste und auf der
Insel Rügen im eigentlichsten Wortsinn heimisch, so daß
diese Landschaften den Hintergrund für beinahe alle seine
spätern poetischen Schöpfungen abgeben. Nachdem er das
Gymnasium zu Stralsund absolviert, studierte er von 1847 an, die
ursprünglich geplanten medizinischen Studien bald aufgebend,
Philologie und Philosophie zu Bonn, Berlin und Greifswald, war
einige Zeit Hauslehrer in einer aristokratischen Familie und ging
1854 nach Leipzig, um sich als Dozent an der Universität zu
habilitieren. Seine litterarischen Studien und Beschäftigungen
führten ihn inzwischen um so ausschließlicher auch dem
litterarischen Beruf zu, als er die Unvereinbarkeit einer
philologischen Dozentenkarriere und poetischer Bestrebungen
erkannte. Neben kritischen Essays trat er mit vorzüglichen
Übertragungen, z. B. von Emersons "Englischen
Charakterzügen" (Hannov. 1858), Roscoes "Lorenzo von Medici"
(Leipz. 1859), Michelets Werken: "Die Liebe" (das. 1859), "Die
Frau" (das. 1860) und "Das Meer" (das. 1861) sowie mit der Sammlung
"Amerikanische Gedichte" (das. 1859, 3. Aufl. 1871), hervor. Die
Hauptsache aber blieb die eigne Produktion. Die Novelle "Klara
Vere" (Hannov. 1857) und das graziöse Idyll "Auf der
Düne" (Hannov. 1858) wurden nur von kleinen Kreisen als Proben
eines ungewöhnlichen Talents beachtet. Eine um so
glänzendere Aufnahme fand der erste größere Roman
des Autors: "Problematische Naturen" (Berl. 1860, 4 Bde.; 12.
Aufl., Leipz. 1887), mit seiner abschließenden Fortsetzung:
"Durch Nacht zum Licht" (Berl. 1861, 4 Bde.; 10. Aufl. 1885).
Dieser Roman gehörte durch Originalität der Erfindung,
durch psychologische Feinheit der Charakteristik, höchste
Lebendigkeit des Kolorits und eine in den meisten Partien
künstlerisch vollendete Darstellung zu den besten deutschen
Romanproduktionen der Neuzeit und lenkte die Aufmerksamkeit der
gebildeten Lesewelt dauernd auf den Autor. S. war inzwischen 1859
von Leipzig nach Hannover übergesiedelt, hatte dort die
Redaktion des Feuilletons der "Zeitung für Norddeutschland"
übernommen und sich verheiratet. Ende 1862 nahm er seinen
dauernden Wohnsitz in Berlin, von wo aus er größere
Reisen (nach der Schweiz, Italien, England, Paris etc.) unternahm,
redigierte hier kurze Zeit die "Deutsche Wochenschrift" und das
Dunckersche "Sonntagsblatt", trat mehrfach mit öffentlichen
Vorträgen auf, konzentrierte sich aber zuletzt immer
ausschließlicher auf die Produktion. Auch von der Herausgabe
von Westermanns "Illustrierten deutschen Monatsheften", die er 1878
übernommen, trat er 1884 wieder zurück. Sein zweiter
großer Roman: "Die von Hohenstein" (Berl. 1863, 4 Bde.; 6.
Aufl. 1885), der die revolutionäre Bewegung des Jahrs 1848 zum
Hintergrund hatte, eröffnete eine Reihe von Romanen, welche
die Bewegungen der Zeit und zwar ebensowohl die zufälligen und
äußerlichen wie die wirklich tief eingreifenden und
echte Menschennaturen wahrhaft bewegenden zu spiegeln unternahmen.
War hierdurch ein gewisses Übergewicht des tendenziösen
Elements gegenüber dem poetischen unvermeidlich, und standen
die Romane: "In Reih und Glied" (Berl. 1866, 5 Bde.; 5. Aufl. 1880,
2 Bde.) und "Allzeit voran!" (das. 1872, 3 Bde.; 6. Aufl. 1880) wie
die Novelle "Ultimo" (Leipz. 1873) allzu stark unter der Herrschaft
momentan in der preußischen Hauptstadt herrschender
Interessen, Erscheinungen und Stimmungen, welche der Dichter mit
all seiner Kunst nicht zur Poesie zu erheben vermochte, so erwiesen
andre freiere Schöpfungen den Gehalt, die
143
Spielhonorar - Spielkarten.
Lebensfülle und die künstlerische Reife des
Spielhagenschen Talents. Neben der Novelle "In der zwölften
Stunde" (Berl. 1862), den unbedeutendern: "Röschen vom Hof"
(Leipz. 1864), "Unter den Tannen" (Berl. 1867), "Die Dorfkokette"
(Schwer. 1868), "Deutsche Pioniere" (Berl. 1870), "Das Skelett im
Hause" (Leipz. 1878) u. den Reiseskizzen: "Von Neapel bis Syrakus"
(das. 1878) schuf S., unabhängig von den momentanen
Tagesereignissen oder sie nur in ihren großen, allgemein
empfundenen Wirkungen auf das deutsche Leben darstellend, die
Romane: "Hammer und Amboß" (Schwerin 1868, 5 Bde.; 8. Aufl.
1881), "Was die Schwalbe sang" (Leipz. 1872, 2 Bde.; 6. Aufl. 1885)
und "Sturmflut" (das. 1876, 3 Bde.; 5. Aufl. 1883), ein Werk, worin
der Dichter, besonders im ersten und letzten Teil, auf der vollen
Höhe seiner Darstellungskraft und Darstellungskunst steht; den
Roman "Platt Land" (das. 1878); die feine, in Motiven und
Detaillierung etwas allzusehr zugespitzte Novelle "Quisisana" (das.
1879) sowie die neuesten Romane: "Angela" (das. 1881, 2 Bde.),
"Uhlenhans" (das. 1884, 2 Bde.), "Was will das werden" (das. 1886,
3 Bde.), "Noblesse oblige" (das. 1888), "Ein neuer Pharao" (1889)
u. a. Nur in den kleinern Werken: "Deutsche Pioniere" und "Noblesse
oblige", streifte S. vorübergehend das Gebiet des historischen
Romans, sonst schöpfte er Handlungen und Gestalten aus der
jüngsten Vergangenheit und unmittelbaren Gegenwart. Mit dem
nach einer eignen Novelle (7. Aufl., Leipz. 1881) bearbeiteten und
an mehreren Theatern erfolgreich aufgeführten Schauspiel "Hans
und Grete" (Berl. 1876) wendete sich der Dichter auch der
Bühne zu. Größern Erfolg hatte das Schauspiel
"Liebe für Liebe" (Leipz. 1875), in dem die Kritik neben
novellistischen Episoden einen wahrhaft dramatischen Kern
anerkannte. Neuerdings brachte er die Schauspiele: "Gerettet"
(Leipz. 1884) und "Die Philosophin" (das. 1887). Von S. erschienen
außerdem: "Vermischte Schriften" (Berl. 1863-l868, 2 Bde.),
"Aus meinem Skizzenbuch" (Leipz. 1874), "Skizzen, Geschichten und
Gedichte" (das. 1881), und "Beiträge zur Theorie und Technik
des Romans" (das. 1883). Von seinen "Sämtlichen Werken", die
auch die bis dahin zerstreuten innigen und formschönen
Gedichte des Autors enthalten, erschienen bisher 18 Bände
(Leipz. 1875-87). Vgl. Karpeles, Friedr. S. (Leipz. 1889).
Spielhonorar, am Theater die dem Darsteller für sein
jedesmaliges Auftreten festgesetzte, in der Gage nicht mit
inbegriffene Summe. Der Brauch stammt aus Frankreich und war
bereits im 18. Jahrh. in Deutschland eingeführt.
Spielhuhn, s. v. w. Birkhuhn.
Spielkarten, länglich-viereckige Blätter von
steifem Papier, welche auf einer Seite mit Figuren und Zeichen von
besonderer Bedeutung bemalt sind, und die in bestimmt
zusammengesetzter Anzahl "ein Spiel Karten" bilden, mittels dessen
man eine große Menge von Hasard- und Unterhaltungsspielen
ausführt. Absehend von der früh und selbständig
entstandenen chinesischen Karte (bemalte Holz- oder
Elfenbeintäfelchen), unterscheidet man zwei Hauptgattungen:
die Tarock- und die Vierfarbenkarte. Alle Formen der Tarockkarte,
ältere wie neuere, bieten 21 besondere Bilder (Tarocks), deren
Rang durch aufsteigende Ziffern bezeichnet ist, ferner einen
Harlekin von der Größe des ganzen Blattes (den
Sküs) und 4 Reiterbilder (Kavalls). Von Vierfarbenkarten gibt
es drei Arten, als deren gemeinschaftliches Merkmal gilt, daß
dieselben Wertzeichen viermal in einem Spiel unter verschiedener
Auszeichnung (Farben) vorhanden sind. Die Trappola- oder
Trappelierkarte, die älteste der in Deutschland
eingeführten Karten, kam wahrscheinlich aus Italien. Sie
besteht aus viermal 13 Blättern: Re, Cavallo, Fante, Zehn,
Neun, Acht, Sieben, Sechs, Fünf, Vier, Drei, Zwei und Asso mit
den Emblemen Spade (Schwerter), Coppe (Kelche), Denari (Pfennige)
und Bastoni (Stöcke). Meist braucht man von diesen Karten 40
(Zehn, Neun, Acht werden abgelegt). In der schlesischen
Trappelierkarte fehlen Sechs, Fünf, Vier, Drei; sie hat also
36 Blätter. Die deutsche Karte zählt 32 Blätter, von
denen je acht Daus (As), König, Ober, Unter, Zehn, Neun, Acht
und Sieben darstellen und durch die Farben Eicheln (Eckern),
Grün, Rot (Herzen) und Schellen unterschieden sind. Die
früher noch vorhandenen Sechsen sind jetzt fast in allen
Gegenden aus der deutschen Karte geschwunden. Die jetzt wohl am
meisten verbreitete französische Karte (Whistkarte) von 52
Blättern hat Treff (schwarze Kleeblätter), Pik (schwarze
Lanzenspitzen), Coeur (rote Herzen) und Karo (rote Vierecke) zu
Unterscheidungszeichen und besteht aus König, Dame, Bube und
der Zahlenfolge Eins bis Zehn (52). In Süddeutschland, wo man
vielfach französische Karten benutzt, heißen die vier
Farben Kreuz (Treff), Schippen (Pik), Herz (Coeur) und Eckstein
(Karo). Der Ursprung der S. bedarf noch sehr der Aufhellung. Zwar
nicht eigentliche S., aber doch ähnlichen Zwecken dienende
elfenbeinerne und hölzerne, mit Figuren bemalte Täfelchen
hatten die Chinesen und Japaner schon längst, ehe die Karten
bei uns bekannt waren. Wer sie in Europa eingeführt hat,
darüber wissen wir nichts Sicheres. Die erste sicher
beglaubigte Erwähnung der S. datiert aus dem Jahr 1392, wo der
Schatzmeister Karls VI. von Frankreich in seinem Ausgabebuch eine
Zahlung für drei Spiele Karten in Gold und Farben an den Maler
Jacquemin Gringonneur verzeichnet hat. Die S. können also
nicht erst, wie behauptet worden, zur Unterhaltung für den
geisteskranken König Karl erfunden worden sein. Wahrscheinlich
ist es, daß die Sarazenen die S. in Europa eingeführt
haben. Die ältesten S. wurden gemalt, oft mit Aufwand
großer Kunstfertigkeit. Besonders waren die deutschen
Kartenmacher, welche um 1300 bereits Innungen gebildet zu haben
scheinen, berühmt. Nachdem die Erfindung der Holzschneidekunst
und des Kupferstichs schrankenlose Vervielfältigung
ermöglicht hatte, stieg der Export billiger Karten aus
Deutschland außerordentlich, besonders entwickelten Ulm,
Augsburg und Nürnberg eine gewinnreiche Kartenindustrie. Wegen
ihrer Bedeutung für die Entstehungsgeschichte der Typographie,
wegen der Trachtenbilder, welche auf ihnen erhalten sind, nach
welcher Richtung hin spätere Abarten der französischen
Karte besonders interessantes Material liefern, sind die S.
früherer Zeiten von besonderm kulturgeschichtlichen Interesse
und werden darum gesammelt (Sammlung von Weigel in Leipzig, hrsg.
das. 1865; "Die ältesten deutschen S. des königlichen
Kupferstichkabinetts zu Dresden", hrsg. von Lehrs, Dresd. 1885, u.
a.). Bei der großen Beliebtheit, deren sich das Kartenspiel
bei den gebildeten Nationen erfreut, ist auch heute die
Kartenfabrikation ein wichtiger Industriezweig, besonders in
Frankreich und Deutschland (Stralsund, Hamburg, Kassel, Naumburg a.
S., Frankfurt a. M, München, Stuttgart, Ravensburg, Ulm, Mainz
etc.). In den meisten Ländern unterliegen die S. einer
Stempelsteuer (s. unten). Die Kartenspiele, deren Zahl sich ins
Unübersehbare vermehrt
144
Spielkartenstempel - Spiera.
hat, sind teils Glücksspiele (s. d.), teils sogen. Kammer-
oder Kommerzspiele, bei welch letztern nicht bloß das
Glück, sondern auch die Geschicklichkeit und die
Verstandeskräfte der Spielenden ausschlaggebend sind. Die
beliebtesten Kartenspiele sind das englische Whist, ferner Skat,
Solo, Boston, Mariage etc. Die S. dienen ferner zu
Kartenkunststücken, wovon die interessantesten auf gewissen
Kunstgriffen (Volteschlagen), einige auf Berechnung arithmetischer
Verhältnisse, alle auf Geschwindigkeit und Geschicklichkeit in
der Handhabung beruhen. Endlich ist das Kartenschlagen oder
Kartenlegen, die Kunst der Kartomantie, welche arabischen Ursprungs
sein soll, noch gegenwärtig eins der beliebtesten Mittel,
vorzüglich bei den Frauen aus den niedern Volksschichten, um
den Schleier der Zukunft zu lüften, und ist besonders bei den
Zigeunern zu einem Haupterwerbsmittel ausgebildet worden. Die
berühmteste Kartenschlägerin der Neuzeit war die
Lenormand (s. d.). Theoretisch behandelten die Kunst Francesco
Marcolini in seinen "Sorti" (Vened. 1540) und der Pariser
Kupferstichhändler Aliette unter dem Anagramm Etteila im
"Cours théorétique et pratique du livre de Thott"
(Par. 1790). Die wichtigsten Werke über die Geschichte der S.
sind: J. B. Thiers, Traité des jeux (Par. 1686); Breitkopf,
Versuch, den Ursprung der S. etc. zu erforschen (Leipz. 1784);
Leber, Jeux des tarots et des cartes numérales (Par. 1844,
mit 100 Kupfern); Singer, Researches into the history of playing
cards (Lond. 1848); Chatto, Origin and history of playing cards
(das. 1848); Taylor, History of playing cards (das. 1865); Merlin,
Origine des cartes à jouer (Par. 1869). Anweisung zur
Erlernung sämtlicher Kartenspiele geben die "Encyklopädie
der Spiele" (3. Aufl., Leipz. 1879) und Opel (Erf. 1880). Vgl. auch
Schröter, Spielkarte und Kartenspiel (Jena 1885); Signor
Domino, Das Spiel, die Spielerwelt und die Geheimnisse der
Falschspieler (Bresl. 1886).
Spielkartenstempel, eine unter Anwendung der Abstempelung
von Spielkarten erhobene Aufwandsteuer. Ein solcher wurde mit der
für Sicherung des Eingangs erforderlichen Beaufsichtigung und
Kontrollierung der Fabrikation und des Handels 1838 in
Preußen eingeführt, nachdem bis dahin der Staat den
Alleinhandel mit Spielkarten sich vorbehalten hatte. Eine solche
Steuer bestand auch in den meisten andern deutschen Ländern,
seit 1878 ist an deren Stelle der S. als Reichsabgabe getreten (30
u. 50 Pf. vom Spiel). Ertrag 1888/89: 1,066 Mill. Mk. Ein solcher
Stempel besteht auch in Österreich (30 und 15 Kr. vom Spiel)
und in England (seit 1828: 1 Schilling, seit 1862: 3 Pence vom
Spiel). Frankreich sichert sich die richtige Erhebung der
Spielkartensteuer (50 u. 57 Cent.) dadurch, daß der Staat den
nur am Sitz von Steuerdirektionen gestatteten Fabriken das für
die Hauptseiten der Karten erforderliche Papier liefert. Die
Einfuhr ausländischer Karten ist verboten; wo sie auf Grund
von Verträgen zugelassen ist, wird von solchen Karten neben
dem Stempel noch ein Zoll erhoben. England erhebt eine
jährliche Lizenzgebühr vom Verkäufer von
Spielkarten, daneben besteht ein S. In Griechenland hat der Staat
seit 1884 das Monopol der Erzeugung und des Verkaufs.
Spielleute (Spilman), im Mittelalter Bezeichnung für
die fahrenden Sänger, Musikanten, Gaukler etc., welche um Geld
ihre Künste vorführten (s. Fahrende Leute). Jetzt
heißen S. (Signalisten) die Tamboure und Hornisten der
Infanterie im deutschen Heer, deren je zwei bei der Kompanie sind,
und die für ihre Ausbildung unter dem Bataillonstambour (beim
ersten Bataillon jedes Regiments Regimentstambour genannt) stehen.
Reservespielleute sind je zwei Mann pro Kompanie, welche im
Gebrauch der Instrumente ausgebildet werden, aber sonst Dienst mit
der Waffe thun.
Spielmarke, s. Jeton.
Spieloper, eine Oper mit lustspielartiger Handlung und
leichter, gefälliger Musik, im Gegensatz zur ernsten
dramatischen Musik der großen Oper.
Spielpapiere, s. v. w. Spekulationspapiere (s.
Spekulation).
Spieluhr, ein Uhrwerk, welches zu bestimmten Zeiten, etwa
nach Ablauf einer Stunde, ein oder mehrere musikalische Stücke
spielt. Bei den Glockenspieluhren, welche früher nicht selten
mit Turmuhren verbunden wurden, schlagen kleine, durch eine Stift-
oder Daumenwalze gehobene Hämmer in bestimmter Abwechselung
taktmäßig an abgestimmte Glocken. In ähnlicher
Weise wurden auch Flötenwerke und Harfensaiten mit Uhrwerken
in Verbindung gebracht. Gegenwärtig sind die sogen.
Stahlspielwerke (Carillons) am gebräuchlichsten, welche sich
in einem kleinen Raum (in Taschenuhren, Dosen, Albums etc.)
unterbringen lassen. Sie bestehen aus abgestimmten Stahlfedern,
welche durch die Stifte einer mittels des Uhrwerks in Umdrehung
versetzten Walze geschnellt werden. Befindet sich ein solches
Spielwerk in einer Uhr, so ist dasselbe von dem Gang- und
Schlagwerk derselben ganz unabhängig, indem es
selbständig durch ein Gewicht oder eine Feder getrieben wird,
und es findet eine Verbindung zwischen beiden nur in der Weise
statt, daß das Uhrwerk in bestimmten Zeiten das Spielwerk
auslöst, d. h. seine Triebkraft frei macht, worauf letzteres
sofort zu spielen beginnt und damit fortfährt, bis es durch
die Arretierung wieder zum Stillstehen gebracht wird. Die
Stahlspielwerke werden hauptsächlich in der Schweiz
angefertigt.
Spielwaren, Arbeiten aus verschiedenen Stoffen (Metall,
Elfenbein, Knochen, Holz, Pappe, Papiermaché, Leder, Wachs,
Kautschuk etc.) zur Unterhaltung und Beschäftigung der Kinder,
gegenwärtig Gegenstand eines bedeutenden Industriezweigs, der
für die ganz ordinären bis mittelfeinen Artikel seinen
Hauptsitz im sächsischen Erzgebirge (Seiffen,
Grünhainichen etc.), in Oberammergau und in der Rauhen Alb in
Württemberg, für mittelfeine bis feinere Waren in
Sonneberg und Umgegend in Thüringen, für noch bessere und
beste Qualität in Nürnberg, Stuttgart und Berlin hat.
Nürnberg und Stuttgart konkurrieren in hochfeiner Ware
erfolgreich mit Paris. Die Gesamtproduktion Deutschlands
schätzt man auf 400,000 Ztr. im Wert von 30-36 Mill. Mk. Die
Herstellung von S. reicht zurück bis in die
prähistorische Zeit. In den bronzezeitlichen Pfahlbauten der
Westschweiz wurden bronzene und irdene Gegenstände
ausgegraben, die den heutigen Kinderrappeln ähneln und
offenbar demselben Zweck wie diese gedient haben. Ähnliche
Objekte wurden auch in Schlesien, der Mark Brandenburg etc.,
Spielwürfel aus Knochen oder Bronze zu La Tène (s.
Metallzeit, S. 528), unweit Este und zu Sackrau (bei Breslau)
ausgegraben. Die in alten Gräbern aufgefundenen Sprungbeine
(astragali) von Schafen, Ziegen und Kälbern haben nach Bolle
zum Knöchelspiel gedient.
Spiera, Francesco, "der Apostat", geboren um 1498, war
als Rechtsgelehrter zu Citadella bei Padua 1542 evangelisch
geworden, schwor aber, von der Inquisition bedroht, 1547 die
gewonnene Überzeugung
145
Spieren - Spill.
ab, um sofort ein Opfer rasender Verzweiflung zu werden. Sein
1548 erfolgtes trauriges Ende war entscheidend für den
Übertritt des P. P. Vergerio (s. d.). Sein Leben beschrieben
Comba (ital., Flor. 1872) und Rönneke (Hamb. 1874).
Spieren, die Rundhölzer des Schiffs, besonders
diejenigen zum Ausspannen der Leesegel an ihrem untern Liek;
unbearbeitete Hölzer, welche Schiffe zum Ersatz zerbrechender
Raaen und Stengen mitnehmen.
Spierlingsvogelbeere, s. Sorbus.
Spierstaude (Spierstrauch), s. Spiraea.
Spieß, Stoßwaffe mit langem Schaft und
dünner Eisenspitze, s. v. w. Pike (s. d.).
Spieß, 1) Christian Heinrich, Schriftsteller auf
dem Gebiet des niedern Romans, geb. 1755 zu Freiberg i. S., war
längere Zeit Mitglied einer wandernden
Schauspielergesellschaft und wurde darauf als Wirtschaftsbeamter
auf dem Schloß Betzdiekau in Böhmen angestellt, wo er
17. Aug. 1799 starb. Anfangs schrieb er Schauspiele; später
lieferte er besonders Romane, jede Messe einige Bände (z. B.
"Der alte Überall und Nirgends", Geistergeschichte, 1792; "Das
Petermännchen", 1793; "Der Löwenritter", 1794; "Die
zwölf schlafenden Jungfrauen", 1795, etc.), die wohl noch
jetzt in den untern Schichten der Gesellschaft Leser finden und
sich insgemein durch wüste Erfindung und platte
Ausführung charakterisieren. Vgl. Appell, Die Ritter-,
Räuber- und Schauerromantik (Leipz. 1859).
2) Adolf, Begründer einer neuen Richtung des Schulturnens,
geb. 3. Febr. 1810 zu Lauterbach am Vogelsberg, wuchs in Offenbach
auf und widmete sich mehr und mehr der Pflege und Förderung
der Leibesübungen, nachdem er das anfänglich ergriffene
Studium der Theologie aufgegeben hatte. 1833-44 an den Schulen von
Burgdorf im Kanton Bern, dann 1844-48 in Basel angestellt,
entfaltete er hier eine erfolgreiche, eigenartige Thätigkeit
als Turnlehrer und Schriftsteller. 1848 zur Leitung des hessischen
Schulturnens nach Darmstadt berufen, wirkte er in dieser Stellung
mit weit über die Grenzen dieses Landes hinausgehendem Erfolg,
bis ihn 1855 ein von früh an in ihm keimendes Lungenleiden,
dem er 9. Mai 1858 erlag, von seiner Thätigkeit
zurückzutreten zwang. S.' Verdienst ist es, die Gebiete der
Freiübungen (s. d.) und Ordnungsübungen (s. d.) für
die Turnkunst erschlossen und systematisch erschöpft sowie die
Betriebsform der Gemeinübungen auch für andre Turngebiete
eingeführt zu haben. Auch hat er dem Mädchenturnen zuerst
entscheidend Bahn gebrochen und überhaupt ein eigentliches
Schulturnen erst ins Leben gerufen. Sein Hauptwerk ist die
systematische "Lehre der Turnkunst" (Basel 1840-46, 4 Tle.; 2.
Aufl. 1867-85). Zur Anleitung für den Schulturnunterricht ist
bestimmt sein "Turnbuch für Schulen" (Basel 1847-51, 2 Tle.;
2. Aufl. von Lion, 1880-89). S.' "Gedanken über die Einordnung
des Turnwesens in das Ganze der Volkserziehung" (Basel 1842) sind
mit anderm zusammengefaßt nebst Beiträgen zu seiner
Lebensgeschichte in seinen "Kleinen Schriften über Turnen"
(hrsg. von Lion, Hof 1872). Vgl. Waßmannsdorff, Zur
Würdigung der Spießschen Turnlehre (Basel 1845).
Spießbock, s. Antilopen, S. 640.
Spießbock, Käfer, s. Bockkäfer.
Spießbürger, ursprünglich arme, nur mit
Spießen bewaffnete Bürger als Fußsoldaten; jetzt
verächtliche Bezeichnung für engherzige, beschränkte
Kleinbürger.
Spieße, s. Geweih.
Spießer, in der Jägersprache der
einjährige Hirsch; Spießbock, das einjährige
männliche Reh, solange es Spieße trägt, was auch
bisweilen noch bei ältern Stücken der Fall ist (s.
Geweih).
Spießglanz, s. v. w. Antimon;
Spießglanzbleierz, s. v. w. Bournonit;
Spießglanzbutter, s. v. w. Antimonchlorid;
Spießglanzkönig, s. v. w. Antimon.
Spießglas, s. v. w. Antimon.
Spießglassilber, s. Antimonsilber.
Spießlein (Wurf), in Nürnberg s. v. w.
fünf Stück.
Spießlerche, s. Pieper.
Spießrecht (Recht der langen Spieße), das
Recht der Landsknechtsregimenter, schwere Verbrechen selbst
abzuurteilen, sowie der Rechtsgang dabei.
Spießrutenlaufen (Gassenlaufen), militär.
Leibesstrafe, welche früher wegen schwerer Vergehen durch
Kriegs- oder Standgericht über gemeine Soldaten verhängt
wurde, und bei deren Ausführung, unter Aufsicht von
Offizieren, ein oder mehrere hundert Mann mit vorgestelltem Gewehr
eine etwa 2 m breite Gasse bildeten, welche der bis zum Gürtel
entblößte Verurteilte mit auf der Brust
zusammengebundenen Händen und eine Bleikugel zwischen den
Zähnen haltend, um "sich den Schmerz zu verbeißen",
mehrmals langsam bei Trommelschlag durchschreiten mußte.
Hierbei erhielt er von jedem Soldaten mit einer Hasel- oder
Weidenrute (Spieß- oder Spitzrute) einen Schlag auf den
Rücken. Bei der Kavallerie wurden, in Preußen bis 1752,
statt der Ruten Steigbügelriemen (daher Steigriemenlaufen)
verwendet. Um den Verurteilten am schnellen Gehen zu hindern,
schritt ein Unteroffizier mit ihm vor die Brust gehaltener
Säbelspitze voran. Ein sechsmaliges S. durch 300 Mann an 3
Tagen mit Überschlagen je eines Tags wurde der Todesstrafe
gleich geachtet, hatte aber auch gewöhnlich den Tod zur Folge.
Konnte der Verurteilte nicht mehr gehen, so wurde er auf Stroh
gelegt und erhielt dann die festgesetzte Anzahl von Streichen.
Diese barbarische Strafe wurde in Preußen 1806, in
Württemberg 1818, in Österreich 1855, in Rußland
erst 1863 abgeschafft. Ähnliche Strafen waren auch bei den
Römern im Gebrauch, s. Fustuarium. Bei den Landsknechten (s.
d.) war es das "Recht der langen Spieße", aus dem das S.
hervorging.
Spießtanne, s. Cunninghamia.
Spik, s. v. w. Lavandula Spica; s. auch Valeriana.
Spiköl (Spicköl), s. Lavendelöl.
Spilanthes Jacq. (Fleckblume), Gattung aus der Familie
der Kompositen, meist behaarte, einjährige Kräuter mit
einfachen, gegenständigen Blättern und einzeln stehenden,
gelben Blütenköpfen. Von den mehr als 40 Arten in den
Tropen der Alten und Neuen Welt wird S. oleracea Jacq., die
Parakresse, in den Tropen als Salat- und Gemüsepflanze, bei
uns als Zierpflanze kultiviert. In Südeuropa benutzt man sie
gegen Skorbut und bei uns eine aus dem Kraut bereitete Tinktur
(Paraguay-Roux) gegen Zahnschwerz.
Spilimbergo, Distriktshauptstadt in der ital. Provinz
Udine, am Tagliamento, hat ein altes Schloß, eine Kirche mit
Gemälden von Pordenone u. a., Seidenfilanden, Handel und
(1881) 1732 Einw.
Spill, Vorrichtung zum Einwinden der Ankerkette, zum
Einholen von Trossen, wenn ein Schiff verholt werden soll, oder zum
Heben schwerer Lasten. Ein S. besteht aus einer eisernen, bei
Gangspillen vertikal, bei Bratspillen horizontal gelagerten Welle
(mit einer Armatur aus Gußeisen zur Aufnahme der Ankerkette
und aus Holz zum Umlegen von Trossen) und dem Spillkopf, welcher
mit Öff-
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl., XV. Bd.
10
146
Spillage - Spindler.
nungen zum Einstecken der Spillspaken versehen ist, mit deren
Hilfe man den Apparat in Rotation versetzt. Palldaumen oder
Sperrklinken verhindern, daß das S. sich rückwärts
dreht. Auf Dampfschiffen wird das S. gewöhnlich durch eine
kleine Dampfmaschine in Bewegung gesetzt. In neuerer Zeit werden
die Spille vielfach ganz aus Eisen gebaut.
Spillage (spr. -ahsche), Verlust an auf Schiffen
beförderten Waren infolge mangelhafter Verpackung.
Spillbaum, s. Evonymus.
Spille, im Altdeutschen s. v. w. Spindel oder Kunkel,
daher die deutschrechtlichen Ausdrücke: Spillgelder,
Spilllehen, Spillmage, Spillseite u. dgl.
Spillgelder, s. Nadelgeld.
Spilling, s. Pflaumenbaum.
Spilllehen (Kunkellehen), ein Lehen, welches auch auf
Frauen vererblich war.
Spillseite (Spindelseite, Spillmagen), im altdeutschen
Recht die Verwandten mütterlicherseits im Gegensatz zu der
Schwertseite oder den Schwertmagen (s. d.), den Verwandten von der
Seite des Schwerts, dem Mannesstamm. Vgl. Mage.
Spilographa, s. Bohrfliege.
Spin., Abkürzung für Max von Spinola, Graf von
Tassarolo, geb. 1780 zu Toulouse, gest. 1857 auf Tassarolo bei
Genua (Entomolog).
Spina (lat.), Dorn, Stachel, Gräte; auch
Rückgrat (S. dorsi); in der altrömischen Rennbahn die
niedrige Mauer, an deren Enden die zu umkreisenden Ziele standen
(s. Circus). S. bifida, Rückgratsspalte (s.d.).
Spinacia Tourn. (Spinat), Gattung aus der Familie der
Chenopodiaceen, einjährige, aufrechte, kahle Kräuter mit
abwechselnden, gestielten, dreieckig ei- oder
spießförmigen, ganzrandigen oder buchtig gezahnten
Blättern, diözischen Blüten in geknäuelten
Wickeln, die der weiblichen Pflanze meist unmittelbar in den
Blattachseln, die der männlichen zu unverbrochenen, terminalen
und achselständigen Scheinähren geordnet. Vier
orientalische Arten. S. oleracea L. (gemeiner Spinat), 30-90 cm
hoch, soll durch die Araber zuerst nach Spanien gebracht und von
dort weiter verbreitet worden sein. Man kultiviert ihn jetzt als
Gemüsepflanze in zwei Varietäten, als Sommerspinat
(großer, holländischer Spinat, S. oleracea inermis
Mönch), mit länglich-eirunden oder stumpf dreieckigen
Blättern und glattem Fruchtperigon, und als Winterspinat (S.
oleracea spinosa Mönch), mit spießförmig
zweizähnigen Blättern und stachligem Fruchtperigon. Diese
Varietät säet man im Herbst und schneidet sie im
Frühjahr; den Sommerspinat bevorzugt man als
Sommergewächs, weil er weniger leicht in Samen schießt.
Die Blätter liefern ein zartes Gemüse, welches mild
abführend wirkt. Es enthält 2,189 eiweißartige
Körper, 0,292 Fett, 0,058 Zucker, 2,378 sonstige
stickstofffreie Substanzen, 0,551 Cellulose, 1,152 Asche, 93,380
Wasser. In Griechenland füllt man Gebäck mit Spinat und
einigen Gewürzkräutern als Fastenspeise; in Frankreich
verbäckt man den Samen zu Brot.
Spinalis (lat.), was auf das Rückgrat Bezug hat,
daher Medulla s., das Rückenmark; Spinalkrankheiten, die
Krankheiten des Rückenmarks.
Spinalmeningitis, Entzündung der
Rückenmarkshäute.
Spinalnerven, s. Rückenmark.
Spinalneuralgie (Spinalirritation), die im Verlauf der
Rückenmarksnerven auftretenden Schmerzen, sind entweder
bedingt durch anatomisch nachweisbare Erkrankungen 1) der
Wirbelkörper, z. B. bei Frakturen der Wirbelknochen, durch
Verrenkungen oder Quetschungen der Bandscheiben, durch
eingedrungene Geschosse oder knöcherne Auswüchse, welche
auf das Rückenmark oder die aus diesem entspringenden
Empfindungsnerven einen Druck ausüben; 2) durch
Entzündungen oder Geschwulstbildungen in den
Rückenmarkshäuten, welche sich z. B. bei den
häufigen syphilitischen Erkrankungen auch auf die Scheide der
Nerven fortsetzen; 3) durch Entzündungen, Geschwülste,
Entartungen des Rückenmarks selbst; S. ist daher ein
regelmäßiges Symptom der Rückenmarksschwindsucht.
Diese große Gruppe von Fällen bietet der ärztlichen
Diagnose gewöhnlich keine besondere Schwierigkeit, da die S.
als solche nur Teilerscheinung ist neben Lähmungen,
Krampfzuständen und andern schweren, oft tödlichen
Komplikationen, so daß demnach die S. bei der Behandlung nur
als Symptom berücksichtigt wird. Als reine Neurose kommt die
S. vor bei Personen, welche durch voraufgegangene schwere
Gemütsbewegungen, körperliche oder geistige
Überanstrengungen, Exzesse aller Art in ihrer Gesundheit tief
erschüttert sind. Neben dem Gefühl von Kriebeln, Taubsein
oder Kälte in der Haut des Rückens und der
Extremitäten klagen die Kranken über
Rückenschmerzen, welche besonders bei Druck auf die
Dornfortsätze lebhaft werden (Irritatio spinalis),
während Lähmungen meistens fehlen oder nur in
untergeordnetem Grad auftreten. In diesen Fällen ist die S.
eine bloße Funktionsstörung des spinalen Nervensystems,
welche gewöhnlich Teilerscheinung einer allgemeinen
Nervenschwäche ist, kein bedrohliches Symptom darstellt,
sondern bei geeigneter Behandlung verschwindet (s.
Nervenschwäche).
Spinalsystem (Vertebralsystem), das Rückenmark mit
den von ihm ausgehenden Nerven.
Spinat, Pflanzengattung, s. Spinacia; englischer oder
ewiger S., s. v. w. Rumex Patientia: neuseeländischer S., s.
v. w. Tetragonia expansa; wilder S., s. Atriplex.
Spina ventosa (lat.), s. Winddorn.
Spinazzola, Stadt in der ital. Provinz Bari, Kreis
Barletta, mit 6 Kirchen und (1881) 10,353 Einw.; Geburtsort des
Papstes Innocenz XII.
Spindel, in der Technik ein langer, dünner, an einem
oder an beiden Enden zugespitzter Körper, wie er seit alters
beim Spinnen benutzt wird; dann jede dünne stehende Welle
(Bohrspindel, Schraubenspindel etc.), auch die Welle der Unruhe in
den Spindeluhren. In der Botanik heißt S. (Rhachis) die
Hauptachse der Ähre (s. Blütenstand, S. 80).
Spindelbaum, Pflanzengattung, s. Evonymus.
Spindelsträucher, s. Celastrineen.
Spindeluhr, s. Uhr.
Spindler, Karl, Romanschriftsteller, geb. 16. Okt. 1796
zu Breslau, ward in Straßburg erzogen. Das juristische
Studium gab er auf, nachdem er sich dem französischen
Kriegsdienst durch Flucht entzogen, und wurde Schauspieler, bis er
in der Pflege seines außerordentlichen Erzählertalents
seinen eigentlichen Beruf erkannte. Er lebte nacheinander in Hanau,
Stuttgart, München, zuletzt in Baden-Baden und starb 12. Juli
1855 in Bad Freiersbach. Unter seinen zahlreichen Romanen (neue
Ausg., Stuttg. 1854 bis 1856, 95 Bde.; Auswahl 1875-77, 14 Bde.)
sind die bedeutendsten: "Der Bastard" (Zürich 1826, 3 Bde.;
aus der Zeit Kaiser Rudolfs II.), "Der Jude" (Stuttg. 1827, 4 Bde.;
eine Sittenschilderung aus der ersten Hälfte des 15. Jahrh.),
"Der Jesuit" (das. 1829, 3 Bde.), "Der Invalide" (das. 1831, 5
Bde.) und "Der König von Zion" (das. 1837, 3 Bde.),
147
Spinell - Spinnen.
deren Vorzüge ihm einen der ersten Plätze unter den
deutschen Erzählern anweisen. 1829 erschien unter seiner
Redaktion die "Damenzeitung", 1830-49 das Taschenbuch
"Vergißmeinnicht".
Spinell, Mineral aus der Ordnung der Anhydride, findet
sich in gewöhnlich kleinen, regulären Kristallen, einzeln
ein- oder aufgewachsen, sehr häufig, namentlich auf
sekundärer Lagerstätte, in Kristallfragmenten u.
Körnern. S. ist meist rot, auch braun, blau, grün und
schwarz. Der rote wird beim Erhitzen vorübergehend grün,
dann farblos, nach dem Erkalten aber wieder rot. Die licht
gefärbten Spinelle sind durchsichtig, die dunklern
durchscheinend bis undurchsichtig, alle glasglänzend.
Härte 8, spez. Gew. 3,5-4,1. Der rote, durchsichtige (edle) S.
ist ein Magnesiumaluminat MgAl2O4, wahrscheinlich durch etwas Chrom
gefärbt. Eine blaue Abart enthält bis 2,5 Proz. Eisen,
der grasgrüne Chlorospinell 6-10 Proz. Eisen und etwas
Kupferoxyd als färbendes Prinzip, während der schwarze S.
(Pleonast, Ceylanit) nach der Formel (Mg,Fe),(Al,Fe)2O4
zusammengesetzt ist. Edler S. (s. Tafel "Edelsteine", Fig. 14)
findet sich fast nur auf sekundärer Lagerstätte, in
Ceylon, Ostindien und Australien, der blaue zu Aker in
Södermanland. Chlorospinell entstammt einem Chloritschiefer
von Slatoust; Pleonast tritt in Silikatgesteinen und Kalken oder
auch lose auf, so besonders am Monzoniberg in Südtirol, am
Vesuv, auf Ceylon, zu Warwick und Amity in New York. S. ist ein
geschätzter Edelstein und besitzt in seinen gesättigt
ponceauroten Varietäten etwa den halben Wert eines
gleichgroßen Diamanten. Tiefroter S. kommt auch als
Rubinspinell, licht rosenroter als Rubinbalais (Balasrubin),
violetter als Almandinspinell und gelbroter als Rubicell (Rubicill)
in den Handel. Die zuletzt genannten drei Sorten stehen den edlen
Spinellen an Wert bedeutend nach. Kochenille- und blutroter S.
kursiert wohl auch als Goutte de Sang ("Blutstropfen"). Pleonaste
dienen als Trauerschmuck. Eine Anzahl von Mineralspezies, deren
einzelne Glieder als isomorphe Körper untereinander eng
verknüpft sind, faßt man als Spinellgruppe zusammen. Sie
kristallisieren sämtlich im regulären System, am
häufigsten in Oktaedern und oktaedrischen Zwillingen, nach dem
sogen. Spinalgesetz und sind übereinstimmend nach der
allgemeinen Formel RII(RIV2)O4 [s. Bildansicht] zusammengesetzt.
Die folgende Tabelle gibt die wichtigsten Spezies der Gruppe und
die Elemente, welche sich an der Zusammensetzung beteiligen, in der
Reihenfolge ihres Vorwaltens in der betreffenden Verbindung :
Arten | RII | (R2)VI
Edler Spinell . . . . | Mg, vielleicht Cr | Al
Blauer Spinell . . . . | Mg | Al, Fe
Chlorospinell . . . . . | Mg, etwas Cu | Al, Fe
Pleonast . . . . . . | Mg, Fe | Al, Fe
Pikotit . . . . . . . | Fe, Mg | Al, viel Cr
Chrompikotit . . . . . | Fe, Mg | Cr, zurücktret. Al
Hercynit . . . . . . | Fe, wenig Mg | Al
Automolit (Gahnit, Zinkspinell) | Zn | A1
Kreittonit . . . . . . | Zn, Fe, Mg | Al, Fe
Dysluit . . . . . . | Zn, Fe, Mn | Al, Fe
Franklinit. . . . . . | Zn, Fe, Mn | Fe, Mn
Chromit (Chromeisenerz) | Fe, Mg, Cr | Cr, Al, Fe
Magneteisen (Magnetit) . | Fe | Fe
Talkeisenstein. . . . . | Fe, Mg | Fe
Jacobsit . . . . . . | Mn, Mg | Fe, Mn
Magnoferrit (Magnesioferrit) | Mg | Fe
Uranpecherz . . . . . | U | U
Spinellan, s. Nosean.
Spinelltiegel, s. Schmelztiegel.
Spinett (franz. Epinette), veraltetes Tasteninstrument,
kleines Klavicimbal (s. Klavier, S. 816).
Spingole, s. Espingole.
Spinndrüsen, bei Insekten, Spinnen und einigen
andern Tiergruppen diejenigen Organe, welche einen zu feinen
Fäden ausziehbaren, rasch erhärtenden Saft absondern und
so den Stoff für die bekannten Spinnweben, Kokons und andre
derartige Gebilde liefern. Die Larven (Raupen) von Insekten haben
zwei sehr lange S., die im Hinterleib liegen und ihren Inhalt dicht
am Mund ergießen; bei den Spinnen hingegen münden die S.
am Hinterende des Körpers aus. Auch die Byssusdrüse der
Muscheln (s. d.) wird wohl als Spinndrüse bezeichnet.
Spinnen, s. Spinnentiere.
Spinnen (hierzu Doppeltafel "Spinnmaschinen"), aus kurzen
Fasern durch Zusammendrehen beliebig lange Fäden (Gespinst,
Garn, s. d.) erzeugen. Damit das Garn die größte
Gleichmäßigkeit und Festigkeit bekommt, müssen die
Fasern nicht nur vor allen etwanigen Verunreinigungen sowie kurzen
Härchen befreit, sondern auch gleichmäßig verteilt
und in eine parallele Lage gebracht, demnach also gewissen
Vorbereitungsarbeiten unterworfen werden, bevor das eigentliche S.
stattfinden kann. Je nachdem die verschiedenen Operationen von der
Hand mit einfachen Werkzeugen oder von mechanischen Vorrichtungen
ausgeführt werden, unterscheidet man Hand- und
Maschinenspinnerei.
1) Die Handspinnerei,
durch die Maschinen fast verdrängt, wird nur noch von den
Landbewohnern zum S. des Flachses und der Wolle benutzt, zeigt aber
bereits deutlich die der Spinnerei zu Grunde liegenden
Hauptoperationen. Der gehechelte Flachs oder die gewaschene und
gekratzte Wolle werden um einen hölzernen Stock (Rocken) a
(Textfig. 1) gewunden, den die Spinnerin neben sich aufstellt oder
in den Gürtel steckt. Das Ordnen der Fasern bewirkt sie durch
Ausziehen derselben mit der einen Hand, während sie mit der
andern die Spindel am obern Ende dreht, an welchem der Faden mit
einer Schlinge in einem Häkchen oder einem
schraubenförmigen Einschnitt so befestigt ist, daß die
Drehung auf ihn übertragen wird. Die Spindel b besteht aus
einem hölzernen (selten eisernen) Stäbchen von 20-30 cm
Länge, das etwa 8 cm vom untern Ende seine größte
Stärke, 0,8-1,5 cm, hat u. sich von da aus nach beiden Enden
zuspitzt. Etwas unter der stärksten Stelle befindet sich eine
kleine Schwungmasse c (Wirtel) aus Zinn oder Horn, in den
ältesten Zeiten aus einem durchbohrten Stein bestehend, durch
welche die Drehung der Spindel länger erhalten wird, nachdem
sie losgelassen und, an dem sich bildenden Faden hängend,
allmählich zur Erde sinkt. Ist dies geschehen, so wird der
Faden
148
Spinnen (Hand-, Maschinenspinnerei).
vom obern Ende der Spindel abgelöst, aufgewickelt und von
neuem festgehakt, die Spindel gedreht etc. Viel nutzbringender ist
das S. mit dem Spinnrad (Handrad oder Trittrad), durch welches die
beiden Operationen des Drehens und Aufwickelns der Hand abgenommen
werden, während nur das Ordnen der Fasern (Ausziehen)
derselben überlassen bleibt. Bei dem Handrad (Textfig. 2) wird
die frei schwebende Spindel a durch das von der rechten Hand an der
Kurbel b gedrehte Rad c mittels Schnur ohne Ende in Umdrehung
versetzt, während man in der linken das Spinnmaterial (meist
Wolle) hält und in geeigneter Menge durch die Finger gleiten
läßt. Zunächst wird der Faden gedreht, indem man
ihn in der Richtung 1, d. h. unter stumpfem Winkel, gegen die
Spindel hält und sich allmählich mit der linken Hand von
der Spindel entfernt; hierauf bringt man ihn in die Richtung 2,
wodurch er aufgewickelt wird. Bei dem Trittrad (Textfig. 3) ist
eine Spindel x y vorhanden, die an beiden Enden gelagert und bei y
mit einem sogen. Kopfe versehen ist, welcher der Länge nach
eine Durchbohrung mit einem Seitenloch sowie zwei Flügel a a
besitzt. Auf der Spindel befindet sich eine hölzerne Spule b
zum Aufwickeln des Garns i i. Die Spindel x y erhält nun durch
die Schnurrolle r (Wirtel) und die Schnur s, die Spule b durch die
Schnurrolle u und die Schnur t, beide von dem durch den
Fußtritt f, Schubstange e und Kurbel d in Umdrehung
versetzten Schwungrad c aus eine Drehbewegung. Der bei y durch den
Kopf gehende, von dem Spinnrocken kommende Faden i wird
zunächst durch diese Bewegung gedreht, dann aber über
kleine Häkchen des Flügels auf die Spule b geleitet. Da
nun letztere entweder einen kleinern oder größern Wirtel
u hat als die Spindel, also mehr oder weniger Umdrehungen als diese
macht, so muß dadurch das Garn aufgewickelt werden. Um
hierbei ein regelmäßiges Bewickeln der Spule zu
bewirken, wird der Faden der Reihe nach über andre
Häkchen geleitet.
2) Die Maschinenspinnerei, welche jetzt die Regel bildet,
erzeugt das Garn in der Weise, daß das Fasermaterial
zunächst zum Zweck der Reinigung und Anordnung eine Reihe von
Maschinen durchläuft, die dasselbe als ein
zusammenhängendes Band abliefern, welches Vorgarn genannt und
durch allmähliche Verfeinerung und Drehung in Garn (Feingarn)
verwandelt wird.
A. Baumwollspinnerei. Die zum Verspinnen bestimmte Baumwolle (s.
d.) kommt in sehr stark zusammengepreßten Ballen in die
Spinnereien und muß zur Abscheidung der Schmutzteile
geöffnet werden. Dies erfolgt in dem Wolf (Öffner,
Willow), der sehr verschieden konstruiert, aber in neuester Zeit
hauptsächlich in der durch Fig. 4 dargestellten Einrichtung
des vertikalen, konischen Willows angewendet wird. Auf der
vertikalen Achse a a befinden sich 6-8 runde Blechscheiben 1-6, mit
einer Anzahl von Stäben c versehen, welche mit der Achse a a
sich mit großer Geschwindigkeit (1000- 1200 Umdrehungen in
der Minute) drehen. Die durch den Kanal A zugeführte Baumwolle
wird von diesen Schlägern gefaßt und gewaltsam gegen den
konischen Korb o p geschleudert, welcher siebartig durchbrochen ist
und daher den groben Staub durchläßt, der sich in der
Kammer K K ansammelt und zeitweilig entfernt wird. Der feinere
Staub dahingegen wird durch eine Trommel E abgesondert, deren
Inneres mit dem Ventilator G in Verbindung steht, der dasselbe
aussaugt. Obige Trommel G ist nun mit einem Drahtgewebe
überspannt, gegen welches durch den Luftzug die aufgelockerte
Baumwolle fliegt, um sich von dem Staub zu trennen, der in das
Siebinnere und zum Staubturm H gejagt wird. Infolge einer langsamen
Drehung der Siebtrommel gelangt die Baumwolle durch D auf das Tuch
ohne Ende F, welches sie, im hohen Grad gelockert, aus der Maschine
auswirft. Unmittelbar auf dieses Öffnen folgt eine noch weiter
gehende Auflockerung und Reinigung in der gewöhnlich doppelten
Schlag- oder Flackmaschine (Batteur), deren Einrichtung Fig. 5 im
Längsschnitt zeigt. Das Wichtigste an dieser Maschine sind die
Schlagvorrichtungen, welche sich in den Kasten c und e befinden und
aus einer Welle bestehen, an der mittels Arme zwei Lineale
(Schläger) t t befestigt sind, die sich mit einer
Geschwindigkeit von etwa 1500 Umdrehungen in der Minute drehen. Die
Baumwolle wird nun auf das Tuch ohne Ende a gelegt und von diesem
einem Walzenpaar (Speisewalzen) b übergeben, an dem die
Schläger sehr nahe vorbeifliegen, und das sich so langsam
dreht, daß auf etwa 1 mm des vorgeschobenen Materials 1
Schlag kommt. Der bei diesem Schlagen frei werdende Staub fliegt
zum Teil durch die Roste r d, zum Teil durch die Siebtrommel d mit
Ventilator k, während die Baumwolle erst auf der Siebtrommel d
gesammelt und dann von dieser den Speisewalzen e1 zugeschoben wird,
um in e noch einmal geschlagen, durch Rost s, Siebtrommel f f mit
Ventilator m gereinigt zu werden. Aus f f gelangt sie zu den
Preßwalzen g und endlich auf eine durch i i gedrehte Walze h
zum Aufwickeln zu einem Wickel. Da die Baumwolle mindestens zwei-,
oft mehrere Male auf der Schlagmaschine bearbeitet werden
muß, so findet man gewöhnlich solche doppelte
Schlagmaschinen und benutzt zwei derselben hintereinander. Dabei
legt man mehrere Wickel (1, 2, 3) der ersten Schlagmaschine auf das
Speisetuch a der zweiten sogen. Wattenmaschine, wodurch eine
Mischung und die
148a
Spinnmaschinen.
Fig. 23 Wollkämme
Fig. 10. Häkchenstellung der Walzenkarde
Fig. 4 Konischer Wolf
Fig. 9. Deckelkratze
Fig. 11. Walzenkarde (Seitenansicht).
Fig. 5. Schlagmaschine.
Meyers Konv.-Lex., 4. Aufl.
Bibliogr. Institut in Leipzig.
Zum Artikel »Spinnen«.
148b
Spinnmaschinen.
Fig. 15. Mulemaschine
Fig. 13. Vorspinnmaschine (Flyer).
Fig. 19. Waterspinnmaschine für Flachs.
Fig. 16. Selbstspinner (Self-actor)
148c
Spinnmaschinen.
Fig. 21. Reißwolf.
Fig. 20. Schlagwolf.
Fig. 17. Ringspindel
Fig. 24. Igelstrecke.
Fig. 18. Anlegemaschine.
Fig. 22. Florteiler.
Fig. 12. Streckwerk.
Fig. 14. Waterspinnmaschine für Baumwolle.
149
Spinnen (Baumwollspinnerei).
Bildung einer regelmäßigen Watte erzielt wird
(Duplieren). Der Abschluß der Reinigung und Auflockerung
erfolgt sodann durch das Kratzen oder Krempeln auf der
Kratzmaschine (Krempel, Karde), deren wesentlichster Teil der
Auflockerungsapparat ist, welcher der ausgiebigen Wirkung wegen aus
zwei Systemen von hakenartigen Zähnchen besteht, die aus
hartem Draht, knieförmig gebogen, durch Lederstreifen gesteckt
sind, so daß sie in großer Zahl dicht nebeneinander
stehen und den Kratzenbeschlag (Textfig. 6) bilden. Zur
Verdeutlichung des Vorganges dienen die untenstehenden Fig. 7 u. 8,
welche Stücke eines Kratzenbeschlags in den zwei verschiedenen
Stellungen zeigen. Denkt man sich in b b (Textfig. 7) Fasern und a
a nach links bewegt, so erfolgt gar keine Wirkung oder ein
Aufrollen des Materials zwischen den Kratzflächen; bewegt sich
aber a a nach rechts, so findet ein Vorgang wie beim Kämmen,
d. h. ein Kratzen, statt, welches in seiner Wirkung noch vermehrt
wird wenn sich zugleich b b nach links bewegt. Geht in Textfig. 8 b
b nach links, so spießt es die Wolle von a a auf,
während bei der umgekehrten Bewegung, oder wenn a a sich nach
links begibt, die Fasern in a a hängen bleiben. Bei dieser
Häkchenstellung kann man also, je nach der Wahl der relativen
Bewegungsrichtung, die Fasern beliebig von einem Beschlag in den
andern überführen (Abnehmen, Wenden). Zur
Bethätigung dieser Werkzeuge ist nun ein System stets auf
einer großen cylindrischen Trommel (Tambour) von etwa 1 m
Durchmesser angebracht, während das zweite System entweder auf
Latten sitzt, welche die Trommel konzentrisch umgeben und die
Deckel (Deckelkarde) bilden, oder auf passend gelagerten kleinern
Walzen (Igel) angebracht ist (Walzenkarde). Die Einrichtung der
Deckelkratze zeigt Fig. 9. Die von der zweiten Schlagmaschine
kommende Watte wird bei a eingelegt, durch die drehende Walze b
allmählich wieder abgewickelt und über die Platte c den
Speisewalzen e übergeben, aus welchen sie von der sogen.
Vorwalze f herausgezogen und an die große Trommel T
abgeliefert wird. Diese dreht sich nun mit großer
Geschwindigkeit (100- bis 160mal in der Minute) und kratzt das
Material mit Hilfe der Deckel d d, dasselbe zugleich in ein
äußerst zartes Vlies verwandelnd, welches vermittelst
der mit Kratzenbeschlag garnierten Trommel K von der Trommel T
abgenommen wird (Abnehmer, Kammtrommel). Zur Entfernung des Vlieses
aus dieser Trommel K dient ein Kamm k (Hacker), welcher, durch eine
schnell umlaufende Kurbel m auf und ab bewegt, das Vlies aushackt.
Da letzteres sehr zart ist, so zieht man es bei n seitwärts
zusammen und leitet es durch einen Trichter t, in dem es die
Gestalt eines Bandes erhält, welches, zwischen den Walzen q
noch zusammengepreßt, durch den Kopf u in den Topf p geleitet
wird, in dem es sich in Spiralen ablagert, welche durch einen in u
angebrachten Drehapparat gebildet werden. Statt der Deckelkratzen
verwendet man ihrer größern Leistung wegen jetzt ebenso
vielfach die Walzenkarden (Igelkrempel), deren Häkchenstellung
neben der Haupttrommel a Fig. 10 zeigt, wo b Arbeiter und c Wender
heißen, und deren Konstruktion aus Fig. 11 hervorgeht. Um die
große Trommel T liegen die Arbeiter a und dazwischen die
kleinern Wendern, welche fortwährend die in a sitzen bleibende
Baumwolle von a auf T übertragen (wenden), um die Wirkung zu
erhöhen. Die Wickel werden wie bei der Deckelkarde durch die
Walze z abgewickelt, von dem Zufuhrapparat b c auf die Vorwalze d
und von dieser auf die Trommel T gebracht, sodann durch die Walzen
1, 2, 3 gleichmäßiger verteilt, zwischen T und a
gekratzt, um endlich auf die Kammwalze K mit Hacker k und auf die
Wickelwalze q zu gelangen, oder durch einen Trichter die Bandform
zu gewinnen. Die Drehung der Arbeiter erfolgt durch eine endlose,
durch das Gewicht g gespannte Kette s von der Scheibe 7, die
Drehung der Wender w, n sowie der Walzen d, 1, 2 und 3 durch Riemen
r, t, u und Riemenscheiben 5 auf der Achse 4 und 12 auf der Achse B
von der großen Trommelwelle A aus. Von 7 wird zugleich die
Bewegung durch Kegelräder 8, 9, 10 auf c und weiter auf z
übertragen. In der Regel wird die Baumwolle zweimal gekratzt:
auf der Vorkarde und nach Behandlung auf der Lappingmaschine auf
der Feinkarde, in welchem Fall mehrere Bänder der Vorkarde
zusammengewickelt und als Bandwickel auf die Feinkarde gebracht
werden. Um im Band eine vollständig gleiche, gestreckte,
parallele Lage und gleiche Verteilung der Fasern zu bekommen,
passieren sie eine Reihe von Walzen in der Weise, daß immer
so viel Bänder vereinigt werden (Duplieren), als jedes Band
verlängert (gestreckt) wird. Dazu dient ein Streckwerk
(Laminirstuhl, Strecke), dessen Einrichtung (Fig. 12) folgende ist.
In einem passenden Bock liegen vier Walzenpaare 1, 2, 3, 4, die die
Bänder A dadurch verlängern, daß sie der Reihe nach
von 4 nach 1 größere Umdrehgeschwindigkeiten, z. B. auf
das Sechsfache gesteigert, erhalten. Die Oberwalzen sind mit Leder
überzogen und durch Gewichte q q auf die geriffelten
Unterwalzen gepreßt. Die (z. B. 6) gestreckten und
vereinigten Bänder laufen als ein Band A durch eine Platte h,
Walzen c und den drehenden Kopf T in die Kanne D D, welche sich
durch eine Schnecke s mit Schneckenrad r um die Achse dreht, um dem
Bande die Spirallage zu geben (Drehkanne). Wegen der
Gleichmäßigkeit des Bandes muß die Strecke sofort
stillstehen, wenn ein Band reißt. Dazu dienen der Hebel z y x
und die Platte h (Bandwächter), die
150
Spinnen (Baumwollspinnerei).
von dem Band gehalten werden und sofort mit x oder p gegen die
Zähne des Rades a fallen, wenn das Band bei b oder h
reißt. Durch die Arretierung von a wird dann sofort die
Strecke abgestellt. In dem gestreckten und duplierten Band sind die
Fasern so verteilt und gelagert, daß dasselbe durch weitere
Streckung und Drehung in Garn überführt werden kann. Der
großen Lockerheit halber muß diese Operation aber in
gewissen Abstufungen so erfolgen, daß die Zusammendrehung
zunächst dem Band nur eine Festigkeit erteilt, welche das
Weiterstrecken nicht hindert; dadurch entsteht das Vorgarn
(Vorgespinst). Zur Erzeugung desselben dient der Flyer oder die
Spindelbank, welche die früher üblichen Vorspinnmaschinen
(Röhrchen-, Eklipsmaschine, Jackmaschine etc.) fast
vollständig verdrängt hat. Der Flyer, welcher in mehreren
Größenabstufungen (Grob-, Mittel-, Fein-, Feinfein- und
Doppelfeinflyer) nacheinander in Verwendung kommt, erhält
zuerst das Band aus den Kannen der Streckmaschinen, wickelt aber
das Vorgarn auf Spulen, so daß vom Grobflyer abwärts das
Garn auf Spulen gewickelt in die Maschine gelangt. Das Wesen eines
Flyers zeigt Fig. 13 der Tafel. Von den Spulen a a läuft das
Vorgarn in das Streckwerk b, von hier zu den Spindeln c c, mit den
Flügeln d, welche durch die am Fuß angebrachten
Kegelräder k in Umdrehung versetzt werden und dadurch dem Garn
Draht geben. Indem das Garn zugleich durch den hohlen
Flügelarm d und den Finger f auf die Spule e geleitet und
letztere um die Spindel vermittelst schiefer Kegelräder i
gedreht wird, wickelt es sich auf die Spule, welche aus einem
hölzernen Rohr besteht und behufs regelmäßiger
Bewickelung mit der sogen. Spulenbank (Wagen) g innerhalb der
Flügel auf und ab steigt, bis sie gefüllt ist, um nach
Abheben des Flügels von der Spindel abgezogen u. der
nächstfolgenden Maschine übergeben zu werden. Ein sehr
sinnreicher, aber komplizierter Mechanismus mit
Differenzialräderwerk (Differenzialflyer) regelt die
Aufwickelbewegung, welche sich nach jeder Garnschicht ändern
muß. - Nachdem das Vorgarn den letzten (Fein-) Flyer etwa in
der Dicke eines gewöhnlichen Bindfadens verlassen hat,
empfängt dasselbe die endgültige Streckung und Drehung
zur Verwandlung in Garn auf den Feinspinnmaschinen, die entweder
nach dem Prinzip des Spinnrades oder des Handrades (s. S. 148)
konstruiert sind und danach Watermaschinen oder Mule heißen.
Die Watermaschine (Fig. 14) wird immer doppelt gebaut, d. h. es ist
an derselben ein Träger (Aufsteckrahmen) für zwei Reihen
mit Vorgarn gefüllter Spulen a a, zwei Reihen Streckwerke b b
und Spindeln mit Flügeln und Spulen vorhanden. Das Garn geht
von a nach b, sodann gestreckt durch ein Führungsauge n nach
dem Flügel c und von diesem gedreht auf die Spule zwischen dem
Flügel zum Aufwickeln. Die 120 Spindeln n o werden von den mit
den Wellen g g sich drehenden Trommeln x x vermittelst Schnüre
s und Wirtel t 3600-4500mal in der Minute gedreht, während die
Spulenbank t mit den Stangen f f auf und nieder geht. Zu dem Zweck
werden die letztern in den Büchsen z und y geführt und
von den Schienen m m getragen, welche an Ketten k k hängen,
die über die Rollen r r laufen und an den Winkeln e e
befestigt sind, welche sich mit Rollen gegen eine Herzscheibe d
legen, die eine solche Form hat, daß sie bei ihrer
gleichmäßigen Drehung die Hebel und dadurch die Stangen
f f abwechselnd auf und ab bewegt. Die Aufwickelung des Garns
erfolgt durch ein Zurückbleiben der Spulen infolge einer
starken Reibung auf der Bank t. Sämtliche Bewegungen gehen von
einer der Wellen g aus, die direkt angetrieben wird, durch
Zahnräder die Bewegung dem Streckwerk und durch das Zahnrad 2,
Schnecke 3, Schneckenrad 4, Welle h und Schneckengetriebe 5 u. 6
der Herzscheibe d mitteilt. Während bei der Watermaschine
Streckung, Drehung und Aufwickelung gleichzeitig und ununterbrochen
vor sich gehen, sind bei der Mulemaschine diese Operationen
getrennt. Sie besteht nämlich (Fig. 15 der Tafel) aus einem
festen Gestell A mit Aufsteckrahmen für die mit Vorgarn
gefüllten Spulen a a sowie Streckwerk b und einem Wagen B mit
den Spindeln c, mit denen das Garn h verbunden ist. In der ersten
Periode fährt der Wagen etwa 2 m vom Gestell weg aus,
während sich sowohl die Streckwalzen b als die Spindeln c
drehen, um das Garn zu spinnen. In der nun folgenden zweiten
Periode fährt der Wagen dem Gestell zu ein, während das
Streckwerk stillsteht, um das gesponnene Garn aufzuwickeln, zu
welchem Zweck ein Draht gesenkt wird, der in Bügeln g
über sämtlichen Fäden der Maschine liegt und deshalb
auch durch Bewegung der Bügel g sämtliche (600-700)
Fäden in die zum Aufwickeln erforderliche Lage zu den Spindeln
bringt (Aufwindedraht). Bei den ersten Mulemaschinen führte
ein Arbeiter sämtliche beim Einfahren stattfindende Bewegungen
aus, weshalb die Zahl der gleichzeitig gesponnenen Fäden 300
nicht überschritt. Die jetzigen Mulemaschinen arbeiten
dahingegen mit wenig Ausnahmen selbstthätig (Selbstspinner,
Selfactor), indem nicht nur die Bewegungen, sondern namentlich die
so wichtige und äußerst schwierige Regulierung von einer
Stelle aus erfolgt; daher ist es möglich, sie mit 800-1100
Spindeln auszustatten. Einen Überblick über den
höchst komplizierten Mechanismus eines Selfaktors gewährt
Fig. 16 der Tafel. Die Transmissionsriemenscheibe I sitzt fest auf
der Welle A und dreht einerseits durch Kegelräder die Strecken
b, anderseits die große Schnurrolle R. Von b aus setzt sich
die Drehung fort durch die Räder 1, 2, 3, 4 auf die Scheibe M,
welche vermittelst der am Wagen B befestigten, durch M1 gespannten
Wagenschnur W den Wagen ausfährt. Gleichzeitig dreht die um R
und R1 gelegte, um Führungsrollen h und die Trommel f laufende
Schnur s s die Trommel f und somit durch Schnüre e e die
Spindeln c. Das Einfahren des Wagens erfolgt von der um A drehbaren
Riemenscheibe I I aus durch Stirn- und Kegelräder i k, Welle l
und Schnecke m vermittelst der zweiten um m1 gespannten Wagenschnur
w1, die sich auf die Schnecke aufwickelt, um abwechselnd die
Geschwindigkeit zu vergrößern und zu verkleinern, weil
der Wagen anfangs beschleunigt und dann verzögert wird. Zur
Bildung des Garnkörpers (Kötzer) senkt sich der Aufwinder
g, während ein zweiter, unten hinlaufender Draht g1
(Gegenwinder) die Fäden gespannt hält, damit sie keine
Knoten bekommen. Der Winder g wird dadurch bewegt, daß die
Stange o mit einer Nase unter die Zahnstange z schnappt und sich
dadurch hebt und senkt, daß ihre Rolle p auf einer an- und
absteigenden Schiene q q q (Formplatte) rollt; z
überträgt diese Vertikalbewegung durch ein Zahnrad auf
eine Welle, an welcher die Arme g befestigt sind. Beim Ausfahren
schnappt o wieder aus, wobei ein Gewicht in Wirkung tritt, das mit
der Kette r g hebt und z senkt. Zur Bewegung der Spindeln c zum
Zweck der Kötzerbildung dient der sogen. Quadrant Q, welcher
durch ein mit M1 verbundenes Zahnrad, das in den Zahnquadranten y1
eingreift, hin und her bewegt wird
l51
Spinnen (Flachsspinnerei etc.).
und diese Bewegung vermittelst der Kette t und
Zwischenräder auf die Trommel f überträgt. Durch die
Quadrantenschraube u u wird diese Aufwindebewegung aufs genaueste
geregelt, da durch sie der Angriffspunkt y der Kette beliebig
eingestellt werden kann. Neben den Water- und Mulemaschinen kommt
immer mehr die Ringspindelbank in Aufnahme, deren Wesen Fig. 17
erkennen läßt. Der Faden gelangt zu der Spule S von
einer Führungsöse a und einer kleinen Klammer b (Fliege),
welche den Kopf des Ringes r r umfaßt. Indem nun die Spindel
mit der Spule S durch den Wirtel w in Drehung versetzt wird,
erhält der Faden zwischen a und b Draht, während die
Fliege b zugleich auf dem Ring r r hinläuft und dadurch das
Aufwickeln des Fadens bewirkt. Die Verteilung des Fadens über
die ganze Spule erfolgt durch Auf- und Abbewegung der Ringbank R
wie bei der Watermaschine.
B. Flachspinnerei. Das Verspinnen des Flachses (s. d.) beginnt
damit, daß man Bündel des je nach der Feinheit des Garns
weniger oder mehr (bis fünfmal) gehechelten Flachses, sogen.
Risten, zu einem Band vereinigt, wozu die in Fig. 18 skizzierte
Anlegemaschine dient. Dieselbe besteht der Hauptsache nach aus zwei
Walzenpaaren bei C und A mit einem dazwischenliegenden
Hechelapparat E (Nadelstabstrecke). Das Einziehwalzenpaar C, dessen
Oberwalze o durch ein Gewicht q mit 150 kg auf die untere Walze
gepreßt wird, empfängt die auf einem Zuführtuch
regelmäßig ausgebreiteten Risten über die Platte b,
um sie den bei E sichtbaren, in der Pfeilrichtung bewegten
Hechelstäben zu übergeben, welche sie dem
Streckwalzenpaar A zutragen, dessen Oberwalze o mit 550 kg durch
das Gewicht q belastet ist. Da die Streckwalzen A sich schneller
drehen als C, so wird der Flachs nicht nur gestreckt, sondern auch
fortgesetzt gehechelt und zu einem Band vereinigt, das über
die sogen. Bandplatte B durch das Abzugswalzenpaar F in eine Kanne
geleitet wird. Zu bemerken ist noch, daß die Schaber n und m
die Oberwalzen, eine rauhe Walze mit rotierender Bürste die
untere Streckwalze von Fasern frei halten, daß ein Gewicht p
die untere Abzugswalze nachgiebig in der Schwebe hält, und
daß die Hechelstäbe ihre obere Vorwärts- und untere
Rückwärtsbewegung durch Schrauben erhalten
(Schraubenstrecke). Auf ganz ähnlichen Maschinen (Durchzug,
Flachsstreckmaschinen) mit immer feiner werdenden Hecheln erfolgt
dann ein weiteres Strecken und Duplieren der Bänder und
hierauf die Verwandlung in Vorgarn auf einer Vorspinnmaschine,
welche sich von dem Flyer (s. oben) nur durch das Streckwerk
unterscheidet, welches genau so eingerichtet ist wie bei der
Anlegemaschine. Zum Feinspinnen dienen ausschließlich
Watermaschinen, welche oft die Einrichtung haben, welche Fig. 19
zeigt. Bei a werden die Spulen mit Vorgarn aufgesteckt; b und d
sind die Streckwalzen mit Zwischenwalzen c c zum Leiten des Garnes;
die Flügelspindeln werden von der Schnurtrommel e durch die
Schnüre f und Wirtel g gedreht, die Spulen h stecken lose auf
den Spindeln und erhalten die zum Aufwickeln erforderliche Bremsung
durch eine mit dem Gewicht i belastete Schnur, welche in einer um
den untern Spulenrand laufenden Nute liegt. Das Heben und Senken
der Spulen erfolgt wie bei der oben beschriebenen Watermaschine. Um
den Flachsfasern im Augenblick des Zusammengehens die
eigentümliche Sturheit zu benehmen und dadurch ein sehr
glattes, schönes Garn spinnen zu können, führt man
jetzt ganz allgemein das Garn vor der Drehung durch einen Trog mit
etwa 80° warmem Wasser (Naßspinnen), der vor den Spindeln
liegt. Solche Garne müssen gehaspelt und dann noch getrocknet
werden.
C. Hanfspinnerei stimmt ganz mit der Flachsspinnerei
überein.
D. Hede- (Werg-) Spinnerei unterscheidet sich von der
Flachsspinnerei nur durch die Bildung des ersten Bandes, welche
nach Art der Baumwollspinnerei auf einer groben Walzenkarde
vorgenommen wird.
E. Jutespinnerei erfolgt nach zwei verschiedenen Methoden. Nach
der einen werden die 2-3 m langen Risten in kürzere, 760 mm
lange Teile zerschnitten und dann genau wie Flachs verarbeitet, d.
h. gehechelt, auf der Anlege in ein Band verwandelt, gestreckt,
dupliert, in Vorgarn übergeführt und auf Watermaschinen
trocken versponnen. Diese in England vorwiegend für feinere
Garne gebrauchte Methode liefert das sogen. gehechelte oder
Jute-Linen-Garn und verarbeitet nur ausgesuchte Fasern. Die zweite
Methode, welche in Deutschland und Österreich allgemein
eingeführt ist, liefert das sogen. kardierte oder Towgarn,
weil die Fasern auf Karden bearbeitet und in Hede (Tow) verwandelt
werden. In beiden Fällen geht dem Verspinnen eine
Vorbereitungsarbeit voran, welche ein Geschmeidigmachen der Fasern
bezweckt und darin besteht, daß man die aufgestapelten Risten
mit Wasser und Thran besprengt, um sie einzuweichen
(Einweichprozeß), und dann in einer Maschine quetscht, in der
20-40 Paar grob geriffelte Walzen auf einem horizontalen oder
cylindrischen Gestell nebeneinander liegen und infolge einer
drehenden Bewegung die Juteristen durchziehen, welche dabei derart
geknetet werden, daß sie diese Quetschmaschine weich und
geschmeidig verlassen. Nur die Wurzelenden bleiben mitunter hart
und müssen abgerissen werden, was auf der Schnippmaschine
geschieht, welche mit einer Hechelmaschine Ähnlichkeit hat.
Nach dem Quetschen gelangen die bandartig zusammenhängenden
Fasern auf eine Walzenkratze (Fig. 11) mit grobem Beschlag, um in
kurze Faser zertrennt zu werden, welche sich zu einem Band
vereinigen und in eine Kanne einlegen. Nach zweimaligem Kratzen
folgt das Duplieren und Strecken auf 3-5 Nadelstabstrecken (Fig.
18), darauf die Bildung des Vorgarns auf Flyern und das Feinspinnen
auf Watermaschinen (trocken), wie beim Flachsspinnen angegeben
ist.
F. Wollspinnerei umfaßt die Herstellung von Streichgarn,
Kammgarn und Halbkammgarn aus Wolle von verschiedener
Beschaffenheit (s. Wolle), welche zunächst gewaschen,
gespült und getrocknet wird. Die Streichwolle erfährt
sodann eine gründliche Auflockerung im Wolf, der als Schlag-
und Reißwolf angewendet wird. Ersterer hat in der Regel die
in Fig. 20 skizzierte Einrichtung. Auf zwei Wellen a a befinden
sich sechs Reihen von je sechs Stäben, welche mit den Wellen
in der Pfeilrichtung sich mit 500-600 Umdrehungen in der Minute
drehen, die durch das Tuch c zugeführte Wolle von dem
Walzenpaar d e empfangen, durcheinander schlagen und aus h
herauswerfen, während die Schmutzteile durch die Roste g f und
f e fliegen. Der Reißwolf (Fig. 21) besteht der Hauptsache
nach aus einer großen sich drehenden Trommel a, deren
Oberfläche mit 5 cm langen radialen Zähnen besetzt ist,
welche die auf das Zufuhrtuch z gelegte Wolle aus dem durch
Verteilungswalze u, Speisewalze m und Klaviatur o gebildeten
Speiseapparat herausreißen, zerteilen und bei q aus dem
Gehäuse werfen, während der Schmutz durch den Rost p in
den Raum k fällt. Nach dem Wolfen oder
152
Spinnen (Woll-, Seidenspinnerei; Geschichtliches).
während desselben wird die Streichwolle mit Olivenöl
oder Petroleumrückständen gefettet, damit sie geschmeidig
wird (Schmälzen). In diesem Zustand gelangt sie zum Krempeln,
Kardätschen oder Streichen auf die Kratzmaschine (Krempel), um
einen Pelz (Vlies, Fell) zu bilden, in dem die Fasern
regelmäßig angeordnet sind, und durch dessen Teilung
einzelne Bänder entstehen, die ohne weiteres Vorgarn liefern.
Zum Krempeln dienen ausschließlich Walzenkratzen, 2-4mal
hintereinander, welche mit einer Vorrichtung verbunden sind, die
das vom Hacker abgenommene Vlies in Bänder teilen.
Gewöhnlich besteht ein solcher Florteiler nach Fig. 22 aus
einer Anzahl (z. B. 120) Riemchen ohne Ende, welche abwechselnd um
die Walzen a und b sowie oqt und rpm laufen, das durch den Hacker K
von der Kammwalze T genommene Vlies c in 120 Bänder zerlegen
und diese durch A und B sowie Führer l auf Spulen leiten,
welche in vier Reihen C, D, E, F angeordnet sind. Die Apparate A
und B bestehen aus zwei kurzen Riemen ohne Ende, welche sich nicht
nur in der Richtung des Pfeils zum Transport der Bänder
drehen, sondern auch in der Richtung der Walzenachsen sehr schnell
hin und her bewegen und dadurch die Bänder kräftig rollen
(Würgeln, Nitscheln) und auf diese Weise sofort in Vorgarn
überführen, das ohne weiteres auf Mulemaschinen oder auf
der Ringbank zu Feingarn versponnen wird.
Die Kammwolle wird nach dem Entschweißen zuerst einem
Prozeß unterworfen, der die parallele Lage der Wollhaare, die
Ausscheidung kurzer Haare (Kämmlinge), die Bildung eines
Bandes (Kammzug) bezweckt und Kämmen genannt wird. Man benutzt
dazu entweder ein Paar heiß gemachter Handkämme
(Wollkämme, Fig. 23), indem man eine Portion wenig
geölter Wolle in einen der Kämme einschlägt, mit dem
zweiten kämmt und dann mit der Hand auszieht, dieselbe
zugleich in ein kurzes Band verwandelnd, das mit andern vereinigt
wird, oder die Kammmaschine, welche die Handarbeit in vollkommener
Weise nachmacht, aber sehr kompliziert ist. Das aus einzelnen
kurzen Zügen gebildete Band erhält eine weitere
Gleichförmigkeit durch Strecken und Duplieren auf sogen.
Igelstrecken, welche (Fig. 24) aus zwei Paar Streckwalzen A und B
besteht, zwischen welchen eine mit Stacheln besetzte Walze E
angebracht ist. Die Kammzüge treten aus Kannen D über die
Schiene a in die Strecke, werden von E zurückgehalten, um die
Fasern glatt zu streichen, im Trichter t vereinigt und durch das
Vorziehwalzenpaar C in die untergestellte Kanne D' geliefert. Zur
Entkräuselung und Entölung passieren sie dann in einer
Plättmaschine eine Seifenlösung und eine Reihe
heißer Walzen. Das Verspinnen der Streckbänder zu Garn
erfolgt stufenweise, indem erst Vorgarn auf dem Flyer oder einer
Strecke mit Würgelzeug (Fig. 13), darauf das Feingarn auf
Water- oder Mulemaschinen, neuerdings auch auf der Ringspindelbank
hergestellt wird. Die Halbkammgarnspinnerei, welche
hauptsächlich die Kämmlinge verarbeitet, benutzt zum
Anordnen der Fasern die Krempel und die Igelstrecken, zum
Vorspinnen die Strecke mit Würgelzeug und zum Feinspinnen die
Watermaschine.
G. Seidenspinnerei beschränkt sich auf die Verarbeitung von
Seidenabfall und heißt demgemäß auch
Florettspinnerei. Sie beginnt damit, daß man die Abfälle
(Strusi, Bourrette, Flockseide etc.) einem Macerationsprozeß
zur Zerstörung des Seidenleims unterwirft, wozu ein Verweilen
in warmem (60-70°) Wasser während 3-7 Tagen ausreicht,
dann folgt ein Waschen mit warmem Wasser in einem Stampfwerk, ein
Ausschleudern in einer Zentrifuge und ein Trocknen in luftigen,
warmen Räumen. Zur weitern Verarbeitung feuchtet man die Masse
mit Seifenwasser schwach an und öffnet sie in einer Art
Reißwolf. Von hier gelangen sie auf eine Kämmaschine zur
Abscheidung kurzer und zur Parallellegung der langen Fasern. Die
letztern werden auf einer Anlege (Fig. 18) gemischt und in Vliese
verwandelt, welche vermittelst einer sogen. Wattenmaschine (einer
Art Nadelstabstrecke) zu Bändern verzogen werden, die nunmehr
auf Nadelstabstrecken eine weitere Streckung und Duplierung
erhalten, um sodann auf einer Spindelbank mit Nadelstäben in
Vorgarn überzugehen, das auf Waterspinnmaschinen zu
Florettgarn fertig gesponnen wird. Der größte Teil der
Florettgarne kommt übrigens gezwirnt in den Handel.
Geschichtliches.
Das S. gehört zu den ältesten
Handbeschäftigungen, wie neben erhaltenen Resten von Geweben
aus gesponnenem Garn aus den Nachrichten der ältesten
Schriftsteller hervorgeht. Insbesondere nehmen Wollengewebe und
somit -Gespinste schon im Altertum einen hohen und unter allen
Gespinsten den ersten Rang an, denn unmittelbar auf die Bekleidung
mit Tierfellen folgt jene mit Geweben aus Wollgarn. Zum S. bediente
man sich derjenigen einfachen Geräte, die noch heutzutage bei
vielen Völkern angetroffen werden, nämlich des Wockens
oder Rockens und der Spindel in der oben beschriebenen Art, wie
besonders aus alten Vasenbildern (Textfig. 25) und
Wandgemälden zu entnehmen ist. Als Erfinderin der Wollarbeit
galt Athene und als Ort der Erfindung Athen. Auch die Zubereitung
des Flachses war im Altertum bekannt. 1530 erfand Joh. Jürgen
in Watenbüttel bei Braunschweig das Trittrad, welches langsam
Verbreitung fand. Im vorigen Jahrhundert tauchten die ersten
Bemühungen auf, den Spinnprozeß mittels Maschinen zu
vollziehen. Die wichtigste Erfindung, die der Streckwalzen, wurde
1738 Lewis Paul in England patentiert, der sie mit
Flügelspindeln des Spinnrades in Verbindung brachte und so die
erste Spinnmaschine 1741, die zweite mit 250 Spindeln 1743 durch
Esel in Bewegung setzte. Diese Maschine wurde von Arkwright in
vielen Teilen verbessert, sodann durch noch andre
Vorbereitungsmaschinen, Kratzmaschine mit Bandabgabe,
Streckmaschine mit Duplierung und eine Vorspinnmaschine,
152a
Spinnentiere.
Ufer-Spindelassel
(Pycnogonum littorale). 3/i
(Art. Ufer-Spindelassel.)
Bekränzte Webspinne (Theridium redimitum), nat. Gr a Eier,
b Augenstellung. (Art. Spinnentiere.)
Violettroter Holzbock
(Ixodes reduvius). 5/i.
(Art. Zecken.)
Krätzmilbe des Menschen
(Sarcoptes scabiei). 80/i.
(Art. Milben.)
Bücherskorpion (Chelifer cancroides), stark
vergrößert.
(Art. Bücherskorpion.)
Feldskorpion (Scorpio occitanus) uch mit den Kämmen u.
Luft
Nat. Gr. (Art. Skorpione.)
Haarbalgmilbe
(Demodex folliculorum)
600/i. (Art. Milben.)
Männchen der Apulischen Tarantel-
(Tarantula Apuliae). Nat. Gr. (Art. Tarantel.)
Männchen der Gestreckten Strickerspinne (Tetragnatha
extensa), nat. Gr. a Augenstellung.
(Art. Spinnentiere.)
Käsemilbe (Tyroglyphus siro). 80/i.
(Art. Milben.)
^A«,Jema), nat. Gr. b Augenstellung, inke
Kieferfühler der Kreuzspinne T. (Art. Kreuzspinne.)
a Weibliche Kreuzspinne
c Fußspitze der Hausspinne
Weibchen der Hausspinne (Tegenaria domestica), nat. Gr. a
Augenstellung.
(Art. Spinnentiere.)
Gemeine Wasserspinne (Argyroneta aquatica), etwas
vergrößert, a Nest, b Augenstellung. (Art.
Spinnentiere.)
Weibchen der Umherschweifenden Krabbenspinne (Thomisus
viaticus), im Hintergrund Fäden schießend. B/2. (Art.
Spinnentiere.)
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl.
Bibliographisches Institut in Leipzig.
Zum Artikel »Spinnentiere«..
153
Spinnendistel - Spinnentiere.
ergänzt und 1775 durch Wasserkraft betrieben, woher ihre
Bezeichnung Watermaschine rührt. Um dieselbe Zeit erfand
Hargreaves in Standhill die nach seiner Tochter genannte
Jennymaschine, die statt der Streckwalzen die sogen. Presse (zwei
zusammengepreßte horizontale Latten) besaß, welche das
Band festhielt, während die nach Art des Handrades
konstruierten Spindeln vertikal auf einem bewegten Wagen standen,
das Ausziehen und Drehen besorgten und beim
Rückwärtsfahren das gedrehte Produkt aufwickelten. Im J.
1779 endlich vereinigte Crompton in Firnwood das Streckwerk der
Watermaschine mit dem Spinnwerk der Jennymaschine zu jener
Maschine, welche unter dem Namen Mule (Maulesel, als Bastard
zwischen der Water- und Jennymaschine), später, namentlich von
Roberts zu Manchester 1825, als Selfaktor ausgebildet, als die
größte Erfindung auf dem Gebiet der Spinnerei zu gelten
hat, da sie das S. der feinsten Garne gestattet, wozu die
Watermaschine ungeeignet ist. Um das Jahr 1830 erfand Jenks in
Amerika die sogen. Ringspindel, welche die Grundlage der immer mehr
in Aufnahme kommenden Ringspindelbank bildet. Erst nachdem die
mechanische Baumwollspinnerei zu hoher Entwickelung gekommen war,
vollzog sich ein ähnlicher Prozeß auf den Gebieten der
Flachs- und Wollspinnerei, wenn auch viel langsamer, weil die
Beschaffenheit dieser Materialien bezüglich der mechanischen
Verarbeitung bedeutend größere Schwierigkeiten bietet,
die zum Teil noch jetzt nicht überwunden sind. Die wichtigste
Erfindung machte hier Girard in Paris durch Lösung der von
Napoleon I. 1810 gestellten Ausgabe, "den Flachs auf Maschinen zu
spinnen", indem er noch in demselben Jahr ein Patent auf eine
Flachsfeinspinnmaschine erhielt, welche in der Anwendung von
Hechelkämmen zum Ausziehen als auch in der Benutzung von
Wasser (Naßspinnen) die Lösung des Problems darbot und
in der Grundlage unverändert geblieben ist. In der
Kammwollspinnerei war die Erfindung der Kämmmaschine
epochemachend, welche nach unzähligen, zum Teil
beachtenswerten Versuchen erst 1829 von Opelt zu Hartau und Wieck
zu Schlema brauchbare Gestalt annahm, bis einerseits Lister und
Donisthorpe (1850), anderseits Heilmann und Schlumberger zu
Mühlhausen (1851) die schwierige Aufgabe des
Maschinenkämmens auf zwei verschiedenen Wegen glänzend
lösten. Vgl. B. Nieß, Baumwollspinnerei (2. Aufl., Weim.
1885); Leigh, Science of modern cotton spinning (3. Aufl., Lond.
1875, 2 Bde.); Grothe, Technologie der Gespinstfasern, Bd. 1 (Berl.
1877); Lohren, Kämmmaschinen (Stuttg. 1875); Kronauer, Atlas
der Spinnerei und Weberei (2. Aufl., Hannov. 1878); Marshall, Der
praktische Flachsspinner (deutsch, Weim. 1888); Pfuhl, Die Jute und
ihre Verarbeitung (Berl. 1888); Hoyer, Spinnerei und Weberei (2.
Aufl., Wiesb. 1888).
Spinnendistel, s. Cnicus.
Spinnentiere (Arachniden, Arachnida, hierzu Tafel
"Spinnentiere"), Klasse der Gliederfüßler (Arthropoden),
meist kleine Tiere von sehr mannigfacher Gestalt. Kopf und Brust
sind bei ihnen gewöhnlich zu Einem Stück, dem sogen.
Cephalothorax, verschmolzen. Die vordern, als Kiefer verwendeten
Gliedmaßen des Kopfes, die Kieferfühler, entsprechen
vielleicht den Fühlern der Insekten, dienen aber nicht als
solche, sondern als Kiefer und enden oft mit einer Schere
(Skorpione) oder Klaue (Spinnen); auch das zweite
Gliedmaßenpaar, die Kiefertaster, hat im allgemeinen
ähnlichen Bau und ähnliche Verwendung. Es folgen dann
vier Paar Beine, von denen nur selten das erste als Taster und
Kiefer zugleich fungiert, gewöhnlich jedoch gleich den
übrigen zum Laufen dient. Diese Beine bestehen aus sechs oder
sieben Gliedern. Der Hinterleib ist äußerst verschieden
und hat seine Zusammensetzung aus Ringen (Segmenten) nur noch bei
den Skorpionen und ihren nächsten Verwandten bewahrt, ist bei
den Spinnen einfach rundlich und durch einen dünnen Stiel mit
dem Cephalothorax verbunden, bei den Milben sogar mit diesem
verschmolzen. Er trägt keine Beine. Auch der innere Bau ist
bei den einzelnen Ordnungen der S. sehr verschieden. Das
Nervensystem ist meist in Gehirn und Bauchmark geschieden,
letzteres auch wohl in eine Reihe Nervenknoten (Ganglien) getrennt,
gewöhnlich jedoch zu einer einzigen Nervenmasse verschmolzen.
Die Augen sind unbeweglich und stehen, 2-12 an der Zahl, auf der
Oberseite des Cephalothorax; Gehörorgane sind nicht mit
Sicherheit bekannt; zum Tasten dienen die Kiefertaster und die
Enden der Beine. Der Darmkanal läuft meist geradlinig vom Mund
zum After und zerfällt in eine engere Speiseröhre und
einen weitern, meist mit seitlichen Blindsäcken versehenen
Darm; häufig läßt sich an letzterm der Anfang als
Magen unterscheiden. Speicheldrüsen, Leber und Harnorgane in
verschiedener Form sind fast immer vorhanden. Kreislaufsorgane
fehlen nur bei den niedersten Milben, bei den übrigen liegt
das Herz gewöhnlich als mehrkammeriges
Rückengefäß im Hinterleib; es besitzt seitliche
Spaltöffnungen zum Eintritt des Bluts und häufig
Arterienstämme am vordern und hintern Ende. Besondere
Atmungsorgane fehlen gleichfalls bei manchen Milben völlig und
sind im übrigen Tracheen (s. d.), in welche die Luft durch
Luftlöcher (Stigmen) eintritt. Mit Ausnahme der Tardigraden
(s. unten) sind die S. getrennten Geschlechts. Die Männchen,
oft durch äußere Merkmale unterschieden, besitzen
paarige Hodenschläuche, aber in der Regel keine eignen
Begattungsorgane, so daß mitunter so entfernt gelegene
Gliedmaßen wie die Kiefertaster der Spinnen die
Übertragung des Samens auf das Weibchen übernehmen.
Letzteres hat einen unpaaren oder paarige Eierstöcke, deren
Eileiter meist gemeinschaftlich am Anfang des Hinterleibs
ausmünden. Die meisten S. legen Eier, die sie zuweilen in
Säcken bis zum Ausschlüpfen der Jungen mit sich
herumtragen. Letztere haben meist schon die Form der ausgewachsenen
Tiere; wenige durchlaufen eine wahre Metamorphose. Die Lebensdauer
der S. ist nicht wie die der Insekten eine beschränkte; sie
häuten sich auch noch nach Eintritt der Zeugungsfähigkeit
in bestimmten Zeiträumen und sind zu wiederholten Malen
fortpflanzungsfähig. Sie besitzen ein zähes Leben, so
daß manche monatelang ohne Nahrung existieren können,
und eine bedeutende Reproduktionskraft, welche sich z. B. im
Wiederersatz verlorner Beine äußert. Sie nähren
sich meist vom Raub andrer Gliedertiere, besonders der Insekten,
die sie meist nur aussaugen; unter den niedrigsten Formen leben
einige parasitisch an Wirbeltieren; wenige nähren sich von
pflanzlichen Säften. Fast sämtlich sind sie Landtiere,
welche sich vielfach am Tag verborgen halten und nur nachts auf
Raub ausgehen. Sie sind über den ganzen Erdkreis verbreitet,
doch finden sich in den heißern Zonen die meisten und
größten Arten. Die nicht besonders zahlreichen fossilen
Arten gehen bis in das Steinkohlengebirge zurück (z. B. die
Skorpiongattung Cyclophthalmus, s. Tafel "Steinkohlenformation
I").
Man teilt die S. in sechs oder mehr Ordnungen ein (die
früher hierher gestellten Krebsspinnen, Pan-
154
Spinnentiere.
topoda oder Pycnogonidae, sind als selbständige Gruppe
nicht mit eingerechnet), nämlich: 1) Gliederspinnen
(Arthrogastra), welche durch ihren gegliederten Hinterleib und auch
den innern Bau noch am meisten der ursprünglichen Form der S.
zu entsprechen scheinen, während alle übrigen S. mehr
oder weniger abgeändert sind. Zu ihnen gehören unter
andern die Skorpione (s. Gliederspinnen). 2) Echte Spinnen oder
Spinnen im engern Sinn (s. unten). 3) Milben (Acarina), schon stark
rückgebildete Formen, die aber noch deutlich ihre
Zugehörigkeit zu den Spinnentieren verraten. 4) Tardigraden.
5) Zungenwürmer, beides, namentlich aber die letztern,
Ordnungen von eigentümlichstem Bau.
Die Tardigraden (Tardigrada) sind kleine, sich langsam bewegende
Tiere mit wurmartigem Körper, der nicht in Cephalothorax und
Abdomen geschieden ist, mit saugenden und stechenden Mundteilen und
vier Paar kurzen, stummelförmigen Beinen. Herz und Tracheen
fehlen ganz. Sie sind Zwitter und legen die Eier während der
Häutung in die abgeworfene Haut ab; sie leben zwischen Moos
und Algen, auf Ziegeln in Dachrinnen, zum Teil auch im Wasser,
nähren sich von kleinen Tieren und können nach langem
Eintrocknen durch Befeuchten wieder ins Leben gerufen werden.
Hierher gehören nur wenige Arten, unter andern das
Bärtierchen (Arctiscon tardigradum).
Die Zungenwürmer oder Pentastomiden (Linguatulidae),
früher allgemein zu den Eingeweidewürmern gerechnet, sind
durch Parasitismus außerordentlich rückgebildete,
milbenartige S. mit wurmförmigem, geringeltem Körper,
verkümmerten Mundwerkzeugen und Beinen, an deren Stellen zwei
Paar Klammerhaken getreten sind, ohne Augen und ohne besondere
Atmungs- und Kreislaufsorgane, mit einfachem Darm. Beide
Geschlechter (das Weibchen ist bedeutend größer als das
Männchen) hausen im erwachsenen Zustand in den Luftwegen von
Warmblütern und Reptilien. Das hierher gehörige
Pentastomum taenioides Rud. (Textfig. 1), dessen Männchen 8 cm
und dessen Weibchen nur 2 cm lang wird, lebt in den Nasen-, Stirn-
und Kieferhöhlen des Hundes und Wolfs; seine Embryonen
gelangen mit dem Nasenschleim auf Pflanzen und von da in den Magen
der Kaninchen, Hasen, Ziegen, Schafe, seltener Rinder und Katzen,
auch wohl des Menschen; sie schlüpfen aus, durchbohren die
Darmwandungen, gehen in die Leber, kapseln sich hier ein und
durchlaufen nach Art der Insektenlarven eine Reihe von
Verwandlungen, durchbohren später die Kapsel und gelangen in
die Leibeshöhle ihrer Wirte, kapseln sich aber, wenn sie
daraus nicht bald befreit werden, wieder ein und sterben ab (sie
sollen indes auch durch Lunge und Luftröhre auswandern).
Gelangen sie mit dem Fleisch ihres Wirtes in die Rachenhöhle
des Hundes, so dringen sie in die benachbarten Lufträume und
werden in 4-5 Monaten geschlechtsreif. Mit zahlreichen Pentastomen
behaftete Hunde zeigen oft starke Anfälle von Tob- und
Beißsucht, die leicht mit Tollwut verwechselt werden
können. Der junge Zungenwurm, früher als eigne Art (P.
denticulatum, Textfig. 2) beschrieben, kann in Lunge und Leber
seines Wirtes furchtbare Verheerungen anrichten, auch bei
zahlreichem Auftreten den Tod veranlassen.
Die Spinnen oder Webspinnen (Araneina) haben einen
ungegliederten, gestielten und stark hervortretenden Hinterleib.
Ihre großen Kieferfühler enden mit einer wie die Klinge
eines Taschenmessers einschlagbaren Klaue, an deren Spitze der
Ausführungsgang einer Giftdrüse mündet, deren Saft
in die durch die Klaue geschlagene Wunde fließt und kleinere
Tiere fast augenblicklich tötet. Die Unterkiefer tragen einen
mehrgliederigen Taster, beim Weibchen von der Form eines
verkürzten Beins, beim Männchen mit aufgetriebenem, als
Begattungsorgan dienendem Endglied. Die vier meist langen,
übrigens bei den einzelnen Gattungen sehr verschieden gebauten
Beinpaare enden mit zwei kammartig gezahnten Krallen, oft noch mit
kleiner unpaarer Afterkralle oder einem Büschel gefiederter
Haare. An der Bauchseite des Hinterleibs liegt die
Geschlechtsöffnung, und seitlich von ihr befinden sich die
beiden Spaltöffnungen der sogen. Lungensäckchen,
öfters auch noch ein zweites Stigmenpaar. Den After umgeben am
Ende des Hinterleibs vier oder sechs Spinnwarzen, aus denen die
Absonderung der Spinndrüsen hervortritt. Letztere sind
birnförmige, cylindrische oder gelappte Schläuche; ihr
Sekret gelangt durch Hunderte feiner Röhrchen nach
außen, erhärtet an der Luft schnell zu einem Faden und
wird unter Beihilfe der Fußklauen zu dem bekannten Gespinst
verwebt. Das Nervensystem besteht aus dem Gehirn und aus einer
gemeinsamen Brustganglienmasse. Hinter dem Stirnrand stehen acht,
seltener sechs kleine Punktaugen in einer nach den Gattungen und
Arten verschiedenen Anordnung. Der Darmkanal zerfällt in
Speiseröhre, Magen mit fünf Paar Blindschläuchen und
Darm, in welchen die Lebergänge und zwei verästelte
Harnkanäle münden. Der Lebersaft wirkt ähnlich dem
der Bauchspeicheldrüse der höhern Wirbeltiere. Die
Atmungsorgane sind meist eigentümliche sogen.
Fächertracheen oder Tracheenlungen (s. Tracheen), auch
Lungensäckchen genannt; doch finden sich außerdem auch
wohl noch gewöhnliche Tracheen. Das Blut fließt aus
einem pulsierenden, im Hinterleib gelegenen
Rückengefäß durch Arterien nach den
Gliedmaßen und dem Kopf, umspült zurückkehrend die
Lungensäckchen und tritt durch drei Paar seitliche
Spaltöffnungen in das Rückengefäß zurück.
Alle Spinnen legen Eier und tragen sie häufig in besondern
Gespinsten mit sich herum. Die Männchen haben einen Hinterleib
von geringerm Umfang als die Weibchen; das verdickte
154a
Spinnfaserpflanzen.
Cannabis sativa (Hanf), a Weibliche uud b männliche
Pflanze. (Art. Hanf.)
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl.
Bibliographisches Institut in Leipzig.
Zum Artikel »Spinnfaserpflanzen«.
155
Spinner - Spinnfasern,
Endglied der Kiefertaster ist löffelförmig
ausgehöhlt und enthält einen spiralig gebogenen Faden
nebst hervorstreckbaren Anhängen. Bei der Begattung füllt
das Männchen dies Glied mit Samen und führt es in die
weibliche Geschlechtsöffnung ein, wo sich ein besonderes
Behältnis zur Aufbewahrung des Samens (Samentasche) befindet.
Zuweilen leben beide Geschlechter friedlich nebeneinander in
benachbarten Gespinsten oder selbst eine Zeitlang in demselben
Gespinst; in andern Fällen stellt das stärkere Weibchen
dem schwächern Männchen wie jedem andern Tier nach, und
selbst bei der Begattung ist dieses gefährdet. Die
Entwickelung im Eie ist insofern interessant, als der Embryo eine
Zeitlang einen deutlich aus 10 bis 12 Segmenten bestehenden
Hinterleib besitzt, an dem sich auch die Anlagen von
Gliedmaßen zeigen, die aber im weitern Verlauf samt der
Gliederung wieder verschwinden. Die ausschlüpfenden Jungen
erleiden keine Metamorphose, bleiben aber bis nach der ersten
Häutung im Gespinst der Eihüllen. - Alle Spinnen
nähren sich vom Raub: die vagabundierenden überfallen die
Tiere im Lauf oder Sprung; andre bauen Gespinste, welche bei den
verschiedenen Gattungen sehr wesentlich voneinander abweichen und
zum Fang von Insekten dienen; oft finden sich in der Nähe
derselben röhren- oder trichterartige Verstecke zum Aufenthalt
der Spinnen. Die meisten Spinnen ruhen am Tag und jagen in der
Dämmerung. Junge Spinnen erzeugen im Herbst lange Fäden
(sogen. Alterweibersommer, s. d.), mittels welcher sie sich hoch in
die Luft erheben, vielleicht um sich zur Überwinterung an
geschützte Orte tragen zulassen.
Man kennt mehrere tausend Arten Spinnen; fossil finden sie sich
namentlich in Bernstein eingeschlossen vor. Man ordnet sie in zwei
größere Gruppen: 1) Vierlunger (Tetrapneumones), mit 4
Lungensäcken und 4 Stigmen, 4, selten 6 Spinnwarzen. Hierher
nur die Familie der Vogelspinnen (Theraphosidae), s. Vogelspinne.
2) Zweilunger (Dipneumones), mit 2 Lungensäcken und 2 oder 4
Stigmen (in diesem Fall führt das hintere Paar zu
Tracheenstämmen), stets 6 Spinnwarzen. Sie zerfallen in
mehrere kleinere Gruppen: a) Springspinnen (Saltigradae), b)
Wolfsspinnen (Citigradae), unter andern mit der Gattung Lycosa
(Tarantel, s. d.), c) Krabbenspinnen (Laterigradae), unter andern
mit der Gattung Thomisus (umherschweifende Krabbenspinne, T.
viaticus C. L. Koch), d) Röhrenspinnen (Tubitelariae), zu
denen Tegenaria (Hausspinne, T. domestica L.) und Argyroneta
(gemeine Wasserspinne, A. aquatica L.) gehören, e) Webspinnen
(Retitelariae) mit der Gattung Theridium (bekränzte Webspinne,
T. redimitum L.), f) Radspinnen (Orbitelariae) mit der Gattung
Tetragnatha (gestreckte Strickerspinne, T. extensa Walck.) und
Epeira (Kreuzspinne, s. d.).
Vgl. Walckenaer und Gervais, Histoire naturlle des Insectes
aptères (Par. 1836-47, 4 Bde.); Walckenaer, Histoire
naturelle des Aranéides (das. u. Straßb. 1806); Hahn
und Koch, Die Arachniden (Nürnb. 1831-49, 16 Bde.); Koch,
Übersicht des Arachnidensystems (das. 1837-50); Lebert, Bau
und Leben der Spinnen (Berl. 1878).
Spinner (Bombycidae), Familie aus der Ordnung der
Schmetterlinge (s. d.).
Spinnerin am Kreuz, eine von H. v. Puchsbaum 1451 erbaute
gotische Denksäule südlich vor Wien (s.
Betsäulen).
Spinnfasern (hierzu Tafel "Spinnfaserpflanzen"),
vegetabilische oder animalische Gebilde, die sich zur Verarbeitung
auf Gespinste und Gewebe eignen und daher fest, geschmeidig und
womöglich bleichbar sein müssen. Die Zahl der tierischen
S. ist verhältnismäßig gering. Von
größerer Bedeutung sind nur Wolle, Seide und die Haare
einiger Ziegen, des Alpako u. der Vicunna, das Kamelhaar und
Pferdehaar. Viel größer ist die Zahl der vegetabilischen
S., welche auch in ihrer Natur und Beschaffenheit viel mehr
voneinander abweichen. Wir finden darunter Haargebilde,
Gefäßbündel und
Gefäßbündelbestandteile. Die erstern sind fast
ausschließlich Samenhaare, wie die Baumwolle, die Wolle der
Wollbäume und die vegetabilische Seide; viele S. setzen sich
aus den Gefäßbündeln der Blätter, Stämme
oder Wurzeln monokotyler Pflanzen zusammen, wie der
neuseeländische Flachs, die Agavefaser, die Aloefaser und die
Ananasfaser, der Manilahanf und die Tillandsiafaser. Am
häufigsten werden aber Gefäßbündelbestandteile
dikotyler Pflanzen als S. benutzt. Hanf, Flachs, Jute, Sunn etc.
sind Bastbündel oder Fragmente von solchen aus den
Gefäßbündeln der Stengel der betreffenden
Stammpflanzen. Die Farbe der S. ist sehr verschieden: Schwarz,
Braun, bei den vegetabilischen ins Gelbe, Grüne, Graue
geneigt, auch Weiß; sie sind glanzlos bis
seidenglänzend, zum Teil sehr hygroskopisch, so daß
wenigstens bei den animalischen (Seide, Wolle) im Handel der
Wassergehalt der Ware in besondern Anstalten
(Konditionierungsanstalten) festgestellt zu werden pflegt. Aber
auch Baumwolle, welche lufttrocken 6,5 Proz. Feuchtigkeit
enthält, kann über 20 Proz., Manilahanf sogar über
40 Proz. Wasser aufnehmen. Die Hygroskopizität der S. wechselt
bei den Kulturvarietäten einer und derselben Pflanze und
steigt bisweilen bei derselben Faser, wenn diese beim Lagern an der
Luft dunkler wird. Über die Festigkeit der S. liegen
vergleichbare Angaben bis jetzt nicht vor; weitaus am festesten ist
Seide, die übrigen zeigen die mannigfachsten Abstufungen der
Zerreißbarkeit. Die chemische Zusammensetzung der
vegetabilischen S. ist eine sehr gleichartige; die Hauptsubstanz
bildet überall Cellulose, und die Fasern, welche nur aus
letzterer bestehen, sind biegsam, geschmeidig und fest,
während diejenigen, bei denen außer Cellulose noch
Holzsubstanz oder ähnliche Stoffe auftreten, spröde und
brüchig erscheinen und erst nach Entfernung derselben weicher
und biegsamer werden. Eine solche Vervollkommnung der Fasern wird
z. B. durch den Prozeß des Bleichens erreicht; doch ist die
weiße Farbe einer Faser keineswegs ein Beweis, daß sie
frei von Holzfaser sei. Selbst sehr geringe Mengen von letzterer
kann man durch Betupfen mit einer Lösung von schwefelsaurem
Anilin nachweisen, welche die Holzsubstanz bräunt. Alle S.,
die der Hauptmasse nach aus Cellulose bestehen, werden durch Jod
und Schwefelsäure blau gefärbt und durch
Kupferoxydammoniak aufgelöst; die übrigen, denen
größere Mengen von Holzsubstanz oder andern organischen
Stoffen anhaften, werden durch ersteres Reagens gelb oder braun
oder grün bis blaugrün gefärbt und durch
Kupferoxydammoniak entweder nicht verändert, oder nur unter
mehr oder minder deutlicher Quellung gebläut. Alle S.
enthalten mineralische Stoffe und lassen daher beim Verbrennen
Asche zurück. Die tierischen S. weichen in ihrer
Zusammensetzung vollständig von den vegetabilischen ab: sie
enthalten sämtlich Stickstoff und unterscheiden sich sehr
bestimmt von den vegetabilischen durch ihr Verhalten beim
Verbrennen, indem sie vor der Flamme gleichsam schmelzen und unter
Verbreitung eines übeln Geruchs eine schwammige Kohle
hinterlassen, während die Pflan-
156
Spinnmaschine - Spinola.
zenfasern bis auf die Asche vollständig und ohne Geruch
verbrennen. Eine Unterscheidung der einzelnen tierischen und
vegetabilischen S. ist nur durch methodische Prüfung mittels
des Mikroskops und chemischer Reagenzien möglich; letztere
aber leisten im allgemeinen für die rohen Fasern nicht viel
und für die gebleichten, welche sämtlich aus reiner
Cellulose bestehen, naturgemäß sehr wenig oder
nichts.
Pflanzen, welche zur Darstellung von Gespinsten taugliche Fasern
liefern, finden sich in zahlreichen Familien und bilden, soweit sie
größere Wichtigkeit besitzen, den Gegenstand
ausgedehnter Kulturen. Die wichtigsten Spinnfaserpflanzen (vgl.
beifolgende Tafel) gehören zu den Malvaceen (Gossypium-Arten
liefern die Baumwolle, Hibiscus-Arten den Gambohanf; auch sind
Abelmoschus tetraphyllus, Sida retusa, Thespesia lampas und Urena
sinuata zu erwähnen), den Kannabineen (Hanf von Cannabis
sativa), Lineen (Flachs, Linum usitatissimum), Tiliaceen (Jute von
Corchorus-Arten), den Urtikaceen (Chinagras und Ramé von
Boehmeria-Arten, Nesselfasern von Urtica-Arten), den Palmen
(Arenga, Caryota, Piassava von Attalea funifera, Kokosfaser von
Cocos nucifera etc.), den Musaceen (Manilahanf von Musa-Arten), den
Bromeliaceen (Agavefasern von Agave-Arten, Ananasfaser von Ananassa
sativa, Silkgras von Bromelia karatas, Tillandsiafaser von
Tillandsia usneoides), den Asphodeleen (neuseeländischer
Flachs von Phormium tenax), den Papilionaceen (Sunn von Crotalaria
juncea, auch Spartium-Arten). Erwähnung verdienen ferner: die
Bombaceen mit den Bombax-Arten Eriodendron anfractuosum und Ochroma
Lagopus, die Datisceen mit Datisca cannabina, die Kordiaceen mit
Cordia latifolia, die Asklepiadeen mit Beaumontia grandiflora,
Calotropis gigantea, Asclepias-Arten etc., welche sämtlich
vegetabilische Seide liefern, die Moreen mit Broussonetia-Arten,
die Pandaneen mit Pandanus odoratissimus und die Gramineen mit dem
Espartogras (Stipa tenacissima). Weitaus die größte
Bedeutung von allen haben aber Baumwolle, Flachs und Hanf, welchen
sich noch die Jute anschließt. Die übrigen
Spinnfaserpflanzen, zum Teil seit alter Zeit in Gebrauch, haben in
der neuern Industrie doch erst angefangen, einen Platz sich zu
erobern, was der Jute, in gewissem Grad auch dem Chinagras,
Ramé, der Piassava, der Agavefaser, dem Manilahanf, der
Kokosfaser und einigen andern bereits gelungen ist und
voraussichtlich noch weiter gelingen wird. Beherrscht Nordamerika
durch seine Baumwolle das ganze Gebiet, so wird es doch an
Mannigfaltigkeit der dargebotenen Fasern weit übertroffen von
Asien, speziell von Indien, woher wir wohl die wichtigsten
Bereicherungen auch ferner noch zu erwarten haben. Vgl. Royle, The
fibrous plants of India (Lond. 1855); Wiesner, Beiträge zur
Kenntnis der indischen Faserpflanzen (Sitzungsberichte der Wiener
Akademie, Bd. 62); Derselbe, Rohstoffe des Pflanzenreichs (Leipz.
1873); Richard, Die Gewinnung der Gespinstfasern (Braunschw.
1881).
Spinnmaschine s. Spinnen, S. 148 f.
Spinnrad s. Spinnen, S. 148 f.
Spinnstube (auch Lichtstube), der ehemals auf dem flachen
Land und namentlich in den Gebirgsgegenden weitverbreitete
Gebrauch, die langen Winterabende gemeinsam in geselliger
Handarbeit hinzubringen. Die S. wird abwechselnd auf dem einen oder
andern Hof abgehalten, die Frauen und Mädchen spinnen, die
Burschen machen Musik, oder es werden Volkslieder gesungen, Hexen-
und Gespenstergeschichten erzählt und allerlei Kurzweil dabei
getrieben. Wegen der dabei vorkommenden Ausschreitungen in
sittlicher Beziehung mußten in verschiedenen Ländern
"Spinnstubenordnungen", d. h. polizeiliche Regelungen
bezüglich der Zeit und Dauer des Beisammenseins, erlassen
werden, ja im Bereich des ehemaligen Kurhessen wurden sie bereits
1726 gänzlich verboten. In Nachahmung dieser alten Dorfsitte
wurden im Palast Emanuels d. Gr. zu Evora, wo die glänzendste
Periode des portugiesischen Hoflebens sich abspielte, die von
mehreren Dichtern geschilderten "portugiesischen Spinnstuben"
(Seroëns de Portugal) abgehalten.
Spinnwebenhaut (Arachnoïdea), die mittlere Hirnhaut
(s. Gehirn, S. 2).
Spinnwurm, s. Wickler.
Spinola, 1) Ambrosio, Marchese de los Balbazes, span.
General, geb. 1571 zu Genua aus altem ghibellinischen Geschlecht,
zeichnete sich seit 1599 mehrfach in den Diensten König
Philipps III. von Spanien aus und unterstützte mit einem Korps
von 9000 Mann alter italienischer und spanischer Truppen, nach Art
der frühern Condottieri, den Erzherzog Albrecht von
Österreich bei der Belagerung von Ostende (1602-1604). Hierauf
zum Generalleutnant und Kommandierenden aller in den Niederlanden
kämpfenden spanischen Truppen ernannt, stand er seit 1605 dem
Prinzen Moritz von Oranien in Flandern gegenüber; doch
vermochte keiner einen wesentlichen Vorteil zu erlangen. 1620 von
Spanien zur Unterstützung des Kaisers Ferdinand II. gegen die
protestantischen Reichsfürsten abgesandt, drang er im August
an der Spitze von 23,000 Mann in die Pfalz ein und eroberte viele
Städte, ward aber 1621 in die Niederlande berufen, wo er
wieder gegen Moritz kämpfte. Durch Entlassung der meuterischen
italienischen Truppen geschwächt, konnte er den Krieg trotz
der Eroberung Jülichs (1622) nur lau fortsetzen und erst im
Sommer 1624 die Belagerung von Breda unternehmen, welchen Platz er
2. Juni 1625 endlich zur Übergabe zwang. Seitdem
kränkelnd, mußte er den Oberbefehl niederlegen. Nur noch
einmal trat er 1629 in Italien auf, indem er in dem Streit um das
Erbe des Markgrafen von Mantua die Franzosen aus Montferrat
vertrieb und sie in Casale einschloß. Er starb 25. Sept. 1630
in Castelnuovo di Scrivia. Vgl. Siret, S., épisode du temps
d'Albert et d'Isabelle (Antwerp. 1851).
2) Christoph Rojas de, Vertreter des Gedankens der Union
zwischen Katholiken und Protestanten, aus Spanien gebürtig,
trat in den Franziskanerorden, ward 1685 Beichtvater der
österreichischen Kaiserin und 1686 Bischof von
Wiener-Neustadt. Seine Unionspläne, zu deren Durchführung
er die meisten deutschen Residenzen (1676 und 1682) aufsuchte,
fanden Anklang am hannöverschen Hof; der Philosoph Leibniz und
der Abt Molanus ließen sich in nähere Verhandlungen mit
ihm ein (1683). Seine Schrift "Regulae circa christianorum omnium
ecclesiasticam reunionem" bot als Zugeständnisse von
katholischer Seite an: deutschen Gottesdienst, Laienkelch,
Priesterehe, Aufhebung der Tridentiner Beschlüsse bis zum
Zusammentritt eines neuen Konzils etc., forderte dagegen von den
Protestanten Unterordnung unter die katholische Kirchenverfassung
nebst Anerkennung des päpstlichen Primats. Gegen diese Basis
der Verhandlungen erklärte sich Bossuet, während Innocenz
XI. dieselbe anzunehmen nicht abgeneigt war. Der Tod Spinolas
(1695) raubte diesem unionistischen Unternehmen seinen ebenso
tiefreligiösen wie geschäftsgewandten Leiter.
157
Spinös - Spinoza.
Spinös (lat.), dornig; schwer zu behandeln.
Spinoza (eigentlich d'Espinosa), Baruch (Benedikt),
berühmter Philosoph, geb. 24. Nov. 1632 zu Amsterdam als Sohn
jüdischer Eltern portugiesischen Ursprungs, ward zum Rabbiner
gebildet, aber seiner freien Religionsanschauungen wegen aus der
Gemeinde ausgestoßen, verließ seine Vaterstadt und
ließ sich nach wechselndem Aufenthalt im Haag nieder, wo er,
um seine Unabhängigkeit zu bewahren, sich seinen Unterhalt
durch Unterrichterteilung und durch Schleifen optischer Gläser
erwarb. Eine ihm vom Kurfürsten von der Pfalz angebotene
Professur zu Heidelberg sowie eine ihm von seinem Freund Simon de
Vries zugedachte Erbschaft schlug er aus gleichem Grund aus und
starb arm, unvermählt und unberühmt 21. Febr. 1677 in
Scheveningen an der Lungenschwindsucht. Über die innere
Entwicklung seines Gedankenkreises weiß man wenig. Einerseits
ist die talmudistische Vorschulung, anderseits das Studium der
Cartesianischen Schriften in Anschlag zu bringen. Die erste
Jugendarbeit Spinozas war eine verhältnismäßig
unselbständige Darstellung der Cartesianischen Prinzipien nach
seiner Lieblingsmethode, der geometrischen des Eukleides. Hierauf
folgte der "Theologisch-politische Traktat" ("Tractatus
theologico-politicus") und zwar anonym (1670). Das epochemachende
Hauptwerk, die "Ethik" ("Ethica"), obgleich seinen Hauptzügen
nach als ursprünglich in holländischer Sprache
abgefaßter, erst neuerlich (durch van Vloten) wieder
aufgefundener Traktat "Von Gott und dem Menschen" in früher
Zeit vollendet, wurde erst nach seinem Tod von seinem Freunde, dem
Arzt Ludwig Mayer, herausgegeben. Zwei unvollendete, ebenfalls
nachgelassene Schriften, der "Politische Traktat" u. die
"Abhandlungen über die Verbesserung des Verstandes" ("De
intellectus emendatione"), kamen hinzu. Spinozas epochemachende
"Ethik" ist der Form nach, im Gegensatz zu der analytischen
(regressiven, von den Folgen auf die Gründe
zurückgehenden) Denkweise des Descartes, in synthetischer
(progressiver, von dem ersten Grund zu den äußersten
Folgerungen fortschreitender) Darstellung und nach der Methode des
Eukleides in Grundbegriffen, Axiomen, Theoremen, Demonstrationen
und Korollarien abgefaßt, wodurch sie (gleich ihrem Vorbild)
den Anschein unumstößlicher Gewißheit
empfängt. Dem Inhalt nach stellt dieselbe gleichfalls einen
Gegensatz zum Cartesianismus dar, indem an die Stelle der
dualistischen eine monistische Metaphysik tritt. Spinozas
Philosophie knüpft daher zwar an die des Descartes (s. d.) an,
aber nur, um dessen System der Form und dem Inhalt nach aufzuheben.
Dieselbe ist mit ihrer Vorgängerin zwar darüber
einverstanden, daß Geist, dessen Wesen im Denken, und
Materie, deren Wesen in der Ausdehnung besteht, einen
(qualitativen) Gegensatz bilden, jener ohne das Merkmal der
Ausdehnung, diese ohne das des Denkens gedacht werden kann. Aber S.
leugnet, daß derselbe ein Gegensatz zwischen Substanzen
(Dualismus) sei, sondern setzt ihn zu einem solchen zwischen
bloßen "Attributen" einer und derselben Substanz (Monismus)
herunter. Da nämlich aus dem Begriff der Substanz, d. h. eines
Wesens, das seine eigne Ursache (causa sui) ist, folgt, daß
es nur eine einzige geben kann, so können Geist und Materie
(die zwei angeblichen Substanzen des Cartesianismus, zwischen
welchen ihres Gegensatzes halber keine Wechselwirkung möglich
sein soll) nicht selbst Substanzen, sondern sie müssen
Attribute einer solchen (der wahren und einzigen Substanz) sein,
welche an sich weder das eine noch das andre ist. Diese (einzige)
Substanz, welche als solche mit Notwendigkeit existiert, und zu
deren Natur die Unendlichkeit gehört, nennt S. Gott (deus),
dasjenige, was der Verstand (intellectus) von derselben als deren
Wesen (essentia) ausmachend erkennt, Attribut, die Substanz selbst
bestehend aus unendlichen Attributen, deren jedes (nach seinem
Wesen) deren ewige und unendliche Wesenheit ausdrückt. Zwei
derselben (die einzigen, deren S. Erwähnung thut) sind nun
Denken und Ausdehnung (dieselben, welche, nach Descartes, als Wesen
des Geistes und der Materie diese zu zweierlei entgegengesetzten
Substanzen machen sollten); unter dem erstern aufgefaßt,
erscheint die Substanz dem Intellekt als das unendliche Denkende
(als unendliche Geisteswelt), unter dem zweiten aufgefaßt,
als das unendlich Ausgedehnte (als unendliche Stoffwelt); beide
sind, da außer Gott keine andre Substanz existiert, der
Substanz nach identisch (keine qualitativ entgegengesetzten
Substanzen mehr, daher der Cartesianische Einwand gegen die
Möglichkeit der Wechselwirkung zwischen Geist und Materie,
Seele und Leib, beseitigt erscheint). Das unendliche (als solches
unbestimmte) Denken zerfällt durch (inhaltliche) Bestimmung in
unzählig viele Gedanken (Ideen); die unendliche (als solche
unbegrenzte) Ausdehnung zerfällt durch (räumliche)
Begrenzung in unzählig viele Stoffmassen (Körper), die
sich untereinander ebenso gegenseitig ausschließen, als sich
(in stetiger Reihenfolge) gegenseitig berühren. S. bezeichnet
dieselben als Modi, d. h. als Affektionen der Substanz, die Ideen
als solche, insofern die Substanz unter dem Attribut der denkenden,
die Körper als solche, insofern sie unter dem Attribut der
ausgedehnten Wesenheit vorgestellt wird. Da beide Attribute der
Substanz nach identisch sind, das unendliche Denken aber der Summe
aller einzelnen Denkbestimmungen (Ideen), die unendliche Materie
der Summe aller einzelnen begrenzten Stoffteile (Körper)
gleich ist, so müssen auch diese beiden in ihrer stetigen
Reihenfolge untereinander (der Substanz nach) identisch und kann
zwischen der (idealen) Gesetzmäßigkeit des Ideenreichs
und der (mechanischen) Gesetzmäßigkeit der
Körperwelt kein Gegensatz vorhanden sein. S. stellt daher
nicht nur den Satz auf, daß aus dem unendlichen Wesen Gottes
(als natura naturans) Unendliches auf unendlich verschiedene Weise
folge (als natura naturata), sondern auch den weitern, daß
die Folge und Verknüpfung der Ideen (die ideale) und jene der
Sachen (die reale Weltordnung) eine und dieselbe (ordo et connexio
idearum idem est ac ordo et connexio rerum) seien. Folge des
erstern ist, daß die Gesamtsumme der Wirkungen Gottes (die
Welt der Erscheinungen) ihrer Beschaffenheit sowohl als ihrer
Verknüpfung nach als eine unabänderliche, von Ewigkeit
her feststehende, weil in der ewigen und unwandelbaren Natur Gottes
(der alleinen Substanz) als Ursache begründete, angesehen
werden muß. Folge des zweiten ist, daß die im Reich des
Geistes waltende sittliche) von der das Reich der Materie regelnden
(mechanischen) Gesetzlichkeit nicht verschieden, das die
Erscheinungen der Natur ausnahmslos beherrschende Kausalgesetz
daher auch das die Erscheinungen des Geistes bestimmende sei. So
wenig in der Körperwelt eine Wirkung ohne (zwingende) Ursache,
so wenig ist in der Geisteswelt ein Willensentschluß ohne
(nötigendes) Motiv (und daher keine indeterministische
Willensfreiheit) möglich. Die (geistigen wie
körperlichen) Erscheinungen selbst als Entfaltung der
(all-einen) Substanz sind weder das Werk einer Vorsehung (da die
Substanz als solche
158
Spinster - Spirale.
weder Intelligenz noch Willen besitzt, von einem "Weltplan" oder
gar einer "Wahl" zwischen mehreren Weltplänen nicht die Rede
sein kann) noch eines blinden Verhängnisses (da die Substanz
Ursache ihrer selbst und von nichts außer ihr abhängig
ist). Die Beschaffenheit und Reihenfolge derselben sind nicht durch
Zweck-, sondern lediglich durch wirkende Ursachen bestimmt;
dieselben sind weder nützlich (gut) noch schädlich
(schlecht), sondern einfach notwendig. Als solche ist die Welt
weder die beste noch die schlechteste unter (mehreren)
möglichen, sondern die einzig mögliche. Die Erkenntnis
dieser unabänderlichen Weltordnung ist es, welche den Weisen
vom Thoren scheidet. Während der letztere vom Weltlauf die
Erfüllung seiner Wünsche hofft oder deren Gegenteil
fürchtet, erkennt der erstere, daß jener unabhängig
von diesen unabänderlich feststeht und daher weder Hoffnung
noch Furcht einzuflößen vermag. Die philosophische
Erkenntnis besteht darin, die Dinge zu schauen, wie Gott sie schaut
(unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit, sub specie aeternitatis,
gleichsam "aus der Vogelperspektive"), d. h. jedes Einzelne (Idee,
Körper, Ereignis) im Zusammenhang als Glied des (unendlichen)
Ganzen. Die philosophische Gemütsstimmung besteht einerseits
in der Resignation, d. h. in der Ergebung, welche aus der
Erkenntnis der Notwendigkeit, anderseits in der (intellektuellen)
Liebe zu Gott, welche aus der Erkenntnis der (ursprünglichen)
Göttlichkeit des Weltlaufs entspringt. Da die eine wie die
andre Wissen, d. h. Erkenntnis des (metaphysischen) Wesens der Welt
(als Entfaltung Gottes), voraussetzt, so bildet die
(pantheistische, richtiger akosmistische) Metaphysik die
unentbehrliche Vorbedingung zu der (affekt- und leidenschaftslosen)
Ethik Spinozas. Sowohl um dieses ihres echt philosophischen
Ergebnisses in praktischer wie um ihres auf den Zusammenhang des
Ganzen als Weltorganismus gerichteten Blicks (den übrigens
Leibniz zum mindesten im gleichen Grad besaß) in
theoretischer Hinsicht halber hat die Philosophie Spinozas, die
anfänglich nur in Holland einen kleinen Kreis von
Anhängern fand (de Vries, Mayer u. a.), ein Jahrhundert
später bei Größen ersten Ranges, wie Lessing,
Jacobi, Herder, Goethe u. a., Bewunderung, bei Fichte, Schelling,
Hegel mehr oder weniger eingestandene Nachahmung gefunden. Am 14.
Sept. 1880 ist ihm im Haag ein Denkmal (von Hexamer) errichtet
worden. Für die Erläuterung seiner (selbst von seinen
Freunden oft mißverstandenen) Lehre ist sein ziemlich
umfangreicher Briefwechsel wichtig. Eine vollständige Ausgabe
der Werke Spinozas wurde von Paulus veranstaltet (Jena 1802, 2
Bde.); eine andre von Gfrörer im "Corpus philosophorum optimae
notae", Bd. 3 (Stuttg. 1830), enthält sämtliche Werke
ohne die hebräische Grammatik. Korrekter als die erstgenannte,
aber ohne die Biographie des Colerus ist die Ausgabe von Bruder
(Leipz. 1843-46, 3 Bde.); die neueste ist die von J. van Vloten und
Land (Haag 1882, 2 Bde.). Deutsche Übersetzungen lieferten B.
Auerbach (2. Aufl., Stuttg. 1871, 2 Bde.), welcher die
französische von Saisset (2. Aufl., Par. 1861, 3 Bde.)
vorzuziehen ist, und neuerlich Kirchmann und Schaarschmidt in der
"Philosophischen Bibliothek". Den "Tractatus de deo et homine"
(hrsg. von van Vloten, Amsterd. 1862, und mit Einleitung von
Ginsberg, Leipz. 1877) hat Sigwart (Tübing. 1870) ins Deutsche
übersetzt und erläutert. Über die S. betreffende
Litteratur vgl. van der Linde, S. (Göttingen 1862); über
dessen Philosophie: Sigwart, Der Spinozismus, historisch und
philosophisch erläutert (Tübing. 1839); Thomas, S. als
Metaphysiker (Königsb. 1840); Saintes, Histoire de la vie et
des ouvrages de S. (Par. l842); Trendelenburg, Historische
Beiträge zur Philosophie, Bd. 2 und 3 (Berl. 1855-67); K.
Fischer, Geschichte der neuern Philosophie (Bd. 1, Abt. 2);
Camerer, Die Lehre Spinozas (Stuttg. 1877); Baltzer, Spinozas
Entwickelungsgang (Kiel 1888); Ginsberg, Briefwechsel des S.
(Leipz. 1876, mit der Biographie von Colerus). B. Auerbach
behandelte das Leben Spinozas in einem Roman.
Spinster (engl.), lediges Frauenzimmer.
Spintherismus (griech.), das Funkensprühen.
Spintisieren, grübeln, fein ausspinnen.
Spintrien (lat.), Gemmen oder Münzen mit
unzüchtigen Darstellungen.
Spion (ital.), s. Kundschafter.
Spira, Johannes de (Johann von Speier), wahrscheinlich
einer der deutschen Buchdrucker, die nach der Eroberung von Mainz
1462 auswanderten und die Buchdruckerkunst weiter verbreiteten. Er
war der erste Typograph zu Venedig und zugleich auch der erste
"privilegierte Buchdrucker". Seine ersten Werke sind: Ciceros
"Epistolae" und Plinius' "Historia naturalis" (Vened. 1469). Seine
Ausgabe des Tacitus, zugleich die erste dieses Schriftstellers, ist
das erste mit arabischen Blattziffern bezeichnete Buch (vgl.
Antiqua). Nach seinem 1470 zu Venedig erfolgten Tod führte
sein Bruder Wendelin de S. die Offizin bis 1477 fort; dieser
druckte die erste Ausgabe der Bibel in italienischer Sprache nach
der Übersetzung von Malermi.
Spiraea L. (Spierstrauch, Spierstaude), Gattung aus der
Familie der Rosaceen, Sträucher und Kräuter mit
gefiederten oder ganzen Blättern, ohne oder mit
Nebenblättern, in endständigen Ähren, Trauben,
Rispen oder Doldentrauben stehenden Blüten und mehrsamiger
Balgkapsel. S. ulmaria L. (Krampfkraut, Wurmkraut,
Mädelsüß, Geißbart, Wiesenkönigin),
60-120 cm hoch, mit unterbrochen fiederteiligen Blättern,
großen Nebenblättern, in Trugdolden stehenden,
weißen Blüten und spiralförmig gedrehten, kahlen
Früchtchen, wächst in Europa und Nordasien an feuchten
Stellen. Die Blüten liefern ein ätherisches Öl,
welches salicylige Säure enthält. Dasselbe gilt von S.
filipendula L. (Erdeichel, Haarstrang), deren Früchtchen nicht
spiralig gedreht und behaart sind, und an deren langen,
fadenförmigen Wurzeln erbsengroße Knollen hängen.
Diese Art wächst auf trocknen Wiesen und in Wäldern und
war, wie die vorige, früher offizinell. Gegen 40 andre Arten
aus Südeuropa, Asien und Nordamerika sind beliebte
Ziersträucher.
Spiräaceen, Unterfamilie der Rosaceen.
Spirabel (lat.), atembar, verdunstbar.
Spiraculum (lat.), Luftloch, Öffnung.
Spirale (lat., Spiral-, irrtümlich auch
Schneckenlinie), ebene krumme Linie, die um einen festen Punkt O
unendlich viele Umläufe macht. Die einfachste ist die von
Archimedes untersuchte, welche von einem Punkt P beschrieben wird,
der sich mit gleichförmiger Geschwindigkeit auf einer durch O
gehenden Geraden bewegt, während letztere sich
gleichförmig um O dreht. Es ist also der Abstand O P = r
proportional dem Drehungswinkel Phi (r=a *^Phi, wenn a konstant
ist). Man kann dieselbe zur Teilung der Winkel benutzen, welche auf
die Teilung einer Geraden zurückgeführt wird. Andre
Spiralen sind: die Fermatsche (r² = a²*^Phi), die
hyperbolische oder reciproke (r*^Phi = a), die logarithmische
159
Spiralgefäße - Spiritismus.
(r = ac*^Phi, c wie a konstant). Mit dem Namen S. bezeichnet man
auch bisweilen räumliche Kurven; es bedeutet z. B.
cylindrische oder konische S. den Durchschnitt einer
Schraubenfläche mit einer Cylinder- oder Kegelfläche
(richtiger cylindrische oder konische Schraubenlinie),
sphärische S. die Linie, welche ein Punkt auf der Kugel
beschreibt, wenn seine Länge und Breite proportional sind.
Spiralgefäße, s. Gefäße (der
Pflanzen).
Spiralklappe, s. Darm.
Spiralpumpe, Wasserfördermaschine, welche 1746 von
Wirz in Zürich erfunden wurde. Sie besteht (s. Fig.) aus einem
um eine horizontale Welle A spiralförmig gewundenen Rohr
DEFGHJKL, welches an dem Wasser schöpfenden Ende C
trichterförmig erweitert ist (zu dem sogen. Horn) und mit dem
andern Ende in das hohle Ende der Welle mündet. Eine zwischen
dem Wellenende und dem Steigrohr N eingeschaltete Stopfbüchse
M ermöglicht einen dichten Verschluß während der
Drehung der Welle. Ist nun der Apparat mit den zu unterst gelegenen
Teilen der Schraubenwindungen in ein Wasserbassin getaucht, so wird
von dem Horn bei der Drehung der Welle Wasser geschöpft,
solange seine Mündung sich unter Wasser befindet, bei weiterer
Umdrehung tritt so lange Luft ein, bis das Horn wieder ins Wasser
taucht. Während der dazu erforderlichen einmaligen Umdrehung
ist das zuerst geschöpfte Wasser, da es wegen seiner Schwere
bestrebt ist, immer den zu unterst gelegenen Teil der Schraube
einzunehmen, um einen Schraubengang in dem Rohr vorgerückt,
die ihm folgende Luft wird durch das bei einem zweiten Eintauchen
des Horns aufgenommene Wasser abgesperrt, und so geht es fort, bis
das ganze Schlangenrohr in den untern Teilen seiner Windungen mit
Wasserquantitäten gefüllt ist, die zwischen sich in den
obern Teilen der Windungen Luftsäulen einschließen, die
bis jetzt nur die Spannung der äußern Atmosphäre
besitzen. Sobald nun weiter gedreht wird, will Wasser in das
Steigrohr treten und übt deshalb auf die Flüssigkeit im
Rohr einen Druckwiderstand aus, durch welchen die einzelnen
Flüssigkeitssäulen in den Schraubengängen
entsprechend in die Höhe getrieben werden und nun mit
demselben Druck auf die Flüssigkeit im Steigrohr
zurückwirken können. Dabei wird zunächst von der
zuletzt aufgenommenen Wassersäule CD, ihrer barometrischen
Niveaudifferenz entsprechend, auf die ihr vorangegangene
Luftsäule DE gedrückt, welche den erhaltenen Druck mit
Hilfe der sich daran schließenden Wassersäule EF auf die
folgende Luftsäule FG überträgt; aber auch die
zweite Wassersäule EF übt auf letztere in derselben Weise
wie die erste einen Druck aus, so daß sich der Druck auf die
zweite Luftsäule aus dem Druck der beiden nachgeschöpften
Wassersäulen zusammensetzt. In gleicher Weise summieren sich
die Wasserdrucke bis zur letzten Windung, und der hier herrschende
Druck entspricht derjenigen Druckhöhe, bis zu welcher die
Maschine fördern kann. Diese S. ist nur in wenigen Exemplaren
ausgeführt, wohl aber hat man sie in geeigneter Umformung zur
Erzeugung von Gebläsewind benutzt, indem man am Ende der
Schraube eine Vorrichtung anbrachte, welche zwar die Luft aufnimmt
und in die Windleitung treibt, aber das Wasser unten entweichen
läßt (vgl. Gebläse).
[Spiralpumpe.]
Spiranten (lat.), s. Lautlehre, S. 571.
Spirato (ital., "zu Ende gegangen"), in der
Handelssprache s. v. w. im verflossenen Monat oder Jahr.
Spirdingsee, Landsee im preuß. Regierungsbezirk
Gumbinnen, im N. von Johannisburg, mit seinen Verzweigungen 118 qkm
(2,14 QM.) groß, liegt 117 m ü. M., fließt durch
den Pissek (Pysz) zum Narew ab, ist tief und fischreich,
enthält vier Inseln (auf einer derselben das eingegangene Fort
Lyck) und steht gegen N. mit dem Löwentin- und Mauersee durch
die Masurischen Kanäle in schiffbarer Verbindung.
Spirifer, s. Brachiopoden.
Spiriferensandstein, s. Devonische Formation.
Spirillum Ehrb. (Schraubenbakterie), früher Gattung
der Spaltpilze, nach neuern Untersuchungen als Entwickelungsform
von Bakterien (s. d. u. Tafel) erkannt. Man rechnet zu den
Spirillen diejenigen krummen Bacillen, bei welchen ein Auswachsen
zu schraubenartig gewundenen und sich in derselben Form
vermehrenden Fäden beobachtet wird. Dahin gehören der
Kommabacillus der Cholera, das S. von Finkler und Prior bei Cholera
nostras, das S. (Spirochaete) bei Rückfallfieber, das S.
(Spirochaete) des Zahnschleims etc.
Spiritismus (neulat., auch Spiritualismus, aber dann zu
unterscheiden von der gleichnamigen philosophischen Richtung), der
in der Neuzeit wieder stark entwickelte Glaube, daß nicht nur
die Geister der abgeschiedenen Menschen fortleben, sondern
daß auch ein beständiger und leichter Verkehr mit ihnen
möglich sei. Ein solcher Verkehr kann aber angeblich nur von
wenigen Auserwählten unmittelbar gepflogen werden, welche als
Mittelspersonen (Medien) den Geistern eine Art dünnen
Körpers zu leihen vermögen, damit sich dieselben
"materialisieren" und unsern gröbern Sinnen bemerklich machen
können. Der menschliche Geist, ein persönliches,
immaterielles Wesen, wäre nach dieser Theorie von einem
besondern, die niedern tierischen Funktionen leitenden, im
Körper verteilten ätherischen Fluidum, dem Perisprit,
gleichsam aufgelöst und durch dieses Vehikel erst dem
Körper zeitweise verbunden, könne aber auch schon im
Leben denselben gelegentlich verlassen (Verzückung,
Doppeltgehen etc.) und Fernwirkungen ausüben, namentlich bei
den Medien, deren Geist nur sehr lose "verzellt" ist. Von jener
seelischen Hülle des Geistes sollen nun die Medien einen
gewissen Überfluß besitzen, eine Aura desselben um sich
verbreiten und davon den überall im Raum verteilten Geistern
so viel abgeben können, daß diese sich für kurze
Zeit den Sterblichen offenbaren können. Ihre Manifestationen
und Materialisationen geschehen angeblich durch Erscheinen im
Dunkeln in ganzer Gestalt oder wenigstens als leuchtende Hände
oder Gesichter und sollen, wenn selbst das Auge nicht im stande
sein sollte, das zarte Lichtgebilde zu erkennen, wenigstens auf der
photographischen Platte ihre Spur zurücklassen. Die
Geisterphotographie bildet in Amerika ein schwunghaft betriebenes
Geschäft, welches kaum dadurch gelitten hat, daß einer
oder der andre dieser Künstler vor Gericht den groben Betrug
eingestand, wie der Photograph Buguet in Paris (1875). In neuerer
Zeit sind dazu noch die Abdrücke der Geisterhände in
Mehlschüsseln oder in Gips gekommen. Eine andre Art der
Offenbarung
160
Spirito - Spiritualismus.
ist diejenige durch Musik, die wichtigste von allen aber die
durch mechanische Wirkungen, weil man darauf eine Verkehrsmethode,
eine wirkliche Unterhaltung mit den Geistern basiert. Die Antworten
werden entweder durch eigentümliche Klopftöne im
Sitzungstisch oder in andern Möbeln etc. gegeben, um dadurch
die Folge der Buchstaben festzustellen, oder kürzer mit dem
Manulektor oder Psychographen (s. d.) direkt geschrieben. An dessen
Stelle ist in neuester Zeit namentlich durch das Medium Slade die
unsichtbare Niederschrift der Antwort auf eine unter den Tisch oder
hinter den Rücken gehaltene Schiefertafel getreten. Jedes
Medium hat in der Regel seine besondere Art, zu "arbeiten", und man
unterscheidet danach Klopfmedien, Schreibmedien etc. Die
Spiritisten geben allgemein zu, daß die Geisterantworten oft
ungemein albern, zuweilen auch neckisch sind; aber sie
erklären sich dies dadurch, daß es auch unwissende,
unorthographisch schreibende und boshafte Geister gebe. Weitere
mechanische Leistungen der Geister sind: die Entfesselungen
gebundener Medien, Knotenknüpfen in beiderseits festgehaltenen
Schnüren, Ineinanderbringen hölzerner Ringe, die aus
einem Stück bestehen, das Erheben der Möbel und andrer
schwerer Gegenstände (s. Tischrücken), Transportierungen
derselben, Schweben der Medien und ähnliche Manifestationen,
in denen besonders das Medium Home sehr geschickt gewesen sein
soll. Zum Gelingen dieser Versuche gehören in der Regel
besondere Vorbedingungen, so z. B., daß die Teilnehmer einer
Soiree durch Berühren der Hände eine Kette
schließen, um angeblich eine Ansammlung und Zirkulation jenes
Fluidums zu erzeugen und damit das Medium zu unterstützen,
welches durch Ausgabe seines Perisprits oft gänzlich
erschöpft werden soll. Manche Versuche gelingen auch
bloß im Dunkeln, weil das Licht angeblich die
Materialisationen hindert. Der in vielen Fällen selbst den
berühmtesten Medien (Home, Slade u. a.) nachgewiesene Betrug
hindert die große Gemeinde der Spiritisten nicht, der Sache
ferner ihr Zutrauen zu schenken. Was die Geschichte dieser
merkwürdigen Bewegung betrifft, so fanden sich ähnliche
Praktiken schon seit alten Zeiten in China, Indien, Griechenland
und Rom, woselbst man zum Teil in sehr ähnlicher Weise
Geisterschriften und Orakel zu erlangen wußte; aber der
neuere Anstoß ging von dem quäkerischen Sektenwesen mit
seinem Geister- und Erleuchtungsglauben aus, welches sich seit
Jahrhunderten in Amerika ausgebreitet hat. Die Geschwister Fox zu
Hydesville bei New York sind die Entdecker der Geisterklopferei
(1849). Fast gleichzeitig damit begann das Tischrücken (s. d.)
für die spiritistischen Anschauungen Propaganda zu machen.
Diese "Offenbarungen" gewannen in Amerika in der That sehr bald
zahlreiche Anhänger, die eine förmliche Kirche bildeten
und ihre Überzeugungen durch eine große Menge
Zeitschriften und Broschüren stärkten. Man erzählt
von vielen Millionen; doch lassen sich solche Angaben
begreiflicherweise nicht kontrollieren, wenn auch zugegeben werden
muß, daß die höhern Klassen infolge einer
natürlichen Reaktion gegen die herrschenden materialistischen
und sozialistischen Lehren der Gegenwart den S. überall mit
offenen Armen aufnehmen und in ihm zum Teil das einzige
Rettungsmittel der Gesellschaft sehen. In Amerika wirkten als
spiritistische Schriftsteller insbesondere Andreas Jackson Davis
durch eine Unzahl von Offenbarungen triefender Schriften (z. B.
"Der Reformator", "Der Zauberstab", "Die Prinzipien der Natur"
etc.), Richter Edmonds, Prof. Hare, Owen ("Das streitige Land") u.
a. In Philadelphia soll auf Grund eines größern Legats
sogar eine Professur für spiritistische Philosophie errichtet
werden. In Europa wollte der S. lange Zeit keinen Eingang gewinnen,
und bloß einzelne Medien, wie Home, zogen in den
europäischen Hauptstädten umher, um in hohen und
allerhöchsten Privatzirkeln "Sitzungen" abzuhalten. Durch
Allan Kardec in Paris nahm die Sache mehr den Charakter der reinen
Magie, durch den Baron Güldenstubbe, der in seiner "Positiven
Pneumatologie" 194 Totenbriefe aus allen Zeiten und in den
verschiedensten Sprachen veröffentlichte, denjenigen der
Nekromantie und durch den Rendanten Hornung in Berlin das Ansehen
einer Burleske an. In neuerer Zeit sind indessen in England
namhafte Naturforscher, wie Wallace, der Mitbegründer der
Darwinschen Theorie und Verfasser der spiritistischen Schriften:
"Die wissenschaftliche Ansicht des Übernatürlichen" und
"Eine Verteidigung des modernen S.", sowie der Chemiker Crookes
("Der Spiritualismus und die Wissenschaft") dafür eingetreten
und haben sehr viele Bekehrungen im Gefolge gehabt. In Deutschland
sind erst durch die Bemühungen des russischen Staatsrats
Aksakow und seines litterarischen Gehilfen Wittig diese Lehren
heimisch geworden, sofern dieselben, in ihrem Vaterland gesetzlich
an solchen Bestrebungen verhindert, bei uns eine spiritistische
Zeitschrift ("Psychische Studien", Leipz. 1874 ff.)
begründeten und Anregung zur Bildung von Vereinen gaben.
Schriftstellerisch haben außerdem M. Perty. Zöllner, K.
du Prel, Baron Hellenbach u. a. in dieser Richtung gewirkt, und
eine neue Monatsschrift: "Die Sphinx" (hrsg. von
Hübbe-Schleiden, Hamb. 1886 ff.), dient der weitern
Ausbreitung. Ob dieser von der streng kirchlichen wie von der
liberalen und fortschrittlichen Presse gleich lebhaft angefeindeten
Bewegung irgend welche nicht durch die bekannten Kräfte
erklärbare Thatsachen zu Grunde liegen, wie Hare, Wallace und
Crookes behaupten, oder ob eine noch ununtersuchte
Nerventhätigkeit, resp. das sogen. Od (s. d.), wie andre
wollen, dieselben erklären kann, oder ob alles auf
bewußter und unbewußter Täuschung beruht, mag der
Zukunft anheimgestellt bleiben. Vgl. A. Aksakow und K. Wittig,
Bibliothek für Spiritualismus (Leipz. 1867-77, bisher 14
Bde.); Dixon, Neuamerika (a. d. Engl., Jena 1868); Perty, Der
jetzige Spiritualismus (Leipz. 1877); J. H. Fichte, Der neue
Spiritualismus (das. 1878); Zöllner, Wissenschaftliche
Abhandlungen (das. 1877-81, 4 Bde.); K. du Prel, Philosophie der
Mystik (das. 1885); Hellenbach, Geburt und Tod (Wien 1885); A.
Bastian, In Sachen des S. (Berl. 1886); polemische Schriften von
Wundt, Vogel, Nagel, E. v. Hartmann u. a. Über die
gewöhnlichen Betrügereien und Entlarvungen der Medien
haben Home (1877), der später selbst wegen Betrug und
Erbschleicherei verurteilt wurde, und Erzherzog Johann von
Österreich (1884) geschrieben.
Spirito (ital.), Geist; con s., mit Feuer.
Spiritualen (neulat.), Sittenaufseher in den
Priesterseminaren; dann Partei der strengern Franziskaner (s.
d.).
Spiritualis (lat.), geistig, dem Materiellen
entgegengesetzt; daher Spiritualien, geistige oder geistliche
Angelegenheiten, Glaubenssachen.
Spiritualisieren (franz.), begeistern; vergeistigen,
spiritualistisch auffassen oder gestalten.
Spiritualismus (lat.), dasjenige metaphysisch-psycholog.
System, welches die menschliche Seele für ein rein geistiges
oder absolut immaterielles Wesen
161
Spiritualität - Spiritus.
erklärt (vgl. Pneumatismus). Dann auch s. v. w. Spiritismus
(s. d.).
Spiritualität (lat.), s. v. w. Geistigkeit im
Gegensatz zur Körperlichkeit (Materialität). Vgl.
Seele.
Spirituell (lat.), geistig, geistreich, geistlich.
Spirituosen (lat.), geistige, berauschende
Getränke.
Spiritus (lat.), das Wehen des Windes, die bewegte Luft;
der Atem, Hauch und, weil dieser als das Belebende (Geistige) des
Körpers oder als das erzeugende (Lebens-) Prinzip desselben
gedacht wurde, alles Feine, Dünnflüssige, Flüchtige,
das zugleich auf den Organismus anregend, belebend einwirkt; daher
auch der flüchtige Teil des Weins (Weingeist, vgl. den
folgenden Artikel). S., S. vini rectificatissimus, Alcohol vini,
Spiritus vom spez. Gew. 0,830-0,834 (91,2-90 Proz.); S. dilutus, S.
vini rectificatus, Mischung aus 7 Teilen Spiritus und 3 Teilen
Wasser vom spez. Gew. 0,892-0,896 (67,5-69,1 Proz.); S. aethereus,
s. Hoffmannsche Tropfen; S. aetheris chlorati, S. salis dulcis, S.
muriatico-aethereus, versüßter Salzgeist, s.
Salzäther; S. aetheris nitrosi, S. nitri dulcis, S. nitrico-
(nitroso-) dulcis, versüßter Salpetergeist, s.
Salpetrige Säure; S. ammoniaci caustici Dzondii, alkoholische
Ammoniaklösung; S. Angelicae compositus, zusammengesetzter
Engelwurzelspiritus, Destillat von 75 Spiritus und 125 Wasser
über 16 Angelikawurzel, 4 Baldrianwurzel, 4 Wacholderbeeren.
Man zieht 100 Teile ab und löst darin 2 Teile Kampfer; S.
camphoratus, Lösung von 1 Teil Kampfer in 7 Teilen Spiritus
und 2 Teilen Wasser; S. Cochleariae, Löffelkrautspiritus,
Destillat (4 Teile) von 3 Teilen Spiritus und 3 Teilen Wasser
über 8 Teile frisches blühendes Löffelkraut; S.
ferri chlorati aethereus, s. Bestushewsche Nerventinktur; S.
Formicarum, Ameisenspiritus; S. Frumenti, Kornbranntwein; S. fumans
Libavii, Zinnchlorid; S. Juniperi, Wacholderspiritus, Destillat (20
Teile) von 15 Teilen Spiritus und 15 Teilen Wasser über 5
Teilen Wacholderbeeren; S. Lavandulae, Lavendelspiritus, Destillat
(20 Teile) von 15 Spiritus und 15 Wasser über 5
Lavendelblüten; S. Melissae compositus, Karmelitergeist; S.
Menthae crispae, Krauseminzessenz, und S. Menthae piperitae,
Pfefferminzessenz, Lösung von 1 Teil Krauseminz-, resp.
Pfefferminzöl in 9 Teilen Spiritus; S. Mindereri, s.
Essigsäuresalze; S. nitri, Salpetersäure; S. nitri
dulcis, s. S. aetheris nitrosi; S. nitri fumans, rauchende
Salpetersäure; S. Rosmarini, S. anthos, Rosmarinspiritus, aus
Rosmarin wie Wacholderspiritus bereitet; S. saponatus,
Seifenspiritus; S. salis, Salzsäure; S. salis ammoniaci
causticus, Ammoniakflüssigkeit; S. salis dulcis, s. S.
aetheris chlorati; S. Serpylli, Quendelspiritus, aus Quendel wie
Wacholderspiritus bereitet; S. Sinapis, Senfspiritus; S. vini
Cognac, Kognak; S. sulfuratus Beguini, Lösung von
Schwefelammonium; S. terebinthinae, Terpentinöl; S. vini,
Alkohol; S. vitrioli, verdünnte Schwefelsäure. -
In der Grammatik der griech. Sprache bezeichnet S. den starken
oder scharfen und den gelinden oder schwachen Hauch (s. asper und
s. lenis), der über jeden Vokal oder Diphthong zu Anfang eines
Wortes gesetzt und im ersten Fall durch das Zeichen ^?, im zweiten
durch ^? [s. Bildansicht] ausgedrückt wird. Vgl. den Artikel
"H".
Spiritus (hierzu Tafel "Spiritusfabrikation"), mehr oder
weniger reiner Alkohol, aus zuckerhaltigen Flüssigkeiten durch
Destillation gewonnen. Früher, als noch der S.
größtenteils zum Genuß in der Form von Branntwein
(s. d.) bereitet wurde, war die Spiritusfabrikation
hauptsächlich Branntweinbrennerei. Der neuere Betrieb
unterscheidet sich von letzterer durch das Arbeiten in
größerm Maßstab und auf alkoholreichere
Destillate. Im allgemeinen nennt man solche durch Destillation
erhaltene Flüssigkeiten Branntweine, welche zum Getränk
bestimmt sind und 30-50 Volumprozent Alkohol enthalten; die zu
andern Zwecken dienenden, bis über 90 Volumprozent Alkohol
enthaltenden, ebenso gewonnenen Flüssigkeiten heißen S.
Bei dem Branntwein hat der je nach dem Ursprung (und zum Teil der
Bereitungsweise) verschiedene Geruch und Geschmack Einfluß
auf den Handelswert, der wesentliche Bestandteil ist aber stets der
berauschend wirkende Alkohol, und beim S. kommt letzterer allein in
Betracht, die fremden, riechenden Stoffe, welche als Nebenprodukte
bei der Alkoholbildung auftreten, werden möglichst
vollständig entfernt. Das Produkt heißt dann gereinigter
S. (Sprit). Die Darstellung aller dieser Produkte begreift im
allgemeinen zwei wesentlich verschiedenartige Arbeiten: die
Herstellung einer alkoholhaltigen Flüssigkeit und die
Abscheidung des Branntweins oder S. aus dieser mittels
Destillation. Die alkoholhaltige Flüssigkeit wird stets durch
Gärung einer zuckerhaltigen gewonnen. Die Darstellung der
letztern aber ist je nach dem zu verarbeitenden Rohmaterial eine
sehr verschiedene. Als solches kommen nämlich in Betracht: a)
feste oder flüssige Stoffe, welche Zucker fertig gebildet
enthalten; hierher gehören namentlich Zuckerrüben,
Maisstengel, Sorghum, alle Arten Obst und Beeren, Melasse und
Sirupe sowie andre Rückstände oder Abfälle der
Zuckerfabrikation, Trester, Honig u. a.; b) Stoffe, welche zwar
keinen Zucker, wohl aber Stärkemehl enthalten, welches durch
Einwirkung von Malz (Diastase) in Zucker (Maltose)
übergeführt werden kann; dazu gehören: Wurzeln und
Knollen, namentlich Kartoffeln (Topinambur), Getreide aller Art,
Mais, manche Leguminosen und andre Samen.
Verarbeitung zuckerhaltiger Rohstoffe.
Die zuckerhaltigen Rohstoffe brauchen nur in eine für die
Vergärung brauchbare Form (Lösung von bestimmter
Konzentration) versetzt zu werden, um durch den Einfluß der
Hefe in Alkohol und Kohlensäure zu zerfallen. Die
stärkemehlhaltigen Stoffe hingegen können erst die
gärungsfähigen Zuckerlösungen ergeben, wenn sie der
Verzuckerung durch Malz unterlegen haben. Obwohl es viel einfacher
erscheint, die bereits zuckerhaltigen Rohstoffe zu verwenden,
richtet sich doch die Wahl derselben weniger hiernach als nach der
Besteuerungsart des betreffenden Landes. Aus diesem Grund wird in
dem größten Teil Deutschlands, dort, wo der Raum,
welchen die gärende Flüssigkeit einnimmt, als Maß
für die zu bezahlende Steuer gilt, derjenige Rohstoff am
meisten benutzt, welcher die am meisten zuckerhaltigen Maischen
liefert, d. h. also diejenigen, bei welchen aus einem bestimmten
Maß gärender Maischen am meisten S. gewonnen werden
kann. Dies sind die stärkemehlhaltigen Rohstoffe Getreide,
Mais und die Kartoffeln, von zuckerhaltigen nur die Melasse.
Ausnahme bilden nur diejenigen Teile Deutschlands, in denen eine
andre Besteuerung noch herkömmlich ist, welche die
Verarbeitung von allerhand Obstarten im Kleinbetrieb gestattet.
Sollte hier die Steuer nach dem Gärraum bezahlt werden, so
würde der Verbrauch der bezeichneten Rohstoffe unmöglich,
weil der Betrieb zu teuer werden würde. Die Benutzung des in
größten Mengen (im Klima des mittlern Europa, namentlich
in Deutschland) zu habenden zuckerhaltigen Rohstoffs, der
Zuckerrübe, hat in Deutschland selbst in
162
Spiritus (aus zuckerhaltigen und stärkehaltigen
Stoffen).
den Teilen, wo nicht der Gärraum besteuert wird, keine
Verbreitung finden können. In Frankreich, wo ein andres
Steuersystem herrscht, unter welchem es vorteilhaft ist, weniger
gehaltreiche Flüssigkeiten zur Vergärung und
Spiritusgewinnung zu benutzen, ist die Verwendung der
Zuckerrüben zur Spiritusgewinnung in manchen Gegenden sehr
verbreitet, vielfach in der Weise, daß man, je nach Handels-
und Preisverhältnissen der Jahrgänge, die
Rübenernten zur Zuckerfabrikation oder zur Spiritusbereitung
benutzt. Als zuckerhaltiger Rohstoff kommt für Deutschland nur
die Melasse in Betracht, aber auch diese wird jetzt vielfach
vorteilhafter auf Zucker als auf S. verarbeitet. Aus Traubenwein
werden namentlich im südlichen Frankreich die gesuchtesten
Traubenbranntweine (Franzbranntweine) gewonnen, obwohl immer nur
dann, wenn die Verwertung dieses alkoholreichern Produkts eine
höhere als die des Weins ist (Rückstände von der
Weinbereitung werden stets in ähnlicher Weise verarbeitet).
Die Darstellung des zum Branntweinbrennen bestimmten Weins verlangt
nicht dieselbe Sorgfalt wie die des Trinkweins, sie zielt auf
möglichste Ausbeutung an Alkohol von reinem Geschmack; die Art
des Abbrennens (s. unten) und der Aufbewahrung ist auf den
Geschmack des Produkts von wesentlichem Einfluß. Die
Rückstände der Weinbereitung liefern den
Tresterbranntwein, die bei der Gärung abgeschiedene Hefe den
Drusenbranntwein.
Aus zuckerhaltigen Stoffen werden in möglichst einfacher
Weise Flüssigkeiten hergestellt, welche den gesamten Zucker
des Rohmaterials in Lösung enthalten, worauf durch Zusatz von
Hefe die Gärung eingeleitet wird, bei welcher der Zucker in
Alkohol und Kohlensäure zerfällt. Melasse wird unter
Zusatz von etwas Schwefel- oder Salzsäure und unter
Erwärmung zu einer Flüssigkeit von 12-25 Proz. Gehalt
verdünnt und bei geeigneter Temperatur mit der Hefe
(Hefenmaische, Kunsthefe) versetzt. Zur Darstellung von Rum werden
Rückstände von der Darstellung des Zuckers aus Zuckerrohr
mit Wasser und Schwefelsäure oder Schlempe zu
Flüssigkeiten von 14-16 Proz. Gehalt verdünnt und mit
Hefe zur Gärung gestellt; bisweilen wird Zuckerrohrsaft
zugesetzt. Von Obst oder süßen Früchten werden
Äpfel und Birnen, Kirschen, Zwetschen, Brombeeren,
Heidelbeeren, Holunderbeeren u. a. benutzt. Aus Äpfeln und
Birnen wird durch Zermalmen oder Reiben, aus den andern
Früchten durch teilweises Zerstampfen ein Brei hergestellt und
dieser entweder ausgepreßt, oder, und zwar meistenteils,
unmittelbar in Tonnen gefüllt, in denen die Masse bald in
Gärung kommt. In manchen Gegenden, z. B. im Schwarzwald,
bildet die Obstbrennerei eine eigentümliche ländliche
Industrie, die von vielen Tausenden in kleinerm und
größerm Maßstab betrieben wird; es werden aus den
einzelnen Obstarten ebenso viele verschiedene und zum Teil sehr
geschätzte Trinkbranntweine dargestellt, die durch ganz
bestimmten Geschmack gekennzeichnet sind. Nachdem die Gärung
begonnen, werden die Tonnen nach der erfahrungsmäßig
besten Zeit dicht verschlossen und so lange an einem kühlen
Ort aufbewahrt, bis die Reihe des Abbrennens an sie kommt; das
Abbrennen dauert das ganze Jahr hindurch, so daß manches Obst
ein Jahr, Zwetschen auch wohl zwei Jahre und mehr in der Tonne
verbleiben; die Dauer dieser überaus langsamen Gärung ist
von bestimmtem Einfluß auf die Eigenschaften, namentlich auf
die Klarheit, des Erzeugnisses. Zuckerrüben liefern neben
einem hohen Spiritusertrag von der Bodenfläche ein
geschätztes Viehfutter als Rückstand. Nach Champonnois
werden die Rüben auf einer Schneidemaschine in Stücke
geschnitten, aus diesen wird der Saft durch Auslaugen mit
säurehaltigem Wasser oder mit Schlempe gewonnen und mit Hefe
oder mit Hefe enthaltendem, gärendem Rübensaft in rasch
verlaufende Gärung versetzt. Nach Leplay wird der Saft nicht
abgeschieden, sondern innerhalb der gleichfalls in Stücke
geschnittenen Rüben dadurch in Gärung versetzt, daß
man sie unter einem Zusatz von etwas Schwefelsäure in
gärenden Rübensaft bringt. Im erstern Fall wird der
Rübensaft, im letztern werden die Rübenschnitte als
solche nach Vollendung der Gärung (also nach 1-2 Tagen) der
Destillation behufs Abscheidung des Alkohols unterworfen.
Verarbeitung stärkehaltiger Rohstoffe.
Die Verarbeitung der stärkemehlhaltigen Rohstoffe ist in
Deutschland von größter volkswirtschaftlicher Bedeutung.
Hauptmaterial ist die Kartoffel, welche für große
Länderstrecken mit sandigem Boden das hauptsächlichste
Landesprodukt bildet, aber bei ihrem niedrigen Preis hohe
Transportkosten nicht erträgt. Die Umwandlung in ein teureres,
verhältnismäßig weniger Gewicht besitzendes und
daher Frachtkosten leicht ertragendes Produkt erscheint um so
vorteilhafter, als dabei ein Nebenprodukt, die Schlempe,
entfällt, welche ein höchst wertvolles Futtermittel
für Milchtiere ist. Hierin liegt begründet, daß die
Spiritusfabrikation selten als selbständige
Großindustrie auftritt, sondern ein landwirtschaftliches
Gewerbe bildet, welches eine große Viehhaltung
ermöglicht, so daß der ärmere Boden stark
gedüngt werden kann und bei der intensiven Bearbeitung, welche
die Kartoffel erfordert, so wesentlich verbessert wird, daß
auch der Getreidebau sich lohnend erweist. Hierbei ist nun aber zu
beachten, daß die Kartoffeln zur Verzuckerung des
Stärkemehls des Malzes und ebenso zur Erzeugung des
nötigen Gärmittels der Gerste in solchem Verhältnis
bedürfen, daß man auf die Kartoffelernte von je zwei
oder drei die Gerstenernte von einem Morgen Landes nötig hat.
Es muß also die erforderliche, zum Gerstenbau geeignete
Landoberfläche zur Verfügung stehen, oder es muß
Gerste von außen eingeführt (gekauft) werden. Dazu kommt
in neuerer Zeit die Aufnahme des Maiskorns in den Brennereibetrieb
und eine solche Hebung der Verkehrsmittel, daß
gegenwärtig große Mengen Kartoffeln nach entfernten
Ländern transportiert werden. Die Beurteilung der
Spiritusindustrie muß also gegenwärtig wesentlich anders
lauten als ehemals. Von Getreide werden vorzugsweise Roggen und
Mais (bei uns hauptsächlich als Zusatz zu Kartoffeln),
außerdem auch Gerste und zuweilen Weizen und Reis auf S.
verarbeitet. Wie in der Bierbrauerei werden diese Rohstoffe in der
Weise mit Malz behandelt, daß durch die in letzterm
enthaltene Diastase das Stärkemehl in Dextrin und Zucker
verwandelt wird. Abweichungen ergeben sich aber insofern, als bei
der Bierbrauerei Dextrin erhalten bleiben soll, während die
Spiritusfabrikation eine möglichst vollständige
Vergärung bezweckt. Das bei der Verzuckerung des
Stärkemehls durch Malz neben Zucker (Maltose) gebildete
Dextrin ist in der Zeitspanne, welche in der Praxis der Brennerei
für die Alkoholgärung eingehalten wird, als direkt
unvergärbar zu betrachten, und doch vergärt es, indem
nach der Zersetzung der Maltose durch die Hefe die aus dem
Verzuckerungsprozeß noch aktiv zurückgebliebene Diastase
nunmehr auch das Dextrin in gärungsfähigen Zucker
verwandelt. Es ist mithin sehr wesentlich, in der Maische noch
Diastase für die
162a
Spiritusfabrikation.
Fig. 1. Lacambres Maischapparat (Querschnitt).
Fig. 3. Hollefreunds Apparat (Querschnitt)
Fig. 4. Hollefreunds Apparat (Grundriß).
Fig. 2. Kartoffelmaischapparat (Durchschnitt).
Fig. 7. Hentschels Apparat (Durchschnitt).
Fig. 6. Pauckscher Apparat (Durchschnitt).
Meyers Konv.- Lexikon, 4. Aufl.
Zum Artikel : Spiritus K.
163
Spiritus (Maischverfahren).
Alkoholgärung zu erhalten. Die nachwirkende Kraft der
Diastase wird zerstört durch zu hohe Temperatur und durch in
der gärenden Maische vorhandene Milchsäure.
Bei der Verarbeitung von Getreide auf Kornbranntwein wird ein
Gemenge von Roggen mit Weizen- oder Gerstenmalz oder Weizen mit
Gerstenmalz, und zwar 1 Teil Malz auf 2-3 Teile ungemalztes
Getreide, möglichst fein geschroten, um eine vollständige
Einwirkung der Stoffe aufeinander zu erreichen, und eingemaischt.
In England zieht man wie bei der Bierbrauerei eine wirkliche
Würze, in Deutschland dagegen läßt man die ganze
Maische mit den Trebern gären. Bei der Maischraumsteuer liegt
es im Interesse des Brenners, den Maischraum möglichst
auszunutzen und eine möglichst konzentrierte Maische
herzustellen, anderseits ist eine vollständige Verzuckerung
und Vergärung nur bei einer gewissen Verdünnung der
Maische möglich. Man hat früher mit 8 Teilen Wasser
gearbeitet und ist bis auf 3,75 herabgegangen, hält jetzt aber
das Verhältnis von 1 : 4,5 für das vorteilhafteste.
Kartoffeln werden gewaschen, mit Dampf gekocht, zerkleinert und mit
Gerstenmalz (bisweilen unter Zusatz von Roggenmalz) gemaischt. Auf
100 Teile Kartoffeln rechnet man 3-5 Teile Gerste (als Malz). Die
Konzentration der Maische wird etwas stärker genommen als beim
Getreide, indem man auf 1 Teil Trockensubstanz 4,5, 4 und selbst
nur 3 Teile Wasser nimmt. Es ist klar, daß der große
Wassergehalt der Kartoffeln bei diesem Verhältnis in Abzug
gebracht wurde. Als Regel für die anzuwendenden Temperaturen
hat sich ergeben, daß beim Maischen mit dem Malz 61°
nicht überschritten werden soll, u. daß 20 Minuten zur
Verzuckerung ausreichen.
Maischverfahren.
Das Maischen wird in kleinern Brennereien durch Handarbeit, in
größern mittels Maischmaschinen bewirkt, die
erforderliche Temperatur teils durch Erhitzen des zum Maischen
verwendeten Wassers, teils durch Einleiten von Dampf erzielt. Bei
der Handarbeit wendet man zum gründlichen Durcharbeiten
Maischhölzer, bei der Maschinenarbeit ähnliche
Vorrichtungen an, wie sie bei der Kartoffelbrennerei üblich
sind (s. unten). In Belgien und Frankreich wird vielfach der
Lacambresche Maischapparat (s. Tafel, Fig. 1) benutzt, welcher die
beste Durchmaischung und die Herstellung jeder Temperatur in
vorteilhafter Weise gestattet. Es ist ein liegender, oben
abgeschnittener und offener, an beiden Enden durch Seitenwände
geschlossener, etwa 2 m langer Cylinder von Eisenblech mit
Rührwerk und Mantel. a ist der innere, zur Maischarbeit
dienende Raum, b der Raum zwischen Cylinder und Mantel, e eine
Öffnung zum Einlassen, d ein Ablaßrohr für Dampf
oder Wasser, e' das Ablaßrohr für die fertige Maische.
Ein Rührwerk, dessen Achse die Mitte des Cylinders einnimmt,
hat eine Anzahl eine Schraubenlinie darstellender, mit eisernen
Rechen, Rahmen und Querstäben oder Gittern versehener Arme und
macht etwa 25 Umdrehungen in der Minute, so daß eine
vollkommene, beliebig lange fortzusetzende Durcharbeitung der Masse
geschieht, während der den Zwischenraum b durchströmende
Dampf die Erhitzung bewirkt. Die gewaschenen Kartoffeln werden nach
dem ältern Verfahren mittels frei einströmenden Dampfes
in (meist hölzernen) Bottichen (Dampffässern) gekocht,
noch heiß mittels Quetschwalzen oder mittels andrer
Vorrichtungen zerdrückt und dann unter Zusatz der
verhältnismäßigen Quantität Wasser mit dem
(meistens Grün-) Malz vermischt; dieses Einmaischen geschieht
auf verschiedene Weise, je nachdem man die ganze Menge Malz und
Kartoffeln zugleich maischt oder die Kartoffeln in kleinern
Anteilen zu dem vorher eingemaischten Malz bringt oder endlich die
Kartoffeln in kleinern Mengen ebenfalls mit Anteilen des Malzes
mischt, bis die Masse jedesmal durch die Zuckerbildung
dünnflüssig geworden ist. Die Einrichtung der zum
Einmaischen der Kartoffeln angewandten Maischbottiche ist eine sehr
mannigfaltige; ein Beispiel zeigt Fig. 2 der Tafel. a ist das
Kartoffeldampffaß, b der hölzerne Trichter, mittels
dessen die entleerten Kartoffeln zwischen die Quetschwalzen d d
geleitet werden; diese sind durch die Schraube e gegeneinander
verstellbar und erhalten ihre Bewegung durch c; die
zerdrückten Kartoffeln fallen in den Bottich g, in dem sich
ein durch p q, r n bewegtes, um die auf dem Lager m ruhende Achse o
sich drehendes Rührwerk befindet, welches aus dem Arm t und
aus Rahmen mit Querstäben u s besteht, die sich während
des Umlaufs der Mittelachse um ihre eigne horizontale Achse s s
drehen. f h sind Röhren für Wasser und Dampf, k i der
Ablaß für die fertige Maische, l ein Ventil zum Reinigen
des Bottichs.
Nach den neuern Maischverfahren werden die Kartoffeln sowie auch
Getreide und besonders in neuerer Zeit auch Mais, letzterer in
eingequelltem Zustand, in geschlossenen Gefäßen unter
einem Druck von 2-3 Atmosphären und bei der demselben
entsprechenden höhern Temperatur gedämpft, hierauf,
vollends zerkleinert, in geeigneten Kühlapparaten auf die
Zuckerbildungstemperatur gebracht, bei welcher das Zusetzen des
Malzes und hierauf die Umwandlung des Stärkemehls in Zucker
erfolgt, dann einige Zeit, wie bei dem ältern Verfahren,
dieser Einwirkung überlassen und schließlich durch eine
zweite Abkühlung auf die Gärungstemperatur gebracht.
Zweck dieser Art zu arbeiten ist ein vollständigeres
Aufschließen und Löslichmachen der Stärke in Form
von Zucker und folgerichtig eine höhere Ausbeute an S., und
dieser Zweck wird in so sicherer Weise erreicht, daß man das
ältere Verfahren durch eine ganze Reihe auf demselben Grund
beruhender, in der Ausführung jedoch verschiedener Verfahren
allmählich ersetzt. Das erste dieser Verfahren war das
Hollefreundsche, bei welchem nach dem Erhitzen der Kartoffeln auf
die angegebene Höhe eine plötzliche Verminderung des
Luftdrucks durch Kondensation des Dampfes und eine Luftpumpe
angewandt und die Masse zugleich energisch umgerührt wird.
Fig. 3 und 4 der Tafel stellen einen in dieser Weise wirkenden
Apparat dar. A ist der auf dem Gestell L ruhende eiserne
Maischcylinder mit dem auf der Achse o sitzenden Rührwerk C,
dem Mannloch b und dem Dom B, D der Kondensator mit der Luftpumpe.
Das Rührwerk wird durch die Teile K M f betrieben. Die
Kartoffeln werden nebst etwas Wasser durch das Füllloch a
eingeschüttet, worauf alles fest verschlossen und durch das
Rohr o s i mit den Ventilen k l Dampf zugelassen wird, welcher
durch die kleinern Rohre mit Ventilen k k k in den Cylinder
gelangt. Nachdem in diesem die gewünschte Spannung und
Temperatur eingetreten, wird das Rührwerk eine Zeitlang in
Thätigkeit gesetzt, sodann der Dampf abgesperrt und durch
Öffnung von m der im Cylinder vorhandene durch das Rohr p ins
Freie entlassen, worauf die Temperatur auf 100° und die
Spannung auf 0 herabgehen. Hierauf wird die Luftpumpe in Betrieb
gesetzt und durch p und Q Wasser bei D in den Kondensator
eingelassen. Hierdurch finden eine rasche Verminderung des Druckes
im In-
164
Spiritus (Maischmaschinen).
nern des Apparats unter den der Atmosphäre und ein
Herabgehen der Temperatur statt. Sobald die zur Zuckerbildung
geeignetste erreicht ist, wird durch Öffnen des
Verbindungshahns H das mit Wasser zu einem feinen Brei angemachte,
im Bottich E befindliche Grünmalz in den Cylinder A (infolge
der hierin hervorgebrachten Luftverdünnung) eingesaugt und mit
dem Kartoffelbrei durch das Rührwerk wohl vermischt. Nun wird
die Luftpumpe stillgestellt, der Cylinder geöffnet und die
Masse unter jeweiligem Umrühren der Zuckerbildung
überlassen; ist diese vollendet, so wird die Maische auf den
Kühlschiffen oder in einem mit dem Apparat verbundenen
Kühler auf die Gärungstemperatur abgekühlt.
Ähnlich ist der Apparat von Bohm, der aber ohne Luftpumpe
arbeitet und das Kühlen der heißen Maische durch eine
Verbindung von Rühr- und Kühlvorrichtung bewirkt. Das
Rührwerk besteht aus flachen cylindrischen Gefäßen
aus Eisenblech, die an ihren Flächen messerartige
Vorsprünge tragen und auf einer hohlen Achse derartig
angebracht sind, daß das Kühlwasser durch die Cylinder
gehen und durch die ein Doppelrohr vorstellende hohle Achse wieder
austreten kann. Von außen wird die Kühlung des Apparats
durch Aufspritzen von kaltem Wasser bewirkt. Dasselbe Ziel wie die
vorigen Apparate, aber mit den einfachsten Mitteln, verfolgt der
Henzesche Dämpfer, der, wie Textfigur 1 zeigt, nur ein
verbessertes Dampffaß ist, in welchem die Einwirkung
höher gespannter und entsprechend heißerer Dämpfe
möglich ist, eine Einwirkung, welche bis zum Austritt der
Masse aus dem Dämpfer dauert, wobei diese durch den gespannten
Dampf in außerordentlich feiner Verteilung in das eigentliche
Maischgefäß geblasen wird. Der eiserne Cylinder A ist
mit dem konischen Bodenansatz B versehen, welcher in das Ablauf-
oder vielmehr Ausblaserohr C übergeht. D D' sind die
Einlaßröhren für den Dampf, d ein Verschluß
zum Reinigen des Ausblaserohrs, e das durch das Handrad f
verstellbare Ventil zum Regulieren des Ausblasens. Das Mannloch a
dient zum Einfüllen der Kartoffeln und wird dann dicht
verschlossen; b ist ein Sicherheitsventil. Wenn die Einwirkung des
hoch gespannten Dampfes auf die im Dämpfer befindlichen
Kartoffeln beendet ist, werden diese durch Öffnen des Ventils
in einem passenden, mit Rührwerk versehenen Maischbottich
ausgeblasen, in welchem bereits ein Teil des zur Verzuckerung
erforderlichen Malzes, mit Wasser zu einem Brei angerührt,
sich befindet. Bei langsamem Ausblasen reicht die Verdunstung der
zerstäubenden Masse aus, diese auf die
Zuckerbildungstemperatur abzukühlen. Indessen sind die
Maischbottiche meist mit Vorrichtungen versehen, welche die
erforderliche Abkühlung durch Wasserströmungen bewirken.
Wenn das Ausblasen beendet ist, wird das noch fehlende Malz
zugesetzt, die Zuckerbildung abgewartet und dann die verzuckerte
Maische vollends zur Gärtemperatur gebracht, und zwar entweder
unter Anwendung der oben bezeichneten Wasserkühlung oder in
derselben Art wie bei der ältern Arbeitsweise, nämlich
auf Kühlschiffen mit Hand- oder Maschinenbetrieb. Der
Henzesche Dämpfer ist mehrfach verbessert worden. Durch
Modifizierung der Dampfeinströmung hat man eine wirbelnde
Bewegung des zu dämpfenden Materials erreicht, und diese hat
sich namentlich bei Verarbeitung von Mais und Roggen in dem
ursprünglich nur für Kartoffeln konstruierten
Dämpfer bewährt. Um beim Ausblasen eine vollkommnere
Zerkleinerung des Materials zu erreichen, wurden verschiedene
Vorrichtungen angebracht; man ging aber in derselben Richtung noch
weiter und konstruierte Nachzerkleinerungsapparate, welche eine bis
dahin nicht gekannte feine Zerteilung des Materials
herbeiführen. Der Apparat von Ellenberger ist dem sogen.
Holländer der Papierfabriken nachgebildet und dem
Brennereibetrieb angepaßt. Die gar gedämpfte Kartoffel-
oder Getreidemasse wird ausgeblasen und fällt auf die 200mal
in der Minute sich drehende Trommel des Holländers, deren
Zähne, wie die der Grundplatte, eine besondere Form haben. Der
Apparat arbeitet anerkanntermaßen vorzüglich und ist
sehr verbreitet. Beim Dämpfen von Mais und Getreide wird
außerdem der Dämpfer selbst mit einem sehr wirksamen
Rührwerk an horizontaler Achse versehen. Eine hervorragende
Stellung nimmt der Apparat von Paucksch (Fig. 5 u. 6 der Tafel)
ein. Außer dem eigentümlich gestalteten Dämpfer
besitzt derselbe einen Vormaischbottich, der aus einem
schalenförmigen Unterteil mit cylindrischem Aufsatz besteht.
Auf dem Boden ist der Zentrifugal-Maisch- und Zerkleinerungsapparat
angebracht; er besteht aus einer festliegenden Grundplatte und
einem Flügelrad als Läufer, welches 300-400 Umdrehungen
macht. Vermöge seiner Einrichtung saugt er die Maische durch
vier Öffnungen ein und wirft sie nach dem Mahlen
seitwärts aus. Ein Rührwerk ist nicht vorhanden, der
Maischraum daher frei und so für die Beobachtung der
Temperatur zugänglich. Die Bewegung der Maische ist eine
äußerst heftige und doch zugleich eine höchst
regelmäßige, die Wirkung gründlich. Die kleinen
Apparate werden mit Mantel für Wasserkühlung
eingerichtet. Der Maischapparat von Hentschel (Fig. 7 der Tafel)
hat ebenfalls eine ausgezeichnete Maischwirkung. Er besteht aus
einem doppelwandigen Vormaischbottich mit trichterförmigem
doppelten Boden und einem eigentümlichen Zerkleinerungs- u.
Maischapparat. Durch das unter diesem befestigte
Schneckengehäuse mit aufgeschraubtem Mahlring und die aufrecht
stehende rotierende Welle, auf welcher der gerippte
Zerkleinerungskonus gemeinschaftlich mit den ansaugenden Schnecken
festsitzt, wird die Maische in Bewegung gesetzt. Das aus dem
Dämpfer ausgeblasene Maischgut fällt in die
schüsselförmige Vertiefung des Zerkleinerungsapparats,
wird von diesem in parabolischer Richtung ausgeworfen, gleitet an
der innern Wandung des Bodens herab und wird durch den-
165
Spiritus (Verarbeitung der Maische).
trichterförmigen Boden der anhängenden Schnecke
zugeführt und im Zerkleinerungsapparat vermahlen. Die Bewegung
ist eine so lebhafte, daß die im Bottich befindliche Maische
in eine starke Rotation versetzt wird. Die innere Wandfläche
ist mit Rippen versehen, und wenn die Maischekühlung
beabsichtigt wird, werden außer der Wandkühlung noch
Kühlröhren angewendet.
Kein Zweig der Spiritusfabrikation hat in der neuern Zeit so
bedeutende Fortschritte gemacht wie die Verarbeitung des Maises in
den Hochdruckapparaten. Man bringt die ganzen Körner in den
Henzedämpfer, welcher auf 100 kg Mais 130-200 kg Wasser
enthält, kocht bei offenem Mannloch unter lebhafter Bewegung
des Maises eine Stunde lang, schließt dann das Mannloch,
dämpft wieder eine Stunde unter steigendem Druck, zuletzt eine
Viertelstunde bei wenigstens drei Atmosphären und bläst
endlich unter diesem Druck aus. Soll der Mais mit Kartoffeln
verarbeitet werden, so maischt man ihn, nachdem er abgekühlt
ist, für sich ein, verteilt ihn mit der erforderlichen Hefe
auf zwei oder drei Gärbottiche und setzt die Kartoffelmaische
zu. Auch Roggen wird jetzt in ganzen Körnern im
Henzedämpfer verarbeitet. Während bei dem alten Verfahren
durchschnittlich 18,7 Proz. Stärke unvergoren blieben, betrug
der Verlust bei Hollefreund 6,9, bei Bohm 7,2, bei Henze, bei
Ellenberger 4,6-6,6 Proz. 1 kg Stärkemehl gibt theoretisch
71,7 Literprozent (s. unten) Alkohol; da jedoch thatsächlich
nur 94 Proz. dieser Menge in Rechnung gezogen werden können,
so ergeben sich als erreichbarer Maximalbetrag nur 67,4 Literproz.
In der Praxis erhielt man nach dem alten Verfahren 45,3 Proz., nach
Henze 48,4, nach Hollefreund 50,5 und nach Bohm 53,8 Proz.
Verarbeitung der Maische.
Die verzuckerte Maische muß so schnell wie möglich
auf die zum Hefengeben und zum Einleiten der Gärung
erforderliche Temperatur (12-17°) abgekühlt werden. Dies
geschah früher auf Kühlschiffen, flachen
Gefäßen von solcher Größe, daß die
Maische darin nur eine dünne Schicht bildet, deren
Abkühlung noch durch Umrühren und starken Luftwechsel
befördert wird. In neuerer Zeit wendet man häufiger
kaltes Wasser und Eis in Oberflächen- oder
Röhrenkühlern oder in Rührwerken mit hohlen
Schaufeln an. In dem oben erwähnten Lacambreschen
Maischcylinder wird kaltes Wasser durch den Zwischenraum b
geleitet, während das Rührwerk in Thätigkeit ist. In
dem Kühlapparat von Hentschel (Textfigur 2) wird die durch den
Fülltrichter a in den Kühltrog c c einfallende Maische
von der sich drehenden kupfernen Spirale e erfaßt und der
Ausgangsöffnung k zugeführt. Das Kühlwasser tritt
durch das Rohr m in die Hohlwelle d, aus dieser in die Spirale e
und fließt bei k wieder ab. Um auch die Wandungen des Trogs
für eine möglichst vollkommene Kühlung nutzbar zu
machen, ist der Trog doppelwandig und wird durch das Rohr l in den
Hohlraum Wasser geleitet. Ein kleinerer Teil des austretenden
Kühlwassers bewirkt schließlich auch noch eine innere
Kühlung der Hohlwelle d. Die wasserführende Spirale ist
aus einzelnen Scheiben hergestellt, die nur teilweise eintauchen
und daher auch eine Kühlung durch Verdunstung bewirken.
Die auf die eine oder die andre Weise erhaltenen
gärungsfähigen Flüssigkeiten, d.h. im wesentlichen
Traubenzuckerlösungen von passender Verdünnung und
Temperatur, sollen nunmehr unter dem Einfluß der Hefe so
zersetzt werden, daß der Zucker möglichst
vollständig in entweichende gasförmige Kohlensäure
und zurückbleibenden, in der Flüssigkeit als Lösung
zu erhaltenden Alkohol zerfällt. Am einfachsten setzt man den
Maischen die als Nebenprodukt andrer Gewerbe (Bierbrauerei)
erhaltene Oberhefe oder in besondern Gewerben bereitete Hefe
(Bierhefe, Branntweinhefe, Preßhefe) zu. Nicht immer aber ist
dieselbe in der erforderlichen Menge und Beschaffenheit zu
erhalten, und es ist daher in denjenigen Ländern, in welchen
die Steuergesetze kein Hindernis bilden, allgemein an Stelle
derselben die Kunst- oder Maischhefe (s. Kunsthefe) getreten.
Dieses Verfahren ist in Deutschland und Österreich allgemein
sowohl in Melasse- als in Getreide- und Kartoffelbrennereien
üblich, obwohl in der Art der Herstellung und Fortführung
dieser Nebenmaische sehr vielfach verschiedene Methoden befolgt
werden. Dagegen wird in Frankreich und Belgien fast nur Bier- oder
Preßhefe benutzt. Man rechnet auf 100 kg 1 bis 2 Lit. breiige
Hefe oder 0,75-1 kg Preßhefe. In allen Fällen wird die
Gärung der Hauptmaische in großen hölzernen, meist
offenen Gefäßen, Bottichen, bewirkt, und man sucht es so
einzurichten, daß sie möglichst energisch und
vollständig und in derjenigen Zeitdauer (in 1-3 Tagen)
verläuft, welche unter den bestehenden Steuergesetzen als die
vorteilhafteste erscheint. Die Temperatur steigt dabei bedeutend
und dient ebenso wie die Abnahme der Dichtigkeit (infolge der
stattfindenden Zersetzung des Zuckers) als ein Erkennungsmittel
für den Verlauf und die Beendigung der Gärung. Die durch
die Gärung erzielte alkoholhaltige Flüssigkeit, die
weingare Maische, enthält außer Alkohol verschiedene
Mengen fremder Stoffe, von denen der Alkohol getrennt werden
muß. Diese fremden Bestandteile rühren teils von dem
Rohmaterial her, welches ja nicht reiner Zucker war und also nicht
völlig in Alkohol oder Kohlensäure übergeführt
werden kann, teils sind es Nebenprodukte der Gärung selbst.
Der Gehalt an reinem Weingeist beträgt durchschnittlich 5-10
Proz. Denselben in konzentrierter Gestalt und frei von den
übrigen Bestandteilen der Maische zu erhalten, ist der Zweck
der Destillation (s. d.), des Abtreibens oder Abbrennens. Reines
Wasser kocht bei 100° C., reiner Alkohol bei 78,3°. Der
Siedepunkt
166
Spiritus (Darstellung des Trinkbranntweins).
eines Gemisches von Alkohol und Wasser liegt zwischen diesen
beiden Punkten und ist im allgemeinen um so höher, je geringer
der Alkoholgehalt desselben ist. Wird ein solches der Destillation,
d. h. dem Kochen in einem Apparat, unterworfen, welcher die
vollständige Wiederverdichtung des gebildeten Dampfes in einem
andern Teil des Apparats durch Abkühlung gestattet, so
erhält man aus dem Dampf eine Flüssigkeit, ein Destillat,
welches im Verhältnis zum Wasser mehr Alkohol enthält als
die siedende Flüssigkeit. Der einfachste Destillationsapparat,
bei welchem der aus der kochenden weingaren Maische sich
entwickelnde Dampf sofort vollständig verdichtet wird, liefert
ein alkoholarmes Produkt (Lutter, Läuter, Lauer), aus welchem
bei abermaliger Destillation (Rektifikation) ein alkoholreicheres
Produkt erhalten werden kann. Die verschiedenen Apparate, welche
gegenwärtig bei der Spiritusfabrikation in Anwendung sind,
liefern sofort ein alkoholreiches Produkt (bis 95 Proz.) und
führen die Verdichtung des letzten alkoholreichen Dampfes in
sehr verschiedener Weise und mit sehr verschieden gestalteten
Apparatteilen aus. Bei dem einfachsten Destillationsapparat benutzt
man zur Verdichtung der Dämpfe kaltes Wasser, bei den
vollkommnern aber Maische, die bei dieser Verwendung
vorgewärmt wird; anderseits schaltet man zwischen Blase und
Kühler Verstärkungsvorrichtungen (Verdampfer und
Niederschlagsvorrichtungen) ein und trifft Vorkehrungen, um den
vollständigen Abtrieb (namentlich durch Anwendung zweier
Blasen) zu sichern. In Deutschland war Pistorius der erste, welcher
zwei Brennblasen statt einer anwandte und mit den Blasen
Rektifikatoren und Dephlegmatoren auf sehr zweckmäßige
Weise verband. Wenn man von einem normal konstruierten Apparat
verlangt, daß man mit seiner Hilfe nicht nur allen Alkohol
aus der Maische, sondern denselben auch möglichst rein
konzentriert und zwar mit dem geringsten Aufwand an Zeit,
Arbeitslohn und Brennstoff erhalte, so muß man anerkennen,
daß der Apparat von Pistorius viel leistet. Es wird ihm
deshalb in Norddeutschland (viel weniger in Süddeutschland, wo
mehr der Gallsche Apparat eingeführt ist) meist der Vorzug vor
andern Brennapparaten gegeben, zu deren Konstruktion der
Pistoriussche Apparat in vielen Fällen der Ausgangspunkt war
(vgl. Destillation, S. 721).
Sehr gebräuchliche Apparate sind ferner: der Pistoriussche
Apparat mit direkter Feuerung, der Pistoriussche
säulenförmige Apparat, der Gallsche Wechselapparat,
außerdem die Apparate von Neumann, Dorn, Egrot, Siemens und
besonders auch der kontinuierlich arbeitende Apparat von Ilges, der
beim ersten Abtrieb S. von mindestens 94 Proz. liefert (s.
Destillation, S. 723). Eine besondere Art der zusammengesetzten
Apparate bilden die namentlich von Savalle gebauten Säulen-
oder Kolonnenapparate, welche besonders in Frankreich und Belgien
in außerordentlicher Anzahl verbreitet sind, und deren
Hauptteil die verschiedenen Arten Verdampfungskapseln bilden. Die
Säulenapparate sind meistens für kontinuierlichen Abtrieb
eingerichtet und enthalten in vielen Fällen keine eigentliche
Blase. Die Verstärkungseinrichtungen sind bei denselben
vielfach nicht sehr ausgeprägt, und sie werden dann nur zur
Herstellung von 35-50proz., oft sogar nur von 25proz. Destillaten
benutzt. Sie sind vorzugsweise für starken,
fabrikmäßigen Betrieb bestimmt und setzen, wenn 80proz.
S. erzeugt werden soll, eine zweite Destillation oder die
Hinzufügung von in Frankreich und Belgien nicht üblichen
Verstärkungseinrichtungen voraus. Ein in Frankreich
verbreiteter Apparat für kontinuierlichen Betrieb ist endlich
der von Derosne verbesserte von Cellier-Blumenthal (s.
Destillation,. S. 722). Es ist der älteste dieser Art und war
ursprünglich nur für die Destillation von Wein (s. oben)
bestimmt; doch dient er jetzt auch zur Destillation von andern
gegornen dünnen oder klaren Flüssigkeiten, wie z. B.
Rübensaft. Für dicke Maischen, wie die in Deutschland zu
verarbeitenden, ist er nicht verwendbar.
Um Trinkbranntwein zu erhalten, wird in zweierlei Weise
verfahren: Ein Teil des aus verschiedenen Rohstoffen erzeugten
alkoholischen Destillats von 80-82 Proz. (Rohspiritus) wird
unmittelbar mit Wasser auf die verlangte Branntweinstärke
verdünnt, zuweilen durch eine Filtration über Holzkohle
in geringem Maß von den in dem Rohspiritus stets als
Nebenprodukt der Gärung enthaltenen, unangenehm riechenden und
schmeckenden Fuselölen gereinigt und außerdem
öfters mit aromatischen, bittern etc. Stoffen versetzt. In
dieser Weise werden nur sehr unreine und fuselig schmeckende
Branntweine erhalten. Reinere und ganz reine Branntweine bereitet
man aus 90-94proz. Sprit, wie derselbe durch Verfeinerung
(Raffinierung) des Rohsprits erhalten wird. Die reinsten in dieser
Weise erzielten Produkte sind das Material, aus welchem die
Liköre und sonstige zusammengesetzte weingeistige
Getränke fabriziert werden. Die weitaus größere
Menge eigentlichen Trinkbranntweins wird aber so erhalten,
daß man die gewünschte geringe Stärke des Produkts
(40-50 Proz.) unmittelbar durch Destillation solcher Maischen
erzielt, welche eigens zu diesem Zweck hergestellt werden, und aus
welchen dann eigentlicher, reinerer S. nicht gewonnen wird. Diese
Art, Trinkbranntwein darzustellen, ist in allen Ländern
gebräuchlich, jedoch je nach dem Geschmack des Publikums und
der Art des Rohmaterials verschieden. Der Absatz des Branntweins
ist an den durch Herkommen und Gewohnheit beliebten Geschmack
desselben gebunden, und es haben sich demnach in den verschiedenen
Gegenden etwas abweichende Branntweinbrennerei-Methoden
herausgebildet, welche, Verbesserung durchweg verschmähend,
darauf gerichtet sind, dem Produkt gewisse Beimengungen (meist zu
den oben erwähnten Fuselölen gehörig) in sehr
geringem Verhältnis zu erhalten, welche den besondern, von dem
des reinen, verdünnten Alkohols abweichenden Geschmack
bedingen. So wird z. B. in Deutschland in kleinen Brennereien aus
der vergornen Weizen- und Gerstenmalzmaische zuerst durch Abtrieb
in der einfachen Blase über freiem Feuer Lutter dargestellt
und aus diesem durch eine zweite Destillation in derselben Weise
Branntwein von der gewünschten Stärke gewonnen. In
Belgien wird der sogen. Genever sowohl in kleinen als in kolossalen
fabrikmäßigen Brennereien aus Roggenmaische erhalten,
welche man zuerst mittels eines kontinuierlich arbeitenden
Säulenapparats mit ununterbrochenem Dampfbetrieb zu Lutter von
etwa 30-35 Proz. abbrennt. Dieser Lutter wird dann ausnahmslos in
ganz einfachen Blasen ohne jede Verstärkung über freiem
Feuer abgetrieben und so Branntwein von der gewünschten
Stärke erhalten. Wacholder wird nicht zugesetzt. Der Abtrieb
des Obstbranntweins aus den verschiedenen Obstmaischen (s. oben)
geschieht im Kleinbetrieb (z. B. im Schwarzwald)
ausschließlich in ganz kleinen, einfachen kupfernen Blasen,
welche auf freiem Feuer erhitzt werden. Es wird zwei- oder dreimal
gebrannt, also zuerst aus der Maische (durch
167
Spiritus (Benutzung, Ausbeute, Produktionsstatistik).
das Rauchbrennen) 15-20proz. Lutter, dann aus diesem (durch das
Läutern) mittels derselben Blase das fertige Produkt erhalten.
Zuweilen wird noch ein drittes Mal geläutert. Weinbranntwein,
Franzbranntwein, Kognak werden in Frankreich aus Wein, entweder
mittels des Apparats von Cellier, Blumenthal und Derosne (s. oben)
oder auch mittels der einfachen, im Wasser- oder Dampfbad erhitzten
Blase, erhalten. Für die feinern Branntweine wird der
Nachlauf, d. h. der gegen Ende des Abtriebs kommende
schwächere Branntwein, wegen seines geringern Geschmacks
getrennt aufgefangen.
Wie schon angedeutet, enthält das Destillat aller weingaren
Maischen flüchtige Stoffe, die demselben einen besondern
Geschmack geben und unter dem Namen Fuselöle (s. d.)
zusammengefaßt werden. Sie sind weniger flüchtig als
Wasser und treten erst in der letzten Periode der Destillation auf.
Außerdem kommen noch andre riechende und schmeckende Stoffe
vor, welche, leichter flüchtig als Alkohol, bei der
Destillation zuerst erscheinen und hauptsächlich aus Aldehyd
bestehen. Um den Branntwein oder Rohspiritus von diesen Stoffen zu
befreien (denselben zu raffinieren), behandelt man ihn zuweilen mit
Holzkohle; meistens aber wird zugleich mit Herstellung von starkem
S. (die Rektifikation zu Ware von 90 und mehr Prozenten) eine
Trennung der zu Anfang, Mitte und Ende der nochmaligen Destillation
zu erhaltenden Produkte vorgenommen und so, unter Benutzung der
verschiedenen Flüchtigkeit der bezeichneten Stoffe, ein reines
Produkt, der Sprit, erhalten. Das Verfahren stellt also im
wesentlichen eine unterbrochene Destillation dar; die Apparate sind
hauptsächlich Säulenapparate mit Blase und kräftigen
Verstärkungseinrichtungen. Man erhält Vorlauf, reinsten
Sprit von etwa 90-93 Proz., und dann Nachlauf, die getrennt
aufgefangen werden. Alle Kühlvorrichtungen der
Destillationsapparate endigen mit einem sogen. Verschluß
(Ablauf, Glocke). Ein solcher (Textfig. 3) besteht z. B. aus einer
zweischenkeligen Röhre t t, welche bei s an das Ende der
Schlange p p befestigt ist. Der eine Schenkel erweitert sich oben
zu einem mit einer Glasglocke bedeckten Trichter w mit dem
Abfluß v und enthält ein Alkoholometer, so daß man
die Beschaffenheit des Destillats beständig beobachten kann.
Das Rohr x dient zum Entweichen von Luft aus dem Apparat und von
Kohlensäure aus der Maische. Soll das Destillat je nach seiner
Reinheit nach verschiedenen Behältern geleitet werden, so sind
weniger einfache Verschlüsse erforderlich. Der Ablauf von
Savalle (Textfig. 4) gestattet nicht nur die Beobachtung des
Alkoholgehalts des Destillats und die beliebige Ableitung, sondern
auch das Abmessen der in einer gewissen Zeit gelieferten
Flüssigkeit. b ist das Zuflußrohr vom Kühlapparat,
c der Ansatz für den Ablauf mit dem Probehähnchen d; die
Verschlußglocke e enthält ein Aräometer und die
Meßröhre, welche durch den Boden der die Glocke
tragenden Schale l hindurchgeht. f ist die Öffnung für
den Abfluß, g die Verteilungskugel mit den Leitungen h i k
nach den verschiedenen Behältern. Der zuströmende S.
fließt durch f ab, steigt aber teilweise nach e, übt von
hier aus einen Druck auf den Abfluß durch f und setzt sich
mit diesem ins Gleichgewicht. Die Größe der Öffnung
f wird durch besondere Versuche so reguliert, daß die Zahlen
an der Meßröhre den Abfluß in einer bestimmten
Zeit ergeben. Steigt die Flüssigkeit in e, so fließt
durch f mehr S. ab, weil der Druck größer wird. Wenn der
Brennapparat und der Kühler gleichmäßig arbeiten,
erscheint der Stand der Flüssigkeit in e vollkommen ruhig und
unveränderlich; jede Unregelmäßigkeit im Betrieb
wird hier sofort erkannt.
Man benutzt S. zu Getränken (Branntwein, Likör), als
Lösungsmittel zur Darstellung von Tinkturen, Firnissen,
Parfümen, Extrakten, Alkaloiden, auch in der Färberei und
Rübenzuckerfabrikation, ferner zur Bereitung von Essig,
Äther, Chloroform, Chloralhydrat, zusammengesetzten
Äthern, Aldehyd, Knallsäuresalzen, Soda, Pottasche,
Teerfarben und vielen andern Präparaten, zum Konservieren
fäulnisfähiger Substanzen, als Brennmaterial, zum
Füllen von Thermometern, zur Regeneration alter
Ölgemälde, als Arzneimittel etc. - Was die Ausbeute
betrifft, so sollten Stärkemehl 56,78 Proz., Rohrzucker 53,8,
Traubenzucker 51,1 Proz. Alkohol liefern, thatsächlich aber
erhält man weniger, z. B. aus Rohrzucker nur 51,1 Proz.
Alkohol. In der Praxis liefern:
100 kg Gerste . . 44,64 Liter S. von 50 Proz. Tr.
100 " Gerstenmalz 54,96 " " " 50 " "
100 " Weizen . . 49,22 " " " 50 " "
100 " Roggen . . 45,80 " " " 50 " "
100 " Kartoffeln . 18,32 " " " 50 " "
Multipliziert man die Literzahl mit dem Alkoholgehalt in
Volumprozenten, so erhält man Literprozente. Ein metrischer
Zentner Gerste liefert danach 2232, Gerstenmalz 2748, Weizen 2461,
Roggen 2290, Kartoffeln 916 Literprozent Alkohol. Nach solchen
Literprozenten rechnet man im deutschen Spiritushandel, und zwar
nimmt man 10,000 Literprozent (100 Lit. à 100 Proz.) als
Einheit an und bezieht auf sie die Preisnotierungen.
Über die Alkoholproduktion liegen zuverlässige Angaben
nicht vor. Der jährliche Verbrauch auf den Kopf der
Bevölkerung betrug 1881-85 in:
Liter Alkohol | Lit. 45% Branntwein
Italien . . . 0,9 | 2,0
Norwegen . . 1,7 | 3,8
Finnland . . 2,2 | 4,9
Großbritannien 2,7 | 6,0
Österreich-Ungarn . . . 3,5 | 7,7
Frankreich . . 3,8 | 8,4
Schweden . . 3,9 | 8,7
Deutschland 4,1 | 9,1
Schweiz . . 4,6 | 10,2
Rußland (europ.) . . 4,7 | 10,4
Belgien . . 4,7 | 10,4
Niederlande 4,7 | 10,4
Dänemark . 8,9 | 19,8
Verein. Staaten 2,6 | 5,8
168
Spiritus familiaris - Spittler.
Seit 1875 zeigt sich eine Steigerung des Alkoholverbrauchs in
Frankreich von 2,9 auf 3,8, in Rußland von 4,0 auf 4,7, in
Österreich-Ungarn, Belgien blieben die Verbrauchsziffern
dieselben, in den Niederlanden, Großbritannien, Finnland,
Deutschland ist eine geringe, in Schweden und Norwegen eine
beträchtliche Abnahme zu verzeichnen. 95 Proz. des
produzierten S. sollen zum Genuß verbraucht werden.
Alkoholische Getränke waren schon in den ältesten
Zeiten bei vielen Völkern bekannt, aber erst im 8. Jahrh.
gewann man durch Destillation von Wein einen S. In den
nördlichen Ländern war bis zum Ende des 18. Jahrh. der
Kornbranntwein allein herrschend. Die ersten Versuche mit
Kartoffeln scheinen 1775 in Schweden angestellt worden zu sein, und
1796 wurde in Franken Kartoffelbranntwein gewonnen. Wichtigkeit
erlangte die Kartoffelbrennerei aber erst seit 1810, und 20 Jahre
später war die Kartoffel in Deutschland das Hauptmaterial
für die Branntweingewinnung. Infolge der Kartoffelkrankheit
wandte man sich wieder mehr dem Getreide, dann aber auch dem Mais,
der Melasse und den Zuckerrüben zu. Zur Verarbeitung der
Kartoffel gaben der ältere und der jüngere Siemens 1818
und 1840 zweckmäßige Apparate an. Die alten
Destillierblasen wurden vielfach verbessert, durch direkten Dampf
geheizt (Gall 1829) etc. Zusammengesetzte Destillierapparate
konstruierten Adam und Solimani in Nîmes (1801), Pistorius
(1816), Cellier-Blumenthal und Derosne (1818), Dorn (1819), Schwarz
(1833), Siemens (1850) etc. Die von Lowitz 1790 entdeckte
Eigenschaft der Kohle, das Fuselöl zu absorbieren, wurde
schnell in die Praxis eingeführt. Die neuesten Fortschritte
betreffen die gründlichere Aufschließung des Materials
durch gespannte Dämpfe und Zerkleinerungsapparate vor dem
Maischen (Hollefreund, Bohm, Henze), namentlich aber ist die
Spiritusfabrikation auch durch wissenschaftliche Untersuchungen
über den Gärungsprozeß, die Ernährung der Hefe
und durch Verbesserung der analytischen Methoden gefördert
worden. Das Laboratorium und die Versuchsstation der deutschen
Spiritusfabrikanten in Berlin hat wesentlich beigetragen, für
die Spiritusfabrikation eine wissenschaftlich begründete Basis
zu gewinnen. Vgl. Stammer, Die Branntweinbrennerei und deren
Nebenzweige (Braunschw. 1875); Derselbe, Wegweiser in der
Branntweinbrennerei (das. 1876); Märcker, Handbuch der
Spiritusfabrikation (4. Aufl., Berl. 1886); Böhm,
Branntweinbrennereikunde (9. Aufl., das. 1885); Gumbinner,
Anleitung zur Spiritusfabrikation (das. 1882); Bersch, Die
Spiritusfabrikation und Preßhefebereitung (das. 1881);
Ulbricht und Wagner, Handbuch der Spiritusfabrikation (Weim. 1888);
Freiesleben, Der Brennereibau (Berl. 1885); "Zeitschrift für
Spiritusindustrie" (das.).
Spiritus familiaris (neulat.), ein vertrauter dienstbarer
Geist, Hausgeist.
Spirochaete Ehrb., früher Gattung der Spaltpilze,
deren angebliche Arten wie die nahe verwandten Spirillen als
Entwickelungsformen von Bakterien erkannt sind.
Spirometer (griech.), von Hutchinson angegebener Apparat,
welcher dazu dient, das Luftquantum zu bestimmen, welches beim
Atmen aus den Lungen entweicht. Das S. stimmt im Prinzip mit dem
gewöhnlichen Gasometer (s. d.) überein. Die durch einen
Schlauch unter die Glocke des Gasometers geleitete ausgeatmete Luft
hebt die durch Gegengewichte äquilibrierte Glocke und kann
direkt an einer Skala gemessen werden.
Spirre, s. Blütenstand, S. 82.
Spirsäure, s. Salicylsäure.
Spital (lat., Spittel), s. v. w. Hospital.
Spital, Marktflecken im österreich. Herzogtum
Kärnten, an der Drau und der Bahnlinie Marburg-Franzensfeste,
ist Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines Bezirksgerichts,
hat ein Schloß des Fürsten Porzia, Holzstofffabrikation
und (1880) 1832 Einw.
Spitalfields (spr. spittelfihlds), Stadtteil im O.
Londons, in welchem sich die aus Frankreich eingewanderten
hugenottischen Seidenweber niederließen, deren Nachkommen
teilweise noch jetzt dort wohnen.
Spithead (spr. spitt-hedd), s. Portsmouth.
Spitta, Karl Johann Philipp, geistlicher Liederdichter,
geb. 1. Aug. 1801 zu Hannover, studierte in Göttingen
Theologie und ward, nachdem er verschiedene andre Stellen bekleidet
hatte, 1853 Superintendent zu Peine im Hildesheimischen, dann im
Juli 1859 Superintendent in Burgdorf, wo er 28. Sept. d. J. starb.
Außer einzelnen Predigten veröffentlichte er: "Psalter
und Harfe" (Leipz. 1833 u. öfter), eine in zahlreichen
Auflagen verbreitete Sammlung geistlicher, für häusliche
Erbauung bestimmter Lieder, die durch Vollendung der Form,
Innigkeit und wahrhaft christliches Gepräge zu den besten
derartigen Produkten der Neuzeit gehören. Noch erschienen von
ihm: "Nachgelassene geistliche Lieder" (5. Aufl., Brem. 1883).
Spittas Leben beschrieb Münkel (Leipz. 1861). -
Sein Sohn Philipp, geb. 27. Dez. 1841 zu Wechold bei Hoya in
Hannover, seit 1875 Dozent der Musikgeschichte an der Hochschule
für Musik (seit 1882 deren stellvertretender Direktor) sowie
Universitätsprofessor für Musikwissenschaft und
Sekretär der Akademie der Künste zu Berlin, hat sich
durch seine Biographie "Johann Sebastian Bach" (Leipz. 1873-79, 2
Bde.; engl., Lond. 1884) sowie durch eine Gesamtausgabe der
Orgelwerke Buxtehudes und der Werke von H. Schütz bekannt
gemacht. Kleinere Schriften von ihm sind: "Über J. S. Bach"
(Leipz. 1879) und "Ein Lebensbild Robert Schumanns" (das. 1882).
Mit Chrysander und Adler gibt er seit 1885 die "Vierteljahrsschrift
für Musikwissenschaft" (Leipz.) heraus.
Spittler, Ludwig Timotheus, Freiherr von, berühmter
Geschichtschreiber und Publizist, geb. 11. Nov. 1752 zu Stuttgart,
widmete sich in Tübingen und Göttingen theologischen und
historischen Studien, ward 1778 Repetent am theologischen Seminar
zu Tübingen und 1779 Professor der Philosophie zu
Göttingen, wo er sich als Lehrer der Geschichte großen
Ruf erwarb, kehrte aber 1797 als Präsident der
Oberstudiendirektion und Wirklicher Geheimer Rat in sein Vaterland
zurück; 1806 ward er auch zum Kurator der Universität
Tübingen und Minister ernannt und zugleich in den
Freiherrenstand erhoben. Er starb 14. März 1810. Von seinen
Schriften sind zu bemerken: "Geschichte des kanonischen Rechts bis
auf die Zeiten des falschen Isidor" (Halle 1778); "Grundriß
der Geschichte der christlichen Kirche" (Götting. 1782; 5.
Aufl. von Planck, 1813); "Geschichte Württembergs unter den
Grafen und Herzögen" (das. 1783); "Geschichte des
Fürstentums Hannover" (das. 1786); "Entwurf der Geschichte der
europäischen Staaten" (Berl. 1793, 2 Bde.; 3. Aufl. von
Sartorius, 1823); "Geschichte der dänischen Revolution 1660"
(das. 1796). Seine geistreich skizzierten "Vorlesungen über
die Geschichte des Papsttums" wurden mit Anmerkungen von Gurlitt
(Hamb. 1828), seine "Geschichte der Kreuzzüge" (das. 1827) und
die "Geschichte der Hierarchen von Gregor VII. bis auf die Zeit der
Reformation"
169
Spitzbergen - Spitzen.
von K. Müller (das. 1828) herausgegeben. Seine
sämtlichen Werke gab sein Schwiegersohn K. v. Wächter
(Stuttg. 1827-37, 15 Bde.) heraus. S. verband mit ernster
Quellenforschung philosophischen Geist und lichtvolle Darstellung
bei sinnreicher Kürze, hellen politischen Blick und Sicherheit
des Urteils. Vgl. Planck, Über S. als Historiker
(Götting. 1811).
Spitzbergen, Inselgruppe im Nördlichen Eismeer,
zwischen 76° 27'-80° 50' nördl. Br. und
10°-32½° östl. L. v. Gr., nordöstlich von
Grönland, dem es früher zugerechnet wurde, während
Nordenskjöld 1868 den untermeerischen Zusammenhang von S. mit
Skandinavien nachwies. Die Gruppe besteht aus der Hauptinsel,
Westspitzbergen (39,540 qkm oder 718 QM.), dem von voriger durch
die Hinlopenstraße getrennten Nordostland (10,460 qkm oder
190 QM.), dem Edgeland oder Stans-Foreland (5720 qkm oder 104 QM.),
der Barentsinsel, König Karls-Land, Prinz Karls-Vorland und
vielen kleinern Eilanden, welche ein Gesamtareal von 70,068 qkm
(1273 QM.) einnehmen. Die Inselgruppe ist im Sommer von Eisschollen
umgeben, im Winter von festen Eismassen eingeschlossen; nur
längs der Westküste ist das Meer fast das ganze Jahr
hindurch von Eis frei. Die Nordküste wird in den meisten
Jahren durch den auch an ihr vorüberziehenden Golfstrom
verhältnismäßig früh vom Treibeis befreit,
wogegen die Ostseite von einem Polarstrom bestrichen wird. Die
Hauptinseln steigen mit steilen Ufern aus dem Meer auf und sind im
Innern mit einer 100 m dicken Schicht Landeis bedeckt, aus welcher
scharfe Bergspitzen (daher der Name) bis zu 1390 m hervorragen. Die
Hauptgebirgsart ist Granit; von vulkanischen Produkten findet sich
der sogen. Hyperit vor, daneben Jurakalksteine, Kreide und andre
Sedimentärgebilde. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt
unter 79° 53' nördl. Br. (Mosselbai) -9,56° C., die
des kältesten Monats (Februar) -22,69°, die des Juli
+4,55°. Das Klima ist also bedeutend milder als in Nordamerika
unter weit südlichern Breiten, was dem Golfstrom zuzuschreiben
ist. Die Vegetation ist äußerst dürftig, da die
Erdrinde nur während weniger Wochen im Sommer, wo die Sonne
nicht untergeht, von Eis und Schnee frei ist; von baumartigen
Gewächsen finden sich nur zwei einige Zoll hohe Weidenarten.
Überhaupt hat man 96 Arten von Phanerogamen und etwa 250
Kryptogamen beobachtet. Kruciferen und Gramineen herrschen vor.
Fließende Wasser gibt es nur zur Zeit der Schneeschmelze. Von
Landsäugetieren kommen vor: das Renntier (sehr zahlreich), der
Eisbär, der braune Bär (?, selten), der Blaufuchs, aber
kein Lemming; dagegen sind die Küsten reich an Walrossen und
Robben. Im W. fanden sich früher viele Walfische, deren Zahl
jedoch durch die beständige Verfolgung auf ein Geringes
gesunken ist. Jetzt jagt man an den Küsten neben den
Flossenfüßern besonders den Weißfisch und eine
Haifischart (Haakjärring). Von Vögeln kennt man 28 Arten,
von denen das Schneehuhn (Lagopus hyperboreus) der einzige
Standvogel ist. An Insekten hat man bisher 23 Arten entdeckt. Das
Mineralreich bietet Granit (reich an edlen Granaten), Graphit,
Bleiglanz, Eisen, Marmor u. Braunkohlen. Eingeborne oder auch nur
ansässige Bevölkerung hat keine der Inseln; doch haben
sich bisweilen einzelne russische Jäger mehrere Jahre lang auf
denselben aufgehalten, und während der Sommermonate werden sie
von Fangfischern besucht, wenn auch nicht mehr so zahlreich wie
früher. Im 17. und 18. Jahrh. war die Gruppe der Sammelplatz
aller Walfischfänger, und an den Küsten wurden um das
Privilegium des Walfischfangs und Robbenschlags zwischen
Engländern, Holländern, Dänen und Franzosen vielfach
blutige Kämpfe ausgefochten. Jetzt macht keine der
seefahrenden Nationen Ansprüche auf den Besitz der Gruppe. S.
wurde 1596 von den Holländern Barents, Heemskerk und Cornelis
Ryp entdeckt. Näher erforscht wurden die Inseln in neuerer
Zeit unter andern von Scoresby (1817-18), Parry (1827), der
Recherche-Expedition (1838 ff.), Lamont (1858 und später),
Karlsen (seit 1859), v. Heuglin (1870), Tobiesen (seit 1865), Leigh
Smith (1871-72), besonders aber von den schwedischen Expeditionen
unter Torell und Nordenskjöld (1858-73). S. Karte
"Nordpolarländer". Vgl. außer den Berichten in
"Petermanns Mitteilungen": Nordenskjöld, Die schwedischen
Expeditionen nach S. und Bären-Eiland (Jena 1869); Heuglin,
Reisen nach dem Nordpolarmeer 1870-71 (Braunschw. 1872-74, 3
Bde.).
Spitzbeutel, s. Filtrieren, S. 263.
Spitzblume, s. Ardisia.
Spitzbogen, s. Bogen und Gewölbe.
Spitzbogenstil, ungenaue Benennung für gotischer
Stil, s. Baukunst, S. 496.
Spitze, in der Heraldik, s. Heroldsfiguren.
Spitzeder, Adele, s. Dachauer Banken.
Spitzel, in Süddeutschland s. v. w.
Geheimpolizist.
Spitzeln, Kartenspiel, eine Art Solo unter dreien, wird
mit mancherlei Abweichungen gespielt. Erforderlich ist dazu eine
Pikettkarte, aus welcher man 1) alles Karo (bez. Schellen) bis auf
die Sieben und 2) die Coeur- (rote) Acht entfernt hat. So bleiben 8
Blätter für jeden. Man spielt entweder in den schlechten
Farben oder in "Kouleur" (Karo). Die ständigen Trümpfe:
Spadille, Manille, Baste gelten wie im gewöhnlichen Solo; in
Kouleur gibt es also nur 3 Trümpfe. Zum Gewinn eines Spiels
gehören wenigstens 5 Stiche. Wenn alle passen, wird
"gespitzelt" ("gestichelt"), d.h. man spielt ohne Trumpf, und
derjenige, welcher den letzten Stich macht, verliert. Gerade diese
für das Spiel charakteristische Regel wird aber oft durch
Karteneinwerfen oder durch ein Points-Spiel ersetzt. Im letztern
Fall zählt man die Karten von Daus bis Zehn herab der Reihe
nach 5, 4, 3, 2 und 1. Jeder sucht soviel Points wie möglich
zu bekommen. Wer über 15 hat, bekommt von jedem den
Überschuß vergütet, und wer die wenigsten Augen
hat, muß an beide bezahlen, selbst wenn der zweite nicht bis
15 gekommen ist.
Spitzen (Kanten), zarte Geflechte mit durchsichtigem
Grund und einem aus dichter liegenden Fäden gebildeten Muster,
werden entweder mit Klöppeln (Kissenspitzen, Dentelles) oder
mit der Nadel (Points) gefertigt. Zum Klöppeln bedarf man
eines Polsters (Klöppelsacks), welches im Erzgebirge
walzenförmig und drehbar, in Belgien und Frankreich viereckig
und flach gewölbt ist; auf dem Sack liegt der
Klöppelbrief, ein Streifen Papier, auf welchem das Muster in
Nadelstichen vorgezeichnet ist. Die Klöppel sind etwa 10 cm
lange Holzstäbchen, auf welchen der zu verarbeitende Zwirn
aufgewickelt (und im Erzgebirge durch eine übergeschobene
Papierhülse geschützt) ist; die Löcher des
Musterbriefs werden bei der Arbeit mit Nadeln besteckt und die
Fäden durch Hin- und Herwerfen der Klöppel, welche von
der Walze herabhängen oder auf dem belgischen Kissen liegen,
zwischen den Nadeln verflochten. In dem Maß, wie die Arbeit
fortschreitet, werden aus der fertigen Spitze die Nadeln ausgezogen
und in die folgenden offenen Löcher des Briefs gesteckt. Ist
die Spitze Ellenware, so kann die Arbeit auf der rotierenden Walze
beliebig
170
Spitzen - Spitzenglas.
oft rund herum fortgehen. Genähte S. werden entweder auf
einem Gewebe, Tüll, Marly etc., oder auf einem für diesen
Zweck mit dem Klöppel oder der Nadel hergestellten
Spitzengrund aufgenäht. Das Muster ist auf ein Blatt starkes
Papier (früher Pergament) gezeichnet; die Nadel folgt den
Umrissen und umschnürt diese der Befestigung halber noch
einmal. Ist das Muster fertig, so wird das Papier weggerissen.
Durch noch stärkern, sowohl breitern als plastisch
heraustretenden Umriß zeichnet sich die Guipurespitze aus;
Guipure ist ein dicker Faden oder ein Streifen von dünnem
Pergament oder Kartenpapier, welcher mit dem Faden ganz umwunden
ist. Seit Anfang unsers Jahrhunderts besteht neben der
Handspitzenindustrie die Fabrikation der S. auf Maschinen, so
daß man wohl Handspitzen (echte) und Maschinenspitzen
(unechte) unterscheidet. Wenn nun auch feststeht, daß die
Spitzenmaschine eine große Mannigfaltigkeit in ihren
Produkten und eine erstaunliche Ähnlichkeit mit den echten S.
zu erzeugen vermag, so nehmen die Maschinenspitzen in Bezug auf
Wechsel und schöne Formgestaltung des Erzeugnisses doch immer
nur einen zweiten Rang ein, da sie ausschließlich
Nachahmungen der Handspitzen sind. Bei den applizierten S. wird das
geklöppelte Muster auf feinen Maschinengrund aufgenäht;
bei den tamburierten ist der Grund und zum Teil auch das Muster aus
der Maschine erzeugt und die Ergänzung durch Handarbeit
ausgeführt. Nach dem Material unterscheidet man seidene S.,
speziell Blonden, welche in Schwarz und Weiß vorkommen,
leinene S. (alle echten S.), baumwollene (die englischen
Maschinenspitzen) und wollene (Mohairspitzen). Die Anfertigung der
S. mag in eine sehr frühe Zeit zurückreichen, doch ist
über ihren Ursprung nichts bekannt. Vielleicht entwickelte sie
sich aus Flecht- und Knüpfwerk, welches in der auf alter
Überlieferung beruhenden Hausindustrie namentlich
südlicher Länder noch heute vorkommt und mit der Nadel
später auf einen durchbrochenen Grund übertragen wurde.
In Italien wurden um die Mitte des 15. Jahrh. nachweislich schon
Nadelspitzen gefertigt, und man gibt an, daß die Kunst
dorthin von Byzanz oder dem sarazenischen Sizilien gekommen sei.
Man unterscheidet Reticellaspitzen (s. d.), venezianische oder
Reliefspitzen (s. d.), Rosenspitzen (s. d.) u. a. Der englische
Ausdruck Lace findet sich zur Zeit Richards III., und 1545 werden
in Frankreich Dentelles erwähnt. Älter scheint die
Spitzenklöppelei in den Niederlanden zu sein; doch liegen auch
dafür keine bestimmten Zeugnisse vor. In Deutschland wurde
diese Industrie durch Barbara v. Elterlein (aus Nürnberg
stammend) eingeführt, welche 1553 als Gattin des Bergherrn
Uttmann zu Annaberg in Sachsen starb. Die alten italienischen
Nadelspitzen wurden besonders in Venedig und Mailand hergestellt;
in Genua und Albissola wurde geklöppelt. Im 17. Jahrh.
gelangte die Spitzenindustrie durch den Venezianer Vinciolo nach
Frankreich, und gewisse Städte, wie Sedan, Alençon,
wurden schnell berühmt als Sitze derselben, zumal seit Ludwig
XIV. sie lebhaft begünstigte. Alençoner S. werden
durchaus mit der Nadel gearbeitet; die Fabrikation, welche
wiederholt dem Erlöschen nahe war, wurde immer wieder
emporgebracht, zuletzt durch Napoleon III. Argentan, Chantilly,
Valenciennes, Lille lieferten ebenfalls berühmte S. In den
Niederlanden entwickelte sich die Klöppelarbeit sehr lebhaft
und kann noch heute als ein Hauptfaktor des Nationalwohlstandes in
Belgien betrachtet werden. Die Brüsseler S. sind in jeder
Beziehung die feinsten von allen; ihre Vorzüge sind
begründet durch die Güte des belgischen Flachses, die
Feinheit des aus diesem gewonnenen Zwirns und die ererbte
Geschicklichkeit der Arbeiterinnen. Der Netzgrund (réseau)
der Brüsseler S. wird jetzt von der Maschine geliefert
(Bobbinet), während man ihn früher nähte oder
klöppelte. Mechelner S. werden in Einem Stück auf dem
Polster gearbeitet und besitzen nach Art des Plattstichs
eingewirkte Blümchen. Andre Sitze der belgischen
Spitzenindustrie sind Gent und Brügge (points de duchesse).
Von Hugenotten lernten die Holländer feinere Leinenspitzen
machen, doch gelangte diese Industrie dort nicht zu der Bedeutung
wie in den südlichen Provinzen. Im Erzgebirge verbreitete sich
das Klöppeln sehr schnell, und seit dem Anfang des 17. Jahrh.
trugen schottische Händler die sächsischen und
böhmischen S. in alle Länder. Seit Einführung der
Maschinenarbeit hat gerade diese einst so blühende Industrie
sehr stark gelitten, weil sie sich im allgemeinen auf so einfache
Erzeugnisse beschränkte, die sehr leicht durch Maschinenarbeit
nachgeahmt werden konnten. Jetzt werden im Erzgebirge (weiteres s.
d.) und in Böhmen die verschiedensten S. dargestellt, und um
die Hebung der Industrie bemühen sich zahlreiche
Klöppelschulen (Schneeberg, Gassengrün, Bleistadt u. a.).
Auch im Hirschberger Kreis ist seit 1855 die Spitzenindustrie
eingeführt worden. In vielen andern Gegenden Deutschlands
sowie in Genf und Neuchâtel erblühte dieselbe durch
Hugenotten, doch nur auf kurze Zeit. Französische und
niederländische Flüchtlinge wurden auch in England die
Begründer der Spitzenfabrikation. Zuerst ahmte man
vorzüglich Valencienner und Brüsseler S. nach,
gegenwärtig werden alle möglichen Stile gepflegt. Honiton
in Devonshire arbeitet mit der Nadel auf Brüsseler Grund,
vornehmlich Zweige mit Blättern und Blüten, welche jetzt
meist in Guipure ausgeführt werden. Die Maschinenarbeit hat
der Spitzenmacherei außerordentlich geschadet, sie bringt
schöne Arbeit in unbegrenzter Menge zu mäßigen
Preisen hervor; doch ist das Glatte und Regelmäßige der
Arbeit den zarten Effekten der Ausführung schädlich, und
niemals kann sie mit den durch die Hand geschaffenen Meisterwerken
konkurrieren. Spanische S. werden aus Gold- und Silberdraht
hergestellt, der mit bunter Seide und kleinen Perlen untermischt
ist. In den skandinavischen und slawischen Ländern werden
meist grobe Leinen- und Litzenspitzen angefertigt, in
Rußland, Siebenbürgen, Rumänien u. a. von der
Hausindustrie. Vgl. Palliser, History of lace (3. Aufl., Lond.
1875); Séguin, La dentelle. Histoire, description,
fabrication, bibliographie (Par. 1874); Ilg, Geschichte und
Terminologie der alten S. (Wien 1876); Hans Sibmacher, Stick- und
Musterbuch (nach der Ausgabe von 1597 hrsg. vom
Österreichischen Museum für Kunst und Industrie, 3.
Aufl., das. 1882, und von Wasmuth, Berl. 1885; nach der 4. Ausg.
von 1604 hrsg. von Georgens, das. 1874); Wilhelm Hoffmann,
Spitzenmusterbuch (nach der Ausgabe von 1607 hrsg. vom
Österreichischen Museum, Wien 1876); Derselbe,
Originalstickmuster der Renaissance (das. 1874); v. Braunmühl,
Technik u. Entwickelung der Spitzen (in der Zeitschrift "Kunst und
Gewerbe", Nürnb. 1882); Raßmussen, Klöppelbuch
(Kopenh. 1884); Jamnig u. Richter, Technik der geklöppelten
Spitze (Wien 1886 ff.). Auch gab Cocheris in Paris eine Reihe
seltener Spitzenmusterbücher aus der Bibliothèque
Mazarin und Eitelberger 50 Blatt der schönsten Muster aus
deutschen und italienischen Musterbüchern des 16. Jahrh. (Wien
1874) heraus.
Spitzenglas, s. v. w. Fadenglas, s. Millefiori.
171
Spitzengrund - Spitzmäuse.
Spitzengrund, s. Spitzen.
Spitzenkatarrh, Katarrh der Lungenspitzen.
Spitzenpapier, durch Pressen und Ausschlagen
spitzenähnlich gestaltetes Papier, dient besonders zu
Manschetten für Bouketts.
Spitzenschnitt, in der Heraldik, s. Heroldsfiguren.
Spitzer, Daniel, Wiener Feuilletonist, geb. 3. Juli 1835
zu Wien, studierte daselbst die Rechte, war kurze Zeit als
Konzipist bei der Wiener Handelskammer beschäftigt und begann
seine litterarische Laufbahn mit volkswirtschaftlichen Artikeln und
einzelnen Beiträgen für die Witzblätter Wiens. Seine
satirischen Aufsätze, welche er von 1865 an als "Wiener
Spaziergänge" in der "Neuen Freien Presse" zu
veröffentlichen begann, fanden außergewöhnliche
Teilnahme und begründeten seinen Ruf. Ein Teil dieser an die
politisch-sozialen oder litterarischen Hauptereignisse des Tags
anknüpfenden Feuilletons wurde unter dem Titel: "Wiener
Spaziergänge" (6 Bde., mehrfach aufgelegt) gesammelt
herausgegeben. Die Novellen: "Das Herrenrecht" (Wien 1877) und
"Verliebte Wagnerianer" (das. 1878), die ebenso zahlreiche Auflagen
erlebten, sind gleichfalls nur als Satiren, nicht als wirkliche
Erzählungen aufzufassen; an ihrem Erfolg hatten die
pikant-lüsternen Elemente jedenfalls so viel Anteil wie die
humoristischen.
Spitzfuß, s. Pferdefuß.
Spitzgang, s. Mühlen, S. 849.
Spitzgeschoß, s. v. w. Langgeschoß, s.
Geschoß.
Spitzharfe, s. Harfe.
Spitzhengst (Klopfhengst), männliches Pferd, bei
welchem eine oder beide Hoden nicht im Hodensack, sondern in der
Bauchhöhle liegen und nicht zur vollständigen
Entwickelung gelangen. Die Kastration des Spitzhengstes ist nicht
ohne Gefahr, gelingt aber bei geschickter Ausführung oft. Die
Meinung, daß der S. eine größere Anlage zur
Bösartigkeit habe als Hengste mit normalen Hoden, beruht auf
Irrtum.
Spitzhörnchen (Tupaiidae), s. Insektenfresser.
Spitzkasten, s. Aufbereitung, S. 53.
Spitzkeimer, s. Monokotyledonen.
Spitzklette, s. Xanthium.
Spitzkugeln, Geschosse gezogener Handfeuerwaffen mit
kegelförmiger Spitze.
Spitzlerche, s. Pieper.
Spitzmäuschen (Apion Herst.), Käfergattung aus
der Gruppe der Kryptopentameren und der Familie der
Rüsselkäfer (Curculionina), sehr kleine, birnförmige
Käferchen mit dünnem, fadenförmigem Rüssel,
dünnen, nicht geknieten Fühlern, welche in einem ovalen
und zugespitzten Knopf enden, punktförmigem Schildchen und
kürzern oder längern Flügeldecken, welche den
Hinterleib ganz bedecken. Man kennt ca. 300 Arten, welche im
Sonnenschein lebhaft umherfliegen und Blüten und junges Laub
der verschiedensten Pflanzen benagen. Die Larven leben meist in den
Samen von Leguminosen, seltener im Mark von Krautstengeln. A.
apricans Herbst., 2 mm lang, schwarz, leicht metallisch
glänzend, an der Fühlerbasis, den Hüften und
Schenkeln rotgelb, ist überall häufig auf Wiesen; das
Weibchen legt die Eier an den Blütenstand des Klees, dessen
Samen die Larven auf einzelnen Feldern bisweilen fast
vollständig vernichten. Die Larven verpuppen sich zwischen den
Blüten des Köpfchens, und bald darauf schlüpft der
Käfer aus, welcher überwintert.
Spitzmäuse (Soricidea Gerv.), Familie aus der
Ordnung der Insektenfresser, kleine Säugetiere vom Habitus der
Ratten und Mäuse, mit schlankem Leib, langem Kopf, gestrecktem
Schnauzenteil, sehr vollständigem Gebiß, meist kleinen
Augen und Ohren und eigentümlichen Drüsen an den Seiten
des Körpers oder an der Schwanzwurzel. Die S. finden sich in
der Alten Welt und Amerika und sind durch Vertilgung
schädlicher Insekten sehr nützlich. Sie zerfallen in zwei
Unterfamilien: eigentliche S. (Soricina) und Bisamspitzmäuse
(Myogalina). Die Waldspitzmaus (Sorex vulgaris L., s. Tafel
"Insektenfresser"), 6,5 cm lang, mit 4,5 cm langem,
gleichmäßig behaartem Schwanz, ist rotbraun, an den
Seiten lichter, unterseits gräulichweiß, mit oben
dunkelbraunem, unten bräunlichgelbem Schwanz und langen,
schwarzen Schnurren, findet sich weitverbreitet in Europa, in der
Ebene und im Gebirge, am häufigsten in feuchten Wäldern,
an Flüssen und Teichen; sie kommt im Winter in Ställe,
Scheunen und Wohnhäuser und lebt in selbstgegrabenen oder
schon vorhandenen unterirdischen Gängen. Sie ist sehr
lichtempfindlich und jagt daher nur nachts. Außer Insekten
und Würmern frißt sie auch Mäuse und S. Sie ist
ungemein gewandt, höchst gefräßig und blutgierig,
durchaus ungesellig und wirft zwischen Mai und Juli im Mauerwerk
oder unter hohlen Baumwurzeln in einem selbstgebauten Nest 5-10
Junge. Sie riecht sehr stark moschusartig, wird deshalb von der
Katze zwar getötet, aber nicht gefressen; nur einige
Raubvögel, Storch und Kreuzotter verschlingen sie. Ehemals
galt sie als sehr heilkräftig und, wie z. B. noch jetzt in
England, als höchst giftig. Die Zwergspitzmaus (S. pygmaeus
Pall.), das kleinste Säugetier diesseit der Alpen, 4,6 cm
lang, mit 3,4 cm langem Schwanz, oberseits dunkel graubraun, an den
Seiten mit gelblichem Anflug, unterseits weißgrau, findet
sich in fast allen Ländern Europas, in Nordasien und
Nordafrika, in Wäldern und in der Nähe von Gebüsch
und hat wesentlich dieselbe Lebensweise wie die vorige. Die
Hausspitzmaus (Crocidura Araneus Wagn., s. Tafel
"Insektenfresser"), 7 cm lang, mit 4,5 cm langem Schwanz, aus dem
Pelz deutlich hervortretenden Ohren und langen, zerstreut stehenden
Wimperhaaren auf dem Schwanz, oberseits braungrau, unterseits
hellgrau, bewohnt Nordafrika und fast ganz Europa, besonders Felder
und Gärten, jagt morgens und abends auf allerlei kleine Tiere,
siedelt sich gern in Gebäuden an und benascht Fleisch, Speck
und Öl. Das Weibchen wirft 5-10 Junge, welche schon nach sechs
Wochen ziemlich erwachsen und selbständig sind. Die
Wimperspitzmaus (C. etrusca Wagn.), 4 cm lang, mit 2,5 cm langem
Schwanz, neben einer Fledermaus das kleinste Säugetier, mit
verhältnismäßig sehr großer Ohrmuschel, ist
hellbräunlich, lebt in den Mittelmeerländern und am
Schwarzen Meer, am liebsten in Gärten und Gebäuden. Die
Wasserspitzmaus (Crossopus fodiens Wagn., s. Tafel
"Insektenfresser"), 6,5 cm lang, mit 5,3 cm langem Schwanz, mit
steifen Borstenhaaren ringsum an den Füßen und Zehen und
mit einem Kiel von ebensolchen Borstenhaaren längs der Mitte
der Unterseite des Schwanzes, ist oberseits schwarz, unterseits
weißlich, aber vielfach in der Farbe ändernd, findet
sich zuweilen in erstaunlicher Menge in Mittel- und Südeuropa
und in einem Teil Asiens, bewohnt fließende und stehende
Gewässer besonders gebirgiger Gegenden, geht auch auf Felder
und in Gebäude, gräbt sich unterirdische Gänge,
benutzt aber auch solche von Mäusen und Maulwürfen,
erscheint an Orten ohne Störung auch am Tag, schwimmt
vortrefflich, wobei ihr die Borstenhaare gute Dienste leisten, und
bleibt dabei vollständig trocken. Sie ist im Verhältnis
zu ihrer Größe das furchtbarste Raubtier, frißt
namentlich auch Lurche, Fische, Vögel und kleine
172
Spitzpocken - Spohr.
Säugetiere und wird dadurch der Teichwirtschaft
schädlich. Das Weibchen wirft in einem kleinen Kessel, der mit
Moos ausgekleidet wurde, 6-10 Junge. In der Gefangenschaft sind sie
schwer zu erhalten.
Spitzpocken, s. Windpocken.
Spitzsäule, s. v. w. Obelisk.
Spitzschwanz, s. v. w. Pfriemenschwanz, s. Madenwurm.
Spitzstein, s. Diamant, S. 931.
Spitzweg, Karl, Maler, geb. 5. Febr. 1808 zu
München, war anfangs Apotheker, studierte dann von 1830 bis
1832 auf der Universität in München und wendete sich erst
um 1835 der Kunst zu, in welcher er sich als Autodidakt durch
Studien nach ältern Meistern, insbesondere durch Kopien nach
den Niederländern ausbildete. Zur malerischen Darstellung
wählte er das spießbürgerliche Leben seiner Zeit in
gemütvoller und humoristischer Auffassung und mit Hervorhebung
gewisser Typen (Stadtgardisten, Nachtwächter, fahrende
Künstler, Invaliden, Sonderlinge, Gelehrte, Klausner), malte
daneben aber auch romantisch gehaltene Landschaften mit
phantastischer Staffage. Er bevorzugte dabei besonders die
Mondscheinbeleuchtung. Dem kleinen Format seiner Bilder entsprachen
die sorgsame Durchführung und die feine Charakteristik der
Figuren. Seine Hauptwerke sind: der arme Poet, Zauberer und Drache,
die reisende Künstlergesellschaft, schlafender Wachtposten bei
Mondschein, der Bücherantiquar, der Gelehrte im
Dachstübchen, der Kommandant, der Hypochonder, der
Sonntagsjäger, der Nachtwächter und die Serenade. Seit
1844 war er Mitarbeiter an den "Fliegenden Blättern", welche
er mit zahlreichen humoristischen Zeichnungen versah. Er starb 23.
Sept. 1885. Vgl. E. Spitzweg, Die S.-Mappe (Münch. 1887).
Spitzwegerich, s. Plantago (lanceolata).
Spitzahnornament, eine im normännischen und
romanischen Baustil vorkommende Gliedbesetzung (s. Abbildung).
Spix, Johann Baptist von, Naturforscher und Reisender,
geb. 9. Febr. 1781 zu Höchstadt a. d. Aisch, studierte in den
Seminaren zu Bamberg und Würzburg Theologie, wandte sich dann
zur Medizin und wurde 1811 Konservator der zootomischen Sammlungen
in München. 1817 ging er mit Martins nach Brasilien, kehrte
1820 nach Europa zurück und starb 13. März 1826 in
München. Er schrieb: "Geschichte und Beurteilung aller Systeme
in der Zoologie" (Nürnb. 1811); "Cephalogenesis" (Münch.
1815); "Reise nach Brasilien" (fortgesetzt von Fr. v. Martius, das.
1823 bis 1831, 3 Bde. mit Karten und Kupfern) und mehrere
Prachtwerke über Affen, Fledermäuse, Reptilien und
Vögel, die er in Brasilien gesammelt hatte (1824 bis 1825 mit
andern Zoologen vollendet).
Spizza (slaw. Spiz), Gemeinde in der dalmatischen
Bezirkshauptmannschaft Cattaro, im äußersten Süden
Österreichs, am Adriatischen Meer, mit Hafen und (1880) 1521
vorwiegend albanesischen Bewohnern. S. wurde durch den Berliner
Frieden 1878 von der Türkei an Österreich abgetreten.
Splanchnici (nervi s.), Eingeweidenerven.
Splanchnologie (griech.), Eingeweidelehre, Teil der
Anatomie (s. d.).
Spleen (engl., spr. splihn, "Milzsucht"), Form von
Melancholie mit Hypochondrie, welche oft zum Selbstmord führt.
Esquirol findet die Ursachen derselben zur Zeit der Pubertät
in einer unbestimmten, im Grund geschlechtlichen, unbefriedigten
Sehnsucht, beim reifern Alter im Aufgeben einer geregelten
Thätigkeit, in Übersättigung mit Vergnügungen
etc. Die Behandlung des Spleens muß zuerst die
körperlichen Verhältnisse berücksichtigen,
hinsichtlich deren sich meist Verdauungsstörungen vorfinden,
und die geistige Verstimmung durch zweckmäßige
psychische Behandlung, besonders durch geregelte Thätigkeit,
zu heben suchen.
Spleißofen, s. Kupfer, S. 320.
Splen (lat.), Milz; Splenalgie, Milzstechen; Splenitis,
Milzentzündung.
Splendid (lat.), glänzend, prächtig,
prachtliebend, viel aufgehen lassend; beim Buchdruck s. v. w. weit,
geräumig gesetzt (Gegenteil: kompreß).
Splint (Splintholz), s. Holz, S. 669; im Bauwesen s. v.
w. Schließe, s. Anker, S. 597.
Splintkäfer, s. Borkenkäfer.
Splissen, die Vereinigung zweier Tauenden, welche zu dem
Zweck aufgedreht werden, so daß die einzelnen Kardeele oder
Garne frei liegen; letztere werden demnächst mit Hilfe des
Marlpfriems zwischen die Kardeele der nicht aufgedrehten Teile der
Taue gearbeitet, derart, daß die fertige Splissung keinen
wesentlich größern Durchmesser erhält als das
übrige Tau.
Splißhorn, ein als Gefäß zum
Mitführen von Talg benutztes Kuhhorn, welches, am Gurt
getragen, neben dem Messer und Marlpfriem, dessen Spitze vor dem
Gebrauch mit Talg eingefettet wird, das Handwerkszeug der Takler
und Matrosen bildet.
Splitter, Dorf im preuß Regierungsbezirk Gumbinnen,
westlich bei Tilsit, mit Stolbeck zusammenhängend, hat (1885)
770 Einw.; hier 30. Jan. 1679 siegreiches Gefecht der Brandenburger
gegen die Schweden.
Splügen (roman. Speluga), ein Hochgebirgspaß
der Graubündner Alpen (2117 m), zwischen dem Tambo- und
Surettahorn, verbindet den Hinterrhein mit dem Liro
(Nebenfluß der Adda), also Bodensee und Comersee, und ward
schon zur Römerzeit benutzt. Über den S. führte
Macdonald (27. Nov. bis 4. Dez. 1800) die französische
Reservearmee. Später (1812 bis 1822) unternahm die
österreichisch-lombardische Regierung den Bau der
Splügenstraße, die vom Graubündner Dorf S. (1450 m)
bis Chiavenna (317 m) 38 km lang, überall 4,5 m breit ist und
eine größere Zahl von Galerien und Zufluchtsstätten
enthält. Erbauer war Karl Donegani. Seit längerer Zeit
ist der S. auch als Paß für eine ostschweizerische
Alpenbahn in Aussicht genommen.
Spodium (lat.), s. v. w. Beinschwarz oder Knochenkohle;
weißes S., s. v. w. Knochenasche.
Spodumen, Mineral, s. Triphan.
Spohr, Ludwig, Violinspieler und Komponist, geb. 5. April
1784 zu Braunschweig als das älteste Kind eines Arztes, der
1786 als Physikus nach Seesen am Harz versetzt wurde, zeigte
früh musikalisches Talent, so daß er schon in seinem
fünften Jahr gelegentlich in den musikalischen
Abendunterhaltungen der Familie mit seiner Mutter Duette singen
konnte, und wurde mit zwölf Jahren nach Braunschweig
geschickt, um bei gleichzeitigem Gymnasialunterricht sich in der
Musik auszubilden. Hier wurden Kunisch und später Maucourt
seine Violinlehrer, während ihn der Organist Hartung, jedoch
nur kurze Zeit, in der Komposition unterrichtete. Nach Spohrs
eigner Versicherung war dies die einzige Unterweisung, die ihm in
Harmonielehre und Kontrapunkt je zu teil geworden, so daß er
also die bedeutenden Fähigkeiten, welche er gerade auf diesem
Gebiet besaß, hauptsächlich dem eignen Fleiß zu
danken hatte.
173
Spöl - Spoleto.
15 Jahre alt, wurde er vom Herzog von Braunschweig, zum
Kammermusikus ernannt und erhielt zugleich das Versprechen,
daß der Herzog ihn zu weiterer Ausbildung noch irgend einem
großen Meister übergeben wolle. Die Wahl fiel endlich
auf Franz Eck in München, als dieser eben im Begriff war, eine
Kunstreise nach Rußland anzutreten. S. begleitete ihn und
kehrte erst im Juli 1803 nach Braunschweig zurück. Hier traf
er Rode an, dessen Spiel nachhaltigen Einfluß auf seine
weitere Entwickelung übte. Spohrs Ruf als ausgezeichneter
Violinvirtuose verbreitete sich nun infolge einiger Kunstreisen so
rasch, daß er schon 1805 die Konzertmeisterstelle in Gotha
erhielt. In dieser Stellung verblieb er, nachdem er sich ein Jahr
später mit der Harfen- und Klaviervirtuosin Dorette Scheidler
verehelicht hatte, abgesehen von mehreren mit seiner Gattin
unternommenen Kunstreisen, bis 1813, in welchem Jahr er einem Ruf
als Kapellmeister des Theaters an der Wien folgte. Zwistigkeiten
mit dem Direktor desselben, Grafen Pálffy, waren die
Ursache, daß er dies Amt bereits nach zwei Jahren niederlegte
und wiederum Kunstreisen antrat, die sich diesmal auch auf die
Schweiz, Italien und Holland erstreckten, bis er im Winter 1817 die
Kapellmeisterstelle am Theater in Frankfurt a. M. übernahm.
Hier brachte er 1818 seine Oper "Faust" und 1819 "Zemire und Azor"
zur Aufführung, welche beide enthusiastischen Beifall fanden;
gleichwohl verließ S. schon im September d. J. Frankfurt und
begab sich von neuem auf Kunstreisen nach Belgien, Paris und 1820
nach London. Nach viermonatlichem Aufenthalt ruhmgekrönt
zurückgekehrt, ließ er sich in Dresden nieder, erhielt
jedoch schon im folgenden Jahr auf Veranlassung K. M. v. Webers die
Berufung als Hofkapellmeister nach Kassel und trat im Januar 1822
in sein neues Amt ein. Größere Virtuosenreisen unternahm
er von nun an nicht mehr; dagegen entfaltete er die
ersprießlichste Thätigkeit zur Hebung der musikalischen
Zustände Kassels, insofern er sowohl das Orchester zu einer
zuvor nie gekannten Höhe hob, als auch außerdem einen
Gesangverein für Oratorienmusik gründete. Nicht minder
bedeutend war seine Thätigkeit als Lehrer und Komponist. In
ersterer Eigenschaft wurde er das Haupt einer Violinschule, wie sie
Deutschland seit Franz Benda nicht besessen, und von allen Teilen
Europas strömten ihm die Schüler zu. Gleichzeitig
entwickelte er eine erstaunliche Produktionskraft auf allen
Gebieten der Komposition und bethätigte sich als Dirigent
zahlreicher Musikfeste in Deutschland und England. Auch der Verlust
seiner Gattin (1834), für den er in einer zweiten Ehe mit der
Klavierspielerin Marianne Pfeiffer nur einen annähernden
Ersatz fand, vermochte seinen Arbeitseifer und seine Pflichttreue
nicht zu vermindern, so wenig wie die kleinlichen Schikanen, die er
später von seinem Fürsten zu erdulden hatte, dies
namentlich nach dem Jahr 1848, obwohl er das Jahr zuvor durch die
Ernennung zum Generalmusikdirektor ausgezeichnet war. 1857 gegen
seinen Wunsch und mit teilweiser Entziehung seines Gehalts
pensioniert, blieb er bis zu seinem Tod 22. Okt. 1859 als Mensch
wie als Künstler ein Gegenstand der allgemeinen Verehrung. Als
Komponist hat S. die musikalische Litteratur auf jedem ihrer
Gebiete durch Meisterwerke von unvergänglichem Wert
bereichert. Auf dem der dramatischen Musik wurde er neben K. M. v.
Weber und Marschner der Hauptvertreter der romantischen Oper, wenn
er auch hinsichtlich des szenisch Wirksamen hinter diesen beiden
zurücksteht und infolgedessen seine Opern, mit Ausnahme von
"Jessonda", noch zu seinen Lebzeiten von den deutschen Bühnen
verschwanden. Auch in seinen Oratorien: "Die letzten Dinge", "Der
Fall Babylons" u. a. folgt er zu ausschließlich seinem
subjektiven Naturell, um auf die Nachwelt zu wirken, wiewohl hier
seine Neigung zum Elegischen und das konsequente Festhalten eines
erhabenen Pathos sowie endlich der für alle seine Arbeiten
charakteristische, nicht selten in Überfülle ausartende
Reichtum der Modulation die Wirkung weniger beeinträchtigen
als in seinen Opern. Unbedingte Bewunderung verdienen seine
zahlreichen, ausnahmslos durch Adel der Empfindung und formale
Abrundung hervorragenden Instrumentalwerke, sowohl für
Orchester als für Kammermusik, unter den erstern die
Symphonien in C moll und "Die Weihe der Töne", unter den
letztern die Quintette und Quartette, sowohl für
Streichinstrumente allein als mit Klavier. Den größten
und verdientesten Erfolg aber haben die speziell für sein
Instrument geschriebenen Werke gehabt, und seine 15 Violinkonzerte,
darunter namentlich das 7., 8. ("in Form einer Gesangsszene") und
9., sowie seine Violinduette, endlich seine große
Violinschule stehen noch heute an klassischem Wert
unübertroffen da. Vgl. Spohrs "Selbstbiographie"
(Götting. 1860-61, 2 Bde.; bis 1838 von ihm selbst geschrieben
und von da bis zu seinem Tod von den Angehörigen
ergänzt); v. Wasielewski, Die Violine und ihre Meister (2.
Aufl., Leipz. 1883); Malibran, Louis S., sein Leben und Wirken
(Frankf. a. M. 1860); Schletterer, Louis S. (Leipz. 1881).
Spöl, Fluß, s. Livigno (Val di).
Spoleto, Kreishauptstadt in der ital. Provinz Perugia
(Umbrien), an der Eisenbahn Rom-Foligno-Ancona, auf einem
Hügel (dem Krater eines erloschenen Vulkans) unfern der
reißenden Maroggia, über deren Thal ein 69 m hoher, 209
m langer Aquädukt mit altem Brückenweg führt, hat
ein schönes Kastell (jetzt Strafhaus), viele Kirchen (darunter
die Kathedrale mit Fresken von Filippo Lippi), zahlreiche
Altertümer, ansehnliche Paläste (Kommunalpalast mit
kleiner Gemäldesammlung), ein schönes Theater und (1881)
7696 Einw., die Fabrikation von Hüten, Leder, Wollenstoffen,
Bereitung von Konserven, Getreide-, Wein- und Ölbau sowie
Handel mit diesen Produkten betreiben. S. hat ein Lyceum,
Gymnasium, Seminar, eine technische Schule, ein Konviktkollegium,
eine Bibliothek, eine wissenschaftliche Akademie und ist Sitz eines
Erzbischofs, eines Unterpräfekten und eines Handelsgerichts. -
S. hieß im Altertum Spoletium und war eine der ansehnlichsten
Städte Umbriens, die 242 v. Chr. eine römische Kolonie
ward und sich 217 standhaft gegen Hannibals Angriffe verteidigte.
Von den Goten unter Totilas zerstört, ward sie von Narses
wieder aufgebaut und dann von den Langobarden zur Hauptstadt eines
Lehnsherzogtums gemacht, das einen großen Teil Mittelitaliens
(Umbrien, Sabiner- und Marsenland, Fermo und Camerino)
umfaßte und auch unter fränkischer Herrschaft bestehen
blieb. Herzog Guido von S. ward 891 Kaiser, ebenso sein Sohn
Lambert 898. Mit Konrad dem Schwaben erlosch das selbständige
Herzogtum. Durch Kaiser Heinrich II. wurde S. mit Toscana
vereinigt, war nach Mathildens von Tuscien Tod (1115) Gegenstand
des Streits zwischen Kaiser und Papst und nur vorübergehend
Sitz eines kaiserlichen Markgrafen. Seit dem 13. Jahrh.
gehörte das Herzogtum nebst der Mark Fermo zum Kirchenstaat,
seit 1861 gehört es zum Königreich Italien. Vgl. Sansi,
Storia del comune di S. (Foligno 1879).
174
Spoliation - Spontini.
Spoliation (lat.), Beraubung.
Spolien (lat. Spolia), die dem Feind von den
römischen Soldaten in der Schlacht entrissene Beute an Waffen,
Schmuck etc., welche den Tempel sowie das Vestibulum und Atrium des
Hauses, namentlich der siegenden Feldherren, schmückte und
stets an dem Haus blieb, auch wenn es den Besitzer wechselte.
Besonders berühmt waren die Spolia opima ("fette Beute"), die
dem feindlichen Feldherrn abgenommen waren und dem Jupiter
Feretrius auf dem Kapitol geweiht wurden. Auch die ehedem in den
Kirchen aufgehängten ritterlichen Ehrenzeichen (Schild, Helm
etc.) der Kirchenpatrone sowie die Güter geistlicher, ohne
Testament verstorbener Personen werden S. genannt (vgl.
Spolienrecht).
Spolienklage, s. Besitz.
Spolienrecht (Jus spolii), das von den deutschen Kaisern
ehedem in Anspruch genommene und bis auf Friedrich II.
ausgeübte Recht, den Nachlaß verstorbener Bischöfe
einzuziehen. Auch die Landes- und Grundherren nahmen im Mittelalter
dem Nachlaß von katholischen Geistlichen gegenüber
zuweilen ein S. in Anspruch, und auch von Päpsten und
Bischöfen ist es ausgeübt worden.
Spoliieren (lat.), berauben, plündern.
Sponde (lat.), Bettgestell, Bettstatt.
Spondeus, ein aus zwei langen Silben (- -) bestehender
Versfuß, der anfänglich bei den Libationen (Spondä)
der Griechen, wobei man eine langsame und ernste Melodie liebte,
dann aber namentlich mit dem Daktylus abwechselnd im Hexameter
angewendet wurde.
Spondias L., Gattung aus der Familie der Anakardiaceen,
Bäume mit unpaarig gefiederten Blättern, unansehnlichen
Blüten und fleischigen, pflaumenähnlichen Früchten.
Von den etwa zehn tropischen Arten liefert S. Mombin L. (S.
purpurea Mill., Mombinpflaumenbaum), in Südamerika und
Westindien, die beliebten Mombinpflaumen oder otahaitischen
Äpfel, zum Räuchern dienendes Amra- oder Aruraharz und
Holz zu Pfropfen. S. lutea L. hat gelbe, herbe Früchte, die
als Arzneimittel dienen, und liefert Acajouholz. S. mangifera Pers.
(Amrabaum), auf Malabar und Koromandel, mit ebenfalls
genießbaren Früchten, liefert auch Amraharz. S. dulcis
Forst., auf den Südseeinseln, liefert die
Cytherenäpfel.
Spondieren (lat.), geloben, besonders von
Ehegelöbnissen gebraucht.
Spondylarthrokace (Spondylitis), s. v. w.
Wirbelentzündung, s. Pottsches Übel.
Spondylus (lat.), Wirbelknochen.
Spongiae, Schwämme (s. d.); S. ceratae,
Wachsschwämme, mit geschmolzenem gelben Wachs getränkte
und scharf ausgedrückte Schwämme; S. compressae,
Preßschwämme, durch Umschnüren mit Bindfaden stark
komprimierte Schwämme, werden wie die vorigen ihres
Quellungsvermögens halber zu unblutigen Erweiterungen,
namentlich des Uteruskanals und des Muttermundes, benutzt, in
neuerer Zeit aber meist durch Laminaria digitata ersetzt.
Spongiös (lat.), schwammig; spongiöse
Knochensubstanz, die weiche, am macerierten Knochen poröse
Substanz in den Knochenenden im Gegensatz zu der festen
Knochenrinde und dem weichen Mark.
Spongitenkalk (Scyphienkalk), fossile Schwämme
enthaltender Kalk; s. Juraformation.
Sponheim (Spanheim), früher reichsunmittelbare
Grafschaft im oberrhein. Kreis, zwischen dem Rhein, der Nahe und
der Mosel, zerfiel in S.-Kreuznach und S.-Starkenburg oder die
vordere und hintere Grafschaft. Der Stammvater des gräflichen
Geschlechts ist Eberhard, um 1044; sein Sohn Stephan gründete
1101 unweit seiner Burg die Abtei S. auf dem Gauchsberg. Nach dem
Tod Gottfrieds II. (1232) begründeten seine Söhne Johann
I. die Linie S.-Starkenburg, Simon II. S.-Kreuznach, während
Heinrich 1248 in der Grafschaft Sayn den Zweig S.-Blankenberg
stiftete, welcher sich bald in die Zweige S.-Heinsberg und
S.-Lewenberg teilte und im 15. Jahrh. erlosch. Johanns I. zweiter
Sohn, Gottfried, ist der Stammvater der Grafen von Sayn und
Wittgenstein (s. d.). Bei dem Aussterben der Kreuznacher Linie 1416
fiel ein Fünftel der Grafschaft an Kurpfalz, vier Fünftel
an die Starkenburger Grafen. Als auch diese 1437 ausstarben, fielen
ihre Besitzungen an Baden und die Pfalz. Nach langwierigen
Streitigkeiten mit der Pfalz wurde im Teilungsvertrag von 1708
Birkenfeld an Pfalz-Zweibrücken überwiesen, fiel jedoch
1776 an Baden zurück, während Kreuznach bei Kurpfalz
verblieb. 1801 kam die ganze Grafschaft an Frankreich, 1814 an
Preußen, das 1817 einen Teil davon, das Fürstentum
Birkenfeld, an Oldenburg abtrat.
Sponsalien (lat.), s. Verlöbnis.
Sponsieren (lat.), liebeln, um ein Mädchen werben,
buhlen; Sponsierer, Freier, Buhler.
Sponsor (lat.), Bürge; auch s. v. w. Pate.
Sponsus (lat.), Bräutigam; Sponsa, Braut.
Spontan (lat.), von selbst, ohne äußere
Einwirkung erfolgend; daher Spontaneität,
Selbstthätigkeit, das Vermögen, von selbst und nicht
infolge besonderer Anregung thätig zu sein.
Spontini, Gasparo, Komponist, geb. 14. Nov. 1774 zu
Majolati bei Jesi (Mark Ancona), erhielt seine Ausbildung zu Neapel
im Konservatorium della Pietà, wo er von Sala im Kontrapunkt
unterrichtet wurde, und debütierte 1796 in Rom mit der Oper "I
puntigli delle donne", welche mit Beifall aufgenommen wurde. Diesem
Werk folgte für verschiedene italienische Theater eine Reihe
von Opern, die sich jedoch von dem damals in Italien
landläufigen Stil in nichts unterschieden. In Paris, wohin er
sich 1803 wandte, vermochte er anfangs keine Anerkennung zu finden
und mußte durch Gesangstunden sein Leben fristen, bis er 1804
mit der einaktigen Oper "Milton" die Aufmerksamkeit des Publikums
erregte. S. hatte sich mittlerweile den Stil Glucks angeeignet und
verwendete ihn zum erstenmal in seiner "Vestalin" (Text von Jouy),
welche 15. Dez. 1807 zur Aufführung kam. Der Erfolg war ein
vollständiger, und das Nationalinstitut erkannte dem Meister
den von Napoleon I. gestifteten Preis von 10,000 Frank zu. Die 1809
folgende Oper "Ferdinand Cortez" fand gleichfalls enthusiastische
Aufnahme. Im nächsten Jahr erhielt S., nachdem er schon 1805
Direktor der Kammermusik der Kaiserin Josephine geworden war, die
Direktion des italienischen Theaters im Odéon, woselbst er
zum erstenmal in Paris Mozarts "Don Juan" zur Aufführung
brachte. Intrigen verleideten ihm jedoch bald genug dieses Amt, er
legte es deshalb nach zwei Jahren wieder nieder. Mit dem Sturz des
Kaiserreichs verlor S. auch seine Stellung bei Hof und war
demgemäß für die folgenden Jahre lediglich auf sein
Talent und seine Arbeiten für die Bühne angewiesen. Sein
nächstes großes Werk: "Olympia", ging im Dezember 1819
zum erstenmal in Szene, fand jedoch nicht den entschiedenen Beifall
wie die beiden vorhergehenden Opern. S. folgte daher um so lieber
einer Aufforderung des Königs von
175
Sponton - Sporenfink
Preußen, der ihn 1820 als Generalmusikdirektor nach Berlin
berief. Hier entfaltete S. während seiner mehr als
20jährigen unbeschränkten Herrschaft über die
Opernbühne eine auf alle Zweige des Opernwesens sich
erstreckende Thätigkeit, die so erfolgreich war, daß er
das seiner Leitung anvertraute Institut auf eine weder vor noch
nach ihm erreichte Höhe brachte; allein die drei "Hofopern",
welche er in Berlin noch schrieb ("Nurmahal", "Alcidor" und "Agnes
von Hohenstaufen"), blieben hinter seinen drei vorhergegangenen
Werken weit zurück. Zudem schuf er sich durch sein häufig
schroffes Auftreten eine große Anzahl von Feinden, und die
hieraus sich entspinnenden litterarischen Fehden, die ihn fast in
einen Prozeß wegen Majestätsbeleidigung verwickelt
hätten und schließlich bei Gelegenheit einer von ihm
geleiteten Aufführung des "Don Juan" zu einer gegen ihn
gerichteten stürmischen Demonstration des Publikums
führten, veranlaßten ihn 1842, sein Amt niederzulegen
und nach Paris zurückzukehren. 1844 unternahm er eine Reise
nach Italien, wo ihn der Papst zum Grafen Sant' Andrea ernannte.
1847 wollte sich S. auf Wunsch des Königs von Preußen
nochmals nach Berlin begeben, um dort einige seiner Opern zu
dirigieren, allein ein Gehörübel verhinderte ihn daran.
Infolge der politischen Wirren kehrte er endlich 1848 für
immer in sein Vaterland zurück, wo er 24. Jan. 1851 in seinem
Geburtsort starb. S. ist einer der Hauptrepräsentanten der
unter dem Einfluß des Napoleonischen Kaiserreichs
entstandenen heroischen Oper, die trotz alles Aufwandes
äußerer Effektmittel doch unter seinen Händen zu
einem Kunstwerk ersten Ranges wurde. Hinsichts des Adels der
Melodie, der Reinheit der Deklamation und der Konsequenz in der
Ausführung seiner Charaktere steht er von allen Komponisten
der französischen Großen Oper Gluck am nächsten,
und er ist von keinem seiner Nachfolger auf diesem Gebiet erreicht
worden. Vgl. Robert, G. Spontini (Berl. 1883); R. Wagner,
Erinnerungen an S. ("Gesammelte Schriften", Bd. 5).
Sponton (spr. spongtóng, Esponton, franz.), eine
Halbpike nach Art der Hellebarde (s. Abbildung), wurde bis zu
Anfang dieses Jahrhunderts von den Offizieren der Infanterie neben
dem Degen als Paradewaffe geführt. Der S. der Unteroffiziere,
auch Partisane genannt, war länger, etwa 2,5 m lang, und
hieß mit ersterm Kurzgewehr im Gegensatz zur längern
Pike (s. d.).
Sporaden, Inselgruppe im Ägeischen Meer und zwar im
Gegensatz zu den Kykladen (s. d.) diejenigen Inseln, welche im N.,
O. und Süden um dieselben "zerstreut" an der Küste von
Kleinasien und Thessalien liegen. Die S. zerfallen in die
Nordsporaden (Skiathos, Skopelos, Chilidromia, Pelagonisi, Skyros
und mehrere kleinere), die Ostsporaden (Nikaria, Patinos, Lero,
Kos, Rhodos nebst vielen kleinern) und die Südsporaden (Thera
oder Santorin, Amurgos, Astypaläa oder Stampalia, Ios oder
Nio, Karpathos, Kasos und mehrere kleinere). Letztere werden von
manchen Neuern (wie auch offiziell) zu den Kykladen gezählt
und die Ostsporaden dann als Südsporaden bezeichnet. Die S.
sind meist mit Bergen bedeckt, die sich durch ihre schroffen Formen
auszeichnen; vielen fehlt die Bewässerung; die
bewässerten zeichnen sich durch große Fruchtbarkeit aus.
Die alten Griechen bezeichneten als S. im engern Sinne nur die im
Ikarischen Meer von Rhodos bis Nikaria (Ikaria) gelegenen Inseln.
Bei der Trennung Griechenlands von der Türkei blieben nur die
zunächst der Küste von Kleinasien liegenden Ostsporaden
bei letzterm Land, während die Nord- und die meisten
Südsporaden an Griechenland fielen. S. Karte
"Griechenland".
Sporadisch (griech., "zerstreut"), in der Medizin von
Krankheiten gebraucht, welche nur einzelne Individuen ergreifen, im
Gegensatz zur Epidemie; auch sonst s. v. w. vereinzelt
vorhanden.
Sporangium (lat., Keimfrucht), bei den Kryptogamen die
Behälter der Sporen, welche entweder, wie bei vielen Algen und
Pilzen, einfache Zellen darstellen, in denen durch Zellbildung
zahlreiche ruhende Sporen oder Schwärmsporen (im letztern Fall
Zoosporangien genannt) entstehen, oder kapselartige Behälter
sind, welche eine aus Zellen zusammengesetzte Wand besitzen und im
Innern meist durch Vierteilung aus Mutterzellen die Sporen
erzeugen, wie bei den Moosen, Farnkräutern etc.
Sporck, Johann von, kaiserl. General, geb. 1595 zu
Westerloh bei Delbrück im Bistum Paderborn, Sohn eines armes
Edelmanns, trat als gemeiner Soldat in das ligistische Heer, in dem
er den Dreißigjährigen Krieg mitmachte, ward 1639
bayrischer Reiteroberst, vollführte im November 1643 einen
glücklichen Handstreich gegen das französische Heer und
zeichnete sich 1645 in der Schlacht bei Jankau aus. Als
Generalwachtmeister beteiligte er sich im Juli 1647 an dem Versuch
Johanns v. Werth, das bayrische Heer dem Kaiser nach Böhmen
zuzuführen, wurde nach dessen Mißlingen vom
Kurfürsten Maximilian für einen Verräter
erklärt, trat in kaiserliche Dienste, ward zum
österreichischen Freiherrn ernannt und mit Gütern in
Böhmen beschenkt. Er focht dann als Reitergeneral unter
Montecuccoli 1657-60 gegen die Schweden in Polen und
Schleswig-Holstein, in der Schlacht bei St. Gotthardt 1. Aug. 1664
gegen die Türken, worauf er zum Reichsgrafen ernannt wurde,
und 1674-75 gegen die Franzosen am Rhein. Er starb 6. Aug. 1679 auf
seinem Gut Herman-Mestiz in Böhmen. Vgl. Rosenkranz, Graf
Johann v. S. (2. Ausg., Paderb. 1854). Fr. Löher hat sein
Leben in einem Epos behandelt.
Sporco (ital., "unrein"), s. v. w. Brutto (s. d.).
Sporen (Sporae, Keimkörner), bei den Kryptogamen die
zur Vermehrung dienenden, den Samen der Phanerogamen analogen
Körper, welche aber einzelne Zellen oder aus wenigen Zellen
zusammengesetzt sind und nie einen Embryo enthalten, wie die Samen
der Blütenpflanzen. Sie sind in der Regel mikroskopisch klein,
treten aber meist massenhaft auf. Ihre Entstehung und
Beschaffenheit sind in den einzelnen Klassen, Ordnungen und
Familien der Kryptogamen verschieden; man nennt die durch
Abschnürung auf Basidien entstehenden S. Basidio- oder
Akrosporen, oft auch Konidien oder Stylosporen, die in
Sporenschläuchen sich bildenden S. Askosporen oder
Thekasporen, die in Sporangien entstehenden nackten, d. h. nicht
von einer Zellhaut umhüllten, mittels schwingender Wimpern im
Wasser frei beweglichen S. Schwärmsporen oder Zoosporen.
Sporenfink, s. Ammer, S. 489
176
Sporenfrucht - Spottdrossel.
Sporenfrucht, s. Sporocarpium.
Sporenorden, s. Goldener Sporn.
Sporenschlacht (Journée des éperons),
Bezeichnung sowohl der Schlacht (1302) bei Courtrai (s. d.) als der
zweiten (1513) bei Guinegate (s. d.).
Sporenschlauch (Ascus, Theca), bei Pilzen und Flechten
diejenigen meist keulen- oder schlauchförmigen Mutterzellen
von Sporen, in welchen die letztern durch Zellbildung erzeugt
werden.
Sporer, zünftiger Name der Metallarbeiter, welche
Sporen und die zum Reitzeug gehörigen Beschläge und
sonstigen Zieraten verfertigten.
Spörer, Gustav Friedrich Wilhelm, Astronom, geb. 23.
Okt. 1822 zu Berlin, wurde Professor der Mathematik am Gymnasium in
Anklam, 1868 Teilnehmer an der Expedition, welche vom Norddeutschen
Bund zur Beobachtung der totalen Sonnenfinsternis (18. Aug.) nach
Mulwar in Ostindien geschickt wurde, 1875 an das bei Potsdam
erbaute astrophysikalische Observatorium berufen, machte sich
besonders durch Beobachtungen der Sonnenoberfläche
verdient.
Spörgel, s. Spergula.
Sporidesmium Link, Pilzgattung aus der Gruppe der
Pyrenomyceten, umfaßt etwa 20 deutsche Arten, welche
wahrscheinlich alle Konidienformen von Pyrenomyceten, besonders
Pleospora, darstellen. Sie bilden auf Pflanzenteilen dunkle
Überzüge, den sogen. Rußtau. S. putrefaciens Fuckel
lebt parasitisch in den jungen Blättern der Runkelrübe
und verursacht die Herzfäule der Rüben. Er bildet
olivengrüne, ausgebreitete Räschen auf den durch den Pilz
schwarz gefärbten Blättern.
Sporidien, bei Rost- und Brandpilzen die auf den
Promycelien (s. d.) durch Abschnürung entstehenden kleinen
Sporen, welche durch Keimung das eigentliche Mycelium erzeugen.
Spörk, s. v. w. Spergel, s. Spergula.
Sporn, s.v.w. Stachel, stachelähnliches Werkzeug, z.
B. an der Ferse eines Reiterstiefels; auch s. v. w. Ramme eines
Panzerschiffs (s. d.); stachelartige Hervorragung an den
Füßen mancher Tiere, besonders Vögel (Hahnensporn
etc.); in der Botanik ein nach abwärts röhrenförmig
verlängerter, etwas gekrümmter Fortsatz der Perigon-,
Kelch- oder Blumenblätter (s. Blüte, S. 67).
Spornblume, s. Plectranthus.
Sporocarpium (Sporenfrucht), der nach der Befruchtung zur
Ausbildung gelangende Fruchtkörper der Karposporeen, in oder
an welchem sich die Sporen bilden; s. Kryptogamen.
Sporocysten, s. Leberegel.
Sporogonium (griech.-lat.), s. Moose, S. 790.
Sport (engl., "Spiel, Belustigung"), das ehrgeizige
Bestreben eines Mannes nach hervorragender körperlicher
Leistung, ein Begriff, der dem Altertum (Kampfspiele der Griechen)
und dem Mittelalter (Turniere) nicht unbekannt war. Der neuesten
Zeit war es indessen vorbehalten, den S. nach allen Richtungen hin
auszubilden, und zwar geschah dies hauptsächlich in England.
Es folgten dann besonders die Vereinigten Staaten und in
größerm oder geringerm Maß das europäische
Festland. Zugleich erweiterte sich der Begriff dahin, daß man
darunter auch Thätigkeiten verstand, bei welchen nicht
bloß der Körper, sondern auch der Geist seine Rechnung
findet. Ein wesentliches Merkmal dieser Thätigkeiten war es
indessen von jeher und ist es noch, daß sie im Freien
ausgeübt werden. Widersinnig ist daher z. B. die Bezeichnung
Briefmarkensport, ebenso widersinnig wie die ausschließliche
Anwendung des Wortes S. auf die Pferderennen. Man unterscheidet: 1)
die mehr gesundheitlichen Zwecken dienenden, im wesentlichen
bloß Kraft erfordernden, bez. die Körperkraft
fördernden Sportarten, so die Mehrzahl der Turnübungen,
das Rudern, das Fahren mit Dreirädern, das Gehen, Laufen etc.;
2) die Sportarten, welche Kraft und Geschicklichkeit zugleich
verlangen, bez. fördern helfen: Schlittschuhlaufen und
Schwimmen, die höhern Turnübungen, das Fechten, das
Fahren mit Zweirädern, das gewöhnliche Reiten, die Jagd
auf wehrlose Tiere, die Angel- und Netzfischerei auf
Binnengewässern, Cricket, Fußball, Lawn Tennis, das
Schießen; 3) endlich die Sportarten, deren Ausübung
Kraft und Geschick erfordert und mit einer gewissen Gefahr
verbunden ist, welche mit Hilfe dieses Geschicks abgewendet werden
soll: die Jagd auf wilde, wehrhafte Tiere, Parforcejagd und
Pferderennen, der Bergsport, die Fischerei auf hoher See und vor
allen der Segelsport, welcher bei den Engländern für den
Inbegriff des Sportlichen gilt. Dieser zerfällt wiederum in
Segeln auf Binnengewässern und Segeln auf hoher See. Letzterer
erfordert zugleich erhebliche mathematische und astronomische
Kenntnisse. Die Sportarten lassen sich aber auch nach den toten
oder lebendigen Gegenständen einteilen, welche zu deren
Ausübung dienen, bez. den Gegenstand derselben bilden. So
unterscheidet man 1) Jagd- und Schießsport nebst Hundezucht;
2) Pferdesport in allen seinen Abarten, wie: Turf, Trabersport,
Fahrsport, Parforcejagd, Schnitzeljagd, Dauerreiten und
Steeplechase; 3) Wassersport, welcher wiederum zerfällt in
Segeln, Dampfen, Rudern, Fischen und Angeln, Eissport und
Schwimmen; endlich 4) die verschiedenen Sportarten, als: Fechten
und Turnen, Radfahren, Athletik, Skaten, Ballonsport, Bergsport,
Gartenspiele etc. Als ein wesentliches Merkmal des Sports ist
endlich anzuführen, daß dessen Ausübung nicht um
des Gelderwerbs wegen geschieht. Näheres s. in den einzelnen
Artikeln. Vgl. Georgens, Illustriertes Sportbuch (Leipz. 1882).
Eine "Sportzeitung" (seit 1880) und eine "Sportbibliothek" für
die verschiedenen Sportzweige gibt V. Silberer in Wien heraus; in
Berlin erscheinen die "Sportswelt" und die "Neuesten
Sportsnachrichten" (hrsg. vom Unionklub).
Sporteln (lat.), Gebühren für Amtshandlungen,
die nach gesetzlich festgestellter Norm (Sporteltaxe) entrichtet
werden; namentlich Bezeichnung für die Gerichtskosten (s.
d.).
Sports-man (engl., spr. -män), Liebhaber oder
Betreiber des Sports (s. d.).
Sposalizio (ital., "Verlobung"), in der Malerei die bei
den Italienern übliche Bezeichnung für die Darstellung
der Verlobung der Jungfrau Maria und Josephs, insbesondere für
die beiden berühmten Bilder Peruginos (in Caen) und Raffaels
(in Mailand).
Spott kommt mit dem Scherz (s. d.) darin überein,
daß er den andern lächerlich, unterscheidet sich von
diesem dadurch, daß er ihn zugleich verächtlich
macht.
Spottdrossel (Mimus Boie), Gattung aus der Ordnung der
Sperlingsvögel, der Familie der Drosseln (Turdidae) und der
Unterfamilie der Spottdrosseln (Miminae), Vögel mit sehr
gestrecktem Leib, mittellangem, abwärts gekrümmtem
Schnabel mit deutlicher Kerbe an der Spitze,
verhältnismäßig hochläufigen, starken
Füßen mit kräftigen Zehen und schwächlichen
Nägeln, kurzen, abgerundeten Flügeln, in denen die
dritte, vierte und fünfte Schwinge am längsten sind, und
mäßig langem, stufigem Schwanz. Die S. (Mimus
polyglottus Boie) ist oberseits dunkelgrau, am Kopf bräunlich,
unterseits bräunlichweiß;
177
Spottiswoode - Sprache (physiologisch).
die Schwingen sind braunschwarz, fahlgrau gesäumt, die
Spitzen der Flügeldeckfedern weiß, die mittelsten
Steuerfedern schwarz, die äußern weiß; die Augen
sind blaßgelb, der Schnabel ist bräunlichschwarz, die
Füße dunkelbraun. Die S. bewohnt Nordamerika, vom
40° nördl. Br. bis Mexiko, besonders den Süden,
findet sich im Buschwerk, im lichten Wald und in Pflanzungen, in
Ebenen und an der Küste, sucht, besonders im Winter, die
Nähe menschlicher Wohnungen, ähnelt in ihren Bewegungen
den Drosseln und nährt sich von Kerbtieren und Beeren. Sie
brütet zwei-, im Süden auch dreimal in dichten Baumkronen
oder Büschen oft sehr nahe den Wohnungen und legt 3-6
hellgrüne, dunkelbraun gefleckte Eier. Sie singt vortrefflich,
berühmt aber ist sie durch ihre bewundernswerte
Fähigkeit, fremde Gesänge und die verschiedensten
Töne und Geräusche nachzuahmen. Sie hält sich gut in
der Gefangenschaft und hat sich mehrfach, auch in Europa,
fortgepflanzt.
Spottiswoode (spr. -wudd), William, Mathematiker und
Physiker, geb. 11. Jan. 1825 zu London, studierte in Oxford und
übernahm dann die Druckerei der Königin, welche unter
seiner Leitung namhaften Aufschwung gewann, ohne ihm die Muße
zu selbständiger wissenschaftlicher Thätigkeit zu rauben.
Seine frühsten Werke: "Meditationes analyticae" (1847) und
"Elementary theorems relating to Determinants" (1851), bilden die
erste umfassendere Darstellung der Determinantentheorie. Eine Reise
durch Ostrußland (1856) beschrieb er in "A tarantasse journey
through Eastern Russia" (1857) und eine andre durch Kroatien und
Ungarn in Galtons "Vacation tourist in 1860". Seit 1870 wandte er
der Optik und Elektrizitätslehre seine Aufmerksamkeit zu und
schrieb noch "Polarisation of light" (1874). 1879 ward ihm die
höchste wissenschaftliche Würde in England, die des
Präsidenten der Royal Society, übertragen, welche er bis
zu seinem Tod 27. Juni 1883 bekleidete.
Spottkruzifix, Bezeichnung eines 1856 in einem antiken
Gebäude am Palatin entdeckten, im Museum Kircherianum zu Rom
befindlichen Stuckfragments mit der kunstlos eingeritzten
Darstellung eines Gekreuzigten mit einem Eselskopf, vermutlich aus
der Mitte des 2. Jahrh. Er ist bekleidet mit einem Hemd und einer
losen Tunika; rechts daneben steht eine ebenso bekleidete
menschliche Gestalt, die Hand als Zeichen der Anbetung
emporstreckend; darunter die griechischen Worte: "Alexamenos betet
Gott an". Das S. ist wichtig als Zeugnis der Verspottung der ersten
Anhänger des Christentums durch die Römer. Vgl. Kraus,
Das S. vom Palatin (Freiburg 1872); Becker, Das S. der
römischen Kaiserpaläste (Gera 1876).
Spottsylvania Court-House (spr. kohrt-haus'),
Gerichtshalle der gleichnamigen Grafschaft im nordamerikan. Staat
Virginia, 20 km südwestlich von Fredericksburg, wo Lee 24. Mai
1864 von Grant besiegt wurde.
Spr., auch Spreng., bei botan. Namen Abkürzung
für Kurt Sprengel (s. d.).
Sprache (Sprechen), vom physiologischen Standpunkt eine
Kombination von Tönen und Geräuschen, welche durch
entsprechende Verwendung der Ausatmungsluft, in gewissen
Fällen auch beim Einatmen (Schnalzlaute der Hottentoten und
andrer Völker) hervorgebracht werden. Die Vokale oder
Selbstlauter sind Klänge, die an den Stimmbändern
entstehen und sich mit den auf einem musikalischen Instrument
hervorgebrachten Tönen vergleichen lassen; ihre besondere
Klangfarbe erhalten sie wie die Töne auf einer Geige, einem
Pianoforte etc. durch die neben dem Grundton erklingenden Ober-
oder Nebentöne, welche ihrerseits durch die wechselnde
Gestaltung des Ansatzrohrs und Resonanzraums, d. h. der
Mundhöhle, des Gaumens etc., bedingt werden. Als die drei
Grundvokale kann man a, i, u bezeichnen; doch gibt es zwischen
denselben eine unendliche Menge von Nuancen, die durch kleine
Verschiedenheiten der Mundstellung bedingt werden. Bei der
Aussprache des u senkt sich der Kehlkopf, und die Lippen treten
nach vorn, indem sie nur eine kleine rundliche Öffnung
zwischen sich lassen (Fig. 1). Von dem dumpfen u gelangt man zu dem
heller klingenden a durch die Übergangsstufe des o, bei dessen
Bildung sich die Lippenöffnung mäßig erweitert. Bei
der Hervorbringung des a liegt der Kehlkopf höher, die Zunge
liegt platt auf dem Boden der Mundhöhle, so daß das
Ansatzrohr einem vorn offenen Trichter gleicht (Fig. 2). Den
Übergang vom a zu i, dem hellsten Vokal, bildet das e, bei dem
der hintere Teil der Zunge und zugleich der Gaumen sich etwas
emporheben. Beim i wird der Kehlkopf sowohl als der hintere Teil
der Zunge stark emporgehoben, so daß die Mundhöhle eine
Flasche mit sehr engem Hals darstellt (Fig. 3). Die Diphthonge
entstehen durch raschen Übergang der Organe aus einer
Mundstellung in die entsprechende andre, die zur Hervorbringung des
zweiten Teils des Diphthongen erforderlich ist. Die Konsonanten
oder Mitlauter kann man auf verschiedene Weise einteilen. Ihrer
physiologischen oder akustischen Beschaffenheit nach sind sie
entweder tonlos oder tönend, d. h. sie werden entweder
178
Sprache und Sprachwissenschaft (Natur- und
Kulturvölker).
wie die Vokale mit periodischen Schwingungen der
Stimmbänder oder ohne solche Schwingungen hervorgebracht.
Tonlose Laute sind z. B. k, t, p, h, f, tönende Laute z. B. r,
l, n, m, d, b, g. Übrigens können die tönenden
Konsonanten in vielen Fällen auch tonlos gebildet werden; auch
kann sich dem in der Stimmritze gebildeten Ton ein in der
Mundhöhle entstehendes Geräusch beimischen, wodurch
solche Konsonanten den Charakter von Geräuschlauten annehmen.
Der Artikulationsstelle nach teilt man die Konsonanten von alters
her ein in Dentale oder Zahnlaute, bei deren Hervorbringung der
vordere Teil der Zunge und die Zähne in Betracht kommen,
Labiale oder Lippenlaute, die vorn an den Lippen, und Gutturale
oder Gaumenlaute, die hinten am Gaumen gebildet werden.
Tatsächlich gibt es jedoch viele Zwischenstufen; so kann man
nach Brücke von den eigentlichen Dentalen die alveolaren,
lingualen und dorsalen Dentalen unterscheiden, auch gibt es neben
den rein labialen die labiodentalen Konsonanten und drei Arten von
Gaumenlauten. Im Deutschen können als Dentale das t, d, s,
sch, auch n, r, l angesehen werden; labiale Konsonanten sind p, b,
f, m, w; guttural sind k, g, ch, j. Bis zu einem gewissen Grad
kommt die Verschiedenheit der Artikulationsstellen auch für
die Vokale in Betracht, indem z. B. bei u ungefähr die
labiale, bei i ungefähr die dentale Artikulation stattfindet.
Drittens lassen sich die Konsonanten nach ihrer Artikulationsart
einteilen, wobei am meisten der Mundraum, außerdem der
Nasenraum und der Kehlkopf in Betracht kommen. Wird die Stimmritze
so weit verengert, daß die ausgeatmete Luft an den
Rändern der Stimmritze ein reibendes Geräusch erzeugt, so
entsteht der Hauchlaut h; auch alle geflüsterten Laute werden
auf diese Weise gebildet. Der Nasenraum erscheint an der Bildung
der Nasalen oder Nasenlaute n, m und ng (z. B. in "Ding")
beteiligt, indem er durch Senkung des Gaumensegels geöffnet
wird, so daß die Luft aus der Nase strömen kann (ein
Vorgang, durch den auch das sogen. Näseln bedingt wird). Die
Artikulationsart des Mundraums kann wechseln und so entstehen: 1)
Liquidä oder Zitterlaute, die entweder durch Biegung der
Zungenspitze gebildet werden (r-Laute) oder an den
Seitenwänden der Zunge (l-Laute); 2) frikative oder
Reibelaute, durch Verengerung des Mundkanals gebildet, indem die
Ausatmungsluft an den Rändern der Enge ein reibendes
Geräusch erzeugt, wie z. B. beim deutschen s, sch, f, ch, j,
w; 3) Explosiv- oder Verschlußlaute, bei deren Erzeugung der
Mundkanal an irgend einer Stelle plötzlich geschlossen und
wieder geöffnet wird, z. B. an den Lippen bei b, p, hinter
oder an den Zähnen bei d, t, am Gaumen bei g, k. Andre
Sprachen kennen auch noch andre Artikulationsarten, wie
überhaupt die Mannigfaltigkeit der menschlichen Sprachlaute
eine fast unbegrenzte und durch die Schrift nicht entfernt
ausdrückbare ist. Ein sehr wichtiger Faktor bei der
Lautbildung ist auch die Betonung, auf der namentlich die Silben-
und Wortbildung und daher auch die landläufige Unterscheidung
zwischen Vokalen und Konsonanten vornehmlich beruht. Ihrer
akustischen Beschaffenheit nach unterscheiden sich z. B. die Nasale
n, m und die Zitterlaute r, l in keiner Weise von den Vokalen, da
sie wie die letztern mit dem auf regelmäßigen
Schwingungen der Stimmbänder beruhenden Stimmton
hervorgebracht werden (daher auch Resonanten genannt); sie stimmen
aber darin mit den übrigen Konsonanten überein, daß
sie in der Regel nicht als Träger des Silbenaccents fungieren.
Doch gibt es auch hierin Ausnahmen; man vergleiche z. B. das
silbenbildende l in dem deutschen Wort "Handel" (sprich: Handl)
oder die r- und l-Vokale der slawischen Sprachen und des Sanskrit.
Eine künstliche Nachbildung der menschlichen Sprachlaute
liefert der Phonograph Edisons, durch den die schon im 18. Jahrh.
von Kempelen konstruierte Sprechmaschine weit überboten wurde.
Vgl. auch Lautlehre.
Sprache und Sprachwissenschaft. Unter Sprache versteht man, ohne
beide Bedeutungen streng zu sondern, einesteils die
Sprachthätigkeit oder das Sprachvermögen, d. h. nach W.
v. Humboldts treffender Definition der Sprache "die ewig sich
wiederholende Arbeit des menschlichen Geistes, den artikulierten
Laut zum Ausdruck des Gedankens fähig zu machen"; andernteils
wird damit etwas Konkretes, Individuelles bezeichnet, nämlich
die Summe der Wörter, welche bei einem bestimmten Volk als
Mittel zur Verständigung in Anwendung sind oder (bei toten
Sprachen) gewesen sind. Die einzelnen Sprachen sind das Produkt des
Sprachvermögens oder mit andern Worten des Triebes nach
Äußerung und Mitteilung, und die Sprache im allgemeinen
ist eine nicht minder wichtige Seite in der Eigenart des Menschen
als Recht und Sitte, Religion und Kunst und zwar eine solche,
welche sich schon auf den frühsten Stufen der geistigen
Entwickelung, beim Kind und unzivilisierten Menschen, geltend
macht. Gerade bei den rohesten Naturvölkern ist die
Sprachthätigkeit besonders lebendig und das Leben der Sprache,
die man bei ihnen gewissermaßen in ihrem natürlichen
Zustand studieren kann, ein ungemein rasches. So herrscht im Innern
von Brasilien eine so große Sprachverschiedenheit, daß
bisweilen an einem Fluß hin, dessen Länge 300-500 km
nicht übersteigt, 7-8 völlig verschiedene Sprachen
gesprochen werden. Genaue Kenner des Landes erklären dies
daraus, daß es ein Hauptzeitvertreib der Indianer ist,
während sie an ihrem Feuer sitzen, neue Wörter zu
ersinnen, über die, wenn sie treffend sind, der ganze Haufe in
Gelächter ausbricht und sie dann beibehält. Bei
südafrikanischen Negerstämmen, unter denen der englische
Missionär Moffat lebte, wurden die Kinder manchmal von ihren
Eltern so sehr sich selbst überlassen, daß sie
genötigt waren, sich eine besondere Sprache zu ersinnen,
wodurch im Lauf einer Generation die Sprache des ganzen Stammes
eine andre Gestalt annahm. Missionäre in Zentralamerika hatten
von der Sprache des Volkes, dem sie das Christentum predigten, ein
sorgfältiges Lexikon angelegt; als sie nach zehn Jahren zu dem
nämlichen Stamm zurückkehrten, fanden sie, daß
dasselbe veraltet und unbrauchbar geworden war. Die kleinen
melanesischen Inseln des Stillen Ozeans haben jede eine besondere
Sprache, wenn dieselben auch zu dem gleichen Sprachstamm
gehören. Selbst auf den friesischen Inseln der Nordsee hat die
Isoliertheit der insularen Lage die Folge gehabt, daß auf
allen diesen Inseln verschiedene Dialekte herrschen, worin sogar
ein so gewöhnlicher Begriff wie "Vater" durch besondere
Wörter ausgedrückt wird. Dieselbe sprachliche
Isoliertheit wie bei Inselvölkern findet sich auch bei
Bergvölkern. So fand der russische General Baron v. Uslar bei
der ethnographischen und linguistischen Durchforschung des
nördlichen Kaukasus dort mindestens zehn total verschiedene
Sprachen, und die auf etwa 800,000 Köpfe geschätzten
Basken der Pyrenäen sprechen acht Dialekte, die so stark
voneinander abweichen wie das Französische vom Englischen.
Bei Kulturvölkern erscheint die Veränderung der
179
Sprache und Sprachwissenschaft (Ursprung der Sprache).
Sprache ungemein verlangsamt. Ganz neue Wörter werden
meist nur von Kindern erfunden, deren Neuerungsversuche in der
Regel keine bleibende Wirkung hinterlassen. So berichtet Charles
Darwin von einem englischen Kinde, das im Alter von einem Jahr
alles Eßbare mit der Silbe "umm" bezeichnete; Taine
beobachtete ein französisches Kind, das etwa im gleichen Alter
einen Hund "na-na", ein Pferd "da-da" nannte; und der Schreiber
dieser Zeilen kannte ein deutsches Kind, das umherflatternde Tauben
als "Wattel-Wattel" bezeichnete. Aber wenige Jahre später
waren diese Wörter vergessen. Dem gebildeten Deutschen,
Engländer, Franzosen etc. sind daher noch jetzt Bücher,
die in den zwei oder drei letzten Jahrhunderten geschrieben wurden,
fast ohne Mühe verständlich. Das Englische hat sich
über alle Weltteile verbreitet, ist aber dabei vollkommen
stabil geblieben. Namentlich bildet die Schrift und in der Neuzeit
auch der Buchdruck, dann die ungeheure Vermehrung und Verbesserung
der Verkehrsmittel die wirksamste Schranke gegen die sprachliche
Neuerungssucht. Dennoch wäre es ein vollkommener Irrtum,
irgend eine moderne Sprache für vollkommen abgeschlossen zu
halten. Vor allem ist auch in der Sprache unaufhörlich ein
Gesetz der Trägheit wirksam, das sich besonders in der
Vereinfachung oder gänzlichen Beseitigung schwer sprechbarer
oder unbetonter Laute und Lautverbindungen geltend macht. Durch
diese stufenweise fortschreitende Abschleifung und Verwitterung der
Laute ist z. B. im Englischen überall das ch und das vor einem
n stehende k abgestoßen worden, so daß knight, das
deutsche "Knecht", wie neit gesprochen wird; im Deutschen ist das
tonlose e in Schlußsilben in völligem Rückzug
begriffen, wodurch z. B. erst in neuester Zeit "des Königes,
dem Könige" in "Königs, König", "befestiget" in
"befestigt" verwandelt wurde u. dgl. Anderseits führt der
Nachahmungs- und Analogietrieb zur Erfindung und Ausbildung neuer
Wörter, Formen und Bedeutungen, die entweder aus fremden
Sprachen entlehnt werden, wie z. B. unsre aus dem
Französischen herübergenommenen zahlreichen Verba auf
-ieren, oder aus den Mundarten in die Schriftsprache eindringen,
oder an ältere einheimische Wörter und Formen angelehnt
werden, wie z. B. die deutsche Form der Vergangenheit auf -te,
welche zusehends die alten ablautenden Verba verdrängt,
wofür unser "backte" für das noch im vorigen Jahrhundert
übliche "buk" als Beispiel dienen kann. Überhaupt hat die
Sprachforschung dargethan, daß der Grad, bis zu dem sich
Laute, Wörter, Wort- und Satzformen verändern
können, an und für sich ein völlig unbegrenzter ist
und oft die scheinbar unähnlichsten Sprachen durch eine Reihe
von Mittelgliedern hindurch auf eine und dieselbe Grundsprache
zurückgeführt werden können.
Denkt man sich die Entwickelung sämtlicher geschichtlich
nachweisbarer Grundsprachen in einer vorgeschichtlichen Periode bis
an ihren Ausgangspunkt fortgesetzt, so liegt es nahe, die Frage
aufzuwerfen, ob nicht dieser Ausgangspunkt der gleiche, alle
Grundsprachen in letzter Linie aus der nämlichen Ursprache
entsprungen seien. Diese Frage, die man früher, teilweise aus
religiösen Vorurteilen, voreilig zu bejahen pflegte, muß
auf dem heutigen Stande der Wissenschaft entschieden verneint
werden. Standen auch eine Reihe wichtiger Sprachen einander
früher viel näher als jetzt, so weichen doch die
Grundsprachen, auf die sie zurückgehen, sowohl hinsichtlich
der Wurzeln als des grammatischen Baues so entschieden voneinander
ab, daß alle Versuche, sie (z. B. die indogermanische und
semitische Grundsprache) auf eine gemeinsame Ursprache
zurückzuführen, vollständig scheitern mußten.
Man muß im Gegenteil annehmen, daß eine Reihe
ursprünglicher Sprachtypen jetzt entweder völlig oder nur
mit Hinterlassung vereinzelter Überreste, wie das
rätselhafte Baskisch der Pyrenäen und die Sprachen des
nördlichen Kaukasus, vom Erdboden verschwunden sind; denn je
mehr die Kultur zunimmt, desto mehr nimmt die Sprachverschiedenheit
ab und ist daher in Europa trotz seiner dichten Bevölkerung
weit geringer als in allen übrigen Erdteilen. Auch die
bestehenden Sprachen werden von der heutigen Sprachforschung auf
eine beträchtliche Anzahl selbständiger Ursprachen
zurückgeführt.
Mit dieser Erkenntnis hat sich die Frage nach dem Ursprung der
Sprache, die schon Platon und Aristoteles, Epikur und die Stoiker
beschäftigt und die griechischen und römischen
Grammatiker in zwei Lager gespalten hat, später mit
unbegründetem Hinweis auf die Bibel, welche die Erfindung der
Sprache dem ersten Menschen beilegt, im Sinn eines
übernatürlichen Ursprungs beantwortet wurde, in eine
Frage nach der Entstehung der einzelnen tatsächlich
nachgewiesenen Grundsprachen verwandelt. Wie man sich dieselbe zu
denken habe, läßt sich freilich historisch nicht
feststellen; auch gehen die Ansichten darüber sehr
auseinander, indem die einen, wie W. v. Humboldt, M. Müller,
Steinthal etc., annehmen, daß sich unwillkürlich
bestimmte Laute an bestimmte Begriffe oder Anschauungen anschlossen
(Nativismus), die andern dagegen, wie Whitney, L. Geiger, Bleek,
Marty, Madvig u. a., von der jetzigen Unabhängigkeit des Lauts
vom Gedanken und des Gedankens vom Laut ausgehend, einen solchen
Zusammenhang der Laute mit dem Gedanken abweisen (Empirismus). Doch
ist neuerdings eine Vermittelung zwischen den beiden sich
entgegenstehenden Ansichten angebahnt und namentlich die
früher versuchte Zurückführung der Sprache auf ein
eigentümliches, später verlornes Vermögen der
ursprünglichen Menschheit durchweg aufgegeben worden.
Überhaupt ist es bei allen Mutmaßungen über den
Sprachenursprung nötig, sich durchaus auf den
thatsächlichen Boden zu stellen, welchen das Leben der Sprache
während der durch die Geschichte beleuchteten Strecke ihrer
Entwickelung und besonders bei unzivilisierten Völkern
darbietet, und es sind dabei namentlich folgende Sätze
festzuhalten, die sich also ebenso auf das Wesen wie auf den
Ursprung der Sprache beziehen: 1) Sprache und Vernunft sind nicht
identisch, so vielfach sie sich gegenseitig beeinflussen, und zwar
ist das Sprechen eine weitaus beschränktere Fähigkeit als
das Denken, da selbst die gebildetsten Sprachen, die das
Sprachvermögen erzeugt hat, bei weitem nicht alle Gedanken
auszudrücken vermögen. Es gibt Gedanken und Empfindungen,
welche ein Ton oder eine Gebärde viel bezeichnender
ausdrückt als ein Wort, und namentlich beim Kind und bei einem
Menschen von lebhaftem Naturell ist die Gebärdensprache
höchst entwickelt. Die Taubstummen, denen gewiß niemand
die Vernunft absprechen wird, haben eine höchst
künstliche und ihnen gleichwohl völlig geläufige
Zeichensprache. Viele Lehrsätze der Mathematik, welche sich in
Worten nur mit Mühe oder gar nicht ausdrücken lassen,
können durch ein paar einfache Zeichen oder eine Zeichnung
leicht demonstriert werden. Musik und Malerei stehen der Poesie als
selbständige Künste zur Seite. Auch sind die Gesetze der
Denklehre oder Logik von den Gesetzen der Sprachlehre oder
Grammatik verschieden, wie z. B. der deutsche Satz: "die
180
Sprache und Sprachwissenschaft (Grammatik, Etymologie).
Kugel ist viereckig" grammatisch ganz richtig, aber logisch
verkehrt ist. Hiernach hat es gewiß auch von allem Anfang an
ein Denken ohne Sprechen gegeben. 2) Kinder und Naturmenschen
bezeichnen viele Individuen oder Gegenstände dadurch,
daß sie mit ihrer Stimme den Schall nachahmen, den sie als
von denselben ausgehend wahrgenommen haben. Diese einfache und
nächstliegende Art der Bezeichnung, die onomatopoetische, war
ohne Zweifel in jeder Ursprache sehr häufig, wenn die
Wau-wau-Theorie (so genannt von dem Namen Wau-wau des Hundes in der
Kindersprache) auch nicht den Anspruch erheben kann, alle
Wörter zu erklären. 3) Ausrufe und Schreie
(Interjektionen) spielen selbst bei gebildeten und erwachsenen
Menschen noch eine mehr oder weniger große Rolle, eine sicher
viel größere in den Anfängen einer Sprache. Hierin
liegt die Berechtigung der sogen. Ah-ah- oder Interjektionstheorie
vom Ursprung der Sprache. 4) Hiernach sind wohl auch die ersten
Wörter nichts als Reflexlaute gewesen, welche im Affekt
hervorgebracht wurden, gerade wie die Zuckungen oder sonstigen
unwillkürlichen Reflexbewegungen, die aus
Gemütsbewegungen hervorgehen. Die Reflexlaute gingen
ursprünglich mit den andern unwillkürlichen Gebärden
Hand in Hand. Da die Gemütsbewegungen am leichtesten durch
verschiedenerlei Geräusche verursacht wurden, so ahmte die
menschliche Stimme mit Vorliebe diese Geräusche nach. 5) Erst
in zweiter Linie wurden die Sprachlaute zugleich zu Mitteilungen
verwendet, nachdem es wiederholt gelungen war, durch ihre
Hervorbringung die Aufmerksamkeit der andern zu erregen. Es ging
damit ähnlich wie mit der Gebärdensprache, die sich aus
ursprünglichen Reflexbewegungen zu der ausgebildeten
Zeichensprache entwickelt hat, die man z. B. bei den Indianern
Nordamerikas findet. Auch die Schrift hat sich aus roher
Ideenmalerei und Bilderschrift successive zu einem der
vollkommensten Verständigungsmittel entwickelt. 6) Die ersten
Sprachschöpfungen waren primitive Sätze, etwa wie die
Ausrufe: "Diebe!" "Feuer!", und aus diesen chaotischen
Äußerungen haben sich erst allmählich
selbständige Wörter und Redeteile entwickelt.
Vgl. Herder, Über den Ursprung der Sprache (zuerst Berl.
1772); W. v. Humboldt, Über die Verschiedenheit des
menschlichen Sprachbaues (neu hrsg. mit einer Einleitung von Pott,
das. 1876, 2 Bde.); Steinthal, Der Ursprung der Sprache im
Zusammenhang mit den letzten Fragen alles Wissens (4. Aufl., das.
1888); Derselbe, Abriß der Sprachwissenschaft (2. Aufl., das.
1881, Bd. 1: "Einleitung in die Psychologie und
Sprachwissenschaft"); J. Grimm, Über den Ursprung der Sprache
(in "Kleinere Schriften", Bd. 1, das. 1864); Max Müller,
Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache (deutsch von
Böttger, 2. Aufl., Leipz. 1866-70, 2 Bde.); Renan, De
l'origine du langage (4. Aufl., Par. 1863); Heyse, System der
Sprachwissenschaft (Berl. 1856); Schleicher, Die Darwinsche Theorie
und die Sprachwissenschaft (3. Aufl., Weim. 1873); Wedgewood, On
the origin of language (Lond. 1866); Whitney, Die
Sprachwissenschaft (bearbeitet von Jolly, Münch. 1874); Bleek,
Über den Ursprung der Sprache (Weim. 1868); L. Geiger,
Ursprung und Entwickelung der menschlichen Sprache und Vernunft
(Stuttg. 1869-72, 2 Bde.); Wackernagel, Über den Ursprung und
die Entwickelung der Sprache (Basel 1872); Madvig, Kleine
philologische Schriften (Leipz. 1875); Marty, Über den
Ursprung der Sprache (Würzb. 1875); Noiré, Der Ursprung
der Sprache (Mainz 1877); Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte (2.
Aufl., Halle 1886). Weitere Litteratur S. 182.
Sprachwissenschaft.
Die Sprachwissenschaft oder Linguistik (auch allgemeine
Grammatik genannt) ist als Wissenschaft erst ein Kind des 19.
Jahrh. Denn die Grammatik der Griechen und Römer und die nicht
minder bedeutenden grammatischen Forschungen der Inder und Araber
waren schon durch ihre Beschränkung auf eine oder
höchstens zwei Sprachen völlig ungeeignet, zu einer
Einsicht in das Wesen und die Verwandtschaftsverhältnisse der
Sprachen zu führen, und vom Mittelalter ab bis in die Neuzeit
herein bildete besonders das Vorurteil, als sei das Hebräische
die Ursprache der Menschheit, ein Hemmnis für den Fortschritt
der Sprachforschung. Erst die Entdeckung der alten heiligen Sprache
Indiens, des Sanskrit, gegen Ende des 18. Jahrh. und die Aufdeckung
des Zusammenhangs, in dem es mit den meisten Kultursprachen Europas
steht, gaben den Anstoß zu einer ausgedehntern
Sprachvergleichung und damit zur Begründung einer wirklichen
Wissenschaft von der Sprache, deren Lebensprinzip, wie das jeder
Wissenschaft, die Vergleichung ist. Ihrer exakten, streng
induktiven Methode wegen ist die Sprachwissenschaft mehrfach den
Naturwissenschaften zugezählt worden; doch gehört sie
ihres Objekts wegen entschieden zu den sogen.
Geisteswissenschaften, da die Sprache kein Naturprodukt, sondern
ein Erzeugnis des menschlichen Geistes ist. Auch waren die
Begründer der Sprachwissenschaft durchweg Philologen. Durch
die Forschungen Fr. Schlegels, Bopps und ihrer Nachfolger wurde der
indogermanische Sprachstamm nachgewiesen und die zu ihm
gehörigen Sprachfamilien festgestellt wie auch die
vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen
begründet. Zugleich regten W. v. Humboldts und Potts
weitgreifende Forschungen eingehende Untersuchungen sowohl auf
andern, selbst den fernst liegenden Sprachgebieten als auf dem
Gebiet der Sprachphilosophie an, und die historische
Sprachforschung, von J. Grimm und W. Diez begründet, schuf
durch exakte und gründliche Forschung in dem enger begrenzten
Bereich einzelner Sprachfamilien die Methode der historischen
Grammatik. Seitdem hat der Betrieb der Sprachwissenschaft in ihren
drei Hauptrichtungen, der historischen, vergleichenden und
philosophischen, in allen Ländern, namentlich aber in
Deutschland, einen mächtigen Aufschwung genommen.
Die genaue Beobachtung des Lautwechsels, der sogen. Lautgesetze,
bildet die Hauptgrundlage, auf der die bedeutenden Resultate der
Sprachwissenschaft beruhen. Vor allem besitzen wir jetzt eine
wissenschaftliche Etymologie, während früher nach dem
Ausspruch des heil. Augustin die Ableitung der Wörter wie die
Deutung der Träume ganz nach subjektiver Willkür
betrieben und das berüchtigte Prinzip "lucus a non lucendo"
nicht selten alles Ernstes angewendet wurde. Nicht minder haben
auch alle Teile der Grammatik, die Laut-, Flexions- und
Wortbildungslehre wie die Syntax und die Lehre von der
Zusammensetzung, eine völlige Umgestaltung erfahren, der sich
auch die Schulgrammatik nicht mehr entziehen kann, seitdem Curtius
in seiner "Griechischen Schulgrammatik" (zuerst 1852) gezeigt hat,
wie wichtig auch für den Schulbetrieb der Grammatik die
Ergebnisse der vergleichenden Sprachforschung sich gestalten.
Ferner ist über die Urgeschichte der Menschheit, besonders der
indogermanischen Völker, ein un-
180a
[Zur Sprachenkarte bei Artikel Sprache etc.]
Übersicht der wichtigern Sprachstämme.
I. Einsilbige Sprachen in Südostasien.
Chinesisch mit seinen Dialekten, Anamitisch mit der Sprache von
Kambodscha, Siamesisch nebst dem Schan und der Sprache der Miaotse,
Birmanisch nebst Khassia und Talaing (Pegu) und Tibetisch nebst den
zahlreichen, noch wenig erforschten Himalajasprachen. Die Sprache
besteht ganz aus einsilbigen Wurzeln, welche keiner
Veränderung fähig sind; jede Wurzel kann je nach ihrer
Stellung im Satz alle verschiedenen Redeteile ausdrücken, die
wir durch besondere Wortformen unterscheiden. Doch gibt es neben
den Stoffwurzeln, welche Begriffe und Thätigkeiten
ausdrücken, auch eine Anzahl Deutewurzeln, die sich mit unsern
grammatischen Endungen vergleichen lassen. Unter sich sind diese
Sprachen nur durch die Gleichheit des Baues, nicht durch
Gleichklang der Wurzeln verbunden.
II. Malaio-polynesischer Sprachstamm,
zerfallend in drei Gruppen (nach Fr. Müller):
1) Die malaiische, welche von der Insel Formosa an der
chinesischen Küste bis zur Insel Java im Süden und bis
zur Insel Madagaskar in Afrika reicht und die Sprachen der
Philippinen (Tagalisch, Bisaya, Pampanga etc.), der Insel Formosa,
der Inseln Borneo, Celebes und Sumatra (Dajak, Alfurisch, Bugi,
Makassarisch und Batak), der Marianen, Molukken und einiger andern
kleinern Inseln, der Insel Java (dazu Kawi, die stark mit Sanskrit
versetzte Litteratursprache), der Halbinsel Malakka (eigentliches
Malaiisch) und der Insel Madagaskar (Malagasi) umfaßt.
2) Die melanesische, auf den Neuen Hebriden und den Fidschi-
sowie den Salomoninseln, vielleicht auch auf Neukaledonien
(Gabelentz), den Palau-, Marshall- und Kingsmillinseln (Fr.
Müller).
3) Die polynesische, auf Neuseeland (Maori), den Unionsinseln,
Samoa, Tonga, Tahiti, Rarotonga, Paumotu, den Markesas, der
Osterinsel etc. bis einschließlich Hawai im Norden.
Diese Sprachen zeichnen sich durch Wohlklang aus, indem sie sehr
reich an Vokalen sind, dagegen nur wenig Konsonanten unterscheiden;
auch sind die Wörter meist vielsilbig. Gleichwohl ist die
Grammatik auch hier sehr unentwickelt, wie z. B. Nomen und Verbum
gar nicht unterschieden und nur einige andre grammatische
Beziehungen durch vorn angehängte Silben bezeichnet werden. Am
unentwickeltsten sind die Sprachen Polynesiens, das wahrscheinlich
den Ausgangspunkt der großen nach Westen gerichteten
Wanderung der Malaio-Polynesier gebildet hat.
III. Drawidasprachen in Südindien.
Telugu und Tamil an der Koromandel-, Kanaresisch, Malayalam,
Tulu an der Malabarküste, die Hauptsprachen Südindiens,
die sich nach der neuesten Statistik der englischen Regierung auf
ungefähr 49 Mill. Köpfe in der Weise verteilen, daß
das Tamil oder Tamulische nebst dem nördlich und nordwestlich
davon bis nach der Provinz Orissa sich verbreitenden Telugu
zusammen von nahezu 35 Mill., das Malayalam nebst dem nördlich
daran anstoßenden Tulu und das Kanaresische zusammen von etwa
14 Mill. gesprochen werden. Das Tamil wird außerdem von einem
Bruchteil der Bevölkerung von Ceylon gesprochen.
Zu den Drawidasprachen werden auch die Idiome der Kota, Toda,
Gond, Kond, Uraon und einiger andrer wilder Stämme in
Südindien sowie der Brahui in Belutschistan gerechnet. Die
grammatischen Elemente folgen hier der Wurzel nach und wirken auf
dieselbe zurück, indem sie sich ihren Endvokal assimilieren;
sonst bleibt die Wurzel unverändert.
IV. Uralaltaischer Sprachstamm,
auch Turanisch (Max Müller), Skythisch (Whitney) oder
Finnisch-Tatarisch genannt, zerfällt in fünf Gruppen:
1) Die finnisch-ugrische in Osteuropa und Nordasien (nach
Budenz), mit den 7 Hauptsprachen: Finnisch (Suomi) nebst Esthnisch
und Livisch, Lappisch, Mordwinisch, Tscheremissisch,
Sirjänisch-Wotjakisch und Permisch, Ostjakisch-Wogulisch,
Magyarisch.
2) Die samojedische, im Norden und Nordosten der vorigen,
nämlich: Yurak, Tawgy, Jenissei- und
Ostjakisch-Samojedisch.
3) Die türkische, von der europäischen Türkei mit
Unterbrechungen bis zur Lena, nämlich: Osmanisch, Nogaisch (in
der Krim), Tschuwaschisch, Kirgisisch, Kumükisch, Uigurisch,
Tschagataisch, Turkmenisch, Uzbekisch und Jakutisch. Alle diese
Sprachen sind trotz der großen räumlichen Entfernung
sehr nahe untereinander verwandt.
4) Die mongolische, nämlich die Sprachen der Mongolen,
Kalmücken und Buräten.
5) Die tungusische, nämlich die Sprachen der Tungusen und
Mandschu.
Der grammatische Bau ist auch hier sehr einfach, indem jedes
Wort aus einer unveränderlichen Wurzel und einem oder mehreren
Suffixen besteht. Letztere sind aber sehr zahlreich und
drücken nicht bloß den Unterschied von Nomen und Verbum,
sondern die verschiedensten andern grammatischen Beziehungen aus;
die in den Suffixen enthaltenen Vokale werden an den Wurzelvokal
assimiliert (Vokalharmonie). Die Flexion zeichnet sich durch
große Regelmäßigkeit aus.
V. Bantu-Sprachstamm
(von kafferisch abantu, »Leute«), auch
südafrikanischer Sprachstamm genannt, reicht, abgesehen von
einigen Unterbrechungen im Süden durch die isoliert
dastehenden Sprachen der Hottentoten und Buschmänner, von der
Kapkolonie an im Westen etwa bis zum 8.° nördl. Br., im
Osten bis zum Äquator, weiter wahrscheinlich in den noch
unbekannten Regionen Zentralafrikas. Er zerfällt in 3 Gruppen
(Fr. Müller):
1) Die östliche Gruppe umfaßt die Kaffernsprachen
(Kafir im engern Sinn, Zulu), die Sambesisprachen (Sprachen der
Barotse, Bayeye, Maschona) und Sansibarsprachen (Kisuaheli, Kinika,
Kikamba, Kihiau, Kipokomo).
2) Die mittlere Gruppe besteht aus:
a) Setschuana (Sesuto, Serolong, Sehlapi).
b) Tekeza (Sprachen der Mankolosi, Matonga, Mahloenga).
3) Zur westlichen Gruppe gehören:
a) Herero, Bunda, Loanda.
b) Congo, Mpongwe, Dikele, Isubu, Fernando Po, Dualla (in
Camerun).
Auch dieser Sprachstamm zeichnet sich durch eine sehr reiche und
regelmäßige Flexion aus, die aber fast nur durch vorn
antretende grammatische Elemente (Präfixe) bewirkt wird.
Besonders besitzen sämtliche Bantusprachen eine
beträchtliche Anzahl von Artikeln, die zugleich, in der
Bedeutung von Pronomina, an das Verbum und andre Satzteile vorn
angesetzt werden, um die grammatische Kongruenz der Satzglieder
auszudrücken. Daher hat sie Bleek die
»präfix-pronominalen« Sprachen genannt.
VI. Hamito-semitischer Sprachstamm.
A. Die hamitische Gruppe umfaßt:
1) Die libyschen od. Berbersprachen in Nordafrika.
2) Die äthiopischen Sprachen, Galla, Somali, Bedscha,
Dankali (Danakil), Agau, Saho, Falascha, Belen, vom südlichen
Ägypten bis au den Äquator reichend.
180b
Übersicht der wichtigern Sprachstämme.
3) Das Altägyptische der ägyptischen Denkmäler
und Papyrusrollen mit seiner ebenfalls schon ausgestorbenen
Tochtersprache, dem Koptischen.
B. Die semitische Gruppe teilt sich in:
1) Nördliche Abteilung, bestehend aus dem nahe verwandten
Assyrisch und Babylonisch der Keilinschriften, den kanaanitischen
Sprachen, nämlich Hebräisch nebst Samaritanisch und
Phönikisch nebst Punisch, und aus den aramäischen
Sprachen, d. h. Chaldäisch und Syrisch nebst Mandäisch
und Palmyrenisch.
2) Südliche Abteilung mit Arabisch, jetzt auch in
Nordafrika verbreitet u. mit dem Islam immer weiter nach dem
Süden Afrikas vordringend, Himjarisch, Äthiopisch (Geez),
Amharisch, Tigré, Harrari.
Die beiden ersten Spezies der semitischen Gruppe sind
völlig ausgestorben, wenn man von dem syrischen Dialekt
einiger Nestorianer und Jakobitengemeinden am Urmiasee und in
Turabdin absieht, und auch von der dritten Spezies sind das
Äthiopische und Himjarische jetzt erloschen. Die hamitische
und semitische Gruppe stimmen nur betreffs eines Teils ihrer
Wurzeln, namentlich bei den Pronomina und Zahlwörtern, und
betreffs der Unterscheidung des grammatischen Geschlechts
überein. Sonst sind die hamitischen Sprachen grammatisch sehr
wenig, die semitischen dagegen im höchsten Grad entwickelt,
indem sie, die verschiedenen grammatischen Beziehungen, sowohl am
Nomen als am Verbum, teils durch vorn oder hinten antretende
Affixe, teils durch Variation des Wurzelvokals ausdrücken.
Jede Wurzel enthält drei Konsonanten, welche stets
unverändert bleiben, so sehr die Vokale wechseln.
VII. Der indogermanische Sprachstamm
zerfällt in acht Gruppen:
1) Indische Gruppe: Jetzt ausgestorben sind das Sanskrit,
Prâkrit und Pâli; lebende Sprachen sind: Hindi und
Hindostani (Urdu), fast in ganz Nordindien verbreitet, wo es von
nahezu 100 Mill. Menschen gesprochen wird, Pandschabi am obern,
Sindi am untern Indus, Marathi und Gadscherati in der
Präsidentschaft Bombay, Bengali, Assami, Oriya in Bengalen,
Nepali, Kaschmiri im Norden, nach einigen auch das Singhalesische
auf der Südhälfte der Insel Ceylon, nördlich von
Indien das Kafir und Dardu, in Europa die mit diesen beiden Idiomen
nahe verwandte Sprache der Zigeuner, die Auswanderer aus Indien
sind.
2) Iranische Gruppe: Zend oder Altbaktrisch, Altpersisch der
Keilinschriften, Pehlewi oder Mittelpersisch, Pazend und Parsi,
wahrscheinlich auch die Sprache der Skythen nordwärts vom
Schwarzen Meer (Müllenhoff) sind die toten, Neupersisch,
Kurdisch, Belutschi, Afghanisch oder Puchtu und Ossetisch (im
Kaukasus) die lebenden Sprachen dieser Gruppe, die mit der
indischen sehr nahe verwandt ist.
3) Armenisch, früher zu der iranischen Gruppe
gerechnet.
4) Griechische Gruppe: Dazu gehören die alt- und
neugriechischen Dialekte und Schriftsprachen; das Neugriechische
herrscht auch auf der Südküste von Kleinasien, in Kreta
und Cypern.
5) Illyrische Gruppe: Albanesisch in Epirus.
6) Italische Gruppe: Latein, Umbrisch, Oskisch im Altertum; in
der Neuzeit die romanischen Sprachen: Spanisch nebst Katalonisch,
Portugiesisch, Italienisch, Französisch nebst
Provençalisch, Rumänisch, Ladinisch nebst
Rätoromanisch (in Südtirol, Graubünden und
Friaul).
7) Keltische Gruppe: Kymrisch in Wales und der Bretagne, dazu
das ausgestorbene Cornisch in Cornwallis; Gälisch in Irland,
dem schottischen Hochland (Erse) und auf der Insel Man (Manx). Auch
die nur aus einigen Inschriften bekannte Sprache der alten Gallier
gehört hierher.
8) Slawisch-lettische Gruppe, dazu:
a) Altslawisch oder Kirchenslawisch, jetzt ausgestorben,
Russisch nebst Weiß- und Kleinrussisch (Russinisch,
Ruthenisch), Serbo-kroatisch, Slowenisch oder Südslawisch in
Steiermark, Kärnten etc., Tschechisch-Slowakisch in
Böhmen und Mähren, Polnisch in Preußisch- und
Russisch-Polen und Galizien, Wendisch in der Lausitz,
b) Altpreußisch (jetzt ausgestorben), Litauisch,
Lettisch.
9) Germanische Gruppe, zerfallend in:
a) Ost- und Nordgermanisch mit Gotisch (ausgestorben),
Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Isländisch.
b) Westgermanisch mit Hoch- oder Oberdeutsch, Mitteldeutsch,
Niederdeutsch od. Plattdeutsch, Vlämisch, Niederländisch
und Englisch.
Der indogermanische Sprachstamm ist, wie der wichtigste u.
verbreitetste, so der vollkommenste aller Sprachtypen, dem nur der
semitische einigermaßen nahekommt. Wie die übrigen
grammatisch entwickelten Sprachstämme, bildet er die
Wörter aus Wurzeln und Affixen, welch letztere in der Regel
der Wurzel nachfolgen. Die große Anzahl der Affixe, welche
überdies in beliebiger Menge aufeinander gehäuft werden
können, ihre innige Vereinigung mit der Wurzel zu einem
vollkommen selbständigen, neuen Wort ermöglichen den
charakteristischen Wort- und Bedeutungsreichtum der
indogermanischen Sprachen. Auch die feine und mannigfaltige
Gliederung der Sätze ist ihnen eigentümlich.
VIII. Der amerikanische Sprachstamm
umfaßt die Sprachen der Eingebornen von Nord- und
Südamerika mit Ausnahme der Eskimo im äußersten
Norden. Es gehört dazu der an die Eskimosprachen angrenzende
athabaskische Sprachstamm (dazu nach Buschmann auch die
Kenaisprachen in Alaska), dessen südwestliche Ausläufer,
die Idiome der Apatschen und der Navajo, bis nach Mexiko hinein
reichen; die Algonkinsprachen (dazu das Delaware, Mohikan,
Odschibwä, Minsi, Kri, Mikmak etc.) südlich davon sind
besonders im Osten heimisch und reichten früher von Labrador
bis nach Südcarolina; westlich vom Hudson schließt sich
daran das Irokesische, weiter nach Westen, jenseit des Mississippi,
das Dakota der Sioux-Indianer, das Pani der Pani-Indianer am
Arkansas etc. Im Felsengebirge und Quellengebiet des Missouri
beginnt mit der Gruppe der Schoschonensprachen der
Sonora-Sprachstamm, der im südlichen Arizona und Kalifornien
sowie im nördlichen Mexiko herrscht; dazu gehören wohl
auch das Nahuatl der Epoche Montezumas und das davon abgeleitete
moderne Aztekisch nebst zahlreichen Dialekten, die bis nach San
Salvador reichen. Im Süden und Südosten schließen
sich daran die Sprachen der Urbewohner Mexikos, der
mittelamerikanischen Republiken und der Antillen: Otomi,
Mixtekisch, Zapotekisch, Tarasca, Cibuney, Cueva, Maya u. a. Die
Hauptsprachen Südamerikas sind: das Galibi oder Karibische
nebst dem Arowakischen, vom Isthmus von Panama bis nach Guayana,
zur Zeit der Entdeckung Amerikas auch auf den Antillen heimisch,
verwandt mit dem weitverbreiteten Tupi (Lingoa geral, d. h.
allgemeine Umgangssprache, genannt) im Innern von Brasilien und dem
Guarani am La Plata; das Chibcha in Kolumbien; die andoperuanische
Gruppe mit Kechua und Aymara als Hauptsprachen; die andisische
Gruppe östlich davon, mit den Sprachen der Yuracare u. a.; das
Araukanische, Patagonische, Guaicuru, Chiquito, Abiponische und die
Sprache der Pescheräh oder Feuerländer. Alle diese
Sprachen oder Sprachstämme Amerikas nebst vielen andern hier
ungenannten Sprachen (Amerika zählt deren über 400) haben
zwar keine Wurzeln, aber den gleichen grammatischen Bau miteinander
gemeinsam. Der ganze Satz geht im Verbum auf, mit welchem Subjekt,
Objekt und adverbiale Bestimmungen zu Einem Wort verschmolzen
werden, wodurch die ungeheuern Wortkonglomerate entstehen, welche
die amerikanischen Sprachen charakterisieren.
Über die außerhalb der angeführten acht
Sprachstämme stehenden sogen. isolierten Sprachen vgl. den
Text, S. 181 f.
180c
SPRACHENKARTE.
Gegenwärtige Verbreitung der Sprachstämme.
Maßstab am Äquator
l:155 000 000.
Indogermanischer Sprachstamm:
Germanisch
Romanisch
Slawisch
^Keltisch
Griechisch
^Iranisch
^Irakisch
Ural-Altaischer Sprachstamm:
Finnisch-Ugrisch
Türkisch u. Jakut.
Mongolisch
^Tiutgusisch
^Samojectiscfv
Südostasiatischer Sprachstamm:
Chinesisch
Siamesisch
Birmanisch
Tibetisch
Hamito-Semitischer Sprachstamm:
Semitisch (Arabisch)
Hamitisch
Malayo-Polynesischer Sprachstamm:
Malayisch
Melanesisch
Polynesisch
Bantu-Sprachstamm
Drawida-Sprachen
Amerikan. "
(nur dem Bau nach verwandt)
Isolirte oder noch unerforschte Sprachen
zum Artikel »Sprachwissenschaft«
181
Sprache und Sprachwissenschaft (Verbreitung u. Einteilung der
Sprachen).
erwartetes Licht verbreitet worden, indem die Ausscheidung der
allen indogermanischen Sprachen gemeinsamen Wörter erkennen
ließ, welchen Kulturgrad diese Völker vor ihrem Aufbruch
aus der gemeinsamen asiatischen Heimat schon erreicht hatten. Auch
hat sich im Anschluß an diese Forschungen eine vergleichende
Mythologie und eine vergleichende Sitten- und Rechtsgeschichte
entwickelt. Selbst die schwierige Frage nach dem Ursprung der
Sprache ist, wie schon erwähnt, in ein ganz neues Licht
getreten. Das wichtigste Ergebnis bleibt aber immer die
Klassifikation der Sprachen, weil dadurch zugleich die wichtigsten
Fragen der Anthropologie auf einem ganz neuen Weg ihrer Lösung
entgegengeführt werden. Man unterscheidet zwischen einer
morphologischen und einer genealogischen Einteilung der Sprachen.
Bei der erstern gibt der grammatische Bau der Sprachen den
Einteilungsgrund ab, und man stellt meistenteils drei Hauptarten
desselben auf. Die isolierenden Sprachen, wie z. B. das
Chinesische, bestehen aus lauter einsilbigen Wurzeln, welche stets
unverändert bleiben, selbst wenn sie miteinander
zusammengesetzt werden. Der Unterschied zwischen Subjekt und Objekt
und überhaupt alle grammatischen Verhältnisse werden nur
durch die Stellung der Wörter im Satz ausgedrückt.
Agglutinierende ("anleimende") Sprachen sind solche, welche einen
Teil ihrer Wurzeln zum Zweck des Beziehungsausdrucks an andre
regelmäßig anfügen und dabei die erstern
verändern, während dagegen die Hauptwurzel, welche den
Begriff des Wortes enthält, unverändert bleibt. Eine
Unterart dieser sehr zahlreichen Klasse sind die polysynthetischen
Sprachen, die, wie z. B. die amerikanischen, alle abhängigen
oder minder wichtigen Satzglieder in verkürzter Form an die
Hauptwurzel anhängen. Diese unbeholfene Ausdrucksweise ist
vielleicht als ein Überbleibsel aus der primitiven Stufe des
Sprachlebens anzusehen, als man noch nicht dazu gelangt war, den
Satz in seine einzelnen Bestandteile aufzulösen. Von den
polysynthetischen Sprachen trennen manche als eine besondere Klasse
die einverleibenden ab, die, wie das Baskische, die
Nebenbestimmungen zwischen Wurzel und Endung einschieben.
Flektierend sind diejenigen Sprachen, welche in Zusammensetzungen
sowohl die erste als die zweite nebst den folgenden Wurzeln
beliebig verändern können, um verschiedene
Nebenbeziehungen auszudrücken. Zu dieser höchsten
morphologischen Klasse rechnet man nur den indogermanischen und
semitischen Sprachstamm. Die morphologische Verschiedenheit
läßt sich auch durch Zeichen ausdrücken, indem man
die unveränderlichen Wurzeln durch große, die
veränderlichen durch kleine Buchstaben bezeichnet. Die
Wörter der isolierenden Klasse können dann nur die Form A
oder A B, B A, A B C etc., die der agglutinierenden außerdem
auch die Form A b, A c, b A etc., die der flektierenden noch die
Formen a b, b a, a b c etc. annehmen. Übrigens kommen nicht
nur in den flektierenden und agglutinierenden Sprachstämmen
Wortbildungen nach dem isolierenden, sondern auch in den
isolierenden Sprachen solche nach dem agglutinierenden und selbst
dem flektierenden Prinzip vor, so daß sich diese Einteilung
keineswegs streng durchführen läßt. Viel wichtiger
als die morphologische Klassifikation ist daher die genealogische
Einteilung der Sprachen, welche Gemeinsamkeit der Abstammung zum
Einteilungsgrund macht. Stimmen zwei oder mehrere Sprachen sowohl
in betreff ihrer Wörter und Wurzeln als ihres grammatischen
Baues überein, oder haben sie wenigstens in einer diesen
beiden Beziehungen so viel miteinander gemein, daß die
Annahme einer bloß zufälligen Ähnlichkeit
völlig ausgeschlossen ist, so muß man annehmen,
daß sie auf eine und dieselbe Grundsprache zurückgehen.
Hieraus folgt zugleich, daß die Völker, welche die
betreffenden Sprachen sprechen, zu irgend einer Zeit einmal ein
einziges Volk gebildet haben müssen, und es ergeben sich so
aus der genealogischen Klassifikation der Sprachen die wichtigsten
Resultate für die Einteilung der Völker und Rassen,
Resultate, die viel sicherer sind als diejenigen der
Schädelvergleichung, da die Sprachen weniger leicht der
Mischung unterliegen und stattgehabte Mischungen weit leichter
erkennbar sind als bei den Körpermerkmalen.
Verbreitung und Einteilung der Sprachen.
(Hierzu die "Sprachenkarte", mit Textblatt.)
Die Gesamtzahl der lebenden Sprachen mag in runder Summe etwa
1000 betragen. Adelung in seinem "Mithridates" zählte deren
über 3000 auf; dagegen veranschlagen Balbi und Pott sie nur
auf 860, Max Müller auf 900, welche Ziffern jedoch
wahrscheinlich zu niedrig gegriffen sind. Die Sprachenstatistik
wird dadurch sehr erschwert, daß es unmöglich ist, die
Grenze zwischen Sprache und Dialekt zu bestimmen. Bei einer
Übersicht über die geographische Verbreitung der Sprachen
handelt es sich vorzugsweise darum, ihre Zusammengehörigkeit
zu größern oder kleinern Gruppen, die von einer
gemeinsamen Ursprache herstammen, zur Anschauung zu bringen. Auf
beifolgender "Sprachenkarte" und der zugehörigen
Übersicht sind nur die wichtigern der bis jetzt von der
Linguistik ermittelten Sprachstämme und deren Unterabteilungen
vollständig (letztere auch einschließlich der jetzt
ausgestorbenen), von den einzelnen Sprachen sind nur die
hervorragendsten aufgeführt, namentlich von den in Amerika
gesprochenen. Dort ist die Sprachverschiedenheit am
größten; geringer ist sie in den Weltteilen, die
wenigstens teilweise von alters her von Kulturvölkern bewohnt
und daher früher zur Ausbildung von Schriftsprachen gelangt
sind, in Asien und Afrika, am geringsten in Europa, wo es nur 53
Sprachen gibt; die Sprachen der Eingebornen von Australien sind
teilweise schon ausgestorben. Nach den bisherigen Ergebnissen der
genealogischen Einteilung der Sprachen unterscheiden wir nun acht
Sprachstämme: 1) einsilbige Sprachen in Südostasien; 2)
den malaio-polynesischen Sprachstamm; 3) die Drawidasprachen in
Südindien; 4) den uralaltaischen Sprachstamm; 5) die
Bantusprachen (südafrikanischer Sprachstamm); 6) den
hamito-semitischen Sprachstamm; 7) den indogermanischen
Sprachstamm; 8) den amerikanischen Sprachstamm. Außerdem gibt
es noch eine beträchtliche Anzahl isolierter Sprachen, welche
sich, wenigstens auf Grund der bisherigen Forschungen, in keinen
der größern Sprachstämme einreihen lassen. Dazu
gehören: in Europa das Baskische in den Pyrenäen und das
jetzt ausgestorbene Etruskische (nach Corssen Indogermanisch) in
Toscana; die meisten Negersprachen in Nord- und Zentralafrika, so
das Wolof, Bidschogo, Banyum, Haussa, Nalu, Bulanda, Baghirmi,
Bari, Dinka etc., von denen nur einzelne, wie die Nuba-, Fulbe-,
Mande-, Nil-, Kru-, Ewe-, Bornusprachen, sich zu Gruppen vereinigen
lassen; in Südafrika die verschiedenen Sprachen der
Hottentoten und Buschmänner, welche sich durch das
Vorhandensein zahlreicher Schnalzlaute, im Buschmännischen
acht, auszeichnen, übrigens dem Aussterben nahe sind; die
Sprachen des Kaukasus, unter denen man einen südkaukasischen
Sprachstamm
182
Sprachfehler - Sprachreinigung.
mit Georgisch, Mingrelisch und Lasisch nebst Suanisch und einen
nordkaukasischen Sprachstamm mit Tscherkessisch, Awarisch, Udisch,
Tschetschenzisch etc. unterscheiden kann; im Innern von Ostindien
die Mundasprachen (Ho und Santhal) etc.; das Japanische und
Koreanische in Japan und Korea; das Jukagirische, Korjakische u.
Tschuktschische, Kamtschadalische, Aino, Giljakische,
Jenissei-Ostjakische und Kottische in Nordasien; die Sprachen der
Aleuten in Nordamerika; die Maforsprache auf Neuguinea und andre
Papuasprachen; die südaustralischen und die jetzt
ausgestorbenen tasmanischen Sprachen auf Vandiemensland; die
Sprachen der Mincopie auf den Andamanen sowie der Negrito auf den
Philippinen und der Halbinsel Malakka und andre Sprachen. Vgl.
außer den S. 180 angeführten Werken: Pott, Die
quinäre und vigesimale Zählmethode bei Völkern aller
Weltteile (Halle 1847); Steinthal, Charakteristik der
hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues (Berl. 1860); Max
Müller, Essays (deutsch, Leipz. 1869 ff., 4 Bde.); Schleicher,
Die deutsche Sprache (5. Aufl., Stuttg. 1888); Whitney, Leben u.
Wachstum der Sprache (deutsch von Leskien, Leipz. 1876); Sayce,
Introduction to the science of language (2. Aufl., Lond. 1883, 2
Bde.); Hovelacque, La linguistique (3. Aufl., Par. 1882); Pezzi,
Glottologia aria recentissima (Tur. 1877); Fr. Müller,
Grundriß der Sprachwissenschaft (Wien 1876-88, 4 Bde.); G.
Curtius, Kleine Schriften (Leipz. 1886, 2 Bde.); Delbrück,
Einleitung in das Sprachstudium (2. Aufl., das. 1884); Brugmann,
Zum heutigen Stand der Sprachwissenschaft (Straßb. 1885);
Jolly, Schulgrammatik und Sprachwissenschaft (Münch. 1874);
Benfey, Geschichte der Sprachwissenschaft und orientalischen
Philologie in Deutschland (das. 1869); Brücke, Physiologie und
Systematik der Sprachlaute (2. Aufl., Wien 1876); Sievers,
Grundzüge der Phonetik (3. Aufl., Leipz. 1885). Eine
"Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft" wird von
Techmer herausgegeben (Leipz., seit 1884).
Sprachfehler (besser Sprachstörungen) werden bedingt
durch Bildungsfehler oder Erkrankungen 1) der lautbildenden Organe
(Kehlkopf, Schlund, Mund), 2) des diesen Artikulationsorganen
zugehörenden Nervenapparats. Über S. der ersten Gruppe s.
die betreffenden Artikel. Die S. der zweiten Gruppe, die
eigentlichen S., äußern sich als solche der
Artikulation, d. h. der mechanischen Silben- und Wortbildung, und
solche der Diktion, d. h. der Fähigkeit, einen Gedanken in
richtiger Wahl und Anordnung der Wörter zum Ausdruck zu
bringen. Bei den Fehlern der Artikulation handelt es sich um
Beeinträchtigung derjenigen Muskelbewegungen, welche
nötig sind, um einen bestimmten Laut hervorzubringen; diese
Muskeln werden in Thätigkeit versetzt von dem zwölften
Gehirnnerv (nervus hypoglossus), und da die Ursprungsstellen oder
Kerne dieses Nervs im verlängerten Mark (bulbus), am Boden des
vierten Gehirnventrikels, gelegen sind, so sind es besonders
häufig Blutungen oder andre Veränderungen dieses
Gehirnteils, welche zu schweren Bewegungsstörungen der
Lippen-, Zungen- und Schlundmuskulatur (Bulbärparalyse, s. d.)
führen. Die S. der Diktion sind stets bedingt durch
Erkrankungen des Großhirns (z. B. Gehirnerweichung), und zwar
sind es besonders zwei Stellen der Großhirnrinde, deren
Zerstörung die als Aphasie benannten S. herbeiführt. Die
eine dieser Stellen (von Broca entdeckt) findet sich bei
Rechtshändern im Fuß der dritten linken Stirnwindung,
die andre (nach Wernicke) in der ersten Schläfenwindung. Ist
die erstere erkrankt, so findet sich motorische oder ataktische
Aphasie, d. h. der Kranke ist nicht im stande, die Bewegungen
seiner Sprachwerkzeuge so zu beeinflussen, daß ein ihm in
seinem Bewußtsein vorschwebender Laut ertönt. Bei
Schädigung der zweiten Stelle tritt sensorische Aphasie
(Worttaubheit Kußmauls) ein, wobei der Kranke trotz
vorhandener Intelligenz und bei intaktem Gehör den Sinn
gesprochener Worte nicht auffassen kann. Als amnestische Aphasie
bezeichnet man das Unvermögen des Kranken, für einen ihm
bekannten Gegenstand die richtige Bezeichnung zu finden; als
Paraphasie das Verwechseln ganzer Wörter oder Silben, ein
krankhaftes Sichversprechen. - Den Störungen der Sprache
entsprechen solche des Schreibens, der Aphasie die Agraphie; doch
findet sich z. B. bei sensorischer Aphasie nicht etwa auch
sensorische Agraphie, d. h. das Unvermögen, Geschriebenes zu
verstehen, woraus hervorgeht, daß die Zentren des Hörens
und Lesens an verschiedenen Stellen der Gehirnrinde ihren Sitz
haben. Da die meisten S. durch solche Gehirnveränderungen
bedingt werden, welche einen dauernden Verlust von Rindensubstanz
mit sich bringen, so sollte man annehmen, daß diese S.
unheilbar sein müßten; doch lehrt die Erfahrung,
daß teilweise oder völlige Heilung eintreten kann, wobei
namentlich methodischer Unterricht von Erfolg ist. Vgl.
Kußmaul, Störungen der Sprache (2. Aufl., Leipz.
1881).
Sprachgewölbe, Gewölbe, welche so gebaut sind,
daß alles, was an einem bestimmten Punkt ihres Innern leise
gesprochen wird, nur an einem andern Punkte desselben gehört
werden kann. Sie müssen ellipsoidisch gebaut sein, weil
Ellipsen die Eigenschaft haben, alle Schallstrahlen, welche von dem
einen ihrer beiden Brennpunkte ausgehen, nach dem andern
zurückzuwerfen und dort zu vereinigen. Die Pariser Sternwarte,
die Kuppel der Paulskirche in London, das Ohr des Dionys besitzen
oder bilden solche [korrigiert für "soche"] S. Vgl. Echo.
Sprachlehre, s. Grammatik.
Sprachreinigung, die Ausscheidung fremdartiger, im
weitern Sinn auch fehlerhafter Beimischungen (Solözismen) aus
einer Sprache und die Ersetzung derselben durch einheimische und
regelrecht gebildete Wörter und Wortverbindungen. Das hierauf
gerichtete Streben ist an sich löblich; doch muß dabei
mit Vorsicht, gründlicher Sprachkenntnis, gesundem Urteil und
geläutertem Geschmack zu Werke gegangen werden, da es leicht
in Übertreibung (Purismus) ausartet. Wörter wie Fenster,
Wein, Pforte, opfern, schreiben etc. (v. lat. fenestra, vinum,
porta, offerre, scribere) lassen nur für den Sprachforscher
den fremden Ursprung erkennen; seit frühster Zeit
eingebürgert, haben sich dieselben mit den auf deutschem
Sprachboden erwachsenen Wörtern verschwistert und gleiche
Rechte erworben (vgl. Fremdwörter). Auch werden heutzutage,
wenn neue technische und wissenschaftliche Begriffe eine
sprachliche Bezeichnung verlangen, die Ausdrücke dafür
mit Recht vornehmlich dem griechischen und lateinischen
Sprachschatz entnommen. Mit einheimischen vertauscht, sind diese
häufig unverständlich oder zu unbestimmt oder müssen
gar umschrieben werden; auch wird dadurch der Verkehr mit fremden
Nationen erschwert. Mehr als lächerlich ist es aber, wenn der
Purismus sich an solchen Wörtern vergreift, die nur scheinbar
fremden Ursprungs sind, wie z. B. von Deutschtümlern für
Nase der Ausdruck "Gesichtserker" vorgeschlagen wurde, während
Nase keineswegs von dem lateini-
183
Sprachrohr - Sprachunterricht.
schen nasus stammt, sondern ein Urwort ist, das sich in allen
indogermanischen Sprachen übereinstimmend wiederfindet
(sanskr. nas, nasa, altpers. naha, lat. nasus, altslaw. nosu etc.).
Auch die S., die in neuester Zeit von einigen Germanisten an den
durch Volksetymologie (s. Etymologie) entstandenen Wörtern
Sündflut, Friedhof u. a. versucht wurde, ist, obwohl sie auf
gründlicher Sprachkenntnis beruht, nicht zu billigen. In
diesen Fällen hat die jetzige Schreibung und Deutung dieser
Wörter längst das Bürgerrecht erlangt, wenn auch
"Sinflut" und "Freithof", wie man nach jenen Gelehrten schreiben
sollte, früher "die große Flut" und den "eingefriedigten
Hof" bedeutet haben. Ihren triftigen Grund hat dagegen die S., wenn
aus bloßer Nachlässigkeit oder Bequemlichkeit oder aus
Vorliebe für das Ausländische ohne alle Not
Fremdwörter eingeschwärzt werden. Einen solchen Kampf
hatte namentlich die deutsche Sprache zu führen seit dem
Anfang des 17. Jahrh., als der Verkehr mit den Franzosen zunahm und
der Deutsche die größere Freiheit und Gewandtheit
derselben auch durch Nachäffung ihrer Sprache sich anzueignen
suchte. Energisch trat diesem Unwesen zuerst Martin Opitz in seinem
Buch "Von der teutschen Poeterei" entgegen; weiter noch ging
Philipp v. Zesen teils mit seiner Schrift "Rosenmond", teils durch
die Stiftung der Deutschgesinnten Genossenschaft (s. d.) in
Hamburg. Ähnliche Zwecke verfolgten: die Frucht bringende
Gesellschaft zu Weimar, der Blumenorden an der Pegnitz zu
Nürnberg, der Schwanenorden an der Elbe und die Deutsche
Gesellschaft zu Leipzig. Größern Erfolg aber als diese
Verbindungen, die von abgeschmackt puristischen Bestrebungen sich
nicht frei erhielten, hatten die Bemühungen einzelner für
die Sache begeisterter Männer, namentlich Leibniz', der,
obschon er nur selten in deutscher Sprache schrieb, dennoch die
Kraft und Ausdrucksfähigkeit derselben wohl erkannte und in
seinen "Unvorgreiflichen Gedanken, betreffend die Ausübung und
Verbesserung der deutschen Sprache" (1717) und der "Ermahnung an
die Deutschen, ihren Verstand und ihre Sprache besser zu üben"
(hrsg. von Grotefend, Hannov. 1846) gerade die deutsche Sprache als
die geeignetste für die Darstellung einer wahren Philosophie
erklärte. Noch freilich fehlten Werke, die mit dem Streben
nach reiner und edler Form auch gediegenen Inhalt verbanden. Sobald
aber im 18. Jahrh. die große Blütezeit der deutschen
Litteratur anbrach, erhob sich auch die Sprache aus ihrer tiefen
Erniedrigung und gedieh durch unsre Klassiker noch vor dem Ende des
Jahrhunderts zu hoher Vollendung. Nicht ohne Verdienst waren dabei
auch die besondern, ausdrücklich auf S. gerichteten
Bemühungen J. H. Campes (s. d.) und Karl W. Kolbes (gest.
1835; "Über Wortmengerei", Berl. 1809), während Chr.
Heinr. Wolke (gest. 1825) sich wieder in übertriebenen
Purismus verirrte. In der neuesten Zeit wurde der Kampf gegen den
noch immer über Gebühr herrschenden Gebrauch von
Fremdwörtern sowohl als von sprachwidrigen Wortbildungen und
Redensarten von M. Moltke in seiner Zeitschrift "Deutscher
Sprachwart" (1856-79) und namentlich von dem 1885 begründeten
Allgemeinen Deutschen Sprachverein und der "Zeitschrift" desselben
(hrsg. von Riegel in Braunschweig) wieder aufgenommen. Vgl. Wolff,
Purismus in der deutschen Litteratur des 17. Jahrhunderts
(Straßb. 1888); H. Schultz, Die Bestrebungen der
Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts für Reinigung der
deutschen Sprache (Götting. 1888); Riegel, Der Allgemeine
Deutsche Sprachverein (Heilbr. 1885).
Sprachrohr, eine Blechröhre von der Form eines
abgekürzten Kegels, dessen kleinere Öffnung der
Sprechende vor den Mund nimmt, während er die weitere einer
entfernt stehenden Person zuwendet. Je größer das S.
ist, desto lauter und weiter vernehmbar ist das hineingesprochene
Wort. Auf Schiffen bedient man sich meist solcher von 1,25-2 m
Länge bei einer Stärke von 5 cm an dem obern und von
15-25 cm an dem untern Ende. Eine starke Mannsstimme soll sich
durch ein S. von 5,5-7,5 m Länge auf 5,5 km vernehmlich machen
lassen, mit einem 1,5 m langen aber kann man auf eine Entfernung
von höchstens 1,5-2 km verstanden werden. Erfunden ward das S.
1670 von dem Engländer Morland, welcher die ersten aus Glas,
dann aus Kupfer verfertigte. Die Theorie des Sprachrohrs
bearbeitete namentlich Lambert. Überall gleich weite Rohre
(Blei-, Zinkrohre etc.) mit Mundstück, welche zwei entfernte
Räume direkt miteinander verbinden und zur Übermittelung
von gesprochenen Worten dienen, nennt man wohl auch Sprachrohre
(Kommunikationsrohre). Durch ein 950 m langes Rohr hört man
noch leise Geräusche.
Sprachunterricht. Da die Sprachen in der Regel zu praktischen
Zwecken erlernt werden, d. h. um verstanden und gesprochen zu
werden, so bietet sich als der natürliche Weg zum Ziel die
Art, wie wir unsre Muttersprache erlernen. Man gibt also Kindern
ausländische Erzieherinnen und bringt es nicht selten dahin,
daß gut begabte Kinder sich in mehreren Sprachen
auszudrücken vermögen, allerdings meist auf Kosten ihrer
Muttersprache; da aber die Korrektheit des Ausdrucks und der Umfang
des Sprachmaterials notwendig von dem oft sehr geringen
Bildungsgrad der Bonnen abhängen, so kann von einer
Beherrschung der Sprache gar keine Rede sein. Für Erwachsene
ist ein längerer Aufenthalt im Ausland sowie die unausgesetzte
Übung im Gebrauch des fremden Idioms notwendig, wenn die
Fertigkeit, sich leicht und fließend in der fremden Sprache
auszudrücken, erreicht werden soll. "Es gehört eine gar
große Gewandtheit dazu, der Natur entgegen, die eigentlich
jeden nur an Eine Sprache, wie an Ein Vaterland gewiesen hat, sich
zweier Sprachen bis zum Schreiben und Reden zu bemächtigen,
und nur diejenigen können hierin den Mund zum Fordern weit
aufthun, die keine solcher Forderungen selbst zu erfüllen
vermögen" (Fr. A. Wolf). Leute, die als Dienstboten,
Handwerker, Handlungsdiener etc. sich in einem fremden Land
aufhalten, vermögen zwar nach einer gewissen Zeit sich im
fremden Idiom auszudrücken; da sie aber immer nur einen eng
umgrenzten Wortschatz und Ideenkreis beherrschen, so haben sie beim
Versuch, sich in einer andern geistigen Sphäre zu bewegen,
fast dieselben Schwierigkeiten zu überwinden, als sollten sie
eine neue Sprache erlernen. Ebenso sind die Deutsch-Amerikaner ein
redender Beweis dafür, daß der ausschließliche
Gebrauch eines fremden Idioms, das bedingungslose Aufgehen in das
Wesen einer fremden Nation immer den Verlust der Muttersprache zur
Folge hat. In vielsprachigen Ländern, wie Österreich,
Rußland etc., fehlt es nicht an Menschen, die fünf und
sechs Sprachen nebeneinander sprechen; aber vollständig
beherrschen sie selten auch nur eine. Bei dieser Art der
Spracherlernung kann natürlich von S. keine Rede sein; die
Erfahrung hat aber gelehrt, daß ein Aufenthalt im Ausland
erst dann wirklich fruchtbar ist, wenn die Grundlage einer guten
grammatischen Vorbildung vorhanden ist. Diese muß sogar
ausreichen für alle die, welche weder Zeit
184
Sprachunterricht (Schule und Selbststudium).
noch Mittel haben, das Ausland aufzusuchen, und denen es weniger
auf Sprachfertigkeit als auf die Befähigung ankommt, die in
der fremden Sprache geschriebenen Werke zu verstehen und vielleicht
auch einen Brief in derselben abzufassen. Diese Vorbildung erwirbt
man gewöhnlich mit Hilfe eines Lehrers unter Zugrundelegung
eines Lehrbuchs; die Methoden des Unterrichts sind entweder die
analytische oder die synthetische. Während die analytische
Methode, welche auch die natürliche, praktische oder die
induktive genannt wird, mit der mechanischen Einübung eines
Sprachstoffes beginnt und an diesem die Gesetze der Sprache zu
erkennen und zu entwickeln lehrt, geht die synthetische,
wissenschaftliche oder deduktive Methode den umgekehrten Weg, von
der Regel zum Beispiel, von dem in Form und Geltung erkannten
Einzelwort zur Bildung eines Sprachganzen. Diesen Weg haben im
allgemeinen alle gelehrten Schulen bis auf den heutigen Tag
eingeschlagen, nur daß wohl kaum noch die Synthese in ihrer
Reinheit angewendet wird; jedenfalls erfährt der
propädeutische Kursus jetzt eine vorwiegend praktische und
methodische Behandlung. Das Verdienst, diese in die Schule
eingeführt zu haben, anfangs allerdings nur für das
Französische, gebührt Seidenstücker (Rektor in
Soest, gest. 1817). Nach ihm wird mit den einfachsten Sätzen
begonnen, und an ihnen werden die Elemente der Sprache zur
Anschauung gebracht, dann allmählich und stufenweise
fortgeschritten, bis das Wichtigste aus der Grammatik sowie die
notwendigsten lexikalischen Kenntnisse vorgeführt sind und
durch unablässige Übung festgewußt werden; erst
dann schreitet man zu leichtern, zusammenhängenden
Lesestücken. Diese Methode, welche ohne besondere Berechtigung
die Ahnsche genannt wird, ist von Schifflin, Seyerlein, Barbieux,
Schmitz u. a. selbständig fortgebildet worden und hat ihre
Anwendung auf alle europäischen Sprachen gefunden; sie ist am
bekanntesten geworden durch die französischen Lehrbücher
von Plötz (s. d.), welche eine große Verbreitung
gefunden haben. Die geschickte Anordnung und leichtfaßliche
Darstellung des Sprachstoffes sowie die Betonung der Wichtigkeit
einer guten Aussprache sind ihre Hauptvorzüge, während
mit Recht über die oft überaus trivialen
Übungssätze, über den Zwang, den seine "Methodik"
auf den Gang des Unterrichts ausübt, und über den Mangel
an Wirtschaftlichkeit geklagt wird.
Die Versuche, die rein analytische Methode für den
Unterricht nutzbar zu machen, gehen alle auf die Interlinearmethode
des Franzosen Jacotot (s. d.) und des Engländers Hamilton
(s.d. 9) zurück, welche darauf beruht, daß zuerst ein
Sprachganzes vollständig eingeübt, dann in seine Teile
zerlegt und erläutert wird. Es wird also ein Abschnitt aus dem
zu Grunde gelegten Musterbuch (bei Jacotot der "Telémaque"
von Fénelon, bei Hamilton das Evangelium Johannis), welches
mit fortlaufender Interlinearübersetzung versehen ist, so
lange gelesen, übersetzt und abgefragt, bis der Schüler
es vollständig innehat. So schafft man durch unablässige
Wiederholung einen festen Besitz von Wörtern und Phrasen und
bringt mit diesem Grundstock das jedesmal hinzutretende Neue in
lebendige Verbindung. Erst spät tritt grammatische Analyse und
bei Jacotot auch Synthese hinzu. Die bessere Durcharbeitung und
Durchführung der Methode ist unbedingt Jacotot
nachzurühmen; ihre größte Schwäche bestand in
der Gefahr, das Interesse der Schüler durch die mechanische
Behandlung des Stoffes abzustumpfen und sie zu einer
Oberflächlichkeit zu erziehen, welche äußerliche
Fertigkeit und Dressur mit wirklichem Wissen und Können
verwechselt. Dennoch erwarben die unzweifelhaften Erfolge, welche
die Erfinder aufzuweisen hatten, ihrer Methode viele Freunde, und
wenn auch die Versuche andrer, nach derselben zu unterrichten (z.
B. von L. Tafel in Württemberg, L. Lewis in Österreich,
W. Blum in Leipzig), scheiterten, so haben doch einige
Lehrbücher, in denen die analytische Methode mehr ausgebildet
wurde und zwar durch stärkere Betonung der grammatischen
Synthese, große Verbreitung gefunden, z. B. die englischen
Lehrbücher von Gesenius, Fölsing u. a. Großes
Aufsehen haben die Reformvorschläge von Perthes in Karlsruhe
erregt, welche die analytische Methode auch auf den lateinischen
Unterricht (und zwar zur leichtern Erlernung der Sprache) anwenden
wollen und zuerst in der "Zeitschrift für Gymnasialwesen"
1873-75 veröffentlicht wurden. Seine Methode besteht
hauptsächlich darin, daß der Knabe von Anfang an zur
Induktion angeleitet wird, daß die Wörter und Phrasen,
die ihm entgegentreten, nicht aus ihrem natürlichen
Zusammenhang gerissen werden, daß das Neue stets nach der
sogen. gruppierenden Repetitionsmethode an das Gelernte
angeknüpft werde, und daß der Unterricht durch
Hinweisung auf abgeleitete Wörter und naheliegende oder leicht
abzuleitende Begriffe aus der unbewußten Aneignung derselben
möglichst Nutzen ziehe. Die Hauptsache sind, wie bei allen
Methodikern, seine Hilfsbücher, welche mit großem
Fleiß und Geschick gearbeitet sind und eine treffliche
Anleitung zur Präparation geben. Allein trotz der Anerkennung,
welche diese Vorschläge gefunden haben, verhält sich die
überwiegende Mehrzahl der Fachmänner ablehnend; besonders
wird das Prinzip der unbewußten Aneignung bestritten sowie
die Anwendbarkeit der Induktion auf die Erlernung der Grammatik.
Auch im Französischen sind in neuester Zeit Versuche gemacht
worden, die rein analytische Methode in den Anfangsunterricht
einzuführen. Man geht von kleinen Erzählungen aus,
übt sie mechanisch ein, lehrt daran lesen, sprechen, schreiben
und, durch Zusammenstellung des Gleichartigen, die Grammatik, doch
nur, soweit sie am Übungsstoff in die Erscheinung tritt. Diese
Methode, welche sich auf die Lehrbücher von Mangold und Coste,
von Ulbrich u. a. stützt, rühmt sich großer
Erfolge, findet aber auch starken Widerspruch und wird ihn ebenso
wie die Perthessche finden, solange an den Schulen die Erreichung
einer logisch-formalen Bildung als das Hauptziel des Unterrichts
gilt.
Wer zur Erlernung einer Sprache auf Privatunterricht oder
Selbststudium angewiesen ist, hat die Auswahl unter einer Anzahl
von Lehrbüchern, welche sich zwar alle einer ihnen
eigentümlichen Methode rühmen, aber doch samt und sonders
an die natürliche Art der Spracherlernung durch den Gebrauch
anknüpfen. Zu den verbreitetsten gehören die von
Ollendorff. In ihnen sind die Regeln auf ein geringes Maß
beschränkt, Vokabeln und Sätze dem gewöhnlichen
Leben entnommen und außer den fremdsprachlichen
Musterbeispielen nur deutsche Übungssätze gegeben,
welche, auf Einführung in die Konversation berechnet,
hauptsächlich Fragen und Antworten enthalten. Der eng
begrenzte Kreis von Wörtern und Gedanken, in denen sich diese
Sätze bewegen, bedingt eine fortwährende Wiederholung des
meist trivialen und absurden Stoffes und führt zu einer
mechanischen, geistlosen Dressur. Ebenso wie Ollendorff geht
Robertson darauf aus, den Lernenden möglichst bald zum
Sprechen zu befähigen. Diese Methode (weitergebildet von
Ölschläger und A. Boltz) nähert
185
Sprachvergleichung - Spreewald.
sich der Hamiltonschen, unterscheidet sich aber darin, daß
auf jeden Textabschnitt mit der Interlinearversion eine
möglichst ausführliche Erläuterung grammatischer,
lexikologischer und andrer Schwierigkeiten folgt, die dem
Schüler am besten vorbehalten bleibt. Eine andre viel
angepriesene Methode, das Meisterschaftssystem von Rich. S.
Rosenthal, welche in drei Monaten bei täglich
halbstündiger Arbeit eine fremde Sprache lesen, sprechen und
schreiben lehren will, kann ihr Programm nur erfüllen durch
weise Beschränkung auf die für den Reisenden und
Geschäftsmann notwendige Sprache. Von "System" ist allerdings
wenig zu merken; die Grammatik wird vollständig
zerpflückt, und in Bezug auf die Aussprache muß der
Verfasser den Schüler an einen ausländischen Lehrer
verweisen! Einen großen Teil seiner Regeln, Beispiele etc.
hat das "Meisterschaftssystem" der sogen. Konversationsmethode von
Gaspey-Otto-Sauer entnommen, deren Lehrbücher für
Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch,
Holländisch, Russisch großen Nachdruck auf
Sprechübungen legen und die oben erwähnten
Lehrbücher durch größere Einfachheit und
Zuverlässigkeit übertreffen. Das Meisterschaftssystem
unter gleichzeitiger Anwendung der Robertsonschen Methode hat F.
Booch-Árkossy in Leipzig für seine modernen Grammatiken
benutzt, die für Schul- und Selbstunterricht eingerichtet sind
und nicht nur alle neuern Sprachen, sondern auch Latein und
Griechisch lehren wollen; er "berechnet das Studium dieser letztern
auf je ein Jahr, welches bei ausschließlicher Verwendung
dieser Zeit auf den betreffenden Gegenstand hinreichen wird, dem
fleißig Studierenden die betreffende klassische Litteratur
zum selbständigen nützlichen und angenehmen Gebrauch zu
erschließen". Nützlich und empfehlenswert sind die von
Thum herausgegebenen Lehrbücher des Englischen,
Französischen etc. für den Kaufmann und Gewerbtreibenden;
sie beschränken sich auf die dem geschäftlichen Leben
angehörigen Phrasen, Vokabeln und Übungen und führen
leicht und sicher in den kaufmännischen Stil ein. Eine
ausgezeichnete Hilfe für das Selbststudium bieten die
Unterrichtsbriefe von Toussaint-Langenscheidt für
Französisch und Englisch. Diese, von vortrefflichen Kennern
der beiden Sprachen zusammengestellt, geben nicht nur Anleitung zur
richtigen Aussprache, sondern auch klar und präzis
gefaßte Regeln und einen durchaus korrekten Sprachstoff
("Atala" von Chateaubriand und "The Christmas Carol" von Dickens).
Durch die Reichhaltigkeit des Stoffes, die leichte
Verständlichkeit der Darstellung sowie die Richtigkeit des
Gebotenen übertreffen diese "Briefe" alle ähnlichen
Werke, stellen aber an den Lernenden so hohe Anforderungen,
daß er nur mit "großer Anstrengung, Ausdauer und
Einsetzung der edelsten Kräfte" sein Ziel in der angegebenen
Zeit (9 Monate) erreichen wird. Diese "Briefe" sind häufig
nachgeahmt worden. In allerneuester Zeit macht die Methode von
Berlitz aus Nordamerika viel von sich reden, welche darin besteht,
daß der Lehrer sich beim Unterricht ausschließlich des
fremden Idioms bedient und auch die Schüler zwingt, in
demselben zu antworten. Sie ist also im Grund nichts andres als die
systematisierte Form der Erlernung einer fremden Sprache im fremden
Lande durch den wirklichen Gebrauch.
Sprachvergleichung, Sprachwissenschaft, s. Sprache und
Sprachwissenschaft.
Sprangrute, s. Vogelfang.
Spratzen, die Eigenschaft einiger Metalle, im
flüssigen Zustand absorbierte Gase während der
Abkühlung zu entlassen, wobei das gewaltsam entweichende Gas
Metallteilchen mit fortreißt und zuweilen auf der
Oberfläche des Metalls blumenkohlähnliche Auswüchse
hervorbringt. So absorbiert Silber Sauerstoff, Kupfer schweflige
Säure, Stahl Kohlenoxydgas.
Spray (engl., spr. spreh), "Sprühregen" von
antiseptischer Flüssigkeit, welcher nach Listers Vorschriften
der Wundbehandlung bei Operationen über das ganze
Operationsfeld, die Hände des Chirurgen und die Instrumente
mittels Richardsonschen Doppelgebläses unterhalten werden
soll. Nachdem bakteriologische Untersuchungen die
Unschädlichkeit der Luft erwiesen haben, wird die S. kaum noch
angewandt.
Sprechmaschine, s. Sprache, S. 178.
Sprechsaal, in vielen Tages- und Wochenzeitschriften eine
Abteilung, in welcher die Redaktion Anfragen ihrer Abonnenten
beantwortet, auch Zuschriften derselben von gemeinnützigem
Interesse zum Abdruck bringt und einen schriftlichen Verkehr
zwischen den Lesern vermittelt. Vgl. Eingesandt.
Spree, der bedeutendste unter den Nebenflüssen der
Havel in der Mark Brandenburg, entspringt bei dem Vorwerk Ebersbach
in der sächsischen Oberlausitz, unweit der böhmischen
Grenze, in mehreren Quellen, von denen der Spreeborn in Spreedorf
und der Pfarrborn in Gersdorf als Hauptquellen angesehen werden und
neuerdings vom Humboldt-Verein in Zittau eingefaßt und mit
Anlagen umgeben worden sind, durchfließt die sächsische
Oberlausitz, teilt sich hinter Bautzen in zwei Arme, die bei
Hermsdorf und Weißig auf preußisches Gebiet
übertreten und bei Spreewitz wieder zusammenfließen. Die
S. fließt dann an Spremberg und Kottbus vorbei, wendet sich
unterhalb letzterer Stadt westlich, teilt sich in viele Arme und
bildet den Spreewald (s. d.). Oberhalb Lübben vereinigen sich
diese Arme wieder, woraus die S. eine nordöstliche Richtung
nimmt und sich unterhalb Lübben abermals in mehrere Arme
teilt, die sich bei Schlepzig wieder vereinigen. Sie wird bei
Leibsch für kleinere Fahrzeuge schiffbar, durchfließt
den Schwielug- und Müggelsee, bildet bei Berlin eine Insel,
auf der ein Hauptteil dieser Stadt, Kölln an der S., gebaut
ist, und mündet unterhalb Spandau links in die Havel, nachdem
sie einen Lauf von 365 km (wovon 180 schiffbar) zurückgelegt
hat. Ihre Hauptzuflüsse sind rechts: die Schwarze Schöps,
Malxe, das schiffbare Rüdersdorfer Kalkfließ und die
Panke (in Berlin); links: die Berste und die schiffbare Dahme, die
wieder mehrere schiffbare Gewässer, darunter die Notte,
aufnimmt. Das ganze Flußgebiet der S. beträgt 9470 km
(172 QM.). Durch den Friedrich Wilhelms- oder Müllroser Kanal,
neuerdings auch durch den Oder-Spreekanal (s. d.) ist sie mit der
Oder verbunden; außerdem bestehen noch bei Berlin mehrere
schiffbare Kanäle, von denen der Landwehrkanal Berlin auf der
Südseite umgeht und der Berlin-Spandauer Schiffahrtskanal (9
km lang) unterhalb Berlin die S. auf der rechten Seite
verläßt und zur Havel bei Saatwinkel führt. Um die
S. innerhalb Berlins mit großen Schiffen befahren zu
können und den Durchgangsverkehr zwischen Elbe und Oder
(Hamburg und Breslau) zu erlangen, ist eine Tieferlegung des
Flußbettes innerhalb des Weichbildes der Stadt in Aussicht
genommen, deren Kosten auf 9,5 Mill. Mk. veranschlagt sind.
Spreewald, bruchige Niederung an der Spree im
preuß. Regierungsbezirk Frankfurt, in den Kreisen Kottbus,
Kalau und Lübben, ist in seinem Hauptteil, dem obern S.,
zwischen Peitz und Lübben, 30 km lang und zwischen Neuzauche
und Lübbenau 10 km
186
Sprehe - Sprengen.
breit, während der untere S., unterhalb Lübben, 15 km
Länge und 6 km Breite hat. Von der Spree in zahlreichen
netzförmig verbundenen Armen durchflossen, ist die Niederung
oft überschwemmt. Ein Teil des sumpfigen Bodens ist durch
Kanäle entwässert und in Felder und Wiesen umgewandelt
worden, während der andre, mit Wald (größtenteils
Erlen) bestandene Teil nur auf Kähnen zugänglich ist. Der
gleiche Verkehr findet auch in den Orten Burg (Kaupergemeinde),
Lehde und Leipe statt, wo jedes Gehöft auf einer einzelnen
Insel liegt. Die Einwohner sind nur noch im östlichen Teil des
obern Spreewaldes (Burg) Wenden, sonst bereits germanisiert; sie
treiben außer Viehzucht und Fischerei besonders
Gemüsebau, dessen Produkte (Gurken von Lübbenau) weit
verfahren werden. Durch die Bemühungen des Spreewaldvereins
ist neuerdings Sorge getragen, die Schönheiten des Spreewaldes
noch mehr aufzuschließen, namentlich auch die für den
Fremdenverkehr meist unzulänglichen Wirtshäuser zu heben.
Vgl. Franz, Der S. in physikalischer und statistischer Hinsicht
(Görl. 1800); "Führer durch den S." (Lübben 1889);
Trinius, Märkische Streifzüge, Bd. 3 (Mind. 1887);
Köhler, Die Landesmelioration des Spreewaldes (Berl. 1885); v.
Schulenburg, Wendische Volkssagen aus dem S. (Leipz. 1879); Virchow
und v. Schulenburg, Der S. und der Schloßberg von Burg,
prähistorische Skizze (Berl. 1880).
Sprehe (Spreu), Vogel, s. v. w. Star.
Sprekelia formosissima, s. Amaryllis.
Spremberg, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk
Frankfurt, an der Spree und der Linie Berlin-Görlitz der
Preußischen Staatsbahn, 104 m ü. M., hat 2 evangelische
und eine neue gotische kath. Kirche, ein Realprogymnasium, eine
Webschule, ein Rettungshaus, ein Amtsgericht, eine
Reichsbanknebenstelle, sehr bedeutende Tuchfabrikation nebst
Wollspinnerei, Papp- und Möbelfabrikation, ein großes
Mühlenwerk, Braunkohlengruben und (1885) 10,999 meist evang.
Einwohner.
Spreng., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung
für Kurt Sprengel (s. d.).
Sprengarbeit, s. Sprengen.
Sprengbock, in der Baukunst, s. Bock.
Sprengel, 1) Kurt, Arzt und Botaniker, geb. 3. Aug. 1766
zu Boldekow bei Anklam, studierte seit 1784 in Halle Theologie,
später Medizin und Naturwissenschaften, ward 1789 daselbst
Professor der Medizin, 1797 auch der Botanik und starb hier 15.
März 1833. S. erweckte zu Anfang des 19. Jahrh. erneutes
Interesse für Phytotomie und lieferte mehrere Untersuchungen
über Zellen und Gefäße; größere
Verdienste erwarb er sich als Historiker der Medizin und Botanik.
Er schrieb: "Pragmatische Geschichte der Arzneikunde" (Halle
1792-1803, 5 Bde.; 3. Aufl. 1821-28; Bd. 6 von Eble, Wien 1837-40;
Bd. 1, 4. Aufl. von Rosenbaum, Leipz. 1846); "Historia rei
herbariae" (Amsterd. 1807-1808, 2 Bde.); "Geschichte der Botanik"
(Altona u. Leipz. 1817-18, 2 Bde.); "Neue Entdeckungen im ganzen
Umfang der Pflanzenkunde " (das. 1819-22, 3 Bde.). Seine "Opuscula
academica" nebst Biographie gab Rosenbaum heraus (Leipz. 1844). -
Ein Oheim Sprengels, Christian Konrad S., geb. 1750, gest. 7. April
1816 als Rektor in Spandau, entdeckte die Bestäubung der
Blüten durch Insekten und schrieb: "Das entdeckte Geheimnis
der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen" (Berl.
1793).
2) Karl, Landwirt, geb. 1787 zu Schillerslage bei Hannover,
besuchte die Thaerschen Institute in Celle und Möglin und war
seit 1808 als Ökonom in Sachsen und Schlesien thätig,
studierte 1821-24 in Göttingen Naturwissenschaften,
habilitierte sich 1830 daselbst als Privatdozent der Ökonomie
und Chemie und folgte 1831 einem Ruf als Professor der
Landwirtschaft an das Carolinum in Braunschweig, von wo er 1839 als
Generalsekretär der Ökonomischen Gesellschaft in Pommern
nach Regenwalde ging. Hier gründete er eine höhere
landwirtschaftliche Lehranstalt und eine Ackergerätfabrik und
starb 19. April 1859. S. gehört zu den Vorläufern
Liebigs, insofern er die Naturforschung in die Landwirtschaft
einführte und namentlich die Chemie auf Bodenkunde und
Düngerlehre anwandte. Er betonte bereits, daß jede
Pflanze eine bestimmte Menge nicht organischer Stoffe zu ihrer
Ausbildung bedürfe, und daß auch der Stickstoffgehalt
des Düngers und des Bodens zu berücksichtigen sei. Auch
bildete er die Boden- und Düngeranalyse aus und wollte durch
künstlichen Dünger Ersatz für die durch die Analyse
festgestellte Erschöpfung des Bodens geben. Er schrieb:
"Chemie für Landwirte" (Braunschw. 1831-32); "Bodenkunde" (2.
Aufl., Leipz. 1844); "Die Lehre vom Dünger" (2. Aufl., das.
1845) und "Die Lehre von den Urbarmachungen" (2. Aufl., das. 1846).
Seit 1840 gab er die "Allgemeine landwirtschaftliche Monatsschrift"
(Kösl. 1840-44, Berl. 1844 ff.) heraus.
Sprengen, Zertrümmerung fester Materialien, wobei es
sich um die Gewinnung der Bruchstücke (Bergbau,
Steinbruchbetrieb etc.) oder nur um Beseitigung des Materials
(Tunnel-, Straßen-, Kanalbau, Eissprengung) oder um
Verwertung der den Bruchstücken erteilten lebendigen Kraft
(Sprenggeschosse, Minen) handelt. Gesteine sprengt man zur
Gewinnung regelmäßig geformter großer
Werkstücke mittels eiserner Keile, indem man in der Richtung
der herzustellenden Spaltfläche nach unten zu gespitzte Rinnen
einarbeitet, in diese keilförmig zusammengebogene Bleche
bringt und dann eiserne Keile durch mäßige, später
kräftige Schläge eintreibt. Die alten Ägypter
arbeiteten Keillöcher in das Gestein, trieben in diese
künstlich getrocknete Pflöcke aus Weidenholz und
übergossen letztere mit heißem Wasser, unter dessen
Einwirkung das Holz sich so energisch ausdehnte, daß es die
Sprengung herbeiführte. Hierher gehört auch das S. mit
gebranntem Kalk. Man preßt aus demselben unter einem Druck
von 40,000 kg Cylinder von 65 mm Dicke, läßt an der
Peripherie jedes Cylinders eine schmiedeeiserne Röhre mit
Längsschlitz und vielen Löchern ein und schiebt diese
Vorrichtung, in einen Leinwandsack eingeschlossen, in ein Bohrloch
ein, welches mit kurzem Lehmbesatz verschlossen wird. Pumpt man nun
mittels einer Druckpumpe Wasser in das Rohr, so löscht sich
der Kalk, und unter dem Druck von 250 Atmosphären, welche die
Dampfspannung erreichen soll, erfolgt die Sprengung. Beim S. durch
Feuersetzen, welches schon die Römer kannten, wird das Gestein
nach einer Seite hin stark erhitzt, so daß eine ungleiche
Spannung in seinen Teilen entsteht, die sich bis zum
Zerreißen des Steins steigert. Durch starke
Hammerschläge, auch durch plötzliches Abkühlen wird
dies Zerreißen befördert. Viel häufiger sprengt man
gegenwärtig mit Hilfe von Explosivstoffen (Sprengstoffen).
Schieß- oder Sprengpulver wurde im Bergbau angeblich
zuerst
187
Sprengen.
1613 in Freiberg, 1632 in Klausthal zum S. benutzt. Man bohrt in
das Gestein Löcher von 2,25-3 cm Durchmesser mit dem
Meißel- oder Kronenbohrer, bei sehr hartem Gestein mit dem
Stern- oder Kreuzbohrer und hebt das Steinmehl, welches hierbei
entsteht, mittels eines kleinen Löffels an langem eisernen
Stiel (Krätzer) von Zeit zu Zeit heraus. Öfteres
Eingießen von Wasser ins Bohrloch beschleunigt die Arbeit
(Naßbohren). Die Tiefe des Bohrlochs richtet sich nach der
Dicke des abzusprengenden Steins. Man stößt in dasselbe
die Patrone hinab, führt die kupferne Räumnadel an der
einen Seite des Bohrlochs bis in die Mitte des Pulvers ein und
füllt nun das Bohrloch mit dem Besatz aus. Dieser besteht aus
Lehm und Ziegelmehl, aus Thonschiefermehl, auch aus
Schieferstücken oder Sand. Unmittelbar über die Patrone
füllt man lockern Besatz, die höhern Schichten aber
werden fest eingestampft, bis das Bohrloch gefüllt ist. Dann
zieht man die Räumnadel heraus und führt in den Kanal ein
Zündröhrchen (Raketchen, Schredel) ein, an dessen
äußerm Ende ein längerer Schwefelfaden befestigt
wird. Vorteilhafter ist die Bickfordsche Zündschnur, welche
mit dem einen Ende in der Patrone steckt und mit dem andern aus dem
Bohrloch herausragt, so daß man das gefährliche
Herausziehen der Räumnadel vermeidet. Zum Abthun des Schusses
wird der Schwefelfaden oder das freie Ende der Zündschnur
entzündet, worauf die Arbeiter fliehen u. die Explosion
abwarten. Größere Sicherheit und, wenn es sich bei
großen Sprengungen um das gleichzeitige Abthun mehrerer
Schüsse handelt, höhern Effekt erzielt man durch
elektrische Zündung, u. zwar benutzt man Zündung durch
den Funken häufiger als durch Erglühen eines dünnen
Drahts. Die Drähte, zwischen denen der Funke überspringen
soll, werden gut isoliert in die Patrone geführt und hier so
gebogen, daß ihre Enden sich gegenüberstehen. Eine bei
jeder Witterung, selbst in feuchten Gruben stets brauchbare
Elektrisiermaschine von Bornhardt zeigt Fig. 1 und 2. Die Maschine
steht in einem durch eine Glasplatte hermetisch verschlossenen
Blechkasten. Die Scheibe B besteht aus Ebonit, das Reibzeug aus
eigentümlich präpariertem Pelzwerk ohne Amalgam. Die
Saugarme A sitzen unmittelbar auf der kleinen Leidener Flasche F.
Die Achse der Scheibe B geht durch eine Stopfbüchse in der
Rückwand des Kastens hindurch und trägt außerhalb
desselben eine Kurbel. Das Reibzeug und die äußere
Belegung der Leidener Flasche stehen mit dem Blechkasten und mithin
auch mit dem Metallring b, in welchen das eine Ende der zum
Zünder führenden Drahtleitung eingehängt wird, in
leitender Verbindung. Das andre Ende der Drahtleitung wird an den
Ring a befestigt, welcher mit einem vertikalen Messinghebel, der
die Kugel k trägt, in leitender Verbindung steht, aber von dem
Blechkasten durch zwei Ebonitplatten D isoliert ist. Als
Zündung dient eine Mischung von Schwefelantimon und
chlorsaurem Kali, in welcher der Funke überspringt. Der
Zünder wird in die Patrone eingeführt, und die aus dem
Bohrloch hervorragenden Drähte verbindet man mit den
Leitungsdrähten. Sollen mehrere Bohrlöcher miteinander
verbunden werden, so schaltet man sie hintereinander in die Leitung
ein, indem man den ersten Draht des ersten Bohrlochs mit der
Hinleitung, den zweiten mit dem ersten Drahte des zweiten Bohrlochs
verbindet und so fortfährt, bis der zweite Draht des letzten
Bohrlochs mit der Rückleitung verbunden wird. In neuerer Zeit
wird statt des Pulvers meist Dynamit verwendet. Dasselbe wird in
Patronen in das Bohrloch bis zur erforderlichen Ladehöhe
eingedrückt und mit einer Zündpatrone versehen. Letztere
besteht aus einem Zündhütchen, welches man an dem einen
Ende der Zündschnur durch Einkneifen befestigt und bis zu
dieser Stelle in das Dynamit einer kleinen Patrone versenkt, deren
Papier an die Zündschnur gebunden wird. Auf diese Weise
erreicht man sicher, daß die Zündschnur zunächst
das Zündhütchen und nicht direkt das Dynamit
entzündet. Geschähe letzteres, so würde das Dynamit
abbrennen, aber nicht explodieren. Die Zündpatrone wird in das
Bohrloch eingeführt, welches nun auf halbe Länge mit
losem Besatz und dann völlig mit festem Satz gefüllt
wird. Bei Verwendung in Wasser muß man die Umhüllung des
Dynamits und die Zündschnur durch Wachs oder Talg vor
Feuchtigkeit schützen, auch wendet man vorteilhaft
Cellulosedynamit an, das durch Feuchtigkeit weniger leidet.
Stärkere Ladungen setzt man gern in
Weißblechbüchsen ein.
Die Wirkung der verschiedenen Sprengstoffe ist abhängig von
der Schnelligkeit, mit welcher sie sich zersetzen, von ihrer
Brisanz. Man kann bei Sprengungen eine Zermalmungs-, eine
Verschiebung- und eine Trennungszone unterscheiden. Je brisanter
ein Sprengungsstoff ist, um so größer werden bei
gleicher Ladungsstärke die kubischen Inhalte der beiden ersten
Zonen. Schwarzpulver erzeugt fast gar keine Zermalmungs-, eine
mittelgroße Verschiebungs-, aber
188
Sprenger - Sprengwerk.
eine verhältnismäßig große Trennungszone,
während Dynamit um so mehr zermalmt, je stärker es ist.
Die starken Dynamitsorten zerbrechen und zermalmen die
zunächst gelegenen Massen, und ihre Wirkung ist eine ziemlich
scharf begrenzte, die schwächern Dynamitsorten brechen nur in
unmittelbarer Nähe, trennen aber die Gesteine weithin. -
Sprengarbeit kommt im Bergbau, beim Bau von Tunnels, Eisenbahnen,
Straßen, Kanälen, zur Beseitigung von Felsen in
Flußläufen etc. vor. Auch aus Ackerland werden
Felsklippen durch S. fortgeschafft. Ebenso werden Bodenvertiefungen
für Baumpflanzungen und Lockerung des Ackerbodens auf Tiefen,
in die kein Ackergerät reicht, durch S. hervorgebracht
(Sprengkultur). Große Wurzelstöcke werden vorteilhaft
durch S. zerrissen. In Steinbrüchen gewinnt man das Material
durch S., auch sprengt man Stahl- und Gußeisenblöcke.
Für Kriegszwecke baut man Minen und benutzt S. in Geschossen
(Granaten, Schrapnells) und Torpedos, zum Zerstören von
Brücken, Eisenbahnen etc. Vgl. Mahler, Die Sprengtechnik (2.
Aufl., Wien 1882); Krause, Die moderne Sprengtechnik (Leipz. 1881);
Hamm, Sprengkultur (Berl. 1877); Zickler, Elektrische
Minenzündung (Braunschw. 1888).
Sprenger, Aloys, Orientalist, geb. 3. Sept. 1813 zu
Nassereit in Tirol, studierte zu Wien neben Medizin und
Naturwissenschaften besonders orientalische Sprachen, ging 1836
nach London, wo er als Hilfsarbeiter des Grafen von Münster an
dessen großem Werk über die Geschichte der
Kriegswissenschaften bei den mohammedanischen Völkern
thätig war, 1843 nach Kalkutta und ward hier 1848 zum
Vorsteher des Kollegiums in Dehli ernannt, in welcher Stellung er
viele Unterrichtsschriften aus europäischen Sprachen in das
Hindostani übertragen ließ. 1848 wurde er nach Lathnau
geschickt, um einen Katalog der dortigen königlichen
Bibliothek anzufertigen, wovon der erste Band 1854 in Kalkutta
erschien. Dieses Buch mit seinen Listen persischer Dichter, seiner
sorgfältigen Beschreibung aller Hauptwerke der persischen
Poesie und seinem wertvollen biographischen Material ist ein
treffliches Hilfsmittel für die Durchforschung des noch so
wenig angebauten Feldes neupersischer Litteratur. 1850 ward S. zum
Examinator, Dolmetsch der Regierung und Sekretär der
Asiatischen Gesellschaft in Kalkutta ernannt. Von seinen
Publikationen aus jener Zeit sind noch zu erwähnen:
"Dictionary of the Technical terms used in the sciences of the
Musulmans" (arab., Kalk. 1854); "Ibn Hajar's biographical
dictionary of persons who knew Mohammed" (arab., 1856); "Soyuti's
Itqân on the exegetic sciences of the Qoran in Arabic" (1856)
u. a. Seit 1857 wirkte S. als Professor der orientalischen Sprachen
an der Universität zu Bern, siedelte aber im Nov. 1881 nach
Heidelberg über. Seine reichhaltige Sammlung arabischer,
persischer, hindostanischer und andrer Manuskripte und Drucke hat
die königliche Bibliothek in Berlin angekauft. Sonstige Werke
von S. sind: "Otby's history of Mahmud of Ghaznah" (arab., Dehli
1847); "Masudî's meadows of gold" (Übersetzung, Lond.
1849, Bd. 1); "The Gulistân of Sady" (pers., Kalk. 1851),
eine korrekte Ausgabe des berühmten didaktischen Werkes, u.
a.; ferner in deutscher Sprache: "Das Leben und die Lehre des
Mohammed" (Berl. 1861-65, 3 Bde.); "Post- und Reiserouten des
Orients" (Leipz. 1864); "Die alte Geographie Arabiens als Grundlage
der Entwickelungsgeschichte des Semitismus" (Bern 1875) und
"Babylonien, das reichste Land in der Vorzeit und das lohnendste
Kolonisationsfeld" (Heidelb. 1886).
Sprenggelatine, s. Nitroglycerin.
Sprenggeschosse, s. Explosionsgeschosse.
Sprengglas, s. v. w. Glasglanz.
Sprenggummi, s. v. w. Sprenggelatine, s.
Nitroglycerin.
Sprengkultur, s. Sprengen, S. 188.
Sprengling, Fisch, s. Äsche.
Sprengmörser, s. v. w. Petarde.
Sprengöl, Nobelsches, s. v. w. Nitroglycerin.
Sprengpulver, s. Schießpulver, S. 453.
Sprengsel, s. v. w. Heuschrecke.
Sprengstoffe, Substanzen, welche durch Erwärmung,
Stoß oder Druck plötzlich mehr oder weniger
vollständig aus dem starren oder flüssigen in den
gasförmigen Zustand übergehen (s. Explosivstoffe) und
durch den dabei sich entwickelnden Gasdruck in der Nähe
befindliche Körper zertrümmern oder fortschleudern. Der
zuerst angewandte Sprengstoff, das Sprengpulver, besitzt im
allgemeinen die Zusammensetzung des Schießpulvers, welche nur
aus Rücksichten auf den Preis und in der Absicht, eine
stärkere Gasentwickelung zu erzielen, etwas modifiziert wurde.
Gegenwärtig ist das Sprengpulver durch neuere Präparate,
namentlich durch die nitroglycerinhaltigen, also hauptsächlich
durch die Dynamite (s. Nitroglycerin) und durch die
Schießbaumwolle (s. d.), stark zurückgedrängt
worden. Auch pikrinsäurehaltige Mischungen, Nitrocellulose und
ähnliche Substanzen spielen eine größere Rolle.
Diese neuen S., welche viel größere Brisanz besitzen als
Schießpulver und selbst, gegen die zu sprengenden Körper
gelegt und zur Explosion gebracht, ihre zerstörende Wirkung
äußern, führen im Bergbau und Tunnelbau zu
erheblichen Ersparnissen an Zeit, Bohr- und Verdämmungsarbeit,
und ihre Explosionsgase sind bei weitem weniger gesundheits- und
lebensgefährlich als die des Sprengpulvers. Bei hartem Gestein
gewähren sie eine Ersparnis an Handarbeit von 30 Proz., bei
sehr weichem Gestein und Kohle etwas weniger; die Zeitersparnis
beträgt bei Sprengungen im Trocknen ca. 30 Proz., in
wasserhaltigem Gestein aber 100 Proz. und mehr. Ebenso große
Vorteile erzielt man durch die neuen S. im Kriegswesen, wo man
Schießbaumwolle mit großem Erfolg zur Füllung von
Granaten angewandt hat. Wegen des weithin hörbaren hellen
Knalles hat man Schießbaumwolle auch im Signalwesen benutzt.
Vgl. Upmann, Das Schießpulver (Braunschw. 1874); v. Meyer,
Die Explosivkörper (das. 1874); Trauzl, Die Dynamite (Wien
1876 und Berl. 1876); Heß, Sprenggelatine (das. 1878); Rziha,
Theorie der Minen (Lemb. 1866).
Sprengweite, s. Intervall.
Sprengwerk, im Gegensatz zu Hängewerk (s. d.)
Baukonstruktion, mittels deren Balken oder Balkenlagen von mehr
oder minder bedeutender Länge durch Streben oder durch Streben
und Spannriegel von unten gestützt werden. Sprengwerke werden
zur Unterstützung von Brückenbahnen und von
Dachstühlen, seltener von Zwischendecken, verwendet und
bestehen in ihrer einfachsten Gestalt aus einem durch zwei Streben
(Fig. 1) oder aus einem durch zwei Streben und einen Spannriegel
(Fig. 2) unterstützten Balken. Bei zunehmenden Längen der
Balken werden dieselben durch je vier, je sechs und mehr Streben
ohne Spannriegel oder mit bez. je zwei, je drei und mehr der
letztern unterstützt. Bei Dachstühlen werden die
Sprengwerke meist aus mehreren in Form eines Polygons verbundenen
geraden Streben zusammengesetzt (Fig. 3), während sie bei
Brückenbauten meist fächerförmig angeordnet werden.
Wo, besonders im
189
Sprenkel - Springbrunnen.
letztern Fall, die Streben sehr lang werden und eine geringe
Neigung erhalten müssen, werden sie an einem oder mehreren
Punkten durch Zangen, welche mit den Hauptbalken verbunden sind,
versteift (Fig. 4) oder die Streben aus mehreren, meist
verdübelten Balken zusammengesetzt. Bogensprengwerke sind aus
gebogenen Balken oder aus teils wagerecht (System Emy), teils
lotrecht (System Delorme) untereinander verbundenen Bohlen
bestehende Sprengwerke, die früher teils im Hoch-, teils im
Brückenbau Anwendung fanden. Unter die bedeutendsten
hölzernen Bogensprengwerke im Hochbau gehören das nach
dem Delormeschen System gebaute Kuppeldach der Kornhalle in Paris
und der katholischen Kirche in Darmstadt sowie der nach dem
Emyschen System erbaute Dachstuhl einer Reitbahn zu Libourne bei
Bordeaux. Die bedeutendsten hölzernen Sprengwerkbrücken
sind die nach dem Emyschen System konstruierten Viadukte von
Willington und St.-Germain (Fig. 5) sowie die 1848 und 1849 von
Brown in der Eriebahn erbaute Kaskadebrücke, welch letztere
eine Schlucht von 53,34 m Weite überspannt, und deren vier
Tragrippen aus je zwei gekrümmten, durch Fachwerk verbundenen
Balkenlagen (Fig. 6) bestehen.
Sprenkel, s. Vogelfang.
Sprenzling, Fisch, s. v. w. Äsche.
Spreublätter (Paleae), trockenhäutige,
nichtgrüne Deckblätter in den Köpfchen vieler
Kompositen.
Spreuschuppen, Epidermoidalorgane an Stämmen und
Wedeln der Farne (s. d., S. 50).
Spreustein, s. Natrolith.
Sprichwörter (lat. Proverbia), kurze und
bündige, leichtfaßliche Sätze, welche eine Regel
der Klugheit oder des sittlichen Verhaltens oder eine Erfahrung des
praktischen Lebens ausdrücken und, dem Volksmund entstammend,
in die volkstümliche Redeweise übergegangen sind. Sie
bilden ein nicht unwichtiges Mittel zur Erkenntnis und Beurteilung
des Charakters eines Volkes, insofern sie dessen Anschauung und
Denkweise, Sitten und Gebräuche treu abspiegeln. S. sind bei
allen Völkern im Gebrauch, und zwar hat jedes Volk seine
eigentümlichen, obwohl manche räumlich und zeitlich weit
verbreitet sind. Auch haben fast alle zivilisierten Nationen die
Bedeutung der S. zu würdigen gewußt und Sammlungen
derselben angelegt. Schon bei den Griechen fand dies statt (s.
Parömiographen). Eine große, aber ungeordnete Menge
griechischer und lateinischer S. und ähnlicher Ausdrücke
gab Erasmus in seinem "Adagia" betitelten Buch. Sammlungen
lateinischer S. veröffentlichten Goßmann (Landau 1844),
Wiegand (Leipz. 1861), Wüstemann (2. Aufl., Nordhaus. 1864),
Georges (Leipz. 1863) u. a. Auch Sammlungen deutscher S. erschienen
seit dem 16. Jahrh. zahlreich; hervorzuheben sind die von Agricola
(zuerst 1529), Seb. Franck (1541), Eyering (1601), Zinkgref (zuerst
1626), Lehmann (1630); aus neuerer Zeit die von Körte (2.
Aufl., Leipz. 1861), Simrock (4. Aufl., Frankf. 1881), Binder
(Stuttg. 1874), Wächter (Gütersloh 1888), ferner
Sutermeister ("Schweizerische S.", Aar. 1869), Birlinger ("So
sprechen die Schwaben", Berl. 1868), Eichwald ("Niederdeutsche S."
Leipz. 1860), Frischbier ("Preußische S.", Berl. 1865) und
als umfangreichste Sammlungen: Wanders "Deutsches
Sprichwörterlexikon" (Leipz. 1863-80, 5 Bde.) und v.
Reinsberg-Düringsfelds "S. der germanischen und romanischen
Sprachen, vergleichend zusammengestellt" (das. 1872-75, 2 Bde.).
Arabische S. veröffentlichte Socin (Tübing. 1878),
niederländische Harrebomée (Utr. 1853-70, 3 Bde.),
italienische Passerini (Rom 1875), sizilische Pitrè (Palermo
1879, 3 Bde.). S. auch Rechtssprichwort. Vgl. Nopitsch, Litteratur
der S. (Nürnb. 1833); Zacher, Die deutschen
Sprichwörtersammlungen (Leipz. 1852); Duplessis, Bibliographie
parémiologique (Par. 1847); Wahl, Das Sprichwort der neuern
Sprachen (Erf. 1877); Prantl, Die Philosophie in den
Sprichwörtern (Münch. 1858); Borchardt, Die
sprichwörtlichen Redensarten im deutschen Volksmund (Leipz.
1888).
Spriet, das bei Sprietsegeln von Booten und andern
Fahrzeugen benutzte Rundholz zur Ausbringung der obern,
äußern Ecke des länglich vierkantigen Segels, wobei
das untere Ende des Spriets am untern Teil des Mastes
fährt.
Springaufblumen, s. Convallaria.
Springbock, s. Antilopen, S. 639.
Springbrunnen (Fontäne), Vorrichtung zum
Emportreiben eines oder mehrerer freier Wasserstrahlen. Leitet man
aus einem hoch gelegenen Reservoir das Wasser in einer Röhre
nach einem tiefer liegenden Ort und läßt es hier aus
einer passend angebrachten Öffnung ausströmen, so springt
ein Strahl empor, welcher nach dem Gesetz der kommunizierenden
Röhren die Höhe des Wasserspiegels im Reservoir erreichen
würde, wenn nicht durch Reibung ein Kraft-
190
Springe - Springer.
verlust entstände. Finden sich die hier künstlich
geschaffenen Bedingungen in der Natur, so entstehen die
natürlichen S., zu welchen auch die artesischen Brunnen
gehören (s. Brunnen). Die Steighöhe des Wasserstrahls
hängt bei einer guten Anordnung der Rohrleitung auch noch
hauptsächlich von der Sprungöffnung ab. Die senkrecht
emporspringenden Wasserstrahlen steigen (unter nicht sehr kleinem
Druck) aus kurzen konischen, konoidischen und innen gehörig
abgerundeten cylindrischen Ansatzröhren bei gleichem
Querschnitt und gleichem innern Druck höher als die aus
Mündungen in der sogen. dünnen Wand ausfließenden
kontrahierten Wasserstrahlen. Der Widerstand der Luft ist bei
schwächern Strahlen ein verhältnismäßig
größerer als bei dickern Strahlen. Wasserstrahlen von
kreisförmigem Querschnitt springen unter gleichen
Verhältnissen höher als solche mit quadratischem oder
anders geformtem Querschnitt. Auch das zurückfallende Wasser
hemmt den aufsteigenden Strahl; neigt man daher einen senkrechten
Strahl, so daß das zurückfallende Wasser seitlich
fortgeht. so erreicht der Strahl sofort eine größere
Höhe. Künstliche S. kann man durch Wasser- und
Windmühlen, Dampfmaschinen etc. betreiben, indem man Pumpen in
Bewegung setzt, durch welche das Wasser in hoch liegende Reservoirs
geschafft oder in Windkessel gepreßt wird, aus welchen es die
komprimierte Luft in die Höhe treibt. Zu den kleinern
künstlichen S. gehört der Heronsbrunnen, welcher aus drei
Gefäßen besteht, einem obern schüsselförmigen
und zwei verschlossenen, ferner aus drei Röhren, von denen die
eine am Boden des obern Gefäßes mündet und im
untern bis dicht an den Boden reicht, die zweite vom Deckel des
untern Gefäßes im mittlern bis fast an den Deckel reicht
und die dritte durch den Boden des obern Gefäßes fast
bis auf den Boden des mittlern hinabreicht. Nachdem das mittlere
Gefäß mit Wasser gefüllt ist, gießt man auch
in das schüsselförmige Gesäß Wasser, welches
nun in das untere Gefäß abfließt, dadurch aber die
Luft in diesem und im mittlern Gefäß
zusammendrückt, so daß aus diesem ein Wasserstrahl
emporsteigen muß.
Springe (Hallerspringe), Kreisstadt im preuß.
Regierungsbezirk Hannover, am Ursprung der Haller und an der Linie
Hannover-Altenbeken der Preußischen Staatsbahn, 113 m ü.
M., hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, eine
Oberförsterei, Teppich- und Wattefabrikation, Spinnerei,
Ziegelei und (1885) 2700 Einw. In der Nähe ein kaiserlicher
Saupark mit Jagdschloß; auf dem Ebersberg die "Deisterpforte"
mit Aussichtsturm.
Springen, eigentümliche Art der Fortbewegung des
Körpers, bei welcher der Körper vermittelst der
Wadenmuskulatur energischer vom Boden abgestoßen wird und
längere Zeit frei in der Luft schwebt als beim Laufen. Der
Körper erhält beim S. durch die kräftige
Zusammenziehung der Wadenmuskeln eine Wurfbewegung, bei welcher der
Schwerpunkt des Körpers eine parabolische Linie beschreibt,
entsprechend einem geworfenen, bez. fallenden Körper.
Gewöhnlich geht dem S. der Eillauf (Anlauf) voran, weil
dadurch der Körper schon eine gewisse Schnelligkeit der
Bewegung erhält, welche ihm dann beim S. zu statten kommt.
Ebenso werden die beim S. hauptsächlich beteiligten
Wadenmuskeln durch eine Wurfbewegung der Arme unterstützt.
Springer, 1) Robert, Schriftsteller, geb. 23. Nov. 1816
zu Berlin, widmete sich erst dem Lehrfach, privatisierte studierend
eine Reihe von Jahren in Paris, Rom, Wien und Leipzig und lebte
seit 1853 dauernd in Berlin, wo er 21. Okt. 1885 starb. Er
veröffentlichte: "Weimars klassische Stätten" (Berl.
1867); "Die klassischen Stätten von Jena und Ilmenau" (das.
1869); die Romane: "Gräfin Lichtenau" (das. 1871, 3 Bde.),
"Devrient und Hoffmann" (das. 1873, 3 Bde.), "Sidney Smith" (das.
1874, 3 Bde.), "Anna Amalia von Weimar und ihre poetische
Tafelrunde" (das. 1875, 2 Bde.) etc.; ferner: "Enkarpa.
Kulturgeschichte der Menschheit im Lichte der pythagoreischen
Lehre" (Hannov. 1884); "Essays zur Kritik und Philosophie und zur
Goethe-Litteratur" (Minden 1885); "Charakterbilder und Szenerien"
(das. 1886); auch zahlreiche beliebte Jugendschriften, letztere
meist unter dem Pseudonym A. Stein.
2) Anton, Geschichtschreiber und Kunsthistoriker, geb. 13. Juli
1825 zu Prag, widmete sich auf der Universität daselbst sowie
in München und Berlin den Studien der Philosophie und der
Kunst, ging, nachdem er 1846 kurze Zeit die Stelle eines Lehrers
der Kunstgeschichte an der Prager Akademie bekleidet, auf ein Jahr
nach Italien und ließ sich sodann in Tübingen nieder, wo
er seine erste Schrift: "Die Hegelsche Geschichtsanschauung",
erscheinen ließ. Das Jahr 1848 rief ihn nach Prag
zurück. S. trat hier für die föderative Verfassung
des Kaiserstaats ein und galt als ein Wortführer der Rechte
des Reichstags in der Presse. Im Herbste d. J. habilitierte er sich
zu Prag für neuere Geschichte; doch zogen ihm seine
freisinnigen Vorlesungen, welche sodann als "Geschichte des
Revolutionszeitalters" (Prag 1849) im Druck erschienen, die Ungunst
der Regierung zu, so daß er seine Lehrthätigkeit aufgab
und eine Reise zu kunsthistorischen Studien durch die Niederlande,
Frankreich und England unternahm. Von London aus durch seine
politischen Freunde zurückgerufen, trat er an die Spitze der
Zeitung "Union", die aber, weil er darin die Rechte Preußens
auf die Führerrolle in Deutschland vertrat, 1850
unterdrückt wurde. Während des orientalischen Kriegs
1854-56 arbeitete S. zahlreiche Druckschriften im Auftrag der
serbischen Regierung aus, in welchen er für die Emanzipation
der türkischen Vasallenstaaten, aber gegen das russische
Protektorat plaidierte. Dieselben politischen Grundsätze
führten ihn im letzten russisch-türkischen Krieg wiederum
auf den publizistischen Kampfplatz und veranlaßten ihn zu
zahlreichen Aufsätzen in "Im neuen Reich" gegen die russische
Politik. Im Herbst 1852 habilitierte er sich in Bonn als
Privatdozent der Kunstgeschichte, und 1859 ward er zum Professor
derselben ernannt. Bei der Gründung der Universität
Straßburg 1872 wurde er als Professor für neuere
Kunstgeschichte berufen; seit 1873 gehört er der
Universität Leipzig an. Von seinen historisch-politischen
Schriften sind noch hervorzuheben: "Österreich nach der
Revolution" (Prag 1850); "Österreich, Preußen und
Deutschland" (das. 1851) und "Südslawische Denkschrift" (das.
1854); "Paris im 13. Jahrhundert" (Leipz 1856); " Geschichte
Österreichs seit dem Wiener Frieden" (das. 1863-64, 2 Bde.);
"Friedr. Christoph Dahlmann", Biographie (das. 1870-72, 2 Bde.);
"Protokolle des Verfassungsausschusses im österreichischen
Reichstag 1848-49" (das. 1885). Springers Kunstanschauung,
wenngleich zunächst durch die Hegelsche Philosophie
vermittelt, hat sich von dem beschränkenden Einfluß
dieser Schule loszumachen gewußt. Sein Hauptstudium hat er
den Schöpfungen des Mittelalters und der neuern und neuesten
Zeit, besonders der Periode der klassischen italienischen Kunst,
zugewendet. Seine vorzüglichsten kunstgeschichtlichen Werke
sind: "Kunsthistorische Briefe"
191
Springerle - Springschwänze.
(Prag 1852-57); "Handbuch der Kunstgeschichte" (Stuttg. 1855);
"Geschichte der bildenden Künste im 19. Jahrhundert" (Leipz.
1858); "Bilder aus der neuern Kunstgeschichte" (Bonn 1867; 2.
Aufl., das. 1887, 2 Bde.); "Raffael u. Michelangelo " (Leipz. 1877;
2. Aufl. 1883, die beste Biographie der beiden Meister);
"Grundzüge der Kunstgeschichte" (das. 1887-88). Auch hat S.
die deutsche Ausgabe von Crowes und Cavalcaselles "Geschichte der
altniederländischen Malerei" (Leipz. 1875) bearbeitet.
Springerle, ein in Süddeutschland und der Schweiz
sehr beliebtes Backwerk, eine Art Anisbrot.
Springfield (spr. -fild), 1) Hauptstadt des nordamerikan.
Staats Illinois, liegt südlich vom Sangamonfluß an der
Grenze der Prärien, hat ein Kapitol (Staatenhaus), einen
Gerichtshof, ein Zeughaus, ein Zollamt, eine sogen. Hochschule,
Uhren- und andre Fabriken, Eisenbahnwerkstätten und (1880)
19,743 Einw. Auf dem Ridge Cemetery das Grabmal des
Präsidenten Lincoln. -
2) Hauptstadt der Grafschaft Hampden im nordamerikan. Staat
Massachusetts, am Connecticut, hat ein großartiges Zeughaus
mit Waffenfabrik (Vorrat von Gewehren etc. für 175,000 Mann),
eine Bibliothek von 30,000 Bänden, Baumwoll-, Woll-,
Papierkragen-, Waffen- u. Eisenbahnwagenfabriken, Goldschmiederei
und (1885) 37,577 Einw. S. ist Knotenpunkt zahlreicher Eisenbahnen;
es wurde 1635 gegründet. -
3) Stadt im nordamerikan. Staat Missouri, Grafschaft Greene, 320
km südwestlich von St. Louis, hat Tabaksfabriken, Bau
landwirtschaftlicher Geräte etc. und (1880) 6522 Einw. -
4) Hauptstadt der Grafschaft Clarke im nordamerikan. Staat Ohio,
am Mad River, 64 km westlich von Columbus, Sitz des lutherischen
Wittenberg College, ist berühmt wegen seiner Turbinen und
landwirtschaftlichen Maschinen und hat (1880) 20,720 Einw.
Springflut, s. Ebbe und Flut.
Springfrüchte, alle trocknen oder saftigen
Früchte, deren Wandung bei der Reife in irgend welcher Weise
sich öffnet und die Samen frei werden läßt, wie
Balgfrucht, Hülse, Schote, Kapsel oder auch die Frucht der
Roßkastanie, deren saftiges, mit Stacheln versehenes Perikarp
sich klappig öffnet.
Springgurke, s. v. w. Momordica.
Springhase, s. v. w. Springmaus.
Springinklee, Hans, deutscher Maler und Zeichner für
den Holzschnitt, arbeitete in der Werkstatt und unter dem
Einfluß Dürers und fertigte unter andern 50 Zeichnungen
zu den Holzschnitten in einem Nürnberger Gebetbuch: "Hortulus
animae" (1518).
Springkäfer, s. v. w. Schnellkäfer.
Springkasten, s. Tisch.
Springkörner, s. Euphorbia.
Springkraut, s. Impatiens; kleines S., s. Euphorbia.
Springkürbis, s. Momordica.
Springläuse, s. Blattflöhe.
Springmaus (Dipus Schreb.), Gattung aus der Ordnung der
Nagetiere und der Familie der Springmäuse (Dipodina), kleine
Tiere mit gedrungenem Leib, sehr kurzem Hals, hasenähnlichem
Kopf, großen, häutigen Ohrmuscheln, großen Augen,
sehr langen Schnurrhaaren, sehr langem Schwanz, stark
verkürzten Vorderfüßen (welche beim Springen
größtenteils im Pelz versteckt werden, daher der Name
Zweifuß, Dipus) mit vier Zehen und wohl sechsfach
längern Hinterfüßen mit drei Zehen, die mit steifem
Borstenhaar bedeckt sind, und deren Krallen rechtwinkelig zum
Nagelglied stehen. Die Sohle ist mit elastischen Springballen
versehen. Die Wüstenspringmaus (Djerboa, D. aegyptius Hempr.
et Ehbg., s. Tafel "Nagetiere I"), 17 cm lang, mit 21 cm langem
Schwanz, oben grausandfarben, schwarz gesprenkelt, unterseits
weiß, mit breitem, weißem Schenkelstreifen, oben
blaßgelbem, unten weißlichem Schwanz mit weißer,
pfeilartig schwarz gezeichneter Quaste, bewohnt Nordostafrika bis
Mittelnubien und das westliche Asien und findet sich in den
ödesten Steppen und in Sandwüsten, zuweilen in
größern Gesellschaften. Sie gräbt vielverzweigte,
flache Gänge im Boden, um bei der geringsten Gefahr in diese
Zufluchtsstätten zu flüchten. In der Ruhe steht sie oft
aufrecht wie ein Känguruh, im Lauf macht sie weite
Sprünge und entwickelt eine außerordentliche
Geschwindigkeit. Sie nährt sich hauptsächlich von Knollen
und Wurzeln, frißt aber auch Blätter, Früchte und
Kerbtiere. Gegen Hitze ist sie sehr unempfindlich, doch erscheint
sie als echtes Nachttier und verfällt bei Kälte und
Nässe in eine Art Erstarrung. Sie soll in ihrem Bau 2-4 Junge
werfen. In der Gefangenschaft zeigt sie sich sehr harmlos und
zutraulich. Die Araber essen das Fleisch der S. und benutzen das
Fell zu kleinen Pelzen für Kinder und Frauen, zu Besatz etc.
Die Alten erwähnen die S. häufig, auch finden sich
bildliche Darstellungen auf Münzen und Tempelverzierungen.
Jesaias verbot, das Fleisch der S. zu genießen (Jes. 66,
17).
Springprozession, s. Echternach.
Springraupe, s. Zünsler.
Spring-Rice (spr. -reiß), Thomas, Baron Monteagle
von Brandon, brit. Staatsmann, geb. 8. Febr. 1790 in Irland,
studierte zu Cambridge und saß seit 1816 als Mitglied der
Whigpartei im Unterhaus. Als diese 1830 unter Grey ans Staatsruder
kam, ward er Unterstaatssekretär des Innern, dann
Sekretär des Schatzes und gelangte nach Stanleys
Rücktritt 1834 als Staatssekretär der Kolonien ins
Ministerium, welches jedoch schon im November zurücktreten
mußte. Bei der Bildung des neuen Whigministeriums 1835
übernahm S. die Finanzverwaltung, bewies sich aber nicht
befähigt für dieselbe. Als er im August 1839 aus dieser
Stellung schied, erhielt er die Peerswürde mit dem Titel eines
Lord Monteagle und das Amt eines Kontrolleurs der Schatzkammer. Er
starb 7. Febr. 1866; in der Peerswürde folgte ihm sein Enkel
Thomas S., geb. 31. Mai 1849.
Springschwänze (Poduren, Poduridae Burm.),
Insektenfamilie aus der Ordnung der Thysanuren, kleine, meist
langgestreckte Tiere mit behaarter oder beschuppter
Oberfläche, meist wagerecht gestelltem Kopf, derben, vier- bis
sechsgliederigen Fühlern, jederseits 4-8 (selten bis 20)
einfachen Augen, verborgenen Mundteilen, derben Beinen mit
zweilappigen, in eine gespaltene Klaue endenden Tarsen und an der
Spitze des Hinterleibs mit langer, unter den Bauch geschlagener
Springgabel, mittels welcher sie sich weit fortschnellen. Sie leben
am Boden unter faulenden Vegetabilien, bedürfen großer
Feuchtigkeit, erscheinen oft im Winter massenhaft auf dem Schnee,
sind sehr fruchtbar, entwickeln sich aber langsam. Der
Gletscherfloh (Desoria glacialis Nic.), 2 mm lang, schwarz, dicht
behaart, findet sich häufig auf den Alpengletschern und kann
bei -11° einfrieren, ohne Schaden zu leiden. Auf Schnee
erscheint auch häufig die gelblichgraue, schwarz gestreifte
Degeeria nivalis L.; auf stehenden Gewässern findet sich in
zahlloser Menge der Wasserfloh (Podura aquatica de Geer), welcher 2
mm lang, schwarzblau, an Fühlern und Beinen rot ist. Der
zottige Springschwanz (Podura villosa L.), 3,37 mm lang, gelbrot
mit schwarzen Binden, lebt wie der gleichgroße
192
Springwurm - Spruner.
bleigraue Springschwanz (P. plumbea L.) im Gebüsch unter
abgefallenem Laub.
Springwurm, s. Madenwurm.
Springzeit, Flutzeit, s. Ebbe und Flut.
Sprinz, s. Sperber.
Sprit, s. v. w. gereinigter Spiritus; auch s. v. w.
Essigsprit (s. Essig, S. 860).
Spritzflasche, chemischer Apparat zum Auswaschen von
Niederschlägen etc., besteht aus einer etwa zur Hälfte
mit Wasser gefüllten Flasche mit durchbohrtem Kork, in welchem
ein kurzes, zu einer Spitze ausgezogenes Glasrohr steckt.
Bläst man durch dieses Rohr, um die Luft in der Flasche zu
verdichten, so schießt aus der mit der Mündung nach
unten gekehrten Flasche ein Wasserstrahl hervor. Bequemer steckt
man in den zweimal durchbohrten Kork ein bis auf den Boden der
Flasche reichendes Rohr, das im spitzen Winkel umgebogen ist und am
abwärts gerichteten Schenkel in eine Spitze ausläuft, und
außerdem ein stumpfwinkelig gebogenes Blasrohr, welches dicht
unter dem Kork endet.
Spritzgurke, s. v. w. Momordica Elaterium.
Spritzloch, bei den Walen und den meisten Haifischen eine
oder zwei Öffnungen am Kopf zum Ausstoßen von Luft oder
Wasser. Bei den Haifischen liegt ein Paar Spritzlöcher hinter
den Augen, entspricht einem Paar Kiemen und spritzt Wasser aus, bei
den Walen ist das S. enger, geht aus der Verschmelzung der
Nasenlöcher hervor und entläßt den Atem, dessen
Feuchtigkeit in der kalten Luft sich zu einer hohen Säule von
Wasserdampf verdichtet und so den Anschein hervorruft, als
würde Wasser ausgespritzt.
Sprocke (Sprockwürmer), s. Köcherjungfern.
Sprödglaserz (Stephanit, Schwarzgüldigerz,
Melanglanz), Mineral aus der Ordnung der Sulfosalze, kristallisiert
in rhombischen, dick tafelartigen oder kurz
säulenförmigen Kristallen, findet sich auch eingesprengt,
in derben Massen und als Anflug, ist eisenschwarz bis bleigrau,
selten bunt angelaufen, Härte 2-2,5, spez. Gew. 6,2-6,3, und
besteht aus Antimon, Silber und Schwefel 5Ag2 + Sb2S3 mit 68,36
Silber und 15,44 Antimon. Das auf Gängen der kristallinischen
Schiefer, der ältesten Sedimentformationen und trachytischer
Gesteine brechende Mineral kommt besonders im Erzgebirge, am Harz,
in Böhmen, Ungarn, Mexiko sowie auf dem Comstockgang in Nevada
vor und ist ein sehr reiches Silbererz. Vgl. Eugenglanz.
Sprödigkeit, Eigenschaft harter Körper,
vermöge welcher sie leicht durch einen Stoß oder durch
eine geringe Verletzung ihrer Oberfläche in mehr oder weniger
zahlreiche Stücke zerspringen, wie z. B. Glas. Vgl.
Kohäsion.
Sproß, in der Botanik der ganze Einer Achse
angehörige Pflanzenteil, also insbesondere jeder Zweig, der
aus einer Achse niedern Grades entspringt, samt allen seinen
seitlichen Organen.
Sprossen, die Enden am Hirschgeweih unterhalb der Krone
(Augen-, Eis-, Mittelsprosse).
Sprossentanne, s. Tsuga.
Sprosser, s. Nachtigall.
Sprossung, s. Knospe und Proliferierend; hefeartige
Sprossung, s. Pilze, S. 65.
Sprottau, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk
Liegnitz, an der Mündung der Sprotte in den Bober und der
Linie Lissa-Hansdorf der Preußischen Staatsbahn, 132 m
ü. M., hat eine evangelische und eine kath. Kirche, ein
stattliches Rathaus, ein öffentliches Schlachthaus, ein
Realgymnasium, ein Amtsgericht, Fabrikation von Tabak und Zigarren,
Brückenwagen, Zündwaren, Teppichen und künstlichen
Blumen, Strumpfwirkerei, Bierbrauerei, Ziegelbrennerei, große
Mühlwerke, bedeutende Stadtforst und (1885) mit der Garnison
(eine Abteilung Feldartillerie Nr. 5) 7552 meist evang. Einwohner.
In der Nähe die Eisenhütte und Maschinenbauanstalt
Wilhelmshütte. S. erhielt 1289 deutsches Stadtrecht.
Sprotte (Breitling, Clupea sprattus L.), Fischart aus der
Gattung Hering, 10-13 cm lang, dem gemeinen Hering ähnlich,
mit gekieltem, deutlich gezähneltem Bauch, auf dem Rücken
dunkelblau mit grünem Schimmer, sonst silberweiß, mit
dunkler Rücken- und Schwanzflosse und weißer Brust-,
Bauch- und Afterflosse, findet sich in der Nord- und Ostsee,
nördlich bis Island gewöhnlich in bedeutender Tiefe,
laicht im Mai und Oktober und wird an der Küste Englands,
Frankreichs und in der Ostsee im Juni bis September und im November
bis Frühling in großer Zahl mit feinmaschigen Netzen
gefangen und zusammen mit den sehr zahlreichen jungen Heringen, die
ebenfalls in das Netz geraten waren, auf den Markt gebracht.
Geschätzt sind in Deutschland besonders die geräucherten
Kieler Sprotten. In Hamburg wird auch der Stint zu "Kieler
Sprotten" verarbeitet. In Norwegen macht man die S. ein und bringt
sie als Anschovis in den Handel, wie sich auch den Sardellen u.
Sardinen viele Sprotten beimischen. Mit Gewürzen zubereitet
ist die S. als russische Sardine im Handel.
Spruchband, s. Banderole.
Sprüche Salomos (lat. Proverbia), Titel einer
Gnomensammlung des Alten Testaments, welche aus mehreren, durch
besondere Überschriften bezeichneten Hauptteilen und einigen
Anhängen besteht. Der erste Teil (Kap. l-9) enthält eine
zusammenhängende Empfehlung der Weisheit in Form der Rede
eines Vaters an seinen Sohn; dann folgen unter dem Titel:
"Denksprüche Salomos" (10, 1) einzelne aneinander gereihte
Sentenzen. Eine dieser Sammlungen (Kap. 25-29) soll nach ihrer
Aufschrift unter Hiskias' Regierung durch Gelehrte des Hofs
veranstaltet worden sein. Somit erscheint Salomo (s. d.) bloß
als Kollektivname zur Charakterisierung dieser ganzen Art von
Lehrdichtung. Kommentiert wurden die S. zuletzt von Hitzig
(Zürich 1858), Zöckler (Bielef. 1867), Ewald
(Götting. 1867), Delitzsch (Leipz. 1873), Nowack (das.
1883).
Spruchliste, s. Schwurgericht, S. 781.
Sprüchwörter, s. Sprichwörter.
Sprudelstein, Absatz oder Niederschlag aus brodelnden
Quellen, z. B. der Aragonitabsatz, den die Karlsbader Quelle
liefert, und als besondere Abart der Pisolith oder Erbsenstein,
zusammengebackene konzentrisch-schalige Kugeln, durch Umrindung
fremdartiger Gesteinsbrocken entstanden. Gegen einen Vergleich des
Erbsensteins mit den Oolithen der frühern geologischen
Perioden spricht das Vorkommen dieser Oolithe: sie sind mitunter in
mächtigen Schichten über große Strecken
gleichmäßig verbreitet und stellen mithin keine
Quellabsätze, die sich doch nur lokal hätten entwickeln
können, dar. Den S. verarbeitet man auf allerlei kleine
Gebrauchs- und Schmuckgegenstände, auch läßt man
Objekte (Blumen, Holzschnitzereien etc.) durch längeres
Einhängen in die Quellen mit S. überziehen.
Spruner, Karl S. von Mertz, Geschichtsforscher und
Kartograph, geb. 15. Nov. 1803 zu Stuttgart, ward, seit 1814 im
Kadettenkorps zu München gebildet, 1825 Leutnant, 1851
Hauptmann im Generalstab, 1855 Oberstleutnant und Lehrer der
Militärgeographie im Kadettenkorps, 1869 endlich
Generaleutnant. Daneben hatte ihn König Maximilian II. zu
193
Sprung - Spurgeon.
seinem Flügeladjutanten, König Ludwig II. 1864 zu
seinem Generaladjutanten ernannt. Im Sommer 1886 trat S. in den
Ruhestand. Er schrieb: "Bayerns Gaue" (Bamb. 1831) und gab eine
"Gaukarte des Herzogtums Ostfranken" (das. 1835) heraus. Sein
Hauptwerk ist der große auf Grund der sorgfältigsten
Detailforschung sehr sauber ausgeführte
"Historisch-geographische Handatlas" (Gotha 1853-64) in 3
Abteilungen: "Atlas antiquus" (3. Aufl. bearbeitet von Menke, 31
Bl., 1862-64), "Handatlas für die Geschichte des Mittelalters
und der neuern Zeit" (neubearbeitet von Menke, 90 Bl., 3. Aufl.
1879) und "Zur Geschichte Asiens, Afrikas etc." (18 Bl., 2. Aufl.
1855). Außerdem veröffentlichte S. einen trefflichen
"Historischen Atlas von Bayern" (Gotha 1838, 7 Bl.), einen
"Historisch-geographischen Schulatlas" (23 Bl., das. 1856, 5. Aufl.
1870), desgleichen historisch-geographische Schulatlanten von
Österreich (13 Bl., das. 1860) und von Deutschland (12 Bl., 2.
Aufl., das. 1866), den "Historico-geographical handatlas" (26 Bl.,
Gotha 1860) u. a. Historische Schriften von S. sind: "Leitfaden zur
Geschichte von Bayern" (2. Aufl., Bamb. 1853), " Pfalzgraf Rupert
der Kavalier" (Münch. 1854) und "Die Wandbilder des bayrischen
Nationalmuseums" (das. 1858), später unter dem Titel:
"Charakterbilder aus der bayrischen Geschichte" (das. 1878) neu
herausgegeben. Endlich hat S. auch mehrere historische Schauspiele
sowie die Schriften: "Jamben eines greisen Ghibellinen" (Bonn 1876)
u. "Aus der Mappe des greisen Ghibellinen" (Münch. 1882)
verfaßt.
Sprung (lat. Saltus), in der Logik und zwar im Beweis das
Auslassen von Mittelsätzen, die nicht fehlen dürfen, wenn
der Schlußsatz bewiesen, in der Metaphysik und
Naturphilosophie das Auslassen von Mittelstufen, die nicht
übergangen werden dürfen, wenn das Ziel der Entwickelung
erreicht werden soll. Ersteres, die Stetigkeit der
Beweisführung, wird durch den Satz, daß die Folge nur
aus der Gesamtheit der Gründe, letzteres, die Stetigkeit der
Entwickelung, durch den Satz, daß die Wirkung nur aus der
Gesamtheit der Ursachen entspringe, die Anwendung des letztern auf
die Natur insbesondere durch den Kanon ausgedrückt, daß
es in dieser keinen S. gebe (in natura non datur saltus).
Sprung, in der Jägersprache mehrere
beisammenstehende Rehe.
Sprungbein, s. Fuß, S. 800.
Sprungzügel, s. Zaum.
Spule, eine hölzerne Walze zum Aufwickeln von Garn,
Draht etc.
Spülkanne, s. v. w. Irrigator (s. d.).
Spuller (spr. spüllähr), Eugène, franz.
Politiker, geb. 8. Dez. 1835 zu Seurre (Côte d'Or) von aus
Baden eingewanderten Eltern, studierte die Rechte, ließ sich
1859 in Paris als Advokat einschreiben, widmete sich aber seit 1863
ganz der demokratischen Journalistik, trat in enge
Freundschaftsbeziehungen zu Gambetta, dessen Sekretär er
während seiner Diktatur 1870-71 war, ward 1872 Redakteur der
"République française" und 1876 Mitglied der
Deputiertenkammer. Er gehörte in dieser zum Republikanischen
Verein und unterstützte Gambettas Politik mit hingebendem
Eifer. Als dieser im November 1881 Ministerpräsident wurde,
ernannte er S. zum Unterstaatssekretär des Auswärtigen,
was er aber bloß bis zum Januar 1882 blieb. 1884 wurde er zum
Vizepräsidenten der Deputiertenkammer erwählt und war vom
Mai bis Dezember 1887 im Ministerium Rouvier Unterrichtsminister.
Im März 1889 ward er Minister des Äußern.
Spulmaschine, Vorrichtung zum Aufwickeln von Fäden
auf Spulen.
Spulrad, eine einem Spinnrad ähnliche Vorrichtung
zum Bewickeln einer Garnspule.
Spulwurm (Ascaris L.), Gattung aus der Klasse der
Nematoden (Fadenwürmer) und der Familie der Askariden (s. d.),
derbhäutige Eingeweidewürmer von mäßiger Dicke
und ansehnlicher Länge, mit stark entwickelten, hohen und
breiten Lippen, welche einen mehr oder minder kugeligen Kopfzapfen
zusammensetzen und bei den größern Arten am Rand
gezähnelt sind. Sie legen meist hartschalige Eier, welche nach
längerm Aufenthalt in feuchter Umgebung einen Embryo
entwickeln, der vielleicht überall zunächst in einen
Zwischenwirt gelangt und seine ganze Metamorphose in der Regel erst
in dem definitiven Wirt durchläuft. Die zahlreichen Arten
bewohnen mit wenigen Ausnahmen den Darm von Wirbeltieren, besonders
Warmblütern. Der gemeine S. (A. lumbricoides L., s. Tafel
"Würmer"; das Männchen etwa 40 cm lang und reichlich 5 mm
dick, das Weibchen bedeutend kleiner), meist gelblichbraun oder
rötlich, verbreitet einen unangenehmen Geruch, bewohnt den
Dünndarm des Menschen, besonders der Kinder, bisweilen in so
beträchtlicher Menge, daß er denselben fast unwegsam
macht, findet sich auch im Rind und Schwein und scheint über
die ganze Erde verbreitet zu sein. Er produziert im Jahr etwa 60
Mill. Eier, die beständig mit dem Kot abgehen, sehr lange auch
in Frost und Trockenheit ihre Keimkraft behalten und sich in Wasser
oder feuchter Erde langsam entwickeln. Ob die Embryonen beim
Genuß von abgefallenem Obst, rohen ungereinigten Rüben,
Bachwasser etc. direkt in den Menschen oder zunächst in einen
Zwischenwirt gelangen, ist noch nicht ermittelt. Sie verursachen
mancherlei Störungen und nicht selten schwerere Leiden. Der
Katzenspulwurm (A. mystax Fab.) schmarotzt auch im Hund und
gelegentlich im Menschen, der großköpfige S. (A.
megalocephala Cloquet), bis 37 cm lang, im Darm des Pferdes und des
Esels und erzeugt oft bösartige Verstopfungen, Katarrh der
Darmschleimhaut etc.
Spur, im Hüttenwesen die Öffnung in der Vorwand
von Schachtöfen, durch welche die geschmolzenen Massen aus dem
Schmelzraum in einen Sammelraum vor dem Ofen fließen; daher
Spuröfen, Öfen mit einer solchen Öffnung. Spuren
nennt man beim Kupferhüttenprozeß die Anreicherung des
Kupfers in den Kupferlechen (Kupfersteine) durch Rösten u.
reduzierend-solvierendes Schmelzen, wobei Spurstein
(Konzentrations-, Anreich-, Dublier-, Mittelstein) entsteht (s.
Kupfer, S. 319). Über den Ausdruck S. in der Jägersprache
s. Fährte.
Spur (Spurweite), s. Eisenbahnbau, S. 450.
Spüren, in der Jägersprache s. v. w.
Abspüren.
Spurensteine, die natürlichen äußern
Abgüsse pflanzlicher oder tierischer Organismen, besonders
aber die Fährten vorweltlicher Tiere.
Spurgeon (spr. spörrdsch'n), Charles Haddon, engl.
Kanzelredner, geb. 19. Juni 1834 zu Kelvedon in Essex, war
zunächst Hilfslehrer an einer Schule zu Newmarket und
schloß sich, von Bunyans Pilgerreise beeinflußt, 1850
der baptistischen Gemeinde in Cambridge an, deren Lehren er bald
als Landprediger zu Teversham vertrat; seine große Jugend
verschaffte ihm hier den Beinamen "the boy preacher". Kaum 17 Jahre
alt, wurde er Prediger einer kleinen Baptistenkapelle zu Waterbeach
und erreichte als solcher Erfolge, wie sie an Wesley und Whitefield
erinnerten. Seit 1853 an der Baptistenkapelle in der New
194
Spurinna - Srászy.
Parkstreet zu London, predigte er unter solchem Zudrang,
daß sehr bald eine Vergrößerung des Gebäudes
nötig wurde. Doch auch das neue Gebäude genügte auf
die Dauer nicht, denn bald war S. die merkwürdigste
Charakterfigur des so überreich verzweigten kirchlichen Lebens
der englischen Metropole und ihr populärster Kanzelredner, zu
welchem Vertreter aller Stände und Bekenntnisse wallfahrteten.
So veranlaßten seine Verehrer 1856 eine öffentliche
Subskription zum Bau einer mächtigen Halle, welche, in
Newington Butts gelegen und zu den Sehenswürdigkeiten Londons
gehörend, 1861 unter dem Namen "Spurgeon's Tabernacle"
eröffnet wurde und 4400 Zuhörern Raum darbietet. Von
seinen Predigten erschienen viele Hunderte im Druck, zahlreiche
auch in deutschen Übersetzungen (gesammelt in 5 Bänden,
Hamb. 1860-73); zuletzt noch seine "Lectures to my students" (Lond.
1875; deutsch, Hamb. 1878-80, 2 Bde.). Vgl. Pike, Ch. H. S.
(deutsch, Hagen 1887).
Spurinna, 1) Vestricius, röm. Feldherr und Dichter
in der ersten Hälfte des 1. Jahrh. n. Chr., focht siegreich
gegen die Germanen am Rhein, zog sich aber später vom
öffentlichen Leben zurück. Die angeblichen Fragmente
seiner lyrischen Poesien, deren Anmut die Alten rühmten, sind
ein modernes Fabrikat des Polyhistors Kasp. Barth (abgedruckt in
Rieses "Anthologia latina", Bd. 2, Leipz. 1870, und Bährens'
"Poetae latini minores", Bd. 5, das. 1883).
2) Haruspex und Wahrsager, welcher Cäsar vor dem
verhängnisvollen 15. März warnte.
Spurius (lat., "unecht"), s. v. w. Bastard.
Spurstein, s. Spur.
Spurstränge (Blattspuren), in der Pflanzenanatomie
die untern, im Stengel befindlichen Endigungen der in die
Blätter ausbiegenden Gefäßbündel.
Spurweite, s. Eisenbahnbau, S. 450.
Spurzapfen (Grundzapfen), Zapfen, bei denen der
größte vorkommende Druck in der Richtung der Achse des
Zapfens wirkt und von der Grundfläche des Zapfens aufgenommen
wird. Vgl. Zapfen.
Sputum (lat.), der Auswurf.
Spuz (spr. spuhsch), Städtchen in Montenegro, an der
Zeta, mit Citadelle und ca. 1000 Einw.; lange Schauplatz von
Kämpfen mit den Türken, kam durch den Berliner Frieden
1878 an Montenegro.
Squalidae, Haifische.
Squalius, Elten (Fisch).
Squamae (lat.), Schuppen (s. d. und Fruchtschuppen);
squamös, schuppig.
Squarcione (spr. skwartschohne), Francesco, ital. Maler,
geb. 1394 zu Padua, gest. 1474 daselbst, Haupt der paduanischen
Malerschule und vornehmlich als Lehrer Mantegnas bekannt. Von
seinen Werken ist nur eine Madonna mit dem Kind (im Besitz der
Familie Lazzara zu Padua) durch seine Namensinschrift
beglaubigt.
Square (engl., spr. skwehr), Quadrat, daher S. mile,
Quadratmeile; auch ein viereckiger oder runder, von Häusern
umgebener, mit Rasen und Baumgruppen versehener und meist durch ein
eisernes Gitter abgeschlossener Platz in englischen (und danach
auch in andern) Städten. Derartige Plätze von
halbkreisförmiger Gestalt heißen Crescent
("Halbmond").
Squatter (engl., spr. skwotter, von to squat,
niederkauern), in den Vereinigten Staaten von Amerika ein
Ansiedler, der sich ohne Rechtstitel auf einem Stück Land
niederläßt, insbesondere derjenige, welcher noch nicht
angebautes Regierungsland ohne Kauf okkupiert. Da diese Praxis viel
zum raschen Anbau, namentlich der westlichen Staaten, beitrug,
indem unbemittelte Leute in Gegenden, wohin die Kolonisation auf
dem gewöhnlichen Weg erst spät gedrungen sein würde,
Niederlassungen gründeten, so suchte man dergleichen Ansiedler
durch sogen. Präemtionsgesetze in dem Besitz der von ihnen
eigenmächtig okkupierten Ländereien zu schützen.
Nach einem bereits 1808 in Massachusetts erlassenen Gesetz wurde
das Eigentumsrecht auf ein Grundstück schon durch
40jährige Okkupation erworben; spätere
Kongreßbeschlüsse erteilten den Squatters das Recht, von
ihnen okkupierte Staatsländereien, ohne Rücksicht auf den
inzwischen gestiegenen Wert derselben, zum Minimalpreis von
1¼ Doll. pro Acre zu erwerben. Nachdem 1830 dies Gesetz
für eine bestimmte Anzahl von Jahren auf das ganze
Unionsgebiet ausgedehnt worden, kam 1841 das Präemtionsgesetz
zu stande, wodurch die Squatters allenthalben in den Vereinigten
Staaten die Befugnis erhielten, durch Erlegung jenes Minimalpreises
sich einen gesetzlichen Rechtstitel auf die von ihnen bebauten
Grundstücke zu erwerben, wobei nur die Beschränkung
stattfinden sollte, daß kein Kolonist mehr als 160 Acres auf
einmal ankaufen oder auf die zu Schul- und andern
gemeinnützigen Zwecken bestimmten Ländereien Anspruch
machen dürfte. Seit Erlaß des Heimstättegesetzes
von 1862 (homesteadbill) müssen jedem, der sich in gutem
Glauben ansiedelt und Bürger ist oder seine Absicht,
Bürger zu werden, erklärt, 160 Acres Kongreßland
unentgeltlich bewilligt werden. - In Australien heißen
Squatters die Viehzüchter, welche große Strecken neu
angebauten Landes von der Regierung pachten.
Squaws (spr. skwahs), die Frauen der nordamerikan.
Indianer.
Squier (spr. skwihr), Ephraim George, nordamerikan.
Altertumsforscher, geb. 17. Juni 1821 zu Bethlehem (New York), ward
Ingenieur, stellte mit Davis Untersuchungen über die alten
Denkmäler im Mississippithal an, worüber er in "The
ancient monuments of the Mississippi valley" (Washingt. 1848)
berichtete, und ward 1849 zum Geschäftsträger der Union
in den zentralamerikanischen Republiken ernannt, welche Staaten er
ebenfalls (wiederholt 1853) zu wissenschaftlichen Zwecken
erforschte. Später besuchte er Europa, war 1863-64 Kommissar
der Union in Peru, 1868 Generalkonsul für Honduras in New York
und wurde 1871 Präsident des Anthropological Institute
daselbst. Er starb 17. April 1888 in New York. Von seinen Schriften
sind noch zu nennen: "Aboriginal monuments of the state of New
York" (Washingt. 1849); "The serpent symbols" (New York 1851);
"Travels in Central-America: Nicaragua, its people, scenery and
monuments" (das. 1852, 2 Bde.); "The states of Central America"
(das. 1857, 2. Aufl. 1870); "Honduras, descriptive, historical and
statistical"(1870); "Peru. Incidents and explorations in the land
of the Incas" (1877; deutsch, Leipz. 1883).
Squillace (spr. -latsche), Flecken in der ital. Provinz
Catanzaro, unweit des Golfs von S. des Ionischen Meers, an der
Eisenbahn Metaponto-Reggio gelegen, Bischofsitz, mit Kathedrale,
geistlichem Seminar, Industrie in Seide und Thonwaren und (1881)
2673 Einw. S. ist das antike Scylacium, eine Stadt der Bruttier und
Geburtsort des Cassiodorus (s. d.).
Squire (engl., spr. skweir), entstanden aus Esquire (s.
Adel, S. 111, und Esquire), s. v. w. Gutsherr.
Sr, in der Chemie Zeichen für Strontium.
Srászy (spr. ssrahschi), poln. Gericht, mit
Zwiebeln u. dgl. gedünstete Scheiben von Rindfleisch.
195
Sredec - Staat.
Sredec, bulgar. Name für Sofia (s. d.).
Srinagar, 1) Hauptstadt von Kaschmir, in der Nordwestecke
Ostindiens, 1568 m ü. M., am Dschelam, in einem durch seine
malerischen Reize weltberühmten Thalkessel, mit großem
Palast, Fort, Gewehrfabrik, Münze, engen, schmutzigen
Straßen aus hohen Holzhäusern und 150,000 Einw. (meist
Mohammedaner, nur 20,000 Hindu), welche besonders berühmte
Shawlweberei betreiben. Zur Unterkunft der in beschränkter
Zahl zugelassenen Europäer (300 bis 400) gibt es jetzt
Pensionen und Hotels. -
2) Hauptort des Distrikts Garwhal (s. d. 1).
S romanum (Flexura sigmoidea, F. iliaca), der
S-förmig gekrümmte untere Abschnitt des Grimmdarms, der
an den Mastdarm anstößt.
Ss... Die so beginnenden russischen Namen s. unter einfachem
S...
Ssant s. Acacia.
Ssossar s. Acacia.
Sselo (russ.), s. v. w. Kirchdorf; vgl. Derewnja.
St., Abkürzung für Sanctus, Sankt oder
Saint.
St., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung
für Jakob Sturm (s. d.) oder für H. Steudner (s. d.).
Staab, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmannschaft
Mies, an der Radbusa und der Böhmischen Westbahn, hat ein
Bezirksgericht, (1880) 2068 Einw., Bierbrauerei und
Dampfbrettsäge.
Staal, Marguerite Jeanne, Baronin de, durch Geist und
Bildung ausgezeichnete Französin, geb. 1693 zu Paris als
Tochter eines armen Malers, Cordier, dessen Namen sie ablegte, um
den ihrer Mutter, Delaunay, anzunehmen, war zuerst Kammerjungfer
der tyrannischen Herzogin von Maine, machte sich durch ihre Verse
und Pläne zu Theaterstücken den Prinzen und vielen
geistreichen Männern des Hofs bekannt und ward
schließlich die Tonangeberin in den Salons von Paris. Ihre
Ergebenheit für die Herzogin brachte sie auf zwei Jahre in die
Bastille. 1735 heiratete sie den Offizier der Garde, Baron von S.
Sie starb 16. Juni 1750 bei Paris. Ihre "Mémoires" (Par.
1755, 4 Bde.; neue Ausg. von Lescure, 1878, 2 Bde.) zeichnen sich
durch scharfe Beobachtung und feine Satire aus und sind in einem
Stil geschrieben, dem die Kritik nur denjenigen Voltaires vorzog.
Ihre "OEuvres complètes" erschienen Paris 1821, 2 Bde. Vgl.
Frary, Étude sur Mad. S. (1863).
Staar, Augenkrankheit und Vogel, s. Star.
Staat, das öffentliche Gemeinwesen, welches eine auf
einem bestimmten Gebiet ansässige Völkerschaft in der
Vereinigung von Regierung und Regierten umfaßt. Diese
Definition ist freilich keine allgemein angenommene; vielmehr gehen
in der Wissenschaft die Ansichten über Wesen und Zweck des
Staats sehr auseinander. Jedenfalls müssen aber folgende
Requisite vorhanden sein, wenn von einem S. die Rede sein soll:
Staatsgebiet, Regierung, Regierte und eine zweckentsprechende
Organisation.
[Wesen und Zweck des Staats.] Die Geschichte lehrt uns,
daß von eigentlichen Staaten erst dann die Rede sein kann,
wenn eine größere Gesamtheit von Menschen zu einem
gemeinsamen Organismus vereinigt ist. Die Familie mag als die
natürliche Grundlage und als der Ausgangspunkt dieses
Organismus betrachtet werden; der S. selbst aber charakterisiert
sich gerade im Gegensatz zur Familie dadurch, daß seine
Angehörigen nicht durch das Band der Verwandtschaft, sondern
durch eine besondere Organisation zusammengehalten werden, und das
Charakteristische ebendieser Organisation besteht wieder darin,
daß eine Vereinigung von Regierung (Staatsregierung,
Gouvernement) einerseits und von Regierten (Staatsangehörigen,
Staatsbürgern, Unterthanen) anderseits gegeben ist. Endlich
ist aber noch als wesentlicher Faktor des Staatsbegriffs das
Vorhandensein eines bestimmten Gebiets (Staatsgebiet, Territorium)
hervorzuheben, auf welchem sich jene Gesamtheit von Menschen
dauernd niedergelassen hat. Der Zustand eines Nomadenvolkes ist die
Negation des Staatsbegriffs. Diejenigen Rechte nun, welche der
Staatsregierung und deren Inhaber, dem Staatsbeherrscher
(Staatsoberhaupt, Souverän), als solchem zustehen, die sogen.
Hoheitsrechte, bilden den Inhalt der Staatsgewalt
(Regierungsgewalt), welche namentlich insofern, als sie das Recht
des Staatsbeherrschers zur Ausübung der Hoheitsrechte auf dem
Staatsgebiet und in Ansehung der auf demselben lebenden Menschen
(Territorialitätsprinzip) bedeutet, als Souveränität
(Staatshoheit, Suprema potestas) bezeichnet zu werden pflegt. Das
Subjekt der Staatsgewalt sowie die Art und Weise ihrer
Ausübung durch ersteres, also die Staats- und Regierungsform,
wird durch die Staatsverfassung (Konstitution) bestimmt. Wenn man
aber ferner die Staatsgewalt in die gesetzgebende, die richterliche
und die vollziehende Gewalt (Exekutive) einzuteilen pflegt, so ist
dies im Grund nur eine Bezeichnung der verschiedenen Richtungen,
nach denen hin die Staatsgewalt thätig ist; denn die
Staatsgewalt selbst ist und bleibt unteilbar, einheitlich und
ausschließend. Die wissenschaftliche Begründung und
Rechtfertigung des Staatsbegriffs ist von Philosophen und
Publizisten auf die verschiedenste Weise versucht worden,
während andre sich damit begnügen wollen, den S. und das
damit gegebene Verhältnis der Unterordnung der Regierten als
eine historische Thatsache und ebendarum der philosophischen
Rechtfertigung nicht bedürftig hinzustellen. Dagegen finden
wir schon im Altertum in den Theokratien der Orientalen die sogen.
religiöse Theorie vertreten, welche den S. als eine
göttliche Stiftung und die Einsetzung der Regierungsgewalt als
einen Teil der göttlichen Weltordnung auffaßt; eine
Theorie, welche man neuerdings als die Lehre vom Königtum "von
Gottes Gnaden" zu modernisieren suchte, wie dies z. B. von Stahl
geschehen ist. Andre wollen die Entstehung des Staats aus dem
sogen. Rechte des Stärkern, aus der Übermacht, welche
auch in dem Ausdruck "Staatsgewalt" angedeutet sei, herleiten,
während auf der entgegengesetzten Seite der S.
(Patriarchalstaat) auf die väterliche Gewalt
zurückgeführt und als eine Erweiterung der Familie
hingestellt wird. Eine weitere, früher auch in Deutschland
vielfach praktisch geltend gemachte Theorie (Patrimonialprinzip)
stellt die Staatsgewalt als Ausfluß des Eigentums
(Patrimonialität) am Grund und Boden hin. Es ist dies die
Theorie der absoluten Monarchie, vermöge deren sich die
Staatsbeherrscher gewissermaßen als Eigentümer von Land
und Leuten betrachteten, und welche zu jenem Satz führen
konnte, der Ludwig XIV. in den Mund gelegt wird: "Ich bin der S."
Auch der sogen. Vertragstheorie ist hier zu gedenken, welche die
Entstehung des Staats auf eine vertragsmäßige
Unterwerfung der Unterthanen unter die Staatsgewalt (Contrat
social) zurückzuführen sucht und durch Jean Jacques
Rousseau populär geworden ist, zuvor aber schon durch die
Engländer Hobbes und Locke vertreten worden war. Dagegen
bezeichneten Kant und nach ihm Karl Salomo Zachariä und Wilh.
v. Humboldt den S. als durch das Rechtsgesetz gerechtfertigt.
196
Staat (Staatsformen, Staatenverbindungen).
Im Zusammenhang damit stellte man den Schutz des Rechts als den
eigentlichen Zweck des Staats (Rechtsstaat) hin. Dieser Theorie
(Manchestertheorie) steht die sogen. Wohlfahrtstheorie
gegenüber, welche die öffentliche Wohlfahrt des Staats
und die allgemeine Wohlfahrt seiner Angehörigen als den
Staatszweck bezeichnet, damit aber freilich nicht selten zu einer
Bevormundung des Volkes und zum sogen. Polizeistaat geführt
hat. Dazwischen steht die vermittelnde Theorie, welche das Recht
als die Basis und den Hauptzweck des Staats bezeichnet und im
übrigen die Staatshilfe nur als völkerschaftliche
Unterstützung zur selbstthätig freien Entwickelung der
Staatsangehörigen eintreten lassen will, indem das gesamte
staatliche Leben sich in den Angeln des Rechts bewegen soll
(Kulturstaat). Übrigens pflegt man gegenwärtig den
Ausdruck "Rechtsstaat" kaum noch in jener engen Bedeutung, sondern
vielmehr gleichbedeutend mit "Verfassungsstaat" zu gebrauchen,
indem man für den Staatsbürger nicht nur in
Privatrechtssachen, sondern auch auf dem Gebiet des
öffentlichen Rechts die Möglichkeit richterlicher
Entscheidung fordert und die Grenzen der staatlichen
Machtvollkommenheit durch Verfassung und Gesetz festgelegt wissen
will.
[Staatsformen.] Nach der Art und Weise, wie das Verhältnis
zwischen Regierung und Regierten geordnet ist, werden verschiedene
Staats- und Regierungsformen unterschieden. Bis in die neueste Zeit
hat sich die alte Einteilung des Aristoteles erhalten, welcher
zwischen Monarchie (Einzelherrschaft), Aristokratie (Herrschaft
einer bevorzugten Volksklasse) und Demokratie (Volksherrschaft)
unterschied und als die Entartungen dieser Staatsformen die
Despotie, die Oligarchie und die Ochlokratie hinstellte. Manche
haben noch eine sogen. Theokratie hinzugefügt, als eine
Staatsbeherrschungsform, bei welcher die Gottheit selbst als durch
ihre Priester regierend gedacht ist. Richtiger und den modernen
Verhältnissen entsprechend ist es wohl, nur zwei Hauptarten
der Staatsformen zu unterscheiden: die Monarchie und den Freistaat
oder die Republik. In der erstern steht ein Einzelner an der Spitze
des Staatswesens, während in der Republik die Gesamtheit des
Volkes als regierend gedacht ist, welcher die Einzelnen als die
Regierten gegenüberstehen. Bezüglich der Monarchie ist
dann zwischen der absolutistischen Staatsbeherrschungsform, der
Autokratie, wie sie z. B. in Rußland besteht, zu
unterscheiden und zwischen der konstitutionellen Monarchie, in
welcher dem Volk durch seine Vertretung ein Mitwirkungsrecht bei
den wichtigern Regierungshandlungen und namentlich bei der
Gesetzgebung eingeräumt ist. Bezüglich der Autokratie
kann man übrigens wiederum zwischen reinen Autokratien
unterscheiden und solchen mit geregelten Staatsformen und
bestimmten Staatsgrundgesetzen. Der Konstitutionalismus aber ist
nicht als eine Teilung der Staatsgewalt zwischen Monarch und
Volksvertretung aufzufassen, auch ist der Monarch selbst der
Volksvertretung nicht verantwortlich; wohl aber ist letzteres in
Ansehung der Minister der Fall. Bezüglich der Republik endlich
ist, abgesehen von dem Unterschied zwischen Aristokratie und
Demokratie, zwischen der unmittelbaren (antiken) und der
repräsentativen Demokratie zu unterscheiden, je nachdem das
Volk selbst in der Volksversammlung die Regierung ausübt, oder
je nachdem dies durch seine Vertreter geschieht. Vgl. die Artikel
über die einzelnen Staatsformen und die Übersicht
über die Staats- und Regierungsformen bei dem Art.
"Bevölkerung".
Staatenverbindungen.
Die regelmäßige Erscheinungsform des Staats ist der
Einheitsstaat, d. h. der für sich bestehende souveräne S.
mit einem einheitlichen Staatsgebiet unter einer und derselben
Staatsregierung. Dadurch, daß der S. zu andern Staaten
Beziehungen unterhält und mit solchen vorübergehend oder
dauernd in Verbindung tritt, wird die Selbständigkeit des
Einheitsstaats nicht beeinträchtigt. Zwischen den
nebeneinander bestehenden Staaten entwickeln sich eben
naturgemäß ein geistiger und materieller
Völkerverkehr und ein völkerrechtliches Verhältnis,
welches namentlich auf dem Gebiet des Handels und der Rechtspflege
vielfach durch besondere Staatsverträge geregelt ist. Man
bezeichnet dies Verhältnis selbständig nebeneinander
bestehender, aber durch freundschaftliche Beziehungen verbundener
Staaten als Staatensystem (im weitern Sinn) und pflegt so
namentlich von einem europäischen Staatensystem zu sprechen.
Treten nun verschiedene Staatskörper zu einer nähern
Vereinigung mit einem bestimmten Zweck zusammen, so wird dies als
Bund bezeichnet. Dieser Bund kann aber a) nur vorübergehend zu
einem speziellen Zweck ins Leben treten (Allianz, Koalition) oder
b) auf die Dauer zur Verwirklichung umfassender politischer Zwecke
berechnet sein (Staatsverbindung, Staatensystem im engern Sinn).
Ein Beispiel der erstern Art ist das gegenwärtig zwischen
Deutschland und Österreich-Ungarn bestehende Schutz- und
Trutzbündnis. In dem zweiten Fall dagegen trägt die
Vereinigung selbst einen staatlichen Charakter, ohne daß
jedoch die selbständige staatliche Existenz der einzelnen
verbündeten Staaten aufgehoben wäre, wie dies bei der
Vereinigung mehrerer Staaten zu einem Einheitsstaat der Fall ist.
Letzteres kann nämlich entweder so geschehen, daß die zu
einem Einheitsstaat zusammengefügten Staaten einen ganz neuen
S. bilden, wie dies z. B. bei der Gründung des
Königreichs Italien geschah, oder so, daß der eine S.
dem andern einverleibt wird, in welcher Weise z. B. Preußen
den 1866 annektierten Staaten gegenüber verfuhr. Im erstern
Fall spricht man von einer Union in diesem besondern Sinn,
während in dem letztern Fall eine Inkorporation vor sich geht.
Bei der Staatenverbindung dagegen bleiben die verbündeten
Staatswesen nach wie vor nebeneinander bestehen, und zwar ist es
möglich, daß diese verbündeten Staaten an und
für sich völlig unabhängig voneinander, oder
daß dieselben zu einem politischen Gesamtwesen vereinigt
sind. Im erstern Fall ist eine Union (im engern Sinn), im zweiten
eine Konföderation gegeben.
Es kommt nämlich einmal vor, daß verschiedene, an und
für sich voneinander getrennte und unabhängige Monarchien
unter einem und demselben Souverän stehen, also durch die
Identität des Staatsbeherrschers miteinander verbunden sind
(Union, Unio civitatum); sei es nun, daß eine Personalunion
(Unio personalis), sei es, daß eine Realunion (Unio realis)
vorliegt. Die Personalunion ist dann gegeben, wenn rein
thatsächlich zwei oder mehrere an und für sich
selbständige Staaten unter dem Zepter eines gemeinsamen
Monarchen vereinigt sind. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn in
einer Wahlmonarchie ein Fürst an die Spitze des Staats
gestellt wird, der bereits das Oberhaupt eines andern Staats ist.
So erklärt sich z. B. die Personalunion Sachsens und Polens
unter August dem Starken. Der Hauptfall der Personalunion aber ist
der, daß infolge einer Übereinstimmung der
Thronfolgeordnung dasselbe Glied derselben Dynastie zur Regierung
über beide
197
Staat (Staatenbund und Bundesstaat).
Länder gerufen wird. Hierfür bietet die Geschichte in
der Vereinigung von Spanien und Deutschland, Hannover und England,
Preußen und Neuenburg Beispiele. Auch Holland und Luxemburg
stehen zu einander im Verhältnis der Personalunion. Ist
dagegen die Union eine verfassungsmäßige, dauernde und
von Rechts wegen unauflösliche, so liegt eine Realunion vor.
Die einzelnen Kronländer sind, wie dies in
Österreich-Ungarn der Fall ist, zwar besondere Staaten, aber
sie sind verfassungsmäßig unter Einem Zepter vereinigt.
Sie stellen sich daher in ihrer Verbindung und namentlich dem
Ausland gegenüber als eine staatliche Gesamtheit dar. Ihre
gemeinsamen Interessen werden in Österreich-Ungarn durch ein
gemeinsames Reichsministerium wahrgenommen, und aus den
Volksvertretungen der beiden Reichshälften, dem
österreichischen Reichsrat und dem ungarischen Reichstag,
werden Delegationen (Parlamentsausschüsse) zum Zweck der
Teilnahme an der gemeinsamen Gesetzgebung abgeordnet. Ebenso stehen
Schweden und Norwegen seit 1814 in Realunion, während die
Elbherzogtümer Schleswig und Holstein ehedem zu einander im
Verhältnis der Realunion, zur Krone Dänemark aber in
demjenigen der Personalunion gestanden haben.
Was dagegen die Konföderation (Föderation) anbetrifft,
so wird zwischen Staatenbund (lat. Confoederatio civitatum, ital.
Confederazione degli stati) und Bundesstaat (Bundesreich,
Föderativstaat, Gesamtreich, Gesamtstaat, Staatenstaat,
Civitas foederata s. composita, von den italienischen Publizisten
Stato federativo genannt) unterschieden. Bei dem Staatenbund wie
bei dem Bundesstaat ist eine Mehrheit von Staaten mit besondern
Staatsgebieten und Staatsregierungen und, wofern die letztern
monarchische sind, auch mit verschiedenen Staatsbeherrschern
vorhanden. Beide sind im Gegensatz zu der nur vorübergehenden
Allianz auf die Dauer berechnet, beide stellen ferner einen
politischen Organismus mit einer Zentralgewalt dar. Allein bei dem
Staatenbund sind es immer nur bestimmte Aufgaben, welche den Zweck
des Bundes bilden, der Bundesstaat dagegen sucht die Zwecke des
Staats überhaupt zu erfüllen. Der Staatenbund ist
vorwiegend Bund, der Bundesstaat ist vorwiegend Staat. Der
Staatenbund ist ein völkerrechtlicher Verein mit
internationalem Charakter, der Bundesstaat ist ein wirkliches
Staatswesen mit nationalem Charakter. So war die Schweiz bis 1848
nur ein Staatenbund, während sie jetzt vermöge der
Verfassung vom 12. Sept. 1848 ein Bundesstaat ist. Auch die
Vereinigten Staaten von Nordamerika sind ein solcher, und als
dritter Bundesstaat kommt das gegenwärtige Deutsche Reich
hinzu, während der vormalige Deutsche Bund ein bloßer
Staatenbund war. Freilich entspricht in Deutschland der
gegenwärtige Sprachgebrauch des praktischen politischen Lebens
dem theoretischen Schulbegriff nicht. Denn man pflegt offiziell die
einzelnen verbündeten deutschen Staaten als Bundesstaaten zu
bezeichnen, während theoretisch der Gesamtstaat, zu welchem
sie vereinigt sind, also das Deutsche Reich, der Bundesstaat
ist.
Im einzelnen treten dabei namentlich folgende Gegensätze
hervor: Im vormaligen Deutschen Bund als einem bloßen
Staatenbund waren die einzelnen Staaten völlig souverän.
Das Organ dieses Bundes, der Frankfurter Bundestag, setzte sich
lediglich aus den instruierten Bevollmächtigten der
verschiedenen souveränen Bundesregierungen zusammen. Der
Angehörige des einzelnen Staats stand zu jenem Zentralorgan in
keiner direkten Beziehung, sondern die Bundesbeschlüsse hatten
nur für die verbündeten Regierungen, nicht aber für
die von diesen Regierten rechtsverbindliche Kraft. Sie erhielten
diese für die Angehörigen der einzelnen Staaten vielmehr
erst dadurch, daß sie von der betreffenden Einzelregierung
als Gesetz verkündet wurden. Das Deutsche Reich als ein
Gesamtstaat hat dagegen eine wirkliche Staatsgewalt im Gegensatz zu
der lediglich vertragsmäßig geschaffenen Zentralgewalt
des Staatenbundes. In der Unterordnung unter jene Staatsgewalt des
Gesamtstaats liegt eine Beschränkung der
Souveränität der einzelnen Regierungen. Das Reich
übt ferner eine wirkliche gesetzgebende Gewalt aus, die
Reichsgesetze gehen den Landesgesetzen vor, und sie erhalten ihre
rechtsverbindliche Kraft für die Unterthanen des Reichs und
der Einzelstaaten durch die Verkündigung von Reichs wegen. Dem
vormaligen deutschen Bundestag entspricht jetzt der Bundesrat. Aber
ihm steht im Deutschen Reich als einem wirklichen konstitutionellen
Staat in dem Reichstag eine Volksvertretung zur Seite. An der
Spitze dieses Gesamtstaats steht ein einzelner Monarch, welcher die
Reichsgesetze verkündet und vollzieht, auch das Reich
völkerrechtlich zu vertreten hat, namens desselben den Krieg
erklärt und den Frieden schließt. In dem Reichskanzler
ist ihm ein verantwortlicher Minister beigegeben, von welchem
natürlich im Staatenbund nicht die Rede sein kann. Das
Bundesreich hat ferner seine eignen Reichsbeamten, sein eignes Heer
und seine eignen Finanzen wie ein wirklicher Staat. Die Unterthanen
der einzelnen deutschen Staaten stehen jetzt in einem doppelten
Unterthanenverhältnis; sie sind Bürger des Einzelstaats,
dem sie angehören, und Unterthanen der betreffenden
Einzelregierung, aber sie sind auch zugleich Unterthanen und
Bürger des Deutschen Reichs und im Verhältnis zu einander
keine Ausländer mehr. Während endlich der Deutsche Bund
sich lediglich "die Erhaltung der äußern und innern
Sicherheit Deutschlands und der Unabhängigkeit und
Unverletzbarkeit der einzelnen deutschen Staaten" als Zweck gesetzt
hatte, ist der Zweck des nunmehrigen Bundesreichs "der Schutz des
Bundesgebiets und des innerhalb desselben gültigen Rechts
sowie die Pflege der Wohlfahrt des deutschen Volkes", also der
allgemeine Staatszweck. Die Organisation des Deutschen Reichs und
der oben genannten beiden andern Bundesstaaten veranschaulicht die
nachstehende Übersicht:
Bundesstaaten Vollziehende Gewalt Gesetzgebende Gewalt
Vertretung der Staaten Vertretung des Volkes
Deutsches Reich Kaiser Bundesrat Reichskanzler Bundesrat
Reichstag
Nordamerikanische Union Präsident Senat
Repräsentantenhaus
Kongreß
Schweiz Bundesrat Ständerat Nationalrat
Bundesversammlung
[s. Bildansicht]
Die Verhältnisse und Beziehungen der Staatsregierung zu den
Staatsunterthanen und die Beziehungen der letztern untereinander
werden, insoweit sie sich auf den S. beziehen, durch das
Staatsrecht (s. d.) geregelt. Dorthin gehören auch die
Satzungen über die Rechtsverhältnisse in einem
zusammengesetzten S., als welchen man vornehmlich die Realunion und
den Bundesstaat bezeichnen kann. Für
198
Staatenbund - Staatsanwalt.
das Deutsche Reich bildet die Gesamtheit jener
Rechtsgrundsätze das Reichsstaatsrecht. Das Staatsleben
dagegen bildet den Gegenstand der Politik (s. d.), während die
rechtlichen Beziehungen mehrerer selbständiger Staaten
untereinander sich nach dem Völkerrecht (s. d.) bestimmen.
Vgl. Waitz, Das Wesen des Bundesstaats (in seinen "Grundzügen
der Politik", Kiel 1862); Jellinek, Die Lehre von den
Staatenverbindungen (Wien 1882); Brie, Der Bundesstaat (Leipz.
1874); Derselbe, Theorie der Staatenverbindungen (Stuttg.
1886).
Staatenbund, Staatensystem, s. Staat.
Staateninsel, die östlichste Insel des Feuerlandes,
von der Hauptinsel durch die 60 km breite Le Maire-Straße
getrennt, hat steile, von Baien tief eingeschnittene Küsten,
steigt bis 900 m an und ist fast das ganze Jahr durch mit Schnee
bedeckt. Nahe ihrem Ostende liegt St. John's Hafen. Die Insel wurde
1616 von Schouten zu Ehren der "Staaten" (Stände) der
Niederlande benannt.
Staatsadreßbuch, s. Staatshandbuch.
Staatsangehörigkeit (Heimatsrecht, Indigenat), die
Eigenschaft als Unterthan in einem bestimmten Staatswesen. Im
Bundesstaat ist der Staatsangehörige einer doppelten
Herrschaft unterworfen; er steht unter der Staatsgewalt des
Einzelstaats, welchem er angehört, und er ist der
Bundes-(Reichs-) Gewalt untergeordnet, welche in dem Gesamtstaat
besteht, welchem jener Einzelstaat zugehört. So ergibt sich
für die Angehörigen des Deutschen Reichs eine S. oder ein
Landesindigenat und eine Reichsangehörigkeit oder ein
Bundesindigenat (s. d.). Die Reichsangehörigkeit setzt die S.
in einem deutschen Einzelstaat voraus, sie wird mit der S. erworben
und endigt mit derselben. Nach dem Bundes-(Reichs-) Gesetz vom 1.
Juni 1870 über den Erwerb und Verlust der Bundes- und
Staatsangehörigkeit wird die S., mit welcher also die
Reichsangehörigkeit von selbst verbunden ist, erworben durch
Abstammung von einem inländischen Vater und für
uneheliche Kinder durch die Geburt von einer dem betreffenden Staat
angehörigen Mutter, auch durch die nachfolgende Legitimation
seitens des natürlichen Vaters; sodann seitens einer Ehefrau
durch deren Verheiratung mit einem Staatsangehörigen und
endlich für den Angehörigen eines Bundesstaats durch
dessen Aufnahme in einen andern (Überwanderung) und für
Ausländer oder Nichtdeutsche durch die Naturalisation
(Einwanderung) derselben. Beides, Aufnahme u. Naturalisation,
erfolgt durch die höhere Verwaltungsbehörde des
betreffenden Staats und zwar die Aufnahme kostenfrei. Der
Hauptunterschied zwischen Aufnahme und Naturalisation besteht
darin, daß die Aufnahme jedem Angehörigen eines andern
Bundesstaats erteilt werden muß, wenn er darum nachsucht und
zugleich nachweist, daß er in dem Bundesstaat, in welchem er
um die Aufnahme nachsucht, sich niedergelassen habe; es
müßte denn einer der Fälle vorliegen, in welchen
nach dem Freizügigkeitsgesetz die Abweisung eines
Neuanziehenden oder die Versagung der Fortsetzung des Aufenthalts
als gerechtfertigt erscheint. Dagegen besteht keine Verpflichtung
zur Naturalisation eines Ausländers, deren allgemeine
Voraussetzungen Dispositionsfähigkeit, resp. Zustimmung des
gesetzlichen Vertreters, Unbescholtenheit, Wohnung am Orte der
Niederlassung und die Fähigkeit, sich und seine
Angehörigen ernähren zu können, sind. Bei Staats-,
Kirchen- und Gemeindedienern vertritt die Bestallung die Aufnahme-
oder die Naturalisationsurkunde. Die S. geht verloren durch
zehnjährigen ununterbrochenen Aufenthalt im Ausland, es sei
denn, daß sich der Betreffende im Besitz eines Reisepapiers
oder Heimatscheins befindet; durch Verheiratung einer
Inländerin mit einem Ausländer oder mit einem
Angehörigen eines andern Bundesstaats sowie bei dem
unehelichen Kind einer inländischen Frauensperson durch die
Legitimation seitens des ausländischen Vaters. Außerdem
geht die S. verloren durch die Entlassung, welche unbedenklich zu
erteilen ist, wenn der zu Entlassende in einem andern deutschen
Staate die S. erworben hat. Die Entlassung ist gegenüber
Wehrpflichtigen vom vollendeten 17. bis zum 25. Lebensjahr zu
beanstanden, desgleichen Militärpersonen und den zum aktiven
Dienst einberufenen Reservisten und Landwehrleuten gegenüber.
Ferner kann ein Deutscher der S. und damit auch der
Reichsangehörigkeit für verlustig erklärt werden,
wenn er ohne Erlaubnis seiner Regierung in fremde Staatsdienste
tritt, oder wenn er im Fall eines Kriegs oder einer Kriegsgefahr im
Ausland sich aufhält und einer Aufforderung zur Rückkehr
innerhalb der hierzu gesetzten Frist keine Folge leistet. Dagegen
geht die S. nicht dadurch verloren, daß man in einem andern
Staat naturalisiert wird, wie dies in Frankreich der Fall ist.
Deutschen, welche ihre S. durch zehnjährigen Aufenhalt im
Ausland verloren haben, kann die S. in dem frühern Heimatstaat
wieder verliehen werden, auch wenn sie sich in diesem Heimatstaat
nicht wiederum niederlassen, wofern sie keine anderweite S.
erworben haben. Sie muß ihnen wieder verliehen werden, wenn
sie sich dort wieder niederlassen, selbst wenn sie inzwischen eine
anderweite S. erworben haben sollten. Übrigens wird jene
zehnjährige Frist durch Eintrag in die Matrikel eines
Reichskonsuls auf weitere zehn Jahre unterbrochen. Die
Bescheinigung über die S. heißt
Staatsangehörigkeits-Ausweis (Heimatschein). Vgl. v. Martitz,
Das Recht der S. im internationalen Verkehr (Leipz. 1875);
Folleville, Traité de la naturalisation (Par. 1880); Cahn,
Das Reichsgesetz über die Erwerbung und den Verlust der
Reichs- und S. (Berl. 1889).
Staatsanleihen, s. Staatsschulden.
Staatsanwalt, der zur Wahrnehmung des öffentlichen
Interesses in Rechtssachen und insbesondere in Untersuchungssachen
bestellte Staatsbeamte; Staatsanwaltschaft (ministère
public), die hierzu geordnete ständige Behörde. Dem
Altertum war das Institut der Staatsanwaltschaft fremd. Man
überließ es dem Verletzten oder seinen Familiengenossen,
gerichtliche Genugthuung zu suchen, und nur zuweilen traten Redner
mit einer öffentlichen Anklage hervor, ohne daß sie von
Staats wegen dazu veranlaßt waren. Der Ursprung der S. ist in
Frankreich zu suchen, woselbst die heutigen Staatsanwalte aus den
fiskalischen Beamten (gens du roi, avocats généraux,
procureurs du roi) hervorgingen, welche die königlichen
Gerechtsame bei den Gerichten wahrnahmen und die fiskalischen
Interessen zu vertreten hatten. Aber schon im Mittelalter wurde
diesen Beamten auch die Wahrnehmung der öffentlichen
Interessen verbrecherischen Handlungen gegenüber
übertragen, und so entwickelte sich in Frankreich die
strafprozessualische Thätigkeit der Staatsanwaltschaft als die
hauptsächlichste, wenn auch nicht ausschließliche
Berufssphäre derselben. Nach heutigem französischen
Recht, wie dasselbe namentlich durch das Organisationsgesetz
Napoleons I. vom 20. April 1810 normiert ist, gilt nämlich der
S. überhaupt als Wächter des Gesetzes. Er tritt daher
auch in bürgerlichen Rechte
199
Staatsärar - Staatsarzneikunde.
streitigkeiten, auch wenn das staatliche Interesse direkt dabei
nicht in Frage kommt, in Thätigkeit. Der S. vermittelt ferner
den Verkehr des Justizministeriums mit den Gerichten; er nimmt als
Vertreter der bürgerlichen Gesellschaft auch an Akten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit teil, vermittelt den Verkehr der
Gerichte untereinander und mit dem Ausland, überwacht den
Geschäftsgang der Gerichte, beantragt
Disziplinaruntersuchungen, beaufsichtigt die Anwalte und die
Subalternbeamten und überwacht das Gefängniswesen. In
Strafsachen geht die Verfolgung aller verbrecherischen Handlungen
und ebenso der Vollzug der Strafurteile von dem S. aus. Die
Funktionen der Staatsanwaltschaft werden bei dem Kassationshof
durch den Procureur général (Generalprokurator) und
sechs Vertreter desselben (avocats généraux)
wahrgenommen. Ebenso fungiert bei den Appellhöfen ein
Generalprokurator, welchem Generaladvokaten und Substituten
(substituts du procureur général) beigegeben sind.
Bei den Untergerichten sind Staatsanwalte (procureurs de la
république) und Substituten oder Gehilfen derselben
bestellt, während bei den Polizeigerichten die
staatsanwaltlichen Funktionen von Polizeikommissaren wahrgenommen
werden. Nach diesem französischen Muster ist die
Staatsanwaltschaft in den meisten europäischen Staaten
eingerichtet worden; doch war es, wenigstens in Deutschland, die
strafprozessualische Seite der staatsanwaltschaftlichen
Thätigkeit, auf welche sich diese Nachahmung beschränkte,
abgesehen von der in den Rheinlanden vollständig nach
französischem Muster durchgeführten Justizorganisation.
Die deutschen Justizgesetze von 1877 haben jene Einschränkung
zur Regel erhoben. Die Zivilprozeßordnung kennt eine
Mitwirkung der Staatsanwaltschaft im öffentlichen Interesse
nur in Ehesachen und im Entmündigungsverfahren, wenn es sich
darum handelt, eine Person unter Zustandsvormundschaft zu stellen.
Das deutsche Gerichtsverfassungsgesetz aber erklärt
ausdrücklich, daß den Staatsanwalten eine Dienstaufsicht
über die Richter nicht übertragen werden dürfe. Das
Amt der Staatsanwaltschaft selbst wird bei dem Reichsgericht durch
einen Oberreichsanwalt und durch einen oder mehrere Reichsanwalte,
bei den Oberlandesgerichten, den Landgerichten und den
Schwurgerichten durch einen oder mehrere Staatsanwalte und bei den
Amts- und Schöffengerichten durch einen oder mehrere
Amtsanwalte ausgeübt. Zum Oberreichsanwalt, zu Reichsanwalten
und Staatsanwalten können nur zum Richteramt befähigte
Beamte ernannt werden. Oberreichsanwalt und Reichsanwalte sind dem
Reichskanzler untergeordnet, während hinsichtlich aller
übrigen staatsanwaltschaftlichen Beamten die
Landesjustizverwaltung das Recht der Aufsicht und Leitung
ausübt; auch sind den ersten Beamten der Staatsanwaltschaft
bei den Oberlandesgerichten und Landgerichten alle Beamten der
Staatsanwaltschaft ihres Bezirks untergeordnet. Die ersten
Staatsanwalte bei den Oberlandesgerichten und in manchen Staaten
auch die bei den Landgerichten führen den Titel
Oberstaatsanwalt. Der frühere Amtstitel "Generalstaatsanwalt"
für den S. bei den Gerichten höchster Instanz kommt nur
noch als Auszeichnungstitel vor. Die Bezeichnung "Kronanwalt" ist
nicht mehr üblich. In Österreich führt der S. bei
dem obersten Gerichts- und Kassationshof in Wien den Titel
"Generalprokurator". Bei den österreichischen
Oberlandesgerichten fungieren Oberstaatsanwalte. Die Beamten der
Staatsanwaltschaft haben den dienstlichen Weisungen ihres
Vorgesetzten nachzugehen. Die Beamten des Polizei- und
Sicherheitsdienstes sind Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft und
sind in dieser Eigenschaft verpflichtet, den Anordnungen der
Staatsanwalte und der diesen vorgesetzten Beamten Folge zu leisten.
Die Thätigkeit der Staatsanwaltschaft besteht nach der
deutschen Strafprozeßordnung im wesentlichen in der
Vorermittelung verbrecherischer Handlungen (Vorverfahren,
Ermittelungs-, Skrutinialverfahren), in dem Antrag auf
Voruntersuchung und dem Mitwirken bei derselben sowie in der
Erhebung und Vertretung der öffentlichen Klage bei strafbaren
Handlungen. Nur bei Körperverletzungen und Beleidigungen,
soweit diese Vergehen auf Antrag verfolgt werden, ist es Sache des
Verletzten oder des an seiner Stelle zur Stellung des Strafantrags
Berechtigten, die Strafverfolgung mittels der Privatklage zu
betreiben. Bloß dann, wenn dies im öffentlichen
Interesse geboten erscheint, übernimmt auch in solchen
Fällen der S. die Strafverfolgung. Die sogen. subsidiäre
Privatklage, d. h. das Recht des Verletzten, im Fall einer
Ablehnung der Strafverfolgung seitens der Staatsanwaltschaft diese
Strafverfolgung selbst zu betreiben, wurde in die
Strafprozeßordnung nicht aufgenommen, obwohl sich der
deutsche Juristentag dafür ausgesprochen hatte. Es ist aber
für den Fall, daß die Staatsanwaltschaft dem bei ihr
angebrachten Antrag auf Erhebung der öffentlichen Klage keine
Folge gibt, nicht nur das Recht der Beschwerde an die vorgesetzte
Dienstbehörde, sondern auch gegen einen ebenfalls ablehnenden
Bescheid der letztern die Berufung auf gerichtliche Entscheidung
statuiert. Diese geht von dem Oberlandesgericht und in den vor das
Reichsgericht gehörigen Sachen von diesem selbst aus. Auf
diese Weise ist also das sogen. Anklagemonopol der
Staatsanwaltschaft abgeschwächt. Übrigens kann die
Staatsanwaltschaft gerichtlichen Entscheidungen gegenüber auch
zu gunsten des Beschuldigten von den gesetzlich zulässigen
Rechtsmitteln Gebrauch machen. Endlich ist auch die
Strafvollstreckung Sache der Staatsanwaltschaft. In Preußen
liegt übrigens dem S. auch die Überwachung der durch das
Handelsgesetzbuch den Kaufleuten auferlegten Verpflichtungen ob.
Vgl. Deutsches Gerichtsverfassungsgesetz, § 142-153; Deutsche
Strafprozeßordnung, § 151-175, 225 ff., 483 ff.;
Österreichische Strafprozeßordnung, § 29 ff.;
Berninger, Das Institut der Staatsanwaltschaft (Erlang. 1861); von
Holtzendorff, Die Umgestaltung der Staatsanwaltschaft (Berl. 1865);
Keller, Die Staatsanwaltschaft in Deutschland (Wien 1866); Gneist,
Vier Fragen zur Strafprozeßordnung (das. 1874); König,
Die Geschäftsverwaltung der Staatsanwaltschaft in
Preußen (Berl. 1882); Tinsch, Die Staatsanwaltschaft im
deutschen Reichsprozeßrecht (Erlang. 1883); von Marck, Die
Staatsanwaltschaft bei den Land- und Amtsgerichten (Berl. 1884);
Massabiau, Manuel du ministère public (4. Aufl., Par. 1876,
3 Bde.; "Répertoire" dazu, 1885).
Staatsärar, s. v. w. Fiskus (s. d.).
Staatsarzneikunde, derjenige Teil der Medizin, welcher
der öffentlichen Gerichtsbarkeit und Gesundheitspflege dient.
Der Begriff fällt im gewöhnlichen Sprachgebrauch mit
demjenigen der gerichtlichen Medizin zusammen, das neuerrichtete
Institut für S. in Berlin enthält außer einem Raum
für die Leichenschau, in welchem unbekannte Verunglückte
zur Rekognoszierung ausgestellt werden, auch die zum Unterricht in
der gerichtlichen Medizin notwendigen Einrichtungen. Im weitern
Sinn gehören zur S.
200
Staatsausgaben - Staatsflandern.
größere Teile der Gesundheitspflege (s. d.), der
Medizinalpolizei, des Militärmedizinalwesens, allein sowohl im
akademischen Unterricht als in der praktischen Verwaltung sind
diese einzelnen Teile der S. völlig getrennte Fächer.
Vgl. Kraus und Pichler, Encyklopädisches Wörterbuch der
S. (Stuttg. 1872 bis 1878, 4 Bde.).
Staatsausgaben, s. Finanzwesen, S. 267.
Staatsbankrott, derjenige Zustand der Staatswirtschaft,
bei welchem der Staat, sei es mit, sei es ohne ausdrückliche
Erklärung, seine Schuldverbindlichkeiten nicht erfüllt
oder sich Einnahmen verschafft, welche mit der Verfassung oder doch
mit einer gesunden Finanzverwaltung im Widerspruch stehen. Wie
jeder Private, kann auch der Staat in die Lage kommen, daß er
unfähig wird, seinen Verpflichtungen zu genügen. Die
formellen Folgen, welche eine Insolvenz dem Privatmann
gegenüber hat, der Konkursprozeß, die Unfähigkeit
zu eigner Vermögensverwaltung, treten alsdann freilich dem
Staat gegenüber nicht ein, und es trägt demnach der S.
den Charakter eines einseitigen Gewaltaktes. Derselbe kommt in
folgenden Formen vor: 1) Repudiation der Staatsschulden, d. h. die
Erklärung, daß der Staat seine Schulden oder einen Teil
derselben überhaupt nicht verzinsen oder zurückzahlen
werde. Eine solche Weigerung kam früher oft beim Wechsel der
Regierung vor, indem die neue Regierung die von der frühern
eingegangenen Verpflichtungen als ungesetzlich erklärte
(einzelne nordamerikanische Freistaaten 1841, Dänemark 1850,
welches das Anlehen der vom Deutschen Bund in Schleswig-Holstein
eingesetzten Bundesregierung nicht anerkannte, Frankreich zur
Revolutionszeit); 2) Einstellung der Zahlungen auf unbestimmte
Zeit; 3) einseitige, d. h. ohne das Angebot etwaniger Heimzahlung,
also ohne die Zustimmung der Gläubiger, herbeigeführte
Zinsreduktion; 4) einseitige oder verhältnismäßig
zu hohe Besteuerung der Koupons der Staatsschulden, also eine
verschleierte Herabsetzung des Zinsfußes; 5) Ausgabe einer
übermäßigen Menge Papiergeldes mit Zwangskurs. Vom
moralischen Standpunkt muß jede Abweichung von der
Erfüllung der staatlichen Verpflichtungen um so mehr
verurteilt werden, als dieselbe mit einer der ersten Aufgaben des
Staats, der Wahrung der Rechtsordnung, im Widerspruch steht. Aber
auch in finanzieller Beziehung ist sie zu mißbilligen, da sie
für die Zukunft den Kredit des Staats erschwert und verteuert.
Solide Staatsverwaltungen werden deshalb auch den Bankrott zu
vermeiden suchen und sich bemühen, das Gleichgewicht zwischen
Einnahmen und Ausgaben durch wirtschaftliche Bemessung der
letztern, Reorganisation der Verwaltung und zweckentsprechende
Ausnutzung des Besteuerungsrechts herzustellen.
Staatsbetrieb, der Betrieb von Unternehmungen durch den
Staat, welche mehr oder weniger einen privatwirtschaftlichen
Charakter tragen. Derselbe kann ganz auf dem Boden des freien
Wettbewerbs stehen (Domänen, Forsten, Bergwerke), oder er ist
im finanziellen Interesse (z. B. bei dem Tabaksmonopol) oder aus
andern Gründen monopolisiert oder regasiert. Vgl.
Aufwandsteuern und Regalien.
Staatsbürger, im weitern Sinn jeder
Staatsangehörige (s. Staatsangehörigkeit); im engern Sinn
derjenige, welcher selbstthätig in der durch die Verfassung
bezeichneten Weise an den öffentlichen Angelegenheiten
teilnimmt. Zu den Rechten des Staatsbürgers in diesem Sinn
gehören insbesondere die Fähigkeit zu öffentlichen
Ämtern und das aktive und passive Wahlrecht. Dieses
Staatsbürgerrecht kann durch richterliches Urteil wegen
Verbrechen und durch Konkurs ganz oder vorübergehend entzogen
werden (s. Ehrenrechte).
Staatsbürgereid, s. Huldigung.
Staatsdienst, derjenige Dienst, der auf einem besondern,
von der Staatsgewalt ausgehenden Auftrag beruht und den
Beauftragten zur Verwaltung bestimmter Staatsangelegenheiten
anweist. Hiernach schließt man vom S. jeden Dienst aus, worin
nur die Erfüllung einer allgemeinen Bürgerpflicht liegt;
ferner jeden Dienst, der, wenn auch zu seiner Ausübung eine
Bevollmächtigung oder Bestätigung durch die Staatsgewalt
erforderlich ist, doch nicht Staatsangelegenheiten, sondern nur
Privatinteressen betrifft, welche den Staat bloß mittelbar
berühren, wie namentlich die Funktionen der Privat- und
Hofdiener des Fürsten, der Korporations- und Gemeindediener,
der Diener der Kirche und aller, welche, wie Ärzte und
Rechtsanwälte, nur die ihnen vom Publikum an vertrauten
Angelegenheiten besorgen; endlich jeden Dienst, der, wenn auch auf
öffentliche Zwecke gerichtet, doch nicht vom Inhaber der
Staatsgewalt übertragen wird (Mitglieder der
Ständeversammlung, Geschworne). Dagegen sind die Offiziere
Staatsdiener, wenn auch der Ausdruck S. zuweilen auf den
Zivildienst allein beschränkt wird. Insofern übrigens
Kommunalbeamte mit gewissen Funktionen betraut sind, die von dem
Staat auf die Gemeinde oder auf einen Kommunalverband
übertragen wurden, pflegt man dieselben als mittelbare
Staatsbeamte zu bezeichnen. Die Berufung zum S. geschieht durch das
Staatsoberhaupt, in der Regel auf gutachtliche Vorschläge der
vorgesetzten Behörden; bei Subalternbeamten pflegt die
Anstellung von der Oberbehörde kraft erteilter Vollmacht
seitens des Regenten auszugehen. Die Beschäftigung mit dem
öffentlichen Dienst ist in der Regel eine
ausschließliche, neben welcher andre regelmäßige
Erwerbsgeschäfte nicht betrieben werden dürfen. Daher
muß aber auch der Unterhalt durch ausreichende Besoldung
(Gehalt) und für den Fall unverschuldeter
Dienstuntüchtigkeit durch Gewährung eines Ruhegehalts
gesichert werden (s. Pension). In der Regel darf der Staat den
Beamten nicht ohne weiteres entfernen, sofern er nicht durch
Vergehen oder durch ihm zuzurechnende Dienstunfähigkeit die
Entfernung verschuldet. Ebensowenig kann der Beamte seinen Dienst
ohne weiteres verlassen. Der Beamte ist dem Staatsoberhaupt
Gehorsam schuldig und für seine Handlungen verantwortlich; er
steht unter der staatlichen Disziplinargewalt (s. d.). Der Gehorsam
ist aber nur ein verfassungsmäßiger; der Befehl
muß von der zuständigen Behörde und in der
gesetzmäßigen Form ergangen sein und in den Bereich des
Dienstes fallen, um Gehorsam beanspruchen zu können; auch darf
nichts gefordert werden, was dem allgemeinen Sitten- und dem
Rechtsgesetz entgegen ist. Eine eigentümliche Stellung nehmen
die Richter (s. d.) und die Minister (s. d.) ein, welch letztere
mit ihrer Verantwortlichkeit die Handlungen des Fürsten
decken. Im einzelnen sind die Rechtsverhältnisse der
Staatsdiener (Staatsbeamten) in den meisten Staaten durch besondere
Gesetze geregelt; für die deutschen Reichsbeamten insbesondere
ist dies durch Reichsgesetz vom 31. März 1873 (mit
Nachtragsgesetz vom 25. Mai 1887) geschehen (s. Reichsbeamte und
die dort angeführte Litteratur).
Staatseinnahmen, s. Finanzwesen, S. 268.
Staatsflandern, s. Flandern.
201
Staatsforstwissenschaft - Staatsrat.
Staatsforstwissenschaft, die Lehre von dem
Verhältnis des Staats zu den Forsten. Zur S. gehören die
Forstpolitik, welche lehrt, wie dies Verhältnis sein soll, und
das Forstverwaltungsrecht, welches das rechtlich geordnete
Verhältnis, wie es ist, darstellt. S. Forstpolitik u.
Forstverwaltung.
Staatsgarantie, die von der Staatsregierung
übernommene Bürgschaft, vermöge deren sie für
die vertragsmäßige Rückzahlung und Verzinsung einer
von einem Dritten gewirkten Schuld einsteht. Der
hauptsächlichste Fall einer solchen S. ist der, daß der
Staat, um das Zustandekommen eines im öffentlichen Interesse
wünschenswerten Eisenbahnbaues zu ermöglichen, den
Aktionären eine bestimmte Dividende "garantiert", d. h.
alljährlich für einen gewissen Prozentsatz einsteht,
für welchen er dann selbst aufzukommen hat, wenn und soweit
die Einnahmen der Bahn nicht ausreichen. Auch kommt es vor,
daß der Staat für die Verzinsung und Amortisation einer
Anleihe einsteht, welche im Interesse einer Eisenbahnanlage
kontrahiert wird. Zuweilen wird eine solche Eisenbahngarantie
seitens des Staats nur auf eine bestimmte Reihe von Jahren
übernommen, auch kommt dabei eine sogen. Rückgarantie
vor, welche darin besteht, daß gewisse bei dem Bahnbau
besonders interessierte Gemeinden, Korporationen etc. sich
verpflichten, den Staat für den Fehlbetrag, für welchen
er eventuell aufzukommen hat, ganz oder teilweise schadlos zu
halten. In konstitutionellen Staaten ist zur Übernahme einer
S. die Zustimmung der Volksvertretung nötig.
Staatsgefangene, Gefangene, welche nicht wegen eines
begangenen Verbrechens durch gerichtliches Urteil der Freiheit
beraubt waren, sondern die man eingekerkert hatte, weil es das
Interesse des Staats oder Fürstenhauses zu fordern schien.
Staatsgerichtshof, derjenige Gerichtshof eines Landes,
welcher über die gegen einen Minister erhobene Anklage wegen
Verfassungsverletzung zu entscheiden hat. In England ist die
Peerskammer der S., während in den meisten deutschen Staaten
das oberste Gericht des Landes die Funktionen des
Staatsgerichtshofs auszuüben hat oder, wie in Baden, Bayern,
Sachsen und Württemberg, ein besonderer Gerichtshof in solchem
Fall niedergesetzt wird, und zwar in der Weise, daß Krone und
Stände gleichmäßig dessen Besetzung bewirken. S.
wird auch die zur Entscheidung von Kompetenzkonflikten zwischen
Justiz- und Verwaltungsbehörden bestellte Behörde
genannt, endlich auch das zur Aburteilung schwerer politischer
Verbrechen bestellte Ausnahmegericht. Das deutsche
Gerichtsverfassungsgesetz (§ 136) verweist Verbrechen der
letztern Art, sofern sie gegen den Kaiser oder das Reich gerichtet
sind, vor das Reichsgericht.
Staatsgewalt, s. Staat, S. 195.
Staatsgrundgesetz, s. Staatsverfassung.
Staatsgut, s. v. w. Domäne (s. d.).
Staatshandbuch (Staatsadreßbuch, Staatskalender),
Namensverzeichnis der Beamten eines Staats, insbesondere die
offizielle Darstellung eines Hof- und Staatswesens unter
Aufführung aller oder doch der höhern Staats- und
Hofbeamten unter Hinzufügung genealogischer und statistischer
Notizen. Wahrscheinlich ist der französische "Almanach royal"
(1679 von dem Buchhändler Laurent Houry in Paris
gegründet) der Vorläufer der Staatshandbücher. Im
18. Jahrh. erschienen ähnliche Almanache nach und nach in
allen, selbst in den kleinsten, europäischen Staaten sowie in
den verschiedenen Gebieten des damaligen Deutschen Reichs. Die
ersten darunter waren: das "Namensregister für die vereinigten
Niederlande" (1700), der "Preußisch-brandenburgische
Staatskalender" (seit 1704), der "Regensburger Komitialkalender"
(seit 1720), der "Kursächsische Staatskalender" (seit 1728),
der englische "Royal calendar" (seit 1730) etc. Auch der
"Gothaische Genealogische Hofkalender" nebst
"Diplomatisch-statistischem Jahrbuch" (1889 im 126. Jahrgang
erscheinend) ist hier zu nennen. Wie jetzt für die meisten
europäischen Staaten amtlich redigierte Staatshandbücher
herausgegeben werden, z. B. für Preußen das "Handbuch
über den königlich preußischen Hof und Staat", so
wird auch ein "Handbuch für das Deutsche Reich" (Berl. 1876
ff.) vom Reichsamt des Innern herausgegeben.
Staatshaushalt, s. Finanzwesen und Budget.
Staatshaushaltskontrolle, die Gesamtheit derjenigen
Einrichtungen, durch welche festgestellt werden soll, ob die
Finanzverwaltung des Staats unter Beobachtung des Etatsgesetzes und
der sonstigen gesetzlichen Schranken erfolgt ist. Die Befugnis der
Volksvertretung, nach Ablauf der Budgetperiode die Staatsrechnungen
zu prüfen und die Entlastung der Staatsregierung
auszusprechen, ist eine notwendige Folge des Budgetrechts selbst.
Dieser parlamentarischen S. geht aber regelmäßig eine
Prüfung der Staatsrechnungen durch eine unabhängige
Revisionsbehörde voraus, so z. B. in Preußen durch die
Oberrechnungskammer (s. d.), welche auch als Rechnungshof für
das Deutsche Reich fungiert. In manchen Kleinstaaten findet diese
Vorprüfung durch einen Finanzausschuß des Landtags unter
Zuziehung eines Finanzministerialbeamten statt.
Staatshoheit (Souveränität), die dem Staat als
solchem zukommende Unabhängigkeit, vermöge deren er
selbst sich die Gesetze seines Handelns gibt und an fremden Staaten
nur die gleiche Unabhängigkeit zu achten hat. Die S. ist mit
dem Dasein des Staats selbst gegeben, ohne daß es der
völkerrechtlichen Anerkennung bedarf; vielmehr kann und
muß jeder Staat die Achtung seiner S. von andern Staaten
fordern. Thatsächliche Verhältnisse haben aber zur
Bildung halb souveräner Staaten geführt, welche der
Oberhoheit (Suzeränität) eines andern unterworfen sind;
auch kommen in den sogen. zusammengesetzten Staaten
Beschränkungen der S. der Einzelstaaten im Interesse des
Gesamtstaats vor (s. Staat).
Staatskreditzettel, s. v. w. Schatzscheine (s. d.).
Staatskunst, s. Politik.
Staatsministerium, s. Minister.
Staatsnotrecht, s. Notrecht.
Staatspapiere nennt man alle Schuldverschreibungen,
welche über die Einzelbeträge ausgestellt sind, in die
eine vom Staat aufgenommene Schuld zerlegt ist. Im weitern Sinn
umfassen sie auch die unverzinslichen Papiere (Papiergeld oder
Staatsnoten, Kassenanweisungen), im engern nur die verzinslichen
(Staatsobligationen, Staatseffekten, Schatzscheine), bez. mit
Gewinnaussicht verbundenen (Prämienscheine, Losbriefe). Vgl.
Staatsschulden.
Staatspraxis, s. v. w. praktische Politik.
Staatsrat, Kollegium, welches die wichtigsten
Staatsangelegenheiten in gutachtliche Beratung zieht und sich
über die Grundsätze für deren weitere Behandlung
ausspricht. Durch das Vertrauen des Fürsten aus hochgestellten
und erfahrenen Personen berufen, hat der S. die Aufgabe, Einheit in
die Maßregeln der einzelnen großen Verwaltungszweige zu
bringen und demnach teils die Organisation der Staatsverwaltung im
ganzen, teils die Grundlagen der Gesetzgebung, teils die
auswärtigen Verhältnisse
202
Staatsrechnungshof - Staatsromane.
zu beraten. In Preußen (Verordnungen vom 20. März
1817 und 6. Jan. 1848) war der S. bis 1848 eine wichtige
Institution, deren Bedeutung jedoch mit der Entwickelung des
Konstitutionalismus nahezu aufhörte, wenn auch ein Erlaß
vom 12. Jan. 1852 eine Wiederbelebung versucht hat. Auch der 1884
gemachte Wiederbelebungsversuch und die Übertragung des
Vorsitzes auf den damaligen Kronprinzen Friedrich Wilhelm hatten
keinen nennenswerten Erfolg. Der S. setzt sich zusammen aus den
Prinzen des königlichen Hauses, sobald sie das 18. Lebensjahr
erreicht haben, und aus den Staatsdienern, welche durch ihr Amt zu
Mitgliedern des Staatsrats berufen sind, nämlich dem
Präsidenten des Staatsministeriums, den Feldmarschällen,
den aktiven Staatsministern, dem Chefpräsidenten der
Oberrechnungskammer, dem Geheimen Kabinettsrat und dem Chef des
Militärkabinetts. Ferner haben die kommandierenden Generale
und die Oberpräsidenten, wenn sie in Berlin anwesend sind,
Sitz und Stimme im S. Dazu kommen dann diejenigen Staatsdiener,
welchen aus besonderm königlichen Vertrauen Sitz und Stimme im
S. beigelegt ist. Derartige Ernennungen erfolgten 1884 in
beträchtlicher Anzahl. Auch in Bayern, Elsaß-Lothringen,
Sachsen und Württemberg besteht ein S. Vgl. Sailer, Der
preußische S. (Berl. 1884). In der absoluten Monarchie,
insbesondere in Rußland, ist der S. (in Rußland
"Reichsrat") eine Art Ersatz der Volksvertretung. In manchen
Staaten ist S. auch Titel für höhere Staatsbeamte,
namentlich für die verantwortlichen Vorstände von
Ministerialabteilungen, in Rußland auch für verdiente
Gelehrte.
Staatsrechnungshof, s. Oberrechnungskammer.
Staatsrecht (Jus publicum) im weitern Sinn s. v. w.
öffentliches Recht; im engern und eigentlichen und zwar im
subjektiven Sinn wird damit unter Ausscheidung des Straf- und
Prozeßrechts, des Kirchen- und Völkerrechts der
Inbegriff der Rechte und Pflichten bezeichnet, welche durch das
Staatswesen für die Regierung und für die Regierten im
Verhältnis zueinander und für die letztern untereinander
begründet, im objektiven Sinn die Gesamtheit derjenigen
Rechtsgrundsätze, durch welche jene Rechte und Pflichten
normiert werden. Je nachdem nun diese Grundsätze unmittelbar
aus dem Begriff und aus dem Wesen des Staats überhaupt
abgeleitet und entwickelt werden, oder je nachdem es sich um die
positiven Satzungen eines bestimmten Staats, z. B. des Deutschen
Reichs, handelt, wird zwischen allgemeinem (philosophischem,
natürlichem) und besonderm (positivem, historischem) S., z. B.
dem S. des Deutschen Reichs, unterschieden. Ferner unterscheidet
man nach den Gegenständen, auf welche sich jene Satzungen
beziehen, zwischen äußerm und innerm S., je nachdem es
sich um die äußern Verhältnisse und um die Stellung
des Staats andern Staaten gegenüber oder um innere
Staatsangelegenheiten handelt. Für Deutschland insbesondere
war zur Zeit des frühern Deutschen Reichs die Einteilung in
Reichsstaatsrecht und Territorial- oder Landesstaatsrecht von
Wichtigkeit, indem man damit die auf Verfassung und Regierung des
Reichs bezüglichen Satzungen den für die einzelnen
Territorien besonders gegebenen staatsrechtlichen Bestimmungen
gegenüberstellte, eine Einteilung, welche nach der Errichtung
des neuen Deutschen Reichs, und nachdem so die bisherige Einteilung
in Bundesrecht und Landesstaatsrecht hinweggefallen, wiederum
praktische Bedeutung gewonnen hat. Ferner pflegt man neuerdings aus
dem S. das Verwaltungsrecht auszuscheiden, als den Inbegriff
derjenigen Rechtsgrundsätze, nach welchen sich die
Thätigkeit der Verwaltungsorgane in den einzelnen Fällen
richtet. Dem S. (Verfassungsrecht) verbleibt alsdann die Lehre von
dem Herrschaftsbereich und von der Organisation der Staatsgewalt
(Monarch, Volksvertretung, Behörden, Kommunalverbände),
von ihren Funktionen und von den Rechtsverhältnissen der
Unterthanen. Die staatsrechtliche Litteratur, namentlich die
deutsche, ist eine sehr reichhaltige. Die zahlreichen Publizisten
des 16. und 17. Jahrh., unter denen besonders Pufendorf, Leibniz,
Cocceji und Thomasius zu nennen sind, wurden von J. J. Moser durch
die Gründlichkeit, womit er in seinen zahlreichen Schriften
die verschiedenen Zweige des Staatsrechts behandelte, und von
Pütter, dem größten Staatsrechtslehrer des vorigen
Jahrhunderts, übertroffen, welcher auf historischer Grundlage
zuerst einer systematischen Bearbeitung des Staatsrechts die Bahn
eröffnete. Unter den neuern Systemen des Staatsrechts sind die
von Zachariä (3. Aufl., Götting. 1865-67, 2 Bde.),
Zöpfl (5. Aufl., Leipz. 1863), Held (Würzb. 1856-57, 2
Bde.), Gerber (3. Aufl., Leipz. 1880), Laband (Tübing.
1876-82, 3 Bde.), G. Meyer (2. Aufl., Leipz. 1885), Zorn (Berl.
1880-83, 2 Bde.), H. Schulze (Leipz. 1881), Kirchenheim (Stuttg.
1887) und Gareis u. Hinschius (Freib. 1887) hervorzuheben. Unter
den Bearbeitungen des partikulären Staatsrechts, von welchen
besonders die von Schulze (Preußen), Mohl (Württemberg),
Pözl (Bayern), Milhauser (Sachsen) und Wiggers (Mecklenburg)
zu nennen sind, steht Rönnes "S. der preußischen
Monarchie" (4. Aufl., Leipz. 1882 ff., 5 Bde.) obenan. Ebenso ist
unter den systematischen Bearbeitungen des deutschen
Reichsstaatsrechts der Gegenwart das Werk von Rönne (2. Aufl.,
Leipz. 1877) wegen seiner Reichhaltigkeit und Gründlichkeit
von Bedeutung. Um die Bearbeitung des allgemeinen Staatsrechts hat
sich namentlich Bluntschli verdient gemacht, welcher in der
"Deutschen Staatslehre für Gebildete" (2. Aufl.,
Nördling. 1880) auch eine populäre Darstellung des
Staatsrechts zu geben versuchte. Vgl. außer den
angeführten Lehr- u. Handbüchern des Staatsrechts:
Bluntschli, Lehre vom modernen Staat (Stuttg. 1875 ff.), Bd. 1.
"Allgemeine Staatslehre", Bd. 2: "Allgemeines S." (6. Aufl. des
frühern Werkes, welches unter diesem Titel erschien), Bd. 3:
"Politik"; Sarwey, Das öffentliche Recht und die
Verwaltungsrechtspflege (Tübing. 1880); Marquardsen, Handbuch
des öffentlichen Rechts der Gegenwart (in
Einzelbeiträgen, Freib. 1885 ff.); Hirth, Annalen des
Deutschen Reichs (Leipz. 1871 ff.). Encyklopädische Werke:
Rotteck u. Welcker, Staatslexikon (3. Aufl., Leipz. 1856-66, 14
Bde.); Bluntschli und Brater, Staatswörterbuch (Stuttg.
1856-70, 11 Bde.); kleinere Lexika von K. Baumbach (Lpz. 1882),
Rauter (Wien 1885) u. a.
Staatsromane, Schriften, welche in der Form eines Romans
die Zustände und Einrichtungen eines Staats behandeln, und
zwar indem sie "den realen Erscheinungen des staatlichen Lebens
gegenüber ein Ideal aufstellen, welchem sie das Gewand der
Wirklichkeit geben". Werke ähnlicher Art finden sich schon bei
den Griechen; wir erinnern nur an Platons "Republik" und Xenophons
"Kyropädie". In der modernen Litteratur eröffnete den
Reigen der S. Thomas Morus' "Beschreibung der Insel Utopia (1515),
der sich ein Jahrhundert später des Dominikanermönchs
Thomas Campanella "Sonnenstaat" ("Civitas solis", 1620; deutsch von
Grün, Darmst. 1845), J. Valentin Andreäs "Reipublicae
christiano-poli-
203
Staatsschatz - Staatsschulden.
tanae descriptio" (1619), Bacons "Nova Atlantis" (geschrieben um
1624), Harringtons "Oceana" (1656) u. a. anreihten. Aus
späterer Zeit sind hervorzuheben: Fénelons
"Télémaque" (1700) nebst Ramsays "Voyages de Cyrus"
(1727); Holbergs "N. Klimii iter subterraneum" (1741); Morellys
"Naufrage des îles flottantes, ou la Basiliade" (1753) und
"Code de la nature" (1755); Stanislaus Leszczynskis "Entretien d'un
Européen avec un insulaire du royaume de Dimocala" (1756);
Fontenelles (?) "République des philosophes" (1768); Albr.
v. Hallers Romantrilogie "Usong" (1771), "Alfred, König der
Angelsachsen" (1773) und "Fabius und Cato" (1774); Wielands
"Goldener Spiegel" (1772); Cabets "Voyage en Icarie" (1840) u.a.
Vgl. R. v. Mohl, Die S. (in seiner "Geschichte und Litteratur der
Staatswissenschaften", Bd. 1, Erlang. 1855).
Staatsschatz, s. v. w. Staatskasse, insbesondere ein
Vorrat an barem Geld, welcher vom Staat für
außergewöhnliche Bedürfnisse, vornehmlich zur
Deckung der ersten großen Ausgaben vor Ausbruch und bei
Beginn eines Kriegs zurückgelegt und unter besonderer
Verwaltung gehalten wird. Ein solcher Schatz wurde früher von
Herrschern im dynastischen Interesse (Perser, orientalische
Fürsten) erhalten. Gegenwärtig hat nur das Deutsche Reich
einen S. von Bedeutung. In Preußen, wo Friedrich Wilhelm I.
einen ansehnlichen S. bildete, mußten
Etatsüberschüsse, sofern über dieselben nicht
anderweit durch Gesetz verfügt war, in den S. abgeliefert
werden, ohne daß für die Höhe eine Grenze gesetzt
war. 1866 wurde, nachdem der vorhandene Schatz für
Kriegszwecke verwandt worden war, ein neuer S. im Betrag von 30
Mill. Thlr. gebildet. An dessen Stelle ist 1871 der
Reichskriegsschatz (s. d.) getreten. Die volkswirtschaftlichen,
teilweise aus merkantilistischen Überschätzungen des
Geldes hervorgegangenen Bedenken, welche man früher gegen den
S. hegte, als werde durch denselben dem Verkehr produktives Kapital
entzogen, halten nicht Stich gegenüber dem Bedürfnis, bei
unvermutetem Ausbruch eines Kriegs auf eine bereite Summe rasch
zurückgreifen zu können, ohne durch sofortige
Ausschreibung von Kriegssteuern Mißtrauen zu erregen oder
sich der Gefahr auszusetzen, bei Auflegung eines Anlehens nicht die
ganze gewünschte Summe zu erhalten oder dasselbe zu allzu
niedrigem Kurs begeben zu müssen. Wie viele andre Güter,
welche für den Fall eines Bedürfnisses bereit gehalten
werden müssen, ist der S., auch wenn er keine Zinsen
trägt, keineswegs als totes Kapital zu betrachten, sobald er
nur seinen Zweck erfüllt. Übrigens ist die Notwendigkeit
der Ansammlung eines Staatsschatzes eine durchaus relative, indem
sie durch die politische Stellung des Staats, Beschaffenheit des
Staatsgebiets, Ausbildung des Kreditwesens etc. bedingt ist.
Staatsschrift, s. Deduktion.
Staatsschuldbuch, amtliches Register, in welches
Darlehnsforderungen an die Staatskasse in der Form von Buchschulden
eingetragen werden können. Nach dem preußischen Gesetz
vom 20. Juli 1883 kann der Inhaber einer Schuldverschreibung der
konsolidierten Staatsanleihe gegen Einlieferung des Schuldbriefs
die Eintragung dieser Schuld in das bei der Hauptverwaltung der
Staatsschulden geführte S. beantragen. Dadurch entsteht eine
Buchschuld des Staats auf den Namen des eingetragenen
Gläubigers. Dieser Eintrag vertritt die Stelle einer
Obligation. Der Gläubiger erhält zwar über den
erfolgten Eintrag eine Benachrichtigung, allein diese
Benachrichtigung ist auch nichts weiter als eine solche; sie
repräsentiert nicht wie die Staatsobligation die Forderung
selbst. Da noch ein zweites Exemplar des Staatsschuldbuchs an einem
andern Ort geführt wird, so ist durch das S. der Vorteil einer
absoluten Sicherheit gegeben. Das S. ist so für Stiftungen,
Fideikommisse, vormundschaftliche und ähnliche
Vermögensverwaltungen, aber auch für einzelne
Privatpersonen von großer Wichtigkeit. Durch Löschung
der Buchschuld und Ausreichung eines neuen Inhaberschuldbriefs kann
der betreffenden Forderung die Zirkulationsfähigkeit
wiedergegeben werden. Vgl. "Amtliche Nachrichten über das
preußische S." (3. Ausg., Berl. 1888). In Frankreich wurde
ein S. (Grand-livre de la dette publique) schon durch Gesetz vom
24. Aug. 1793 eingeführt.
Staatsschulden. Auch bei durchaus geordnetem Staatsleben
ist eine unmittelbare Deckung der erforderlichen Ausgaben nicht
immer möglich. Oft können Leistung und Gegenleistung der
Natur der Sache nach sich nicht sofort begleichen, und es sind
infolge dessen Kreditverträge unvermeidlich. Hieraus
entspringen die sogenannten Verwaltungsschulden, d. h. diejenigen,
welche aus der Wirtschaftsführung der einzelnen
Verwaltungszweige hervorgehen, und die innerhalb des Rahmens der
diesen Zweigen überwiesenen Kredite oder ihrer eignen
Einnahmen ihre Tilgung finden (A. Wagner). Zu unterscheiden hiervon
sind die Finanzschulden, d. h. solche, welche die allgemeine
Finanzverwaltung macht. Dieselben werden zum Teil nur zu dem Zweck
aufgenommen, um in einer Finanzperiode den Etat
kassengeschäftlich durchzuführen. Einnahmen und Ausgaben
sind in einer solchen Periode nicht immer gleich hoch, wenn sie
sich auch summarisch begleichen. Erfolgen die Einnahmen erst
später, während vorher die entsprechenden Ausgaben zu
bestreiten sind, so kann man sich durch Aufnahme einer
vorübergehenden Anleihe, einer sogen. schwebenden Schuld
(franz. dette flottante, engl. Floating debt, flottierende Schuld,
auch unfundierte Schuld genannt) helfen, deren Rückzahlung mit
Hilfe jener bestimmten Einnahmen in Aussicht genommen werden kann.
Die übliche Form solcher Schulden ist die Ausgabe von
verzinslichen, zu festgesetzter Zeit wieder einlösbaren
Schatzscheinen (s. d.). Dem Wesen nach sind hierher auch alle
diejenigen Schulden zu rechnen, welche dazu dienen, um
Störungen infolge unerwarteter Mindereinnahmen oder
Mehrausgaben zu begleichen, die in der folgenden Finanzperiode ihre
Deckung finden sollen und meist ebenfalls durch Begebung von
Schatzscheinen aufgenommen werden können. Solche schwebende
Schulden werden oft prolongiert und dadurch thatsächlich zu
dauernden. Sie werden aber auch oft, wenn die Finanzverwaltung mehr
nur die Bedürfnisse der Gegenwart ins Auge faßt, formell
in bleibende oder fundierte Schulden umgewandelt. Überhaupt
gehören zu den schwebenden Schulden alle kurzfristigen und
stets fälligen Verbindlichkeiten, insbesondere die
verschiedenen Depositenschulden, welche in Frankreich (Caisse des
depôts et des consignations) einen hohen Betrag ausmachen.
Ursprünglich bezeichnete man als fundierte Schulden solche,
für deren Verzinsung und Tilgung bestimmte Einnahmen
vorgesehen oder auch verpfändet waren. Heute, wo diese Art der
Fundierung meist außer Gebrauch gekommen ist, nennt man
fundierte Schulden schlechthin solche, für welche eine rasche
Rückzahlung nicht vorgesehen oder eine bestimmte
Tilgungspflicht nicht übernommen wird. Da grund-
204
Staatsschulden (Arten der Staatsanleihen, Emission).
sätzlich die ordentlichen Ausgaben durch ordentliche
Einnahmen gedeckt werden sollen, so dürfte die Aufnahme von
dauernden Schulden nur in Frage kommen, wenn es sich darum handelt,
Mittel zur Ermöglichung außergewöhnlicher
Aufwendungen zu beschaffen, wie sie im Interesse des Schutzes und
der Selbsterhaltung (Krieg) oder in demjenigen einer positiven
Wohlfahrtsförderung durch Ausführung kostspieliger
Unternehmungen (Meliorationen, Flußregulierungen, Bahnbau
etc.) nötig werden. Da nun in solchen Fällen alle
Aufwendungen tatsächlich jetzt schon gemacht werden, so sind
auch alle Opfer von der Gesamtheit heute schon zu tragen, sie
können nicht der Zukunft durch Aufnahme von Anlehen
zugewälzt werden. Dieser Umstand gab zur Forderung
Veranlassung, es sollten auch alle außerordentlichen Ausgaben
durch Besteuerung gedeckt werden. Man übersieht jedoch
hierbei, daß alle Ausgleichungen von Störungen des
volkswirtschaftlichen Gleichgewichts mit Opfern verknüpft
sind, ferner daß, wenn auch bei der Steuer wie beim Anlehen
die jetzt aufzulegende Last die gleiche ist, doch nicht in beiden
Fällen die gleichen Personen als Träger derselben
erscheinen. Die Steuer muß von allen Staatsangehörigen
entrichtet werden ohne Rücksicht darauf, ob die Summen
überall gleich verfügbar sind. Bei dem freiwilligen
Anlehen werden dagegen vorwiegend die disponibleren Summen
angeboten. Strömt bei demselben auch Kapital aus dem Ausland
zu, so führt die augenblickliche örtlich-persönliche
Übertragung der Last auch für das ganze Volk zu einer
zeitlichen, indem die jetzige Aufwendung von einer spätern
Generation bei der Tilgung getragen wird. Was hier von Volk zu
Volk, das tritt im andern Fall von Klasse zu Klasse ein. Insofern
kommt auch hier eine zeitliche Überwälzung der Last vor.
Eine solche Überwälzung ist an und für sich
gerechtfertigt, wenn den spätern Steuerträgern auch die
Vorteile der außerordentlichen Aufwendung zu gute kommen. Zu
ungunsten der Besteuerung kann noch weiter der Umstand sprechen,
daß die Veranlagung derselben praktisch immer unvollkommen
ist, Ungleichmäßigkeiten aber um so schwerer empfunden
werden, je höher die Steuer ist. Hiernach kommen bei der
Frage, ob Anlehen oder Besteuerung, im wesentlichen die Wirkung der
Steuerauflegung und die der außerordentlichen Aufwendung in
Betracht. Ist letztere sehr hoch, und kommt sie den spätern
Staatsangehörigen vorzüglich zugute, so ist das Anlehen,
im andern Fall die Besteuerung am Platz. Da nun ersteres die
Möglichkeit der Lastenüberschiebung bietet, so gibt es
allerdings leicht Veranlassung zu unwirtschaftlichen Mehrausgaben,
welche unterblieben wären, wenn man sie sofort hätte
decken müssen. Für das Anlehen wird weiter geltend
gemacht, daß dasselbe Gelegenheit zu sicherer Kapitalanlage
biete, infolgedessen zu Fleiß und Sparsamkeit anrege und in
den Gläubigern konservative staatserhaltende Kräfte
schaffe, während freilich damit auch die Bildung
müßiger Rentnerexistenzen veranlaßt wird.
Arten der Staatsanleihen. Emission.
Man unterscheidet freiwillige und erzwungene oder
Zwangsanleihen. Zu letztern rechnet man die Einziehung von Bank-
und Kautionskapitalien, Einstellung fälliger Zahlungen,
erzwungene Steuervorschüsse, die eigentlichen Zwangsanleihen
mit Zins- und Tilgepflicht, dann auch die Ausgabe von Papiergeld.
Die eigentlichen Zwangsanleihen, früher auch patriotische
Anleihen genannt, kommen beider heutigen Kreditentwickelnng nur
noch selten vor, und man greift in der Not schon lieber zum Mittel
der Ausgabe von Papiergeld (s. d.). Letzteres bildet jedoch als
unverzinsliche Schuld ein verlockendes, deshalb aber auch
gefährliches Mittel. Der Verkehr wird jeweilig bis zu einer
gewissen Menge Papiergeld willig annehmen, ohne daß der Kurs
unter pari sinkt. Dies geschieht jedoch, sobald jene Grenze
überschritten wird, ohne daß dafür gesorgt ist,
daß die überschüssige Menge bei vorhandenen
Einlösungsstellen wieder zurückfließen kann. Der
Zwangskurs führt somit von jener Grenze ab zur Entwertung,
welche für Geldwesen, Verkehr und Staatskredit gleich
schädlich ist. Die freiwilligen Anlehen sind innere, wenn sie
im Inland aufgelegt werden, was jedoch nicht ausschließt,
daß sich bei denselben auch fremdes Kapital beteiligt. Die
äußern Anlehen werden im Ausland aufgenommen und lauten
dann auf fremde Währung oder auf mehrere in ein festes
Verhältnis zu einander gesetzte Geldsorten. Bei unentwickeltem
Kredit müssen den Gläubigern besondere Sicherheiten
bestellt werden. Dies geschah früher durch Verpfändung
von Domänen und Landesteilen, durch "Radizierung" von
Verzinsung und Tilgung auf bestimmte Einnahmequellen, welche auch
oft den Gläubigern zur eignen Verwaltung überwiesen
wurden. In modernen Kulturstaaten mit entwickeltem Kredit ist die
Verpfändung nicht mehr nötig. An ihre Stelle tritt der
allgemeine auf Reichtum des Volkes u. Vertrauenswürdigkeit
seiner Regierung gegründete Staatskredit, von dessen Höhe
Zins und Emissionskurs abhängen.
Die Begebung (Emission) von Staatsanleihen erfolgt entweder auf
direktem Weg, indem der Staat sich unmittelbar an die Kapitalisten
wendet, oder indirekt, indem der Staat sich der
Zwischenhändler bedient. Im erstern Fall kann der Staat die
Anlehenspapiere (Staatsschuldscheine, Staatspapiere) auf eigne
Rechnung durch Agenten und Makler gegen Provision verkaufen
(Kommissionsanleihe, weil das Zusammenbringen der Zeichnungen in
Kommission gegeben wird), was bei kleinen Beträgen anwendbar
ist, bei großen leicht einen Kursdruck bewirkt, oder er
befolgt das französische System des beständigen
Rentenverkaufs durch Hauptsteuereinnehmer, welche das Recht haben,
Inskriptionen im großen Buch vorzunehmen und Schuldtitel
auszustellen, oder endlich, er beschreitet bei großem Bedarf
den Weg der Auflegung zur allgemeinen öffentlichen
Subskription. Bei letzterer werden die Kapitalbesitzer unmittelbar
aufgefordert, an bestimmten Stellen (Zeichen-,
Subskriptionsstellen) ihre Erklärung zur Beteiligung an dem
Anlehen in vorgeschriebener Weise kundzugeben und gegen meist
ratenweise Einzahlung die betreffenden Dokumente in Empfang zu
nehmen. Wird der geforderte Betrag überzeichnet, so findet
gewöhnlich eine Reduktion nach Verhältnis der
gezeichneten Summen statt. Die indirekte Emission (Negoziation)
kommt meist in der Form der Submission vor. Der Staat fordert
größere Geldinstitute, bez. Bereinigungen von solchen
(Konsortien) auf, ein Angebot zu stellen, leiht die erforderliche
Summe von demjenigen, welcher sich unter sonst gleich
günstigen Bedingungen mit dem geringsten Gewinnsatz
begnügt, also den höchsten Kurs zahlt, und
überliefert ihm hierauf die bedungenen Obligationen, welche
der Darleiher bei dem Publikum durch Subskription, Verkauf an der
Börse oder sonst unter der Hand zu möglichst hohem Kurs
auf eigne Rechnung unterzubringen sucht. Der gewöhnlich in
Prozenten des Anleihekapitals ausgedrückte Gewinn, den hierbei
der Übernehmer der Anleihe er-
205
Staatsschulden (Kündigung, Tilgung, Konversion).
zielt, heißt Bonus. Derselbe kann um so kleiner sein, je
größer der Staatskredit und je mehr Kapital auf dem
Geldmarkt zur Verfügung steht. Auch können die
Unternehmer, statt unmittelbar die Obligationen an den Staat zu
bezahlen, die Garantie für ein bestimmtes
Minimalerträgnis übernehmen. Diese Form der Emission
bietet den Vorteil, daß die gewünschte Summe
vollständig beschafft wird und alle einzelnen Punkte in Bezug
auf Zahlung, Raten und Fristen von vornherein festgestellt werden
können. Dagegen kommt sie leicht sehr teuer, wenn die
Darleiher wegen hohen Risikos auf hohen Gewinn rechnen müssen.
Darum wird, wenn die Summe nicht plötzlich ihrem vollen Betrag
nach aufzubringen ist und der Kredit des Darlehensnehmers einen
hohen Emissionskurs anzusetzen gestattet, ohne daß aus einem
submissionsweisen Unterbieten erhebliche Vorteile zu erwarten
wären, die direkte Emission am Platze sein. In besonders
kapitalreichen Ländern, welche der Garantie durch Bankiers
nicht bedürfen, werden mit der Subskription überhaupt
leicht günstigere Erfolge erzielt.
Die Anlehenspapiere werden meist unter pari begeben, so
daß der wirkliche Zinssatz unter den Nominalzinsfuß zu
stehen kommt. Je höher der vom Nominalbetrag gewährte
Zins, um so höher kann der Emissionskurs sein. Ob nun ein
niedriger Nominalzinsfuß mit geringem oder ein hoher mit
hohem Kurs vorzuziehen ist, hängt im wesentlichen von der Art
der Tilgung und den Schwankungen des landesüblichen Zinssatzes
ab. Ist ein Sinken des Zinses wahrscheinlich und Gefahr vorhanden,
daß der Staat kündigt, sobald der Kurs über pari
gestiegen ist, so wird die Neigung größer sein, Papiere
zu nehmen, die zu geringem, als solche, die zu hohem Nominalzins
ausgeboten werden. Infolgedessen werden Papiere der erstern Art zu
verhältnismäßig höherm Kurs begeben werden
können. Allerdings wird damit auch die Tilgung erschwert,
indem bei der Einlösung der Nennbetrag zurückzuzahlen
ist.
Die Staatsschuldscheine lauten entweder auf den Inhaber oder auf
Namen. Im letztern Fall werden die Namen der Besitzer im
Staatsschuldbuch (s. d.) eingetragen. Die Übertragung auf
Dritte erfolgt durch Umschreibung, kann aber auch durch Ausgabe von
Certifikaten (s. d.) erleichtert werden. Einzelne Staaten besorgen
auf Wunsch die Umwandlung von Inhaberpapieren in Namenpapiere und
umgekehrt (vgl. Außerkurssetzung). Die Papiere selbst
bestehen aus der eigentlichen Schuldurkunde und, wenn sie
periodisch auszuzahlende Zinsen tragen, aus dem meist mit einem
Talon versehenen Kouponbogen (s. Koupon). Der Nominalbetrag lautet
auf abgerundete Summen, und zwar sind die Appoints so zu
wählen, daß auf genügende Beteiligung desjenigen
Publikums gerechnet werden darf, dessen Zuziehung als
erwünscht erscheint.
Kündigung. Tilgung.
Die Staatsschuld kann sein 1) eine von beiden Seiten
aufkündbare. Eine solche kann zur Bedrängnis der
Finanzverwaltung führen. Sie ist deshalb um so weniger zu
empfehlen, als die Erfahrung lehrt, daß den Gläubigern
ein freies Kündigungsrecht nicht eingeräumt zu werden
braucht; 2) eine von beiden Seiten unaufkündbare und zwar
entweder mit festem Rückzahlungstermin oder ohne solchen. In
die letztere Klasse gehört die echte ewige Rente, welche nur
dadurch getilgt werden kann, daß die Rententitel an der
Börse zurückgekauft werden; in die erstere Klasse
gehören die temporären oder Zeitrenten, wie die
eigentlichen Zeitrenten oder Annuitäten (s. d.), durch deren
Zahlung in bestimmter Frist das Kapital verzinst und getilgt wird,
dann dem Wesen der Sache nach die Leibrenten und Tontinen (s.
Rente), ferner die Lotterieanlehen (s. Lotterie) sowie diejenigen
Obligationen, bei denen bestimmte Tilgungstermine festgesetzt sind
und durch Verlosung die zu tilgenden Serien und Nummern
festgestellt werden. Die Schuld kann endlich auch sein 3) eine nur
vom Staat, nichts aber auch vom Schuldner jederzeit
aufkündbare (terminable, amortisierbare Anlehen, deren Titel
gewöhnlich schlechthin Obligationen genannt werden). Hierher
sind auch viele Rentenschulden zu rechnen wie z. B. die englischen
Konsols, deren Rentenverschreibungen (bonds) sich auf eine
bestimmte Kapitalsumme beziehen, zu welcher der Staat jederzeit
einlösen kann. Bisweilen wird auch eine Minimal- und eine
Maximalfrist für die Rückzahlung bestimmt, innerhalb
deren die Verwaltung freie Hand hat. Eine Verpflichtung zur Tilgung
zu bestimmter Zeit kann für die Finanzverwaltung sehr
lästig werden. Die Tilgung kann dann leicht zu einem Zeitpunkt
stattfinden, in welchem keine Mittel verfügbar oder gar zu
großen außerordentlichen Aufwendungen Anlehen
aufgenommen werden müssen. Alsdann kann leicht der Fall
eintreten, daß nicht allein neue Schulden lediglich zu dem
Zweck gemacht werden müssen, um alte heimzuzahlen, sondern
daß auch neue Anlehen unter ungünstigern Bedingungen
abgeschlossen werden. Aus diesem Grund empfiehlt es sich auch
nicht, einen besondern Tilgungsfonds (s. d.) zu bilden, sondern
vielmehr jeweilig Tilgungen vorzunehmen, wenn die Einnahmen die
Ausgaben übersteigen. Allerdings wäre im Interesse eines
geordneten Staatshaushalts schon bei Aufstellung des Budgets darauf
zu sehen, daß auch wirklich vorteilhafte Tilgungen
stattfinden können. Andernfalls würde Schuld auf Schuld
gehäuft und eine unbillige Lastenabwälzung bewirkt.
Für die technische Erledigung der Geschäfte, welche sich
an die Staatsschulden anknüpfen, sind besondere Stellen
erforderlich, und zwar können hierfür entweder besondere
Behörden und Kassen (Staatsschuldenverwaltung, Amortisations-,
Schuldentilgungskasse) eingerichtet oder auch Banken mit der
Besorgung beauftragt werden. Für Kontrolle der
Staatsschuldenverwaltung werden in mehreren Staaten aus den
Mitgliedern der Volksvertretung besondere
Staatsschuldenkommissionen gebildet. Ist der Staat nicht durch
einen Verlosungsplan oder überhaupt durch einen Vertrag an die
Tilgung gebunden, und hat er freies Kündigungsrecht, so kann
er Obligationen aufrufen und zum Nominalbetrag heimzahlen oder
dieselben durch Agenten an der Börse aufkaufen lassen.
Ersteres empfiehlt sich, wenn bei sinkendem Zinsfuß der Kurs
der Papiere über pari steigt, letzteres, wenn bei niedrigem
Kurs verfügbare Geldbestände in der genannten Weise
vorteilhaft verwendet werden können.
Konversion. Statistisches.
Kündigungen sind nicht allein am Platz, wenn Schulden
getilgt werden sollen, sondern auch wenn der Staat in der Lage ist,
neue Anlehen zu günstigern Bedingungen aufzunehmen,
insbesondere wenn der Staatskredit gestiegen oder der
landesübliche Zinsfuß gesunken ist. In diesem Fall kann
der Staat Zinsherabsetzungen (Zinsreduktionen), bez.
Schuldumwandlungen (Konversionen, Rentenkonversionen) durch
Änderung von Schuldbedingungen, welche die Zinsenlast
verringern, vornehmen. Solche Konversionen oder Reduktionen sind
dann angezeigt, wenn bei gu-
206
Staatssekretär - Staatsverbrechen.
tem Kredit des Staats der Kurs über pari gestiegen, mithin
Geld zu einem niedrigern Zins zu haben ist. Zur sichern
Durchführung der genannten Maßregel ist es nötig,
daß die Finanzverwaltung der Einwilligung der meisten
Gläubiger gewiß ist und die nötigen Mittel bereit
gehalten werden, um die erforderlichen Heimzahlungen
vollständig bewirken zu können. Hierauf werden die
Gläubiger öffentlich aufgefordert, ihren Willen zu
erklären. Diejenigen, welche den neuen Bedingungen zustimmen,
erhalten für die alten Obligationen, falls dieselben nicht nur
einfach abgestempelt werden, neue mit entsprechenden Kouponbogen,
die übrigen Schuldtitel werden gegen bar eingelöst. Meist
wird, um die Gläubiger der Konversion geneigt zu stimmen, noch
eine besondere Konversionsprämie in einem Prozentsatz der
umzutauschenden Summe zugestanden. Solche Konversionen sind dann
unmöglich, wenn der Staat sich an einen bestimmten
Tilgungsplan gebunden hat oder die Kündigung überhaupt
ausgeschlossen ist; sie werden unvorteilhaft, wenn das Anlehen zu
einem zu niedrigen Nominalzinsfuß und damit auch zu niedrigem
Kurs begeben worden ist. Die Zinsreduktionen werden oft mit der
Konsolidation oder Schuldzusammenziehung verbunden, d. h mit
Operationen, durch welche mehrere Anlehen verschiedener Benennung
und mit verschiedenen Nominalzinsfüßen in eine einzige
mit nur einem Zinsfuß zusammen verbunden werden. Dieser
Umstand hat dazu Veranlagung gegeben, daß die Worte
Konversion, Zinsreduktion und Konsolidation oft als gleichbedeutend
gebraucht werden. Die Konvertierung kann auch unter der Form der
Arrosierung auftreten. Unter letzterer ist jede Nachzahlung zu
verstehen, welche zu dem Zweck gemacht wird, um bereits bestehende
Ansprüche behaupten zu können. So verlangte
Österreich 1805 und 1809 Nachzahlungen von den Inhabern von
Schuldscheinen, welche ihrer Forderungsrechte überhaupt nicht
verlustig gehen wollten. Die Arrosierungsanlehen können jedoch
auch den Charakter freier Übereinkunft behaupten. Steigt der
Zinsfuß erheblich, während der Kurs vorhandener, zu
niedrigem Nominalzinsfuß abgeschlossener Anlehen stark sinkt,
so kann die Möglichkeit einer spätern Zinsreduktion und
einer Tilgung dadurch geschaffen werden, daß der
Nominalzinsfuß erhöht wird und zudem Ende die
Gläubiger zu Zahlungen aufgefordert werden. Gewaltsame
Ermäßigung von Zins und Schuldsumme ohne
Einverständnis der Gläubiger nennt man Staatsbankrott (s.
d.).
In den meisten Ländern ist bei der gegebenen Lage der
Finanzverwaltung (fortwährend steigende Ausgaben) an eine
erfolgreiche Tilgung der Schulden nicht zu denken. Letztere sind
vielmehr seit Ende vorigen Jahrhunderts stetig gestiegen. Eine
genaue Vergleichung der Schulden verschiedener Länder und
Zeiten ist zwar unmöglich; doch bieten die Zahlen
nachfolgender Tabelle immerhin einen brauchbaren Inhalt für
die Beurteilung im allgemeinen. Unter der Hauptsumme von 91,794
Mill. Mk. (für 1880) sind 6984 Mill. Mk. Eisenbahnschulden.
Auf Deutschland allein entfallen davon 2700 Mill. Mk., so daß
unter den Großstaaten Deutschland
verhältnismäßig am günstigsten gestellt ist.
Die Ausgaben für Verzinsung und Tilgung der[e] Schuld waren in
Millionen Mark 1885: in Frankreich 1067, England 591, Rußland
521, Italien 436, Österreich-Ungarn 372, Spanien 219,
Vereinigte Staaten 201, Niederlande 58, Preußen 182, Bayern
51, Sachsen 31, Württemberg 17, Deutsches Reich 17. Es
betrugen die S. (in Millionen Mark) in:
Länder...................1787 1816 1846 1874 1880
Frankreich.............1500 1680 3300 18126 24798
Großbritannien.......4800 16990 16080 15690 14834
Spanien..................600 2250 3600 7200 10333
Italien.....................240 900 1200 7830 10006
Österreich-Ungarn... 690 1800 2490 7290 7992
Rußland...................600 2400 1800 6700 7211
Türkei - - - 2250 5727
Deutschland ...........240 1020 900 3150 4821
Portugal ..................60 240 480 2160 1745
Belgien .................. - - 450 564 1633
Niederlande...........1500 2700 2400 1520 1579
Rumänien..............- - - 120 377
Griechenland..........- - 120 212 277
Schweden................18 24 30 144 220
Dänemark................46 108 330 270 194
Serbien...................- - - - 28
Norwegen................- 26 16 40 17
Zusammen:............10294 30058 33196 75266 91794
Regelmäßige Angaben über die S. aller
Länder der Erde liefert das "Diplomatisch-statistische
Jahrbuch des Gothaischen Hofkalenders". Vgl. Nebenius, Der
öffentliche Kredit (2. Aufl., Karlsr. 1829); Baumstark,
Staatswissenschaftliche Versuche über Staatskredit, Steuern
und Staatspapiere (Heiden. 1833); Hock, Die öffentlichen
Abgaben und Schulden (Stuttg. 1863); Eug. Richter, Das
preußische Staatsschuldenwesen (Bresl. 1869); Salings
Börsenpapiere, finanzieller Teil (12. Aufl., Berl. 1888).
Staatssekretär, der Chef eines Verwaltungsressorts.
Wenn man auch den Ausdruck S. vielfach gleichbedeutend mit Minister
gebraucht, so besteht zwischen beiden im konstitutionellen
Staatswesen doch ein wichtiger Unterschied, indem der Minister der
Volksvertretung verantwortlich ist, der S. nicht. Der Minister hat
eine politische, der S. eine geschäftliche Stellung. Im
Deutschen Reich ist der Reichskanzler der alleinige verantwortliche
Minister. Die Chefs der einzelnen Reichsämter, die
Staatssekretäre des Auswärtigen Amtes, des Reichsamtes
des Innern, des Reichsjustizamtes, des Reichsschatzamtes und des
Reichspostamtes haben keine selbständige politische Stellung.
Den Staatssekretären des Auswärtigen und des Innern sind
Unterstaatssekretäre beigegeben. In Preußen führen
die Vertreter der verantwortlichen Minister den Amtstitel
Unterstaatssekretär. In Elsaß-Lothringen führt der
unter dem Statthalter stehende Chef des Ministeriums den Titel S.
Die Chefs der einzelnen Ministerialabteilungen heißen
Unterstaatssekretäre.
Staatsservituten (öffentliche Servituten), dauernde
Beschränkungen der Staatshoheit eines unabhängigen
Staatswesens im Interesse und zugunsten eines andern Staats oder
sonstigen Berechtigten. In diesem Sinn wurde früher z. B. das
dem Haus Thurn und Taxis zustehende Postrecht in den einzelnen
deutschen Staaten als Staatsservitut bezeichnet. Auch die
Verpflichtung, fremde Truppen auf bestimmten Etappenstraßen
durch das eigne Staatsgebiet marschieren zu lassen, gehört
hierher.
Staatssozialismus, diejenige soziale Richtung, welche
unter Befestigung der Machtstellung der Monarchie von der letztern
eine Hebung der Lage der Arbeiter, insbesondere aber eine
Einschränkung der Herrschaft der Bourgeosie und des
beweglichen Kapitals erwartet. Vgl. Arbeiterfrage, S. 752, und
Sozialismus.
Staatsstreich, s. Revolution.
Staatsverbrechen, s. Majestätsverbrechen.
207
Staatsverfassung - Stabel.
Staatsverfassuug, Inbegriff der Bestimmungen, welche den Zweck
eines Staats (s. d.), die dazu bestehenden Einrichtungen, Formen,
Grenzen und Inhaber der Staatsgewalt und deren Verhältnisse zu
den Staatsbürgern bezeichnen und regeln; dann Bezeichnung
eines umfassenden Gesetzes (Konstitution, Charte, Grundgesetz), in
welchem die Staats- und Regierungsform eines Landes verbrieft, auch
der Urkunde selbst, welche darüber aufgenommen ist. Je nachdem
eine solche S. einseitig von dem Staatsbeherrscher gegeben oder
nach vorgängiger Vereinbarung mit Vertretern des Volkes
erlassen worden ist, wird zwischen oktroyierter und paktierter
(vereinbarter) Verfassung unterschieden. Insbesondere spricht man
in der konstitutionellen Monarchie im Gegensatz zur absoluten von
der bestehenden S., wonach der Monarch in der Gesetzgebung an die
Zustimmung von Vertretern der Staatsbürger gebunden ist, sei
es, daß diese nur für einzelne bevorrechtete Klassen
(ständische Verfassung) oder daß sie zur Vertretung des
ganzen Volkes berufen sind (Repräsentativsystem). Über
die verschiedenen Arten der S. (Staatsformen) s. Staat.
Staatsvertrag, das zwischen zwei selbständigen
Staaten getroffene völkerrechtliche Übereinkommen. Ein
solches kann verschiedene Angelegenheiten betreffen, in welchen
befreundete Staaten miteinander in Beziehung treten, so z. B.
Rechtshilfe, Auslieferung von Verbrechern u. dgl. Besonders wichtig
sind die Handels- und Schiffahrtsverträge. In
konstitutionellen Staaten ist zum Abschluß von
Staatsverträgen in der Regel die Zustimmung der
Volksvertretung erforderlich. Nach der deutschen Reichsverfassung
bedürfen Verträge über Gegenstände, welche in
den Bereich der Reichsgesetzgebung gehören, zu ihrem
Abschluß der Zustimmung des Bundesrats und zu ihrer
Gültigkeit der Genehmigung des Reichstags.
Staatsverwaltung, s. Verwaltung.
Staatswirtschaft, die Wirtschaft des Staats, umfaßt
alle Thätigkeiten und Veranstaltungen, welche zur Befriedigung
von Staatsbedürfnissen dienen, wird im engern Sinn auch oft
als mit der Finanzverwaltung identisch betrachtet (vgl.
Finanzwesen).
Staatswirtschaftslehre, Lehre von der Wirtschaft des
Staats, Finanzwissenschaft, auch als gleichbedeutend mit
Volkswirtschaftslehre (s. d.) gebraucht.
Staatswissenschaften (Kameralwissenschaften), im
allgemeinen Bezeichnung für diejenigen Wissenschaften, deren
Gegenstand der Staat ist. Sie sind teils erzählende und
beschreibende (historische), teils erörternde (dogmatische),
teils philosophische und teils politische. Zu der erstern Kategorie
gehören die Statistik oder Staatenkunde, welche dermalige
Zustände und Einrichtungen schildert, und die
Staatengeschichte. Die staatswissenschaftliche Dogmatik dagegen
behandelt systematisch Zweck, Wesen und Eigenschaften des Staats
und seine rechtlichen Beziehungen, und zwar sowohl diejenigen unter
den Staaten selbst (Völkerrecht) als diejenigen zwischen der
Staatsgewalt und den Staatsangehörigen sowie zwischen den
letztern untereinander (Staatsrecht). Sie handelt ferner von den
Mitteln zur Erreichung des Staatszwecks (Verwaltungsrecht, Polizei-
und Finanzwissenschaft). Die dogmatische Staatswissenschaft hat
einen gegebenen Staat und dessen positive Satzungen zum Gegenstand,
während die Staatsphilosophie nicht das, was ist, sondern das,
was nach der Staatsidee sein soll, ins Auge faßt, und so
entsteht namentlich der Gegensatz zwischen positivem und
allgemeinem philosophischen Staats- und Völkerrecht. Die
politische Behandlungsweise endlich betrachtet den Staat, seine
Mittel und seine Zwecke vom Standpunkt der
Zweckmäßigkeit aus, und eben dadurch wird das Gebiet der
Politik ebenso wie dasjenige der Volkswirtschaftslehre
(Nationalökonomie) staatswissenschaftlich abgegrenzt.
Stab (lat. Scipio), im Altertum Auszeichnung für
ältere Personen oder Könige (s. Zepter); außerdem
war der S. in besonderer Form auch gewissen Priesterschaften,
namentlich den Augurn, die damit die Weltgegenden bezeichneten,
beigelegt, worauf ihn später in der christlichen Kirche der
Bischof symbolisch als Hirt der Gemeinde trug (Hirtenstab,
Bischofstab). Den S. als Attribut und Gerät der Zauberer
(Zauberstab) führte schon im alten Chaldäadie "Dame
(Göttin) des magischen Stabes", sodann Moses, Zoroaster und in
der griechischen Mythe Hermes, der mit Hilfe desselben "Schlummer
gibt und enthebt". Auch ist der S. Zeichen der richterlichen und
oberherrschaftlichen Gewalt und trägt dann an der Spitze die
Hand als Schwur- oder Machtsymbol. - Als Ellenmaß war ein S.
in Frankreich = 1,188 m, in Berlin = 1,75 Ellen, in Frankfurt a. M.
= 2,166 Ellen. - In der Baukunst, und im Kunsthandwerk
(Möbeltischlerei) ist S. ein rundes Glied von verschiedener
Form: als Astragal, Rundstab, gebrochener S. (s. Figur), gewundener
S., gewunden mit Hohlkehlen etc. (vgl. Viertelstab).
[Gebrochener Stab.]
Stab (franz. État-major), die zu dem Kommando
eines Truppenteils gehörigen Personen. Man unterscheidet den
Oberstab (Offiziere und im Offiziersrang stehende Beamte), z. B.
beim Bataillon: den Kommandeur, den Adjutanten, Arzt und
Zahlmeister, und den Unterstab: die Schreiber, Ordonnanzen,
Büchsenmacher u. dgl. Höhere Stäbe sind diejenigen
der Armeen, Korps und Divisionen, welche neben einer
größern Zahl von Offizieren etc. noch Geistliche,
Auditeure, Post-, Kassen-, Proviant- und andre Beamte, dann zum
Botendienst im Frieden die Stabsordonnanzen, zur Sicherung im Felde
die Stabswachen umfassen. Vgl. Generalstab.
Stabat mater (lat., "die Mutter [Jesu] stand [am
Kreuz]"), Anfangsworte eines geistlichen Textes in lateinischen
Terzinen, der als sogen. Sequenz (s. d.) in der katholischen
Kirche, besonders am Feste der sieben Schmerzen Mariä,
gesungen wurde und wahrscheinlich von dem Minoriten Jacopone da
Todi herrührt. Von den Kompositionen desselben sind die
berühmtesten die von Palestrina, Pergolese und Astorga, aus
neuerer Zeit die von Jos. Haydn, Winter und Rossini. Vgl. Lisco,
Stabat mater (Berl. 1843).
Stäbchenalgen (Bacillarien), s. v. w. Diatomeen, s.
Algen, S. 343.
Stäbchenbakterie, s. Bacterium.
Stabeisen, Schmiedeeisen in Stabform, auch Eisen- oder
Stahlstangen von gleichmäßigem Querschnitt.
Stabel, Anton von, bad. Staatsmann, geb. 9. Okt. 1806 zu
Stockach, studierte in Tübingen und Heidelberg die Rechte und
trat 1828 in den Staatsjustizdienst. 1832 wurde er zum
Obergerichtsadvokaten und Prokurator in Mannheim, 1838 zum Mitglied
des dortigen Hofgerichts, 1841 zum Hofgerichtsrat und in demselben
Jahr zum Professor der Jurisprudenz in Freiburg ernannt. 1845 wurde
er Hofgerichts-
208
Staberl - Stachel.
präsident in Freiburg, 1847 Vizekanzler des Oberhofgerichts
in Karlsruhe und 1849 Präsident der Ministerien des Innern und
der Justiz im sogen. Reaktionsministerium; er machte sich um die
Reform der Justiz sehr verdient. Nachdem er 1850 Mitglied des
Erfurter Parlaments gewesen, trat er 1851 wieder als Oberhofrichter
an die Spitze des obersten Gerichtshofs und ward 1853 zum Mitglied
und Vizepräsidenten der Ersten Kammer ernannt. Als
Berichterstatter der Kommission der Ersten Kammer über das
Konkordat in der Landtagssession 1859-1860 wies er nach, daß
für dasselbe gemäß der Verfassung die
ständische Zustimmung unerläßlich sei. Als
infolgedessen das Konkordatsministerium Meysenbug-Stengel
stürzte, ward S. im April 1860 zum Minister der Justiz und des
Auswärtigen und 1861 zum Präsidenten des Ministeriums und
Staatsminister ernannt. Er leitete nun die badische
Kirchengesetzgebung und schuf die vortreffliche badische
Gerichtsverfassung. Im Juli 1866 in Ruhestand versetzt, trat er
Anfang 1867 nochmals als Justizminister in das Ministerium Mathy
ein, schied aber nach dessen Tod 1868 wieder aus und zog sich in
das Privatleben zurück. 1877 in den erblichen Adelstand
erhoben, starb er 22. März 1880 in Karlsruhe. Er
verfaßte mehrere bedeutende juristische Schriften:
"Vorträge über das französische und badische
Zivilrecht" (Freiburg 1843); "Vorträge über den
bürgerlichen Prozeß (Heidelb. 1845); "Institutionen des
französischen Zivilrechts" (Mannh. 1871, 2. Aufl. 1883) u.
a.
Staberl, stehend gewordene Figur der Wiener Lokalposse,
welche einen Wiener Bürger des Mittelstands (Parapluiemacher)
darstellt, der sich in fremdartigen Verhältnissen zwar
ungelenk benimmt, aber durch Mutterwitz sich immer zu helfen
weiß; von A. Bäuerle (s. d.) erfunden.
Stabheuschrecken, s. Gespenstheuschrecken.
Stabiä, alte Stadt in Kampanien, zwischen Pompeji
und Surrentum, beim heutigen Castellammare (s. d.), wurde im
Bundesgenossenkrieg von Sulla zerstört, dann als Badeort
wiederhergestellt, der bei dem Ausbruch des Vesuvs mit Herculaneum
und Pompeji zugleich verschüttet ward. Einige Gebäude der
alten Stadt wurden im vorigen Jahrhundert (seit 1749) ausgegraben;
die aufgefundenen Kunstwerke befinden sich in Neapel.
Stabil (lat.), beständig, nicht veränderlich;
stabilieren, festigen, fest begründen; Stabilismus, das
Beharren beim Bestehenden, Herkömmlichen.
Stabilität (lat.), in der Mechanik das Vermögen
eines Körpers, seine Stellung der Schwerkraft gegenüber
selbständig zu behaupten, s. Standfähigkeit. Allgemeiner
gebraucht man S. für Beständigkeit,
Unveränderlichkeit, Beharren in dem Bestehenden.
Stablo, belg. Stadt, s. Stavelot.
Stabmessung (Stäbchenmessung), s. v. w. Bakulometrie
(s. d.).
Stabrecht, das (zuweilen dem Gutsherrn oder der Gemeinde
zustehende) Recht, fremde Schafe hüten, weiden und düngen
zu lassen, während man mit Stabgemeinschaft lediglich das
Verhältnis derjenigen bezeichnet, welche sich für ihre
Schafe gemeinschaftlich einen Hirten halten.
Stabreim, s. Allitteration.
Stabsapotheker, s. Feldapotheker.
Stabschrecken, s. v. w. Stabheuschrecken.
Stabsführer, s. Führer.
Stabskapitän, früher militär. Rangklasse,
etwa dem heutigen 13. Hauptmann entsprechend.
Stabsoffiziere, militär. Rangklasse, welche die
Obersten, Oberstleutnants und Majore, in der Marine den
Kapitän zur See und Korvettenkapitän umfaßt.
Stabsquartier, s. v. w. Hauptquartier.
Stabswachen, beim Militär die den mobilen
höhern Stäben dauernd zugeteilte Mannschaft zum
Sicherheits- und Ordonnanzdienst: bei der Division 8 Mann
Infanterie, 4 Reiter; beim Armeekorps 1 Offizier, 52 Mann, 26
Reiter.
Stabtierchen (Bacillarien), s. v. w. Diatomeen (s. Algen,
S. 343).
Stabübungen, den Freiübungen verwandte
Turnübungen mit einem jetzt meist eisernen Stab von 1 m
Länge und 1½ -2 cm Stärke, hauptsächlich
durch Otto Jäger (s. d. 4) zu mannigfaltiger Verwendung
gekommen, besonders im Schulturnen. Über das Springen mit
langen Stäben s. Stangenspringen. Vgl. Zettler, Die Schule der
S. (Leipz. 1887); Mayr, Übungen mit langen Stäben (Hof
1887).
Stabwurz, s. Artemisia.
Stabziemer, s. Drossel.
Staccato (ital., abgekürzt stacc.,
"abgestoßen"), eine musikalische Vortragsbezeichnung, welche
fordert, daß die Töne nicht direkt aneinander
geschlossen, sondern deutlich getrennt werden sollen, so daß
zwischen ihnen wenn auch noch so kurze Pausen entstehen. Über
die verschiedenen Arten des S. beim Klavierspiel, Violinspiel etc.
s. Anschlag und Bogenführung. Das S. beim Gesang besteht in
einem Schließen der Stimmritze nach jedem Ton; seine virtuose
Ausführung ist sehr schwer. Entsprechend wird das S. bei den
Blasinstrumenten durch Unterbrechung des Atemausflusses
(stoßweises Blasen) hervorgebracht.
Stachel (Aculeus), in der Botanik jede mit einer starren,
stechenden Spitze versehene, durch Umwandlung aus Haargebilden,
Blättern oder ganzen Sprossen hervorgehende Bildung, auch die
Dornen (spinae) umfassend. Die Stacheln treten bald nur als
Anhangsgebilde fertig angelegter Organe an Blättern oder
Stengeln auf (Haut- oder Trichomstacheln), oder sie entstehen durch
Umwandlung von ganzen Blättern oder Blattteilen (Blatt- oder
Phyllomstacheln), oder sie stellen selbständig umgewandelte
Sprosse (Dornen oder Kaulomstacheln) dar. Die Hautstacheln sind
bald einzellige Haarbildungen, bald vielzellige Gewebekörper
oder Zwischenbildungen beider; bald gehen sie nur aus der Epidermis
hervor, wie bei der Brombeere, bald beteiligt sich auch das unter
der Oberhaut liegende Rindengewebe, das Periblem, an ihrer Bildung,
wie bei dem S. der Rose. In den meisten Fällen sind die
Hautstacheln gefäßlos, bisweilen, z. B. bei den Stacheln
auf den Kapfeln des Stechapfels und der Roßkastanie,
führen sie Gefäßbündel.
Übergangsbildungen zwischen den Haut- und Blattstacheln finden
sich bei den Kakteen, deren Stacheln aus den Vegetationspunkten der
Achselknospen wie wahre Blätter, jedoch ohne deren
Entwickelungsfähigkeit, hervorgehen. Unter den Blattstacheln
bilden sich einige durch Metamorphose von Nebenblättern, z. B.
die Stacheln der Robinie; andre gehen aus umgewandelten Blattteilen
hervor (Blattzahnstacheln), wie die Stacheln der Stechpalme, welche
Gefäßbündel und Blattparenchym enthalten. Eine
dritte Gruppe besteht aus denen, die durch Umwandlung eines ganzen
Blattes entstehen, wie die gefiederten Stacheln von Xanthium oder
die dreigeteilten Stacheln der Berberitze, aus deren Achseln
Laubsprosse entspringen. Ebenso verschieden ist auch der Ursprung
der Kaulomstacheln oder Dornen; es können
überzählige Knospen, wie bei Genista, Ulex, Gleditschia,
oder auch normale Achselknospen, wie bei Ononis, zu Stacheln
auswachsen
209
Stachelbeerstrauch - Stachelschwein
Die höchste Form der Stachelbildung tritt bei vielen
Pomaceen und Amygdalaceen, besonders bei Arten von Crataegus und
Prunus ein; hier wandelt sich ein ganzer blatttragender Zweig in
einen S. um. Auch kann umgekehrt durch Kultur der S. wieder als
blatttragender Zweig erscheinen. Auch der Hauptsproß erzeugt
unter Umständen, wie bei Rhamnus cathartica, durch Verholzung
des Vegetationspunktes einen endständigen S. Im allgemeinen
zeigt sich, daß der Begriff des Stachels durchaus nicht durch
ein einheitliches morphologisches Merkmal zu bestimmen ist, sondern
daß hier wie überall die Pflanze die verschiedensten
morphologischen Glieder demselben physiologischen Zweck anzupassen
weiß. Die biologische Aufgabe der Stacheln besteht teils
darin, als Schutzorgan der Pflanze gegen die Angriffe weidender
Tiere zu dienen, teils in der Rolle eines Verbreitungsmittels,
insbesondere bei stachligen Früchten, die in dem Haar- oder
Federkleid von Tieren hängen bleiben und dadurch weiter
transportiert werden; endlich sind auch Beziehungen zwischen
stacheltragenden Pflanzen und insektenfressenden Vögeln, wie
den Würgerarten, bekannt, die ihre Beute an den Stacheln von
Dornsträuchern aufzuspießen pflegen. Vgl. Delbrouck, Die
Pflanzenstacheln (Bonn 1875). Bei Tieren ist der S. eine Waffe zur
Verteidigung oder zum Angriff, aber auch zur Anbohrung von
Pflanzen, Erdreich etc., um die Eier hineinzulegen (Legestachel).
Besonders verbreitet bei den Insekten (Bienen, Wespen etc.):
häufig fließt durch ihn ein in besonderer Drüse
bereitetes Gift in die Wunde (Giftstachel); stets sitzt er am Ende
des Hinterleibes, nie am Munde (die Stechvorrichtungen der
Mücken, Wanzen etc. sind Mundteile und heißen
Stechborsten, nicht Stacheln). Beim Stachelschwein sind die
Stacheln Haargebilde, bei Fischen umgewandelte Flossenstrahlen.
Vgl. auch Echinodermen.
Stachelbeerstrauch (Ribitzel, Grossularia Mill.),
Untergattung der Gattung Ribes (Familie der Saxifragaceen),
Sträucher mit sehr verkürzten Zweigen, meist dreiteiligen
Dornen an der Basis derselben, büschelförmig gestellten
Blättern und einzeln oder in arm-, selten reichblütigen
Trauben stehenden Blüten. Der gemeine Stachelbeerstrauch
(Krausbeere, Klosterbeere, R. Grossularia L.), mit meist
dreiteiligen Stacheln, drei- bis fünflappigen Blättern,
1-3 grünlichgelben Blüten an gemeinschaftlichem Stiel und
grünlichweißen oder roten Früchten, ist
wahrscheinlich im nordöstlichen Europa heimisch, wo er in
Norwegen bis 63° nördl. Br. vorkommt, und findet sich bei
uns vielfach verwildert. Linné u. a. unterscheiden drei
Arten: R. uva crispa, mit schließlich unbehaarten,
grünlichen oder gelben Früchten, im Norden; R.
Grossularia, niedriger, behaart, sehr stachlig, mit behaarten,
grünlichen oder gelben Früchten, in den Alpen, in
Griechenland, Armenien, auf dem Kaukasus, Himalaja, seltener bei
uns verwildert; R. reclinatum, mit roten, glatten Früchten,
aus dem Kaukasus, vielleicht bei uns verwildert. Die meisten
Kultursorten dürften von der ersten Art abstammen, die roten
von den letztern; doch werden auch viele Blendlinge kultiviert. Der
S. wächst am besten in lockerm, nahrhaftem Boden in freier,
aber geschützter Lage; man pflanzt ihn meist auf Rabatten,
doch darf er nicht zu dicht und nicht unter hohen Bäumen
stehen. Im Spätherbst oder im zeitigen Frühjahr schneidet
man allzu lange oder schlecht gestellte Zweige wie auch
Wurzelschößlinge fort, nach dem Fruchtansatz gibt man
zweimal einen Düngerguß und pflückt zu dicht
hängende Beeren aus; man vermehrt ihn durch Stecklinge aus
vorjährigen, im Herbst geschnittenen Trieben oder durch
Wurzelausläufer und gewinnt die besten Früchte von
einstämmig erzogenen Kronenbäumchen, welche durch
Unterdrücken der Seitentriebe und Wurzelsprosse, sehr gut und
dauerhaft durch Okulieren und Kopulieren auf R. aureum zu erziehen
sind. Empfehlenswerte Sorten sind: rote: Alexander, Blood hound,
Farmer's Glory, Jolly Printer, Over all; grüne: Early green
hairy, Freecost, Green Willow, Nettle green; gelbe: Britannia,
Bumper, Golden, Smiling Beauty, Yellow Lion; weiße: Balloon,
Large hairy, Ostrich White. Queen Mary, Sämling von Pausner.
Über die Zusammensetzung der Stachelbeeren s. Obst. Der
Strauch wird zuerst in einem französischen Psalmenbuch des 12.
Jahrh. als Groisellier, die Frucht vom Trouvère Rutebeuf im
13. Jahrh. erwähnt. Gegenwärtig ist die Stachelbeere eine
Lieblingsfrucht der Engländer, welche vorzügliche Sorten
erzogen haben. Man benutzt sie auch viel zur Bereitung von
Obstwein. Mehrere amerikanische Stachelbeersträucher werden
bei uns als Ziersträucher kultiviert.
Stachelbeerwein, s. Obstwein.
Stachelberg, Bad im schweizer. Kanton Glarus, in
romantischer Lage des Linththals, 664 m ü. M., mit
heilkräftiger Schwefelquelle (7,7° C.), jetzt
zugänglicher durch die Bahnlinie Glarus-Schwanden-Linththal.
Vgl. König, Bad S. (Zürich 1867).
Stachelflosser, s. Fische, S. 298.
Stachelhäuter, s. Echinodermen.
Stachelkümmel, s. Cuminum.
Stachelmohn, s. Argemone.
Stachelnuß, s. Datura.
Stachelschwamm, s. Hydnum.
Stachelschwein (Hystrix L.), Gattung aus der Ordnung der
Nagetiere und der Familie der Stachelschweine (Hystrichina), sehr
gedrungen gebaute Tiere mit kurzem Hals, dickem Kopf, kurzer,
stumpfer Schnauze, kleinen Ohren, kurzem, mit hohlen,
federspulartigen Stacheln besetztem Schwanz,
verhältnismäßig hohen Beinen, fünfzehigen
Füßen, stark gekrümmten Nägeln und ungemein
stark entwickeltem Stachelkleid. Das gemeine S. (Hystrix cristata
L., s. Tafel "Nagetiere II"), 65 cm lang, mit 11 cm langem Schwanz,
24 cm hoch, hat auf der Oberlippe glänzend schwarze Schnurren,
längs des Halses eine Mähne aus starken,
rückwärts gerichteten, sehr langen, gebogenen,
weißen oder grauen Borsten mit schwarzer Spitze, auf der
Oberseite verschieden lange, dunkelbraun und weiß geringelte,
scharf gespitzte, leicht ausfallende Stacheln und borstige Haare,
an den Seiten des Leibes kürzere und stumpfere Stacheln, am
Schwanz abgestutzte, am Ende offene Stacheln, an der Unterseite
dunkelbraune, rötlich gespitzte Haare. Die dünnen,
biegsamen Stacheln werden 40 cm, die starken nur 15-30 cm lang,
aber 5 mm dick; alle sind hohl oder mit schwammigem Mark
gefüllt. Das S. stammt aus Nordafrika und findet sich jetzt
auch in Griechenland, Kalabrien, Sizilien und in der Campagna von
Rom. Es lebt ungesellig am Tag in langen, selbstgegrabenen
Gängen, sucht nachts seine Nahrung, die in allerlei
Pflanzenstoffen besteht. Alle Bewegungen des Stachelschweins sind
langsam und unbeholfen, nur im Graben besitzt es einige Fertigkeit.
Im Winter schläft es tagelang in seinem Bau. Vollkommen
harmlos und unfähig, sich zu verteidigen, erliegt es jedem
geschickten Feind. Es ist stumpfsinnig, aber leicht erregbar.
Gereizt grunzt es, sträubt die Stacheln und rasselt mit
den-
210
Stachelschweinaussatz - Stadion.
selben, wobei oft einzelne ausfallen, was zu der Fabel
Veranlassung gegeben hat, daß es die Stacheln
fortschießen könne. In der Not rollt es sich wie ein
Igel zusammen. Die Paarung erfolgt im Frühjahr, und 60-70 Tage
nach der Begattung wirft das Weibchen in einer Höhle 2-4
Junge, deren kurze, weiche Stacheln sehr bald erhärten und
ungemein schnell wachsen. In der Gefangenschaft wird es leicht
zahm, hält sich gut, pflanzt sich auch fort, bleibt aber stets
scheu und furchtsam. Italiener ziehen mit gezähmten
Stachelschweinen von Dorf zu Dorf. Man ißt sein Fleisch und
benutzt die Stacheln zu mancherlei Zwecken. Die Bezoarkugel eines
ostindischen Stachelschweins war früher als Heilmittel
hochgeschätzt. Stachelschweine mit Wickelschwanz, welche
andern Gattungen angehören, leben als Baumtiere in
Amerika.
Stachelschweinaussatz, s. v. w. Fischschuppenkrankheit
(s. d.).
Stachelschweinholz, s. Cocos.
Stachelschweinmenschen, an Ichthyosis oder
Fischschuppenkrankheit (s. d.) Leidende.
Stachelzaundraht, Drahtlitzen mit in kurzen
Abständen eingeflochtenen kurzen, spitzigen Draht- oder
Blechstückchen oder aus zackig ausgeschnittenem Bandeisen,
dient zu billigen Einfriedigungen.
Stachine, Fluß, s. Stikeen.
Stackelberg, Otto Magnus, Freiherr von, Archäolog
und Künstler, geb. 25. Juli (a. St.) 1787 zu Reval, studierte
in Göttingen, machte hierauf eine Kunstreise durch
Südfrankreich, Oberitalien und sein eignes Vaterland, ging
1808, um die Malerei zu erlernen, nach Dresden, dann nach Rom und
unternahm von da aus 1810-14 mit Brönstedt u. a. eine
Expedition nach Griechenland und Kleinasien, auf der er mit seinen
Gefährten die äginetischen Statuen und die Reste des
Apollontempels zu Bassä (Phigalia) auffand. Seine Zeichnungen
des letztern samt der Umgebung sind seinem Werk "Der Apollotempel
zu Bassä (Berl. 1826) beigefügt. Eine andre Frucht dieser
Reise sind die "Costumes et usages des peuples de la Grèce
moderne" (Rom 1825). Von Rom aus unternahm er später Reisen
nach Großgriechenland, Sizilien und Etrurien, wo er 1827 die
etrurischen Hypogäen von Corneto entdeckte, bereiste dann
Frankreich, England und die Niederlande und starb 27. März
1837 in Petersburg. Noch sind von seinen Arbeiten hervorzuheben:
"La Grèce, vues pittoresques ettopographiques" (Par. 1830, 2
Bde.); "Trachten und Gebräuche der Neugriechen" (Berl.
1831-1835, 2 Abtlgn.) und besonders "Die Gräber der Hellenen
in Bildwerken und Vasengemälden" (das. 1836-37, mit 80
Tafeln). Eine Biographie Stackelbergs nach seinen Tagebüchern
und Briefen veröffentlichte seine Tochter Natalie v. S.
(Heidelb. 1882).
Slackh., bei botan. Namen Abkürzung für John
Stackhouse, geb. 1740, gest. 1819 in Bath (Algen).
Stade, Hauptstadt des gleichnamigen Regierungsbezirks der
preuß. Provinz Hannover, an der schiffbaren Schwinge und der
Eisenbahn Harburg-Kuxhaven, hat 2 evangelische und eine kath.
Kirche, ein Gymnasium, verbunden mit Realprogymnasium, ein
Schullehrerseminar, eine Taubstummenanstalt, einen Historischen
Verein (für Bremen und Verden), eine königliche
Regierung, ein Konsistorium, ein Landratsamt, ein Landgericht, ein
Hauptsteueramt, einen Ritterschaftlichen Kreditverein, eine
Handelskammer, Eisengießerei, Maschinen-, Schiff- und
Mühlenbau, Tabaks- und Zigarrenfabrikation, Brennerei,
Bierbrauerei, Färberei, Ziegeleien, Schiffahrt, lebhaften
Handel und (1885) mit der Garnison (ein Füsilierbataillon Nr.
75 und eine Abteilung Feldartillerie Nr. 9) 9997 meist evang.
Einwohner. In der Nähe viele Ziegeleien sowie ein Gipslager
und bei dem Dorf Kampe eine Saline. Zum Landgerichtsbezirk S.
gehören die elf Amtsgerichte zu Bremervörde, Buxtehude,
Freiburg, Harburg, Jork, Neuhaus a. O., Osten, Otterndorf, S.,
Tostedt und Zeven. - S. erscheint schon im Anfang des 10. Jahrh.
als der Stammsitz eines gräflichen Geschlechts, das 1056 auch
in den Besitz der sächsischen Nordmark gelangte, sie fast ein
Jahrhundert behielt und 1168 ausstarb. Von den Welfen Kaiser Otto
IV. und seinem Bruder, dem Pfalzgrafen Heinrich, ward S. 1202
erobert, fiel aber um 1204 an Bremen zurück, nachdem es von
Otto IV. umfangreiche Freiheiten erhalten hatte. In diese Zeit
fällt die Einführung des Elbzolles. 1648 im
Westfälischen Frieden ward es Schweden zuerkannt und zur
Hauptstadt des Fürstentums Bremen gemacht. 1676 von den
Hannoveranern, 1712 von den Dänen erobert, kam es 1719 nebst
dem Bistum Bremen an Hannover. 1807 ward es Westfalen einverleibt,
1810 von Napoleon I. in Besitz genommen, 1813 aber von den
Alliierten an Hannover zurückgegeben und von diesem wieder zur
Festung gemacht und 1816 neu befestigt. Hannover mußte den
Elbzoll durch Vertrag vom 22. Juni 1861 gegen eine
Entschädigung von 2,857,338 Thlr. aufheben (s. Elbe, S. 503).
Am 18. Juni 1866 wurde die Festung S. von den Preußen ohne
Kampf genommen und fiel dann mit dem übrigen Hannover an
Preußen. Der Regierungsbezirk S. (s. Karte "Hannover etc.")
umfaßt 6786 qkm (123,25 QM.), zählt (1885) 325,916 Einw.
(darunter 320,329 Protestanten, 4118 Katholiken und 1126 Juden) und
besteht aus den 14 Kreisen:
Kreise QKilom. QMeilen Einwohner Einw. auf 1 qkm
Achim 286 5,19 19973 70
Blumenthal 174 3,16 19224 110
Bremervörde 579 10,52 16760 29
Geestemünde 630 11,44 33656 53
Hadeln 326 5,92 17086 52
Jork 167 3,03 21097 126
Kehdingen 378 6,87 20214 53
Lehe 633 11,50 28797 45
Neuhaus a. Oste 522 9,48 28474 55
Osterholz 479 8,70 27736 58
Rotenburg i. Hann 816 14,82 19282 24
Stade 725 13,17 34536 48
Verden 409 7,43 25257 62
Zeven 662 12,02 13824 21
Stadel, in Süddeutschland s. v. w. Scheune; auch
Vorrichtung zum Rösten der Erze (s. Rösten).
Städelsches Institut, s. Frankfurt a. M., S.
500.
Staden, Stadt in der hess. Provinz Oberhessen, Kreis
Friedberg, an der Nidda, hat eine evang. Kirche, ein Schloß
und (1885) 376 Einw. Stadion, uraltes Adelsgeschlecht, dessen
Stammschloß S. ob Küblis in Graubünden jetzt Ruine
ist, und das sich später in Schwaben an der Donau
niederließ; von Walter von S. (Stategun) an, der als
habsburgischer Landvogt von Glarus 1352 im Kampf gegen die Glarner
fiel, läßt sich die Geschichte des Geschlechts genau
verfolgen. Die bemerkenswertesten Sprößlinge desselben
sind: Christoph von S., Bi-
211
Stadium - Stadt.
schof von Augsburg, geb. 1478, ein Freund Kaiser Maximilians I.
und Ferdinands I., aber auch Melanchthons, mit dem er in Verkehr
wegen der Reformation der Kirche und Wiedervereinigung der beiden
christlichen Kirchen stand; starb 1543. Johann Kaspar von S.,
Hochmeister des Deutschen Ordens, österreichischer
Kriegspräsident und Feldzeugmeister, zeichnete sich besonders
1634 in der Schlacht bei Nördlingen aus. Johann Philipp von
S., Staatsminister von Kurmainz, geb. 1652, war die Seele aller
Reichsgeschäfte, 1711 Botschafter bei der Wahl Karls VI. und
Gesandter des rheinischen Kreises beim Utrechter und Badener
Friedenskongreß. Mit ihm ward das Geschlecht 1705 in den
Reichsgrafenstand erhoben. Er starb 1741 und ward durch seine
beiden Söhne der Stifter der jetzt noch blühenden
Fridericianischen und Philippinischen Linie. Ersterer gehörte
an Johann Philipp Karl Joseph, Graf von S., geb. 18. Juni 1763.
Derselbe hatte auf deutschen Hochschulen eine tüchtige Bildung
erhalten, war 1788 österreichischer Gesandter zu Stockholm,
1790 bis 1792 zu London, trug 1797 nicht wenig dazu bei, die durch
die polnischen Teilungen zwischen Österreich und Preußen
entstandene Spannung zu heben, betrieb, seit 1804 Botschafter in
Petersburg, eifrig die Bildung der dritten Koalition und folgte
1805 dem Kaiser Alexander I. zur Armee. Von reichsritterlichem
Stolz und echt deutschem Patriotismus erfüllt, haßte er
Napoleon aus ganzer Seele. Nach dem Preßburger Frieden mit
dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten betraut, hatte
er die Absicht, Österreich im Innern zu reorganisieren, seine
äußere Macht wiederherzustellen und es an die Spitze des
wieder befreiten Deutschland zu bringen. Er löste die
drückenden Geistesfesseln, förderte den Gemeinsinn und
betrieb vor allem die Reform des Heerwesens und die Bildung einer
Landwehr. Das plötzliche Erscheinen eines deutschen
Patriotismus in Österreich beim Beginn des auf seinen Antrieb
unternommenen Kriegs von 1809 war Stadions Werk. Der
unglückliche Ausgang des Kriegs nötigte ihn, dem Grafen
Metternich im Ministerium Platz zu machen; doch ward er schon 1812
wieder nach Wien berufen und erhielt nach der Schlacht bei
Lützen eine Sendung zu Alexander I. und Friedrich Wilhelm III.
Nach dem Frieden mußte er sich abermals dem schwierigen
Auftrag der Herstellung der Finanzen unterziehen. Die Ausgaben des
Staats wurden beschränkt und genau bestimmt und die
Steuerverfassung nach vernünftigen Grundsätzen geregelt.
Er starb 18. Mai 1824 in Baden bei Wien. Franz Seraph, Graf von S.,
zweiter Sohn des vorigen, geb. 27. Juli 1806, trat früh in den
Staatsdienst ein und zeichnete sich namentlich als
Administrativbeamter aus. In Triest und Galizien, wo er 1846 an die
Spitze der Verwaltung trat, sicherte er sich ein dankbares
Andenken. Nach Niederwerfung der Wiener Revolution trat er mit
Schwarzenberg und Bach ins Ministerium vom 21. Nov. 1848 und
vertrat hier die freisinnigere Richtung. Schon im Mai 1849 aber
mußte er wegen eines Körperleidens zurücktreten; er
starb in Geisteszerrüttung 8. Juni 1853. Vgl. Hirsch, Franz
Graf S. (Wien 1861). Sein Neffe Philipp, Graf von S., geb. 29. Mai
1854, ist jetzt das Haupt der Fridericianischen Linie; die
Philippinische wird repräsentiert durch Friedrich, Grafen von
S., geb. 13. Dez. 1817, erblichen Reichsrat der Krone Bayern.
Stadium (griech. Stadion), bei den Alten
Längenmaß, eine Strecke von 600 griech. Fuß, aber
thatsächlich von schwankender Länge; das Itinerarstadium
(s. d.) war jedenfalls kleiner, und man kann es bis in die Mitte
des 2. Jahrh. v. Chr. auf etwa 1/50 geogr. Meile ansetzen. Das
olympische S. betrug ungefähr 1/40 Meile. In der
römischen Kaiserzeit rechnete man 7,5 Stadien auf eine
römische Meile. Ursprünglich bezeichnete das Wort die
für den Wettlauf bestimmte Rennbahn von der angegebenen
Länge, namentlich die zu Olympia (s. d., mit Plan), nach der
die andern eingerichtet wurden. Die Konstruktion des Stadiums
erkennt man deutlich aus vielen noch vorhandenen Ruinen. Demnach
war es der Länge nach durch mehrere Richtungssäulen in
zwei Hälften geteilt und eine oder mehrere Seiten desselben
oft mit Benutzung des Terrains mit aufsteigenden Sitzreihen
versehen. An einem der schmalen Enden wurde die Bahn in der Regel
von einem Halbkreis eingeschlossen, in dem sich die Plätze
für die Kampfrichter (Hellanodiken) und die vornehmern
Zuschauer befanden, und wo auch die übrigen Wettkämpfe
stattfanden. Bei den Römern kamen die Stadien zu Cäsars
Zeit auf und wurden hier auch zu andern Vergnügungen,
namentlich zu Tierhetzen, benutzt. Im modernen Sprachgebrauch
bezeichnet man mit S. jeden einzelnen Abschnitt in dem Verlauf oder
der Entwickelung einer Sache.
Stadler, Maximilian, Abbe, Kirchenkomponist, geb. 7. Aug.
1748 zu Melk in Unterösterreich, genoß seine
musikalische Ausbildung vorwiegend als Zögling des Wiener
Jesuitenkollegiums, trat dann in das Benediktinerstift seines
Geburtsorts, ward 1786 zum Abt von Lilienfeld und drei Jahre
später zum Abt und Kanonikus von Kremsmünster ernannt.
Nachdem er 1791 von dieser Stelle freiwillig zurückgetreten
war, lebte er bis zu seinem Tod 8. Nov. 1833 in Wien, als Mensch
und Künstler hochgeachtet und mit allen musikalischen
Berühmtheiten seiner Zeit in lebhaftem Verkehr stehend. Unter
seinen zahlreichen durch kontrapunktische Gewandtheit
ausgezeichneten Kompositionen sind besonders sein Oratorium "Die
Befreiung Jerusalems", ein großes Requiem und Klopstocks
"Frühlingsfeier" hervorzuheben.
Stadt (Stadtgemeinde), größere Gemeinde mit
selbständiger Organisation und Verwaltung der
Gemeindeangelegenheiten. Verschiedene Merkmale, welche früher
für den Unterschied zwischen S. und Dorf oder zwischen Stadt-
und Landgemeinde von Bedeutung waren, sind es jetzt nicht mehr. Wie
die alten Stadtthore und Stadtmauern gefallen sind, welche
früher einem Ort im Gegensatz zum platten Lande den
städtischen Charakter verliehen, so hat sich auch der
Unterschied zwischen der rechtlichen und wirtschaftlichen Stellung
des städtischen Bürgers und des Landmanns mehr und mehr
verwischt. Die Größe und Einwohnerzahl ist nicht mehr
schlechthin entscheidend. Denn manche Industriedörfer sind
heutzutage volkreicher als kleine Landstädtchen mit vorwiegend
landwirtschaftlicher Beschäftigung der Ackerbürger.
Beseitigt sind ferner durch die moderne Gesetzgebung die einstige
Ausschließlichkeit des zunftmäßigen
Gewerbebetriebs innerhalb des städtischen Weichbildes und das
Recht der Stadtgemeinde, innerhalb der städtischen Bannmeile
jeden für den städtischen Verkehr nachteilige
Gewerbebetrieb zu untersagen. Das Marktrecht, welches einst den
städtischen Gemeinden ausschließlich zukam, ist jetzt
auch größern Landgemeinden (Marktflecken) zugestanden.
Auch die Beschäftigung auf dem Gebiet des Handels und der
Industrie findet sich nicht mehr ausschließlich und in
manchen Gegenden nicht einmal mehr vorwiegend in den Städten.
Dagegen besteht noch in verschiedenen Staaten in Ansehung der
Gemeindeverfassung ein
14*
212
Stadt (Entwicklung des Städtewesens).
erheblicher Unterschied zwischen S. und Land (s. Gemeinde); doch
auch dieser Unterschied ist bereits in manchen Gegenden mehr oder
weniger beseitigt.
Die Entwickelung des Städtewesens.
Die ersten Städte wurden unter den mildern Himmelsstrichen
Asiens, Afrikas, Griechenlands und Italiens gegründet. In
Griechenland erhielten sie sich meist ihre volle
Selbständigkeit und wurden Mittelpunkte besonderer Staaten.
Bei den Babyloniern und Assyrern dienten sie vornehmlich als feste
Plätze, als Handelsniederlassungen bei den Phönikern. Bei
den Etruskern und Latinern gab es schon früh städtische
Niederlassungen, zunächst mit einer gewissen
Selbständigkeit ausgestattet und durch Bündnisse geeint,
bis sich Rom zur Herrin Italiens, dann sogar der ganzen
zivilisierten Welt machte und unter Beibehaltung städtischer
Verfassungsformen die Herrschaft über ein ausgedehntes Reich
zu führen wußte. Während bei den Kelten, ja auch
bei den Slawen die Sitte des städtischen Zusammenwohnens von
Anbeginn wohlbekannt war, fehlte den alten Germanen jede Neigung
zum Stadtleben. Die ersten Städte in Deutschland verdankten
vielmehr den Römern ihre Entstehung; sie erwuchsen meist aus
den am Rhein und an der Donau angelegten Lagern und Kastellen. So
entstanden: Straßburg, Speier, Worms, Mainz, Bingen, Koblenz,
Remagen, Bonn, Köln, Xanten, Utrecht, Leiden im Rheinthal; im
Gebiet der Donau: Augsburg, Regensburg, Passau, Salzburg und
Wien.
Später ging mit der Ausdehnung des Deutschen Reichs
über den slawischen Osten die Entwickelung des
Städtewesens Hand in Hand. Um die zum Schutz der deutschen
Landschaft angelegten Burgen entstanden städtische
Niederlassungen, wie sie zuerst Heinrich I., den man den
Städtegründer genannt hat, begründete; ihm verdanken
Quedlinburg, Merseburg und Goslar ihren Ursprung. Seinem Beispiel
folgten die Markgrafen der östlichen Gebiete. Als Beamte
erscheinen in größern Orten Burggrafen, in kleinern
Schultheißen, in bischöflichen Vögte. In Orten, wo
sich eine altfreie Einwohnerschaft erhalten hatte, erlangte diese
in der Folgezeit das Übergewicht in der städtischen
Verwaltung. Hier übten Schöffen die Rechtspflege aus; es
gab einen Rat mit einem Schultheißen oder, wie in Köln,
mit zwei Bürgermeistern an der Spitze. Die Rechte des Reichs
nahm daneben ein Burggraf wahr, wozu in Bischofstädten noch
der Vogt trat. Die glänzendste Entwickelung aber haben die
königlichen Pfalzstädte genommen, aus deren
bevorrechteter Stellung allmählich die Reichsfreiheit
erblühte (s. Reichsstädte). Dagegen blieben die
fürstlichen Städte, welche meist von den Fürsten
selbst gegründet waren, noch lange und viele für immer
unter der Territorialhoheit derselben. Doch auch hier besteht
wenigstens ein Schein von Selbstverwaltung: sie wählen ihren
Schultheißen, ihre Schöffen selbst. Wo dann die
herzogliche Gewalt erlischt oder geteilt wird, wie in Schwaben und
Sachsen, haben sich die fürstlichen Städte zur
Reichsfreiheit emporgeschwungen. Je reicher und unabhängiger
die Städte wurden, um so mehr übten sie innerhalb des
Reichs politischen Einfluß aus. Da ihr Handel nur bei der
Sicherheit der Land- und Wasserstraßen gedeihen konnte, so
war die Aufrechterhaltung des Landfriedens ihre vornehmste Sorge.
Deshalb schlossen sie Bündnisse, wie die rheinischen und
schwäbischen Städte und besonders die Hansa, welche sogar
den Norden Europas in den Bereich ihrer Machtsphäre zu ziehen
vermocht hat. Als innerhalb der Städte einzelne Klassen durch
Handel an Reichtum zunahmen, schlossen sie sich von den niedern ab
und suchten möglichst allein die Leitung der städtischen
Angelegenheiten sich anzueignen. Dies hatte dann zur Folge,
daß die Handwerker sich in Zünfte organisierten und um
Beteiligung am Stadtregiment sich bemühten. Sie erhielten denn
auch meist einige Stellen oder eine besondere Bank im Rat. An den
deutschen Reichstagen nehmen die Reichsstädte vereinzelt schon
seit Wilhelm von Holland teil; Ludwig der Bayer hat sie mehr
herangezogen, doch wird ihre Beteiligung an jenen Versammlungen
erst seit 1474 regelmäßig. Seit dem 16. Jahrh. bilden
die Reichsstädte neben den Kurfürsten und Fürsten
eine besondere Körperschaft auf den Reichstagen. Die
Auffindung des Seewegs nach Ostindien und die Entdeckung Amerikas
habenden deutschen Handel schwer geschädigt und den
Mittelpunkt der merkantilen Interessen nach dem Westen, nach
Spanien, Holland und England, verlegt. Verheerend schritt dann der
Dreißigjährige Krieg über die deutschen Gauen, und
unter seiner blutigen Geißel erstarb die Blüte der einst
so mächtigen Städte. Viele Reichsstädte verloren
ihre Reichsunmittelbarkeit und wurden Landstädte der
Fürsten, und selbst der Hansabund ging seinem Untergang
entgegen. Zur Zeit des Beginns der französischen Revolution
gab es nur noch 51 Reichsstädte, die aber noch vor und nach
der Auflösung des Deutschen Reichs bis auf vier, 1866 bis auf
drei, Hamburg, Bremen und Lübeck, welche noch jetzt
selbständige Staaten sind, ihre Selbständigkeit verloren.
Inzwischen waren namentlich die Residenzstädte der
Fürsten zur Blüte gekommen, die sich um so schneller und
glänzender entwickelte, je entschiedener die
Fürstengewalt der Mittelpunkt des politischen Lebens in
Deutschland wurde. Im 19. Jahrh. aber hat nicht nur der Bau von
Eisenbahnen, sondern auch der Aufschwung im Bergbau, in der
Fabrikthätigkeit und im Handel dem Städtewesen in
Deutschland einen ungeahnten Aufschwung gegeben. Städte,
welche im Mittelpunkt wichtiger Eisenbahnnetze, ergiebiger Bergbau-
und Industriebezirke liegen, haben ihre Bevölkerung bisweilen
verzehnfacht.
Einen bedeutenden Aufschwung hatte das Städtewesen
frühzeitig in Italien genommen. Die einzelnen Einwohnerklassen
traten in Vereinigungen zusammen, so in Mailand die vornehmen
Lehnsleute, die Ritter und Vollfreien, und erwarben zu Ende des 11.
Jahrh. für ihre Vorsteher (consules) die Verwaltung und
Gerichtsbarkeit innerhalb der S. Friedrich I. hatte den Anspruch
erhoben, diese Consules in den lombardischen Städten zu
ernennen, mußte ihnen aber nach furchtlosem Kampf 1183 das
Wahlrecht der Konsuln zugestehen. Diese wurden dann vom König
oder in den bischöflichen Städten vom Bischof mit den
Regalien belehnt. Neben jenen Beamten finden sich häufig ein
Rat von 100 Personen (credenza) und eine allgemeine
Bürgerversammlung (parlamentum). Seit dem 13. Jahrh. wurde es
Sitte, Mitgliedern auswärtiger adliger Familien unter dem
Titel "Podestà" die militärische und richterliche
Gewalt auf ein Jahr anzuvertrauen, neben denen zwei Ratskollegien,
ein Großer und ein Kleiner Rat, fungierten. Auch die
Handwerker bemühten sich, Anteil am Stadtregiment zu erhalten,
bildeten Innungen und organisierten sich unter Consules oder einem
eignen Podestà oder Capitano del popolo als besondere
Gemeinde neben den Adelsgeschlechtern. Diese Rivalität unter
den einzelnen Bevölkerungsklassen erhielt einen neuen Impuls
durch die Parteiungen der Guelfen und Ghibellinen.
213
Stadt (Bevölkerungsverhältnisse).
In diesen blutigen Kämpfen ging meist die städtische
Freiheit
verloren. Erst in neuerer Zeit nahm das Städtewesen in
Italien wiederum
einen erfreulichen Aufschwung.
In Südfrankreich findet anfangs eine
ähnliche Entwickelung wie in Italien statt. Auch hier gibt
es Consules,
Ratskollegien und ein Parlamentum, aber daneben macht sich auch
die
erstarkende Staatsgewalt geltend; ihre Vertreter sind die
Baillis, denen
die höhere Gerichtsbarkeit vorbehalten bleibt. In den
bischöflichen
Städten von Nordfrankreich traten die untern Stände zu
Vereinigungen
(Kommunen) zusammen, nahmen den Kampf gegen ihre Bischöfe
auf und fanden
dabei bei den Königen lebhafte Unterstützung. Diese
vertraten den
wohlwollenden Grundsatz, daß jede "Kommune" unter dem
König stehe,
obwohl sie die Städte ihres unmittelbaren Gebiets (des
alten Francien)
nicht sonderlich begünstigten. Als Beamte finden sich in
diesen Städten:
ein Maire, mehrere Schöffen (Jurati) und ein Bailli. Als
die Macht des
Königtums wuchs, wurde die städtische Selbstverwaltung
mehr und mehr
eingeschränkt.
In England sind die Städte teils auf keltischen,
teils
auf römischen Ursprung zurückzuführen. Sie
besaßen in der
angelsächsischen Zeit eine seltene Freiheit und
Selbständigkeit, berieten
ihre Angelegenheiten in eigner Versammlung und standen unter
Burggrafen. Innerhalb der städtischen Bevölkerung
haben sich schon früh
Vereinigungen (Gilden) gebildet, welchen die Pflicht
gegenseitiger
Rechtshilfe und der Blutrache oblag. Diese Gilden hatten
Statuten und
eigne Vorsteher. Nach der Eroberung Englands durch die Normannen
wurden
die Rechte der Städte vielfach verkürzt; sie gerieten
in Abhängigkeit
von den Königen, Baronen oder Bischöfen. Seit dem 15.
Jahrh. erhielten
sie von den Königen umfangreichere Privilegien, doch haben
sie auch
schon früher bei der eigenartigen Entwickelung der
englischen Verfassung
Einfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten
gewonnen. Ihnen wurden
bestimmte Anteile der aufzubringenden Steuern nicht ohne ihre
Zustimmung
auferlegt und die Verteilung und Eintreibung im einzelnen ihnen
selbst
überlassen. In der Magna Charta ist jedoch nur London und
sieben andern
Städten oder Häfen ein Recht der Teilnahme am
Parlament
zugestanden. Später stieg die Zahl dieser Städte
bisweilen auf 200, doch
hing die Berufung der städtischen Abgeordneten von der
Willkür der
Könige ab. Schon um die Mitte des 13. Jahrh. kam für
die Vertreter der
Städte die Bezeichnung "Gemeine" (communitas totius regni
Angliae) auf;
sie bildeten neben der Versammlung der Barone und Prälaten
ein zweites
Kollegium und erhielten einen Sprecher. Ihr Hauptrecht war
die
Verwilligung von Abgaben. Manche Städte sendeten einen,
andre zwei
Vertreter zur Versammlung der Gemeinen, wozu im 14. Jahrh. noch
zwei
Vertreter aus jeder Grafschaft kamen. Seit dem 16. Jahrh.,
besonders
aber seit den Zeiten Elisabeths, hob sich mit dem wachsenden
Wohlstand
der Einfluß der Städte. Die Mehrzahl der englischen
Städte hat jedoch
erst seit dem vorigen Jahrhundert durch Handel, Schiffahrt und
Industrie
einen bewunderungswürdigen Aufschwung genommen; denn noch
zu Ende des
17. Jahrh. gab es außer London, das damals ½ Mill.
Einwohner zählte,
nur zwei Städte (Bristol und Norwich) mit 30,000 und vier
andre mit mehr
als 10,000 Einw.
Bevölkerungsverhältnisse.
Naturgemäß bildet die S. vorzüglich den
Standort für Handel und Gewerbe,
welche die Anhäufung vieler Betriebe auf kleinem
Flächenraum nicht
allein gestatten, sondern in derselben eine vorzügliche
Stütze für
Gedeihen und Weiterentwickelung finden, während die auf die
Bebauung der
Bodenoberfläche angewiesene Landwirtschaft eine Zerstreuung
der
Bevölkerung über das ganze Land hin bedingt. Land und
S. versorgen
einander gegenseitig. Demnach können große
Städte, welche stets der
Zufuhr von Massengütern (Lebensmittel, Brennstoffe etc.)
bedürfen, nur
bestehen, wenn die Verkehrsverhältnisse für sie
genügend entwickelt
sind. Darum sind solche Städte früher vornehmlich an
Meeresküsten und
schiffbaren Strömen entstanden. Zwar hatte auch das
Altertum seine
Großstädte, doch konnte die Zahl derselben nur
verhältnismäßig klein
sein. Und im Mittelalter bis zum 19. Jahrh. trat in den
meisten
europäischen Ländern die städtische
Bevölkerung gegenüber der ländlichen
erheblich zurück. Eine wesentliche Änderung wurde in
dieser Beziehung
durch die Fortschritte der modernen Technik und insbesondere
des
Verkehrswesens herbeigeführt. Die städtische
Bevölkerung wächst in
größerm Verhältnis und zwar vorzugsweise durch
Zuzug als diejenige des
flachen Landes. Als Folge dieses Umstandes läßt sich
in den Städten eine
stärkere Besetzung der Altersklassen von 15-35 Jahren
wahrnehmen. So
enthielten Prozente der Bevölkerung die Altersklassen unter
15 Jahren im
Deutschen Reich 35, in einer Reihe größerer deutscher
Städte nur 25; für
die Alter von 20-30 Jahren waren die Prozente 16 u. 26, für
die Alter
von 30-40 Jahren: 13 u. 16, für die Alter über 40
Jahren dagegen: 25
u. 20. Schon aus diesem Grund wird es nicht als auffallend
erscheinen,
wenn in den Städten Heirats- u. Geburtszahl
verhältnismäßig hoch
sind. Gleichzeitig ist aber auch und zwar vornehmlich, weil hier
die
gesamten Lebensverhältnisse andrer Art sind, die Anzahl der
unehelichen
Geburten und der Sterbefälle in den meisten Städten
relativ größer als
auf dem Land.
In Orten mit über 2000 Einw. leben Prozente von
der
gesamten Bevölkerung: in den Niederlanden 80, Belgien 60,
Großbritannien
und Irland 45, Spanien und Italien 43, Portugal 41, Deutschland
40
(Sachsen 52, Rheinland 60, Posen 22), Schweiz 39,
Österreich-Ungarn 37,
Frankreich 30, Dänemark 22, Norwegen 15, Schweden 11,
Rußland
11. Vorzüglich ist in den letzten Jahren die
Bevölkerung der großen
Städte und zwar am meisten die der Städte mit mehr als
100,000
Einw. gewachsen. In geringerm Grad hat die der kleinern
Städte
zugenommen, während in Orten von weniger als 3000 Seelen
nicht selten
ein Rückgang zu beobachten war. Auf der ganzen Erde gibt es
zur Zeit 206
Städte mit über 100,000 Einw. Hiervon entfallen je 2/5
auf Europa und
Asien. Von der gesamten Bevölkerung lebten 1881 in solchen
Großstädten:
in England und Wales 33 Proz., Belgien u. Niederlande 12,5,
Frankreich
7,7, Deutschland 7,1, Italien 6,7, Österreich-Ungarn 3,3,
Rußland 1,7
Proz. Die Art des raschen Wachstums einiger
Großstädte wird durch
nachstehende Zahlen verdeutlicht. Es hatten in Tausenden
Städte Jahr Einw. Jahr Einw. Jahr Einw. Jahr
Einw.
London 1801 959 1851 2362 1875 3445 1886 4120
Paris 1817 714 1856 1171 1876 1989 1886 2345
Berlin 1801 173 1851 425 1875 967 1885 1315
Wien 1800 231 1857 476 1875 677 1880 726¹
New York - - 1850 516 1875 1029 1886 1439²
Leipzig 1801 32 1852 67 1875 127 1885 170
¹ Mit 35 angrenzenden Gemeinden 1888: 1,200,000.
² Mit Brooklyn, Jersey City und Hoboken 2¼
Mill.
214
Stadt (Verfassungen).
Sind die Städte schon infolge davon in politischer und
wirtschaftlicher Beziehung in vielen Ländern tonangebend,
daß in denselben das gesamte geistige Leben und der
menschliche Verkehr viel reger ist als auf dem Land, so wird ihr
Einfluß durch das Wachstum der Volkszahl noch weiter
gesteigert. Mit dieser Zunahme erwachsen den Städten eine
Reihe von Aufgaben, welche das Landleben entweder gar nicht oder
doch nur in einem viel bescheidenern Umfang kennt, und die
vollständig zu bewältigen erst mit den Fortschritten der
modernen Technik möglich wurde. So werden in unsern
Millionenstädten großartige Aufwendungen gemacht im
Interesse der Sicherheit, der Sittlichkeit und Reinlichkeit,
für Gesundheitspflege, Wasserbeschaffung, Kanalisierung,
Abfuhr von Abfallstoffen, Beleuchtung, Unterrichtswesen,
Verkehrswesen etc., welche die Budgets vieler kleinerer Staaten
weit übertreffen. Übrigens gilt der Satz: "Wo viel Licht
ist, da ist auch viel Schatten" ganz vorzüglich von den
Städten, insbesondere von Großstädten, in welchen
sich immer viele verkümmerte und verzweifelte Existenzen
ansammeln, wo dicht neben Luxus und Üppigkeit Jammer und Elend
ihre Wohnstätte aufschlagen und bei Vorhandensein von nur
teilweise bewohnten Palästen von einer für die untern
Klassen empfindlichen und für die mittlern oft selbst
drückenden Wohnungsnot gesprochen werden kann.
Städteverfassungen.
In Bezug auf die Verfassung der Stadtgemeinden stehen sich
gegenwärtig in Deutschland hauptsächlich zwei Systeme
gegenüber. Das eine hat sich namentlich im Anschluß an
die preußische (Steinsche) Städteordnung vom 19. Nov.
1808 entwickelt. Es charakterisiert sich dadurch, daß die
Verfassung der Städte und der Landgemeinden eine verschiedene,
und daß den Städten eine weiter gehende Selbstverwaltung
eingeräumt ist als den ländlichen Ortschaften. An der
Spitze der Stadtgemeinde befindet sich nach diesem System in der
Regel eine kollegialische Vollzugsbehörde, der als Vertretung
der Bürgerschaft das städtische Kollegium zur Seite
steht. Die erstere Behörde ist der Magistrat oder Stadtrat
(Gemeindevorstand, Ortsvorstand), bestehend aus einem ersten
Bürgermeister (Stadtschultheißen), welcher in
größern Städten den Titel Oberbürgermeister
führt, dem zweiten Bürgermeister oder Beigeordneten und
in größern Städten aus einer Anzahl von besoldeten
und unbesoldeten Stadträten (Ratsherren, Schöffen,
Ratsmännern, Magistratsräten). Dazu kommen nach
Bedürfnis noch besondere besoldete Magistratsmitglieder
für einzelne Zweige der städtischen Verwaltung
(Kämmerer, Baurat, Schulrat, Syndikus etc.). Der Magistrat ist
das Organ der Verwaltung; insbesondere steht ihm auch die
Handhabung der Ortspolizei zu, wofern diese nicht, wie in manchen
größern Städten, einer staatlichen Behörde
(Polizeipräsident, Polizeidirektion) übertragen ist. Die
Vertretung der Bürgerschaft ist die
Stadtverordnetenversammlung (Gemeinderat, städtischer
Ausschuß, Kollegium der Bürgervorsteher,
Stadtältesten, Stadtverordneten, Stadtrat). Diese
Körperschaft hat das Recht der Kontrolle; ihre Zustimmung ist
zur Aufstellung des städtischen Haushaltsetats, zu wichtigen
Akten der Vermögensverwaltung und zum Erlaß von
Ortsstatuten erforderlich. Die Stadtverordneten versehen ihre
Funktionen als Neben- und Ehrenamt; ihre Wahl erfolgt durch die
Bürgerschaft. Dagegen werden die Magistratsmitglieder in der
Regel durch die Stadtverordneten gewählt; sie sind teils
besoldete Berufsbeamte, was namentlich von den Bürgermeistern
in den größern Städten gilt, teils fungieren sie im
Ehrenamt. Die Wahlperiode der Stadtverordneten ist eine drei- bis
sechsjährige, für die Magistratsmitglieder beträgt
sie 6, 9, 12 Jahre; auch ist bei den letztern Wahl auf Lebenszeit
zulässig. Gegenüber diesen Gemeindewahlen hat die
Regierung ein Bestätigungsrecht, dessen Umfang jedoch
verschiedenartig begrenzt ist. Dies System des kollegialischen
Magistrats und Gemeinderats ist namentlich im Norden und im Osten
Deutschlands verbreitet. Es besteht zunächst in den
östlichen Provinzen Preußens und in den Provinzen
Hannover, Westfalen und Schleswig-Holstein. Die Städteordnung
vom 19. Nov. 1808 hatte nämlich die preußischen
Städte von den beengenden Fesseln einer weitgehenden
staatlichen Bevormundung befreit. Ihr folgte die revidierte
Städteordnung vom 17. März 1831, welche die
Möglichkeit erweiterte, durch Ortsstatuten Sonderbestimmungen
treffen zu können. Nach einem mißglückten Versuch,
die Gemeindeverfassung für die Städte, Landgemeinden und
Gutsbezirke für das ganze Staatsgebiet in einheitlicher Weise
zu regeln, folgte die Städteordnung vom 30. Mai 1853 für
die östlichen Provinzen, indem nur Neuvorpommern und
Rügen für die dortigen Städte ihre auf besondern
Bestimmungen beruhende Verfassung behielten. Die neuern
Verwaltungsgesetze haben übrigens manche Abänderungen
dieser Städteordnung herbeigeführt. Dasselbe gilt von der
Städteordnung für Westfalen vom 19. März 1856. Eine
besondere Städteordnung ist 25. März 1867 für
Frankfurt a. M. erlassen. Der erste Bürgermeister wird dort
aus den von der S. präsentierten Kandidaten vom König
ernannt. Die Städteordnung für Schleswig-Holstein vom 14.
April 1869 überweist die Verwaltung einem aus
Bürgermeister und "Ratsverwandten" bestehenden
Magistratskollegium. Auch in der Provinz Hannover
(Städteordnung vom 24. Juni 1858) ist der Magistrat, ebenso
wie das Kollegium der Bürgervorsteher, kollegialisch
organisiert. Dasselbe System finden wir im rechtsrheinischen Bayern
(Gesetze von 1817, 1818, 1869 und 1872), im Königreich Sachsen
(revidierte Städteordnung vom 24. April 1873), in
Braunschweig, Oldenburg, Sachsen-Koburg-Gotha, Lippe und
Schaumburg-Lippe. In Sachsen-Meiningen und -Altenburg beruht die
Städteverfassung zumeist auf ortsstatutarischer Bestimmung,
ebenso in Mecklenburg.
Neben dem bisher erörterten System findet sich aber in
Deutschland ein zweites, welches seine Verbreitung wesentlich dem
Einfluß der französischen Gesetzgebung verdankt. Dies
kennt für Stadt- und Landgemeinden nur Eine Verfassung (sogen.
Bürgermeistereiverfassung). Die Verwaltungsgeschäfte der
S. werden hiernach von einem Bürgermeister mit einem oder
mehreren Beigeordneten geführt, die Gemeindevertretung ist
Sache eines gewählten Gemeinderats. Dies System ist in der
Rheinprovinz (Städteordnung vom 15. Mai 1856), in der
bayrischen Pfalz, in Hessen, Sachsen-Weimar, Anhalt, Waldeck und in
den reußischen und schwarzburgischen Fürstentümern
vertreten. Ein drittes zwischen jenen beiden vermittelndes System
gilt in Württemberg, Baden und in Hessen-Nassau. Auch hier ist
die Verfassung für S. und Land eine einheitliche; sie
nähert sich aber mehr der städtischen als der
ländlichen Verfassung, indem sie neben dem Vorstand der
Gemeinde noch einen Gemeinderat für die
Verwaltungsgeschäfte und dann als Vertretung der
Bürgerschaft den Gemeindeausschuß hat. In
Elsaß-Lothringen besteht das französische System, doch
ist seit 1887 die Änderung getroffen, daß der
Bürgermeister und die Beigeordneten nicht
215
Stadtältester - Stadtlohn.
mehr notwendig dem Gemeinderat zu entnehmen sind, wie dies
früher vorgeschrieben war. Auch kann jenen Gemeindebeamten,
entgegen den in Frankreich geltenden Bestimmungen, kraft
ministerieller Anordnung eine Besoldung gewährt werden. Eine
Entschädigung für Repräsentationsaufwand war schon
nach französischem Recht zulässig. In Frankreich selbst
erscheinen die Städte wesentlich als Verwaltungsbezirke, und
von einer eigentlichen Selbständigkeit derselben ist nicht die
Rede. Dagegen hat Schweden durch Gesetz vom 3. Mai 1862 seinen
Städten die Selbstverwaltung verliehen. Auch in England ist
die Städteverfassung von dem Regierungseinfluß
möglichst unabhängig. Für Rußland ist eine
Städteordnung 16. Juni 1870 erlassen.
[Litteratur.] Vgl. v. Maurer, Geschichte der
Städteverfassung in Deutschland (Erlang. 1869-71, 4 Bde.);
Heusler, Der Ursprung der deutschen Städteverfassung (Weim.
1872); Hüllmann, Städtewesen des Mittelalters (Bonn
1825-29, 4 Bde.); Arnold, Verfassungsgeschichte der deutschen
Freistädte (Gotha 1854, 2 Bde.); Brülcke, Die
Entwickelung der Reichsstandschaft der Städte (Hamb. 1881);
"Chroniken der deutschen Städte" (hrsg. von der Münchener
Historischen Kommission 1862-89, Bd. 1-21); Lambert, Die
Entwickelung der deutschen Städteverfassungen im Mittelalter
(Halle 1865, 2 Bde.); v. Below, Entstehung der deutschen
Stadtgemeinde (Düsseld. 1888); Jastrow, Die Volkszahl
deutscher Städte zu Ende des Mittelalters etc. (Berl. 1886)
und die Litteratur bei Art. Stadtrechte; ferner Steffenhagen,
Preußische Städteordnung vom 30. Mai 1853 (6. Aufl.,
Demmin 1885); Derselbe, Handbuch der städtischen Verfassung
und Verwaltung in Preußen (Berl. 1887-1888, 2 Bde.);
Örtel, Städteordnung vom 30. Mai 1853 (Liegn. 1883, 2
Bde.); Kotze, Die preußischen Städteordnungen (2. Aufl.,
Berl. 1883); Ebert, Der Stadtverordnete im Geltungsgebiet der
Städteordnung vom 30. Mai 1853 (2. Aufl., das. 1883);
"Städteordnung für die Rheinprovinz" (3. Aufl., Elberf.
1882); v. Bosse, Die sächsische Städteordnung (4. Aufl.,
Leipz. 1879); Schwanebach, Russische Städteordnung (St.
Petersb. 1874); Gneist, Selfgovernment (3. Aufl., Berl. 1871);
Kohl, Die geographische Lage der Hauptstädte Europas (Leipz.
1874); Sitte, Der Städtebau (geschichtlich, Wien 1889).
Stadtältester, in Preußen Ehrentitel eines
Magistratsmitglieds, welches sein Amt mindestens neun Jahre lang
mit Ehren bekleidet hat; wird vom Magistrat in Übereinstimmung
mit der Stadtverordnetenversammlung verliehen. In andern Staaten
heißen die Stadtverordneten zuweilen Stadtälteste.
Stadtamhof, Bezirksamtsstadt im bayr. Regierungsbezirk
Oberpfalz, an der Mündung des Regen in die Donau, Regensburg
gegenüber, hat eine kath. Kirche, 2 Waisenhäuser, ein
Amtsgericht, Maschinenfabrikation, Schiffahrt, Speditionshandel und
(1885) 3449 meist kath. Einwohner.
Stadtausschuß, s. Stadtkreis.
Stadtbahn, entweder das durch die Straßen einer
Stadt gelegte, zum Befahren mit Pferdewagen oder
Straßenlokomotiven bestimmte Schienennetz (s.
Straßeneisenbahn) oder die zur Vermittelung des Lokalverkehrs
und durchgehenden Eisenbahnverkehrs durch eine Stadt geführte
Lokomotiveisenbahn.
Stadtberge, Stadt, s. Marsberg.
Stadtbücher, s. Grundbücher.
Städtebünde, die Verbindungen der Städte
im Mittelalter zur Verteidigung ihrer Freiheiten gegen
fürstliche Herrschaftsansprüche und in den Zeiten des
Faustrechts zum Schutz ihres Handels und Verkehrs: so bildete sich
in Italien der Lombardische Städtebund gegen Kaiser Friedrich
I., in Deutschland im 14. Jahrh. der Rheinische und der
Schwäbische Städtebund, in Norddeutschland vor allem die
Hansa (s. d.), in Preußen im 15. Jahrh. der
Westpreußische Städtebund u. a.
Städteordnung, die für Städte im Gegensatz
zu den Landgemeinden gegebene Gemeindeordnung (s. Stadt, S.
214).
Städtereinigung, die Beseitigung aller Abfallstoffe
aus den Städten zur Vermeidung schädlicher Zersetzungen
derselben und einer Verunreinigung des Bodens und des Grundwassers
mit fäulnisfähigen Substanzen, welche die Entwickelung
krankheiterregender Organismen begünstigen. In den meisten
ältern großen Städten ist der Boden durch
Senkgruben, Schlachthäuser etc. arg verunreinigt, und an
vielen Orten ist infolgedessen das Wasser aus den städtischen
Brunnen nur noch für gewisse technische Zwecke brauchbar. Die
moderne S. kann daher nur durch rationelle Abfuhr der Exkremente
(s. d.), durch Kanalisation (s. d.), Zentralisation des
Schlächtereibetriebs in öffentlichen Schlachthäusern
etc. weiterer Verunreinigung vorbeugen und die Selbstreinigung des
Bodens vorbereiten, für die Versorgung mit gutem Trinkwasser
müssen Wasserleitungen angelegt werden. Wo S. konsequent
durchgeführt ist, hat sich der Gesundheitszustand gehoben und
ist die Sterblichkeit gesunken. Vgl. Varrentrapp, Entwässerung
der Städte (Berl. 1868); "Reinigung und Entwässerung
Berlins" (das. 1870-79, 13 Hefte); Pettenkofer, Kanalisation und
Abfuhr (Münch. 1876); Sommaruga, Die
Städtereinigungssysteme in ihrer land- und
volkswirtschaftlichen Bedeutung (Halle 1874); kleinere Schriften
von v. Langsdorff, Lorenz, Martini, Riedel, Stammer u. a.
Stadthagen, Stadt im Fürstentum Schaumburg-Lippe,
Knotenpunkt der Linien Braunschweig-Hamm und S.-Osterholz der
Preußischen Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, ein
Schloß, ein Landratsamt, ein Amtsgericht, Steinkohlengruben,
Glasfabrikation, Gerberei, Holzschneiderei, Steinbrüche,
Ziegeleien und (1885) 4394 meist evang. Einwohner.
Stadtilm, Stadt im Fürstentum
Schwarzburg-Rudolstadt, Landratsamt Rudolstadt, an der Ilm, 348 m
ü. M., hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, eine
Hutfabrik, Gerberei, Orgelbau, Bierbrauerei und (1885) 3107 evang.
Einwohner. 1599 ward hier der Hauptrezeß, betreffend die
Teilung der schwarzburgischen Länder, geschlossen.
Stadtkreis, in Preußen der besondere Kreis- und
Kommunalverband, welchen die sogen. großen Städte, d. h.
diejenigen, welche mit Ausschluß der aktiven
Militärpersonen mindestens 25,000 Einwohner haben, bilden
können. Kleinere Städte können nur ausnahmsweise auf
Grund königlicher Verordnung aus dem Kreisverband ausscheiden.
Die Geschäfte des Kreistags und des Kreisausschusses, soweit
sich die Thätigkeit des letztern auf die Verwaltung der
Kreiskommunalsachen bezieht, werden von den städtischen
Behörden wahrgenommen. Im übrigen besteht an Stelle des
Kreisausschusses ein Stadtausschuß unter dem Vorsitz des
Bürgermeisters oder seines Stellvertreters.
Stadtlohn, Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Münster, Kreis Ahaus, an der Berkel, hat eine kath. Kirche,
bedeutende Nesselweberei, Lein- und Halbleinweberei, Bleicherei,
Thonwarenfabrikation und (1885) 2189 Einw. Hier 6. Aug. 1623 Sieg
der Kai-
216
Stadtmusikus - Stael-Holstein.
serlichen unter Tilly über Herzog Christian von
Braunschweig und im August 1638 der Kaiserlichen (Hatzfeld)
über die Schweden (King).
Stadtmusikus (Stadtpfeifer), s.
Musikantenzünfte.
Stadtoldendorf, Stadt im braunschweig. Kreis Holzminden,
an der Linie Holzminden-Jerxheim der Preußischen Staatsbahn,
195 m ü. M., hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, eine
Oberförsterei, Sandsteinbrüche und (1885) 2571 Einw.
Dabei das ehemalige Cistercienserkloster Amelunxborn mit einer
berühmten Klosterschule von 1569 bis 1754.
Stadtprozelten, Stadt im bayr. Regierungsbezirk
Unterfranken, Bezirksamt Marktheidenfeld, am Main, hat eine kath.
Kirche, eine Burgruine, ein Amtsgericht, ein Forstamt, ein reiches
Hospital, Obst- und Weinbau und (1885) 844 Einw. Dabei das Dorf
Dorfprozelten mit 1017 Einw.
Stadtrat, städtische Kollegialbehörde, welcher
die Verwaltung der städtischen Angelegenheiten obliegt. Das
vollziehende Organ ihrer Beschlüsse ist der Magistrat
(Bürgermeisteramt). Mitunter wird aber auch der letztere S.
genannt und für die Mitglieder desselben die Bezeichnung
"Stadträte" (Magistratsräte) gebraucht. Vgl. Stadt, S.
215.
Stadtrecht (Weichbildrecht), ursprünglich das
kaiserliche oder landesherrliche Privilegium, wodurch eine Gemeinde
zur Stadt erhoben ward; dann Inbegriff der in einer Stadt
gültigen Rechtssätze. Solche Stadtrechte entstanden in
Deutschland seit dem 10. Jahrh., und es wurden dadurch nicht nur
Privatrechtsverhältnisse, sondern auch Gegenstände des
öffentlichen Rechts normiert. Oft ward das Recht einer Stadt
mehr oder minder vollständig von andern rezipiert; so die
Stadtrechte von Münster, Dortmund, Soest und andern
westfälischen Städten, ganz besonders aber die
Stadtrechte von Magdeburg, Lübeck und Köln. Das
lübische Recht gewann die Küstenstriche von Schleswig ab
bis zu den östlichsten deutschen Ansiedelungen, das
Magdeburger die Binnenlande bis nach Böhmen, Schlesien und
Polen hinein und verbreitete sich als Kulmer Recht über ganz
Preußen. Infolge der Umgestaltung der
Territorialverhältnisse sowie der Rechtsbegriffe machten sich
Umänderungen der Stadtrechte notwendig, und so entstanden im
Lauf des 15., 16. und 17. Jahrh. an vielen Orten verbesserte
Stadtrechte, sogen. "Reformationen", wobei aber unter Einwirkung
der Rechtsgelehrten mehr und mehr römisches Recht eingemischt
ward bis zuletzt die alten Stadtrechte zugleich mit der eignen
Gerichtsbarkeit und der Autonomie der Städte bis auf
dürftige Reste der Autorität der Landesherren weichen
mußten. Nur für das Familien- und Erbrecht haben sich
einzelne Satzungen der alten Stadtrechte (Statuten) bis auf die
Gegenwart erhalten.
Vgl. Gaupp, Deutsche Stadtrechte des Mittelalters (Bresl.
1851-52, 2 Bde.); Gengler, Deutsche Stadtrechte des Mittelalters
(neue Ausg., Nürnb. 1866); Derselbe, Codex juris municipalis
Germaniae (Erlang. 1863-67, Bd. 1); Derselbe, Deutsche
Stadtrechtsaltertümer (das. 1882).
Stadtreisender, s. Platzreisender.
Stadtsteinach, Bezirksamtsstadt im bayr. Regierungsbezirk
Oberfranken, an der Steinach, hat eine kath. Kirche, ein
Amtsgericht, ein Forstamt, Eisensteingruben und (1885) 1490 meist
kath. Einwohner.
Stadtsulza, s. Sulza.
Stadtverordnete, s. Stadt, S. 214.
Staël-Holstein (spr. stal), Anne Louise Germaine,
Baronin von, berühmte franz. Schriftstellerin, geb. 22. April
1766 zu Paris, Tochter des Ministers Necker, entwickelte sich
frühzeitig unter dem Einfluß einer streng
protestantischen Mutter und der philosophischen Anschauungen, denen
man im Haus ihres Vaters huldigte, verfaßte mit 15 Jahren
juristische und politische Abhandlungen und verheiratete sich 1786
auf den Wunsch ihrer Mutter mit dem schwedischen Gesandten, Baron
von S. Doch war diese Ehe nicht glücklich; 1796 trennte sie
sich von ihrem geistig tief unter ihr stehenden Gemahl,
näherte sich ihm aber 1798 wieder, als er krank wurde, um ihn
zu pflegen, und blieb bei ihm bis zu seinem Tod (1802). Seit dem
ersten Jahr ihrer Ehe entwickelte sie eine eifrige litterarische
Thätigkeit. 1786 war ihr Schauspiel "Sophie, ou les sentiments
secrets" erschienen, dem als letzter Versuch dieser Art 1790 die
Tragödie "Jane Gray" folgte; sie sah ein, daß sie
für Bühnendichtung nicht geschaffen war. Besser gelangen
ihr die überschwenglich lobenden "Lettres sur les
écrits et le caractère de J. J. Rousseau" (1788);
doch fehlt die Kritik fast ganz. Das immer reichlicher
fließende Blut ließ ihre anfängliche Begeisterung
für die Revolution bald schwinden; ein Plan zur Flucht, den
sie der königlichen Familie unterbreitete, wurde nicht
angenommen; am 2. Sept. 1792 mußte sie selbst flüchten.
Auch ihre beredte Schrift zu gunsten der Königin:
"Réflexions sur le procès de la reine" (1793) hatte
keine Wirkung. Dagegen erregte sie Aufsehen durch ihre Schriften:
"Réflexions sur la paix, adressées à M. Pitt
et aux Français" (Genf 1795) und besonders durch "De
l'influence des passions sur le bonheur des individus et des
nations" (Laus. 1796), ein Werk voll tiefer und lichtvoller
Gedanken. Nach ihrer Rückkehr verfeindete sie aber ihr
energisches Eintreten für konstitutionelle Ideen derart mit
Bonaparte, daß sie auf 40 Stunden im Umkreis von Paris
verbannt wurde. Sie ging nach Coppet, lebte aber meist auf Reisen.
Ihr schriftstellerischer Ruf hatte sich inzwischen in weitern
Kreisen verbreitet durch ihre Schrift "De la littérature
considérée dans ses rapports avec les institutions
sociales" (1799, 2 Bde.) und durch den Roman "Delphine" (1802, 6
Bde., u. öfter; hrsg. von Sainte-Beuve, 1868; deutsch, Leipz.
1847, 3 Bde.), eine Schilderung ihrer eignen Jugend in Briefform.
1803 machte sie ihre erste Reise nach Deutschland, wo sie
längere Zeit in Weimar und Berlin verweilte; 1805 bereiste sie
Italien. Seit dieser Zeit war A. W. v. Schlegel, den sie in Berlin
kennen gelernt hatte, ihr Begleiter, und sein Umgang ist nicht ohne
Einfluß auf ihre Ansichten, besonders über Kunst und
deutsche Litteratur, geblieben. Die Frucht ihrer Reise nach Italien
war der Roman "Corinne, ou l'Italie" (1807, 2 Bde., u. öfter;
deutsch von Fr. Schlegel, Berl. 1807; von Bock, Hildburgh. 1868),
eine begeisterte Schilderung Italiens und das glänzendste
ihrer Werke. 1810 ging sie nach Wien, um Stoff zu ihrem schon lange
geplanten Werk "De l'Allemagne" zu sammeln, einem Gemälde
Deutschlands in Beziehung auf Sitten, Litteratur und Philosophie;
doch wurde die ganze Auflage auf Befehl des damaligen
Polizeiministers Savary sogleich vernichtet und gegen die
Verfasserin von Napoleon I. ein neues Verbannungsdekret erlassen,
das sich auf ganz Frankreich erstreckte. Erst zu Ende 1813 erschien
das Werk (3 Bde.) zu London, darauf 1814 auch zu Paris. So reich es
an geistvollen Gedanken ist und so achtungswert durch die
Wärme, womit es den Franzosen deutsche Art und Kunst
empfiehlt, so enthält es doch auch viele schiefe Ansichten und
erhebliche Unrichtigkeiten. Jedenfalls
217
Stäfa - Staffordshire.
aber hat es den größten und dauerndsten Eindruck
gemacht und muß darum als ihr Hauptwerk gelten. S. lebte in
der nächsten Zeit wieder zu Coppet, wo sie sich insgeheim mit
einem jungen Husarenoffizier, de Rocca, verheiratete. Von der
französischen Polizei fort und fort verfolgt, begab sie sich
im Frühjahr 1812 nach Moskau und Petersburg und von da nach
Stockholm, wo ihr jüngster Sohn, Albert, im Duell blieb. Im
Anfang des folgenden Jahrs ging sie nach England; erst nach
Napoleons Sturz kehrte sie nach langer Verbannung, deren Ereignisse
sie in "Dix années d'exil" (1821; deutsch, Leipz. 1822)
teilweise erzählt, nach Paris zurück. Nach Bonapartes
Rückkehr von Elba zog sie sich nach Coppet zurück. Nach
der zweiten Restauration erhielt sie Vergütung für die
alte Schuld von 2 Mill. Frank, die ihr Vater bei seinem Abschied im
öffentlichen Schatze zurückgelassen hatte, und lebte
fortan in einem glücklichen häuslichen Kreis und im engen
Verkehr mit litterarischen und politischen Freunden in Paris, bis
zu ihrer letzten Krankheit mit Ausarbeitung der trefflichen
"Considérations sur les principaux événements
de la Révolution française" (1818, 3 Bde.; neue Ausg.
1861; deutsch von A. W. v. Schlegel, Heidelb. 1818, 6 Bde.)
beschäftigt. Sie starb 14. Juli 1817. Zu erwähnen sind
noch die Werke: "Vie privée de M. Necker", an der Spitze der
Ausgabe der Manuskripte ihres Vaters (1804); "Réflexions sur
le suicide" (1813); "Zulma et trois nouvelles" (1813); "Essais
dramatiques" (1821), eine Sammlung von 7 Stücken in Prosa,
darunter das Drama "Sapho". Eine Ausgabe ihrer Werke (Par. 1820-21,
17 Bde.) veranstaltete ihr ältester Sohn, Auguste Louis, Baron
von S. (geb. 1790), der sich selbst als Schriftsteller bekannt
machte und 1827 starb (seine "OEuvres divers" gab seine Schwester,
die Herzogin von Broglie, heraus, 1829, 3 Bde.). Vgl. Baudrillart,
Éloge de Mad. de S. (1850); Norris, Life and times of Mad.
de S. (Lond. 1853); Gérando, Lettres inédites et
Souvenirs biographiques de Mad. Récamier et de Mad. S. (Par.
1868); Stevens, Mad. de S. (Lond. 1880, 2 Bde.); Lady
Blennerhassett, Frau von S. und ihre Freunde (Berl. 1887-89, 3
Bde.); ferner "Correspondance diplomatique du baron de S.,
documents inédits" (hrsg. von Léouzon le Duc, Par.
1881).
Stäfa, Gemeinde im schweizer. Kanton Zürich, am
rechten Ufer des Zürichsees, mit Weinbau, Baumwoll- und
Seidenweberei und (1880) 3874 Einw., durch Dampfschiffahrt mit
sämtlichen Uferorten verbunden.
Stafette (franz. Estafette), ein außerordentlicher
reitender Bote, welcher Briefe so schnell wie möglich
befördert, namentlich den Verkehr der Regierungen mit den
obern Behörden und den Gesandtschaften vielfach
unterhält. Seit der Entwickelung des Eisenbahn- und
Telegraphenverkehrs ist die Sache und mit ihr das Wort sehr
außer Gebrauch gekommen. Für Deutschland sind
Bestimmungen über die Estafettenbeförderung in Abschnitt
II, § 45 der Postordnung gegeben.
Staffa, eine der innern Hebriden, westlich von Mull, nur
360 Hektar groß, aber berühmt wegen ihrer
Basaltsäulen und Höhlen, unter denen die
Fingalshöhle (s. d.) die berühmteste ist.
Staffage (spr. -ahsche), Bezeichnung für einzelne
Figuren oder ganze Gruppen von Menschen und Tieren, welche in einer
Landschaft oder einem Architekturbild zur Belebung der Darstellung
angebracht werden, jedoch ohne die Hauptsache derselben zu
sein.
Staffelei, hölzernes Gestell, dessen sich der Maler
beim Anfertigen seiner Bilder zum Aufstellen derselben bedient. Es
hat an der Rückseite eine bewegliche Stütze zum Behuf
einer willkürlich schrägen Stellung und an der
Vorderseite ein bewegliches Querholz zum Höher- und
Niedrigerstellen des Bildes, was durch eiserne oder hölzerne
Bolzen erfolgt, welche in parallel angebrachte Öffnungen
gesteckt werden, und auf denen das Querholz aufliegt. Daher
Staffeleigemälde, kleinere Gemälde, welche auf der S.
verfertigt werden, Gegensatz von Wandgemälden.
Staffelgiebel, die an den Seitenkanten durch
stufenförmige Einschnitte gegliederten Hausgiebel, welche in
der Profanbaukunst des Mittelalters häufig angewendet wurden,
auch Katzentreppen (s. d.) und Treppengiebel genannt.
Staffelit, Mineral aus der Ordnung der Phosphate, nach
dem Fundort Staffel in Nassau benannt, vielleicht nur eine
Varietät des Phosphorits, bildet hellgrüne, traubige und
nierenförmige, mikrokristallinische Aggregate und enthält
bis zu 9 Proz. kohlensauren Kalk, etwas Wasser und Spuren von
Jod.
Staffeln, s. v. w. Stufen, beim Militär die Teile
von Truppenkörpern, die sich in gewissen Abständen
folgen, z. B. bei der Artillerie die Wagenstaffeln der Batterien
und Kolonnen. Über S. im taktischen Sinn s. Echelon.
Staffelngebete, s. Stufengebete.
Staffelrechnnng, s. Kontokorrent, S. 47.
Staffelrecht, s. Stapelgerechtigkeit.
Staffelschnitt, in der Heraldik die stufenförmige
Teilung eines Wappenschildes.
Staffelstein, Bezirksamtsstadt im bayr. Regierungsbezirk
Oberfranken, an der Lauter und der Linie München-Bamberg-Hof
der Bayrischen Staatsbahn, 295 m ü. M., hat eine kath. Kirche,
ein Amtsgericht, Obst-, Wein- und Spargelbau, Bierbrauerei, 2
Kunstmühlen, Landesprodukten-, Gerberrinden-, Weidenreifen-
und Holzhandel und (1885) 1837 Einw. Dabei der pittoreske
Staffelberg (mit Kapelle), reich an Versteinerungen. S. war der
Geburtsort des Rechenmeisters Adam Riese.
Staffieren (v. altfranz. estoffer), mit dem nötigen
Stoff oder Zubehör versehen, verzieren, mit Beiwerk
ausschmücken. Vgl. Staffage.
Stäffis am See, Ort, s. Estavayer le Lac.
Stafford, altertümliche Hauptstadt von Staffordshire
(England), am Sow, der sich dicht bei der Stadt mit dem Trent
vereinigt, hat 2 alte Kirchen, eine Grafschaftshalle (Shire Hall),
ein Rathaus mit großer Markthalle, ein neues Schloß,
Irrenhaus, Zuchthaus, große Stiefelfabriken, Gerberei,
Brauereien und (1881) 19,977 Einw.
Staffordshire (spr. stäffordschir), engl.
Grafschaft, von den Grafschaften Derby, Warwick, Worcester, Salop
und Chester begrenzt, umfaßt 3022 qkm (54,9 QM.) mit (1881)
981,013 Einw. Der Norden des Landes besteht aus kahlem,
unfruchtbarem, bis zu 552 m ansteigendem Hügelland mit
großen Strecken Moorland; im O. liegt Needwood Forest, ein
ausgedehnter Strich Heide; das Thal des Trent aber ist ungemein
fruchtbar, und auch der wellenförmige Süden ist
vorzüglich angebaut. Von der Oberfläche sind 39,7 Proz.
unter dem Pflug, 56,8 Proz. bestehen aus Wiesen, und an Vieh
zählte man 1887: 143,159 Rinder, 244,394 Schafe und 116,956
Schweine. Die wichtigsten Produkte des Bergbaues sind: Steinkohlen
(1887: 12,853,000 Ton.), Eisen (938,018 T. Erz), Blei und Kupfer.
Die Industrie ist ungemein entwickelt und liefert namentlich
Eisenwaren, Töpferwaren (in dem
218
Stage - Stahl.
als "Potteries" bekannten Bezirk), Glas, Seidenwaren,
Baumwollwaren und Stiefel. Hauptstadt ist Stafford, die
volkreichste Stadt ist Wolverhampton.
Stage, Taue aus Hanf oder Draht, welche von den Spitzen
der Masten und Stengen schräg nach vorn und unten verlaufen,
um den genannten Rundhölzern einen bessern Halt zu geben; sie
gestatten die Anbringung von Stagsegeln.
Stageiros (Stagira), von Andriern im 7. Jahrh. v. Chr.
gegründete Stadt im alten Makedonien, auf der Halbinsel
Chalkidike, berühmt als Geburtsort des Aristoteles (daher der
Stagirite), von Philipp II. 348 v. Chr. zerstört, aber
später wieder aufgebaut. Heute Ruinen Lymbiada.
Stägemann, Friedrich August von, preuß.
Staatsmann und Dichter, geb. 7. Nov. 1763 zu Vierraden in der
Ukermark, studierte zu Halle die Rechte und ward 1806 Geheimer
Oberfinanzrat, 1807 vortragender Rat bei dem nachmaligen
Staatskanzler v. Hardenberg und nach dem Tilsiter Frieden Mitglied
der zur Verwaltung des Landes niedergesetzten Immediatkommission,
unter dem Ministerium Stein vortragender Rat, 1809 Staatsrat, in
welcher Stellung er Hardenberg nach Paris, London und zum Wiener
Kongreß begleitete. Er starb 17. Dez. 1840 in Berlin. Seine
vaterländischen Gedichte, gesammelt als "Historische
Erinnerungen in lyrischen Gedichten" (Berl. 1828), zum Teil in
kunstvoller Odenform, spiegeln den idealistisch-patriotischen
Geist, welcher zur Zeit der Befreiungskriege die gebildeten Kreise
durchdrang. Dem Andenken seiner Gattin (gest. 1835) gewidmet ist
die als Manuskript gedruckte Sonettensammlung "Erinnerungen an
Elisabeth" (Berl. 1835); von ihr selbst erschienen: "Erinnerungen
für edle Frauen" (Leipz. 1846, 3. Aufl. 1873). Vgl. auch
"Briefe von S., Metternich, Heine und Bettina v. Arnim" (aus
Varnhagens Nachlaß, Leipz. 1865).
Stagione (ital., spr. stadschohne), Jahreszeit,
Saison.
Stagnation (lat.), Stillstand, Stockung.
Stagnelius, Erik Johan, schwed. Dichter, geb. 14. Okt.
1793 zu Gärdslösa auf Örland, studierte in Lund und
Upsala und erhielt dann eine Anstellung in der königlichen
Kanzlei. Seine Muße widmete er philosophischen Studien,
namentlich suchte er Schellings Identitätslehre mit
gnostischer Mystik zu verschmelzen. Finster und verschlossen, dabei
maßlos ausschweifend, verfiel er in periodischen Wahnsinn und
starb 23. April 1823. Seinen litterarischen Ruf begründete
1817 das epische Gedicht "Wladimir ten store", das von der
schwedischen Akademie gekrönt wurde. Seine Hauptwerke aber
sind der halb philosophische, halb religiöse Gedichtcyklus
"Liljor i Saron" (1820), das antike Trauerspiel "Bacchanterna", die
nordischen Tragödien "Visbur" und "Sigurd Ring", das Drama
"Riddartornet", die Schauspiele "Gladjetlickan i Rom" und
"Karlekena fter doden" und die religiöse Tragödie
"Martyrerne", worin die Idee vom Leben als einer Strafe und einem
Leiden in ergreifender Weise durchgeführt ist. Auch viele
seiner kleinern, im Volkston gehaltenen Lieder sind vortrefflich.
Seine "Gesammelten Schriften" gab zuletzt C. Eichhorn (Stockh.
1866-68, 2 Bde.) heraus; eine deutsche Übersetzung
Kannegießer (Leipz. 1853, 6 Bde.).
Stagnieren (lat.), stillstehen, stocken.
Stagnone (spr. stanjohne), flacher Meerbusen an der
Westseite Siziliens, zwischen Marsala und Trapani, welcher durch
die niedrigen, fast ganz mit Salinen bedeckten Stagnoneinseln gegen
das Meer geschlossen ist. Dieser Inseln sind drei: Borrone,
Isolalonga und in der Mitte die kleine kreisrunde Insel San
Pantaleone, berühmt als Sitz der karthagischen Stadt Motye,
von der noch einzelne Reste vorhanden sind.
Stahl, s. Eisen, S. 418 ff.
Stahl, 1) Georg Ernst, Chemiker und Mediziner, geb. 21.
Okt. 1660 zu Ansbach, studierte in Jena wurde 1687 Hofarzt des
Herzogs von Weimar, 1694 Professor der Medizin in Halle, 1716
Leibarzt des Königs von Preußen; starb 14. Mai 1734 in
Berlin. S. stellte eine Theorie der Chemie auf, welche bis auf
Lavoisier allgemeine Geltung behielt und auf der Annahme des
Phlogistons beruhte. Auch entdeckte er viele Eigenschaften der
Alkalien, Metalloxyde und Säuren. Seine Hauptwerke sind:
"Experimenta et observationes chemicae" (Berl. 1731) und "Theoria
medica vera" (Halle 1707; Leipz. 1831-33, 3 Bde.; deutsch von
Ideler, Berl. 1831-32, 3 Bde.), in welcher er Hoffmann
bekämpfte und die Lehre vom psychischen Einfluß
(Animismus, s. d.) aufstellte.
2) Friedrich Julius, hervorragender Schriftsteller im Fach des
Staatsrechts und Kammerredner, geb. 16. Jan. 1802 zu München
von jüdischen Eltern, trat 1819 in Erlangen zur
protestantischen Kirche über, studierte in Würzburg,
Heidelberg, Erlangen Rechtswissenschaft und habilitierte sich im
Herbst 1827 als Privatdozent in München. In demselben Jahr
erschien seine erste größere Schrift: "Über das
ältere römische Klagenrecht" (Münch. 1827). Von
Schelling angeregt, schrieb er: "Die Philosophie des Rechts nach
geschichtlicher Ansicht" (Heidelb. 1830-1837, 2 Bde. in 3 Abtlgn.;
5. Aufl. 1878), sein wissenschaftliches Hauptwerk, welches trotz
großer Mängel epochemachend für die Geschichte der
Staatswissenschaft ist. S. trat darin der naturrechtlichen Lehre
schroff entgegen und begründete seine Rechts- und Staatslehre
"auf der Grundlage christlicher Weltanschauung", indem er "Umkehr
der Wissenschaft" zum Glauben an die geoffenbarte Wahrheit der
christlichen Religion forderte. 1832 ward S. zum
außerordentlichen Professor in Erlangen, im November zum
ordentlichen Professor für Rechtsphilosophie, Pandekten und
bayrisches Landrecht in Würzburg ernannt. Später kehrte
er nach Erlangen zurück und lehrte hier Kirchenrecht,
Staatsrecht und Rechtsphilosophie. 1840 als Professor der
Rechtsphilosophie, des Staatsrechts und Kirchenrechts nach Berlin
berufen, 1849 von König Friedrich Wilhelm IV., der ihm seine
Gunst zuwandte, zum lebenslänglichen Mitglied der damaligen
Ersten Kammer, des spätern Herrenhauses ernannt, wurde S. der
Hauptwortführer der Reaktion und der ritterschaftlichen
Partei, der er bis zu seinem Ende treu geblieben ist. Auch auf
kirchlichem Gebiet benutzte er seine Stellung als Mitglied des
evangelischen Oberkirchenrats (I852-58) zur Lockerung der Union,
zur Stärkung des lutherischen Konfessionalismus und zur
Erneuerung der Herrschaft der orthodoxen Geistlichkeit über
die Laienwelt. Der politische Umschwung infolge der Erhebung des
Prinz-Regenten und der Sturz des Ministeriums Manteuffel brachen
auch Stahls Herrschaft im Oberkirchenrat und veranlaßten 1858
seinen Austritt aus dieser Behörde. Seitdem setzte er den
politischen Kampf gegen das "Ministerium der liberalen Ära"
mit zäher Energie im Herrenhaus fort, drohend, "das Haus werde
in seinem Widerstand gegen die neue liberale Richtung der Regierung
vielleicht brechen, aber nicht biegen", erlebte jedoch nicht mehr
den Umschlag der Regierung, welche nach schwachen liberalen
Versuchen ihre Stütze wieder in dem Herrenhaus suchte. Er
starb 10. August 1861 in Brückenau. Von seinen Schriften sind
noch hervorzuheben: "Die Kirchenver-
219
Stahlblau - Stahr.
fassung nach Lehre und Recht der Protestanten" (Erlang. 1840, 2.
Aufl. 1862); "Über Kirchenzucht" (Berl. 1845, 2. Aufl. 1858);
"Das monarchische Prinzip" (Heidelb. 1845); "Der christliche Staat"
(Berl. 1847, 2. Aufl. 1858); "Die Revolution und die
konstitutionelle Monarchie" (das. 1848, 2. Aufl. 1849); "Was ist
Revolution?" (1.-3. Aufl., das. 1852); "Der Protestantismus als
politisches Prinzip" (das. 1853, 3. Aufl. 1854); "Die katholischen
Widerlegungen" (das. 1854); "Wider Bunsen" (gegen dessen "Zeichen
der Zeit", 1.-3. Aufl., das. 1856); "Die lutherische Kirche und die
Union" (das. 1859, 2. Aufl. 1860). Nach seinem Tod erschienen:
"Siebenzehn parlamentarische Reden" (Berl. 1862) und "Die
gegenwärtigen Parteien in Staat und Kirche" (2. Aufl., das.
1868). Vgl. "Pernice, Savigny, S." (Berl. 1862).
3) Karl, Pseudonym, s. Gödeke.
4) Pierre Jules, Pseudonym, s. Hetzel.
5) Arthur, Pseudonym, s. Voigtel.
Stahlblau, dunkelblaue Farbe, ähnlich dem
angelaufenen Stahl, besonders wenn der so gefärbte Körper
Metallglanz hat.
Stahlbrillanten (Stahldiamanten), Stahlstückchen mit
vielen glänzenden Facetten, bisweilen als Köpfe von
Stahlstiften mit Schraubengewinde.
Stahlbronze, s. Bronze, S. 460.
Stahleck, Burg bei Bacharach (s. d.).
Stahlfedern, Schreibfedern aus Stahl, werden dargestellt,
indem man aus entsprechend dünnem Stahlblech Plättchen
von der Gestalt der Federn mittels eines Durchstoßes
ausschneidet, dann diese Plättchen unter einem andern
Durchstoß mit dem Loch versieht, in welchem der Spalt endigt,
und zugleich mit den beiden seitlichen Spalten, welche die
Biegsamkeit der Feder erhöhen. Hierauf glüht man die
Plättchen in eisernen Töpfen aus, versieht sie unter
einem Fallwerk mit der Schrift und etwanigen Verzierungen und gibt
ihnen auf einer Presse durch Hineintreiben in eine entsprechend
konkave Stanze die rinnenförmige Gestalt. Die durch das
Ausglühen sehr weich gewordenen Federn werden nun zum Zweck
des Härtens in flachen, bedeckten Eisengefäßen
rotglühend gemacht und schnell in Öl oder Thran
geschüttet. Behufs ihrer Reinigung von dem Öl behandelt
man sie dann mit Sägespänen in einer um ihre Achse
rotierenden Trommel, scheuert sie durch eine ähnliche Prozedur
mit zerstoßenen Schmelztiegelscherben und schleift sie nun
einzeln auf der Außenseite ihres Schnabels durch fast nur
augenblickliches Anhalten an eine schnell umlaufende
Schmirgelscheibe. Die blau oder gelb angelaufenen S. erhalten diese
Farbe durch Erhitzen in einer über Kohlenfeuer rotierenden
Trommel aus Eisenblech. Diese Operation ist für alle S.
erforderlich, da sie die Härte bestimmt, und es müssen
daher diejenigen, welche nicht farbig in den Handel gebracht werden
sollen, schließlich nochmals gescheuert werden. Zuletzt wird
der Spalt mittels einer besonders gebauten kleinen Parallelschere
erzeugt. Manche S. werden schließlich noch mit
Schellackfirnis überzogen. Über die Erfindung der S. ist
nichts Sicheres begannt. Die ersten S. soll auf Anregung des
Chemikers Priestley der Metallwarenfabrikant Harrison in Birmingham
hergestellt haben, aber erst sein Gehilfe Josiah Mason (gest. 1881)
beutete die Erfindung aus und arbeitete Jahrzehnte für Perry,
welcher als Begründer der Birminghamer Stahlfederindustrie
gilt. Gegenwärtig gibt es 18 Stahlfedernfabriken: 13 in
England, 2 in Nordamerika, 2 in Deutschland (Berlin und
Plagwitz-Leipzig), 1 in Frankreich, welche zusammen
wöchentlich 37½ Mill. Stück fabrizieren.
Stahlhof (Steelyard, wohl aus "Stapelhof" korrumpiert),
die alte Faktorei der Hanseaten in London, die ihnen 1473 gegen
eine Jahresmiete von 70 Pfd. Sterl. überlassen wurde und bis
1866 ihr Eigentum blieb, in welchem Jahr sie dieselbe an eine
Eisenbahngesellschaft verkauften. Jetzt steht an der Stelle der
Bahnhof in Canon Street.
Stahlquellen, s. v. w. Eisenquellen, s.
Mineralwässer, S. 652.
Stahlrot, s. Englischrot.
Stahlrouge, s. Polierrot.
Stahlspiel, s. Lyra.
Stahlstein, s. Spateisenstein.
Stahlstich (Siderographie), die Vervielfältiggung
von Bildwerken mittels geschnittener Stahltafeln, 1820 von dem
Engländer Charles Heath erfunden. Das Verfahren dabei ist
folgendes. Stahlblöcke oder Platten werden dekarbonisiert, d.
h. des Kohlenstoffs beraubt, und dadurch bis zu dem Grad erweicht,
daß sie sich beim Stich der Figuren noch besser behandeln
lassen als Kupfer. Das Verfahren beim Stich ist dasselbe wie bei
dem auf Kupfer, nur bedient man sich auf Stahl seltener und mit
weniger Vorteil der kalten Nadel. Nach dem Stich wird durch ein
chemisches Verfahren die Platte wieder gehärtet. Um den Stich
auf andre Platten zu übertragen, schiebt man einen gleichfalls
dekarbonisierten Cylinder von Stahl in die Übertragungspresse
(transfer-press) und fährt damit über die
eingeschnittenen Figuren der wieder gehärteten Stahlplatte
hin. Die Einschnitte der Platte drücken sich hierbei dem
Cylinder erhaben auf, und zwar wird es durch eine schwingende
Bewegung der Presse und der Peripherie des Cylinders
ermöglicht, daß sich immer eine neue Oberfläche zur
Aufnahme des Stahlschnitts darbietet. Nachdem darauf der Cylinder
ebenfalls gehärtet worden ist, drückt man damit auf neue
dekarbonisierte Stahlplatten das ursprüngliche Bild der
Originalplatte auf und druckt diese wie gewöhnlich ab. Auf
diese Weise kann das Bild ins Unendliche vervielfältigt
werden, so daß der 10,000. Abdruck nicht den geringsten
Unterschied vom ersten zeigt. Dennoch ist für Kunstwerke
höherer Gattung der Kupferstich in Geltung geblieben, da er
größere Kraft, Sicherheit und Weichheit in der
Linienführung gestattet, wogegen der S. besonders für
solche Werke angewendet wird, welche einen starken Absatz
versprechen, wie für Illustrationen, Veduten u. dgl. Der erste
Stahlstecher in Deutschland war Karl Ludwig Frommel in Karlsruhe.
Seit der Erfindung der Galvanoplastik, welche die Abnahme von
Klischees von Kupferplatten gestattet, und der Verstählung von
Kupferplatten ist der S. in Abnahme gekommen. Vgl.
Kupferstecherkunst.
Stahlwasser, eisenhaltiges Mineralwasser.
Stahlweinstein, s. Eisenpräparate.
Stahr, Adolf Wilhelm Theodor, Schriftsteller, geb. 22.
Okt. 1805 zu Prenzlau, widmete sich in Halle den klassischen
Studien, ward 1826 Lehrer am Pädagogium daselbst und 1836
Konrektor am Gymnasium zu Oldenburg. Seine litterarische
Thätigkeit erstreckte sich zunächst auf die Geschichte,
Kritik und Erklärung der Schriften des Aristoteles. Hierher
gehören seine "Aristotelia" (Halle 1830-32, 2 Bde.), ferner:
"Aristoteles bei den Römern" (Leipz. 1834) und die Bearbeitung
der Aristotelischen "Politik" (das. 1836 bis 1838), denen sich
"Aristoteles und die Wirkung der Tragödie" (Berl. 1859) und
die Übersetzungen von Aristoteles' Poetik, Politik, Rhetorik
und Ethik (Stuttg. 1860-63) anschließen. Neben dieser
philologischen Thätigkeit hatte sich S. frühzeitig auch
den
220
Stähr - Stair.
allgemeinen litterarischen Interessen zugewandt. Er gab eine
Handschrift von Goethes "Iphigenia", die er in der Bibliothek zu
Oldenburg entdeckt hatte, mit einem trefflichen Vorwort heraus,
schrieb eine "Charakteristik Immermanns" (Hamb. 1842) und nahm an
dem versuchten Aufschwung der Oldenburger Hofbühne lebhaften
Anteil, den seine "Oldenburgische Theaterschau" (Oldenb. 1845, 2
Bde.) bethätigte. Einen Wendepunkt seines Lebens bildete seine
Reise nach Italien, die er 1845 antrat und die er in seinem
lebendig geschriebenen, farbenreichen und weitverbreiteten Buch
"Ein Jahr in Italien" (Oldenb. 1847-50, 3 Bde.; 4. Aufl., das.
1874) eingehend schilderte. In Rom lernte er Fanny Lewald (s. d.)
kennen, mit der er sich nach Trennung seiner ersten Ehe 1854
verheiratete. Schon vorher hatte er wegen Kränklichkeit seine
Stellung am Oldenburger Gymnasium niedergelegt und sich 1852 in
Berlin niedergelassen, wo er lebte, bis ihn
Gesundheitsrücksichten nötigten, verschiedene Kurorte zu
seinem Wohnsitz zu wählen. S. starb 3. Okt. 1876 in Wiesbaden.
Seine litterarische Produktivität hatte während der Zeit
seines Berliner Aufenthalts sich beständig gesteigert. Die
poetischen Anläufe in dem Roman "Die Republikaner in Neapel"
(Berl. 1849, 3 Bde.) und den Gedichten "Ein Stück Leben" (das.
1869) erwiesen keine eigentliche Produktionskraft. So wandte sich
S. in zahlreichen Kritiken, Essays und selbständigen Werken
zur Kunst- und Litteraturgeschichte. Seinem "Torso; Kunst,
Künstler und Kunstwerke der Alten" (Braunschw. 1854- 55, 2
Bde.; 2. Aufl. 1878) folgten: "Lessing, sein Leben und seine
Werke", eine populäre Biographie und Charakteristik, die
raschen Eingang ins Publikum gewann (Berl. 1859, 2 Bde.; 9. Aufl.
1887); "Fichte", ein Lebensbild (das. 1862); "Goethes
Frauengestalten" (das. 1865-68, 2 Bde.; 7. Aufl. 1882); "Kleine
Schriften zur Litteratur und Kunst" (das. 1871-75, 4 Bde.). Aus
Lebenserinnerungen, persönlichen Eindrücken, namentlich
der zahlreichen Reisen, die er mit seiner Gattin unternahm, gingen
die Bücher: "Die preußische Revolution" (Oldenb. 1850, 2
Bde.; 2. Aufl. 1852), "Weimar und Jena", ein Tagebuch (das. 1852, 2
Bde.; 2. Aufl. 1871), "Zwei Monate in Paris" (das. 1851, 2 Bde.),
"Nach fünf Jahren", Pariser Studien (das. 1857, 2 Bde.),
"Herbstmonate in Oberitalien" (das. 1860, 3. Aufl. 1884), "Ein
Winter in Rom", gemeinsam mit Fanny Lewald (Berl. 1869, 2. Aufl.
1871), hervor, während er in der Schrift "Aus der Jugendzeit"
(Schwerin 1870-77, 2 Bde.) seine Jugendtage schilderte. Heftigen
Widerspruch erfuhren seine "Bilder aus dem Altertum" (Berl.
1863-66, in 4 Bänden), "Tiberius" (2. Aufl. 1873), "Kleopatra"
(2. Aufl. 1879), "Römische Kaiserfrauen" (2. Aufl. 1880),
"Agrippina, die Mutter Neros" (2. Aufl. 1880) enthaltend, in denen
S. den Versuch unternahm, die bisherige historische Auffassung,
namentlich des Tacitus, zu entkräften und die genannten
historichen Gestalten zu reinigen und zu rechtfertigen.
Stähr, s. v. w. männliches Schaf, Bock.
Staigue-Fort (spr. stäckfort), vorgeschichtliches
Festungswerk der Grafschaft Kerry (Irland), bestehend aus einer
ohne Mörtel erbauten Ringmauer von 114 Fuß
äußerm Durchmesser.
Stainer (Steiner), Jakob, berühmter
Saiteninstrumentenmacher, geb. 14. Juli 1621 zu Absam bei Hall in
Tirol, war ein Schüler von Amati zu Cremona. Im Leben von
Sorgen und Mißgeschick heimgesucht, mußte er anfangs
von seinen Violinen das Stück für 6 Gulden verkaufen.
1669 vom Erzherzog Leopold zum "Hofgeigenmacher" ernannt, wurde er
gleichwohl von den Jesuiten als vermeintlicher Ketzer monatelang in
Haft gehalten, verfiel in Wahnsinn und starb in größter
Not 1683. Seine Geigen zeichnen sich durch besonders hohe Bauart
und einen ganz vorzüglichen Ton aus und werden von Kennern
jetzt teuer bezahlt. Auch sein Bruder Markus S. war als
Instrumentenmacher bekannt. Vgl. Ruf, Der Geigenmacher J. S.
(Innsbr. 1872).
Staines (spr. stehns), Stadt in der engl. Grafschaft
Middlesex, 24 km westsüdwestlich von Hyde Park (London), an
der Themse, hat lebhaften Produktenhandel und (1881) 4628 Einw. Die
Jurisdiktion Londons über die Themse erstreckt sich seit 1280
bis hierher.
Stair (spr. stehr), 1) John Dalrymple, erster Graf von,
brit. Staatsmann, geb. 1648, schloß sich wie sein als Jurist
berühmter, 1690 zum Viscount S. erhobener Vater James
Dalrymple (gest. 1695) Wilhelm III. von Oranien an, wurde 1691 zum
Staatssekretär für Schottland ernannt, mußte aber
wegen der von ihm 1692 angeordneten Niedermetzelung eines Clans
jakobitischer Hochländer zu Glencoe, die das schottische
Parlament für einen barbarischen Mord erklärte, 1695
seine Entlassung nehmen und wagte erst fünf Jahre nach dem Tod
seines Vaters im Oberhaus zu erscheinen. 1703 nichtsdestoweniger
zum Grafen von S. ernannt, gehörte er zu den eifrigsten
Vertretern der unter Königin Anna zu stande gebrachten Union
zwischen England und Schottland und starb 18. Jan. 1707.
2) John Dalrymple, zweiter Graf von, Sohn des vorigen, brit.
Staatsmann und Heerführer, geb. 1673 zu Edinburg, diente von
1702 bis 1709 unter Markborough in den Niederlanden und Deutschland
und zeichnete sich in den Schlachten von Ramillies, Oudenaarde und
Malplaquet aus. 1714 zum Gesandten in Paris ernannt, erlangte S.
nach Ludwigs XIV. Tod bei dem Regenten so viel Einfluß,
daß er den bourbonischen Familienbund zwischen Frankreich und
Spanien sprengte und Frankreich vermochte, die Stuarts
preiszugeben. 1720 aber erregte sein Widerstand gegen die
Finanzpläne Laws den Unwillen der britischen Regierung und
veranlaßte seine Zurückberufung. Erst nach dem
Rücktritt Walpoles trat er wieder in den Staatsdienst, wurde
Gesandter bei den Generalstaaten und 1742 Feldmarschall und
Kommandeur der englischen Armee im österreichischen
Erbfolgekrieg. Er drang mit seinem Heer bis Aschaffenburg vor und
schlug 27. Juni 1743 die Franzosen unter Noailles bei Dettingen,
verließ dann aber wegen Bevorzugung der hannoverschen
Interessen und wegen Einmischung der Minister und Diplomaten die
Armee. Infolge davon fiel er am Hof in Ungnade, bis der
jakobitische Aufstand in Schottland (1745) ihn an die Spitze des in
England aufgestellten Heers rief. Er starb 1. Mai 1747.
3) John Hamilton Dalrymple, achter Graf von, geb. 15. Juni 1771
aus einer Seitenlinie, diente seit 1790 in der britischen Armee,
focht mit Auszeichnung 1794 und 1795 in Holland und Flandern und
nahm 1807 an der Expedition nach Kopenhagen teil, worauf er zum
Generalmajor befördert ward. 1832 wurde er ins Parlament
gewählt, 1840 erbte er von seinem Vetter die Grafschaft S.,
und im April 1841 ward er als Lord Oxenfoord zum englischen Peer
erhoben. In den Jahren 1840-41 und 1846-52 verwaltete er das Amt
eines Großsiegelbewahrers für Schottland. Er starb 10.
Jan. 1853 auf Oxenfoord Castle. Ihm folgten sein Bruder North
Dalrymple, geb. 1776, gest. 9. Nov. 1864,
221
Stake - Stallungen.
als neunter und dessen Sohn John, Viscount Dalrymple, geb. 1.
April 1819, als zehnter Graf von S. Vgl. Graham, Annals and
correspondence of the Viscount and the first and second Earls of S.
(Edinb. 1875, 2 Bde.).
Stake, Wasserbaukunst, s. Buhne.
Stake (engl., spr. stehk), Einsatz, Einlage (beim
Spielen, Wetten etc.).
Staket, Zaun aus Pfählen, Latten etc. (Staken).
Stakholz, s. Fachholz.
Stalagmiten und Stalaktiten, s. Tropfstein.
Stalaktitengewölbe, eine Gewölbeform des
arabischen Baustils, welche durch Verbindung von einzelnen
Gewölbstückchen den Eindruck von Tropfsteinbildungen
hervorruft. S. Baukunst, S. 492.
Stalaktitenstruktur, s. Mineralien, S. 647.
Stalbent, Adriaen van, niederländ. Maler, geb. 1580
zu Antwerpen, wurde 1610 Freimeister daselbst und starb 1662. Er
hat meist Landschaften andrer Künstler mit Figuren in der Art
des H. van Balen staffiert, aber auch selbständige
Landschaften in der bunten Manier der ältern vlämischen
Schule und Figurenbilder gemalt. Werke von ihm befinden sich in den
Galerien von Antwerpen, Kassel (Kirmes), Frankfurt a. M., Dresden
(Midasurteil, Göttermahlzeit), Berlin und Schwerin.
Stalimene, Insel, s. Lemnos.
Stälin, Christoph Friedrich von, deutscher
Geschichtsforscher, geb. 4. Aug. 1805 zu Kalw in Württemberg,
studierte zu Tübingen und Heidelberg Theologie und Philologie,
ward 1826 Bibliothekar in Stuttgart, 1846 Oberbibliothekar, 1869
Bibliothekdirektor und leitete die königliche Bibliothek diese
lange Zeit mit großem Geschick und Erfolg. Auch die
königliche Münz- und Medaillen-, ebenso die Kunst- und
Altertümersammlung ordnete und verwaltete er. Er starb 12.
Aug. 1873. Außer kleinern Arbeiten über
württembergische Landeskunde verfaßte er die
"Wirtembergische Geschichte" (Stuttg. 1841-73, 4 Bde.), sein
Hauptwerk und die beste deutsche Provinzialgeschichte. Seit 1858
Mitglied der Historischen Kommission in München, redigierte er
mit Waitz und Häusser die "Forschungen zur deutschen
Geschichte". - Sein Sohn Paul, geb. 23. Okt. 1840, Archivrat in
Stuttgart, schrieb "Geschichte Württembergs" (Gotha 1882
ff.).
Stall, s. Stallungen.
Stallbaum, Gottfried, Philolog und Schulmann, geb. 25.
Sept. 1793 zu Zaasch bei Delitzsch, vorgebildet in Leipzig,
studierte daselbst seit 1815, ward 1818 Lehrer am Pädagogium
in Halle, 1820 an der Thomasschule zu Leipzig und 1835 Rektor
dieser Anstalt. Seit 1840 auch außerordentlicher Professor an
der Universität, starb er 24. Jan. 1861. S. hat sich besonders
um Platon verdient gemacht, nicht bloß durch tüchtige
Bearbeitung einzelner Dialoge, des "Philebus" (Leipz. 1820, 2.
Ausg. 1826), "Euthyphro" (das. 1823), "Meno" (das. 1827, 2. Ausg.
1839), "Dialogorum delectus" (das. 1838, 2. Ausg. 1851),
"Parmenides" (das. 1839, 2. Aufl. 1848), sondern vor allem durch
seine Gesamtausgaben, die große kritische (das. 1821-25, 12
Bde.; der Text auch besonders in 8 Bänden), die kommentierte
in der Jacobs-Rostschen "Bibliotheca graeca" (Gotha 1827-1860, 10
Bde.; zum Teil in wiederholten Auflagen, zuletzt von Wohlrab und
Kroschel) und die Tauchnitzsche Stereotypausgabe (1 Bd., das. 1850
u. 1873; 8 Bde., 1850 u. 1866-74). Sonst sind zu nennen seine
Ausgaben des Herodot (Gotha 1819, 3 Bde.; 2. Aufl. 1825-26) und des
Kommentars zu Homer von Eustathios (das. 1825-30, 7 Bde.) sowie
Bearbeitungen der Ruddimanschen "Institutiones grammaticae latinae"
(das. 1823, 2 Bde.) und des Westerhofschen "Terentius" (das.
1830-31, 6 Bde.).
Stallfütterung, s. Futter, S. 811.
Stallungen, Wohnungen der landwirtschaftlichen Haustiere.
Die Lage des Stalles muß leichte Ableitung der
Flüssigkeiten gestatten und Ansammlungen von Grundwasser,
welches, durch die Auswurfstoffe der Tiere verunreinigt, zum
Träger von Krankheitserregern wird, vermeiden. Die Hauptfronte
legt man gegen Osten und den Ausgang an diese Hauptfronte;
Thüren an der Westseite erleichtern das Eindringen von
Fliegen, die gegen Abend warme Stellen aufsuchen. In der Mitte der
Höhe geteilte Thüren gestatten durch Öffnen der
obern Thürflügel eine leichte und gründliche
Ventilation. Der Feuersgefahr wegen bringt man zahlreiche
Thüren an; um aber zu vermeiden, daß bei Öffnung
derselben der Luftzug die Insassen trifft, stellt man die
Thüren in der Regel an die Enden der sogen. Stallgasse, welche
meist zugleich als Mistgang dient. Die Thürpfosten macht man
rund oder doch an den Kanten abgerundet und versieht sie mit 1,5 m
hohen senkrechten Walzen, um Beschädigungen der Tiere beim
Aus- und Eindrängen in den Stall vorzubeugen; ebendeshalb
müssen Thüren und Thürflügel sich stets nach
außen öffnen und nicht von selbst zufallen.
Gegenwärtig sind vielfach Schiebthüren in Gebrauch. Die
Stallfenster bringt man womöglich hinter den Köpfen der
Tiere an und so hoch, daß Lichtstrahlen wie
Luftströmungen über den Tieren hinwegstreichen. Erlaubt
dies die Anlage des Gebäudes nicht, dann verwendet man matt
geschliffene oder blaue Glasscheiben und schützt diese gegen
Zerbrechen durch Drahtgitter. Mit Oberlicht können
Vorrichtungen zur Lufterneuerung verbunden werden, und mit
teilweise beweglichen Fenstern kann man lüften, ohne das ganze
Fenster zu öffnen, und ohne daß die eindringende kalte
Luft die Tiere unmittelbar trifft. Die Fensterrahmen werden am
besten von Eisen hergestellt. Zur Ventilation der S. dürften
senkrechte, an dem First ausmündende Dunstkamine immer noch
verhältnismäßig ebensoviel leisten wie die neuern
kostspieligen Einrichtungen. Die Abzugskanäle bleiben in
kleinern S. am besten offen, werden aber wasserdicht eingerichtet
und mit Wasserleitungsröhren in Verbindung gebracht. Offene,
nicht zu tiefe Stallrinnen sind der bequemen und gründlichen,
auch leicht kontrollierbaren Reinigung wegen vorzuziehen. Die
größte Dauer und die sicherste Abscheidung zwischen
Stall und darüber gelegenen Räumen gewähren
steinerne Gewölbe, doch benutzt man auch Konstruktionen mit
Eisenbahnschienen; bei Anwendung von Holz ist für enge
Verbindung der einzelnen Bretter (Einlegen in Falze) zu sorgen. Der
Fußboden soll den Tieren eine bequeme und nicht
abkühlende Lagerstätte bieten, er darf daher nach hinten
nur geringen Fall haben und nicht aus guten Wärmeleitern
hergestellt sein. Das beste Pflasterungsmaterial geben
hartgebrannte Backsteine ab. Die sogen. Brückenstände, d.
h. über flache Kanäle gelegte Dielenböden, sind
teuer, nicht dauerhaft und unreinlich, geben aber allerdings die
wärmste Unterlage.
Das Baumaterial für Ställe darf nicht porös sein,
um die bei Zersetzung des Urins sich bildenden Stoffe nicht
aufzusaugen. Die Bildung von Salpeter an den Stallwänden
erhält diese stets feucht. Der Raumbedarf in den Ställen
ist nach Tiergattung, Zahl der Tiere und den Nutzungszwecken
äußerst verschieden zu bemessen. Man unterscheidet: a)
freie,
222
Stallupönen - Stamma.
offene Standplätze ohne Abgrenzung; b) Standplätze mit
beweglichen Abscheidungen, den sogen. Latier- oder Raumbäumen,
die an Säulen befestigt werden oder an Ketten hängen; c)
Kastenstände, Standplätze mit festen
Trennungsscheidewänden; d) Laufstände, Loose boxes, zur
Aufnahme Eines frei gehenden Tiers ohne Raum zum Tummeln; e)
Laufställe für mehrere frei gehende Tiere mit Raum zum
Tummeln, für junge Tiere, Mutter mit Jungen etc.; f) Paddocks,
Stallräume für einzelne Tiere, meist Pferde, z. B.
Zuchtpferde, mit Ausgang in einen sicher abgegrenzten Hofraum,
Tummelplatz oder in Weideabteilungen. Ein Pferd bedarf eines 1,70 m
breiten und 3 m langen Standplatzes, nur bei beweglicher
Abscheidung durch Latierbäume kann die Breite um 10-20 cm
geringer sein; in Boxen berechnet man aufs Pferd 3 qm.
Rindviehställe sollen Standplätze von 1,4 m Breite bei
2,8 m Länge haben, Kälber und Jungvieh solche von 2-3 qm.
Bei Schafen veranschlagt man den Raum auf 2 für das einzelne
Stück, für frei gehende auf 1 qm. Hinter den
Standplätzen wird ein genügend breiter Stallgang
eingerichtet (1,6-2,0-3,0 m breit), damit, namentlich in
Pferdeställen, Menschen und Tiere ungefährdet verkehren
können. In größern landwirtschaftlichen S. ist
dieser Gang häufig breit genug, um das Einfahren von Futter-
und Mistwagen zu gestatten. Stehen die Tiere in zwei Reihen mit den
Köpfen einander gegenüber, wie vielfach in
Rindviehställen, so wird dazwischen ein erhöhter
Futtergang oder ein Futtertisch nötig; letzterer erleichtert
die Fütterung erheblich. Zum Vorlegen des "Kurzfutters":
Körner, Schrot, Häcksel, Wurzeln etc., vielfach auch zur
Aufnahme des Getränks, dienen die Krippen. Abteilung der
Krippe für die einzelnen Tiere (Krippenschüsseln für
Pferde) gestattet die Zuteilung bestimmter Ration an jedes,
zugleich auch die Kontrolle der Freßlust. Krippen aus weichem
Holz sind schwer zu reinigen und begünstigen daher die
Zersetzung des Futters; das beste Material sind: Granit, Jurakalk,
gut gebrannte Backsteine, Zementguß; für
Pferdeställe gußeiserne, innen gut emaillierte
Krippenschüsseln. Hölzerne Krippen sowie hölzerne
Krippenträger in Pferdeställen müssen zum Schutz
gegen das Benagen durch die Tiere mit Eisenblech beschlagen werden.
In den gewöhnlich oberhalb der Krippen angebrachten, meist
leiter- oder korbförmigen Raufen wird das Lang- oder
Rauffutter (fälschlich Rauh- oder Rauchfutter): Heu, Stroh,
Grünfutter, verabreicht. Zur Vermeidung von Verletzungen an
Kopf und Augen hat man die "Nischenraufe" empfohlen, bei welcher
einige Zentimeter über der Krippe in einer Mauernische, vor
der eine senkrechte Leiterraufe angebracht ist, das Langfutter
dargereicht wird. Vgl. Rueff, Bau und Einrichtung der S. (Stuttg.
1875); Miles, Der Pferdestall (Frankf. a. M. 1862); Engel, Der
Viehstall (2. Aufl., Berl. 1889); Derselbe, Der Pferdestall (das.
1876); Gehrlicher, Der Rindviehstall (Leipz. 1879); Wanderley, Die
Stallgebäude (Karlsr. 1887).
Stallupönen, Kreisstadt im preuß.
Regierungsbezirk Gumbinnen, an der Linie Seepothen-Eydtkuhnen der
Preußischen Staatsbahn, 80 m ü. M., hat ein Amtsgericht,
ein Warendepot der Reichsbank, Maschinenfabrikation, Gerberei,
Ziegelbrennerei und (1885) mit der Garnison (2 Eskadrons Ulanen Nr.
12) 4181 meist evang. Einwohner.
Stalwarts (engl., "Starke", "Mutige"), in Nordamerika
Name derjenigen Republikaner, welche die Herrschaft dieser Partei
nach dem Bürgerkrieg rücksichtslos zu ihrem Vorteil
ausbeuten wollten und deshalb 1879 für die dritte Wahl Grants
zum Präsidenten, wiewohl vergeblich, eintraten; ihre
Führer waren Conkling, Cameron und Logan. Ihre Gegner in der
Partei, die zur Versöhnung mit den Demokraten geneigten, der
Korruption feindlichen Republikaner (unter Schurz und Curtis),
hießen Mugwumps.
Stalybridge (spr. stehlibriddsch), Fabrikstadt an der
Grenze von Cheshire und Lancashire (England), am Tame, hat
Baumwollmanufaktur, Maschinenbau, Nagelschmieden und (1881) 25,977
Einw.
Stambul, türk. Name für Konstantinopel.
Stambulow, St., bulgar. Staatsmann, geb. 1853 zu Tirnowa,
studierte in Rußland die Rechte, erregte 1875 in Eski Zagra
einen Aufstand gegen die Türken, mußte nach dessen
Scheitern nach Bukarest fliehen, nahm 1877-78 als Freiwilliger am
russisch-türkischen Krieg teil, ließ sich darauf in
Tirnowa als Advokat nieder und ward Mitglied und bald
Präsident der Sobranje. Als 21. Aug. 1886 der Staatsstreich
gegen den Fürsten Alexander ausgeführt und eine
revolutionäre Regierung eingesetzt wurde, stürzte er
diese im Verein mit Mutkurow und Karawelow und bildete mit diesen
eine neue Regierung, der nach der Abdankung Alexanders 7. Sept. die
Regentschaft übertragen wurde. Er behauptete sich gegen alle
Ränke seiner Nebenbuhler und die Wühlereien der
russischen Agenten, besonders des Generals Kaulbars, und bewirkte
7. Juli 1887 die Wahl des Fürsten Ferdinand, nach dessen
Regierungsantritt (14. Aug.) er an die Spitze des Ministeriums
trat.
Stamen (lat.), Staubgefäß (s. d.).
Stamford, 1) Stadt in Lincolnshire (England), am
schiffbaren Welland, hat mehrere alte Kirchen, ein Museum,
Brauereien, Fabriken für landwirtschaftliche Maschinen, Handel
mit Malz, Kohlen und Bausteinen und (1881) 8773 Einw. 1572
ließen sich vlämische Weber hier nieder. -
2) Hafenstadt im nordamerikan. Staat Connecticut, am Long
Island-Sound, hat Eisen-, Woll- und Farbefabriken und (1880) 2540
Einw.; beliebter Sommeraufenthalt.
Staminodie (lat.-griech.), die durch vor- oder
rückschreitende Metamorphose bewirkte Umbildung eines
Blütenteils in ein Staubblatt (s. Staubgefäß).
Stamm, in der Botanik im weitesten Sinn s. v. w. Stengel
(s. d.); im engern Sinn derjenige Teil des Stengels, welcher als
unmittelbare Fortsetzung der Wurzel nach oben sich vertikal erhebt
und größern Umfang besitzt als die in einer gewissen
Höhe seitlich von ihm ausgehenden Äste. In der
Sprachlehre ist S. der Teil des Wortes, welcher nach Ausscheidung
aller Beugungsformen übrigbleibt; z. B. Haus in Haus-es, ruf
in ruf-en. Trennt man auch die Ableitungssilben ab, so erhält
man die Wurzel, wie z. B. in er-wach-en "erwach" der S., "wach" die
Wurzel ist. Häufig fällt indessen der S. mit der Wurzel
zusammen. Ferner versteht man unter S. Menschen oder Familien und
Geschlechter, welche ihre Abkunft von Einem Elternpaar
(Stammeltern) in ununterbrochener Reihe abzuleiten vermögen.
Im Militärwesen heißt S. der Teil einer Truppe, welcher
bei der Fahne bleibt, während die andern in die Heimat
entlassen und durch Rekruten ersetzt werden.
Stamma, Philipp, Schachmeister, gebürtig aus Aleppo
in Syrien, ist der Verfasser eines der bekanntesten ältern
Schachbücher, der "100 künstlichen Endspiele", 1737 zu
Paris erschienen und herausgegeben von Bledow und O. v. Oppen
(Berl. 1856). S. war der erste, welcher die jetzt bei uns
gebräuchliche Notation mit Buchstaben und Zahlen
anwendete.
223
Stammakkord - Stampiglia.
Stammakkord, in der Harmonielehre der Gegensatz der
abgeleiteten Akkorde. Man versteht unter S. meist einen in lauter
Terzen aufgebauten Akkord, also Dreiklang, Septimenakkord oder
Nonenakkord; die Umkehrungen dieser Akkorde (abgeleiteten Akkorde),
bei denen die Terz, Quinte, Septime oder None tiefster Ton ist,
sind Sextakkord, Quartsextakkord, Quintsextakkord,
Terzquartsextakkord, Sekundquartsextakkord etc. Doch kann man die
Bezeichnung S. auch als Gegensatz der durch Alteration oder
Vorhalte veränderten reinen Harmonien gebrauchen.
Stammaktien, s. Aktie, S. 263.
Stammbaum, die Aufstellung der Nachkommenschaft einer
bestimmten Persönlichkeit in männlicher Linie, in welcher
die Töchter zwar aufgezählt werden können, aber
(falls sie in ein andres Geschlecht heiraten) nicht deren
Nachkommenschaft. Der Name S. rührt von dem Gebrauch her, die
Aufstellung in der Form eines Baums zu entwerfen, an welchem die
Zweige die verschiedenen Linien eines Geschlechts darstellen. Vgl.
Genealogie.
Stammbuch, s. Album.
Stammeln, s. Stottern und Stammeln.
Stammgüter, im weitern Sinn diejenigen von den
Vorfahren ererbten Immobilien, welche die Bestimmung haben, bei der
betreffenden Familie zu bleiben. Im einzelnen wird aber dabei
wiederum zwischen Stammgütern im engern Sinn, zwischen
Familienfideikommiß- und Erbgütern unterschieden.
Erstere (bona stemmatica) sind Familiengüter des höhern
und niedern Adels, bei welchen die Erbfolge vermöge Herkommens
nur auf Agnaten, d. h. auf die durch Männer miteinander
verwandten männlichen Familienangehörigen, übergeht.
Bei den Familienfideikommißgütern ist durch besondere
Disposition bestimmt, daß dieselben stets bei der Familie
bleiben sollen (s. Fideikommiß), während die
Erbgüter endlich, welche sich früher auch beim
Bürgerstand fanden, dadurch ausgezeichnet sind, daß ihre
Veräußerung, abgesehen von besondern Notfällen, im
Interesse der Intestaterben untersagt oder doch erschwert ist. Vgl.
Bärnreither, Stammgütersystem und Anerbenrecht in
Deutschland (Wien 1882).
Stammkapital, s. Aktie, S. 262.
Stammprioritäten, s. Aktie, S. 264.
Stammregister, s. v. w. Juxtabuch (s. d.).
Stammrolle, das für Aushebungszwecke geführte
Verzeichnis aller im militärpflichtigen Alter stehenden
Männer eines Ortes; auch die Liste der Mannschaften einer
Kompanie, Eskadron etc.
Stammtafel, s. Genealogie.
Stammtöne, in der Musik die Töne ohne
Vorzeichen, von denen alle übrigen durch ^[Kreuz], ^[B],
^[Doppelkreuz] und ^[Doppel-B] abgeleitet sind. Die Folge der S. in
Sekundschritten (Grundskala) ist und war schon im Altertum die
Folge von 2 Ganztönen, 1 Halbton, 3 Ganztönen, 1 Halbton,
welche sich in allen Oktaven wiederholt:
^[siehe Bildansicht]
Eine Ausnahme machen nur die noch ältern
fünftönigen Skalen (archaistische Tonleitern), welche
sich der Halbtonschritte gänzlich enthalten und daher den
untern oder obern Ton des Halbtonintervalls auslassen, so in
uralter Zeit bei den Chinesen, aber auch bei den Griechen, Schotten
(Tonleiter ohne Quarte und Septime) und vermutlich
überall.
Stammzuchtbuch, s. Herdbuch.
Stamnos, altgriech. faßartiges
Vorratsgefäß aus gebranntem Thon zur Aufbewahrung von
Wein, Öl u. dgl. (s. Tafel "Vasen", Fig. 7).
Stampa (ital.), Gepräge, Stempel; Druck, Druckerei;
Stampatore, Buchdrucker.
Stampa, Gaspara, ital. Dichterin, geb. 1524 zu Padua,
wird nicht mit Unrecht die "Sappho ihrer Zeit" genannt, denn auch
ihr bereitete eine verkannte, unerwiderte Liebe, deren Sehnsucht
sich in ihren Liedern ergoß, ein frühes Grab. Sie starb
1554 in Venedig. Ihre Gedichte, die sie selbst auch zur Laute sang,
haben einen musikalischen Charakter und zeichnen sich durch
ungewöhnliche Innigkeit wie durch leidenschaftliches Pathos
vorteilhaft aus. Sie erschienen Venedig 1554 (neuere Ausg., das.
1738).
Stampalia (griech. Astropalia, türk. Ustopalia),
türk. Insel im Ägeischen Meer, südöstlich von
Amorgos, 136 qkm (2½ QM.) groß, besteht aus zwei
gebirgigen Hälften, die durch einen schmalen Isthmus verbunden
sind, hat mehrere treffliche Häfen und Reste aus dem
spätern Altertum und den ersten christlichen Zeiten. Auf dem
Isthmus liegt die Stadt S., mit Bergschloß und 1500 Einw. Im
Altertum hieß die Insel Astypaläa.
Stampfbau, s. Pisee.
Stampfen, die oszillierende Bewegung eines Schiffs um
seine Querachse, bei welcher Bug und Heck abwechselnd aus- und
eintauchen.
Stämpfli, Jakob, schweizer. Staatsmann, geb. 1820 zu
Schupfen im Kanton Bern, widmete sich zu Bern juristischen Studien,
ward 1843 Advokat und trat 1845 als Redakteur der "Berner Zeitung",
des Organs der radikalen Partei, in Opposition zu der
gemäßigt liberalen Fraktion, welche damals am Ruder war.
In dem auf seinen Betrieb berufenen Verfassungsrat führte er
neben Ochsenbein die Hauptstimme. Im Juli 1846 in den Regierungsrat
berufen, übernahm er die Leitung der Finanzen und führte
direkte Besteuerung, Aufhebung aller Feudallasten und
Zentralisation des Armenwesens durch. 1849 wurde er
Regierungspräsident, mußte aber 1850 beim Sturz der
radikalen Partei ins Privatleben zurücktreten. 1849 von seinem
Kanton in den schweizerischen Ständerat und 1850 in den
Nationalrat gewählt, dem er 1851 und 1854 präsidierte,
wurde er, nachdem er eben infolge der Fusion der beiden bernischen
Parteien wieder in die Regierung des Kantons getreten war, im
Dezember 1854 an Stelle Ochsenbeins in den Bundesrat berufen. 1856
und 1862 Bundespräsident, nahm er in der Neuenburger wie in
der Savoyer Frage eine energische Stellung ein und forderte
vergeblich den Bau und Rückkauf der Eisenbahnen durch den
Staat, erfreute sich aber gerade deshalb außerordentlicher
Popularität. 1863 schied er aus dem Bundesrat und stand
1865-78 der sogen. Eidgenössischen Bank vor. 1872 wurde er vom
Bundesrat zum Mitglied des internationalen Schiedsgerichts in der
Alabamafrage ernannt. Er starb 15. Mai 1879 in Bern.
Stampfmühle (Stampfwerk), Maschine, welche aus
niederfallenden Stampfen besteht und zum Zerkleinern der
Ölfrüchte in Ölmühlen, der Ingredienzien zur
Anfertigung von Schießpulver, der Materialien in Porzellan-,
Glas- und dergleichen Fabriken, der Hadern in Papierfabriken, der
Mineralien (Pochen) etc., zum Boken des Hanfs, zum Kalandern der
Leinengewebe, zum Klopfen des Leders etc. dient. Vgl.
Pochwerke.
Stampiglia (ital., spr. -pillja), "Stempel", wel-
224
Stams - Standesherren.
cher zum Abdruck des Titels einer Behörde, Anstalt, Firma
etc. mittels Druckerschwärze oder Farbe aus Dokumenten,
Briefen, Rechnungen u. dgl. benutzt wird.
Stams, Dorf in Tirol, Bezirkshauptmannschaft Imst, im
Oberinnthal, an der Arlbergbahn, hat (1880) 565 Einw. und eine
berühmte Cistercienserabtei (1271 von Elisabeth, der Mutter
Konradins, gegründet) mit Bibliothek, reichen Sammlungen und
der Gruft tirolischer Fürsten in der Klosterkirche.
Stanco (türk. Istankoi, das alte Kos), türk.
Insel im Ägeischen Meer, an der Südwestspitze von
Kleinasien, 246 qkm (4½ QM.) groß, ist bergig, aber an
der Nordküste eben und fruchtbar, liefert Südfrüchte
(Export jährlich 10-20,000 Ztr. Rosinen), trefflichen Wein und
Salz und hat ca. 11,000 Einw., meist Griechen. - Die gleichnamige
Stadt, an der Nordostküste, ist Sitz eines Bischofs und eines
türkischen Kaimakams, hat eine alte Citadelle, einen
schlechten Hafen und 3000 Einw.
Stand, s. Stände.
Standard (engl., spr. stanndard), s. v. w. gesetzlich,
normal, mustergültig, z. B. s. gold, Goldlegierung von dem
Gesetz entsprechendem (11/12) Feingehalt.
Standard Hill, Hügel in der engl. Grafschaft Nork,
bei Cutton, berühmt durch die Standartenschlacht zwischen
Engländern und Schotten 22. Aug. 1138, in der 11,000 der
letztern blieben.
Standard of life (engl., spr. leif, "Lebenshaltung"),
dasjenige, was der Mensch zum Leben braucht, um die von ihm
erreichte Kulturhöhe zu behaupten. Vgl. Existenzminimum.
Standarte (v. franz. étendard), ursprünglich
das kaiserliche Reichsbanner, jetzt die Fahne der Kavallerie, mit
kleinerm Tuch als die Fahne der Infanterie. Die Stange (Schaft) mit
Metallbeschlägen steht mit der untern Spitze im
Standartenschuh am rechten Steigbügel. Früher führte
jede Eskadron eine S., jetzt hat in der Regel ein
Kavallerieregiment nur eine Fahne. - In der Jägersprache
heißt S. der Schwanz des Fuchses.
Standbein, in der Bildhauerkunst bei einer stehenden
menschlichen Figur dasjenige Bein, auf welchem nach Maßgabe
der gewählten Stellung die Hauptlast des Körpers ruht.
Das andre heißt Spielbein.
Ständchen, s. v. w. Huldigungsmusik, Serenade, doch
nicht wie letztere mit der Vorstellung einer bestimmten Tageszeit
verknüpft, da es Abend- und Morgenständchen gibt. Der
Form nach kann das S. in einem Lied bestehen, das der Liebhaber
unter dem Fenster der Geliebten singt, aber auch aus
größern Vorträgen vom Chor, ja Orchester.
Stände, im juristischen Sinn Bezeichnung für
die verschiedenen Klassen von Personen, welchen entweder
vermöge ihrer Geburt (Geburtsstände) oder infolge ihrer
Berufsthätigkeit (Berufsstände, erworbene S.) gewisse
besondere Befugnisse zustehen oder besondere Verpflichtungen
auferlegt sind. Auf dem erstern Einteilungsgrund beruht der
Unterschied zwischen Adligen und Nichtadligen (s. Adel), auf dem
letztern derjenige zwischen Bürger- und Bauernstand, beide in
rechtlicher Hinsicht jetzt nahezu bedeutungslos. Im
gewöhnlichen Leben werden aber auch als S. gewisse Klassen von
Personen bezeichnet, welche wegen Gleichartigkeit ihrer Interessen
und ihrer Beschäftigung als zusammengehörig zu betrachten
sind, wie man denn z. B. von dem Gelehrten-, Beamten-,
Handwerkerstand etc. zu sprechen pflegt. Auch wird der Ausdruck S.
zur Bezeichnung der Landstände (s. Volksvertretung)
gebraucht.
Ständer, in der Heraldik eine gewöhnlich aus
dem rechten Obereck des Schildes hervorkommende halbe
Schräglinie, gegen welche eine halbe Teilungslinie von der
Mitte des Schildrandes gezogen ist. Einen "geständerten"
Schild s. Heroldsfiguren, Fig. 14. In der Jägersprache
bezeichnet der Ausdruck S. die Füße des eßbaren
Federwildes sowie der nicht zu den Schwimmvögeln
gehörigen Wasservögel; ständern, die S. durch einen
Schuß verletzen.
Standesamt, s. Personenstand.
Standesbeamter (Zivilstandsbeamter), der zur Beurkundung
der Geburten, Heiraten und Sterbefälle bestellte staatliche
Beamte (s. Personenstand).
Standeserhöhung, die Versetzung aus dem
bürgerlichen Stand in den Adelstand oder die Erhebung von
einer niedrigern Adelstufe zu einer höhern. S. Adel, S.
109.
Standesgehalt, in manchen Staaten, namentlich in Bayern,
der feststehende und unwiderrufliche Gehalt des Staatsdieners,
neben welchem ein mit den Jahren steigender Dienstgehalt
besteht.
Standesherren (Mediatisierte), die Mitglieder derjenigen
fürstlichen und gräflichen Häuser, welche vormals
reichsunmittelbar waren und Reichsstandschaft besaßen, deren
Territorien aber bei der Auflösung des frühern Deutschen
Reichs andern deutschen Staaten einverleibt wurden (s.
Mediatisieren); im engern Sinn die Häupter dieser Familien.
Die zu dem vormaligen Deutschen Bund vereinigten Regierungen gaben
den S. in der Bundesakte (Art. 14) die Zusicherung, daß diese
fürstlichen und gräflichen Häuser zu dem hohen Adel
Deutschlands gerechnet werden sollten, und daß ihnen das
Recht der Ebenbürtigkeit (s. d.) verbleiben solle.
Spätere Bundesbeschlüsse sicherten den Fürsten das
Prädikat "Durchlaucht" und den Häuptern der vormals
reichsständischen gräflichen Familien das Prädikat
"Erlaucht" zu. Außerdem wurden den Mediatisierten folgende
Rechte garantiert: Die unbeschränkte Freiheit, ihren
Aufenthalt in jedem zu dem Bund gehörenden oder mit demselben
in Frieden lebenden Staat zu nehmen; ein Vorrecht, welches mit der
nunmehrigen allgemeinen Freizügigkeit gegenstandslos geworden
ist. Ferner sollten die Familienverträge der S. aufrecht
erhalten werden, indem den letztern zugleich die Befugnis
zugesichert ward, über ihre Güter- und
Familienverhältnisse, vorbehaltlich der Genehmigung des
Souveräns, gültige Bestimmungen zu treffen. Hierüber
sind jetzt die Landesgesetze der einzelnen deutschen Staaten
maßgebend. Die den S. weiter für sich und ihre Familien
garantierte Befreiung von der Wehrpflicht ist auch in dem Bundes-
(Reichs-) Gesetz vom 9. Nov. 1867, betreffend die Verpflichtung zum
Kriegsdienst, anerkannt. Wenn aber den S. außerdem noch ein
privilegierter Gerichtsstand sowie die Ausübung der
bürgerlichen Rechtspflege und der Strafgerichtsbarkeit in
erster und, wo die Besitzung groß genug, auch in zweiter
Instanz sowie die Ausübung der Forstgerichtsbarkeit
zugesichert ward, so sind die Überbleibsel dieser Gerechtsame
durch das deutsche Gerichtsverfassungsgesetz vom 27. Jan. 1877
beseitigt. Endlich sind auch die Zusicherungen, welche den S. in
Ansehung der Ausübung der Ortspolizei und der Aufsicht in
Kirchen- und Schulsachen erteilt worden waren, nach der modernen
Gesetzgebung als hinfällig anzusehen. Überhaupt bedarf
das Verhältnis der S. der anderweiten Regelung durch die
Gesetzgebung derjenigen Staaten, welchen die S. im einzelnen
angehören. Dies ist wenigstens die Auffassung des Bundesrats,
und in diesem Sinn ist bereits Preußen z. B. mit der
gesetzlichen Regelung
225
Standesregister - Stang.
der Rechtsverhältnisse des vormaligen Herzogtums
Arenberg-Meppen vorgegangen. Übrigens hatte die deutsche
Bundesversammlung nachmals auch verschiedenen Familien, welche
nicht zu den Mediatisierten im Sinn der Bundesakte gehörten,
die Befugnisse der S. verliehen. Dies bezog sich jedoch nicht auf
die Grundbesitzungen der Betreffenden, die damit nicht zu einer
sogen. Standesherrschaft wurden, sondern nur auf die
persönliche Stellung, weshalb man in solchen Fällen von
standesherrlichen Personallisten sprach. Hervorzuheben ist endlich
noch, daß den S. regelmäßig in den
Staatsverfassungen der deutschen Länder die erbliche
Mitgliedschaft in der Ersten Kammer eingeräumt ist. Vgl.
Vollgraf, Die deutschen S. (Gieß. 1823); Vahlkampf, Die
deutschen S. (Jena 1844); "Die Stellung der deutschen S. seit 1866"
(2. Aufl., Berl. 1870); Heffter, Sonderrechte der souveränen
und vormals reichsständischen Häuser Deutschlands (das.
1871).
Standesregister, s. Personenstand.
Ständeversammlung, s. v. w. Landtag.
Standfähigkeit (Stabilität) nennt man das
Vermögen eines Körpers, seine Stellung der Schwerkraft
gegenüber zu behaupten. Auf einer wagerechten Ebene bleibt ein
Körper stehen, wenn die durch seinen Schwerpunkt, in welchem
das Gewicht des Körpers vereinigt zu denken ist, gezogene
lotrechte Linie die Unterstützungsfläche des Körpers
trifft. Stützt sich ein Körper nur in einzelnen Punkten
auf die Unterlage, so ist als Unterstützungsfläche die
Fläche anzusehen, welche man erhält, wenn man die
äußersten Stützpunkte durch gerade Linien
verbindet. Bei einem stehenden Menschen bilden nicht bloß die
Fußsohlen, sondern auch der zwischen ihnen liegende Raum,
welcher beiderseits von den Sohlen, vorn durch eine die
Fußspitzen, hinten durch eine die Fersen verbindende gerade
Linie begrenzt wird, die Stützfläche. Trägt ein
Mensch eine Last, so muß er, um nicht zu fallen, seinen
Körper derart neigen, daß die durch den gemeinsamen
Schwerpunkt des Körpers und der Last gezogene Lotrechte den
Boden innerhalb jener Stehfläche trifft. Um einen Körper
umzuwerfen, muß man ihn um eine Kante oder einen Punkt (a der
Figur) des Umfanges seiner Unterstützungsfläche so lange
drehen, bis sein Schwerpunkt lotrecht über jener Kante oder
jenem Punkt liegt; läßt man ihn los, ehe diese Lage
erreicht ist, so fällt er in seine frühere Stellung
zurück; dreht man ihn aber nur ein wenig über jene Lage
hinaus, so stürzt er um und bleibt in einer neuen Stellung
liegen. Soll das Umkanten durch eine wagerecht am Schwerpunkt (S)
des Körpers angreifende Kraft (K) bewirkt werden, so muß
das Drehungsbestreben dieser Kraft dem entgegengesetzten der
Schwere (G) mindestens gleich sein, oder die Kraft K, multipliziert
mit ihrer Entfernung (ab) vom Drehpunkt (d. h. mit der Höhe
des Schwerpunktes über der Grundfläche), muß gleich
sein der Kraft G oder dem Gewicht des Körpers, multipliziert
mit ihrer Entfernung (ac) vom Drehpunkt (d. h. mit der halben
Breite der Stützfläche). Die Standfestigkeit des
Körpers, für welche die Kraft K das Maß darstellt,
steht demnach im geraden Verhältnis zu dem Gewicht des
Körpers und zur Breite seiner Stützfläche und im
umgekehrten Verhältnis der Höhe des Schwerpunktes
über der Grundfläche, oder ein Körper steht um so
fester, je größer sein Gewicht und je breiter seine
Stützfläche ist, und je tiefer sein Schwerpunkt liegt.
Ein Körper, welcher um eine wagerechte feste Achse drehbar
ist, befindet sich der Schwerkraft gegenüber in jeder
beliebigen Lage im Gleichgewicht, wenn sein Schwerpunkt genau in
der Drehungsachse liegt: man sagt alsdann, er befinde sich im
"gleichgültigen" oder indifferenten Gleichgewicht. Liegt sein
Schwerpunkt lotrecht über der Achse, so wird der Körper,
sobald man ihn aus dieser Gleichgewichtslage nur ein wenig
herausdreht, von der Schwere nach der Seite weiter gedreht, nach
welcher er sich neigt; man nennt daher in diesem Fall sein
Gleichgewicht unsicher, unbeständig oder labil. Er
"schlägt um" und dreht sich so lange, bis sein Schwerpunkt
lotrecht unter der Achse liegt; in dieser Lage ist sein
Gleichgewicht sicher, beständig oder stabil, denn wird er aus
dieser Lage herausgebracht, so wird er durch die Schwerkraft immer
wieder dahin zurückgeführt.
Standgeld (Stättegeld), Vergütung für den
dem Verkäufer für Aufstellung seiner Waren etc.
überlassenen Raum auf Märkten, öffentlichen
Plätzen etc.
Standgericht, früher Ausnahmegericht bei
Unterdrückung von Empörungen und innern Unruhen, dessen
Urteile der in einem Ort oder Lager anwesende oberste Befehlshaber
sofort bestätigen und vollziehen lassen konnte. Das Standrecht
proklamieren hieß der Einwohnerschaft und den Soldaten
kundgeben, daß solche Ausnahmegerichte eingesetzt sind. Jetzt
ist das S. in Deutschland im Gegensatz zu dem mit der höhern
Gerichtsbarkeit betrauten Kriegsgericht das Organ der niedern
Militärgerichtsbarkeit, zuständig über
Unteroffiziere und Gemeine für Vergehen, auf die keine
strengere Strafe gesetzt ist als Arrest und Versetzung in die
zweite Klasse des Soldatenstandes.
Sündhaftigkeit heißt das geduldige Ertragen
vermeidlicher Übel dann, wenn das Vermeiden derselben den
Duldenden einem sittlichen Tadel aussehen würde.
Standia, Insel, s. Dia.
Standish (spr. stänndisch), Stadt in Lancashire
(England), 5 km nordwestlich von Wigan, mit Kohlengruben und (1881)
4261 Einw. Hier Lancashire-Verschwörung zur Restauration der
Stuarts.
Standrecht, s. Standgericht.
Standrede, kurze Rede aus dem Stegreif.
Standrohre, s. Handfeuerwaffen, S. 102.
Standtreiben, s. Treibjagd.
Standwild, das Wild, welches sich an gewissen
Örtlichkeiten zu halten und von diesen nicht weit zu entfernen
pflegt, im Gegensatz zu Wechselwild.
Stang, 1) F., norweg. Staatsmann, geb. 1810, trat 1845
als Chef des Departements des Innern in die norwegische Regierung
ein, legte aber nach zehn Jahren 21. April 1856 sein Amt einer
Nervenkrankheit wegen nieder. Nachdem er sich von derselben in der
Schweiz erholt hatte, ward er 1857 während der Krankheit des
Königs Mitglied der interimistischen Regierung und vertrat
1859-60 Christiania im Storthing. 1861 bildete er ein neues
Ministerium, das er 1873 erneuerte, und war seitdem Staatsminister
des Königreichs. Durch Beförderung der Eisenbahn- und
Wegebauten sowie durch seine ausgezeichneten persönlichen
Eigenschaften erwarb er sich große Sympathien und
Anhänglichkeit, so daß er sich auch während des
langjährigen Streits mit der radikalen Majorität des
Storthings im Amt behauptenkonnte. Anfang Oktober 1880 erhielt er
unter lebhafter Anerkennung seiner Verdienste vom König
die
226
Stange - Stanhope.
erbetene Entlassung. Das Storthing bewies ihm aber seine
Feindseligkeit dadurch, daß es 1881 die für ihn
beantragte Pension von 12,000 Kronen auf die Hälfte
herabsetzte, obwohl S. 1856-60 eine höhere (10,000 Kronen)
bezogen hatte. Eine bedeutende Geldsumme, welche die konservative
Partei zur Entschädigung aufbrachte, verwandte S. zu
wohlthätigen Zwecken. Er starb 8. Juni 1884.
2) Rudolf, Kupferstecher, geb. 26. Nov. 1831 zu Düsseldorf,
bildete sich unter I. Keller auf der dortigen Akademie von 1845 bis
1856. Sein erstes größeres Werk war eine Madonna mit dem
Kind nach Deger in ausgeführter Linienmanier. Die
Verkündigung Mariä, nach Degers Freskobild auf
Stolzenfels, trug ihm 1861 in Metz eine Medaille ein. Zu Goethes
Frauengestalten, nach Kaulbach, stach er drei Blätter: die
Muse, Mignon und Eugenie. 1865 ging er nach Italien, wo er eine
Zeichnung nach Raffaels Sposalizio fertigte. Nach Düsseldorf
zurückgekehrt, vollendete er deren Stich 1873 und wurde in
Anerkennung dieses vortrefflichen Blattes von den Akademien zu
Berlin, München und Brüssel zum Mitglied ernannt; auch
erhielt er vom König von Preußen den Professortitel. Von
1874 bis 1875 war er wieder in Italien, wo er Zeichnungen zu einem
großen Stich des Abendmahls nach Leonardo da Vinci und einem
kleinern Blatt, Fornarina, nach Raffael ausführte. 1876
fertigte er einen Stich nach Landelles Fellahmädchen, und 1881
wurde er als Professor der Kupferstecherkunst an die Akademie zu
Amsterdam berufen, wo er den Stich nach Leonardos Abendmahl, sein
Hauptwerk, 1888 vollendete.
Stange, schwed. Längenmaß, = 2,969 m; 10
Stangen = 1 Schnur.
Stangengehörn, s. Geweih, S. 285.
Stangenkohle, s. Braunkohle und Steinkohle.
Stangenkugeln, zwei durch eine eiserne Stange mit Gelenk
verbundene Voll- oder Halbkugeln, die aus einem Geschütz
großen Kalibers gegen breite Ziele, namentlich gegen die
Takelage von Schiffen, ähnlich den Kettenkugeln, früher
gebraucht wurden.
Stangenkunst, s. v. w. Kunstgestänge, s. Bergbau, S.
729.
Stangenpferde, die an der Deichsel gehenden Pferde eines
Wagens; der auf dem Stangensattelpferd reitende Fahrer bei der
Artillerie heißt Stangenreiter.
Stangenschörl, s. Turmalin.
Stangenspat, s. Schwerspat.
Stangenspringen (Stabspringen), das Springen mit
Unterstützung durch eine 2½ - 4 m lange, bis 4 cm
starke Stange. Während seine Pflege in der hellenischen
Gymnastik zweifelhaft ist, ist es in manchen Gegenden
volkstümlich im Gebrauch, in Deutschland z. B. in
Marschgegenden an der Nordsee zum Überspringen der das Land
durchziehenden Gräben mit den sogen. Klot- od. Pad- (Pfad-)
Stöcken, die meist am untern Ende mit einer Vorrichtung gegen
zu tiefes Einsinken in weichen Boden versehen sind. Die Turnkunst
hat das S. seit Guts Muths und Jahn in den Bereich ihrer
Übungen genommen und macht es neuerdings oft zum Gegenstand
von Wettturnen. Vgl. I. K. Lion, Die Turnübungen des
gemischten Sprunges (2. Aufl., Leipz. 1876); Kluge, Anleitung zum
S., in den "Zeitfragen aus dem Gebiete der Turnkunst" (Berl.
1881).
Stangenstein, s. Topas.
Stanhope (spr. stannop). 1) James, erster Graf von, engl.
Staatsmann, aus der Familie der Grafen von Chesterfield stammend,
geb. 1673, diente unter Wilhelm III. in Flandern mit Auszeichnung
und erwarb sich den Rang eines Obersten. Unter der Königin
Anna ward er Mitglied des Parlaments und später Gesandter bei
den Generalstaaten. Im spanischen Erbfolgekrieg diente er unter
General Peterborough in Spanien, eroberte 1708 als Generalmajor
Port Mahon und die Insel Menorca, siegte, zum Oberbefehlshaber der
englischen Truppen in Spanien befördert, im Sommer 1710 bei
Almenara und Saragossa und führte den Erzherzog Karl nach
Madrid, verzögerte dann aber durch seinen Eigensinn den
notwendigen Rückzug und wurde mit 6000 Mann bei Brihuega im
Dezember d. J. gefangen und erst 1712 ausgewechselt. König
Georg I. ernannte S. 1714 zum Staatssekretär und Mitglied des
Geheimen Rats. 1716 begleitete S. den König von Hannover und
entwarf mit dem Abbe Dubois, Abgesandten Frankreichs, die
Präliminarien zu der Tripelallianz, welche 4. Jan. 1717 im
Haag zwischen England, Frankreich und den Generalstaaten
abgeschlossen wurde; er wurde dafür 1717 zum ersten Lord des
Schatzes, Kanzler der Schatzkammer und Peer von
Großbritannien unter dem Titel Baron S. von Elvaston und
Viscount S. von Mahon ernannt. 1718 vermittelte er als erster
Staatssekretär mit Dubois die berühmte Quadrupelallianz
und wurde hierauf zum Grafen von S. erhoben. Er starb 4. Febr. 1721
in London.
2) Charles, dritter Graf von, Enkel des vorigen, geb. 3. Aug.
1753 zu Genf, löste im Alter von 18 Jahren eine Preisaufgabe
der Akademie zu Stockholm über die Pendelschwingungen, trat
1780 ins Parlament, wo er der Opposition angehörte, und nach
seines Vaters Tod 1786 ins Oberhaus. Die Ideen der
französischen Revolution hatten in ihm einen begeisterten
Vertreter. Als die Habeaskorpusakte suspendiert ward, blieb er aus
dem Parlament weg und erschien erst 1800 wieder. Er starb 15. Dez.
1816. S. erfand eine seinen Namen tragende eiserne Druckerpresse
(s. Presse, S. 332), verbesserte die Stereotypie und schrieb
mehrere Abhandlungen über Mathematik und Mechanik, die sich in
den "Philosophical Transactions" finden.
3) Lady Esther, durch ihre Sonderbarkeiten bekannt gewordene
Tochter des vorigen, geb. 12. März 1776 zu London. Von der
Natur mit imposantem Äußern, scharfem Verstand und
geistiger Energie ausgerüstet, erhielt sie keine geregelte
Erziehung. Später leitete sie das Hauswesen ihres
unverheirateten Oheims Pitt und führte dessen Briefwechsel.
Nach Pitts Tod (1806) zog sie sich mit einem geringen
mütterlichen Erbteil und einer Staatspension von 1200 Pfd.
Sterl. nach Wales zurück. Nach mehrjährigen Reisen durch
Griechenland und die Türkei beschloß sie, sich in Syrien
eine neue Heimat zu gründen, litt aber bei der Überfahrt
Schiffbruch, kehrte nach England zurück, verkaufte den Rest
ihrer Güter und ging dann wirklich nach Syrien. Der Glanz, den
sie um sich verbreitete, und ihr mysteriöses Wesen machten
dort großen Eindruck. Anfangs wohnte sie in einem
griechischen Kloster, später errichtete sie sich zu Dschihun
unweit Sidon, mitten im Libanon, eine Wohnung. Die Syrer pflegten
sie Königin von Tadmor, Zauberin von Dschihun und Sibylle des
Libanon zu nennen und glaubten sie durch Verbindung mit der
Geisterwelt im Besitz großer Schätze. Bei Ibrahim
Paschas Einfall in Syrien spornte sie die Drusen zum Widerstand an
und wußte jenem solchen Respekt einzuflößen,
daß derselbe sie um Neutralität bat. Ein Haupthebel
ihres Einflusses war ihre großartige
227
Stanhopepresse - Stanislaus.
Wohlthätigkeit, bis sie später völlig verarmte,
namentlich seit ihre Staatspension, um ihre Gläubiger zu
befriedigen, innebehalten wurde. Von allen englischen Dienern
verlassen, nur von einigen treuen Arabern umgeben, starb sie 22.
Juni 1839 in Dschihun. Man setzte sie in der Gruft zu Mar Elias
bei. Ihr Arzt veröffentlichte: "Memoirs of the Lady Esther S."
(Lond. 1845, 3 Bde.; deutsch, Stuttg.1846).
4) Philip Henry, Viscount Mahon, fünfter Graf von, engl.
Staatsmann und Geschichtschreiber, geb. 30. Jan. 1805 auf Walmer
Castle, Enkel von S. 2), trat 1830 für den Flecken
Wootton-Basset in das Parlament, wo er als strenger Tory die
Reformbill heftig bekämpfte. Nach deren Annahme verlor er
seinen Sitz im Unterhaus, wurde aber für Hertford wieder
gewählt, bekleidete unter dem Ministerium Peel-Wellington vom
Dezember 1834 bis April 1835 das Amt eines
Unterstaatssekretärs im Auswärtigen Departement, ward im
Juli 1845 Sekretär des indischen Amtes, mußte aber beim
Sturz des Ministeriums Peel im Juli 1846 zurücktreten und
gehörte nun im Unterhaus zur Partei der Peeliten. 1855 trat er
nach seines Vaters Tod ins Oberhaus, wirkte aber hauptsächlich
in verschiedenen Kommissionen und gelehrten Gesellschaften, unter
anderm als Präsident der Society of Antiquaries, als Lord
Rektor der Universität Aberdeen, als Vorstandsmitglied des
Britischen Museums etc., in höchst verdienstlicher Weise. Er
starb 24. Dez. 1875 in Bornemouth. Von seinen Schriften sind
hervorzuheben: "Life of Belisarius" (Lond. 1829, 2. Aufl. 1848);
"History of the war of the succession in Spain" (1834, neue Ausg.
1850); "History of England from the treaty of Utrecht to the peace
of Aix-la-Chapelle" (1836, 2 Bde.; später fortgesetzt bis zum
Frieden von Versailles, 5. Aust. 1858, 7 Bde.; deutsch von Steger,
Braunschw. 1855, 8 Bde.); "Life of the Great Conde" (1840); "Life
of William Pitt" (des jüngern, 4. Aufl. 1879, 3 Bde.);
"History of England comprising the reign of Queen Anne" (1867; 4.
Aufl. 1873, 2 Bde.); "Miscellanies" (1863, neue Folge 1872);
"French retreat from Moscow and historical essays" (1876). Eine
Auswahl seiner für die "Quarterly Review" gelieferten Artikel
erschien unter dem Titel: "Historical essays" (Lond. 1848, neue
Ausg. 1861). Er gab auch die "Letters of Philip Dormer S., Earl of
Chestertield" (neue Ausg., Lond. 1853, 5 Bde.) und "Memoirs by Sir
Robert Peel" (das. 1856-57, 2 Bde.) heraus. Als sechster Graf von
S. folgte ihm sein Sohn Arthur Philip, geb. 13. Sept. 1838, 1868
bis 1875 Mitglied des Unterhauses, 1874-76 Lord des Schatzamtes im
Ministerium Disraeli.
5) Edward, zweiter Sohn des vorigen, geb. 1840 zu London,
erzogen in Harrow und Oxford, wurde 1865 Rechtsanwalt in London und
1874 für Lincolnshire als konservativer Abgeordneter ins
Unterhaus gewählt. Er war Sekretär im Handelsamt vom
November 1875 bis April 1878, Unterstaatssekretär für
Indien vom April 1878 bis April 1880, Vizepräsident des
Erziehungsrats vom Juni bis August 1885, Präsident des
Handelsamtes von da an bis zum Februar 1886. Im August 1886 wurde
er in Lord Salisburys zweitem Ministerium zum Staatssekretär
für die Kolonien und 1887 zum Kriegsminister ernannt. 1888
legte er dem Parlament eine neue Landesverteidigungsbill vor.
Stanhopepresse, s. Stanhope 2).
Stanislau (Stanislawow), Stadt in Galizien, an der
Bistritza, Knotenpunkt der Lemberg-Czernowitzer Bahn und der
Staatsbahnlinie Stryi-Husiatyn, ist Sitz eines
griechisch-katholischen Bistums, einer Bezirkshauptmannschaft,
eines Kreisgerichts und einer Finanzbezirksdirektion, hat ein
Standbild Kaiser Franz I., ein Obergymnasium, Oberrealschule,
Lehrerbildungsanstalt, große Eisenbahnwerkstätte,
Ziegelfabrikation, Dampfmühle, Bierbrauerei, Gerberei,
lebhaften Handel und (1880) 18,626 Einw. (darunter 10,023
Juden).
Stanislaus (Stanislaw), 1) Heiliger, geb. 1030 in
Galizien, studierte zu Gnesen und Paris, wurde 1071 Bischof von
Krakau, aber 1079 in der dortigen Michaeliskirche während der
Messe zusammengehauen, weil er die Ausschweifungen des Königs
Boleslaw des Kühnen gerügt und über denselben den
Bann verhängt hatte. Von Papst Innocenz IV. 1253 heilig
gesprochen, wird S. als Schutzpatron Polens verehrt. Sein
Gedächtnistag ist der 7. Mai.
[Könige von Polen.] 2) S. L Leszczynski, geb. 20. Okt. 1677
zu Lemberg, Sohn Raphael Leszczynskis, Woiwoden von Posen, ward zum
Starosten und Landboten und nach seines Vaters Tod vom König
August II. zum Woiwoden von Posen und General von Großpolen
ernannt. 1704 beteiligte er sich an der Konföderation, die auf
Betrieb Karls II. von Schweden August II. absetzte, und ward
hierauf durch des erstern Einfluß 12. Juni 1704 zum
König von Polen erhoben und 7. Okt. 1705 nebst seiner Gemahlin
Katharina Opalinska gekrönt. Er vermochte sich jedoch nur bis
zur Schlacht von Poltawa (1709) in Polen zu halten, floh darauf
nach Stettin und setzte 1711 nach Schweden über. 1712 kam er
mit einem Heer zurück und stieß zur Armee des Generals
Steenbock. Bereit, auf die Krone zu verzichten, unternahm er 1713,
um Karls Zustimmung zu erhalten, eine Reise nach Jassy, ward aber
vom Hospodar der Moldau nach Bender geschickt und erst 1714 gegen
das Versprechen, das türkische Gebiet meiden zu wollen,
freigegeben. Karl XII. trat ihm, bis er ihm den polnischen Thron
wiedererkämpft hätte, das Fürstentum
Zweibrücken ab. Nach dem Tod Karls XII. (1718) mußte S.
hier dem Pfalzgrafen Gustav Samuel weichen und ging 1720 nach
Frankreich, wo er seinen Aufenthalt erst in Weißenburg, dann
in Bergzabern und, nachdem sich König Ludwig XV. mit seiner
Tochter Maria Leszczynska vermählt hatte, in Chambord bei
Blois nahm. Nach Augusts II. Tod (1733) machte S. seine
Ansprüche auf die polnische Krone von neuem geltend, worin ihn
Frankreich und Schweden unterstützen wollten, reiste heimlich
nach Warschau und ward dort 11. Sept. zum zweitenmal zum König
gewählt. Allein Rußland und Österreich zwangen den
Polen den Kurfürsten von Sachsen, August III., zum König
auf, und S. floh vor einem russischen und sächsischen Heer
nach Danzig und, als er die Übergabe der Festung an die Russen
nahe sah, nach Marienwerder. Durch den Wiener Frieden (3. Okt.
1735, ratifiziert 1738) ward endlich festgesetzt, daß S. auf
die polnische Krone Verzicht leisten, aber den Titel eines
Königs beibehalten und die Herzogtümer Lothringen und Bar
vom Herzog Franz von Lothringen abgetreten erhalten sollte, die
nach dem einstigen Absterben S. an Frankreich fallen sollten.
Nachdem er die Revenuen seiner Herzogtümer gegen eine Pension
von 2 Mill. Frank an Frankreich abgetreten hatte, residierte er
teils zu Nancy, das er sehr verschönerte, teils zu Luneville
und erwarb sich durch Wohlthätigkeit und Förderung der
Wissenschaften und Künste die Liebe seiner Unterthanen. Er
starb an den Folgen einiger am Kaminfeuer erhaltenen Brandwunden
23. Febr. 1766. Seine Schriften erschienen gesammelt
228
Stanislausorden - Stanley.
unter den Titeln: "Oeuvres du philosophe bienfaisant" (Par.
1765, 4 Bde.; neue Ausg. von Migne, 1850); "Oeuvres choisies" (das.
1825).
3) S. II. August, der letzte König von Polen, Sohn des
Grafen Stanislaus Poniatowski und der Fürstin Konstantia
Czartoryiska, geb. 17. Jan. 1732 zu Wolczyn, trat zuerst 1752 auf
dem Reichstag als Landbote auf. August III. sandte ihn an die
Kaiserin Elisabeth nach Petersburg, wo er sich die Gunst der
Großfürstin, nachherigen Kaiserin Katharina, erwarb,
deren Liebhaber er mehrere Jahre war. Nach Augusts Tod brachte es
diese durch ihren Einfluß dahin, daß S. 7. Sept. 1764
zum König von Polen gewählt und 25. Nov. in Warschau
gekrönt wurde. Seine Stellung inmitten der Parteiungen des
Adels und der Übermacht der Nachbarstaaten war eine
schwierige. Der nötigen Energie ermangelnd, um den
unabhängigen Adel zu zügeln und sich der schlauen
russischen Politik zu entziehen, ward er bald mißliebig. Ja,
3. Nov. 1771 ward er von den Verschwornen aus Warschau
entführt, doch auf seine beredten Vorstellungen wieder dahin
zurückgeführt. Die erste Teilung Polens 1772 mußte
er genehmigen. Er schloß sich dann den Bestrebungen, den
zerrütteten Staat zu reformieren, an, vereitelte dieselben
aber dadurch, daß er sich der Konföderation von
Targowitz gegen die Konstitution vom 3. Mai 1791 anschloß und
die abermalige Einmischung der Russen veranlaßte. Sein
Widerspruch gegen die zweite Teilung Polens hatte zur Folge,
daß Katharina ihn nach der Einnahme Warschaus durch Suworow
nach Grodno bringen ließ, wo er den dritten Teilungsvertrag
unterzeichnen und 25. Nov. 1795 dem Thron entsagen mußte. Er
erhielt von Österreich, Rußland und Preußen
200,000 Dukaten Pension, die er anfangs in Grodno verzehrte. Paul
I. berief ihn gleich nach dem Tod Katharinas nach Petersburg, wo er
12. Febr. 1798 unvermählt starb. Der von ihm gestiftete
Stanislausorden ward 1816 vom Zaren Alexander erneuert. Vgl.
"Mémoires secrets inédits de Stanislas II Auguste"
(Leipz. 1862); "Correspondance inédite du roi S. Auguste
Poniatowski et Mad. Geoffrin 1764-77" (1887).
Stanislausorden, russischer, ursprünglich poln.
Verdienstorden, gestiftet von König Stanislaus II. 7. Mai 1765
für 100 Ritter, wurde nach der Teilung Polens nicht mehr
verliehen; erst König Friedrich August von Sachsen, Herzog von
Warschau, verlieh ihn wieder. Kaiser Alexander, als König von
Polen, erneuerte ihn 1815 und teilte ihn in vier Klassen; Kaiser
Nikolaus I. verleibte ihn 1831 den russischen Orden ein und
beschränkte ihn 1839 auf drei Klassen (die zweite mit zwei
Unterabteilungen mit und ohne Krone). Er kommt im Rang nach dem St.
Annenorden. Die Dekoration ist ein rot emailliertes achtspitziges
Kreuz mit goldenen Kugeln und goldenen Halbkreisen zwischen den
Spitzen sowie goldenen Adlern zwischen den Armen. Der weiß
emaillierte Mittelschild, von grünem Lorbeer eingefaßt,
trägt in Rot die Chiffer S. S. (Sanctus Stanislaus). Der
Revers trägt dieselbe Inschrift auf Gold mit weißem
Rande. Der achtstrahlige Silberstern trägt die Devise:
"Praemiando incitat". Der Orden wird in der üblichen Weise an
dunkelrotem Band mit doppelter weißer Einfassung getragen.
Für eine bestimmte Anzahl von Rittern ist eine Pension mit dem
Orden verbunden, dessen Fest 23. April gefeiert wird.
Staniza (russ.), s. v. w. Kosakenansiedelung.
Stankkugeln, Leinwandsäckchen, mit einem Brandsatz
gefüllt, dem Federn, Hornspäne und ähnliche, beim
Verbrennen stinkende Gegenstände beigemengt werden;
früher angewendet, um den Feind aus Minengängen,
Kasematten etc. hinauszuräuchern.
Stanley (spr. stännli), 1) Arthur Penrhyn, engl.
Gelehrter, Sohn des Bischofs S. von Norwich und Vetter des Lords S.
of Alderley, geb. 13. Dez. 1815, studierte Theologie in Oxford, wo
er für sein Gedicht "The gipsies" einen Preis errang, wirkte
dann von 1840 ab als Fellow am University College daselbst und
wurde 1851 zum Kanonikus von Canterbury, 1858 zum Professor der
Kirchengeschichte in Oxford erwählt. Daneben war er Kaplan des
Bischofs von London und seit 1863 Dechant von Westminster.
Vertreter einer milden Aufklärung innerhalb des Christentums,
beteiligte er sich 1872 mit Lebhaftigkeit am
Altkatholikenkongreß in Köln und wurde 1875 zum
Lord-Rektor der Universität St. Andrews erhoben. Seine
litterarische Thätigkeit hatte er mit der Biographie seines
Jugendlehrers Th. Arnold (1844, 13. Aufl. 1882; deutsch, Potsd.
1846) begonnen. Es folgten: "Sermons and essays on the apostolical
age" (1846, 3. Aufl. 1874); "Historical memorials of Canterbury"
(1854, 10. Aufl. 1883); "Sinai and Palestine", die Frucht einer
Reise nach dem Orient (1856, 4. Aufl. 1883); "Lectures on the
history of the Eastern Church" (1861, 5. Aufl. 1883) u. a. Nachdem
er 1862 als Begleiter des Prinzen von Wales eine zweite Reise nach
dem Orient gemacht, veröffentlichte er: "Scenes of the East"
(1863); "Lectures on history of the Jewish Church" (1862; 8. Aufl.
1884, 3 Bde.); "Historical memorials of Westminster Abbey" (5.
Aufl. 1882); "Essays chiefly on questions of church and state from
1850-70" (1870, neue Aufl. 1884); "The Athanasian creed" (1871);
"Lectures on the history of the Church of Scotland" (1872);
"Christian institutions" (4. Aufl. 1883) u. a. Vielfach Unwillen
erregte S. 1880 durch seinen hartnäckig festgehaltenen Plan,
dem Sohne Napoleons III. ein Denkmal in der Westminsterabtei setzen
zu lassen, bis ihn endlich der Wille des Parlaments zum Nachgeben
nötigte. Er starb 18. Juli 1881 in London. Vgl. Grace Oliver,
A. P. S. (3. Aufl., Lond. 1885).
2) Henry Morton (eigentlich James Rowland), berühmter
Afrikareisender, geb. 28. Jan. 1841 bei Denbigh in Wales als Sohn
des Farmers John Rowland, kam im Alter von drei Jahren ins
Armenhaus von St. Asaph, woselbst er bis zum 13. Jahr blieb und
eine gute Erziehung erhielt. Er wollte sich anfangs dem Lehrfach
widmen, wurde dann aber Schiffsjunge und kam als solcher nach New
Orleans. Hier fand er bei einem Kaufmann, Namens S.,
Beschäftigung, ward von demselben adoptiert und nahm dessen
Namen an. Nach dem Tod seines Wohlthäters trat er 1861 beim
Ausbruch des Kriegs in die Armee der Konföderierten, wurde
aber gefangen genommen und der Marine der Vereinigten Staaten
zugeteilt, in welcher er es bis zum Fähnrich brachte. Nach dem
Frieden bereiste er 1865 die Türkei und Kleinasien und
begleitete 1867-68 als Korrespondent des "New Vork Herald" die
englische Armee nach Abessinien. Seinen Weltruf verdankte S. seinem
kühnen Zug zur Auffindung Livingstones, während die
Feststellung des Lualaba und Congostroms ihn zum ersten
Afrikareisenden aller Nationen der Jetztzeit stempelte. Im Auftrag
von J. G. Bennett (s. d.), dem Besitzer des "New York Herald", war
S. nämlich im Okt. 1869 ausgeschickt worden, um den ganz
verschollenen Livingstone aufzusuchen und ihm Hilfe zu bringen.
Nachdem er zuvor als Berichterstatter des "Herald" der
229
Stanley (Afrikareisender).
Einweihung des Suezkanals beigewohnt, dann einen Abstecher nach
Persien und Indien gemacht hatte, langte er im Januar 1871 in
Sansibar an, von wo er mit etwa 200 Mann (darunter 3 Weiße),
vorzüglich ausgerüstet und aufs beste bewaffnet, einige
Wochen später seinen Marsch ins Innere von Afrika antrat. Nach
vielen zu überwindenden Schwierigkeiten war er endlich am
Ziel: 10. Nov. hielt er seinen feierlichen Einzug in Udschidschi am
Tanganjikasee, wo er in der That den tot geglaubten Livingstone
fand. Daß S. in Großbritannien eine starke Anfeindung
erfuhr, daß man seinen ganzen Bericht für eine
Unwahrheit erklärte, daß später aber sich alles
dies als bloße Verleumdung herausstellte, trug nur dazu bei,
dem verdienten Manne noch größere Berühmtheit zu
verschaffen. Nachdem er mit Livingstone sich noch der Erforschung
des Tanganjika gewidmet, trat er im März 1872 seine
Rückreise nach Sansibar und Europa an. Über seine
Erlebnisse und die Resultate seiner Expedition, die dem Besitzer
des "New York Herald" gegen 10,000 Pfd. Sterl. gekostet hatte,
berichtete er in dem Werk "How I found Livingstone" (Lond. 1872;
deutsch, 2. Aufl., Leipz. 1885), worin er außer seinen eignen
auch Livingstones Beobachtungen in dem See- und Flußsystem im
SW. und W. des Tanganjikasees brachte. Darauf wohnte er 1873 bis
1874 dem Feldzug der Engländer gegen den König der
Aschanti bei und berichtete darüber wie über den
abessinischen Feldzug in "Coomassie and Magdala" (Lond. 1874). In
noch großartigerer Weise nahm S. sodann seine Forschungen
1874 wieder auf und zwar zuerst auf Kosten des "New York Herald"
und des Londoner "Daily Telegraph". Mit mehr als 300 Soldaten und
Trägern verließ er im November 1874 Bagamoyo, erreichte
27. Febr. 1875 das südliche Ufer des Ukerewe oder Victoria
Nyanza und umfuhr den ganzen See. Da S. nicht wußte,
daß der Schwestersee des Ukerewe, der 1864 von Baker
entdeckte Mwutan oder Albert Nyanza, bereits von dem Italiener
Gessi bis zu seinem Südende befahren war, so versuchte er,
diesen See zu erreichen. Vom Ukerewe sich westlich wendend,
entdeckte er im Januar 1876 zunächst das 5000 m hohe,
schneebedeckte Gambaragaragebirge. Unter 30° 20' östl. L.
v. Gr. und dem Äquator stieß er alsdann auf einen
großen Golf, den er Beatricegolf nannte und für einen
Teil des Mwutan ansah. Nach spätern Aufnahmen des
ägyptischen Obersten Mason Bei muß jedoch angenommen
werden, daß S. hier einen neuen großen, noch
unbenannten See entdeckt hat. Nun sich südlich wendend,
erforschte er den Hauptzufluß des Ukerewe, den Kagera oder
Kitangule, welchen er als einen bedeutenden, 20-40 m tiefen Strom
schildert, und der aus einem gleichfalls von S. entdeckten See, dem
Akanjaru oder Alexandrasee (zwischen 2-3° südl. Br. und
31° östl. L. v. Gr.), entspringt. S. wandte sich nun der
Lösung des größten noch vorhandenen afrikanischen
Problems zu. Er wollte zu ergründen suchen, wohin die
ungeheuern Wassermassen der Seen und Ströme, die westlich vom
Tanganjikasee liegen, sich ergössen, und ob dieselben, wie
theoretisch bereits Behm nachgewiesen, den obern Lauf des Congo
darstellten, von dem man nur die Mündung kannte. Am 27. Mai
1876 war S. wieder in Udschidschi am Ostufer des Tanganjikasees,
machte auf demselben sein tragbares Boot flott und umfuhr in 51
Tagen zum erstenmal vollständig dieses große
Wasserbecken. Auch den nach W. führenden "Abfluß" des
Tanganjika, den von Cameron entdeckten Lukuga, fand S. wieder auf
und fuhr denselben eine Strecke weit abwärts. Nach seinen
Schilderungen ist der Lukuga jedoch nur ein sumpfiger Arm des
Tanganjika, welcher bloß bei Hochwasser einen gelegentlichen
Abfluß nach W. ausmacht. Nach Vollbringung dieser Aufgabe
drang S. nach W. vor und erreichte unter großen Gefahren
Nyangwe, den äußersten von Livingstone und Cameron
erreichten Ort am obern Lualaba-Congo. Nachdem er seine
zusammengeschmolzene Expedition wieder auf 200 Bewaffnete gebracht
hatte, verließ er 15. Nov. 1876 mit 18 Kanoes Nyangwe, um
eine der gefahrvollsten und merkwürdigsten Reisen anzutreten,
von welcher die Geschichte aller Zeiten berichtet. Sowohl in seinem
obern Lauf bis zum Äquator als in seinem untern zeigt der
Lualaba-Congo zahlreiche bedeutende Wasserfälle, die zum
großen Teil umgangen werden mußten, was meist unter
Kämpfen mit den Eingebornen geschah. Einzelne Katarakte wurden
durchschifft, doch verlor S. hierbei seinen treuen Diener Kalulu
und seinen letzten weißen Gefährten, Francis Pocock.
Drei Vierteljahre hatte diese gefahrvolle, abenteuerliche Reise
gedauert, als S. mit seiner zusammengeschmolzenen Schar, dem
Hungertod nahe, 8. Aug. 1877 in Boma an der Congomündung in
den Bereich portugiesischer Herrschaft gelangte. Aber die
Anstrengungen waren des Resultats wert. Der bisher unbekannte
Riesenlauf des Congo konnte in die Karte eingetragen werden (s.
Congo). S. stellte die ganze Länge des Stroms, für
welchen er den nicht acceptierten Namen "Livingstone" vorschlug,
auf 630 Meilen fest, von denen der 225 Meilen lange, oft seeartig
erweiterte mittlere Teil für die größten Schiffe
fahrbar ist, so daß hier dem Handel ein neues, ungeheuer
großes Gebiet durch den kühnen Reisenden eröffnet
wurde. Die Identität des Congo mit dem Lualaba war somit
festgestellt und damit eine Wasserstraße ins Innere von
Afrika von mehr als 4000 km Länge eröffnet, die nur an
2-3 Stellen von Katarakten unterbrochen wird. Bereits vier Monate
nach seiner Rückkehr veröffentlichte er seinen
Reisebericht "Through the dark continent" (Lond. 1878), der
mehrmals aufgelegt wurde, ebenso wie die zu gleicher Zeit
erschienene deutsche Übersetzung "Durch den dunkeln Weltteil"
(2. Aufl., Leipz. 1881, 2 Bde.). Der großartige Erfolg
Stanleys führte nach der Begegnung König Leopolds II. von
Belgien mit dem Entdecker in Brüssel zur Gründung des
Comité d'études du Haut-Congo, das es sich zur
Aufgabe stellte, Zentralafrika dem Handel zu eröffnen. S.
wurde mit der Leitung des Unternehmens betraut, er legte nicht
allein längs des Congo, auch in dem später an Frankreich
abgetretenen Gebiet des Kuilu eine Reihe von Stationen an bis zu
den Stanleyfällen am obern Congo, entdeckte, den Kwa
aufwärts fahrend, den großen See, welchem er den Namen
Leopolds II. gab, und war mit kurzer Unterbrechung, als ihn seine
geschwächte Gesundheit zur Reise nach Europa nötigte, bis
1884 unermüdlich im Congogebiet thätig. In diesem Jahr
kehrte er endgültig nach Europa zurück, nahm als
technischer Kommissar des Bevollmächtigten der amerikanischen
Union an der Congokonferenz in Berlin teil und veranlaßte in
England die Bildung einer Gesellschaft zur Erbauung einer Eisenbahn
von der Congomündung bis zum Stanley Pool. Zu gleicher Zeit
publizierte er "The Congo and the foundation of its free state",
deutsch unter dem Titel: "Der Congo und die Gründung des
Congostaats" (Leipz. 1885, 2 Bde.). Als Ende 1886 die
ägyptische Regierung in Gemeinschaft mit einigen englischen
Kapitalisten eine Expedition zum Entsatz Emin Beis auszusenden
beschloß,
230
Stanley Pool - Stans.
übernahm S. bereitwilligst die Führung dieses
schwierigen und gefahrvollen Unternehmens, traf 24. Dez. 1886 von
New York in London ein, das er 21. Jan. 1887 verließ, um sich
nach Sansibar zu begeben, von wo er mit den dort von ihm
angeworbenen Leuten um das Kap zum Congo fuhr. Dort traf er 18.
März ein. Seine Begleitung bestand aus 9 Europäern, 13
Somal, 61 Sudanesen und 620 Sansibariten. Außerdem
schloß sich der arabische Sklavenhändler Tippu Tip,
welchen S. durch dessen Ernennung zum Gouverneur vom obern Congo
mit einem Jahresgehalt gewonnen hatte, mit 40 Mann an; weitere
Mannschaften vom Tanganjika und von Kassongo bei Nyangwe sollten
bei den Stanleyfällen zu Tippu Tip stoßen. Da am Congo
großer Mangel an Nahrungsmitteln herrschte, war die
Verproviantierung der großen Kolonne sehr schwierig, doch
konnte sich S. 29. April von Stanley Pool auf vier Dampfern und
mehreren großen Booten endlich einschiffen. Am 28. Mai
erreichte er die Mündung des Aruwimi, wo er ein festes Lager
errichtete, und bereits 2. Juni brach er mit 5 Europäern und
580 Mann nach O. auf. Am 20. Juni befand er sich an den
Jambujafällen des Aruwimi, wo er ein festes Lager zum Schutz
der unter Major Barttelot zurückbleibenden 100 Mann starken
Besatzung errichtete. Von hier brach er 28. Juni mit 389 Mann auf,
am linken Ufer des Flusses aufwärts ziehend. Der Name des
Aruwimi ändert sich wiederholt, 140 km von Jambuja heißt
er Lubali, dann Nevoa, nach seinem Zusammenfluß mit dem
Nepoko heißt er No-Welle, 350 km vom Congo aber Ituri. Trotz
der Feindseligkeiten der Eingebornen ging der Marsch ohne
Schwierigkeit vor sich, bis man Anfang August ein Urwaldgebiet
erreichte, wo der Expedition furchtbare Leiden harrten. Die
Eingebornen widersetzten sich dem Vordringen Stanleys und
erschossen 5 Mann mit vergifteten Pfeilen, auch Leutnant Stairs
wurde schwer verwundet. Um den arabischen Sklavenjägern
auszuweichen, hielt sich S. auf der Congostraße, stieß
31. Aug. aber doch auf eine Abteilung des Sklavenhändlers
Ugarrowa, zu dem 26 Leute desertierten. Auch mußte S. 56
Invalide im Lager Ugarrowas zurücklassen. Mit 273 zog er
weiter, schreckliche Leiden ausstehend in dem durch
Sklavenjäger verwüsteten Land, so daß ein
mitgebrachtes Boot mit 70 Warenladungen unter dem Wundarzt Parke
und dem Kapitän Nelson, beide marschunfähig und
verwundet, bei dem Sklavenhändler Kilonga-Longa
zurückgelassen werden mußte. Endlich wurde Ibwiri
erreicht, wo an Stelle des bisherigen dichten, dumpfen Waldes weite
fruchtbare Ebenen traten und Lebensmittel im Überfluß
waren. Zwar widersetzte sich der mächtige Häuptling
Mogamboni Stanleys Vordringen, doch wurden alle Angriffe
zurückgeschlagen. Am 14. Nov. erreichte S. den Albert Nyanza
bei Kawalli, wo er ein verschanztes Lager errichtete, und da keine
Nachricht von Emin Pascha eingelaufen war, marschierte S. die 200
km zu Kilonga-Longa zurück, um das Boot zu holen. Am 28. April
1888 traf S. endlich mit Emin und Casati zusammen, die ihn in dem
Dampfer Khediv aufgesucht hatten. Emin blieb 26 Tage bei S., ohne
sich bewegen zu lassen, nach Europa zurückzukehren. Darauf
trat S. 16. Juni mit 111 Sansibariten und 101 ihm von Emin
überlassenen Trägern seinen Rückmarsch an, fand
indes von den zurückgelassenen 257 Mann nur noch 71 bei
Bunalaya vor und schlug darauf einen kürzern Weg ein, um nach
Fort Bodo bei Ibwiri, wo er seine Europäer gelassen
zurückzukehren. Vgl. Rowlands, Henry M. S., record of his life
(Lond. 1872); Volz, Stanleys Reise durch den dunkeln Weltteil,
für weitere Kreise bearbeitet (3. Aufl., Leipz. 1885).
3) Frederik Arthur, Lord, engl. Staatsmann, jüngerer Bruder
des Lords Derby, geb. 15. Jan. 1841, widmete sich der
militärischen Laufbahn und avancierte zum Kapitän bei den
Gardegrenadieren, trat aber dann zur Reserve über und wurde
erst zum Major, dann zum Obersten eines Milizregiments ernannt.
Seit 1865 gehörte er für Preston dem Unterhaus an, wo er
sich, den Traditionen seiner Familie gemäß, der
konservativen Partei anschloß. 1868 war er auf kurze Zeit
jüngerer Lord der Admiralität, mußte aber im
Dezember d. J. mit Disraeli zurücktreten. 1878-80 war S.
Kriegsminister und leitete die Vollendung der Rüstungen gegen
Rußland und die Okkupation Cyperns. Unter Salisbury war er im
Juni 1885 bis Januar 1886 Staatssekretär für die Kolonien
und seit August 1886 Handelsminister. Unter dem Titel Lord S. of
Preston wurde er 1887 in den Peersstand erhoben.
Stanley Pool (spr. stännli puhl), das von H. M.
Stanley entdeckte, ca. 40 km lange und 26 km breite, 348 m ü.
M. gelegene Becken, welches der Congo unter 16° östl. L.
und 4° südl. Br. oberhalb der Kallulufälle bildet. Am
Nordufer liegt Brazzaville, im SW. des Sees die Station
Leopoldville.
Stannate, s. Zinnsäure.
Stannin, s. Zinnkies.
Stanniol (Zinnfolie), sehr dünnes Zinnblech aus
reinem Zinn oder einer Zinnlegierung mit 1-2 Proz. Kupfer (wodurch
die Folie an Festigkeit gewinnt) durch Gießen, Walzen und
Schlagen hergestellt. Man gießt das Metall in
Platteneingüssen zu Platten von 10 mm Dicke aus und walzt
diese Platten in einem Blechwalzwerk anfangs einzeln, dann mehrere
aufeinander gelegt, zu Blechen bis zu einer Dicke von 0,1 mm. Noch
dünneres S. wird aus diesen Platten durch Schlagen unter
Hämmern auf die gleiche Weise wie das Blattgold (s.
Goldschlägerei) hergestellt. Nach einem neuen Verfahren wird
Zinn in einer flachen, 2,5 m langen eisernen Schale flüssig
gehalten; über dieser Schale befindet sich eine 2,5 m lange
Walze von 2 m Durchmesser, mit Leinwand überzogen. Diese Walze
wird in das Zinn gesenkt und einmal umgedreht, wodurch sie sich mit
einer dünnen Lage Zinn bedeckt, welche während einer
Rückdrehung der gehobenen Walzen abgewickelt und auf einen
polierten ebenen Stein gelegt wird. Auf diese Lage kommen noch 299
solche Blätter, die nun gemeinschaftlich von zehn Arbeitern
bis zur gewünschten Dicke geschlagen werden. S. dient
hauptsächlich zum Belegen der Spiegel und erhält für
diesen Zweck eine Dicke von 0,038-0,5 mm. S. zum Einwickeln von
Seife, Schokolade etc. ist 0,15-0,0077 mm dick. Auch bleihaltige
Zinnfolie wird vielfach dargestellt und zwar entweder aus
Legierungen oder aus Bleiplatten, die mit Zinn übergossen
wurden. Um farbige, glänzende Zinnfolie zu bereiten, wird S.
mit Baumwolle und Kreidepulver gereinigt, mit Gelatinelösung
überzogen, mit Berberis-, Lackmus-, Orseille- oder
Safranabkochung oder Anilinlösung gefärbt und nach dem
Trocknen mit Weingeistfirnis überzogen.
Stannum (lat.), Zinn,
Stanowoi, Gebirge, s. Sibirien, S. 927.
Stans (auch Stanz), Flecken im schweizer. Kantor
Unterwalden, Hauptort von Nidwalden, am Fuß des 1900 m hohen
Stanser Horns, mit (1880) 2210 Einw. und einem Denkmal Arnolds von
Winkelried.
231
Stansfield - Stapelia.
Hier 9. Sept. 1798 Gefecht zwischen den Nidwaldnern und den
Franzosen unter Schauenburg. Der Hafen des Orts, am
Vierwaldstätter See, ist Stansstad (s. Alpnach), mit 763
Einw.
Stansfield (spr. stännsfild), James, engl.
Staatsmann, geb. 1820 zu Halifax, studierte in London, wurde 1849
Barrister und trat 1859 für seine Geburtsstadt ins Unterhaus,
wo er sich dem linken Flügel der liberalen Partei
anschloß. 1863 wurde er zum Lord der Admiralität
ernannt, schied aber schon 1864 wieder aus der Regierung, bei der
sein intimes Verhältnis zu Mazzini Anstoß erregte.
Trotzdem konnten die folgenden liberalen Regierungen bei dem
Einfluß, den er im Unterhaus hatte, nicht umhin, ihn wieder
in ihre Mitte aufzunehmen: er war Unterstaatssekretär unter
Russell vom Februar bis Juni 1866 und Lord der Admiralität
unter Gladstone vom Dezember 1868 bis Oktober 1869 sowie
Sekretär des Schatzamtes unter demselben bis März 1871.
Darauf erhielt er das Präsidium des Armenamtes und im August
d. J. das Präsidium des neugegründeten
Local-government-board. 1874 trat er mit Gladstone zurück; bei
der Neubildung des liberalen Ministeriums im Frühjahr 1880
wurde S. übergangen.
Stante pede (lat.), stehenden Fußes, auf der
Stelle, flugs, stracks.
Stanton, Edwin M., nordamerikan. Staatsmann, geb. 1815 zu
Steubenville (Ohio), studierte die Rechte, wirkte als Advokat, seit
1857 in Washington, ward 1860 Generalstaatsanwalt, 1861 unter
Lincoln Kriegsminister, weil er als einer der Führer der
republikanischen Partei belohnt werden mußte, erwarb sich
zwar durch rastlose Thätigkeit um die Organisation und
Verpflegung des Heers während des Bürgerkriegs
Verdienste, stiftete aber durch Nepotismus und Einmischung in die
Kriegsoperationen auch Schaden, trat gegen Johnsons vermittelnde
Politik auf, ward deshalb abgesetzt, was den Staatsprozeß
gegen den Präsidenten zur Folge hatte, legte im Mai 1868 sein
Amt nieder, war Richter am obersten Gerichtshof und starb 23. Dez.
1869.
Stanze (ital.), eigentlich Wohnung, Zimmer; dann s. v. w.
Reimgebäude, Strophe; insbesondere das auch Oktave (ital.
Ottava rima) genannte epische Versmaß der Italiener, eine aus
acht fünffüßigen Jamben bestehende Strophe, in
welcher die Verse so verschlungen sind, daß der 1., 3. und
5., dann der 2., 4. und 6., endlich der 7. und 8. aufeinander
reimen und zwar ursprünglich nur mit weiblichem Reim,
während in neuerer Zeit männlicher mit weiblichem Reim
wechselt. Die Strophe findet sich bei den Italienern in allen
größern epischen Gedichten (Ariosts "Rasender Roland",
Tassos "Befreites Jerusalem") angewendet; auch Camoens hat seine
"Lusiaden", Byron seinen "Don Juan" in dieser Form gedichtet sowie
von neuern deutschen Dichtern E. Schulze seine "Bezauberte Rose",
Lingg seine "Völkerwanderung". Indessen eignet sich die S. im
Deutschen mehr zu Widmungsgedichten (z. B. in Goethes "Faust"), zu
Prologen, gedankenreichen Apostrophen u. dgl. als zu
größern epischen Gedichten, wo sie leicht monoton wird
und ermüdend wirkt. Diese Erkenntnis regte Wieland (im
"Oberon") zu einer freiern Behandlung derselben an, indem er die
Zahl der Versfüße beliebig zwischen vier, fünf und
sechs schwanken, die Reime aber ein- oder zweimal wiederkehren
ließ und dabei willkürlich verband. Außer Wieland
hat diese freiere Form, welche einen großen malerischen
Reichtum zu entfalten gestattet, auch Schiller bei seiner
Übersetzung des Vergil angewendet. Eine andre Abart der S. ist
die Spenserstanze, die Spenser in seiner "Feenkönigin" und
nach ihm Lord Byron in seinem "Childe Harold" zur Anwendung
brachte. Sie ist neunzeilig, die Reimpaarung derartig, daß
zuerst zwei Zeilen: die 1. und 3., dann vier: die 2., 4., 5. und
7., und zuletzt drei: die 6., 8. und 9., aufeinander reimen, und um
dem Ganzen einen wuchtigen Abschluß zu geben, hat der letzte
Vers stets einen Fuß mehr. - In der Kunstgeschichte
heißen Stanzen ("Zimmer") vorzugsweise die von Raffael und
seinen Schülern ausgemalten Räume des Vatikans in
Rom.
Stanzen, in der Technik Stempel aus Stahl oder Bronze zur
Verfertigung vertiefter Gegenstände aus Blech
(Eßlöffel, Dosendeckel, Ornamente etc.). Man stellt sie
durch Gravieren oder Gießen her und benutzt sie im Verein mit
Gegenstempeln, indem man das Blech durch Fall- oder Prägwerke
in die liegenden S. eintreibt. Die Gegenstempel werden aus weicherm
Metall (Kupfer, Hartblei etc.) in die S. gegossen oder in dieselben
eingeprägt.
Stanzer Thal, linksseitiges Nebenthal des Inn in
Nordtirol, Bezirkshauptmannschaft Landeck, von der Rosanna
durchströmt, heißt im obersten Teil Verwallthal und wird
von der Straße und Eisenbahn über den Arlberg
durchzogen. Den Namen trägt es vom Dorf Stanz bei Landeck (301
Einw.).
Stanzmaschine, s. Hobelmaschinen, S. 588.
Stapel, ein Haufe, eine Menge Dinge, besonders wenn sie
in einer gewissen Ordnung aufgesetzt sind; vorzüglich eine
Quantität gewisser trockner Waren, welche aufeinander
geschichtet ist, z. B. Holz, Tücher etc., besonders
Häute; Jahrmarkt, Messe, daher Stapelplatz, Ort oder Hafen mit
Warenniederlagen (vgl. Stapelgerechtigkeit). Im Schiffbau nennt man
S. in einer gewissen Ordnung aufeinander gelegte hölzerne
Balken, die entweder bei Luftzutritt aufbewahrt werden sollen, oder
mit deren Hilfe man eine ebene Plattform in einer gewissen
Höhe und Neigung über dem Terrain gewinnen will, auf
welcher ein neues Schiff erbaut wird. Wird ein fertiges Schiff ins
Wasser gelassen, so verläßt es den S., daher Stapellauf
(s. Ablauf).
Stapelartikel, solche Artikel, welche vornehmlich
Handelsgegenstand eines Platzes und infolgedessen hier in
größerer Menge aufgestapelt sind.
Stapelgerechtigkeit (Stapelrecht, Staffelrecht,
Stapelfreiheit), ein in ältern Zeiten gewissen Städten
bewilligtes Recht, wonach gewisse oder auch alle Waren, welche auf
Straßen versandt wurden, an denen ein Stapelplatz gelegen
war, in diesem abgeladen und daselbst eine gewisse Zeit
(Stapelzeit) über zum Verkauf ausgestellt werden mußten,
ehe man sie weiterbringen durfte.
Stapelholm, Landschaft in der preuß. Provinz
Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig, östlich von
Friedrichstadt, bildet einen Geestrücken zwischen
Flußmarschen an der Eider, mit den Pfarrdörfern
Süderstapel und Erfde mit (1885) 869 u. 1391 Einw.
Stapelia L. (Aaspflanze), Gattung aus der Familie der
Asklepiadaceen, kaktusartige, blattlose Gewächse mit
fleischigen, oft kantigen und an den Kanten gezähnelten
Stengeln und Ästen, großen, radförmigen
Blumenkronen, welche meist auf gelbem oder gelbgrünem Grund
schwarzpurpurn oder violett gefleckt oder marmoriert sind, und fast
cylindrischen Balgkapseln mit geschwänzten Samen. Die etwa 60
besonders in Südafrika heimischen Arten werden der Blüten
halber als Zierpflanzen in Gewächshäusern kultiviert; die
Blüten riechen indes höchst widerwärtig nach Aas. S.
Tafel "Kakteen".
232
Stapellauf - Star.
Stapellauf, s. Stapel
Stapelplatz, s. Stapel
Stapelrecht, s. v. w. Stapelgerechtigkeit.
Stapelstädte, in Schweden die Städte, welchen
das Recht verliehen ist, auf eignen Schiffen Waren ein- und
auszuführen.
Stapes (lat.), Steigbügel; in der Anatomie eins der
Gehörknöchelchen.
Staphylea L. (Pimpernuß), Gattung aus der Familie
der Sapindaceen, Sträucher mit gegenständigen, unpaarig
gefiederten Blättern, gipfelständigen, meist
überhängenden, weißlichen Blütentrauben und
häutiger, ein- oder wenigsamiger, aufgeblasener Kapsel. S.
pinnata L. (Klappernuß, Blasennuß, Paternosterbaum),
3-5 m hoch, mit fünf- bis siebenzählig gefiederten
Blättern, länglich elliptischen Blättchen,
rötlichweißen Blüten und hellbraunen,
ölreichen Samen mit großem Nabelfleck
(Ölnüßchen), in Gebirgswäldern Mitteleuropas
und Vorderasiens, wird als Zierstrauch angepflanzt. Das
weiße, feste Holz dient zu Drechslerarbeiten; die Samen sind
eßbar und geben ein gutes Öl. Auch S. colchica Stev.
(Hoibreghia formosa hort.), aus Transkaukasien, mit drei- bis
fünfzählig gefiederten Blättern und weißen
Blüten, und S. trifolia L., mit dreizähligen
Blättern, aus Nordamerika, sind Ziersträucher.
Staphyleaceen, dikotyle Pflanzengruppe, eine Unterfamilie
der Celastrineen (s. d.) bildend, von denen sie sich
hauptsächlich durch die Lage des Blütendiskus, die blasig
aufgetriebene Frucht und das Fehlen des Samenmantels
unterscheiden.
Staphylhämatom (griech.), Blutgeschwulst am
Zäpfchen, welche wahrscheinlich durch kleine Verletzungen beim
Essen, Räuspern etc. entsteht und ohne schlimme Bedeutung
ist.
Staphylinus, Staphylinidae, s. Kurzflügler.
Staphyloma (griech.), in der Augenheilkunde zwei
wesentlich verschiedene Zustände: 1) Das S. der Hornhaut ist
ein Auswuchs, der aus jungem Bindegewebe oder Narbenmasse besteht
und seinen Ursprung einer geschwürigen Hornhautentzündung
mit Vorfall der Iris verdankt. Dies S. wird mit dem Messer
abgetragen und ist auf diesem Weg heilbar. 2) Das S. der Sklera,
der harten weißen Haut, bedeutet eine Ausbuchtung derselben,
oft verbunden mit Verdünnung und zunehmender Transparenz,
welche entweder mehr allgemein ist, wie beim grünen Star (s.
Glaukom), oder auf den hintern Umfang beschränkt, wie bei der
Verlängerung des sagittalen Augendurchmessers kurzsichtiger
Augen (S. posticum), oder an mehrfachen Stellen
unregelmäßige Hervorwölbungen bedingen kann, die
ihren Ursprung Entzündungen der Aderhaut oder Iris verdanken.
Ist eine solche Ausstülpung einmal eingetreten, so können
korrigierende Brillen oder die Operation beim Glaukom die
Sehstörungen und die Vergrößerung das S. wohl
beseitigen, aber nicht das Übel selbst heilen.
Staphyloplastik (griech.), künstliche
Gaumenbildung.
Staphylorrhaphie, s. Gaumenspalte.
Stapß, Friedrich, bekannt durch seinen Mordversuch
gegen Napoleon I., geb. 14. März 1792 zu Naumburg, erlernte
die Kaufmannschaft und kam dann nach Leipzig in Stellung. Ein
erbitterter Gegner Napoleons, beschloß er, denselben zu
ermorden, und reiste zu diesem Zweck nach Wien und von da 13. Okt.
1809 nach Schönbrunn, wo jener Heerschau hielt. Der General
Rapp, dem das Benehmen S.', der den Kaiser zu sprechen verlangte,
verdächtig vorkam, ließ ihn festnehmen, und man fand bei
ihm ein großes Küchenmesser. S. gestand unerschrocken
seine Absicht und antwortete auf die Frage des Kaisers: "Wenn ich
Sie nun begnadige, wie werden Sie mir es danken?" mit den Worten:
"Ich werde darum nicht minder Sie töten". Er ward hierauf 17.
Okt. erschossen.
Star, die Herabsetzung oder gänzliche Aufhebung des
Sehvermögens eines oder beider Augen, sofern dieselbe auf
Anomalien der lichtempfindenden Elemente (schwarzer S.) oder auf
Trübung der Kristalllinse (grauer S.) beruht. Über den
sogen. grünen S. oder das Glaukom s. d. Bei dem schwarzen S.
unterscheidet man herkömmlich: Amblyopie, Stumpf- oder
Schwachsichtigkeit, und Amaurose (besser Anopsie), völlige
Blindheit. Beide kommen zu stande zum Teil in der Form von Hemiopie
durch Erkrankung der Netzhaut oder des Sehnervs an irgend einer
Stelle seines Verlaufs oder des Gehirns selbst. Liegt die erkrankte
Stelle hinter dem Eintritt des Sehnervs in die Netzhaut, so
läßt sich die Ursache des schwarzen Stars durch den
Augenspiegel nicht erkennen. In den meisten Fällen hat der
schwarze S. einen langsamen Verlauf, entsteht unmerklich, nimmt
ganz allmählich zu und geht schließlich in
vollständige Erblindung über; doch kommt es auch vor,
daß er auf einer gewissen Stufe der Entwickelung stehen
bleibt oder selbst rückgängig wird. Selten bildet er sich
in sehr kurzer Zeit aus oder tritt selbst plötzlich nach Art
eines Schlaganfalls auf, namentlich dann, wenn sich die Netzhaut
durch einen Bluterguß oder durch ein Entzündungsprodukt
von der Gefäßhaut des Auges abgelöst hat, oder wenn
Blutergüsse, schnell wachsende Geschwülste u. dgl. den
Ursprung des Sehnervs im Gehirn zerstört haben. Der schwarze
S. kommt bei beiden Geschlechtern und in jedem Alter, selbst
angeboren vor; doch ist er bei Männern häufiger als bei
Weibern und in dem Alter von 20-40 Jahren häufiger als im
Greisenalter, hier aber häufiger als im Kindesalter. Vielfach
ist erbliche Disposition vorhanden. Die Pupille pflegt erweitert
oder wenig beweglich oder auch ganz starr zu sein, selbst wenn
starkes Licht in das Auge fällt. Der Kranke hat einen stieren,
nichtssagenden Blick; er büßt überhaupt mehr oder
weniger die Herrschaft des Willens über die Bewegungen des
Auges ein. Die Augenlider sind in der Regel weit geöffnet, der
Augenlidschlag ist träge. Die Bewegungen eines an schwarzem S.
Leidenden sind unsicher, seine Haltung ist ängstlich. Das
wichtigste Symptom ist Schwachsichtigkeit. Jeder Versuch, kleinere
Objekte deutlich zu sehen und anhaltend zu fixieren, kostet
Anstrengung; das Auge ermüdet sehr schnell. Später geht
auch der letzte Lichtschein, das Vermögen, Hell und Dunkel zu
unterscheiden, verloren. Die meisten Fälle von schwarzem S.
sind unheilbar oder sehr schwer zu heilen. Ein frisch entstandener
Fall gibt eine bessere Prognose als ein solcher, der schon lange
Zeit bestanden hat. Der schwarze S., welcher infolge von
Sehnervenschwund, Netzhautablösung und von Zerstörungen
des Gehirns auftritt, gibt die geringste Aussicht auf Heilung. Am
ehesten lassen diejenigen Fälle eine Heilung zu, welche durch
konstitutionelle und dyskrasische Leiden, durch Gicht, Syphilis,
Nierenerkrankungen, Hysterie etc., sowie diejenigen, welche durch
übermäßigen Gebrauch narkotischer Mittel (z. B.
übermäßigen Genuß starker Zigarren, von
Alkohol) entstanden sind. Oft wird nur das eine Auge geheilt, das
andre nicht, oder der schwarze S. heilt nur auf einer Stelle der
Netzhaut; völlige Heilung beider Augen ist selten. Die
Behandlung ist je nach der Form des schwarzen Stars sehr
verschieden. Die
233
Star (Augenkrankheit) - Star (Vogel).
Funktionen des Körpers müssen durch eine angemessene
Lebensordnung geregelt, die Verrichtungen des Auges sorgfältig
überwacht, Anstrengungen desselben durchaus vermieden werden.
Oft wird ein längerer Aufenthalt im Dunkeln, das Tragen
dunkler Brillen etc. notwendig. Die spezielle Behandlung ist von
einem Augenarzt zu leiten.
Der graue S. (Cataracta, s. Tafel "Augenkrankheiten", Fig. 10 u.
11) besteht in einer Trübung im Bereich des Linsensystems, d.
h. der Linse selbst oder ihrer Kapsel, bez. beider, wodurch den
Lichtstrahlen der Durchgang zu der lichtempfindenden Netzhaut
verwehrt wird. Zuerst zeigt sich hinter der Pupille eine
unbedeutende Trübung, welche allmählich zunimmt; der
Kranke sieht wie durch ein trübes Glas, durch Nebel oder
Rauch. Nach und nach wird der vor dem Auge schwebende Nebel
dichter, und die Gegenstände erscheinen wie dunkle Schatten.
Die Pupille bewegt sich meist frei, nur bei sehr großem S.
verliert die Iris an Beweglichkeit und wird nach vorn
gedrängt. Nur nach Verletzungen des Auges entwickelt sich der
graue S. in wenig Tagen (Cataracta traumatica, s. Tafel
"Augenkrankheiten", Fig. 12), meist bedarf er zu seiner Ausbildung
Monate und Jahre. Nur Stare nach äußerer Verwundung
beschränken sich auf Ein Auge. Selten bleibt der S. auf einer
niedern Entwicklungsstufe stehen. Nach dem Sitz der Trübung
unterscheidet man den Kapselstar und den Linsenstar. Der Kapselstar
kommt viel seltener vor und erscheint als eine unsymmetrische,
grauweiße, undurchscheinende Trübung nahe hinter der
Iris. Der Linsenstar befällt am häufigsten alte Leute
(Altersstar, Cataracta senilis) infolge des Sinkens der
Ernährungsthätigkeit. Der Linsenstar ist bald ein
Kernstar, bald ein Rindenstar; bald ist sowohl Kern als Rinde
getrübt (totaler S.). Nach der Konsistenz der getrübten
Linsenmasse teilt man die Linsenstare ein in harte und weiche
Stare. Der harte S. ist von dunkler, bräunlicher Farbe,
betrifft meist den Kern der Linse; dieselbe ist oft knorpelartig
fest oder selbst in eine kalkartige oder steinige Masse (Cataracta
gypsea) umgewandelt. Beim weichen S., welcher unter allen
Starformen am häufigsten vorkommt, zeigt die Linse eine
verminderte Konsistenz. Hinsichtlich der Entwicklungsstufe nennt
man den S. reif, wenn die Trübung die ganze Linse einnimmt,
dagegen unreif, wenn die Entartung noch im Fortschreiten begriffen
ist und besonders die Linsenperipherie noch durchsichtige Stellen
besitzt, überreif, wenn die schon lange getrübten
Linsenmassen stellenweise oder ganz verhärtet und geschrumpft
sind. Die Disposition zum grauen S. ist bei dem männlichen
Geschlecht größer als bei dem weiblichen; Leute mit
blauer oder grauer Iris werden viel häufiger davon betroffen
als solche mit brauner Iris. Mitunter ist der graue S. angeboren
(Cataracta congenita), sehr selten entwickelt er sich vor dem 7.
Lebensjahr; von dieser Zeit an bis zum 60.-70. Lebensjahr wird er
allmählich immer häufiger. Der graue S. tritt oft nach
entzündlichen Augenkrankheiten auf und ist mit solchen
kompliziert. Bei einfachen, nicht komplizierten Staren bleibt
stets, auch wenn das Erkennen von Gegenständen längst
unmöglich geworden ist, die Fähigkeit, Hell und Dunkel zu
unterscheiden, z. B. eine vor dem Auge hin und her bewegte
Lampenflamme zu erkennen, erhalten. Das einzige Mittel, das
Sehvermögen wiederherzustellen, ist die Staroperation, deren
Zweck darin besteht, durch Beseitigung der kranken Linse den
Lichtstrahlen den Eintritt in das Innere des Auges wieder zu
eröffnen. Dies kann auf dreifachem Weg erreicht werden:
entweder indem man die getrübte Linse gänzlich und mit
einemmal aus dem Auge entfernt (Extraktion des Stars); oder durch
Lagenveränderung der Linse, indem man sie aus der Sehachse
entfernt und an einen solchen Ort schiebt, wo sie dem Einfallen der
Lichtstrahlen kein Hindernis in den Weg legt, ohne sie aus dem Auge
zu schaffen (Depression oder Reklination des Stars); oder durch
Zerstückeln und Zerschneiden, wodurch man den S. in einen
solchen Zustand versetzt, daß er aufgesaugt werden und also
von selbst verschwinden kann (Discision des Stars). Die Operation
gelingt bei der Vervollkommnung der modernen Technik unter 100
Fällen 94-96mal. Aber auch im günstigsten Fall ist
dieselbe nicht im stande, das Gesicht so vollkommen
wiederherzustellen, wie es vor der Erkrankung war; denn es fehlt ja
im Auge die Linse, ohne welche sich keine scharfen Bilder auf der
Netzhaut bilden können, und mit der Linse fehlt auch das
Akkommodationsvermögen für verschiedene Entfernungen. Die
verloren gegangene Kristalllinse ersetzt man daher durch starke
(½-¼) Konvexlinsen, durch eine sogen. Starbrille, mit
deren Hilfe der Kranke dann meist wieder kleinste Schrift zu lesen
und die meisten Arbeiten zu verrichten im stande ist. Da aber der
Operierte auch das Akkommodationsvermögen verloren hat, so
muß er Brillen von verschiedener Brechungskraft gebrauchen,
je nachdem er nahe oder ferne Gegenstände sehen will. Nach der
Staroperation tritt oft von neuem wieder eine Trübung in der
hintern Augenkammer ein, welche man sekundärer Kapselstar,
Nachstar (s. Tafel "Augenkrankheiten", Fig. 13), nennt, und wodurch
das Sehvermögen wieder beschränkt oder ganz aufgehoben
wird. Der Nachstar entsteht dadurch, daß die bei der
Operation zurückgelassene hintere Linsenkapsel sich aufs neue
trübt; dieselbe wird dann entweder durch eine Nachoperation
ganz entfernt, oder auf ungefährliche Weise durch
Zerreißung (Discision des Nachstars) beseitigt. Eine
abermalige Trübung ist dann nicht mehr möglich. Vgl.
Magnus, Geschichte des grauen Stars (Leipz. 1876)
Star (Sturnus L.), Vogelgattung aus der Ordnung der
Sperlingsvögel und der Familie der Stare (Sturnidae),
mittelgroße, gedrungen gebaute Vögel mit kurzem Schwanz,
ziemlich langen Flügeln, in welchen die erste Schwinge
verkümmert, die zweite am längsten ist,
mittelmäßig langem, geradem, breit kegelförmigem
Schnabel, mittelhohen, ziemlich starken Füßen und langen
Zehen. Der gemeine S. (Strahl, Sprehe, Spreu, S. vulgaris L.), 22
cm lang, 37 cm breit, ist im Frühling schwarz, auf Schwingen
und Schwanz wegen der breiten, grauen Federränder lichter,
nach der Mauser und im Herbst weiß gepunktet, mit braunen
Augen, schwarzem Schnabel und rotbraunen Füßen, bewohnt
den größten Teil Europas, erscheint aber in den
Mittelmeerländern nur im Winter und geht höchstens bis
Nordafrika; bei uns weilt er von Februar oder März bis Oktober
und November. Er bevorzugt die Ebenen mit Auenwaldungen,
läßt sich aber auch in Gegenden, die er sonst nur auf
dem Zug berührt, durch Anbringung von Brutkasten etc. fesseln.
Dadurch hat ihn z. B. Lenz seit 1856 in Thüringen heimisch
gemacht. Durch sein munteres, heiteres Wesen ist er allgemein
beliebt; seine Stimme ist ein angenehmes Geschwätz, er besitzt
aber auch ein großes Nachahmungsvermögen und mischt die
verschiedensten Töne ein. Er nistet in Baumhöhlungen,
Mauerlöchern, am liebsten in Brutkästchen auf
Bäumen, Stangen, Hausgie-
234
Staraja-Russa - Starhemberg.
beln etc., und legt im April 5-6 lichtblaue Eier (s. Tafel "Eier
I", Fig. 57), welche vom Weibchen allein ausgebrütet werden.
Die ausgeschlüpften Jungen sind bald selbständig und
schweifen mit andern Nestlingen umher. Ist auch die zweite Brut
flügge, so vereinigen sich alle Stare und sammeln sich zu
großen Scharen in Wäldern sowie später (etwa Ende
August) im Röhricht der Gewässer. Die Alten kehren
zuletzt gegen Ende September noch einmal zu den Nistkasten
zurück, singen morgens und abends, ziehen aber nach den ersten
starken Frösten mit den Jungen in die Winterherberge. Der S.
nährt sich von Kerbtieren, Würmern und Schnecken und wird
durch massenhafte Vertilgung derselben sehr nützlich;
weidenden Rindern liest er Mücken und andre Insekten vom
Rücken ab. In Kirschpflanzungen und Gemüsegärten,
namentlich in Weinbergen richtet er zwar oft erheblichen Schaden
an, doch überwiegt sein Nutzen bei weitem. In der
Gefangenschaft wird er leicht zahm, lernt Lieder pfeifen und Worte
nachsprechen und dauert fast ein Menschenalter aus.
Staraja-Russa, Kreisstadt im russ. Gouvernement Nowgorod,
südlich vom Ilmensee, an der Polista und der Eisenbahn
S.-Nowgorod, mit Mönchskloster, 16 Kirchen, weiblichem
Progymnasium, Theater, Stadtbank, Findelhaus, mehreren Kasernen und
(1885) 13,537 Einw. S. besitzt bedeutende Salinen und ist in
neuerer Zeit als Solbad in Ruf gekommen.
Stara Planina, s. Balkan.
Starbuck, zum Manihikiarchipel der Südssee
gehörige, unbewohnte Insel, 3 qkm groß, wurde 1866
für englisches Eigentum erklärt.
Staremiasto (Alt-Sambor), Stadt in Galizien, am Dnjestr,
südwestlich von Sambor, Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und
eines Bezirksgerichts, mit (1880) 3482 Einw.
Stargard, 1) Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk
Stettin, Kreis Saatzig, an der Ihna, Knotenpunkt der Linien
Berlin-S., Posen-S. und S.-Zoppot der Preußischen Staatsbahn
wie der Eisenbahn S.-Küstrin, 36 m ü. M., hat 3
evangelische und eine kath. Kirche, ein Bethaus der Irvingianer,
eine Synagoge und (1885) mit der Garnison (ein Grenadierregiment
Nr. 9) 22,112 meist evang. Einwohner, welche Maschinen-,
Schuhwaren-, Lack-, Filzwaren-, Dachpappen-, Seifen-,
Bürsten-, Spiritus- und Zigarrenfabrikation, Bildhauerei,
Gerberei, Bierbrauerei, Feilenhauerei und Dampfschleiferei
betreiben. S. hat außerdem eine Wasser- und
Dampfmahlmühle, eine Dampfmolkerei, eine
Provinzialobstbaumschule und bedeutende Landwirtschaft. Der Handel,
unterstützt durch eine Reichsbanknebenstelle, ist besonders
lebhaft in Getreide, Vieh und Produkten, auch finden
alljährlich in S. ein Leinwandmarkt und zwölf besuchte
Vieh- und Pferdemärkte statt. S. hat ein Landgericht, ein
Landratsamt (für den Kreis Saatzig), ein Hauptsteueramt, eine
Landschaftsdepartements-Direktion, ein Gymnasium, ein
Realprogymnasium, ein Zentralgefängnis, ein Waisenhaus, 8
Hospitäler etc. S. erhielt 1253 Stadtrecht und ward dann die
Hauptstadt von Hinterpommern. Zum Landgerichtsbezirk S.
gehören die 14 Amtsgerichte zu Dramburg, Falkenburg, Gollnow,
Greifenberg i. P., Jakobshagen, Kallies, Labes, Massow, Naugard,
Nörenberg, Pyritz, Regenwalde, S. und Treptow a. R. Vgl.
Petrich, Stargarder Skizzenbuch (Starg. 1876). -
2) (Stargardt, Preußisch-S.) Kreisstadt im preuß.
Regierungsbezirk Danzig, an der Ferse und der Linie
Schneidemühl-Dirschau der Preußischen Staatsbahn, hat
eine evangelische und eine kath. Kirche, eine Synagoge, ein
Gymnasium, eine Präparandenanstalt, ein Amtsgericht, ein
Hauptsteueramt, Eisengießerei, Kupferschmiederei,
Schnupftabaks-, Möbel-, Spiritus- und Essigfabrikation, eine
Holzbearbeitungsanstalt, große Mühlen, Bierbrauerei und
(1885) mit der Garnison (2 Eskadrons Husaren Nr. 1) 6634 meist
kath. Einwohner. Vgl. Stadie, Geschichte der Stadt S. (Starg.
1864). -
3) (S. an der Linde) Stadt im Großherzogtum
Mecklenburg-Strelitz, an der Linie Berlin-Stralsund der
Preußischen Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, ein
Amtsgericht, ein Domanialamt, Furniertischlerei, Wollspinnerei,
Tuchmacherei, 2 Dampfschneidemühlen und (1885) 2200 evang.
Einwohner. Dabei auf steiler Höhe die alte Burg S. mit
Wartturm. Vgl. v. Örtzen, Geschichte der Burg S. (Neubrandenb.
1887). Nach S. wurde ehemals auch der Hauptteil des
Großherzogtums Mecklenburg-Strelitz benannt (s. Strelitz,
Herzogtum).
Starhemberg (Starchimberg, Storchenberg),
österreich., teils fürstliches, teils gräfliches
Geschlecht, stammt aus Oberösterreich, erhielt 1643 die
reichsgräfliche, 1765 die reichsfürstliche Würde und
blüht noch in einer fürstlichen Hauptlinie und einer
gräflichen Nebenlinie, erstere vertreten durch Camillo,
Fürsten von S., Mitglied des österreichischen
Herrenhauses, geb. 31. Juli 1835, letztere durch Stephan, Grafen
von S., geb. 25. Juni 1817. Vgl. Schwerdling, Geschichte des
uralten, teils fürstlichen, teils gräflichen Hauses S.
(Linz 1839). Die namhaftesten Sprößlinge des Geschlechts
sind:
1) Ernst Rüdiger, Graf von, geb. 12. Jan. 1638 zu Graz in
Steiermark, diente unter Montecuccoli gegen Türken und
Franzosen und machte sich besonders als Kommandant von Wien durch
die erfolgreiche Verteidigung der Stadt gegen die Türken vom
9. Juli bis 12. Sept. 1683 berühmt. Kaiser Leopold verlieh ihm
hierfür den Feldmarschallsstab, die Würde eines Staats-
und Konferenzministers und das Recht, den Stephansturm in seinem
Wappen zu führen. S. folgte dann dem König Johann
Sobieski als Kommandierender der Infanterie nach Ungarn, ward aber
1686 bei Ofen so schwer verwundet, daß er sein Kommando
niederlegen mußte, und lebte fortan als Präsident des
Hofkriegsrats (seit 1691) zu Wien, vorzugsweise mit der
Organisation des österreichischen Heers beschäftigt. Er
starb 4. Juni 1701. Sein Leben beschrieb Graf Thürheim (Wien
1882).
2) Guido, Graf von, geb. 1657, kämpfte während der
Belagerung Wiens 1683 mit Auszeichnung als Adjutant des vorigen,
seines Vetters, folgte nach dem Entsatz Wiens dem Heer nach Ungarn
und that sich auch dort vielfach, unter anderm 1686 dei der
Belagerung von Ofen, 1687 bei Mohács und bei der
Erstürmung Belgrads (6. Sept. 1688) sowie in den Schlachten
bei Slankamen (19. Aug. 1691) und Zenta (11. Sept. 1697), hervor.
Nach dem Ausbruch
235
Staring - Stärke.
des spanischen Erbfolgekriegs ging er mit dem Prinzen Eugen nach
Italien, führte hier 1703 an dessen Stelle den Oberbefehl und
wußte die versuchte Vereinigung der Franzosen und Bayern in
Tirol zu verhindern. 1708 übernahm er als Feldmarschall das
Kommando der in Spanien kämpfenden österreichischen Armee
und führte trotz der geringen ihm zu Gebote stehenden
Streitkräfte den kleinen Krieg glücklich. 1710 zog er
nach den Siegen bei Almenara und Saragossa in Madrid ein, ward aber
durch Mangel und die Teilnahmlosigkeit des spanischen Volkes an der
Sache Karls bald zum Rückzug nach Barcelona genötigt. Als
Karl nach Josephs Tod in die österreichischen Erblande
zurückgekehrt war, blieb S. als Vizekönig in Barcelona
zurück, konnte sich aber trotz seiner genialen Taktik und
seines Mutes, der ihm den spanischen Beinamen el gran capitan
verschaffte, aus Mangel an Unterstützung daselbst nicht halten
und ließ sich infolge des Neutralitätstraktats vom 14.
Mai 1713 mit den Resten seiner Truppen auf englischen Schiffen nach
Genua übersetzen. Er lebte seitdem in Wien. Während des
Türkenkriegs von 1716 bis 1718 übernahm er in Abwesenheit
des Prinzen Eugen das Präsidium des Hofkriegsrats. Er starb 7.
März 1737 als Gouverneur von Slawonien. Sein Leben beschrieb
Arneth (Wien 1853).
Staring, Antony Winand Christiaan, holländ. Dichter,
geb. 24. Jan. 1767 zu Gendringen, studierte die Rechte in Harderwyk
und Göttingen und wohnte seitdem auf seinem Landgut
Wildenborch bei Zütphen, wo er 18. Aug. 1840 starb. S. hat nur
einen Band Novellen und vier kleine Bände Gedichte geschrieben
(hrsg. von Nik. Beets, 4. Aufl. 1883), welche erst nach seinem Tod
nach Verdienst geschätzt wurden und sich durch
Ursprünglichkeit, Kernhaftigkeit und einen gesunden Humor
auszeichnen.
Stariza, Kreisstadt im russ. Gouvernement Twer, an der
Wolga, die hier den Fluß S. aufnimmt, und an der Eisenbahn
Ostaschkow-Rshew, mit (1885) 4709 Einw., welche starken
Getreidehandel auf der Wolga und den Kanälen nach Petersburg
treiben,
Stark (Starck), 1) Johann Friedrich, luther. asketischer
Schriftsteller, geb. 10. Okt. 1680 zu Hildesheim, wirkte als
Prediger nacheinander in Sachsenhausen und Frankfurt a. M., wo er
17. Juli 1756 als Konsistorialrat starb. Außer vielen
geistlichen Liedern schrieb er einige bis auf den heutigen Tag
vielgebrauchte Gebetbücher, so namentlich: "Tägliches
Handbuch" (Frankf. 1727).
2) Johann August, Freiherr von, bekannt als Kryptokatholik, geb.
29. Okt. 1741 zu Schwerin, war zuerst Lehrer in Petersburg,
besuchte 1763 England und ward 1765 in Paris Interpret der
morgenländischen Handschriften an der königlichen
Bibliothek und, heimgekehrt, Konrektor in Wismar. Nach einer
zweiten Reise nach Petersburg übernahm er 1769 eine Professur
der morgenländischen Sprachen zu Königsberg und wurde
hier 1770 Hofprediger, 1772 ordentlicher Professor der Theologie
und 1776 Oberhofprediger, ging 1777 als Professor an das Gymnasium
nach Mitau und 1781 als Oberhofprediger und Konsistorialrat nach
Darmstadt. 1786 beschuldigten ihn Biester und Nicolai
öffentlich, daß er Kryptokatholik, Priester und Jesuit
sei. S. vermochte sich in der Schrift "Über
Kryptokatholizismus, Proselytenmacherei, Jesuitismus, geheime
Gesellschaften etc." (Frankf. 1787, 2 Bde.; Nachtrag 1788) nicht
vollständig zu rechtfertigen, und sein anonymes Buch "Theoduls
Gastmahl, oder über die Vereinigung der verschiedenen
christlichen Religionssocietäten" (das. 1809, 7. Aufl. 1828)
gab jenem Verdacht nur neue Nahrung. Gleichwohl ward er vom
Großherzog von Hessen 1811 in den Freiherrenstand erhoben; er
starb 3. März 1816. Nach seinem Tod soll man in seinem Haus
ein zum Messehalten eingerichtetes Zimmer gefunden haben, und es
wird behauptet, daß er schon 1766 in Paris förmlich zur
katholischen Kirche übergetreten sei.
3) Karl Bernhard, Archäolog, geb. 2. Okt. 1824 zu Jena,
Sohn des als Professor der Pathologie bekannten Geheimen Hofrats S.
(gest. 1845), studierte in seiner Vaterstadt und in Leipzig
Philologie, wandte sich dann vorzugsweise der Archäologie zu
und unternahm 1847 eine Reise nach Italien. Seit 1848 in Jena erst
als Privatdozent, dann als außerordentlicher Professor
thätig, folgte er 1855 einem Ruf als Professor der
Archäologie nach Heidelberg, wo er 12. Okt. 1878 starb. Er
schrieb: "Kunst und Schule" (Jena 1848); "Forschungen zur
Geschichte des hellenistischen Orients: Gaza und die
philistäische Küste" (das. 1852); "Archäologische
Studien" (Wetzl. 1852) und als Ergebnis einer Reise durch
Frankreich und Belgien "Städteleben, Kunst und Altertum in
Frankreich" (Jena 1855); "Niobe und die Niobiden" (Leipz.1863);
"Gigantomachie auf antiken Reliefs und der Tempel des Jupiter
tonans in Rom" (Heidelb. 1869); "Handbuch der Archäologie der
Kunst" (Leipz. 1878, Bd. 1, die Systematik der Archäologie und
eine Geschichte der archäologischen Studien enthaltend);
kleinere Schriften über Creuzer, Winckelmann, das Heidelberger
Schloß u. a. Auch bearbeitete er die zweite Auflage des
dritten Teils von Hermanns "Lehrbuch der griechischen
Antiquitäten" (Privataltertümer, Leipz. 1870). Eine neue
Reise nach dem griechischen Orient gab Stoff zu einer Reihe von
Berichten, die er später in dem Werk "Nach dem griechischen
Orient" (Heidelb. 1874) verarbeitete. Vgl. W. Frommel, Karl Bernh.
Stark (Berl. 1880).
4) Ludwig, Musikpädagog, geb. 19. Juni 1831 zu
München, studierte daselbst Philologie, widmete sich jedoch
dann unter Ignaz Lachners Beistand der Musik und konnte bald mit
Erfolg als Komponist von Ouvertüren, Zwischenaktsmusiken etc.
am Hoftheater debütieren. Die Bekanntschaft mit Siegm. Lebert
(s. d.) führte S. an die von jenem gegründete Stuttgarter
Musikschule als Lehrer der Theorie und Geschichte der Musik; als
solcher erhielt er 1868 den Professortitel, 1873 den Doktorgrad von
der Universität Tübingen sowie andre Auszeichnungen. Er
starb 22. März 1884 in Stuttgart. Von Starks mit Lebert
gemeinschaftlich herausgegebenen Unterrichtswerken ist außer
der berühmt gewordenen "Klavierschule" (s. Lebert) noch die
"Deutsche Liederschule" zu erwähnen. Ferner erschienen von ihm
ein "instruktives" u. "Solfeggien-Album", eine weitverbreitete
Chorsammlung: "Stimmen der Heimat", eine große, mit A. und C.
Kißner gemeinschaftlich bearbeitete Sammlung keltischer
Volksweisen in verschiedenen Serien ("Burns-Album" etc.), eine
"Elementar- und Chorgesangschule" (mit Faißt, Stuttg.
1880-83, 2 Tle.), Klaviertransskriptionen etc. und eine Bearbeitung
der Klavierwerke Händels, Bachs, Mozarts; endlich auch
zahlreiche Originalkompositionen für Gesang, Klavier und andre
Instrumente und eine Auswahl seiner Tagebuchblätter unter dem
Titel: "Kunst und Welt" (Stuttg. 1884).
Stärke (Stärkemehl, Satzmehl, Kraftmehl,
Amylum), neben Protoplasma (s. d.) u. Chlorophyll (s. d.) der
wichtigste Inhaltsbestandteil der Pflanzenzelle, in welcher sie in
Form organisierter Körner (Fig. 1 u. 2) auftritt. Dieselben
besitzen eine sehr wech-
236
Stärke (natürliches Vorkommen, Chemisches;
Gewinnung).
selnde Größe und erscheinen kugelig, oval, linsen-
oder spindelförmig, mitunter, wie im Milchsaft der Euphorbien,
auch stabartig mit angeschwollenen Enden, in andern Fällen
durch gegenseitigen Druck polyedrisch. Nicht selten treten mehrere
Körner zu einem abgerundeten Ganzen zusammen (zusammengesetzte
Stärkekörner). Im Wasser liegende Stärkekörner
lassen eine deutliche Schichtung (Fig. 1a) erkennen, welche dadurch
hervorgerufen wird, daß um eine innere, weniger dichte
Partie, den sogen. Kern, Schichten von ungleicher Lichtbrechung
schalenartig gelagert sind; der Kern liegt nur bei kugeligen
Körnern genau im Mittelpunkt, meist ist er exzentrisch, und
die ihn umgebenden Schichten haben dem entsprechend ungleiche
Dicke. Die Schichtung wird durch verschiedenen Wassergehalt und
entsprechend verschiedene Lichtbrechung der Schichten verursacht,
weshalb auch trockne oder in absolutem Alkohol liegende Körner
ungeschichtet erscheinen. In polarisiertem Licht zeigen alle
Stärkekörner ein helles, vierarmiges Kreuz, dessen
Mittelpunkt mit dem Schichtungszentrum zusammenfällt, und
verhalten sich demnach so, als wenn sie aus einachsigen
Kristallnadeln zusammengesetzt wären. Mit Jodlösung
färben sich je nach Konzentration derselben die
Stärkekörner mit wenigen Ausnahmen indigoblau bis
schwarz, eine Reaktion, durch welche sich auch sehr geringe
Stärkemengen in Gewebeteilen nachweisen lassen. In kaltem
Wasser sind die Körner unlöslich, quellen aber in warmem
Wasser auf und lösen sich zuletzt beim Kochen auf. Nach
Einwirkung von Speichel oder von verdünnten Säuren bleibt
ein substanzärmeres Stärkeskelett zurück, das sich
mit Jod nicht mehr blau, sondern violett oder gelb färbt, so
daß die Annahme zweier verschiedener Substanzen (von
Nägeli als Granulose und Cellulose bezeichnet) naheliegt;
jedoch scheint die Annahme einer unter diesen Umständen
eintretenden Umwandlung der S. in Amylodextrin wahrscheinlicher.
Die S. tritt in den verschiedenartigsten Geweben aller Pflanzen mit
Ausnahme der Pilze und einiger Algen (Diatomeen und Florideen) auf;
bei letztern wird sie jedoch durch eine ähnliche Substanz
(Florideenstärke) vertreten, welche sich mit Jod gelb oder
braun färbt und direkt aus dem Zellplasma hervorgeht. Auch im
Zellinhalt von Euglena kommen stärkeähnliche, mit Jod
jedoch sich nicht färbende Körner (Paramylon) vor.
Endlich tritt in den Epidermiszellen einiger höherer Pflanzen
eine mit Jod sich blau oder rötlich färbende Substanz in
gelöster Form (lösliche S.) auf. In allen übrigen
Fällen ist das Auftreten der S. in der beschriebenen
Körnerform die Regel. Sehr reich an S. sind die als
Stoffmagazine dienenden Gewebe der Samen, Knollen, Zwiebeln und
Rhizome sowie die Markstrahlen und das Holzparenchym im
Holzkörper der Bäume. Diese Reservestärke
unterscheidet sich durch ihre Großkörnigkeit von der
feinkörnigen, im assimilierenden Gewebe auftretenden S. (s.
Ernährung der Pflanzen). Die Bildung der S. erfolgt entweder
innerhalb der Chlorophyllkörner und andrer
Farbstoffkörper, oder sie entsteht aus farblosen
Plasmakörnern, den Leukoplasten oder Stärkebildnern. Die
letztern treten besonders in solchen chlorophyllfreien Geweben auf,
in welchen die Assimilationsprodukte in Reservestärke
übergeführt werden, wie in vielen stärkemehlhaltigen
Knollen; in diesen werden die kleinen Stärkekörner von
den Leukoplasten fast ganz eingehüllt, während letztere
den großen, exzentrisch gebauten Stärkekörnern nur
einseitig aufsitzen. Bei vielen Chlorophyllalgen, z. B. bei
Spirogyra, treten die Stärkemehlkörner an besondern
Bildungsherden im Umkreis von plasmatischen Kernen (Pyrenoiden)
auf. Das Wachstum der anfangs ganz winzigen Stärkekörner
erfolgt durch Einlagerung neuer Stärkemoleküle zwischen
die schon vorhandenen (Intussuszeption), während die
zusammengesetzten Stärkekörner sich durch
nachträgliche Verschmelzung und Umlagerung mit neuen Schichten
bilden. Die Auflösung der S. im Innern der Pflanzenzelle kommt
vorzugsweise durch Einwirkung von Fermenten zu stande, welche der
Diastase des keimenden Getreidekorns ähnlich sind. Im Leben
der Pflanze liefert die S. das Material für den Aufbau der
Zellwand. - Auch in chemischer Beziehung steht das Stärkemehl
(C6H10O5) in naher Verwandtschaft zu andern Kohlehydraten, wie der
Cellulose, den Zuckerarten, dem Dextrin u. a. Die Umwandlung in
Dextrin und Zucker erfolgt besonders leicht durch Behandlung der S.
mit verdünnten Säuren, Diastase, Speichel, Hefe und
andern Fermenten. Bei 160° geht die S. in Dextrin über,
mit konzentrierter Salpetersäure bildet sie explosives
Nitroamylum (Xyloidin), mit verdünnter Salpetersäure
gekocht, Oxalsäure. Beim Erhitzen mit Wasser quillt die S. je
nach der Abstammung bei 47-57°, die Schichten platzen, und bei
55-87° (Kartoffelstärke bei 62,5°, Weizenstärke
bei 67,5°) entsteht Kleister, welcher je nach der
Stärkesorte verschiedenes Steifungsvermögen besitzt
(Maisstärkekleister größeres als
Weizenstärkekleister, dieser größeres als
Kartoffelstärkekleister) und sich mehr oder weniger leicht
unter Säuerung zersetzt.
Man gewinnt S. aus zahlreichen, sehr verschiedenen Pflanzen, von
denen Weizen, Kartoffeln, Reis (Bruchreis aus den
Reisschälfabriken) und Mais befonders wichtig sind. Wichtige
Objekte des Handels sind außerdem: Sago, Marantastärke
(Arrowroot), brasilische Maniokstärke, ostindische
Kurkumastärke und Kannastärke, letztere beiden ebenfalls
als Arrowroot im Handel. Zur Darstellung der Kartoffelstärke
werden die Kartoffeln, welche etwa 75 Proz. Wasser, 21 Proz. S. und
4 Proz. andre Substanzen enthalten, auf schnell rotierenden
Cylindern, die mit Sägezähnen besetzt sind, unter
Zufluß von Wasser möglichst fein zerrieben, worauf man
den Brei, in welchem die Zellen möglichst vollständig
zerrissen, die Stärkekörner also bloßgelegt sein
sollen, aus einem Metallsieb, auf welchem ein Paar Bürsten
langsam rotieren, unter Zufluß von Wasser auswäscht. Bei
größerm Betrieb benutzt man kontinuierlich wirkende
Apparate, bei denen der Brei durch eine Kette allmählich
über ein langes, geneigt liegendes Sieb transportiert und
dabei ausgewaschen und das
237
Stärke (Gewinnung aus Kartoffeln, Weizen, Reis, Mais).
auf den schon fast erschöpften Brei fließende Wasser,
welches also nur sehr wenig Stärkemehl aufnimmt, auch noch auf
frischen Brei geleitet wird. Der ausgewaschene Brei (Pülpe)
enthält 80-95 Proz. Wasser, in der Trockensubstanz aber noch
etwa 60 Proz. S. und dient als Viehfutter, auch zur
Stärkezucker-, Branntwein- und Papierbereitung; das
Waschwasser hat man zum Berieseln der Wiesen benutzt, doch gelang
es auch, die stickstoffhaltigen Bestandteile des
Kartoffelfruchtwassers für die Zwecke der Verfütterung zu
verwerten. Da die Pülpe noch sehr viel S. enthält, so
zerreibt man sie wohl zwischen Walzen, um alle Zellen zu
öffnen, und wäscht sie noch einmal aus. Nach einer andern
Methode schneidet man die Kartoffeln in Scheiben, befreit sie durch
Maceration in Wasser von ihrem Saft und schichtet sie mit
Reisigholz oder Horden zu Haufen, in welchen sie bei einer
Temperatur von 30-40° in etwa acht Tagen vollständig
verrotten und in eine lockere, breiartige Masse verwandelt werden,
aus welcher die S. leicht ausgewaschen werden kann.
Das von den Sieben abfließende Wasser enthält die
Saftbestandteile der Kartoffeln gelöst und S. und feine
Fasern, die durch das Sieb gegangen sind, suspendiert. Man
rührt es in Bottichen auf, läßt es kurze Zeit
stehen, damit Sand und kleine Steinchen zu Boden fallen
können, zieht es von diesen ab, läßt es durch ein
feines Sieb fließen, um gröbere Fasern
zurückzuhalten, und bringt es dann in einen Bottich, in
welchem sich die S. und auf derselben die Faser ablagert. Die obere
Schicht des Bodensatzes wird deshalb nach dem Ablassen des Wassers
entfernt und als Schlammstärke direkt verwertet oder weiter
gereinigt, indem man sie auf einem Schüttelsieb aus feiner
Seidengaze, durch deren Maschen die S., aber nicht die Fasern
hindurchgehen, mit viel Wasser auswäscht. Die Hauptmasse der
S. wird im Bottich wiederholt mit reinem Wasser angerührt und
nach jedesmaligem Absetzen von der obern unreinen S. befreit. Man
kann auch die rohe S. mit Wasser durch eine sehr schwach geneigte
Rinne fließen lassen, in deren oberm Teil sich die schwere
reine S. ablagert, während die leichtern Fasern von dem Wasser
weiter fortgeführt werden. Sehr häufig benutzt man auch
innen mit Barchent ausgekleidete Zentrifugalmaschinen, in welchen
sich die schwere S. zunächst an der senkrechten Wand der
schnell rotierenden Siebtrommel ablagert, während die leichte
Faser noch im Wasser suspendiert bleibt. Das Wasser aber entweicht
durch die Siebwand, und man kann schließlich die S. aus der
Zentrifugalmaschine in festen Blöcken herausheben, deren
innere Schicht die Faser bildet. Die feuchte (grüne) S.,
welche etwa 33-45 Proz. Wasser enthält, wird ohne weiteres auf
Dextrin und Traubenzucker verarbeitet, für alle andern Zwecke
aber auf Filterpressen oder auf Platten aus gebranntem Gips, die
begierig Wasser einsaugen, auch unter Anwendung der Luftpumpe
entwässert und bei einer Temperatur unter 60° getrocknet.
Man bringt sie in Brocken oder, zwischen Walzen zerdrückt und
gesiebt, als Mehl in den Handel. Bisweilen wird die feuchte S. mit
etwas Kleister angeknetet und durch eine durchlöcherte eiserne
Platte getrieben, worauf man die erhaltenen Stengel auf Horden
trocknet. Um einen gelblichen Ton der S. zu verdecken, setzt man
ihr vor dem letzten Waschen etwas Ultramarin zu.
Weizenstärke wird aus weißem, dünnhülsigem,
mehligem Weizen dargestellt. Derselbe enthält etwa 58-64 Proz.
S., außerdem namentlich etwa 10 Proz. Kleber und 3-4 Proz.
Zellstoff, welcher hauptsächlich die Hülsen des Korns
bildet. Die Eigenschaften des Klebers bedingen die Abweichungen der
Weizenstärkefabrikation von der Gewinnung der S. aus
Kartoffeln. Nach dem Halleschen oder Sauerverfahren weicht man den
Weizen in Wasser, zerquetscht ihn zwischen Walzen und
überläßt ihn, mit Wasser übergossen, der
Gärung, die durch Sauerwasser von einer frühern Operation
eingeleitet wird und namentlich Essig- und Milchsäure liefert,
in welcher sich der Kleber löst oder wenigstens seine
zähe Beschaffenheit so weit verliert, daß man nach 10-20
Tagen in einer siebartig durchlöcherten Waschtrommel die S.
abscheiden kann. Das aus der Trommel abfließende Wasser setzt
in einem Bottich zunächst S., dann eine innige Mischung von S.
mit Kleber und Hülsenteilchen (Schlichte, Schlammstärke),
zuletzt eine schlammige, vorwiegend aus Kleber bestehende Masse ab.
Diese Rohstärke wird ähnlich wie die Kartoffelstärke
gereinigt und dann getrocknet, wobei sie zu Pulver zerfällt
oder, wenn sie noch geringe Mengen Kleber enthält, die sogen.
Strahlenstärke liefert, die vom Publikum irrtümlich
für besonders rein gehalten wird. - Nach dem Elsässer
Verfahren wird der gequellte Weizen durch aufrechte Mühlsteine
unter starkem Wasserzufluß zerquetscht und sofort
ausgewaschen. Das abfließende Wasser enthält neben S.
viel Kleber und Hülsenteilchen und wird entweder der
Gärung überlassen und dann wie beim vorigen Verfahren
weiter verarbeitet, oder direkt in Zentrifugalmaschinen gebracht,
wo viel Kleber abgeschieden und eine Rohstärke erhalten wird,
die man durch Gärung etc. weiter reinigt. Die bei diesem
Verfahren erhaltenen Rückstände besitzen
beträchtlich höhern landwirtschaftlichen Wert als die bei
dem Halleschen Verfahren entstehenden; will man aber den Kleber
noch vorteilhafter verwerten, so macht man aus Weizenmehl einen
festen, zähen Teig und bearbeitet diesen nach etwa einer
Stunde in Stücken von 1kg in einem rinnenförmigen Trog
unter Zufluß von Wasser mit einer leicht kannelierten Walze.
Hierbei wird die S. aus dem Kleber ausgewaschen und fließt
mit dem Wasser ab, während der Kleber als zähe,
fadenziehende Masse zurückbleibt (vgl. Kleber).
Reis enthält 70-75 Proz. S. neben 7-9 Proz.
unlöslichen, eiweißartigen Stoffen, welche aber durch
Einweichen des Reises in ganz schwacher Natronlauge
großenteils gelöst werden. Man zerreibt den Reis alsdann
auf einer Mühle unter beständigem Zufluß schwacher
Lauge, behandelt den Brei in einem Bottich anhaltend mit Lauge und
Wasser, läßt kurze Zeit absetzen, damit sich
gröbere Teile zu Boden senken, und zieht das Wasser, in
welchem reine S. suspendiert ist, ab. Aus dem Bodensatz wird die S.
in einem rotierenden Siebcylinder durch Wasser ausgewaschen, worauf
man sie durch Behandeln mit Lauge und Abschlämmen vom Kleber
befreit. Die zuerst erhaltene reinere S. läßt man
absetzen, entfernt die obere unreine Schicht, behandelt das
übrige auf der Zentrifugalmaschine und trocknet die reine
S.
Mais weicht man vier- bis fünfmal je 24 Stunden in Wasser
von 35°, wäscht ihn und läßt ihn dann durch
zwei Mahlgänge gehen. Das Mehl fällt in eine mit Wasser
gefüllte Kufe mit Flügelrührer und gelangt aus
dieser auf Seidengewebe, welches nur die grobe Kleie
zurückhält. Die mit der S. beladenen, durch das Gewebe
hindurchgegangenen Wasser gelangen in Tröge, dann durch zwei
feine Gewebe und endlich auf wenig geneigte, 80-100 m lange
Schiefertafeln, auf welchen sich die S. ablagert. Das
abfließende, nur noch Spuren von S. enthaltende Wasser
über-
238
Stärkeglanz - Starnberg.
läßt man der Ruhe und preßt den Absatz zu
Kuchen, um ihn als Viehfutter zu verwenden. Die Behandlung mit
schwacher Natronlauge von 2-3° B. ist im nördlichen
Frankreich und in England gebräuchlich. Stärkere Laugen
würden einen Verlust an Eiweißstoffen verursachen. Da
zudem bei Anwendung von Natron sich ein übler Geruch bei der
Gärung entwickelt und dieses Verfahren auch fast keine
Vorzüge bietet, so ist die Behandlung mit reinem Wasser
vorzuziehen. Die S. des Maises ist unter dem Namen Maizena im
Handel. Auch aus Roßkastanien wird S. gewonnen, doch ist
dieselbe nur für technische Zwecke verwendbar, da ein
derselben anhaftender Bitterstoff durch Behandeln mit kohlensaurem
Natron kaum vollständig entfernt werden kann. Die Ausbeute
beträgt 19-20 Proz. Die S. des Handels enthält etwa 80-84
Proz. reine S., 14-18 Proz. Wasser und in den geringern Sorten bis
5 Proz. Kleber, 2,5 Faser und 1,3 Proz. Asche, während der
Aschengehalt in den besten Sorten nur 0,01 Proz. beträgt.
S. dient allgemein zur Appretur, zur Darstellung von Schlichte,
zum Steifen der Wäsche, zum Beizen von Baumwolle, zur
Färbung mit Anilinfarben, zum Leimen des Papiers, zum
Verdicken der Farben in der Zeugdruckerei, zu Kleister, zur
Darstellung von Dextrin (Stärkegummi) und Traubenzucker
(Stärkezucker, Stärkesirup), Nudeln, künstlichem
Sago, überhaupt als Nahrungsmittel (Kartoffelmehl, Kraftmehl
etc.). Die S. ist auch der wesentliche Bestandteil im Getreide und
in den Kartoffeln, aus welcher sich bei der Bierbrauerei und
Branntweinbrennerei, nachdem sie in Zucker und Dextrin
übergeführt worden, der Alkohol bildet. S. war bereits
den Alten bekannt, nach Dioskorides wurde sie amylon genannt, weil
sie nicht wie andre mehlartige Stoffe auf Mühlen gewonnen
wird. Nach Plinius wurde sie zuerst auf Chios aus Weizenmehl
dargestellt. Über die Fortschritte der Fabrikation im
Mittelalter weiß man wenig, nur so viel ist sicher, daß
die Holländer im 16. Jahrh. S. im großen Maßstab
darstellten und bedeutende Mengen exportierten. Die
Stärkeindustrie entwickelte sich vorwiegend als
landwirtschaftliches Gewerbe; mit einfachsten Vorrichtungen gewann
man zwar nur eine mäßige Ausbeute, doch genügte
dieselbe bei der Möglichkeit vorteilhafter Verwertung der
Abfälle, bis die Fortschritte in den eigentlichen
Stärkefabriken auch die Landwirtschaft zwangen, auf
höhere Ausbeute bedacht zu sein. Diese wurde namentlich durch
Vervollkommnung der Maschinen und Apparate erreicht, um welche sich
Fesca durch Einführung eigentümlich konstruierter
Zentrifugalmaschinen wesentliche Verdienste erwarb. In neuerer Zeit
hat die Reisstärke der Kartoffel- und Weizenstärke
namentlich für Zwecke der Appretur erfolgreich Konkurrenz
gemacht. Vgl. Nägeli, Die Stärkekörner (Zürich
1858); Derselbe, Beiträge zur nähern Kenntnis der
Stärkegruppe (Leipz. 1874); Schneider, Rationelle Fabrikation
der Kartoffelstärke (Berl. 1870); Wagner, Handbuch der
Stärkefabrikation (2. Aufl., Weim. 1884); Derselbe, Die
Stärkefabrikation (2. Ausg., Braunschw. 1886); Rehwald,
Stärkefabrikation (2. Aufl., Wien 1885).
Stärkeglanz, s. Glanzstärke.
Stärkegummi, s. Dextrin.
Starke Mann, der, s. Eckenberg.
Stärkemehl, s. Stärke.
Stärkemesser, s. Fäkulometer.
Stärken, s. Appretur.
Starkenbach (tschech. Jilemnice), Stadt im
nördlichen Böhmen, Station der Österreichischen
Nordwestbahn, Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines
Bezirksgerichts, mit gräflich Harrachschem Schloß,
Webschule, bedeutender Leinwand- und Batistmanufaktur, Bierbrauerei
und (1880) 3418 Einw.
Starkenburg, Provinz des Großherzogtums Hessen,
umfaßt 3019 qkm (54,83 QM.) mit (1885) 402,378 Einw.
(darunter 116,974 Katholiken und 9516 Juden), hat Darmstadt zur
Hauptstadt und sieben Kreise:
Kreise QKilom. QMeilen Einwohner Einw. auf 1 qkm
Bensheim 391 7,10 48756 125
Darmstadt 298 5,41 84020 282
Dieburg 504 9,15 53002 105
Erbach 593 10,77 47540 80
Groß-Gerau 450 8,17 39805 88
Heppenheim 406 7,38 43916 108
Offenbach 377 6,85 85339 225
Stärkende Mittel (tonische Mittel, Tonica,
Roborantia), diejenigen Mittel, welche bei
Schwächezuständen die Thätigkeit und Ausdauer des
ganzen Körpers und der einzelnen Organe steigern; entweder
diätetisch-psychische: einfache, nicht erschlaffende
Lebensweise, Abhärtung, namentlich der Haut, frühes
Aufstehen, Waschungen und Bäder, frische Luft, Turnen,
Fechten, Schwimmen, Sorge für Gemütsruhe etc., oder
arzneiliche, die namentlich bei allgemeiner und örtlicher
Erschlaffung, Blutmangel, Blutzersetzung, schlechter Ernährung
am Platze sind (hier stehen obenan die Eisenmittel, denen sich die
Mineralsäuren, China, Ergotin und die bittern Mittel
anreihen), oder dynamische, wie die Anwendung der Elektrizität
bei Schwäche und Erkrankungen des Muskel- und
Nervensystems.
Stärkescheide (Stärkering, Stärkeschicht),
in der Pflanzenanatomie eine stärkeführende Zellschicht,
welche den Gefäßbündelkreis oder die einzelnen
Gefäßbündel im Stengel und im Blatt umgibt.
Stärkesirup, s. Traubenzucker.
Stärkerer, s. v. w. Traubenzucker.
Stärkmehl, s. Stärke.
Stärlinge (Icteridae), Familie aus der Ordnung der
Sperlingsvögel (s. d.).
Starnberg (Starenberg), Dorf im bayr. Regierungsbezirk
Oberbayern, Bezirksamt München II, am Nordende des danach
benannten Sees und an der Linie München-Peißenberg der
Bayrischen Staatsbahn, hat eine kath. Kirche, ein königliches
Schloß, ein Amtsgericht, ein Forstamt und (1885) 1745 Einw.
Der Starnberger See (auch Würmsee genannt) liegt 584 m ü.
M., ist 21 km lang, bis 5 km breit und 245 m tief. Sein
Abfluß ist die Würm, welche den See unweit S.
verläßt und in die Ammer mündet. Der See ist reich
an trefflichen Fischen (Lachse, Welse, Karpfen, Hechte etc.). Seine
amphitheatralisch aufsteigenden Ufer sind mit Dörfern,
Landhäusern, Schlössern, Kirchen und Gasthäusern
besetzt; im Süden bilden die Alpen (Zugspitze, Benediktenwand,
Karwändelgebirge) einen großartigen Hintergrund.
Bemerkenswert sind außer dem 1541-85 erbauten
Bergschloß S.: das königliche Jagdschloß Berg (s.
d.), das Schloß Possenhofen (s. d.), in dessen Nähe die
liebliche Insel Wörth liegt, das Schlößchen Leoni,
Bad Unterschäftlarn im NO., Bad Petersbrunn am Ausfluß
der Würm, endlich Schloß Leutstetten am Beginn des
romantischen Mühlthals. Der See wird von Dampfschiffen
befahren. Vgl. Horst, Der Starnberger See, eine Wanderung
(Münch. 1877); Schab, Die Pfahlbauten im Würmsee (das.
1877); Lidl, Wanderungen (Landsb. 1878).
239
Starobielsk - Starrsucht.
Starobielsk, Kreisstadt im russ. Gouvernement Charkow, am
Aidar, mit 4 Kirchen, Progymnasium, Talgsiedereien, Getreidehandel
und (1885) 8270 Einw.
Starobradzen, Sekte, s. Raskolniken.
Starodub, Kreisstadt im russ. Gouvernement Tschernigow,
mit 15 Kirchen, einer hebräischen Kronschule, vielen
Gärten, Überresten alter Befestigungen, Handel mit
Getreide und Hanf und (1885) 24,388 Einw.; gehört seit 1686 zu
Rußland.
Staro-Konstantinow, Kreisstadt im russ. Gouvernement
Wolhynien, hat 4 griechisch-russische, 2 kath. Kirchen, 2
Synagogen, bedeutenden Getreidehandel nach Odessa und
Österreich, Ausfuhr von Schweinen nach Polen und
Preußen, von Rindern, Pferden und Schafen nach
Österreich und (1885) 19,025 Einw. Das frühere
Dominikanerkloster (jetzt Gefängnis und Krankenhaus) diente
ehedem als Festung.
Starosten (slaw., "Älteste", Capitanei), in Polen
früher Edelleute, die eins der königlichen Güter
(Starosteien) zum Lehen und damit zumeist auch die Gerichtsbarkeit
in einem gewissen Umfang erhalten hatten (Starosteigerichte). Beim
Ableben des derzeitigen Inhabers durften diese Starosteien nicht
wieder eingezogen, sondern mußten an einen andern verliehen
werden. In Sibirien werden die Vorsteher eines Dorfs S. genannt. In
Böhmen ist Starosta der Titel der Bürgermeister, auch
Bezeichnung von Vereinsvorständen.
Starowertzi, Sekte, s. Raskolniken.
Starrkrampf (Tetanus und Trismus), eine Krankheit, welche
darin sich äußert, daß auf geringe Erregungen
entweder nur gewisse Muskelgruppen, z. B. die Kaumuskeln beim
Trismus (Mundsperre), die Nackenmuskeln beim Opisthotonus
(Genickkrampf), oder daß die gesamte Muskulatur des
Körpers in den Zustand stärkster Zusammenziehung
gerät. Später reicht der geringste Anlaß, eine
Erschütterung, das Klappen einer Thür hin, um einen S.
auszulösen. Fast immer wird zuerst der Kopf durch starre
Kontraktionen der Rückenmuskeln fixiert und
rückwärts gezogen. Vom Nacken aus verbreitet sich der
Krampf über die Rückenmuskeln, der ganze Körper wird
dadurch bogenförmig rückwärts gekrümmt. Aber
auch die Bauch- und Brustmuskeln beteiligen sich an dem S., deshalb
ist der Unterleib eingezogen und bretthart. Die kontrahierten
Muskeln bleiben während des ganzen Verlaufs der Krankheit
gespannt; sie sind dabei hart wie Stein und der Sitz furchtbarer
Schmerzen, welche denjenigen beim Wadenkrampf ähnlich sind.
Die Krankheit ist um so entsetzlicher, als der Kranke meist bis zum
Tode das volle Bewußtsein seiner furchtbaren Leiden
behält. Er leidet Hunger und Durst, weil er nicht schlingen
kann; der Schlaf fehlt, die Atmung ist erschwert, und die
gestörte Respiration und die Erstickungszufälle sind es
auch, welche den Kranken meist schon nach wenigen Tagen
hinwegraffen. Der S. entsteht durch Vergiftungen, von welchen
diejenige mit Strychnin am besten erforscht ist. Neuere
Untersuchungen machen es wahrscheinlich, daß die alte
Einteilung in rheumatischen und traumatischen S. hinfällig
sei, daß vielmehr alle Fälle von kleinen Wunden
ausgehen, in welchen eine Giftbildung (Briegers Tetanin und
Tetanotoxin) durch Bakterien vor sich geht. Da die Wunden meistens
klein und unbedeutend sind, so hat man sie früher nicht
beachtet und den S. als eine Erkältungskrankheit gedeutet;
für zahlreiche Fälle von S. nach Fußverletzungen,
nach dem Einreißen von Splittern unter einen Fingernagel,
für den S. der Neugebornen, welcher von der Nabelwunde
ausgeht, sind indessen Bakterien (Tetanusbacillen) nachgewiesen
worden, welche auch in Nährflüssigkeiten ein Gift
hervorbringen, welches Tetanus bei Tieren erzeugt. Diese Bacillen
kommen im Erdboden vor, woraus sich die Gefährlichkeit kleiner
Fußwunden namentlich bei barfuß gehenden Personen
erklärt. Die Behandlung gewährt nur Aussicht, wenn
frühzeitig die Wunde ausgeschnitten oder das Glied amputiert
wird; gegen den S. selbst wendet man Morphium an, um das Leiden zu
lindern.
S. kommt auch bei den Haustieren und besonders häufig bei
Pferden vor. Gewöhnlich entwickelt sich das Leiden schnell,
aber ohne Temperaturerhöhung. Die Pferde gehen steif, mit
gestrecktem Kopf; die Muskeln sind gespannt, und oft bekunden die
Tiere eine krankhafte Reizbarkeit. Die Schneidezähne sind mehr
oder weniger fest aufeinander geklemmt, so daß die Tiere wohl
noch Wasser trinken, aber keine festen Nahrungsmittel verzehren
können. Nach diesem Symptom wird der S. auch Maulsperre
(Trismus) genannt. Mehr als die Hälfte der am S. erkrankten
Tiere geht zu Grunde. Bei günstigem Verlauf lassen die
Symptome am 10.-15. Krankheitstag allmählich nach; aber die
Rekonvaleszenz erstreckt sich auf 4-6 Wochen. Mit Arzneimitteln
kann beim S. nicht viel geholfen werden. Mehr empfiehlt sich
zweckmäßige Pflege und Vermeidung jeder Aufregung der
kranken Tiere.
Starrsucht (Katalepsie), eine eigentümliche
Krankheit der Bewegungsnerven, bez. des Rückenmarks, welche in
einzelnen Anfällen auftritt. Während eines kataleptischen
Anfalls verharren die Glieder in der Stellung, in welche sie der
Kranke vor dem Anfall durch seinen Willen gebracht hat, oder in der
Stellung, in welche sie während des Anfalls durch fremde Hand
gebracht werden. Sie sinken weder durch ihre eigne Schwere herab,
noch können sie durch den Willen des Kranken in eine andre
Stellung gebracht werden. Es ist wahrscheinlich, daß bei der
S. alle Bewegungsnerven sich in einem Zustand mittlerer Erregung
befinden, und daß infolgedessen alle Muskeln bis zu dem Grad
kontrahiert sind, daß sie der Schwere der Glieder Widerstand
zu leisten vermögen. Kataleptische Erscheinungen treten bei
gewissen Geisteskranken, bei Hysterischen und neben manchen
Krampfformen, sehr selten dagegen selbständig bei sonst
gesunden Individuen auf. Gelegenheitsursachen zum Ausbruch der S.
sind namentlich starke Gemütsbewegungen oder auch diejenigen
Nervenreizungen, welche den magnetischen Schlaf (s. Hypnotismus)
hervorbringen. Als Vorboten der Anfälle von S. sind
Kopfschmerz, Schwindel, Ohrenklingen, unruhiger Schlaf, große
Reizbarkeit etc. zu nennen. Der Anfall selbst tritt plötzlich
ein; die Kranken bleiben unbeweglich wie eine Statue in der
Stellung oder Lage, in welcher sie sich gerade befinden, wenn sie
der Anfall überrascht. Entweder ist während des Anfalls
das Bewußtsein und damit die Empfindlichkeit gegen
äußere Reize vollständig aufgehoben, oder das
Bewußtsein ist vorhanden, äußere Reize werden
empfunden, aber die Kranken sind nicht im stande, durch Worte oder
Bewegungen Zeichen ihres Bewußtseins zu geben. Die
Atmungsbewegungen, der Herz- und Pulsschlag sind zuweilen so
schwach, daß man sie kaum wahrnimmt. Ein solcher Anfall
dauert meist nur wenige Minuten, selten mehrere Stunden oder Tage.
Die Kranken gähnen und seufzen, wenn der Anfall
vorübergeht, und machen ganz den Eindruck eines Menschen, der
aus einem tiefen Schlaf erwacht. Geht der Anfall schnell
vorüber, und ist während des-
240
Stars and stripes - Staßfurt.
selben das Bewußtsein erloschen gewesen, so wissen die
Kranken oft gar nicht, daß etwas Ungewöhnliches mit
ihnen vorgegangen ist. In andern Fällen bleiben die Kranken
nach dem Anfall für kurze Zeit angegriffen, schwindlig und
klagen über Eingenommenheit des Kopfes. Oft tritt nur ein
Anfall ein, selten folgen sich in kurzen oder langen
Zwischenräumen mehrere Anfälle. Die S. geht fast immer
nach längerm oder kürzerm Bestand in Genesung über.
Dauert der Anfall länger an, so kann es nötig werden, dem
Kranken künstlich (durch die Schlundsonde) Nahrung
einzuführen. Vgl. Kataplexie.
Stars and stripes (engl., spr. stars änd streips),
in Nordamerika beliebte Bezeichnung für das "Sternenbanner"
der Vereinigten Staaten von Nordamerika.
Starstein, s. Holz, fossiles.
Start (engl.), der Anfang des Wettrennens, geschieht aus
dem Schritt, wenn er gut oder glatt ist. Geschieht er aus dem
Galopp, so nennt man ihn fliegend. Der Starter gibt durch Senken
einer Fahne das Zeichen zum Ablaufen.
Stary (slaw.), in zusammengesetzten Ortsnamen oft
vorkommend, bedeutet "alt".
Staryj-Bychow (Bychow), Kreisstadt im russ. Gouvernement
Mohilew, am Dnjepr, zur Zeit der Polenherrschaft eine der
stärksten Festungen Weißrußlands, seit 1772 zu
Rußland gehörig, jetzt ein armer Ort mit (1885) 6074
Einw.
Staryj-Oskol, Kreisstadt im russ. Gouvernement Kursk, hat
6 griechisch-russ. Kirchen, ein weibliches Progymnasium, Fabriken
für Seife, Leder, Lichte und Tabak, Getreidehandel und (1885)
10,960 Einw.
Stas, Jean Servais, Chemiker, geb. 20. Sept. 1813 zu
Löwen, war längere Zeit Professor an der
Militärschule in Brüssel und wurde 1841 Mitglied der
belgischen Akademie. Er lieferte anfänglich Untersuchungen
über organische Verbindungen, wie das Phloridzin, das Acetal,
aber schon 1841 mit Dumas eine Arbeit über das Atomgewicht des
Kohlenstoffs und hat sich seitdem große Verdienste durch
überaus exakte Atomgewichtsbestimmungen erworben.
Staschow (Stasczow), Stadt im polnisch-russ. Gouvernement
Radom, Kreis Sandomir, am Czarna, hat Fabrikation von Gewehren,
Thonpfeifen und Papier, Strumpfweberei, Wollweberei, Eisen- und
Kupferhämmer und (1885) 7748 Einw.
Stasimon (griech.), Name der Standlieder des Chors im
griechischen Drama, bei deren Vortrag der Chor meist unbeweglich
stehen blieb. Sie traten nur ein, wo die Handlung einen Ruhepunkt
forderte, und teilten mit dem dem Prolog folgenden Einzugslied
(Parodos) das Stück in verschiedene Abschnitte.
Stasis (griech.), Stellung, Stand; auch s. v. w.
Blutstockung (s. d.), Vorläufer bei der Entzündung.
Stassart (spr. -ssar), Goswin Joseph Augustin, Baron von,
belg. Staatsmann, geb. 2. Sept. 1780 zu Mecheln, studierte die
Rechte in Paris, wurde daselbst 1804 Auditeur im französischen
Staatsrat, erhielt 1805 eine Intendantur in Tirol und 1807 bei der
französischen Armee in Preußen. 1810 ward er
Präfekt des Vauclusedepartements und 1811 des der
Maasmündungen. Nach der zweiten Restauration lebte er auf
seinem Landgut bei Namur, bis ihn die Stadt Namur 1822 in die
niederländische Zweite Kammer sandte, wo er zur Opposition
gehörte. Nach dem Ausbruch der Revolution in Brüssel im
September 1830 war er unter den Abgeordneten der südlichen
Provinzen, welche der Einberufung der Kammer nach dem Haag Folge
leisteten. 1831 begab er sich nach Belgien zurück, wo er in
den Kongreß gewählt und Mitglied der provisorischen
Regierung sowie dann des Senats wurde. In dieser Stellung
bekleidete er sieben Sessionen hindurch das Amt eines
Präsidenten, während er von der Regierung 1834 auch zum
Gouverneur von Brabant ernannt wurde, verlor aber 1838 diese beiden
Würden, da er als Großmeister der belgischen
Freimaurerei mit dem dieselbe besehdenden Episkopat offen gebrochen
hatte. 1840 ward er für kurze Zeit Gesandter zu Turin. 1841
legte er seine Würde als Großmeister der belgischen
Freimaurerei nieder. Er starb 16. Okt. 1854 in Brüssel. Seine
Schriften (Denkschriften, Reden, Kritiken etc., namentlich aber
treffliche Fabeln) erschienen gesammelt Brüssel 1854.
Staßfurt, Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Magdeburg, Kreis Kalbe, an der Bode, Knotenpunkt der Linien
S.-Schönebeck, S.-Blumenberg und S.-Löderburg der
Preußischen Staatsbahn, 65 m ü. M., hat 2 evangelische
und eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, ein bedeutendes
Steinsalzbergwerk, große chemische Fabriken, eine
Zuckerfabrik, Eisengießerei und Dampfkesselfabrikation und
(1885) 16,459 meist evang. Einwohner. S. wird zuerst 806 als Ort
erwähnt, und die dortigen Solbrunnen existierten bereits 1227.
Im 16. und 17. Jahrh. befand sich der blühende Salzbetrieb
hauptsächlich in den Händen des dort seßhaften
Adels, 1796 aber ging der gesamte Besitz an den König von
Preußen über. Unter der Konkurrenz von Dürrenberg
mußte der Betrieb nach wenigen Jahren eingestellt werden, und
als er 1815 wieder aufgenommen wurde, konnte er doch nur bis 1839
erhalten werden. Damals begann man ein Bohrloch, welches 1843 bei
256 m Tiefe ein Salzlager antraf, dessen Liegendes bei 325 m noch
nicht erreicht wurde. Die Bohrlochsole erwies sich aber wegen hohen
Gehalts an Kali- und Magnesiasalzen unbrauchbar, und als man 1851
mit dem Abteufen zweier Schächte begann, erreichte man in
fünf Jahren das Salzlager, welches sich in einer
Mächtigkeit von 160 m mit Kali- und Magnesiasalzen bedeckt
erwies, die man damals als lästige Zugabe betrachtete und als
Abraumsalze (s. d.) bezeichnete. Spätere Bohrungen ergaben,
daß stellenweise über den Abraumsalzen noch ein
jüngeres Steinsalzlager liegt, welches keine
Anhydritschnüre enthält und sehr reines Steinsalz
liefert. Die ersten Vorschläge zur Verwertung der Kalisalze
veranlaßte die anhaltische Regierung zum Abteufen zweier
Schächte zu Leopoldshall, in unmittelbarer Nähe von S.,
und diese kamen 1861 in Betrieb. Ähnliche Unternehmungen, wie
Douglashall, Neustaßfurt, entstandenen der Umgebung von S.,
und auch Schmidtmannshall bei Aschersleben ist hierher zu rechnen.
Die Kalisalzindustrie entwickelte sich seit 1857 und hat eine so
große Bedeutung gewonnen, daß von S. aus der Weltmarkt
für Kalisalze beherrscht wird. Man stellt schwefelsaures Kali,
schwefelsaure Kalimagnesia, Chlorkalium, Pottasche, außerdem
Glaubersalz, Bittersalz, Kieseritsteine, Chlormagnesium, Brom, Soda
etc. dar. 1887 gab es im Staßfurter Becken 7
Kalisalzbergwerke, darunter 2 fiskalische (ein preußisches
und ein anhaltisches). Diese förderten 12,940,808 metr. Ztr.
Kalisalze (8,402,068 Carnallit 2,375,177 Kainit, 141,850 Kieserit
etc.) und 2,019,625 metr. Ztr. Steinsalz. Davon kamen auf die
königlichen Salzwerke in S. an Carnallit 1,979,816, an Kainit
727,093, an Steinsalz 609,851, auf Leopoldshall an Carnallit
2,152,723, an Kainit 644,881, an Kieserit 29,303, an Steinsalz
480,390 metr. Ztr. Vgl. die Litteratur bei Art. Abraumsalze;
außerdem Precht, Die Salzindustrie von S. (3. Aufl.,
Staßf.
241
Staßfurtit - Statistik.
1889); Pfeiffer, Die Staßfurter Kaliindustrie (Braunschw.
1887).
Staßfurtit, s. Boracit.
Stassjulewitsch, Michael Matwejewitsch, russ. Publizist,
geb. 9. Sept. 1826, studierte auf der Petersburger
Universität, bekleidete an derselben 1851 bis 1861 den
Lehrstuhl der Geschichte und war 1860 bis 1862 Lehrer des
verstorbenen Thronfolgers Nikolaus. Er verfaßte einige
Monographien zur altgriechischen und mittelalterlichen Geschichte
und eine Geschichte des Mittelalters (russ., Petersb. 1863-65, 3
Bde.). Später widmete er sich ganz dem Journalismus, indem er
1865 den "Europäischen Boten" ("Westnik Jewropy")
begründete, eine Monatsschrift, welche bis jetzt unter den
Veröffentlichungen dieser Art in Rußland die erste
Stelle einnimmt.
Statarisch (lat.), stehend, verweilend; daher statarische
Lektüre, Lektüre, bei der das Einzelne genau erklärt
wird (Gegensatz: kursorische Lektüre).
Staten Island (spr. steht'n-eiländ), Insel an der
Küste des nordamerikan. Staats New Jersey, an der Einfahrt in
die Bai von New York, wird durch einen schmalen Meeresarm (Staten
Island-Sound) vom festen Land getrennt, ist 160 qkm groß und
hat (1880) 38,991 Einw. Hauptstadt ist Richmond.
Stater, Name verschiedener Geldstücke des Altertums.
Der athenische Goldstater, meist im 5. Jahrh. geprägt, wiegt
etwa 8,6 g; der Kyzikener S., etwa 16 g schwer, war ein aus sogen.
Elektron (Gold- und Silbermischung) geprägtes Stück; der
äginetische S. ist das silberne Didrachmon von 12,3 g. Die
verbreitetsten S. genannten Münzen sind die nach attischem
Fuß ausgeprägten Goldstücke Philipps und Alexanders
von Makedonien (s. Tafel "Münzen I", Fig. 6).
Stathmograph (griech.), ein von Dato konstruierter
Apparat zur Kontrolle der Fahrzeiten, Aufenthaltszeiten und
Fahrgeschwindigkeiten von Eisenbahnzügen, verbunden mit einem
Kilometerzeiger. Letzterer schlägt bei jedem Kilometerstein in
einen durch ein Uhrwerk fortgezogenen Papierstreifen ein Loch. Auf
diesem über eine Walze gehenden Papierstreifen verzeichnet ein
Bleistift die Fahrgeschwindigkeitskurve, welche auf den Stationen
so lange in die Nulllinie fällt, als der Zug steht. Da der
Streifen eine gewisse Bewegungsgeschwindigkeit besitzt, so ist aus
der Fahrtenkurve ersichtlich, mit welcher Geschwindigkeit der Zug
jeden Punkt der Strecke durchfuhr. Vgl. Perambulator.
Statice Tourn. (Limoniennelke, Strandnelke), Gattung aus
der Familie der Plumbagineen, Kräuter oder Halbsträucher
mit ährigen oder traubigen Blütenständen und
häutigen, einsamigen Schließfrüchten. S. Limonium
L., mit fast lederartigen, verkehrt-eiförmigen,
länglichen Wurzelblättern, 30-45 cm hohem
Blütenstiel und blauen Blüten, wächst in
Mitteleuropa an Meeresküsten. Die Wurzel dient in
Rußland als Kermek zum Gerben, doch stammt die genannte
Drogue hauptsächlich von S. coriaria Pall. in Rußland.
Auch die Wurzel von S. tatarica L. in Sibirien und der Tatarei
dient zum Gerben und Färben. Andre Arten aus Süd- und
Osteuropa, von den Kanarischen Inseln und aus Mittelasien werden
als Zierpflanzen kultiviert.
Statik (griech.), die Lehre vom Gleichgewicht der
Körper, bildet einen Teil der Mechanik (s. d.); man
unterscheidet die S. der festen, flüssigen und
gasförmigen Körper oder Geostatik, Hydrostatik und
Aerostatik. Vgl. Poinsot, Elemente der S. (deutsch, Berl. 1887). S.
des Landbaues, die Lehre vom Gleichgewicht der Entnahme und Zufuhr
an Nährstoffen des Bodens. Durch die Agrikulturchemie ist die
Lehre von der S. eine außerordentlich durchsichtige geworden
und hat die bisher vagen Begriffe "Reichtum des Bodens", "Kraft",
"Thätigkeit" in feste Gestalt gebracht, so daß man immer
umfassender wiegt und mißt, was dem Grund und Boden durch die
Ernten entnommen wird, was ihm der Dünger zurückgibt.
Nicht nur im chemischen Laboratorium, auch im großen
praktischen Betrieb der intelligenten Wirtschaften macht man sich
täglich die Errungenschaften der Agrikulturchemie mehr zu
nutze, wendet die Lehre der S. thätig an. Durch die
umfassenden Düngungsversuche, welche durch die
agrikulturchemischen Versuchsstationen in ganz eminent
hervorragender Weise unter Leitung der Halleschen und neuerdings
Breslauer Station veranlaßt wurden, wird alljährlich
diese Lehre mehr und mehr ausgebaut. Durch die Wolffschen
Nährstofftabellen, die sich in jedes tüchtigen Landwirts
Händen befinden (Kalender von Mentzel u. Lengerke und der von
Graf Lippe), ist es ein Leichtes, sich über Aus- und Zufuhr
der Nährstoffe sichere Rechnung aufzustellen. Würde noch
das Bedürfnis der Pflanzen nach Stickstoffzufuhr festgestellt,
so wäre die Lehre von der S. eine vollkommene; auch diesen
Schleier wird die Agrikulturchemie und -Physiologie über kurz
oder lang zu heben im stande sein. - In gleichem Sinn spricht man
auch von forstlicher S. (vgl. Forstwissenschaft, S. 455).
Station (lat.), Aufenthalts-, Standort; auf Reisen, im
Post- und Eisenbahnwesen Ort, wo angehalten wird; daher auch bei
Wallfahrtsorten Bezeichnung für die durch Kreuze,
Bildstöcke, Kapellen etc. bezeichneten Stellen, wo die
Prozessionen Halt machen, um zu beten (vgl. Kreuzweg); allgemeiner
s. v. w. Amt, Stellung.
Stationär (lat.), stillstehend, seinen Standort oder
Standpunkt behauptend; auch s. v. w. Stationsbeamter.
Stationers' Hall (engl., spr. stehscheners hahl), in
London Bezeichnung des Hauses der alten Buchhändlergilde, die
vom Staat mit dem Einschreiben (registration) der litterarischen
Urheberrechte betraut ist.
Stationsvorsteher, s. Eisenbahnbeamte.
Statiös (lat.), staatmachend, prunkend.
Statisch (griech.), stillstehend; auf Statik
bezüglich.
Statisches Moment, s. Hebel, S. 254.
Statist (lat.), jemand, der auf der Bühne eine nur
"dastehende", nicht mitspielende Person vorstellt; gewöhnlich
gleichbedeutend mit Komparse (s. d.).
Statistik (v. lat. status oder ital. stato, Staat),
ursprünglich die beschreibende Darstellung von Staat
(Verfassung, Verwaltung) und Bevölkerung nach ihren
bemerkenswerten Seiten. Solche Darstellungen, einem praktischen
Bedürfnis für militärische und finanzielle Zwecke
entsprungen, kamen bereits im Altertum vor. In China, Ägypten
und bei den Juden wurden schon frühzeitig
regelmäßige Volkszählungen vorgenommen. Dann hatte
Rom einen entwickelten Zensus aufzuweisen, während das
Mittelalter für eine S. und deren Ausbildung keine Gelegenheit
bot. Erst nach dem 15. Jahrh. macht sich wieder das Bedürfnis
geltend, die eigne und die fremde Lage kennen zu lernen, welchem in
Frankreich unter Sully durch Schaffung einer Art statistischen
Büreaus genügt wurde. Die wissenschaftliche Behandlung
der S. nahm ihren Anfang in der Mitte des 17. Jahrh. In Deutschland
entwickelte sich zuerst die beschreibende Schule der S., welche
dieselbe in dem oben genannten Sinn auffaßte. Als
Schöpfer derselben gilt H. Conring (1606-81, s. d.,)
welcher
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl., XV. Bd.
16
242
Statistik (geschichtliche Entwickelung, heutige Richtung).
1660 den üblichen Universitätsvorlesungen eine neue,
aus Geographie, Geschichte und Politik abgesonderte Disziplin als
Notitia rerum publicarum hinzufügte, in welcher er die
Staatszustände zusammenhängend darstellte. Achenwall
(1719-72), ein fleißiger Sammler, stellt den Begriff genauer
fest und führt auch die Bezeichnung S. als Kenntnis der
Staatsmerkwürdigkeiten ein. Auf gleichem Boden steht sein
Schüler Schlözer (1735-1809), welcher der damaligen
Heimlichkeit in Staatssachen gegenüber mit einem gewissen
Freimut die politischen Ereignisse zum Gegenstand der Besprechung
in Vorlesungen machte. Von ihm stammt die bekannte Definition: "S.
ist stillstehende Geschichte, Geschichte ist fortlaufende S."
Gegenüber der ethnographischen Methode der S., welche jedes
Volk für sich behandelte, führte Büsching (1724-93)
die vergleichende Methode ein, indem er bei sachlicher Gliederung
des Stoffes zwischen den entsprechenden Zuständen
verschiedener Länder eine Parallele zog. Bald machte sich das
Bedürfnis geltend, die gesammelten Zahlen der S.
übersichtlich in Tabellenform zu ordnen und dieselben auch
durch graphische Darstellung zu veranschaulichen (Crome, 1782).
Dies führte zu einem lebhaften Streit zwischen der
Göttinger Schule (Anhänger Schlözers) auf der einen
und den von denselben so betitelten Linear- oder
Tabellarstatistikern auf der andern Seite. Der Kampf war insofern
ein verfehlter, als für statistische Darstellungen weder die
Größenangabe (Zahl) noch der Wortausdruck entbehrt
werden kann. Von jeher waren die Ansichten über das Gebiet der
S. geteilt gewesen. Die einen beschränkten es auf den Staat
und staatliche Verhältnisse (Staatsverfassung, Darstellung der
Staatskräfte), andre dehnten es auf alle gesellschaftliche
Thatsachen (faits sociaux) aus, wieder andre überhaupt auf
alle Erscheinungen, an denen ein Dasein, Entstehen und Vergehen
wahrnehmbar sei (also auch Naturerscheinungen). Verlangten die
einen, daß die S. sich nur auf Schilderung der Erscheinungen
der Gegenwart beschränken solle, daß jedes statistische
Datum neu sein müsse, da sich die Vergangenheit nicht
beobachten lasse, so gingen sie zum Teil selbst wieder von dieser
Forderung ab, indem sie auch Einsicht in die Zustände bieten,
den jetzigen Zustand aus dem frühern begreiflich machen
wollten (pragmatische S. nach Achenwall). Man verwechselte hierbei
die einfache Beobachtung, Erhebung und Aufzeichnung des
statistischen Materials mit der wissenschaftlichen Verarbeitung
desselben. Die Beobachtung kann nur die Gegenwart erfassen, die
Zusammenstellung der durch eigne oder (meist) fremde Beobachtung
gewonnenen Ergebnisse erstreckt sich bereits auf die Vergangenheit,
und für die wissenschaftliche Verwertung kann es ganz
gleichgültig sein, welcher Zeit das Material angehört.
Eine weitere Streitfrage war früher die, ob die S. sich auf
solche Thatsachen zu beschränken habe, welche sich durch
Zahlen wiedergeben lassen (nach M. de Jonnés: faits sociaux,
exprimés par des termes numériques). Die moderne S.
befaßt sich allerdings vorzüglich mit Größen
und deren Vergleichung, auch erblickt das gewöhnliche Leben
allgemein in der S. eine Wissenschaft, welche es mit Zahlen und
zwar mit Massen von Zahlen zu thun hat, wobei freilich nicht zu
übersehen, daß Größenangaben in allen
Gebieten der Natur und des gesellschaftlichen Lebens möglich
sind.
Die heutige Richtung der S. hat ihren Ausgangspunkt in England,
und zwar entwickelte sie sich aus der politischen Arithmetik, d.h.
derjenigen Wissenschaft, welche mathematische Rechnungen auf das
Finanzwesen anwandte. Anlaß zur Förderung derselben
gaben vorzüglich das Versicherungswesen und die im 17. Jahrh.
in Aufnahme gekommenen Glücksspiele. Letztere gaben ihrerseits
Anstoß zur Entstehung und Ausbildung der
Wahrscheinlichkeitsrechnung (Huygens, Fermat, Pascal, Bernoulli),
welche eine unentbehrliche Grundlage für wichtige Zweige der
politischen Arithmetik und der S. wurde. Letztere begann sich bald
von der erstern abzuzweigen, ohne daß jedoch, sofern nicht
unter der politischen Arithmetik lediglich die Zins- und
Arbitragerechnung verstanden wird, eine scharfe Scheidung
überhaupt möglich ist. Nachdem Graunt (1660), dann
Pettey, Halley, Kerseboom, Deparcieux sich mit Berechnung der
Sterblichkeit und mit Aufstellung von Sterblichkeitstafeln
befaßt hatten, gab Süßmilch (1707-67) in seiner
"Göttlichen Ordnung in den Veränderungen des menschlichen
Geschlechts" (1742) überhaupt dem Gedanken Ausdruck, daß
im gesellschaftlichen Leben gewisse Regelmäßigkeiten
beobachtet werden könnten, welche freilich nicht in einzelnen,
sondern in einer großen Zahl von Fällen hervortreten.
Diesen Gedanken verfolgte Quételet weiter, und es wird jetzt
an Stelle der frühern einfachen Beschreibung die S. zu einer
Wissenschaft der umfassenden Durchzählung verwandter
Fälle und Vorgänge, um aus derselben
Regelmäßigkeiten und Gesetzmäßigkeiten
abzuleiten. Dieselbe erstreckt sich auf alle diejenigen Gebiete,
auf welchen im einzelnen eine bunte individuelle Mannigfaltigkeit
in Erscheinung tritt, während durchschlagende Ursachen und
Beweggründe erst aus einer großen Zahl von Fällen
erkennbar sind. So kann in wenigen Familien eine
verhältnismäßig große Zahl von Totgeburten
eintreten, während in andern gar keine vorkommt. Faßt
man aber eine große Zahl zusammen, so nähert man sich
einer Mittelzahl (Prozent), von welcher die zu einer andern Zeit
oder in einem andern Gebiet für große Zahlen gewonnenen
Ergebnisse nur wenig abweichen werden. Voraussetzung hierfür
ist, daß die verglichenen Zustände nicht wesentlich
voneinander verschieden sind. Solche durchschlagende
Einflüsse, mögen sie nun das Bestreben haben, einen
Zustand der Beharrung zu bewirken oder Veränderungen zu
veranlassen, können nicht allein da festgestellt werden, wo
der menschliche Wille keine Rolle spielt, sondern auch in der Welt
der sittlichen Thatsachen, in welcher ebenfalls nachgewiesen werden
kann, daß bei aller Freiheit des Willens die menschlichen
Handlungen doch wesentlich durch Naturumgebung, gesellschaftliche
Verhältnisse, Erziehung etc. beeinflußt werden, indem je
nach gegebenen äußern Verhältnissen solche
Handlungen eben als die vernünftigen erscheinen.
Eine richtige Ermittelung der Wirkung jener durchschlagenden
Ursachen und damit dieser selbst ist ohne mathematische Behandlung
nicht möglich und darum die mathematische S. unentbehrlich.
Letztere ist insbesondere in der neuern Zeit in ihrer Anwendung auf
Versicherungs- und Bevölkerungswesen durch Wittstein, Zeuner,
Knapp, Lexis gefördert worden. Je nach den Gebieten, welche
einer statistischen Betrachtung unterworfen werden, unterscheidet
man Ackerbau-, Forst-, Gewerbe-, Handels-, Post-, Eisenbahn-,
Medizinal-, Kriminal-, Moral-, Bevölkerungsstatistik etc. Im
engern Sinn wird heute auch oft die S. als eine auf die
gesellschaftlichen Erscheinungen (Volk und Staat) beschränkte
Disziplin aufgefaßt (vgl. Demographie), während die
Methode der S. in allen Gebieten, auch in denen der
Naturwissenschaften (Meteorologie), anwendbar sei. Die Sammlung des
statistischen Materials ist nun Einzelnen selten in
243
Statistik des Warenverkehrs - Statistische
Darstellungsmethoden.
genügendem Umfang möglich (Privatstatistik), sie
bildet vorzüglich eine Aufgabe von Staat und Gemeinden und in
zweiter Linie als Ergänzung von Vereinen. Infolgedessen ist
denn die S. vorwiegend amtliche S. Die erste Organisation derselben
erfolgte 1756 in Schweden, wo eine "Tabellenkommission"
jährlich Nachweisungen über die Bewegung der
Bevölkerung lieferte. Ferner wurden eigne mit der Ansammlung,
Ordnung und Veröffentlichung des statistischen Materials
betraute Stellen (statistische Büreaus) errichtet in:
Frankreich (1796 vorübergehend, dann 1800), Bayern (1801,
Hermann, Mayr), Italien (1803, Bodio), Preußen (1805 von
Stein gegründet, Krug, I. G. Hoffmann, Dieterici, Engel,
Blenck), Österreich (1810, Czörnig, Ficker), Belgien
(1831), Griechenland (1834), Hannover, Holland (1848), Sachsen
(1849, von Engel gegründet, Petermann, Böhmert),
Kurhessen, Mecklenburg (1851), Braunschweig (1853), Oldenburg
(1855), Rumänien (1859), in der Schweiz (1860), im
Großherzogtum Hessen (1861), in Serbien (1862), den
vereinigten thüringischen Landen (in Jena, 1864, jetzt Weimar)
etc. Das 1872 ins Leben gerufene "Statistische Amt des Deutschen
Reichs" verarbeitet die Erhebungen der einzelnen Landesbüreaus
und der Reichs- und Zollvereinsbehörden. Meist sind die
Büreaus Zentralstellen, welchen in mehreren Ländern
für Beratungen über die Art der auszuführenden
Arbeiten noch eigne aus Mitgliedern verschiedener
Verwaltungszweige, Volksvertretern und Theoretikern bestehende
statistische Zentralkommissionen beigegeben sind. Seit neuerer Zeit
haben auch die meisten Großstädte eigne statistische
Büreaus errichtet. In der ersten Hälfte des Jahrhunderts
wurden die Arbeiten der statistischen Büreaus ziemlich geheim
gehalten; seitdem hat man überall mit regelmäßigen
amtlichen statistischen Veröffentlichungen in Form von
Zeitschriften, Jahrbüchern etc. begonnen, neben welchen als
private Unternehmungen das "Journal of the Statistical Society"
(London) und das "Journal de la Société de
statistique" (Paris) zu nennen sind. Eine internationale S. ist
schwer durchführbar, insbesondere deswegen, weil die Begriffe,
welche den Gegenstand statistischer Ermittelung bilden, nicht
überall die gleichen sind. Volle Gleichheit läßt
sich auf vielen Gebieten wegen der Verschiedenartigkeit in den
Verwaltungseinrichtungen, Volksleben, Gebräuchen etc. nicht
erzielen. Die besonders auf Quételets Anregung geschaffenen
internationalen statistischen Kongresse, welche stattgefunden haben
in Brüssel (1853), Paris (1855), Wien (1857), London (1860),
Berlin (1863), Florenz (1867), Haag (1869), St. Petersburg (1872),
Pest (1876), hatten es sich zur Aufgabe gemacht, Einheit in die
amtlichen Statistiken der verschiedenen Staaten zu bringen und
gleichförmige Grundlagen für die statistischen Arbeiten
zu erlangen. 1885 wurde in London ein "internationanales Institut
der S." mit dem Sitz in Rom gegründet, welches das "Bulletin
de l' Institut international de statistique" herausgibt. Weiteres
s. in den Artikeln: Bevölkerung, Gewerbe-, Handels-,
Kriminal-, Moralstatistik und Statistische
Darstellungsmethoden.
Vgl. Fallati, Einleitung in die Wissenschaft der S.
(Tübing. 1843); A. Quételet, Sur l' homme (Par. 1835;
deutsch, Stuttg. 1838); Derselbe, Physique sociale (Brüssel
1869, 2 Bde.); Knies, Die S. als selbständige Wissenschaft
(Kassel 1850); Jonak, Theorie der S. (Wien 1856); Rümelin,
Reden und Aufsätze (Tübing. 1875); Ad. Wagner (in
Bluntschlis "Staatswörterbuch"); M. Haushofer, Lehr- und
Handbuch der S. (2. Aufl., Wien 1882); Block Traité
théorique et pratique de statistique (Par. 1878; deutsch von
v. Scheel, Leipz. 1879); Wappäus, Einleitung in das Studium
der S. (das. 1881); Meitzen Geschichte, Theorie und Technik der S.
(Berl. 1886); Gabaglio, Teoria generale della statistica (2. Aufl.,
Mail. 1888); John, Geschichte der S. (Stuttg. 1884 ff.); R.
Böckh, Die geschichtliche Entwickelung der amtlichen S. des
preußischen Staats (Berl. 1863); Puslowski, Das
königlich preußische Statistische Büreau (das.
1872); Klinckmüller, Die amtliche S. Preußens im vorigen
Jahrhundert (Jena 1880); Mayr, Die Organisation der amtlichen S.
(Münch. 1876). Als Sammlungen wichtiger statistischer
Thatsachen sind zu erwähnen: der "Gothaische Genealogische
Hofkalender" und O. Hübners "Statistische Tafel" (Frankf. a.
M., jährlich erscheinend); Kolb, Handbuch der vergleichenden
S. (8. Aufl., Leipz. 1879); Brachelli, Die Staaten Europas (4.
Aufl., Brünn 1884).
Statistik des Warenverkehrs, s. v. w. Handelsstatistik
(s. d.).
Statistische Darstellungsmethoden. Statistische Thatsachen
können zunächst durch einfache Beschreibung oder
Schilderung vorgeführt werden. Doch gestattet der Wortausdruck
(groß, steigend, abnehmend, kleiner etc.) keine
übersichtliche Darstellung, sobald eine große Menge
nebeneinander gelagerter oder gereihter Thatsachen in Betracht
kommen. In diesem Fall bietet die ohnedies unvermeidliche Zahl eine
Hilfe, welche, in Tabellenform angeordnet, über
Größen und deren Änderungen Auskunft gibt. Doch
gestattet die Tabelle, zumal wenn eine Masse mehrstelliger Zahlen
vorgeführt wird, keine rasche Orientierung und Vergleichung.
Dieser Zweck soll durch die graphische Darstellung erfüllt
werden, welche zur einfachen Veranschaulichung dient, die
Aufsuchung von Gleichmäßigkeiten,
Gesetzmäßigkeiten und Gegensätzen sowie die
Beurteilung wechselseitiger Zusammenhänge erleichtert, aber an
und für sich nicht als ein besonderes Beweismittel zu
betrachten ist. Die graphische Darstellung gibt Größen
in der linearen oder der Flächenausdehnung oder räumlich
in Körpern für verschiedene Begriffe an. Letztere werden
unterscheidbar gemacht durch verschiedenartige Punktierung,
Anwendung der Schraffur, der Farbe oder andrer Zeichen. Man
unterscheidet das Diagramm und das Kartogramm. Das Diagramm gibt
die Größen einfach als solche wieder. Ist für
dieselben eine feste Reihenfolge gegeben (z. B. nach der Zeit), so
können sie in einem Koordinatensystem in der Art zur
Darstellung kommen, daß je auf den Abschnitten der
Abscissenachse die zugehörigen Größen aufgetragen
werden. Hierfür können aneinander gereihte Flächen
für jede Einheit gewählt werden, wenn die Änderungen
der Größen keine stetigen sind. Statt dessen trägt
man aber auch wohl Linien auf die betreffenden Punkte der Abscissen
auf und verbindet deren Endpunkte miteinander durch eine besondere
Linie, welche eine Leitung für das Auge bilden soll. Alsdann
kann auch die Ordinatenlinie selbst gespart werden. Die
Leitungslinie wird zur regelmäßig verlaufenden Kurve,
sobald die Änderungen stetige sind. Auf einem und demselben
Blatt können mehrere derartige Kurven aufgetragen werden,
voneinander durch Farbe, Punkte, Striche, Kreuze etc.
unterschieden, was eine Vergleichung verschiedener Reihen
erleichtert. Das einfache Flächendiagramm gibt eine
statistische Größe in einer Fläche (Rechteck,
Dreieck) wieder, indem Unterabteilungen (z. B. männliches
16*
244
Statistische Gebühr - Statuten.
weibliches Geschlecht, Altersklassen) in der oben erwähnten
Weise kenntlich gemacht werden. Auch der Körper (Würfel,
Pyramide, Raumkoordinaten mit krummer Oberfläche) kann
statistische Größen zur Anschauung bringen. Das
Kartogramm dient dazu, die örtliche Lagerung statistischer
Thatsachen (auf der Landkarte) anzugeben. Hierfür kann nun,
wie dies schon von jeher üblich, Punkt, Schraffur und Farbe,
dann die Fläche benutzt werden (z. B. für die Städte
auf der Landkarte), welch letztere bei der Darstellung des
längs einer Linie (Fluß, Eisenbahn) sich bewegenden
Verkehrs dem Auge als Bänder erscheinen.
Statistische Gebühr nennt man in Deutschland eine auch
in England, Italien und Frankreich erhobene Gebühr, welche
von über die Grenze des Zollgebiets ein-, aus- oder
durchgeführten Waren im Interesse und zur Deckung der Kosten
der für Zollgesetzgebung und Handel wichtigen Statistik des
Warenverkehrs auf Grund von bei den bestimmten amtlichen
Anmeldestellen erfolgenden Anmeldungen (nach Gattung, Menge,
Herkunft, Bestimmungsland) seit 1. Jan. 1880 (Reichsgesetz vom 20.
Juli 1879) erhoben wird.
Statius, Publius Papinius, röm. Dichter, geboren um
45 n. Chr. zu Neapel, ward in Rom von seinem Vater, der selbst
Lehrer und Dichter war, gebildet und erwarb sich schon früh
durch sein poetisches Talent, namentlich im Improvisieren, Beifall
und mehrfach den Sieg in dichterischen Wettkämpfen. Doch sah
er sich sein lebenlang in Abhängigkeit von der Gunst des
Domitian und der römischen Großen, denen er oft in der
unleidlichsten Weise schmeichelte. Später zog er sich nach
Neapel zurück, wo er um 96 starb. Von seinen Schriften, die
sich durch Gewandtheit und Phantasie auszeichnen, aber vielfach an
rhethorischem Schwulst und dunkler Gelehrsamkeit leiden, besitzen
wir noch: "Silvae", Gelegenheitsgedichte in fünf Büchern
und in verschiedenen Versmaßen (hrsg. von Markland, Lond.
1728, Dresd. 1827, von Bährens, Leipz. 1876); "Thebais", ein
Epos in 12 Büchern (Buch 1-6 hrsg. von Müller, das. 1870,
das ganze Werk von Kohlmann, das. 1844; deutsch von Imhof, Ilmenau
1886), und von dem unvollendeten Epos "Achilleïs" die beiden
ersten Bücher (hrsg. von Kohlmann, Leipz. 1879).
Gesamtausgaben besorgten Gronov (Amsterd. 1653), Dübner (Par.
1835-1836, 2 Bde.) und Queck (Leipz. 1854, 2 Bde.); eine
Übersetzung Bindewald (Stuttg. 1868 ff.).
Stativ (lat.), Gestell für mathematische,
astronomische und andre Apparate.
Stator (lat.), Beiname des Jupiter, angeblich weil ihm
Romulus einen Tempel gelobte, wenn er die vor den Sabinern
fliehenden Römer zum Stehen brächte.
Stättegeld, s. v. w. Standgeld (s. d.).
Statthalter, derjenige, welcher die Stelle des
Landesherrn oder der höchsten Obrigkeit in einem Land oder
einer Provinz vertritt, so in Elsaß-Lothringen (s. d., S.
577) der an der Spitze der Staatsverwaltung stehende höchste
Beamte; (stadhouder) ehemals in den Vereinigten Niederlanden Titel
der Prinzen von Oranien, welchen nach der Losreißung von
Spanien ein Teil der königlichen Rechte, namentlich der
Oberbefehl über die Kriegsmacht zu Lande und zur See,
übertragen wurde; in Österreich Amtstitel von politischen
Landesbehörden (Statthaltereien), s. Landesbehörden.
Statue (lat. statua, Standbild), die durch die
Thätigkeit des bildenden Künstlers in irgend einer, meist
harten Masse dargestellte volle Gestalt, besonders des Menschen. Im
Altertum und in der neuern Zeit bis zur Zeit der Renaissance
pflegte man statuarische Bildwerke zur Belebung und Verdeutlichung
der Formen mehr oder weniger reich zu bemalen (s. Polychromie). Man
unterschied schon im griechischen Altertum Ideal- und
Porträtstatuen, je nachdem der Künstler aus der Phantasie
schöpfte oder sich an die Wirklichkeit hielt. Zu den
Idealstatuen gehörten die der Götter und Heroen. Die
Porträtstatuen kamen erst verhältnismäßig
spät durch die Sitte auf, in Olympia Statuen der Sieger in den
Wettkämpfen aufzustellen. Doch waren auch diese anfangs ideal,
d. h. nicht porträtähnlich, gehalten. Noch später
kam dazu das Genrebild, welches Personen und Vorgänge aus dem
Alltagsleben als Einzelstatuen oder Gruppen darstellte. In der
römischen, besonders kaiserlichen, Zeit wurden in großer
Menge Porträtstatuen gefertigt. Kolossale Dimensionen wurden
durch den Zweck der Aufstellung bedingt. Den Begriff der
Erhabenheit durch räumliche Ausdehnung anzudeuten, war aber
dem griechischen Geschmack fern, und erst die verfallende Kunst,
die sich ägyptisch-asiatischen Begriffen anbequemte, suchte
auf diese Weise durch Zusammenstellungen eine größere
Wirkung hervorzubringen. In Hinsicht ihrer äußern
Stellung unterschieden schon die Alten stehende, sitzende,
Reiterstatuen und fahrende Statuen, und die Statuen waren teils
einzeln, teils in Gruppen zusammengefaßt. Die moderne
Bildhauerkunst versteht unter S. im weitesten Sinn jede plastische
Einzelfigur, im engern Sinn ein stehendes Bild. Statuette,
Standbildchen. Vgl. Bildhauerkunst.
Statuieren (lat.), aufstellen, festsetzen, bestimmen;
etwas statthaben lassen; ein Exempel s., ein Beispiel zur Warnung
aufstellen.
Statur (lat.), Leibesgröße und Gestalt,
Wuchs.
Status (lat.), Stand (z. B. des Vermögens, die
Bilanz der Aktiva und Passiva, wie sie von Aktien-Gesellschaften
als Monatsstatus allmonatlich veröffentlicht wird), Zustand;
daher S. quo, der Zustand, die Lage, in welcher sich etwas befand
oder befindet, namentlich S. quo ante (bellum), die Lage,
insbesondere die Gebiets- und Machtverhältnisse, wie sie vor
einem Krieg waren. S. nascendi, Entstehungszustand; S. praesens,
der gegenwärtige Gesundheitszustand eines Kranken und der
ärztliche Bericht über denselben. Die Römer
bezeichneten mit S. auch die drei Hauptstufen der
Persönlichkeit, nämlich Freiheit, römisches
Bürgerrecht und Familienstand. Der Verlust eines solchen S.
involvierte eine Capitis deminutio (s. d.).
Status duplex (lat., "doppelter Stand"), ein Kapitel in
der Christologie (s. d., S. 100).
Status nascendi, s. Entstehungszustand.
Statutarisch (lat.), was Statuten (Satzungen) zufolge
gesetzmäßig ist; daher statutarische Portion, der
festgesetzte Erbteil, den eine Witwe von der Verlassenschaft des
Mannes erhält (s. Güterrecht der Ehegatten, S. 948).
Statuten (lat.), Satzungen, Gesetze; namentlich
Bezeichnung für die mittelalterlichen Stadtrechte, auch
für die Hausgesetze des hohen Adels (s. Autonomie). S.
heißen ferner die Satzungen über die Verfassung und
Verwaltung von Vereinen, juristischen Personen und Korporationen,
und zwar bestehen über Inhalt und Gültigkeit, namentlich
aber auch über die staatliche Anerkennung und Bestätigung
solcher S. vielfach besondere Vorschriften, so z. B. in Ansehung
der Aktiengesellschaften, der Genossenschaften und der Innungen.
Den Gemeinden und Kommunalverbänden ist jetzt in den meisten
Staaten das Recht ein-
245
Statz - Staubeinatmungskrankheiten.
geräumt, zur Durchführung gemeinnütziger
Maßregeln, zur Aufrechthaltung der öffentlichen
Sicherheit innerhalb des Gemeindebezirks und sonst zur Erreichung
der Gemeindezwecke innerhalb der durch die Gesetzgebung gezogenen
Schranken Ortsstatuten, geeigneten Falls mit Strafbestimmungen, zu
errichten. Nach preußischem Recht bedürfen derartige S.
der Stadtgemeinden der Genehmigung des Bezirksausschusses, in
Berlin des Oberpräsidenten. In andern Staaten ist die
Genehmigung der Zentralverwaltungsbehörde oder sogar diejenige
des Souveräns erforderlich. In England versteht man unter S.
(Statutes) die eigentlichen Gesetze, welche mit Zustimmung des
Parlaments von der Krone erlassen werden, im Gegensatz zur
königlichen Verordnung (Ordinance), für welche die
Zustimmung der beiden Häuser des Parlaments nicht erforderlich
ist. Die Lokalverordnungen der Gemeinden, welche bei uns S.
heißen, werden in England als Bylaws (s. d.) bezeichnet.
Statz, Vinzenz, Architekt, geb. 1819 zu Köln, war
anfangs Maurermeister am dortigen Dombau, wurde 1845
Dombauwerkmeister, legte 1854 diese Stelle nieder und wurde 1863
Diözesanbaumeister. In dieser Stellung war er eifrig
beflissen, der strengen Gotik neue Bahnen zu brechen. Die Zahl der
unter seiner Leitung hergestellten kirchlichen Bauten beläuft
sich auf einige hundert, von denen als die größten zu
nennen sind: die Mauritiuskirche in Köln, die Marienkirche in
Aachen, die katholischen Kirchen in Kevelaer, Dessau, Eberswalde,
Bernshausen in Hannover, wobei er es trefflich verstand, moderne
Einrichtungen mit mittelalterlichen Formen zu verbinden.
Hervorzuheben sind noch: das große Krankenhaus zu St. Hedwig
in Berlin und sein Wohnhaus in Köln. Auch leistete er
Bedeutendes in der innern Ausstattung der Kirchen, in der Holz- wie
in der Steinarchitektur, namentlich in der Liebfrauenkirche zu
Trier, wo er einen prächtigen Altar ausführte. Sein
größtes Werk ist der Dom in Linz an der Donau, den er
1862 begann, ein Bau von gewaltigen Dimensionen. S. gab heraus:
"Gotische Entwürfe" (Bonn 1861); "Gotische Einzelnheiten" (180
Tafeln, 2. Aufl., Berl. 1886); "Gotisches Musterbuch" (mit
Ungewitter und Reichensperger, Leipz. 1856-60) u. a. Er erhielt
1864 den Titel Baurat, ist Ehrenmitglied der Londoner Royal
Society, der k. k. Akademie in Wien etc.
Staub, in der atmosphärischen Luft enthaltene
Körperchen verschiedener Art, welche bei gewisser
Größe oder massenhafter Anhäufung dem bloßen
Auge sichtbar, aber auch in vollkommen rein erscheinender Luft
immer noch nachweisbar sind. Man unterscheidet gröbere
Stäubchen, die, von Winden oder vom Kehrbesen aufgewirbelt,
bei einigermaßen ruhiger Luft bald niederfallen;
Sonnenstäubchen, die nur im Sonnenstrahl sichtbar sind und
auch in scheinbar ruhiger Zimmerluft meist nicht zu Boden sinken;
endlich unsichtbare Stäubchen, die nur künstlich
nachweisbar sind und auch in ruhigster Luft sich schwebend
erhalten. Der S. entsteht hauptsächlich durch die Verwitterung
der Gesteine, wodurch diese in feinste Teilchen zerfallen, auch die
Vulkane werfen Staubmassen aus, die in weite Entfernungen getragen
werden; er entsteht ferner durch zahlreiche Verbrennungsprozesse,
die Ruß und Asche liefern; in jedem S. finden sich auch
Pollenkörner, Sporen der Kryptogamen und Keime der niedersten
Organismen. Endlich erzeugt der Mensch durch seine Thätigkeit
beständig S. Aus Flüssigkeiten und von feuchten
Oberflächen gelangen niemals Teilchen als S. in die Luft,
solange sich jene Substrate in Ruhe befinden; wohl aber kann durch
Verspritzen heftig bewegter Flüssigkeiten oder durch
Schaumbildung ein solcher Übergang bewirkt werden. In der
Regel wird jedoch Austrocknung und nachfolgende Zerkleinerung die
Veranlagung zum Zerstäuben von Pilzvegetationen in
Flüssigkeiten und von gelösten nicht flüchtigen
Substanzen sein. Die Zerkleinerung aber braucht nicht immer durch
mechanische Wirkungen zu erfolgen, sie kann vielmehr auch eine
Folge der geringen Bewegungen sein, welche durch
Temperaturänderungen bedingt sind und leicht
Zusammenhangstrennungen, Ablösungen von Partikelchen
herbeiführen. Landluft enthält weniger S. als Stadtluft,
im Winter und Frühjahr und nach Regen ist die Luft ärmer
an S. als im Sommer und Herbst und nach langer Dürre. 1 cbm
Landluft enthält bei trocknem Wetter 3-4,5, bei feuchtem 0,15
mg S., in Fabriken fand man bis 175 mg S. Aller S. besteht, seiner
Bildung entsprechend, aus mineralischen und organischen Substanzen;
unter letztern interessieren hauptsächlich die Keime
niederster Organismen, welche unter den feinsten Staubteilen zu
suchen sind. Stets enthält die Luft Sporen von Schimmelpilzen,
im März am wenigsten (5480 in 1 cbm), im Juni bis 54,460, nach
Regen mehr als nach Trockenheit. An Bakterien ist die Luft im
Winter arm (53), im Herbst am reichsten (121), nach Regen weniger
reich als bei Dürre. Stadtluft enthält ungleich mehr
Bakterien als Landluft. Die angegebenen Zahlen müssen bei der
Unvollkommenheit der Methode, nach welcher sie gewonnen wurden, im
allgemeinen als zu niedrig betrachtet werden. Der in der Luft
vorkommende S. gelangt vorzüglich durch die Respirationsorgane
zur Einwirkung auf den Menschen, wenn auch nur ein Teil des Staubes
in den Respirationsorganen zurückbleibt; die feinsten
Staubpartikelchen werden fast vollständig wieder ausgeatmet.
Der S., welcher an den Wänden der Luftwege hängen bleibt,
wird durch das Flimmerepithel, welches diese bedeckt, wieder aus
dem Körper entfernt. Vermag das Epithel die Staubmassen nicht
zu bewältigen, so entstehen krampfhafte Bewegungen, wie
Räuspern, Husten etc., zur Herausbeförderung der
staubhaltigen Schleimmassen. Reichen auch diese Hilfsmittel nicht
mehr aus, so entstehen Störungen, welche je nach der Art des
eingeatmeten Staubes verschieden charakterisiert sind. Nur
mechanisch reizender S. erzeugt die Staubeinatmungskrankheiten (s.
d.); S., welcher aus Partikelchen giftiger Substanzen besteht,
erzeugt namentlich durch den in den Mund und in den Magen
gelangenden Anteil eigentümliche Krankheitserscheinungen, am
wichtigsten aber sind die Keime solcher Organismen, welche als
Krankheitserreger zu betrachten sind. Man muß annehmen,
daß jene Keime ebensogut wie alle übrigen in Staubform
auftreten können, und in der That sind mehrere derselben im S.
nachgewiesen worden. Die Übertragung von Krankheiten durch den
S. der Luft ist mithin sehr wohl möglich, sofern nur nicht
jene Keime durch das Austrocknen ihre Entwickelungsfähigkeit
einbüßen. Vgl. Renk, Die Luft ("Handbuch der Hygieine",
von Pettenkofer und Ziemssen, Tl. 1, Abt. 2, Leipz. 1886);
Tissandier, Les poussieres de l'air (Par. 1877).
Staubbach, s. Lütschine.
Staubbeutel, s. Staubgefäß.
Staubbilder, elektrische, s. Lichtenbergsche Figuren.
Staubbrand, s. Brandpilze I.
Staubeinatmungskrankheiten. Der Staub, welcher bei der
Atmung in die Luftwege eingesogen wird,
246
Stäuben - Staubgefäße.
wird größtenteils von dem Schleim aufgenommen, durch
die Flimmerbewegung der Lungenepithelien zurück nach der
Luftröhre geführt und von hier durch Räuspern und
Husten ausgeworfen. Ist die eingeatmete Menge zu groß, so
wird ein Teil der feinsten Körnchen von der Lunge aufgenommen
und bleibt entweder in ihrem Gewebe selbst oder in den
Lymphgefäßen und Drüsen dauernd haften. Am
auffallendsten bemerkbar ist der Kohlenstaub, welcher beim
Lampenbrennen, Kohlen-, Holz- und Torffeuern, kurz überall
entsteht, wo unvollkommene Verbrennung irgend welcher Art vor sich
geht, also auch beim Tabaksrauchen, wenngleich in weit geringerm
Maß, als von den Gegnern des Rauchens angegeben wird.
Während die Lungen der Wilden und der im Freien lebenden Tiere
(nicht der Haustiere) ganz frei davon sind, findet sich bei den
Kulturmenschen und den unter gleichen Verhältnissen lebenden
Haustieren ein gewisser Grad von Schwarzfärbung
(Pigmentierung) der Lunge. Zu einer wirklichen Krankheit, der
Staubeinatmungskrankheit, gibt die Verunreinigung der Luft
Anlaß, wenn infolge gewisser Umstände die Luft mit Staub
geradezu überladen ist und die Einatmenden infolge ihrer
gewerblichen Thätigkeit gezwungen sind, derselben sich
fortwährend oder einen großen Teil des Tags auszusetzen.
So sind dem Kohlenstaub exponiert die Stein- und
Braunkohlenarbeiter, auch manche mit der Holzkohlenfabrikation
beschäftigte Arbeiter, dem Sandstaub oder den Kieselpartikeln
die Steinhauer und Schleifer, dem Eisenstaub die Schmiede,
Feilenhauer, Stahlschleifer, Spiegelglaspolierer, dem Tabaksstaub
die Tabaksarbeiter, dem Farbenstaub die Farbenarbeiter, der
kieselsauren Thonerde die Ultramarinarbeiter etc. Den Nachweis,
daß diese Substanzen wirklich in die Lunge eindringen,
liefert die anatomische, mikroskopische und chemische Untersuchung
der Lungen. Die Folgen der Staubinhalation bestehen in diesen
Fällen zunächst in Hyperämie und Katarrh der
Luftröhrenverzweigungen mit fortwährendem Räuspern,
Husten und Auswurf; weiterhin gesellt sich eine wirkliche
chronische Entzündung des Lungengewebes hinzu, welches seine
Elastizität mehr oder weniger verliert und sich bis zu einem
Grade, daß es unter dem Messer knirscht, verhärtet;
schließlich geht der Zustand in eine Verödung des
Lungengewebes über. Die Überladung des Lungengewebes mit
Kohlenpigment nennt man Anthrakosis, die mit Eisenpartikelchen
Pneumonosiderosis. Vgl. Hirt, Die Staubinhalationskrankheiten
(Leipz. 1871); Eulenberg, Handbuch der Gewerbehygieine (Berl.
1876); Merkel, Staubinhalationskrankheiten (in Ziemssens Handbuch,
Leipz. 1882).
Stäuben, das Fallenlassen des Kotes bei
Feldhühnern.
Staubbewässerung, s. Bewässerung, S. 859.
Staubfaden, s. Staubgefäße.
Staubfiguren, elektrische, s. Lichtenbergsche
Figuren.
Staubgefäße (Stamina, Staubblätter), die
den Blütenstaub erzeugenden Teile der Blüte bei allen
phanerogamen Pflanzen, bilden zusammen in einer Blüte den
männlichen Geschlechtsapparat (Andröceum) derselben und
entstehen wie die übrigen Blattgebilde der Blüte als
seitliche Höcker unterhalb des im Wachstum befindlichen
Scheitels der jungen Blütenanlage. Von besonderer Wichtigkeit
ist außer der Zahl die Verzweigung und die Verwachsung der S.
Verzweigte S. entstehen dadurch, daß an der jungen
Staubblattanlage neue Höcker auftreten, die zu einem
Büschel von Staubgefäßen auswachsen, während
das gemeinsame Fußstück sehr kurz bleibt; es tritt dies
z. B. bei den Staubblättern von Hypericum ein, die in Gruppen
von drei oder fünf in jeder Blüte zusammenstehen, aber
durch Verzweigung aus drei oder fünf ursprünglich
einfachen Staubblattanlagen hervorgegangen sind. Die Spaltung
(Chorise, dédoublement) der Staubblätter ist eine sehr
früh eintretende Teilung einer Staubblattanlage in zwei
später völlig getrennte Staubblätter, wie bei den
Staubgefäßen der Kruciferen. Verwachsene
Staubblätter entstehen durch seitliche Verschmelzung von
Staubblattanlagen, wie z. B. beim Kürbis. Die S. bestehen in
der Regel aus einem stielförmigen Träger, dem Staubfaden
(Filament), und einem durch eine Furche in zwei
Längshälften geteilten angeschwollenen Teil, dem
Staubbeutel (Anthere). Wenn sämtliche Staubfäden der
Blüte in ein einziges Bündel vereinigt sind, so nennt man
die S. einbrüderig (stamina monadelpha). So sind z. B. in der
männlichen Blüte des Kürbisses die S. in eine im
Mittelpunkt stehende Säule vereinigt. In den
Zwitterblüten dagegen bilden die einbrüderigen S. eine
Röhre um den in der Mitte stehenden Stempel (Fig. 1). Sind sie
in zwei oder mehrere Partien vereinigt, so werden sie
zweibrüderig (s. diadelpha) und vielbrüderig (s.
polyadelpha) genannt. Ersteres ist z. B. bei den Fumariaceen,
letzteres bei den Hypericineen Regel, wo die S. in drei Bündel
vereinigt sind (Fig. 2). Einen besondern Fall von
Zweibrüderigkeit bieten viele Schmetterlingsblütler,
indem hier von den zehn vorhandenen Staubgefäßen neun zu
einer gespaltenen Röhre verbunden sind, während das 10.
Staubgefäß vor der Spalte der Röhre frei steht
(Fig. 3). Bei manchen Pflanzen haben die Staubfäden
verschiedene Länge; wo zwei Kreise von Staubgefäßen
vorkommen, sind häufig die des einen kürzer als die des
andern. Bei den Kreuzblütlern finden sich sechs S.; von diesen
sind vier die längern, zwei andre, welche einem
äußern Kreis angehören und links und rechts stehen,
sind kürzer (viermächtige S., s. tetradynama). Bei vielen
Lippenblütlern und Skrofularineen gibt es zwei lange und zwei
kurze, sogen. zweimächtige S. (s. didynama). - Der Staubbeutel
ist ein meist aus zwei Fächern (thecae) bestehendes Gebilde,
in dessen Innenraum der Blütenstaub (Pollen) enthalten ist.
Fig. 4 versinnlicht den Durchschnitt durch einen jungen
Staubbeutel; der Teil, welcher die beiden Fächer
verknüpft, heißt Zwi-
Fig. 1. Einfache Staubgefäßröhre der Malve. Fig.
2. Vielbrüderige Staubgefäße. Fig. 3.
Zweibrüderige Staubgefäße einer
Schmetterlingsblüte. Fig. 4. Durchschnitt eines
Staubbeutels
247
Stäubling - Staubregen.
schenband oder Konnektiv (connectivum). Jedes Fach besteht aus
zwei durch eine Scheidewand getrennten, nebeneinander liegenden
Pollensäcken. Später wird diese Scheidewand
aufgelöst, und jedes Fach stellt dann eine einfache
Höhlung dar. Über den Blütenstaub s. Pollen und
Geschlechtsorgane der Pflanzen. Der Staubfaden ist entweder an das
untere Ende des Konnektivs angesetzt (basifix), oder er geht an
einem höhern Punkt in dasselbe über (dorsifix). Das
Konnektiv ist entweder gleichmäßig schmal, so daß
die beiden Fächer der Länge nach parallel nebeneinander
stehen, wobei es sich in irgend einer Form als sogen.
Konnektivfortsatz über die Antheren fortsetzen kann, z. B. bei
der Gattung Paris (Fig. 5), oder das Konnektiv ist zwischen den
Fächern in der Breite ausgedehnt, so daß die letztern
voneinander entfernt werden, bald nur mäßig, und dann
unten oft weit stärker als oben, so daß die Fächer
mehr und mehr in eine Linie zu liegen kommen, bald sehr
beträchtlich, so daß es einen Querbalken bildet, an
dessen Enden die Fächer sitzen (z. B. bei Salvia, Fig. 6),
oder auch wie eine Spaltung des Staubfadens erscheint, deren beide
Äste je ein Staubbeutelfach tragen, wie z. B. bei der
Hainbuche, bei der Haselnuß, bei den Malven. Eine
Eigentümlichkeit zeigen die Staubbeutel der
Kürbisgewächse, insofern hier die beiden Fächer
unregelmäßig gewunden sind (Fig. 7). Auch die
Staubbeutel können untereinander in eine Röhre vereinigt
sein, während ihre Staubfäden frei sind, wie bei den
Kompositen, die aus diesem Grund auch Synantheren, d. h.
Verwachsenbeutelige, genannt werden (Fig. 8a und b). Behufs
Ausstreuung des Blütenstaubes öffnen sich die beiden
Antherenfächer zur Blütezeit in bestimmter Weise,
gewöhnlich so, daß die Wand jedes Faches eine
Längsspalte bekommt; selten treten Querspalten auf, wie z. B.
bei der Tanne. Danach unterscheidet man die Staubbeutel als
antherae longitudinaliter und transverse dehiscentes. Diese Spalten
liegen meist an der dem Mittelpunkt der Blüte zugekehrten
Seite des Staubbeutels (antherae introrsae), bisweilen aber auch
dem Umfang der Blüte zugewendet (a. extrorsae), wie bei den
Schwertlilien, oder auch an der Seite, z. B. bei Ranunculus. Eine
andre Art des Öffnens ist die mittels Klappen (a. valvatim
dehiscentes), indem eine gewisse Stelle der Antherenwand als Deckel
sich von untenher abhebt, wie z. B. bei Berberis. Oder endlich
jedes Fach öffnet sich mittels eines meist an der Spitze
liegenden Loches (a. porose dehiscentes), wie bei der Kartoffel.
Das Öffnen der mit Spalten aufspringenden Staubbeutel wird
ermöglicht durch den Bau der Antherenwand. Diese besteht
nämlich aus zwei Zellenschichten: einer kleinzelligen
Epidermis und einer unter derselben liegenden Schicht weiterer
Zellen. Letztere sind an ihrer nach innen gekehrten Wand mit ring-
oder netzförmigen Verdickungsschichten ausgestattet, welche
wegen ihrer relativen Starrheit dieser Zellwand keine erhebliche
Zusammenziehung beim Austrocknen gestatten. Dagegen ist die an die
Epidermis stoßende Zellwand nicht verdickt; sie zieht sich
wie die Epidermis bei Wasserverlust stark zusammen. Da somit also
beide Seiten der Antherenwand beim Austrocknen verschiedene
Dimensionen annehmen, so muß dieselbe sich krumm werfen
dergestalt, daß die stärker sich zusammenziehende Seite,
d. h. die äußere, konkav wird, und somit gehen die
Wände auseinander. Die Spalte ist schon vorher angelegt, indem
in der Ausdehnung, in welcher sie entstehen soll, eine Partie von
Zellen zu Grunde geht, so daß dort das Durchreißen der
Wand den geringsten Widerstand findet. Die Ursache des Öffnens
der Antheren ist also das Austrocknen ihrer Wand; daher öffnen
sie sich beim Befeuchtetsein nicht und können durch Benetzen
mit Wasser wieder zum Schließen gebracht werden. Trocknes
Wetter ist daher der Befruchtung der Blüten und somit der
Samenbildung entschieden günstiger als nasses. - Bisweilen
werden gewisse Staubblätter regelmäßig
unvollständig ausgebildet, indem sie keinen Blütenstaub
enthalten. Derartige Staminodien können in verschiedenen
Formen auftreten, bei den Skrofularineen ist von fünf
Staubgefäßen eins bisweilen als bloßer Faden oder
als Schüppchen ausgebildet. Bei den Laurineen nimmt oft ein
ganzer Kreis von Staubblättern die Form von Staminodien in
Gestalt drüsenartiger Gebilde an. Bei der Parnassia palustris
folgt auf den einfachen Kreis der S. ein andrer von Staminodien,
welche hier als Nektarien (s. d.) ausgebildet sind, indem sie
schuppenförmige Blätter mit langen Wimpern darstellen,
deren jede mit einer kopfförmigen, honigtropfenähnlichen
Drüse endigt. Vgl. auch den Art. Blüte.
Stäubling, s. v. w. Lycoperdon.
Staubregen, die meist trocknen Niederschläge der
Atmosphäre, deren Substanz teils von der Erde aus mit den
aufsteigenden Luftströmungen in die höhern Gegenden der
Atmosphäre gelangt, sich mit dem Wind bis auf große
Strecken von dem Ort ihres Aussteigens entfernt und entweder
zugleich mit dem Regen und Schnee niederfällt, oder sich als
Staub (s. Passatstaub) oder trockner Nebel (s. Nebel und Herauch)
und Trübung der Atmosphäre niedersenkt, teils einen
kosmischen Ursprung hat, indem sie aus zu feinem Staub zerfallenen
oder zerriebenen Teilchen von Sternschnuppen und Feuerkugeln
bestehen kann, welche tief in die Erdatmosphäre hineingetaucht
sind, teils endlich Teile von kosmischen Staubmassen bildet, welche
im Weltenraum sich bewegen, und denen die Erde zuweilen in ihrer
Bahn begegnet. Zu den S. irdischen Ursprungs gehören folgende:
1) Die sogen. Blutregen (Blutquellen), die schon von den alten
Schriftstellern, wie unter andern von Livius und Plinius,
häufig erwähnt werden und im Mittelalter zu vielen
abergläubischen Ansichten Anlaß gaben. Die Nachrichten
über diese Blutregen beziehen sich aber meist nicht auf
trockne, sondern auf flüssige oder schleimige Massen, welche
als rote Flecke auftreten, den Boden, die Pflanzen und das Wasser
rot färben
248
Staubspritze - Staudt.
und ihren Ursprung in den Exkrementen von gewissen Insekten, wie
Bienen, Schmetterlingen etc., auch in dem Auftreten der
Blutregenalge (Protococcus pluvialis) haben. 2) Die roten S., d. h.
wirklicher Regen, welcher durch aufgewirbelten Staub rot
gefärbt ist, ereignen sich am häufigsten im Frühling
und Herbst, zur Zeit der Äquinoktialstürme. Auch der
Schnee kann durch solchen roten Staub rot gefärbt werden und
als erdiger roter Schnee niederfallen. Diese Färbung des
Schnees durch roten Staub muß aber nicht mit der oft
wahrgenommenen Färbung verwechselt werden, welche sich
öfters über größere Schneeflächen der
Polargegenden verbreitet, auch auf den Alpen und Pyrenäen
vorkommt und unter dem Namen Blutschnee (s. d.) bekannt ist. 3) Bei
den vulkanischen S. (meist grau) wird die Asche der Vulkane vom
Wind bis auf sehr weite Entfernungen fortgetrieben (Hekla,
westindische Vulkane). Ein auffallendes Beispiel dafür bot die
neueste Zeit, indem die in den letzten Monaten 1883 und 1884 in
Europa vielfach beobachteten eigentümlichen
Dämmerungs-Erscheinungen sowie das häufige Auftreten von
ungewöhnlich starkem Abend- und Morgenrot und das Bilden eines
braunroten Ringes um die Sonne als Folge des vulkanischen Ausbruchs
nachgewiesen sind, welcher 27. Aug. 1883 auf dem Krakatoa in der
Sundastraße erfolgte. 4) Schwefelregen (gelb), d. h. das
Herabfallen eines gelben oder gelblichroten Pulvers, meistens in
Begleitung von wirklichem Regen. Göppert hat nachgewiesen,
daß das gelbe Pulver aus vom Wind fortgeführtem und vom
Regen niedergeschlagenem Blütenstaub besteht, und zwar im
März und April aus Blütenstaub von Erlen und
Haselnuß, im Mai und Juni von Fichtenarten, Wacholder und
Birke, im Juli, August und September von Bärlappsamen, Rohr-,
Liesch- oder Teichkolben. 5) Getreideregen entstehen dadurch,
daß der Regen die kleinen Wurzelknollen gewisser Pflanzen,
wie des kleinen Schöllkrauts (Chelidonium minus), der
Butterblume (Ranunculus Ficaria), des epheublätterigen
Ehrenpreis (Veronica hederaefolia) u.a., aus dem Boden
ausspült und diese dann durch den Wind von ihrem Ursprungsort
weit fortgeführt werden und später zu Boden fallen. - Von
den kosmischen S. hat man erst in neuerer Zeit einige Kenntnis
erlangt. Am 1. Jan. 1869 war in Heßle bei Upsala ein
Meteorit, der aus zahlreichen weithin zerstreuten Stücken
bestand, niedergefallen und mit ihm zugleich ein schwarzer, Kohle
und metallisches Eisen enthaltender Staub (Meteorstaub). Ganz
dieselbe Zusammensetzung zeigte der Staub, welcher während
eines sechstägigen ununterbrochenen Schneefalls in Stockholm
im Dezember 1871 im Schnee gefunden wurde, und ebenso der
gleichzeitig im Innern Finnlands auf dem Schnee gesammelte Staub.
Es kann aber auch wohl vorkommen, daß Schnee und Regen
kosmischen Staub mit sich in kleinen Mengen zur Erde
herunterführen. Die wenigen kohlehaltigen Meteorsteine (s. d.,
S. 541), die wir kennen, zerfallen nämlich in unmerklichen
Staub, sobald sie mit Wasser oder Feuchtigkeit (Regen, Schnee,
Wolken) in Berührung kommen, wobei ihre Kittsubstanz
aufgelöst wird.
Staubspritze, s. v. w. Drosophor, s.
Zerstäubungsapparate.
Staubstrommethode, metallurgisches Verfahren, welches
darin besteht, daß zwei Ströme derjenigen Körper,
welche chemisch aufeinander einwirken sollen, sich in feinster
Verteilung entgegenkommen und durchdringen. Dies Prinzip ist zuerst
im Gerstenhöferschen Röstofen zur Anwendung gekommen, bei
welchem gepulverte Erze, durch Bänke aufgehalten, langsam
durch einen vorher stark geheizten Schachtofen fallen, während
von unten Luft in den Ofen strömt. Die Reaktion ist hierbei
sehr energisch, die durch Verbrennung entstandene schweflige
Säure passiert Flugstaubkammern und gelangt dann in die
Bleikammern zur Schwefelsäureerzeugung. Man benutzt den Ofen
zum Rösten von schwefelkiesreichen Erzen, Kupferrohstein,
Zinkblende etc. Ähnliche Versuche sind in Amerika bei der
Silbergewinnung gemacht worden, indem Stetefeldt mit seinem hohen
Schachtofen den Erzstaub frei, ohne daß er durch Bänke
aufgehalten wird, dem Luftstrom entgegenfallen läßt.
Auch hat man in ähnlicher Weise staubförmige
Brennmaterialien verwertet. Gemahlene und gebeutelte Holzkohle wird
durch einen Ventilator in einem Luftstrom angesogen und in einer
passenden Vorrichtung oder im Ofen selbst verpufft. Nach diesem
Prinzip sind der Eisenstreckofen von Resch, der Doppelzinkofen von
Dähn und der rotierende Puddelofen von Crampton eingerichtet,
wobei indessen Staub- und Luftstrom meist dieselbe Richtung
haben.
Staude, s. v. w. perennierende Pflanze, s.
Ausdauernd.
Staudenmaier, Franz Anton, kath. Theolog, geb. 11. Sept.
1800 zu Donsdorf in Württemberg, studierte im Wilhelmsstift zu
Tübingen, trat 1826 in das Priesterseminar zu Rottenburg,
folgte 1830 einem Ruf als Professor der katholischen Theologie nach
Gießen und 1837 nach Freiburg i. Br., wo er 1843 auch zum
Domkapitular ernannt wurde. Seit 1855 zurückgetreten, starb er
19. Jan. 1856. Unter seinen zahlreichen Schriften, in denen er eine
spekulative Konstruktion des Katholizismus anstrebte, sind
hervorzuheben: "Johann Scotus Erigena" (Frankf. 1834, Bd. 1); "Der
Geist des Christentums" (Mainz 1835; 8. Aufl. 1880, 2 Bde.);
"Darstellung und Kritik des Hegelschen Systems" (das. 1844); "Die
christliche Dogmatik" (Freiburg 1844-52, 4 Bde.); "Zum
religiösen Frieden der Zukunft" (das. 1846-51, 3 Tle.).
Staudenpappel, s. Lavatera.
Staudensalat, s. Lattich.
Staudigl, Joseph, Opernsänger (Baß), geb. 14.
April 1804 zu Wöllersdorf in Niederösterreich, wollte
sich im ersten Jünglingsalter dem geistlichen Stand widmen,
wandte sich dann nach Wien, um Chirurgie zu studieren, und
beschloß endlich, zunächst um seine materielle Lage zu
verbessern, seine herrliche Baßstimme auf der Bühne zu
verwerten. Anfangs als Chorist am Kärntnerthor-Theater
wirksam, gelang es ihm, in der Rolle des Pietro ("Stumme von
Portici") die er an Stelle des erkrankten Inhabers übernommen,
die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zu lenken, und infolge
des Beifalls, den er bei dieser Gelegenheit errang, wurden ihm nach
und nach immer größere Partien übertragen, bis er
endlich im Besitz aller ersten Rollen war. Von Wien aus, wo er bis
1856 dem Hofoperntheater angehörte, verbreitete sich sein Ruf
über ganz Deutschland, und nicht minder wurden seine
Leistungen in London anerkannt, dies um so mehr, da S. auch als
Oratorien- und Liedersänger glänzte und überdies die
englische Sprache vollkommen beherrschte. Er starb nach
fünfjähriger Krankheit 28. März 1861 in der
Irrenanstalt von Michelbeuerngrund.
Staudt, Karl Georg Christian von, Mathematiker, geb. 24.
Jan. 1798 zu Rothenburg a. Tauber, war 1822-27 Professor am
Gymnasium und Privatdozent an der Universität zu
Würzburg, 1827-33 Professor am Gymnasium und der
polytechnischen
249
Stauen - Staupitz.
Schule zu Nürnberg, von 1833 bis zu seinem Tod 1. Juli 1867
Professor an der Universität Erlangen. Staudts Verdienst
beruht namentlich in der Ausbildung der synthetischen Methoden in
der Geometrie, die er in seinem Hauptwerk: "Geometrie der Lage"
(Nürnb. 1847), und in den dazu gehörigen "Beiträgen"
(das. 1856, 1857, 1860) niedergelegt hat.
Stauen, das Unterbringen der Ladung im Schiffsraum, um
diesen möglichst auszunutzen und den Schwerpunkt von Schiff
und Ladung zusammen in eine solche Lage zu bringen, daß
ersteres hinreichende Stabilität hat. Gerät der
Schwerpunkt von Schiff und Ladung durch unsachgemäßes S.
in eine zu hohe Lage, so wird das Schiff zu "oberlastig" und
verliert an der für seine Sicherheit gegen Kentern notwendigen
Stabilität. Auch muß die Ladung so gestaut werden,
daß sie bei den heftigen Bewegungen des Schiffs im Seegang
ihre Lage nicht ändern kann. S. heißt auch das
Zurückhalten fließender Gewässer durch Schleusen,
Dämme und sogen. Stauwerke.
Staufen, Stadt im bad. Kreis Freiburg (Breisgau), am
Fuß des Schwarzwaldes, 290 m ü. M., hat eine kath.
Kirche, ein altertümliches Rathaus, ein Amtsgericht, Tuch-,
Filz- und Gummibandweberei, Weinbau und (1885) 1820 Einw. In der
Nähe die Ruinen der Staufenburg.
Staufen (Staufer), deutsches Kaisergeschlecht, s.
Hohenstaufen.
Staufenberg (Ritter von S.), altdeutsches Gedicht von
einem unbekannten elsässischen Dichter, wahrscheinlich aus dem
Anfang des 14. Jahrh., wurde im 16. Jahrh. von Fischart
überarbeitet und von Engelhardt (Straßb. 1823) und
Jänicke (in "Altdeutsche Studien", Berl. 1871) neu
herausgegeben.
Staufenburg, Ruine; Name mehrerer Ruinen, z. B. bei
Staufen und Gittelde (s. d.).
Stauffacher, Werner, nach der Sage von der Gründung
der schweizerischen Eidgenossenschaft ein wohlhabender Landmann aus
Schwyz, der sich auf das Zureden seiner Gemahlin Margareta Herlobig
an die Spitze der Erhebung der Waldstätte gegen die Vögte
Albrechts I. stellte und 1307 die Verschwörung im Rütli
stiftete. Ein Werner S. erscheint urkundlich als Landammann von
Schwyz 1313 und 1314.
Stauffenberg, Franz August, Freiherr Schenk von,
deutscher Politiker, geb. 4. Aug. 1834 zu Würzburg, studierte
in Heidelberg und Würzburg die Rechte, war bis 1860 als
Staatsanwalt in bayrischem Staatsdienst und lebte seitdem auf
seinem Gut Geißlingen bei Balingen in Württemberg. Seit
1866 Mitglied des bayrischen Abgeordnetenhauses, 1873-75
Präsident desselben, Führer der bayrischen
Fortschrittspartei, ward er 1868 in das Zollparlament, 1871
für München in den deutschen Reichstag gewählt,
schloß sich der nationalliberalen Partei an und war 1876-1879
erster Vizepräsident des Reichstags. 1880 schied er aus der
nationalliberalen Partei aus, ward Mitglied der liberalen
Vereinigung (Sezessionisten) und 1884 der deutschen freisinnigen
Partei.
Staunton (spr. stahnt'n), Stadt im nordamerikan. Staat
Virginia, Grafschaft Augusta, an einem Nebenfluß des
Shenandoah, mit großem Irrenhaus, Staatsanstalt für
Taubstumme und Blinde und (1880) 6664 Einw.; wird von Touristen
viel besucht.
Staunton (spr. stahnt'n), 1) Sir George Leonhard,
Reisender, geb. 1740 zu Galway in Irland, ging 1762 als Arzt nach
Westindien, dann nach Ostindien und begleitete 1792-94 Macartney
auf seiner Gesandtschaftsreise nach China, die er im "Account of an
embassy from the king of Great Britain to the emperor of China"
(Lond. 1791; deutsch, Zürich 1798) beschrieb. Er starb 14.
Jan. 1801 in London.
2) Sir George Thomas, Reisender, Sohn des vorigen, geb. 26. Mai
1781 zu London, begleitete seinen Vater 1792 nach China, studierte
dann in Cambridge, wurde 1799 bei der Faktorei der Ostindischen
Gesellschaft in Kanton angestellt und leistete bei den von 1814 bis
1817 zwischen England und China gepflogenen Verhandlungen wichtige
Dienste. Nach London zurückgekehrt, widmete er sich
litterarischen Arbeiten und übersetzte namentlich vieles aus
dem Chinesischen, z. B. den Kriminalkodex des chinesischen Reichs
(Lond. 1810; franz., Par. 1812, 2 Bde.). Er war bis 1852 Mitglied
des Unterhauses und starb 10. Aug. 1859 in London.
3) Howard, engl. Schriftsteller und berühmter
Schachspieler, geb. 1810, studierte zu Oxford, widmete sich dann in
London der journalistischen Thätigkeit und trug 1843 in einem
großen Schachspielwettkampf zu Paris über den Franzosen
Saint-Amant den Sieg davon, was ihm mit Einem Schlag den Ruf des
ersten Schachspielers in Europa verschaffte. Er erfreute sich
desselben bis zu dem großen Londoner Turnier 1851, aus
welchem der Deutsche Anderssen (s. d.) als erster Sieger
hervorging, und vermied es seitdem, an öffentlichen
Wettkämpfen teilzunehmen. S. starb 22. Juni 1874. Von seinen
Schriften über das Schachspiel wurde das Handbuch ("Laws and
practice of chess") mehrfach aufgelegt (neue Ausg. von Wormald,
1881). Auch leitete er lange Jahre die Schachrubrik in den
"Illustrated London News". Im übrigen beschäftigte er
sich mit dem Studium der ältern englischen Dramatiker und war
als Kommentator bei der Herausgabe einer der besten
Shakespeare-Ausgaben (Edition Routledge) beteiligt. Noch
veröffentlichte er "Great schools of England" (2. Aufl. 1869)
u. a.
Staupe, s. Hundsseuche und Pferdestaupe; böse S., s.
v. w. Epilepsie.
Staupenschlag (Staupbesen, lat. Fustigatio), die
früher gewöhnlich mit der Landesverweisung und mit
Ausstellung am Pranger verbundene Strafe des Auspeitschens bei
welcher der Delinquent vom Henker durch die Straßen
geführt und auf den entblößten Rücken
gepeitscht wurde.
Staupitz, Johann von, Gönner und Freund Luthers,
geboren im Meißenschen, studierte in Tübingen Theologie,
ward Prior im Augustinerkloster daselbst, 1502 Professor und der
eigentliche Organisator der neugegründeten Universität zu
Wittenberg, auch 1503 Generalvikar der (kleinen) sächsischen
Kongregation des Augustinerordens. In dieser Eigenschaft ward er
1505 in Erfurt Luthers geistlicher Vater und veranlaßte 1508
seine Berufung nach Wittenberg. 1512 legte er seine Professur
nieder und hielt sich in München, Nürnberg und Salzburg
auf; 1520 gab er auch das Amt des Generalvikars auf, zog sich aus
Scheu vor den Kämpfen, die er nahen sah, nach Salzburg
zurück, ward dort Hofprediger des Erzbischofs und 1522 Abt des
dortigen Benediktinerklosters. Hier mußte er, vom Erzbischof
von Salzburg zur Zustimmung zu der Bannbulle gegen Luther
aufgefordert, sich wenigstens zu der Erklärung verstehen,
daß er im Papst seinen Richter anerkenne, was Luther ihm als
eine Verdammung der Lehre auslegte, zu der S. ihn selbst gewiesen.
Er starb 1524. Seine hinterlassenen deutschen Schriften gab Knaake
heraus (Potsd. 1867). Vgl. Kolde, Die deutsche
Augustinerkongregation und J. v. S. (Gotha 1879); Keller, Joh. v.
S. (Leipz. 1888).
250
Staurodulie - Stearin.
Staurodulie (griech.), Anbetung des Kreuzes.
Staurolith, Mineral aus der Ordnung der Silikate
(Andalusitgruppe), kristallisiert in rhombischen, meist
säulenförmigen Kristallen und tritt häufig in
Zwillingsverwachsungen auf, von welchen die einer beinahe
rechtwinkeligen Durchkreuzung zweier Individuen den Namen
Kreuzstein sowie gelegentlich eine abergläubische Benutzung zu
Amuletten veranlaßt hat. S. ist rötlich- bis
schwärzlichbraun, selten etwas durchscheinend, gewöhnlich
undurchsichtig, glasglänzend, Härte 7-7,5, spez. Gew.
3,34-3,77. Er enthält zahlreiche mikroskopische
Einschlüsse (Quarz, Granat, Glimmer etc.); seine
Zusammensetzung entspricht am wahrscheinlichsten der Formel
H2R3(Al2)6Si6O34, worin R vorwaltend Eisen in der Form des
Öxyduls neben Magnesium ist. S. findet sich eingewachsen in
Thon- und Glimmerschiefer (namentlich in Paragonitschiefer) am St.
Gotthard, häufig mit Disthen gesetzmäßig
verwachsen, in Tirol, Mähren, Steiermark, im Departement
Finistere, bei Santiago de Compostela und in Nordamerika.
Staurophör (griech.), Kreuzträger.
Stauroskop (griech.), ein von Kobell angegebener
einfacher Polarisationsapparat zur Beobachtung der Farbenringe und
dunkeln Büschel in Kristallplatten.
Stauung, s. Stauen.
Stauungspapille, ein durch v. Gräfe in die
Augenheilkunde eingeführter Begriff, welcher besagt, daß
die Eintrittsstelle des Sehnervs in die Netzhaut von sehr
zahlreichen, strotzend gefüllten Venenästchen durchzogen
wird. Ob diese Stauung eine rein mechanische oder zugleich der
Ausdruck einer Entzündung des Sehnervs (Neuroretinitis) ist,
scheint noch zweifelhaft; dagegen ist die S. ein sehr wertvolles
Symptom, welches auf eine Steigerung des Druckes in der
Schädelkapsel, namentlich auf Geschwulstbildungen im Gehirn,
schließen läßt.
Stavanger, Hauptstadt des gleichnamigen Amtes, welches
9279 qkm (168,5QM.) mit (1876) 110,965 Einw. umfaßt, im
südwestlichen Norwegen, am Buknfjord, durch Eisenbahn mit
Egersund verbunden, ist auf felsigem Boden nach wiederholten
Feuersbrünsten ganz modern aus Holz erbaut, hat eine Domkirche
(im 12. und 13. Jahrh. im alten normännischen Stil erbaut,
1866 im Innern restauriert), eine Lateinschule, ein kleines Museum,
2 Häfen und (1885) 22,634 Einw., welche vornehmlich Schiffahrt
und Handel mit den Produkten der Fischerei betreiben. Die Stadt
besaß 1885: 285 Segelschiffe von 91,851 Ton. und 40
Dampfschiffe von 12,792 T. S. ist Sitz eines deutschen Konsuls. S.,
eine alte, aber erst im 18. Jahrh. wieder emporgekommene Stadt, war
bis 1685 Bischoffitz.
Stavelot (Stablo), Stadt in der belg. Provinz
Lüttich, Arrondissement Verviers, an der Ambleve und der
Staatsbahnlinie Gouvy-Pepinster, hat eine höhere Knabenschule,
Gerberei, Wollmanufakturen und (1887) 4452 Einw. - S. war bis 1801
die Hauptstadt des deutschen Reichsfürstentums S., dessen
Oberhaupt der jeweilige gefürstete Abt des 648 vom
austrafischen König Sigebert gegründeten
Benediktinerstifts S. war. Ein Leben des Abts Poppo (1020-48) von
Everhelm ist erhalten. Wichtig ist der Streit des Klosters gegen
den Erzbischof Anno von Köln um das Kloster Malmedy, in
welchem Anno 1071 unterlag. Von der Abteikirche ist nur noch ein
Teil des Turms vorhanden. In der Stadtkirche befindet sich der
kostbare Schrein des heil. Remaclus.
Stavenhagen, Stadt im Großherzogtum
Mecklenburg-Schwerin, Herzogtum Güstrow, an der Linie
Lübeck-Mecklenburgisch-Preußische Grenze der
Mecklenburgischen Friedrich Franz-Bahn, hat eine evang. Kirche, ein
Schloß mit Park, ein Progymnasinm, ein Waisenhaus, ein
Amtsgericht, eine Zuckerfabrik, eine Dampfmolkerei, Dampfmahl- und
Sägemühlen, eine Spiegelrahmenfabrik, 2
Selterwasserfabriken, Bierbrauerei und (1885) 3023 Einw. S. ist
Geburtsort des Dichters Fritz Reuter, dem am Rathaus eine
Gedenktafel gewidmet ist.
Stavoren (Staveren), Stadt in der niederländ.
Provinz Friesland, an der Zuidersee, Endpunkt der Eisenbahn
Leeuwarden-Sneek-S., mit (1887) 877 Einw.; die älteste Stadt
Frieslands, ehemals groß und mächtig durch Handel und
Schiffahrt, jetzt infolge der Versandung des Hafens ganz
unbedeutend.
Stawell, Stadt in der britisch-austral. Kolonie Victoria,
durch Eisenbahn mit Melbourne verbunden, mit 5 Bankfilialen,
Theater und (1881) 7348 Einw. In der Nähe die Pleasant
Creek-Goldfelder mit 1150 Goldgräbern.
Stawropol, 1) Gouvernement der russ. Statthalterschaft
Kaukasien, an der Nordgrenze gegen Astrachan und das donische
Gebiet, 68,631 qkm (1246 QM.) groß mit (1885) 657,554 Einw.
(Russen, nomadisierenden Kalmücken, Truchmenen, Nogaiern,
Armeniern). Das Gouvernement enthält zum Teil reiches
Ackerland, so daß in jedem Jahr über 16,000 Arbeiter zum
Einheimsen der Ernte aus Rußland kommen müssen, teils
weite, an Salzseen reiche, aber an Trinkwasser arme Steppen, auf
denen Viehzucht getrieben wird. Waldmangel ist nicht nur in der
Steppe, sondern auch in den Berggegenden fühlbar. Die beiden
Hauptflüsse Manytsch und Kuma sind wasserarm und verlieren
sich in den Sand. Getreide, Leinsaat, Sonnenblumenkerne, Wolle,
Häute und Talg werden nach Rostow am Don ausgeführt. Der
südlichste Zipfel des Gouvernements wird von der Eisenbahn
Rostow Wladikawkas durchzogen. Die gleichnamige Hauptstadt, am
Flüßchen Taschla, in dürrer, baumloser Ebene, 611 m
ü. M. gelegen, mit (1885) 36,561 Einw. (Russen, Tataren,
Armeniern, Persern, Nogaiern, Grusiern u. a.), ist Sitz eines
Zivil- und Militärgouverneurs und des kaukasischen und
tschernomorskischen Bischofs, hat 13 griechisch-russ. Kirchen, eine
armenische und eine kath. Kirche, eine Moschee, Nonnenkloster,
geistliches Seminar, vorzügliche Mädchenschule,
öffentliche Bibliothek, Theater und zahlreiche Fabriken, deren
Thätigkeit ebenso wie der Handel beständig im Zunehmen
sind. Die Stadt hat durch ihre Lage an der aus Persien nach
Rußland führenden Karawanenstraße große
kommerzielle Bedeutung, auch für die asiatische Post ist S.
Station. -
2) Kreisstadt im russ. Gouvernement Samara, an der Wolga, 1738
gegründet, mit (1885) 4883 Einw., welche sich vorwiegend mit
Anbau von Getreide, Zwiebeln und Kartoffeln beschäftigen.
Stazione (ital.), Bahnhof.
Steamer (Steamboat, engl., spr. stihmer, stihmboht),
Dampfschiff.
Stearin (C18H35O2)C3H5 findet sich in den meisten Fetten
neben Palmitin und Olein, besonders reichlich im Hammeltalg. Um es
aus diesem zu gewinnen, schmelzt man denselben und mischt ihn mit
so viel Äther, daß er nach dem Erstarren Breikonsistenz
besitzt, preßt wiederholt und kristallisiert den
Rückstand aus Äther häufig um. Das S. bildet farb-,
geruch- und geschmacklose, perlmutterglänzende Schuppen, ist
löslich in siedendem Alkohol und Äther, sehr schwer in
kaltem Alkohol, nicht in Wasser, reagiert neutral, schmilzt bei
62-64°, erstarrt wachsartig und wird
251
Stearinsäure - Stechapfel.
durch Alkalien leicht verseift. Es besteht aus
Stearinsäuretriglycerid und kann direkt durch Erhitzen von
Stearinsäure mit Glycerin erhalten werden. Das S. des Handels
ist kein neutrales Fett, sondern ein aus solchem dargestelltes
Gemisch von Stearinsäure und Palmitinsäure.
Stearinsäure C18H36O2 findet sich, an Glycerin
gebunden, als Stearin (s. d.) in den meisten Fetten, namentlich in
den festen, aber fast immer neben Palmitin und Olein. Aus diesen
Fetten, besonders aus Talg und Palmöl, wird im großen
ein Gemisch von S. und Palmitinsäure dargestellt, welches
unter dem Namen Stearin in den Handel kommt. Stearin liefert 95,7
Proz. S., Palmitin 94,8 Proz. Palmitinsäure, Olein 90,3 Proz.
Olein- oder Ölsäure. Zur Gewinnung des
Fettsäuregemisches erhitzte man das Fett ursprünglich mit
Kalkmilch (aus 14 Proz. gebranntem Kalk), trennte die Kalkseife von
dem glycerinhaltigen Wasser und schied aus derselben durch
Schwefelsäure die fetten Säuren ab. Gegenwärtig
arbeitet man in verschlossenen Kesseln (Autoclaves) unter einem
Druck von 8-10 Atmosphären (bei 170°) und erreicht eine
ziemlich vollständige Verseifung durch Anwendung von nur 2-4
Proz. Kalk, so daß bei der weitern Verarbeitung an
Schwefelsäure bedeutend erspart wird. Unter einem Druck von
10-15 Atmosphären und bei einer Temperatur vom Schmelzpunkt
des Bleies werden die Fette auch durch reines Wasser ohne Anwendung
von Alkalien zersetzt, und wenn man sie bei 315° mit
überhitztem Wasserdampf in geeigneten Apparaten behandelt, so
destillieren die Fettsäuren und das Glycerin über,
während in dem Apparat ein brauner, pechartiger Rückstand
bleibt, den man auf Photogen und Anilin verarbeitet. Diese beiden
Methoden sind im großen Maßstab ausgeführt,
gegenwärtig aber durch die Verseifung mit Schwefelsäure
verdrängt worden. Letztere wendet man besonders auf solche
Fette an, welche wegen ihrer Beschaffenheit oder ihrer
Verunreinigungen nicht mit Kalk verseift werden können, wie
Palmöl, Kokosöl, Knochenfett, Abfälle aus
Schlächtereien, Küchen etc. Man erhitzt die
möglichst gereinigten Fette unter Umrühren mit 6-12 Proz.
konzentrierter Schwefelsäure durch Dampf auf 110-177°,
kocht noch 15-20 Stunden das Produkt mit Wasser, reinigt es durch
wiederholtes Waschen, entwässert es durch Erhitzen in flachen
Pfannen und unterwirft es, da es sehr dunkel gefärbt ist, auch
unzersetztes Fett enthält, der Destillation durch
überhitzten Wasserdampf. Die Produkte, welche nach dieser
Methode erhalten werden, weichen in mancher Hinsicht von den durch
Kalkverseifung gewonnenen ab. Die Ausbeute beträgt bei
letzterer 45-48, bei der Schwefelsäureverseifung mit
Destillation 55-60 Proz. Kerzenmaterial. Das gewonnene Gemisch von
Fettsäuren läßt man in flachen Gefäßen
möglichst langsam grobkristallinisch bei 20-32° erstarren,
preßt unter starkem Druck zuerst kalt, dann bei 35-40°
die Ölsäure ab, aus welcher sich bei hinreichender
Abkühlung noch S. ausscheidet, die man auf
Zentrifugalmaschinen von der Ölsäure trennt, schmelzt und
kocht sämtliche S. mit stark verdünnter
Schwefelsäure und Wasser, klärt sie mit Eiweiß,
bleicht sie auch wohl durch Kochen mit schwacher
Oxalsäurelösung und gießt sie in Formen. Nach einer
neuern Methode erhitzt man das Fett mit 4-6 Proz.
Schwefelsäure etwa 2 Minuten auf 120° und kocht es dann
mit Wasser. Es findet vollständige Zersetzung statt, und von
der erhaltenen S. kann man 80 Proz. nach zweimaliger Pressung
direkt auf Kerzen verarbeiten, während nur der Rest von 20
Proz. zu destillieren ist. Nebenprodukte bei der
Stearinsäurefabrikation sind Glycerin und Ölsäure.
Letztere durch geeignete Prozesse in feste Fettsäuren
umzuwandeln (Ölsäure gibt mit schmelzenden Alkalien
Palmitinsäure und Essigsäure, mit salpetriger Säure
starre Elaidinsäure), ist bis jetzt in lohnender Weise noch
nicht gelungen. Reine S. erhält man aus Seife, wenn man diese
in 6 Teilen Wasser löst, 40-50 Teile kaltes Wasser zusetzt,
das ausgeschiedene Gemenge von saurem stearinsaurem und
palmitinsaurem Natron durch Umkristallisieren aus heißem
Alkohol trennt, das schwer lösliche Stearinsäuresalz mit
Salzsäure zersetzt und die S. aus Alkohol umkristallisiert.
Sie bildet farb- und geruchlose, silberglänzende
Kristallblättchen, ist leicht löslich in Alkohol und
Äther, nicht in Wasser, reagiert sauer, schmilzt unter starker
Volumvergrößerung bei 69° und erstarrt
schuppig-kristallinisch, ist in kleinen Quantitäten bei
vorsichtigem Erhitzen destillierbar, leichter im Vakuum und mit
überhitztem Wasserdampf. Von ihren Salzen sind die der
Alkalien in Wasser löslich, werden aber durch viel Wasser
zersetzt, indem sich unlösliche saure Salze ausscheiden und
basische gelöst bleiben. In Kochsalzlösung sind auch die
Alkalisalze der S. unlöslich. Die übrigen Salze sind
unlöslich; erstere finden sich in der Seife, stearinsaures
Bleioxyd im Bleipflaster. Beim Zusammenschmelzen von S. mit
Palmitinsäure wird der Schmelzpunkt des Gemisches selbst unter
den der Palmitinsäure herabgedrückt. Das
fabrikmäßig dargestellte Gemisch von S. und
Palmitinsäure wird auf Kerzen verarbeitet und zum Enkaustieren
von Gipsabgüssen benutzt.
Ein Patent auf Darstellung von Kerzen aus S. und
Palmitinsäure nahmen zuerst Gay-Lussac, Ehevreul und
Cambacères 1825, doch wurde erst de Milly Begründer der
Stearinindustrie, indem er 1831 die Kalkverseifung einführte
und 1834 auch die Verseifung mit wenig Kalk andeutete und 1855
vervollkommte. 1854 gelangten Tilghman und Melsens unabhängig
voneinander zu der Zersetzung der Fette durch überhitztes
Wasser, und Wright und Fouché konstruierten Apparate
für diese Methode, welche indes, wie auch die mit einer
Destillation verbundene Behandlung der Fette mit überhitztem
Wasserdampf, nur vorübergehende Bedeutung errang. Anfang der
40er Jahre begründeten Jones, Wilson, Gwynne die Methode,
welche auf der schon 1777 von Achard beobachteten Zersetzung der
Fette durch Schwefelsäure beruht und in neuerer Zeit
allgemeine Verbreitung gefunden hat.
Stearoptene, s. Ätherische Ole.
Steatit, s. Speckstein.
Steatom (griech.), veralteter Name krankhafter
Geschwülste von festerer Konsistenz.
Steatopygie (griech.), übermäßige
Fettanhäufung am Gesäß der Hottentotinnen, s.
Hottentoten.
Steatórnis, s. Guacharo.
Steatose (griech.), krankhafte Fettbildung.
Steben (Untersteben), Dorf und Badeort im bayr.
Regierungsbezirk Oberfranken, Bezirksamt Naila, im Frankenwald und
an der Linie Hof-S. der Bayrischen Staatsbahn, 580 m ü. M.,
hat eine evangelische und eine kath. Kirche, ein Forstamt, 5
Stahlquellen und ein Moorbad, die bei Blutarmut, Bleichsucht,
Skrofulose, Rheumatismus, Gicht etc. angewendet werden, und (1885)
772 meist evang. Einwohner. Vgl. Klinger, Bad S. (2. Aufl., Hof
1875).
Stecchetti (spr. stecketti), Lorenzo, Pseudonym des ital.
Dichters Olindo Guerrini (s. d.).
Stechapfel, Pflanzengattung, s. Datura.
252
Stechbeeren - Stecknitz.
Stechbeeren, s. Daphne und Rhamnus.
Stechbeitel, s. Beitel.
Stechbüttel, s. v. w. Stichling.
Stechdorn, s. v. w. Schlehendorn (s. Pflaumenbaum, S.
970); s. v. w. Ilexaquifolium; s. v. w. Rhamnus cathartica.
Stecheiche, s. v. w. Stechpalme, Hex aquifolium.
Stechen, in der Jägerei das Auswerfen kleiner
Vertiefungen im Boden durch den Dachs und den Fuchs beim Aufsuchen
von Insektenlarven, auch das Einbohren des Schnabels (Stechers) der
Schnepfen in den Boden zum Fang von Regenwürmern sowie das
Aufeinanderstoßen der Männchen und Weibchen zur Paarzeit
in der Luft, besonders der Schnepfen zur Strichzeit; endlich das
Spannen des Stechschlosses an einer Büchse durch den Druck am
Stecher.
Stechente, s. Lumme.
Stecher, in der Orgel dünne, aber feste Stäbe,
die unter den Tasten der Klaviatur angebracht sind und, durch diese
herabgedrückt, den weitern Mechanismus in Bewegung setzen.
Vgl. Abstrakten.
Stechginster, s. v. w. Ulex europaeus.
Stechheber, eine weite, bisweilen an einer Stelle zu
einer Kugel oder in andrer Form erweiterte, auch konisch zulaufende
Glas- oder Metallröhre, deren obere Öffnung bequem durch
den aufgedrückten Finger geschlossen werden kann (s. Figur),
dient zum Herausheben von Flüssigkeit aus einem Faß od.
dgl. Der S. füllt sich beim Eintauchen in die Flüssigkeit
u. bleibt gefüllt, wenn man ihn mit verschlossener oberer
Öffnung herauszieht. Durch vorsichtiges Heben des
verschließenden Fingers kann man beliebige Quantitäten
der Flüssigkeit abfließen lassen. Vgl. Pipette.
Stechhelm, s. Helm, S. 364.
Stechpalme, s. v. w. Ilex aquifolium.
Stechwinde, Pflanzengattung, s. v. w. Smilax.
Steckbrief, öffentliches Ersuchen um Festnahme einer
zu verhaftenden Person, welche flüchtig ist oder sich
verborgen hält. Nach der deutschen Strafprozeßordnung
(§ 131) können Steckbriefe von dem Richter sowie von der
Staatsanwaltschaft erlassen werden. Ohne vorgängigen
Haftbefehl ist eine steckbriefliche Verfolgung nur statthaft, wenn
ein Festgenommener aus dem Gefängnis entweicht oder sonst sich
der Bewachung entzieht. In diesem Fall sind auch die
Polizeibehörden zum Erlaß des Steckbriefs befugt. Der S.
muß eine Beschreibung der Person des Verfolgten
(Signalement), soweit dies möglich, enthalten sowie die
demselben zur Last gelegte strafbare Handlung und das
Gefängnis bezeichnen, in welches die Ablieferung zu erfolgen
hat, wofern nicht wegen der Abholung des Festgenommenen eine
Nachricht erbeten wird. Ist ein S. unnötig geworden, so
erfolgt dessen Widerruf (Steckbriefserledigung) auf demselben Weg,
auf dem er erlassen ist.
Steckenknechte, bei den Landsknechten dem Profoß
beigegebene, zur Ausführung von Prügelstrafen "Stecken"
tragende Gehilfen.
Steckenkraut, s. Ferula.
Stecker, Anton, Afrikareisender, geb. 17. Jan. 1855 zu
Josephsthal bei Jungbunzlau in Böhmen, studierte zu Heidelberg
Naturwissenschaften und begleitete 1878 G. Rohlfs auf seiner
Expedition nach Kufra. 1879 nach Bengasi zurückgekehrt, ging
er im Auftrag der Afrikanischen Gesellschaft 1880 nach Tripolis und
von da mit Rohlfs nach Abessinien. Während Rohlfs nach Europa
zurückkehrte, nahm S. den Tsanasee kartographisch auf, kam
1881 nach Godscham, drang von da bis in die Gallaländer,
geriet aber in die Gefangenschaft des Königs Menelik von
Schoa. Auf Verwendung Antinoris freigegeben, nahm S. noch einige
Seen in Abessinien auf und kehrte 1883 nach Europa zurück. Er
starb 15. April 1888 in seinem Geburtsort an der
Lungenschwindsucht.
Steckling (Stopfer), ein beblätterter, halbreifer
oder junger Zweig einer Pflanze, den man in die Erde steckt, damit
er sich bewurzele und dann zu einer neuen, selbständigen
Pflanze sich entwickle. Man schneidet ihn dicht unter einem Auge
(bei Verbenen mit Beibehaltung eines Stückchens vom Stiel),
schneidet einige der untern Blätter ab und steckt ihn in Sand
oder Torfmull. Für die schwierigen Pflanzen oder für eine
Vermehrung in großartigem Maßstab hat man kalte,
halbwarme und warme Vermehrungshäuser und benutzt doppeltes
Glas, d. h. im Vermehrungshaus (auch Wohnzimmer) noch Glasscheiben
oder Glasglocken auf den Stecklingstöpfen oder Schalen;
gleichmäßige Feuchtigkeit und Beschattung gegen
brennende Sonnenstrahlen verhindern das Verwelken und Abtrocknen,
zeitweises Lüften des innern Glases das Faulen. Stecklinge von
Pflanzen mit starkem Saft oder Milchsaft steckt man in Sand mit
stehendem Wasser.
Steckkmuschel (Pinna L.), Gattung aus der Familie der
Miesmuscheln (Mytilidae), mit schiefdreieckigen, vorn spitzen,
hinten klaffenden, dünnen Schalen. Die Steckmuscheln stecken
mit dem spitzen Ende im Schlamm oder Sand und sind durch feine
Byssusfäden an der Umgebung befestigt. Die größte
Art ist die 70 cm lange schuppige S. (Pinna squamosa Gm.), im
Südlichen Ozean und im Mittelländischen Meer. Diese und
die nur 30 cm lange edle S. (P. nobilis L.), im
Mittelländischen und Atlantischen Meer, werden namentlich im
Busen von Tarent gefischt. Den 10-25 cm langen, goldbraunen Bart
verspinnt man mit Seide und fertigt feine und haltbare Handschuhe,
Geldbeutel etc. daraus (s. Byssus). Hin und wieder findet man
wertlose Perlen von brauner Farbe in ihr. Im Altertum fabelte man
von dem sogen. Muschelwächter (Pinnotheres), einem Krebs,
welcher seinen Wirt, die Pinna, vor Gefahren warnen, dafür
aber in ihr wohnen sollte. Die letztere Angabe ist richtig, die
erstere grundlos.
Stecknadeln, s. Nadeln.
Stecknetz (Doppelgarn), Netz zum Fang von
Rebhühnern, Fasanen und Wachteln, gewöhnlich 15 bis 16 m
lang und 35 cm hoch, welches aus zwei spiegelig gestrickten
Außengarnen und einem in der Mitte liegenden Innengarn mit
engern Maschen besteht. Wenn Hühner gesprengt sind und man
dieselben sich zusammenlocken hört, so stellt man zwischen
ihnen die Stecknetze mittels Stellstäbchen auf und lockt sie
dann mittels einer Hühnerlocke (s. d.) zusammen. Wenn sie
durch die Maschen des Außengarns durchkriechen, so bleiben
sie in dem faltigen (busigen) Innengarn hängen. In gleicher
Weise kann man auch die Steckgarne an das Ende nicht zu breiter
Kartoffelstücke und an Hecken stellen und die Hühner
hineintreiben. Der Fang mit diesen Garnen ist leicht, die
Hühner werden jedoch dabei gewöhnlich so beschädigt,
daß man sie nicht lebend aufbewahren kann. Über den Fang
der Wachteln im S. s. Wachtel.
Steckknitz, Fluß im Kreis Herzogtum Lauenburg der
preuß. Provinz Schleswig-Holstein, entspringt aus dem
Möllnsee und fließt in die Trave, ist kanalisiert und
mit der in die Elbe mündenden Delvenau in Verbindung gesetzt,
so daß nun die ganze (56 km lange) Schiffahrtsstrecke
zwischen der Elbe und Trave Stecknitzkanal heißt.
253
Steckrübe - Steen.
Steckrübe, s.Raps.
Stedingerland, fruchtbarer Landstrich in der oldenburg.
Wesermarsch, begreift im wesentlichen das heutige Amt Berne und ist
berühmt durch seine freiheitliebenden und tapfern Bewohner,
die Stedinger (Stettländer). In alten Zeiten umfaßte der
Stedinggau außer dem jetzigen S. die vormaligen vier
Marschvogteien Moorrieh, Oldenbrook, Strückhausen und
Hammelwarden, die Vogtei Wüstenlande (die Stedingerwüste
oder Wösting genannt), das jenseit der Weser gelegene
Osterstade und wahrscheinlich auch den damals schon vorhandenen
Teil des nachmaligen Vogteidistrikts Schwey. Das jetzige S. liegt
zwischen der Ochte, Weser und Hunte, wird von mehreren kleinen
Flüssen, der Berne, Hörspe und Ollen, durchströmt
und ist an zwei Seiten von der Geest umgeben. Der Boden, dessen
obere Lage von dem fetten Wasserschlamm gebildet worden, ist
fruchtbar und der Landstrich unter allen Marschdistrikten
Oldenburgs der gesündeste; wegen seiner niedrigen Lage bedarf
er aber der Eindeichung. - Als König Heinrich IV. 1062 das
linke Weserufer von der Mündung der Ochte bis zum
Butjadingerland dem Erzbischof von Bremen schenkte, siedelte dieser
Rüstringer und Holländer in dem durch Deiche dem
Fluß abgerungenen Gebiet an. Sie nannten sich Stedinger, d.h.
Uferbewohner. Ursprünglich zu Zehnten verpflichtet,
wußten sie sich bei der Schwäche mehrerer
Erzbischöfe allmählich jeder Zahlung zu entziehen und
wahrten ihre Grenzen ebenso energisch gegen die Grafen von
Oldenburg, deren Burgen Lichtenberg und Line sie 1187
zerstörten. Auch Erzbischof Hartwig II., dem der Papst schon
gestattete, einen Kreuzzug gegen die Stedinger zu predigen, konnte
sie nicht unterwerfen (1207). Einer seiner Nachfolger, Gerhard II.,
verklagte sie 1232 beim Papst Gregor IX. als Ketzer; die Folge
waren Bann und Interdikt und ein neuer Kreuzzug, für dessen
Zustandekommen besonders Konrad von Marburg thätig war. Kaiser
Friedrich lI. ließ sich außerdem zur
Achtserklärung herbei. Bald ward unter Anführung des
Herzogs Heinrich von Brabant, der Grafen von Holland, von der Mark,
von Kleve und von Oldenburg ein Heer von 40,000 Mann gesammelt,
welches teils zu Land, teils auf der Weser 1234 gegen die bei
Oldenesch (Altenesch) 11,000 Mann stark in Schlachtordnung
stehenden Stedinger anrückte. Letztere wurden 27. Mai nach
tapferm Widerstand in die Flucht geschlagen. Tausende kamen um, und
gegen die Gefangenen ward schrecklich gewütet und das Land
verwüstet. Die Sieger teilten sich darauf in dasselbe, der
größte Teil fiel dem Erzbischof von Bremen und den
Grafen von Oldenburg zu; doch überließen diese das
Erworbene meist den Besiegten oder neuen Kolonisten wieder zu
Meierrecht. Erzbischof Nikolaus von Bremen (1422-35) sicherte die
Stellung der Stedinger durch ein besonderes Landrecht. Auf dem
Schlachtfeld von Altenesch wurde an der Stelle einer verfallenen
Kapelle 27. Mai 1834 ein Denkmal ("Stedingsehre") errichtet. Vgl.
Schumacher, Die Stedinger (Brem. 1865).
Steeden (Steeten), Dorf im preuß. Regierungsbezirk
Wiesbaden, Oberlahnkreis, an der Lahn, hat eine Dolomithöhle
mit zahlreichen Knochen vorweltlicher Tiere, Kalkbrennerei und
(1885) 645 Einw.
Steele, Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Düsseldorf, Landkreis Essen, an der Ruhr, Knotenpunkt der
Linien Ruhrort-Holzwickede, Vohwinkel-S., S.-Witten und Heissen-S.
der Preußischen Staatsbahn, 69 m ü. M., hat ein
Amtsgericht, wichtigen Steinkohlenbergbau und (1885) 8237 meist
kath. Einwohner.
Steele (spr. stihl), Sir Richard, engl. Schriftsteller,
geb. 1671 zu Dublin, studierte in Oxford (Genosse Addisons), trat
dann als gemeiner Soldat in die Armee (was seine Enterbung zur
Folge hatte) und versuchte sich nebenbei als Schriftsteller. Mitten
in einem extravaganten Leben überraschte er die Welt durch den
moralischen Traktat "The christian hero"; ihm folgten einige
ebenfalls moralische Lustspiele. Als Herausgeber der "Gazette", des
offiziellen Regierungsorgans, hatte er den Vorteil, wichtige
Nachrichten aus sicherster Quelle verbreiten zu können, sah
sich aber bei ihrer Beurteilung durch manche Rücksichten
gehemmt. Er gab daher seit 1709 eine eigne, dreimal
wöchentlich erscheinende Zeitschrift: "The Tatler", heraus, in
der er "eine belehrende und zum Denken anregende Unterhaltung"
versprach. Der Inhalt war sehr vielseitig, der Beifall allgemein.
Die bedeutendsten Schriftsteller boten ihre Hilfe an, Addison wurde
der hervorragendste Mitarbeiter. Bald vergrößerte sich
das Unternehmen: seit 1711 erschien täglich "The Spectator",
der in einem novellistischen Rahmen Unterhaltungen über
litterarische, ästhetische, selten politische Dinge,
Erzählungen, moralische Betrachtungen brachte. Im J. 1713
löste "The Guardian" den "Spectator" ab, lenkte aber zu tief
in das politische Fahrwasser, um dauernd Erfolg zu haben, zumal S.
im whiggistischen Sinn wirkte, was sogar 1714 seinen
Ausschluß aus dem Parlament herbeiführte. Als bald
darauf mit der Thronbesteigung Georgs I. die Whigs ans Ruder
traten, kam S. wieder zu Ehren und erhielt die Stelle eines
Oberstallmeisters zu Hamptoncourt. Er starb 1. Sept. 1729. Seine
Lustspiele erschienen 1761, seine Briefe 1787. Vgl. Montgomery,
Memoirs of Sir R. S. (Lond. 1865, 2 Bde.); Dobson, R. S. (das.
1886).
Steen, Jan, holländ. Maler, geboren um 1626 zu
Leiden, war Schüler N. Knupfers zu Utrecht und soll sich dann
in Haarlem bei A. van Ostade, vielleicht auch nach Dirk Hals,
gebildet haben. 1648 ließ er sich in die Malergilde zu Leiden
aufnehmen, und 1649 verheiratete er sich im Haag, wo er bis 1653
thätig war. Von 1654 bis 1658 wohnte er wieder in Leiden, dann
bis 1669 in Haarlem, und 1672 erhielt er in Leiden die Erlaubnis,
eine Schenke zu halten. Er wurde daselbst 3. Febr. 1679 begraben.
S. ist der geistreichste und humorvollste der holländischen
Genremaler, der auch eine scharfe gesellschaftliche Satire nicht
scheut. Er malte biblische Darstellungen in sittenbildlicher,
bisweilen humoristischer Auffassung (Hauptwerke: Simson unter den
Philistern, in Antwerpen; Verstoßung der Hagar und Hochzeit
zu Kana, in Dresden), zumeist aber Szenen aus dem mittlern und
niedern Bürgerstand, in welchen er die größte
Feinheit und Mannigfaltigkeit der Charakteristik mit derbem,
ausgelassenem, oft groteskem Humor zu verbinden weiß. Er
liebt es, seinen figurenreichen Darstellungen oft eine moralische
Tendenz unterzulegen oder durch sie ein Sprichwort oder eine
allgemeine Wahrheit zu versinnlichen. Am besten ist er im
Reichsmuseum zu Amsterdam vertreten, wo sich ein St. Niklasfest,
der berühmte Papageienkäfig, die kranke Dame mit dem
Arzt, eine Tanzstunde und eine Darstellung des Sprichworts "Wie die
Alten sungen, so zwitschern die Jungen" befinden. Von seinen
übrigen Werken sind die hervorragendsten: die Menagerie und
die Lebensalter (im Haag), die Unterzeichnung des Ehekontrakts
(Braunschweig), das Bohnenfest (Kassel), der Streit beim Spiel und
der Wirtshausgarten (Berlin) und die Hochzeit (St. Petersburg). In
der koloristischen Durchführung seiner Bilder ist S.
ungleich.
254
Steenbergen - Steffeck.
Doch übertrifft er in seinen besten und sorgfältigsten
Arbeiten alle Zeitgenossen an geistreicher, fein zusammengestimmter
Färbung und meisterhafter Behandlung des Helldunkels. Vgl. T.
van Westrheene, J. S. (Haag 1856). - Sein Sohn Dirk soll sich als
Bildhauer bekannt gemacht haben.
Steenbergen, Stadt in der niederländ. Provinz
Nordbrabant, Bezirk Breda hat eine katholische und eine reform.
Kirche, einen Hafen, starke Krapp-, auch Garancinfabrikation und
(1887) 6790 Einw. S. war früher Festung.
Steendysser, s. Gräber, prähistorische.
Steenkerke (Steenkerque), Dorf in der belg. Provinz
Hennegau, Arrondissement Soignies, an der Naasee (zur Senne), mit
860 Einw., historisch denkwürdig durch den Sieg der Franzosen
unter dem Marschall von Luxemburg über Wilhelm III. von
England 3. Aug. 1692.
Steenstrup, Johann Japetus Smith, Zoolog und
Prähistoriker, geb. 8. März 1813 zu Vang in Norwegen, war
bis 1845 Lektor für Mineralogie in Sorö, dann Professor
der Zoologie und Direktor des zoologischen Museums in Kopenhagen,
privatisiert seit 1885. Von Bedeutung für die Tierkunde im
allgemeinen sind seine Arbeiten über das Vorkommen des
Hermaphroditismus in der Natur (Kopenh. 1846) und über den
Generationswechsel (das. 1842). Außerdem arbeitete er
über die Cephalopoden, über niedere Schmarotzerkrebse
(mit Lütken, Kopenh. 1861) und über die Wanderung der
Augen bei den Flundern (das. 1864). Lange Jahre widmete er sich
auch der Untersuchung der Torfmoore und der
Kjökkenmöddinger Dänemarks, bei denen er nicht nur
die damalige Tier- und Pflanzenwelt, sondern auch die Erzeugnisse
früherer Kultur berücksichtigte. - Sein Sohn Johannes,
geb. 5. Dez. 1844 in Sorö, seit 1877 Professor der nordischen
Altertumskunde in Kopenhagen, machte sich als Historiker bekannt
durch "Studien über Waldemars Erdebuch "(1873) und ein
größeres Werk über die Normannen (1876-86, 4
Bde.).
Steenwijck (spr. -weik). 1) Hendrik der ältere,
niederländ. Maler, geboren um 1550 zu Steenwijk im Kreis
Overyssel, kam früh nach Antwerpen, wo er Schüler von
Hans Fredeman de Vries wurde und 1577 in die Lukasgilde eintrat. Er
siedelte aber bald nach Frankfurt a. M. über, wo er um 1603
starb. S. war Architekturmaler und hat vorzugsweise das Innere
gotischer Kirchen und großer Säle in genauer, strenger
Zeichnung, aber mit harter Farbe dargestellt. Bilder von ihm
befinden sich in den Galerien von Wien, Petersburg, Stockholm,
Kassel u. a. D.
2) Hendrik der jüngere, Sohn des vorigen, ebenfalls
Architekturmaler, geboren um 1580 zu Frankfurt a. M., war
später in Antwerpen und London thätig und starb nach
1649. Er hat Kircheninterieurs, große Hallen und
Palasträume mit Staffage, aber auch die architektonischen
Hintergründe zu Bildnissen andrer Künstler gemalt. Seine
Bilder sind häufig (z. B. in Berlin, in der kaiserlichen
Galerie zu Wien, im Louvre zu Paris, in der Eremitage zu St.
Petersburg und in den Galerien zu Dresden und Kassel). Seine
malerische Behandlung ist freier und breiter als die des
Vaters.
Steenwijk (spr. -weik), Stadt in der niederländ.
Provinz Overyssel, Bezirk Zwolle, an der Steenwijker Aa und der
Bahnlinie Zwolle-Leeuwarden, Sitz eines Kantonalgerichts, mit
mehreren Kirchen, Ackerbau, lebhafter Industrie und Handel und
(1887) 5065 Einw. S. war früher Festung und ist namentlich
bekannt durch die Belagerung von 1580 und die Einnahme durch die
Spanier 1582. Nordwestlich davon der Flecken Steenwijkerwold, mit
Ackerbau, Viehzucht, Torfstich, starker Besenbinderei und (1887)
6045 Einw.
Steeple-chase (engl., spr. stihpl tsches',
"Kirchturmrennen"), ein Wettrennen, bei welchem man früher
einen Kirchturm oder einen ähnlichen hervorragenden Gegenstand
zum Ziel setzte und dann querfeldein über Hecken und
Zäune, durch Bäche und Flüsse hindurch auf denselben
zujagte. Gegenwärtig versteht man in Deutschland unter S. ein
Rennen mit Hindernissen, bei welchem die Reiter auf einer mit
Flaggen abgesteckten Bahn in unebenem Terrain verschiedene feste,
natürliche oder künstlich angelegte Hindernisse "nehmen"
müssen, um das Ziel zu erreichen.
Stefan, Joseph, Physiker, geb. 24. März 1835 zu St.
Peter bei Klagenfurt in Kärnten, studierte seit 1853 zu Wien,
habilitierte sich 1858 daselbst für mathematische Physik,
wurde 1863 Professor der Physik an der Universität und 1866
Direktor des physikalischen Instituts. 1875-85 war er Sekretär
der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Akademie der
Wissenschaften in Wien, 1883 Präsident der internationalen
wissenschaftlichen Kommission der elektrischen Ausstellung und 1885
Präsident der internationalen Stimmtonkonferenz. Er arbeitete
über die Fortpflanzung des Schalles, über Polarisation,
Interferenz und Doppelbrechung des Lichts, über Diffusion und
Wärmeleitung der Gase, über die Abhängigkeit der
Wärmestrahlung von der Temperatur, über die
elektrodynamischen Erscheinungen und die Induktion.
Steffani, Agostino, Abbate, ital. Komponist, geb. 1655 zu
Castelfranco in Venetien, erhielt seine musikalische Ausbildung in
Venedig und München (bei Ercole Bernabei), wurde 1675 in
letzterer Stadt Organist, um 1681 Direktor der kurfürstlichen
Kammermusik und erhielt 1688 infolge seiner Oper "Servio Tullio"
die Kapellmeisterstelle am Hof zu Hannover, wo er die Musik zu
hoher Blüte brachte. Seine italienischen Opern, welche dort im
Garten zu Herrenhausen mit großem Glanz zur Aufführung
kamen, wurden auch ins Deutsche übersetzt und in den Jahren
1690-1700 auf dem Operntheater zu Hamburg gegeben. Bedeutender aber
als diese und seine kunstvollen Kirchenwerke sind seine zahlreichen
Kammerduette zu italienischen Texten, welche die größte
Kunst des Tonsatzes mit einer gesangreichen und ausdrucksvollen
Melodie vereinigen und als Muster ihrer Gattung gelten. Später
nahm mehr und mehr die Diplomatie sein Interesse in Anspruch.
Nachdem er seine Kapellmeisterstelle 1710 an Händel, mit dem
er befreundet war, abgetreten, wurde er vom Kurfürsten von der
Pfalz zum Geheimrat, vom Papst zum Protonotar und Bischof von Spiza
(in partibus) ernannt und widmete sich öffentlich nur noch
staatswissenschaftlichen und geistlichen Geschäften, die ihn
1729 auch noch einmal nach Italien führten. Er starb auf der
Reise 1730 in Frankfurt a. M. Von seinen wenigen im Druck
erschienenen Kompositionen nennen wir: "Psalmodia vespertina"
(für 8 Stimmen, 1674); "Sonate da camera a due violini, alto e
continuo" (1679); "Duetti da camera a soprano e contralto" (1683)
und "Janus quadrifons" (Motetten mit Basso continuo für 3
Stimmen, von denen jede beliebige weggelassen werden kann.
Steffeck, Karl, Maler, geb. 4. April 1818 zu Berlin, kam
1837 in das Atelier von Franz Krüger, später in das von
Karl Begas und ging 1839 nach Paris, wo er eine Zeitlang im Atelier
von Delaroche arbeitete, besonders aber nach Horace Vernet
studierte.
255
Steffenhagen - Steg
Von 1840 bis 1842 hielt er sich in Italien auf und malte nach
seiner Rückkehr meist Jagd- und Tierstücke, schwang sich
aber auch zu einem großen Geschichtsbild: Albrecht Achilles
im Kampf mit den Nürnbergern um eine Standarte, auf (1848, in
der Berliner Nationalgalerie), welches sowohl durch den Glanz des
Kolorits als durch die meisterhafte Darstellung der Pferde
ausgezeichnet war. In der Darstellung von Pferden in ruhiger
Stellung oder dramatischer Bewegung, aber auch andrer Tiere bewegte
sich fortan seine Hauptthätigkeit. Insbesondere bildete er das
Sportsbild und das Pferdeporträt zu großer
Virtuosität aus. Seine Hauptbilder dieser Gattung sind:
Pferdeschwemme, zwei Wachtelhunde um einen Sonnenschirm streitend
(1850, in der Berliner Nationalgalerie), der lauernde Fuchs,
Arbeitspferde (1860), Halali (1862), Pferdekoppel (1870),
Wochenvisite (1872), Wettrennen (1874), Zigeunerknabe durch einen
Wald reitend, die Stute mit dem toten Füllen. Daneben hat S.
auch zahlreiche Porträte, insbesondere Reiterbildnisse (Kaiser
Wilhelm I., Kronprinz Friedrich Wilhelm und v. Manteussel), und
einige Geschichtsbilder (König Wilhelm auf dem Schlachtfeld
von Königgrätz, im königlichen Schloß zu
Berlin; Übergabe des Briefs Napoleons III. an König
Wilhelm bei Sedan, im Zeughaus zu Berlin) gemalt. Seit dem Anfang
der 50er Jahre entfaltete S. eine umfangreiche Lehrthätigkeit.
1880 wurde er als Direktor der Kunstakademie nach Königsberg
berufen. Er hat auch lithographiert und radiert.
Steffenhagen, Emil Julius Hugo, Rechts- und
Literarhistoriker, geb. 23. Aug. 1838 zu Goldap in
Ostpreußen, studierte zu Königsberg die Rechte, wandte
sich aber bald vorzugsweise litterarwissenschaftlichen Studien zu
und habilitierte sich 1865 in der juristischen Fakultät als
Privatdozent. 1867 ging er nach Athen, um die dortige
Nationalbibliothek im Auftrag der Athener Universität neu zu
ordnen, folgte 1870 einem Ruf als Stadtbibliothekar nach Danzig,
erhielt 1871 eine Kustodenstelle an der Königsberger
Bibliothek, wurde 1872 als Bibliotheksekretär nach
Göttingen versetzt und übernahm 1875 die Leitung der
Universitätsbibliothek in Kiel. 1884 wurde er zum
Oberbibliothekar ernannt. Schon als Student veröffentlichte er
aus Königsberger Handschriften "Beiträge zu v. Savignys
Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter" (Königsb.
1859, 2. Ausg. 1861) und den von ihm entdeckten Originaltext von
Johannes Faxiolus "De summaria cognitione" im "Jahrbuch des
gemeinen deutschen Rechts" (Bd. 3, 1859), welchen Arbeiten er 1861
den Katalog der juristischen, 1867 und 1872 den der historischen
sowie in Haupts "Zeitschrift für deutsches Altertum" (Bd. 13,
1867) die Beschreibung der altdeutschen Handschriften der
Königsberger Bibliotheken folgen ließ. Außer
Aufsätzen in verschiedenen Zeitschriften schrieb er noch: "De
inedito juris germanici monumento" (Königsb. 1863); "Die neun
Bücher Magdeburger Rechts" (das. 1865); "Deutsche
Rechtsquellen in Preußen" (Leipz. 1875). 1877 übertrug
ihm die Wiener Akademie der Wissenschaften die kritische
Bearbeitung der Sachsenspiegelglosse. Als Vorarbeit dazu erschien
von ihm in den Sitzungsberichten der Akademie "Die Entwickelung der
Landrechtsglosse des Sachsenspiegels" (Wien 1881-87, 9 Hefte). An
bibliothekwissenschaftlichen Schriften gab er heraus: "Die neue
Aufstellung der Universitätsbibliothek zu Kiel" (Kiel 1883);
"Die Klosterbibliothek zu Bordesholm und die Gottorfer Bibliothek"
(mit A. Wetzel, das. 1884); "Über Normalhöhen für
Büchergeschosse" (das. 1885); "Verzeichnis der laufenden
periodischen Schriften der Universitätsbibliothek Kiel" (das.
1887); "Die Ordnungsprinzipien der Universitätsbibliothek
Kiel" (Burg 1888).
Steffens, Henrich, Philosoph, Naturforscher und Dichter,
geb. 2. Mai 1773 zu Stavanger in Norwegen, widmete sich seit 1790
zu Kopenhagen naturwissenschaftlichen Studien, bereiste dann
Norwegen, eröffnete 1796 zu Kiel naturwissenschaftliche
Vorlesungen, wandte sich aber schon im folgenden Jahr nach Jena, wo
er ein Anhänger von Schillings Naturphilosophie wurde. 1800
ging er nach Freiberg, wo er Werners Gunst gewann und
"Geognostische geologische Aufsätze" (Hamb. 1810)
ausarbeitete, die er später in seinem "Handbuch der
Oryktognosie" (Berl. 1811-24, 4 Bde.) weiter ausführte. Nach
seiner Rückkehr nach Dänemark 1802 hielt er Vorlesungen
an der Kopenhagener Universität, ging aber 1804 als Professor
nach Halle, wo er die "Grundzüge der philosophischen
Naturwissenschaft" (Berl. 1806) herausgab, und 1811 nach Breslau.
1813 trat er in die Reihen der Freiwilligen ein und machte die
Freiheitskriege bis zur ersten Einnahme von Paris mit. Nach dem
Frieden kehrte er zu seinem akademischen Lehrerberuf nach Breslau
zurück, folgte 1831 einem Ruf an die Universität zu
Berlin und starb hier 13. Febr. 1845. S. war einer der
Hauptvertreter der spekulativen Richtung der Naturforschung,
beteiligte sich aber auch lebhaft an andern Fragen der Zeit, wie er
z. B. in Breslau in der sogen. "Turnfehde" mit seinen "Karikaturen"
(s. unten) und dem "Turnziel" (Bresl. 1818) entschieden gegen die
Turnsache Partei nahm und später eifrig die Sache der
Altlutheraner verfocht (vgl. seine Schrift "Wie ich wieder
Lutheraner wurde", das. 1831). Von seinen naturwissenschaftlichen
Arbeiten ist noch die "Anthropologie" (Bresl. 1824, 2 Bde.)
hervorzuheben, Zeitfragen hat er in religiös und politisch
mehr als konservativem Geist unter anderm in den Schriften:
"Karikaturen des Heiligsten" (Leipz. 1819-21, 2 Bde.), "Von der
falschen Theologie und dem wahren Glauben" (Bresl. 1824, neue Aufl.
1831) behandelt, neben welchen die "Christliche
Religionsphilosophie" (das. 1839, 2 Bde.) zu erwähnen ist. Von
seinen dichterischen Arbeiten (gesammelt als "Novellen", Bresl.
1837-38, 16 Bde.) sind besonders "Die Familien Walseth und Leith"
(1827, 5 Bde.), "Die vier Norweger" (1828, 6 Bde.) und "Malkolm"
(1831, 2 Bde.), Werke, die sich namentlich durch meisterhafte
Naturschilderungen aus seiner nordischen Heimat auszeichnen,
hervorzuheben. Eine Selbstbiographie schrieb er unter dem Titel:
"Was ich erlebte" (Bresl. 1840-45, 10 Bde.). Nach seinem Tod
erschienen "Nachgelassene Schriften" (Berl. 1846). Vgl. Tietzen,
Zur Erinnerung an S. (Leipz. 1871); Petersen, Henrik S. (deutsch
von Michelsen, Gotha 1884).
Steg, bei den Streichinstrumenten das zierlich
ausgeschnittene, aus festerm Holz gefertigte Holztäfelchen,
das zwischen den beiden Schalllöchern auf der Oberplatte
aufgestellt ist, und über das die Saiten gespannt sind. Der S.
steht mit seinen beiden Füßen fest auf der Oberplatte
auf; genau unter dem einen Fuß ist zwischen Ober- und
Unterplatte der Stimmstock (die Seele) eingeschoben, welcher ein
Nachgeben der Oberplatte verhindert und dem S. eine einseitige
feste Stütze gibt, die dem andern Fuß, sobald eine Saite
schwingt, eine kräftige stoßweise Übertragung der
Schwingungen auf die Oberplatte ermöglicht. Beim Klavier
heißt S. die parallel mit dem Anhängestock laufende
lange Leiste, die auf dem Re-
256
Steganographie - Steiermark.
sonanzboden aufliegt, und über welche die Saiten gespannt
sind. - An der ionischen Säule heißt S. der schmale
Streifen zwischen den Kannelüren.
Steganographie (griech.), Geheimschrift.
Steganopodes, s. v. w. Ruderfüßer, s.
Schwimmvögel.
Stege, Hauptstadt der dän. Insel Möen (s.
d.).
Steglitz, Dors im preuß. Regierungsbezirk Potsdam,
Kreis Teltow, an der Linie Berlin-Magdeburg der Preußischen
Staatsbahn und an der Dampfstraßenbahn S.-Schöneberg,
hat eine schöne gotische evang. Kirche, ein Progymnasium, eine
Blindenanstalt, ein Feierabendhaus für Lehrerinnen, ein
Denkmal des Prinzen Friedrich Karl (auf der Maihöhe),
bedeutende Gärtnerei, Seidenraupenzucht, Musterlandwirtschaft
und (1885) 8501 meist evang. Einwohner.
Stegreif, s. v. w. Steigbügel; Stegreifritter,
Raubritter. Aus dem S., eigentlich: ohne abzusteigen, dann s. v. w.
ohne Vorbereitung; daher Stegreifdichtung, s. v. w. Improvisation
(s. d.).
Stegreifkomödie, s. Commedia dell' arte.
Stehbolzen, Bolzen, gegen deren Ansätze
plattenförmige Körper gepreßt werden können,
so daß letztere durch die Bolzen in bestimmter Entfernung
voneinander festgehalten werden.
Stehendes Gut, s. Takelung.
Stehkolben (Kochflaschen), s. Kolben.
Stehlsucht (Kleptomanie), s. Geisteskrankheiten, S.
35.
Steichele, Anton, Erzbischof von München-Freising,
geb. 22. Jan. 1816 zu Wertingen in Schwaben, studierte in
München katholische Theologie, ward 1838 Kaplan, 1841 Domvikar
in Augsburg, 1844 geistlicher Rat u. Sekretär des Bischofs von
Augsburg, Peter v. Richarz, 1847 Domkapitular und 1873 Dompropst.
In fast klösterlicher Zurückgezogenheit lebend, widmete
sich S. ganz der Wissenschaft, namentlich der Kirchengeschichte;
für seine Verdienste um diese verlieh ihm die theologische
Fakultät in München 1870 die Doktorwürde. Seine
hauptsächlichsten Werke sind: "Friedrich, Graf von Zollern,
Bischof von Augsburg, und Johann Geiler von Kaisersberg. Mit
Briefen" (Augsb.1854); "Bischof Peter v. Richarz" (das. 1856); "Das
Bistum Augsburg, historisch und statistisch beschrieben" (das.
1861-87, Bd. 1-5). Durch seine Gelehrsamkeit, Frömmigkeit und
Milde für eine hohe kirchliche Würde besonders geeignet,
ward er 1878 vom König nach dem Tod Scherrs zum Erzbischof von
München-Freising ernannt.
Steier, Stadt, s. Steyr.
Steierdorf (ungar. Steierlak), Markt im ungar. Komitat
Krasso Szöreny, an der Flügelbahn Jassenova-S., mit
berühmtem Kohlen- und Eisensteinbergbau der
Österreich.-Ungarischen Staatsbahn und (1881) 9239 deutschen
Einwohnern. In der Nähe das Eisenwerk Anina und der
Bergwerksort Oravicza (s. d.).
Steiermark (hierzu Karte "Steiermark"), österreich.
Herzogtum, grenzt nördlich an Ober- und Niederösterreich,
östlich an Ungarn, westlich an Salzburg und Kärnten,
südlich an Krain und Kroatien und umfaßt 22,355 qkm
(405,99 QM.). Die Bodenbeschaffenheit veranlaßt eine
natürliche Einteilung des Landes in das Hochgebirgsland von
Obersteiermark, das fruchtbare Hügelland von Mittelsteiermark
und das von Slowenen bewohnte Bergland von Untersteiermark. Das
Land nimmt an allen Ketten der Ostalpen Anteil: am nördlichen
Gebirgszug durch die zu den Salzkammergutalpen gehörigen
Massivs des Dachsteins (2996 m), des Kammergebirges, des
Totengebirges, des Grimming (2346 m), des Pyrgas (2244 m) und des
Buchsteins (2224 m), alle nördlich von der Enns gelegen.
Südlich von dieser erheben sich zwischen Enns und Mur die
eigentlichen Steirischen Alpen, im westlichen Teil auch Niedere
Tauern genannt, mit dem Hochgolling (2863 m), im östlichen
Teil als Seckauer Alpen, welche noch weiter östlich in die
Steirisch-Österreichischen Alpen übergehen, mit den
Gruppen des Hochthor (2372 m), Hochschwab (2278 m) und Hochveitsch
(1982 m), woran sich endlich der Semmeringberg und -Paß
anschließen. Das Gebiet der S. zwischen der Mur und Drau wird
von den Kärntnerisch-Steirischen Alpen erfüllt mit dem
Eisenhut (2441 m) im äußersten Südwesten und dem
Zirbitzkogel (2397 m), südlich von Judenburg. Zwischen Lavant
und Mur befinden sich die Stainzer Alpen mit der Koralpe (2141 m),
deren östliche Fortsetzung, der Posruck und die weinreichen
Windischen Bühel, sich zwischen Mur und Drau herabsenkt.
Östlich von der Mur erheben sich die Fischbacher Alpen, welche
nördlich mit dem Wechsel (1738 m) dem Semmering
gegenübertreten, den Schöckel bei Graz (1446 m)
einschließen und nach O. gegen die Raab hin in das Steirische
Hügelland übergehen. Das Land in S. zwischen Drau und
Save endlich gehört den Karawanken und Steiner Alpen (Grintouz
2559 m, Oistriza 2350 m) mit deren östlichen Fortsetzungen,
dem Bachergebirge (1542 m), dem Bergland von Cilli und dem
Matzelgebirge an der kroatischen Grenze, an. Größere
Ebenen sind: das Grazer, Leibnitzer und Pettauer Feld. Die
wichtigsten Flüsse sind: die Drau, welcher die Mur (mit der
Mürz) zufließt, und die Save (mit dem Sann und der
Sotla). Minder wichtig, weil nicht schiffbar, sind: die Enns (mit
der Salza), die Raab (mit der Feistritz und Lasnitz) und die Traun,
die aus den Abflüssen der Seen des steirischen Salzkammerguts,
des Grundelsees, Altausseer Sees und Ödensees, entsteht.
Außer diesen gibt es in S. nur kleine Gebirgsseen, z. B. den
Leopoldsteiner See bei Eisenerz, den Erlassee an der
österreichischen Grenze. Das Klima ist nach der
Bodenbeschaffenheit verschieden, rauher im Hochgebirge (Aussee
+6° C.), günstiger im fruchtreichen Flachland (Cilli fast
+10° C.). Unter den zahlreich vorkommenden Mineralquellen sind
die Säuerlinge von Rohitsch und Gleichenberg, die Saline zu
Aussee, die indifferenten Thermen von Tüffer, Römerbad,
Neuhaus und Tobelbad sowie die Eisenquelle zu Einöd
hervorzuheben. Andre Kurorte sind: St. Radegund und Frohnleiten mit
Kaltwasserheilanstalten. S. zählte Ende 1869: 1,137,990, Ende
1880: 1,213,597 Einw., so daß sich die Bevölkerung im
Durchschnitt jährlich um 0,58 Proz. vermehrte und auf 1 qkm 54
Einw. kommen. Ende 1887 wurde sie auf 1,261,006 Seelen berechnet.
Der Nationalität nach sind 67 Proz. Deutsche und 33 Proz.
Slowenen (die Sprachgrenze läuft südlich von Eibiswald
nach Spielfeld an der Mur, dann längs derselben;
außerdem finden sich deutsche Sprachinseln im slowenischen
Gebiet), der Religion nach größtenteils Katholiken (nur
9221 Protestanten und 1782 Israeliten). Die produktive
Bodenfläche beträgt im ganzen 93 Proz.; von derselben
kommen auf Ackerland 20,26 Proz., auf Weinland 1,63, auf Wiesen
12,78, auf Weiden und Alpen 12,62, auf Wald 51,48 Proz., so
daß unter allen Kronländern Österreichs S.
verhältnismäßig das waldreichste ist. Die
fruchtbarsten Teile des Herzogtums sind die Thäler, besonders
das Mur- und das Mürzthal, und mit geringen Ausnahmen die
Ebenen. Hauptprodukte sind: Hafer (durchschnittlich 1,450,000 hl),
Mais (1,220,000 hl), Roggen
256a
Steiermark
257
Steiermark (geographisch - statistisch).
(1,000,000 hl) und Weizen (815,000 hl); ferner Buchweizen
(600,000 hl), Hirse, Kartoffeln (1,640,000 hl), Futterrüben
(3,150,000 metr. Ztr.), Kraut, Kürbisse, Klee, Heu; endlich
von Handelspflanzen Flachs (30,000 metr. Ztr.), Hanf, Hopfen und
Weberkarden. Die Obstkultur ist noch sehr vernachlässigt,
gutes Obst (Äpfel und Pfirsiche) kommt hauptsächlich nur
in der Gegend von Marburg vor. Die Weinkultur erstreckt sich von
Mittelsteiermark über das ganze Unterland (Zentralpunkte:
Luttenberg, Radkersburg, Gonobitz) und liefert gute Sorten
(durchschnittlich 375,000 hl). Von großer Bedeutung ist die
Viehzucht. In ausgedehnterm Maß wird die Pferdezucht nur in
einzelnen Hauptthälern, so im Ennsthal, betrieben, wo das
schwere norische Pferd zu Hause ist. Von Rinderrassen sind das
Pusterwalder und Mürzthaler Vieh in Obersteiermark, die
Mariahofer Rasse im mittlern und südlichen S. vertreten. Auf
niedriger Stufe steht die Schafzucht, wogegen Schweine sehr stark
gezüchtet werden. Geflügel kommt namentlich in den
slowenischen Teilen sehr häufig vor. Auch mit Seidenraupen
werden seit längerer Zeit Versuche gemacht. Nach der
Zählung von Ende 1880 betrug der Viehstand in S.: 61,338
Pferde, 663,173 Stück Rindvieh, 188,273 Schafe, 43,821 Ziegen
und 532,721 Schweine. Die Flüsse und Seen sind reich an
trefflichen Fischarten (Forellen, Saiblingen). Auf den Hochgebirgen
trifft man noch Gemsen; außerdem ist die Jagd von geringem
Belang.
Den größten Reichtum besitzt S. in seinen nutzbaren
Mineralien. 1887 waren 84 Bergbau- und 19 Hüttenunternehmungen
mit zusammen 12,719 Arbeitern im Betrieb; die Produktion ergab
einen Wert von 11,24 Mill. Gulden. Am wichtigsten ist die
Produktion von Roheisen, welche durch die ausgezeichnete
Qualität des Produkts Weltruf erlangt hat, quantitativ aber in
den letzten Jahren (wegen der durch die Konkurrenz andrer
Produktionsländer gedrückten Preise) erheblich
eingeschränkt worden ist. Es waren 1887 nur 8 Eisenerzbergbaue
im Betrieb, vor allen an dem berühmten Erzberg bei Eisenerz
(Produktion 3,7 Mill. metr. Ztr. Erz). Roheisen wurde von 16 Werken
mit 22 Hochöfen in einer Menge von 1,104,600 metr. Ztr.
produziert. Die größten Hüttenwerke sind zu Hieflau
und Eisenerz, Vordernberg, Trofaiach, Neuberg und Zeltweg.
Zunächst an Bedeutung steht der Braunkohlenbergbau im
Köflacher, Leoben-Fohnsdorfer und Trifailer Becken (55
Unternehmungen, 19 Mill. metr. Ztr. Kohlenförderung). Andre
Bergbau-, resp. Hüttenprodukte sind: Graphit (25,500 metr.
Ztr.), Zink (12,900 metr. Ztr.), in geringer Menge Silber, Blei und
Glätte, Manganerz und Schwefelkies; ferner Salz zu Aussee
(181,832 metr. Ztr.). Die industrielle Thätigkeit des Landes
besteht hauptsächlich in der Verarbeitung des Roheisens. Es
bestehen in Ober- und Mittelsteiermark zahlreiche, zum Teil
ausgedehnte Eisenguß- und Raffinierwerke, welche Schienen,
Wagenachsen, Ackergerät, Sägen, Bleche, Draht, Guß-
und Zementstahl etc. verfertigen. Sehr bedeutend sind ferner: die
Sensenindustrie (jährlich 3,7 Mill. Stück Sensen, Sicheln
etc.), die Erzeugung von Schmiedewaren, dann die Maschinenindustrie
(zu Graz). Außerdem bestehen Fabriken für Zement, Glas
(18), Papier, chemische Produkte (zu Hrastnigg), Kerzen und Seifen,
Tuch und Filz, Zündwaren, Schieß- und Sprengpulver,
Zuckerraffinerien, Kaffeesurrogatfabriken, Bierbrauereien (600,000
hl), Branntweinbrennereien, Schaumweinfabriken, Tabaksfabriken,
Baumwollspinnereien, Dampfsägen etc. Als Förderungsmittel
des Handels dienen vor allen die Eisenbahnen, die Ende 1887 in
einer Länge von 1046 km im Betrieb waren. Die
Hauptverkehrsader ist die Linie Wien-Triest der Südbahn, an
welche sich deren Seitenlinien, ferner die Staatsbahnlinie
Kleinreifling-St. Michael-Villach, die Graz-Köflacher
Eisenbahn und die Ungarische Westbahn anschließen. Andre
Kommunikationsmittel sind neben den Landstraßen die
Schiffahrtslinien der Drau, Mur und Save (zusammen 579 km).
Für die geistige Kultur sorgen: die Universität und die
technische Hochschule zu Graz, die Bergakademie zu Leoben, 2
theologische Lehranstalten; an Mittelschulen 5 Obergymnasien, ein
Untergymnasium, 2 Oberrealschulen, eine Unterrealschule, 2
Lehrerbildungsanstalten, eine solche Anstalt für Lehrerinnen,
ein Mädchenlyceum, 7 Handelslehranstalten, eine
Staatsgewerbeschule, 2 gewerbliche Fach- und 31
Fortbildungsschulen, eine Zeichenakademie, eine Ackerbauschule, 4
andre Schulen für Land- und Forstwirtschaft, eine Berg- und
Hüttenschule, 768 öffentliche Bürger- und
Volksschulen (mit 2883 Lehrpersonen und 150,435 schulbesuchenden
Kindern). In kirchlicher Beziehung hat das Land 2 katholische
Bistümer (Seckau und Lavant, mit dem Sitz in Graz und
Marburg). An der Spitze der Landesverwaltung steht die
Statthalterei zu Graz, der Hauptstadt von S. Andre Behörden
für S. sind: das 3. Korpskommando, ein Landwehrkommando, eine
Postdirektion, ein Oberlandesgericht (für S., Kärnten und
Krain), eine Finanzlandesdirektion etc. Der Landtag besteht aus 63
Mitgliedern und zwar den beiden Fürstbischöfen, dem
Universitätsrektor, 12 Abgeordneten des
Großgrundbesitzes, 19 Abgeordneten der Städte,
Märkte und Industrieorte, 6 Abgeordneten der beiden Handels-
und Gewerbekammern (Graz und Leoben) und 23 Vertretern der
Landgemeinden. Außerdem sind in den politischen Bezirken
eigne Bezirksvertretungen thätig. In den Reichsrat entsendet
S. 23 Abgeordnete. Das Wappen von S. s. auf Tafel
"Österreichisch-Ungarische Länderwappen". Die politische
Einteilung des Landes ist aus folgender Tabelle zu ersehen:
Bezirke Areal in QKilom. in Qmeilen Bevölkerung 1880
Bruck 2209 40,12 60101
Cilli 2002 36,36 124133
Cilli (Stadt) 2 0,04 5393
Feldbach 984 17,87 81770
Graz 1779 32,31 113328
Graz (Stadt) 22 0,40 97791
Gröbming 1914 34,76 28250
Hartberg 976 17,73 52542
Judenburg 1636 29,71 49544
Deutsch -Landsberg 794 14,42 49487
Leibnitz 730 13,26 64089
Leoben 1086 19,72 41492
Lietzen 1398 25,39 23738
Luttenberg 316 5,74 25615
Marburg 1176 21,35 85057
Marburg (Stadt) 9 0,16 17628
Murau 1388 25,21 27185
Pettau 992 18,01 81328
Radkersburg 457 8,30 38082
Rann 592 10,75 46695
Weiz 1076 19,54 59223
Windischgraz 817 14,84 41126
Zusammen: 22355 405,96 1213597
Vgl. Göth, Das Herzogtum S. (Wien 1840-43, 2 Bde.);
Hlubek, Ein treues Bild des Herzogtums S. (das. 1860); Stur,
Geologie der S. (das. 1871, mit Karte); Janisch,
Topographisch-statistisches
258
Steiermark - Steifensand.
Lexikon von S. (das. 1875-85, 3 Bde.); Frischauf,
Gebirgsführer durch S. (das. 1874); Rosegger, Das Volksleben
in S. (6. Aufl., Wien 1888); Jauker, Das Herzogtum S. (das. 1880);
"Spezial-Ortsrepertorium von S.", herausgegeben von der
statistischen Zentralkommission (das. 1883); Schlossar, Kultur- und
Sittenbilder aus S. (Graz 1885); Derselbe, Die Litteratur der S.
(das. 1886); Krauß, Die nordöstliche S. (das. 1888).
Geschichte.
Unter der Herrschaft der Römer, während welcher die
Kelten, darunter als Hauptstamm die Taurisker, das Land bewohnten,
gehörte der östliche Teil Steiermarks zu Pannonien, der
westliche zu Noricum. Während der Völkerwanderung
besetzten oder durchzogen Westgoten, Hunnen, Ostgoten, Rugier,
Langobarden, Franken und Avaren nacheinander das Land. Seit 595
nahmen Slawen (Winden, weshalb früher die Gegend die windische
Mark hieß) erst den untern Teil, nach Besiegung der Avaren
auch den obern Teil desselben in Besitz. Als ein Teil dieses
karentanischen Slawengebiets kam das Murland unter bayrische
Botmäßigkeit, dann unter karolingisch-fränkische
Herrschaft. Das Christentum verbreitete sich allmählich in
diesen Gegenden von Salzburg aus, das zum Metropolitansitz erhoben
wurde und seinen Sprengel auch über das spätere S.
ausdehnte. Unter Karls Nachfolgern hatte es durch feindliche
Einfälle, namentlich der Magyaren, sehr zu leiden. Den
beträchtlichsten Teil, gegen Westen und Norden, hatten die
Markgrafen von Karentanien (s. Kärnten), den Landstrich am
linken Ennsufer die Herzöge von Bayern inne. Im 11. Jahrh.
ward eine besondere Mark "Kärnten" vom Herzogtum Kärnten
abgezweigt und 1056 dem Grafen Ottokar von Steyr im Traungau, einem
Verwandten des Lambachschen Geschlechts, verliehen. Seitdem ward
der Name S. statt des frühern "Kärntner Mark"
üblich. Markgraf Ottokar VI. (VIII.), welcher von Kaiser
Friedrich I. die herzogliche Würde erhielt, schloß, da
er ohne männliche Erben war, 1186 mit dem Herzog Leopold V.
von Österreich einen Erbfolgevertrag, zufolge dessen der
letztere nach Ottokars Tod 1192 das Herzogtum S. mit seinen
Ländern vereinigte. Leopolds V. Söhne Friedrich und
Leopold VI. teilten sich 1194 in die Herrschaft von Österreich
und S., doch kam schon 1198 mit Friedrichs Tod beides wieder in
Leopolds Hand. Diesem folgte 1230 Friedrich der Streitbare. Da er
sehr willkürlich regierte, führten die Steiermärker
Klage bei dem Kaiser Friedrich II. und erhielten von demselben ihre
in Ottokars Testament erhaltenen Freiheiten von neuem
bestätigt. Dieser Freiheitsbrief und Ottokars Testament gaben
der steirischen Landhandfeste ihr Entstehen. Nach dem Tode des
letzten Babenbergers, Friedrichs des Streitbaren (1246), folgte das
für S. so verderbliche Zwischenreich, in welchem das
Herzogtum, obgleich eine Partei der Stände Heinrich von Bayern
1253 zum Herzog wählte, 1254 unter Vermittelung des Papstes
zwischen den Königen Ottokar II. von Böhmen und Bela IV.
von Ungarn geteilt wurde. Ottokar II. besiegte die Ungarn 1260 auf
dem Marchfeld und ward 1262 vom deutschen König Richard mit
Österreich und S. belehnt, aber 1276 vom König Rudolf von
Habsburg dieser Lehen verlustig erklärt, worauf letzterer
seinen ältesten Sohn, Albrecht I., als Statthalter 1282
gemeinsam mit dem jüngern Bruder, Rudolf, 1283 allein als
erblichen Landesherrn mit S. belehnte. Fortan blieb das Herzogtum
im Besitz des Hauses Habsburg. Bei der nach Rudolfs IV. Tod 1365
zwischen dessen Brüdern Albrecht III. und Leopold III.
vorgenommenen Teilung fiel S. mit Kärnten, Tirol etc. an den
letztern. Als dessen Söhne 1406 wiederum teilten, ward S.
Ernst dem Eisernen zugesprochen. Sein ältester Sohn und
Nachfolger (seit 1424) war der nachmalige Kaiser Friedrich III.,
der wiederum alle habsburgischen Lande vereinigte. Als 1456 die
gefürsteten Grafen von Cilli ausstarben, erwarb Friedrich auf
Grund früherer Verträge deren Besitzungen. Die Lehren der
deutschen Reformatoren fanden schon seit 1530 in S. Eingang, und
1547 beanspruchte der Landeshauptmann Freiherr Johann Ungnad auf
dem Reichstag zu Augsburg freie Religionsübung; doch konnte
dieselbe erst auf den Landtagen zu Bruck 1575 und 1578 dem Herzog
Karl II., dem jüngsten Sohn Kaiser Ferdinands I., welchem bei
der Länderteilung 1564 S., Kärnten und Krain zu teil
geworden waren, abgenötigt werden. Um die Verbreitung der
neuen Lehre zu hemmen, rief Herzog Karl 1570 die Jesuiten zu Hilfe
und stiftete 1586 die hohe Schule zu Graz. Sein Sohn Ferdinand II.,
der 1596 die Regierung übernahm, erklärte den
Freiheitsbrief seines Vaters Karl II. für aufgehoben und wies
1598 die protestantischen Lehrer und Prediger aus dem Land. Eine
hierauf eingesetzte katholische Gegenreformationskommission befahl
allen protestantischen Bürgern, entweder zur katholischen
Religion überzutreten, oder auszuwandern. Viele Protestanten
schwuren damals ihr Bekenntnis ab; eine bedeutende Zahl aber, meist
den reichsten und angesehensten Familien angehörig,
verließ die Heimat, und nur in den unzugänglichen Bergen
des obern S. erhielt sich im stillen in einzelnen Bauernfamilien
der evangelische Glaube, weshalb sich dort, nachdem Joseph II. 1781
Glaubensfreiheit proklamiert hatte, einige protestantische
Gemeinden konstituierten. Ferdinand II. erbte 1619 auch die
übrigen österreichischen Lande, und S. blieb seitdem ein
Teil derselben. Seit Karl VI. (1728) nahm kein Landesfürst
mehr die Huldigung an, und seit 1730 bestätigte keiner die
Landhandfeste mehr. Fortan teilte S. die Schicksale der
österreichischen Monarchie und blieb auch während der
Napoleonischen Kriege den Habsburgern erhalten. Seit dem
Wiedererwachen politischen Lebens in Österreich 1860 zeigte
sich der Landtag von S. verfassungstreu und freisinnig, erhob 1865
seine Stimme gegen die Sistierung der Verfassung und forderte 20.
Okt. 1869 die Aufhebung des Konkordats. Das agitatorische Auftreten
der Slawen in S., das seit 1880 von der Regierung begünstigt
wurde, bewirkte nun, daß das Deutschtum sich um so
kräftiger regte und die deutsch-nationale Partei in S. eine
Hauptstütze hatte. Vgl. A. J. Cäsar, Staats- und
Kirchengeschichte Steiermarks (Graz 1785-87, 7 Bde.); v. Muchar,
Geschichte des Herzogtums S. (das. 1844-67, 8 Bde., reicht bis
1566); Gebler, Geschichte des Herzogtums S. (das. 1862); Reichel,
Abriß der steirischen Landesgeschichte (2. Aufl., das. 1884);
"Mitteilungen des Historischen Vereins für S." (das. seit
1850); "Beiträge zur Kunde steiermärkischer
Geschichtsquellen" (das. 1864 ff.); Zahn, Urkundenbuch des
Herzogtums S. (das. 1875-79, 2 Bde.).
Steifensand, Xaver, Kupferstecher, geb. 1809 zu Kaster
(Regierungsbezirk Köln), bezog 1832 die Kunstakademie in
Düsseldorf und bildete sich, nachdem er den Stich der heil.
Katharina nach Raffael von Desnoyers in Linienmanier kopiert hatte,
unter Felsing in Darmstadt weiter aus. Nach seiner Rückkehr
nach Düsseldorf war sein erstes größeres Werk
(1844) der Stahlstich: das Gewitter, nach Jakob Becker für
den
259
Steigbügel - Stein.
Rheinischen Kunstverein, worauf eine Madonna mit dem schlafenden
Kind, nach Overbeck (1846), Friedrich II. mit seinem Kanzler Peter
de Vineis, nach Jul. Schrader (1847, Stahlstich), die
Gefangennehmung des Papstes Paschalis II. durch Heinrich V., nach
Lessing, und einige Porträte folgten. In den 50er Jahren
entstanden: Mirjam, nach Köhler; der Christusknabe, nach
Deger; die Christnacht, nach Mintrop, u. a. m. Nach Vollendung des
Stichs der Regina coeli, nach Karl Müller, begann er sein
größtes Werk, die Anbetung der Könige, nach Paul
Veronese (in Dresden), das, erst 1873 vollendet, ihm mehrere
Auszeichnungen eintrug. Er starb 6. Jan. 1876.
Steigbügel, metallener Halbring mit Platte (Sohle)
unter demselben, der an den Steigriemen, Strippen von starkem
Leder, zu beiden Seiten des Sattels herabhängt und zum
Einsetzen des Fußes beim Reiten dient. Bei den Türken
und mehreren asiatischen Völkern ist die Sohle so groß,
daß die ganze Fußsohle darauf ruhen kann, und ersetzt
mit ihren scharfen Ecken die Sporen. Die Alten kannten die S.
nicht, die erst zur Zeit Ottos I. aufgekommen zu sein scheinen. -
Auch heißt S. (stapes) eins der drei
Gehörknöchelchen (s. Ohr, S. 349).
Steigentesch, August Ernst, Freiherr von, Dichter und
Schriftsteller, geb. 12. Jan. 1774 zu Hildesheim als Sohn eines
kurmainzischen Kabinettsministers, trat frühzeitig in
österreichische Militärdienste und war eifrig als Soldat
und Diplomat, auch an der Seite des Generals Fürsten
Schwarzenberg, gegen Napoleon I. thätig. Er avancierte bis zum
Generalmajor und war bis 1820 österreichischer
Militärbevollmächtigter am Bundestag. Er starb 30. Dez.
1826 in Wien. Außer zahlreichen Lustspielen, in denen er die
kleinen Schwächen und Thorheiten der Menschen mit großer
Wahrheit schilderte, und die sich lange auf der Bühne
erhielten, veröffentlichte er auch Gedichte (4. Aufl., Darmst.
1823) und eine Reihe von Erzählungen. Seine "Gesammelten
Schriften" erschienen in 6 Bänden (Darmst. 1820).
Steiger, s. Bergleute.
Steigerschulen, s. Bergschulen.
Steigerung, in der Grammatik, s. Komparation.
Steigerwald, ein auf der fränk. Terrasse ziemlich
isoliert liegendes, nach W. sehr steil, nach O. ganz
allmählich abfallendes, mit reichen Nadelholzwaldungen
bedecktes Gebirge auf der Grenze zwischen den bayrischen
Regierungsbezirken Ober-, Mittel- und Unterfranken, in dem westlich
von Bamberg befindlichen Mainwinkel zwischen Eltmann, Kitzingen und
Uffenheim gelegen, bedeckt 440 qkm (8 QM.), erhebt sich in seinen
höchsten Spitzen, dem Frankenberg und Hohenlandsberg
(nördlich von Uffenheim), bis zu 512 und 505 m und gibt den
Flüssen Aurach und Ebrach den Ursprung. Auf der Westseite
bildet der Schwan- oder Schwabenberg (473 m) einen vorgeschobenen
Punkt.
Steigkunst, s. Fahrkunst.
Steigrad (Hemmungsrad), eine Art Sperrrad, welches in
regelmäßigen, durch die Pendelschwingungen bedingten
Zeiträumen arretiert wird.
Steigriemenlaufen, s. Spießrutenlaufen.
Steigrohr, ein Rohr, in welchem eine Flüssigkeit
durch Druck emporgetrieben wird.
Stein, im gewöhnlichen Leben jedes feste
anorganische Naturprodukt, welches aber ein Mineral oder ein
Gestein sein kann; in der Metallurgie s. v. w. Lech.
Stein (Konkrement), in der Medizin Ablagerungen,
bestehend aus anorganischen Massen, namentlich Kalksalzen der Oxal-
und Harnsäure und Cholesterin, welche sich in Hohlräumen
oder Flüssigkeit führenden Kanälen unter krankhaften
Verhältnissen bilden. Sie kommen vor in der Harnblase, in der
Gallenblase, in den Gallengängen, im Darm (Darm- oder
Kotsteine), in der Harnröhre, in der Vorsteherdrüse, in
den Nieren, den Bronchien, in den Speichelgängen u. a. O. Sie
entstehen entweder infolge von Katarrhen der betreffenden
Schleimhäute, oder infolge einer Veränderung der
Absonderung, oder als Niederschläge um von außen
eingedrungene Fremdkörper herum. Sie sind bisweilen sehr
klein, in der Harnblase des Menschen kommen aber Steine bis zu 500
g und darüber vor, im Darm von Pferden Kotsteine bis zu 5 kg.
Sie finden sich einzeln oder zu mehreren, in der menschlichen
Gallenblase bis zu 300; im letztern Fall schleifen sie sich
gegenseitig ab und gehen aus der meist rundlichen Form in
polygonale, facettierte Körper über. Sie hemmen die
Zirkulation der Sekrete und bedingen Katarrhe und
Verschwärungen, die meist unter den lebhaftesten Schmerzen in
sogen. Koliken verlaufen. Werden sie nicht aufgelöst oder
ausgestoßen, so werden sie nicht selten die Quelle
lebensgefährlicher Störungen und Veranlassung zu
eingreifenden Operationen.
Stein, Gewicht für Wolle, Flachs etc. in
Preußen, Sachsen, Österreich früher = 0,2 Ztr.; in
England (stone) à 14 Pfd. Avoirdupois = 6,350 kg; in den
Niederlanden früher = 3 kg; in Schweden = 13,602 kg.
Stein, 1) (S. am Rhein) Landstädtchen in einer
Parzelle des schweizer. Kantons Schaffhausen, am Ausfluß des
Rheins aus dem Untersee (Bodensee) und an der Bahnlinie
Singen-Winterthur, mit (1880) 1364 Einw. Das ehemalige Kloster St.
Georg mit gotischem Kreuzgang und einem durch Holzschnitzerei
reichverzierten Saal ist jetzt im Privatbesitz. Dabei das
Schloß Hohen-Klingen. Vgl. Ziegler, Geschichte der Stadt S.
(Schaffh. 1862); Vetter, Das St. Georgenkloster zu S. am Rhein
(Lindau 1884). -
2) Stadt in der niederösterreich. Bezirkshauptmannschaft
Krems, an der Donau, über welche eine Brücke nach dem
gegenüberliegenden Mautern führt, mit Krems durch eine
Häuserreihe ("Und" genannt) zusammenhängend, hat
Schloßruinen, ein Zellengefängnis, eine große
Tabaks- und eine Holzwarenfabrik, bildet einen wichtigen
Landungsplatz für die Donauschiffahrt und zählt (1880)
4069 Einw., welche hauptsächlich Weinbau betreiben. S. ist
Sitz einer Finanzbezirksdirektion. -
3) Stadt in Krain, am Feistritzfluß und an der Lokalbahn
Laibach-S., Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines
Bezirksgerichts, hat eine Kaltwasserheilanstalt,
Franziskanerkloster, Schießpulverfabrik, Thonwaren- und
Zementfabrikation und (1880) 1963 Einw. Über der Stadt erhebt
sich die Ruine Kleinfeste. Dabei eine sehenswerte dreigeschossige
Kirche. S. bildet den Ausgangspunkt für die nördlich
gelegenen Steiner Alpen (s.d.). -
4) Dorf im bayr. Regierungsbezirk Mittelfranken, Bezirksamt
Nürnberg, an der Regnitz und der Linie
Krailsheim-Nürnberg-Furth i. W. der Bayrischen Staatsbahn, 298
m ü. M., hat eine evang. Kirche, ein Schloß, drei
Bleistiftfabriken (darunter die weltberühmte Fabersche Fabrik
mit 400 Arbeitern), eine Papierfabrik und (1885) 2054 Einw.
Stein, 1) Charlotte von, durch ihre Beziehung zu Goethe
der deutschen Literaturgeschichte angehörig, geb. 25. Dez.
1742 zu Weimar, Tochter des Hofmarschalls v. Schardt daselbst,
vermählte sich als Hofdame der Herzogin Amalia 1764 mit dem
herzoglichen Stallmeister Friedrich v. S. Eine schwärmerische
Verehrerin von Goethe, lernte sie denselben im
260
Stein (Freiherr vom und zum).
November 1775 zuerst persönlich kennen und wurde, wiewohl
fast sieben Jahre älter als er und bereits Mutter von sieben
Kindern, von ihm bald glühend geliebt. Die Innigkeit des
eigentümlichen Verhältnisses, das auf Goethes Leben und
Dichten von großem Einfluß war, litt später unter
Charlottens wachsenden Ansprüchen und endete nach Goethes
Rückkehr aus Italien (1788) mit einem gewaltsamen Bruch,
welcher sich in einer 1794 von Charlotte gedichteten Tragödie
"Dido" (hrsg. von Otto Volger, Leipz. 1867) in peinlicher Weise
kundgibt. Erst nach vielen Jahren gestaltete sich zwischen beiden
wieder ein gewisses Freundschaftsverhältnis, das bis zum Tode
der Frau v. S., die bereits 1793 Witwe geworden, dauerte. Sie starb
6. Jan. 1827 in Weimar. Charlottens schönstes Ehrendenkmal
bleiben "Goethes Briefe an Frau v. S. aus den Jahren 1776-1820"
(hrsg. von A. Schöll, Weim. 1848-51, 3 Bde.; 2.
vervollständigte Ausg. von Fielitz, Frankf. a. M. 1883-85, in
welcher auch "Dido" abgedruckt ist). Eine wertvolle Ergänzung
haben dieselben erhalten durch die von Goethe aus Italien an sie
gerichteten, aber von ihm für die Ausarbeitung seiner
"Italienischen Reise" zurückerbetenen Briefe, die, bisher im
Goetheschen Hausarchiv zu Weimar aufbewahrt, neuerdings durch die
Goethe-Gesellschaft (Weim. 1886) veröffentlicht wurden. Ihre
eignen Briefe an Goethe hatte Frau v. S. sich zurückgeben
lassen und kurz vor ihrem Tod verbrannt. Zahlreiche Briefe
derselben sind in dem Werk "Charlotte von Schiller und ihre
Freunde" (Bd. 2, Stuttg. 1862), enthalten. Gegen mancherlei
Anklagen, die neuerlich erhoben worden sind, rechtfertigt sie H.
Düntzer in "Charlotte v. S." (Stuttg. 1874). Vgl. auch dessen
"Charlotte v. S. und Corona Schröter" (Stuttg. 1876);
Höfer, Goethe und Charlotte v. S. (das. 1878).
2) Heinrich Friedrich Karl, Freiherr vom und zum, berühmter
deutscher Staatsmann, geb. 26. Okt. 1757 zu Nassau an der Lahn aus
einem alten reichsfreiherrlichen Geschlecht, Sohn des
kurmainzischen Geheimrats Philipp von S., widmete sich von 1773 bis
1777 in Göttingen dem Studium der Rechte und der
Staatswirtschaft, arbeitete ein Jahr beim Reichskammergericht in
Wetzlar, unternahm eine Reise durch einen Teil von Europa, trat
dann, entgegen den Traditionen seines Hauses, in den
preußischen Staatsdienst und erhielt 1780 eine Anstellung als
Bergrat zu Wetter in der Grafschaft Mark. Schon 1782 ward er zum
Oberbergrat befördert, und im Februar 1784 erhielt er die
Oberleitung der westfälischen Bergämter. 1793 erfolgte
seine Ernennung zum Kammerdirektor in Hamm, 1795 zum
Präsidenten der märkischen Kriegs- und Domänenkammer
und 1796 zum Oberpräsidenten aller westfälischen Kammern,
in welcher Stellung er sich die größten Verdienste
namentlich um den Chausseebau und die Forsten sowie um Hebung der
Gewerbthätigkeit und Belebung des Handels erwarb. Im Oktober
1804 als Minister des Accise-, Zoll-, Salz-, Fabrik- und
Kommerzialwesens nach Berlin in das Generaldirektorium berufen,
bewirkte er die Aufhebung sämtlicher binnenländischer
Zölle im Innern von Preußen, errichtete das Statistische
Büreau und schuf als Erleichterungsmittel für den Handel
und Verkehr Papiergeld. Vergeblich waren freilich seine
Anstrengungen, den König zu einer kräftigen,
würdigen Politik zu bewegen. Als er im Januar 1807 seinen
Eintritt in das neue Ministerium von der Umgestaltung der obersten
Verwaltungsstellen und insbesondere von der Beseitigung der
Kabinettsregierung abhängig machte, erhielt er vom König
in ungnädigster Weise den Abschied. Nach dem Tilsiter Frieden
(Juli 1807) berief ihn derselbe jedoch wieder zu sich, um ihm als
erstem Minister das große Werk der Neugestaltung des Staats
zu übertragen. Steins Plan war: das Volk wieder für die
Teilnahme am Staat und seinen Zwecken zu beleben und an der Leitung
desselben zu beteiligen, die bisher unterdrückten Stände
von den aus dem Mittelalter überkommenen Lasten und Fesseln zu
befreien und ein allgemeines freies Staatsbürgertum zu
gründen. Die Weise, wie er diese Reform anstrebte, zeugt
ebenso von seinem echt deutschen Geist wie von tiefer
staatsmännischer Einsicht. Im September 1807 übernahm er
sein neues Amt, und 9. Okt. erschien bereits das Edikt, den
erleichterten Besitz und den freien Gebrauch des Grundeigentums
sowie die persönlichen Verhältnisse des
Grundeigentümers betreffend. Ein andres Gesetz
überließ den Domanialbauern ihr Land zu
unumschränktem Grundeigentum. Seine Städteordnung vom 19.
Nov. 1808 bildet noch jetzt die Grundlage der
Rechtsverhältnisse der preußischen Städte. Damit
das so in seinen Verhältnissen und Rechten sittlich und
geistig gehobene Volk auch das Bewußtsein seiner Kraft und
Mut zur Abwerfung des Fremdenjochs gewinne, unternahm S. darauf mit
Scharnhorst die Herstellung einer volkstümlichen
Wehrverfassung. Aber kaum ein Jahr hatte S. als Minister gewaltet,
als er durch einen Machtbefehl Napoleons I., dem ein aufgefangener
Brief Steins an den Fürsten von Wittgenstein seine Hoffnung,
bald das französische Joch abzuschütteln, verraten hatte,
24. Nov. 1808 seinen Abschied zu nehmen und 16. Dez. förmlich
geächtet aus Preußen zu fliehen gezwungen wurde. Ehe er
sein Vaterland verließ, legte er die Grundsätze seiner
Staatsverwaltung in einem Sendschreiben an die oberste
Verwaltungsbehörde nieder, welches unter der Bezeichnung
"Steins politisches Testament" weltgeschichtliche Bedeutung
gewonnen hat. Von der westfälischen Regierung gerichtlich
verfolgt und seiner Güter beraubt, begab er sich nach
Österreich, wo er abwechselnd in Brünn, Troppau und
zuletzt dauernd in Prag lebte. Als zu befürchten stand,
daß seine Auslieferung gefordert werden möchte, folgte
er im Mai 1812 der Einladung des Kaisers Alexander I. nach
Petersburg. Auch von dort aus aber wußte er durch seinen
Einfluß auf den Kaiser sowie durch seine ausgedehnten
Korrespondenzen und die Bildung einer russisch-deutschen Legion die
spätere nationale Erhebung gegen Napoleon I. vorzubereiten.
Nach der Katastrophe von 1812 kehrte er mit dem Kaiser nach
Deutschland zurück und ward zum Vorsitzenden eines
russisch-preußischen Verwaltungsrats für die deutschen
Angelegenheiten ernannt, doch sah er sich in seiner Thätigkeit
in dieser Stellung vielfach beengt. Als nach dem Sieg bei Leipzig
21. Okt. 1813 eine Zentralkommission für die Verwaltung aller
durch die Truppen der Verbündeten besetzten Länder
angeordnet worden war, übernahm S. den Vorsitz in derselben
und erwarb sich trotz der ihm von den einzelnen Regierungen in den
Weg gelegten Hindernisse durch tüchtige Verwaltung im Innern
und Aufstellung zahlreicher Heerhaufen gegen den äußern
Feind hohe Verdienste um das Gesamtvaterland. Die Zentralverwaltung
folgte dem Heer der Verbündeten bis nach Paris. Von dort
kehrte S. im Juni 1814 nach Berlin zurück und begab sich im
September zum Kongreß nach Wien. Hier nahm er besonders an
den Verhandlungen über die deutsche Frage teil. Dann zog er
sich ins Privatleben zurück. Den Sommer brachte er meist auf
seinen Gütern in Nassau,
261
Stein - Steinach.
den Winter in Frankfurt a. M. zu, wo sich im Januar 1819 unter
seinem Vorsitz die Gesellschaft für Deutschlands ältere
Geschichte konstituierte. Ihr Werk ist die Herausgabe der
"Monumenta Germaniae historica" (s. d.), für welche S. selbst
viel sammelte. Mit der nassauischen Regierung in mancherlei
Mißhelligkeiten geraten, siedelte er später auf sein Gut
Kappenberg in Westfalen über. Nach der Einführung der
Provinzialstände in Preußen 1823 ward er für den
westfälischen Landtag zum Deputierten erwählt und vom
König zum Landtagsmarschall ernannt. Auch die Verhandlungen
der evangelischen Provinzialsynode Westfalens leitete er. 1827
ernannte ihn der König zum Mitglied des Staatsrats. S. starb
29. Juni 1831 in Kappenberg als der letzte seines Geschlechts, da
ihn von den Kindern, die ihm seine Gemahlin, Gräfin Wilhelmine
von Wallmoden-Gimborn, geboren, nur drei Töchter
überlebten. 1872 ward ihm auf der Burg Nassau (von Pfuhl),
1874 in Berlin (von Schievelbein und Hagen) ein Standbild
errichtet. Steins Denkschriften über deutsche Verfassungen
wurden von Pertz (Berl. 1848) herausgegeben, Steins Briefe an den
Freiherrn v. Gagern 1813-31 von diesem (Stuttg. 1833), sein
Tagebuch während des Wiener Kongresses von M. Lehmann (in
Sybels "Historischer Zeitschrift", Bd. 60). Vgl. Pertz, Das Leben
des Ministers Freiherrn vom S. (Berl. 1849-55, 6 Bde.); Derselbe,
Aus Steins Leben (das. 1856, 2 Bde.); Stern, S. und sein Zeitalter
(Leipz. 1855); Arndt, Meine Wanderungen und Wandelungen mit dem
Freiherrn vom S. (3. Aufl., Berl. 1869); M. Lehmann, S.,
Scharnhorst und Schön (Leipz. 1877); Seeley, Life and times of
S. (Cambr. 1878, 3 Bde.; deutsch, Gotha 1883-87, 3 Bde.) und die
kürzern Biographien von Reichenbach (Brem. 1880), Baur
(Karlsr. 1885).
3) Christian Gottfried Daniel, Geograph, geb. 14. Okt. 1771 zu
Leipzig, wo er studierte, wurde 1795 an das Gymnasium zum Grauen
Kloster in Berlin berufen, an welchem er bis zu seinem am 14. Juni
1830 erfolgten Tod wirkte. Von seinen zahlreichen Werken sind
besonders zu nennen sein mit Hörschelmann begründetes
"Handbuch der Geographie und Statistik" (Leipz. 1809, 3 Bde.;
neubearbeitet von Wappäus, Delitsch, Meinicke u. a., 7. Aufl.,
das. 1853-71, 4 Bde.); "Geographie für Schule und Haus" (27.
Aufl. von Wagner und Delitsch, das. 1877);
"Geographisch-statistisches Zeitungs-, Post- und Komptoirlexikon"
(2. Aufl., das. 1818-21, 4 Bde.; nebst zwei "Nachträgen", das.
1822-24); "Über den preußischen Staat nach seinem
Länder- und Volksbestand" (Berl. 1818); "Handbuch der
Geographie und Statistik des preußischen Staats" (das. 1819);
"Reisen nach den vorzüglichsten Hauptstädten von
Mitteleuropa" (Leipz. 1827-29, 7 Bde.). Sein "Neuer Atlas der
ganzen Erde" (Leipz. 1814) erlebte in der Bearbeitung durch
Ziegler, Lange u. a. eine 33. Auflage (28 Karten mit Tabellen etc.,
das. 1875).
4) Leopold, jüd. Theolog, geb. 5. Nov. 1810 zu Burgpreppach
(Bayern), bildete sich auf der Talmudschule in Fürth und den
Universitäten zu Erlangen und Würzburg, ward 1834
Rabbiner in Burgkundstadt, 1843 in Frankfurt a. M., wo er nach
Niederlegung des Rabbinats 1864-74 einer höhern
Töchterschule vorstand und 2. Dez. 1882 starb. Er war der
entschiedenste Vertreter der Reform des Judentums. Sein Hauptwerk
ist: "Die Schrift des Lebens. Inbegriff des gesamten Judentums in
Lehre, Gottesverehrung und Sittengesetz" (Mannh. 1868-77).
Außerdem gab er verschiedene Predigtsammlungen und
Zeitschriften ("Der israelitische Volkslehrer", 1851-60;
"Freitagabend", 1860, etc.), mehrere Dramen ("Die Hasmonäer",
Frankf. 1859; "Der Knabenraub von Carpentras", Berl. 1863, u. a.)
heraus. Sein "Gebetbuch" (Straßb. u. Mannh. 1880-82, 2 Bde.)
zeigt S. als formgewandten synagogalen Dichter.
5) Lorenz von, Staatsrechtslehrer und Nationalökonom, geb.
18. Nov. 1815 zu Eckernförde, studierte in Kiel und Jena
Philosophie und Rechtswissenschaft, habilitierte sich dann als
Privatdozent in Kiel und wurde 1846 Professor daselbst. Da er das
Recht der Herzogtümer gegen die dänische Regierung
verfocht und an der Schrift der neun Kieler Professoren über
diesen Gegenstand Anteil nahm, wurde er 1852 aus dem Staatsdienst
entlassen. Er folgte 1855 einem Ruf als Professor der
Staatswissenschaften an die Universität zu Wien, an welcher er
bis zu seiner 1885 erfolgten Pensionierung wirkte. Seine Schriften
sind sehr zahlreich; wir nennen: "Der Sozialismus und Kommunismus
des heutigen Frankreich" (Leipz. 1842, 2. Aufl. 1847); "Die
sozialistischen und kommunistischen Bewegungen seit der dritten
französischen Revolution" (Stuttg. 1818); "Geschichte der
sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsre Tage"
(Leipz. 1850, 3 Bde.); "Geschichte des französischen
Strafrechts" (Bas. 1847); "Französische Staats- und
Rechtsgeschichte" (das. 1846-48, 3 Bde.); "System der
Staatswissenschaft" (Bd. 1: Statistik etc., das. 1852; Bd. 2:
Gesellschaftslehre, das. 1857); "Die neue Gestaltung der Geld- und
Kreditverhältnisse in Österreich" (Wien 1855); "Lehrbuch
der Volkswirtschaft" (das. 1858; 3. Aufl. als "Lehrbuch der
Nationalökonomie", 3. Aufl. 1887); "Lehrbuch der
Finanzwissenschaft" (Leipz. 1860; 5. Aufl. 1885-86, 4 Bde.); "Die
Lehre vom Heerwesen" (Stuttg. 1872). Sein bedeutendstes Werk ist
die "Verwaltungslehre" (Stuttg. 1865-84, 8 Bde.), eine umfassende,
nicht zum Abschluß gelangte Behandlung desjenigen
Gegenstandes, den man sonst als Polizeiwissenschaft zu behandeln
pflegt. Eine kompendiöse Zusammenfassung der ganzen
Wissenschaft ist das "Handbuch der Verwaltungslehre" (Stuttg. 1870;
3. Aufl. 1889, 3 Bde.). Außerdem schrieb er: "Zur
Eisenbahnrechtsbildung" (Wien 1872); "Die Frau auf dem Gebiet der
Nationalökonomie" (Stuttg. 1875, 6. Aufl. 1886); "Gegenwart
und Zukunft der Rechts- und Staatswissenschaft Deutschlands" (das.
1876); "Der Wucher und sein Recht" (Wien 1880); "Die drei Fragen
des Grundbesitzes und seiner Zukunft" (Stuttg. 1881). Das
Eigentümliche der Werke Steins besteht darin, daß er die
Hegelsche Dialektik auf das Gebiet der Volkswirtschaft und der
Staatswissenschaft anwandte, um an der Hand derselben die
Systematik dieser Wissenschaften zu verbessern. Doch hat er
darüber die Hinwendung auf das Geschichtliche nicht
vernachlässigt.
Steinach, 1) Marktflecken im meining. Kreise Sonneberg,
im freundlichen Thal der Steinach, eines Nebenflusses der Rodach,
an der Sekundärbahn Sonneberg-Lauscha (Werrabahn), hat ein
Amtsgericht, Amtseinnahme, Forstei, ein Schloß, Verfertigung
von Kisten, Schachteln, Schiefertafeln, Griffeln, Spielwaren etc.,
Wetzstein- und Schieferbrüche, Eisensteingruben, eine
Glashütte, Schneide- und Märmelmühlen, Bierbrauerei
und (1885) 4743 Einw. Aufwärts im Thal das
Eisenhüttenwerk Obersteinach. Am Fellberg, 3 km von S., die
ersten und lange Zeit einzigen bedeutenden
Griffelschieferbrüche in Deutschland. -
2) Marktflecken in Tirol, Bezirkshauptmannschaft Innsbruck, im
Wippthal, an der Mündung des Gschnitzthals und an der
Brennerbahn gelegen,
262
Steinalter - Steinberge.
beliebte Sommerfrische, hat eine Pfarrkirche mit guten
Gemälden, ein Bezirksgericht und (1880) 643 Einw.
Steinalter, s. Steinzeit.
Steinamanger (ungar. Szombathely), Stadt im ungar.
Komitat Eisenburg, Knotenpunkt der Österreichischen Süd-
und Ungarischen Westbahn und Sitz des Komitats, eines
römisch-katholischen Bischofs und eines Gerichtshofs, mit
bischöflichem Palais und Park, Franziskaner- und
Dominikanerkloster, schöner zweitürmiger Domkirche,
hübschem Komitatshaus und (1881) 10,820 Einw. S. hat eine
große Eisenbahnwerkstätte, eine Gasfabrik, ein
Obergymnasium, ein Seminar, eine theologische
Diözesanlehranstalt, ein Theater und ein archäologisches
Museum. S., das an der Stelle des römischen Savaria (s. d.)
steht, ist von Rebenhügeln umgeben und Fundort zahlreicher
römischer Altertümer.
Stein, armenischer, s. Lasurstein.
Steinau, 1) (S. an der Straße) Stadt im
preuß. Regierungsbezirk Kassel, Kreis Schlüchtern, an
der Kinzig und der Linie Frankfurt-Bebra-Göttingen der
Preußischen Staatsbahn, 169 m ü. M., hat 2 Kirchen, ein
Schloß, ein Amtsgericht, Zigarren-, Wagen- und
Steingutwarenfabrikation, eine Dampfmolkerei, eine Dampfziegelei,
Bierbrauerei und (1885) 2189 meist evang. Einwohner. -
2) Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk Breslau, an der
Oder und der Linie Breslau-Stettin der Preußischen
Staatsbahn, 97 m ü. M., hat eine evangelische und eine kath.
Kirche, ein Schullehrerseminar, 2 Krankenhäuser, ein
Amtsgericht, Fabrikation von Öfen, Thonwaren und Möbeln,
eine Maschinen- u. eine Schiffbauanstalt und (1885) 3636 meist
evang. Einwohner. S. erhielt 1215 deutsches Stadtrecht. Am 11. Okt.
1633 Sieg Wallensteins über die Schweden und Sachsen unter
Thurn, welcher sich mit 12,000 Mann ergeben mußte. Vgl.
Schubert, Geschichte der Stadt S. (Bresl. 1885).
Steinäxte, Steinmesser etc., s. Steinzeit.
Steinbach, Stadt im bad. Kreis Baden, an der Linie
Mannheim-Konstanz der Badischen Staatsbahn, 151 m ü. M., hat
eine kath. Kirche, eine Bezirksforstei, Essig- und
Mostrichfabrikation, bedeutenden Weinbau (Affenthaler) und (1885)
2055 meist kath. Einwohner. S. ist Geburtsort Erwins von S., dem
1844 auf einem nahen Hügel ein Denkmal errichtet ward.
Steinbach, s. Erwin von Steinbach.
Steinbach-Hallenberg, Flecken im preuß.
Regierungsbezirk Kassel, Kreis Schmalkalden, an der Schwarza und an
der Eisenbahn Zella-Schmalkalden, 438 m ü. M., hat eine
imposante Burgruine, ein Amtsgericht, eine Oberförsterei,
Fabrikation von Eisenkurzwaren, gedrechselten Holzwaren, mehrere
Eisenhämmer, Schneidemühlen, Braunsteingruben und (1885)
3116 evang. Einwohner.
Steinbearbeitung, s. Steine.
Steinbeere (Steinfrucht, Drupa), eine Art der
Schließfrüchte, von den Beeren dadurch unterschieden,
daß auf den saftigen Teil der Frucht nach innen eine
saftlose, meist harte Schicht (das Endokarp) folgt, welche in einer
einfachen oder mehrfächerigen Höhlung erst den
eigentlichen Samen einschließt und Steinkern oder Steinschale
(Putamen) genannt wird. Der Steinkern ist meist von holzartiger,
knochen- oder steinartiger Härte, wie beim Walnußbaum
und bei den Amygdalaceen, die deshalb auch Steinobstgehölze
heißen. Bei den Pomaceen ist dagegen der hier
mehrfächerige Steinkern mit wenigen Ausnahmen nur aus einer
dünnen, pergamentartigen Schicht gebildet. Das Fleisch der S.
ist entweder saftig, wie bei den meisten Amygdalaceen, oder
saftlos, wie bei der Mandel und Walnuß, oder trocken und
faserig, wie bei der Kokosnuß. Zusammengesetzte Steinbeeren
sind die Brombeeren und Himbeeren, indem hier die zahlreichen auf
dem Blütenboden sitzenden Steinfrüchtchen
zusammenhängen und als Ganzes sich ablösen.
Steinbeere, s. Paris und Vaccinium
Steinbeis, Ferdinand von, geb. 5. Mai 1807 zu
Ölbronn in Württemberg, erlernte seit 1821 zu
Wasseralfingen und Abtsgmünd den Berg- und Hüttenbetrieb,
studierte in Tübingen Mathematik und Naturwissenschaft und
trat 1827 in die Verwaltung des Staatseisenwerks Ludwigsthal ein.
1830 wurde er Betriebsdirektor der Hüttenwerke des
Fürsten zu Fürstenberg, folgte dann einem Ruf der
Gebrüder Stumm in Neunkirchen bei Saarbrücken zur
Betriebsleitung und zum Umbau ihrer Eisenwerke und führte den
in den Rheingegenden vergeblich versuchten Kokshochofenbetrieb mit
großen Vorteilen in der Materialersparnis und der
Qualität der Produkte ein. 1848 wurde er Mitglied der
neubegründeten Zentralstelle für Gewerbe und Handel in
Stuttgart, deren Präsidium ihm 1855 zufiel. Zu besonderm Ruf
gelangten das von ihm 1849 begonnene württembergische
Gewerbemuseum und der unter seiner Leitung entstandene, über
das ganze Land verbreitete Fortbildungsunterricht, welchem auch die
Frauenarbeitsschulen angehören. Nach dem im Gewerbemuseum
befolgten Plan, der 1851 durch die Ausstellung in London bekannter
wurde, legten die Engländer das Kensington-Museum (allerdings
mit viel bedeutendern Mitteln) an, welches wiederum das Vorbild
für derartige Museen in allen Industrieländern geworden
ist. 1848 wurde S. zu dem in Frankfurt a. M. thätigen
Ausschuß des Allgemeinen Deutschen Vereins zum Schutz der
vaterländischen Arbeit entsandt und unterstützte die
schutzzöllnerischen Bestrebungen desselben bis zur
Auflösung des Parlaments, während er seit 1862 mehr dem
Freihandel zuneigte. Von 185l an war S. als Kommissar und
Preisrichter auf fast allen Universalausstellungen thätig. In
dem seit 1849 von ihm redigierten "Gewerbeblatt" publizierte er
eine große Zahl technischer und volkswirtschaftlicher
Aufsätze. Außerdem schrieb er: "Die Elemente der
Gewerbebeförderung, nachgewiesen an der belgischen Industrie"
(Stuttg. 1853); "Entstehung und Entwickelung der gewerblichen
Fortbildungsschule in Württemberg" (das. 1872). Für seine
vielfachen Verdienste um die Industrie wurde S. der
persönliche Adel verliehen, und nach der Pariser
Industrieausstellung begründete eine große Anzahl
Industrieller eine S.-Stiftung zur Ausbildung u. Unterstützung
der gewerblichen Jugend. Seit 1880 lebt S. in Leipzig.
Steinbeißer, s. v. w. Kirschkernbeißer (s.
Kernbeißer) und Steinschmätzer.
Steinberge (Crannoges, Holzinseln), den schweizerischen
Pfahlbauten ähnliche, aus Erde und Steinen in Verbindung mit
Pfählen hergestellte vorgeschichtliche Konstruktionen in
Irland, besonders auf den durch die Gewässer des Shannon
gebildeten Inseln, die im Winter unter Wasser stehen. Lubbock ("Die
vorgeschichtliche Zeit", Jena 1874, Bd. 1, S. 174) gibt die
Abbildung eines Durchschnitts durch einen solchen Wasserbau.
Knochen von Haus- und Jagdtieren, Stein-, Knochen-, Bronze- und
Eisengeräte wurden auf den Steinbergen in großen Mengen
angetroffen. Die S. sind als Festungen und Zufluchtsorte der
kleinen irischen Häuptlinge noch im 16. Jahrh. bewohnt
gewesen. Vgl. Martin, The lake dwellings of Ireland (Dublin
1886).
263
Steinberger - Steinbrechmaschine.
Steinberger, Rheinweinsorte erster Güte, die am
Stein bei Hochheim (s. d.) erzeugt wird; s. Rheinweine.
Steinbock (Ibex Wagn.), Untergattung der Gattung Ziege
(Capra L.), durch die vorn abgeplatteten Hörner ohne Kiel mit
knotigen Querwülsten charakterisiert, umfaßt mehrere den
höchsten Gebirgen der Alten Welt angehörige Tiere,
über deren Artverschiedenheit nichts Sicheres bekannt ist. Man
kennt Steinböcke auf den europäischen Alpen, auf den
Pyrenäen (Bergbock) und andern spanischen Gebirgen, auf dem
Kaukasus, den Hochgebirgen Asiens, im Steinigen Arabien, in
Abessinien und auf dem Himalaja.
Der Alpensteinbock (Capra Ibex L.), 1,5-1,6 m lang, 80-85 cm
hoch, der Bock mit sehr starkem, 80-100 cm langem, bogen- oder
halbmondförmig schief nach rückwärts gebogenem
Gehörn, welches beim Weibchen bedeutend kleiner und mehr
hausziegenartig ist. Der Körper ist gedrungen und stark, der
Hals von mittlerer Länge, der Kopf
verhältnismäßig klein, aber an der Stirn stark
gewölbt; die Beine sind kräftig und von mittlerer
Höhe. Die Behaarung ist rauh und dicht, am Hinterkopf, Nacken
und Unterkiefer verlängert, im Sommer rötlichgrau, im
Winter fahl gelblichgrau. Längs der Mitte des Rückens
verläuft ein schwach abgesetzter, hellbrauner Streifen; Stirn,
Scheitel, Nase, Rücken und Kehle sind dunkelbraun; die Mitte
des Unterleibs ist weiß.
Der S. der Alpen ist wie die Steinböcke der andern
Hochgebirge und wie die Gemse ein wahres Alpentier; er lebt in
Rudeln von verschiedener Stärke und steigt nur dann in die
Waldregion herab, wenn die Alpenkräuter, seine Nahrung, vom
Schnee bedeckt sind. Alle seine Bewegungen sind rasch und leicht;
er klettert mit außerordentlicher Gewandtheit und weiß
an den steilsten Felsenwänden Fuß zu fassen, auch
springt er mit größter Sicherheit und verfehlt nie sein
Ziel. Mit Sonnenaufgang steigen sie weidend bergauf, lagern sich an
den wärmsten und höchsten Plätzen und kehren gegen
Abend weidend zurück, um die Nacht in den Wäldern weidend
zu verbringen. Die Brunstzeit fällt in den Januar, und
fünf Monate nach der Paarung wirft das Weibchen ein oder zwei
Junge, welche sie in der Gefahr tapfer verteidigt. Jung
eingefangene Steinböcke werden leicht zahm, doch bricht die
Wildheit im Alter wieder hervor. Während der S. in der Mammut-
und Renntierzeit durch die ganze Schweiz, einen Teil
Südfrankreichs und (wahrscheinlich) bis Belgien verbreitet
war, noch von Plinius kenntlich als Hochgebirgsstier erwähnt
wurde, auch im frühen Mittelalter bei den St. Galler
Mönchen als Wildbret beliebt war und noch von Albertus Magnus
zur Hohenstaufenzeit als häufig in den Deutschen Alpen
bezeichnet wurde, ist der Bestand desselben in den letzten
Jahrhunderten schnell zusammengeschmolzen; 1550 wurde der letzte in
Glarus, 1583 der letzte am Gotthard erlegt; 1574 war er in
Graubünden kaum noch aufzutreiben; 1706 verschwand er aus dem
Zillerthal, wo er über ein Jahrhundert von den
Erzbischöfen von Salzburg beschützt worden war, so
daß schon im vorigen Jahrhundert sein natürliches
Vorkommen auf die Hochgebirge des südlichen Wallis, Savoyens
und Piemonts sich beschränkte. Mehrfache Versuche, ihn an
einzelnen Stellen der Schweiz und den Österreichischen Alpen
wieder einzubürgern, haben keinen dauernden Erfolg gehabt, nur
im Höllensteingebirge am Traunsee soll sich eine Kolonie
erhalten und fortgepflanzt haben. Gegenwärtig findet sich nur
noch in den Thälern, welche vom Aostathal in
südwestlicher Richtung streichen, durch strengste
Maßregeln des Königs Viktor Emanuel geschützt, eine
Anzahl von 300 bis 500 Stück, die aber doch trotz allen
Schutzes an Terrain eher zu verlieren als zu gewinnen scheinen. Nur
einzelne alte Böcke finden sich oft weit versprengt bisweilen
noch in andern Gebieten. Im Aostathal legte der König auch ein
Gehege für Steinbockzucht an und erzielte durch eine
ausgewählte Ziegenart, welche in das Gebirge zu den wilden
Steinböcken getrieben wurde und von dort trächtig
zurückkehrte, eine Kolonie von Steinbockbastarden, welche nur
sehr gute Kenner von den echten Steinböcken zu unterscheiden
vermögen. Diese Steinbockbastarde haben 1 m lange Hörner
und sind zur Fortpflanzung durchaus geeignet. Beim Tode des
Königs kam der größte Teil des Bestandes von 52
Stück in das fürstlich Pleßsche Gehege in Salzau,
17 Stück aber wurden in Graubünden in Freiheit gesetzt,
um das Rätische Gebirge mit Steinwild zu bevölkern. Vgl.
Girtanner, Der Alpensteinbock (Trier 1878).
Steinbock, 1) das zehnte Zeichen des Tierkreises
(^[...]);
2) Sternbild zwischen 301-326½° Rektaszension und
9¾-28 1/3° südl. Deklination, nach Heis 63 dem
bloßen Auge sichtbare Sterne zählend, davon drei von
dritter Größe.
Steinborn, Pfarrdorf im preuß. Regierungsbezirk
Trier, Kreis Daun, in geognostisch merkwürdiger Gegend der
Eifel, hat (1885) 282 kath. Einwohner. Dabei der Felsberg,
Rimmerich, Errensberg und Scharteberg mit deutlich erkennbaren
Lavaströmen.
Steinbrand, s. Brandpilze II.
Steinbrech, Pflanzengattung, s. Saxifraga.
Steinbrechartige Pflanzen, s. Saxifragaceen.
Steinbrecher, s. Adler, S. 122.
Steinbrechmaschine, mechan. Vorrichtung zur Zerkleinerung
von Gesteinen, Erzen etc., welche vielfach an Stelle der sonst
üblichen Pochwerke und Walzen angewandt wird, besteht im
wesentlichen nach der Figur aus zwei im spitzen Winkel
gegeneinander gestellten eisernen Platten a c, zwischen welche die
zu zerbrechenden Steine geschüttet werden. Die eine Platte a
steht fest, die andre ist um Zapfen f beweglich und nähert
sich der feststehenden Platte durch die Wirkung eines Kniehebels g
h g', welcher sich gegen a' stützt, während die
Rückbewegung durch das Gewicht der Platte, unterstützt
durch eine Feder i, erfolgt. Bei dieser Rückbewegung findet
natürlich eine Erweiterung des Brechmauls r statt, welche dem
darin befindlichen Steinmaterial Gelegenheit gibt, tiefer zu
sinken, bis es wieder fest anliegt; die hierauf folgende
Verengerung wird sodann, wenn der Winkel zwischen beiden
264
Steinbruch - Steindienst.
Backen genügend klein gewählt ist, um ein Ausweichen
der Steine nach oben auszuschließen, die Zerdrückung zur
Folge haben. Bei rasch aufeinander folgender Wiederholung dieser
Schwingungen des Backens c, hervorgerufen durch das Exzenter k,
welches auf der Welle des Schwungrades l sitzt, werden sonach die
oben aufgegebenen großen Steine immer tiefer einsinken und
allmählich zu immer feinerm Korn zerdrückt. Die Maschine
arbeitet demnach kontinuierlich, indem regelmäßig oben
aufgegeben und unten abgezogen werden kann. Um die Maschine selbst
vor Abnutzung zu schützen und gleichzeitig die Form des
Backenquerschnitts für verschiedenes Material verschieden
wählen zu können, sind die Backen noch mit besondern
Druckplatten b d aus hart gegossenem Gußeisen von
wellenförmigem Querschnitt versehen, welche nach Bedarf
ausgewechselt oder erneuert werden können. Der Antrieb der
Maschine erfolgt durch Riemenscheibe von einem Dampf- oder
Wassermotor aus, und ein Schwungrad l dient zur Regulierung des
Widerstandes. Die S. von Blake zerkleinerte in der Stunde 200 Ztr.
harten, körnigen Granit zu brauchbarem Chausseematerial, wenn
die Betriebsarbeit 5 Pferdekräften entsprach.
Steinbruch (ungar. Köbánya), Ort bei Budapest
in Ungarn und Station der Österreichisch-Ungarischen sowie der
Ungarischen Staatsbahn, hat (1881) 8804 Einw., 2 große
Bierbrauereien, Schweinemastanstalten und 2 Hochreservoirs der
Budapester Wasserleitung und bildet den 10. Bezirk der ungarischen
Hauptstadt (s. Budapest, S. 588).
Steinbrüche, s. Steine.
Steinbrück, Eduard, Maler, geb. 3 Mai 1802 zu
Magdeburg, widmete sich in Berlin unter Wach der Kunst, ging 1829
nach Düsseldorf, dann nach Rom, lebte von 1830 bis 1833 wieder
in Berlin, darauf bis 1846 in Düsseldorf, seitdem abermals in
Berlin und zog sich im März 1876 nach Landeck in Schlesien
zurück, wo er 3. Febr. 1882 starb. Seine Bilder, deren Motive
meist der Sage und der Dichtung entnommen sind, tragen in der
empfindsamen Auffassung wie in dem zarten, weichen Kolorit das
Gepräge der Düsseldorfer Romantik. Die hervorragendsten
derselben sind: Genoveva, Rotkäppchen, Nymphe der Düssel,
Fischerfrau am Strand, Undine, die Magdeburger Jungfrauen, welche
sich während der Plünderung der Stadt 1631 von den
Wällen herabstürzen, und Maria bei den Elfen, nach Tiecks
Märchen (1840, in der Nationalgalerie zu Berlin).
Steinbühler Gelb, s. v. w. chromsaurer Baryt oder
chromsaurer Kalikalk, welcher aus Chlorcalciumlösung durch
chromsaures Kali gefällt wird und einen schön gelben
Farbstoff bildet.
Steinburg, Kreis in der preuß. Provinz
Schleswig-Holstein, benannt nach einer alten Burg, östlich von
Krempe, mit der Hauptstadt Itzehoe.
Steinbutt, s. Schollen.
Steinbutter, s. Bergbutter.
Steindattel (Lithodomus lithophagus Cuv.), Muschel aus
der Familie der Miesmuscheln (Mytilidae), lebt an den Ufern des
Mittelmeers in Felslöchern oder in Steinkorallen, in welche
sie sich auf noch nicht sicher ermittelte Weise einbohrt.
Wahrscheinlich sondert sie einen kalkauflösenden Saft ab, da
sie nicht wie die Bohrmuschel (s. d.) sich durch Feilen helfen
kann. Die Bohrlöcher sind innen völlig glatt. Besonders
interessant ist ihr Vorkommen in den Säulen des sogen.
Serapistempels von Pozzuoli bei Neapel. Sie nehmen dort eine scharf
begrenzte, etwa 2 m hohe Zone ein und beweisen so, daß der
Tempel nach seiner Erbauung eine geraume Zeit im Wasser gestanden
haben muß. Da er aber gegenwärtig wieder auf dem
Trocknen steht, so hat man darin wahrscheinlich ein Beispiel von
Senkung und Hebung des Meeresbodens in vulkanischer Gegend und zu
historischer Zeit (weiteres s. Hebung; vgl. indes Brauns, Das
Problem des Serapeums zu Pozzuoli, Halle 1888).
Stein der Weisen, s. Alchimie.
Steindienst (Steinkultus), die dem gesamten Heidentum der
Vorzeit und Jetztwelt eigentümliche Verehrung erwählter
Steine, sei es roher oder behauener, und zwar als Fetisch, Idol der
Gottheit oder als Opferstein. Die roheste und ursprünglichste
Form scheint diejenige zu sein, in welcher das Naturkind irgend
einen beliebigen Stein erwählt und zu seinem Fetisch macht.
Die Dakota Nordamerikas nehmen einen runden Kieselstein und bemalen
ihn, dann reden sie ihn Großvater an, bringen ihm Opfer und
bitten ihn, sie aus der Gefahr zu erretten. Ähnliches
beobachtete man in Südamerika, in der Südsee, an vielen
Orten Afrikas, Lapplands, Indiens etc. Bei den Kulturvölkern
der Alten Welt finden sich ähnliche Gebräuche, die aber
meist nur Meteorsteinen und prähistorischen Steinwaffen oder
Werkzeugen, die man für vom Himmel gefallene Waffen der
Götter, namentlich für Donnerkeile (Jupiter lapis-Kult),
hielt und vielfach als Amulette trug, dargebracht wurden, wobei man
bereits eine deutlichere Verknüpfung mit der
übersinnlichen Welt gewahrt. Die hochgefeierten Palladien der
Trojaner, Griechen und Römer waren meistens solche vom Himmel
herabgefallene Göttergeschenke, die namentlich im Kulte der
Kybele, Minerva und des Mars eine Rolle spielten. Anderseits
scheint bei einer etwas höher gestiegenen religiösen
Bildung eine Art von Vermählung der Gottheit mit einem
bestimmten ihr errichteten Altarstein, Opfertisch oder Idol
angenommen worden zu sein, sei es, daß man, wie im alten
Ägypten, meinte, die Gottheit nehme in dem Stein Wohnung, oder
auch, indem der Stein als uralte Opferstätte der Väter
den Nimbus des nationalen Allerheiligsten eines Volkes oder Stammes
erwarb. So wurden einfache Platten, Steinkegel, Opfertische etc. zu
dem Ursymbol der Nationalgottheit, dem man sich mit dem
höchsten religiösen Schauder näherte. Hierher
gehören: der schwarze Stein von Pessinus, das berühmte
konische Idol der Venus auf Cypern, der Stein, welcher bei den
böotischen Festen als Vertreter des typischen Eros die
höchsten Ehren genoß, der rohe Stein zu Hyettos, welcher
"nach alter Weise" den Herakles darstellte, die 30 Steine, welche
die Pharäaner in althergebrachter Weise an Stelle der
Götter verehrten, die rohen Steinaltäre zu Bethel,
Garizim und Jerusalem, der Steinkreis von Stonehenge (s. d.) als
vornehmstes Beispiel der unzähligen, über die ganze Alte
Welt verbreiteten Cromlechs (s.d.) etc. Tacitus sagt, wo er von der
Verehrung der paphischen Venus als Steinkegel spricht, die Ursache
ruhe im Dunkel (ratio in obscuro); allein wir werden kaum irre
gehen, wenn wir in ihnen Überbleibsel aus einer rohern
Urreligion suchen, die in dem philosophischer gewordenen Kultus
Aufnahme fanden, wie z. B. so vielfach Isisbilder in "schwarze
Madonnenbilder" umgewandelt worden sind. Durch die Beibehaltung des
alten Idols besiegelte die neue Religion ihren Frieden mit der
alten. Wir sehen ganz dasselbe bei dem heiligen Stein in der Kaaba
(s. d.) zu Mekka und an der heiligen Steinplatte in der Moschee
Omars zu Jerusalem, die eben uralte heilige Steine und
Opferstätten der Araber und Juden waren, vielleicht seit
Jahr-
265
Steindrossel - Steine, künstliche.
tausenden vor dem Auftreten Mohammeds. Aber gerade der mystische
Reiz, welcher in der Verehrung des rohen Naturidols liegt,
führte zu den tollsten Übertreibungen in dieser
Kultusform. Theophrast schildert im 4. Jahrh. v. Chr. den Typus des
abergläubischen Griechen, der immer sein Salbfläschchen
bei sich führt, um jedem heiligen Stein, dem er auf der
Straße begegnet, Öl aufzuträufeln, dann davor
niederzufallen und ihn anzubeten, ehe er seines Wegs weiter
schreitet. Die Kirchenväter (Arnobius, Tertullian u. a.)
machen sich lustig über diesen Gebrauch der Heiden, Steine zu
salben und anzubeten; aber sie vergessen, daß dies eine gut
biblische Sitte war, die auch Jakob, der Erzvater, bei jenem Stein
übte, der ihm als Kopfkissen gedient hatte. Noch Heliogabal
brachte das schwarze Steinidol des syrischen Sonnengottes unter
großer Feierlichkeit nach Rom und errichtete ihm einen durch
orientalische Pracht ausgezeichneten Dienst. Viele Forscher nehmen
an, daß die Menhirs, Bautasteine (s. d.) und megalithischen
Bauwerke, die sich in einer weiten Zone vom Westen Europas bis nach
Indien ziehen, ähnliche Idole eines besondern Steinvolkes
gewesen seien. Mehr an den reinen Fetischdienst erinnert die
besonders in Syrien und Phönikien heimisch gewesene Verehrung
kleiner Meteorsteine oder Bätylien (s. Bätylus); denn
diese Steine wurden speziell als Hausgötter etc. gebraucht,
und die Dioskuren, welche als die Nothelfer des Altertums galten,
wurden besonders häufig als Steine verehrt. Ähnliches
gilt von den Buddhasteinen in Indien. Vgl. v. Dalberg, Über
Meteorkultus der Alten (Heidelb. 1811); Tylor, Anfänge der
Kultur (deutsch, Leipz. 1873).
Steindrossel (Felsschmätzer, Monticola Boie),
Gattung aus der Ordnung der Sperlingsvögel, der Familie der
Drosseln (Turdidae) und der Unterfamilie der Steinschmätzer
(Saxicolinae), große, schlanke Vögel mit starkem,
pfriemenförmigem, gestrecktem, seicht gewölbtem Schnabel
mit überragender Spitze, langen Flügeln, in denen die
dritte Schwinge am längsten ist, kurzem, schwach ausgerandetem
Schwanz und mittelhohem, starkem, langzehigem Fuß mit
großen, merklich gebogenen Krallen. Der Steinrötel
(Steinmerle, Rotschwanz, M. saxatilis Cab.), 23 cm lang, 37 cm
breit, ist am Kopfe, Vorderhals, Nacken u. Bürzel blaugrau, am
Unterrücken weißblau, an der Unterseite und am Schwanz,
mit Ausnahme der beiden mittelsten dunkelgrauen Federn, rot, an den
Flügeln schwarzbraun; die Augen sind rotbraun, der Schnabel
schwarz, die Füße rötlichgrau. Er findet sich in
fast allen Gebirgen Südeuropas, brütet noch in
Österreich, am Rhein, ausnahmsweise in Böhmen, in der
Lausitz und am Harz, geht im Winter nach Nordafrika, bewohnt weite,
steinige Thalmulden, singt trefflich, nährt sich von Beeren
und Kerbtieren, nistet in Mauer- und Felsspalten, auch im
Gestrüpp und legt 4-6 blaugrüne Eier (s. Tafel "Eier I",
Fig. 59). Die Blaumerle (Blauamsel, Blaudrossel, Blauvogel,
einsamer Spatz, Einsiedler, M. cyana Cab.) ist 25 cm lang, 37 cm
breit, schieferblau, mit mattschwarzen Schwingen und Steuerfedern,
braunem Auge, schwarzem Schnabel und Fuß, bewohnt
Südeuropa, Nordafrika, Mittelasien, findet sich auch in den
südlichen Kronländern Österreichs, als Strichvogel
im Bayrischen Hochgebirge, lebt einsam in Einöden, singt sehr
angenehm, nistet in Felsspalten, auf Kirchtürmen etc. und legt
vier grünlichblaue, violett und rotbraun gefleckte Eier. In
Italien, Griechenland und auf Malta ist sie als Stubenvogel sehr
beliebt.
Steindruck, s. Lithographie.
Steine, linksseitiger Nebenfluß der Glatzer
Neiße, im preuß. Regierungsbezirk Breslau, entspringt
unfern Görbersdorf im Waldenburger Gebirge, fließt
südöstlich und mündet unterhalb Glatz; 55 km
lang.
Steine (Bausteine), Gesteine (s. d.) der verschiedensten
Art, welche zu Bauzwecken benutzt werden. Soweit sich dieselben
nicht als lose Trümmer in der Nähe größerer
Felsmassen, als Rollsteine, Geschiebe oder erratische Blöcke
vorfinden, werden sie an ihren natürlichen Fundorten
(Steinbrüchen) abgebaut oder gebrochen. Am häufigsten und
leichtesten gewinnt man die S. durch Tagebau; liegt das brauchbare
Gestein tief unter der Erdoberfläche, so wird die Gewinnung
durch Grubenbau betrieben. Zur Abtrennung der S. von ihren Lagern
dienen Brechstangen und Keile, und wo diese nicht ausreichen,
sprengt man mit Pulver oder Dynamit, während das früher
übliche Feuersetzen jetzt fast ganz aufgegeben ist. Beim
Sprengen werden Bohrmaschinen angewandt, und auch bei der
Ablösung der S. mittels der Keile benutzt man jetzt Maschinen,
wie in einem Steinbruch bei Marcoussis (Paris) einen auf Schienen
beweglichen Dampfhammer, der die S. absprengt und spaltet. Die aus
den Steinbrüchen gelieferten rohen S. werden zum Teil als
solche benutzt, meist aber zu Werkstücken, Schnittsteinen oder
Quadern verarbeitet. Seit dem Altertum wird diese Steinmetzarbeit
mit Hammer und sehr verschieden gestalteten Meißeln (Eisen)
ausgeführt, in neuerer Zeit aber sind immer mehr maschinelle
Vorrichtungen in Gebrauch gekommen, welche erfolgreich mit der
Handarbeit konkurrieren. Zum Zerschneiden der S. dienen
Steinsägen, welche statt der gezahnten in der Regel einfache
Stahlblätter oder Drähte enthalten, die
scharfkörnigen Sand unter Zufluß von Wasser hin- und
herschleifen. Die Bewegung des Gatters wird durch Menschen,
Göpel oder andre Motoren hervorgebracht. Bei den Sägen
mit Draht benutzt man oft einen sehr langen Draht, der sich
abwechselnd von einer Rolle auf eine andre ab- und aufwickelt. Zur
Bearbeitung ebener Flächen benutzt man Maschinen, welche nach
Art der Metallhobelmaschinen wirken, nur daß die Meißel
während der Steinbewegung nicht stillstehen, sondern, unter
45° geneigt, vermittelst schnell drehender Exzenter kurze
Stöße gegen den Stein führen und so die Handarbeit
nachahmen. Bei Anwendung profilierter Meißel erhält man
hierbei Kehlungen etc. Andre Maschinen besitzen als Arbeitsorgan
eine sehr schnell rotierende Scheibe mit feststehenden
Meißeln oder mit kleinen runden Scheiben aus Hartguß
(Kreismeißel), welche bei der schnellen Rotation der Scheibe
gegen den Stein stoßen, sich an diesem wälzen und
Stücke bis 25 mm Dicke abtrennen. Auch schwarze Diamanten
werden statt der Meißel angewandt. Die ebenen
Steinflächen werden mit scharfkörnigem Sand und Wasser
mittels hin und her bewegter, auch rotierender, belasteter eiserner
Schleifschalen geschliffen und zuletzt mit Bimsstein (für
Marmor), Kolkothar (Granit, Syenit), Zinnasche (für weicheres
Gestein) poliert. Hierbei werden runde Formen (Säulen etc.)
durch eine Drehbank gedreht, während die Schleifschalen
dagegen gedrückt werden. In neuerer Zeit benutzt man mehr und
mehr auch Schmirgelscheiben zum Schleifen der S. Vgl. Gottgetreu,
Physischen. chemische Beschaffenheit der Baumaterialien (3. Aufl.,
Berl. 1880, 2 Bde.); Schwartze, Die Steinbearbeitungsmaschinen
(Leipz. 1885).
Steine, künstliche, aus verschiedenen Substanzen
hergestellte steinartige Massen, welche als Surrogate
266
Steinen - Steingallen.
der natürlichen Steine benutzt werden. Hierher gehören
außer den Mauersteinen (s. d.) die Kalkziegel
(Kalksandziegel), die durch Mischen von Kalkmilch mit Sand zu einer
plastischen Masse, Formen der letztern unter starkem Druck und
Trocknen an freier Luft dargestellt werden. Vorteilhaft taucht man
sie vor völligem Erhärten in schwache
Wasserglaslösung. Auch der Zementguß muß zu den
künstlichen Steinen gerechnet werden. Sehr gute k. S.
erhält man aus einer Mischung von Steinbrocken, Zement und
Wasser, welche in Formen gestampft wird. Aus derartigem Beton sind
für Hafenbauten Steine von 18 cbm Inhalt dargestellt worden.
Cendrinsteine bestehen aus Zement mit Kohlenstaub oder Asche; eine
andre Sorte aus gebranntem Kalk und Steinkohlenasche, welche
breiförmig zusammengestampft werden, worauf man die Masse in
Ziegelform bringt und die Steine nach dem Trocknen in
Wasserglaslösung taucht. Die englischen Viktoriasteine werden
aus kleinen Granitbruchstücken und Zement geformt und nach 4
Tagen etwa 12 Stunden in Natronwasserglaslösung gelegt.
Marmorartige und bei Zusatz von Quarzstückchen und Eisenoxyd
auch granitartige Steine stellt Ransome dar, indem er Zement,
Kreide, feinen Sand und Infusorienerde mit Natronwasserglas zu
einem dicken Brei anmacht, diesen in Formen gießt, die
erhärtete Masse wiederholt mit sehr starker
Chlorcalciumlösung begießt, 3 Stunden hineinlegt und
schließlich in Wasser bringt, um lösliche Salze zu
entfernen. Diese Steine werden für solides Mauerwerk,
Trottoirplatten und zu Ornamenten sehr viel benutzt und sind
polierbar. Die Marmormosaik-Bodenbelegplatten von Oberalm bestehen
aus Marmorabfällen, welche durch eine Mischung von Zement und
Marmorpulver zu einer Masse verbunden werden, die man in eiserne
Formen preßt und nach dem Erhärten schleift und poliert.
In Nordamerika finden Steinplatten aus Schieferpulver, mit geringem
Zementzusatz gepreßt, ausgedehnte Verwendung. Der
Bietigheimer künstliche Sandstein besteht aus
Sandkörnern, die durch ein gesintertes alkalisches Silikat
(Feldspat, Glaspulver, Thon) verbunden sind. In Dirschau mischt man
1 Teil Thon mit 4 Teilen Mergel (Wiesenkalk) im Thonschneider,
zerschneidet den heraustretenden Strang, brennt die Steine im
Ringofen, mahlt sie mit 3 Volumen Sand und wenig Wasser in
rotierenden Trommeln, setzt Farbstoff zu und formt daraus Steine
unter dem Dampfhammer. Die Steine trocknen im Trockenschuppen und
sind nach 3 Tagen verwendbar. Auch Magnesiazement, Kieserit, Gips
(s. Zement) werden zu künstlichen Steinen verarbeitet, und
namentlich Schlacken bilden ein vortreffliches Material, aus
welchem sehr allgemein Ziegel gegossen werden. Eine Mischung von
Sodarückständen und geröstetem Schwefelkies mit
konzentrierter Wasserglaslösung liefert sehr harte Steine,
welche dem Wasser Widerstand leisten. Zu den künstlichen
Steinen gehören auch Mischungen aus Steintrümmern und
harzigen Bindemitteln, wie die braune Metalllava aus Sand,
Kalkstein, Teer und wenig Wachs. Aus dieser Masse gegossene Platten
lassen sich schön polieren.
Steinen, Karl von den, Forschungsreisender, geb. 7.
März 1855 zu Mülheim a. d. Ruhr, studierte Medizin in
Zürich, Bonn und Straßburg, widmete sich dann in Berlin
und Wien der Psychiatrie und war 1878-79 Assistenzarzt an der
Irrenklinik der Charitee in Berlin. 1879-81 machte er eine Reise um
die Erde, studierte dabei das Irrenwesen in den Kulturstaaten und
machte auf mehreren Gruppen der Südsee ethnologische
Forschungen. Nachdem er dann wiederum seine frühere Stellung
in Berlin eingenommen hatte, ging er als Arzt und Naturforscher mit
der von Deutschland ausgesandten Südpolarexpedition 1882 nach
Südgeorgien, wo er bis zum nächsten Jahr verweilte, um
darauf noch im Februar 1884 nach Asuncion zu gehen, von wo er mit
seinem Vetter, dem Maler Wilhelm von den S., und Clauß sowie
einem Kommando brasilischer Soldaten den Lauf des Xingu, eines
Nebenflusses des Amazonas, erforschte. Nach Europa
zurückgekehrt, veröffentlichte er als Ergebnis dieser
Reise: "Durch Zentralbrasilien" (Leipz. 1886). Eine zweite Reise in
dasselbe Gebiet trat S. im Januar 1887 an; er untersuchte, durch
den Ausbruch der Cholera am Paraguay aufgehalten, die
merkwürdigen Sambaquis in der Provinz Santa Catharina und traf
16. Juli in Cuyaba ein, von wo er im August aufbrach. Er erforschte
im östlichen Quellgebiet des Xingu eine Reihe von
Stämmen, die noch in vorkolumbianischer Steinzeit lebten, und
kehrte im August 1888 nach Europa zurück.
Steiner, 1) Jakob, Mathematiker, geb. 18. März 1796
zu Utzendorf bei Solothurn, besuchte die heimatliche Dorfschule, wo
er erst mit 14 Jahren schreiben lernte, und ging im Alter von 17
Jahren nach Yverdon zu Pestalozzi, an dessen Anstalt er später
einige Zeit als Hilfslehrer thätig war. Von hier wandte er
sich 1818 nach Heidelberg, um Mathematik zu studieren, sah sich
aber fast ganz auf Privatstudien angewiesen. Seit 1821 lebte er in
Berlin, anfangs als Privatlehrer der Mathematik, dann als Lehrer an
der Gewerbeakademie, seit 1834 als außerordentlicher
Professor an der Universität und Mitglied der Akademie der
Wissenschaften. Die letzten Lebensjahre verbrachte er, von schweren
Körperleiden gequält, in der Schweiz, wo er 1. April 1863
in Bern starb. Von seinem Hauptwerk: "Systematische Entwickelung
der Abhängigkeit geometrischer Gestalten", haben wir nur den
ersten Teil (Berl. 1832); außerdem schrieb er noch: "Die
geometrischen Konstruktionen, ausgeführt mittels der geraden
Linie und Eines festen Kreises" (das. 1833). Nach seinem Tod
erschienen seine "Vorlesungen über synthetische Geometrie"
(hrsg. von Geiser und Schröter, Leipz. 1867, 2 Bde.; 2. Aufl.
1875-76), und seine "Gesammelten Werke" (hrsg. von
Weierstraß, Berl. 1881-82, 2 Bde.). Vgl. Geiser, Zur
Erinnerung an Jakob S. (Schaffh. 1874).
2) Jakob, Instrumentenmacher, s. Stainer.
Steiner Alpen (auch Sannthaler oder Sulzbacher Alpen),
südliche Vorlage der Karawanken zwischen Save und Sann, im
südlichen Steiermark und dem angrenzenden Krain, erreichen mit
der Oistritza 2350 m Höhe. Östlich davon das Cillier
Bergland, vom Drann durchschnitten, reich an Mineralquellen. Vgl.
Frischauf, Die Sannthaler Alpen (Wien 1877).
Steinernes Meer, s. Salzburger Alpen.
Steinfrucht, s. Steinbeere.
Steinfurt, ehemals (seit 1495) reichsunmittelbare
Grafschaft im westfäl. Kreis, jetzt zum preußischen
Regierungsbezirk Münster und zum Kreise S. gehörig,
standesherrliche Besitzung der Grafen von Bentheim-S., mit dem
Hauptort Burgsteinfurt.
Steingallen (blaue Mäler), die durch Quetschung und
Entzündung der Hufsohle, namentlich in den Eckstrebenwinkeln
bei Pferden entstehenden roten, resp. geröteten Flecke. Die
Ursachen der S. beruhen in abnormem Druck auf die Sohlenschenkel
durch die übergewachsene Horn- und Eckstrebenwand oder durch
unzweckmäßigen Beschlag. Am meisten wird das Übel
bei sonst gesunden Hufen durch zu kurze Huf-
267
Steingang - Steinhuhn.
eisen veranlaßt. Bei länger anhaltendem und starkem
Druck auf die Eckstrebenpartie der Hufe entsteht Eiterung (feuchte
oder eiternde S. im Gegensatz zu den trocknen S.). Die Behandlung
wird durch zweckmäßige Beschneidung und Erweichung der
Hufe sowie durch Regelung des Hufbeschlags bewirkt. In letzterer
Hinsicht bedient man sich meist eines langen und starken oder eines
geschlossenen oder auch eines Dreiviertelhufeisens. Die Entstehung
von Eiter in einer Steingalle erfordert eine frühzeitige
Öffnung in dem Sohlenschenkel und Erweichung der Hufe durch
Umschläge von schleimigen und fetthaltigen Mitteln.
Steingang (Allée couverte), s. Dolmen.
Steingeier, s. Adler, S. 122.
Steingrün, s. Grünerde.
Steingut, s. Thonwaren.
Steinh., bei botan. Namen Abkürzung für A.
Steinheil, geb. 1810 zu Straßburg, Pharmazeut, bereiste
Algerien; starb 1839 auf der Überfahrt von Martinique nach
Caracas.
Steinhäger, Branntweinsorte, s. Genever.
Steinharz, s. Dammaraharz.
Steinhausen, Heinrich, Schriftsteller, geb. 27. Juli 1836
zu Sorau in der Niederlausitz, studierte zu Berlin Theologie und
Philologie, bekleidete darauf Lehrerstellen an den
Kadettenanstalten in Potsdam und Berlin, trat 1868 in den
Kirchendienst über und wirkt seit 1883 als Prediger zu Beetz
bei Kremmen im Regierungsbezirk Potsdam. Außer kritischen und
andern Beiträgen zum "Reichsboten" veröffentlichte er:
"Irmela. Eine Geschichte aus alter Zeit" (Leipz. 1881 , 10. Aufl.
1887); "Gevatter Tod. Im Armenhaus. Mr. Bob Jenkins' Abenteuer",
Novellen (2. Aufl., Barmen 1884); "Markus Zeisleins großer
Tag", Novelle (das. 1883); "Der Korrektor. Szenen aus dem
Schattenspiel des Lebens" (1.-4. Aufl., Leipz. 1885) u. a. Aufsehen
erregte seine gegen G. Ebers' Romane gerichtete kritische Schrift
"Memphis in Leipzig" (Frankf. a. M. 1880).
Steinhäuser, Karl, Bildhauer, geb. 3. Juli 1813 zu
Bremen, bildete sich an der Berliner Akademie, besonders unter
Rauchs Leitung, lebte seit 1836 längere Zeit in Rom und seit
1863 als Lehrer an der Kunstschule zu Karlsruhe, wo er 9. Dez. 1879
starb. Mehrere seiner zahlreichen Statuen zählen zu den
vorzüglichsten Schöpfungen der neuern deutschen Plastik,
so die von Olbers, Schmidt und dem heil. Ansgar in Bremen, Goethe
mit der Psyche in Weimar, die Gruppe von Hermann und Dorothea in
Karlsruhe. Er war ein Vertreter der antikisierenden Richtung,
wußte aber die Strenge der Behandlung durch Anmut zu mildern,
was sich besonders in seinen weiblichen Figuren (Mädchen mit
der Muschel, Deborah, Judith) kundgibt.
Steinheid, Dorf im sachsen-meining. Kreise Sonneberg, auf
der Grenzscheide zwischen Thüringer und Frankenwald, 813 m
ü. M., hat eine evang. Kirche, Kaolingruben, Fabrikation von
Glasperlen, Porzellan und Holzschachteln und (1885) 1522 Einw.
Nördlich dabei das Kieferle, 868 m hoch.
Steinheil, Karl August, Physiker, geb. 12. Okt. 1801 zu
Rappoltsweiler im Elsaß, studierte seit 1821 zu Erlangen die
Rechte, hierauf zu Göttingen und Königsberg Astronomie,
lebte seit 1825 auf dem väterlichen Gut zu Perlachseck, mit
astronomischen und physikalischen Arbeiten beschäftigt, und
ward 1832 Professor der Physik und Mathematik an der
Universität München. 1846 ward er von der
neapolitanischen Regierung zur Regulierung des Maß- und
Gewichtssystems berufen. 1849 trat er als Vorstand des Departements
für Telegraphie im Handelsministerium in österreichische
Dienste, richtete ein fast vollständiges Telegraphensystem
für alle Kronländer ein und beteiligte sich 1850 auch an
der Gründung des Deutsch-Österreichischen
Telegraphenvereins. 1851 folgte er einem Ruf der Schweizer
Regierung zur Einrichtung des Telegraphenwesens in diesem Land, und
1852 kehrte er als Konservator der mathematisch-physikalischen
Sammlungen und Ministerialrat im Handelsministerium nach
München zurück; auch gründete er daselbst 1854 eine
optisch-astronomische Anstalt, aus welcher ausgezeichnete
Instrumente hervorgingen. S. gilt als der wissenschaftliche
Begründer der elektromagnetischen Telegraphie, entdeckte die
Bodenleitung, konstruierte den ersten Drucktelegraphen, der indes
keinen Eingang in die Praxis fand, erfand die elektrischen Uhren,
konstruierte ein sinnreiches Pyroskop, fertigte das erste
Daguerreotypbild in Deutschland, vervollständigte und
begründete die Gesetze der Galvanoplastik, konstruierte ein
Zentrifugalwurfgeschütz, mehrere optische Instrumente etc.
Auch bei der Feststellung der bayrischen Maße und Gewichte
und durch Verbesserung der Bier- und Spirituswagen erwarb er sich
Verdienste. Er starb 12. Sept. 1870 in München. Die optische
Werkstätte wird seit 1862 von den Söhnen Steinheils
weitergeführt. Vgl. Marggraff, Karl August S. (Münch.
1888).
Steinheim, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Minden,
Kreis Höxter, an der Emmer und der Linie Hannover-Altenbeken
der Preußischen Staatsbahn, 135 m ü. M., hat eine
evangelische und eine kath. Kirche, eine Synagoge, ein Amtsgericht,
Maschinenfabrikation, Holzschleiferei, 3 Mahlmühlen,
Steinbrüche und (1885) 2660 meist kath. Einwohner.
Steinhirse, s. Lithospermum.
Steinhorst, Gutsbezirk in der preuß. Provinz
Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum Lauenburg, hat ein Amtsgericht
und (1885) 295 Einw.
Steinhuder Meer, Binnensee in Schaumburg-Lippe und der
preuß. Provinz Hannover, ist 8 km lang, 5 km breit, 41 m
tief, sehr fischreich und fließt durch die Meerbeke zur Weser
ab. Daran der lippesche Flecken Steinhude mit 1400 Einw.; im See
selbst auf einer künstlichen Insel das 1761-65, vom Grafen
Wilhelm von der Lippe als Musterfestung angelegte kleine Fort
Wilhelmsstein (ehemals mit Kriegsschule, in der auch der
preußische General v. Scharnhorst seine erste
militärische Bildung erhielt), jetzt Gefängnis.
Steinhuhn (Caccabis Kp.), Gattung aus der Qrdnung der
Scharrvögel, der Familie der Waldhühner (Tetraonidae) und
der Unterfamilie der Feldhühner (Perdicinae), kräftig
gebaute Vögel mit kurzem Hals, großem Kopf, kurzem, auf
der Firste gewölbtem Schnabel, mittelhohem Fuß mit
stumpfem Sporn oder mit einer den Sporn andeutenden Hornwarze,
mittellangem Flügel und ziemlich langem Schwanz. Das S. (C.
saxatilis Briss.), 35 cm lang, 50-55 cm breit, an der Oberseite und
Brust blaugrau, Kehle weiß, mit schwarzem Kehl- und
Stirnband, die Federn der Weichen gelbrotbraun und schwarz
gebändert, an der Unterseite rostgelb, die Schwingen
schwärzlichbraun mit gelblichweißen Schäften und
rostgelblich gekantet, die äußern Steuerfedern rostrot;
das Auge ist rotbraun, der Schnabel rot, der Fuß
blaßrot; lebte im 16. Jahrh. am Rhein, gegenwärtig in
den Alpen, Italien, der Türkei, Griechenland und Vorderasien,
eine Varietät lebt in ganz Nordasien. Es bewohnt sonnige,
etwas begraste Schutthalden zwischen Holz- und Schneegrenze, im
Süden auch die Ebene aus felsigem
268
Steinhund - Steinkohle.
Boden, zeichnet sich durch Behendigkeit, Klugheit und Kampflust
aus, läuft und klettert sehr gut, fliegt leicht und schnell,
bäumt nur im Notfall, nährt sich von allerlei
Pflanzenstoffen und kleinen Tieren und frißt auch die Spitzen
von jungem Getreide. Im Winter lebt es in größern
Gesellschaften, im Frühjahr isolieren sich die Paare, und das
Weibchen legt in den Alpen im Juni oder Juli in einer Mulde unter
Gesträuch oder überhängendem Fels 12-15
gelblichweiße, braun gestrichelte Eier, welche es in 26 Tagen
ausbrütet. Man jagt das S. des sehr wohlschmeckenden Fleisches
halber. Es kann auch leicht gezähmt werden, bleibt aber sehr
kampflustig, und schon die Alten ließen Steinhühner
miteinander kämpfen. In Indien und China sind Steinhühner
halbe Haustiere geworden, werden gezüchtet, auf die Weide
getrieben, laufen frei im Haus umher und werden auch hier zu
Kampfspielen benutzt. In Griechenland glaubt man, daß sie
Schutz gegen Bezauberung gewähren, und hält sie in sehr
engen, kegelförmigen Käfigen.
Steinhund, s. Nörz.
Steinicht, s. Vogtländische Schweiz.
Steinigtwolmsdorf, Pfarrdorf in der sächs. Kreis-
und Amtshauptmannschaft Bautzen, an der Wesenitz, hat eine evang.
Kirche, Lein- und Damastweberei, Bierbrauerei, Steinbrüche und
(1885) 2529 Einw.
Steinigung (Lapidatio), Tötung mit Steinwürfen,
gesetzliche Strafe bei den Römern, Juden und andern
Völkern, besonders aber Akt der Volksjustiz.
Steinigwerden, eine Krankheit der saftigen Früchte
mancher Pomaceen, besonders der Birnen, Quitten und Mispeln, wobei
der größere Teil des saftigen Fruchtfleisches in meist
isolierte steinharte Körner sich verwandelt und dabei an
Süßigkeit verliert. Die Körner bestehen aus Zellen
mit außerordentlich stark verdickten und von
Porenkanälen durchzogenen Wänden (Steinzellen).
Anfänglich sind diese Zellen gleich den andern dünnwandig
und stärkemehlführend; erst beim Reifen bilden sich aus
der Stärke die Verdickungsschichten, anstatt daß
dieselbe sich in Zucker umwandelt. Die Steinzellen fehlen auch in
normalen, guten Früchten nicht ganz; ihre Menge ist in den
wilden Birnen am größten, übrigens nach Sorten
verschieden. Ihre reichlichere Bildung wird durch magern, trocknen
Boden begünstigt, aus welchem oft die saftigsten Sorten
steinig werden. Ähnliche Bildungen (Steinkonkretionen) treten
auch in fleischigen Wurzelknollen, bei Päonien, Georginen, im
Mark von Hoya und besonders in der Rinde vieler Bäume auf.
Steiningwer, s. Löß.
Steinig, Wilhelm, Schachspieler, geb. 18. Mai 1837 zu
Prag, galt schon als Knabe für den besten Schachkämpen
seiner Vaterstadt, erhielt aber die eigentliche Ausbildung darin
erst bei Hamppe in Wien, wohin er sich 1858 als Student der
Mathematik begab. In dem großen internationalen Wettstreit zu
London (mit Anderssen, Paulsen u. a.) gewann er 1862 den letzten
der sechs Preise, blieb in London und machte das Schach zu seinem
Hauptberuf. 1865 gewann er auf dem Kongreß der Dubliner
Ausstellung den ersten Preis, 1866 siegte er im Wettkampf (match)
mit acht zu sechs Spielen gegen Anderssen. Im Pariser Turnier 1867
erhielt er den zweiten Preis, im Baden-Badener 1870 gleichfalls; im
Londoner 1872 wurde er Hauptsieger, ohne eine einzige Partie zu
verlieren, und in Wien erstritt er 1873 den großen
Kaiserpreis von 2000 Gulden. Nachdem er dann noch den
Engländer Blackburne, den Gewinner des zweiten Wiener Preises,
im Einzelkampf besiegt, beteiligte er sich längere Zeit nicht
mehr an Turnieren. Auf den Schachkongressen zu Paris 1878 und zu
Wiesbaden 1880 war er als Berichterstatter für die englische
Zeitung "The Field" erschienen, deren Schachrubrik er damals
leitete. Der Tod Anderssens und die großen Erfolge Zukertorts
(s. d.), den er 1872 in einem Match leicht geschlagen, spornten S.
indessen zu neuer Thätigkeit an, doch mußte er sich,
obwohl er im Wiener Turnier 1882 die beiden ersten Preise mit
Winawer geteilt hatte, 1883 in London, wo Zukertort Erster blieb,
mit der zweiten Stelle begnügen. Seitdem betrieb S.
höchst eifrig einen neuen Einzelwettkampf mit Zukertort, der
nach langen Verhandlungen in den ersten Monaten 1886 in Amerika
ausgefochten wurde, und in welchem S. schließlich mit 10
gegen 5 Gewinn- bei 5 Remisspielen siegte. In jüngster Zeit
stellte sich S., nunmehr der erste Schachspieler der Gegenwart, dem
Russen Tschigorin auf Cuba, der eine Minderheit der Gewinnpartien
erzielte.
Steinkauz, s. Eulen, S. 906.
Steinkern, in der Botanik s. Steinbeere; in der
Petrefaktenkunde s. Abdruck.
Steinkind (Steinfrucht, Lithopaedion), eine unreife
Leibesfrucht, welche abgestorben in der Bauchhöhle liegt,
eingekapselt, verschrumpft und durch Aufnahme von Kalksalzen
steinhart geworden ist. Das S. verursacht der Mutter bisweilen
allerhand Beschwerden; manchmal aber bleibt sie von solchen ganz
verschont, kann sogar schwanger werden und normal gebären.
Derartige Bildungen sind bei Menschen äußerst selten,
bei Schafen häufiger.
Steinkirche, s. Dolmen.
Steinklee, s. Melilotus und Medicago.
Steinkochen, s. Kochkunst (in prähistorischer
Zeit).
Steinkohle (Schwarzkohle), im petrographisch-technischen
Sinn die schwarzen, kohlenstoffreichen, an Wasserstoff und
Sauerstoff armen Kohlen; im geologischen Sinn die Kohlen der
ältern Formationen vom Silur bis einschließlich der
Kreideformation, vorzüglich diejenigen der Steinkohlenperiode.
Beide Begriffe decken sich meist insofern, als die ältern
Kohlen der Regel nach auch die kohlenstoffreichern sind; indes
tragen eine Reihe jüngerer (tertiärer) Kohlen den
petrographischen Charakter der S. an sich, während umgekehrt
Kohlen, welche nachweisbar der Steinkohlenformation angehören,
Braunkohlen zum Verwechseln ähnlich sehen. Die S. im
petrographisch-technischen Sinn des Wortes ist eine dunkel
gefärbte, undurchsichtige, höchstens in kleinen Splittern
durchscheinende amorphe Masse von Glas- und Fettglanz; Härte
2-2,5, spez. Gew. 1,2-1,7; sie färbt heiße Kalilauge im
Gegensatz zur Braunkohle nicht oder unbedeutend; an der offenen
Flamme verbrennt sie unter brenzligem Geruch (Unterschied von
Anthracit). Die Hauptbestandteile sind: Kohlenstoff (C), Sauerstoff
(O) und Wasserstoff(H), daneben etwas Stickstoff (N), Schwefel (S),
Bitumen und Asche (in reinen Kohlen unter 0,5 Proz.). Die
quantitative Zusammensetzung der S. zeigt bedeutende Schwankungen,
und an verschiedenen Stellen desselben Flözes entnommene
Proben zeigen kaum je gleiche Zusammensetzung. Von den
Aschebestandteilen abgesehen, kann man folgende Grenzwerte
annehmen: 55-98 Proz. Kohlenstoff, 1,75-7,85 Proz. Wasserstoff,
0-38 Proz. Sauerstoff, Spuren bis 2,0 Proz. Stickstoff. Bei
Abschluß der Luft erhitzt, liefern die Kohlen je nach ihrer
chemischen Zusammensetzung und der Temperatur in sehr verschiedenen
Mengen: Kohlenwasserstoffgase (namentlich Methan und Äthylen),
Wasserstoff, Kohlensäure, Kohlenoxyd, Stickstoff,
Schwefelwasserstoff, Teerdämpfe (bestehend aus
Kohlenwasserstoffen, Phenolen und
269
Steinkohle (chemische Zusammensetzung, Grubenbrände,
Varietäten).
Basen), Ammoniak und Wasserdämpfe. Als accessorische
Begleiter der Kohle finden sich: Schieferthon, Kalkspat, Gips,
Nakrit, Quarz, Eisenspat, Eisenkies, Bleiglanz, Kupferkies. Von
diesen Beimengungen verringert der Eisenkies den Wert der Kohle als
Brennmaterial, und wo er in größern Mengen auftritt,
zwingt er zu einem Abschwefeln der Kohlen; er kann aber auch durch
die mit seiner Zersetzung verbundene Temperaturerhöhung zu
Selbstentzündungen der Kohle führen. Es wird deshalb in
den Kohlengruben auf das möglichst sorgsame Fördern des
sogen. Grubenkleins Gewicht gelegt. Kohlenbrände entstehen, da
sie die Mitwirkung der Atmosphäre voraussetzen, meist in dem
Abbau unterworfenen (verritzten) Flözen, während
unverritzte Flöze, namentlich an ihrem Ausgehenden
(Kohlenausstrichen), derselben Gefahr ausgesetzt sind. Bei den
Kohlenbränden wird die Kohle teils vollkommen verbrannt, teils
in Koks umgewandelt; die begleitenden Schieferthone werden
gefrittet (Kohlenbrandgesteine, Porzellanjaspis) und eine Reihe von
Sublimationsprodukten (Salmiak, Schwefel, Alaun) gebildet. Die
Bekämpfung einmal ausgebrochener Kohlenbrände muß
sich auf Isolierung der entzündeten Partien durch Abbau der
benachbarten Flözteile und Errichtung trennender Mauern
beschränken. - Nach äußern mineralogischen
Merkmalen unterscheidet man unter den Steinkohlen schieferige
Varietäten (Schieferkohle), dünnblätterige
(Blätterkohle), zu unregelmäßigen
parallelepipedischen Formen zerfallende (Grobkohle), faserige
(Faserkohle), erdige, stark abfärbende (Rußkohle),
pechschwarze, lebhaft fettglänzende von muscheligem Bruch
(Pechkohle). Weitere Abarten sind: die Kannelkohle (Cannel Coal,
Candle Coal), eine schwer zersprengbare, gräulichschwarze
Kohle; Glanzkohle mit muscheligem Bruch und stark glänzenden,
öfters regenbogenartig angelaufenen Absonderungsflächen.
In der Technik unterscheidet man nach dem Verhalten der Kohle im
Feuer: Backkohlen, Sinterkohlen und Sandkohlen, zu welchen Arten
noch die Gaskohlen, bald den einen, bald den andern nahestehend,
als reichlich Leuchtgas liefernde hinzukommen. Das Pulver der
Backkohlen (fette Kohlen) liefert beim Erhitzen eine
gleichmäßig zusammengeschmolzene Masse (Koks), die
Sinterkohlen eine weniger gleichmäßige und weniger
feste, nicht eigentlich geschmolzene, sondern nur
"zusammengesinterte" Masse; die Sandkohlen (magere Kohlen) endlich
liefern ein Pulver ohne Zusammenhang. Fleck versuchte dieser rein
empirischen Einteilung einen wissenschaftlichen Hintergrund zu
geben. Er unterschied den Wasserstoff in der S. als gebundenen und
als disponibeln, von welchen der erstere denjenigen Bruchteil des
Gesamtgehalts darstellt, der mit dem gleichzeitig vorhandenen
Stickstoff und Sauerstoff zu Ammoniak und Wasser verbunden gedacht
werden kann, während der Überschuß an Wasserstoff
"disponibel" bleibt. Nach Fleck sind alle Kohlen, welche auf 1000
Gewichtsteile Kohlenstoff über 40 Teile disponibel und unter
20 Teile gebundenen Wasserstoff enthalten, verkohlbar und bilden
die Backkohlen. 40 Teile disponibler und über 20 Teile
gebundener Wasserstoff geben Back- und Gaskohle; weniger als 40
Teile disponibler und mehr als 20 Teile gebundener Wasserstoff sind
in Gas- und Sinterkohlen enthalten; Sinterkohlen und Anthracite
enthalten weniger als 40 Gewichtsteile disponibeln und weniger als
20 Teile gebundenen Wasserstoff. Da diese Unterschiede nicht
hinreichend scharf durchführbar sind, so hat Gruner eine neue
Klassifikation gegeben, indem er fünf Typen unterscheidet,
deren Zusammensetzung und Verhalten in folgender Tabelle angegeben
sind; an den Grenzen gehen dieselben ineinander über.
Klassen Zusammensetzung (C,H,O) O:H Spezifisches Gewicht
Wärmeeffekt Wärmeeinheiten Wasserverdampfung Kilogr.
Flüchtige Bestandteile Verhalten bei der Destillation (Koks,
Beschaffenheit der Koks, Gas, Ammoniak Wasser, Teer)
1) Trockne Kohlen mit langer Flamme (Sandkohlen) 75-80 5,5-4,5
19,5-15 4-3 1,25 8000-8500 6,7-7,5 45-40 50-60 pulverförmig
od. höchstens gefrittet 20-30 12-5 18-15
2) Fette Kohlen mit langer Flamme (Gaskohlen, Sinterkohlen)
80-85 5,8-5 14,2-10 3-2 1,28-1,30 8500-8800 7,6-8,3 40-32 60-68
geflossen, aber sehr aufgebläht 20-17 5-3 15-12
3) Fette oder Schmiedekohlen (Backkohlen) 84-89 5-5,5 11,5-5,5
2-1 1,30 8800-9300 8,4-9,2 32-26 68-74 geflossen, mitteldicht 16-15
3-1 13-10
4) Fette Kohlen mit kurzer Flamme (Verkokungs-K.) 88-91 5,5-4,5
6,5-5,5 1 1,30-1,35 9300-9600 9,2-10 26-18 74-82 geflossen, sehr
kompakt, wenig blasig 15-12 1-1 10-5
5) Magere Kohlen od.Anthracite mit kurzer Flamme 90-93 4,5-4
5,5-3 1 1,35-1,4 9200-9500 9-9,5 18-10 82-90 gefrittet oder
pulverförmig 12-8 l-0 5-2
Diese fünf Typen charakterisieren sich schon durch
äußere Kennzeichen, welche aber durch Erhitzen bei
Abschluß der Luft (trockne Destillation) kontrolliert werden
müssen. Die den Braunkohlen sich nähernden Steinkohlen
mit langer Flamme sind verhältnismäßig hart, beim
Anschlagen klingend, zäh, von unebenem Bruch, matt schwarz und
von mehr braunem als schwarzem Strich. Mit abnehmendem Sauerstoff
und damit abnehmender Produktion von Wasser beim Destillieren wird
die Kohle zerreiblicher, weniger klingend, schwärzer und
dichter. Der Glanz nimmt mit dem Wasserstoffgehalt und damit auch
das Agglomerationsvermögen zu. Die den Anthraciten sich
nähernden Kohlen sind rein schwarz und im allgemeinen ein
wenig mürber als fette Kohlen mit kurzer Flamme. Die
Eigenschaften werden indes durch erdige Beimengungen alteriert.
Dichtigkeit und Härte wachsen mit dem Aschengehalt,
während der Glanz sich vermindert. Die Brennbarkeit und die
Länge der Flamme hängen von der Gegenwart flüchtiger
Elemente ab. Die den Braunkohlen sich nähernden Steinkohlen
entzünden sich leicht und brennen mit langer, rußiger
Flamme. Die an flüchtigen Bestandteilen ärmern,
namentlich wasserstoffarmen, Kohlen
270
Steinkohle (Vorkommen, Entstehung).
entzünden sich, verbrennen weniger leicht und halten lange
an. Die Flamme ist kurz und wenig rauchig. Die Steinkohlen finden
sich, soweit es sich um größere, technisch wichtige
Massen handelt, in Schichten (Flözen), häufig in
mehrfachem Wechsel, zwischen andern Gesteinen (Schieferthonen und
Sandsteinen). Das ganze Schichtensystem ist ältern Gesteinen
gewöhnlich muldenförmig eingelagert (Steinkohlenbecken,
Steinkohlenmulden). Ein Kohlenfeld ist die Gesamtheit
bauwürdiger Flöze in horizontal ununterbrochenem
Zusammenhang oder doch nur durch Verwerfungen getrennt, welche den
ursprünglichen Zusammenhang trotz der Trennungen erkennen
lassen. Untergeordnete, technisch gewöhnlich wertlose
Vorkommnisse sind die in Form kleiner Lager, Nester, Schmitzchen,
als einzelne Stämme und Stammfragmente. Die Flöze eines
Kohlenfeldes sind nach Lage und Mächtigkeit
außerordentlich verschieden. Als unterste Grenze der
Bauwürdigkeit wird gewöhnlich 0,6 m Mächtigkeit
angegeben, aber auch hier kann das Auftreten mehrerer Flöze
übereinander die Verhältnisse ändern. Es sind bis 30
m mächtige Kohlenflöze bekannt, doch treten die
bedeutendern Mächtigkeiten mehr bei lager- oder
stockförmigen Einlagerungen als bei eigentlichen Flözen
auf. Häufig stören Verwerfungen die ursprüngliche
Lage und unterbrechen den Zusammenhang der Flöze. Solche
Faltungen, Knickungen, Überkippungen und Verschiebungen der
Flöze bereiten dem Abbau oft enorme Schwierigkeiten.
Erfahrungsmäßig gehören die meisten und wichtigsten
Steinkohlen dem Alter nach der Steinkohlenformation (s. d.) an,
obgleich sie den andern Formationen nicht fehlen und hier
wenigstens lokal ebenfalls Wichtigkeit erhalten können. So
führen das Silur und Devon mitunter anthracitische Flöze;
im Rotliegenden, namentlich dem untern, tritt bauwürdige Kohle
in der Saargegend, in Sachsen etc. auf; ein Teil der ostindischen
und chinesischen Kohlenschätze und einige nordamerikanische
Flöze sind triasisch, in Deutschland gehört dem untern
Keuper die meist unbauwürdige sogen. Lettenkohle an. In Polen
sind Keuperkohlen bauwürdig. Der Liasformation gehören
die für Ungarn sehr wichtigen Ablagerungen von Steyerdorf und
Fünfkirchen an. England, Polen, Rußland und Persien
besitzen ebenfalls jurassische Kohlen. Eine für
Norddeutschland sehr wichtige Kohle liegt in den Grenzschichten
zwischen Jura und Kreide, in der Wealdenformation im Teutoburger
Wald, Wesergebirge und links der Weser und im Deister. In der noch
jüngern Kreideformation sind bauwürdige Kohlen sehr
selten. In Deutschland sind als abbauwürdig nur ein paar
dünne Flöze am Altenberg bei Quedlinburg sowie an einigen
Orten (besonders bei Ottendorf) im Regierungsbezirk Liegnitz zu
nennen. Österreich gewinnt aus der der gleichen Formation
angehörigen Mulde der Neuen Welt bei Wiener-Neustadt
jährlich gegen ½ Mill. Ztr. Noch jüngere Kohlen,
welche nach ihren petrographischen Eigenschaften ebenfalls als
Steinkohlen (Pechkohlen) bezeichnet werden müssen,
während sie im geologischen Sinn Braunkohlen darstellen,
finden sich als lokale Abänderungen typischer Braunkohlen in
vielen Tertiärbecken, so unter andern Orten in Böhmen und
Oberbayern. Die Steinkohlen stammen ohne Zweifel von pflanzlichen
(nur selten und untergeordnet von tierischen) Organismen ab, welche
einem langsamen Verkohlungsprozeß unterlegen sind. Dieser
Prozeß verlief unter Entwickelung von wasserstoff- und
sauerstoffreichen Gasen und mußte mithin einen
kohlenstoffreichen Rückstand, die S., liefern. Am
frühsten ist der Zusammenhang zwischen Kohlen und Pflanzen
wohl von Scheuchzer (gest. 1733) betont worden; bestimmter und den
heutigen Ansichten sich vollkommen anschmiegend, betonte v.
Beroldingen 1778 den Zusammenhang zwischen Torf, Braunkohle und S.,
Hutton (1785) und Williams (1798) stellten für die englische
Kohle gleiche Hypothesen auf. Das meiste Beweismaterial zur
Stützung der jetzt herrschenden Ansicht brachte aber
Göppert bei. Ein Vergleich der mittlern chemischen
Zusammensetzung der Holzfaser, des Torfs, der Braunkohle, der S.
und des Anthracits zeigt, daß diese fünf Körper in
der genannten Folge eine Reihe bilden, in welcher ein an
Kohlenstoff relativ armer, an Wasserstoff und Sauerstoff reicher
Körper allmählich andern Substanzen weicht, die immer
reicher an Kohlenstoff, ärmer an Sauerstoff und Wasserstoff
sind. Es ist nämlich die mittlere prozentige Zusammensetzung
der genannten Körper:
C H O N
Holzfaser 50 6,0 43,0 1,0
Torf 59 6,0 33,0 2,0
Braunkohle 69 5,5 25,0 0,8
Steinkohle 82 5,0 13,0 0,8
Anthracit 95 2,5 2,5 Spur
Führt man statt Gewichtsprozente Atome ein und berechnet
unter Vernachlässigung des Gehalts an Stickstoff den
Wasserstoff- und Sauerstoffgehalt auf je 100 Atome Kohlenstoff, so
erhält man:
C H O
Holzfaser 100 150 65
Torf 100 115 40
Braunkohle 100 96 27
Steinkohle 100 80 12
Anthracit 100 27 2
welche Zahlen die Abnahme des Wasserstoffs und Sauerstoffs noch
deutlicher zeigen. Erfahrungsmäßig entwickeln sich in
Torfmooren, in Braunkohlen- und Steinkohlengruben Gase und
Dämpfe, welche, wie das Grubengas (CH4) Kohlensäure (CO2)
und Wasser (H2O), Wasserstoff und Sauerstoff neben Kohlenstoff
enthalten. Es sind dies jene Gase, welche als schlagende und
stickende Wetter in erster Linie den Steinkohlenbergbau so
gefährlich machen, daß im Durchschnitt jährlich 3-4
pro Mille aller Bergleute das Leben einbüßen, und
daß für jede 1½ Mill. Ztr. geförderter S.
ein Menschenleben geopfert werden muß. Diese Gase entziehen
aber, wie ihre chemische Formel zeigt, bei ihrer Bildung dem
Mutterkörper mehr Wasserstoff und Sauerstoff als Kohlenstoff,
so daß der letzte Rest eines solchen Verkohlungsprozesses ein
nur aus Kohlenstoff bestehender Körper sein muß. Erhitzt
man Holz in verschlossenen Röhren, so erhält man bei
200-280° eine der Holzkohle, bei 300° eine der S.
ähnliche Masse, die bei 400° anthracitartig wird. Hierher
gehören auch die vielfältigen Beobachtungen, nach welchen
das Holz der Grubenzimmerung in mitunter überraschend kurzer
Zeit in eine der Braunkohle ähnliche Masse umgewandelt wird.
Einem gleichen Prozeß unterliegen Stämme, welche in
Torfmoore geraten sind, und die tiefsten Schichten der Moore selbst
liefern den Speck- oder Pechtorf, eine an Braunkohle oder noch mehr
an S. erinnernde Masse. Den vollgültigsten Beweis gibt endlich
das Mikroskop, indem es an zahlreichen Präparaten nicht nur
die pflanzliche Natur der Kohlen im allgemeinen zeigt, sondern auch
die systematische Stellung der kohlebildenden Pflanzen bestimmen
läßt. Diese Pflan-
271
Steinkohle (Verbreitung in einzelnen Ländern).
zen sind aber in den verschiedenen Formationen sehr verschieden,
und nur der Umstand, daß erfahrungsmäßig die
Holzfaser systematisch weit voneinander entfernter Pflanzenarten
doch annähernd gleiche Zusammensetzung hat, erlaubte in der
oben angenommenen Allgemeinheit von einem alle mineralischen
Brennstoffe umfassenden Verkohlungsprozeß zu sprechen. Die
Kohlen des Silurs sind bei dem Fehlen sonstiger Pflanzenreste in
dieser Formation vermutlich auf Algen zurückzuführen,
während im Devon schon einige der in der Steinkohlenformation
ihre Hauptentwickelung findenden Pflanzen kohlebildend auftreten.
In den jüngern Formationen wurden Farne, Cykadeen und
Koniferen aufgehäuft, und die letztere Klasse hat neben
Dikotyledonen fast ausschließlich das Material der
steinkohlenartigen Tertiärkohlen geliefert. Den Konsequenzen
aus der Annahme eines langsamen Verkohlungsprozesses entsprechend,
sind die Steinkohlen im allgemeinen ältere Kohlen als die
Braunkohlen und werden ihrerseits durch Anthracit an Alter
übertroffen. Abweichungen von dieser Regel lassen sich auf
besondere Umstände zurückführen, welche bald
beschleunigend, bald verlangsamend auf den Verlauf des Prozesses
einwirken mußten. So verschafften starke
Schichtenstörungen den sich entwickelnden Gasen durch
Spaltenbildungen einen Ausweg; ein Gehalt an vitriolisierendem
Eisenkies bildet neben Eisenvitriol freie Schwefelsäure,
welche verkohlend auf die pflanzliche Substanz einwirkt, und in
demselben Sinn unterstützt eine Erhöhung der Temperatur,
wie sie eruptierendes Gestein hervorbringen kann, den Prozeß.
So ist am Meißner in Hessen Braunkohle durch einen
bedeckenden Basalt stellenweise in einen stängelig
abgesonderten Anthracit (Stangenkohle) umgewandelt, und
ähnliche Erscheinungen sind von Salesl bei Aussig in
Böhmen, von Mährisch-Ostrau u. a. O. bekannt. Wurden
dagegen die Schichten der betreffenden Formation nicht von
jüngern bedeckt, so fehlte ein Haupterfordernis der Einleitung
des Verkohlungsprozesses, der hohe Druck. So kommen in den
Gouvernements Tula und Kaluga Kohlen vor, welche nach ihren
organischen Resten (Stigmaria, Lepidodendron) zweifellos der
Steinkohlenformation angehören, während sie der
Braunkohle durchaus ähnlich geblieben sind. Die die Kohlen
begleitenden Gesteine sind in einem ähnlichen unreifen
Zustand: statt der Schieferthone sind plastische Thone und Letten
entwickelt; die Sandsteine sind locker, fast lose Sande.
Verbreitung. Produktion. Verbrauch
Die wichtigsten Kohlenfelder (soweit sie der
Steinkohlenformation angehören, der übrigen wurde schon
oben Erwähnung gethan) sind in Deutschland, von W. nach O.
geordnet. 1) das Aachener Becken oder das Doppelbecken an der Worm
und Inde, nach Deutschland hereinragende Teile des großen
belgischen Beckens; 2) das Saarbecken oder Saarbrückener
Becken, an welchem außer Preußen auch Bayern und
Lothringen partizipieren; 3) das westfälische oder Ruhrbecken,
zu welchem als äußerste Vorposten nach N. die
Kohlenfelder von Ibbenbüren und Piesberg bei Osnabrück
gehören; 4) und 5) die beiden unbedeutenden Kohlenvorkommnisse
von St. Bilt im Elsaß und Berghaupten in Baden; 6)-10) die
ebenfalls nur kleinen Becken von Ilfeld bei Nordhausen,
Wettin-Löbejün in der Provinz Sachsen,
Manebach-Kammerberg in Thüringen, Stockheim bei Koburg und
Erbendorf in Oberfranken; 11) und 12) im Königreich Sachsen
das größere Zwickau-Chemnitzer und das kleinere
Plauensche Becken; 13) und 14) die beiden schlesischen Becken, das
von Waldenburg und das oberschlesische, in dessen Zentrum
Königshütte gelegen ist. Die relative Wichtigkeit der
Kohlenfelder Deutschlands erhellt aus der folgenden, aus die
Produktion des Jahrs 1873 bezüglichen Tabelle, welche für
die Vergleichszwecke auch gegenwärtig noch ausreicht:
Steinkohlenbecken Zahl der Gruben Prozent der Gesamtzahl
Produktion in Zentnern Prozent der Gesamtproduktion Wert in
Mark Prozent des Gesamtwerts Arbeiter Prozent der Gesamtzahl
Westfälisches Becken 230 42,4 328161620 45,9 180227595 45,8
80281 46,0
Qberschlesisches Becken 132 24,3 155380208 21,8 62077491 15,8
32621 18,8
Saarbecken 38 7,0 96851737 13,6 79696177 20,2 24469 14,1
Zwickau - Plauen 73 13,5 63 321 518 8,938109831 9,7 16429
9,5
Waldenbura 35 6,5 45876197 6,4 1042384 5,7 12298 7,5
Aachener Becken 18 3,3 21037039 3,0 10788069 2,7 6078
Stockheim 6 1,1 1311879 0,2 745863 0,2 683 0,4
Wettin und Lödejün 3 0,5 1045137 0,1 681429 0,2 400
0,3
Ilfeld 3 0,5 501095 0,1 262086 0,1 215 0,2
Berghaupten 3 0,5 253883 0,0 192024 0,0 142 0,1
Manebach und Kammerberg 2 0,4 19831 0,0 12981 0,0 36 0,0
Zusammen: 543 100,0 713760144 100,0 394035930 100,0 173652
100,0
Während unter den außerdeutschen Ländern
Belgien reiche Kohlenlager im Zusammenhang mit dem Aachener
Becken besitzt, sind die französischen Becken (St.-Etienne,
Creusot, Autun, Alais etc.) unbedeutender. Spanien und Portugal
scheinen große Vorräte an Steinkohlen zu bergen, wogegen
Italien und die Schweiz nur wenige und kleine Partien der
produktiven Steinkohlenformation aufzuweisen haben. Im O.
Deutschlands sind in Böhmen mehrere Becken (Kladno, Rakonitz,
Pilsen) zu verzeichnen, ferner das Ostrauer in Mähren und
Österreichisch-Schlesien. Rußland besitzt außer
den oben erwähnten Kohlen der Gouvernements Kaluga und Tula
solche am Donez im Süden, am Ural und hoch im N. auf den
Bäreninseln und Spitzbergen. Das großbritannische
Inselreich hat relativ zu seinem Gesamtgebiet das größte
Areal Kohlenfelder. Es verteilen sich dieselben auf eine Anzahl
isolierter Becken, unter denen die von Northumberland, Yorkshire,
Derbyshire, Südwales und Schottland die wichtigsten sind.
Unter den übrigen Erdteilen der Alten Welt ist besonders Asien
und hier wiederum China, wo die Kohlenlager über ein Areal von
200,000 QM. verbreitet sind (s. China, S. 4), sehr reich an Kohlen,
die zum größten Teil der Steinkohlenformation
angehören. Als unermeßlich werden die Kohlenschätze
Nordamerikas geschildert, die sich über sechs große
Territorien verbreiten: 1) das appalachische Kohlenfeld, an welchem
die Staaten Pennsylvanien, Ohio, Virginia, Kentucky, Tennessee und
Alabama partizipieren; 2) das Illinois-Missouri-Kohlenfeld, von dem
außer auf die benennenden Staaten Teile auf Indiana,
Kentucky, Iowa, Kansas
272
Steinkohle - Steinkohlensormation.
und Arkansas entfallen; 3) das Kohlenfeld in Michigan; 4) das in
Texas; 5) Rhode-Island und endlich 6) das Doppelfeld von
Neuschottland und Neubraunschweig. Die Ausdehnung der Kohlenfelder
in englischen Quadratmeilen wird veranschlagt für China auf
mehr als 200,000, Nordamerika auf 193,870, Ostindien 35,500,
Neusüdwales 24,000, Großbritannien 9000, Deutschland
3600, Spanien 3500, Frankreich 1800, Belgien 900. Die
Kohlenproduktion hat in verhältnismäßig kurzer Zeit
einen rapiden Aufschwung genommen. Sie betrug 1860 in England,
Deutschland, den Vereinigten Staaten von Nordamerika, in
Frankreich, Belgien und Österreich 124 Mill. metr. Tonnen. Die
Gesamtproduktion (zu 1000 kg) betrug nach Neumann Spallart
("Übersichten der Weltwirtschaft") 1884: 409,381,515 Ton.
(à 1000 kg), die sich auf die einzelnen Länder
folgendermaßen verteilen: Großbritannien 163,329,904,
Deutschlands 121,000, Frankreich 20,023,504, Belgien 18,051,499,
Österreich 17,199,518, Rußland 3,500,000, Ungarn
2,525,056, Spanien 979,350, Schweden 196,831, Italien 164,737,
Niederlande 49,554, Portugal 17,000, Schweiz 5800, Europa
298,163,753. Vereinigte Staaten 100,268,109, China 3,000,000,
Neusüdwales 2,793,086, Britisch-Nordamerika 1,673,000,
Ostindien 1,420,183, Japan 755,800, Chile 490,000, Neuseeland
488,524. Die Steinkohlenproduktion im Deutschen Reich betrug 1887
über 60 Mill. Ton. und verteilte sich wie folgt:
Westfalen 21528741
Schlesien 16187078
Rheinland 16127350
Hannover 581546
Königr. Preußen 54548283
Königreich Sachsen 4293417
- Bayern 683619
Baden 6006
Elsaß-Lothringen 693 679
Deutsches Reich 60333984
Der Kohlenverbrauch gibt einen Maßstab für die
materielle Kultur. Er betrug in metr. Tonnen in:
Absoluter Verbrauch Auf den Kopf der Bevölkerung
1865 1884 1865 1884
Großbritannien 90404000 140135000 3,092 3,900
Belgien 7 631 000 13483000 1,577 2,331
Vereinigte Staaten 18825000 98109000 0,598 1,766
Deutschland 26680000 69001000 0,730 1,505
Frankreich 8522000 30941000 0.470 0,816
Osterreich 5050000 18132000 0,139 0,464
Rußland 1085000 5200000 0,015 0,066
Die Frage nach der Möglichkeit einer Erschöpfung der
S. hat namentlich für England größeres Interesse.
Man nimmt an, daß das Land noch einen Vorrat von ca. 146
Milliarden Ton. innerhalb der Tiefe von 4000 Fuß besitze;
davon sind 90 Milliarden Ton. aufgeschlossen, während man 56
Milliarden auf voraussichtlich zu erschließende Flöze
(?) rechnet. Nimmt man an, daß sich der Kohlenverbrauch in
bisheriger Weise weiter steigern werde, so würden diese
Schätze noch für 250 Jahre ausreichen. Auch Deutschland
kann seinen Bedarf noch für Jahrhunderte decken, dann aber
bieten Rußland und andre Länder reichlichen Ersatz, der
voraussichtlich durch Herabsetzung der Transportkosten für die
europäischen Länder erreichbar werden wird. Nicht vor
einer geologischen oder technischen, sondern vor einer
ökonomischen Frage werden also die folgenden Generationen
hinsichtlich des Kohlenbedarfs stehen. - Die Benutzung der S. ist
wesentlich eine doppelte: die als Brennmaterial und die der
Gewinnung der Destillate, welch letztere sich in
Leuchtgasfabrikation, Gewinnung des Teers und seiner Derivate etc.
gliedert. Untergeordnet ist die Verwendung politurfähiger
Kohlen zu Schmuckgegenständen (Gagat in England und
Württemberg), an Eisenkies und Asche reicher Abarten zur
Alaungewinnung, der Steinkohlenasche als Dünger und als Zusatz
zum Mörtel.
Die Benutzung der S. reicht bei einigen Völkern weit
zurück. So sollen die Chinesen schon frühzeitig ihren
Wert erkannt haben, und in einigen englischen Gruben hat man
Steinwerkzeuge vorgefunden, so daß die Kenntnis der Kohle
älter als die des Eisens sein würde. Die alten Deutschen
scheinen neben Holz nur den Torf als Brennmaterial verwendet zu
haben; es finden sich auch alte Schlackenhalden an der Ruhr, also
in kohlenreicher Gegend, nicht im Thal, sondern offenbar wegen der
bequemen Nähe der Wälder auf Bergesrücken. Daß
die Römer, als sie als Eroberer England betraten, die Kohlen
wenigstens an den Ausstrichen benutzt haben, ist durch Funde auf
dem Herd eines römischen Bades bewiesen. In Deutschland
scheint das Zwickauer Becken schon von den bergbautreibenden Sorben
benutzt worden zu sein, während die Ausbeutung des belgischen
und Aachener Beckens sich rückwärts bis ins 11., des
Ruhrbeckens bis ins 14. Jahrh. verfolgen läßt. In
England werden schon im 9. Jahrh. Kohlen als Brennmaterial
urkundlich erwähnt; im 12. Jahrh. sind sie bereits ein
wichtiger Handelsartikel, der sich nicht mehr vom Markt
verdrängen ließ, obgleich mehrere Edikte ihre Benutzung
als luftverpestend verboten. Vgl. Geinitz, Fleck und Hartig, Die
Steinkohlen Deutschlands und andrer Länder Europas
(Münch. 1865); v. Dechen, Die nutzbaren Mineralien und
Gebirgsarten im Deutschen Reich (Berl. 1873); Hull The coalfields
of Great Britain (4. Aufl., Lond. 1880); Mac Farlane, The
coalregions of the United States (New York 1873), Mietzsch,
Geologie der Kohlenlager (Leipz. 1875); Pechar, Kohle und Eisen in
allen Ländern der Erde (Stuttg. 1878); Höfer, Die Kohlen-
und Eisenerzlagerstätten Nordamerikas (Wien 1878,
Ausstellungsbericht); Muck, Grundzüge und Zieleder
Steinkohlenchemie (Bonn 1881); Derselbe, Chemisches
Steinkohlenbüchlein (das. 1882); Toula, Die Steinkohlen (Wien
1888); Demanet, Betrieb der Steinkohlenbergwerke (deutsch,
Braunschw. 1886).
Steinkohleformation (Kohlenformation, karbonische
Formation; hierzu die Tafeln "Steinkohlenformation I-III"), ein
vorwaltend aus Kalksteinen, Konglomeraten, Grauwacken, Sandsteinen
und Schieferthonen, untergeordnet aus Steinkohle,
Sphärosideriten und Kieselschiefern bestehendes
paläozoisches Schichtensystem, das bei vollkommener
Entwickelung der Systemreihe der devonischen Formation aufgelagert
ist und seinerseits vom Rotliegenden überlagert wird. Die
Trennung von den beiden benachbarten Formationen wird häufig
durch vollkommene Konkordanz und petrographische Ähnlichkeit
der betreffenden Grenzschichten, namentlich gegen das Rotliegende
hin, erschwert. Paläontologisch wird die S. charakterisiert
durch die in keiner andern Periode erreichte Üppigkeit der
Kryptogamenflora und durch das erstmalige Auftretenvon Reptilien
und luftatmenden Tieren. Sehr häufig ist die mitunter bis zu
7000 m Mächtigkeit anschwellende Schichtenfolge den
ältern Formationen in Form flach tellerartiger Mulden, Becken
oder Bassins aufgelagert, deren Zusammenhang und ursprüngliche
Lage allerdings oft durch sekundäre Störungen
(Verwerfungen) unterbrochen und verändert worden sind. Das
beigegebene Profil (s. Tafel III) durch einen Teil des Kohlenfeldes
von Zwickau (Sachsen) soll ein Bild der allgemeinen
Lagerungsverhältnisse geben. Es ist der südwestliche
Flügel einer Mulde mit einer Mehrzahl
Steinkohlenformation I.
Säulenglieder (Entrochiten) von Rhodocrinus verus. (Art.
Krinoideen.)
Palaeocidaris clliptica, ganze Schale. (Art. Echinoideen.)
Kinnlade von Cochliodus contortus. (Art. Selachier.)
Rückenstachel von Orodus cinctus.
(Art. Selachier.)
Geöffnet, mit : aufgerollte Armgerüst.
Rückenstachel von
Tristychius arcuatus.
(Art. Selachier.)
Spirifer hystericus. (Art. Brachiopoden.)
Platycrinus triacanmodactylus. (Art. Krinoideen.)
Vorderansicht. Seitenansicht. Conocardium fusiforme. (Art.
Muscheln.)
Einzelner Arm mit den Ranken.
ChoilCtes Dalmanni. (Art. Brachiopoden.)
Von oben. Von der Seite. [Von unten. Pentremites
florßalis. (Art. Krinoideen.)
Innere Seiten-Kammern, ansieht.
Chaetetes radians. (Art. Koranen.)
Nat. Vorder-Gr. ansieht.
Fusulina cylindrica. (Art. Rhizopoden.)
Oyclophthalmus Bucklandi, daneben -lie Flügeldecken eines
Käfers.
(Art. Spinneniere.)
Goniatites sphaericus. (Art. Tintenschnecken.)
Meyers Konv. - Lexikon, 4. Aufl.
Bibliographisches Institut in Leipzig.
Goniatites Jossae (Art. Tintenschnecken.)
Zum Artikel »Steinkohlenformation«
Steinkohlenformation II.
1. Zahnfarn (Odontopteris). - 2. Schuppenbaum (Lepidodendron).
-
3. Cordaites borassifolia. - 4.Pecopteris cyathea. - 5.
Kalamiten. -
6. Sigillaria. - 7. Stigmarienform einer Sigillarie mit Wurzeln
im
Wasser. - 8. Blattstern von Annularien.
Steinkohlenformation III.
GEOLOGISCHES PROFIL DURCH DAS KOHLENFELD VON ZWICKAU.
Von der Cainsdorfer Kirche nach Morgensternschacht II (Nach
Mietzsch).
273
Steinkohlenformation (Abteilungen, Flora).
von Kohlenflözen und zeigt neben dem allgemeinen Einfallen
der Schichten nach Nordosten die Störungen dieser
Gesetzmäßigkeit durch die Verwerfungen, welche einzelne
Abschnitte der Kohlenflöze und der übrige Schichten
losgetrennt und, relativ zu ihrer Umgebung, in eine
größere Tiefe versetzt haben.
Wo immer alle Glieder der S. entwickelt sind, läßt
sich eine Zweiteilung der Formation nach petrographischen u.
paläontologischen Unterschieden nachweisen, deren unteres
Glied zur Bildung von Facies neigt, für welche es aber an
Übergängen ineinander nicht mangelt. In Amerika, den
meisten Becken Englands, in Frankreich, Belgien, am Niederrhein, in
Schlesien und Rußland wird die unterste Abteilung von einem
gewöhnlich festen und dichten, mitunter (Rußland)
kreideartigen Kalkstein (Bergkalk, Mountain limestone, Kohlenkalk,
metallführender Kalk) gebildet, der reich an organischen
Resten meerischen Ursprungs ist. Untergeordnet kommen mit dem
Bergkalk Dolomit, Anhydrit, Gips, Steinsalz (Westvirginia, Durham,
Bristol) vor. In Devonshire, Irland, Nassau, am Harz, in Schlesien,
Mähren und den Alpen (Gailthaler Schichten) bilden dagegen
Thonschiefer, Sandsteine, Grauwacken und Kieselschiefer ein als
Kulm bezeichnetes Äquivalent des Kohlenkalks. Ärmer an
Versteinerungen als der Kohlenkalk, führt der Kulm immerhin
noch genug Arten (Posidonomya Becheri, Goniatites sphaericus etc.)
gemeinsam mit dem Kalk, um ihn als bloße Facies desselben
aufzufassen. Während die Thonschiefer oft sehr reich an
Posidonomya Becheri sind (Posidonomyenschiefer), stellen sich in
den Grauwacken und Sandsteinen Pflanzenreste ein (die im Kohlenkalk
nur als äußerste Seltenheiten bekannt sind), mitunter
sogar zu kleinen Flözen angehäuft (Calamites
transitionis, Sagenaria, Stigmaria). Man betrachtet diese Facies
als eine Bildung innerhalb flacher Meeresbuchten, während der
Kohlenkalk einen Absatz des hohen Meers darstellen würde. Eine
dritte Facies dieser untersten Abteilung ist endlich die von sehr
groben Konglomeraten mit untergeordneten Sandsteinen und
Schieferthonen, an einigen Punkten Sachsens flözführend,
in mehreren Becken durch auskeilende Wechsellagerung mit Kohlenkalk
verknüpft. Es würde sich diese Art der Entwickelung als
eine Uferbildung deuten lassen. - Über jeder dieser Facies ist
als zweites Glied der S. ein Sandstein mit untergeordneten
Konglomeraten entwickelt, der nur selten und dann gewöhnlich
unbauwürdige Flöze enthält. Dieser flözleere
Sandstein (obere Kulmgrauwacke, Millstone grit) wird häufig
dem Kohlenkalk und Kulm noch beigezählt und mit diesem
zusammen als subkarbonische Formation der obern Abteilung, der
produktiven Kohlenformation (Hauptsteinkohlenformation),
entgegengestellt. Diese besteht an den meisten Orten aus
Sandsteinen und Schieferthonen, aus Steinkohlen, thonigen
Sphärosideriten, bald in einzelnen Konkretionen in den
Schieferthonen eingeschlossen, bald zusammenhängende Lagen
bildend, und Kohleneisenstein (s. Spateisenstein). Die Kohle
ebensowohl als die Eisenerze sind lediglich gelegentliche Begleiter
der übrigen Gesteine und, selbst wo sie vorhanden sind, in so
geringer Mächtigkeit gegenüber den Sandsteinen und
Schieferthonen entwickelt, daß sie trotz ihrer großen
technischen Wichtigkeit nur als untergeordnete Glieder der
produktiven S. bezeichnet werden können. Es ist deshalb die
Benennung "produktiv" für die obere Abteilung keine
glückliche, um so weniger, als neuere Untersuchungen zu
beweisen scheinen, daß die nach dieser Bezeichnung
vorausgesetzte ungefähre Gleichalterigkeit für die
wichtigsten Kohlenvorkommnisse nicht besteht, daß vielmehr
einige englische sowie die von Ostrau und Waldenburg dem Kulm, die
westfälischen, belgischen, nordfranzösischen und viele
englische einer untern Stufe der obern Abteilung zugerechnet werden
müssen, während die Flöze von Pilsen und
Zentralfrankreich eine jüngere Periode derselben Abteilung
repräsentieren. Aber auch diese Abteilung führt an
manchen Orten, z. B. Yorkshire, Kentucky, Öberschlesien und
namentlich in Rußland (Fusulinenkalk), Kalksteine mit reichen
Resten marinen Charakters. Das Hangende der produktiven S. wird in
einigen Gegenden (z. B. im Saargebiet) von einer Schichtenfolge
(Ottweiler Schichten) gebildet, deren innige Verwandtschaft mit
höher gelegenen (Cuseler Schichten, s. Dyasformation) die oben
erwähnte Schwierigkeit der Abgrenzung gegen das Rotliegende
bedingt. Die für die Kohle der S. gegebene geographische
Verbreitung (s. Steinkohle) stellt natürlich nur einen kleinen
Teil derjenigen der S. dar, insofern als namentlich der Bergkalk
über große Horizontalstrecken hin als anstehendes
Gestein dominiert. So nimmt derselbe einen großen Teil des
südlichen und mittlern England ein und bildet im Innern
mitunter groteske Bergpartien, an der Küste von Südwales
steile Klippen. In Schottland und in einigen Gegenden Englands sind
die Facies der Konglomerate und des Kulms die Unterlage der
produktiven S., in Irland fehlt die jüngere Abteilung
gänzlich. In Deutschland tritt Kohlenkalk als unterstes Glied
des Aachener (und belgischen) sowie des westfälischen Beckens
auf, weniger und meist durch Kulm vertreten in Schlesien,
während in Hessen-Nassau nur die untere Abteilung (Kulm), bei
Saarbrücken lediglich die obere Abteilung vorkommt. In
Böhmen fehlt ebenfalls die subkarbonische Formation; dagegen
sind in Mähren, besonders aber in Rußland, auf
Spitzbergen, auf den Bäreninseln und in Nordamerika
Kohlenkalke in großer Verbreitung bekannt.
Die pflanzlichen und tierischen Reste der S. unterliegen einer
ähnlichen Trennung wie das Gesteinsmaterial. Die erstern sind
wesentlich auf die Steinkohlenflöze und die sie begleitenden
Schieferthone beschränkt, die tierischen Reste an den
Kohlenkalk und den Kulm geknüpft. Die Flora der S. war trotz
aller Üppigkeit, wie sie sich in der großartigen
Aufhäufung zu mächtigen Kohlenflözen ausspricht,
eine formenarme: es fehlen die höhern Dikotyledonen
vollständig, und auch Koniferen, Palmen und Cykadeen spielen
eine untergeordnete Rolle. Der Schwerpunkt des pflanzlichen Lebens
lag in den Kryptogamen, von denen einige Geschlechter in
größter Anzahl der Individuen und in später nie
wieder erreichten Dimensionen auftreten. Die Kalamiten (s. Tafel
"Steinkohlenformation II", Fig. 5) haben unter der Flora der
Jetztwelt die Schafthalme (Equiseten) zu nächsten Verwandten,
und in die gleiche Klasse dürften auch die zierlichen Rosetten
der Annularien (Fig. 8 und Sphenophyllen gehören. Zu den
Lykopodiaceen zählen die Siegelbäume (Sigillarien, Fig.
6), die Schuppenbäume (Lepidodendren, Fig. 2) und vielleicht
auch die Cordaites-Arten (Fig. 3), die jedoch von andern mit mehr
Wahrscheinlichkeit den Cykadeen zugezählt werden. Besonders
die erstgenannten Angehörigen einer Familie, welche jetzt fast
ausschließlich niedrige, krautartige Pflanzen ausweist,
mögen als baumartige Formen mit ihren Stämmen, welche
deutliche, im Quincunx gestellte, bald rhombische, bald
sechsseitige Blattnarben tragen, den Wäldern der S.
274
Steinkohlenformation (Tierreste).
den typischen Charakter aufgeprägt haben. Die Stigmarien
(Tafel II, Fig. 7) gehören zu ihnen als die Wurzelstöcke
mit weithin verzweigten Wurzeln, während die Lücken
zwischen den Stämmen durch zahlreiche krautartige Farne (man
kennt über 200 Arten), zum Teil noch jetzt lebenden
engverwandt, ausgefüllt waren (z. B. Odontopteris, Fig. I).
Außer diesen niedrigen farnformen kamen aber auch Baumfarne
vor (z. B. Pecopteris, Fig. 4). Neben den
Gefäßkryptogamen treten die Cykadeen (Noeggerathia,
Pterophyllum) und die Koniferen (aus der Abteilung der Araukarien)
nach Arten- und Individuenzahl weit zurück. Die meisten gut
erkennbaren Pflanzenreste sind den die Kohlenflöze
begleitenden Schieferthonen eingelagert; es unterliegt aber keinem
Zweifel und ist durch viele mikroskopische Untersuchungen
dargethan, daß die Kohlenflöze selbst aus dem Detritus
derselben Pflanzen bestehen, deren einzelne Fragmente in den
benachbarten Thon eingeschlossen wurden. Sigillarien, ihre
Wurzelstöcke, die Stigmarien, und Lepidodendren sind
nachweisbar die Hauptkohlenpflanzen, schon der Masse nach
untergeordnet die Kalamiten (manche Rußkohle) und Araukarien,
noch seltener Farne. Das Gesamtbild der Flora der S. ist das einer
üppigen tropischen Sumpfflora; aber trotzdem ist die in den
Kohlenflözen aufgehäufte Pflanzenmenge eine erstaunliche:
hat doch Chevandier berechnet, daß ein 100jähriger
Buchenwald beim Verkohlen ein Schichtchen von nur 2 cm Kohle
liefern würde. Man hat deshalb geglaubt, lokale
Aufhäufungen der Pflanzenleichen durch Anschwemmungen annehmen
zu müssen. Aber das Vorkommen aufrecht stehender Stämme,
die große Reinheit des kohligen Materials, die
ununterbrochene Verbreitung eines und desselben Kohlenflözes
über mitunter große Horizontalstrecken widersprechen
einer solchen Anschwemmungshypothese und lassen sie höchstens
für kleinere Kohlenschmitzchen oder stockartige, in
horizontaler Richtung unbedeutend entwickelte Vorkommnisse gelten.
Man hat ferner (Mohr) das eigentliche kohlenbildende Material nicht
in den oben beschriebenen Pflanzen, sondern vielmehr in Seetangen
gesucht, welche, wie die heutigen Sargassomeere (deren Ausdehnung
übrigens nach neuern Forschungen auch nicht so bedeutend ist,
als man bislang annahm), in großen Bänken aufgetreten
und nach dem Absterben in geschlossenen Massen auf den Boden
gesunken seien. Aber die mikroskopische Untersuchung der
Steinkohlen widerspricht dieser Auffassung vollständig. So
bleibt nichts übrig, als Sümpfe und Moräste auf
flachen Ufern des Meeresstrandes, den Dschangeln (s. d.)
vergleichbar, anzunehmen, in denen unter tropischer Sonne eine die
unsrige an Üppigkeit weit übertreffende Pflanzenwelt sich
entwickelte. Periodische Einbrüche des Meers vernichteten
vorübergehend dieses Leben und führten Schlamm und Sand,
das jetzt als Schieferthon und Sandstein die einzelnen
Kohlenflöze trennende Material, herbei, welches nach
Rückzug des Meers für eine neue Vegetation den Boden
darbot. Ob sich von diesen pelagischen oder paralischen
Kohlenbecken einige kleinere als limnische abtrennen lassen, die
sich an und in Süßwasserseen gebildet haben würden,
diese Ansicht steht und fällt mit der Deutung gewisser
Molluskenreste (Anthracosia) in der Unterlage der betreffenden
Flöze als Süßwasser- oder Seeformen (vgl.
Süßwasserformationen). - Der Typus der Kohlenpflanzen
weist auf eine mittlere Temperatur von 20-25° hin, und der
Umstand, daß selbst hochnordische Kohlenbecken eine
tropischen Charakter tragende Flora geliefert haben, scheint die
Annahme zu rechtfertigen, es sei diese hohe Mitteltemperatur damals
eine allgemein herrschende gewesen. Auf den Zustand der
Atmosphäre während der S. lassen die großartigen
Kohlenschätze insofern schließen, als die
aufgehäuften Pflanzen zum Aufbau ihrer Körper der
Atmosphäre den in ihr als Kohlensäure enthaltenen
Kohlenstoff entzogen. Vor und während der S. mußte
demnach die Luft viel reicher als heute an Kohlensäure sein.
Man hat auf Grund einer Schätzung der Menge der Kohlen den
damaligen Gehalt auf 0,06 Proz. berechnet, also auf das 150fache
des heutigen. Die Tierreste der S. widersprechen der Annahme einer
kohlensäurereichen Atmosphäre nicht: fehlen doch alle
warmblütigen Tiere, während die Reptilien
erfahrungsmäßig in kohlensäurereicher Luft leben
können. In der obern Abteilung der S. war das tierische Leben
auf ein Minimum beschränkt, ähnlich wie heute in unsern
Urwäldern. Interesse erregen einige Landschnecken, Skorpione
(z. B. Cyclophthalmus Bucklandi, s. Tafel I), Spinnen,
Tausendfüße, Heuschrecken, Schaben und Käfer (s.
die Flügeldecke auf derselben Platte). Die Wassertümpel
waren von kleinen Schalenkrebsen (Leaia, Leperditia, Estheria)
bevölkert, während als höchst organisierte Tiere
Amphibien auftreten. Die meisten derselben gehören
Mittelformen zwischen den Echsen und Batrachiern an, den
großschädeligen Labyrinthodonten. Weit
größern Reichtum an tierischen Resten, unzweifelhaften
Meeresbewohnern, birgt der Bergkalk. Von Protozoen kommt eine
weizenkorngroße Foraminifere, Fusulina cylindrica (s. Tafel
I), namentlich in Rußland und Amerika in zahllosen Exemplaren
vor, bestimmte Lagen des Kalks (Fusulinenkalk) fast
ausschließlich zusammensetzend. Die Korallen (Chaetetes, s.
Tafel I), welche ebenfalls mitunter in gesteinsbildender Fülle
auftreten, gehören denselben Ordnungen wie die des Silurs und
der Devonischen Formation (s. d.) an. Die Krinoideen sind zahlreich
nach Formen und Individuen; zu der Krinoideenabteilung der
Blastoideen gehört das Genus Pentremites (s. Tafel I), welches
zwar schon im Silur und Devon auftritt, in der Steinkohle aber
seine zahlreichsten Vertreter besitzt. Aus der Ordnung der
Seelilien stellt die Tafel die Stielglieder (Entrochiten) von
Rhodocrinus Verus dar, welche sich schichtenweise ebenso
aufgehäuft vorfinden wie die Säulenglieder von Encrinus
im Muschelkalk oder von Pentacrinus im Lias sowie Platycrinus
triacanthodactylus. Seeigel, aus 30-35 Reihen sechsseitiger Platten
zusammengesetzt, sind durch mehrere Genera (darunter Palaeocidaris,
s. Tafel I) vertreten. Unter den Mollusken sind die Ordnungen der
Brachiopoden und Cephalopoden, wenn auch noch artenreich, doch
nicht mehr so vorwaltend wie in den noch ältern Formationen
(Chonetes Dalmanni, Spirifer hystericus, Goniatites Jossae und G.
sphaericus, s. Tafel I). Zu den Pelekypoden zählen die im Kulm
häufige Posidonomya Becheri, die Anthracosia und das nach vorn
abgestutzte, nach hinten schnabelförmig ausgezogene und
klaffende Conocardium fusiforme (s. Tafel I). Die Gastropoden
gehören fast ausnahmslos denselben Genera wie die der
devonischen Formation an. Die Trilobiten klingen in der S. aus und
sind nur noch durch die kleinen und seltenen Arten der Gattung
Phillipsia vertreten; daneben sind, wenn auch selten,
Molukkenkrebse (Limulus) beobachtet worden. Von Fischen der S.
findet man Zähne und Rückenstacheln besonders
häufig. Sie gehören Haien an, wenn auch Abteilungen,
welche in der Jetztwelt teils ganz erloschen, teils nur durch
wenige Formen vertreten sind (Orodus. Tristychius
275
Steinkohlengas - Steinla.
und Cochliodus, s. Tafel I). Die Ganoidengeschlechter
Palaeoniscus und Amblypterus kommen in sehr zahlreichen
vollständigen Exemplaren in Schichten (Lehbach im Saarbecken)
vor, welche jetzt dem Rotliegenden beigezählt werden. - Die
vulkanische Thätigkeit lieferte während der
Steinkohlenperiode Diabase (in Schottland, England, Frankreich, an
einzelnen Punkten Deutschlands), Felsitporphyre (Sachsen,
Niederschlesien, Frankreich), seltener Diorite, Pechsteine und
Melaphyre, während die eigentliche Eruptionszeit der zuletzt
genannten erst in die Dyasperiode fällt. Namentlich die
Diabase sind durch Decken und Tuffe, welche sich zwischen die
karbonischen Gesteine einschalten, besonders häufig als
zweifellos gleichzeitige Bildungen charakterisiert. Es mögen
diese sowie jüngere Eruptivgesteine zum Teil auch die
zahlreichen Schichtenstörungen (s. Verwerfungen), welchen die
Gesteine der S. unterworfen sind, verursacht haben. - An technisch
wichtigen Materialien liefert die S. in erster Linie Kohlen und
Eisenerze, außerdem wichtige Erze besonders auf
gangförmigen Lagerstätten. So gehört ein Teil der
Oberharzer Gänge von silberhaltigem Bleiglanz dem Kulm an;
Englands und Amerikas Kohlenkalk birgt ebenfalls
Bleiglanzgänge. Von den Aachener und belgischen
Zinkerzlagerstätten bilden einige Gänge, andre Nester und
Lager, teils in karbonischen Gesteinen, teils an der Grenze
zwischen diesen und devonischen Schichten, teils innerhalb des
devonischen Systems. Der Bergkalk selbst endlich dient hin und
wieder als Marmor und als Zuschlag beim Hochofenbetrieb, gewisse
Varietäten des flözleeren Sandsteins als Mühlstein
(woher der englische Name: Millstone grit), andre als feuerfestes
Material. Vgl. die bei Art. Steinkohle (S. 272) angeführten
Werke, außerdem: Weiß, Das Steinkohlengebirge an der
Saar (Berl. 1875); Lottner, Das westfälische
Steinkohlengebirge (2. Ausg., Iserl. 1868); Geinitz, Geognostische
Darstellung der S. in Sachsen (Leipz. 1856); Römer, Geologie
von Oberschlesien (Bresl. 1870); Geinitz, Die Versteinerungen der
S. in Sachsen (Leipz. 1855); Andrae, Vorweltliche Pflanzen aus dem
Steinkohlengebirge der preußischen Rheinlande und Westfalens
(Bonn 1865-69); Stur, Beiträge zur Kenntnis der Flora der
Vorwelt (Wien 1875-83).
Steinkohlengas, s. Leuchtgas.
Steinkohlenkreosot, s. Phenol.
Steinkohlenpech, pechartige Masse, welche aus
Steinkohlenteer gewonnen wird. Destilliert man aus letzterm die
flüchtigern Öle ab, so erhält man als Rückstand
Asphalt, etwa 80 Proz. vom Gewicht des Teers; destilliert man etwa
10 Proz. mehr ab, so bildet der Rückstand weiches und bei noch
weiter fortgesetzter Destillation mittelhartes und hartes Pech.
Seit Begründung der Anthracenindustrie destilliert man
allgemein bis zur Bildung von hartem Pech, pumpt dann wieder
schweres Teeröl in die Blase und erhält, je nach der
Menge des letztern, weiches Pech, Asphalt, präparierten Teer
oder künstlichen Stockholmer Teer. Weiches Pech erweicht bei
40° und schmilzt bei 60°, mittelhartes erweicht bei 60°
und schmilzt bei 100°, hartes erweicht bei 100° und
schmilzt bei 150-200°.
Steinkohlenasphalt dient als Surrogat des natürlichen
Asphalts und wird zu diesem Zweck mit Sand, Kies, Asche,
Ziegelmehl, Kalkstein, Kreide etc. gemischt. Sehr verbessert wird
er durch Erhitzen mit Schwefel, und ein derartiges Präparat
bildet, vielleicht noch mit Zusatz von indifferenten erdigen
Bestandteilen, den Häuslerschen Holzzement. Hartes Pech wird
in weiches verwandelt (wiederbelebt), indem man es in Teer, Asphalt
oder Schweröl schmelzt und mit Hilfe einer Schraube ohne Ende
bis zu völliger Homogenität knetet. Das S. dient
besonders zur Brikettfabrikation, eignet sich aber auch
vortrefflich zur Darstellung von Ruß, als Reduktionsmittel
bei chemischen Prozessen und zur Zementstahlfabrikation. Wird das
Pech noch in der Blase mit sehr viel Schweröl verdünnt,
so erhält man den präparierten Teer, der viel billiger
ist als roher Teer, dabei aber für Anstriche, zur
Dachpappenfabrikation, in der Seilerei etc. ungleich wertvoller als
letzterer. Er dringt schneller und tiefer in Holz und Stein ein,
trocknet schneller und ohne Risse (in 12-24 Stunden) und gibt einen
schönen glänzenden Überzug. Als Surrogat des
Holzteers (Stockholmer Teer) führt er den Namen
künstlicher Stockholmer Teer. Einen feinern, noch schneller
(in 4-6 Stunden) trocknenden Firnis für feinere Eisenwaren
erhält man auf gleiche Weise aus Pech und Leichtöl, und
endlich wird dieser noch mit Naphtha oder Petroleumäther u.
dgl. gemischt, in welchem Fall der Lack in einer Stunde, ja in
einer Viertelstunde trocknet. Alle drei Firnisse haften ungemein
fest am Eisen und geben einen ziemlich harten, stark
glänzenden und sehr glatten überzug. Diese
Verwendungsarten des Steinkohlenpechs konsumieren nur sehr wenig
von der großen produzierten Menge, und man treibt deshalb die
Destillation noch weiter, um schließlich nur Koks als
Rückstand zu erhalten, für welche stets Absatz gefunden
werden kann. Bei der Anwendung gußeiserner Retorten und eines
Exhaustors, welcher zur Beförderung der Dampfentwickelung ein
teilweises Vakuum in der Retorte erzeugt, erhält man zwischen
260 und 315° meist Naphthalin, dann bis 370° ein
anthracenreiches Produkt und bei höherer Temperatur minder
flüchtige Körper. Die Destillate geben beim Stehen einen
Absatz, aus welchem Rohanthracen gewonnen wird, und das
übrigbleibende Öl dient zum Schmieren. Der
Ausführung der Pechdestillation im größern Umfang
steht bis jetzt noch die Schwierigkeit entgegen, ein passendes
Retortenmaterial zu finden. Vgl. Lunge, Die Industrie der
Steinkohlenteer-Destillation etc. (2. Aufl., Braunschw. 1888).
Steinkohlensystem, s. v. w. Steinkohlenformation.
Steinkohlenteerkampfer, s. v. w. Naphthalin.
Steinkolik, s. Harnsteine, S. 175.
Steinkonkretionen, s. Steinigwerden.
Steinkrankheit, die durch Harnsteine (s. d.)
hervorgerufenen Beschwerden.
Steinkraut, s. Alyssum.
Steinkreise, s. Steinsetzungen.
Steinkresse, s. Chrysospienium.
Steinkultus, s. Steindienst.
Steinla, Moritz, eigentlich Müller, Kupferstecher,
geb. 1791 zu Steinla bei Hildesheim, bildete sich an der Akademie
in Dresden, dann in Florenz unter Morghens und in Mailand unter
Longhis Leitung. In Florenz vollendete er 1829 einen
ausgezeichneten Stich nach Tizians Zinsgroschen. Nach seiner
Rückkehr aus Italien ließ er sich in Dresden nieder, wo
er später Professor der Kupferstecherkunst an der Akademie
wurde und 1830 die Pietà nach Fra Bartolommeo, 1836 den
Kindermord nach Raffael, 1838 die Madonna della Misericordia nach
Fra Bartolommeo, 1841 die Madonna des Bürgermeisters Meyer
nach Holbein stach, welche ihm von der Pariser Akademie die
große goldene Preismedaille erwarb. Seine letzten Hauptwerke
waren die Stiche nach der Sixtinischen Madonna (1848) und der
Madonna mit dem Fisch von Raffael. Er starb 21. Sept. 1858.
276
Steinle - Steinmine.
Steinle, Eduard Jakob von, Maler, geb. 2. Juli 1810 zu
Wien, war Schüler der Akademie daselbst und von Kupelwieser
und ging 1828 nach Rom, wo er sich eng an Overbeck und Ph. Veit
anschloß und bis 1834 blieb. In die Heimat
zurückgekehrt, lebte er mit einigen Unterbrechungen, unter
andern veranlaßt durch einen Aufenthalt in München zur
Erlernung der Freskotechnik bei Cornelius, in Frankfurt a. M. und
wurde dort 1850 erster Professor am Städelschen Institut. 1838
führte er in der Kapelle des Bethmann-Hollwegschen Schlosses
Rheineck seine ersten Fresken aus. Dann begann er im Domchor zu
Köln Freskogemälde, die Engelchöre auf Goldgrund
darstellend, Schöpfungen von großartiger Wirkung. 1844
malte er für den Kaisersaal zu Frankfurt das Urteil Salomos.
1857 begann die Ausmalung der Ägidienkirche in Münster.
Von 1860 bis 1863 beschäftigten ihn die vier großen, die
Kulturentwickelung der Rheinlande schildernden Fresken im
Treppenhaus des Museums Wallraf-Richartz in Köln. Dann malte
er von 1865 bis 1866 die sieben Chornischen der Marienkirche in
Aachen aus. Nach Beendigung der Ausschmückung der
fürstlich Löwenstein-Wertheimschen Kapelle zu Heubach mit
Fresken und Ornamenten wurde ihm 1875 die Ausmalung des Chors im
Münster zu Straßburg übertragen, und 1880 erhielt
er vom Frankfurter Dombauverein den Auftrag, das Innere des Doms
vollständig auszumalen, wozu er einen umfangreichen Entwurf im
Verein mit dem Architekten Linnemann aufstellte. S. hat auch eine
große Anzahl von meist religiösen Staffeleibildern
geschaffen, aber auch Porträte und romantisch gehaltene
Genrebilder von feiner Färbung (der Türmer und der
Violinspieler in der Galerie Schack zu München); ferner eine
Menge von Zeichnungen und Aquarellen, teils religiösen
Inhalts, teils nach Shakespeareschen und andern Dichtungen. Diese
Aquarelle haben meist einen romantischen Zug, den er schon
frühzeitig durch den Verkehr mit Klemens Brentano angenommen
hatte, dessen Dichtungen ihm ebenfalls mehrere Motive geboten
haben. Seine Hauptwerke dieser Gattung sind: Rheinmärchen und
die mehreren Wehmüller nach Brentano, die Beichte in St. Peter
zu Rom, Szene aus "Was ihr wollt" von Shakespeare (in der Berliner
Nationalgalerie), Schneeweißchen und Rosenrot und der
Parzival-Cyklus, sämtlich Aquarelle. S. starb 19. Sept. 1886.
Vgl. v. Wurzbach, Ein Madonnenmaler unsrer Zeit (Wien 1879);
Valentin, Ed. Jak. v. S. (Leipz. 1887).
Steinlerche, s. Pieper und Flüevogel.
Steinlorbeer, s. Viburnum.
Steinmannit, s. Bleiglanz.
Steinmark, Sammelname für eine Reihe derber,
dichter, weißer, gelblicher oder rötlicher,
undurchsichtiger, matter, fettig anzufühlender,
thonerdehaltiger Silikate, die als Zersetzungsprodukte feldspatiger
Mineralien in ihrer Zusammensetzung schwanken und sich zum Teil vom
Kaolin, zum Teil vom Nakrit nicht trennen lassen. Als typisches S.
wird das aus dem Porphyr von Rochlitz in Sachsen aufgeführt
und in Carnat und Myelin getrennt. Beide scheinen sich vom Kaolin
nur in Bezug auf den Gehalt an Wasser zu unterscheiden,
während die Varietäten aus dem Melaphyr von Kainsdorf bei
Zwickau und diejenige, welche den Topas am Schneckenstein in
Sachsen begleitet, dem Nakrit zuzuzählen sind.
Steinmasse, s. Steine, künstliche.
Steinmerle, s. Steindrossel.
Steinmetz, Karl Friedrich von, preuß.
Generalfeldmarschall, geb. 27. Dez. 1796 zu Eisenach, ward im
Kadettenhaus erzogen, trat 1813 als Leutnant in das 1. Regiment,
mit dem er fast alle Gefechte und Schlachten des Yorkschen Korps
1813-14 mitmachte, ward mehrere Male verwundet und erwarb sich das
Eiserne Kreuz. 1818 wurde er in das 2. Garderegiment versetzt, 1820
zur Kriegsschule, 1824 zum topographischen Büreau kommandiert,
1829 Hauptmann, erhielt 1839 als Major das Düsseldorfer
Gardelandwehrbataillon und 1841 ein Bataillon Gardereserve in
Spandau. Während des Barrikadenkampfs in Berlin 18. März
1848 befehligte er das 2. Infanterieregiment, mit welchem er auch
nach Schleswig ging. Im Oktober ward er Kommandeur des 32.
Infanterieregiments, 1849 Oberstleutnant, 1851 Oberst und
Kommandeur des Kadettenkorps, 1854 Kommandant von Magdeburg und
Generalmajor, 1857 Kommandeur der 3. Gardeinfanteriebrigade, im
Oktober der 1. Division in Königsberg, 1858 Generalleutnant,
1862 kommandierender General des 2., 1864 des 5. Korps und General
der Infanterie. An der Spitze des 5. Korps, das zur zweiten Armee
gehörte, siegte er 27. Juni 1866 bei Nachod, am 28. bei
Skalitz und am 29. bei Schweinschädel nacheinander über
drei österreichische Korps und nahm denselben 2 Fahnen, 2
Standarten, 11 Geschütze und gegen 6000 Gefangene ab. Für
diese großartigen Leistungen, welche wesentlich zu der
Durchführung des ganzen Operationsplans beitrugen, erhielt S.
den Schwarzen Adlerorden sowie eine Dotation und ward auch 1867 in
den norddeutschen Reichstag gewählt. 1870 erhielt er das
Oberkommando der ersten Armee, welche den rechten Flügel des
deutschen Aufmarsches bildete. In dieser Stellung entsprach er
jedoch den Erwartungen nicht. Sein durch seine großen Erfolge
von 1866 gesteigerter Eigensinn wirkte höchst nachteilig und
störend ein. Mit der zweiten Armee hatte er fortwährend
Streitigkeiten über Quartiere und Marschrouten, mit Moltke
über die Operationen seiner Armee. In der Schlacht bei
Gravelotte griff er bei St.-Hubert mit einem Kavallerieangriff so
zur Unzeit ein, daß die Schlacht nahe daran war, verloren zu
werden. Infolge hiervon wurde S. nach der Schlacht bei Gravelotte
dem Prinzen Friedrich Karl unterstellt und, da er sich diesem nicht
fügte, zum Generalgouverneur der Provinzen Posen und Schlesien
ernannt, aber 8. April 1871 zum charakterisierten
Generalfeldmarschall ernannt und zu den Offizieren von der Armee
versetzt. S. lebte darauf zu Görlitz und starb 4. Aug. 1877 im
Bad Landeck. S. war ein rauher und herber Vorgesetzter, aber ein
diensteifriger Offizier von spartanischer Strenge gegen sich selbst
und ein tüchtiger Korpskommandeur.
Steinmeyer, Franz Ludwig, protest. Theolog, geb. 15. Nov.
1812 zu Beeskow in der Mittelmark, war Prediger zu Kulm und Berlin,
dann ordentlicher Professor der Theologie 1852 in Berlin, 1854 in
Bonn, 1858 in Berlin. Von ihm erschienen: "Beiträge zum
Schriftverständnis in Predigten" (2. Aufl., Berl. 1859-66, 4
Bde.); "Apologetische Beiträge" (das. 1866-73, 4 Bde.);
"Beiträge zur praktischen Theologie" (das. 1874-79, 5 Bde.);
"Beiträge zur Christologie" (das. 1880-82, 3 Bde.);
"Geschichte der Passion des Herrn" (2. Aufl., das. 1882); "Die
Wunderthaten des Herrn" (das. 1884); "Die Parabeln des Herrn" (das.
1884); "Die Rede des Herrn auf dem Berge" (das. 1885); "Das
hohepriesterliche Gebet" (das. 1886); "Beiträge zum
Verständnis des Johanneischen Evangeliums" (das. 1886-89, 4
Bde.).
Steinmine (Erdwurf, Erdmörser), unter 45° in die
Erde gegrabene und an den Seitenwänden
277
Steinmispel - Steinschnitt.
mit Brettern bekleidete Gruben, die, mit Pulver und Steinen
gefüllt, demnächst mit Erde verdämmt, durch
Zündschnur entzündet, zur Sperrung von Engwegen oder in
den letzten Stadien des Festungskriegs angewandt worden sind. Bei
den Savartinen sind Cylinder aus Eisenblech in die Gruben
gesetzt.
Steinmispel, s. Cotoneaster.
Steinnuß, s. Elfenbein (Surrogat).
Steinobstgehölze, s. Amygdaleen.
Steinöl, s. Erdöl.
Steinoperationen, s. Steinschnitt.
Steinpappe, s. v. w. Dachpappe; auch eine Masse aus
aufgeweichtem und zerkleinertem Papier, angemacht mit Leimwasser
und versetzt mit Thon und Kreide (auch Leinöl), dient zu
Reliefornamenten.
Steinpfeffer, s. Sedum.
Steinpicker, s. Steinschmätzer.
Steinpilz, s. Boletus.
Steinpitzger, s. Schmerle.
Steinpleis, Dorf in der sächs. Kreis- und
Amtshauptmannschaft Zwickau, an der Pleiße, hat eine evang.
Kirche, Vigognespinnerei, Kunstwollfabrikation, Färberei, eine
Dampfmahlmühle und (1885) 2769 Einwohner.
Steinringe, s. Steinsetzungen.
Steinröschen, s. Daphne.
Steinrötel, s. Steindrossel.
Steinsalz, s. Salz, S. 236.
Steinsame, s. Lithospermum.
Steinsänger, s. v. w. Steinschmätzer.
Steinschmätzer (Saxicola Bechst.), Gattung aus der
Ordnung der Sperlingsvögel, der Familie der Drosseln
(Turdidae) und der Unterfamilie der S. (Saxicolinae), schlanke
Vögel mit pfriemenförmigem Schnabel, welcher an der
Wurzel breiter als hoch, auf der Firste kantig und an der Spitze
etwas abgebogen ist, etwas stumpfen Flügeln, in welchen die
dritte und vierte Schwinge am längsten sind, ziemlich kurzem
und breitem, gerade abgeschnittenem Schwanz und hohen und
dünnen Füßen mit mittellangen Zehen. Der S.
(Steinsänger, Steinpicker, Steinbeißer, S. oenanthe
Bechst.), 16 cm lang, 29 cm breit, oberseits hellgrau, an der Brust
rostgelblich, auf dem Bürzel, an der Unterseite und an der
Stirn weiß, mit weißem Augenstreifen, um die Augen, an
den Flügeln und den beiden mittlern Schwanzfedern schwarz; die
übrigen Schwanzfedern sind am Grund weiß, an der Spitze
schwarz; das Auge ist braun, Schnabel und Fuß schwarz. Er
bewohnt Mittel- und Nordeuropa, die asiatischen Länder
gleicher Breite und den hohen Norden Amerikas. Bei uns weilt er vom
März bis September. Er findet sich in steinreichen Gegenden
und geht in der Schweiz bis über den Gürtel des
Holzwuchses empor. Sehr gewandt, munter, ungesellig, vorsichtig,
lebt er einsam, läuft ungemein schnell, fliegt ausgezeichnet,
aber nicht hoch und macht, auf einem Felsen sitzend, wiederholt
Bücklinge. Sein Gesang ist unbedeutend. Er nährt sich von
Insekten, nistet in Felsritzen und Baumlöchern und legt im Mai
5-7 bläuliche oder grünlichweiße Eier (s. Tafel
"Eier I"), welche das Weibchen allein ausbrütet. In der
Gefangenschaft geht er durch seine Wildheit bald zu Grunde.
Steinschneidekunst (Glyptik, Lithoglyptik), die Kunst,
Gegenstände aus Edel- und Halbedelsteinen reliefartig erhaben
(Kameen, s. d.) oder vertieft (Gemmen, Intaglien) in dieselben
eingegraben darzustellen, sowie überhaupt die Kunst,
Edelsteine und Halbedelsteine zu bearbeiten, d. h. ihnen durch
Schleifen die verlangte Gestalt zu geben und sie zu polieren.
Ersteres geschieht auf der Schleifmaschine und vermittelst der
Steinzeiger, letzteres auf bleiernen und hölzernen Scheiben,
erst mit Schmirgel und Bimsstein, dann mit Tripel und Wasser.
Über die Geschichte der S. s. Gemmen nebst Tafel.
Steinschneider, Moritz, jüd. Gelehrter, geb. 30.
März 1816 zu Proßnitz in Mähren, studierte
Philologie und Pädagogik an der Universität Prag, darauf
Orientalia in Wien und wandte sich hier der jüdischen
Theologie und Litteratur zu. Nachdem er seine Studien seit 1839
noch in Leipzig, später in Berlin und 1842 in Prag
fortgesetzt, wurde er hier Lehrer an einer höhern
Töchterschule und ging 1845 nach Berlin, wo er seit 1859 an
der Veitel-Heine-Ephraimschen Lehranstalt Vorlesungen hält und
seit 1869 auch als Direktor der Töchterschule der Berliner
jüdischen Gemeinde thätig ist. Unter seinen
wissenschaftlichen Arbeiten stehen obenan seine an
Forschungsergebnissen reichen Kataloge, von denen wir den
"Catalogus librorum hebraeorum in bibliotheca Bodlejana" (Berl.
1852-60), den dazu gehörigen "Conspectus codicum manuscr.
hebraic. in bibl. Bodl." (das. 1857), "Die hebräischen
Handschriften der königlichen Hof- und Staatsbibliothek in
München" (Münch. 1875), den "Katalog der hebräischen
Handschriften in der Stadtbibliothek zu Hamburg" (Hamb. 1878) und
den "Katalog der hebräischen Handschriften der
königlichen Bibliothek zu Berlin" (Berl. 1878) hervorheben.
Steinschneiders Artikel "Jüdische Litteratur" in Ersch und
Grubers "Encyklopädie" (2. Sekt., 27. Bd.; englisch, Lond.
1857) ist die erste vollständige Darstellung des Gegenstandes
in größerm Umfang. Seine sonstigen Arbeiten sind meist
in der von ihm herausgegebenen "Hebräischen Bibliographie"
(Berl. 1859-64, 1869-81) veröffentlicht. Auf dem Gebiet der
arabischen Litteratur beleuchten seine Abhandlungen
hauptsächlich Philosophie ("Alfarabi", 1869), Medizin
("Donnolo. Pharmakologische Fragmente aus dem 10. Jahrhundert",
Berl. 1868; toxikologische Schriften u. a. in Virchows "Archiv"
1871, 1873) und Mathematik ("Baldi, Vite di matematici arabi", Rom
1874; "Abraham ibn Esra", Leipz. 1880, u. a. in Zeitschriften).
Steinschnitt, ein Teil der Stereometrie, s.
Stereotomie.
Steinschnitt (Blasensteinschnitt, Lithotomie), die
kunstmäßige Eröffnung der Harnblase oder ihres
Halses an irgend einer Stelle und in einem solchen Umfang,
daß ein darin befindlicher Harnstein (s. Harnsteine) entfernt
werden kann. Es gibt fünf verschiedene Methoden des
Steinschnitts beim Mann. Der S. mit der kleinen Gerätschaft,
von Celsus zuerst beschrieben, besteht darin, daß man am Damm
und am Blasenhals einen Einschnitt nach dem Stein zu macht und
denselben mit dem Steinlöffel heraushebt. Beim S. mit der
großen Gerätschaft, von Joh. de Romanis im 16. Jahrh.
erfunden, wird zuerst eine gefurchte Leitungssonde in die Blase
gebracht, an dem Damm die Harnröhre in ihrem schwammigen Teil
durch einen Einschnitt geöffnet und der Blasenhals mittels
besonderer Instrumente in dem Grad erweitert, daß der Stein
herausgenommen werden kann. Diese Methode hat zwar unbestreitbar
Vorzüge vor der erstern, doch sind dabei ebenfalls
Zerreißung und Quetschung leicht möglich und
außerdem die Ausziehung des Steins mit bedeutenden
Beschwerden für den Kranken verbunden. Der hohe Apparat oder
Bauchblasenschnitt, von Franco 1561 erfunden, besteht in der
Eröffnung der Blase zwischen dem obern Rande der
278
Steinschönau - Steinthal.
Schambeine und der Falte des die Blase überziehenden
Bauchfells. Üble Umstände während dieser Operation
und nach derselben sind besonders: Verletzung und heftige
Entzündung des Bauchfells, Infiltration des Harns in das
Zellgewebe, Abscesse, Brand. Ausgeführt wird derselbe
besonders bei Knaben und bei sehr großen Steinen, die sich
auf den andern Wegen nicht herausbefördern lassen. Der
Seitensteinschnitt, ebenfalls von Franco erfunden und
gegenwärtig am meisten üblich, charakterisiert sich im
allgemeinen dadurch, daß im Damm ein Einschnitt gemacht wird,
welcher sich von der linken Seite der Naht des Hodensackes gegen
das Sitzbein herzieht, darauf der häutige Teil der
Harnröhre geöffnet und der Blasenhals, die Prostata und
selbst ein Teil des Blasenkörpers eingeschnitten werden. Die
Methode des Steinschnitts durch den Mastdarm, von L. Hoffmann
vorgeschlagen, besteht darin, daß ein Bistouri durch den
Mastdarm eingeführt, die vordere Wand des Mastdarms und der
äußere Sphinkter des Afters sowie dann auf der
eingeführten Steinsonde der Blasenhals und die Prostata
eingeschnitten und der Stein durch die Zange entfernt wird.
Geringere Lebensgefahr, nicht gefährliche Blutung,
Möglichkeit der Entfernung großer Steine gelten als
Vorzüge, das Zurückbleiben einer Kot- und Urinfistel und
Impotenz als Nachteile dieser Methode. Der S. kommt bei Weibern
ungemein viel seltener vor als bei Männern; einmal, weil
Steine bei jenen überhaupt viel seltener sind, anderseits,
weil nicht zu große Steine bei ihnen durch die kurze, gerade
und sehr dehnbare Harnröhre leicht abgehen oder doch
ausgezogen oder zerstückelt (s. unten) werden können.
Beim Weib wird der Schnitt entweder unterhalb des Schoßbogens
mit Einschneidung der Harnröhre und des Blasenhalses oder
unterhalb der Schoßfuge ohne Verletzung der Harnröhre
geführt, oder es wird die Harnblase von der Scheide aus oder
endlich oberhalb des Schoßbodens, wie beim Mann,
geöffnet. - Denselben Zweck wie mit dem S. sucht man mit der
Steinzermalmung (Steinzertrümmerung, Lithotritie,
Lithotripsie) zu erreichen. Hierbei werden mittels in die Harnblase
eingebrachter Werkzeuge die Steine zerstückelt, so daß
sie mit dem Urin abgehen. Dieses Verfahren, schon früher
vorgeschlagen, wurde von Gruithuisen (1813), Amussat (1821),
Civiale (1824), Heurteloup (1832) und Charrière durch
Erfindung passender Instrumente in Aufnahme gebracht. Hauptmethoden
sind: die jetzt obsolete Perforation oder Anbohrung des Steins
mittels eines in die Harnröhre einzuführenden, aus drei
ineinander passenden Teilen bestehenden Instruments (Lithotritor),
die lithoklastische Methode (Lithotripsie), welche bloß
zerdrückend und zermalmend wirkt und bei nicht sehr harten
Steinen angewendet wird, und die Perkussion, die durch Stoß
und Schlag wirkt, indem man mit einem zweiarmigen Instrument,
welches geschlossen in die Harnröhre eingeführt, durch
Zurückziehen des einen Arms geöffnet und dann wieder
vermittelst eines Hammers geschlossen wird, den Stein faßt
und zu zerdrücken sucht. Die Lithotritie ist zwar nicht so
verletzend wie der S., befreit aber den Kranken meist erst nach
mehreren Operationsversuchen von seinem Übel. Sie ist daher zu
beschränken auf weichere und namentlich kleinere Blasensteine
bei jüngern Individuen mit sonst gesunden Harnorganen,
während große und harte Steine bei ältern Personen
und sonstigen, die an Blasenkatarrh, Nierenreizung etc. leiden, dem
S. anheimfallen.
Steinschönau, Marktflecken in der böhm.
Bezirkshauptmannschaft Tetschen, an der Flügelbahn
Böhmisch-Kamnitz-S. der Böhmischen Nordbahn, ein
Hauptsitz der böhmischen Glasindustrie, mit Fachschule,
zahlreichen Glasraffinerien, bedeutendem Export, Möbelfabrik
und (1880) 4410 Einw.
Steinsetzungen, aus einzelnen oder mehreren Steinen
bestehende Denkmäler, die in vorgeschichtlicher, zum Teil auch
noch in geschichtlicher Zeit zur Erinnerung an gewisse Ereignisse
oder zum Gedächtnis der Toten errichtet wurden. Man
unterscheidet Menhirs (maen, men, keltisch = Stein, hir = lang) und
Cromlechs (crom, keltisch = gekrümmt, lech = Stein) oder
Steinkreise, Steinringe. Die Menhirs sind einzelne, senkrecht
gestellte, meist sehr große (bis 19 m), nicht oder grob
behauene Monolithen. Bisweilen finden sich mehrere Menhirs auf
beschränktem Raum und in geordneter Stellung, wie auf dem
Heerberg bei Beckum in Westfalen und bei Carnac in der Bretagne, wo
sich eine Gruppe aus unbehauenen Steinen, von denen der
größte 7,5 m hoch ist, in elf Reihen etwa 3 km weit
hinzieht. Die Menhirs bezeichnen oft die Stelle eines Grabes oder
einer gemeinsamen Begräbnisstätte der Vorzeit; sie werden
in der Ilias und in der Bibel erwähnt, manche aber
gehören der historischen Zeit an, wie das Denkmal an die
Schlacht bei Largs in Schottland dem 13. Jahrh. Häufig bilden
Reihen von Menhirs die Seitenwände von Gängen, welche zur
Grabkammer der Dolmen oder in das Innere prähistorischer
Grabhügel führen. Über die Steinkreise s. Cromlech.
Auf den Menhirs wie auf den Felsblöcken der Cromlechs finden
sich hier und da Inschriften (Striche, Kreise, Spiralen etc.), von
denen aber nur sehr wenige entziffert werden konnten; auch ist
zweifelhaft, ob diese Inschriften mit den S. gleichaltrig sind oder
einer spätern Zeit angehören. Ausgrabungen in
unmittelbarer Nähe der S. haben Stein-, Bronze-, Eisen-,
Knochen- und Horngeräte, Thonscherben, Münzen aus
frühgeschichtlicher Zeit zu Tage gefördert. Mit den
Menhirs und Cromlechs werden die Dolmen (s. d.) als megalithische
Denkmäler zusammengefaßt. S. Tafel "Kultur der
Steinzeit".
Steintanz, s. Gräber, prähistorische.
Steinthal, Landstrich im Unterelsaß, Kreis
Molsheim, in den Vogesen zu beiden Seiten der Breusch, mit den
Orten Rothau, Waldersbach und Fouday, ehedem eine unfruchtbare,
öde und arme Gegend, jetzt durch die Bemühungen des
Pfarrers Oberlin (s. d.) in einen gewerbthätigen und
wohlhabenden Distrikt umgewandelt.
Steinthal, Heymann, Sprachphilosoph und Linguist, geb.
16. Mai 1823 zu Gröbzig im Anhaltischen, studierte in Berlin
seit 1843 Philologie und Philosophie und habilitierte sich 1850 an
der dortigen Universität, wo er über allgemeine
Sprachwissenschaft und Mythologie Vorträge hielt. 1852-55
verweilte er zum Behuf chinesischer Sprach- und Litteraturstudien
in Paris; seit 1863 ist er außerordentlicher Professor der
allgemeinen Sprachwissenschaft zu Berlin, wo er seit 1872 auch an
der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums
Religionsphilosophie und Religionsgeschichte lehrt. Von Steinthals
sprachwissenschaftlichen Werken, die sich im allgemeinen an die von
W. v. Humboldt begründete philosophische Behandlung der
Sprache anschließen, sind als die bedeutendsten zu nennen:
"Der Ursprung der Sprache im Zusammenhang mit den letzten Fragen
alles Wissens" (Berl. 1851, 4. erweiterte Aufl. 1888); die
"Klassifikation der Sprachen, dargestellt als die Entwicke-
279
Steintisch - Steinverband.
lung der Sprachidee" (das. 1850), welches Werk später
neubearbeitet unter dem Titel: "Charakteristik der
hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues" (das. 1860) erschien
und sehr anregend gewirkt hat; ferner "Die Entwickelung der
Schrift" (das. 1852); "Grammatik, Logik, Psychologie, ihre
Prinzipien und ihre Verhältnisse zu einander" (das. 1855);
"Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und
Römern" (das. 1863); "Die Mande-Negersprachen, psychologisch
und phonetisch betrachtet" (das. 1867); "Abriß der
Sprachwissenschaft" (Bd. 1: "Einleitung in die Psychologie und
Sprachwissenschaft", 2. Aufl. 1881). Von kleinern Arbeiten sind zu
nennen: "Die Sprachwissenschaft W. v. Humboldts und die Hegelsche
Philosophie" (Berl. 1848); "Philologie, Geschichte und Psychologie
in ihren gegenseitigen Beziehungen" (das. 1864);
"Gedächtnisrede auf W. v. Humboldt" (das. 1867) u. a. Von
einer Sammlung seiner "Kleinen Schriften" erschien der 1. Band
(Berl. 1880). Mit Lazarus gibt S. die "Zeitschrift für
Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft" (Berl. 1860 ff.)
heraus, die von ihm namentlich kritische Aufsätze
enthält. Auch besorgte er eine Ausgabe der
"Sprachwissenschaftlichen Werke W. von Humboldts, mit Benutzung
seines handschriftlichen Nachlasses" (Berl. 1884). Seine neueste
Veröffentlichung ist "Allgemeine Ethik" (Berl. 1885).
Steintisch, s. Dolmen.
Steinverband, diejenige Anordnung der Mauersteine, durch
welche auch ohne Bindemittel ein möglichst fester Zusammenhang
unter denselben hergestellt wird. Als Hauptregeln gelten: a) die
Lagerfugen der Mauersteine müssen möglichst horizontale
Ebenen bilden; b) die Stoßfugen der Mauersteine dürfen
in unmittelbar aufeinander folgenden Schichten nicht aufeinander
treffen. Je nach der Gattung der Mauersteine unterscheidet man den
Verband mit künstlichen Steinen (Backsteinen, Mauerziegeln),
mit regelmäßig bearbeiteten natürlichen Steinen
(Quadern, Hausteinen, Werksteinen), mit roh bearbeiteten
natürlichen Steinen (Bruchsteinen) und den gemischten
Verband.
I. S. künstlicher Steine. Die deutschen Normalziegel sind
25 cm lang, 12 cm breit und 6,5 cm dick, wobei zwei Steinbreiten,
vermehrt um eine Stoßfuge von 1 cm, einer Steinlänge
gleich sind (2 x 12 + 1 = 25 cm). Man vermauert ganze Steine, halbe
Steine von der halben Länge ganzer Steine, Dreiviertelsteine
(Dreiquartierstücke) von ¾ der Länge ganzer Steine
und Riem- oder Kopfstücke von der halben Breite und der vollen
Länge ganzer Steine. Steine, welche der Länge nach
parallel und normal zur Mauerflucht liegen, heißen bez.
Läufer und Binder (Strecker) und die aus solchen Steinen
hergestellten Mauerschichten bez. Läuferschichten und
Binderschichten (Streckerschichten). Man unterscheidet folgende
Hauptsteinverbände: 1) Den Schornsteinverband (Fig. 1), so
genannt, weil er für die meist ½ Stein starken Wangen
der Schornsteine verwendet wird, entsteht durch die
regelmäßige Versetzung der Stoßfugen von
Läufern um je ½ Stein und liefert also an den beiden
Enden eine regelmäßige Abtreppung (Fig. 1, rechts) und
eine regelmäßige Verzahnung (Fig. 1, links). 2) Der
Blockverband (Fig. 2-4) entsteht durch regelmäßige
Abwechselung von Binder- und Läuferschichten, wenn deren
Stoßfugen in der Mauerflucht um je ¼ Stein versetzt
werden. In der Ansicht bilden sich hierdurch die durch
Schraffierung (in Fig. 2) hervorgehobenen, zusammenhängenden
Kreuze. Fig. 2 zeigt eine 1 Stein starke Mauer, deren Abtreppung
rechts durch je zwei Stufen von ¾ und ¼ Stein, und
deren Verzahnung links durch Vor- oder Rücksprünge von je
¼ Stein gebildet wird. Aus Fig. 3 u. 4 ergeben sich die
Blockverbände für 1½ Stein u. 2 Steine starke
Mauern mit ihren natürlichen Abtreppungen rechts und
Verzahnungen links. 3) Der Kreuzverband (Fig. 5) entsteht aus dem
Blockverband, wenn die Stoßfugen der 3., 7., 11. etc.
Läuferschicht in der Mauerflucht um ½ Stein verschoben
werden. In der Ansicht bilden sich hierdurch die durch
Schraffierung hervorgehobenen unzusammenhängenden Kreuze,
während die Abtreppung rechts durch Stufen von je ¼
Stein und deren Verzahnung links durch Vor- oder
Rücksprünge von je 2¼ Stein gebildet wird. 4) Der
polnische oder gotische Verband (Fig. 6 u. 7) entsteht, wenn in
einer und derselben Schicht Läufer und Binder abwechseln,
wobei sich in der Ansicht das in Fig. 6 durch Schraffierung
hervorgehobene Muster ergibt. Dieser Verband verstößt
gegen die unter b) gegebene Hauptreael, indem stellenweise Fuge auf
Fuge trifft. Fig. 6 zeigt eine 1 Stein, Fig. 7 eine 1½ Stein
starke Mauer, wobei diejenigen Fugen, welche aufeinander treffen,
markiert sind, mit ihren Abtreppungen rechts und Verzahnungen
links. 5) Der holländische Verband (Fig. 8) vermeidet zwar den
eben angegebenen Fehler des polnischen Verbandes, findet aber
trotzdem nur beschränkte Verwendung. In der Ansicht bildet
Fig. 1. Schronsteinverband.
Fig. 2. Blockverband.
Fig. 3. und 4. Blockverband für 1½ und 2 Steine
starke Mauern.
Fig. 5. Kreuzverband.
Fig. 6. Polnischer Verband (1 Stein).
Fig. 7. Polnischer Verband (1½ Stein).
Fig. 9. Haustein-Eckverband.
Fig. 8. Holländischer Verband.
Fig. 10. Haustein-Eckverband.
280
Steinwald - Steinzeit.
sich das in der Figur durch Schraffierung hervorgehobene Muster,
welche zugleich die Abtreppung links und die Verzahnung links
darstellt. Verbände für Pfeiler und Säulen aus
künstlichen Steinen sowie für Ecken und Kreuzungen von
Mauern sind mit deren Stärke sehr verschieden und in den unten
bezeichneten Werken mehr oder minder ausführlich
dargestellt.
II. S. regelmäßig bearbeiteter natürlicher
Steine. Bei schwächern Mauern wird dieser Verband dem in Fig.
1 dargestellten Schornsteinverband nachgebildet. Bei stärkern
Mauern weicht man von dem Ziegelverband ab und zieht vor, nur
Läufer von verschiedener Breite zu verwenden (Fig. 9 u. 10).
Bei Mauerecken läßt man die in beiden Figuren durch
Schraffierung hervorgehobenen sogen. Flügelsteine in beide
Mauern eingreifen, um hierdurch den beiden Schenkeln der Ecke mehr
Zusammenhang zu geben.
III. S. roh bearbeiteter natürlicher Steine. Da die Steine
hierbei verwendet werden, wie sie aus dem Bruch kommen, und nur mit
dem Mauerhammer etwas zugerichtet werden, so kann von einem
regelmäßigen S. nicht mehr die Rede sein. Immerhin sucht
man den Hauptregeln desselben möglichst zu entsprechen und
möglichst ebene und horizontale Lagerfugen wenigstens in
gewissen, nicht zu hohen Schichten herzustellen, wobei man die
Unebenheiten durch passende Steinstücke ausfüllt, um das
Aufeinandertreffen der Stoßfugen möglichst zu
vermeiden.
IV. Gemischter S. Derselbe entsteht, wenn Bruchsteinmauern in
den Außenflächen mit Quadern oder auch Backsteinen oder
Ziegelmauern mit Quadern verkleidet (verblendet) werden, weshalb
dieses Mauerwerk auch Blendmauerwerk heißt. Gewöhnlich
wechseln hierbei Läufer und Binder der regelmäßigen
Steine in einer und derselben Schicht miteinander ab, während
deren Zwischenräume durch Bruchsteine ausgefüllt
werden.
Steinwald, s. Fichtelgebirge, S. 239.
Steinwärder, Vorort von Hamburg, auf einer Elbinsel
im Freihafengebiet, hat große Schiffswerften,
Maschinenfabrikation, Kesselschmiederei und (1885) 4039
Einwohner.
Steinweg, Heinrich, Pianofortebauer, geb. 15. Febr. 1797
zu Seesen, begann in Braunschweig mit dem Bau von Guitarren und
Zithern und ging dann zum Bau von Tafelklavieren, Pianinos und
Flügeln über. Erlernt hatte er nur die Tischlerei und den
Orgelbau zu Goslar. 1850 übergab er das Braunschweiger
Geschäft seinem Sohn Theodor und ging mit vier andern
Söhnen nach New York, wo sie zunächst in mehreren
Klavierfabriken arbeiteten, 1853 aber sich selbständig unter
der Firma Steinway and Sons etablierten. Das Geschäft nahm
schnell einen enormen Aufschwung, nachdem es 1855 auf der New
Yorker Industrieausstellung den ersten Preis für seine
kreuzsaitigen Pianofortes erhalten. Es liefert jetzt
wöchentlich ca. 60 Instrumente, und das Magazin der Firma ist
eins der schönsten Gebäude der Stadt New York sowie der
Musiksaal "Steinway-Hall" einer ihrer größten
Konzertsäle. Heinrich S. starb 7. Febr. 1871 in New York. Von
den übrigen Begründern der New Yorker Firma lebt nur noch
Wilhelm, der vierte Sohn. Theodor S. gab 1865 das Braunschweiger
Geschäft auf (jetzt: Theodor Steinweg Nachfolger, Helferich,
Grotrian u. Komp.) und trat in das New Yorker ein, nachdem seine
Brüder Heinrich 11. März 1865 in New York und Karl 31.
März 1865 in Braunschweig gestorben waren; er selbst starb 26.
März 1889 in Braunschweig; Albert S. war bereits 1876 in New
York gestorben. Von den patentierten Verbesserungen der Firma seien
erwähnt: die Patent-Agraffeneinrichtung (1855), welche die
Widerstandsfähigkeit des Rahmens gegen die Saiten erhöht;
die Patentkonstruktion in Flügeln von kreuzsaitiger Mensur
(1859), deren Vorteile der Hauptsache nach in den verlängerten
Stegen und deren Verschiebung von den Rändern ab nach der
Mitte des Resonanzbodens zu suchen sind, wodurch größere
Räume zwischen den Chören der Saiten entstehen und somit
größere Resonanzflächen in Bewegung gesetzt werden;
der vibrierende Resonanzbodensteg mit akustischen Klangpfosten
(1869), beruhend auf der Tonleitung durch Stäbe und besonders
bei Pianinos und Flügeln von kleinerer Dimension angewendet;
der Patentringsteg am Resonanzboden (1869), wodurch eine bis dahin
unerreichte Gleichheit der Klangfarbe im Übergang von den
glatten zu den übersponnenen Saiten erzielt wird; die
Doppelmensur (1872); das Patent-Tonhaltungspedal (1874); die neue
Metallrahmenkonstruktion (1875) u. a.
Steinweichsel, s. Kirschbaum, S. 789.
Steinwein, s. Frankenweine.
Steinwurz, s. Agrimonia.
Steinzeit (Steinzeitalter, hierzu Tafel "Kultur der
Steinzeit"), der erste große Abschnitt der Prähistorie,
in welchem der auf niedriger Kulturstufe befindliche Mensch den
Gebrauch der Metalle noch nicht kannte und seine Geräte,
Werkzeuge und Waffen aus Holz, Knochen, Horn, besonders aber aus
Stein herstellte. Solche Steingeräte wurden früher als
vom Himmel herabgefallene Blitzsteine oder Donnerkeile betrachtet,
auch wegen ihrer Form Katzenzungen genannt. Im Gegensatz zur
Metallzeit (s. d.) umfaßt die S. außerordentlich lange
Zeiträume, innerhalb deren der Kulturfortschritt durch
allmähliche Vervollkommnung der besagten Geräte sich zu
erkennen gibt. Man unterscheidet die ältere S. oder
paläolithische Periode und die jüngere S. oder
neolithische Periode. In der ältern wurden die im allgemeinen
sehr primitiven Steingeräte durch Zuhauen, bez. vermittelst
des durch Schläge bewirkten Absplitterns geeigneter
Stücke von größern Steinklumpen hergestellt,
während Waffen und Geräte der jüngern S. durch
Schleifen und Polieren ihre Form erhalten haben. Eine scharfe
Grenze zwischen beiden Perioden läßt sich
selbstverständlich nicht ziehen, und bezüglich einzelner
Funde, wie der dänischen Küchenabfälle, ist es
zweifelhaft, ob sie der paläo- oder der neolithischen Periode
oder einer Übergangszeit angehören. Die ältere S.
fällt im allgemeinen zusammen mit der diluvialen und
eiszeitlichen Existenz des Menschengeschlechts, die jüngere S.
mit der alluvialen und nacheiszeitlichen Existenz des Menschen. Das
Zusammenfallen der ältern S. in Deutschland mit der
Diluvialperiode erklärt sich nach Penck aus dem gegen Ende der
Diluvialzeit stattgehabten klimatischen Wechsel (Abschmelzen der
Gletscher), welcher Veränderungen in der Bewohnbarkeit
gewisser Länderstrecken hervorrief, die ihrerseits wieder zu
Wanderungen des vorgeschichtlichen Menschen Anstoß gaben, bei
welchen im Besitz der neolithischen Kultur befindliche
Volksstämme nach Europa gelangten und der paläolithischen
Kultur den Untergang bereiteten. Die Fundstätten, welche
über die Existenzbedingungen und Lebensweise des Menschen der
ältern S. Aufschlüsse liefern, liegen in diluvialen
Ablagerungen der Flußthäler und in den Kalkhöhlen
Deutschlands, Belgiens, Frankreichs und Englands. Knochen des
Höhlenbären und Höhlenlöwen, des Mammuts,
Auerochsen, Hippopotamus, mehrerer Rhinozerosarten, des irischen
Riesenhirsches u. a. werden mit körperlichen Überresten,
Geräten und sonstigen
Kultur der Steinzeit.
(Shurb Hill.) (Poiton.) Paläolithische
Feuersteingeräte.
(Rügen.) (Irland.) (Schonen.)
_ (Dänemark.) (Dänemark.)
Feuersteinäxte und Schleifsteine.
(Rügen.) (Rügen.) (Schonen.) (Danemark.)
Feuersteinnucleus, Messer, Pfeilspitzen und Schaber.
chönow.) (Lübben.) (Hadersleben.) (Tondern.)
Brandenburg. Schleswig:.
(Schleswig.! (Rügen.)
Feuersteindolche, Lanzenspitze und Säge.
Meyers Konv. - Lexikon, 4. Aufl.
Tumulus mit Grabkammern.
Bibliographisches Institut in Leipzig.
(Waaren.) (Köthen.) (Asmusstadt.)
Mecklenburg. Anhalt.
Durchbohrte Steinhämmer.
Zum Artikel »Steinzeit«.
281
Steinzeit.
Spuren des paläolithischen Menschen auf gemeinschaftlicher
Lagerstätte angetroffen. Im Rheinthal und in Frankreich
aufgefundene Moschusochsenschädel, die hin und wieder die
Spuren menschlicher Thätigkeit erkennen lassen, sowie die in
den Höhlen des Perigord, im Keßlerloch bei Thayingen
(Kanton Schaffhausen) und anderwärts aufgefundenen
bearbeiteten Renntiergeweihe beweisen, daß der
paläolithische Mensch diese Gegenden zu einer Zeit bewohnt
hat, wo das Klima Nord- und Mitteleuropas ein kälteres gewesen
ist als heutzutage. Während die Funde von Taubach (unweit
Weimar) andeuten, daß der Mensch der ältern S. das
heutige Thüringen während der der letzten Vergletscherung
vorausgehenden Interglazialepoche (zwischen zwei Vergletscherungen
fallende wärmere Zwischenperiode) bewohnt hat, zeigen die
Funde von der Schussenquelle (Oberschwaben), bestehend in einer
nordische Moose enthaltenden, unmittelbar auf der
Rheingletschermoräne gelegenen Kulturschicht, daß der
Mensch hier während der letzten Vergletscherungsepoche lebte.
Die Nahrung des paläolithischen Menschen bestand aus dem
Fleisch der erwähnten Tiere und aus Fischen; auch das
diluviale Pferd hat, wie die Funde zahlreicher, zur Gewinnung des
Knochenmarks aufgeschlagener Pferdeknochen beweisen, als
Nahrungsmittel des Menschen der ältern S. eine wichtige Rolle
gespielt. Außer den Höhlen dienten ihm Erdgruben und aus
Fellen hergerichtete Zelte als Wohnungen. Daß er die Felle
des erlegten Wildes mit Hilfe von Tiersehnen zur Kleidung
aneinander nähte, deuten die in diluvialen Höhlen
gefundenen Knochennadeln an, welche durch langen Gebrauch abgenutzt
sind. Man fand auch Stücke farbiger Erde zum Bemalen des
Körpers und zum Teil höchst primitive
Schmuckgegenstände (durchbohrte Tierzähne, welche, mit
Darmsaiten zur Kette aneinander gereiht, getragen wurden, Knochen
kleiner Tiere, Schneckengehäuse und Muscheln, Stücke Jet,
Plättchen von Renntierhorn u. dgl.). Die in französischen
Höhlen, im Keßlerloch und anderwärts aufgefundenen
Gravierungen in Renntierhorn u. Mammutelfenbein und die aus diesem
Material hergestellten Schnitzereien beweisen eine gewisse Begabung
für bildnerische Thätigkeit. Als Material für die
primitiven Geräte, welche in paläolithischen
Fundstätten angetroffen werden, dienten vorzugsweise
Feuersteinknollen, die den Gegenstand eines ausgedehnten
Handelsverkehrs bildeten und zum Teil durch primitiven Bergbau (s.
Schmutzgruben) gewonnen wurden. In der Nachbarschaft der
Feuersteinlager entstanden auch jene Feuersteinwerkstätten,
von wo aus die Umgebung mit Werkzeugen und Waffen versehen wurde.
Solche Werkstätten wurden in Frankreich zu Pressigny le Grand,
in Belgien auf dem rechten Ufer der Trouille, unweit Spiennes,
aufgedeckt. Während für schneidende oder stechende
Werkzeuge und Waffen Gesteinsarten, welche beim Behauen eine
scharfe Kante liefern, wie Feuerstein, Jaspis, Quarz, Achat,
Obsidian u. dgl., vorzugsweise Verwendung fanden, wurden
Hämmer und Äxte aus Diorit, Porphyr, Basalt u. dgl.
angefertigt. Daß die Bearbeitung des Rohmaterials in der
nämlichen Weise stattfand, wie noch heutzutage die Eingebornen
Australiens ihr Steingerät herstellen, indem sie nämlich
gegen den zwischen den Füßen festgehaltenen Steinblock
rasch aufeinander folgende Schläge führen, dies beweisen
die an der Mehrzahl der paläolithischen Geräte und Waffen
nachweisbaren Schlagmarken. Letztere lassen die von Menschenhand
hergestellten Steinobjekte sicher von jenen Steinfragmenten
unterscheiden, welche durch zufällige Zersplitterung ohne
Mitwirkung des Menschen entstehen. Indem von den Feuersteinknollen
messerförmige Späne oder Splitter abgesprengt werden,
bleiben in der Regel jene charakteristisch geformten Steinkerne
(nuclei, s. Tafel "Kultur der Steinzeit") übrig.
Arbeitssteine, ovale Steine mit Aushöhlungen an einer oder
beiden Oberflächen, dienten als Hämmer oder Schnitzer.
Die Schlagsteine (Schlagkugeln) zeigen auf den Rändern die
Spuren der mit ihnen ausgeführten Schläge. Die
Steinmesser (s. Tafel) sind dünne, zweischneidige, einer
Barbierlanzette ähnelnde, länglich-ovale Splitter, die
Schabsteine (s. Tafel) im allgemeinen von mehr
unregelmäßiger Form. Sehr häufig finden sich in den
ältern paläolithischen Fundstätten
mandelförmige Steinäxte (s. Tafel), die wahrscheinlich
vermittelst Tiersehnen an einem Holzstiel befestigt, aber auch als
Meißel oder Pfrieme verwendet wurden. Steinobjekte von drei-
oder viereckiger Form, die auf der einen Seite flach, auf der
andern mehr oder weniger gewölbt, 2½-5½ Zoll
lang, 1½ bis 2½ Zoll breit sind, und die eine wenn
auch nicht scharfe, doch sehr starke Schneide besitzen, werden
vorzugsweise in den Küchenabfallhaufen Dänemarks
angetroffen und in der Regel als kleine Steinbeile bezeichnet, von
Steenstrup aber als Angelschnurgewichte gedeutet. Von
Schleudersteinen unterscheidet man einfache, roh bearbeitete
Feuersteinstücke und runde, etwas abgeflachte, zierlich
gearbeitete Scheiben. Aus Feuerstein hergestellte Sägen (s.
Tafel) gehören in paläolithischen Fundstätten
ebenfalls nicht zu den Seltenheiten. Die Pfeilspitzen (s. Tafel)
der ältern Stadien der paläolithischen Zeit sind von
plumper, dreieckiger Gestalt, später finden sich leichter und
besser gearbeitete, rautenförmige, blattförmige oder mit
Widerhaken versehene Stücke, und daß gegen das Ende der
ältern S. eine bedeutende Vervollkommnung in der Herstellung
der Geräte und Waffen stattgefunden hat, beweisen die
kunstvoll gearbeiteten, meist lorbeerblattförmigen Dolch- und
Speerspitzen (s. Tafel), wie sie in jüngern
paläolithischen Fundstätten wiederholt angetroffen
wurden. Ferner finden sich Speerspitzen und Harpunen aus Knochen,
Renntier- und Hirschgeweih sowie eigentümlich geformte, aus
dem nämlichen Material hergestellte und mit Gravierungen
versehene Objekte, welche als Kommandostäbe (Abzeichen des
Häuptlings etc.) bezeichnet werden. In Gemeinschaft mit
paläolithischen Geräten werden in Deutschland und
Belgien, aber nicht in Frankreich und England Scherben irdenen
Geschirrs, die, mit der Hand geformt und an der Sonne getrocknet,
nur geringe Kunstfertigkeit verraten, nicht selten angetroffen.
Die relativ hohe Entwicklungsstufe, welche der Mensch der
jüngern S. im Vergleich zum paläolithischen Menschen
einnimmt, äußert sich zunächst in der
außerordentlich sorgfältigen und stellenweise einen
nicht geringen Geschmack bekundenden Herstellung der Waffen und
Werkzeuge, die zum Teil auch bedeutende Dimensionen aufweisen. So
fanden sich z. B. in Skandinavien sorgfältig gearbeitete
Steinäxte, welche 33 cm lang sind und in der Mitte eine Breite
von 55-57 mm und eine Dicke von 35-38 mm aufweisen. Die
neolithischen Feuersteingeräte sind nicht von Knollen
abgeschlagene Steinsplitter, sondern von allen Seiten bearbeitete
Steinstücke. Dieselben sind geschliffen oder mehr oder weniger
sorgfältig gemuschelt, d. h. es sind aus dem Feuerstein
Teilchen in muschelförmigem Bruch herausgehoben. Neben
einfachen, beiderseits zur Schneide konvex sich zuschärfenden
Axtblättern finden sich Steincelte,
282
Steinzellen - Steißfuß
d. h. von der Schneide nach hinten zu schmäler werdende
Geräte, die als Messer, Hacken und Streitäxte dienten,
sowie lange und schmale Instrumente mit einseitig flacher Schneide,
die als Meißel oder Hobel bezeichnet werden; auch
Hohlmeißel wurden angetroffen. Ferner finden sich steinerne
Mörser und Handmühlen zum Zerreiben von
Getreidekörnern. Die Schleifsteine (s. Tafel) bestehen
gewöhnlich aus feinkörnigem Sandstein mit einer oder
mehreren Schliffflächen. Als Hämmer (s. Tafel) werden
Äxte bezeichnet, die statt der Schneide eine mehr oder weniger
abgestumpfte Fläche tragen, während Hammeräxte an
einem Ende die Schneide der Axt, am andern die Fläche des
Hammers besitzen. Zur Befestigung des keilförmigen Steinbeils
am hölzernen Stiel wurde es in einen Einschnitt an dem
umgebogenen Ende eines krummen Holzgriffs gesteckt und mit
kreuzweise umgelegten Riemen oder mit einer Schnur befestigt, oder
man höhlte ein Stück Hirschhorn oder Renntiergeweih zu
einer das Steingerät teilweise umfassenden Hülse aus,
welche dann am dicken Ende einer Holzkeule oder eines Stockes
befestigt wurde. Anderseits wurden die Steinäxte, um einen
hölzernen Stiel hindurchzustecken, durchbohrt. Rau hat
nachgewiesen, daß man das härteste Gestein mit einem
hölzernen Stab oder einem cylinderförmigen Knochen, den
man in schnelle Umdrehung versetzt, unter Anwendung von Sand und
Wasser durchbohren kann. Auch ein zugespitztes Hirschhornstück
oder ein an einem Holzstab angebrachter spitzer Feuerstein, der mit
Hilfe einer an einem Bogen befestigten, sich auf- und abwickelnden
Schnur in schnelle Umdrehung versetzt wurde, fand vielfach
Verwendung. Zur Zerteilung eines großen Steinblocks bediente
man sich einer an einem hin- und herschwingenden Baumast
befestigten Feuersteinsäge, mit der man den Block von
verschiedenen Seiten ansägte, während die
übrigbleibende Verbindung mit dem Meißel durchgesprengt
wurde. Besonderes Interesse knüpft sich an die aus Nephrit und
Jadeit hergestellten Geräte, da die Herkunft des Materials
mehr oder weniger zweifelhaft ist (vgl. Nephrit). Die aus Knochen
und Horn hergestellten Objekte der jüngern S. bekunden zum
Teil hervorragende technische Fertigkeit. Aus diesen Materialien
hergestellte Angel-haken, Harpunen und Stechspeere für den
Fischfang, ferner knöcherne Pfrieme, Meißel, Dolche,
Pfeil- und Lanzenspitzen, aus Rippen des Hirsches oder der Kuh
hergestellte Kämme zum Flachshecheln und ähnliche Objekte
gehören nicht zu den Seltenheiten. Aus Holz gefertigte
Gegenstände, wie Speerstangen, Bogen, Kämme aus
Buchsbaumholz, aus einem Baumstamm ausgehöhlte Kähne u.
dgl., haben sich ebenfalls hier und da erhalten. Die neolithischen
Schmuckgegenstände zeichnen sich vor den paläolithischen
durch größere Mannigfaltigkeit aus.
Die Fundstätten der jüngern S. sind über ganz
Europa zerstreut, und auch außerhalb Europas werden dieselben
häufig angetroffen; ganz besonders reich aber hat sich
Skandinavien erwiesen. Außer den gewöhnlichen
neolithischen Objekten finden sich im N. und O. Schwedens aus
Schiefer hergestellte Altertümer, die man für
Überreste der S. der Lappen hält und als arktische
Steinkultur bezeichnet. Außerordentlich reich an
neolithischen Fundstücken ist Rügen, von wo aus in
prähistorischer Zeit ein großartiger Export von
Feuersteingeräten stattfand. Außer in Höhlen,
wohnte der neolithische Mensch auf im Wasser errichteten
Pfahlgerüsten (s. Pfahlbauten). Im nördlichen Europa
dienten ihm wohl während des Sommers aus Fellen hergestellte
Zelte, im Winter vermutlich niedrige Hütten aus einem
Gerüst von Walfischrippen und Holz, das mit Rasenstücken
oder mit einer Lage Torf und darübergeschütteter Erde
bedeckt wurde, als Wohnungen. Die Form der letzterwähnten
Behausungen ist nach Sven Nilsson in den skandinavischen
Ganggräbern nachgeahmt. Das Andenken seiner Toten ehrte der
neolithische Mensch durch Aufwerfen von Grabhügeln (s.
Gräber u. Tafel) sowie durch Errichtung von Dolmen und
Steinsetzungen (s. d.). Ein besonders wichtiges Kennzeichen der
neolithischen Kultur besteht darin, daß während dieses
Abschnitts der Prähistorie der Mensch zuerst Tiere zähmt,
daß ebensowohl die Anfänge der Viehzucht als diejenigen
des Ackerbaues dieser Epoche angehören, daß der
neolithische Mensch aus Pflanzenfasern rohe Gewebe und Gespinste
herstellt, und daß derselbe, wie die Funde an
Gefäßen und Gefäßscherben beweisen, in der
Thonbildekunst bereits erhebliche Fortschritte gemacht hat. Vgl.
Joly, Der Mensch vor der Zeit der Metalle (Leipz. 1880); de
Nadaillac, Die ersten Menschen und die prähistorischen Zeiten
(deutsch, Stuttg. 1884); Kinkelin, Die Urbewohner Deutschlands
(Lindau 1882); Fischer, Betrachtungen über die Form der
Steinbeile auf der ganzen Erde ("Kosmos", Bd. 10,S. 117); Tischler,
Beiträge zur Kenntnis der S. in Ostpreußen etc.
(Königsb. 1882-83, 2 Hefte); Montelius, Die Kultur Schwedens
in vorchristlicher Zeit (deutsch, Berl. 1885); Maska, Der diluviale
Mensch in Mähren (Neutitschein 1886); Rau, Drilling in stone
without the use of metals (Washington 1869); Baier, Die Insel
Rügen nach ihrer archäologischen Bedeutung (Strals.
1886).
Steinzellen, s. Steinigwerden.
Steinzeug, s. Thonwaren.
Steiß, das hintere Rumpfende der Wirbeltiere,
besonders wenn es, wie bei den Vögeln, über den Rumpf
hinausragt.
Steißbein (Os coccygis, Schwanzbein), der
Endabschnitt der Wirbelsäule (s. d.) nach hinten vom
Kreuzbein. Während der Schwanzteil derselben bei den mit einem
deutlichen Schwanz versehenen Wirbeltieren oft aus sehr vielen und
beweglichen Wirbeln besteht, sind beim Menschen 4, seltener 5, bei
andern Säugetieren noch weniger, bei den Vögeln 4-6, bei
den Fröschen ebenfalls einige wenige Wirbel zu einem
Knochenstück, dem sogen. S., verschmolzen. Die Wirbel, in der
menschlichen Anatomie als falsche Wirbel (vertebrae spuriae)
bezeichnet, entbehren des dorsalen Bogens, so daß das
Rückenmark hier nicht in einem Kanal, sondern frei liegt, was
auch schon am letzten Kreuzbeinwirbel der Fall ist (s. Tafeln
"Nerven II", "Skelett II" und "Bänder"). In abnormen
Fällen, bei den sogen. geschwänzten Menschen, ist das S.
nicht nach dem Innern des Körpers zu, sondern nach außen
zu gekrümmt und bildet dann ein ordentliches Schwänzchen,
das übrigens regelmäßig beim Embryo (s. d.)
vorhanden ist.
Steißdrüse, ein kleiner, unpaarer,
drüsenartiger Körper von unbekannter Bedeutung in der
Gegend des Steißbeins.
Steißfuß (Lappentaucher, Podiceps Lath.),
Gattung aus der Ordnung der Taucher und der Familie der Seetaucher
(Colymbidae), Vögel mit breitem, platt gedrücktem Leib,
langem, ziemlich dünnem Hals, kleinem, gestrecktem Kopf,
langem, schlankem, seitlich zusammengedrücktem, zugespitztem,
an den Schneiden sehr scharfem Schnabel, am Ende des Leibes
eingelenkten, nicht sehr hohen, seitlich stark
zusammengedrückten Füßen, mit Schwimmlappen be-
283
Steißfußhuhn - Stellvertretung.
setzten Vorderzehen mit breiten, platten Nägeln,
stummelartiger Hinterzehe, kurzen, schmalen Flügeln und statt
des Schwanzes mit einem Büschel zerschlissener Federn. Die
Steißfüße sind vollkommene Wasservögel,
welche ausgezeichnet tauchen, unter Wasser sich sehr schnell
fortbewegen, auch auf dem Wasser ruhen und in einem schwimmenden
Nest aus nassen Stoffen brüten. Das Gelege besteht aus 3-6
Eiern, welche von beiden Eltern gezeitigt werden. Sie nähren
sich von Fischen, Insekten, Fröschen, verschlucken auch
Pflanzenteile und ihre eignen Federn, welche sie sich aus der Brust
rupfen. Der Haubensteißfuß (Haubentaucher, Blitzvogel,
Seedrache, Fluder, P. cristatus L.), 66 cm lang, 95 cm breit,
oberseits schwarzbraun, mit weißem Spiegel an den
Flügeln, weißen Wangen und weißer Kehle,
unterseits weiß, seitlich dunkel gefleckt, im Hochzeitskleid
mit zweihörnigem Federbusch auf dem Kopf und aus langen,
zerschlissenen Federn gebildetem rostroten, schwarz
geränderten Kragen; die Augen sind karminrot, Zügel und
Schnabel blaßrot, die Füße hornfarben. Er bewohnt
die Seen und Gewässer Europas bis 60° nördl. Br.,
weilt in Deutschland von April bis November, überwintert auf
dem Meer, in Südeuropa oder Nordafrika und findet sich auch in
Asien und Nordamerika. Er lebt paarweise an größern
bewachsenen Teichen oder Seen, hält sich sehr viel auf dem
Wasser auf, ist auf dem Land sehr unbehilflich, fliegt aber
verhältnismäßig schnell und schwimmt und taucht
vortrefflich. Er ist sehr vorsichtig und sucht sich bei Gefahr
stets durch Tauchen zu retten. Das Nest steht in der Nähe von
Schilf auf dem Wasser, und das Weibchen legt drei weiße Eier.
Die Jungen werden von der Mutter beim Schwimmen oft auf dem
Rücken, beim Fluge nicht selten zwischen den Brustfedern
versteckt getragen. Man jagt ihn des kostbaren Federpelzes halber.
Der Zwergsteißfuß (P. minor L.), 25 cm lang, 43 cm
breit, oberseits glänzend schwarz, unterseits grauweiß,
dunkler gewölkt, an der Kehle schwärzlich, an Kopf-,
Halsseiten und der Gurgel braunrot; das Auge ist braun, der
Zügel gelbgrün, der Schnabel an der Wurzel gelbgrün,
an der Spitze schwarz, der Fuß schwärzlich. Er ist wie
der vorige weit verbreitet, weilt in Deutschland vom März, bis
die Gewässer sich mit Eis bedecken, und überwintert in
Südeuropa. Man findet ihn an bewachsenen Teichen, in
Brüchern und Morästen, er lebt wie der vorige, fliegt
aber schlecht und deshalb sehr ungern, nährt sich
hauptsächlich von Insekten, nistet im Schilf und legt 3-6
weiße, schwach gefleckte Eier (s. Tafel "Eier II"), welche in
20 Tagen ausgebrütet werden. Der Ohrensteißfuß (P.
auritus L.), 33 cm lang, 60 cm breit, an Kopf, Hals und Oberteilen
schwarz, mit breitem, goldgelbem Zügel, an Oberbrust und
Seiten lebhaft braunrot, an Brust und Bauchmitte weiß, das
Auge ist rot, der Schnabel schwärzlich, der Fuß
graugrün, bewohnt den gemäßigten Gürtel der
Alten Welt. Die Eier (s. Taf. "Eier II") sind weiß, lehmgelb
gefleckt.
Steißfußhuhn (Megapodius Quoi et Gai.),
Gattung aus der Ordnung der Hühnervögel und der Familie
der Wallnister (Megapodiidae). Das Großfußhuhn (M.
tumulus Less.), von der Größe des Fasans, oberseits
braun, unterseits grau, mit rötlich-braunem Auge und Schnabel
und orangefarbigem Fuß, lebt auf den Philippinen und
Neuguinea im Gestrüpp an der Küste paarweise oder
einzeln, ist sehr scheu, fliegt schwerfällig und nährt
sich von Wurzeln, Sämereien und Insekten. Es erbaut aus Sand
und Muscheln große Haufen, welche, von mehreren Geschlechtern
benutzt und vergrößert, 5 m Höhe und einen Umfang
von 50 m erreichen, und legt in diese sein weißes Ei, welches
es tief vergräbt.
Steißhühner, s. Hühnervögel.
Steißtier, s. Aguti.
Stele (griech.), Grabstein, gewöhnlich ein
viereckiger, nach oben sich etwas verjüngender und mit
Blätter- oder Blumenverzierungen (Anthemien) gekrönter
Pfeiler, welcher den Namen des Verstorbenen trägt (s.
Abbildung). Mitunter finden sich auch auf der S.
Reliefdarstellungen, die sich auf das Leben des Geschiedenen
beziehen. In makedonischer und römischer Zeit wird die S.
niedriger und breiter und meist mit einem Giebel besetzt. Vgl.
Brückner, Ornament und Form der attischen Grabstele
(Straßb. 1886).
Stell., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung
für G. W. Steller, geb. 1709 zu Windsheim, Arzt in Petersburg,
starb 1745 (Seetiere).
Stella (lat.), Stern.
Stella, 1) Pseudonym, s. Lewis 2);
2) s. Swift.
Stellage (französiert, spr. -lahsche), Gestell,
Gerüst; auch s. v. w. Stellgeschäft (s. Börse, S.
238).
Stellaland, s. Westbetschuanen.
Stellaria L. (Sternkraut, Sternmiere), Gattung aus der
Familie der Karyophyllaceen, kleine, einjährige oder
ausdauernde Kräuter mit weißen Blüten in allen
Klimaten, doch meist auf der nördlichen Erdhälfte. S.
Holostea L. (Augentrostgras, Jungferngras), in ganz Europa,
ausdauernd, mit aufsteigendem, vierkantigem Stengel, sitzenden,
lanzettlichen, lang zugespitzten, am Rand und auf dem Kiel scharfen
Blättern, ward früher medizinisch benutzt; S. media Vill.
(Vogelmiere, Hühnerdarm), sehr gemein, wird allgemein als
Vogelfutter benutzt.
Stellaten, s. Rubiaceen.
Stellbrief, s. Engagementsbrief.
Stelldichein, s. Rendezvous.
Stellenvermittelungsbüreaus, s.
Adreßbüreaus.
Stelleriden, s. Asteroideen.
Stellgeschäft, s. Börse, S. 238.
Stellio, Dorneidechse (s. d.). Der S. der Alten ist der
Gecko (s. Geckonen).
Stellionat (Crimen stellionatus), im römischen
Strafrecht die Verletzung und Unterdrückung der Wahrheit zur
Gewinnung unrechtmäßiger Vorteile durch Täuschung,
d. h. durch vorsätzliche Erweckung einer unrichtigen
Vorstellung bei andern. Der Name ist von der Behendigkeit der
Eidechse (stellio) im Entschlüpfen hergenommen.
Stellknorpel, s. Kehlkopf.
Stellmacher (Wagner), ehemals zünftige Handwerker,
die das Holzwerk für Fuhrwerke, Kutschen, Schlitten,
Pflüge etc. verfertigen. An manchen Orten fertigen die
Radmacher die Räder allein.
Stellung, s. Attitüde und Position.
Stellvertretung, das Rechtsverhältnis, in welchem
eine Person die Geschäfte einer andern ausführt, sei es,
daß es sich dabei um einzelne Geschäfte, sei es,
daß es sich um eine Summe von Geschäften handelt. Im
284
Stellvertretung, militärische - Stelzhamer.
privatrechtlichen Verkehr setzt die S. in der Regel einen
Auftrag seitens der zu vertretenden Person voraus (s. Mandat).
Handelt es sich dagegen um die Vertretung eines öffentlichen
Beamten, so wird der Stellvertreter oder Vikar (s. d.) in der Regel
von der vorgesetzten Dienstbehörde bestellt. Dem als
Volksvertreter gewählten Beamten fallen die Kosten der S.
nicht zur Last. Die S. des deutschen Reichskanzlers
(Generalstellvertretung durch einen Vizekanzler oder
Spezialvertretung durch die Chefs der Reichsämter) ist durch
Reichsgesetz vom 17. März 1878 geordnet. Bei gekrönten
Häuptern wird zwischen S. und Regentschaft unterschieden.
Letztere ist auf die Dauer berechnet und tritt kraft gesetzlicher
Bestimmung ein, während man unter S. die auf Anordnung des
Monarchen selbst eintretende vorübergehende Vertretung
versteht.
Stellvertretung, militärische, früher
Ableistung der Dienstpflicht im Kriegsheer durch und für einen
andern, wofür der Stellvertreter (Einsteher, Remplacant) eine
meist gesetzlich geregelte Abfindungssumme erhielt. Nach
Deutschlands Vorgang bis auf Belgien und Niederlande, wo die m. S.
noch heute besteht, nach dem Krieg 1870/71 überall
abgeschafft. S. Loskauf.
Stelter, Karl, lyr. Dichter, geb. 25. Dez. 1823 zu
Elberfeld, widmete sich in einer Seidenweberei daselbst dem
kaufmännischen Beruf, zu dem er auch nach einem kurzen
Versuch, als Schauspieler eine künstlerische Zukunft zu
gewinnen, zurückkehrte und bis 1880 (in den letzten 30 Jahren
als Prokurist) thätig war. Seitdem lebt er in Wiesbaden. S.
gehört als Dichter zu der kleinen Gruppe der "Wupperthaler
Poeten", welche im materiellen Treiben ideale Gesinnungen zu wecken
und zu erhalten bemüht waren und eine freisinnige und freudige
Auffassung des Daseins dem trüben Wupperthaler Pietismus
entgegensetzten. Er veröffentlichte: "Gedichte" (Elberf. 1858,
3. Aufl. 1880); "Die Braut der Kirche", lyrisch-epische Dichtung
(Bresl. 1858); "Aus Geschichte und Sage", erzählende
Dichtungen (Elberf. 1866, 2. Aufl. 1882); die Anthologie
"Kompaß auf dem Meer des Lebens" (4. Aufl., Berl. 1884);
"Kompendium der schönen Künste" (Düsseld. 1869);
"Gedichte", 2. Band (Elberf. 1869); "Novellen" (das. 1882); "Neue
Gedichte" (das. 1886) u. a.
Stelvio, Monte, s. Stilfser Joch.
Stelzen, hohe Stäbe, an welchen in bestimmter
Höhe Trittklötze angebracht sind, auf denen man, sich an
den Stangen selbst festhaltend, stehen und gehen kann. Sie sind ein
gymnastisches Belustigungsmittel, während eine andre Art
Stelzen, die ungefähr eine Elle hoch und oben so breit sind,
daß sie an die Fußsohle festgeschnallt oder gebunden
werden können, besonders von den Äquilibristen zum
Stelzentanz benutzt werden. Beide Arten sind übrigens in
Marschländern sehr gebräuchlich, um sumpfige oder
überschwemmte Stellen zu durchschreiten, namentlich im franz.
Departement des Landes, woselbst die Schäfer sich den ganzen
Tag auf ihren S. bewegen. Zu Namur fand früher
alljährlich zum Karneval ein zweistündiger Kampf zwischen
zwei Armeen auf S. statt.
Stelzengeier (Kranichgeier, Sekretär, Gypogeranus
serpentarius Ill.), Vogel aus der Ordnung der Raubvögel und
der Familie der Kranichgeier (Gypogeranidae), 125 cm lang, sehr
schlank gebaut, mit langem Hals, ziemlich kleinem, breitem, flachem
Kopf, kurzem, dickem, starkem, vom Grund an gebogenem, fast zur
Hälfte von der Wachshaut bedecktem Schnabel mit sehr spitzigem
Haken, langen Flügeln, in welchen die ersten fünf
Schwingen gleich lang sind, auffallend langem, aber sehr stark
abgestuftem Schwanz, unverhältnismäßig langen
Läufen und kurzen Zehen mit wenig gekrümmten,
kräftigen, stumpfen Krallen. Das Gefieder ist am Hinterkopf zu
einem Schopfe verlängert, oberseits hell aschgrau, am
Hinterhals gräulichfahl, an den Halsseiten u. Unterteilen
schmutzig graugelb, Nackenschopf, Schwingen, Bürzel und
Unterschenkel schwarz, die Steuerfedern weiß, graubraun,
schwarz, an der Spitze wieder weiß; das Auge ist graubraun,
der Schnabel dunkel hornfarben, an der Spitze schwarz, Wachshaut
und Lauf gelb. Er bewohnt die steppenartigen Ebenen Afrikas vom Kap
bis 16° nördl. Br., lebt meist paarweise, läuft und
fliegt vortrefflich und ist berühmt als Schlangenvertilger. Er
nistet auf Büschen oder Bäumen und legt 2-3 weiße
oder rötlich getüpfelte Eier, welche das Weibchen in
sechs Wochen ausbrütet. Die Tötung des Stelzengeiers ist
am Kap streng verboten. In der Gefangenschaft hält er sich
gut, wird auch recht zahm.
Stelzenschuhe kamen im 15. Jahrh., wie es scheint zuerst
in Spanien, auf, wo sich diese Mode eine Zeitlang mit der der
Schnabelschuhe vereinigte. Schon in der ersten Hälfte des 16.
Jahrh. kam sie hier wieder in Abnahme, wogegen sie erst jetzt in
England, Italien und besonders in Frankreich (unter dem Namen
patins) Verbreitung fand. Allerdings gewannen sie im Norden
insofern praktische Bedeutung, als der Straßenschmutz zur
Benutzung hölzerner Unterschuhe zwang, die im Haus abgelegt
wurden. Sie wurde hier in dem Maß übertrieben, daß
man sie, nach Art eines förmlichen Piedestals, bis zu 2
Fuß hoch trug und auch durch die Farbe derselben die
Aufmerksamkeit zu erregen suchte. In Deutschland fand diese Mode
weniger Anklang. Trotz häufiger Verbote kam man, wenn auch in
mäßigerer Anwendung, immer wieder auf sie zurück S.
die Abbildungen.
^[Stelzenschuhe.]
Stelzfuß, s. Bockhuf.
Stelzhamer, Franz, ausgezeichneter österreich.
Dialektdichter, geb. 29. Nov. 1802 zu Großpiesenham bei Ried
in Oberösterreich als der Sohn eines Bauern, besuchte,
für den geistlichen Stand bestimmt, die Gymnasien zu Salzburg
und Graz und sollte im Seminar zu Linz die Weihen empfangen,
verließ aber, weltlich gesinnt, das Berufsstudium und ging
nach Wien, wo er sich erst als Jurist, dann als Malerakademiker
versuchte, bis er sich einer wandernden Schauspielertruppe
anschloß. In dieser Laufbahn lernte er Sophie Schröder
kennen, die ihn in der Deklamation unterrichtete. Nach
Auflösung der Truppe kehrte der mehr als 30jährige Sohn,
von der Bäuerin-Mutter geholt, in die heimatliche Hütte
zurück, wo er nun seine zerstreuten Dialektgedichte ordnete
und herausgab ("Lieder in obderennsscher Mundart", Wien 1836; 2.
Aufl. 1844), die einen durchschlagenden Erfolg hatten. Es folgten
"Neue Gesänge" (Wien 1841, 2. Aufl. 1844)
285
Stelzvögel - Stempelsteuern.
von gleichem Wert nach, und nun gehörte S. ganz dem
dichterischen Beruf an, indem er als wandernder Sänger, seine
eignen Gedichte vortrefflich vortragend, Österreich und Bayern
jahrelang durchzog. Weiter veröffentlichte er drei Bände
Erzählungen ("Prosa", Regensb. 1845); "Neue Gedichte" (das.
1846); ferner "Heimgarten" (Pest 1846, 2 Bde.);
"Liebesgürtel", in hochdeutscher Sprache (2. Aufl.,
Preßb. 1876); endlich "D'Ahnl", ein Dialektepos in Hexametern
(Wien 1851, 2. Aufl. 1855). S. starb zu Henndorf bei Salzburg 14.
Juli 1874. Aus seinem Nachlaß erschienen: "Aus meiner
Studienzeit" (Salzb. 1875); "Die Dorfschule" (Wien 1877).
"Ausgewählte Dichtungen" Stelzhamers gab Rosegger heraus (Wien
1884, 4 Bde.).
Stelzvögel, s. v. w. Watvögel (s. d.).
Stemma (griech.), Kranz, besonders als Schmuck der
Ahnenbilder; Stammbaum. Stemmatographie, Genealogie.
Stemm- und Stechzeug, Meißel zur Bearbeitung des
Holzes, haben eine gerade, einseitig oder zweiseitig
zugeschärfte oder eine bogen- oder winkelförmige
Schneide. Zu der ersten Klasse gehört der 3-50 mm breite
Stechbeitel, dessen Zuschärfungsfläche mit der
gegenüberstehenden Fläche einen Winkel von 8-30°
bildet. Der englische Lochbeitel ist sehr viel dicker, 1,5-25 mm
breit und hat einen Zuschärfungswinkel von 25-35°. Die
Kantbeitel sind lange und starke Stechbeitel für Wagner mit
einer niedrigen Rippe auf der Seite, wo die Zuschärfung liegt,
so daß der Querschnitt ein gedrücktes Fünfeck
bildet. Zur zweiten Klasse gehört das Stemmeisen mit
dünner Klinge und 12-36 mm breit. Zur dritten Klasse
gehören die Hohleisen mit rinnenartiger Klinge und ein- oder
zweiseitig zugeschärfter Schneide, deren Mitte bei den
Hohleisen der Zimmerleute weit vorsteht. Der Geißfuß
hat zwei gleichlange, geradlinige Schneiden, welche unter einem
Winkel von 45-90° zusammenstoßen. Stemm- und Stechzeuge
dienen zum Wegnehmen von Holzteilen, zur Bildung von Einschnitten,
Ausarbeitung von Vertiefungen und Löchern etc. Stemmmaschinen
zum Ausstemmen von Zapfen und durch Langlochbohrmaschinen erzeugten
Nuten besitzen einseitig scharf geschliffene Meißel, die sich
hin und her, resp. auf und ab bewegen und dabei in das auf dem
Arbeitstisch liegende Holz einschneiden, welches nach jedem Schnitt
um die Stärke eines Spans vorrückt.
Stempel, Werkzeug, welches auf der einen Fläche mit
erhabenen oder vertieften Figuren, Buchstaben u. dgl. versehen ist,
um mittels aufgetragener Farbe diese Figur abzudrücken oder
vermittelst eines Drucks diese Figuren in eine etwas weichere Masse
einzudrücken, wie namentlich die S. zur Verfertigung der
Münzen und Medaillen; auch das mit einem solchen Werkzeug
aufgedrückte Zeichen, welches als Merkmal der erprobten
Güte einer Ware, des Ursprungs (von woher) oder einer
bezahlten Abgabe dient. - Im Staatshaushalt wird der S.
(eigentlich: die Stempelung) als Mittel benutzt, um auf bequemem
und nicht kostspieligem Wege Gebühren und Steuern
(Verkehrssteuern) zu erheben (Gebührenstempel, Steuerstempel).
Derselbe soll wegen seiner finanziellen Ergiebigkeit zuerst im
verkehrsreichen Holland (seit 1624) in Gebrauch gekommen sein. Er
ist überall da anwendbar, wo einer zu belastenden Leistung
eine Schriftlichkeit zu Grunde liegt, die der Zahlungspflichtige
überreicht oder empfängt. In diesen Fällen
können sowohl Stempelbogen (gestempeltes Papier) als
aufzuklebende, für den Gebrauch bequemere Stempelmarken
benutzt werden, in andern bedient man sich auch wohl gestempelter
Umschläge (Banderollen, z. B. beim Tabak), die bei dem
Gebrauch zerrissen werden, während der Stempelbogen durch das
Beschreiben, die Stempelmarke durch Durchstreichen oder
Ausdrücken eines Zeichens für weitere Verwendungen
unbrauchbar gemacht (nullifiziert, kassiert) wird. Endlich kann
auch ein Gegenstand (z. B. Edelmetall, Zeitung, Kartenspiel)
unmittelbar durch Aufdrücken des Stempels gestempelt und damit
der Beweis der Steuer- oder Gebührenzahlung geliefert werden.
Zu unterscheiden sind: 1) der Fixstempel, welcher mit einem festen
Geldbetrag für die einzelne in Anspruch genommene
öffentliche Leistung heute meist in der Form der Stempelmarke
eintritt; 2) der Klassenstempel, bei welchem nach gewissen
Merkmalen (Bedeutung des Gegenstandes, verursachte Kosten) die
verschiedenen Fälle in Klassen eingeteilt werden und innerhalb
der einzelnen Klassen Festempel zur Anwendung kommen; 3) der
Dimensionsstempel, dessen Höhe sich nach der Ausdehnung des
Gegenstandes (Zeitung, Prozeßakten) richtet, an welchen der
S. angeknüpft wird; 4) der Wert- (Gradations-, Proportional-)
S., welcher sich nach dem durch die steuerpflichtige Urkunde
repräsentierten Wert richtet und in Prozenten des letztern
oder auch mit Abrundung der Prozenthöhe in festen
Beträgen für gewisse Klassen (klassifizierter
Wertstempel) erhoben wird. Gegen Stempelfälschungen
schützt man sich durch künstliche Herstellung der
Stempelzeichen (geschöpftes Papier, Wasserzeichen etc.), gegen
Umgehungen dienen Kontrolle und Strafe. Die Strafe kann dadurch
verschärft werden, daß das vorgenommene
Rechtsgeschäft für nichtig erklärt wird. Da
hierdurch jedoch auch leicht Unschuldige getroffen werden, so
begnügt sich die Stempelgesetzgebung meist mit Geldstrafen,
während die Gültigkeit des Rechtsgeschäfts nicht
weiter angefochten wird. Vgl. Stempelsteuern.
Stempel (Pistill), das weibliche Organ in den
Blüten, s. Blüte, S. 67 f.
Stempelakte, brit. Gesetz, 22. März 1765 für
die nordamerikanischen Kolonien gegeben, angeblich behufs
Aufbringung einer Summe zur Verteidigung der Kolonien gegen
feindliche Angriffe und zwar durch Auflegung einer Stempeltaxe auf
alles bei Geschäften zu verwendende Schreibpapier, steigerte
die Unzufriedenheit, ward zwar 18. März 1766 wieder
aufgehoben, trug aber zum Abfall der Kolonien von England mit bei.
S. Großbritannien, S. 806.
Stempelbogen, Stempelmarke etc., s. Stempel.
Stempelschneidekunst, die Kunst, Figuren und Buchstaben
in Stempel von Metall je nach Erfordernis des Abdrucks vertieft
oder erhaben darzustellen. Zu den Stempelschneidern gehören
daher auch die Petschaftstecher und die Schriftschneider, doch
findet die eigentliche Anwendung der S. besonders für
Münzen und Medaillen statt. Zahlen und sich oft wiederholende
kleine Zeichen (Sternchen, Kreuze etc.) werden mit besondern Bunzen
eingeschlagen. Über die geschichtliche Entwickelung und das
Künstlerische der S. vgl. Denkmünze und Münzwesen,
S. 897.
Stempelsteuern, eine Reihe von Staatsabgaben (Steuern wie
Gebühren), welchen der Stempel (s. d.) als Erhebungsform
gemeinsam ist. Im wesentlichen decken sie sich mit den
Verkehrssteuern (s. d.). Das Deutsche Reich besitzt an solchen S.
die Wechselstempelsteuer (s. d.), den Spielkartenstempel (s. d.)
und die Börsensteuer (s. d.). Die Gliederstaaten haben
mannigfaltige Urkundenstempel, Erbschaftsstempel und
Gebührenstempel. Die französischen S. sind teils
286
Stempelzeichen - Stengel.
Verbrauchsstempel (Dimensionsstempel von Zeitschriften,
öffentlichen Ankündigungen etc.), teils Urkundenstempel
(als Dimensions- oder als Wertstempel auf alle Akte der
öffentlichen Agenten, der Gerichte und
Verwaltungsbehörden etc.). Der englische Stempel ist meist
Fixstempel. Proportionell abgestuft sind hauptsächlich nur die
Wechselstempelsteuern, die Erbschaftssteuern (s. d.), die Stempel
auf Übertragung von Grundeigentum und von gewissen
Wertpapieren.
Stempelzeichen (Kontermarke), Zeichen, welches in die
Münzen eingeschlagen wurde, um anzuzeigen, daß eine
bisher ungültige Münze Geltung erhält, oder
daß der Wert einer bisher kursierenden Münze
verändert worden ist. Dergleichen S. finden sich schon auf den
Münzen der alten Griechen und Römer. In Frankreich wurden
früher bei jedem Regierungswechsel die Münzen
gestempelt.
Stenamma, s. Ameisen, S. 452.
Stenay (spr. stönä), Stadt im franz.
Departement Maas, Arrondissement Montmédy, an der Maas und
der Eisenbahn Sedan-Verdun, mit Eisenhütte und (1881) 2794
Einw.
Stenbock, Magnus, Graf, schwed. Feldmarschall, geb. 12.
Mai 1664 zu Stockholm, studierte in Upsala, trat dann in
holländische Dienste und focht seit 1688 unter dem Markgrafen
von Baden und dem Grafen Waldeck mit Auszeichnung am Rhein. Nachdem
er 1697 als Oberst eines deutschen Regiments in die Dienste seines
Vaterlandes getreten, begleitete er Karl XII. auf dessen meisten
Feldzügen und wirkte namentlich bei Narwa bedeutend zum Sieg
mit. 1707 wurde er zum Statthalter von Schonen ernannt; als
Friedrich IV. von Dänemark 1709 in Schonen landete, siegte S.,
von der Regentschaft jenem entgegengestellt, 28. Febr. 1710 bei
Helsingborg, setzte 1712 nach Pommern über und schlug die
Dänen 20. Dez. d. J. bei Gadebusch, wendete sich hierauf nach
Holstein, wo er 9. Jan. 1713 Altona in Asche legen ließ,
mußte sich aber 6. Mai bei Tönning, von den
dänischen, russischen und sächsischen Truppen
eingeschlossen, mit 12,000 Mann kriegsgefangen ergeben und ward
nach Kopenhagen gebracht, wo er 23. Febr. 1717 im Kerker starb.
Seine "Mémoires" erschienen Frankfurt 1745; seine Biographie
gab Laenborn heraus (Stockh. 1757-65, 4 Bde.).
Stendal, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk
Magdeburg, an der Uchte, Knotenpunkt der Linien
Leipzig-Wittenberge, Berlin-Lehrte und S.-Langwedel der
Preußischen Staatsbahn sowie der Eisenbahn
S.-Tangermünde, 33 m ü. M., ist die ehemalige Hauptstadt
der Altmark, hat 5 evang. Kirchen (darunter die spätgotische
Domkirche), eine kath. Kirche, eine Synagoge, 2 alte interessante
Stadtthore, schöne Anlagen an Stelle der alten Festungswerke,
eine Rolandsäule, ein Denkmal des hier gebornen
Archäologen Winckelmann (von K. Wichmann), ein
öffentliches Schlachthaus und (1885) mit der Garnison (1 Reg.
Husaren Nr.10) 16,184 meist evang. Einwohner, die Wollspinnerei,
Tuch-, Öfen-, Maschinen- u. Goldleistenfabrikation,
Kunstgärtnerei, Bierbrauerei etc. betreiben. Auch befindet
sich hier eine Eisenbahnhauptwerkstatt und werden Pferde-, Vieh- u.
Getreidemärkte abgehalten. S. hat ein Landgericht, ein
Hauptsteueramt, ein Gymnasium, ein Johanniterkrankenhaus etc. Zum
Landgerichtsbezirk S. gehören die 16 Amtsgerichte zu Arendsee,
Beetzendorf, Bismark, Gardelegen, Genthin, Jerichow, Kalbe a. M.,
Klötze, Öbisfelde, Österburg, Salzwedel, Sandau,
Seehausen i. A., S., Tangermünde und Weferlingen. - S. ward
1151 von Albrecht dem Bären gegründet, erhielt, wie die
meisten Städte im Slawenland, das Magdeburger Recht und gewann
unter den folgenden Markgrafen mancherlei Privilegien, so 1215 die
Befreiung vom Gericht des Burggrafen, obwohl es mit der ganzen
Nordmark 1196 unter die Lehnshoheit des Erzstifts Magdeburg geraten
war. Bei der Teilung der Mark unter die Brüder Johann I. und
Otto IV. 1258 ward S. Sitz der ältern (Stendalschen) Linie des
Hauses Askanien, die 1320 mit Heinrich von Landsberg erlosch.
Damals war S. eine der bedeutendsten Städte der Mark, trat
auch der Hansa bei und stand im 15. Jahrh. an der Spitze eines
Bundes der Städte der Altmark. 1530 fand hier die evangelische
Lehre Eingang, wurde aber von Joachim I. mit Gewalt
unterdrückt; erst unter Joachim II. wurde dann die Reformation
in S. durchgeführt. Vgl. Götze, Urkundliche Geschichte
der Stadt S. (Stend. 1871).
^[Wappen von Stendal.]
Stendhal (spr. stangdall), Pseudonym, s. Beyle.
Stenge, auf größern Schiffen die erste
Verlängerung des Mastes über dem Mars, mittels des sogen.
Eselshaupts, eines starken Blocks von hartem Holz, mit dem
Untermast verbunden; s. Takelung.
Stengel (Caulis, Kaulom, Stamm, Achse), eins der
morphologischen Grundorgane der Pflanzen, in der Fähigkeit
dauernder Verjüngung an seiner Spitze mit der Wurzel
übereinstimmend, aber durch den Besitz von Blättern
wesentlich verschieden. Man beschränkt gewöhnlich das
Vorkommen des Stengels im Pflanzenreich auf die deshalb so
genannten stammbildenden Pflanzen (Kormophyten), welche, alle
Gewächse von den Moosen an aufwärts umfassend, den
Thallophyten gegenübergestellt sind, denen man den S.
abspricht und einen Thallus beilegt.
Der S. ist an den Seiten immer mit Blättern besetzt; beim
sogen. blattlosen S. sind in Wahrheit die Blätter entweder nur
auf ganz unscheinbare Rudimente reduziert, oder umfassen ihn als
bloße Scheiden nur am Grund, oder der vermeintlich blattlose
S. ist nur das zu ungewöhnlicher Länge gestreckte
Zwischenstück zwischen je zwei einander folgenden
Blättern. Die Stellen des Stengels, an welchen ein Blatt
sitzt, die Knoten (nodus), sind nicht selten durch eine
knotenartige Verdickung und oft auch durch andre anatomische
Beschaffenheit ausgezeichnet, insbesondere bei hohlen Stengeln mit
Mark erfüllt. Das zwischen je zwei aufeinander folgenden
Knoten liegende Stück heißt Stengelglied (Internodium).
Das aus dem Blatt in den S. übertretende
Gefäßbündel wird als Blattspur bezeichnet. Die im
jugendlichen Zustand an der Stengelspitze dicht
zusammengedrängten Blätterrücken erst bei der
weitern Ausbildung in der Regel mehr auseinander, indem die
Stengelglieder sich strecken. Bei Stengeln, deren Internodien
unentwickelt bleiben, stehen alle Laubblätter unmittelbar
über der Wurzel und heißen deshalb Wurzel- oder
Grundblätter, während man solche Pflanzen ungenau
stengellose Pflanzen (plantae acaules) nennt. Auch die Knospen, die
Köpfchen, die Blüten sind Beispiele für S. mit
verkürzten Internodien. Einen sehr hohen Grad erreicht die
Streckung der Stengelglieder z. B. bei den Pflanzen mit windenden
Stengeln, bei den fadendünnen Ausläufern und beim Schaft
(scapus), welcher ein einziges, ungemein gestrecktes Internodium
eines aus der Achsel
287
Stengel (botanisch).
von Wurzelblättern entspringenden, eine Blüte oder
einen Blütenstand tragenden Sprosses darstellt.
Der S. ist in Bezug auf seine Seitenorgane (Blätter, Haare)
das Primäre; jene entstehen erst auf diesem. Wenn man die in
der Fortbildung begriffene Spitze des Stengels der Länge nach
durchschneidet, so sieht man, daß der S. in eine halbkugel-
bis schlank kegelförmige Kuppe endigt (Fig. 1), auf deren
Oberfläche noch keinerlei seitliche Organe vorhanden sind.
Dieser Vegetationspunkt (punctum vegetationis) bewirkt durch seine
zellenbildende Thätigkeit die Fortbildung des Stengels in die
Länge. Erst ein mehr oder minder großes Stück
unterhalb des Scheitels (Fig. 1 ss) desselben zeigen sich auf
seiner Oberfläche sanfte Höcker, die wir, nach
rückwärts verfolgend, bald in größere Gebilde
übergehen sehen und als die ersten Anlagen der Blätter
erkennen. Die ganze fortbildungsfähige Spitze eines Stengels
samt den daran sitzenden, den Vegetationspunkt bedeckenden jungen
Blättern (Fig. 1 pb) nennt man Knospe (s. d.). Der
Vegetationspunkt ist aus lauter gleichartigen, sehr kleinen,
polyedrischen, dünnwandigen, reichlich mit Protoplasma
erfüllten, sämtlich in Teilung begriffenen Zellen
zusammengesetzt, welche das sogen. Urparenchym oder -Meristem
darstellen, aus welchem allmählich die Gewebe (Fig. 1 m) durch
entsprechende Ausbildung der Zellen hervorgehen. Bei den
Gefäßkryptogamen und einigen Phanerogamen gibt es im
Scheitel des Vegetationspunkts eine Scheitelzelle, welche durch
regelmäßige Teilungen stetig Zellen bildet, und von
welcher alle Zellen des Meristems und somit des ganzen Stengels
abstammen. Bei andern Phanerogamen bilden sich dagegen im
Vegetationspunkt gewisse Gewebe selbständig und
unabhängig voneinander fort, so daß keine Scheitelzelle
anzunehmen ist.
Bei den meisten Pflanzen verzweigt sich der S., d. h. er erzeugt
an seiner Seite neue Vegetationspunkte, die sich fortentwickeln zu
einer neuen, der ersten gleichen und am Grund mit ihr
zusammenhängenden Achse, welche in Bezug auf jene den Zweig
oder Ast (ramus) bildet. Bei der normalen Verzweigung des Stengels
bilden sich die Vegetationspunkte der Zweige frühzeitig, schon
in der Nähe der Spitze des Stengels und meist in
regelmäßiger Stellung. Von dieser Verzweigung, auf
welcher hauptsächlich die Architektonik der ganzen Pflanze
beruht, muß man diejenigen Zweige unterscheiden, welche aus
Adventivknospen (s. Knospe) hervorgehen, da diese fern von der
Spitze des Stengels, an ältern Teilen, ohne bestimmte Ordnung
und oft durch zufällige äußere Einflüsse
veranlaßt entstehen. Bei jeder normalen Verzweigung treten
die neuen Vegetationspunkte meist in der Achsel der Blätter
auf, und zwar an der Oberfläche des Stengels (Fig. 1 k). Daher
ist die Stellung der Zweige von der Blattstellung abhängig und
zeigt dieselbe Regelmäßigkeit wie diese. Indessen
erzeugen meist nicht alle Blätter in ihrer Achsel eine Knospe,
und noch weniger oft bilden sich alle angelegten Knospen zu
wirklichen Zweigen aus. Die Verzweigung des Stengels erfordert die
Unterscheidung von Hauptachse und Seiten- oder Nebenachsen oder, da
man jede einzelne Achse samt allen ihren Blättern Sproß
nennt, von Haupt- und Seitensprossen. Insofern aber die Nebenachsen
sich abermals verzweigen u. s. f., spricht man von Nebenachsen
erster, zweiter etc. Ordnung. Nach dem Ursprung der Achsen und nach
dem Grad ihrer Erstarkung unterscheidet man folgende Arten der
Verzweigung: 1) Wenn die Hauptachse in gleicher Richtung sich
fortbildet und stärker bleibt als alle ihre Nebenachsen, so
nennt man ein solches Verzweigungssystem monopodial oder ein
Monopodium; es ist die gewöhnlichste Form. 2) Wenn der S. aber
an einem Punkt endigt und daselbst in zwei ihm und einander nahezu
gleich starke, in der Richtung divergierende Zweige sich teilt, so
heißt er gabelig verzweigt oder dichotom (cauli dichotomus),
die Verzweigungsform Dichotomie. Dieses Verhältnis kann auf
dreierlei Weise zu stande kommen. Entweder beruht es nur auf einer
Modifikation der monopodialen Verzweigung und wird dann falsche
Dichotomie genannt, wenn nämlich eine Nebenachse sich ebenso
stark entwickelt wie die Hauptachse und die letztere in ihrer
Richtung etwas zur Seite drängt (Fig. 2 C, wo aaa die
Hauptachse, bb die Nebenachsen), oder wenn unter der Spitze der
Hauptachse, deren Gipfelknospe entweder sich nicht ausbildet, oder
welche durch eine Blüte abgeschlossen ist, zwei
gegenüberstehende Seitensprosse sich entwickeln und in
demselben Grad wie der Hauptsproß erstarken (Fig. 2 B,
Mistel). Oder aber es liegt eine echte Dichotomie vor, ein seltener
bei den Selaginellen und Lykopodiaceen vorkommender Fall, der gar
nicht auf der Bildung von Nebenachsen, sondern darauf beruht,
daß das Wachstum am Scheitel des
288
Stengelbrand - Stenograph.
Stengels in der bisherigen Richtung aufhört und daneben in
zwei divergierenden Richtungen sich fortsetzt, indem der
Vegetationspunkt selbst in zwei neue sich teilt (Fig. 2 A,
Bärlapp). 3) Die Scheinachse (sympodium), wenn der S. in
seiner Fortbildung an der Spitze unterbrochen wird, dafür aber
die der Spitze nächste Seitenachse das Wachstum in gleicher
Richtung fortsetzt und dies nach einem oder einer Reihe von
Internodien sich wiederholt (Fig. 2 D, wo a die Hauptachse, bb' die
aufeinander folgenden Nebenachsen), so daß der scheinbar
Einer Achse angehörige Sproß aus successiven Nebenachsen
verschiedenen Grades zusammengesetzt ist.
Der Grad der Verzweigung und die Ausbildungsform der einzelnen
Sprosse, die Sproßfolge, beginnen in ihrer Entwickelung bei
phanerogamen Pflanzen an dem Keimling. Das Stengelchen desselben
erwächst zur Hauptachse. In seltenen Fällen
schließt schon diese mit einer Blüte ab, und der S. kann
dabei einfach bleiben, so daß die Pflanze nur aus einer
einzigen Achse besteht und als einachsige bezeichnet wird.
Zweiachsige Pflanzen sind dagegen diejenigen, bei denen erst an den
Nebenachsen erster Ordnung Blütenentwickelung eintritt, also
z. B. wenn die Hauptachse aufrecht steht und Laubblätter
trägt, aus deren Achseln Blütenstiele entspringen, oder
an der Spitze zu einer Traube, Dolde oder Ähre wird, denn auch
jede Blüte dieser Infloreszenzen ist ein Sproß für
sich; aber auch der Fall gehört hierher, wo die Hauptachse
unterirdisch als Rhizom wächst und einfache Nebenachsen
über den Boden treibt, die mit einer einzelnen Blüte
abschließen, wie z. B. bei Paris quadrifolia. Man kann
hiernach leicht selbst finden, was unter drei-, vierachsigen etc.
Pflanzen zu verstehen ist. Sehr häufig sind bei mehrachsigen
Pflanzen die successiven Achsen nicht bloß dem Grad nach,
sondern auch hinsichtlich der Ausbildung der Blätter, die sie
tragen, voneinander unterschieden. Durch die Metamorphose der
Blätter werden nämlich bei fast allen Phanerogamen
bestimmte Blattformationen bedingt, die man als Nieder-, Laub- u.
Hochblätter charakterisiert (s. Blatt, S. 1016), und nach
deren Auftreten am S. man eine Niederblattregion, Laubblattregion
und Hochblattregion zu unterscheiden hat. Bei einachsigen Pflanzen
folgen diese drei Regionen an Einer Achse aufeinander, bei
mehrachsigen sind sie in der Regel auf die einzelnen Achsen
verteilt, so daß man diese selbst als Niederblattstengel etc.
unterscheiden kann. Diese Verhältnisse, von denen
hauptsächlich mit das äußere Ansehen (Habitus) der
Pflanze abhängt, zeigen wiederum große
Mannigfaltigkeiten.
Für die S. gewisser Pflanzen sind besondere Namen
üblich. Bei den Kräutern redet man schlechthin vom S.
oder Krautstengel, bei den grasartigen Monokotyledonen wird er Halm
(culmus) genannt. Der hohe, meist einfache, an der Spitze mit einer
einzigen großen Gipfelknospe endigende S. der Palmen und
Baumfarne heißt Stock (caudex). Der holzige, lang dauernde,
in Äste und Zweige sich teilende S. der Dikotyledonen und
Nadelhölzer wird Stamm (truncus) genannt (vgl. Baum).
Abweichende, für besondere Lebenszwecke eingerichtete
Stengelformen sind die Knollen, Ranken und Dornen (s. d.). Bei
manchen Pflanzen ist der S. fleischig verdickt und dann knollig,
wie bei dem Kohlrabi (Fig. 3), nahezu kugelig, wie bei Melocactus
(Fig. 4), aus ovalen, zusammengedrückten Gliedern
zusammengesetzt, wie bei den Opuntien (Fig. 5). Ja, es gibt auch
S., welche der Gestalt nach mit Blättern übereinstimmen,
wie z. B. die Zweige von Ruscus aculeatus (Fig. 6), welche
flächenartig ausgebreitet sind und ein beschränktes
Längenwachstum besitzen, daher sie eine begrenzte
blattähnliche Form haben. Solche Blattzweige (phyllocladia)
unterscheiden sich von wahren Blättern leicht dadurch,
daß sie aus den Achseln kleiner, schuppenförmiger
Blätter entspringen und auf ihrer Fläche selbst kleine
Blättchen tragen, aus deren Achsel sie eine Blüte
hervorbringen. Über den innern Bau des Stengels vgl. die
Artikel Gefäßbündel, Holz, Rinde, Kambium.
^[Fig. 5. Stengel von Opuutia.]
^[Fig. 6. Phyllokladien von Ruscus aculeatus.]
^[Fig 3. Kohlrabi.]
^[Fig. 4. Stengel von Melocactus.]
Stengelbrand, s. Brandpilze III.
Stengelgläser, venezian. Gläser mit
dünnem, stengelartigem Fuß (s. Tafel
"Glaskunstindustrie", Fig. 8).
Stenochromie (griech.), Verfahren gleichzeitigen Druckes
einer beliebigen Anzahl von Farben, dessen Erfindung von Radde in
Hamburg und von dessen Kompagnon Greth beansprucht wird. Aus eigens
präparierten Farbentäfelchen werden der zu bedruckenden
Bildfläche entsprechende Teile mittels der Laubsäge
herausgeschnitten, welche man, gleich den Teilen der
Zusammensetzspiele der Kinder, sodann zu einer Platte vereinigt, in
eine besonders konstruierte Presse bringt, wo der Druck mit
chemisch gefeuchtetem Papier derart erfolgt, daß das Papier
die zur Herstellung des Bildes erforderliche Farbenschicht von der
Farbenplatte aufsaugt. Wird über solcherweise erzeugte Grund-
oder Tonplatten eine denselben entsprechende, das Bild selbst als
photographisches Positiv tragende Gelatinehaut gelegt, so
können damit überraschend schöne Resultate erzielt
werden.
Stenograph (griech.), im weitern Sinn jeder, der sich ein
System der Stenographie (s. d.) zu eigen
289
Stenographie (Wesen und Zweck).
gemacht hat; im engern einer, dessen Beruf das
geschwindschriftliche Aufnehmen von Reden u. dgl. ist.
Stenographie (griech., "Engschrift", auch Tachygraphie,
"Schnellschrift", engl. Shorthand. "Kurzhand", deutsch am
treffendsten Kurzschrift genannt), eine Schriftart, welche
vermittelst eines einfachen, von den gewöhnlichen Buchstaben
abweichenden Alphabets, ferner durch eigne Grundsätze
über deren Zusammenfügung und meist auch durch
Aufstellung besonderer Kürzungen zu ihrer Ausführung nur
ein Viertel der sonst nötigen Zeit erfordert und dazu bestimmt
ist, bei schreiblicher Thätigkeit als zeitersparendes
Erleichterungsmittel verwandt zu werden. Da die S. nicht
beabsichtigt, die gewöhnliche Schrift zu verdrängen,
sondern nur neben derselben hergehen will, so nimmt sie in der
Lautbezeichnung hauptsächlich die gangbare Schrift zum
Vorbild; doch werden auch aus orthographischen Vereinfachungen
Kürzungsvorteile gern benutzt. Phonetische Stenographien (s.
Phonographie), wie sie in England (s. Pitman) und Frankreich (s.
Duployé) vorhanden sind, lassen sich in Deutschland bei dem
Mangel einer Behörde zur Entscheidung über die
Richtigkeit der provinziell verschiedenen Aussprache gewisser Laute
vorläufig nicht durchführen. Hinsichtlich der
Zeichenauswahl für das Alphabet unterscheidet man zwei Arten
von Systemen der S.: geometrische, d. h. solche, welche nur die
einfachsten geometrischen Elemente (Punkt, gerade Linie, Kreis und
Kreisteile) verwenden, und graphische, d. h. solche, die ihre
Zeichen aus Teilen der gewöhnlichen Buchstaben bilden und
dadurch im Gegensatz zu den erstern geläufige, der Richtung
der schreibenden Hand entsprechende Züge erzielen.
Geometrische wie graphische Systeme vervielfältigen die
geringe Menge der verfügbaren Urzeichen durch allerhand
Auskunftsmittel, wie Höhenwert, Neigungswert, Stellenwert,
Schattierungswert etc., die zur Erreichung der verschiedensten
Zwecke benutzt werden. An einer Klassifikation der Systeme nach
diesen Gesichtspunkten mangelt es noch vollständig. Zu der
graphischen Art gehören außer der altrömischen
Tachygraphie fast nur die modernen deutschen Systeme und deren
Übertragungen, während die übrigen meist auf
geometrischer Grundlage beruhen. In den Regeln über die
Zeichenzusammenfügung herrscht außerordentliche
Mannigfaltigkeit. Das Gleiche gilt von den Kürzungsregeln,
doch ist fast allen Systemen gemeinsam die Anwendung von Siglen (s.
d.). Schreibkürzungsmethoden, welche sich der
gewöhnlichen Buchstaben, allenfalls mit einigen Signaturen,
bedienen, fallen, auch wenn sie die angegebene Kürze erreichen
sollten, nicht unter den Begriff der S., ebensowenig Systeme,
welche zwar eigne Zeichen verwenden, aber hinter dem Maß von
ein Viertel der sonstigen Schreibzeit erheblich zurückbleiben.
Die Veranlagung, schnelle Reden wörtlich nachzuschreiben,
gehört nicht zu den Bedingnissen einer S., obgleich die
meisten Systeme dazu befähigen oder wenigstens sich dessen
rühmen. Oft aber ist es dieses Bedürfnis, Reden
nachzuschreiben, gewesen, welches den Anstoß zur Aufstellung
einer Kurzschrift gegeben hat. Daher sehen die ersten Systeme mehr
auf Kürze als auf genügende Bürgschaft für
richtiges Wiederlesen des Geschriebenen. Sobald die S. die engen
Grenzen der Redezeichenschrift verläßt, um ihre
umfassendere und höhere Bestimmung zu erfüllen, muß
das Streben nach Kürze durch die Rücksicht auf
Deutlichkeit, Zuverlässigkeit, Lesbarkeit und
Formenschönheit eingeschränkt werden; auch darf die Zeit
und Mühe, welche zur Erlernung eines solchen mechanischen
Erleichterungsmittels aufgewandt wird, nicht zu groß sein
oder gar den Charakter eines förmlichen Studiums annehmen. Je
mehr ein System bei theoretischer Konsequenz und ästhetischem
Äußern Zuverlässigkeit mit Kürze vereinigt,
ohne an leichter Erlernbarkeit zu verlieren, desto höher steht
es an Brauchbarkeit und Güte. Denn die S. ist für alle
bestimmt, welche viel zu schreiben oder Geschriebenes zu lesen
haben, nicht bloß für Gelehrte, Schriftsteller,
höhere Beamte, Kaufleute, Studenten, Gymnasiasten etc.,
sondern auch für Subalternbeamte, Sekretäre, Kanzlisten,
Schreiber, Schriftsetzer etc., bei deren gegenseitigem
Zusammenwirken (ein einheitliches Stenographiesystem vorausgesetzt)
sie erst ihren vollen Wert zeigen kann. Als rein mechanisches
Hilfsmittel für so verschiedene zum Teil wenig gebildete
Kreise besitzt die S. keinerlei Anrecht auf die Bezeichnungen
"Wissenschaft" oder "Kunst"; höchstens im uneigentlichen Sinn,
wie man von Buchdrucker- oder Schreibkunst spricht, könnte die
S. eine Kunst heißen. Aus der Verwertung
sprachlich-etymologischer und lautlich-physiologischer
Forschungsergebnisse vermag die Kurzschrift wohl Vorteile zu
ziehen, aber nur Schwärmer reden von hoher
Wissenschaftlichkeit und zahlreichen bildenden Elementen der S. Die
Kurzschrift hat ihren wissenschaftlichen Gehalt in der Konsequenz,
in rationeller Ökonomie und einem systematischen Aufbau zu
suchen; ihre wissenschaftliche Bedeutung liegt in den Diensten, die
sie der Wissenschaft leistet. Eine kritisch-forschende
Beschäftigung mit Geschichte, Wesen und Wert der S. ist
dagegen sehr wohl als wissenschaftliche Thätigkeit zu denken.
Zur Ausübung der redennachschreibenden Praxis bedarf es neben
stenographischer Virtuosität insbesondere scharfer Sinne,
schneller Auffassung und fester Nerven. Wissenschaftliche Bildung
ist dafür nicht durchaus erforderlich, indessen gewährt
dieselbe größere Bürgschaft für
zuverlässige und von Verständnis getragene Leistungen;
darum verlangt gewöhnlich der Staat von seinen amtlichen
Stenographen außer der technischen Fertigkeit bestimmte
Bildungsnachweise. In den größern deutschen Staaten und
in Österreich werden z. B. fast nur akademisch gebildete
Männer als Kammerstenographen zugelassen. Gegenwärtig
dient die S. ihrem umfassendern, höhern Zweck umfänglich
in Großbritannien, einem Teil des englisch sprechenden
Nordamerika, in Frankreich, Deutschland, der Schweiz,
Österreich-Ungarn und langsam beginnend auch in Italien; in
den übrigen europäischen und einigen überseeischen
Ländern erfährt sie fast nur in dem beschränkten
Sinn Anwendung zum Nachschreiben von Reden. Die Pflege der
Kurzschrift ruht zumeist in den Händen der stenographischen
Vereine, die zuerst in England aufgekommen sind. Ebenda entstand
1842 die stenographische Presse, welche jetzt über fast 150
Fachzeitschriften verfügt. Versuche zur Aufstellung einer
stenographischen Tonschrift an Stelle des gewöhnlichen
Notensystems sind von einigen Franzosen, Deutschen und
Engländern gemacht worden, haben aber eine praktische
Verwertung ebensowenig gefunden wie die Entwürfe zu
"Blindenstenographien". Vgl. Steinbrink, Über den Begriff der
Wissenschaftlichkeit auf dem Gebiet der S. (Berl. 1879); Hasemann,
Prüfung der wichtigsten Kurzschriften (Trarbach 1883);
Morgenstern, Wissenschaftliche Grundsätze zur Beurteilung
stenographischer Systeme (im "Magazin für S." 1884); Brauns,
Welche Anforderungen sind an eine Schulkurzschrift zu stellen?
(Hamb. 1888); Hüeblin, Stimmen über die Bedeutung der S.
(Wetzikon 1888).
290
Stenographie (Geschichtliches, Verbreitung).
Geschichtliches. Verbreitung.
Den ersten Ansatz zu einer S. finden wir in Griechenland. Eine
Marmorinschrift von etwa 350 v. Chr., welche vor wenigen Jahren auf
der Akropolis von Athen ausgegraben ward und im dortigen
Zentralmuseum aufgestellt ist, gibt Anweisungen einer
gekürzten Schriftart, mit welcher allerdings nur die
Hälfte der Zeit erspart wird. Der frühsten Erwähnung
einer griechischen S. begegnet man erst ums Jahr 164 n. Chr. bei
Galenos. Aus Zeugniffen späterer Schriftsteller geht hervor,
daß die wörtliche Aufnahme einer griechischen Rede durch
S. möglich war. Von der Beschaffenheit des dabei angewendeten
Systems können wir uns keine rechte Vorstellung bilden, denn
die Schriftproben, welche unter dem Namen griechische Tachygraphie
gehen, repräsentieren nur eine ganz späte und entartete
Gestalt, in der das System an Kürze sich wenig über die
gewohnliche griechische Schrift erhebt und nicht mehr S., sondern
nur noch Geheimschrift ist. Vgl. Gomperz, Über ein
griechisches Schriftsystem aus der Mitte des 4. vorchristlichen
Jahrhunderts (Wien 1884); Mitzschke, Eine griechische Kurzschrift
aus dem 4. vorchristlichen Jahrhundert (Leipz. 1885); Gitlbauer,
Überreste griechischer Tachygraphie im "Codex Vaticanus
graecus 1809" (Wien 1878); Wessely, Wiener Papyrus Nr. 26 und die
Überreste griechischer Tachygraphie in den Papyri von Wien,
Paris und Leiden (in den "Wiener Studien" 1881, Bd. 3, S. 1-21);
Rueß, Über griechische Tachygraphie (Neuburg a. D.
1882). Reichlicher fließen die Quellen über die
altrömische S., deren Wesen und Geschichte vom Beginn bis zum
Untergang sich verfolgen läßt. Nach ihrem Erfinder Tiro
führt diese Kurzschrift den Namen Tironische Noten (weiteres
s. Tiro). Aus dem Mittelalter verdient nur hervorgehoben zu werden,
daß ein Mönch, Johannes von Tilbury, den Versuch machte,
durch eine Nova notaria die Tironischen Noten zu ersetzen (vgl.
Rose, Ars notaria, im "Hermes", Bd. 8, S. 303 ff.). Die Nation, bei
welcher die Kurzschrift in neuer Zeit zuerst wieder erwachte, und
von wo der zündende Funke fast in alle Länder Europas und
über den Ozean übersprang, war die englische. Die
frühsten Spuren stenographischer Systeme zeigen sich in
England schon zu Ende des 16. Jahrh. in den Schriften von Bright
und Bales. Der erste aber, der hier von Bedeutung ward, ist John
Willis ("The art of stenography, or short-writing", Lond. 1602).
Von diesem Anfangspunkt an bis zur jüngsten Vergangenheit ist
das stenographische Schrifttum Englands ein außerordentlich
fruchtbares gewesen. Als besonders hervorragend sind zu nennen
Samuel Taylors "Essay intended to establish a standard for an
universal system of stenography" (Lond. 1786), wovon
Übertragungen auf viele andre europäische Sprachen
gemacht wurden, und Isaak Pitmans "Phonographie" (1837). Dieselbe
hat nach dem Taylorschen System die weiteste Verbreitung und
praktische Verwertung unter den Volksstämmen englischer Zunge
gefunden (näheres s. Pitman). In Frankreich blieben die ersten
von Cossard 1651 und dem Schotten Ramsay 1681 veröffentlichten
Systeme ohne Erfolg. Erst einer von Bertin verfaßten
Übertragung des Taylorschen Systems, die 1792 unter dem Titel:
"Système universel et complet de sténographie"
erschien, gelang es, Anerkennung und praktische Verwendung zu
finden. Noch heute besitzt dieselbe namentlich in den
Überarbeitungen von Prévost und Delaunay in den
franzöfischen und belgischen Kammern als Redezeichenkunst das
Übergewicht, auch sonst einige Verbreitung im täglichen
Schriftverkehr und eine Zeitschrift zur Vertretung ihrer
Interefsen. Hinsichtlich der allgemeinen Ausbreitung und Benutzung
bei schriftlichen Arbeiten hat aber neuerdings die S.
Duployé (s. d.) alle andern französischen Methoden weit
überflügelt. In Italien ist der erste nachweisbare
Versuch, zu einer Kurzschrift zu gelangen, der von Molina 1797. Ihm
folgte eine von Amanti 1809 bewirkte Übertragung des
Taylorschen Systems ("Sistema universale e completo di
stenografia"), die mit einigen Modifikationen beim italienischen
Parlament Verwendung findet, sonst aber hinter einer von Noe
bewirkten Übertragung der deutschen Redezeichenkunst von
Gabelsberger zurücktritt, welche bereits anfängt, in
weitern Kreisen als Gebrauchsschrift sich Geltung zu verschaffen
("Manuale di stenografia italiana", 9. Aufl., Dresd. 1887). In
Spanien war es Marti, der, auf englischen Grundlagen bauend, durch
seine "Tachigrafia castellana" (Madr. 1803) die Kurzschrift in
seinem Vaterland einbürgerte und eine Stenographenschule
gründete, deren Anhänger auch in Mexiko, Carácas,
Buenos Ayres als Schnellschreiber der dortigen Gesetzgebenden
Körper thätig sind. Ihr ist in neuester Zeit die
"Taquigrafia sistematica" (Barcel. 1864) des Garriga y Marill mit
Erfolg an die Seite getreten; ein thätiger und tüchtiger
Verein in Barcelona wirkt für dieses System. Ein Sohn des
vorgenannten Marti führte seines Vaters System, indem er es
auf das Portugiesische übertrug, in Portugal ein ("Tachigrafia
portugueza", Lissab. 1828). In Brasilien kommt ein nach
englisch-französischen Mustern von Pereira da Silva Velho
geschaffenes System (Rio de Jan. 1844) im Parlament zur Verwendung.
In Rumänien tauchte die Kurzschrift 1848 auf, als Rosetti die
Taylorsche S. seiner Muttersprache anzupassen suchte. Von einigem
Erfolg begleitet war erst Winterhalders 1861 bewirkte
Übertragung des französischen Systems von Tondeur. Auch
in Schweden, Norwegen, Dänemark, den Niederlanden,
Rußland, Polen, Böhmen und den übrigen slawischen
Ländern, Ungarn, Finnland, der Türkei, Griechenland,
Armenien, Madagaskar, Japan trägt die S. das Gepräge
fremder Herkunft. Es gibt in diesen Ländern keine
national-eigentümlichen Stenographien, sondern nur
Übertragungen ausländischer Methoden, besonders der
deutschen von Gabelsberger und Stolze oder
englisch-französischer. Erst 1888 hat sich bei den Tschechen
eine Richtung auf Nationalisierung der S. bemerkbar gemacht. Auch
auf Schleyers Volapük sind schon mehrere Systeme der S.
übertragen worden. In Deutschland begegnen uns
merkwürdige Beispiele großer Schreibgeschwindigkeit
während der Reformationszeit, wo Luthers Freunde und Gehilfen
(Cruciger, Dietrich und Röhrer) Predigten, Reden,
Verhandlungen u. dgl. wörtlich nachgeschrieben haben sollen.
Da jedoch nähere Angaben nicht erhalten sind, muß es
unentschieden bleiben, welcher Hilfsmittel sich diese Männer
bedient haben. Der Versuch des Schotten Ramsay, 1679 das englische
System von Shelton in Deutschland einzuführen, blieb ohne
Erfolg. Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts lenkte Buschendorf in
seinem "Journal für Fabrik, Manufaktur etc." 1796 die
Aufmerksamkeit der Deutschen auf die stenographischen Systeme
Englands und Frankreichs und wies auf die Wichtigkeit dieser
Kunstfertigkeit hin. Noch in demselben Jahr erschienen Mosengeils
"Anleitung zur S. nach Tay-
291
Stenographiermaschine - Stenotelegraph.
lor" und 1797 Horstigs "Erleichterte deutsche S.", beide ebenso
wie das vom Hauptmann Danzer in Wien 1800 veröffentlichte
"Allgemeine System der S. des Herrn Sam. Taylor" nach englischem
Muster gearbeitet. Seit jener Zeit ist in Deutschland eine
außerordentlich große Anzahl stenographischer Systeme
aufgetaucht, unter denen aber nur die Methoden von Gabelsberger (s.
d., 1834), Stolze (s. d., 1841) und Arends (s. d., 1850) in den
Vordergrund getreten sind. Gabelsberger schuf in seiner
Redezeichenkunst das erste deutsche Nationalsystem und eroberte der
graphischen Richtung das Feld. Stolze hob die S. zur Bedeutung
eines allgemeinen Hilfsmittels, brachte strengere Grundsätze
zur Anwendung und belebte den früher toten Bindestrich. Arends
ist darüber nicht hinausgekommen. Die Pflege dieser drei
Hauptsysteme nebst Übertragungen stellt sich nach der neuesten
Statistik folgendermaßen:
Gabelsberger 660 Vereine mit 17000 Mitgliedern,
Stolze 450 - - 10500
Arends 120 - - 2600
Erst in neuester Zeit hat der stenographische Gedanke wieder
eine wirkliche Förderung erfahren durch Brauns, der in seinem
"Entwurf eines Schulkurzschriftsystems" (Hamb. 1888) auf Grund
eingehender Untersuchungen über die Häufigkeit der
Lautgruppen einerseits und die Schreibflüchtigkeit der
verfügbaren Zeichen anderseits die Bahnen für eine
rationelle Ökonomie in der Kurzschrift vorgezeichnet hat.
Diejenigen Systeme der S., welche in der Zwischenzeit
veröffentlicht worden sind, haben wohl diesen oder jenen neuen
Einzelvorteil sich zu nutze gemacht, für den
Allgemeinfortschritt der S. aber nichts geleistet. Faulmanns
Phonographie, die zuerst von Braut 1875 herausgegeben ward, hebt
sich durch ihre Einfachheit hervor. Das sogen.
"Dreimännersystem" von Schrey, Johnen und Socin (1888),
gewöhnlich nach dem Hauptautor Schrey allein benannt, versucht
eine Vermittelung zwischen Gabelsberger, Stolze und Faulmann. Durch
Vereine sind folgende kleinere Systeme vertreten:
Roller (1875) 105 1450
Faulmann (1875) 25 1000
Lehmanns "Stenotachygraphie" (1875) 40 860
Schrey (1888) 30 450
Merkes (1880) 15 150
Velten (1876) 10 150
Ganz vereinzelt bestehen auch Vereine nach den Systemen von
Adler (1877), Herzog (1884) und einigen andern, wie denn das
stenographische Vereinswesen in Deutschland, dem gegenwärtigen
Hauptsitz stenographischer Thätigkeit, am meisten entwickelt
ist. Ein regelmäßiger Gedankenaustausch zwischen den
Stenographen aller Länder ist von Großbritannien aus
durch die Einführung internationaler Stenographenkongresse
geschaffen worden. Die erste Zusammenkunft dieser Art fand 1887 in
London statt (vgl. "Transactions of the first international
short-hand congress", Lond. u. Bath 1888). Einen Einblick in acht
bedeutende Systeme der S. gewährt beifolgende Tafel
"Stenographie". Für die umfängliche stenographische
Litteratur besteht bei J. H. Robolsky in Leipzig eine besondere
buchhändlerische Zentralstelle; Bücher von wirklichem
Wert sind seltene Erscheinungen. Vgl. Pitman, A historv of
short-hand (Lond. 1852); Anderson, History of short-hand (das.
1882) ; Rockwell, The teaching, practice and literature of
short-hand (2. Aufl., Washingt. 1885); Scott de Martinville,
Histoire de la sténographie (Par. 1849); Guénin,
Recherches sur l'histoire, la pratique et l'enseignement de la
sténographie (das. 1880); Depoin, Annuaire
sténographique international (das. 1887); Gabelsberger,
Anleitung zur deutschen Redezeichenkunst oder S. (Münch.
1834); Anders, Entwurf einer allgemeinen Geschichte und Litteratur
der S. (Köslin 1855); Erkmann, Geschichte der S. im
Grundriß (Görl.1875); Mitzschke, Beiträge zur
Geschichte der Kurzschrift (Berl. 1876); Zeibig, Geschichte und
Literatur der Geschwindschreibkunst (2. Aufl., Dresd. 1878) ;
Blenck, Die geschichtliche Entwickelung etc. der S. (Berl. 1887);
Krieg, Katechismus der S. (2. Aufl., Leipz. 1888); Moser,
Allgemeine Geschichte der S. (das. 1889, Bd. 1.);
"Panstenographikon" (Dresd. 1869-74); Faulmann, Historische
Grammatik der S. (Wien 1887); Keil und Hödel, Verzeichnis der
stenographischen Litteratur Deutschlands etc. (Leipz. 1880 u.
1888); Westby-Gibson, The bibliography of short-hand (Lond. u. Bath
1887).
Stenographiermaschine, ein neuerdings konstruierter
Apparat, auf gleicher Idee beruhend und von ähnlicher
Einrichtung wie die Schreibmaschine (s. d.), der indessen mit
solcher Schnelligkeit arbeiten soll, daß er gehaltenen Reden
wörtlich zu folgen vermag. Dieses Ziel ist aber unerreichbar,
und die unter dem Namen S. gehenden Apparate sind in der That nur
Schreibmaschinen von größerer Leistungsfähigkeit.
Am meisten hat die S. des Italieners Michela von sich reden
gemacht. Vgl. Petrie, Reporting and transcribing machines (Lond.
1882); Guénin, Les machines à écrire (in Nr. 4
des "Bulletin de l'Association des sténographes de Paris"
vom 1. Febr. 1883). Vgl. Stenotelegraph.
Stenokardie (griech.), Herz- oder Brustkrampf.
Stenokephalen, s. v. w. Dolichokephalen, s.
Menschenrassen, S. 475, und Schädellehre.
Stenopäisch (griech.), Bezeichnung für Brillen
und andre optische Apparate, welche dem Licht nur durch eine enge
Öffnung Zutritt zum Auge gestatten (z. B. zur Verkleinerung
von Zerstreuungskreisen).
Stenops, Lori.
Stenosis (griech.), Verengerung oder auch
Verschließung von Gefäßen oder Kanälen,
wodurch die normale Zirkulation des Inhalts verhindert wird, so z.
B. S. der Herzöffnungen, der Luftröhre etc.
Stenotachygraphie (griech., "Engschnellschrift"), Name
der Kurzschrift von A. Lehmann; s. Stenographie, S. 291.
Stenotelegraph (griech.), von Cassagnes in Paris
angegebener elektromagnetischer Druckapparat für
stenographische Zeichen, der die gewöhnlichen
Telegraphenapparate an Geschwindigkeit weit übertreffen soll.
Als Geber dient der mechanische Stenograph von Michela, welcher
seit 1880 im italienischen Senat benutzt wird (vgl.
Stenographiermaschine). Michela zerlegt die Wörter in ihre
phonetischen Elemente und verwendet zu deren Wiedergabe 20
Schriftzeichen, welche mittels einer Klaviatur auf mechanischem Weg
hervorgebracht werden. Bei Cassagnes ist jede Taste mit einem Pol
einer Linienbatterie verbunden, deren andrer Pol an der Erde liegt,
und zwar sind zwei Batterien vorhanden, welche mit
entgegengesetzten Polen so an den Geber geführt werden,
daß die Polarität von Taste zu Taste wechselt. Die
Tasten stehen mit den Kontaktplatten einer sehr
gleichmäßig wirkenden Verteilerscheibe in Verbindung;
über dieser Scheibe dreht sich eine metallische Bürste,
welche die Leitung in jeder Sekunde mehrmals mit jeder
Kontaktplatte in Berührung bringt. Auf der Empfangsstelle ist
eine gleichartige Verteilerscheibe mit
292
Stenschewo - Stephan.
völlig übereinstimmend sich drehender Bürste
aufgestellt; letztere teilt jeden aus der Leitung kommenden
Stromstoß einem der 20 mit den Kontaktplatten verbundenen
Elektromagnete mit, welcher sodann die Wiedergabe des
entsprechenden Zeichens auf dem Papierstreifen unter Zuhilfenahme
einer Lokalbatterie durch eine einfache Druckvorrichtung
herbeiführt. Nach jeder Zeichengebung tritt ein 21.
Elektromagnet in Thätigkeit, dessen Anker beim Abfallen
mittels eines Sperrrades den Papierstreifen um die Breite eines
Zeichens vorschiebt. Neuerdings hat Cassagnes die Anzahl der
Kontaktplatten in der Verteilerscheibe vergrößert, um
bei jedem Umlauf mehr als ein stenographisches Zeichen
telegraphieren zu können; statt einer einzigen Klaviatur
treten dann 2 oder 3 gleichzeitig in Thätigkeit, wobei auf
jeder Klaviatur ein andres Telegramm übermittelt wird.
Außerdem hat der Erfinder seinen Stenotelegraphen noch zur
automatischen Beförderung eingerichtet, indem er denselben mit
einem mechanischen Lochapparat verbindet und den gelochten Streifen
durch das Laufwerk der Verteilerscheibe hindurchgehen
läßt, wobei eine Anzahl von Kontaktstiften durch die
Löcher des Streifens die zum Abdruck der Schriftzeichen
dienenden Ströme entsenden. Mit diesem Apparat sollen von
Paris aus Versuche auf Entfernungen zwischen 200 und 920 km
angestellt und Leistungen von 12,000-24,000 Wörtern in der
Stunde erreicht worden sein.
Steuschéwo, Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Posen, Kreis Posen (West-), hat eine kath. Kirche und (1885) 1506
Einw.
Stentando (ital.), musikal. Bezeichnung, s. v. w.
hemmend, zögernd. Stentato, s. v. w. ritenuto, aber mit dem
Ausdruck des Gehemmten, Mühevollen; in der Malerei s. v. w.
gezwungen, steif.
Stentor, bei Homer ein Thraker (oder Arkadier) mit
eiserner Stimme, dessen Ruf so laut tönte wie der 50 andrer
Männer; daher Stentorstimme.
Stenzel, Gustav Adolf Harald, deutscher
Geschichtsforscher, geb. 21. März 1792 zu Zerbst, studierte in
Leipzig Theologie und Geschichte, habilitierte sich, nachdem er als
freiwilliger Jäger den Befreiungskrieg von 1813 mitgemacht, zu
Leipzig, 1817 zu Berlin, folgte 1820 einem Ruf als Professor der
Geschichte nach Breslau und ward 1821 Archivar des schlesischen
Provinzialarchivs. 1848 war er Abgeordneter zur deutschen
Nationalversammlung in Frankfurt, später Mitglied der
preußischen Zweiten Kammer. Er starb 2. Jan. 1854. Von seinen
Arbeiten sind hervorzuheben: "Geschichte Deutschlands unter den
fränkischen Kaisern" (Leipz. 1827, 2 Bde.); "Geschichte des
preußischen Staats" (Hamb. u. Gotha 1830-54, 5 Bde.) und
"Geschichte Schlesiens" (Bresl. 1853, Bd. 1). Auch besorgte er die
Herausgabe der "Scriptores rerum silesiacarum" (Bresl. 1835-1851, 5
Bde.) und der "Urkunden zur Geschichte Breslaus im Mittelalter"
(das. 1845).
Stenzler, Adolf Friedrich, namhafter Sanskritist, geb. 9.
Juli 1807 zu Wolgast, studierte 1826-1829 in Greifswald, Berlin und
Bonn orientalische Sprachen, ging, nachdem er 1829 in Berlin
promoviert, nach Paris, wo er die Vorlesungen von Chezy, S. de Sacy
und A. Remusat besuchte, arbeitete dann bis 1833 in der Bibliothek
des East-India House in London und erhielt noch im genannten Jahr
die Professur der orientalischen Sprachen an der Universität
Breslau, wo er bis 1872 zugleich als Kustos und zweiter
Bibliothekar an der Universitätsbibliothek thätig war.
Seine Hauptwerke sind: "Raghuvansa, Kâlidâsae carmen"
(sanskr. u. lat., Lond. 1832); "Kumâra Sambhava,
Kâlidâsae carmen" (sanskr. u. lat., das. 1838);
"Mricchakatika. i. e. Curriculum figlinum, Sûdrakae regis
fabula" (sanskr., Bonn 1847); "Yâjnavalkyas Gesetzbuch"
(sanskr. u. deutsch, Berl. 1849); "Indische Hausregeln" (sanskr u.
deutsch, 1. Teil: "Acvalâyana" . Leipz. 1864-65, 2 Bde.; 2.
Teil: "Pâraskara", das. 1876-78, 2 Bde.); "Elementarbuch der
Sanskritsprache" (Bresl. 1868, 5. Aufl. 1885); "Meghadûta,
der Wolkenbote, Gedicht von Kalidasa" (mit Anmerkungen und
Wörterbuch, das. 1874); "The Institutes of Gautama" (sanskr.,
Lond. 1876); außerdem Abhandlungen in Webers "Indischen
Studien" und in der "Zeitschrift der Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft" (z. B. über die indischen
Gottesurteile, im 9. Band) und Gelegenheitsschriften. S. starb 27.
Febr. 1887 in Breslau.
Stepenitz, rechter Nebenfluß der Elbe im
preuß. Regierungsbezirk Potsdam, entspringt bei Meyenburg,
fließt in südwestlicher Richtung und mündet nach 75
km langem Lauf bei Wittenberge.
Stepenitz (Groß- S.), Flecken im preuß.
Regierungsbezirk Stettin, Kreis Kammin, am Einfluß des
Gubenbachs in das Papenwasser, hat eine evang. Kirche, ein
Amtsgericht, eine Oberförsterei, Sägemühlen,
Fischerei, Dampfschiffahrt nach Stettin und (1885) 1572 Einw.
Stephan, Name von zehn Päpsten: 1) S. I., ein
Römer, folgte 253 Lucius als Bischof von Rom und entschied den
Streit über die Ketzertaufe dahin, daß auch eine solche
gültig sei; er starb 2. Aug. 257, nach der Sage als
Märtyrer, und ward später kanonisiert. Sein Tag ist der
2. August. -
2) S. (II.), gewählt 27. März 752, starb zwei Tage
nach der Wahl; wird daher gewöhnlich nicht gezählt. -
3) S. II. (III.) bestieg den päpstlichen Stuhl 752. Als er
den Kaiser Konstantin Kopronymos gegen den Langobardenkönig
Aistulf, welcher das Exarchat eroberte, vergebens um Schutz
angefleht hatte, rief er die Hilfe des Königs der Franken,
Pippin, an und erhielt 755 von diesem das wiedereroberte Exarchat
nebst der Pentapolis geschenkt, wodurch der Grund zum Kirchenstaat
gelegt ward. S. starb 26. April 757. -
4) S. III. (IV.), ein Sizilier, folgte auf Paul I. nach
Abfetzung des Gegenpapstes Konstantin 768 und bestimmte, daß
keiner, der nicht durch alle niedern Stufen der Geistlichkeit bis
zur Würde eines Kardinaldiakonus gestiegen sei, auf den
päpstlichen Stuhl erhoben werden sollte. Von dem
Langobardenkönig Desiderius bedrängt, suchte er bei den
Frankenkönigen Karl und Karlmann Hilfe. Er starb 772. -
5) S. IV. (V.), erst Diakonus zu Rom, Nachfolger Leos III. seit
816, krönte den Kaiser Ludwig den Frommen; starb 817. -
6) S. V. (VI.), ein Römer, solgte auf Hadrian III. 885,
krönte den Herzog Guido von Spoleto zum Kaiser; starb 891.
-
7) S. VI. (VII.) bestieg 896 den römischen Stuhl,
ließ den ausgegrabenen Leichnam seines Vorgängers
Formosus in den Tiber werfen, wurde aber selbst schon 897 im Kerker
erdrosselt. -
8) S. VII. (VIII.), ein Römer, Nachfolger Leos VI. seit
929, stand ganz unter dem Weiberregiment der Theodora und Marozia;
starb 931. -
9) S. VIII. (IX.), Verwandter des Kaisers Otto, folgte 939 Leo
VII., ward aber von den Römern gefangen gesetzt und starb 942.
-
10) S. IX. (X.) hieß früher Friedrich und war Bruder
des Herzogs Gottfried von Lothringen, ward vom Papst als Gesandter
nach Konstantinopel geschickt, blieb dann als Mönch in Monte
Cassino, ward Kardinal und nach Viktors II. Tod 1057 zum Papst
gewählt. Als solcher stand er ganz unter dem Ein-
293
Stephan (Fürsten) - Stephan (Zuname).
fluß Hildebrands. Er starb bereits 29. März 1058 in
Florenz. Vgl. Wattendorf, Papst S. IX. (Münster 1883).
Stephan, Name mehrerer Fürsten. Bemerkenswert
sind:
1) S. von Blois, König von England, ward nach dem Tod
König Heinrichs I., dessen Schwester Adele seine Mutter war,
1135 von den normännischen Großen an Stelle von
Heinrichs Tochter Mathilde als König anerkannt, wofür er
den Prälaten und Baronen einen umfassenden Freibrief
gewährte. Die Widersetzlichkeit der Großen suchte er
nicht immer mit Erfolg durch vlämische und französische
Söldner niederzuhalten. Mit Schottland kämpfte er
glücklich, als aber 1139 die von der Thronfolge
ausgeschlossene Mathilde in England landete, fiel S. 1141 selbst in
ihre Gewalt, ward 1142 zwar befreit, behauptete sich aber nur unter
fortwährenden Kämpfen im Besitz der Herrschaft und starb
25. Okt. 1154, nachdem er Mathildens Sohn Heinrich Plantagenet als
Erben anerkannt hatte.
2) Erzherzog von Österreich, Sohn des Erzherzogs Joseph
(gest. 1847) und dessen zweiter Gemahlin, Hermine, gebornen
Prinzessin von Anhalt-Bernburg-Schaumburg, geb. 14. Sept. 1817,
wurde im Dezember 1843 Zivilgouverneur von Böhmen, 1847 nach
dem Tod seines Vaters zum stellvertretenden Palatin von Ungarn
ernannt und im November d. J. durch die Wahl des Reichstags und die
Bestätigung des Kaisers definitiv mit dieser Würde
betraut. Infolge der Märzereignisse 1848 wurde seine Stellung
sowohl der nationalen Partei als auch der österreichischen
Regierung gegenüber eine unhaltbare, namentlich als er im
September vom Reichstag zum Oberbefehlshaber der ungarischen Armee
gegen Jellachich ernannt worden war; er entsagte daher 24. Sept.
dem Palatinat, zog sich 1850 auf seine Besitzungen in Nassau
(Grafschaft Holzappel und Schaumburg) zurück und starb 19.
Febr. 1867 in Mentone. Vgl. "Erzherzog S. Viktor von
Österreich, sein Leben, Wirken etc." (Wiesb. 1868).
3) Bathori, König von Polen, geb. 1532 aus einer vornehmen
ungarischen Familie (s. Bathori), ward 1571 von den
siebenbürgischen Ständen zum Großfürsten von
Siebenbürgen und 1575, nachdem er die Jagellonische Prinzessin
Anna geheiratet, vom polnischen Reichstag zum König von Polen
erwählt. Er verbesserte die Rechtspflege, suchte dem
Jesuitenorden gegenüber die Gewissensfreiheit der Protestanten
zu schützen, kämpfte im Bund mit Schweden glücklich
gegen die Russen (1578-82) und eroberte einen Teil Livlands,
versuchte aber mit seinem Günstling Zamojski vergeblich, ein
starkes nationales Königtum in Polen zu schaffen und die Krone
in seinem Geschlecht erblich zu machen. Er starb 12. Dez. 1586 in
Grodno.
4) S. I., der Heilige, erster König von Ungarn, 997-1038,
war der Sohn des Herzogs Geisa, Urenkels des Großfürsten
Arpad (s. d.), hieß ursprünglich Wajk, ward 995 in
seinem 20. Lebensjahr angeblich durch den Bischof Adalbert von Prag
zum Christentum bekehrt und nahm in der Taufe den Namen Stephanus
an. Mit der bayrischen Herzogstochter Gisela vermählt, zog er
zahlreiche Deutsche nach Ungarn und rottete, zur Regierung gelangt,
das Heidentum mit Feuer und Schwert in seinem Land aus. Er nahm den
Königstitel an, ließ sich mit der vom Papst Silvester
II. ihm gesandten Krone 1001 krönen und gab dem Land eine
Verfassung, durch welche die Krone im Geschlecht Arpads für
erblich erklärt und eine geregelte politische Verwaltung
eingeführt wurde. Die widerspenstigen Stammeshäuptlinge
im Süden und Osten seines Landes zwang er in siegreichen
Kämpfen zur Anerkennung seiner Herrschaft. Er starb 1038 und
ward 1087 heiliggesprochen (sein Tag der 20. August). Nach ihm
werden Ungarn und seine Teile die "Länder der Stephanskrone"
genannt. - S. II.-V., s. Ungarn (Geschichte).
Stephan, 1) Martin, Stifter einer nach ihm benannten
Sekte, geb. 13. Aug. 1777 zu Stramberg in Mähren, machte, seit
1810 Pfarrer der böhmischen Gemeinde in Dresden, hier, im
Muldenthal und im Altenburgischen Propaganda für ein
starkgläubiges Altluthertum. Seine Veranstaltung von
nächtlichen Erbauungs- und Erholungsstunden veranlagte endlich
die Einleitung einer Untersuchung gegen ihn; er entzog sich jedoch
derselben, indem er im Oktober 1838 sich von Bremen mit 700 seiner
Anhänger nach Amerika einschiffte, wo er bereits zu Wittenberg
am Mississippi Ländereien hatte ankaufen lassen. Er ließ
sich dort zum Bischof ernennen, ward aber schon 30. Mat 1839 wegen
Unzucht und Veruntreuung von seiner Gemeinde abgesetzt und nach
Illinois gebracht, wo er 21. Febr. 1846 starb. Über S. und
seine Sekte schrieben unter andern v. Polenz (Dresd. 1840) und
Vehse (das. 1842).
2) Heinrich von, Staatssekretär des deutschen
Reichspostamtes, geb. 7. Jan. 1831 zu Stolp in Pommern, trat 1848
in das Postfach ein, wurde 1856 als Geheimer expedierender
Sekretär ins Generalpostamt nach Berlin berufen, 1858 zum
Postrat, 1865 zum Geheimen Postrat und vortragenden Rat ernannt. In
dieser Zeit war er in besonders hervorragender Weise auf dem Gebiet
der internationalen Postreform thätig, indem er den
Abschluß von Postverträgen mit fast allen
europäischen Staaten bewirkte. Daneben fand er Gelegenheit,
sich reiche Sprachkenntnisse zu erwerben und durch weite Reisen die
internationalen Kulturhebel des Postwesens näher kennen zu
lernen. Nachdem S. 1866 und 1867 die Verhandlungen zur Beseitigung
der Thurn und Taxisschen Lehnspostwesens beendet und die taxissche
Post durch einen Staatsvertrag vom 28. Jan. 1867 an die Krone
Preußen übereignet hatte, wurde er im April 1870 zum
Generalpostdirektor und obersten Chef des Postwesens des
Norddeutschen Bundes ernannt. Gleich in den ersten Monaten seiner
Verwaltung trat die große Aufgabe der Entwickelung der
deutschen Feldpost im deutsch-französischen Krieg an ihn
heran, welche von ihm in vollendeter Weise gelöst wurde. 1871
wurde S. zum kaiserlichen Generalpostdirektor, 1876 nach erfolgter
Verschmelzung der Telegraphenverwaltung mit der Post zum
Generalpostmeister und 1879 zum Staatssekretär des deutschen
Reichspostamtes ernannt. Nach der Errichtung des Reichspostwesens
begann S. das Werk des innern Ausbaues, welches eine neue Epoche
für das Postwesen eröffnete und die deutsche Reichspost
zu mustergültiger Höhe erhoben hat. Er schuf eine
einheitliche Postgesetzgebung, führte den einheitlichen Tarif
für Pakete durch, führte das von ihm erfundene neue
Verkehrsmittel der Postkarten ein, rief den Postanweisungs- und
Postauftragsverkehr sowie die für den litterarischen Verkehr
wichtige Bücherpost ins Leben und führte eine Reihe
erheblicher Erleichterungen bei Benutzung der Postanstalt ein. Dann
folgte 1875 die auf Stephans Veranlagung eingeleitete Vereinigung
der Telegraphie mit der Reichspost, welche zur Folge hatte,
daß die Zahl der deutschen Telegraphenanstalten sich seitdem
von 1700 auf 13,000 gehoben hat. Das bedeutendste Werk Stephans
aber war die Gründung
294
Stephani - Stephansorden.
des Weltpostvereins. Er hat diese Bildung zuerst angeregt und
sie mit umsichtiger und kräftiger Hand gefördert, so
daß dieser Gemeinschaft jetzt mit geringen Ausnahmen alle
zivilisierten Staaten der Erde angehören. Daneben hat S. in
umfassendster Weise für Hebung der materiellen Lage und des
geistigen Wohls der Post- und Telegraphenbeamten (Kaiser
Wilhelm-Stiftung für die Post- und Telegraphenbeamten,
Bewilligung von Stipendien für Studienreisen, Einrichtung der
Postspar- und Vorschußvereine, deren Vereinsvermögen
jetzt 14 Mill. Mk. beträgt, Errichtung der Post- und
Telegraphenschule in Berlin mit akademischem Lehrkursus, Errichtung
des Reichspostmuseums, Gründung von Amtsbibliotheken,
Sonntagsruhe etc.) gesorgt. Bis in die neueste Zeit hinein hat S.
die umfassendsten Umgestaltungen sowohl bei der Post als bei der
Telegraphie durchgeführt; die Zahl der Postanstalten wurde von
5400 im J. 1871 auf 18,000 im J. 1888 erhöht. Das flache Land
ist mit einem dichten Netz von Landbriefträgerverbindungen zu
Fuß und zu Wagen durchzogen (Verstärkung der Zahl der
Landbriefträger im Reichspostgebiet von 10,000 auf über
20,000), in den Städten machen die Fernsprecheinrichtungen
zusehends Fortschritte; unterirdische Telegraphenleitungen sorgen
für eine von atmosphärischen Störungen
unabhängige Zuverlässigkeit des Verkehrs;
überseeische Kabel und Postverbindungen haben sich von Jahr zu
Jahr vermehrt, und seit 1886 haben die auf Stephans Initiative ins
Leben gerufenen deutschen subventionierten Postdampfschiffe ihre
Fahrten eröffnet. In den ersten zehn Jahren nach Gründung
des Weltpostvereins lieferte die Verwaltung unter Stephans Leitung
180 Mill. Überschuß an das Reich ab. S. gründete im
Verein mit Werner Siemens den Elektrotechnischen Verein in Berlin,
welchem er seit seiner Errichtung als Ehrenpräsident vorsteht.
Er ist Mitglied des preußischen Herrenhauses (seit 1872) und
des preußischen Staatsrats, Ehrendoktor der Universität
Halle und Ehrenbürger der Städte Stolp und Bremerhaven.
Auch als Schriftsteller zeichnete sich S. aus. Außer einem
"Leitfaden zur Anfertigung schriftlicher Arbeiten für junge
Postbeamte" schrieb er: "Geschichte der preußischen Post"
(Berl. 1859), "Das heutige Ägypten" (Leipz. 1872), "Weltpost
und Luftschiffahrt" (Berl. 1874) sowie zahlreiche kleinere Essays.
Er begründete das "Archiv für Post und Telegraphie" und
gab das "Poststammbuch" (3. Aufl., Berl. 1877) heraus.
3) (Meister Stephan), s. Lochener.
Stephani, 1) Heinrich, verdienter Pädagog der
Aufklärungszeit, geb. 1. April 1761 zu Gemünden im
Würzburgischen, studierte zu Erlangen, ward 1808 bayrischer
Kirchen- und Schulrat und 1818 Dekan in Gunzenhausen, trat aber
1834 infolge von theologischen Streitigkeiten vom geistlichen Amt
zurück und starb 24. Dez. 1850 zu Gorkau in Schlesien. Er
veröffentlichte zahlreiche ihrer Zeit angesehene theologische,
kirchenrechtliche, pädagogische und methodologische Schriften.
Sein bleibendes Verdienst besteht in der Ausbildung und
Einführung der Lautiermethode beim ersten Leseunterricht,
welche vom Lautwert der Buchstaben ausgeht, statt, wie die
ältere Buchstabiermethode, von den Lautzeichen und Namen der
Buchstaben.
2) Ludolf, Philolog und Archäolog, geb. 29. März 1816
zu Beucha bei Leipzig, studierte hier, erhielt auf Grund seiner
kunstgeschichtlichen Schrift "Der Kampf zwischen Theseus und
Minotaurus" (Leipz. 1842) durch Gottfr. Hermanns Empfehlung eine
Hauslehrerstelle in Athen, gab diese aber bald auf, um zu
wissenschaftlichen Forschungen eine Reise durch Nordgriechenland
und Kleinasien zu unternehmen, die sich schließlich bis
Unteritalien und Sizilien erstreckte. Nach seiner Rückkehr
folgte er 1846 einem Ruf als Professor der Philologie an die
Universität Dorpat und siedelte von da 1850 nach Petersburg
über, wo er als Mitglied der Akademie der Wissenschaften und
Konservator der klassischen Altertümer eine große und
erfolgreiche Thätigkeit entwickelte. Er starb 11. Jun. 1887 in
Pawlowsk. Seine Hauptwerke sind: "Reise durch einige Gegenden des
nördlichen Griechenland" (Leipz. 1843); "Über einige
angebliche Steinschneider des Altertums" (das. 1851); "Der
ausruhende Herakles" (das. 1854); "Antiquités du Bosphore
Cimmérien" (Petersb. 1854, Prachtwerk mit Bilderatlas);
"Nimbus und Strahlenkranz in den Werken der alten Kunst" (das.
1859); "Die Vasensammlung der kaiserlichen Eremitage" (das. 1869, 2
Bde); "Die Antikensammlung zu Pawlowsk" (das. 1872) etc. Zahlreiche
Abhandlungen von S. enthalten die "Comptes rendus" der kaiserlichen
Archäologischen Kommission.
Stéphanie, Louise Adrienne Napoléone,
Großherzogin von Baden, Tochter des Grafen Claude de
Beauharnais (s. Beauharnais 1) und Nichte der Kaiserin Josephine,
geb. 28. Aug. 1789, war 1806 von Napoleon I. adoptiert, zur Fille
de France und kaiserlichen Hoheit erklärt und 8. April mit
Karl Ludwig Friedrich, Erbgroßherzog von Baden,
vermählt, welcher ihr aber mehrere Jahre lang entschiedene
Abneigung zu erkennen gab, da er nur gezwungen die Ehe eingegangen
war. Seit 1811 Großherzogin, aber seit 1818 verwitwet,
residierte sie in Mannheim und starb 29. Jan. 1860 in Nizza. Sie
hinterließ zwei Töchter, Josephine, geb. 21. Okt. 1813,
Witwe des Fürsten Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen, und
Maria, geb. 11. Okt. 1817, seit 1863 verwitwete Herzogin von
Hamilton, gest. 18. Okt. 1888; ihre Söhne waren kurz nach der
Geburt gestorben.
Stephanit, s. Sprödglaserz.
Stephanos, röm. Bildhauer zur Zeit Cäsars,
durch eine Knabenstatue in Villa Albani bekannt, Schüler des
Pasiteles (s. d.).
Stephanos von Byzanz, griech. Grammatiker, lebte in der
ersten Hälfte des 6. Jahrh. n. Chr. und ward bekannt als
Verfasser eines umfangreichen geographischen Wörterbuchs
("Ethnica"), das uns aber nur noch in einem Auszug des Grammatikers
Hermolaos erhalten ist. Die besten Ausgaben sind die von Westermann
(Leipz. 1839) und Meineke (Berl. 1849).
Stephansfeld, Irrenanstalt, s. Brumath.
Stephanskörner, Stephanskraut, s. Delphinium.
Stephauskrone, s. Stephan 4).
Stephansorden. 1) Königlich ungarischer
Zivilverdienstorden, von Maria Theresia als Pendant des
Militär-Maria-Theresienordens 5. Mai 1764 gestiftet und unter
den Schutz des heil. Stephan gestellt. Großmeister ist der
König von Ungarn. Der Orden soll 100 Ritter und drei Grade
haben. Die Dekoration besteht in einem achteckigen, grün
emaillierten, goldgeränderten Kreuz mit der Stephanskrone; im
rot emaillierten Mittelschild steht auf einer goldenen, auf einen
grünen Berg gestellten Krone ein silbernes apostolisches Kreuz
und zu beiden Seiten M. T. mit der Umschrift: "Publicum meritorum
praemium"; auf dem Revers, umgeben von einem Eichenkranz: "STO.
ST.R.I.AP." Das große
295
Stephansstein - Stephenson.
Kreuz tragen die Ritter erster Klasse und Kommandeure, das
kleine die Ritter, sämtlich am grünen Band mit rotem
Streifen in der Mitte in der üblichen Weise. Die
Großkreuze tragen dazu einen brillantierten Silberstern, in
dessen Mitte das Ordensmedaillon angebracht ist, und außerdem
noch eine Kette aus S S und M T, der Königskrone und einem
Wolkenkranz, in dem ein Band die Inschrift: "Stringit amore"
trägt, und zwischen dem ein Adler schwebt.
Auch hat der Orden, der nur dem Adel zugänglich, eine
besondere Ordenskleidung, Beamte und seinen Ordenstag an St.
Stephan. Die Großkreuze heißen Kousins des Königs.
Vgl. Dominus, Der S. und
seine Geschichte (Wien 1873). - 2) Toscanischer
Militärorden, gestiftet 1562 von Cosimo de Me-
dici zur Bekämpfung der Seeräuberei und Verteidigung
des Glaubens, mit religiöser Observanz, wurde 22. Dez. 1817
vom Großherzog Ferdinand III. erneuert und in vier Grade:
Prioren- Großkreuze, Bali-Großkreuze, Kommendatoren und
Ritter (di giustizia und di grazia), eingeteilt. Jeder Adlige von
vier Ahnen, mit freiem Einkommen von 300 Skudi aus seinem Besitz,
hat Anspruch auf den Orden, der in der Familie erblich ist, wenn
der Ritter eine Kommende als Majorat stiftet. Die Cavalieri di
grazia erhalten solche Kommende für ihre Verdienste. Die
Dekoration besteht in einem achtspitzigen, rot emaillierten Kreuz
mit Krone und goldenen Lilien in den Winkeln, das an rotem Band von
den drei ersten Klassen am Hals, von den Rittern im Knopfloch
getragen wird. Die Plaque wird auf der Brust getragen. Viktor
Emanuel hob den Orden 16. Nov. 1859 auf.
Stephansstein, s. Chalcedon.
Stephanus, Name zahlreicher Heiligen der
römisch-katholischen Kirche, von denen besonders zu nennen
sind : 1) Einer der sieben Armenpfleger der Christengemeinde zu
Jerusalem, der, ein eifriger Verkündiger des Evangeliums, vom
fanatischen Pöbel als Gotteslästerer 36 oder 37
gesteinigt wurde und deshalb für den ersten Märtyrer gilt
(Apostelgesch. 6 und 7); sein Tag ist der 26. Dezember. Die
Steinigung des S. wurde in der bildenden Kunst häufig
dargestellt, namentlich von Raffael (in den Teppichen des
Vatikans), von Giulio Romano (in Santo Stefano zu Genua) u. a. 2)
Erster König von Ungarn, s. Stephan 4).
Stephanus, Gelehrtenfamilie, s. Estienne.
Stephens, 1) Alexander Hamilton, amerikan. Politiker,
geb. 11. Febr. 1812 zu Taliafero in Georgia, ward im Franklin
College erzogen und studierte die Rechte, worauf er sich 1834 zu
Crawfordsville in Georgia als Advokat niederließ,
gleichzeitig aber sich der Politik widmete. Schon 1836 wurde er in
die Legislatur, 1842 in den Senat von Georgia gewählt und 1843
zum Mitglied des Repräsentantenhauses ernannt, welchem er bis
1859 angehörte. Er schloß sich zuerst der Partei der
Whigs, dann der demokratischen an, stimmte 1854 für die
Kansas- und Nebraskabill und betrieb 1856 mit Eifer die Wahl
Buchanans zum Präsidenten. 1859 schied er aus dem
Kongreß, weil er die extremen Ansichten der
Sklavenhalterpartei nicht billigte, wie er 1861 auch anfangs
gegen die Sezession war. Dennoch ließ er sich zum
Vizepräsidenten der südlichen Konföderation
wählen und bekleidete diesen Posten bis zu deren Untergang
1865. Er wurde auf Befehl der Unionsregierung verhaftet und nach
Fort Warren bei Boston gebracht, im Oktober 1865 aber freigelassen.
1872-77 wieder demokratisches Mitglied des Kongresses, bemühte
er sich um die Versöhnung der Parteien. Seit 1882 Gouverneur
von Georgia, starb er 4. März 1883. Er veröffentlichte:
"A constitutional view of the late war between the states" (Philad.
1869, 2 Bde.); "Compendium of the history of the U.S. (neue Ausg.,
New York 1883). Ein Teil seiner Reden und Briefe wurde von
Cleveland ("A. H. S.. in public and private life", Philad. 1867)
herausgegeben.
2) George, Archäolog und Philolog, geb. 13. Dez. 1813 zu
Liverpool, kam mit 20 Jahren nach Schweden, dessen Bibliotheken er
behufs altnordischer Studien eifrig durchforschte, wurde 1851 an
der Universität zu Kopenhagen angestellt und 1855 zum
Professor ernannt. Sein Hauptwerk ist: "The old-northern Runic
monuments of ScandinaVia and England" (Lond. u. Kopenh. 1866-84, 3
Bde.; abgekürzte Ausg. 1884). Von seinen übrigen
Schriften sind zu ermähnen: "Bihang till Frithiofs saga"
(1841); "Svenska folksagor och afventyr" (1844) und "Sveriges
historiska och politiska visor" (1853); die beiden letztern
Schriften sind im Verein mit G.O. Hylten-Cavallius
herausgegeben.
Stephenson (spr. stihwensson), 1) George, der
Hauptbegründer des Eisenbahnwesens, geb. 8. Juni 1781 zu Wylam
bei Newcastle als Sohn eines Kohlenarbeiters, arbeitete sich von
einem gewöhnlichen Maschinisten zum Direktor der großen
Kohlenwerke des Lord Ravensworth bei Darlington empor und baute
1812 die erste Lokomotive fürdas Kohlenwerk Killingworth. 1824
gründete er in Newcastle eine Maschinenfabrik, und im
folgenden Jahr wurde nach seinem Prinzip die erste Eisenbahn zur
Beförderung von Personen zwischen Stockton und Darlington
angelegt. Er gehörte zu den ersten, welche hierbei die
Anwendung glatter walzeiserner Schienen befürworteten und
deren Konstruktion verbesserten. Die Erbauung der
Liverpool-Manchester-Eisenbahn 1829 begründete seinen Ruf
für immer. Bei der berühmten Preisausschreibung für
die beste und schnellste Lokomotive dieser Bahn, welche ihr
dreifaches Gewicht mit 10 engl. Meilen Geschwindigkeit in der
Stunde ziehen sollte,
ohne Rauch zu erzeugen, errang Stephensons Rocket den Preis,
indem sie ihr fünffaches Gewicht zog und 14-20 engl. Meilen in
der Stunde zurücklegte, also die gestellten Bedingungen weit
übertraf. Dieser Erfolg war hauptsächlich der
Einführung des eine lebhaftere Verbrennung erzeugenden
Blasrohrs sowie des nach einer Idee Booths, des
Generalsekretärs der Gesellschaft, zu einer größern
Dampfentwickelungsfähigkeit geeigneten Röhrenkessels
zuzuschreiben. Von da an leitete S. den Bau der bedeutendsten
Eisenbahnen in England oder baute Maschinen für dieselben und
wurde zu gleichem Zweck nach Belgien, Holland, Frankreich,
Deutschland, Italien und Spanien berufen. Er war zuletzt auch
Eigentümer mehrerer Kohlengruben und der großen
Eisenwerke von Claycroß und starb 12. Aug. 1848 in Tapton
House bei Chesterfield. Seine Statue ward in Newcastle auf der
Stephensonbrücke aufgestellt. Vgl. Smiles, The life of George
S. (Lond. 1884).
2) Robert, Baumeister, Sohn des vorigen, geb. 16. Dez. 1803 zu
Wilmington, studierte in Edinburg,
unterstützte seinen Vater bei dessen Unternehmungen,
leitete den Bau mehrerer Eisenbahnlinien, verbesserte die
Lokomotive, erbaute die unter dem Namen High Lewel Bridge bekannte
eiserne Bogenhängwerkbrücke bei Newcastle, welche in
sechs Öffnungen von je 37,5 m Weite und 25,8 m Höhe den
Tyne überspannt, und erfand unter andern die sogen. Tubular-
oder Röhrenbrücken, welche aus Blech zusammengesetzt und
so weit sind, daß sie einem Eisenbahnzug die Durchfahrt
gestatten. Eine Riesenbrücke dieser Art,
296
Steppe - Sterblichkeit.
die bekannte Britanniabrücke (s. d.), erbaute er von 1847
bis 1850 über den Menaikanal, indem er deren Röhren an
dem Ufer zusammensetzte, auf Pontons zwischen die Pfeiler
flößte und mittels hydraulischer Pressen bis zu dem Orte
ihrer Bestimmung aufzog. Das bedeutendste Beispiel dieser
Brückengattung ist die von S. entworfene, 3 km lange
Viktoriabrücke bei Montreal in Kanada, welche den St.
Lorenzstrom in 25 Öffnungen überspannt, deren mittlere
eine Weite von 100,58 m besitzt. S. starb 12. Okt. 1859. Sein
"Report on the atmospheric railway-system" wurde von Weber (Berl.
1845) deutsch bearbeitet. Vgl. Smiles, Lives of George and Robert
S. (8. Aufl., Lond. 1868); Jeaffreson und Pole, Life of Robert S.
(das. 1864, 2 Bde.).
Steppe (v. russ. stepj, "flaches, dürres Land"), in
der Erdkunde Bezeichnung für ausgedehnte Ebenen, die nur mit
Gras und Kräutern bewachsen sind, auch wegen Mangels an
Bewässerung keinen Anbau gestatten, in ihrem sonstigen
physiognomischen Charakter aber von der geognostischen
Beschaffenheit des Bodens und dem Klima abhängig sind (vgl.
Ebene). Die Steppen stellen mannigfaltige Übergänge zu
den Wüsten dar und sind entweder Salzsteppen, deren kahler
Boden effloreszierendes Salz und magere Vegetation von Salzpflanzen
trägt, oder mit Gerölle bedeckte Steinsteppen oder
eigentliche Grassteppen, die sich nach dem Regen mit einem dichten
und einförmigen Pflanzenteppich überziehen, deren
Ackerkrume aber nicht tief genug ist, als daß Bäume
darin Wurzel schlagen könnten; auch die mit Flechten und
Moosen überzogenen Sumpfsteppen (Tundren) sind hierher zu
rechnen. Die Steppen kommen unter verschiedenen Namen in allen
Kontinenten vor; sie heißen im südlichen Rußland
und in Westasien Steppen, im nordwestlichen Deutschland Heiden, im
südwestlichen Frankreich Landes, in Ungarn Pußten, in
Nordamerika Savannen und Prärien, in Südamerika Llanos
und Pampas etc. Vgl. Humboldt, Über die Steppen und
Wüsten (in den "Ansichten der Natur", zuletzt Stuttg.
1871).
Steppenhuhn (Syrrhaptes Ill.), Gattung aus der Ordnung
der Scharrvögel und der Familie der Flughühner
(Pteroclidae), gedrungen gebaute Vögel mit kleinem Kopf,
kurzem, seitlich wenig komprimiertem, auf der Firste leicht
gebogenem Schnabel, sehr spitzen Flügeln, in welchen die erste
Schwinge am längsten, nach der Spitze hin verschmälert
und fast borstenartig ist, bis zur Spitze der Zehen mit
zerschlissenen, daunenartigen Federn bekleideten, kleinen
Füßen, fehlender Hinterzehe, durch eine Haut verbundenen
Vorderzehen und breiten, kräftigen Nägeln. Das S.
(Fausthuhn, S. paradoxus Ill.), ohne die verlängerten
Mittelschwanzfedern 39 cm lang und ohne die verlängerten
Schwingenspitzen 60 cm breit, am Kopf und Hals aschgrau, Kehle,
Stirn und ein Streif über dem Auge lehmgelb, mit schwarzem und
weißem Brustband, an der Brust grau isabellfarben, am
Öberbauch schwarzbraun, Unterbauch hell aschgrau, Rücken
lehmgelb, dunkel gefleckt und quergestreift, Schwingen aschgrau,
die vorderste schwarz gesäumt, Schwanzfedern gelb, dunkel
gebändert. Es bewohnt die Steppe östlich vom Kaspischen
Meer bis zur Dsungarei, im W. nördlich bis 46°, im O. noch
die Hochsteppen des südlichen Altai, geht im Winter
südlich bis zum Südrand der Gobi, lebt im Frühjahr
in kleinen Trupps, im Herbst in größern Flügen, in
welchen aber die Paare stets beisammen bleiben. Sie laufen rasch,
aber nicht anhaltend, fliegen schneller und schneidender als Tauben
und nisten in kleinen Gesellschaften. Das Gelege besteht aus vier
hell grünlichgrauen bis schmutzig bräunlichgrauen Eiern.
1860 zeigten sich Fausthühner in Holland und England, 1861 in
Norwegen und Nordchina, 1863 aber erfolgte eine große
Einwanderung, welche sich von Galizien bis Island, von
Südfrankreich bis zu den Färöerinseln ausdehnte. Auf
Borkum verschwanden die letzten im Oktober. Aber noch im folgenden
Jahr wurden sie in Deutschland mehrfach beobachtet, und in
Jütland und auf mehreren dänischen Inseln haben sie auch
gebrütet. Eine ähnliche Einwanderung erfolgte 1888, blieb
indes ebenfalls ohne weitere Folgen; nur im SO. Europas hat sich
das S. seßhaft gemacht. In der Gefangenschaft hält es
sich recht gut. Vgl. Holtz, Über das S. (Greifsw. 1888).
Steppenhund, s. Hyänenhund.
Steppenkuh, s. Antilopen, S. 640.
Steppstich, s. Nähen.
Ster (franz. stere, v. griech. stereos, starr, fest),
Körpermaß (besonders Holzmaß), = 1 cbm, und zwar
entweder Festmeter (fm) = 1 cbm fester Masse, oder Raummeter (rm) =
1 cbm Schichtmaß.
Sterbekassen (Grabe-, Leichenkassen, Totenladen,
Sterbeladen, Begräbniskassen) sind kleine, im wesentlichen die
Deckung der Beerdigungskosten bezweckende genossenschaftliche, oft
zweckmäßig mit Krankenkassen verbundene
Lebensversicherungsanstalten, welche im Todesfall das Sterbegeld an
die Erben auszahlen oder, wenn solche nicht vorhanden, auch wohl
die Beerdigung selbst besorgen. Es gab solche nachweisbar schon in
Rom und bei den alten germanischen Völkern. Sie sind in
Deutschland sehr verbreitet und werden namentlich von den untern
Klassen benutzt, ohne daß es jedoch möglich wäre,
genauere Zahlenangaben über dieselben zu machen. S. bestehen
auch als Nebenzweige von etwa zehn deutschen großen
Lebensversicherungsanstalten, meistens aber sind sie kleinere
Privatvereine, an welchen die Beteiligung entweder nur einer
bestimmten Zahl von Personen (geschlossene Kassen) oder einer nicht
festgesetzten Zahl von Mitgliedern, entweder nur Personen
bestimmter Kategorien (z. B. Beamten derselben Behörde,
Arbeitern derselben Fabrik, Personen bestimmten Berufs etc.) oder
jedem Beitrittswilligen offen steht. Viele derselben werden in
alter unrationeller Weise ohne genügende Abstufung der
Prämien (hier oft Totenopfer genannt) und ohne richtige
Bemessung der Prämienreserven verwaltet und sind deshalb zum
Teil wenig lebensfähig, doch haben es manche bereits zu hohem
Alter gebracht. In England gehören viele S. zu den
hauptsächlichsten Einrichtungen der Friendly Societies (s.
d.), welchen gesetzlich verboten ist, für den Sterbefall von
Frau und Kind mehr als die Begräbniskosten zu versichern. Vgl.
Lebensversicherung und Krankenkassen; Hattendorf, Über S.
(Götting. 1867); Heym, Die Grabekassen (Leipz. 1850);
Fleischhauer, Die Sterbekassenvereine (Weim. 1882).
Sterbelehen, Abgabe, welche bei einem durch den Tod
herbeigeführten Wechsel in der Person des Lehnsherrn oder des
Beliehenen entrichtet werden mußte.
Sterbender Fechter, s. Gallierstatuen.
Sterbequartal, s. v. w. Gnadenquartal (s. Pension, S.
832). Vgl. Deservitenjahr.
Sterbethaler, s. Begräbnismünzen.
Sterbevogel, s. Seidenschwanz.
Sterbfall, s. Bauer, S. 464.
Sterblichkeit (Sterblichkeitsziffer, Mortalität),
das Verhältnis der Zahl der Gestorbenen einer Zeiteinheit
(gewöhnlich das Jahr) zur Zahl derjeni-
297
Sterblichkeit (statistisch).
gen, welche vorher am Leben waren. Dagegen versteht man unter
Intensität der S. den Bruch, welchen man erhält durch
Division einer Anzahl Gestorbener durch die Zeit, welche die
Personen, aus denen jene weggestorben sind, während der Dauer
des Absterbens zusammen durchlebt haben. Zu unterscheiden ist die
S. einer gesamten Bevölkerung und diejenige einer Gruppe,
insbesondere von gleichaltrigen Personen. So kamen im Deutschen
Reich im Durchschnitt der Jahre 1841-85 je auf 10,000 Köpfe
der mittlern Bevölkerung 281,6 Todesfälle, die S. stellte
sich demnach rund auf 0,028, dagegen findet man andre Zahlen
für verschiedene Altersklassen. Die Feststellung der S. ist
nicht allein für die Wissenschaft, sondern auch für die
Praxis (Lebensversicherung, Gesundheitspflege etc.) von hoher
Wichtigkeit. Eine Tausende von Jahren umfassende Erfahrung hat zu
dem bekannten Satz geführt, daß jeder Mensch einmal
stirbt. Wenn man auch das höchste überhaupt nur
erreichbare Alter nicht kennt, so hat man doch beobachtet,
daß die Zahl derjenigen, welche die Grenze von 90 und 100
Jahren überschreiten, außerordentlich klein ist. Man
fand ferner, daß die S. verschiedener Altersklassen, sobald
sie nur für genügend große Zahlen ermittelt wird,
gewisse Regelmäßigkeiten aufweist. Diese Thatsache gab
dazu Veranlassung, an der Hand von Volkszählungen Geburts-,
Sterbelisten etc., Sterblichkeit (Überlebens-,
Mortalitäts-) Tafeln oder Absterbelisten aufzustellen (die
ersten von den Engländern Graunt 1661 und Halley 1691, vom
Holländer Kerseboom 1742, vom Franzosen Deparcieux 1746, vom
Schweden Wargentin 1766). Aus denselben ist die Absterbeordnung, d.
h. die Art zu ersehen, wie eine Anzahl Gleichalteriger
(Neugeborner) sich durch Absterben von Jahr zu Jahr mindert. Diese
Tafeln haben nur dann eine Bedeutung, wenn sie aus großen
Zahlen gewonnen werden. Sie geben alsdann die Wahrscheinlichkeit
des Sterbens an, ihreZahlen werden darum in Wirklichkeit um so mehr
zutreffen, auf eine je größere Zahl von Personen sie
angewandt werden. So wird die Zahl derjenigen, welche von 1 Mill.
30jährigen Männern in den nächsten zwölf
Monaten sterben werden, nicht viel von 0,928 Proz. abweichen,
während der Prozentsatz, welcher von einer gegebenen kleinen
Anzahl wirklich sterben wird, erheblich größer oder
kleiner sein kann. Dann dürfen die Tafeln nur auf solche
Bevölkerungsmassen angewandt werden, welche denen gleichartig
sind, die Gegenstand der Erhebung waren. Denn die S. ist
verschieden je nach Wohnort (Stadt, Land, Gegend), Geschlecht (im
allgemeinen geringere S. des weiblichen Geschlechts), Beruf (Gefahr
für Gesundheit, Anstrengung, Aufregung), Zivilstand,
Lebensweise, Gesundheitspflege, Wohlstand etc. So wird die
Sterblichkeitstafel einer Versicherungsanstalt, welche nur
genügend gesunde Personen aufnimmt, andre Zahlen aufweisen als
diejenige, welche für die Gesamtbevölkerung eines Landes
aufgestellt wurde. Aus den Sterblichkeitstafeln ist zunächst
die Sterbenswahrscheinlichkeit für jedes Lebensalter zu
ersehen. Ist die Zahl der $n+1$-und die der $n$-jährigen
Personen $m_{n+1}$ und $m_n$, so ist die Sterbenswahrscheinlichkeit
der $n$-jährigen (für das nächste Jahr) gleich
$\frac{m_{n+1}}{m_n}$, die Wahrscheinlichkeit des Gegenteils
(Überlebenswahrscheinlichkeit) ist gleich
$1-\frac{m_{n+1}}{m_n}$. Die Wahrscheinlichkeit eines
$n$-jährigen, in einem der nächsten vier Jahre zu
sterben, ist $\frac{m_{n+4}}{m_n}$, wenn $m_{n+4}$ die Zahl der
übriggebliebenen $n+4$jährigen bedeutet. Dieselbe Zahl
erhält man, wenn man die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen
Jahre miteinander multipliziert. Denn es ist
$\frac{m_{n+4}}{m_n}=\frac{m_{n+1}}{m_n}\frac{m_{n+2}}{m_{n+1}}\frac{m_{n+3}}{m_{n+2}}\frac{m_{n+4}}{m_{n+3}}$.
Das mittlere Lebensalter (Durchschnittsalter, vie moyenne) einer
Anzahl Personen (gleichzeitig Lebender oder Gestorbener
verschiedenen Alters) ist gleich der Summe der Jahre, welche alle
zusammen durchlebt haben, dividiert durch die Anzahl der Personen.
Von demselben ist zu unterscheiden die nur an der Hand von
Sterblichkeitstafeln als eine Wahrscheinlichkeit zu berechnende
mittlere Lebenserwartung (auch mittlere Lebensdauer oder
Vitalität genannt), dieselbe ist gleich der Summe der nach
Maßgabe der Tafel noch zu verlebenden Jahre, dividiert durch
die Zahl der Personen. Die wahrscheinliche Lebensdauer oder
Lebenserwartung (vie probable) ist gleich der Anzahl von Jahren,
nach deren Verlauf gerade die Hälfte einer gegebenen Anzahl
(wahrscheinlich) gestorben sein wird. Für diese Zeit sind also
Sterbens- und Überlebenswahrscheinlichkeit einander gleich (je
gleich 1/2). Nach der vom kaiserlichen Statistischen Amt
aufgestellten deutschen
Sterbetafel (1871-81) ist die S.:
Eben vollendetes Alter
Zahl der Überlebenden
Sterbenswahrscheinlichkeit für das nächste Jahr
Mittlere (durchschnittliche) Lebenserwartung
Wahrscheinliche Lebenserwartung
männl. weibl. männl. weibl. männl. weibl.
männl. weibl.
0^1 104520 103692 0,2850 0,2453 34,0 37,1 34,2 39,6
0 100000 100000 0,2527 0,2174 35,6 38,5 38,1 42,5
1 74727 78260 0,0649 0,0636 46,5 48,1 53,2 56,3
2 69876 73280 0,0332 0,0326 48,7 50,3 54,6 57,7
3 67997 70892 0,0231 0,0225 49,4 51,0 54,6 57,7
13 61320 64390 0,0035 0,0039 44,1 45,8 47,4 50,2
20 59287 62324 0,0075 0,0061 38,5 40,2 41,2 44,0
30 54454 57566 0,0093 0,0097 31,4 33,1 33,2 35,6
40 48775 51576 0,0136 0.0122 24,5 26,3 25^3 27,6
50 41228 45245 0,0215 0,0160 18,0 19,3 18,0 19,6
60 31124 36293 0,0382 0,0329 12,1 12,7 11,5 12,3
70 17750 21901 0,0811 0,0747 7,3 7,6 6,5 6,7
80 5035 6570 0,1745 0,1683 4,1 4,2 3,3 3,4
90 330 471 0,3190 0,3138 2,3 2,4 1,8 1,8
100 2 3 0,5193 0,5180 1,4 1,2 1,0 0,9
1 Einschließlich der Totgebornen, die Zahl 100,000
bedeutet die Lebendgebornen.
Die S. (Sterbenswahrscheinlichkeit) nimmt von Geburt an bis zum
13. Lebensjahr beim männlichen wie beim weiblichen Geschlecht
ab; dann steigt sie mit einer kurzen Unterbrechung zuerst langsam,
dann immer rascher bis zum höchsten Alter. Die S. des
weiblichen Geschlechts bleibt mit Ausnahme der Zeit vom 9. bis 15.,
dann vom 27. bis zum 35. Lebensjahr stets hinter derjenigen des
männlichen zurück. Die mittlere Lebenserwartung ist beim
männlichen Geschlecht bis zum 50., bei dem weiblichen bis zum
54. Jahr kleiner und dann größer als die
wahrscheinliche. Der Umstand, daß ermittelte
Absterbeordnungen einen regelmäßigen Verlauf aufweisen,
gab zur Aufstellung von Formeln Veranlassung, welche das
Sterblichkeitsgesetz darstellen sollten, und aus denen die S., bez.
die Zahl der Überlebenden für jedes Alter zu ermitteln
sei (bereits Lambert für die Londoner Bevölkerung 1776,
Th. Young 1826, Gompertz 1825 mit Erweiterungen von Makeham und
Lazarus 1867, ferner Littrow 1832, Moser 1839,
298
Sterculia - Stereometer.
endlich Kaiser 1884), und zwar gelangte man, da die
Sterbenswahrscheinlichkeit für kleine Zeitteilchen gleich dem
Bruch aus dem Differential der jeweilig Lebenden und diesen
letztern selbst ist, zu Exponentialfunktionen, deren Konstante
durch Ausgleichungsrechnung an der Hand wirklicher Beobachtungen zu
ermitteln sind; doch führen derartige Formeln nur für
gewisse Zeitstrecken zu genügend genauen Ergebnissen.
Vgl.Wappäus, Allgemeine Bevölkerungsstatistik (Leipz.
1859-61, 2 Bde.); Quételet, Sur l'homme (Par. 1835, 2 Bde.;
deutsch, Stuttg. 1835); Derselbe, Physique sociale (Par. 1869, 2
Bde.); Moser, Die Gesetze der Lebensdauer (Berl. 1839); Casper, Die
wahrscheinliche Lebensdauer der Menschen (das. 1843);
Österlen, Handbuch der medizinischen Statistik (Tübing.
1865); Kolb, Handbuch der vergleichenden Statistik (8. Aufl.,
Leipz. 1879); Beneke, Vorlagen zur Organisation der
Mortalitätsstatistik in Deutschland (Marb. 1875); die
Veröffentlichungen des königlich preußischen
Statistischen Büreaus: "Deutsche Sterblichkeitstafeln aus den
Erfahrungen von 23 Lebensversicherungsgesellschaften" (Berl. 1883),
nicht zu verwechseln mit der für die
ganze deutsche Bevölkerung aufgestellten Tafel
(Novemberheft der "Statistik des Deutschen Reichs" von
1887); Oldendorff, Der Einfluß der Beschäftigung auf
die Lebensdauer des Menschen (das. 1877-78, 2 Tle.); Westergaard,
Die Lehre von der Mortalität etc. (Iena 1882).
Sterculia L. (Stinkbaum), Gattung aus der Familie der
Sterkuliaceen, meist große Bäume mit
wechselständigen, einfachen oder gelappten Blättern und
filzigen Blüten in Rispen, sämtlich in heißen
Ländern. S. foetida L. (Stinkmalve) ist ein großer
Baum in Ostindien und auf den Molukken mit großen,
gefingerten Blättern und dunkel karminroten, orangegelb
gescheckten, sehr stark und unangenehm, dem Menschenkot
ähnlich riechenden Blüten, von welchem die jüngern,
schleimigen Blätter nach Art der Malvenblätter benutzt,
die haselnußgroßen Samen aber geröstet gegessen
werden und ein gutes Öl liefern. Einige andre Arten werden in
Gewächshäusern kultiviert. S. acuminata Beauv., welche
die Kolanüsse liefert, s. v. w. Cola acuminata (s. Cola).
Stereiden, in der Pflanzenanatomie die einzelnen
Bestandteile des Stereoms (s. d.).
Stereobat (griech.), der massive, abgestufte Unterbau der
griechischen Tempel. Weiteres s. Säule (S.
350) und Tempel.
Stereochromie (griech.), eine 1846 in München von
Schlotthauer (s.d.) und Oberbergrat Fuchs erfundene Art Malerei,
welche eine Zeitlang angewendet wurde, um Wandflächen
unmittelbar mit Gemälden, nach Art der Freskomalerei, zu
bedecken. Es wurde dabei ein Malgrund hergerichtet, der bei
Gemälden auf Leinwand in einer leichten Bindung, womit
dieselbe gesättigt wurde, bei Wänden mit Stein oder
Mörtel
aus einem wenige Linien dicken Bewurf bestand, der mit der
Steinunterlage zu einer mechanisch völlig untrennbaren Masse
sich verbindet. Auf diesem Grund wurde mit eigens präparierten
Wasserfarben gemalt, und da diese sich mit dem Grund vereinigen und
die Bildfläche schließlich durch Aufspritzen von
Wasserglas steinhart gemacht wurde, so glaubte man in diesem
Verfahren eine Technik gefunden zu haben, welche besonders
Wandgemälde in großen Räumen gegen die nachteiligen
Einflüsse des Temperaturwechsels, der Feuchtigkeit etc.
unempfindlich machen würde. Doch hat auch die von Seibertz
erfundene Vervollkommnung der S. durch Anwendung von trocknen
Farben die Erwartungen, welche man von der S. hegte, nicht
gerechtfertigt. Der von Kaulbach im Treppenhaus des Neuen Museums
zu Berlin in großem Maßstab mit der S. gemachte Versuch
hat vielmehr gezeigt, daß die Bildflächen über und
über mit störenden Riffen überzogen werden, weshalb
man die S. wieder aufgegeben hat.
Stereograph (griech.), eine von Liwtschack zu Wilna
erfundene Maschine zur Anfertigung von Stereotypmatrizen ohne
vorgängigen Schriftsatz. Die Herstellung der letztern erfolgt
durch Einschlagen von Typen, eine nach der andern, in eine
präparierte, halbweiche Platte, welche stets um die Breite der
eingeschlagenen Type durch den Mechanismus der Maschine weiter
geschoben wird, wobei der Arbeiter den Wortlaut des Manuskripts auf
einer Tastatur, wie bei den meisten Setzmaschinen, abspielt. Bis
jetzt sind technisch befriedigende Resultate mit dem Stereographen
nicht erzielt worden.
Stereographie (griech.), perspektivische Zeichnung von
Körpern auf einer Fläche.
Stereom (griech.), in der Pflanzenanatomie die Gesamtheit
der Gewebe, welche die mechanische Festigkeit eines Pflanzenteils
bedingen, nämlich die Bastzellen, das Kollenchym und das
Libriform, im
Gegensatz zu dem Mestom (s.d.) oder dem Füllgewebe ohne
mechanische Bedeutung.
Stereometer (griech.), Apparat zur Bestimmung des von
fester Substanz ausgefüllten Volumens pulverförmiger
Körper. Das S. von Say (s. Figur) besteht aus einem
Glasgefäß A, dessen eben geschliffener Rand durch eine
Glasplatte luftdicht verschlossen werden kann; nach unten setzt
sich dasselbe in eine offene, mit einer Teilung versehene
Glasröhre fort, deren zwischen zwei Teilstrichen enthaltener
Rauminhalt genau bekannt ist. Wird die Röhre, während A
offen ist, in ein mit Quecksilber gefülltes
Standgefäßbis zum Nullpunkt o der Teilung eingetaucht
und die Glasplatte aufgelegt, so ist ein bestimmtes Luftvolumen v
abgesperrt, dessen Druck durch den herrschenden Barometerstand b
angegeben wird. Zieht man nun das Gefäß A in die
Höhe, so dehnt sich die in ihr enthaltene Luft um das an der
Teilung abzulesende Volumen w aus, ihr Druck wird geringer, u. der
äußere hebt eine Quecksilbersäule h in die
Röhre. Nach dem Mariotteschen Gesetz hat man nun die
Proportion v+w:v=b:b-h, aus welcher, da w, b und h bekannt sind, v
berechnet werden kann. Wiederholt man denselben Versuch, nachdem
der pulverförmige Körper, dessen Volumen x bestimmt
werden soll, in das Gefäß A gebracht ist, so ist das
Volumen der abgesperrten Luft, wenn die Röhre bis zum
Nullpunkt eingetaucht ist, v-x. Erhebt man nun die Röhre
wieder, bis das Volumen um w zugenommen hat, und wird dabei die
Quecksilbersäule h' gehoben, so kann man aus der Proportion
v-x+w: v-x=b : b-h' das Volumen x finden. Mittels Division des
absoluten Gewichts des Pulvers (in Grammen) durch sein Volumen (in
Kubikzentimetern)ergibt sich das spezifische Gewicht desselben. Die
Volumenometer von Kopp und Regnault gründen sich auf dasselbe
Prinzip und haben dieselbe Bestimmung wie das S.
299
Stereometrie - Stereoskop.
Stereometrie (griech., "Körpermessung"), eigentlich
die Lehre von der Ermittelung des Inhalts und der Oberfläche
der Körper; im weitern Sinn der Teil der Geometrie, welcher
sich mit den Gebilden beschäftigt, zu deren Konstruktion alle
drei Dimensionen des Raums erforderlich sind, im Gegensatz zur
Planimetrie. Vgl. Geometrie.
Stereoskop (griech.), optisches Instrument, welches dazu
dient, zwei ebene Bilder desselben Gegenstandes derart zu
kombinieren, daß der Beschauer den Eindruck eines
körperlichen Gegenstandes erhält. Beim Betrachten naher
Gegenstände bietet das Sehen mit zwei Augen ein wesentliches
Mittel zur richtigen Schätzung der Entfernungen. Mit dem
rechten Auge sehen wir einen nahen Gegenstand auf einen andern
Punkt des Hintergrundes projiziert als mit dem linken, und dieser
Unterschied wird um so bedeutender, je näher der Gegenstand
rückt. Richten wir beide Augen auf einen nicht allzu weit
entfernten Punkt, so machen die beiden Augenachsen einen Winkel
(Gesichtswinkel) miteinander, der um so kleiner wird, je weiter
sich der Gegenstand entfernt. Die Größe
dieses Winkels gibt uns daher ein Maß für die
Entfernung der Gegenstände. Wir unterscheiden also beim Sehen
mit zwei Augen deutlich, welche Punkte mehr vortreten, und welche
mehr zurückliegen. Dazu kommt noch, daß wir nahe
Gegenstände mit dem rechten Auge etwas mehr von der einen, mit
dem linken Auge etwas mehr von der andern Seite sehen, und
daß gerade die Kombination dieser etwas ungleichen Bilder zu
einem Totaleindruck wesentlich
dazu beiträgt, die flächenhafte Anschauung des
einzelnen Auges zu einer körperlichen, einer plastischen zu
erheben. Eine auf einer Fläche ausgeführte Zeichnung oder
ein Gemälde kann immer nur die Anschauung eines einzelnen
Auges wiedergeben; bietet
man aber jedem Auge das passend gezeichnete Bild eines
Gegenstandes dar, so werden sich beide Bilder zu einem einzigen
Totaleindruck vereinigen. Wheatstone erreichte diese Vereinigung
durch sein Spiegelstereoskop^ (Figur 1). Dasselbe besteht
aus zwei rechtwinkelig gegeneinandergeneigten Spiegeln ab u. a
c, deren Ebenen vertikal stehen. Der Beobachter schaut mit dem
linken Auge l in den linken, mit dem rechten Auge r in den rechten
Spiegel. Seitlich von den Spiegeln find zwei vorschiebbare
Brettchen angebracht, welche die umgekehrten perspektivischen
Zeichnungen d und e eines Objekts aufnehmen. Durch die Spiegel
werden nun die von entsprechenden Punkten der beiden Zeichnungen
ausgehenden Strahlen so reflektiert, daß sie von einem
einzigen hinter den Spiegeln gelegenen Punkt m zu kommen scheinen.
Jedes Auge sieht also das ihm zugehörige Bild an demselben
Orte des Raums, und der Beobachter erhält daher den Eindruck,
als ob sich daselbst der Gegenstand körperlich befände.
Brewster hat die Spiegel dieses Instruments durch linsenartig
gebogene Prismen ersetzt, und diese Stereoskope (Fig. 2) sind jetzt
allgemein im Gebrauch.
Fig. 1. Wheatstones Spiegelstereoskop.
^ Fig. 2. Brewster Linsenstereoskop.
Eine Sammellinse von etwa 18 cm Brennweite ist
durchschnitten; die beiden Hälften A und B sind, mit ihren
scharfen Kanten gegeneinander gerichtet, in einem
Gestell befestigt, und am Boden desselben wird das
Blatt, welches die beiden Zeichnungen aa' und bb'
(gewöhnlich
photographische Bilder) enthält,
eingeschoben. Durch die Anwendung der Linsenstücke ist es
zunächst möglich, die Bilder dem
Auge näher zu bringen; dann aber wirken sie auch wie
Prismen, indem die Linsenhälfte vor dem rechten Auge das Bild
etwas nach dem linken schiebt, während das Bild der mit dem
linken Auge betrachteten Zeichnung etwas nach rechts gerückt
erscheint. Auf diese Weise wird das vollständige
Zusammenfallen der beiden Bilder bei CC' hervorgebracht. Wenn man
durch eine zwischen den Bildern befindliche senkrechte Scheidewand
dafür sorgt, daß
jedes Auge nur das ihm zugehörige, nicht aber das für
das andre
bestimmte Bild sieht, so ist eine besondere Vorrichtung, um die
Bilder zur Deckung zubringen, gar nicht nötig
(S. von Frick). Im S. von Steinhauser mit konkaven Halblinsen
muß das für das rechte Auge bestimmte Bild links, das
für das linke bestimmte rechts liegen;
die Bilder des Brewsterschen Stereoskops würden darin mit
verkehrtem Relief erscheinen. Die Bedeutung der Stereoskope, welche
durch die Photographie eine so wesentliche Förderung gefunden
haben, ist bekannt; man benutzt sie außer zur Unterhaltung
auch zur Veranschaulichung trigonometrischer und stereometrischer
Lehrsätze und zum Studium der Gesetze des binokularen Sehens.
Dove demonstrierte mit Hilfe des Stereoskops die Entstehung des
Glanzes. Ist nämlich die Fläche einer Zeichnung blau und
die entsprechende der andern gelb angestrichen, so sieht man sie,
wenn man sie im S. durch ein violettes Glas
betrachtet, metallisch glänzend. Weiß und Schwarz
führen zu einem noch lebhaftern Bilde der Art. Auch zur
Unterscheidung echter Wertpapiere von unechten hat Dove das S.
benutzt. Betrachtet man nämlich die zu vergleichenden Papiere
mit dem Instrument, so werden sofort die kleinsten Unterschiede
bemerkbar. Die einzelnen Zeichen, die nicht genau mit dem Original
übereinstimmen, decken sich nicht und befinden sich
anscheinend in verschiedenen Ebenen. Es wurde schon erwähnt,
daß der Gesichtswinkel sehr klein wird, wenn wir beide Augen
auf einen weit entfernten Punkt richten. Darum vermindern sich die
Vorteile des Sehens mit zwei Augen in dem Maß, als die zu
beschauenden Gegenstände weiter weg liegen, und verschwinden
bereits völlig beim Betrachten einer landschaftlichen Ferne.
Die Augen liegen zu nahe, als daß sich einem jeden derselben
ein merklich verschiedenes
Bild darstellen könnte. Helmholtz hat deshalb das
Telestereoskop konstruiert, welches dem Beschauer zwei sich
deckende Bilder einer Landschaft darbietet, gleich als ob das eine
Auge von dem andern mehrere Fuß abstände. Das Instrument
besteht aus vier Planspiegeln, welche senkrecht in einem
hölzernen Kasten und unter 45° gegen die längsten
Kanten desselben geneigt befestigt sind. Das von dem fernen Objekt
kommende Licht fällt auf die zwei äußern
großen Spiegel, wird von diesen rechtwinkelig auf die
beiden
300
Stereotomie - Sterigmen.
innern reflektiert und gelangt, nachdem es auch von den kleinen
innern Spiegeln rechtwinkelig reflektiert wurde, in die Augen des
Beobachters. Jedes Auge erblickt in den kleinen Spiegeln das von
den großen Spiegeln reflektierte Bild der Landschaft in einer
solchen perspektivischen Projektion, wie sie von den beiden
großen Spiegeln aus erscheint. Will man das Bild
vergrößern, so kann man die Lichtstrahlen, ehe sie in
die Augen gelangen, auch noch durch kleine Fernrohre gehen lassen.
Wie man mikroskopische Bilder körperhaft erscheinen lassen
kann, ist unter Mikroskop, S. 602, angegeben worden. Vgl. Brewster,
The stereoscope (Lond. 1856); Ruete, Das S. (2. Aufl., Leipz.
1867); Steinhauser, Über die geometrische Konstruktion der
Stereoskopbilder (Graz 1870).
Stereotomie (griech.), der Teil der Stereometrie, welcher
die Durchschnitte der Oberflächen der Körper behandelt,
insbesondere der sogen. Steinschnitt, welcher bei
Gewölbekonstruktionen in Anwendung kommt. Ihre Darstellungen
werden durch die beschreibende Geometrie zur Anschauung
gebracht.
Stereotypie (griech.), das Verfahren, von aus beweglichen
Lettern gesetzten Druckseiten vertiefte Formen abzunehmen und
vermittelst derselben erhöhte, den Satzseiten genau
entsprechende Druckplatten zu gewinnen. Die S. bietet sehr
große Vorteile dar; ohne sie würde die Schnellpresse bei
weitem nicht ihren jetzigen hohen Wert erlangt haben, und das
Zeitungswesen hätte nicht annähernd seine
gegenwärtige Entwickelung gewinnen können. Die S.
ermöglicht jederzeit den Druck neuer Auflagen von den durch
sie erzeugten Platten; das Papierstereotypieverfahren bietet sogar
die Möglichkeit der Aufbewahrung billiger Matrizen, aus denen
bei Bedarf Platten gegossen werden können, reduziert somit
ganz außerordentlich die Anlagekosten für Druckwerke.
Als erste Erzeugnisse der S. können betrachtet werden die
Reproduktionen von Holzschnitten in einem 1483 zu Ulm von Konrad
Dinkmut gedruckten Buch: "Der Seele Wurzgarten". Van der Mey und
Johann Müller zu Leiden (1700-1716), Ged in Edinburg
(1725-49), Valeyre in Paris (1735), Alexander Tilloch und Foulis zu
Glasgow (um 1775), F. J. Joseph Hoffmann zu Schlettstadt im
Elsaß (1783), der eine Anzahl experimentierender Nachfolger
(unter andern Carez in Toul) erhielt, sind nacheinander als
Erfinder der S. bezeichnet worden; zu dauernder Verbreitung aber
wurde das Verfahren erst gebracht durch Earl Stanhope (s. d. 2) in
London (1800) sowie um dieselbe Zeit durch Pierre und Firmin Didot
und Herhan in Paris. Zu ihrer heutigen großen Bedeutung
gelangte die S. durch die Erfindung von Genoux (1829), welcher die
Matrize aus Lagen von Seidenpapier mit einem dazwischengestrichenen
Gemisch von Kleister und Schlämmkreide etc. bildete. Bei dem
Stanhopeschen oder Gipsverfahren wird die Satzform in einem
eisernen Rahmen festgeschlossen (eingespannt) und leicht
geölt, worauf der Gips als dünnflüssiger Brei
über den Typensatz gegossen und mit Bürste oder Pinsel
gehörig eingearbeitet wird. Die Gipsmatrize erstarrt in 15-20
Minuten; sie wird dann abgehoben und in einen Trockenofen gebracht.
Der Guß geschieht in sargähnlichen eisernen
verschließbaren Pfannen. Auf den Boden der Pfanne wird zuerst
eine abgedrehte Eisenplatte gelegt, hierauf die erhitzte Gipsform
mit der Bildfläche nach unten und nun der ebenfalls abgedrehte
Pfannendeckel, welcher an allen vier Ecken abgestumpft ist, um dem
Metall den Einlauf zu gestatten. Das Ganze wird durch einen
Bügel geschlossen und mittels eines Krans in den mit
flüssigem Metall versehenen Schmelzkessel versenkt; nach
erfolgtem Guß wird die Pfanne aufgewunden und auf ein mit
nassem Kies angefülltes Kühlfaß abgesetzt. Nach dem
völligen Erstarren des Metalls wird die Stereotypplatte
gerichtet, auf der Rückseite abgeebnet und an den Rändern
bestoßen. Bei dem von Daulé in Paris um 1830
erfundenen Flaschenguß bleibt die Gipsmater in dem nach innen
mit einem Vorstoß versehenen Rahmen, welcher hinlänglich
groß ist, um noch Raum für einen Nachdruck gebenden
Anguß zu gewähren. Nach dem Trocknen bringt man diesen
Matrizenrahmen in die Gießflasche, die aus zwei abgeebneten
Eisenplatten besteht, von denen die der Bildfläche zugekehrte
mit Papier beklebt ist, um das Metall beim Eingießen weniger
abzuschrecken. Beide Platten sind unten durch ein Scharnier
verbunden und während des Gusses durch einen
Schraubenbügel zusammengehalten. Bei dem
Papierstereotypieverfahren wird die Matrize aus Seiden- und
Schreibpapier angefertigt; zwischen die einzelnen Bogen kommen
dünne, gleichmäßig ausgestrichene Schichten eines
Breies, der aus gekochter, mit Schlämmkreide oder Magnesia,
wohl auch mit Asbest oder China Clay, versetzter Weizenstärke
besteht. Auf die mit einem zarten Pinsel oder auch mittels einer
mit Flanell bezogenen Walze leicht geölte Form wird dann das
Matrizenpapier gelegt und entweder mit einer Bürste
gleichmäßig in den Schriftsatz eingeklopft, oder die
Form wird mit der Matrize unter eine feststehende Walze geschoben,
mit Filzen bedeckt und unter derselben durchgedreht; sodann schiebt
man dieselbe mit der darauf befindlichen Papiermatrize in eine
erhitzte Trockenpresse und bedeckt sie reichlich mit Filz und
Fließpapier zum Aufsaugen der Feuchtigkeit; schon nach 6-8
Minuten ist die Matrize trocken und kann abgenommen werden. Nachdem
sie beschnitten, in größern, beim Druck weiß
bleibenden Stellen durch Hinterkleben von Pappstückchen oder
auch durch Ausfüllen mit einer aus in dünner
Gummiarabikumlösung verrührter Schlämmkreide
erzeugten, leicht trocknenden Masse verstärkt und ein
Eingußstreifen angeklebt worden, kommt sie mit dem Gesicht
nach oben in das Gießinstrument, das dem beim
Dauléschen Verfahren gebräuchlichen sehr ähnlich
ist; ein verstellbarer eiserner Rahmen, Gießwinkel genannt,
hält sie glatt und gibt das Maß ab für ihre Dicke,
und der Guß kann erfolgen. Das Abschneiden des Angusses, das
Anhobeln von Facetten an den Rändern der Platten geschieht in
Zeitungsdruckereien mit eigens dafür hergerichteten Maschinen,
wodurch eine große Betriebsbeschleunigung ermöglicht
wird, so daß z. B. in der Londoner "Times" bei deren
Morgenausgabe die letzte Druckplatte innerhalb 8 Minuten, vom
Empfang der Satzform seitens des Stereotypeurs ab gerechnet, fertig
gestellt werden kann. Für den Kleinbetrieb der Buchdruckereien
hat man die S. durch Konstruktion kleiner, kompendiöser
Stereotypie-Einrichtungen nutzbar gemacht; diese ermöglichen
die Herstellung von Platten bis zu einer gegebenen Größe
schon nach kurzer Übung bei geringen Anlagekosten. Vgl.
außer den ältern Werken von Camus (Par. 1802) und
Westreenen de Tiellandt (Haag 1833): H. Meyer, Handbuch der S.
(Braunschw. 1838); Isermann, Anleitung zum Stereotypengießen
(Lpz. 1869); Archimowitz, Die Papierstereotypie (Karlsr. 1862);
Böck, Die Papierstereotypie (Leipz. 1885); Kempe, Wegweiser
durch die S. und Galvanoplastik (das. 1888).
Sterigmen, s. Basidien.
301
Steril - Stern.
Steril (lat.), unfruchtbar, dürr; Sterilität,
Unfruchtbarkeit; sterilisieren, unfruchtbar machen, in der
Bakteriologie von entwicklungsfähigen Keimen befreien ; s.
Bakterioskopische Untersuchungen.
Sterkoral (lat.), kotig.
Sterkrade, Dorf im preuß. Regierungsbezirk
Düsseldorf, Kreis Ruhrort, Knotenpunkt der Linien
Oberhausen-Emmerich und Ruhrort-Wanne (Emscherthalbahn) der
Preußischen Staatsbahn, 41 m ü. M., hat eine
evangelische und eine kath. Kirche, ein großes
Eisenhüttenwerk, Maschinenfabrikation, Kettenschmiederei und
(1885) 7164 meist kath. Einwohner.
Sterkuliaceen, dikotyle, etwa 500 Arten umfassende, der
Tropenzone eigentümliche Familie aus der Ordnung der
Kolumniferen, meist Bäume, deren grüne Teile mit
sternförmigen Haaren bekleidet sind. Die
Blätter sind wechselständig, meist an der Basis des
Blattstiels mit abfallenden Nebenblättern versehen. Die
regelmäßigen, meist zwitterigen,
fünfzähligen
Blüten haben einen verwachsenblätterigen, in der
Knospe klappigen Kelch, eine gedrehte, selten verkümmerte,
fünfblätterige Blumenkrone, einen doppelten
Staubblattkreis mit mehr oder weniger verwachsenen, zum Teil durch
Spaltung vermehrten oder auch zu Staminodien verkümmerten
Gliedern und einen
oberständigen, aus meist fünf Fruchtblättern
gebildeten Fruchtknoten. Die Frucht ist entweder eine
fünffächerige Kapsel und springt meist fachspaltig mit
fünf Klappen auf, welche auf ihrer Mitte die von der
Mittelsäule sich lösenden Scheidewände tragen, oder
sie ist eine Steinbeere oder Beere mit 5, 3, 2 oder einem Fach,
oder sie besteht aus mehreren freien, holzigen, krustigen oder
häutigen Balgfrüchten, welche an der Bauchnaht aufgehen
und innen häufig dicht wollig behaart sind. Die Samen haben
ein fleischiges oder kein Endosperm und einen geraden oder
gekrümmten Keimling mit faltigen, blattartigen oder
fleischigen Kotyledonen. Die mit den Malvaceen verwandte Familie,
zu welcher man auch die Bombaceen und Büttneriaceen (s. d.)
rechnet, waren schon in der Tertiärzeit durch eine Anzahl von
Arten aus den Gattungen Sterculia L. und Bombax L. vertreten.
Sterlett, s. Stör.
Sterling, im Mittelalter engl. Silbermünze,
welche
um 1190 aufkam, jetzt englische Währung, die seit
1816 in dem in Gold ausgeprägten Sovereign ihre
Einheit findet. Ein Pfund S. in Gold wiegt gesetzlich 7,9881 g,
enthält 7,3224 g fein Gold, ist 11/12 fein und hat einen Wert
von 20,4295 deutschen Goldmark.
Das Pfund S. (meist geschrieben L oder l.) zerfällt
in 20 Schillinge (s.) à 12 Pence (d.). Der Ursprung des
Namens S. ist von den Osterlingen (Easterlings) abzuleiten,
worunter die Normannen diejenigen deutschen Stämme verstanden,
die den Dänen nahe wohnten. Ein damaliger Penny Easterling wog
24 Gran, 240 machten 1 Pound Easterling (= 12 Unzen) aus, aus dem
das neuere Pfund S. entstand.
Sterling, Stadt im nordamerikan. Staat Illinois, am Rock
River, 170 km westlich von Chicago, hat lebhaften Handel und (1880)
5087 Einw.
Sterling, John, engl. Dichter und Schriftsteller, geb.
20. Juli 1806 zu Kaimes-Castle auf der Insel Bute, Sohn des
Kapitäns Edward S. (geb. 1773, gest. 1847), eines eifrigen und
angesehenen Mitarbeiters an der "Times" (genannt "the thunderer of
the Times"), studierte in Glasgow und Cambridge, ging dann nach
London, wo er für Zeitschriften thätig war und den Roman
"Arthur Coningsby" (1833) veröffentlichte, ließ sich
1834 zum Geistlichen ordinieren und erhielt das Pfarrverweseramt zu
Hurstmonceaux, das er indessen bald wieder aufgab. Er lebte nun
wieder litterarischen Beschäftigungen meist
im Süden Englands und starb 18. Sept. 1844 in
Ventor auf der Insel Wight. Seine übrigen Werke sind:
"Poems" (1839); "The election", ein satirisches Gedicht in 7
Büchern (1841), und das Trauer-
spiel "Stafford" (1843). Seine gesammelten Prosawerke: "Essays
and tales" gab Hare (1848, 2 Bde.) heraus; aus seinem Nachlaß
erschienen: "Twelve letters by John S." (1851) und "The onyx
ring"
(hrsg. von Hale, Boston 1856). Seine Biographie schrieb sein
Freund Carlyle (Lond. 1851).
Sterlitamak, Kreisstadt im russ. Gouvernement Ufa, am
Flüßchen Sterleja, das in die Bjelaja mündet, hat 2
Kirchen, eine Moschee, bedeutende Gerbereien und (1886) 9447
Einw.
Stern, leuchtender Himmelskörper, s. Fixsterne,
Planeten, Kometen; heraldische Figur, Symbol des Glücks und
des Ruhms; in der Nautik (unrich-
tig) das Hinterteil des Schiffs (vgl. Heck); als kriti-
sches Zeichen, s. Asteriskos.
Stern, 1) Julius, Komponist und Dirigent, geb.
8. Aug. 1820 zu Breslau, trat schon mit zwölf Jahren als
Violinspieler öffentlich auf, ward 1834 auf
der Akademie der Künste zu Berlin Rungenhagens und Bachs
Schüler in der Komposition und empfing 1843 auf zwei Jahre ein
Staatsstipendium, das er zunächst zu einem längern
Aufenthalt in Dresden benutzte, um bei Mieksch gründliche
Studien im Gesang zu machen. Von hier begab er sich nach Paris, wo
er als Dirigent des Deutschen Männergesangvereins
glänzende Erfolge hatte. 1847 nach Berlin
zurückgekehrt, gründete er hier seinen später
berühmt gewordenen Chorgesangverein, dessen Direktion 1873
Stockhausen, 1878 M. Bruch, 1880 E. Rudorff übernahm. 1850
begründete er gemeinschaftlich mit Kullak und Marx das
Konservatorium der Musik, welches er, nachdem 1855 Kullak und zwei
Jahre später auch Marx ausgeschieden waren, allein
übernahm und bis an seinen Tod mit ungewöhnlichem
Geschick geleitet hat. Geringern Erfolg hatte seine Wirksamkeit als
Orchesterdirigent 1869-71 an der Spitze der Berliner
Symphoniekapelle sowie 1873-75 an der von ihm organisierten Kapelle
der Reichshallen, wiewohl seine Leistungen auch auf diesem Gebiet
hervorragend waren. Er starb 27. Febr. 1883. Von seinen
Kompositionen haben namentlich die Lieder und
Gesangunterrichtswerke vielen Beifall gefunden. Vgl. R. Stern,
Erinnerungsblätter an J. S. (Leipz. 1886).
2) Adolf, Dichter und Literarhistoriker, geb. 14. Juni 1835 zu
Leipzig, trat, nachdem er seine Bildung in bedrängten
Jugendjahren auf selbständigem Wege gewonnen, sehr früh
in die Litteratur ein, indem er
mit "Sangkönig Hiarne" (Leipz. 1853, 2. Aufl. 1857),
einer nordischen Sage, debütierte, der die Dichtungen:
"Zwei Frauenbilder" (das. 1856) und "Jerusalem"
(das. 1858, 2. Aufl. 1866) folgten. Nachdem S. 1852
bis 1853 in Leipzig philosophischen und historischen Studien
obgelegen, lebte er in den folgenden Iahren teils in Weimar, teils
in Chemnitz und Zittau litterarischen Studien und ging 1859,
nachdem er die
philosophische Doktorwürde erworben, als Lehrer der
Geschichte und deutschen Litteratur nach Dresden, wo der Roman "Bis
zum Abgrund" (Leipz. 1861, 2 Bde.) und das Lustspiel "Brouwer und
Rubens" (das. 1861) entstanden. Im Herbst 1861 siedelte er dann zu
erneuten sprachwissenschaftlichen und historischen Studien nach
Jena über, ließ sich 1863 in
Schandau nieder und kehrte 1865 nach Dresden zurück, wo er
1868 zum außerordentlichen, 1869 zum
302
Sterna - Sternberg.
ordentlichen Professor der Litteratur und Kulturgeschichte am
Polytechnikum ernannt ward. Als Resultate dieser Jahre traten seine
"Gedichte" (Leipz. 1860, 3. Aufl. 1882), die Novellen: "Am
Königssee" (das. 1863) und "Historische Novellen" (das. 1866)
hervor, welche einen bedeutenden Fortschritt bekundeten. Als
Litterarhistoriker veröffentlichte er die Anthologie:
"Fünfzig Jahre deutscher Dichtung" (Leipz. 1871, 2. Aufl.
1877); "Katechismus der allgemeinen Litteraturgeschichte" (das.
1874, 2. Aufl. 1876); "Aus dem 18. Jahrhundert", Essays (das.
1874); "Zur Litteratur der Gegenwart", Studien und Bilder (das.
1880); "Lexikon der deutschen Nationallitteratur" (das. 1882);
"Geschichte der neuern Litteratur" (das. 1883-85, 7 Bde.);
"Geschichte der Weltlitteratur" (Stuttg. 1887-88) sowie mehrere
litterar-historische Monographien in Riehls "Historischem
Taschenbuch", Arbeiten, von denen namentlich der "Geschichte der
neuern Litteratur" umfassendes Wissen, Sicherheit des Urteils,
Geschmack in der Darstellung und Größe der historischen
Auffassung zugestanden werden. Spätere poetische Werke sind:
"Das Fräulein von Augsburg", Roman (Leipz. 1867); "Neue
Novellen" (das. 1875); die Tragödie "Die Deutschherren"
(Dresd. 1878); die epische Dichtung "Johannes Gutenberg" (Leipz.
1873, 2. Aufl. 1889); das Novellenbuch "Ans dunklen Tagen" (das.
1879, 2. Aufl. 1880); die Romane: "Die letzten Humanisten" (3.
Aufl., das. 1889), "Ohne Ideale" (das. 1881, .2 Bde.) und "Camoens"
(das. 1887); "Drei venezianische Novellen" (das. 1886), Werke,
welche uns S. als einen Dichter von reicher Phantasie und
künstlerischer Darstellung erkennen lassen. Er schrieb noch:
"Wanderbuch", Bilder und Skizzen (Leipz. 1877, 2. Aufl. 1886),
"Hermann Hettner", Lebensbild (das. 1885), "Die Musik in der
deutschen Dichtung" (das. 1888) und gab "W. Hauffs sämtliche
Werke" (Berl. 1879, 4 Bde.), "Herders ausgewählte Schriften"
(Leipz. 1881, 3 Bde.), "Chr. Gottfr. Körners gesammelte
Schriften" (das. 1882) und die 22. Auflage von Vilmars "Geschichte
der deutschen Nationallitteratur" mit Fortsetzung (1887, 23. Aufl.
1889) heraus. - Seine Gattin Margarete, geborne Herr, geb. 25. Nov.
1857 zu Dresden, Schülerin Liszts, ist eine namhafte, durch
echt musikalische Natur und Poesie der Auffassung hervorragende
Klavierspielerin.
3) Alfred, Historiker, geb. 22. Nov. 1846 zu Göttingen,
studierte in Heidelberg, Göttingen und Berlin, erhielt darauf
eine Anstellung im badischen Generallandesarchiv zu Karlsruhe,
habilitierte sich, nachdem er 1871 eine Studienreise nach England
unternommen, 1872 für Geschichte in Göttingen und wurde
1873 Professor der Geschichte in Bern, 1888 am Polytechnikum in
Zürich. Er schrieb: "Über die zwölf Artikel der
Bauern und einige andre Aktenstücke aus der Bewegung von 1525"
(Leipz. 1868), wozu sich Ergänzungen in den "Forschungen zur
deutschen Geschichte" (Bd. 12, 1872) befinden; "Milton und seine
Zeit" (das. 1877-79, 2 Bde.); "Geschichte der Revolution in
England" (in Onckens Geschichtswerk, Berl. 1881); "Briefe
englischer Flüchtlinge in der Schweiz", herausgegeben und
erläutert (Götting. 1874); "Abhandlungen und
Aktenstücke zur Geschichte der preußischen Reformzeit
1807-15" (Leipz. 1885). Gemeinsam mit W. Vischer gab er den 1. Band
der "Baseler Chroniken" (Leipz. 1872) heraus.
4) Daniel, Pseudonym, s. Agoult.
Sterna, Seeschwalbe.
Sternanis, Pflanzengattung, s. Illicium.
Sternapfel, s. Chrysophyllum.
Sternb., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung
für Kaspar Maria v. Sternberg (s. d. 1).
Sternbedeckugen, s. Bedeckung.
Sternberg, alte Landschaft im preuß.
Regierungsbezirk Frankfurt, im O. von der Oder und im Süden
von der Warthe, bildet jetzt die beiden Kreise Oststernberg
(Landratsamt in Zielenzig) und Weststernberg mit der Hauptstadt
Drossen. Vgl. Freier, Geschichte des Landes S. (Zielenzig
1887).
Sternberg, 1) Stadt in Mähren, an der
Ferdinands-Nordbahn (Linie Olmütz-S.) und der Mährischen
Grenzbahn (S.-Grulich), Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines
Bezirksgerichts, hat 9 Vorstädte, eine Landes-Unterrealschule,
eine Webschule, Tabaksfabrik, sehr starke Leinen- und
Baumwollwarenfabrikation, Obstbau (besonders Kirschen), Handel mit
diesen Erzeugnissen und (1880) 14,243 Einw. S. ist im 13. Jahrh.
von Jaroslaw von Sternberg gegründet worden, der hier 1241 die
Mongolen geschlagen hatte. Seit Ende des 17. Jahrh. bildet S. eine
Domäne des Hauses Liechtenstein. -
2) Stadt im preuß. Regierungsbezirk Frankfurt, Kreis
Oststernberg, an der Linie Frankfurt-Posen der Preußischen
Staatsbahn, 91 m ü. M., hat eine evang. Kirche und (1885) 1568
Einw. -
3) Stadt im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin, Kreis
Mecklenburg, an einem See, hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht,
eine Forstinspektion, (1885) 2646 Einw. und ist abwechselnd mit
Malchin Sitz der mecklenburgischen Stände. Nach S. benannt
sind die sogen. Sternberger Kuchen, Reste der Tertiärformation
innerhalb der Diluvialschichten.
Sternberg, 1) altes freiherrliches, später
reichsgräfliches Geschlecht aus Franken, das in
Österreich, Böhmen und Mähren begütert ist, in
Böhmen seit dem 13. Jahrh. urkundlich auftaucht und 1663 von
Kaiser Leopold I. in den Reichsgrafenstand erhoben ward. Die
böhmische Linie teilte sich Anfang des 18. Jahrh. in eine
ältere und jüngere. Jene erwarb durch Heirat 1762 die
reichsunmittelbaren, in der Eifel gelegenen Herrschaften der Grafen
Manderscheid mit Sitz und Stimme im westfälischen
Grafenkollegium, nannte sich seitdem S.-Manderscheid und ward
für den Verlust jener Besitzungen im Lüneviller Frieden
mit den vormaligen Abteien Schussenried und Weißenau
entschädigt, die jetzt eine Standesherrschaft unter
württembergischer Oberhoheit bilden. Die Linie starb 1843 im
Mannesstamm aus. Die jüngere Linie, S.-Serowitz, in
Böhmen begütert, hat zum Haupte den Reichsgrafen Leopold
von S., geb. 22. Dez. 1811, erbliches Mitglied des Herrenhauses des
Reichsrats. Aus dieser Linie stammte auch Kaspar Maria von S., geb.
6. Jan. 1761 zu Prag, anfänglich für den geistlichen
Stand bestimmt, sonders dem Studium der Kunst ergeben, 1748 im
Regensburger, 1788 im Freisinger Kapitel, seit 1795 der Botanik und
den Naturwissenschaften überhaupt ergeben und seit 1809
für Böhmens geistige Kultur rastlos thätig; gest.
20. Dez. 1838 zu Brzesina als Präsident des böhmischen
Nationalmuseums in Prag, dem er seine sämtlichen reichen
naturwissenschaftlichen Sammlungen, darunter eine nach
geognostische Zeitperioden geordnete Petrefaktensammlung,
vermachte. Man verdankt ihm die ersten tüchtigen Arbeiten
über gewisse Gruppen vorweltlicher Pflanzen; sein Hauptwerk
ist der "Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der
Flora der Vorwelt" (Prag 1820-32, 2 Bde. mit 160 Tafeln). Auch
lieferte S. eine Monographie über die Saxifrageen und mehrere
Arbeiten über die böhmische Flora etc. Seinen
Briefwechfel mit Goethe aus den Jahren 1820-32 gab Bratranek
303
Sternberger Kuchen - Sternkarten.
(Leipz. 1866) heraus. Vgl. Palacky, Leben des Grafen Kaspar S.
(Prag 1868).
2) Alexander von, Schriftsteller, s. Ungern-Sternberg.
Sternberger Kuchen, s. Tertiärformation.
Sternbilder (Konstellationen), Gruppen von Fixsternen zu
leichterer Übersicht und Bezeichnung, wurden schon von den
alten Ägyptern aufgestellt und mit zum Teil noch jetzt
gültigen Namen belegt; die Griechen führten viele
mythologische Bezeichnungen ein. Nähere Angaben sowie ein
Verzeichnis der S. enthält das Textblatt der Karte
"Fixsterne".
Sternblume, s. Aster und Narcissus.
Sterndeutekunst, s. Astrologie.
Sterndienst (Sternanbetung), s. Sabäismus.
Sterndolde, s. Astrantia.
Sterne, 1) (spr. stern) Lawrence, berühmter engl.
Humorist, geb. 24. Nov. 1713 zu Clonmel in Irland, widmete sich zu
Cambridge theologischen Studien und wurde 1720 Pfarrer in Sutton,
siedelte 1760 nach London über, bereiste dann Frankreich und
Italien und starb 18. März 1768 in London. Sein Hauptwerk ist
: "The life and opinions of Tristram Shandy" (Lond. 1759-67, 9
Bde., oft aufgelegt; deutsch von Gelbke, Hildburgh. 1869), von dem
die beiden ersten Bände ihn bereits auf den Gipfel der
Popularität erhoben. Die Neuheit und Seltsamkeit seines Stils
erregte allgemeines Aufsehen; er wurde der verzogene Liebling der
feinen Gesellschaft Londons. "Tristram Shandy" ist eine
Erzählung, die aus einer Reihe von Skizzen besteht und teils
unter der Maske des Yorick (S. selbst), eines Geistlichen und
Humoristen, teils unter derjenigen des phantastischen Tristram
vorgetragen wird. Das Ganze ist, ähnlich wie bei unserm Jean
Paul, mit wunderlicher Gelehrsamkeit verquickt und mehr ein buntes
Durcheinander als ein planvolles Kunstwerk. Viel lesbarer als
"Tristram Shandy" ist Sternes "Sentimental journey through France
and Italy" (Lond. 1768 u. öfter; deutsch von Böttger,
Berl. 1856; von Eitner, Hildburgh. 1868) geblieben. Der geistvolle,
scharf beobachtende, tief empfindende Reisende, hinter dessen
leicht hingeworfenen Liebesabenteuern man übrigens kaum einen
Geistlichen vermutet, ist eins der frischesten und
unvergänglichsten Charakterbilder des 18. Jahrh. Außer
den genannten Schriften erschienen von S. mehrere Bände
"Sermons" (1760 ff.), die nicht minder den Humoristen verraten,
sowie nach seinem Tod "Letters to his most intimate friends" (1775,
3 Bde.) und sein Briefwechsel mit Elisa (Elizabeth Draper), einer
indischen Lady, zu der er eine Zeitlang in einem
Liebesverhältnis stand (1775). Von den vielen Gesamtausgaben
der Sterneschen Werke ist die neueste, mit Sternes
Selbstbiographie, von Browne besorgt (1884, 2 Bde.). Vgl. Ferriax,
Illustrations of S. (Lond. 1798); Traill, L. S. (das. 1882);
Fitzgerald, Life of L. S. (das. 1864, 2 Bde.), worin auch Sternes
merkwürdiges Schicksal nach dem Tod mitgeteilt ist, indem sein
Leichnam von den Wiederauferstehungsmännern nach Cambridge auf
die Anatomie verkauft wurde.
2) Carus, Pseudonym, s. Krause 5).
Sterneichuugen, das von William Herschel angewandte
Verfahren, um die Verteilung der Sterne im Weltraum zu ermitteln:
ein Fernrohr wird nach und nach auf verschiedene Punkte des Himmels
eingestellt und die Zahl der gleichzeitig im Gesichtsfeld
erscheinenden Sterne abgezählt, worauf aus mehreren
benachbarten Zählungen unter Berücksichtigung der
Größe des Gesichtsfeldes ein Schluß auf die Dichte
der Sterne an der betreffenden Stelle des Himmels gemacht werden
kann. Herschel kam 1785 auf dieses Verfahren und durchmusterte nach
demselben mit seinem 20füßigen Spiegelteleskop, dessen
Gesichtsfeld ungefähr 1/833000 des ganzen Himmels betrug, die
Zone vom 45.° nördl. bis 15.° südl. Deklination,
in welcher er 3400 Felder abzählte.
Sterngewölbe, s. Gewölbe, S. 312 (mit
Abbild.).
Sterngucker, s. Dummkoller.
Sternhaufen, s. Fixsterne, S. 322, und Nebel
(Nebelflecke).
Sternhaufen, s. Stör.
Sternjahr, s. Jahr.
Sternkammer (lat. Camera stellata, engl. Star Chamber),
engl. Gerichtshof, von König Heinrich VII. eingesetzt,
welcher, aus dem Lord-Kanzler und aus königlichen Räten
bestehend, über Staats- und Majestätsverbrechen urteilte
und unter den letzten Stuarts durch Härte und Willkür
sich sehr verhaßt machte. Sterne zierten die Decke des
Sitzungssaals, daher der Name. Sie ward 1641 aufgehoben (s.
Großbritannien, S. 797).
Sternkarten, Darstellung der Himmelskugel mit den Sternen
auf einer ebenen Fläche, gewöhnlich in stereographischer
oder zentraler Projektton (vgl. Landkarten). Die älteste
bemerkenswerte Sammlung von S. ist Bayers "Uranometria" (Augsb.
1603), 51 Blätter nebst einem Katalog von 1706 Sternen;
gleichfalls aus dem 17. Jahrh. ist Schillers "Coelum stellatum
christianum" (das. 1627) in 55 Blättern, worin an die Stelle
der alten Sternbilder die Apostel, Propheten und Heiligen gesetzt
waren, sowie Hevels "Firmamentum Sobiescianum" (Danz. 1690), 54
Blätter mit 1900 Sternen. Verdrängt wurden diese Atlanten
durch Flamsteeds "Atlas coelestis britannicus" (Lond. 1729, 28 Bl.;
kleinere Ausg. von Fortin, Par. 1776, und neu aufgelegt 1796),
welcher 2919 Sterne enthält und von Bode in Berlin 1782
verbessert in 34 Blättern herausgegeben wurde. 1782 erschien
Bodes "Représentation des astres" (Stralsund), auf 34
Blättern gegen 5000 Sterne enthaltend, worauf seine 20
großen Himmelskarten in der "Uranographia" (Berl. 1802; 2.
Aufl., das. 1819) mit 17,240 Sternen folgten. Diese ältern
Karten, auf denen überdies die ausführliche Zeichnung der
Sternbilder sehr störend wirkt, konnten dem Bedürfnis der
Astronomen nicht mehr genügen, seitdem man das Kreismikrometer
zur Beobachtung der Kometen anwandte; es kam jetzt darauf an,
möglichst viel Sterne, auch schwächere, in der Karte zu
haben. Hardings "Atlas novus coelestis" (Götting. 1822; neue
Ausg., Halle 1856), der auf 27 Tafeln 120,000 Sterne enthält,
war in dieser Hinsicht epochemachend. Aus späterer Zeit sind
zu nennen: Argelanders "Neue Uranometrie" (Berl. 1843), welche ein
getreues Bild des gestirnten Himmels gibt, wie er sich im mittlern
Europa dem bloßen Auge darstellt; dessen "Atlas des
nördlichen gestirnten Himmels" (Bonn 1857-63, 40 Karten) und
Schwincks "Mappa coelestis" (Leipz. 1843), welche in 5
Blättern den nördlichen gestirnten Himmel bis zu 30°
südl. Deklination darstellt. Eine bis dahin unbekannte
Ausführlichkeit zeigen die "Akademischen S.", welche auf
Bessels Anregung und auf Kosten der Berliner Akademie der
Wissenschaften 1830-59 von Argelander, Bremiker, Harding,
Göbel, Hussey, Inghirami, d'Arrest, Boguslawski, Fellecker,
Hencke, Knorre, Morstadt, Bluffen, Steinheil und Wolfers
veröffentlicht worden sind und alle Sterne zwischen 15°
nördlicher und südl. Deklination bis herab zur neunten
und teilweise bis zur zehnten Größe enthalten. Diese
304
Sternkataloge - Sternschnuppen.
Karten haben bei der ersten Aufsuchung des Planeten Neptun und
bei der Entdeckung der Planetoiden wesentliche Dienste geleistet.
Für derartige Zwecke genügt es aber, alle Fixsterne in
der Nähe der Ekliptik genau zu verzeichnen, da jeder Planet
zweimal bei seinem Umlauf die Ekliptik schneidet; dies gab den
Anlaß zur Entwerfung der "Ekliptischen Atlanten" von Hind und
Chacornac, welcher letztere von der Pariser Sternwarte vollendet
wird und die Sterne bis herab zur 13. Größe und bis auf
2 1/2° Abstand von der Ekliptik auf mehr als 72 Karten
darstellen wird. Für Laien sind geeignet: Littrow, Atlas des
gestirnten Himmels (3. Aufl., Stuttg. 1866); Dieu, Atlas celeste
(Par. 1865); Proctor, A star atlas showing all the stars visible to
the naked eye and 1500 objects of interest in 12 circular maps
(Lond. 1870); Heis, Neuer Himmelsatlas (Köln 1872), welcher
auf 12 Karten alle im mittlern Europa am Himmel sichtbaren Objekte
darstellt und namentlich auch durch sehr genaue Zeichnung der
Milchstraße sich auszeichnet; etwas Ähnliches leistet
für den südlichen Himmel Gould, Uranometria Argentina
(1879), und für beide Hemisphären Houzeau,
Uranométrie générale (Brüssel 1878);
Klein, Sternatlas (Köln 1887); Schurig, Himmelsatlas (Leipz.
1886); Messer, Sternatlas für Himmelsbeobachtungen (Petersb.
1888).
Sternkataloge, Verzeichnisse der Örter von
Fixsternen für einen bestimmten Zeitpunkt mit Angabe
derjenigen Größen, welche notwendig sind, um die
Örter zu andern Zeiten zu berechnen. Der älteste, von
Hipparch entworfene enthielt 1080 Sternpositionen für das Jahr
128 v. Chr.; ihm ist wahrscheinlich der im "Almagest" des
Ptolemäos enthaltene mit 1025 Sternen nachgebildet. Aus dem
Mittelalter sind zu nennen die S. des Abd al Rahmân al
Sûfi (903-986): "Description des étoiles fixes,
composée au milieu du X. siècle de notre ère
par l'astronome persan Abd al Rahmân al Sûfi, par
Schjellerup" (Petersb. 1874) und der des Herrschers von Samarkand,
Ulugh Beigh, mit 1019 Sternpositionen für 1437: "Ulugh Beigh,
tabulae astronomicae, ed. Th. Hyde" (Oxf. 1665) und das Sammelwerk
von Baily: "The catalogues of Ptolemy, Ulugh Beigh. Tycho Brahe,
Halley, Hevelius" (Lond. 1843). Im christlichen Abendland entwarf
zuerst Tycho Brahe (1600) ein Verzeichnis von 777 Sternen, sodann
(1660) Hevel eins von 1564 Sternen. Leider konnte der letztere sich
nicht zum Gebrauch des Fernrohrs bei seinen Beobachtungen
entschließen, weshalb auch sein Katalog rasch verdrängt
wurde durch den von Flamsteed in der "Historia coelestis
britannica" (Lond. 1712; 2. Ausg. von Halley, 1725)
veröffentlichten, welcher 2866 Sterne zählt. Lalandes
"Histoire celeste" (Par. 1801) enthält die Örter von
47,390 Sternen, die später von Baily mit Hilfe der von
Schumacher gegebenen Reduktionstafeln auf die Epoche 1800 reduziert
wurden (Lond. 1847), und Piazzi veröffentlichte (1803) ein
Verzeichnis von 6748 Sternen, welche Zahl in der spätern
Ausgabe ("Praecipuarum stellarum inerrantium positiones mediae
ineuntesaeculo XIX., ed. altera", Pal. 1814) auf 7646 vermehrt ist.
Epochemachend sind Bessels "Fundamentaastronomiae" (Königsb.
1818), welche auf den Beobachtungen Bradleys fußen; daran
reiht sich Argelanders "Bonner Durchmusterung" ("Bonner
Beobachtungen", Bd. 3-5, 1859-62), welche 324,198 am
nördlichen Himmel bis zu 2° südl. Br. sichtbare
Sterne aufzählt (von Schönfeld bis 10° südl. Br.
fortgesetzt). Ferner sind zu nennen: Baily, "The catalogue of stars
of the British Association" (Lond. 1845, 8377 Sternpositionen
für 1850); von Airy eine Reihe von Katalogen nach Greenwicher
Beobachtungen von 1836-41 (das. 1843), 1836-47 (das. 1849), 1848-53
(das. 1856), 1854-60 (das. 1862), 1861-67 (das. 1868); von
Groombridge "Catalogue of circumpolar stars"; Weißes
"Positiones mediae stellarum tixarum in zonis Regiomontanis a
Besselio observatarum" (Petersb. 1846 u. 1863, gegen 70,000
Sterne); Argelanders "Zonenbeobachtungen" (geordnet von W.
Öltzen, Wien 1851, 1852, 1857); Lamonts in den Annalen der
Münchener Sternwarte erschienene Verzeichnisse von Sternen
zwischen 15° nördlicher und südlicher Deklination
(34,634 Sterne, darunter an 12,000 zum erstenmal bestimmte); das
Verzeichnis von Sternen in der Nähe der Ekliptik, die Cooper
und Graham zu Markree Castle in Irland beobachteten, u. a. Von der
südlichen Halbkugel hat zuerst Halley einen Sternkatalog
geliefert, ferner im vorigen Jahrhundert Lacaille ("Coelum australe
stelliferum", Par. 1763; neue engl. Ausg., Lond. 1847); in unserm
Jahrhundert haben Henderson, Fallows, Brisbane, Maclear u. a.
solche S. geliefert, der neueste ist Ellerys "Melbourne catalogue".
Kataloge von Doppelsternen haben hauptsächlich W. Herschel, W.
Struve und I. Herschel geliefert; den des letztern (mit 10,300
Doppel- und vielfachen Sternen) haben Main und Pritchard im 40.
Bande der "Memoiren der Londoner Astronomischen Gesellschaft"
(Lond. 1874) veröffentlicht. Kataloge der veränderlichen
Sterne haben Schönfeld (1866 u. 1874), Dreyer (1888) und
Chandler (1889) geliefert.
Sternkegel, s. Globus, S. 436.
Sternkrant, s. Stellaria.
Sternkreuzorden, österreich. Frauenorden, 18. Sept.
1668 von der Kaiserin Eleonore, zur Erinnerung an ein verlornes und
wiedergefundenes Reliquienkreuz, für adlige Damen zur
Förderung der Andacht zum heiligen Kreuz, des tugendhaften
Lebens und wohlthätiger Handlungen gestiftet. Die Zahl der
Damen ist unbeschränkt, alter Adel unbedingt erforderlich. Die
Ernennungen gehen von der Großmeisterin des Ordens, "der
höchsten Ordensschutzfrau", immer einer österreichischen
Erzherzogin, aus. Die Dekoration, welche viermal geändert
wurde, besteht jetzt in einem kaiserlichen Adler, auf welchem ein
achteckiges rotes Kreuz auf einem blauen liegt; das Ganze ist
medaillonartig gefaßt, und an dem obern Rand zieht sich ein
weiß emailliertes Band mit der Devise: "Salus et gloria" hin.
Das Band ist schwarz. Ordensfesttage sind der 3. Mai und 14.
September.
Sternkunde, s. Astronomie.
Sternmiere, s. Stellaria.
Sternocleidomastoideus (Musculus s.),
Kopfnickermuskel.
Sternsaphir, s. Korund.
Sternschanze, Schanze mit sternförmigem
Grundriß.
Sternschnuppen, Lichtpunkte, die in heitern Nächten
plötzlich am Himmel aufleuchten, rasch eine meist scheinbar
geradlinige, mehr oder minder ausgedehnte Bahn beschreiben und dann
erlöschen, öfters einen leuchtenden Schweif
hinterlassend. Größere derartige Erscheinungen nennt man
Feuerkugeln (s. d.). Während man sie früher für
entzündete, von der Erde aufgestiegene Gase hielt, hat sich
seit Chladni die Überzeugung Bahn gebrochen, daß diese
Erscheinungen herrühren von Körpern, die aus dem Weltraum
zu uns kommen und in den obern Schichten unsrer Atmosphäre zum
Leuchten erhitzt werden. Die
305
Sternschnuppen.
Helligkeit der S. ist sehr verschieden, im Mittel gleich
derjenigen von Fixsternen 4. Größe. Die Farbe ist meist
weiß, ins Gelbe oder Blaue spielend. Nach Schmidt steht
dieselbe im Zusammenhang mit der mittlern Dauer der sichtbaren
Bewegung; er findet dieselbe nämlich für weiße S.
0,75 Sekunden (886 Beobachtungen), für gelbe 0,98 Sek. (400
Beob.), für rote 1,63 Sek. (188 Beob.) und für grüne
1,97 Sek. (125 Beob.). Beim Erlöschen mancher S. beobachtet
man, wie bei den Feuerkugeln, Funkensprühen, auch bisweilen
ein erneutes Aufleuchten. Der leuchtende Schweif, den viele
hinterlassen, dauert häufig mehrere Minuten lang. Diese
Schweife zeigen oft merkwürdige Formverändernngen,
namentlich sieht man bei teleskopischer Beobachtung in den ersten
Sekunden starke wellenförmige Krümmungen; auch haben sie
nach Heis eine seitliche Bewegung. Das Spektrum der S. hat Konkoly
kontinuierlich von vorherrschend gelber oder grüner Farbe, je
nach der Färbung der S., gefunden; Indigo wurde selten, Rot
nur bei roten S., Violett nie beobachtet. Im Spektrum des Schweifs
wurde bei gelben S. Natrium, bei grünen Magnesium, bei roten
Strontium gefunden ; bei einem 156 Sekunden nachleuchtenden Schweif
einer Sternschnuppe, welche die Venus an Helligkeit übertraf,
zeigten sich außer den Natrium- und Magnesiumlinien noch
helle Banden in Grün und Blau. Coulvier-Gravier hat zuerst
darauf aufmerksam gemacht, daß die Zahl der S., die ein
Beobachter stündlich zählt, im allgemeinen im Lauf der
Nacht von den Abendstunden an zunimmt, und Schiaparelli hat dies
dadurch erklärt, daß ein Beobachter um so mehr S. sehen
werde, je höher über dem Horizont der Punkt des Himmels
steht, nach welchem hin die Bewegung der Erde gerichtet ist. Dieser
Punkt, der sogen. Apex, ist aber um einen Vierteltreis nach W. von
der Sonne aus ; er hat also seinen höchsten Stand um
Sonnenaufgang. Nach Schmidt fällt die größte
stündliche Zahl auf die Stunde von früh 2 1/2-3 1/2 Uhr.
Die stündliche Häufigkeit der S. ist auch nicht das ganze
Jahr hindurch gleich; nach Schmidt fällt der kleinste Wert auf
den Februar, der größte auf den August, wenn man absieht
von den gleich zu erwähnenden großen
Novemberströmen. Durch außerordentliche Häufigkeit
der S. sind nämlich die Nächte um den 12. Nov.
ausgezeichnet; insonderheit beobachtete man 12. Nov. 1799, 1833,
1866 und 1867 förmliche Sternschnuppenregen. Es erreicht
dieses Phänomen, wie H. A. Newton bis 902 zurück
dargethan hat, alle 33 Jahre seinen Höhepunkt. Weniger dicht,
aber gleichmäßiger wiederkehrend sind die
Sternschnuppenregen in den Nächten um den 10. Aug.
(Laurentiustag). deren schon in altenglischen Kirchenkalendern
unter dem Namen der "feurigen Thränen des heil. Laurentius"
gedacht wird. Außerdem sind auch die Nächte des 18.-20.
April, 26.-30. Juni, 9.-12. Dez. u. a. durch größere
Häufigkeit der S. ausgezeichnet. Bei den
Sternschnuppenfällen in diesen Nächten bewegt sich die
Mehrzahl der S. in parallelen Bahnen; sie scheinen von einem und
demselben Punkte des Himmels ausgestreut zu werden, wie es sein
muß, wenn diese Körper in größern
Schwärmen Bahnen um die Sonne beschreiben. Dieser
Ausstreuungspunkt oder Radiant liegt für die
Novembersternschnuppen im Sternbild des Löwen (10 Stund.
Rektaszension und 23° nördl. Deklination) , für die
Laurentius-S. im Perseus (2,9 Stund. Rektaszension und 56°
nördl. Deklination), weshalb man jene auch Leoniden, diese
Perseiden nennt. Doch gibt es in diesen Nächten nicht
bloß einen, sondern immer mehrere Radianten, so beim
Novemberphänomen nach Heis 5; derselbe Beobachter hat am
nördlichen Himmel über 80 Radianten bestimmt. Im
allgemeinen unterscheidet man die in bestimmten Nächten in
größerer Häufigkeit fallenden S. als periodische
von den sporadischen, die unregelmäßig aus den
verschiedensten Gegenden des Himmels kommen. Die Höhe, in
welcher die S. aufleuchten und verlöschen, läßt
sich aus korrespondierenden Beobachtungen von verschiedenen Punkten
aus ermitteln. Sie ist sehr verschieden; so fand Heis beim
Augustphänomen 1867 Höhen zwischen 20 1/2 und 4 geogr.
Meilen (im Mittel 13 1/2 Meilen) für das Aufblitzen, solche
zwischen 11 1/2 und 3 Meilen (im Mittel 7 1/2) für das
Verlöschen; doch sind auch noch größere Höhen
bis zu 40 Meilen und darüber beobachtet worden. Die
Geschwindigkeiten, mit welchen sich die S. bewegen, sind solche,
wie wir sie nur bei selbständig um die Sonne laufenden
Weltkörpern antreffen, 3 und mehr, selbst 10-20 Meilen in der
Sekunde. Die kosmische Natur dieser Erscheinungen ist namentlich
seit dem bereits erwähnen glänzenden Sternschnuppenfall
im November 1866 außer Zweifel gestellt; derselbe hat uns
auch noch weitere Aufschlüsse über dieselben gegeben.
Schon früher hat man einen Zusammenhang zwischen den
Sternschnuppenschwärmen und den Kometen geahnt, und namentlich
hat Chladni bereits 1819 sich für einen solchen ausgesprochen.
Aber erst 1866 wurde es durch Schiaparelli fast außer Zweifel
gesetzt, daß manche Kometen, wenn auch nicht alle, zu den
Erscheinungen der periodischen Sternschnuppenfälle beitragen.
Insbesondere glaubte Schiaparelli aus der großen
Ähnlichkeit der Bahn des August- oder Laurentiusstroms mit
derjenigen des Kometen III des Jahrs 1862 auf eine Identität
beider Erscheinungen schließen zu müssen. Diese Meinung
fand rasch eine Bestätigung durch die von Leverrier
ausgeführte Berechnung der Bahn des großen
Novemberschwarms von 1866. Es machte nämlich sehr bald Peters
in Altona auf die auffallende Übereinstimmung dieser Bahn mit
derjenigen des Tempelschen Kometen I von 1866 aufmerksam. Seitdem
hat die Idee, daß die periodisch erscheinenden
Sternschnuppenschwärme Teile von Kometen seien, die, durch die
Anziehung der Erde aus ihrer Bahn abgelenkt, durch die obern
Regionen unsrer Atmosphäre schießen und hier infolge
ihrer raschen Bewegung durch die Luft ins Glühen geraten,
immer mehr Anklang gefunden. Insbesondere führt man auch die
glänzenden Sternschnuppenregen vom 27. Nov. 1872 und 1885 auf
kleine kosmische Körper zurück, die der zerfallende
Bielasche Komet längs seiner Bahn ausgestreut hat.
Während aus den größern Feuerkugeln nicht selten
Meteorsteine zur Erde niederfallen, ist bei den S. bis jetzt noch
nichts Ähnliches nachgewiesen. Ob die eisenhaltigen
Staubmassen, welche Nordenskjöld auf den Schneeflächen
Skandinaviens, Gaston Tissandier in Paris und Umgegend gesammelt
und untersucht haben, wirklich von den Schweifen der S. und
Feuerkugeln herrühren, wie letzterer glaubt, ist noch
zweifelhaft. Die gallertigen, frischem Eiweiß oder
Stärkekleister ähnlichen, oft tellergroßen Massen,
die man hin und wieder am Boden findet, und welche die Volksmeinung
in Europa und Nordamerika als Sternschnuppensubstanz bezeichnet,
sind nach Cohn aufgequollene Frosch-Eileiter, welche wahrscheinlich
von Nachtvögeln ausgeleert werden. Vgl. Schiaparelli, Entwurf
einer astronomischen Theorie der S. (deutsch, Stett. 1871);
Boguslawski, Die S. und ihre Beziehungen zu den Kometen (Berl
1874).
306
Sternschnuppengallerte - Sternwarte.
Steruschnuppengallerte, s. Nostoc.
Sterusingen, der in der Weihnachtszeit bis zum
Dreikönigsabend ehedem weit und breit übliche Brauch, mit
einem an einer Stange befestigten goldpapiernen Stern herumzuziehen
und Weihnachts- oder Dreikönigslieder zu singen, um dafür
eine Gabe zu erhalten. Bald sind es Erwachsene, bald Kinder,
welche, meist als die drei Könige aus dem Morgenland
verkleidet, von Haus zu Haus ziehen, um ihre Lieder vorzutragen und
den Stern oder statt dessen auch einen Kasten mit Puppen zu
zeigen.
Sterustein, s. Korund.
Sterntag, s. Tag.
Sterntypen, s. Fixsterne, S. 325.
Sternum (lat.), Brustbein.
Sternutatio (lat.), das Niesen (s. d.).
Stern von Indien, großbrit. Orden, gestiftet 26.
Juni 1861 von der Königin Viktoria für das indische
Reich. Der Orden besteht aus dem Souverän, dem
Großmeister, welcher der Vizekönig von Indien ist, und
246 ordentlichen Genossen sowie einer unbegrenzten Zahl
Ehrenmitglieder. Die Genossen teilen sich in drei Klassen:
Großkommandeure (30), Kommandeure (72) und Genossen (144).
Die Dekoration besteht in einer Kette aus Lotus, Palmzweigen und
roten und weißen Rosen, in der Mitte die königliche
Krone, an welcher das Ordenszeichen hängt, ein kameenartig in
Onyx geschnittenes Brustbild der Königin in einem
durchbrochenen Oval, mit der Devise: "Heaven's light our guide",
überragt von einem Stern aus Diamanten. Der Ordensstern
besteht in einem Mittelschild mit Diamantstern, von welchem
Goldstrahlen ausgehen, und der auf einem blau und weiß
geränderten Band ruht, welches die Devise in Diamanten
zeigt.
Stern von Rumänien, fürstlich rumän.
Zivil- und Militärverdienstorden, gestiftet 10. Mai 1877 vom
Fürsten Karl I. Der Orden hat fünf Klassen:
Großkreuze, Großoffiziere, Kommandeure, Offiziere und
Ritter, deren Zahl festgestellt ist. Die Dekoration besteht in
einem blau emaillierten Kreuz, das, mit Strahlen verziert, die
goldene Fürstenkrone trägt. Militärverdienst wird
durch gekreuzte Schwerter gekennzeichnet. Der Mittelschild des
Kreuzes zeigt in rotem Email vorn einen Adler mit der Devise: "In
fide salus" in grünem Randreif, hinten die fürstliche
Chiffer. Die Ritter tragen das Kreuz in Silber, die andern von
Gold; die Großkreuze und Großoffiziere außerdem
einen diamantierten Silberstern mit darauf liegendem Kreuz. Das
Band ist rot mit dunkel-blauen Randstreifen.
Sternwarte (Observatorium, hierzu Taf. "Sternwarte"), ein
zu astronomischen Beobachtungen und Messungen bestimmtes
Gebäude. Während man früher die Sternwarten der
bessern Umsicht halber gern auf Türmen einrichtete, hat man,
namentlich im vorigen Jahrhundert, eingesehen, daß so hohe
Gebäude einen für Erschütterungen sehr empfindlichen
und infolge der ungleichen Erwärmung durch die Sonne sehr
schwankenden Standort gewähren, weshalb sich auf ihnen genaue,
der gegenwärtigen Vollendung der Instrumente und der
Ausbildung der Beobachtungskunst entsprechende Beobachtungen gar
nicht ausführen lassen. Man baut daher die Sternwarten
heutzutage niedrig und stellt die größern Instrumente
auf steinerne Pfeiler, die mit den übrigen Fundamenten
außer Zusammenhang stehen. Im Meridian, auch im ersten
Vertikal (s. d.), müssen Einschnitte für das
Passageinstrument vorhanden sein. Ferner baut man für die
größern Äquatoriale Türme mit drehbarem Dach,
die Beobachtungen nach den verschiedensten Richtungen gestatten;
auch sorgt man für eine Terrasse od. dgl. zu Beobachtungen im
Freien. Die ganzen Baulichkeiten, mit den Wohnräumen für
das Personal, sollen an einem ruhigen, nicht zu nahe an frequenten
Straßen gelegenen Platz, nicht im Innern größerer
Städte, gelegen sein; die freie Umsicht am Horizont ist nicht
nötig, wenn nur in größerer Höhe der Himmel
frei ist, denn Beobachtungen dicht am Horizont sind wenig
zuverlässig. Zur Ausstattung einer S. gehören:
Meridiankreis, Mittagsrohr, Äquatorial, Vertikalkreis,
Heliometer, kleinere Fernrohre, gute Uhren, elektrische
Registrierapparate und meteorologische Instrumente, zunächst
zur Reduktion der astronomischen Beobachtungen. Neuerdings sind
aber viele Sternwarten auch zugleich meteorologische
Beobachtungsstationen. Die erste nach neuern Grundsätzen
erbaute S. ist die von Greenwich, 1672 errichtet; die noch
ältere, 1664-72 erbaute Pariser S. ist den Ansprüchen der
Gegenwart nicht mehr ganz entsprechend. Ein großartiges
Institut ist die 1833-39 auf dem Pulkowaberg bei Petersburg
errichtete Nikolai-Zentralsternwarte. Auch die Vereinigten Staaten
von Nordamerika besitzen eine Anzahl sehr gut eingerichteter
Sternwarten, unter denen namentlich die Marinesternwarte in
Washington sich durch ihre Leistungen hervorgethan hat und das
Lick-Observatorium auf dem 1400 m hohen Mount Hamilton in
Kalifornien durch seine Lage und Ausstattung außerordentlich
begünstigt ist. Ebenso sind in Südamerika,
Südafrika, Ostindien und Australien einzelne Sternwarten
thätig. Die Gesamtzahl aller Observatorien übersteigt
jetzt 200, während sie Ende des vorigen Jahrhunderts nur 130
betrug. Auf dem Kontinent von Europa sind die meisten Sternwarten
Staatsanstalten, in Großbritannien aber haben sich viele
Privatsternwarten durch ihre Leistungen einen Namen erworben. Als
Beispiel einer allen Anforderungen der Neuzeit, sowohl für die
Zwecke des Unterrichts als der wissenschaftlichen Forschung,
entsprechenden S. dient uns die auf beifolgender Tafel dargestellte
neue S. zu Straßburg (die Beschreibung derselben siehe auf
der Textbeilage zur Tafel, wo sich auch eine Übersicht der
bedeutendsten Sternwarten befindet). Seitdem in den letzten
Jahrzehnten Physik und Chemie insbesondere in der Photographie und
Spektralanalyse neue Hilfsmittel dargeboten haben, welche den
Untersuchungen über die physische Beschaffenheit der
Himmelskörper einen früher ungeahnten Grad von
Genauigkeit und Zuverlässigkeit verleihen, bilden derartige,
ehemals nur einzelnen Liebhabern überlassene Forschungen eine
wesentliche Aufgabe des Astronomen von Fach. Indessen sind die
ältern Sternwarten neben ihren sonstigen, vorzugsweise auf
Erforschung der Bewegung der Himmelskörper gerichteten
Arbeiten nur unvollkommen im stande, sich dieser Aufgabe zu widmen;
denn dieselbe stellt nicht nur an die Ausbildung und Arbeitskraft
der Beobachter Forderungen besonderer Art, sondern sie verlangt
auch bedeutende instrumentelle Hilfsmittel und macht physikalische
und chemische Arbeiten nötig, für welche die ältern
Sternwarten nicht eingerichtet sind. So wie man daher früher
einzelne Sternwarten speziell zur Beobachtung der Erscheinungen auf
der Sonne eingerichtet hat, so ist man in der neuesten Zeit an die
Errichtung von Observatorien gegangen, welche der Pflege der
verschiedensten Zweige der Astrophysik dienen sollen, so in
Frankreich das Observatorium zu Meudon und in Deutschland das
astrophysikalische Observatorium auf dem Telegraphenberg bei
Potsdam, das 1879 seiner Bestimmung übergeben wurde.
STERNWARTE DER KAISER WILHELMS-UNIVERSITÄT ZU
STRASSBURG.
Grosser Refraktorbau. (Ansicht.)
Grosser Refraktorbau. (Durchschnitt von A nach B.)
Grosser Refraktorbau.
a. Grosser Refraktor,
b. Raum für konstante Temperatur,
c. Halle.
d. Boden.
e. Gang.
f. Hörsaal.
g. Keller.
h. Vestibül.
i. Bibliothek
k. Direktionszimmer
Gemeinschaftliches Observatoriengebäude.
a. Treppenhaus.
b. Rechenzimmer.
c. Treppengang zum Instrument
d. Instrumente.
e. Eingang zum Meridiansaal.
f. Passageninstrument.
g. Meridiankreis.
Beamtenwohnhaus.
Situationsplan der Sternwarte
Gemeinschaftliches Observatoriengebäude. (Meridianbau.)
(Durchschnitt von A nach B.)
Turm des Altazimuth
Turm des Bahnsuchers.
[Zu Artikel und Tafel Sternwarte.]
Die Sternwarte der Kaiser Wilhelms-Universität zu
Straßburg.
Die im Sommer 1881 ihrer Bestimmung übergebene Sternwarte
der Kaiser Wilhelms-Universität zu Straßburg besteht aus
drei Gebäuden, von denen das eine Wohnungen, die andern beiden
die zur Aufstellung der Instrumente nötigen Räume
enthalten. Der Refraktorbau für das Hauptinstrument der
Sternwarte (s. Tafel) ist ein von einer mächtigen Kuppel
gekrönter Turm, der sich 24 m über den Boden erhebt. Die
Mitte des aus Sandstein aufgeführten Unterbaues, dessen
Querschnitt die Form eines gleicharmigen Kreuzes zeigt, nimmt eine
Halle ein, um welche sich eine Anzahl verschiedenen Zwecken
dienender Räume gruppieren. Die diese Halle
einschließenden sehr starken Mauerpfeiler tragen ein
mehrfaches Gewölbe, auf welchem die den großen Refraktor
tragende Säule ruht. Dieses Gewölbe ist von der obern,
die Kuppel tragenden Umfassungswand des Turms und von dem
Fußboden des Kuppelraums isoliert, so daß sich
Erschütterungen dieser Teile nicht direkt auf das Instrument
übertragen können; es umschließt einen Hohlraum,
der im Innern des ganzen Mauerwerks zu allen Tages- und
Jahreszeiten sehr nahe dieselbe Temperatur behält, und in
welchem daher die Normaluhren des Observatoriums ihre Aufstellung
gefunden haben. Ein zweiter Raum mit konstanter Temperatur ist noch
inmitten des Kellergeschosses gelegen. Die halbkugelförmige
Kuppel des Turms (vgl. den Durchschnitt auf der Tafel) von 11 m
Durchmesser ist aus eisernen Bogenträgern konstruiert, die
eine außen mit Zink verkleidete Holzverschalung tragen, und
an der Innenfläche zum Schutz gegen die sich hier leicht
ansetzende Feuchtigkeit mit Tuch ausgeschlagen. Ein Spalt von 2 m
Breite, vom Horizont durch den Scheitel bis wieder zum Horizont
gehend, ermöglicht den Ausblick auf den Himmel; bei
ungünstigem Wetter wird derselbe durch zwei halbcylindrische
Stücke geschlossen, die sich beim Öffnen symmetrisch
voneinander entfernen. Die Kuppel ist drehbar und läuft auf
dem obern Rande der Turmwand vermittelst an ihr befestigter
Räder von 1 m Durchmesser. Sie ist mit einem Zahnkranz
versehen, in den eine Transmission eingreift, welche durch ca. 1000
kg schwere, in tiefen, zu diesem Zweck im Mauerwerk ausgesparten
Schächten niedersteigende Gewichte getrieben wird. Durch
Umschaltung einer Welle in dieser Transmission kann man die Drehung
rechts- oder linksherum vor sich gehen lassen, und dieses
Umschalten ebenso wie das Auslösen der Gewichte erfolgt, indem
man durch Schluß eines am Okularende des Fernrohrs
angebrachten Kontakts einen Elektromagnet wirken läßt,
so daß also der Beobachter, ohne seinen Platz zu verlassen
und ohne alle Mühe den Spalt der ca. 34,000 kg schweren Kuppel
auf die gerade zu beobachtende Himmelsgegend richten kann. Eine
breite Terrasse um die Kuppel ist bestimmt für die mit
bloßem Auge oder mit kleinem transportabeln Instrumenten
anzustellenden Beobachtungen. Auf ihr befindet sich auch ein
großer Kometensucher von 16,2 cm Öffnung und 1,3 m
Brennweite, welchen der auf einem Drehstuhl sitzende Beobachter auf
jede Gegend des Himmels richten kann, ohne dabei die Lage seines
Kopfes verändern zu müssen. Derselbe dient außerdem
zur fortlaufenden Beobachtung des Lichtwechsels der in ihrem Glanz
veränderlichen Fixsterne. Unter der Kuppel ruht auf einer 4 m
hohen gußeisernen Säule der große parallaktisch
montierte Refraktor, dessen Objektiv einen freien Durchmesser von
48,7 cm und 7 m Brennweite hat (vgl. Äquatorial).
Bemerkenswert sind noch die an der großen Drehkuppel
angebrachten Vorrichtungen, um dieselbe auf ihrer
Außenfläche vollständig mit Wasser zu berieseln und
so im heißen Sommer vor Beginn der Beobachtungen eine
raschere Abkühlung derselben zu bewirken. In den ersten
Abendstunden würden sonst die das Instrument zunächst
umgebenden Luftschichten eine bedeutend höhere Temperatur als
die äußere Luft zeigen, was eine Störung der
durchgehenden Lichtstrahlen und ein verwaschenes und zitterndes
Ausheben der im Fernrohr beobachteten Gestirne zur Folge haben
müßte. Der Meridianbau (s. Tafel) enthält in seinem
Ostflügel den Meridiansaal, dessen Längsachse in der
Richtung OW. liegt; er wird in nordsüdlicher Richtung von zwei
je 1 m breiten, durch Klappen verschließbaren Spalten
durchschnitten, unter denen der Meridiankreis von 16,2 cm
Öffnung und 1,9 m Brennweite und das Passageinstrument
aufgestellt sind. Diese Instrumente ruhen, um ihnen eine feste und
unveränderliche Aufstellung zu geben, auf starken Pfeilern,
die frei aus dem Boden aufsteigen und vom ganzen übrigen
Gebäude isoliert sind. Die äußern Grundmauern des
Gebäudes sind gleichfalls sehr stark und mit zwischenliegenden
Luftschichten aufgeführt, um die Instrumentenpfeiler
möglichst vor Temperaturschwankungen, welche Verziehungen
derselben zur Folge haben könnten, zu sichern; sie tragen ein
flaches Bogengewölbe, durch das jene Pfeiler frei
hindurchgehen. Der Fußboden ist in der
verhältnismäßig beträchtlichen Höhe von
fast 5 m über der Erde angelegt, um die Gesichtslinien der
Instrumente auch bei nahezu horizontaler Stellung des Fernrohrs aus
dem Bereich der an der Erdoberfläche stattfindenden
unregelmäßigen Strahlungen zu bringen. Der Oberbau des
Meridiansaals ist aus Eisen konstruiert; Wandung und Dach sind aus
verzinntem Wellenblech hergestellt und außen mit einer
jalousieartigen Holzverkleidung versehen, um die Innentemperatur
des Raums möglichst gleich der äußern
Schattentemperatur zu machen und auf diese Weise sowohl alle
störenden Luftströmungen durch die geöffneten
Spalten zu vermeiden als auch namentlich die Bildung von nach oben
wärmer werdenden Luftschichten zu verhindern, wodurch auch die
obern und untern Teile der Instrumente sich ungleich erwärmen
und infolgedessen ihre genaue Gestalt verlieren würden. Der
Westflügel des Meridianbaues wird im N. und S. von zwei mit
Drehkuppeln versehenen Türmen begrenzt, die sich bis zur
Höhe von 20 m erheben. In dem südlichen Turm ist
aufgestellt der Bahnsucher, in dem nördlichen das Altazimut
mit einem Fernrohr von 13,6 cm Öffnung und 1,5 m Brennweite,
welche Instrumente auf sehr starken, vom übrigen Gebäude
völlig getrennten Pfeilern ruhen. Diese verjüngen sich
nach oben, sind im Innern bis auf radiale Versteifungen hohl und
werden zum Schutz gegen Wärmeänderungen, welche leicht
merkliche Schwankungen der 16 m hohen Pfeiler verursachen
könnten, von einem Hohlcylinder aus Backsteinen
eingeschlossen. Um diesen windet sich dann die Wendeltreppe, die
von der äußern Turmwand getragen wird. Die beiden
drehbaren Kuppeln haben einen Durchmesser von 5,5 m; die
südliche ist ganz ähnlich der des Refraktorbaues, die
nördliche dagegen ist, weil das unter ihr befindliche
Altazimut eine besonders große Öffnung derselben bei der
Beobachtung erforderte, durch einen senkrecht durch ihren Scheitel
gelegten Schnitt in zwei gleiche Hälften geteilt, die sich
durch einen Bewegungsmechanismus bis zum Abstand von 2,5 m
voneinander entfernen lassen. Die Galerien und Terrassen, welche
die beiden Kuppeln umgeben, können ebenfalls mit Wasser
berieselt werden. Außer den erwähnten
Meßwerkzeugen besitzt die Sternwarte noch eine Anzahl
kleinerer Instrumente, ein Heliometer, ein transportables
Passageinstrument, welche im Freien unter Bedachung ihre
Aufstellung gefunden haben, etc.
Übersicht der bedeutendsten Sternwarten.
Sternwarte Länge in Bogen von Greenwich Breite
Deutschland.
Berlin ö. 13° 23' 43" +52° 30' 16,7"
Bonn ö. 7 5 58 +50 43 45,0
Bothkamp b. Kiel (Priv.) ö. 10 7 42 +54 12 9,6
Breslau ö. 17 2 16 +51 6 56,5
Danzig ö. 18 39 51 +54 21 18,0
Düsseldorf (Bilk) ö. 6 46 13 +51 12 25,0
Gotha ö. 10 42 37 +50 56 37,5
Göttingen ö. 9 56 33 +51 31 47,9
Hamburg ö. 9 58 25 +53 33 7,0
Kiel ö. 10 8 52 +54 20 29,7
Königsberg ö. 20 29 43 +54 42 50,6
Leipzig ö. 12 23 30 +51 20 6,3
Lübeck ö. 10 41 24 +53 51 31,2
Mannheim ö. 8 27 41 +49 29 11,0
Marburg ö. 8 46 15 +50 48 46,9
München (Bogenhausen) ö. 11 36 28 +48 8 45,5
Straßburg ö. 7 45 35 +48 34 55,0
Wilhelmshaven ö. 8 8 48 +53 31 57,0
Österreich.
Krakau ö. 19 57 37 +50 3 50,0
Kremsmünster ö. 14 8 3 +48 3 23,7
Pola ö. 13 50 52 +44 51 49,0
Prag ö. 14 25 19 +50 5 18,5
Wien ö. 16 22 55 +48 12 35,5
Wien (Josephstadt) ö. 16 21 19 +48 12 53,8
Schweiz.
Bern ö. 7 26 24 +46 57 6,0
Genf ö. 6 9 16 +46 11 58,8
Neuchâtel ö. 6 57 31 +47 0 1,2
Zürich ö. 8 32 58 +47 22 42,1
Niederlande u. Belgien.
Leiden ö. 4 29 3 +52 9 20,3
Utrecht ö. 5 8 1 +52 5 10,5
Brüssel ö. 4 22 8 +50 51 10,7
Großbritannien.
Armagh w. 6 38 53 +54 21 12,7
Birr Castle w. 7 55 14 +53 5 47,0
Cambridge ö. 0 5 40 +52 12 51,6
Dublin w. 6 20 31 +53 23 13,0
Durham w. 1 34 57 +54 46 6,2
Edinburg w. 3 10 54 +55 57 23,2
Glasgow w. 4 17 39 +55 52 42,6
Greenwich 0 0 0 +51 28 38,4
Liverpool w. 3 4 17 +53 24 3,8
Markree w. 8 27 2 +54 10 31,8
Oxford w. 1 15 39 +51 45 36,0
Portsmouth w. 1 5 55 +50 48 3,0
Tulse Hill w. 0 6 56 +51 26 47,0
Rußland.
Abo (aufgelöst) ö. 22 17 2 +60 26 56,8
Charkow ö. 36 13 40 +50 0 10,2
Dorpat ö. 26 43 22 +58 22 47,1
Helsingfors ö. 24 57 16 +60 9 42,3
Kasan ö. 49 7 13 +55 47 24,2
Kiew ö. 30 30 16 +50 27 12,5
Moskau ö. 37 34 13 +55 45 19,8
Nikolajew ö. 31 58 31 +46 58 20,6
Odessa ö. 30 45 35 +46 28 36,2
Petersburg ö. 30 18 22 +59 56 29,7
Pulkowa ö. 30 19 38 +59 46 18,7
Warschau ö. 21 1 50 +52 13 5,7
Wilna ö. 25 17 58 +54 41 0,0
Schweden u. Norwegen.
Lund ö. 13° 11' 15" +55° 41' 54,0"
Stockholm ö. 18 3 32 +59 20 34,0
Upsala ö. 17 37 30 +59 51 31,5
Christiania ö. 10 43 32 +59 54 43,7
Dänemark.
Kopenhagen ö. 12 34 47 +55 41 13,6
Italien.
Bologna ö. 11 21 9 +44 29 47,0
Florenz ö. 11 15 22 +43 46 4,1
Mailand ö. 9 11 31 +45 28 0,7
Modena ö. 10 55 42 +44 38 52,8
Neapel ö. 14 14 42 +40 51 45,4
Padua ö. 11 52 14 +45 24 2,5
Palermo ö. 13 21 1 +38 6 44,0
Rom ö. 12 28 50 +41 53 53,7
Turin ö. 7 42 5 +45 4 6,0
Venedig ö. 12 21 11 +45 25 49,5
Frankreich.
Marseille ö. 5 23 50 +43 18 19,1
Paris ö. 2 20 13 +48 50 11,2
Toulouse ö. 1 27 44 +43 36 47,0
Spanien.
Madrid w. 3 41 18 +40 24 29,7
San Fernande w. 6 12 33 +36 27 40,4
Portugal.
Lissabon w. 9 6 15 +38 42 15,2
Griechenland.
Athen ö. 23 43 55 +37 58 20,0
Vereinigte Staaten von Nordamerika.
Albany w. 73 44 35 +42 39 49,6
Alfred Centre w. 77 46 46 +42 15 19,8
Alleghany-City w. 80 0 49 +40 27 36,0
Ann Arbor w. 83 43 44 +42 16 48,0
Cambridge w. 71 7 41 +42 22 48,0
Chicago w. 87 36 38 +41 50 1,0
Cincinnatiw. 84 29 41 +39 6 26,5
Clinton w. 75 24 18 +43 3 16,5
Georgetown w. 77 4 30 +38 54 26,1
Licks Sternwarte w. 98 54 34 +19 25 17,0
Mew York w. 73 59 12 +40 43 48,5
Philadelphia w. 75 9 37 +39 57 7,5
Washington w. 77 3 2 +38 53 38,8
Südamerika
Cordova w. 64 11 15 -31 25 15,0
Rio de Janeiro w. 43 8 56 -22 53 51,0
Santiago de Chile w. 70 40 34 -33 26 42,0
Ostindien.
Madras ö. 80 14 19 +13 4 8,1
Australien.
Melbourne ö. 144 58 34 -37 49 53,4
Sydney ö. 151 11 27 -33 51 41,1
Williamstown ö. 144 54 38 -37 52 7,2
Windsor ö. 150 48 50 -33 36 29,2
Kapland.
Kap der Guten Hoffnung ö. 18 28 44 -33 56 3,0
1 1825--63 unter dem Direktorat von J. F. Encke. -- 2
Bonn: Argelander, von 1837--75 Direktor, bearbeitete daselbst
seine ausgezeichneten Sternkarten. -- 3 Gotha: Encke begann
hier seine astronomische Thätigkeit; ihm folgte 1825 im
Direktorat P. A Hansen -- 4 Göttingen: K F Gauß
1807--55 Direktor. -- 6 Königsberg: 1810--46 F.
W. Bessel Direktor. -- 6 Prag: Tycho Brahe und Kepler haben
daselbst gewirkt. - 7 Greenwich: Halley beschloß hierselbst
als Direktor der Sternwarte seine ruhmreiche Thätigkeit; ihm
folgte 1725 Bradley. -- 8 Abo: Argelanders
Fixsternbeobachtungen. -- 9 Dorpat: W. Struves Untersuchungen
über Doppelsterne. 1840--66 J. H. Mädler Direktor. -
10 Pulkowa: 1839 -- 65 W. Struve Direktor. -- 11 Bologna:
Cassinis erste Beobachtungen. -- 12 Palermo: Piazzi entdeckte
daselbst den ersten kleinen Planeten. -- 13 Rom: Pater Secchis
(gest. 1878) spektralanalytische Untersuchungen. -- 14 Paris:
Cassini erster Direktor 1669; spätere: Bouvard, Arago,
Leverrier.
307
Sternweite - Stettin.
Sternweite, Entfernung eines Fixsterns von der Sonne,
wenn seine jährliche Parallaxe (s. d.) eine Bogensekunde
beträgt, gleich 206,264,8 Erdbahnhalbmessern oder
ungefähr 30 2/3 Bill. km.
Sternwürmer, s. Gephyreen.
Sternzeit, die durch die scheinbare tägliche
Bewegung der Fixsterne bestimmte Zeit; vgl. Sonnenzeit und Tag.
Sterrometall, Legierung aus 55 Kupfer, 41 Zink und 4
Eisen, von großer Festigkeit und Zähigkeit, dient zu
Blech- und Gußwaren, Achsenlagern etc.
Stertmorchel, s. Phallus.
Stertor (lat.), das Röcheln (s. d.).
Stertz, ein steir. Nationalgericht, bestehend aus einem
aus Buchweizenmehl bereiteten großen Kloß, welcher mit
Speckgriefen und Milch genossen wird.
Sterzing, Stadt in Tirol, Bezirkshauptmannschaft Brixen,
am Eisack und an der Brennerbahn, 947 m ü. M.,
altertümlich gebaut, mit gotischer Pfarrkirche, schönem
gotischen Rathaus, einem Deutschordenshaus (1263 gestiftet),
Kapuzinerkloster, einem Bezirksgericht, Fabrikation von Sensen,
Sicheln, Beinlöffeln etc. und (1880) 1528 Einw.
Südöstlich das nunmehr ausgetrocknete Sterzinger Moos. S.
hieß zur Römerzeit Vipitenum. Gegenwärtig ist es
ein beliebtes Standquartier der Touristen. Vgl. Fischnaler S. am
Eisack (2. Aufl., Innsbr. 1885).
Stesichoros, der bedeutendste Vertreter der ältern
dorischen Lyrik, der "lyrische Homer" genannt, geb. um 630 v. Chr.
zu Himera in Sizilien, starb erblindet 556 in Catana. Von ihm
rührt die Einteilung der chorischen Lieder in Strophe,
Gegenstrophe und Epode her, auch galt er für den
Begründer des höhern frischen Stils. Seine von
Spätern in 26 Bücher eingeteilten Festgesänge
behandelten in prächtiger Darstellung vorwiegend epische
Stoffe; ebenso standen die einfachen metrischen Formen der epischen
nahe, wie auch der Dialekt der mit wenigen Dorismen gemischte
epische war. Wir besitzen von ihm nur Bruchstücke (in
Schneidewins "Delectus poesis Graecorum" , Götting. 1839, und
Bergks "Poetae lyrici graeci" , Bd. 3, 4. Aufl., Leipz. 1882).
Stethograph (griech.), ein Apparat, welcher die
Atmungsbewegungen einzelner Punkte des Brustkorbes in Form von
Kurven graphisch darstellt.
Stethoskop (griech.), s. Auskultation.
Stetig, fest, unbeweglich; ununterbrochen, fortdauernd.
Eine stetige (kontinuierliche) Größe ist eine solche,
deren Teile keine Unterbrechung zeigen, z. B. eine Linie im
Gegensatz zu einer Reihe voneinander getrennter (diskreter)
Punkte.
Stetigkeit, s. v. w. Kontinuität (s. d.).
Stetten, 1) (S. am Kalten Markt) Flecken im bad. Kreis
Konstanz, in rauher Gegend auf der Hardt, hat eine kath. Kirche,
Weißstickerei, Korsettnäherei und (1885) 1037 Einw.
-
2) Dorf im bad. Kreis Lörrach, im Wiesenthal, an der Linie
Basel-Zell i. W. der Badischen Staatsbahn, hat eine kath. Kirche,
Weinbau, Eisengießerei, Baumwollweberei,
Gewehrschäftefabrikation und (1885) 2186 Einw.
Stettenheim, Julius, humorist. Schriftsteller, geb. 2.
Nov. 1831 zu Hamburg, Sohn eines Kunsthändlers, verließ
1857 das väterliche Geschäft, in das er eingetreten war,
und begab sich nach Berlin, wo er studierte und gleichzeitig als
Schriftsteller auftrat. Unter den von ihm um jene Zeit
veröffentlichten Humoresken, Singspielen, Possen etc.
verdienen der "Almanach zum Lachen" (Berl. 1858-63) und das oft
gegebene Liederspiel "Die letzte Fahrt" (das. 1861) besondere
Hervorhebung. Nach vollendetem dreijährigen
Universitätskurs kehrte er nach Hamburg zurück und
gründete hier die bekannte humoristisch-satirische Zeitschrift
"Die Wespen", die jedoch erst eigentlichen Erfolg hatte, nachdem er
mit derselben Ende 1867 nach Berlin übergesiedelt war, wo im
Januar 1868 zuerst die "Berliner Wespen" erschienen, die er noch
gegenwärtig redigiert. S. ist einer der glänzendsten
Vertreter des satirischen Wortwitzes. Von seinen
Veröffentlichungen erwähnen wir noch: "Lohengrin",
humoristische Albumblätter (Berl. 1859); "Die Hamburger Wespen
auf der internationalen landwirtschaftlichen Ausstellung" (das.
1863); "Die Hamburger Wespen im zoologischen Garten" (das. 1863);
"Satirisch-humoristischer Volkskalender" (das. 1863); "Die Berliner
Wespen im Aquarium" (das. 1869); "Ungebetene Gäste", Posse
(das. 1869); "Berliner Blaubuch aus dem Archiv der Komik" (das.
1869-70, 2 Bde.); "Ein gefälliger Mensch", Posse (das. 1872);
"Wippchens sämtliche Berichte" (das. 1878-86, 5 Bde.);
"Muckenichs Reden und Thaten" (das. 1885); "Unter vier Augen" (das.
1885) u. a. Seit 1885 gibt er die illustrierte Monatsschrift "Das
humoristische Deutschland" (Bresl.) heraus.
Stettin (hierzu der Stadtplan), Hauptstadt der
preuß. Provinz Pommern und des gleichnamigen
Regierungsbezirks, Stadtkreis, an der Oder, Knotenpunkt der Linien
Berlin-Stargard, Breslau-S. und S.-Mecklenburgische Grenze, 7 m
ü. M., besteht aus der eigentlichen Stadt am linken
Flußufer mit ausgedehnten neuen Stadtteilen und
Vorstädten, welch letztere wegen der bis 1873 vorhandenen
Befestigung der innern Stadt zum Teil in großer Entfernung
von derselben angelegt sind, und aus der Lastadie und den
zugehörigen Anlagen am rechten User. Beide Ufer der Oder sind
für den allgemeinen Verkehr durch drei Brücken
(Baumbrücke, Lange Brücke und Neue Brücke)
verbunden; für den Eisenbahnverkehr sind über die Oder
und ihre Nebenströme besondere Überbrückungen
hergestellt. Die innere Stadt enthält acht Plätze: den
Paradeplatz, den Königsplatz mit den Statuen Friedrichs d. Gr.
(von Schadow) und Friedrich Wilhelms III. (von Drake), den
Roßmarkt mit monumentaler Fontäne, den Heumarkt und den
Neuen Markt, zwischen denen das alte Rathaus steht, den Marktplatz
und den Viktoriaplatz, durch das neue Rathaus getrennt, und den mit
Anlagen gezierten Kirchplatz. S. hat 6 evang. Kirchen, unter
welchen die in ihrer jetzigen Gestalt spätgotische Petrikirche
(1124 gegründet) als die erste christliche Kirche in Pommern
und die Jakobikirche (aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrh.)
wegen ihrer Größe etc. bemerkenswert sind;
außerdem eine kath. Kirche (im Schloß), eine
Baptistenkapelle, eine Kirche der Altlutherischen, eine der
apostolischen Gemeinde und eine neue Synagoge. Andre hervorragende
Gebäude sind: das königliche Schloß (1575 erbaut),
jetzt Sitz der Regierung und des Oberlandesgerichts, das
Militärkasino, das Schauspielhaus, die Börse, das
Vereins- und Konzerthaus, der Zirkus, das neue großartige
Krankenhaus (auf einer Anhöhe vor der Stadt, vgl. den Plan bei
Art. "Krankenhaus") etc. Bemerkenswert sind ferner zwei von
Friedrich Wilhelm I. erbaute monumentale Thorgebäude
(Königsthor und Berliner Thor), welche, seit Abtragung der
Wälle freigelegt und von der Stadt
Wappen von Stettin.
STETTIN.
Albrecht-Straße
Arndt-Platz
Arndt-Straße
Artillerie-Kaserne
Artillerie-Straße
Artillerie-Zeughaus
Augusta-Straße
Bäckerberg-Straße
Badeanstalt
Bahnhof
Barnim-Straße
Baum-Brücke
Baum-Straße
Bellevue
Bellevue-Straße
Berg-Straße
Berliner Thor, Am
Birken-Allee
Bismarck-Platz
Bismarck-Straße
Bleichholm
Blumen-Straße
Bollwerk
Börse
Breite-Straße
Buggenhagen-Straße
Bürger-Ressource
Burg-Straße
Charlotten-Straße
Deutsche-Straße
Dom Straße, Große
Dom Straße, Kleine
Elisabeth-Straße
Exerzierplatz
Falkenwalder Straße
Fischer-Straße
Fort Preußen
Frauen-Straße
Friedrich-Karl-Straße
Friedrich-Straße
Friedrichs II. Denkmal
Friedrichs Wilhelms III. Denkmal
Fuhr-Straße
Furage-Magazin
Galg-Wiese
Garnison-Lazarett
Garten-Straße
General-Kommando
Gertruden-Kirche
Giesebrecht-Straße
Grabow
Grabower Straße
Grüner Graben
Grüne Schanze
Grünhof
Gastav-Adolf-Straße
Gutenberg- Straße
Güter-Bahnhof
Gymnasium, Kaiser-Wilhelm
Gymnasium, Marienstifts-
Gymnasium, Stadt-
Hauptwache
Heilige Geist-Straße
Heilige Geist-Thor
Heumarkt
Hohenzollern-Platz
Hohenzollern-Straße
Holzmarkt
Holz-Straße
Hühnerbeiner Straße
In den Anlagen
Jageteufel-Straße
Jakobi-Kirche
Johannes-Kirche
Johannis-Kloster
Johannis-Straße
Kaiser-Wilhelm-Platz
Kaiser-Wilhelm-Straße
Karl-Straße
Kirchen-Straße
Kirchplalz
Kohlmarkt
Kommandantur
König-Albert Straße
Königs-Platz
Königs-Straße
Königsthor, Am
Krankenhaus
Krautmarkt
Kronenhof-Straße
Kronprinzen-Straße
Kurfürsten-Straße
Landgericht
Lange Brücke
Lastadie
Linden-Straße
Loge
Logen-Garten.
Löwe-Straße
Luisen-Straße
Lutherischer Kirchhof
Marien-Platz
Marktplatz
Masches Insel
Militär-Kirchhof, Alter
Militär-Kirchhof, Neuer
Mittwoch-Straße
Moltke-Straße
Mönchen-Straße
Münz-Straße
Museum
Neue Brücke
Neuer Markt
Ober-Wick
Oder-Straße, Große
Oder-Straße, Kleine
Offizier-Kasino
Papen-Straße
Parade-Platz
Parnitzer Bollwerk
Passauer Straße
Pelzer Straße
Pölitzer Straße
Polizei-Direktion
Post
Preußische Straße
Prutz-Straße
Rahms Insel
Rathaus
Realschule
Reformierter Kirchhof
Reichsbank
Reifschläger-Straße
Rosengarten-Straße
Roßmarkt
Roßmarkt-Straße
Sankt Petri-Kirche
Sanne-Straße
Schiller-Straße
Schloßkirche
Schloß, Königliches
Schuh-Straße
Schulzen-Straße
Schützengarten
Schwerin-Straße
Schwimm-Anstalt
Sellhaus-Bollwerk
Silberwiese
Speicher-Straße
Synagoge
Tattersall
Theater
Töpfers Park
Töpfers Park-Straße
Turner-Straße
Unter-Wick
Viktoria-Platz
Wall-Straße
Westend
Wilhelm-Straße
Wollweher-Straße, Große
Wrangel-Straße
Zeughaus
Zirkus
Zum. Artikel "Stettin".
308
Stettiner Haff - Steub.
entsprechend ausgebaut, den Mittelpunkt breiter, mit Anlagen
versehener Passagen bilden. Die Zahl der Einwohner belief sich 1885
mit der Garnison (ein Grenadierregiment Nr. 2, 2 Füsilierbat.
Nr. 34 und 2 Abteilungen Feldartillerie Nr. 2) auf 99,543 Seelen,
darunter 2881 Katholiken, 923 sonstige Christen und 2501 Juden. Die
Industrie ist bedeutend. S. hat große Eisengießereien
und Maschinenfabriken, darunter die große Maschinenfabrik und
Schiffbauanstalt "Vulkan" in Bredow (s. d.) mit 4-5000 Arbeitern,
Fabrikation von chemischen Produkten (in Pommerensdorf) mit 800-900
Arbeitern, Zementfabriken (in Züllchow, Bredow und Podejuch)
mit 300-600 Arbeitern, große Mühlenetablissements (in
Züllchow), ferner Fabriken für Zucker, Zichorie,
Parfümerien, Seife, Stearin, Öl, feuerfeste
Geldschränke, Kartonagen, Dachpappe etc., Gartenbau,
Bierbrauerei und Branntweinbrennerei. Für den Handel, der
durch eine Handelskammer, eine Börse, eine Reichsbankstelle
(Gesamtumsatz 1887: 756 Mill. Mk.) und andre große
Geldinstitute unterstützt wird, ist S. der erste Seeplatz des
preußischen Staats. Ausgeführt werden vorzüglich:
Getreide, Mehl, Sprit, Ölfrüchte, Holz, Chemikalien,
Kartoffeln, Heringe, Zichorie, Zucker, Steinkohlen, Zink etc.,
dagegen werden eingeführt: Eisen und Eisenwaren, Erden und
Erze, Getreide, Mehl, Bau- und Nutzholz, Heringe, Reis, Fettwaren,
Petroleum, Steine, Schiefer, Steinkohlen etc. Der Wert der 1887
eingeführten Waren betrug 16,760,036 Mk., der
ausgeführten Waren 17,019,190 Mk. Die Stettiner Reederei
zählte 1887: 193 Schiffe, darunter 58 Seedampfer, mit zusammen
44,259 Registertonnen Raumgehalt. In den Hafen liefen ein 1887:
3826 Schiffe zu 1,116,438 Registertonnen, es liefen aus: 3884
Schiffe zu 1,142,427 Registertonnen. Regelmäßige
Dampferverbindungen unterhält S. mit den wichtigsten
Häfen der Ostsee, mit London und New York. An Bildungs- und
andern ähnlichen Anstalten besitzt S. 3 Gymnasien, 2
Realgymnasien, eine Handelsschule, ein Lehrerinnenseminar, eine
Taubstummen- und eine Blindenanstalt, ein Stadt-, ein pommersches
und ein antiquarisches Museum, einen Verein für
Altertumskunde, einen Kunstverein, mehrere Theater etc.; ferner:
eine Hebammenlehranstalt, ein Johanniskloster,
Diakonissenanstalten, ein Mädchenrettungshaus u. a. m. S. ist
Sitz eines Oberpräsidiums, einer königlichen Regierung,
eines Konsistoriums, eines Medizinal- und eines
Provinzial-Schulkollegiums und einer Provinzial-Steuerdirektion,
der Provinzialverwaltung , der pommerschen
Generallandschaftsdirektion, einer Rentenbank für die
Provinzen Pommern und Schleswig-Holstein, eines Oberlandes- und
eines Landgerichts, einer Oberpostdirektion, eines Seeamtes, eines
Landratsamtes (für den Kreis Randow) etc.; ferner: des
Generalkommandos des 2. Armeekorps, des Kommandos der 3. Division,
der 5. und 6. Infanterie-, der 3. Kavallerie- und der 2.
Feldartilleriebrigade. - Zum Landgerichtsbezirk S. gehören die
14 Amtsgerichte zu Altdamm, Bahn, Gartz a. O., Greifenhagen,
Kammin, Neuwarp, Pasewalk, Penkun, Pölitz, Stepenitz, S.,
Swinemünde, Ückermünde und Wollin. Geschichte. S.
ist schon im 11. Jahrh. gegründet worden, erscheint aber erst
im 12. Jahrh., seit der Zerstörung von Jumne durch die
Dänen, als der erste Seehandelsplatz an der Oder. Von Herzog
Barnim I. erhielt es 1243 Stadtrecht. Seit 1107 war es Sitz eines
pommerschen Fürstenhauses und blieb es, den Zeitraum von 1464
bis 1532 abgerechnet, bis zum Aussterben der einheimischen
Dynastie. 1360 trat es dem Hansabund bei und nahm 1522 die
Reformation an. Hier wurde im Dezember 1570 ein Friede zwischen
Schweden und Dänemark unter Vermittelung des Kaisers
geschlossen. Am 11. Juli 1630 wurde S. Gustav Adolf
eingeräumt, der große Verbesserungen an der Befestigung
vornahm. Im Westfälischen Frieden nebst Vorpommern an Schweden
abgetreten, ward die Stadt 6. Jan. 1678 von dem Kurfürsten von
Brandenburg durch Kapitulation eingenommen, aber schon 1679 an
Schweden zurückgegeben. Eine abermalige Belagerung hatte sie
1713 im Nordischen Krieg von den verbündeten Russen und
Sachsen auszuhalten, wurde infolge einer Übereinkunft (29.
Sept.) von Preußen und Holstein besetzt und erst im Frieden
von Stockholm 1720 nebst Vorpommern an Preußen abgetreten.
Nach der Katastrophe von 1806 ward die Festung 29. Okt. vom General
v. Romberg ohne Widerstand den Franzosen übergeben, die sie
bis 5. Dez. 1813 besetzt hielten. Durch das Reichsgesetz über
den Umbau der deutschen Festungen (19. Mai 1873) ist die Festung S.
aufgehoben. Vgl. Thiede, Chronik von S. (Stett. 1849); Berghaus,
Geschichte der Stadt S. (Wriezen 1875-76, 2 Bde.); Th. Schmidt, Zur
Geschichte des Handels und der Schiffahrt Stettins 1786-1846
(Stett. 1875); K. F. Meyer, S. zur Schwedenzeit (das. 1886); W. H.
Meyer, S. in alter und neuer Zeit (das. 1887). Der Regierungsbezirk
S. (s. Karte "Pommern") umfaßt 12,074 qkm (219,29 QM.) mit
(1885) 728,046 Einw. (darunter 709,671 Evangelische, 8871
Katholiken und 6832 Juden) und 13 Kreise:
Kreise QKilom. QMeil. Einwohner Einw. auf 1 qkm
Anklam 648 11,77 31088 48
Demmin 984 17,87 46464 47
Greifenberg 764 13,88 36257 47
Greifenhagen 964 17,51 52158 54
Kammin 1135 20,63 43626 38
Naugard 1228 22,30 55208 45
Pyritz 1045 18,98 43968 42
Randow 1316 23,90 109462 83
Regenwalde 1190 21,61 46036 40
Saatzig 1220 22,16 66688 55
Stettin (Stadt) 60 1,09 99543 -
Ückermünde 831 15,09 48693 59
Usedom- Wollin 689 12,51 48855 71
Stettiner Haff, s. Pommersches Haff.
Steub, Ludwig, Schriftsteller, geb. 20. Febr. 1812 zu
Aichach in Oberbayern, siedelte mit seinen Eltern später nach
München über und studierte daselbst erst Philologie, dann
aber Rechtswissenschaft. 1834 ging er nach Griechenland, wo er erst
eine Stelle im Büreau der Regentschaft zu Nauplia, dann auf
dem Staatskanzleramt zu Athen bekleidete und bis 1836 blieb. Nach
seiner Rückkehr, die ihn über Rom, Florenz und Venedig
führte, ließ er sich in München nieder, wurde hier
1845 zum Anwalt, 1863 zum Notar ernannt und starb 16. März
1888. Steubs Schriften behandeln vorzugsweise die ethnographischen
und kulturhistorischen Verhältnisse der Alpenländer;
hierher gehören zunächst: "Über die Urbewohner
Rätiens und ihren Zufammenhang mit den Etruskern" (Münch.
1843); "Zur rätischen Ethnologie" (Stuttg. 1854); "Die
oberdeutschen Familiennamen" (Münch. 1870); "Onomatologische
Belustigungen aus Tirol" (Innsbr. 1879); "Zur Namens- und
Landeskunde der Deutschen Alpen" (Nord l. 1885) und "Zur Ethnologie
der Deutschen Alpen" (Salzb. 1887). Mit vielem Glück hat S.
sodann die
309
Steuben - Steuerbewilligung.
Ergebnisse strenger Forschung in das Gewand des gefällig
unterhaltenden Reisebildes zu kleiden gewußt, so in: "Drei
Sommer in Tirol" (Münch. 1846; 2. Aufl., Stuttg. 1871, 3
Bde.); "Aus dem bayrischen Hochland" (das. 1850); "Das bayrische
Hochland" (Münch. 1860); "Wanderungen im bayrischen Gebirge"
(das. 1862); "Herbsttage in Tirol" (das. 1867); "Altbayrische
Kulturbilder" (Leipz. 1869); "Lyrische Reisen" (Stuttg. 1878) und
"Aus Tirol" (das. 1880). Eine Frucht seines Aufenthalts in
Griechenland waren die "Bilder aus Griechenland "(Leipz. 1841, 2.
Ausg. 1885). Außerdem veröffentlichte er
Belletristisches, wie: "Novellen und Schilderungen" (Stuttg. 1853),
"Deutsche Träume", Roman (Braunschweig 1858, 3 Bde.), die
Erzählungen: "Der schwarze Gast" (Münch. 1863), "Die Rose
der Sewi" (Stuttg. 1879), die Lustspiele: "Das Seefräulein"
und "D1e Römer in Deutschland" (1873), "Sängerkrieg in
Tirol", Erinnerungen aus den Jahren 1842-44 (Stuttg. 1882), u. a.
Seine "Kleinern Schriften" erschienen gesammelt Stuttgart 1873-75,
4 Bde.; seine "Gesammelten Novellen" daselbst 1881 (2. Aufl. 1883).
In der "Deutschen Bücherei" erschien von ihm: "Mein Leben"
(mit Anhang von Felix Dahn: "Über Ludwig S.", Bresl.
1883).
Steuben, 1) Friedrich Wilhelm von, amerikan. General,
geb. 15. Nov. 1730 zu Magdeburg, wo sein Vater preußischer
Ingenieurhauptmann war, trat 1747 als Fahnenjunker in das
preußische Infanterieregiment Lestwitz, ward 1753 Leutnant,
machte den Siebenjährigen Krieg meist als Adjutant mit
Auszeichnung mit, nahm nach dem Ende desselben als Kapitän
seinen Abschied, ward Hofmarschall des Fürsten von
Hohenzollern-Hechingen und trat 1775 als Oberst in badische
Dienste. Er begab sich 1777 auf Veranlassung des französischen
Ministers Saint-Germain und Beaumarchais' nach Nordamerika, wo er
1778 als Generalmajor und Generalinspektor der Armee in die Dienste
der Vereinigten Staaten trat, erwarb sich um die Disziplinierung,
die Organisation und die Einübung der Truppen große
Verdienste, war auch zeitweilig Generalstabschef Washingtons, der
ihn besonders hochschätzte, und beteiligte sich in
hervorragender Weise am Entwerfen der Operationspläne. 1780
ward er Greenes Generalquartiermeister in Virginia, wo er auch
selbständig operierte und mit kleinen Mitteln bedeutende
Erfolge errang. Trotz seiner Verdienste mußte er nach
Beendigung des Kriegs sieben Jahre warten, ehe der Kongreß
seinen Ansprüchen auf Entschädigung seiner Verluste und
eine Pension einigermaßen gerecht wurde; doch machten ihm
einige Staaten Landschenkungen. S. lebte nach seiner Verabschiedung
teils in New York, teils aus seiner Farm in Oneida County, wo er
28. Nov. 1794 starb. Vgl. F. Kapp, Leben des amerikanischen
Generals F. W. v. S. (Berl. 1858).
2) Karl von, franz. Maler, geb. 19. April 1788 zu Bauerbach in
Baden, bildete sich in Paris unter David und Gros und malte nach
dem Vorbild dieser Meister eine große Zahl von
Geschichtsbildern von theatralischer Haltung, darunter Peter d. Gr.
in einem Sturm auf dem Ladogasee (1813), der Schwur auf dem
Rütli, Tell den Nachen von sich stoßend, Peter d. Gr.
als Kind durch seine Mutter vor den aufständischen Strelitzen
gerettet, Napoleons I. Rückkehr von Elba und Napoleons I. Tod,
die Schlachten von Tours, Poitiers und Waterloo (im Museum zu
Versailles) u. a. Er starb 21. Nov. 1856 in Paris.
Steubenville (spr. stuhbenwill), nach Steuben 1) benannte
Stadt im nordamerikan. Staat Ohio, am Ohio, hat lebhaften Verkehr,
eine höhere Schule, ein sehr geschätztes Seminar für
Mädchen und (1880) 12,097 Einw. In der Nähe sind
Kohlengruben.
Steud., bei botan. Namen Abkürzung für H.
Steudner (s. d.).
Steudner, Hermann, Naturforscher und Afrikareisender,
geb. 1832 zu Greiffenberg in Schlesien, studierte in Berlin und
Würzburg Botanik und Mineralogie und ließ sich dann
durch Barth zur Teilnahme an der deutschen Expedition nach den
Nilländern unter Heuglin gewinnen. Er begleitete denselben
1861 über Massaua und Keren (im Lande der Bogos) nach Adoa,
Gondar und südlich davon über Magdala hinaus bis zum
Kriegslager des Kaisers Theodoros bei Edschebet. Die Rückreise
erfolgte vom Tsanasee ab in nordwestlicher Richtung zum Blauen Nil
und nach Chartum. 1863 reiste er wieder mit Heuglin und im
Anschluß an die Tinnésche Expedition von Chartum nach
dem Bahr el Ghasal und zum See Reck; bei seinem weitern Vorgehen
aber nach Westen über den Djurfluß erlag er in dem Dorf
Wau 1863 einer Krankheit. Seine sorgfältigen Berichte (in der
"Zeitschrift für allgemeine Erdkunde" 1862-64) sind um so
wichtiger, als weite von ihm bereiste Strecken vorher von einem
Botaniker von Fach noch nicht durchforscht waren.
Steuer, s. Steuerruder.
Steuerabwälzuug, s. Steuer, S. 312.
Steuerbewilliguug und Steuerverweigerung ist als Recht der
Volksvertretung nicht erst mit der konstitutionellen Staatsform
anerkannt worden. Die Entstehung dieser Befugnis reicht vielmehr
viel weiter zurück. Den mittelalterlichen Ständen in den
einzelnen deutschen Territorien, welche allerdings nicht die
Gesamtheit des Volkes, sondern nur gewisse bevorzugte Klassen
desselben vertraten, stand sie unbestritten zu. Aus dem Recht,
Steuern zu bewilligen, d. h. ihre Erhebung zuzulassen, entwickelte
sich aber auch ein Recht der Mitwirkung bei ihrer Verwendung, und
so entstand das parlamentarische Budgetrecht. In England
unterscheidet man dabei einen festen und einen beweglichen Teil des
Staatshaushalts. Zu dem festen Teil gehören alle diejenigen
Einnahmen, welche durch Gesetz auf unbestimmte Zeit, d. h. auf so
lange bewilligt sind, bis sie durch ein andres Gesetz aufgehoben
werden, und alle diejenigen Ausgaben, welchedem Betrag nach
gesetzlich feststehen. Von den Ausgaben für das Heer
abgesehen, welche in England alljährlich neu bewilligt werden
müssen, gehören die meisten Staatsausgaben dem festen
Teil des Budgets an. Dieser feste Teil unterliegt der
jährlichen Bewilligung nicht. Das Recht des Unterhauses bei
Feststellung des Staatshaushalts besteht nur in folgenden
Befugnissen: jeder neuen von der Regierung geforderten Steuer,
jeder Verlängerung einer nur periodisch oder auf einen
bestimmten Zeitraum eingeführten Steuer, jeder Erhöhung
oder Abänderung bestehender Steuern die Zustimmung versagen zu
können und in dem beweglichen Teil der Staatsausgaben die von
der Regierung geforderten Beträge im einzelnen abzusetzen oder
zu streichen. Je nach der Richtung, in welcher diese Befugnisse
ausgeübt werden, spricht man von einer Bewilligung oder
Verweigerung der Steuern. Diese beiden Rechte sind offenbar
Korrelate: man kann nur bewilligen, was man auch verweigern
dürfte. Die meisten Verfassungen enthalten gegenwärtig
die Bestimmung, daß alle Einnahmen und Ausgaben des Staats
jährlich auf den Staatshaushaltsetat gebracht und dort
bewilligt werden müssen. Infolgedessen kann ein
310
Steuerbord - Steuern.
Widerspruch zwischen einem Gesetz und einem
Geldbewilligungsbeschluß entstehen und damit ein Konflikt,
dessen Lösung nicht durch eine Interpretation des geltenden
Rechts herbeigeführt, sondern der als eine Machtfrage
behandelt wird. Ein solcher Konflikt war der preußische
"Militärkonflikt", der von 1862 bis 1866 währte.
übrigens bleiben Steuergesetze, welche auf die Dauer erlassen
sind, so lange wirksam , bis sie auf verfassungsmäßigem
Weg wieder aufgehoben werden; gleichviel ob das Budget zu stande
kommt oder nicht. Dies ist z. B. in der preußischen
Verfassungsurkunde (Artikel 109) ausdrücklich anerkannt. Um
der Volksvertretung ein wirksames Recht der S. u. S. zu geben, ist
notwendig, daß wenigstens Eine periodische und bewegliche
Steuer vorhanden sei, durch deren Bewilligung oder Verweigerung die
Volksvertretung einen Einfluß auf die beweglichen Ausgaben
gewinnt. Im Deutschen Reich ersetzen die Matrikularbeiträge
diese periodische, bewegliche Steuer, und durch sie übt der
Reichstag ein Recht der S. u. S. Vgl. Gneist, Budget und Gesetz
(Berl. 1867); Laband, Das Budgetrecht (das. 1871).
Steuerbord, die rechte Seite des Schiffs, wenn man in der
Richtung von hinten nach vorn sieht. Der Ausdruck stammt daher,
daß der Steuermann eines mit einem Riemen oder losen Ruder
gesteuerten Fahrzeugs seinen Platz an dessen hinterm Ende auf
dieser Seite hatte. Vgl. Bord.
Steuerbuch, s. v. w. Kataster (s. d.).
Steuereinheit, die Maßeinheit der Gegenstände,
für welche die Steuer ausgeworfen ist; dieselbe kann, wie bei
spezifischen Zöllen, in Stückzahl, Maß oder Gewicht
(100 kg) oder, wie bei Wertzöllen und den meisten Steuern, in
einer Geldsumme angegeben sein. Auch ist S. s. v. w. einfacher
Steuersatz oder Simplum, d. h. gleich der Summe, welche als normale
Steuerhöhe für die Einheit der Steuerbemessungsgrundlage
angegeben ist und je nach Bedarf des Staats in einem mehrfachen
Betrag zur Erhebung gelangt. Das Steuersimplum hat besonders seine
Bedeutung für die Fälle, in welchen ein eignes
Steuerkapital (s. d.) berechnet oder überhaupt eine Steuer als
bewegliche in der Art benutzt wird, daß dieselbe eine
Ergänzung der übrigen Steuern bildet. Letzteres ist der
Fall bei der englischen Einkommensteuer, welche vorzüglich zur
Deckung von etwanigem Mehrbedarf bestimmt ist, während die
preußische Einkommensteuer in einem festen Prozentsatz vom
Einkommen erhoben wird.
Steuerfundation, Steuerdeckung, die Sicherung, welche
gegen Entwertung von Staatspapiergeld dadurch geboten wird,
daß dasselbe an öffentlichen Kassen an Zahlungs Statt
angenommen wird, allenfalls in Verbindung mit dem Zwang, daß
bei Meidung eines Strafagios wenigstens ein Teil der Steuern in
Papiergeld (s. d.) entrichtet werden muß.
Steuerfuß, das Verhältnis der Steuer zu
derjenigen Summe, von welcher sie erhoben wird. So ist, wenn von
einem Einkommen von 4-5000 Mk. 100 Mk. entrichtet werden, der S.
gleich 0,020-0,025 oder, auf 100 als Einheit bezogen, gleich 2-2,5
Proz. Auch wird die Summe, welche von der Einheit der
Bemessungsgrundlage, mag dieselbe in einer Geldsumme bestehen oder
nicht, als S. bezeichnet. Insofern wird auch von einem S. bei dem
Dimensionsstempel (s. Stempel) oder bei Zöllen gesprochen,
welche nach Maß, Gewicht oder Stückzahl erhoben
werden.
Steuergemeinschaft nennt man zum Zweck einer
gleichmäßigen Besteuerung geschlossene
Staatenverbindungen. So bilden die norddeutschen Gliederstaaten mit
Elsaß-Lothringen eine S. für Erhebung wichtiger
Verbrauchssteuern.
Steuerkapital, bei verschiedenen direkten Steuern die
Summe, für welche die Steuer als ein Bruchteil in der Art
ausgeworfen ist, daß die relative Steuerhöhe
(Steuerfuß) für alle steuerpflichtigen Personen oder
Gegenstände als gleich erscheint. Ein S. wird vorzüglich
zu dem Zweck berechnet, um in Fällen, in welchen es an einem
Vergleichsmaßstab für verschiedene Steuern fehlt, eine
Einheit zu schaffen und dann nach Bedarf für alle
gleichmäßig die Steuer in einem Ansatz erhöhen oder
herabsetzen zu können. Die Einkommensteuer kann in der Art
ausgeworfen werden, daß in einer Tabelle die Summen
(Prozente) angegeben sind, welche von den verschiedenen
Einkommenshöhen erhoben werden. Nach Bedarf könnte ein
Mehrfaches aller Prozente einverlangt werden. Zahlt man z. B. von
6000 Mk. 3 Proz., von 1000 Mk. 1 Proz., und muß die Einnahme
auf das Doppelte gesteigert werden, so erhebt man einfach im einen
Fall 6, im andern 2 Proz. Statt dessen kann aber auch der
Prozentsatz scheinbar gleich gemacht werden. So könnte, wenn
1000 Mk. das niedrigste noch zu besteuernde Einkommen ist, die
Summe als Einheit angenommen werden, von welcher 10 Mk. als
Steuersimplum (1 Proz.) zu erheben sind. Von 6000 Mk. wären
für gewöhnlich 3 Simpeln zu bezahlen. Um aber auch hier
auf 1 Simpel zu kommen, beziffert man das S. für ein Einkommen
von 6000 Mk. auf 18,000 Mk., von welchen ein Simplum sich auf 180
Mk. stellt. Seine eigentliche Bedeutung gewinnt aber die
Aufstellung eines Steuerkapitals für diejenigen Steuern,
welche nach äußern Merkmalen gemessen werden; so
insbesondere für die Gewerbesteuer, zumal wenn diese Steuern
mit progressivem Steuerfuß angelegt sind. Man bestimmt dann
Steuerkapitalien für gewerbliche Unternehmungen, Grund und
Boden, Gebäude, ferner für andre Einkommensquellen mit
genau bestimmbaren Erträgen und erhält eine Gesamtsumme
für das ganze Staatsgebiet, von welcher der Normalbedarf das
Simplum (berechnet für 100 oder 1000) ausmacht. Ist der Bedarf
m-mal so groß, so werden m Simpla ausgeschrieben und
erhoben.
Steuerkontingent, der bestimmte von einer Gesamtheit von
Pflichtigen und auf die letztern zu verteilende Steuerbetrag, s.
Kontingentierung der Steuern.
Steuerkredit, s.Steuern, S. 313, vgl. auch
Zölle.
Steuermann, auf Kriegsschiffen der Deckoffizier, welcher
unter Verantwortlichkeit des wachthabenden Offiziers die
Navigierung des Schiffs leitet, das Steuern beaufsichtigt, loggt
und den Wachthabenden bei Beobachtungen unterstützt. Auf
Handelsschiffen steht der S. zunächst unter dem Kapitän,
beaufsichtigt das Steuern, die Takelung, das Ankergerät etc.
Er muß im Stande sein, alle Instrumente und die Seekarten
richtig zu benutzen und das Schiff bei jedem Wetter zu
manövrieren; im Notfall vertritt er den Kapitän. Er
erwirbt seine Qualifikation durch eine reichsgesetzlich geregelte
Prüfung für große oder kleine Fahrt. Vgl. Marine,
S. 252.
Steuern im weitern Sinn sind alle nicht auf privatrechtlichem
Titel beruhenden Abgaben, welche die Angehörigen einer
öffentlich-rechtlichen Gemeinschaft an die letztere
entrichten. Sie umfassen somit auch Gebühren, Strafgelder etc.
sowie solche Abgaben, deren Zweck keineswegs eine
Einnahmebeschaffung ist (sogen. Polizeisteuern, echte Luxussteuern,
welche den Luxus hindern sollen, etc.). Heute versteht man unter
denselben Beiträge, welche zum Zweck allgemeiner Ko-
311
Steuern (Allgemeines, Steuerpolitik).
stendeckung der Staats- oder Gemeindewirtschaft von Staats- oder
Gemeinde- (Kreis- etc.) Angehörigen sowie von im Staatsgebiet
sich aufhaltenden Ausländern zwangsweise erhoben werden.
Dadurch, daß die S. nicht zur Vergütung eines durch den
Zahlenden veranlaßten Aufwandes dienen sollen, unterscheiden
sich dieselben von den Gebühren. Bisweilen wird verlangt, die
Besteuerung solle auch als Mittel benutzt werden, um eine für
die untern Klassen günstigere Verteilung des Einkommens zu
bewirken (sogen. sozialpolitische Seite der S.). Während heute
der Zwang ein Merkmal der Steuerbegriffs bildet, war derselbe dem
letztern früher in Deutschland so fremd, daß V. L. v.
Seckendorff in seinem "Deutschen Fürstenstaat" von 1656 die S.
als "Extraordinar Anlagen" bezeichnete, welche "freywillig und als
guthertzige Beysteuern gereichet, und dahero auch in etlichen Orten
Bethen (nach andrer Schreibweise Beden oder Beeden), das ist
erbetene Einkünffte, anderswo auch Hülffen und Praesente
genennet werden". Diese Beden (petitiones, precariae, Heischungen)
wurden in Geld oder Naturalien entrichtet. Ritter und Geistliche
waren davon meist befreit. In außerordentlichen Fällen
wurden sogen. Notbeden gefordert. Auch Städte zahlten oft
Beden (Orbede) an den Landesherrn.
Auferlegte S. (Auflagen) wurden von den Germanen früher als
ein Zeichen der Unfreiheit betrachtet; noch in den ersten Zeiten
des Mittelalters durften die auf dem Reichstag bewilligten S. nur
von denen erhoben werden, die sie bewilligt hatten. Übrigens
waren die S. auch in der ältern germanischen Zeit durch die
Sitte mehr oder weniger gebotene Beiträge, welche in der Zeit,
als der Staatsgedanke mehr von privatrechtlichen Elementen
durchsetzt war, vertragsmäßig geregelt wurden
(Ordinarsteuern). Bei außerordentlichen Beihilfen
(Extraordinarsteuern) ließen sich die Landstände
landesfürstliche Reversbriefe ausstellen, "daß solche
Bewilligungen künfftig zu keiner ordentlichen Beschwerung oder
Aufflage gereichen sollten". Die Einnahmen aus S. flossen in die
der Aufsicht und Kontrolle der Landstände unterstellte
Steuerkasse, während die von den Landständen
unabhängige Kammerkasse die Einnahmen aus Domänen und
Regalien aufnahm. In den modernen Kulturstaaten unterliegt die
Besteuerung und die Verwendung der S. verfassungsmäßiger
Regelung und Bewilligung. Die durch Geburt, Ernennung und Wahl
bestimmten gesetzgebenden Gewalten ordnen die S. an, während
der einzelne Staatsangehörige sich solcher Anordnung zu
fügen hat (Steuerrecht des Staats, Steuerpflicht des
Staatsangehörigen). Vertritt hierbei die Regierung mit ihren
Anforderungen das Interesse der Verwaltung, so wahrt die
Volksvertretung mit ihrem Steuerbewilligungsrecht dasjenige der
Steuerzahler. Dem Steuerbewilligungsrecht entspricht das nicht dem
einzelnen Steuerzahler, sondern der Volksvertretung zustehende
Recht der Steuerverweigerung. Doch wird dies Recht nicht allein
durch die gesetzlich feststehenden Ausgaben, sondern überhaupt
durch die Notwendigkeit der Staatserhaltung praktisch
beschränkt. Die Praxis (in England) und das formale Recht (in
Deutschland) fassen das Steuerbewilligungsrecht auch nur in diesem
Sinn auf. Darum bleiben Steuergesetze, welche nicht für einen
bestimmten Zeitraum erlassen werden, so lange bestehen, als sie
nicht auf verfassungsmäßigem Weg (Übereinstimmung
der gesetzgebenden Gewalten) aufgehoben werden, während
für Einführung neuer S. die Bewilligung der
Volksvertretung erforderlich ist (vgl. Budget).
Steuerpolitik
Eine gute Steuerpolitik stellt folgende Anforderungen: I. Im
Interesse einer geordneten, echt staatswirtschaftlichen
Bedarfsdeckung soll 1) die Steuer sich als ausreichend erweisen. 2)
Ihr Ertrag soll genügend genau voraus bestimmbar sein und auch
pünktlich und sicher eingehen. 3) Die S. müssen
fähig sein, sich dem wechselnden Bedarf des Staats anzupassen,
ohne daß ihre Erhöhung oder Erniedrigung anderweite
Nachteile (z. B. Störungen der Verkehrs- und Erwerbsordnung)
im Gefolge hat.
II. Im Interesse der Steuerzahler liegt es, daß 1) die
Gesamtlast der Steuer richtig verteilt ist. Es soll
demgemäß sein a) die Steuerpflicht eine allgemeine und
zwar als subjektive, indem sie alle steuerpflichtigen Personen, als
objektive, indem sie alle pflichtigen Gegenstände
erfaßt. Steuerfreiheiten (Exemtionen, Steuerprivilegien)
widersprechen dem herrschenden Gerechtigkeitsgefühl.
Früher vielfach von privilegierten Ständen nicht allein
für ihren Grundbesitz, sondern auch für indirekte Abgaben
in Anspruch genommen, sind die Steuerfreiheiten in der neuern Zeit
meist (bei Grundsteuern in der Regel gegen Gewährung von
Entschädigung) aufgehoben worden. Dauernde Freiheiten von
direkten S. (allen, bez. einzelnen) genießen heute meist das
Staatsoberhaupt (in Preußen auch die 1866 depossedierten
Fürstenhäuser), ehemals reichsunmittelbare Standesherren
(in Preußen nur für ihre Domanialgrundstücke),
Gesandte fremder Mächte, Offiziere für den Fall der
Mobilmachung, Beamte für einen Teil der Gemeindesteuer. Dann
wird freigelassen nicht allein der Arme, sondern auch von der
Einkommensteuer das sogen. Existenzminimum in England bis zu 150
Pfd. Sterl., in Preußen bis zu 900 Mk. Vorübergehende
Befreiungen, insbesondere von Ertragssteuern, treten oft ein, wo
sie durch die persönliche Lage (thatsächlich mangelnde
Steuerfähigkeit), Elementarereignisse, Meliorationen mit
zeitweiliger Ertragslosigkeit auch wirklich geboten ist. Aber auch
Doppelbesteuerungen sind zu meiden. Aus diesen Grundsätzen
ergibt sich bei Beachtung eines gegebenen Steuersystems, wer als
pflichtiges Steuersubjekt (Inländer gegenüber
Ausländern, die Frage des abgeleiteten Einkommens, der
Besteuerung von Gesellschaften, Stiftungen, Gemeinden etc.) durch
die Steuer zu erfassen ist. b) Die Steuer soll
gleichmäßig verteilt und gerecht sein. Die ältere
Vergeltungstheorie betrachtete die Besteuerung als eine gerechte,
wenn sie dem Vorteil entspreche, den der Steuerzahler von der
Staatsverbindung habe (Leistung gleich der Gegenleistung). Dabei
nahm man meist an, daß der Staat dem Reichen nach
Maßgabe seines Reichtums mehr Vorteile biete als dem Armen.
So gelangen wir praktisch zu dem meist vertretenen Steuerprinzip,
welches die Steuerfähigkeit als richtigen Maßstab
für die Steuerverteilung betrachtet. Meist wird jetzt
verlangt, daß der Unkräftige freibleibe (Freilassung des
Existenzminimums, die nicht bei allen S. möglich, bei
Aufwandssteuern durch Wahl der Objekte angestrebt werden kann).
Dann sollen die Steuerkräftigen
verhältnismäßig stärker belastet werden,
indem, wenigstens bei kleinem und mittlerm Einkommen, individuelle
Verhältnisse (Krankheit, Stärke der Familie etc.)
berücksichtigt werden, das fundierte Einkommen höher
belastet wird. Streitig ist die Frage des Steuerfußes, d. h.
hier des Verhältnisses von Gesamtsteuer des Pflichtigen zu
dessen Gesamteinkommen. Von der einen Seite wird diejenige Steuer
als gerecht bezeichnet, welche vom Einkommen einen gleichbleibenden
Prozentsatz wegnehme
312
Steuern (Steuersysteme).
(konstanter Steuerfuß), von der andern diejenige, welche
das höhere Einkommen auch mit einem höhern Prozentsatz
belaste (progressiver Steuerfuß, progressive Steuer). Die
Idee der Progression findet mehrfach praktische Anwendung in der
Einkommensteuer. Doch kann dieselbe immer nur darin bestehen,
daß der Steuerfuß, wenn auch steigend, eine gewisse
Höhe nicht überschreitet. weil sonst die bald
übermäßig hoch werdende Steuer schädlich
wirken würde. Infolgedessen wird sich bei großer
Verschiedenheit des Einkommens die Steuer immer nur derart
gestalten können, daß der Steuerfuß von unten auf
steigend bei einer gewissen Einkommenshöhe einen
gleichbleibenden Satz erreicht (degressiver Steuerfuß,
degressive Steuer). Bei der Aufwandsteuer läßt sich die
Progression durch entsprechende Auswahl der Steuerobjekte,
höhere Belastung der bessern Qualitäten anstreben. Ob sie
im ganzen verwirklicht wird, hängt von der Gestaltung des
Steuersystems ab. c)Die Steuer soll den Pflichtigen richtig
erfassen. Viele
S. werden in der Absicht aufgelegt, daß dieselben vom
Zahler auf eine dritte Person übergewälzt werden (durch
Abzug von Zahlungen, Erhöhung des Kaufpreises). Nicht immer
sind solche überwälzungen möglich, auch können
sie vorkommen, wo sie der Absicht des Gesetzgebers widersprechen.
Die dadurch entstehenden Steuerprägravationen (einseitigen
Steuerüberbürdungen), bez. Steuerfreiheiten sind
möglichst durch richtige Wahl der S. und
zweckmäßige Ausführung der Besteuerung zu mindern.
Von der Steuerüberwälzung (als Rückwälzung vom
Käufer auf den Verkäufer als Fortwälzung von diesem
auf jenen) ist die sogen. Steuerabwälzung zu unterscheiden,
welche darin besteht, daß der Steuerzahler die Steuer durch
wirtschaftliche Verbesserungen ausgleicht.
2) Die Steuer soll ferner die wirtschaftliche Lage von
Steuerzahler und Steuerträger, Erwerb und Verkehr nicht
verkümmern. Dem entsprechend sind einseitige
Steuerüberlastungen zu meiden und geeignete Besteuerungsformen
anzuwenden.
III. Bezüglich der Erhebung ist endlich im Interesse von
Verwaltung und Steuerzahler zu fordern: I) Einfachheit und
Bestimmtheit der Steuer. Viele Steuervergehen werden unbewußt
begangen, weil die S. und die Steuerbestimmungen zu verwickelt und
unklar sind. 2) Möglichste Bequemlichkeit in Bezug auf Ort,
Zeit und Art der Entrichtung. Der Zahlungsort soll dem Wohnort des
Pflichtigen nicht zu entlegen sein. Die Steuer soll möglichst
in der Zeit der Zahlungsfähigkeit erhoben werden, darum
richtige Einteilung der Steuertermine, Zulassung von
Steuerkrediten, wenn ohnedies die frühere Erhebung nur der
formellen, nicht der tatsächlichen
Fälligkeit der Steuer entspricht (Rohstoffbesteuerung),
ferner von Vorauszahlungen und Teilzahlungen. Die Erhebungsform
soll mit ihrer Aufsicht, ihren Kontrollen und Vorschriften
möglichst wenig lästig fallen.
3) Die Erhebungskosten sollen möglichst niedrig sein.
4) Die Steuer soll dem Reize zu Umgehungen (Ersatz besteuerter
Verbrauchsgegenstände, Handlungen etc. durch unbesteuerte),
Hinterziehungen (milder Ausdruck für zu niedrige
Steuerfassion), Unterschleif, Schmuggel, Bestechung keinen
Spielraum gewähren. Es gibt nun keine Steuer, welche allen
diesen Anforderungen gleich vollkommen entspricht. Die gesamte
Leistungsfähigkeit läßt sich nicht direkt voll
erfassen, weil dieselbe für Dritte nicht genau erforschbar
ist, vom Steuerpflichtigen aber richtige Angaben nicht zu erwarten
sind. Die Besteuerung von Einkommen, bez. Ertrag würde weder
zureichen, den gesamten Staatsbedarf ohne einseitigen Druck
zudecken, noch eine gleichmäßige Verteilung der gesamten
Steuerlast zu bewirken. Diese Steuer darf demnach eine gewisse
Grenze nicht überschreiten und muß eine Ergänzung
in der indirekten Steuer finden.
Steuersysteme.
Als indirekte Steuer (Aufschlag, in Österreich auch
Steuergefälle genannt) wird meist eine solche verstanden,
welche dem Steuerzahler in der Absicht aufgelegt wird, daß
derselbe sie auf eine dritte Person, den Steuerträger,
überwälze, während bei der direkten Steuer
(Schatzungen) Zahler und Träger eine und dieselbe Person ist.
Da die Erhebungsform der Aufwandsteuern vorwiegend eine indirekte
ist, so bezeichnet man dieselben meist schlechthin als die
indirekten S. und rechnet denselben vielfach noch die Gebühren
und Verkehrssteuern hinzu, während die Ertragssteuern, die
Personal- und Einkommensteuern und die allgemeinen
Vermögenssteuern als direkte S. zusammengefaßt werden.
Von dieser Auffassung weichen andre wesentlich ab. Hoffmann("Lehre
von den S.") bezeichnete als direkte S. solche, die auf den Besitz,
als indirekte solche, die auf eine Handlung gelegt werden; Conrad
nennt indirekte S. diejenigen, bei denen man von den Ausgaben auf
die Einnahmen und somit indirekt auf die Leistungsfähigkeit
schließt, während bei direkten S. vom Besitz oder von
den Einnahmen unmittelbar die Leistungsfähigkeit
geschätzt wird.
Aus dem genannten Grund war man von jeher dazu gezwungen,
mehrere S. miteinander zu verbinden, von denen eine die andre zu
ergänzen bestimmt ist. Entspricht die Gesamtwirkung derselben
den Grundsätzen der Besteuerung, so bilden die S. ein
einheitliches organisches Steuersystem. Im praktischen Leben kommen
folgende S. nebeneinander vor:
1) S., welche auf Produktions- und Erwerbsquellen gelegt werden,
deren Erträge zu treffen bestimmt sind und demgemäß
Ertragsteuern (s. d.) genannt werden. Dieselben sind echte
Realsteuern, wenn sie auf die persönlichen Beziehungen des
Besitzers zur Steuerquelle (Schulden, Möglichkeit einer sehr
vorteilhaften Ausnutzung infolge persönlicher
Tüchtigkeit, günstiger sozialer Stellung u. dgl., oder
Schwierigkeit einer vorteilhaften Benutzung wegen Krankheit,
Überbürdung mit andern Aufgaben, große Entfernung
vom Wohnsitz etc.) gar keine Rücksicht nehmen. Eine
folgerichtig durchgeführte Ertragsbesteuerung würde die
gesamten Reinerträge, welche ein Volk zieht, und damit im
wesentlichen auch das gesamte Einkommen desselben treffen. In der
Praxis freilich kommt eine derartige Besteuerung nicht vor. Werden
doch in den meisten Ländern wichtige Produktionsquellen von
einer Ertragssteuer nicht belastet. Dann kommen bei Ertragssteuern
leicht Doppelbesteuerungen vor, wenn bei denselben nicht scharf
zwischen Real- und Personalsteuer unterschieden wird. Erträge
werfen nun ab das Kapital und die Arbeitskraft. Bei jeder
Unternehmung wären zu treffen alle Bezüge, welche den an
der Unternehmung beteiligten Personen zufließen können,
also der Unterschied zwischen dem gesamten Rohertrag und denjenigen
Aufwendungen, welche für den Zweck der Produktion gemacht
werden, ohne jenen Personen einen Genuß zu ermöglichen
(Rohstoffe, Heizstoffe, Saatfrucht, Dünger etc.). Dieser
Unterschied umfaßt die für die Arbeit gezahlten und
berechneten Löhne, die gezahlten und zu berechnenden
Kapitalzinsen und den dem Unternehmer verbleibenden
Überschuß. Trifft man
313
Steuern (Veranlagung und Erhebung).
denselben mit einer Art Unternehmungssteuer voll bei jedem
Unternehmer, so brauchen die Löhne und die Zinsen der
Leihkapitalien nicht noch besonders belastet zu werden. Kommen
dagegen die Löhne in Abzug, so ist die Arbeitskraft als
Ertragsquelle noch für sich zu besteuern. Ein
vollständiges Ertragssteuersystem müßte alsdann
treffen die Erträge: a) aus Grund und Boden (s. Grundsteuer);
b) von Häusern (s. Gebäudesteuer); c) aus allen sonstigen
gewerblichen und industriellen Unternehmungen (s. Gewerbesteuer);
d) aus der Arbeit (s. Lohnsteuer). Wird unter diesem Titel nur die
vermietete Arbeitskraft besteuert, so sind die aus der eignen
Unternehmung gezogenen Arbeitserträge unter den Titeln von
Grund-, Gebäude- und Gewerbesteuer zu treffen. Mehrere
Länder besteuern nun noch besonders e) die aus Leihkapitalien
fließenden Zinsen (s. Kapitalrentensteuer). Voraussetzung
hierfür aber ist, daß bei den Ertragsstenern die
Verschuldung berücksichtigt wird. Je mehr nun die S., welche
die Reinerträge eines ganzen Erwerbskörpers (Fabrik,
Landgut) treffen sollen, auf die einzelnen Personen gelegt werden,
auf welche sich jene Erträge verteilen, desto mehr nimmt die
Realsteuer den Charakter einer Personalsteuer an. Ganz
vorzüglich ist dies der Fall, wenn die Steuer außerdem
nicht nach den allgemein möglichen, sondern nach den
wirklichen Erträgen bemessen wird.
2) S. auf persönliches Einkommen. Dieselben sind
Personalsteuern, weil sie die Leistungsfähigkeit der einzelnen
Personen treffen. Ist die Steuer auf das Gesamteinkommen gelegt, so
nennt man sie allgemeine Einkommensteuer. (s. d.). Eine Abart
derselben ist die Rang- oder Klassensteuer (s. d.), bei welcher
nicht direkt das wirkliche Einzeleinkommen ermittelt, sondern aus
äußern Merkmalen, welche zu Gruppenbildungen
Veranlassung geben, auf die persönliche
Leistungsfähigkeit geschlossen wird. Hierher wird auch
vielfach die Kopfsteuer (s. d.) gerechnet. Dieselbe haftet
allerdings an einer Person, ist jedoch mit der Realsteuer insofern
verwandt, als sie einen allgemein möglichen Erwerb
voraussetzt, ohne die wirkliche Höhe desselben zu
berücksichtigen. Die Einkommensteuer kann jedoch auch in der
Art aufgelegt werden, daß man die einzelnen Quellen desselben
trifft, wie Einkommensbezüge aus Arbeit (Dienstleistungen,
Hilfe bei der Produktion) und aus Besitz (Grundeigentum,
Gebäude, flüssiges Kapital) und aus Verbindung von Arbeit
mit Besitz (eigne Bewirtschaftung landwirtschaftlichen
Geländes, Betrieb industrieller Unternehmungen etc.). Diese
"partiellen Einkommensteuern" fallen mit denjenigen Ertragssteuern
zusammen, welche die Erträge der Steuerquellen bei ihrer
Verteilung auf die einzelnen an denselben bezugsberechtigten
Personen erfassen.
3) S., welche nach Maßgabe des Aufwandes erhoben werden,
welchen ein Steuerpflichtiger macht. Die wichtigsten derselben sind
diejenigen, welche den Verbrauch von Sachgütern, wie Lebens-
und Genußmittel (vgl. Zölle und Aufwandsteuern),
treffen. Andre werden von Gebrauchsgegenständen erhoben, wie
Häusern, Pferden, Hunden etc. Dann gehört hierher die
Besteuerung der Ausgaben, welche für persönliche
Dienstleistungen und Vergnügungen (Schaustellungen,
Tanzvergnügen etc.) gemacht werden.
4) S. vom Vermögen, welche in der Wirklichkeit jedoch meist
Aufwand- oder Einkommensteuern sind (vgl.
Vermögenssteuern).
5) S., welche bei Gelegenheit von Handlungen und Ereignissen
erhoben werden. Hierher gehören die Gebührensteuern (s.
Gebühren), die Verkehrssteuern (s. d.), einschließlich
der Erbschaftssteuern (s. d.).
6) S., welche ganz oder teilweise die Stelle anderweiter dem
Staat schuldiger Leistungen vertreten. Dazu gehört
insbesondere die Wehrsteuer (s. d.).
Veranlagung und Erhebung. Die Ausführung der Besteuerung
(Veranlagung, Feststellung der Steuergrundlagen und Erhebung) ist
bei vielen S., zumal bei denjenigen, bei welchen sich keine
bleibenden Merkmale bieten, um Steuerpflicht und Steuerschuldigkeit
zu erkennen und zu bemessen, mit großen Schwierigkeiten
verknüpft. Zunächst handelt es sich um Feststellung des
Steuersubjekts, bez. des für dasselbe haftpflichtigen
Stellvertreters. Dieselbe ist einfach bei den meisten direkten S.,
bei welchen amtliche Nachforschung, Grundbücher, Meldezwang
des Pflichtigen zur Aufstellung von Steuerlisten führen,
ebenso bei vielen indirekten Verbrauchssteuern, bei welchen
äußere Thatsachen und gewerbepolizeiliche Listen die
Ermittelung erleichtern. Bei Zöllen und Accisen ist der
Frachtführer, bez. (besonders bei dem Begleitscheinverfahren)
der Eigentümer zahlungspflichtig. Bei vielen Verkehrssteuern
ist durch Gesetz zu bestimmen, wer von beiden Parteien die Steuer
zu entrichten hat. Bei mehreren S. fällt die Ermittelung der
Steuersubjekte mit derjenigen der Steuerobjekte zusammen, von
welchen S. zu entrichten sind. Großen Schwierigkeiten
begegnet meist die Bewertung der Objekte, zumal wo es an
äußerlich leicht erkennbaren Merkmalen und an objektiven
Maßstäben fehlte. Die Bemessung kann erfolgen durch die
Pflichtigen selbst (Fassion, Steuerbekenntnis bei der
Einkommensteuer, der Kapitalrentensteuer, Deklaration), durch
Steuergesellschaften, d. h. eine Gruppe von Steuerpflichtigen,
welche eine ihr auferlegte Gesamtsumme auf die einzelnen Mitglieder
verteilt, durch besondere Steuerkommissionen oder
Steuerausschüsse, welche auf Grund äußerer
Merkmale, von Personal- und Sachkenntnis die Einschätzung
vornehmen, durch die Steuerbehörde (Steuerkommissar,
Steuerperäquator etc.) selbst, bei einigen S. unter Zuziehung
von Sachverständigen etc. (vgl. Kataster). Die Steuereinhebung
wurde früher oft verpachtet, so in Rom, wo die Ritter
gewerbsmäßig als publicani (Steuerpachter) auftraten, in
Frankreich, wo die fermiers généraux (Generalpachter)
die S. der Regierung vorstreckten. Doch kommt die Verpachtung heute
nur noch selten vor. In manchen Fällen besorgt die Gemeinde
die Erhebung, bald als einfaches Erhebungsorgan, bald mit voller
Steuerhaftung, indem sie in diesem Fall oft eine Aversalsumme zahlt
und diese auf ihre Mitglieder verteilt. Ebenso können dritte
Personen, bei welchen sich viele Steuerschuldigkeiten
konzentrieren, die Einhebung übernehmen (bei verschiedenen
Gebühren und Verkehrssteuern). Meist besorgt heute der Staat
die Erhebung in Regie durch eigne Steuerbeamte (Steuereinnehmer,
Steuerempfänger, Steuerperzeptor etc.), insbesondere beim
Zollwesen, bei verschiedenen direkten Steuern etc. Bisweilen wird
hierbei unter Ersparung spezieller Berechnungen und lästiger
Einzelkontrollen die Erhebung dadurch vereinfacht, daß der
Steuerpflichtige eine vertragsmäßig festgesetzte Summe
für eine bestimmte Periode als Steuerabfindung (Fixation)
entrichtet. Im Interesse der Pflichtigen und des richtigen
Steuereingangs sind nötig die amtliche Benachrichtigung und
Steueransage (Zustellung von Steuerzetteln), Festsetzung von
Steuerterminen und Steuerfristen, die Gewährung von
Steuerkrediten (Gestattung der Zahlung zu späterer Zeit als
der gesetzlich bestimmten, wenn letztere
314
Steuerrepartition - Steuerung.
eigentlich zu früh angesetzt ist) unter
Sicherheitsleistung, die Einräumung des Reklamations-,
Beschwerde-, Steuerklagerechts gegenüber der Einschätzung
und Erhebung und die Steuerrestitution (Rückersatz, auch als
Exportbonifikation) bei Zahlungen, welche über die Grenze der
Steuerschuldigkeit hinausgehen. Bei ausbleibender Zahlung tritt
Mahnung und Pfändung (Steuerexekution) ein, allenfalls bei
augenblicklicher Zahlungsunfähigkeit die Steuerstundung, bei
Uneinbringlichkeit die Niederschlagung (Steuererlaß) oder
Steuerabschreibung (der Steuerrückstände oder
Steuerreste), ohne solche aber auch nach bestimmter Frist die
Steuerverjährung. Mittel zur richtigen Durchführung
gegenüber Steuerhinterziehungen, Defraudationen etc. sind die
Steuerkontrolle, die Steuerstrafe, der Steuereid, die
Denunziantengebühr, die Öffentlichkeit des
Steuerverfahrens, Begehung von gegensätzlichen Interessenten
bei der Einsteuerung etc. Mitte der 80er Jahre waren die
Einnahmen
an direkten Steuern Mill. Mk. %
an indirekten Steuern Mill. Mk. %
aus andern Quellen Mill. Mk. %
pro Kopf d. Bevöl-kerung Mark
Deutsches Reich nebst Gliederstaaten 260 13 600 29 1240 59 30 70
19,40
Österr.-Ungarn 280 21 670 49 410 31 30 70 26,00
Rußland 250 19 780 60 270 30 25 75 11,00
Italien 310 25 590 44 410 21 36 64 29,80
Frankreich 340 14 1800 74 290 18 15 85 56,80
Großbritannien. 270 15 1170 67 310 12 21 79 41,00
Vgl. Gebühren, Zölle, Aufwandsteuern sowie die
verschiedenen Artikel über die einzelnen S.
[Litteratur.] Außer den unter "Finanzwesen" angegebenen
Werken vgl. Hofmann, Die Lehre von den S. (Berl. 1840); v. Hock,
Die öffentlichen Abgaben und Schulden (Stuttg. 1863);
Förstemann, Die direkten und indirekten S. (Nordh. 1868);
Schäffle, Die Grundsätze der Steuerpolitik (Tübing.
1880); Roscher, System der Finanzwissenschaft (Stuttg. 1886);
Kaizl, Die Lehre von der Überwälzung der S. (Leipz.
1882); v. Falck, Rückblicke auf die Entwickelung der Lehre von
der Steuerüberwälzung (Dorp. 1882); R. Meyer, Die
Prinzipien der gerechten Besteuerung (Berl. 1884); Fr. J. Neumann,
Die Steuer (Leipz. 1887, Bd. 1); Holzer, Historische Darstellung
der indirekten S. (Wien 1888) ; Mangoldt, Das deutsche Zoll- u.
Steuerstrafrecht (Leipz. 1886) ; Vocke, Die Abgaben, Auflagen und
die Steuer vom Standpunkt der Geschichte etc. (Stuttg. 1887);
Rousset, Histoire des impôts indirects (Par. 1883).
Steuerrepartition, s. v. w. Steuerverteilung, Umlegung
einer bestimmten Summe auf die einzelnen steuerpflichtigen Personen
oder Gegenstände. Vgl. Repartitionssteuern und
Kontingentierung der Steuern.
Steuerrollen, s. Heberolle n.
Steuerruder (Ruder), Vorrichtung zum Lenken des Schiffs,
bestehend aus einem hölzernen oder eisernen Blatt, welches in
vertikaler Ebene, drehbar am Hintersteven des Schiffs, ähnlich
wie eine Thür in ihren Angeln, befestigt ist. Man
unterscheidet am S. das Ruderblatt, welches sich ganz oder zum
größten Teil unter Wasser befindet, und den Ruderhals
mit dem Ruderkopf, welche, wenn erforderlich, wasserdicht durch die
Schiffswand geführt, in den innern Schiffsraum hineinragen. Am
Ruderkopf greift die Ruderpinne an, ein hölzerner oder
eiserner einarmiger Hebel, oder das Ruderjoch, ein eiserner
zweiarmiger Hebel. Während die Pinne gewöhnlich mit dem
Ruderblatt in einer Ebene liegt, steht das Ruderjoch im allgemeinen
querschiffs. Durch Drehung der Pinne oder des Jochs wird das Ruder
um einen ebenso großen Winkel aus der Symmetrieebene des
Schiffs herausgedreht und dadurch die Symmetrie des den
Schiffskörper umgebenden Wasserstroms gestört,
vorausgesetzt, daß ein solcher infolge der bis dahin
geradlinigen Bewegung des Schiffs vorhanden ist. Das Schiff wird
dadurch gezwungen, von seiner bisherigen Bahn in der Weise
abzuweichen, daß der Mittelpunkt der vom Schwerpunkt des
Schiffs beschriebenen Bahnlinie auf derjenigen Seite des Schiffs
liegt, nach welcher das Ruderblatt gedreht wurde. In neuerer Zeit
ist bei einzelnen größern Schiffen (König Wilhelm)
das Balanceruder zur Anwendung gekommen, ein Ruder, dessen
Drehachse die Fläche des Ruderblattes ungefähr in dem
Verhältnis von 1:2 teilt, so daß ein Drittel des
Flächeninhalts des Blattes vor der Drehachse liegt. Ein
Balanceruder bedarf einer kleinern Kraft zum Drehen als ein ebenso
großes gewöhnliches Ruder und kann infolgedessen
schneller gedreht werden. Anderseits kehrt es nicht so schnell in
seine neutrale Lage zurück wie dieses. Die Bewegung der Pinne
ersolgt bei kleinern Schiffen direkt mit der Hand, bei
größern Schiffen durch Flaschenzüge,
Zahnradübersetzungen, Schraubenräder, hydraulische
Pressen etc. Die Kraft wird am Steuerrad eingeleitet, einem mit
Griffen versehenen, um eine horizontale Achse drehbaren
Speichenrad, welches eventuell in mehrfacher Ausführung
vorhanden sein muß, um eine größere Anzahl von
Leuten zum Drehen des Ruders verwenden zu können. Der
Widerstand des um einen gewissen Winkel gedrehten Ruders ist unter
sonst gleichen Umständen proportional mit dem Quadrat der
Schiffsgeschwindigkeit; steigert man diese auf das Doppelte, so
wächst dadurch der Widerstand des Ruders auf die vierfache
Größe. Es ist daher erklärlich, daß bei den
neuesten Schiffen mit Geschwindigkeiten bis zu 20 Knoten und
darüber zur Bewegung des Ruders Menschenkraft nicht mehr
ausreicht, um das Schiff Bahnlinien von starker Krümmung
beschreiben zu lassen. Dies ist die Veranlassung zur
Einführung des Dampfsteuerapparats, einer kleinen,
zweicylindrischen Dampfmaschine, welche die Achse der bisherigen
Steuerräder nach Steuerbord oder Backbord in Rotation
versetzt. Die Verrichtung des Mannes am Ruder beschränkt sich
alsdann auf das Anlassen dieser Maschine in der einen oder andern
Richtung und deren rechtzeitige Arretierung.
Steuerüberwälzuug, s. Steuern, S. 312.
Steuer- und Wirtschaftsreformer, s. Agrarier.
Steuerung, Vorrichtung, mittels deren der Zufluß
einer gepreßten Flüssigkeit oder Luftart zu einer
Kraftmaschine und der Abfluß derselben nach ihrer Wirksamkeit
so geregelt wird, daß der Gang der Maschine zu stande kommt.
Die einer solchen S. benötigten Kraftmaschinen, mit Ausnahme
der nur ganz vereinzelt vorkommenden sogen. rotierenden
Dampfmaschinen, nehmen den Druck der Flüssigkeiten, Gase oder
Dämpfe mittels eines Kolbens auf, welcher in einem Cylinder
durch ebendiesen Druck hin- und hergetrieben wird. Um dies letztere
zu ermöglichen, muß man den arbeitenden Dampf etc.
abwechselnd gegen die eine oder andre Seite des Cylinders
drücken und den verbrauchten Dampf etc. auf der der
jedesmaligen Druckrichtung entgegengesetzten
315
Steuerverein - Stewarton.
Seite wieder austreten lassen. Dazu dient die S., welche in der
Regel von der Maschine aus selbstthätig bewegt, seltener von
Menschenhand bedient wird (z. B. bei Hebemaschinen mit direkt
wirkendem hydraulischen oder Dampfcylinder, bei Dampfbremsen etc.).
Man unterscheidet bei jeder S. eine innere und eine
äußere S.: erstere bestehend aus irgend einer oder
mehreren Absperrvorrichtungen (Ventilen, Schiebern, Hähnen,
Kolben), letztere aus Exzentriks, Daumen, Wellen, Stangen, Hebeln
etc. oder auch aus kleinen Cylindern mit Kolben etc.,
überhaupt aus Mechanismen, mittels welcher die erstern in
passender Weise geöffnet oder geschlossen werden. Schieber-,
Ventil- und Hahnsteuerungen werden besonders bei Dampfmaschinen und
ähnlichen Umtriebsmaschinen, Kolbensteuerungen namentlich bei
den Wassersäulenmaschinen verwendet. Die Einrichtungen der
äußern Steuerungen sind außerordentlich
mannigfaltig; man unterscheidet Einrichtungen für die eine
Rotation hervorbringenden Maschinen, welche ihre Bewegung meist von
einer rotierenden Welle (Schwungradwelle) aus erhalten, und solche
für die sogen. direkt wirkenden, d. h. ohne Rotation, nur hin-
und hergehend arbeitenden Motoren, welche von einem hin und her
bewegten Maschinenteil bethätigt werden. Hierher gehören
die Steuerungen von Dampfhämmern, Gesteinsbohrmaschinen,
direkt wirkenden Dampfpumpen, Wasserhaltungsmaschinen etc. Sehr
ausgebildet sind die Steuerungen der Dampfmaschinen und besonders
die Expansionssteuerungen mit durch den Regulator verstellbarem
Expansionsgrad oder Präzisionssteuerungen (s.Dampfmaschine, S.
464 f.). Umsteuerungen bewirken bei Maschinen mit rotierender
Bewegung eine Richtungsänderung der Rotation, z. B. bei
Lokomotiven, Dampfschiffen, Fördermaschinen, Walzwerken etc.
Hierher gehören die Kulissensteuerungen (erfunden von
Stephenson, abgeändert von Gooch, Allan u. a.), bestehend aus
einer geschlitzten Schiene (Kulisse), deren Enden von zwei auf der
Kurbelwelle der Lokomotive etc. um 180° versetzten Exzentriks
so bewegt werden, daß sie abwechselnd vor- und
rückwärts gehen. In dem Schlitz der Kulisse
läßt sich ein Gleitstück (Stein) auf- und
niederschieben, welches mit einer die Bewegung des Schiebers, der
Ventile oder Hähne der S. vermittelnden Stange verbunden ist,
so daß die betreffenden Absperrungsorgane bald von dem einen,
bald von dem andern Exzenter ihre Bewegung erhalten oder in Ruhe
bleiben, je nachdem die Maschine vorwärts oder
rückwärts gehen oder stillstehen soll. Steuerungen kommen
auch bei manchen Arbeitsmaschinen vor, so z. B. bei den
Schiebergebläsen und Schieberpumpen zur Bewegung ihrer
Schieber. Die S. der Metallhobelmaschine erzeugt selbstthätig
den regelmäßigen Wechsel der Bewegungsrichtung der das
Arbeitsstück tragenden Platte (Tisch).
Steuerverein, s. Zollverein.
Steuerverweigerung, s. Steuerbewilligung etc.
Steuervorschuß, s. Antizipation.
Steuerzölle, s. Zölle.
Steuerzuschläge, die Abgaben, welche Gemeinden zur
Deckung ihres Bedarfs als Zuschläge zu bestehenden (direkten)
Staatssteuern erheben. Vgl. Gemeindehaushalt.
Stev., bei botan. Namen Abkürzung für Ch.
Steven, geb. 1781 zu Fredriksham, bereiste Taurien und den
Kaukasus, gest. 1863 in Simferopol.
Steven, die das Schiff vorn (Vordersteven) und hinten
(Achtersteven) begrenzenden, mehr oder weniger senkrecht
aufsteigenden Hölzer; s. Schiff, S. 455.
Stevens, Alfred, belg. Maler, geb. 11. Mai 1828 zu
Brüssel, besuchte das Atelier von Navez in Brüssel und
später das von Roqueplan in Paris und malte anfangs kleine
Historienbilder, wandte sich aber bald der Schilderung des
eleganten Pariser Lebens der Gegenwart zu. S. schildert mit
Vorliebe das Pariser Damenboudoir mit seinen Bewohnerinnen mit
außerordentlicher koloristischer Zartheit, seinem Geschmack
des Arrangements u. pikanter Charakteristik. Seine sehr zahlreichen
Bilder sind meist im Privatbesitz. Das Museum zu Brüssel
besitzt : die Allegorie des Frühlings, der Besuch; das zu
Marseille: ausgelassene Maskengruppe am Aschermittwochsmorgen; die
Ravené-Galerie in Berlin: die Tröstung. Von seinen
übrigen Bildern sind hervorzuheben: die Unschuld, das
Neujahrsgeschenk, der Morgen auf dem Lande, die japanisierte
Pariserin, die Dame im Atelier, der Frühling des Lebens.
Für den König der Belgier malte er in Fresko die vier
Jahreszeiten als Frauengestalten in moderner Tracht (auch als
Ölbilder wiederholt). Er lebt in Paris. Vgl. Lemonnier in der
"Gazette des beaux-arts" 1878. -
Sein Bruder Joseph S. (geb. 1822 zu Brüssel) hat sich
ebenfalls in der Pariser Schule gebildet und ist als Tiermaler in
Brüssel thätig. Seine Hauptwerke sind: der Hund des
Gefangenen, eine Episode auf dem Hundemarkt in Paris, und eine
Brüsseler Straße am Morgen (beide im Museum zu
Brüssel), der naschende Affe und der Hund mit der Fliege.
Stevens Point (spr. stihwens peunt), Stadt im
nordamerikan. Staat Wisconsin, am obern Wisconsinfluß, mit
Sägemühlen, Holzhandel und (1885) 6510 Einw.
Steward (engl., spr. stjuh-erd), Verwalter, Ordner,
Rentmeister; auf Schiffen s. v. w. Oberkellner. Vgl. High
Steward.
Stewart (spr. stjuh-ert), 1) Dugald, schott. Philo-soph,
geb. 22. Nov. 1753 zu Edinburg, erhielt schon 1775 die Professur
der Mathematik an der dortigen Universität als Nachfolger
seines Vaters, 1780 die der Moralphilosophie und starb, seit 1810
in den Ruhestand versetzt, 11. Juni 1828 in Edinburg. Von seinen
oft ausgelegten Schriften, die ihn als einen der Hauptvertreter der
sogen. schottischen Schule kennzeichnen, sind hervorzuheben:
"Elements of the philosophy of the human mind" (Edinb. 1792-1827, 3
Bde.); "Outlines of moral philosophy" (das. 1793); "Philosophical
essays" (das. 1810); "Philosophy of the active and moral powers"
(das. 1828). Eine Gesamtausgabe seiner Werke besorgte Hamilton
(Edinb. 1854-58, 10 Bde.).
2) Balfour, Physiker, geb. 1. Nov. 1828 zu Edinburg, studierte
daselbst und in St. Andrews, wurde 1859 Direktor des Observatoriums
in Kew, 1867 Sekretär des meteorologischen Komitees, 1870
Professor der Physik am Owen's College in Manchester und starb 21.
Dez. 1887. Er lieferte mit De la Rue und Loewy sehr bedeutende
Untersuchungen über die Physik der Sonne und mit Tait
über die Erzeugung von Wärme bei der Rotation der
Körper im luftleeren Raum; auch lieferte er mehrere Arbeiten
über Magnetismus und Meteorologie und schrieb: "Elementary
treatise on heat" (5. Aufl. 1888); "Lessons in elementary physics"
(1871; erweiterte Ausg. 1888; deutsch, Braunschw. 1872); "Physics"
(7. Aufl. 1878); "The conservation of energy" (4. Aufl. 1878;
deutsch, Leipz. 1875); "The unseen universe" (mit Tait, 6. Aufl.
1876); "Lessons in elementary practical physics" (mit Glee,
1885-87, 2 Bde.).
Stewarton (spr. stjúh-ert'n), Binnenstadt im
nördlichen Ayrshire (Schottland), mit Woll- und
Kappenfabrikation und (1881) 3130 Einw.
316
Steyermark - Stickerei.
Steyermark, s. Steiermark.
Steyr, Stadt mit eignem Statut in Oberösterreich, an
der Mündung des Flusses S. in die Enns und an der Bahnlinie
St. Valentin-Pontafel, ist Sitz einer Bezirkshauptmannschaft
(für die Umgebung von S.) und eines Kreisgerichts, hat eine
1443 vollendete gotische Stadtpfarrklrche, eine 980 erbaute, jetzt
fürstlich Lambergsche Burg, ein Rathaus, eine Oberrealschule,
Handelsschule, Fachschule für Eisen- und Stahlindustrie, eine
bedeutende Sparkasse (Einlagen 10 Mill. Guld.), eine
Pfandleihanstalt und (1880) mit den Vorstädten 17,199 Einw. S.
ist ein Hauptsitz der österreichischen Eisenindustrie und des
Eisenhandels. Es bestehen daselbst: eine große Waffenfabrik,
welche hauptsächlich Armeegewehre verfertigt, außerdem
Maschinenfabriken, Unternehmungen für Messerschmiedewaren,
Ahlen, Feilen, Nägel, Bohrer, Ring- u. Kettenschmiedewaren;
ferner Bierbrauereien, Druckereien und Färbereien, Gerbereien
und Papiermühlen. S. war ehemals Hauptort einer
Markgrafschaft, welche dem Land Steiermark den Namen gab.
Südlich von S. liegt das Dorf Garsten mit
Männerstrafanstalt (ehemals Benediktinerstift). Vgl. Widmann,
Fremdenführer für S. (Steyr 1884).
Stheino (Stheno), eine der Gorgonen (s. d.).
Sthelenos, nach griech. Mythus Sohn des Kapaneus und der
Euadne, war Teilnehmer am Epigonenzug und am Trojanischen Krieg, wo
er als treuer Gefährte und Wagenlenker des Diomedes tapfer
mitkämpfte. Auch ein Sohn des Perseus und der Andromeda,
welcher den König Amphitryon (s. d.) von Tiryns vertrieb,
hieß S.; er war Vater des Eurystheus.
Sthenie (griech.), strotzende Kraftfülle (vgl.
Asthenie); sthenisch, vollkräftig; sthenisieren,
kräftigen, die Wirkung der Lebenskraft erhöhen.
St. Hil., bei botan. Namen Abkürzung für A. F.
C. Prouvensal de Saint-Hilaire (s. d.).
Stibine (Antimonbasen), s. Basen.
Stibio-Kali tartaricum, s. v. w. Brechweinstein.
Stibium, Antimon; S. chloratum, muriaticum,
Antimonchlorid; S. sulfuratum aurantiacum, s. Antimonsulfide; S.
sulfuratum nigrum, Spießglanz, s. Antimonsulfide; S.
sulfuratum rubrum, Mineralkermes, s. Antimonsulfide.
Stich, Bertha und Klara, Schauspielerinnen, s.
Crelinger.
Stichblatt, an Schwertern und Degen die über dem
Griff zum Schutz der Hand angebrachte Platte, welche oft
künstlerisch verziert ist. Besonders von Sammlern gesucht sind
die in Eisen geschnittenen, mit Bronze, Silber und Gold
tauschierten japanischen Schwertstichblätter.
Stiche, s. Seitenstechen und Bruststiche.
Stichel, s. v. w. Grabstichel.
Stichkappe, eine dreieckige gewölbte Fläche,
welche an den Stirnseiten eines Tonnengewölbes in die
Fläche desselben einschneidet. Vgl. Gewölbe, S. 312.
Stichkoupon, s. Koupon.
Stichling (Gasterosteus Art.), Gattung aus der Ordnung
der Stachelflosser und der Familie der Stichlinge (Gasterostoidei),
Fische mit spindelförmigem, seitlich zusammengedrücktem
Körper, spitziger Schnauze, sehr dünnem Schwanzteil,
Bürstenzähnen, freien Rückenstacheln vor der
Rückenflosse, bauchständigen, fast nur aus einem
Stachelstrahl bestehenden Bauchflossen und bisweilen mit 4-5 Reihen
kleiner Schilder an den Seiten. Der gemeine S. (Stechbüttel,
G. trachurus L., s. Tafel "Fische II", Fig. 16), 8 cm lang, mit
drei Stachelstrahlen vor der Rückenflosse, oberseits
grünlichbraun oder schwarzblau, an den Seiten und am Bauch
silberfarben, an der Kehle und Brust blaßrot, variiert
vielfach in der Färbung, findet sich in ganz Europa, mit
Ausnahme des Donaugebiets, und ebenso häufig im
süßen Wasser wie im Meer. Er ist lebhaft,
räuberisch und streitsüchtig, kämpft tapfer mit
seinen Stacheln und ändert in der Erregung seine Färbung;
er jagt auf alle Tiere, welche er zu überwältigen vermag,
besonders auf Fischbrut, und ist äußerst
gefräßig. Er laicht in seichtem Wasser auf kiesigem oder
sandigem Grund und baut aus Wurzelfasern, Halmen etc., die er mit
einem eigentümlichen Klebstoff verbindet, ein
faustgroßes, länglichrundes Nest mit einem seitlichen
Eingang, welches er freischwebend zwischen Wasserpflanzen befestigt
oder halb im Sand vergräbt. In dieses Nest legt das Weibchen
seine Eier und bohrt dann auf der dem Eingang entgegengesetzten
Seite ein Loch in das Nest, um sich zu entfernen. Das Männchen
schafft noch mehrere Weibchen herbei, befruchtet die Eier, bewacht
und verteidigt dann das Nest und sorgt durch Bewegung seiner
Flossen für die nötige Strömung in demselben. Auch
die Jungen überwacht er und führt entweichende im Maul
zum Nest zurück. Auch in der Gefangenschaft baut er Nester und
pflanzt sich fort. Der S. soll nur drei Jahre alt werden. In der
Teichwirtschaft ist der S. nicht zu dulden; an der Nordsee
fängt man ihn oft in großer Menge und benutzt ihn als
Dünger, Schweinefutter und zum Thransieden.
Stichomantie (griech.), eine Art Wahrsagung aus Zeilen
oder Versen (stichos), welche bei den Römern darin bestand,
daß Stellen aus Dichtern (namentlich aus Vergil, auch aus den
Sibyllinischen Büchern) auf Zettel geschrieben und diese,
nachdem man sie in einer Urne gemischt hatte, gezogen wurden. Aus
dem zufällig gezogenen Los weissagte man sich Gutes oder
Schlimmes. Außer andern Büchern wurde später
besonders die Bibel zu ähnlichem Zweck benutzt.
Stichometrie (griech.), bei den Alten übliches
Abmessen oder Zählen der Zeilen (stichos) in den
Handschriften, um den ungefähren Umfang einer Schrift
bestimmen zu können (vgl. Ritschl, De stichometria veterum,
Bonn 1840); in der Rhetorik eine Antithese, welche im Dialog durch
Behauptung und Entgegnung entsteht, wie z. B. in der ersten Szene
von Schillers "Maria Stuart".
Stichtag, bei Zeitgeschäften der Tag der
Erfüllung; s. Börse, S. 236.
Stichwahl, s. Wahl.
Stichwort (Schlag- oder Merkwort), in der
Bühnensprache diejenigen Worte eines Darstellers, nach welchen
ein andrer aufzutreten oder seine Rede anzufangen hat. Ebenso gibt
das S. das Signal zu gewissen in der Handlung des Stücks
bedingten szenischen Vorgängen.
Stickerei, eine Kunst, durch welche verzierende
Darstellungen auf schmiegsamen, Falten werfenden Stoffen, also auf
Geweben, Gewändern, Leder etc., mit der Nadel hergestellt
werden. Von den Chinesen von alters her gepflegt, war die S. auch
den alten Indern und Ägyptern bekannt. Diese gingen in ihren
verzierenden Zeichnungen noch nicht über geometrische Figuren
hinaus, wogegen die Assyrer zuerst Tier- und Menschengestalten auf
ihren glatt anschließenden Kleidern und Vorhängen zur
Darstellung brachten. Von ihnen lernten die Griechen und von diesen
die Römer, welche die S. phrygische Arbeit nannten. Im
Mittelalter wurde sie in den Klöstern im Dienste des Kultus
für geistliche Gewänder und Altarbekleidung (Paramente)
gepflegt. Ihre Arbeiten wurden vom 11. Jahrh. an von arabischen
Kunstanstalten
317
Stickertressen - Stickmaschine.
übertroffen. Seltene Beispiele, wie ein deutscher
Kaiserkrönungsmantel, zeugen noch heute von der Höhe der
damaligen S. Mit der geistigen Bildung kam auch die Kunst des
Stickens in weltliche Hände. Erst in England, später aber
in Burgund erreichte sie im 14. Jahrh. die höchste Ausbildung
und ist seitdem langsam bis auf unsre Zeit ganz in Verfall geraten,
wo auch sie an der allgemeinen Hebung des Kunstgewerbes ihren
Anteil erhielt und jetzt eine verständnisvolle Pflege, zum
Teil durch größere Ateliers (Bessert-Nettelbeck in
Berlin), findet. Die S. verziert nicht nur, sondern sie bedeckt oft
den ihr zu Grunde gelegten Stoff ganz; man könnte danach
Weiß- und Buntstickerei unterscheiden, wenngleich auch bei
der letztern zuweilen der Grund frei stehen bleibt. Die
Buntstickerei kann entweder auf einen dichten Grund, auf Leinwand,
Tuch, Seide, Leder, oder auf einen eigens dazu gefertigten,
siebartig durchlöcherten Stoff, Kanevas, aus Hanf, Leinen,
Baumwolle, auch Seide aufgesetzt sein. Auf Kanevas werden
hauptsächlich der gewöhnliche Kreuzstich und seine
Abarten (Gobelinstich, Webstich) ausgeführt sowie der sehr
feine Petitpoint-Stich, welcher sehr zarte, mosaikartige Bildnerei
ermöglicht. Weniger mühsam als der letztere, aber besser
als der Kreuzstich zur figürlichen Darstellung geeignet ist
der Plattstich, mit dem die mittelalterlichen Arbeiten fast
durchgängig auf dichtem Grund gefertigt sind. Während der
Petitpoint-Stich nur mit Seidenfäden hergestellt wird,
verwendet man für die andern Sticharten gewöhnlich
gefärbte Wolle, wenn auch bei ihnen Seide, Goldfäden und
sogar zeitweise mit eingenähte Perlen nicht ausgeschlossen
sind. Andre Arten der S. sind: der Kettenstich, bei welchem jeder
Stich doppelt gemacht wird, indem der Faden von unten nach oben und
durch dasselbe Loch wieder zurückgeht, so eine Schleife
bildend, durch welche er, nachdem er durch ein neues Loch wieder
nach oben gekommen, gezogen wird; der Steppstich, bei welchem auf
der untern Seite des Stoffes ein langer Stich gemacht wird, auf der
obern Seite um die Hälfte der Ausdehnung desselben wieder
zurückgegriffen wird, so daß auf der untern Seite jeder
Stich doppelt so lang ist wie oben; in umgekehrter Anwendung
entsteht der Stielstich. Noch andre Arten des Stichs
(Flechtenstich, Doppelstich, Gitterstich, maurischer, spanischer
Stich) sind bei Lipperheide, Muster altitalienischer
Leinenstickerei (Berl. 1881-85, 2 Bde.), beschrieben. Die Art der
im Mittelalter hochberühmten Goldstickerei, die so wunderbare
Wirkung hervorbrachte, wie man sie noch an den in Wien aufbewahrten
sogen. burgundischen Gewändern aus dem 15. Jahrh. sieht, ist
technisch sehr von der unsrigen verschieden. Während jetzt die
Goldfäden wie andre Fäden behandelt werden, legte man sie
früher parallel nebeneinander und nähte sie mit
Überfangstichen fest. Auf den so erst gebildeten Grund wurde
nun mit Plattstich die eigentliche S. gesetzt, durch welche das
Gold hindurchschimmerte (Reliefstickerei). Die heutige Gold- und
Silber-Kannetillestickerei nähert sich schon der
Perlenstickerei. Dieses reihenweise Aufnähen billiger
Glasperlen hat dadurch, daß es den Grundstoff schwer und
unbiegsam macht, viel zum Verfall der Kunst beigetragen. Für
den künstlerischen Wert ist allemal die Vorzeichnung des
Musters wichtig, die jetzt selten die Erfindung des Verfertigers
einer S. ist. Die Herstellung der Muster ist dagegen zum besondern
Industriezweig der Dessinateure oder Musterzeichner geworden. Eine
eigne Art der S. ist noch das Tamburieren, das nicht mit der
Nähnadel, sondern mit dem Häkelhaken geschieht, wie auf
den Handrücken feiner Glaceehandschuhe. Ferner werden jetzt
feine Lederwaren, namentlich in Amerika, sehr zart durch auf der
Nähmaschine hergestellten Steppstich verziert. Die
Weißstickerei, abgesehen von der Namenstickerei, dem Zeichnen
der Wäsche, beschränkt sich auf Verzierung der
Wäsche und des Tischzeugs in Leinwand oder Baumwolle (deshalb
auch Leinenstickerei genannt). In der sogen. französischen
Weißstickerei herrscht mehr der Plattstich, in der englischen
der durchbrochene Arbeit liefernde Bindlochstich vor; doch kommen
bei beiden noch der Languettenstich und verschiedene
Phantasiestiche zur Anwendung. Die venezianische
Weißstickerei, bei der stellenweise der Grund nach der Arbeit
entfernt wird, so daß die durchbrochenen Stellen durch feine
Fadenverschlingungen gefüllt werden, streift schon nahe an die
Spitzennäherei. Die Weißstickerei ist im westlichen
Europa mehr Sache der Industrie; in Deutschland wird sie im
sächsischen Vogtland, namentlich in Plauen, und den
angrenzenden Gegenden des Erzgebirges und des bayrischen
Oberfranken und zwar in ausgedehntester Weise mit Stickmaschinen
(s. d.) betrieben. Vgl. die bei den Artikeln Handarbeiten und
Spitzen angeführte Litteratur, insbesondere die
Musterbücher von H. Sibmacher (dazu noch: Kreuzstichmuster, 36
Tafeln der Ausgabe von 1604, Berl. 1885), und Drahan, Stickmuster
(Wien 1873); "Original-Stickmuster der Renaissance" (2. Aufl., daf.
1880); Lessing, Muster altdeutscher Leinenstickerei (3 Sammlungen,
Berl.); Teschendorff, Kreuzstichmuster für Leinenstickerei
(das. 1878-83, 2 Hefte); Wendler, Stickmuster nach Motiven aus dem
16. Jahrhundert in Farben gesetzt (das. 1881); H. Schulze,
Mustersammlung alter Leinenstickerei (Leipz. 1887); Fröhlich:
Neue farbige Kreuzstichmuster (Berl. 1888), Neue Borden (das.
1888), Allerlei Gedanken in Vorlagen für das Besticken und
Bemalen unsrer Geräte (das. l888).
Stickertressen, s. Bortenweberei.
Stickftuß, s. Lungenödem.
Stickgas, s. v. w. Stickstoff.
Stickhusten, s. Keuchhusten.
Stickmaschine, von Josua Heilmann 1829 erfundene
Vorrichtung zur Herstellung von Stickereien auf Geweben. Die
Figuren entstehen hierbei dadurch, daß die Fäden an den
Figurenrändern mittels Nadeln so durch das Gewebe gesteckt und
durchgezogen werden, daß sie nach und nach auf der
Fläche das Muster erhaben bilden, z. B. indem (Fig. 1) der
Faden den durch die Zahlen 1-10 angedeuteten Verlauf nimmt, 1-2
oben, 2-3 unten, 3-4 oben u. s. f. Die Heilmannsche S., welche bis
heute keine wesentliche Abänderung erfahren hat, ahmt die
Handarbeit genau nach und besteht in der Hauptsache aus drei
Teilen, nämlich einem Rahmen, an welchem das mit Stickerei zu
versehende Zeug ausgespannt wird, den Nadeln und einem Apparat,
welcher die Nadel ergreift, durchs Zeug sticht und mit dem Faden
durchzieht, also die Hand des Arbeiters ersetzt. Bei der S. ist nun
aber der Rahmen nicht, wie beim Handsticken, horizontal
feststehend, sondern beweglich und zwar so, daß das Zeug
immer in einer vertikalen Ebene bleibt, während die Nadeln nur
eine horizontale Bewegung machen. Wenn also eine Nadel durch das
Zeug an einer Stelle, z. B. Punkt 1 der Fig. 1, durchgegangen ist,
so wird der Rahmen so bewegt, daß die Nadel beim
Zurückstechen den nächsten Punkt, z. B. Punkt 2 der Fig.
1,
[Fig 1.]
318
Stickmaschine.
trifft. Die S. arbeitet mit einer großen Anzahl Nadeln,
welche in zwei horizontale Reihen so verteilt sind, daß auf
dem Zeuge gleichzeitig zwei kongruente Stickereien an zwei
verschiedenen Stellen gebildet werden. Dazu ist es nötig,
daß der Rahmen stets parallel verschoben wird. Zu dem Zweck
liegt der vertikale Stickrahmen A (Fig. 2) mit zwei runden Schienen
a auf Rollen b, welche wieder in einem Rahmen c sitzen, der sich
mit Schneiden auf das gegabelte Ende eines Hebels d stützt,
welcher in Fig. 2 abgebrochen gezeichnet ist, jedoch sich in
Wirklichkeit über den Drehpunkt d' fortsetzt und am Ende ein
Gegengewicht trägt. Die Gegengewichte beider Hebel halten dem
Rahmen mit den darauf befindlichen Walzen e, e1, e2, e3 und dem
aufgespannten Zeug das Gleichgewicht. Da nun außerdem der
Rahmen unten an zwei Stellen durch vertikale Schlitze f
geführt und oben durch zwei Zapfen g des Gestells, welche
zwischen Gleitschienen h des Rahmens stecken, gehalten wird, so
läßt sich derselbe in horizontaler und vertikaler
Richtung so verschieben, daß er in einer vertikalen Ebene
bleibt, und daß auch jede in ihm liegende Linie ihrer
ursprünglichen Lage parallel bleibt. An dem Rahmen sind nun
vier Walzen e, e1, e2, e3 in Zapfen drehbar angebracht, wovon jede
mit einem Sperrrad versehen ist, in welches je eine Sperrklinke (e'
e1', e2', e3') eingreift. Je zwei Walzen (e und e1, e2 und e3)
dienen zur Aufspannung je eines Zeugstücks kk' parallel zu dem
Rahmen, während die Sperrklinken die Rückdrehung
verhindern. Ist auf jedem Stück eine horizontale Reihe
nebeneinander liegender Figuren fertig gestickt, so zieht man das
Zeug von e auf e1 und von e2 auf e3 ein Stück weiter. Die
Bewegung zwischen je zwei Nadelstichen wird dem Rahmen nicht
direkt, sondern mit Hilfe eines sogen. Storchschnabels
(Pantographen) übertragen. Fig. 3 zeigt denselben mit dem
Rahmen A in verkleinertem Maßstab. I II III IV ist ein in
seinen Ecken in Scharnieren drehbares Parallelogramm. Die Seite II
III ist bis zum Punkt V, die Seite III bis zum Punkt VI
verlängert, wobei die Dimensionen I VI und III V so
gewählt sind, daß die Punkte V, IV und VI auf einer
Geraden liegen. Wenn man daher den Punkt V festhält und den
Punkt VI die Kontur irgend einer Figur umfahren läßt, so
wird dabei Punkt IV eine dieser ähnliche Figur verkleinert
beschreiben. Der Punkt V ist nun an dem Gestell der S. drehbar
befestigt, während im Punkt IV ein am Rahmen A befindlicher
Zapfen angebracht ist. Da sich aber der Rahmen A so verschiebt,
daß jede Linie in ihm ihrer ursprunglichen Lage parallel
bleibt, so wird, wenn Punkt VI an einer vergrößerten
Figur des Stickmusters entlang geführt wird, jeder Punkt des
Rahmens, also auch des aufgespannten Zeugs, dieselbe Figur in
(gewöhnlich sechsfach) verkleinertem Maßstab
beschreiben. An dem Stickmuster sind die einzeln Fadenlagen durch
Linien, die Nadelstiche durch Punkte angedeutet, der Arbeiter
rückt einen in VI befestigten spitzen Stift zwischen je zwei
Nadelstichen von einem Punkt auf den nächstfolgenden, so
daß jeder Punkt des Zeugs in derselben Richtung um eine
verkleinerte Strebe verschoben wird, die der wirklichen
Größe des Musters entspricht. Die Nadeln werden durch
jedes der beiden Zeugstücke in je einer horizontalen Reihe von
50-75 Stück hin- und hergestochen. Dazu sind sie mit zwei
Spitzen und einem in der Mitte sitzenden Öhr durch das der
Faden gezogen ist, versehen und werden auf jeder Seite von Zangen
erfaßt, durchgezogen, dann wieder nach Verschiebung des
Rahmens rückwärts eingestochen, losgelassen und von der
auf der andern Seite dagegen geführten Zange ergriffen und
durchgezogen etc. Diese Zangen sitzen auf jeder Seite in zwei
horizontalen Reihen an je einem mit Rollen ll' auf Schienen m m des
Untergestells C gegen das Zeug zu bewegenden Gestell B B'. Dasselbe
besteht aus einem Wagen n n' von der Breite des Zeugs mit Schildern
o o', welche oben und unten prismatische Schienen p p' tragen. An
diesen sind die Zeuge mit ihren festliegenden Schenkeln q q'
befestigt, welche an ihrer dem Zeug zugekehrten Seite eine kleine
Platte mit einem konischen Loch zum Einführen der Nadeln
haben. Die Nadel wird so weit eingeschoben, daß sie gegen
einen kleien Vorsprung stößt. Während sie nun in
einer kleinen Rille liegt, wird der bewegliche Backen r r' der
Zange dagegen gedrückt. Dies geschieht in folgender Weise: Der
Schwanz der beweglichen Zangenschenkel steht fortwährend
unter
Fig. 2. Stickmaschine (Querschnitt)
Fig. 3. Storchschnabel
319
Sticknähmaschine - Stickstoffoxyd.
dem Druck einer auf Schließung der Zange wirkenden Feder s
s'. Gegen die andre Seite des Schwanzes legt sich jedoch eine
über sämtliche Zangen einer Reihe fortgehende Welle t t',
welche im allgemeinen von rundem Querschnitt und nur von einer
Seite abgeflacht ist. Liegt diese Welle mit ihren runden Teilen auf
den Zangen, so sind dieselben geöffnet; ist sie dagegen so
gedreht, daß sie ihre flache Seite den Zangen zukehrt, so
geben die Schwänze dem Druck der Federn nach und
schließen sich. Zur Drehung dieser Wellen dient der
Zahnsektor u u', in welchen die Zähne einer durch einen
besondern Mechanismus bewegten Zahnstange v v' eingreifen. An den
Stützen o' sind nun noch kleine durchgehende Wellen w w'
gelagert, an deren beiden Enden die Hebelchen x x' und y y'
befestigt sind. Die Enden der erstern sind durch je eine parallel
zum Zeug liegende dünne Stange z z' verbunden, dieselben legen
sich unter der Einwirkung der Gewichte ß ß' auf die von
dem Gewebe zu den Nadeln geführten Stickfäden und geben
ihnen eine gleichmäßige Spannung, werden aber
aufgehoben, sobald sich die Zangen dem Zeug so weit nähern,
daß die Hebel y y' gegen kleine am Maschinengestell
befestigte Zapfen $\zeta\zeta'$ stoßen. Die Bewegung der
Wagen n n' mit den daran befindlichen Zangen erfolgt durch einen
Arbeiter von einer Seite der Maschine aus mittels Mechanismen,
welche in der Figur fortgelassen sind. Die Maschine arbeitet nun in
folgender Weise: Die einen Enden der Fäden mögen im Zeug
befestigt sein, während die andern in die Nadeln
eingefädelt sind. Ist der linke Wagen eben gegen das Zeug
gefahren, und sind dabei die Nadeln mit ihren aus den Zangen
herausstehenden Spitzen durchgestochen, dann muß der rechte
Wagen mit geöffneten Zangen vor dem Zeug stehen, um die Nadeln
zu fassen. Darauf werden zugleich durch Verschiebung der
Zahnstangen v und v' unter Vermittelung der Zahnsegmente u u' und
der Wellen t t' die linken Zangen geöffnet und die rechten
geschlossen, so daß die Nadeln nunmehr in den rechten Zangen
festgehalten werden. Während nun der linke Wagen in seiner
Stellung verbleibt, entfernt sich der rechte vom Zeug und nimmt
dabei die Nadeln mit. Nachdem der Wagen einen kleinen Weg
zurückgelegt hat, sind die an w drehbaren kleinen Stangen v an
den Zapfen $\zeta$ so weit zurückgeglitten, daß sie sich
zugleich mit den Hebeln x und den daran befestigten Querstangen z
unter der Einwirkung des Gewichtshebels ß gesenkt haben, so
daß die Stangen z sich auf die durch das Zeug
hindurchgezogenen Fadenenden legen. Der Wagen wird so weit
geführt, bis die Fäden ganz ausgezogen sind, wobei sie
durch die aufgelegte Stange z eine gleichmäßige schwache
Spannung erhalten, welche genügt, die eben auf der linken
Seite des Zeugs entstandene Lage von Fadenschleifen gehörig
anzuziehen. Nun wird der Rahmen A mit Hilfe des Storchschnabels
verschoben, dann der Wagen B zurückgeführt, damit z
gehoben und die Nadeln von rechts nach links durchgesteckt, worauf
sich der beschriebene Vorgang abwechselnd von links und rechts
wiederholt. In neuester Zeit ist für die S. eine neue
Grundlage dadurch gewonnen, daß man, wie bei den
Nähmaschinen, Nadeln mit dem Öhr an der Spitze und kleine
Schiffchen zum Durchbringen eines zweiten Fadens anwendet, also die
Sticknähmaschine nachahmt. Vgl. Jäck, Die rationelle
Behandlung der S. (3. Aufl., Leipz. 1886).
Sticknähmaschine, zum Sticken kleiner Muster
eingerichtete Nähmaschine, besteht aus einer gewöhnlichen
Nähmaschine, auf deren Nähplatte der Stoff, in einen
Stickrahmen eingespannt, durch Führung des letztern
vermittelst eines Storchschnabels, wie bei den Stickmaschinen,
unter der Nadel hin- und hergeschoben wird, so daß die
Figuren durch Plattstich entstehen.
Stickoxyd und Stickoxydul, s. v. w. Stickstoffoxyd, resp.
Stickstoffoxydul.
Stickseide, s. v. w. Plattseide.
Stickstoff (Stickgas, Azot, Luftgas, Nitrogenium) N,
chemisch einfacher Körper, findet sich in der Atmosphäre
(79 Volumprozent), mit Sauerstoff und Wasserstoff verbunden als
salpetrige Säure und namentlich als Salpetersäure, mit
Wasserstoff verbunden als Ammoniak weitverbreitet, mit Kohlenstoff,
Wasserstoff und Sauerstoff verbunden in vielen Tier- und
Pflanzenstoffen, namentlich in den Proteinkörpern. Zur
Darstellung von S. entzieht man der Luft den Sauerstoff durch
Eisen- oder Manganhydroxydul, alkalische Pyrogallussäure oder
alkalische Kupferchlorürlösung, durch Phosphor,
glühende oder mit Salzsäure befeuchtete
Kupferdrehspäne etc., oder man erhitzt eine Lösung von
salpetrigsaurem Ammoniak (NH4NO2), welches dabei in S. und Wasser
(H2O) zerfällt, oder man leitet Chlor in stets
überschüssiges Ammoniak, wobei Salmiak (NH4Cl) und S.
entstehen; auch kann man saures chromsaures Ammoniak (oder ein
Gemisch von saurem chromsaurem Kali mit Salmiak) erhitzen, welches
sich zu Wasser, Chromoxyd und S. zersetzt. S. ist ein farb-,
geruch- und geschmackloses Gas, welches unter einem Druck von 200
Atmosphären und bei sehr niedriger Temperatur zu einer
farblosen Flüssigkeit verdichtet werden kann. Es besitzt ein
spezifisches Gewicht von 0,971 (1 Lit. wiegt bei 0° und 760 mm
Barometerstand 1,256 g); das Atomgewicht ist 14,01, 100 Volumen
Wasser lösen bei 0°: 2,035, bei 15°: 1,478 Vol. S.,
Alkohol löst etwas mehr. S. ist sehr indifferent,
unterhält weder die Verbrennung noch die Atmung, ist auch
selbst nicht brennbar und verbindet sich direkt nur mit wenigen
Elementen; aus indirektem Weg aber bildet er eine Reihe von
Verbindungen, die meist durch sehr charakteristische Eigenschaften
ausgezeichnet sind: manche von ihnen sind sehr beständig,
andre höchst wandelbar, zum Teil explosiv, wie der
Chlorstickstoff, manche Nitrokörper etc. S. tritt
gewöhnlich dreiwertig, in manchen Verbindungen aber auch
fünfwertig auf. Er bildet mit Sauerstoff fünf
Verbindungen: Stickstoffoxydul N2O, Stickstoffoxyd NO,
Stickstofftrioxyd (Anhydrid der salpetrigen Säure) N2O3,
Stickstoffperoxyd NO2 und Stickstoffpentoxyd (Anhydrid der
Salpetersäure) N3O5. Er wurde von Rutherford 1772 entdeckt,
insofern dieser zeigte, daß die Luft, in welcher Tiere
geatmet hatten, auch nach Beseitigung der ausgeatmeten
Kohlensäure die Verbrennung einer Kerze nicht mehr
unterhält. Scheele sprach 1777 bestimmt von zwei Bestandteilen
der Luft, und Lavoisier erkannte den S. als einfachen Körper
und nannte ihn Azot, weil er das Leben nicht unterhält,
während Chaptal den Namen Nitrogène vorschlug, weil er
in Salpeter enthalten sei. Vgl. König, Der Kreislauf des
Stickstoffs und seine Bedeutung für die Landwirtschaft
(Münst. 1878); Frank, über die Ernährung der Pflanze
mit S. etc. (Berl. 1888).
Stickstoffbor, s. Borstickstoff.
Stickstoffdioxyd, s. v. w. Stickstoffoxyd.
Stickstoffmonoxyd, s. v. w. Stickstoffoxydul.
Stickstoffoxyd (Stickstoffdioxyd, Stickoxyd) NO entsteht
bei Einwirkung vieler Metalle (Kupfer, Silber, Quecksilber etc.),
des Phosphors und andrer leicht oxydierbarer Körper auf
Salpetersäure und beim Erwärmen von Eisenchlorür mit
salpetersaurem Kali und Salzsäure. Es ist ein farbloses Gas
und wird
320
Stickstoffoxydul - Sticta.
bei sehr niedriger Temperatur unter einem Druck von 104
Atmosphären zu einer farblosen Flüssigkeit verdichtet.
Das spezifische Gewicht ist 1,039, es verbindet sich mit dem
Sauerstoff der Luft direkt unter Bildung roter Dämpfe von
Stickstoffperoxyd, löst sich bei mittlerer Temperatur in 20
Volumen Wasser, erträgt hohe Temperatur, ist nicht atembar,
unterhält die Verbrennung von erhitztem Eisen und Phosphor,
während eine Kerze darin erlischt; eine Mischung von
Schwefelkohlenstoffdampf und Stickstoffoxyd verbrennt mit einer
blauen, an chemisch wirksamen Strahlen sehr reichen Flamme, welche
zum Photographieren bei Ausschluß des Tageslichts dienen kann
(Sellsche Lampe). Feuchte Zink- und Eisenfeilspäne,
Schwefelleber etc. reduzieren S. zu Oxydul; Kalium und
glühendes Kupfer reduzieren es vollständig.
Eisennitriollösung absorbiert es reichlich und färbt sich
dabei fast schwarz, auch Salpetersäure nimmt es auf und bildet
eine blaue, grüne oder braune Flüssigkeit. Es wurde schon
von van Helmont beobachtet, aber erst von Priestley näher
untersucht und von ihm Salpetergas genannt.
Stickstoffoxydul (Stickstoffmonoxyd, Stickoxydul,
Lustgas, Lachgas) N2O entsteht bei vorsichtigem Erhitzen von
salpetersaurem Ammoniak, bei Einwirkung sehr verdünnter kalter
Salpetersäure auf Zink- oder feuchter Eisen- oder Zinkfeile,
Schwefelleber oder schwefliger Säure auf Stickstoffoxyd und
bei Einwirkung von schwefliger Säure auf heiße
verdünnte Salpetersäure. Dargestellt wird es stets durch
Erhitzen von salpetersaurem Ammoniak und Waschen des Gases mit
Eisenvitriollösung und Kalilauge; 1 kg des Salzes liefert 182
Lit. Gas. Ein kontinuierlich arbeitender Apparat zur Darstellung
des Gases besteht aus einer mit gereinigtem groben Sand
gefüllten, entsprechend erhitzten eisernen Röhre, in
welcher das geschmolzene salpetersaure Ammoniak, während es
durch den Sand sickert, vollständig zersetzt wird. Man
versendet das Gas im flüssigen Zustand in starkwandigen
eisernen oder kupfernen Flaschen. Es bildet ein farbloses Gas,
riecht und schmeckt schwach süßlich, spez. Gew. 1,52;
100 Volum. Wasser lösen bei 0°: 130,5, bei 15°: 77,8
Vol. In Alkohol ist es noch leichter löslich; bei 0° und
unter einem Druck von 30 Atmosphären wird es zu einer
farblosen Flüssigkeit kondensiert, welche bei -88° siedet,
bei -115° erstarrt und, mit Schwefelkohlenstoff gemischt, beim
Verdampfen im luftleeren Raum eine Temperatur von -140°
erzeugt. Das Gas kann geatmet werden, unterhält den Atmungs-
und Verbrennungsprozeß, und ein glimmender Holzspan
entzündet sich darin fast wie in Sauerstoff. Ein Gemisch von 4
Vol. S. mit 1 Vol. Sauerstoff erzeugt beim Einatmen nach 1 1/2-2
Minuten Rausch und Heiterkeit (daher Lustgas). Bei längerm
Einatmen erzeugt es Ohrensausen, Rausch, Bewußtlosigkeit und
tötet endlich durch Erstickung. Unterbricht man aber die
Einatmung, sobald die Bewußtlosigkeit eingetreten ist, so
verschwinden alle Erscheinungen schnell und ohne bleibenden
Nachteil. Deshalb benutzt man das Gas als anästhetisches
Mittel bei kleinen Operationen. S. wurde 1772 von Priestley
entdeckt, Davy beobachtete 1799 seine eigentümliche Wirkung
auf den Organismus, und Wells zu Hartford in Connecticut benutzte
es zur Hervorbringung einer schnell vorübergehenden Narkose.
Es blieb indes ohne praktischen Wert, bis Colton und Porter 1863
von neuem darauf aufmerksam machten. Letzterer führte es in
England ein, und 1867 brachte es Evans in Paris zur eigentlich
wissenschaftlichen Verwertung. Das S. erleidet bei der Einatmung
durchaus keine Veränderung, und dies Verhalten erschwert eine
genügende Erklärung seiner Wirkung. Zur Hervorbringung
einer vollständigen Narkose sind im Durchschnitt 22-26 Lit.
Gas erforderlich. Gewöhnlich währt dieselbe nur 30-90
Sekunden, reicht also nur für kurze Operationen, wie das
Ausziehen von Zähnen; doch hat man durch geschickte Leitung
des abwechselnden Einatmens von S. und Luft die Narkose auch schon
auf 50-90 Minuten ausgedehnt. Unterbricht man die Zufuhr des
Stickstoffoxyduls vollständig, so tritt schon nach 1-2 Minuten
der normale Zustand wieder ein, ohne daß sich die mindeste
Nachwirkung bemerkbar macht. Lange fortgesetztes Einatmen von S.
behufs Herbeiführung einer vollkommen und lange andauernden
Empfindungslosigkeit erfordert immerhin große Umsicht des
Operateurs, weil in solchem Falle leicht bedenkliche
Erstickungszufälle eintreten können. Nun hat aber Bert
das gleichzeitige Einatmen von S. und Luft ohne Abschwächung
der Wirkung des erstern dadurch ermöglicht, daß er
gleiche Volumen dieser Gase mischt und sie unter doppeltem
Atmosphärendruck einatmen läßt. In gleicher Zeit
wird dann dieselbe Menge S. den Lungen zugeführt wie beim
Einatmen des reinen Gases unter gewöhnlichem Druck, nebenbei
aber erhält die Lunge die für eine normale Respiration
erforderliche Menge Sauerstoff. Auf solche Weise vermochte Bert bei
Versuchen an Tieren eine volle Stunde hindurch gänzliche
Empfindungslosigkeit zu unterhalten und in dieser Zeit große
Operationen schmerzlos vorzunehmen. Nach 2-3 Atemzügen reiner
Luft trat der normale Zustand wieder ein, ohne daß sich
irgend welche Nachwirkungen gezeigt hätten. Vgl. Goltstein,
Die physiologischen Wirkungen des Stickstoffoxydulgases (Bonn
1878); Schrauth, Das Lustgas und seine Verwendbarkeit in der
Chirurgie (Bonn 1889).
Stickstoffpentoxyd, s. Salpetersäure, S. 226.
Stickstoffperoxyd (Stickstofftetroxyd) NO2 entsteht bei
Berührung von Stickstoffoxyd mit Luft, beim Erhitzen
verschiedener Salpetersäuresalze (wie Bleinitrat) und, mit
Stickstofftrioxyd gemischt, bei Einwirkung von Salpetersäure
auf Stärkemehl, Zucker etc.; es bildet bei -9° farblose
Kristalle und schmilzt leicht zu einer farblosen Flüssigkeit,
die sich bei höherer Temperatur gelb färbt, bei 15°
orangerot ist, bei 22° siedet und einen braunroten, erstickend
riechenden Dampf bildet, welcher bei stärkerm Erhitzen immer
dunkler, fast schwarz wird. In Form dieses Dampfes beobachtet man
es am häufigsten. Mit wenig eiskaltem Wasser zersetzt sich das
Peroxyd in salpetrige Säure und Salpetersäure, mit Wasser
von gewöhnlicher Temperatur (wegen Zersetzung der salpetrigen
Säure) in Salpetersäure und Stickstoffoxyd und bei
Gegenwart von Sauerstoff zuletzt vollständig in
Salpetersäure. Wegen der schnell eintretenden sauren Reaktion
des feuchten Peroxyds nannte man dasselbe früher
Untersalpetersäure.
Stickstofftetroxyd, s. v. w. Stickstoffperoxyd.
Stickstofftheorie, s. Agrikulturchemie und
Landwirtschaft, S. 478.
Sticta Schreb. (Grubenflechte), Laubflechten mit
weißen, becherartig vertieften Flecken (Cyphellen) auf der
Unterseite des Thallus, meist am Rande des letztern befindlichen
Apothecien und mit der Markschicht aufsitzender Apothecienscheibe.
S. pulmonacea Ach. (Lungenflechte), mit lederartigem, buchtig
gelapptem, netzförmig grubigem, grünem, trocken
bräunlichem Thallus mit weißen Flecken und rotbraunen
Apothecien, wächst am Fuß alter Buchen und Eichen und
war früher als Lungenmoos offizinell.
321
Stiefel - Stiehle.
Stiefel, Fußbekleidung, s. Schuh.
Stiefel, altdeutsches gläsernes
Trinkgefäß in Form eines Stiefels, zum Willkomm oder
Rundtrunk benutzt, oft von bedeutender Größe; daher die
Redensart "einen S. vertragen". In der Technik heißt S. der
Cylinder, worin der Kolben einer Pumpe sich bewegt.
Stieffel, Michael, s. Stifel.
Stiefgeschwister, s. Halbgeschwister.
Stiefmütterchen, s. v. w. Viola tricolor.
Stiefverwandtschaft, s. Schwägerschaft.
Stiege, eine Anzahl von 20 Stück.
Stieglitz (Distelfink, Goldfink, Jupitersfink, Fringilla
[Carduelis] elegans Cuv.), Sperlingsvogel aus der Gattung Fink, 13
cm lang, 22 cm breit, mit langem, kegelförmigem, an der
dünnen Spitze etwas gebogenem Schnabel, spitzigen
Flügeln, mittellangem Schwanz, kurzen, starken, langzehigen,
mit wenig gebogenen Nägeln bewehrten Füßen und sehr
buntem Gefieder. Den Schnabel umgibt ein schwarzer und diesen ein
breiter, karminroter Kreis; der Hinterkopf ist schwarz, die Wangen
und der Unterkörper sind weiß, der Rücken ist
braun; Flügel und Schwanz sind schwarz mit weißem
Spiegel, die Schwingen an der Wurzelhälfte goldgelb. Beide
Geschlechter ähneln sich täuschend. Der S. findet sich
fast in ganz Europa, auf den Kanaren, Madeira, in Nordwestafrika,
weitverbreitet in Asien, verwildert auf Cuba, überall in baum-
und obstreichen Gegenden. Im Herbst zieht er in Scharen weit umher,
und im Winter trifft man ihn in kleinern Trupps. Er ist
hauptsächlich Baum-, aber nicht eigentlich Waldvogel, sehr
lebhaft und gewandt, fliegt leicht und schnell, klettert wie eine
Meise, nährt sich von allerlei Samen, besonders von Birken,
Erlen, Disteln, frißt auch viele Kerbtiere, nistet auf
Bäumen und legt im Mai 4-5 weiße oder
blaugrünliche, sparsam violettgrau punktierte, am stumpfen
Ende kranzartig gezeichnete Eier, welche das Weibchen 13-14 Tage
bebrütet. Wegen seines anmutigen Gesangs wird er viel in der
Gefangenschaft gehalten; er erzeugt leicht mit dem Kanarienvogel
eigentümlich gefärbte Bastarde.
Stieglitz, 1) Ludwig, Baron von, Gründer des
berühmten Handels- und Wechselhauses seines Namens in
Petersburg, geb. 1778 zu Arolsen, ging früh nach
Rußland, erwarb sich dort durch sein kommerzielles Genie und
seine rastlose Thätigkeit ein bedeutendes Vermögen,
übte auf Rußlands Handel und Industrie einen
weitgreifenden förderlichen Einfluß aus und war an allen
größern Kredit- und Finanzoperationen der russischen
Regierung beteiligt. Seiner Bemühung hauptsächlich
verdankt Rußland unter anderm die Einführung der
Dampfschiffahrt zwischen Petersburg und Lübeck. Dabei war sein
Haus in Petersburg der Sammelplatz der geistreichsten
Notabilitäten. Der Kaiser ernannte ihn 1825 zum Reichsbaron.
Er starb 18. März 1843 in Petersburg. Nach seinem Tod
führte sein Sohn Alexander das Geschäft fort und wahrte
ihm als tüchtiger Finanzmann seinen alten Ruhm, doch
löste er 1863 die Firma auf. Er starb 24. Okt. 1884.
2) Heinrich, Dichter, geb. 22. Febr. 1803 zu Arolsen, studierte
in Göttingen und Leipzig , ward 1828 in Berlin Gymnasiallehrer
und Kustos an der königlichen Bibliothek und verheiratete sich
in demselben Jahr mit Charlotte Sophie Willhöft (geb. 1806 zu
Hamburg). Ein Nervenleiden veranlaßte ihn jedoch bald, seine
Stellen niederzulegen; eine Reise nach Petersburg hatte nicht den
gewünschten Erfolg der Heilung. Ein anempfindendes Talent, dem
Stärke und Konzentration fehlten, fühlte S. diesen Mangel
aufs tiefste; die Sehnsucht nach einer höchsten Leistung
erfüllte und verzehrte ihn krankhaft. Seine
schwärmerische Gattin nährte den unseligen Gedanken,
daß ein großer Schmerz den Geliebten zum ganzen Mann
und Dichter reifen würde, und gab sich deshalb 29. Dez. 1834
durch einen Dolchstich den Tod (vgl. Mundt, Charlotte S., ein
Denkmal, Berl. 1835). Die That dieser opferfreudigen Verirrung
konnte indessen den geträumten Erfolg nicht haben, S. brach
beinahe völlig zusammen. Er lebte fortan meist zu Venedig und
starb daselbst 24. Aug. 1849 an der Cholera. Seine bedeutendsten
dichterischen Arbeiten sind: "Bilder des Orients" (Leipz. 1831-33,
4 Bde.) mit der Tragödie "Sultan Selim III." Ihnen
schließen sich die "Stimmen der Zeit in Liedern" (2. Aufl.,
Leipz. 1834) an. Von seinen spätern Leistungen sind nur die
"Bergesgrüße" (Münch. 1839) hervorzuheben. Vgl. die
von H. Curtze herausgegebenen Schriften: "H. S., eine
Selbstbiographie" (Gotha 1865), "Briefe von S. an seine Braut
Charlotte" (Leipz. 1859, 2 Bde.) und "Erinnerungen an Charlotte"
(Marb. 1865).
Stiehl, Ferdinand, preuß. Schulmann, namentlich
bekannt als Verfasser der "Regulative für das Volksschul-,
Präparanden- und Seminarwesen" vom 1., 2. u. 3. Okt. 1854,
wurde 12. April 1812 zu Freusburg (Kreis Altenkirchen) geboren,
studierte in Bonn und Halle Theologie, kam 1835 als erster Lehrer
an das Seminar zu Neuwied und wurde 1839 zum Direktor ernannt. Der
Minister Eichhorn berief ihn 1844 als Hilfsarbeiter in das
Kultusministerium, 1845 ward er Regierungs- und Schulrat, 1848
Geheimer Regierungs- und vortragender Rat, 1855 Geheimer
Oberregierungsrat. Um die Entwickelung des Seminarwesens in jenen
Jahrzehnten hat er sich bei aller Einseitigkeit seiner
konservativen Richtung unleugbare Verdienste erworben und die
Einfügung des Volksschul- und Seminarwesens der neuen
Provinzen in die preußische Ordnung nach 1866 mit kundiger,
sicherer, wenn auch bisweilen rauher Hand vollzogen. Kurz nach
Falks Antritt des Kultusministeriums und nach dem Erlaß der
"Allgemeinen Bestimmungen" vom 15. Okt. 1872 am 1. Jan. 1873 trat
S. als Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat in den Ruhestand und
starb 16. Sept. 1878 in Freiburg i. Br. Er veröffentlichte:
"Der vaterländische Geschichtsunterricht" (Kobl. 1842);
"Aktenstücke zur Geschichte und zum Verständnis der drei
preußischen Regulative" (Berl. 1855); "Die Weiterentwickelung
der Regulative" (das. 1861); "Meine Stellung zu den drei
preußischen Regulativen" (das. 1872). Auch begründete er
1859 das "Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung
in Preußen".
Stiehle, Gustav von, preuß. General, geb. 14. Aug.
1823 zu Erfurt, trat 1840 in das 4. pommersche Infanterieregiment
Nr. 21, ward 1841 Offizier, 1845 bis 1847 zur Kriegsakademie und
1852-55 zur trigonometrischen Abteilung des Großen
Generalstabs kommandiert. 1858 als Hauptmann in das
Königsgrenadierregiment versetzt, trat er 1859 als Major in
den Generalstab zurück und ward Direktor der neuerrichteten
Kriegsschule zu Potsdam, dann zu Neiße. 1860 erhielt er die
Leitung der historischen Abteilung des Generalstabs und hielt
zugleich Vorlesungen an der Kriegsakademie. 1864 nahm er im Stab
des Feldmarschalls v. Wrangel am Feldzug gegen Dänemark teil,
wurde geadelt, zum Oberstleutnant und Flügeladjutanten des
Königs ernannt und dann als Militärattaché den
Gesandtschaften in London und Wien zugeteilt. Den Feldzug von 1866
machte er im großen Hauptquartier des Königs mit; er
erwarb sich hier den Orden pour le mérite, nahm an den
Nikolsburger
322
Stielbrand - Stiergefechte.
Verhandlungen teil u. leitete die militärischen
Schlußverhandlungen, welche dem Prager Frieden folgten. 1868
ward er zum Kommandeur des Gardegrenadierregiments Königin
Augusta in Koblenz ernannt, 1869 jedoch in den Großen
Generalstab zurückgerufen. 1870 wurde er Chef des Generalstabs
der zweiten Armee und nahm an allen kriegerischen Thaten dieser
Armee in einflußreichster Weise teil. S. war es, der am 27.
Okt. mit dem französischen General Jarras die Kapitulation von
Metz abschloß. Nach dem Friedensschluß trat er als
Abteilungschef in den Generalstab zurück, wurde 1871 Direktor
des allgemeinen Kriegsdepartements und Mitglied des Bundesrats,
1873 Generalleutnant à la suite und Inspekteur der
Jäger und Schützen, 1875 Kommandeur der 7. Division in
Magdeburg, 1881 kommandierender General des 5. Armeekorps in Posen
und 1886 Chef des Ingenieur- und Pionierkorps und Generalinspekteur
der Festungen; im September 1888 nahm er seinen Abschied.
Stielbrand (Stengelbrand), s. Brandpilze III.
Stieler, 1) Adolf, Kartograph, geb. 26. Febr. 1775 zu
Gotha, studierte die Rechte, erhielt 1797 eine Anstellung beim
Ministerialdepartement in Gotha, ward 1813 zum Legationsrat und
1829 zum Geheimen Regierungsrat befördert und starb 13.
März 1836. S. hat sich um die Geographie besonders durch
gründliche und geschmackvolle Behandlung des Kartenwesens
verdient gemacht. Sein Hauptwerk ist der bekannte "Handatlas", den
er unter Mitwirkung von Reichard (Gotha 1817-23) in 75
Blättern herausgab, und der in neuester Bearbeitung seit 1888
(in 90 Bl.) erscheint. Auch sein "Schulatlas" und seine "Karte von
Deutschland" in 25 Sektionen fanden weite Verbreitung.
2) Karl Joseph, Maler, geb. 1. Nov. 1781 zu Mainz, bildete sich
als Autodidakt zum Pastell- und Miniaturmaler, widmete sich dann
seit 1805 als Schüler Fügers in Wien der Ölmalerei
und eröffnete sich hier eine glänzende Thätigkeit
als Porträtmaler. Sein Ruf führte ihn von da nach Ungarn
und Polen, wo er zahlreiche Bildnisse malte, dann nach Paris, wo er
zwei Jahre verweilte und sich weiter bei Gerard ausbildete, dessen
elegante und anmutige, aber oberflächliche und charakterlose
Art für ihn maßgebend blieb. Nach einem Besuch Roms, wo
er das jetzt in der Leonhardskirche zu Frankfurt a. M. befindliche
große Altarblatt malte, ließ er sich 1812 in
München nieder. 1816 nach Wien gerufen, um den Kaiser Franz zu
malen, verweilte er dort bis 1820 und kehrte dann nach München
zurück, wo er 9. April 1858 starb. Von seinen Arbeiten sind
noch hervorzuheben: die Bildnisse Goethes (1828), Schellings,
Tiecks, A. v. Humboldts, Beethovens, der Familie des Königs
Maximilian von Bayern und die Galerie weiblicher Schönheiten
in der königlichen Residenz zu München.
3) Karl, Dichter und Schriftsteller, Sohn des vorigen, geb. 15.
Dez. 1842 zu München, studierte auf der Universität
daselbst die Rechte und promovierte, unternahm dann Reisen nach
England, Frankreich, der Schweiz, Belgien, Italien, Ungarn und
Norddeutschland, über die er meist in der "Allgemeinen
Zeitung" berichtete, und übernahm endlich eine Beamtenstelle
im bayrischen Staatsarchiv zu München, wo er 12. April 1885
starb. Sein Ruf als Dichter gründet sich auf seine
volkstümlich frischen und von köstlichem Humor
gewürzten Dichtungen in oberbayrischer Mundart, von denen
mehrere Sammlungen vorliegen, wie: "Bergbleameln" (Münch.
1865), "Weil's mi freut!" (Stuttg. 1876), "Habt's a Schneid'?!"
(das. 1877), "Um Sunnawend" (das. 1878), "In der Sommerfrisch"
(das. 1883) und "A Hochzeit in die Berg" (das. 1884), letztere
beiden mit Zeichnungen von H. Kauffmann. Alle diese (meist in
wiederholten Auflagen erschienenen) Bücher fanden, wie auch
seine hochdeutschen "Hochlandlieder" (Stuttg. 1879), "Neue
Hochlandlieder" (das. 1883) und das Liederbuch "Wanderzeit" (das.
1882), allgemein die günstigste Aufnahme. Außerdem
beteiligte sich S. an der Herausgabe mehrerer illustrierter
Prachtwerke, so: "Aus deutschen Bergen" (mit H. Schmid, Stuttg.
1871); "Weidmanns-Erinnerungen" (Münch. 1874); "Italien" (mit
E. Paulus und W. Kaden, Stuttg. 1875); "Rheinfahrt" (mit H.
Wachenhusen und Fr. W. Hackländer, das. 1877) und
"Elsaß-Lothringen" (das. 1877). Nach sei- nem Tod erschienen
noch: "Ein Winteridyll" (Stuttg. 1885); "Kulturbilder aus Bayern"
(das. 1885); "Natur- und Lebensbilder aus den Alpen" (das. 1886);
"Aus Fremde und Heimat", vermischte Aufsätze (das. 1886);
"Durch Krieg zum Frieden. Stimmungsbilder aus den Jahren 1870/71"
(das. 1886).
Stielstich, s. Stickerei.
Stier, 1) das zweite Zeichen des Tierkreises (*);
2) ein Sternbild zwischen 46-87° Rektaszension und 0-28
1/2° nördl. Deklination, nach Heis mit 188 dem
bloßen Auge sichtbaren Sternen, darunter der Aldebaran von
erster Größe sowie die Plejaden und Hyaden. Der
Poniatowskische S. ward 1777 vom Abt Poczobut zu Wilna als ein
eignes Sternbild aus Sternen gebildet, die zwischen der
östlichen Schulter des Ophiuchus und dem Adler sich befinden
und größtenteils zum Ophiuchus gehören.
Stier, Ewald Rudolf, protestant. Theolog, geb. 17.
März 1800 zu Fraustadt in Posen, studierte erst Jura, dann
Theologie, war bis 1819 Vorsteher der Halleschen Burschenschaft,
hielt sich hierauf an verschiedenen Orten auf, teils lernend, teils
lehrend, wurde, ohne eine Prüfung absolviert zu haben, 1829
Pfarrer zu Frankleben bei Merseburg, 1838 in Wichlinghausen bei
Barmen; 1846-50 privatisierte er in Wittenberg , dann wurde er zum
Superintendenten ernannt zuerst 1850 in Schkeuditz, 1859 in
Eisleben, wo er 16. Dez. 1862 starb. Unter seinen zahlreichen
exegetischen Werken nennen wir: "Siebzig ausgewählte Psalmen"
(Braunschw. 1834-36, 2 Bde.); "Die Reden des Herrn Jesu" (3. Aufl.,
Leipz. 1865 bis 1874, 7 Bde.); "Die Reden der Engel" (das. 1860);
"Die Reden der Apostel" (2. Aufl., das. 1861); "Jesaias, nicht
Pseudo-Jesaias" (Barm. 1851). Auch beteiligte er sich am Streit
über die Apokryphen (zu gunsten derselben), über die
Union, an der Revision der deutschen Bibel etc. Sehr verbreitet war
"Luthers Katechismus als Grundlage des Konfirmandenunterrichts" (6.
Aufl., Berl. 1855). Seine Auslegung ist mehr von einem kraftvollen
Inspirationsglauben, den er von J. F. v. Meyer übernommen
hatte, als vonwissenschaftlichen Gesichtspunkten bestimmt. Auch war
er Mitherausgeber der "Polyglotten-Bibel" (mit Theile, 4. Aufl.,
Bielef. 1875). Sein Leben beschrieben seine Söhne G. und F. S.
(Wittenb. 1868).
Stiergefechte (Corridas ["Rennen"] oder Fiestas ["Feste"]
de Toros), Kämpfe von Menschen zu Fuß und zu Pferd mit
Stieren, eine spezisisch spanische Volksbelustigung, die,
wahrscheinlich durch die Mauren in Spanien eingeführt, auch in
den spanischen Kolonien (nur schwach in Portugal) sich erhalten
hat. Als ritterliches Vergnügen, ähnlich dem Turnier und
den Eberhetzen, waren sie nachweislich schon im Anfang des 12.
Jahrh. in Spanien üblich, wie denn auch der Cid Campeador als
glänzender echter gerühmt wird, und unter Philipp IV.
323
Stieringen-Wendel - Stift.
erreichten die S. den Höhepunkt ihres Glanzes. Erst Philipp
V. trat, wenn auch ohne Erfolg, als offener Gegner der S. auf,
welche von nun an gewerbsmäßig von bezahlten
Stierkämpfern (Toreros) betrieben wurden, die heute in ganz
Spanien der Gegenstand allgemeinster Popularität und der
übertriebensten Huldigungen sowohl innerhalb als
außerhalb der Arena sind. Fast jede irgend bedeutende Stadt
hat ihre in Form eines Amphitheaters errichtete Plaza de Toros. Die
größten finden sich in Valencia (16,000 Plätze) und
Madrid (14,000). In Madrid finden, mit einer kurzen Unterbrechung
im Sommer, von Ostern bis Allerheiligen jeden Sonntag und
Donnerstag, oft auch häufiger, S. statt, so im J. 1887 deren
34 mit 217 Stieren und 372 Pferden als Opfer; in den
Provinzialstädten nicht so oft, dennoch kann man 200 S.
jährlich in Spanien annehmen. Das moderne Stiergefecht besteht
aus drei Akten, in welchen die vier Gruppen der Cuadrilla (alle
Toreros, welche irgendwie am Gefecht teilnehmen) nacheinander ihre
Geschicklichkeit entfalten. Die Picadores (Lanzenreiter) auf
elenden Kleppern reizen zunächst den auf den Kampfplatz
gelassenen Stier durch Lanzenstiche in den Nacken; seine Wut wird
gesteigert durch die Banderilleros, welche zu Fuß dem Stier
mit Widerhaken versehene aufgeputzte Stäbe (Banderillas,
Fähnlein) ins Fleisch stoßen. Die Chulos (auch
Capeadores, von Capa, Mantel, genannt) unterstützen die
andern, indem sie durch geschicktes Schwingen roter Mäntel die
Aufmerksamkeit des Stiers von seinen Verfolgern, sobald diese in
Gefahr schweben, ablenken. Die Hauptperson aber ist der Espada
(Degen), der dem Stier mit der blanken Waffe, einem ca. 90 cm
langen, starken Stoßdegen (Espada), den Todesstoß in
eine bestimmte Stelle des Nackens zu versetzen hat. Der Espada (der
Ausdruck Matador [Töter] ist in Spanien weniger üblich)
reizt den Stier durch die Muleta, ein an einem Stock befestigtes
Stück roten Tuches, das er mit der Linken vor sich flattern
läßt, und stößt dann dem angreifenden Stier
den Degen zwischen den Hörnern hindurch bis ans Heft in den
Leib. Berühmte Espadas erhalten 6-8000 Frank für jedes
Stiergefecht. Feige Stiere werden erst gebrannt und dann durch
Hunde zerrissen, oder man durchschneidet ihnen von hinten die
Fesseln, und der Cachetero, der auch die andern Stiere, die nicht
tödlich getroffen sind, abfängt, tötet sie durch
einen Dolchstoß ins Genick. Jeder einzelne Stierkampf dauert
ungefähr eine halbe Stunde; meist kommen bei einer Vorstellung
sechs Stiere und ungefähr doppelt so viel Pferde ums Leben.
Man kann heute die Opfer auf jährlich 1000 Stiere und
mindestens 3500 getötete Pferde berechnen. Die jährlichen
Ausgaben für S. betragen viele Millionen Frank. In Spanien wie
in den südamerikanischen Republiken widmen sich zahllose
Zeitschriften dem nationalen Sport der S., und die Litteratur
über dieselbe ist eine sehr reichhaltige. Vgl. Joest,
Spanische S. (Berl. 1889).
Stieringen-Wendel, Gemeinde im deutschen Bezirk
Lothringen, Kreis Forbach, an der Eisenbahn S. (Preußische
Grenze)-Novéant, hat ein bedeutendes Eisenhüttenwerk
mit 1250 Arbeitern (Fabrikation von Trägern, Eisenbahnschienen
etc.), eine Glashütte und (1885) 3854 meist kath.
Einwohner.
Stiersucht, s. Brüllerkrankheit.
Stier von Uri, im Mittelalter der Hürner (Hornist)
der Männer von Uri, so benannt, weil er die Mannschaft durch
das Blasen eines Auerochsenhorns zusammenrief.
Stieve, Felix, Geschichtsforscher, geb. 9. März 1845
zu Münster in Westfalen als Sohn des damaligen
Gymnasialdirektors, spätern vortragenden Rats im
preußischen Unterrichtsministerium, Friedrich S. (gest.
1878), studierte in Breslau, Innsbruck, Berlin und München
Geschichte und erlangte mit einer Dissertation: "De Francisco
Lamberto Avenionensi". 1867 zu Breslau die philosophische
Doktorwürde. Hierauf trat er im Herbst 1867 bei der
Historischen Kommission in München als Mitarbeiter an den
"Wittelsbacher Korrespondenzen zur Geschichte des
Dreißigjährigen Kriegs" ein, habilitierte sich 1874 als
Privatdozent der Geschichte an der Münchener Universität,
wurde 1878 Mitglied der königlich bayrischen Akademie der
Wissenschaften und 1886 Professor der Geschichte am Polytechnikum
in München. Er veröffentlichte: "Die Reichsstadt
Kaufbeuren und die bayrische Restaurationspolitik" (Münch.
1870); "Der Ursprung des Dreißigjährigen Kriegs 1607-19"
(Bd. 1: "Der Kampf um Donauwörth", das. 1875); "Das kirchliche
Polizeiregiment in Bayern unter Maximilian I." (das. 1876); "Zur
Geschichte der Herzogin Jakobe von Jülich" (Bonn1878); "Die
Politik Bayerns 1591-1607" (als Band 4 u. 5 der "Briefe und Akten
zur Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs", Münch.
1878-82); "Die Verhandlungen über die Nachfolge Kaiser Rudolfs
II. in den Jahren 1581-1602" (das. 1879); "Der Kalenderstreit des
16. Jahrhunderts in Deutschland" (das. 1880); "Über die
ältesten halbjährigen Zeitungen oder Meßrelationen
und insbesondere über deren Begründer Freiherrn v.
Aitzing" (das. 1881) ; "Wittelsbacher Briefe aus den Jahren
1590-1610" (das. 1885-88, 3 Tle.) u. a.
Stifel (Styfel, auch Stieffel), Michael, Algebrist, geb.
1487 zu Eßlingen, ging in das dortige Augustinerkloster, aus
dem er aber 1522 als Anhänger Luthers entfloh, worauf er als
evangelischer Prediger erst bei einem Grafen von Mansfeld, dann in
Oberösterreich, 1528-34 zu Lochau bei Torgau, hierauf bis 1547
zu Holzdorf bei Wittenberg, nachher zu Haberstrohm bei
Königsberg i. Pr. wirkte. Später scheint er in Jena
gelebt zu haben, wo er 19. April 1567 starb. Sein Hauptwerk ist die
"Arithmetica integra" (Nürnb. 1544). Vgl. Cantor in
Schlömilchs "Zeitschrift für Mathematik und Physik", Bd.
2.
Stift (das S.; Mehrzahl: die Stifter), jede mit
Vermächtnissen und Rechten ausgestattete, zu kirchlichen
Zwecken bestimmte und einer geistlichen Korporation übergebene
Anstalt mit allen dazu gehörigen Personen, Gebäuden und
Liegenschaften. Die ältesten Anstalten dieser Art sind die
Klöster, nach deren Vorbild sich später das kanonische
Leben der Geistlichen an Kathedralen und Kollegiatstiftskirchen
gestaltete. Im Gegensatz zu den mit den Kathedralkirchen
verbundenen Erz- und Hochstiftern mit je einem Erzbischof oder
Bischof an der Spitze hießen die Kollegiatkirchen, bei
welchen kein Bischof angestellt war, Kollegiatstifter. Die
Mitglieder derselben wohnten in Einem Gebäude zusammen und
wurden von dem Ertrag eines Teils der Stiftsgüter und Zehnten
unterhalten. So bildeten sich die Domkapitel, deren Glieder, die
Canonici, sich Kapitularen, Dom-, Chor- oder Stiftsherren nannten.
Infolge des häufigen Eintritts Adliger entzogen sich dieselben
schon im 11. Jahrh. der Verpflichtung des Zusammenwohnens
(Klausur), verzehrten ihre Präbenden einzeln in besondern
Amtswohnungen, bildeten jedoch fortwährend ein durch Rechte
und Einkünfte ausgezeichnetes Kollegium, welches seitdem 13.
Jahrh. über die Aufnahme neuer Kapitularen zu entscheiden, bei
Erledigung eines Bischofsitzes (Sedisvakanz) die
324
Stifte - Stigel.
provisorische Verwaltung der Diözese zu führen und den
neuen Bischof aus seiner Mitte zu wählen hatte. Vor der durch
den Reichsdeputationshauptschluß vom 25. Febr. 1803
verfügten Säkularisation hatten die deutschen Erz- oder
Hochstifter Mainz, Trier, Köln, Salzburg, Bamberg,
Würzburg, Worms, Eichstätt, Speier, Konstanz, Augsburg,
Hildesheim, Paderborn, Freising, Regensburg, Passau, Trient,
Brixen, Basel, Münster, Osnabrück, Lüttich,
Lübeck und Chur sowie einige Propsteien (Ellwangen,
Berchtesgaden etc.) und gefürstete Abteien (Fulda, Korvei,
Kempten etc.) Landeshoheit und Stimmrecht auf dem Reichstag, daher
sie auch reichsunmittelbare Stifter hießen und den
Fürstentümern gleich geachtet wurden. In andern
Ländern waren die Stifter niemals zu so hoher Macht gelangt.
Auch in den bei der Reformation protestantisch gewordenen
Ländern blieben meist die Stifter und die Domkapitel, jedoch
ohne einen Bischof und ohne Landeshoheit, und ihre Einkünfte
wurden als Sinekuren vergeben. Ausnahmen bildeten nur das ganz
protestantische Bistum Lübeck und das aus gemischten
Kapitularen bestehende Kapitel zu Osnabrück. Jetzt sind alle
Stifter mittelbar, d. h. der Hoheit des betreffenden Landesherrn
unterworfen. Bei den unmittelbaren Hoch- und Erzstistern
mußten die Domherren ihre Stiftsfähigkeit durch 16 Ahnen
beweisen; sie waren Versorgungsanstalten für die jüngern
Söhne des Adels geworden. Während diese adligen
Kapitularen sich den Genuß aller Rechte ihrer Kanonikate
vorbehielten, wurden die geistlichen Funktionen den regulären
Chorherren auferlegt, woher sich der Unterschied der weltlichen
Chorherren (Canonici seculares), welche die eigentlichen
Kapitularen sind, von den regulierten Chorherren (Canonici
regulares) schreibt. Die säkularisierten und protestantisch
gewordenen Stifter behielten häufig ihre eigne Verfassung und
Verwaltung; meist wurden aber ihre Präbenden in Pensionen
verwandelt, welche zuweilen mit gelehrten Stellen verbunden sind.
In Preußen sind die evangelischen Domkapitel zu Brandenburg,
Merseburg und Naumburg sowie das Kollegiatstift in Zeitz
bemerkenswert. Vgl. Schneider, Die bischöflichen Domkapitel
(Mainz 1885). Außer den Erz-, Hoch- und Kollegiatstiftern
gibt es auch noch weibliche Stifter und zwar geistliche und
weltliche. Erstere entstanden durch eine Vereinigung regulierter
Chorfrauen und glichen den Klöstern; bei den freien weltlichen
Stiftern dagegen legen die Kanonissinnen nur die Gelübde der
Keuschheit und des Gehorsams gegen ihre Obern ab, können
jedoch heiraten, wenn sie auf ihre Pfründe verzichten, und
haben die Freiheit, die ihnen vom S. zufließenden
Einkünfte zu verzehren, wo sie wollen. Nur die Pröpstin
und Vorsteherin nebst einer geringen Zahl Kanonissinnen pflegen
sich im Stiftsgebäude aufzuhalten. Auch die Pfründen
dieser Stifter wußte der stiftsfähige Adel vielfach
ausschließlich für seine Töchter zu erlangen, doch
hängt häufig die Aufnahme auch von einer Einkaufssumme
ab. Auch sind für die Töchter von verdienten Beamten
Stiftsstellen geschaffen worden. Die Kanonissinnen dieser "freien
weltadligen Damenstifter" werden jetzt gewöhnlich Stiftsdamen
genannt.
Stifte, s. Nägel, S. 977.
Stifte (Balzstifte), die kleinen hornartigen Federchen an
beiden Seiten der Zehen des Auerhahns, welche er zu Ende der Balz
verliert.
Stifter, Adalbert, Dichter und Schriftsteller, geb. 23.
Okt. 1806 zu Oberplan im südlichen Böhmen, studierte in
Wien die Rechte, daneben Philosophie und Naturwissenschaften, ward
Lehrer des Fürsten Richard Metternich und 1849 zum Schulrat
für das Volksschulwesen Oberösterreichs ernannt. Als
solcher nahm er seinen Wohnsitz in Linz, von wo aus er vielfach die
Alpen, Italien etc. bereiste, ward 1865 pensioniert und starb
daselbst 28. Jan. 1868. Seine Idylle und Novellen erschienen
gesammelt unter den Titeln: "Studien" (Pest 1844-51, 6 Bde.; 8.
Aufl. 1882, 2 Bde.) und "Bunte Steine" (das. 1852, 2 Bde.; 7. Aufl.
1884). Namentlich die "Stadien" erregten von ihrem Erscheinen an
Teilnahme und selbst Enthusiasmus. Die unbedingte Hinwegwendung von
allen Problemen und Tendenzen des Tags, der idyllische, fast
quietistische Grundzug, die meisterhaften Details, namentlich die
sinnigen Naturschilderungen, die feine, gleichmäßige
Durchführung bildeten einen so wohlthuenden Gegensatz zur
Tagesbelletristtk, daß man darüber die Mängel der
überwiegend kontemplativen, aller Leidenschaft und Thatkraft
abgewandten, zur lebendigern Menschendarstellung daher
unfähigen Natur des Autors übersah. Diese Mängel
traten namentlich in den größern Romanen Stifters: "Der
Nachsommer" (Pest 1857, 3. Aufl. 1877) und "Witiko" (das. 1864-67,
3 Bde.), hervor. Stifters Nachlaß ("Briefe", Pest 1869, 3
Bde.; "Erzählungen", das. 1869, 2 Bde.; "Vermischte
Schriften", das. 1870, 2 Bde.) gab Aprent heraus. "Ausgewählte
Werke" von ihm erschienen in 4 Bänden (Leipz. 1887). Vgl. Emil
Kuh, Adalbert S. (Wien 1868); Derselbe, Grillparzer und A. S.
(Preßb. 1872); Markus, A. Stifter (2. Aufl., Wien 1879).
Stiftsherr, s. Domherr.
Stiftshütte (Bundeshütte), das zeltartige
tragbare Heiligtum, welches Moses auf dem Zug der Israeliten durch
die Wüste zum Gottesdienst anfertigen ließ. Es ward
später in Kanaan an verschiedenen Orten, zuletzt unter David
in Jerusalem, aufgestellt und darin bis zur Erbauung des Tempels
durch Salomo der Opferkultus verrichtet. Die S. (hebr. Ohel moed,
wobei man Ohel und Mischkan unterschied) bildete ein Rechteck von
30 Ellen Länge, 10 Ellen Breite und 10 Ellen Höhe. Ihre
Wände bestanden aus 48 übergoldeten Brettern von
Akazienholz, welche durch goldene Ringe zusammengehalten wurden.
Über diesen Wänden hing ein einfacher Teppich. Die
vordere, zum Eingang dienende Seite war mit einem an fünf
Säulen befestigten Vorhang verhängt. Das Innere teilte
ein andrer Vorhang (Parochet) in eine vordere Abteilung, das
Heilige, worin der Tisch mit den Schaubroten, der goldene Leuchter
und der Räucheraltar, und in eine hintere Abteilung, das
Allerheiligste, worin die Bundeslade stand. Das Ganze war mit einem
für das Volk bestimmten Vorhof umgeben. Salomo ließ nach
Erbauung des Tempels die Überreste der S. in diesem
aufstellen. Vgl. Naumann, Die S. (Gotha 1869).
Stiftslehen, s. Kirchenlehen.
Stiftsschulen, s. Domschulen.
Stiftung, s. Milde Stiftungen.
Stigel, Johann, neulat. Dichter, geb. 13. Mai 1515 bei
Gotha, studierte in Leipzig und Wittenberg, wo er Luthers und
Melanchthons Freundschaft genoß, Humaniora, ward 1542, zu
Regensburg vom Kaiser als Dichter gekrönt, Professor der
lateinischen Sprache in Wittenberg, eröffnete 1558 als erster
Professor der Beredsamkeit die Universität Jena mit der
Weihrede und starb 11. Febr. 1562. Unter seinen Schriften sind die
"Carmina" (Jena 1660 ff., 4 Bde.) hervorzuheben. Vgl.
Göttling, Vita Joh. Stigelii (Jena 1858; abgedr. in den
"Opusc. acad.", S. 1-64).
325
Stiglmayer - Stil.
Stiglmayer, Johann Baptist, Erzgießer, Bildhauer
und Medailleur, geb. 18. Okt. 1791 zu Fürstenfeldbruck bei
München, kam zu einem Goldschmied in München in die
Lehre, ward 1810 in die Akademie der bildenden Künste
aufgenommen, 1814 als Münzgraveur angestellt und 1819 nach
Italien gesandt, um die Technik des Erzgusses kennen zu lernen. In
Rom gründete er seinen Ruf durch den Guß der Büste
des spätern Königs Ludwig I. von Bayern nach Thorwaldsens
Modell. 1822 ins Vaterland zurückgekehrt, schnitt er Stempel
zu Kurrentmünzen und Medaillen und ward dann zum Inspektor der
königlichen Erzgießerei ernannt, in welcher Stellung er
eine lebhafte Thätigkeit entfaltete. Aus seiner Werkstatt
gingen folgende Güsse hervor: der Kandelaber für das vom
Grafen von Schönborn in Gaibach errichtete
Konstitutionsdenkmal, der auf dem Karolinenplatz in München
errichtete Obelisk, Bronzethore nach Zeichnungen L. v. Klenzes
für die Glyptothek und die Walhalla, das Denkmal des
Königs Maximilian I. im Bad Kreuth, nach eignem Entwurf, das
Monument des Königs Maximilian I. auf dem Max Josephsplatz in
München, nach Rauchs Modell (1835), die Reiterstatue des
Kurfürsten Maximilian aus dem Wittelsbacher Platz daselbst,
nach Thorwaldsens Modell (1836), die zwölf kolossalen
Standbilder der Fürsten des Hauses Wittelsbach im Thronsaal
der Residenz, nach Schwanthalers Modellen, die Statue Schillers auf
dem Schloßplatz zu Stuttgart, nach Thorwaldsen, die
Standbilder Jean Pauls in Baireuth, Mozarts in Salzburg, des
Markgrafen Friedrich von Brandenburg in Erlangen, des
Großherzogs Ludwig von Hessen-Darmstadt in Darmstadt, nach
Schwanthaler. Das kolossalste Werk der Münchener
Gießerei, dessen Guß S. aber nur in seinen ersten
Teilen ausführte, war die Bavaria in München, sein
letztes die Goethestatue in Frankfurt a. M. Er starb 2. März
1844 in München.
Stigma (griech., "Stich"), bei den Griechen und
Römern ein Brandmal, das Verbrechern, namentlich diebischen
oder entlaufenen Sklaven, eingebrannt wurde (gewöhnlich auf
der Stirn); in der Botanik s. v. w. Narbe (s. Blüte, S. 69);
in der Zoologie s. v. w. Luftloch (s. Tracheen).
Stigmaria Brongn., s. Lykopodiaceen, S.6.
Stigmatisation, das angebliche freiwillige Auftreten der
fünf Wundmale Christi bei Personen, die sich in eine
schwärmerische Betrachtung seiner Leiden versenkt hatten.
Nachdem der heil. Franz von Assisi (s. Franziskaner) zuerst diese
Auszeichnung erhalten haben soll und die heil. Katharina von Siena
wenigstens einen Ansatz dazu genommen, hat sich diese Erscheinung
im Lauf der Jahrhunderte an sehr zahlreichen Personen, namentlich
weiblichen Geschlechts, wiederholt, und zwar sowohl bei Nonnen als
bei weiblichen Laien, und bei einigen blieb die S. eine dauernde,
indem die Wundmale alle Freitage und am stärksten in der
Passionszeit bluteten, was dann häufig zu Schaustellungen
Anlaß gegeben hat. Insbesondere wiederholte sich die S. in
Zeiten religiöser Aufregung, und in unserm Jahrhundert haben
Katharina Emmerich, die Freundin Klemens Brentanos, Maria v.
Mörl und insbesondere Louise Lateau in dem belgischen
Dörfchen Bois d'Haine in dieser Richtung großes Aufsehen
erregt. Diese Personen gaben bestimmten Verehrerkreisen
Schaustellungen, indem sie theatralisch die Leiden Christi,
während sie dieselben angeblich empfanden, in lebenden Bildern
durchführten; daneben bekamen sie kataleptische Zufälle
(Verzückungen), in denen sie unempfindlich gegen Schmerzen zu
sein vorgaben, und mancherlei andre Wundergaben (vollkommenes
Fasten, Empfindung der Nähe heiliger Gegenstände etc.).
Das Urteil über diese Fälle hat sich zuerst
naturgemäß nur in den beiden Gegensätzen: Wunder
oder Betrug! kundgegeben, und in der unendlichen Litteratur, die
über Louise Lateau entstand, vertrat der belgische Arzt
Professor Lefebvre ("Louise Lateau", Löwen 1873) mit aller
Entschiedenheit die Überzeugung, daß hier ein
übernatürliches Ereignis vorliege, während Virchow
u. a. es einfach als Betrug brandmarkten. In der That sind denn
auch nicht wenige Fälle von sogen. S. vor den Gerichten als
grober Betrug entlarvt worden. Bei der Bedeutung, welche von
manchen Seiten dem Fall der Louise Lateau beigelegt wurde, ernannte
die Brüsseler Akademie der Wissenschaften eine Kommission zur
Untersuchung desselben, und in dem Bericht, welchen Warlomont
über die Arbeiten dieser Kommission erstattet hat, wird nun
auf Grund sehr sorgfältiger und den Betrug
ausschließender Untersuchungen und in Übereinstimmung
mit andern belgischen und französischen Ärzten die schon
von Montaigne vertretene Meinung ausgesprochen, daß eine bis
zur Krankheit gesteigerte Einbildungskraft das wiederholte
freiwillige Bluten der irgendwie erworbenen Wunden hervorbringen
könne. Außerdem bieten viele den Stigmatisierten
eigentümliche Zufälle, wie die Katalepsie,
Unempfindlichkeit, die Nachahmungssucht u. a., eine bedeutende
Ähnlichkeit mit den neuerdings genauer untersuchten
Zuständen des Hypnotismus (s. d.), welche in ähnlicher
Weise durch Konzentration der Gedanken und Sinneseindrücke auf
bestimmte eng begrenzte Gebiete hervorgerufen werden. Danach
würde sich die S. in den Fällen, wo nicht grober Betrug
vorliegt, jenen zahlreichen Erscheinengen anreihen lassen, welche
mit hochgradiger Hysterie einhergehen, und bei denen Krankheit und
Selbstbetrug so merkwürdig miteinander verbunden sind. Diesen
Standpunkt nehmen die Schriften von Warlomont (Brüssel 1875)
und Bourneville (Par. 1875) über Louise Lateau und Charbonnier
("Maladies des mystiques", Brüssel 1875) ein; aus der
unübersehbaren fernern Litteratur vgl. Schwann. Mein Gutachten
über die Versuche etc. (Köln 1875).
Stigmatypie (griech.), ein von Fasol in Wien erfundenes
Setzverfahren zur Herstellung von Bildern durch Punkte auf
typographischem Weg.
Stikeen (spr. -kihn, Stachine), Fluß in
Nordamerika, entspringt auf dem Tafelland von Britisch-Columbia,
durchfließt in seinem untern, schiffbaren Teil das
Territorium Alaska und mündet unterm 57.° nördl. Br.
in den Stillen Ozean. An seinen Ufern wurde 1862 Golo entdeckt.
Dampsschiffe befahren ihn 320 km weit.
Stil (v. lat. stilus, "Griffel", Schreibart), bezeichnet
in der Litteratur die Art und Weise der sprachlichen Darstellung,
wie sie sowohl durch die geistige Fähigkeit und subjektive
Eigentümlichkeit des Schriftstellers als auch durch den Inhalt
und den Zweck des Dargestellten bedingt wird. Da der S. also als
die durch das Ganze der schriftlichen Darstellung herrschende Art,
einen Gegenstand aufzufassen und auszudrücken, nicht nur von
dem Inhalt des Gegenstandes, sondern auch von dem Charakter und der
Bildung des Menschen abhängig ist, so hat eigentlich jeder
Schriftsteller seinen eignen S., was Buffon meint, wenn er sagt:
"Der S. ist der Mensch selbst" ("le style c'est l'homme
même"). Die erste Forderung, die man an jede Art des Stils
macht, ist Deutlichkeit und Klarheit. Die Deutlichkeit verlangt
aber Reinheit der Sprache oder Vermeidung aller
326
Stilbit - Stilke.
Wörter, die das Bürgerrecht in der Sprache nicht
erlangt haben, z. B. aller Provinzialismen, ausländischer,
ohne Not neugeschaffener oder veralteter Wörter; treue
Beobachtung der durch die Grammatik bestimmten Gesetze;
Korrektheit, wonach man das den darzustellenden Begriff
bezeichnende und deckende Wort wählt; Präzision oder
Bestimmtheit, wonach alles Überflüssige entfernt und
nicht mehr oder weniger gegeben wird, als was zur genauen
Darstellung des Gedankens erforderlich ist. Inhalt und Zweck der
stilistischen Darstellung können verschieden sein, und man
unterscheidet insbesondere drei Kräfte, die bei derselben in
Wirksamkeit treten: Verstand, Einbildung und Gefühl, weshalb
man von einem S. des Verstandes, der Einbildung und des
Gefühls spricht. Bei dem erstern wird man sich vor allem der
Deutlichkeit, bei dem zweiten der Anschaulichkeit und bei dem
dritten der Leidenschaftlichkeit zu befleißigen haben. Zu dem
ersten gehört die prosaische Darstellung im allgemeinen, zu
dem zweiten die Epik und das Drama, zu dem dritten die Lyrik und
die Rede. Die alten Griechen und Römer unterschieden,
ungefähr dem entsprechend, aber ohne Rücksicht auf Inhalt
und Zweck der Darstellung, in der Prosa einen niedern (genus
submissum), einen mittlern (g. medium) und einen höhern S. (g.
sublime), und es sollen nach ihrer Regel z. B. in einer Rede alle
drei Stilarten miteinander abwechseln (vgl. Rede). Im übrigen
unterscheidet man mehrere stilistische Gattungen mit gewissen
feststehenden Formen, z. B. den philosophischen, den didaktischen,
den historischen, den Geschäfts- und Briefstil. Die Theorie
des Stils oder Stilistik ist die geordnete Zusammenstellung aller
Regeln des guten Stils oder der üblichen Art, sich schriftlich
auszudrücken. Vgl. Wackernagel, Poetik, Rhetorik und Stilistik
(2. Aufl., Halle 1888). - In der bildenden Kunst versteht man unter
S. einerseits die in einem Kunstwerk zur Darstellung gebrachte
formale und geistige Anschauung, wie sie bei einem Volk oder in
einer gewissen Zeit für die verschiedenen Künste als
maßgebend angesehen ward, anderseits die individuelle, sich
von der allgemeinen Richtung in Einzelheiten unterscheidende
Darstellungsweise eines Künstlers. Wenn sich dieser
individuelle S. zu einseitig ausprägt oder seinen geistigen
Inhalt verliert, nennt man diese Darstellungsweise Manier (s. d.).
Ebenso bezeichnet S. in der Musik sowohl die für eine
Kompositionsgattung oder für bestimmte Instrumente
erforderliche Schreibweise (Opernstil, Klavierstil, Kirchenstil,
Vokalstil etc.) als auch die eigentümliche Schreibweise eines
Meisters. Auch spricht man von einem strengen oder gebundenen S.
und versteht darunter die Schreibweise mit reellen Stimmen unter
Beobachtung der für den Vokalstil gültigen Gesetze, und
von einem freien oder galanten S., welcher sich nicht an eine
bestimmte Anzahl Stimmen bindet, sondern dieselben nach Belieben
vermehrt oder vermindert etc. Endlich heißt auch S. die
verschiedene Rechnungsart nach dem julianischen und gregorianischen
Kalender. Man unterscheidet alten S., nach dem julianischen (noch
jetzt bei den Russen gebräuchlich), und neuen S., nach dem
gregorianischen Kalender, die beide um zwölf Tage voneinander
abweichen; daher datiert man meist 12./24. Jan., d. h. 12. Jan.
nach dem alten und 24. Jan. nach dem neuen S.
Stilbit (Heulandit, Blätterzeolith), Mineral aus der
Ordnung der Silikate (Zeolithgruppe), kristallisiert monoklinisch,
findet sich aufgewachsen oder in Drusen (s. Tafel "Mineralien",
Fig. 7), auch derb in strahligblätterigen Aggregaten, ist
farblos, gelblich, grau, braun oder durch eingeschlossene
Schüppchen von Eisenoxyd rot, glasglänzend, durchsichtig
bis kantendurchscheinend, Härte 3,5-4, spez. Gew. 2,1-2,2,
besteht aus Thonerdekalksilikat H4CaAl2Si6O18+3H2O mit geringem
Natriumgehalt. Fundorte aus Erzlagern oder Gängen (Arendal,
Kongsberg, Andreasberg), häufig in Blasenräumen der
Basalte und Basaltmandelsteine auf den Färöern, Island,
Skye, im Fassathal und in Nordamerika. S. auch s. v. w. Desmin (s.
d.).
Stilett (ital.), Spitzdolch, ein kleiner Dolch mit
schlanker, spitzer Klinge; s. Dolch.
Stilfser Joch (Monte Stelvio, Wormser Joch), der
höchste fahrbare Alpenpaß, 2756 m ü. M., an der
Nordwestseite der Ortleralpen in Tirol, mit prachtvoller
Kunststraße, welche das Etschthal (Vintschgau) mit dem Thal
der Adda (Veltlin) verbindet. Die Straße wurde 1820-25 vom
Ingenieur Donegani angelegt, ist 53 km lang und führt von
Spondinig im Vintschgau über Gomagoi (Mündung des
Suldenthals), Trafoi und Franzenshöhe in 48 Windungen, von
denen die letzten teilweise durch Galerien gedeckt sind, bis zur
Paßhöhe und von dort in 38 Windungen in das Brauliothal
und weiter nach Bormio in der italienischen Provinz Sondrio. Die
Straße übertrifft an Großartigkeit der Umgebung
alle fahrbaren Alpenübergänge. Seinen Namen erhielt das
Joch nach dem oberhalb der Straße gelegenen Tiroler
Dörfchen Stilfs.
Stilicho, röm. Feldherr und Staatsmann, Sohn eines
im römischen Heer dienenden Vandalen, schwang sich durch Mut,
Einsicht und Treue unter Kaiser Theodosius I. zu den höchsten
Stellen empor und ward von diesem zum Gemahl seiner Nichte und
Pflegetochter Serena und zum Vormund seines Sohns Honorius, welcher
395 als elfjähriger Knabe die Herrschaft des
weströmischen Reichs antrat, erwählt. S. ließ
seinen Nebenbuhler Rufinus ermorden, zwang 396 den Gotenkönig
Alarich, das von ihm verwüstete Griechenland zu räumen,
unterdrückte 398 den Aufstand des Gildo in Afrika, brachte
Alarich, als derselbe 403 in Italien einfiel, zwei Niederlagen bei
Pollentia und Verona bei, durch die derselbe genötigt wurde,
Italien zu verlassen, und als 405 oder 406 ein großes Heer
deutscher Völker unter Radagaisus in Italien eindrang, wurde
dieses bei Fäsulä von ihm eingeschlossen und fast
völlig vernichtet. Dagegen vermochte er nicht, Gallien gegen
die Vandalen und Alanen, welche dasselbe 406 überschwemmten,
zu schützen und Britannien, wo sich Constantinus zum
Gegenkaiser erhoben hatte, wieder zu unterwerfen. Er wurde 408
durch Olympius gestürzt und in Ravenna ermordet. Vgl. Keller,
Stilicho (Berl. 1884).
Stilisieren, stilmäßig formen, besonders in
Bezug auf die Schreibweise (s. Stil); in der Zeichenkunst und
Malerei das Zurückführen der Naturformen unter
Fortlassung des Zufälligen und Willkürlichen auf
Grundformen, in welchen eine gewisse Gesetzmäßigkeit
waltet. So ist z. B. der Akanthus (s. d., mit Abbildung) am
korinthischen Kapitäl stilisiert. Über stilisierte oder
stilistische Landschaften s. Heroisch.
Stilistik (lat.), s. Stil.
Stilke, Hermann, Maler, geb. 29. Jan. 1803 zu Berlin,
studierte auf der Akademie daselbst, dann seit 1821 in München
unter Cornelius, folgte demselben nach Düsseldorf, malte mit
Stürmer gemeinsam im Assisensaal zu Koblenz das (unvollendete)
Jüngste Gericht, führte darauf mehrere Fresken in den
Arkaden zu München aus, besuchte 1827 Oberitalien und ging
1828 nach Rom. 1833 kehrte er nach Düsseldorf zurück,
stellte 1842-46 im Rittersaal des Schlosses
327
Stille - Stiller Ozean.
Stolzenfels die sechs Rittertugenden in großen Wandbildern
dar, siedelte 1850 nach Berlin über und starb daselbst 22.
Sept. 1860. Außer einigen Fresken für das
königliche Schloß in Berlin und das Schauspielhaus in
Dessau malte er dort nur Staffeleibilder. Von seinen übrigen
Werken sind hervorzuheben: Kreuzfahrerwacht (1834), St. Georg mit
dem Engel, Pilger in der Wüste (Nationalgalerie in Berlin),
die Jungfrau von Orléans, die letzten Christen in Syrien
(1841, Museum in Königsberg), Raub der Söhne Eduards
(Nationalgalerie in Berlin). - Seine Gattin Hermine S., geborne
Peipers, geb. 1808, gest. 1869, hat sich als talentvolle Zeichnerin
und Aquarellmalerin bekannt gemacht.
Stille, Karl, Pseudonym, s. Demme 1).
Stille Gesellschaft, s. Handelsgesellschaft.
Stillen der Kinder, die Ernährung der Kinder in den
ersten Lebensmonaten durch die Mutter- oder Ammenmilch. Für
das neugeborne Kind, den Säugling, ist die Milch seiner Mutter
die natürlichste und gesündeste Nahrung. Anderseits ist
das Stillen ihrer Kinder für die Mutter eine natürliche
Pflicht und für die Erhaltung ihrer eignen Gesundheit, zumal
während des Wochenbettes, erforderlich. Bleibt die Mutter
gesund, und wird die Milchabsonderung nicht gestört, so
genügt die Mutterbrust dem Kind bis zu der Zeit, wo mit dem
Durchbruch der Zähne sich der Trieb nach festen
Nahrungsmitteln äußert. Mit dem ersten Anlegen des
Kindes darf man nicht warten, bis die Brüste reichlichere und
wirkliche Milch geben. Gerade durch das Saugen des Kindes wird die
Milchabsonderung am besten befördert, und das Kolostrum,
welches vom Kind zuerst verschluckt wird, begünstigt den
Abgang des Kindspechs aus dem Darm. Schon in den ersten 24 Stunden
nach der Geburt, am besten, sobald das Kind ordentlich aufgewacht
ist, legt man dasselbe an die Brust und wiederholt dies etwa alle 3
Stunden, im allgemeinen um so häufiger, je schwächlicher
das Kind ist, und läßt es dann um so weniger auf einmal
trinken. Sonst aber läßt man es saugen, bis es satt ist,
d. h. bis es zu trinken aufhört, oder bis es einschläft.
Man läßt das Kind nun so lange schlafen, bis es von
selbst aufwacht, und gibt ihm dann wieder die Brust. Nach einigen
Monaten braucht dem Kinde die Brust nur in größern
Zwischenräumen gereicht zu werden, und es pflegt dann um so
größere Portionen auf einmal zu trinken. Wegen der
nachteiligen Wirkung auf die Milchabsonderung und somit auch auf
den Säugling darf dieser niemals gleich nach einem heftigen
Gemütsaffekt, Zorn oder Ärger, der Mutter an die Brust
gelegt werden; man kennt viele Fälle, wo Kinder unter solchen
Umständen plötzlich erkrankt und selbst gestorben sind.
Nach jedesmaligem Trinken muß der Mund des Säuglings mit
einem zarten, in Wasser getauchten Leinwandläppchen
sorgfältig gereinigt werden. Es ist dies das sicherste Mittel
gegen Schwämmchenbildung auf der kindlichen Mundschleimhaut
sowie gegen das Wundwerden der Brustwarzen. Mit der Entwickelung
der Zähne müssen dem Kind noch andre Nahrungsmittel als
Milch gereicht werden, und jetzt, wenn das Kind die Mutterbrust
beißen kann, soll es von derselben entwöhnt werden,
gewöhnlich etwa nach Vollendung des ersten Lebensjahrs, oft
aber auch erst später. Je schwächlicher und
kränklicher das Kind, je schlechter es genährt ist, um so
später ist dasselbe zu entwöhnen, desgleichen bei
bestehendem Verdacht auf erbliche Anlage zu gewissen Krankheiten.
Hier fahre man womöglich mit dem Stillen über das erste
Zahnen hinaus fort. Überhaupt warte man mit dem Entwöhnen
eine Zeit ab, wo das Kind ganz gesund ist, und nehme es
womöglich erst im Frühjahr oder Sommer vor. Immer sollte
das Kind schon vorher mit Vorsicht und allmählich an
dünnen Milchbrei, Suppen mit Zwieback, Arrowroot u. dgl.
gewöhnt werden. Dem entwöhnten Kind gibt man täglich
vier- bis fünfmal einen dünnen Brei aus feinem
Weizenmehl, fein gestoßenem Zwieback und Milch mit wenig
Zucker. Nebenher gibt man dem Kind gute, erwärmte, nicht
abgekochte Kuhmilch, unter Umständen mäßig
verdünnt, zu trinken. Wird das Kind stärker, so reicht
man ihm Kalbfleisch- und Hühnerfleischbrühe, später
auch andre Fleischbrühsuppen mit Grieß, Reis u. dgl.,
die aber durchgeseiht und einem dünnen Brei ähnlich sein
müssen, bis man endlich nach dem Zahndurchbruch zu festern
Nahrungsmitteln übergeht.
Stiller Freitag, s. Karfreitag.
Stiller Ozean (engl. Pacific Ocean, franz. Océan
Pacifique), derjenige Teil des Weltmeers, welcher sich zwischen
Amerika, Asien und Australien von der Beringsstraße bis zum
südlichen Polarkreis ausbreitet (s. Karte "Ozeanien") und
gegen den Atlantischen Ozean durch den Meridian des Kap Horn, gegen
den Indischen Ozean durch den Meridian des Kap Liuwin abgegrenzt
wird. Er überdeckt (uneingerechnet das Chinesische Meer und
die australisch-ostindischen Archipelgewässer) einen
Flächenraum von 2,926,210 QM. oder 161,125,673 qkm (nach
Krümmels Berechnung), übertrifft also an Ausdehnung die
Gesamtoberfläche der fünf Kontinente (2,441,642 QM.). Die
älteste Benennung des Stillen Ozeans war Mar del Zur, die
Südsee, weil dieses Meer bei der ersten Entdeckung 1513 von
Vasco Nunez de Balboa im Süden des Isthmus von Darien gesehen
wurde. Die Benennung Südsee ist noch jetzt für das
gesamte inselreiche Meer südlich von Japan und den
Sandwichinseln, namentlich bei den Seeleuten, allgemein in
Gebrauch. Die von Malte-Brun herrührende Bezeichnung als
Großer Ozean hat sich nicht allgemein einzubürgern
vermocht und verschwindet mehr und mehr. Die in allen Sprachen
eingebürgerte Bezeichnung Pacific oder S. O. rührt von
Magelhaens her, welcher nach stürmischer Fahrt drei Monate
lang bei beständigem stillen Wetter dieses Meer durchsegelte,
bis er die Ladronen erreichte. Die Erforschung des Stillen Ozeans
auf wissenschaftlicher Grundlage datiert von Cook und seinen
unmittelbaren Nachfolgern. Krusenstern, Dumont d'Urville, King und
Fitzroy und eine Reihe andrer hervorragender Seeoffiziere setzten
diese Arbeiten in unserm Jahrhundert fort. Die Hydrographie des
Stillen Ozeans ist so weit gefördert, daß Entdeckungen
neuer Inseln als ausgeschlossen gelten dürfen, wenn auch die
genauere Bestimmung und Kartierung der zahlreichen kleinen Inseln
(nahe 700) noch zum größern Teil der Zukunft vorbehalten
bleibt.
Die Tiefenverhältnisse des Stillen Ozeans sind durch eine
Reihe von Forschungen in den beiden letzten Jahrzehnten in
großen Zügen bestimmt worden. Danach befindet sich im
nördlichen Stillen Ozean ein großes Depressionsgebiet
von über 6000 m Tiefe (Tuscaroratiefe), dessen westlicher Teil
die größte bisher gelotete Tiefe aufweist (8513 m; vgl.
die Tabelle im Art. "Meer", S. 411). Der steile Abfall von der
Küste von Japan zu diesen großen Tiefen ist
bemerkenswert. Ein kleines tiefes Gebiet liegt in großer
Nähe des südamerikanischen Kontinents. Dagegen ist der
südliche Stille Ozean, soweit bis jetzt erforscht,
verhältnismäßig arm an großen Tiefen. Die
Tiefenverhältnisse zwischen den einzelnen Inselgruppen
sind
328
Stiller Ozean (Hydrographisches, Verkehrsverhältnisse).
noch wenig bekannt und nach den vereinzelten Lotungen als sehr
ungleichmäßig zu betrachten.
Die für den Stillen Ozean charakteristischen
Erdbebenwellen, welche von Zeit zu Zeit beobachtet worden sind,
lassen einen Schluß zu auf die mittlere Tiefe des
durchlaufenen Meeresgebiets. Die Erdbebenwellen von 1854, 1868 und
1877 sind zu solchen Berechnungen benutzt und haben für die
Richtung Kalifornien-Japan rund 4050 m, für die Richtung
Peru-Neuseeland 2750 m ergeben (Hochstetter 1869, Geinitz 1877 in
"Petermanns Geographischen Mitteilungen"). Bisher sind solche
Beobachtungen nur immer an einer Seite des Ozeans mit
selbstregistrierenden Apparaten angestellt, während die
Zeitangaben für die andre Seite schwankend waren. Die
Ergebnisse sind daher noch ungenau. Auf Grund der verschiedenen
Lotungen und Berechnungen bis zum Jahr 1878 ist die mittlere Tiefe
des Stillen Ozeans von Supan gefunden worden zu 3370 m, von
Krümmel (ohne Rücksicht auf die Wellenrechnung) zu 3912
m. Das Stromsystem an der Oberfläche des Stillen Ozeans zeigt
in seinen Hauptzügen Analogien mit dem des Atlantischen
Ozeans. Auch hier wird ein Äquatorialstrom von den Passaten zu
beiden Seiten des Äquators nach W. getrieben. Die Nordgrenze
dieser Westströmungen setzt Duperrey in 24° nördl.
Br., die Südgrenze in 26° südl. Br. In der Nähe
des Äquators findet sich ein östlich gerichteter
Äqnatorialgegenstrom, in der Regel zwischen 2 und 6°
nördl. Br. angegeben. Diese Strömungen sind bei weitem
nicht so stark und beständig wie die analogen des Atlantischen
Ozeans. Da außerdem ihre Grenzen nach N. und Süden mit
den Jahreszeiten schwanken müssen, so bedarf es einer sehr
großen Zahl von Beobachtungen, um ein zuverlässiges Bild
dieser Verhältnisse zu erlangen. Daran mangelt es so sehr,
daß die Fortführung dieser Strömungen über den
ganzen Ozean auf einer Verbindung von Einzelbeobachtungen und
Wahrscheinlichkeiten beruht, welche noch weiterer Bestätigung
bedürfen. Die weitaus größte Fläche des
Stillen Ozeans ist frei von regelmäßigen
Strömungen, an den Küsten der Kontinente dagegen finden
sich ausgeprägte Stromverhältnisse, welche denen des
Atlantischen Ozeans nahekommen. Namentlich der Kuro Siwo (Schwarzer
oder Japanischer Strom, s. Kuro Siwo), welcher warmes Wasser an der
Ostküste von Japan nach N. führt, ist stets gern mit dem
Golfstrom verglichen worden. Seine Fortsetzung macht sich an der
Westküste Nordamerikas in warmem, feuchtem Klima bemerklich.
Der Labradorströmung der Ostküste von Nordamerika
entspricht das kalte Wasser im Ochotskischen Meer und bis zur
Halbinsel von Korea. Im südlichen Stillen Ozean finden sich
ebenfalls analoge Strömungen wie im südlichen
Atlantischen Ozean. Eine nach Süden setzende australische
Strömung macht sich an der Küste von Neusüdwales
bemerklich. Im Süden von Australien herrscht ein
östlicher Strom vor, welcher den australischen Strom nach
Neuseeland hin ablenkt.
Südlich von 30° südl. Br. herrschen Westwinde und
mit ihnen laufende Ostströme vor, welche nach der
Westküste Südamerikas das Wasser hintreiben. Daraus
resultieren an dieser Küste die an der patagonischen
Küste nach Süden um das Kap Horn setzende Strömung
und nach N. die kalte Peru- oder Humboldt-Strömung, welche
sich bis über die Galapagosinseln hinaus fortsetzt und auf das
Klima der ganzen Küste einen so wohlthätigen
Einfluß ausübt. Die an der Küste von Chile und Peru
bekannten dichten Nebel werden diesem kalten Wasser zugeschrieben.
Doch wird selbst diese Strömung streckenweise durch anhaltende
Nordwinde in ihren obern Schichten zum Stillstand gebracht. Neuere
Forschungen machen es wahrscheinlich, daß das kalte Wasser an
der peruanischen Küste nicht der Strömung direkt
entstammt, sondern aus der Tiefe aufsteigt.
Die Temperaturverteilung an der Oberfläche dieses
ausgedehnten Wasserbeckens ist nur lückenhaft erforscht. Es
knüpft sich jedoch an die Kenntnis derselben das für die
Südsee so wichtige Problem von der Verbreitung der Riffe
bauenden Korallen; man hat daher aus direkten Beobachtungen, aus
den Strömungen und aus der Lage der Koralleninseln
wechselseitig Schlüsse gezogen. Danach ist die
Oberflächentemperatur zwischen 28° nördl. Br. und
28° südl. Br. im allgemeinen nicht niedriger als 20°
C., mit Ausnahme der Gewässer im Bereich der peruanischen
Strömung und der Küste von Kalifornien, während im
O. das warme Wasser noch höhere Breiten (Japan) erreicht. Im
Bereich des Äquatorialgegenstroms ist das Wasser, ebenso wie
im Atlantischen Ozean, am wärmsten. Das Gebiet, in welchem das
Wasser über 20° warm bleibt, bietet die Lebensbedingungen
für die Riffe bauenden Korallen, welche im Stillen Ozean eine
so große Verbreitung aufweisen (vgl. Dana, Corals and
coral-islands) und Inselgruppen von der Ausdehnung der Karolinen u.
der Tuamotus u.a. ganz ausschließlich aufgebaut haben. Eine
charakteristische Eigentümlichkeit des westlichen Stillen
Ozeans sind die tiefen Meeresbecken, welche von der freien
Zirkulation des Tiefenwassers durch unterseeische Bodenerhebungen
abgeschlossen werden (vgl. Tiefentemperatur im Art. "Meer", S. 413
f.). Eine solche Erhebung verbindet in ca. 2600 m Tiefe Japan mit
den Bonininseln, Marianen und Karolinen und umschließt ein
8400 m tiefes Becken. Das Korallenmeer mit Tiefen von 4900 m ist in
2500 m durch eine Bodenerhebung abgesperrt, ebenso sind die Sulusee
(4700 m), Mindorosee (4800 m), Celebessee (5150 m) in Tiefen von
600-1200 m umrandet, wie sich aus ihren warmen Bodentemperaturen
unzweifelhaft ergibt.
Die Windverhältnisse des Stillen Ozeans sind im allgemeinen
denen des Atlantischen Ozeans ähnlich. Zwischen 25°
nördl. Br. und 25° südl. Br. wehen vorherrschend
Nordost- und Südostpassate, welche jedoch hier nur durch einen
schmalen, im mittlern Teil sogar überhaupt nicht durch einen
Stillengürtel voneinander getrennt sind. An der Westküste
von Nordamerika sind nördliche, an der von Südamerika
sehr beständige, aber schwache südliche Winde das ganze
Jahr hindurch vorherrschend. Die Westseite des Stillen Ozeans,
namentlich die oben genannten, durch ihre Tiefentemperaturen
merkwürdigen Meeresteile liegen im Gebiet der Monsune, welche
sie mit dem Indischen Ozean (s. d.) gemeinsam haben. Die
höhern Breiten beider Hemisphären weisen, ähnlich
wie im Atlantischen Ozean, vorherrschend Westwinde auf, welche
namentlich im Süden sehr kräftig und beständig
angetroffen werden.
Verkehrsverhältnisse des Stillen Ozeans.
Der Stille Ozean ist erst sehr spät dem Weltverkehr
eröffnet worden. Seine nordwestliche Küste wurde
allerdings schon in früher Zeit befahren, ohne daß man
aber eine Ahnung davon hatte, daß man sich hier in andern
Gewässern befinde als denen des Atlantischen Ozeans. Auch
Kolumbus meinte, daß letzterer bis nach Japan und China
reiche. Erst dem Vasco Nunez de Balboa verdanken wir die Entdeckung
der Existenz einer zwischen der Westküste Amerikas und Asien
sich hinziehenden Meeresfläche. Als der
329
Stillfried-Rattonitz - Stillleben.
eigentliche Entdecker des Stillen Ozeans muß aber
Magelhaens gelten, welcher ihn in seiner ganzen Ausdehnung von SO.
nach NW. durchquerte. Aber erst 44 Jahre später (1565) gelang
dem Mönch und Seefahrer Urbaneta der oft gemachte, stets
mißglückte Versuch, den Stillen Ozean von W. nach O. zu
durchmessen. Doch bot trotz mancher neuen Unternehmungen noch 250
Jahre nach Magelhaens der Stille Ozean noch immer ein ungeheures
Feld für Entdeckungen; der Ruhm, nicht nur die in ihm
verstreuten Archipele und einzelnen Inseln, auch seine
Tiefenverhältnisse und Riffe näher bekannt gemacht zu
haben, gebührt unbestritten Cook, und wenn auch nach ihm noch
viel gethan wurde, die Hauptarbeit hatte er doch geleistet.
Indessen eine Verkehrsstraße wurde der Stille Ozean erst viel
später. Seine Ränder freilich wurden an den asiatischen
und den australischen Küsten sowie entlang der Westseite
Amerikas mit dem wirtschaftlichen Aufschwung, bez. der
Erschließung derselben für den europäischen Handel
mit jedem Jahr belebter; allein ein Bedürfnis, durch die ganze
weite Fläche des Ozeans einen regelmäßigen Verkehr
hindurchzuleiten, stellte sich erst weit später ein. Dies fand
erst nach dem Aufblühen der australischen Kolonien und nach
der regern Anteilnahme Nordamerikas an dem Handel mit Ostasien
statt. Die Vollendung der Eisenbahn über den Isthmus von
Panama führte zur Errichtung einer Dampferlinie von Panama
nach Sydney als Fortsetzung einer in Aspinwall endigenden
englischen Linie, aber die Pacificbahn von New York nach San
Francisco gab dem Verkehr sofort eine andre Bahn. Die Dampfer
verließen in Zukunft San Francisco, um über Honolulu und
Auckland nach Sydney zu gelangen, und kehrten auf demselben Weg zu
ihrem Ausgangspunkt zurück. Eine Linie von Segelschiffen
stellte regelmäßige Verbindung zwischen San Francisco
und den französischen Markesas und Tahiti her. Eine bessere
Kenntnis der Winde und Meeresströmungen bestimmte viele
Segler, den Weg von Australien nach Europa um die Südspitze
Amerikas zu nehmen. Die zunehmende volkswirtschaftliche Bedeutung
der australischen Kolonien führte Hand in Hand mit einem
schnell wachsenden Handelsverkehr zu einer Vermehrung der zwischen
Europa und dem fünften Weltteil fahrenden Postdampferlinien.
Zu den Linien, welche um die Südküste des
Australkontinents dessen Ostküste erreichen, traten solche,
welche die Torresstraße durchziehen, kamen
Anschlußlinien in Sydney nach Neukaledonien, dem
Fidschiarchipel, der Samoa- und Tongagruppe sowie nach Neuguinea.
Englische, französische und deutsche Dampfer traten hier in
Konkurrenz. Den nördlichen Stillen Ozean durchziehen zwei von
Hongkong über Jokohama gehende Dampferlinien, deren eine in
San Francisco, deren andre in Vancouver endet. Ein
größerer Verkehr mit und zwischen den einzelnen Inseln
wurde erst dann zum Bedürfnis, als man auf denselben oder in
deren Gewässern Waren entdeckte, deren der Welthandel
benötigt, wie Kopra und Kokosnußkerne, Perlen und
Perlmutter, Trepang, Schildkrötenschalen, und als die von
europäischen Unternehmern in Ostaustralien und auf mehreren
Inselgruppen begonnene Plantagenwirtschaft eine Nachfrage nach
Arbeitern erzeugte, die nur durch Herbeiziehung von Bewohnern
gewisser Inselgruppen befriedigt werden konnte. Daß das
Telegraphenkabel hier noch einen wenig bedeutenden Platz einnimmt,
ist bei der ungeheuern Ausdehnung des Stillen Meers
erklärlich. Doch haben bereits seit längerer Zeit
Tasmania und Neuseeland Anschluß an den Australkontinent
gefunden, der wiederum durch Kabel und Landlinien mit der
übrigen Welt in Verbindung steht.
Stillfried-Rattonitz, Rudolf Maria Bernhard, Graf von,
preuß. Geschichtsforscher, geb. 14. Aug. 1804 zu Hirschberg
aus einem alten, ursprünglich böhmischen, jetzt auch in
Schlesien verzweigten Geschlecht, studierte zu Breslau die Rechte,
trat für kurze Zeit in den Staatsverwaltungsdienst und widmete
sich dann historisch-antiquarischen Studien. Er begründete,
von Friedrich Wilhelm IV. an den Hof gezogen und 1840 zum
Zeremonienmeister ernannt, das königliche Hausarchiv und ward
1856 Direktor desselben. Seit 1853 Oberzeremonienmeister und 1856
Wirklicher Geheimer Rat, ward er 1858 in Lissabon zum Granden
erster Klasse mit dem Titel eines Grafen von Alcantara und 1861 zum
preußischen Grafen ernannt. Auch ward er zum Ehrenmitglied
der Akademie der Wissenschaften gewählt. Er starb 9. Aug.
1882. S. machte sich unter anderm durch folgende Arbeiten bekannt:
"Altertümer und Kunstdenkmale des Hauses Hohenzollern" (Berl.
1838-67, 2 Foliobände), "Geschichte der Burggrafen von
Nürnberg" (Görl. 1843), "Monumenta Zollerana" (Berl.
1843-62, 7 Bde.), "Der Schwanenorden" (Halle 1845), "Beiträge
zur Geschichte des schlesischen Adels" (Berl. 1860-64, 2 Hefte),
"Stammtafel des Gesamthauses Hohenzollern" (das. 1869; neue Ausg.
1879, 6 Blatt), "Hohenzollern. Beschreibung u. Geschichte der Burg"
(Nürnb. 1871), "Friedrich Wilhelm III. und seine Söhne"
(Berl. 1874), "Die Attribute des neuen Deutschen Reichs" (3. Aufl.,
das. 1882), "Die Titel und Wappen des preußischen
Königshauses" (das. 1875), "Kloster Heilsbronn" (das. 1877)
und gab mit Kugler das Prachtwerk "Die Hohenzollern und das
deutsche Vaterland" (3. Aufl., Münch. 1884, 2 Bde.) sowie mit
Hänle "Das Buch vom Schwanenorden" (das. 1881) heraus. Auch
leitete er den Bau der Burg Hohenzollern und die Wiederherstellung
der Klosterkirche zu Heilsbronn.
Stillgericht, s. Femgerichte.
Stilling, Schriftsteller, s. Jung 2).
Stillingia L. (Talgbaum), Gattung aus der Familie der
Euphorbiaceen, meist Sträucher mit wechselständigen,
ganzen Blättern, endständigen Blütenähren und
dreisamigen Kapseln. S. sebifera Michx. (Exoecaria sebifera J.
Müll., s. Tafel "Öle und Fette liefernde Pflanzen"), ein
kleiner Baum mit langgestielten, breit rhombisch-eiförmigen,
ganzrandigen Blättern und großer, kugelig-elliptischer
Kapsel, besitzt haselnußgroße, schwarze Samen, welche
mit talgartigem Fett umgeben sind. Er ist in China und Japan
heimisch, wird dort sowie in Ost- und Westindien, Nordamerika,
Algerien und Südfrankreich kultiviert und liefert den
chinesischen Talg. Durch Pressen der von der Fetthülle
befreiten Samen erhält man fettes Öl. S. silvatica J.
Müll., ein Strauch mit fast sitzenden und linealischen bis
elliptisch lanzettlichen Blättern, im südlichen
Nordamerika, liefert eine purgierend wirkende Wurzel.
Stillkoller, s. Dummkoller.
Stillleben (holländ. Stilleven, engl. Still-life,
franz. Nature morte, ital. Riposo), ein Zweig der Malerei, welcher
die Darstellung lebloser Gegenstände, wie toter Tiere (Wild,
Geflügel und Fische), Haus-, Küchen- und
Tischgeräte, Früchte, Blumen, Kostbarkeiten,
Raritäten etc., zum Gegenstand hat und besonders durch ein
geschicktes Arrangement, durch koloristische Reize und feine
Beleuchtung zu wirken sucht. Schon im Altertum entwickelte sich das
S. seit
330
Stillwater - Stimme.
der alexandrinischen Zeit zu größter Blüte,
wofür die pompejanischen Wandbilder noch zahlreiche Beispiele
liefern. Die Malerei der Renaissance behandelte das S. nicht als
eine selbständige Gattung der Malerei. Seit dem Anfang des 17.
Jahrh. wurde es jedoch von den niederländischen Malern in
großem Umfang kultiviert und zur höchsten
Virtuosität entwickelt, wobei man zwei Richtungen zu
unterscheiden hat, deren eine nach glänzender koloristischer
Wirkung bei einer mehr aufs Ganze gerichteten dekorativen
Behandlung strebte, während die andre mehr auf peinliche,
miniaturartige Wiedergabe der Einzelheiten sah. Die Hauptvertreter
der niederländischen Stilllebenmalerei sind: J. Brueghel der
ältere, Snyders, Seghers, die Familie de Heem, A. van
Beijeren, W. Kalf, Heda, W. van Aelst, Dou, Fyt, Weenix, R. Ruysch,
van Huysum u. a. m. Im 19. Jahrh. ist das S. wieder sehr in
Aufnahme gekommen, in Frankreich besonders durch Robie, Vollon und
Ph. Rousseau, in Deutschland durch Preyer (Düsseldorf), die
Berliner Hoguet, P. Meyerheim, Hertel, Th. und R. Grönland,
Heimerdinger (Hamburg), namentlich aber durch die Malerinnen
Begas-Parmentier, H. v. Preuschen, Hormuth-Kallmorgan, Hedinger u.
a. Vgl. Blumen- und Früchtemalerei.
Stillwater, Stadt im nordamerikan. Staat Minnesota, 25 km
nordöstlich von St. Paul, am schiffbaren St. Croix, hat ein
Staatsgefängnis, bedeutenden Holzhandel und (1885) 16,437
Einw.
Stilo (ital.), Stil; S. osservato, der "hergebrachte",
strenge Stil, besonders der reine Vokalstil, a cappella-Stil,
Palestrinastil; S. rappresentativo, der für die szenische
Darstellung geeignete, dramatische Stil, die um 1600 zu Florenz
erfundene begleitete Monodie (s. Oper, S. 398).
Stilo, Stadt in der ital. Provinz Reggio di Calabria,
Kreis Gerace, am Stillaro, hat ein merkwürdiges altes
Kirchlein, Seidenzucht, Weinbau und (1881) 2655 Einw. Das
südöstlich davon gelegene Kap S. schließt
südlich den Golf von Squillace.
Stilpnosiderit (Eisenpecherz, Pecheisenstein), Mineral
aus der Ordnung der Hydroxyde, tritt gewöhnlich gleichzeitig
mit Brauneisenstein in nierenförmigen oder stalaktitischen,
amorphen, pechschwarzen oder schwärzlichbraunen Massen mit
starkem Fettglanz auf; Härte 4,5-5, spez. Gew. 3,6-3,8. S.
enthält Eisenoxyd und Wasser und nähert sich bald dem
Brauneisenerz (14 Proz. Wasser), bald dem Goethit (10 Proz.
Wasser); er findet sich bei Siegen, Sayn, Amberg, in Böhmen
und Mähren und wird mit Brauneisenstein verhüttet.
Stilpon, griech. Philosoph, aus Megara, blühte um
300 v. Chr. und erhob, durch Ernst und Reinheit seiner Ethik, in
welcher er ein Vorläufer der Stoiker war, sowie durch
Schärfe seiner Dialektik ausgezeichnet, die megarische Schule
zu großem Ansehen. Von seinen Schriften hat sich nichts
erhalten.
Stilton, Dorf in Huntingdonshire (England), mit (1881)
645 Einw., hat seinen Namen einer berühmten Sorte Käse
gegeben, der hier zuerst verkauft wurde, indes meist aus
Leicestershire kommt.
Stimmbänder, s. Kehlkopf.
Stimmbildung. Die verschiedenen, bei der Ausbildung der
Singstimmen (s. Stimme, S. 321) in Betracht zu ziehenden Momente
sind: 1) Bildung des richtigen Ansatzes (s. d.) der für den
Gesang geeigneten Resonanz der Vokale; 2) Schulung des Atemholens
und Atemausgebens (mittels des messa di voce), also Kräftigung
der Respirationsorgane, welche die erste Vorbedingung einer
Kräftigung der Stimme ist; 3) Übung im Festhalten der
Tonhöhe (zugleich eine Übung der beteiligten Muskeln und
Bänder und des Gehörs, ebenfalls mittels des Messa di
voce); 4) Ausgleichung der Klangfarbe der Töne (wobei zu
beachten ist, daß manchmal ein einzelner Ton schlecht
anspricht); 5) Erweiterung des Stimmumfanges (durch Übung der
Töne, welche dem Sänger bequem zu Gebote stehen); 6)
Übung der Biegsamkeit der Stimme (zunächst langsame
Tonverbindung in engen und weiten Intervallen, später
Läuferübungen, Triller, Mordente etc.); 7) Ausbildung des
Gehörs (systematische Treffübungen, Musikdiktat); 8)
Übungen in der richtigen Aussprache (am besten durch
Liederstudium) ; 9) Übungen im Vortrag (durch geschickte
Auswahl von Werken verschiedenartigen Charakters für das
Studium). Vgl. Gesang.
Stimmbruch, s. Mutation.
Stimme (Vox), im physiologischen Sinn der Inbegriff der
Töne, welche im tierischen Organismus beim Durchgang des Atems
durch den Kehlkopf willkürlich erzeugt werden. Das menschliche
Stimmorgan zerfällt in das Windrohr, das Zungenwerk und in das
Ansatzrohr. Der Kehlkopf ist ein Zungenwerk mit membranösen
Zungen (den Stimmbändern). Als Windrohr dienen die
Luftröhre und deren Verästelungen, als Zungen die beiden
untern Stimmbänder, und das Ansatzrohr wird gebildet von den
obern Teilen des Kehlkopfes (den Morgagnischen Taschen und den
sogen. obern Stimmbändern) sowie von der Schlund-, Mund- und
Nasenhöhle. Der Vorgang bei der Stimmbildung, welche auf
regelmäßigen periodischen Explosionen der durch die enge
Stimmritze tretenden Luft beruht, ist nun folgender: Die
Luftröhre leitet die unter einem gewissen Druck stehende
Ausatmungsluft gegen die mehr oder weniger gespannten und also
schwingungsfähigen Stimmbänder, die jedoch für sich
keine oder nur ganz schwache Töne geben. Die beiden untern
Stimmbänder treten von den Seiten her einander entgegen und
verwandeln die zwischen ihnen liegende Stimmritze in eine feine
Spalte, welche dem Luftaustritt ein gewisses Hindernis
entgegensetzt. Dadurch wird eine zu schnelle Entleerung des in den
Lungen vorhandenen Luftvorrats verhindert, und es wird
möglich, einmal den Ton längere Zeit hindurch auszuhalten
und das andre Mal die Luft des Windrohrs durch den Druck der
Ausatmungsmuskeln in eine bestimmte Spannung zu versetzen. Der
Luftstoß drängt die Stimmbänder in die Höhe
und etwas auseinander; sofort aber schwingen die Bänder
zurück, und die Stimmritze wird dadurch wieder verengert.
Dieses Schwingen der Stimmbänder mit abwechselnder minimaler
Verengerung und Erweiterung der Stimmritze wiederholt sich oft und
in rhythmischer Weise, d. h. die Schwingungen sind
regelmäßige. Dadurch wird auch die Luft des Ansatzrohrs
in regelmäßige, stehende, also tönende Schwingungen
versetzt. Zur Hervorbringung selbst der schwächsten Töne
ist eine gewisse Stärke des Anblasens nötig, d. h. es
muß die Luft im Windrohr eine gewisse Spannung haben, welche
wir ihr durch Zusammendrücken des Brustkorbes, d. h. durch die
Ausatmung, geben. Bei großer Kraftlosigkeit der
Atmungsmuskeln und bei einer Öffnung in der Luftröhre
(Wunde) geht daher die S. verloren. Übrigens dienen die
Wandungen der Luftröhre und der Bronchien sowie die in ihnen
eingeschlossenen Luftmassen als Resonanzapparate, denn sie
verstärken durch ihr Mitschwingen die Töne. Menschen mit
entwickeltem Brustkorb haben darum eine kräftige S.; der
Brustkorb selbst wird durch die
331
Stimme (des Menschen).
S. in Schwingungen versetzt, welche die auf den Brustkorb
aufgelegte Hand wahrzunehmen vermag (Stimmvibration des Thorax).
Selbst beim heftigsten und schnellsten Ausatmen entstehen keine
Töne, welche der S. irgendwie vergleichbar wären, sondern
nur blasende oder keuchende Geräusche infolge der Reibung der
Luft im Kehlkopf und an andern Stellen der Luftwege. Tonbildung ist
immer nur möglich, wenn der Luftstrom regelmäßig
unterbrochen wird durch die gespannten Stimmbänder. Aus diesem
Grund muß eine feine Stimmritze vorhanden sein, wenn es zur
Tonbildung kommen soll, denn die weite Stimmritze gibt kein
hinreichendes Hemmnis für den Luftstrom ab. Diese Stimmritze
wird ausschließlich durch die untern Stimmbänder
gebildet, denn wenn man am toten Kehlkopf die untern
Stimmbänder abträgt, so bekommt man mittels der obern
Stimmbänder allein keine Töne mehr. Bei höhern
Tönen näherten sich zwar auch die obern Bänder
einander, doch nie in dem Grade, daß dadurch ein zur
Tonbildung hinreichendes Lufthindernis gebildet wurde. Entfernt man
aber am toten Kehlkopf die obern Bänder, so erlangt man durch
die untern Bänder immer noch mit Leichtigkeit Töne, nur
von etwas anderm Klang als bei unversehrtem Kehlkopf. Ebensowenig
wird durch Verstümmelung der obern Bänder die
Tonhöhe verändert. Die untern Bänder sind demnach
unentbehrlich zur Tonerzeugung, und sie allein verdienen daher den
Namen der Stimmbänder. Die Bildung der engen Stimmritze wird
dadurch bewirkt, daß die Gießkannenknorpel aneinander
rücken und somit den freien Rand der Stimmbänder einander
nähern. Mit zunehmender Tonhöhe wird die Stimmritze enger
und kürzer. Ganz unentbehrlich für die Stimmbildung ist
die gehörige Spannung und Elastizität der
Stimmbänder. Ist der Schleimüberzug derselben
entzündlich geschwollen, mit zähem und dickem Schleim
belegt, oder sind die Stimmbänder durch andre krankhafte
Prozesse, Neubildungen etc., verdickt, so sind sie unfähig, in
gehöriger Weise zu schwingen. Die Tongebung ist dann mehr oder
weniger gehindert, die Töne werden rauh, unangenehmer und
tiefer; in höherm Grade tritt völlige Stimmlosigkeit ein.
Außerdem ist zum Hervorbringen eines Tons von bestimmter
Höhe erforderlich, daß Länge und Spannung der
Stimmbänder unverändert bleiben. Die Bildung und
Öffnung der Stimmritze ist an die Ortsbewegungen gebunden,
welche die beiden Gießkannenknorpel ausführen. Durch das
Auseinanderrücken letzterer wird die Stimmritze gebildet
(geschlossen), durch die Rückwärtsbewegung derselben
werden die Stimmbänder gespannt und umgekehrt. Die
Tonhöhe ist abhängig von der Länge und der Spannung
der Stimmbänder. Die Länge der Stimmbänder ist von
großem Einfluß auf die Stimmlage in der Art, daß
mit langen Stimmbändern (beim Mann) eine tiefe, mit kurzen
Stimmbändern (beim Kind und Weib) eine hohe Stimmlage
verbunden ist. Für jedes einzelne Stimmorgan ist die Spannung
der Bänder das Hauptveränderungsmittel der Tonhöhe:
je größer die Spannung, um so höher der betreffende
Ton. Die Spannung der Stimmbänder erfolgt durch Muskelwirkung
, wobei ihr hinterer Insertionspunkt sich von dem vordern entfernt.
Für alle die Formveränderungen, welche mit der Stimmritze
bei der Tonbildung vor sich gehen, sind besondere Muskeln am
Kehlkopf angebracht. Die Tonhöhe steigt jedoch nicht
bloß mit zunehmender Spannung der Stimmbänder, sondern
auch mit zunehmender Stärke des Luftstroms, welcher durch die
Stimmritze geht. Eine und dieselbe Tonhöhe ist also erreichbar
entweder durch stärkere Bänderspannung bei zugleich
ruhigem Ausatmungsstrom oder mittels schwächerer Spannung der
Bänder bei stärkerm Luftstrom. Im erstern Fall hat der
Ton einen angenehmern Klang, aber beide Faktoren sind wichtige
Kompensationsmittel der Tonhöhe. Auch erklärt sich
hieraus, daß die höchsten Töne niemals schwach, die
niedrigsten niemals sehr stark gegeben werden können. Obschon
während des Ausatmens mit Abnahme des Luftvorrats auch die
Kraft des Anblasens abnimmt, so kann der Ton trotzdem auf gleicher
Höhe erhalten werden durch zunehmende Spannung der
Stimmbänder. Das Ansatzrohr der musikalischen Zungenwerke wird
am menschlichen Stimmorgan mit mannigfachen, der S. zu gute
kommenden Modifikationen durch diejenigen Abschnitte der Luftwege
vertreten, welche oberhalb der untern Stimmbänder liegen, also
durch die Rachen-, Mund- und Nasenhöhle. Dieses Ansatzrohr
verändert zwar nicht wesentlich die Tonhöhe, wohl aber
den Klang und besonders die Stärke des Tons. Zuhalten der
Nase, Schließen oder Öffnen des Mundes z. B.
verändern in der That niemals die Höhe, wohl aber den
Klang und die Stärke der Töne. Ein Verschluß der
Nase ändert, wenn der Ausatmungsstrom schwach und der Mund
weit geöffnet ist, den Klang der Töne
verhältnismäßig nur wenig; bei starkem Luftstrom
aber wird der Klang näselnd, indem die Wände der
Nasenhöhle die Schallwellen nicht bloß reflektieren,
sondern auch selbst in stärkere, den Klang modifizierende
Schwingungen geraten. Zunehmende Räumlichkeit der Mund- und
Nasenhöhle begünstigt, umfängliche
Verknöcherung der Kehlkopfknorpel vermindert die
Tonstärke.
Nach dem Umfang der menschlichen S. unterscheidet man den Sopran
oder die höhere Frauenstimme, den Alt oder die tiefere
Frauenstimme, den Tenor oder die hohe Männerstimme und den
Baß oder die tiefe Männerstimme. Der Sopran liegt
ungefähr eine Oktave höher als der Tenor, der Alt um
ebensoviel höher als der Baß. Zwischen dem tiefsten
Baß- und höchsten Sopranton liegen etwas über 3 1/2
Oktaven. Rechnet man die Stimmen von seltener Tiefe und Höhe
dazu, so beträgt der ganze Umfang der Menschenstimme sogar 5
Oktaven; ihr tiefster Ton hat 80, ihr höchster 1024
Schwingungen in der Sekunde. Eine gute Einzelstimme umfaßt 2
Oktaven (und etwas darüber) musikalisch verwendbarer
Töne. Stimmen von größerm Umfang sind nicht so
selten, ja selbst ein Gebiet von 3 1/2 Oktaven wurde schon
beobachtet. Der Baß erreicht ausnahmsweise f1, Kinderstimmen
und der Frauensopran manchmal f3, ja selbst a3. Nur wenige
Töne, nämlich von c1-f1, sind allen Stimmlagen gemein.
Die Menschenstimme zeigt unendlich viele individuelle
Modifikationen oder Klangarten. Hierfür sind außer der
Regelmäßigkeit, d. h. der gleichen Dauer, der
Schwingungen der Stimmbänder, wodurch die Reinheit der S.
vorzugsweise bedingt wird, namentlich die Teile des Ansatzrohrs,
deren Form, Größe, Elastizität etc.
maßgebend. Abgesehen von den individuellen Klangarten,
unterscheidet man zwei Hauptregister von Tönen: Brusttöne
und Falsetttöne. Der Klang der erstern ist voll und stark, die
auf die Brust gelegte Hand fühlt deutliche Vibrationen; die
Falsett- oder Fisteltöne (s. Falsett) dagegen sind weicher.
Weiteres s. unter Stimmbildung.
Vgl. v. Kempelen, Der Mechanismus der menschlichen Sprache nebst
der Beschreibung einer sprechenden Maschine (Wien 1791); Joh.
Müller, über die
332
Stimmer - Stimmführung.
Kompensation der physischen Kräfte am menschlichen
Stimmorgan (Berl. 1839); Liskovius, Physiologie der menschlichen S.
(Leipz. 1846); Merkel, Anthropophonik (das. 1857); Derselbe, Die
Funktionen des menschlichen Schlund- und Kehlkopfes (das. 1862);
Roßbach, Physiologie der menschlichen S. (Würzb. 1869);
Luschka, Der Kehlkopf des Menschen (Tübingen 1871);
Fournié, Physiologie des sons de la voix et de la parole
(Par. 1877); Helmholtz, Lehre von den Tonempfindungen (4. Aufl.,
Braunschw. 1876); Grützner, Physiologie der S. und Sprache (in
Hermanns "Handbuch der Physiologie", Bd. 1, Tl. 2, Leipz. 1879);
Mandl, Die Gesundheitslehre der S. in Sprache und Gesang
(Braunschw. 1876).
Die Stimmen der Tiere.
Mit Ausnahme der walfischartigen Tiere und des Stachelschweins,
die weder Stimmbänder noch Morgagnische Taschen besitzen,
treffen wir bei sämtlichen Säugetieren stimmbildende
Apparate an, die dem beschriebenen des Menschen ganz ähnlich
sind. Oftmals finden sich große resonatorische Nebenapparate
vor, welche die S. zu verstärken und in ihrer Klangfarbe zu
beeinflussen berufen sind. Je umfangreicher der Kehlkopf und die
Stimmbänder, desto lauter ist die S. Die S. der meisten Tiere
ist nicht sehr umfangreich; bei den meisten Wiederkäuern
bewegt sie sich nur innerhalb ein bis zwei Tonstufen. Oftmals
bringen Tiere Töne hervor, die in ihrer Höhe sehr weit
auseinander liegen, ohne daß sie zur Erzeugung der
zwischenliegenden Töne befähigt wären. Bei einigen
Tieren dient nicht allein der Ausatmungs-, sondern auch der
Einatmungsluftstrom der Stimmbildung; in diesen Fällen ist
meistens der Kehlkopf mit besondern Apparaten ausgestattet, z. B.
beim Esel. Bei der Erzeugung hoher Töne bedienen sich die
Tiere oftmals der Fistelstimme, z. B. der Hund, wenn er sich nach
etwas sehnt, oder wenn er Schmerzen empfindet. Die S. der
Vögel, namentlich der Männchen, ist ungemein entwickelt.
Obenan stehen hier die Singvögel und die Papageien. Mit
Ausnahme einiger straußartiger Vögel und Geier haben
sämtliche Vögel einen doppelten Kehlkopf. Der eine davon
entspricht vollständig dem Kehlkopf der Säugetiere, hat
aber mit der eigentlichen Stimmbildung gar nichts zu thun und
besitzt keine knorpelige, sondern eine knöcherne Grundlage.
Der andre liegt im Brustraum an der Vereinigungsstelle der
Luftröhrenzweige und stellt den eigentlichen stimmbildenden
Apparat dar. Derselbe ist entweder einfach oder doppelt vorhanden
und liegt im erstern Fall entweder im Anfangsteil der
Luftröhre oder an der Übergangsstelle in die Bronchien;
im andern Fall befindet sich in jedem der beiden Bronchien ein
Stimmapparat. Schon Cuvier und Johannes Müller konnten
experimentell nachweisen, daß die S. der Vögel in dem
untern Kehlkopf gebildet wird; letzterm gelang es auch, durch
Anblasen des ausgeschnittenen untern Kehlkopfes der S.
ähnliche Töne zu erzeugen. Die Stimmbildung beruht bei
den Vögeln im wesentlichen auf demselben Prinzip wie beiden
Säugetieren, da wir es auch hier mit membranösen
Zungenpfeifen zu thun haben. Die S. der Amphibien ist nur von
untergeordnetem Interesse. Die Krokodile haben eine durchdringende
und schreiende S., die allerdings in der Gefangenschaft kaum
beobachtet wird. Bei den Lurchen, besonders bei den
ungeschwänzten, findet man neben den stimmbildenden Apparaten
vielfach noch resonatorische Einrichtungen, die wesentlich zur
Verstärkung der S. dienen (z. B. die Luftsäcke der Kehle
bei den Fröschen). Sind auch die meisten Fische stumm, so
wußte doch schon Aristoteles, daß manche Fische
brummende, singende Töne zu erzeugen im stande sind.
Allerdings kann man hier von einer S. nur dann sprechen, wenn man
unter letzterer die Fähigkeit eines Tiers versteht, Töne
als Mittel zur gegenseitigen Verständigung zu benutzen. Auch
nur im letztern Sinn können wir von einer S. der Insekten
sprechen; hierbei kommen die durch den Flügelschlag erzeugten
Töne kaum in Rechnung. über die Einrichtung der
Stimmapparate s. Insekten, S. 978.
Stimmer, Tobias, Maler und Zeichner für den
Holzschnitt, geb. 1539 zu Schaffhausen, war dort, in
Straßburg und Frankfurt a. M. als Fassaden- und
Porträtmaler thätig und hat besonders eine große
Anzahl von Zeichnungen für den Holzschnitt (biblische
Darstellungen, Allegorien, Embleme, Genrebilder etc.) gefertigt,
welche von dem Buchdrucker S. Feierabend in Frankfurt a. M.
herausgegeben wurden. Er starb 1582 in Straßburg. S.
schloß sich an H. Holbein den jüngern an, verfiel aber
zuletzt in leere Manier. Von seinen Fassadenmalereien hat sich die
des Hauses zum Ritter in Schaffhausen erhalten. Bildnisse von ihm
befinden sich im Museum zu Basel.
Stimmfehler (Vitia vocis), organische oder funktionelle
Affektionen des Kehlkopfes und des oberhalb desselben gelegenen
Teils des Respirationsorgans, bei welchen entweder die Erzeugung
der tongebenden Schwingungen der Stimmbänder mehr oder weniger
aufgehoben, oder die willkürliche Modifizierung derselben
unmöglich gemacht worden, oder die Klangfarbe der im Kehlkopf
erzeugten Töne eine abnorme geworden ist. Die wichtigsten S.
sind Heiserkeit und Aphonie. Häufig, namentlich beim
Stimmwechsel und männlichen Geschlecht, ist auch das
Überschnappen der Stimme (Hyperphonie), wobei die Töne
der Stimme leicht aus dem Brustregister in das Falsettregister
umschlagen.
Stimmführung nennt man den musikalischen Satz in Bezug
auf die Behandlung der einzelnen denselben hervorbringenden
Stimmen. Das Wichtigste der Lehre von der S. läßt sich
in wenige Worte zusammenfassen. Die Seele der S. ist die
Sekundfortschreitung. Der Satz erscheint um so glatter,
vollkommener, je mehr die Akkordfolgen durch Sekundschritte der
einzelnen Stimmen bewerkstelligt werden. Selbst harmonisch sehr
schwer verständliche Folgen geben sich mit einer gewissen
Ungezwungenheit, wenn alle oder die meisten Stimmen Sekundschritte
machen, seien diese Ganztonschritte, Leitton- oder chromatische
Halbtonschritte (s. Beispiel). Ein vorzügliches Bindemittel
einander folgender Akkorde ist ferner das Liegenbleiben gemeinsamer
Töne. Eine Ausnahme macht die Führung der
Baßstimme, welche gern von Grundton zu Grundton der Harmonien
fortschreitet und wesentlich der Förderung des harmonischen
Verständnisses dient; auch von Hauptton zu Terzton und von
Terzton zu Terzton oder Hauptton geht der Baß gern, dagegen
ist der Sprung der Baßstimme zum Quintton mit Vorsicht zu
behandeln (s. Quartsextakkord und Konsonanz). Überhaupt aber
ist die Sekundbewegung zwar erstrebenswert, jedoch keineswegs immer
erreichbar, und gerade die Stimme, welche zumeist frei und zuerst
erfunden wird, die eigentliche Melodiestimme (in der neuern Musik
gewöhnlich die Oberstimme), unterbricht die Sekundbewegung
gern durch größere, sogen. harmonische Schritte. Da
solche Schritte, wie bereits bemerkt, den Effekt der
Mehrstimmigkeit durch Brechung machen, so sind sie
333
Stimmgabel - Stimmung.
eine Bereicherung des Satzes; es blüht sozusagen eine
zweite Stimme aus der einen heraus (im Orchester- und Klaviersatz
geschieht das oft genug wirklich). Von solchem Gesichtspunkt aus
erscheint das Abweichen von der Sekundbewegung auch für die
Mittelstimmen oft als ein Vorzug, indem dieselben sich dadurch
selbständiger herausheben. Gewisse Stimmschritte, die
harmonisch schwer verständlich und darum schwer rein zu
treffen sind, vermeidet der Vokalsatz gern (der "strenge" Stil
vermeidet sie ganz), nämlich die übermäßigen
Schritte (Tritonus, übermäßiger Sekundschritt etc.)
und den verminderten Terzschritt (cis-es). Die in allen
Lehrbüchern der Harmonie zu findenden Regeln, daß der
Leitton einen kleinen Sekundschritt nach oben mache und die Septime
nach unten fortschreiten müsse, sind nur bedingungsweise
richtig. Wo der Leitton in Dominantenakkord auftritt und dieser
schließend sich zur Tonika fortbewegt, wird natürlich
der Leittonschritt gemacht werden, weil überhaupt
Halbtonfortschreitungen überall zu machen sind, wo sich
Gelegenheit bietet und dadurch nicht gegen eine andre Satzregel
verstoßen wird; deshalb wird auch die Septime in den
Fällen gern nach unten fortschreiten, wo sie einen fallenden
Leittonschritt ausführen kann, z. B. wo sich der
Dominantseptimenakkord in die Durtonika auflöst (s. das
Beispiel). In diesem Fall ist sowohl der steigende Leittonschritt
h'-c'' als der fallende f'-e' obligatorisch und wird nur in
Ausnahmefällen von einem von beiden abzusehen sein. Dagegen
ist kein Grund abzusehen, warum in Akkorden wie h:d:f:a oder
c:e:g:h die Septime sich abwärts bewegen sollte, wenn nicht
Gefahr der Quintenparallelen od. dgl. dazu zwingt. Es wird immer
darauf ankommen, was für eine Harmonie folgt; enthält
dieselbe die Oktave des Grundtons, so wird die Septime häufig
steigen. Die Regel der abwärts zu führenden Septime wie
des aufwärts zu führenden Leittons ist also nichts andres
als ein praktischer Fingerzeig, weil bei den gewöhnlichsten
Akkordfolgen sich diese S. als eine bequeme ergibt. Dagegen sind
von höchster Bedeutung für die S. die negativen Gesetze:
das Quintenverbot und Oktavenverbot (s. Parallelen), da falsche
Parallelen dem Grundprinzip des mehrstimmigen Satzes, eine
Vereinigung mehrerer sich selbständig und wohl unterscheidbar
bewegender Stimmen zu sein, widersprechen.
Stimmgabel, ein nach Gerber im 18. Jahrh. von dem
englischen Musiker John Shore erfundenes, aus Stahl gabelartig
zweizinkig gearbeitetes, unten mit einem Stiel von gleicher Masse
versehenes Instrument, das, wenn seine beiden Zinken durch
Anschlagen in Vibration gesetzt werden, einen sanften, einfachen
Ton von bestimmter Tonhöhe gibt. Die S. ist in den meisten
Fällen auf das eingestrichene a (Kammerton) gestimmt und dient
zur Bewahrung einer absolut gleichen Tonhöhe. S. Schall, S.
392.
Stimmrecht, allgemeines, s. Allgemeines S.
Stimmritze, s. Kehlkopf.
Stimmritzenkrampf (Laryngospasmus infantilis, Asthma
laryngeum, Laryngismus stridulus), krampfhafte Zusammenziehung
derjenigen Muskeln, welche die Stimmritze verschließen,
beruht auf einem krampfhaften Erregungszustand der Nerven, welche
jene Muskeln innervieren. In manchen Fällen scheint die Anlage
zum S. angeboren zu sein, da in einzelnen Familien fast alle Kinder
daran erkranken. Der S. tritt in Anfällen auf, zwischen
welchen freie Pausen liegen. Der Anfall ist charakterisiert durch
eine plötzliche gewaltsame Unterbrechung des Atmens, welche
mehrere Minuten lang andauern kann, wenn die Stimmritze nicht
gänzlich verschlossen, sondern nur stark verengert ist. Das
Atmen ist dabei mit einem pfeifenden langgezogenen Geräusch
verbunden. Das Kind ist voll der höchsten Angst und Unruhe,
wird blau im Gesicht und macht angestrengte Bewegungen, um zu
atmen. Husten, Heiserkeit und Fieber fehlen dabei. Ist der Krampf
vorüber, und hat das Kind seine Angst vergessen, so ist wieder
vollständiges Wohlbefinden da. Manchmal sind krampfhafte
Bewegungen der Finger und Zehen, der Arme und Beine mit den
Anfällen von S. verbunden oder wechseln mit ihnen ab. Die
Anfälle treten in verschiedenen Zeiträumen auf; oft
wiederholen sie sich erst nach acht und mehr Tagen, in schlimmen
Fällen folgen sie schneller aufeinander. Immer bleibt
große Neigung zu Rückfällen zurück, welche man
selbst dann noch zu fürchten hat, wenn das Kind monatelang
frei geblieben ist. In seltenen Fällen trat der S. nur in
Einem Anfall auf und kehrte nie wieder. Der Krankheitsanfall geht
meist binnen wenigen Sekunden oder Minuten vorüber, endet aber
auch manchmal mit dem plötzlichen Tode der Kinder durch
Erstickung. Sobald sich ein Anfall einstellt, soll man das Kind
aufrichten, ihm Wasser in das Gesicht spritzen, kühle Luft
zufächeln, den Rücken reiben und ein Klystier von
Kamillen-oder Baldrianthee setzen. Auch ist es gut, einen Senfteig
vorrätig zu halten, um denselben, sobald der Anfall eintritt,
in die Magengrube zu legen. In der freien Zwischenzeit muß
man alle Unregelmäßigkeiten in der Verdauung beseitigen,
den Stuhlgang regulieren und für eine möglichst
zweckmäßige Ernährung des Kindes sorgen.
Stimmung, in der Musik s. v. w. Feststellung der
Tonhöhe und zwar 1) Feststellung der absoluten Tonhöhe,
d.h. der Schwingungszahl eines Tons, nachdem die übrigen
gestimmt werden. In ältern Zeiten hatte man verschiedene
Stimmungen für verschiedene Instrumente: die einen waren in
den Chorton (s. d.), die andern in den Kammerton (s. d.) gestimmt;
in der neuern Zeit bediente man sich allgemein des Kammertons (vgl.
A). Indessen war nicht nur die Tonhöhe des letztern an
verschiedenen Orten eine verschiedene, so daß man von einer
Pariser, Wiener, Berliner, Petersburger S. etc. spricht, sondern es
hat sich außerdem in den letzten anderthalb Jahrhunderten ein
stetiges Hinauftreiben der S. herausgestellt. Zu Lullys Zeiten
(1633-87) war dieselbe fast anderthalb Töne tiefer als jetzt;
seit Händel und Gluck ist sie um einen ganzen Ton gestiegen,
seit Mozart um einen halben. Nach der Pariser S. von 1788 zeigte
das eingestrichene a 409 (Doppel-) Schwingungen in der Sekunde,
nach der ältern Mozart-Stimmung etwas über 421, nach der
Pariser S. von 1835: 449, nach der Wiener und Berliner S. von etwa
1850: 442. Um diesem fortdauernden Schwanken des Kammertons Einhalt
zu thun und die Einführung einer allgemein gültigen S.
anzubahnen, nahm man in Deutschland in Übereinstimmung mit der
Deutschen Naturforschergesellschaft (1834) Scheiblers Bestimmung
als für den Kammerton maßgebend an, nach welcher dem
eingestrichenen a in der Sekunde 440 Schwingungen zukommen,
während man 1858 zu Paris auf Anlaß Napoleons III. durch
eine Kommission von Sachverständigen einen neuen Kammerton
(diapason normal) feststellte, welcher zunächst für
Frankreich die normale Tonhöhe auf 870 einfache (= 435
Doppel-) Schwingungen bestimmte. Dieselbe kam bald auch auf
mehreren deutschen Bühnen (z. B. der Wiener, Dresdener und
Ber-
334
Stimmungsbild - Stinktier.
liner) zur Geltung und wurde auf der 16.-19. Nov. 1885 in Wien
tagenden internationalen Konferenz zur Feststellung eines
einheitlichen Stimmtons endlich einstimmig angenommen. - 2)
Theoretische Bestimmung der relativen Tonhöhen, der
Verhältnisse (Intervalle) der Töne untereinander, welche
wieder auf zweierlei Weise möglich ist: a) abstrakt
theoretisch als mathematisch-physikalische Tonbestimmung (s. d.),
und b) für die Praxis berechnet, welche statt der zahllosen
theoretisch definierten Tonwerte nur wenige substituieren
muß, wenn sie einen sichern Anhalt für die Intonation
gewinnen will, als Temperatur (s. d.). - 3) Die praktische
Ausführung der Temperatur, welche jetzt für Orgel wie
Klavier allgemein die gleichschwebende zwölfstufige ist. Exakt
durchführbar ist dieselbe nicht, doch erreicht die Routine
befriedigende Resultate. Was mit der Undurchführbarkeit der
gleichschwebenden Temperatur versöhnen kann, ist der Umstand,
daß diese selbst keine exakten Werte vorstellt, sondern nur
Näherungswerte, Mittelwerte, und daß eine etwanige
Abweichung ein Intervall schlechter, dafür aber ein andres
besser macht. Das einzige Intervall, das absolut rein gestimmt
werden muß, ist die Oktave; die Quinte muß ein wenig
tiefer sein, und zwar beträgt die Differenz in der
eingestrichenen Oktave etwa eine Schwingung, d.h. wenn man jede
Quinte so viel tiefer stimmt, daß sie gegen die reine Quinte
eine Schwebung in der Sekunde macht, und jede Quarte um ebensoviel
höher, so wird man ungefähr genau auskommen. Von
Schriften, welche die S. der Klavierinstrumente behandeln, seien
besonders die von Werkmeister (1691 und 1715), Sinn (1717), Sorge
(1744, 1748, 1754, 1758), Kirnberger (1760), Marpurg (1776 und
1790), Schröter (1747 und 1782), Wiese (1791, 1792, 1793),
Türk (1806), Abt Vogler (1807) und Scheibler (1834, 1835 und
1838) erwähnt. Die Mehrzahl der ältern Stimmmethoden sind
gemischte, ungleich schwebend temperierte, d.h. sie bewahren einer
Anzahl Intervallen ihre akustische Reinheit, während andre
dafür desto schlechter ausfallen. - Im geistigen Sinn
bezeichnet S. einen bestimmten Gemütszustand, den in aller
Reinheit zum Ausdruck zu bringen eine der Hauptaufgaben der Musik
wie jeder andern Kunst ist.
Stimmungsbild, s. Landschaftsmalerei.
Stimmwechsel, s. Mutation.
Stimulieren (lat.), anreizen; Stimulantia, Reizmittel (s.
Erregende Mittel); Stimulation, Reizung, Anregung.
Stinde, Julius, Schriftsteller, geb. 28. Aug. 1841 zu
Kirch-Nüchel in Holstein, studierte Chemie und
Naturwissenschaften, war, nachdem er 1863 promoviert, in Hamburg
mehrere Jahre als Fabrikchemiker thätig, übernahm aber
schließlich die Redaktion des "Hamburger Gewerbeblatts" und
widmete sich ganz der Schriftstellerei, insbesondere dem
naturwissenschaftlichen Feuilleton. Außer zahlreichen
Aufsätzen in Fachzeitschriften veröffentlichte er:
"Blicke durch das Mikroskop" (Hamb. 1869); "Alltagsmärchen",
Novelletten (2. Aufl., das. 1873, 2 Bde.); "Naturwissenschaftliche
Plaudereien" (das. 1873); "Die Opfer der Wissenschaft" (unter dem
Pseudonym Alfred de Valmy, 2. Aufl., Leipz. 1879); "Aus der
Werkstatt der Natur" (das. 1880, 3 Bde.) u. a. Für die
Bühne schrieb S. eine Anzahl mit großem Erfolg
aufgeführter plattdeutscher Komödien, wie: "Hamburger
Leiden", "Tante Lotte", "Die Familie Karstens", "Eine Hamburger
Köchin", "Die Blumenhändlerin" u. a.; ferner das
Lustspiel "Das letzte Kapitel", die beiden Weihnachtsmärchen:
"Prinzeß Tausendschön" und "Prinz Unart" sowie
gemeinschaftlich mit G. Engels das Volksstück "Ihre Familie".
Seit 1876 in Berlin lebend, schrieb er noch: "Waldnovellen" (Berl.
1881, 2. Aufl. 1885); "Das Dekamerone der Verkannten" (das. 1881,
2. Aufl. 1886); "Berliner Kunstkritik und Randglossen" (das. 1883)
und seine ergötzlichen Bücher über die Familie
Buchholz: "Buchholzens in Italien" (Berl. 1883), "Die Familie
Buchholz" (das. 1884), "Der Familie Buchholz zweiter Teil" (das.
1885), "Der Familie Buchholz dritter Teil: Frau Wilhelmine" (das.
1886), welche seinen Namen am bekanntesten machten und in
zahlreichen Auflagen erschienen; endlich "Frau Buchholz im Orient"
(das. 1888); "Die Perlenschnur und andres" (das. 1887).
Stinkasant, s. Asa foetida.
Stinkasantpflaster, s. Pflaster.
Stinkbaum, s. Sterculia.
Stinkholz von Guayana, s. Gustavia.
Stinkkalk, s. Kalkspat.
Stinkkohle, s. Braunkohle, S. 356.
Stinkmalve, s. Sterculia.
Stinkmarin, s. Skink.
Stinknase (griech. Ozäna), eine krankhafte Affektion
der Nasenhöhle mit äußerst widerwärtigem,
manchmal direkt fauligem Geruch der ausströmenden Luft.
Derselbe rührt in vielen Fällen von einer fauligen
Zersetzung des zurückgehaltenen Schleimhautsekrets her,
besonders bei engen und verbogenen Nasenkanälen und
Krankheiten der Nebenhöhlen der Nase. In andern Fällen
ist ein wirklich jauchiger Ausfluß vorhanden, herstammend von
wirklichen Nasengeschwüren und am häufigsten durch
syphilitische oder skrofulöse Verschwärung der
Schleimhaut und der Nasenknochen bedingt. Die Behandlung kann nur
auf Grund sorgfältiger ärztlicher Untersuchung erfolgen
und hat das Grundübel sowie das Symptom selbst zu
bekämpfen. Letzteres geschieht durch Ausspülen der Nase
mit schwachem Salzwasser, Lösungen von Alaun, Tannin,
übermangansaurem Kali etc. mit Hilfe der Nasendouche, deren
ungeschickter Gebrauch aber böse Entzündungen des
Mittelohrs veranlassen kann.
Stinkspat (Stinkstein), s. Kalkspat.
Stinktier (Mephitis Cuv.), Raubtiergattung aus der
Familie der Marder (Mustelida), dem Dachs ähnlich, nur
schlanker gebaute Tiere mit kleinem, zugespitztem Kopf,
aufgetriebener, kahler Nase, kleinen Augen, kurzen, abgerundeten
Ohren, kurzen Beinen, mäßig großen Pfoten,
fünf fast ganz miteinander verwachsenen Zehen, ziemlich
langen, schwach gekrümmten Nägeln, mindestens auf den
Ballen nackten Sohlen und langem, dicht behaartem Schwanz. Sie
besitzen zwei haselnußgroße Stinkdrüsen, welche
sich innen in den Mastdarm öffnen und eine gelbe,
ölähnliche Flüssigkeit von furchtbarem Gestank
absondern, die das Tier zur Verteidigung mehrere Meter weit
fortspritzen kann. Die Stinktiere leben in Amerika und Afrika,
besonders in steppenartigen Gegenden, liegen am Tag in hohlen
Bäumen, Felsspalten oder selbstgegrabenen Erdhöhlen und
jagen nachts auf kleine Wirbeltiere und niedere Tiere, fressen aber
auch Beeren und Wurzeln. Die Chinga (M. varians Gray), 40 cm lang,
mit fast ebenso langem Schwanz, ist schwarz, mit zwei weißen
Streifen auf dem Rücken und Schwanz, und bewohnt Nordamerika,
besonders die Hudsonbailänder. Sie lebt in Gehölzen
längs der Flußufer und in Felsengegenden, ist in ihren
Bewegungen langsam und unbeholfen, verteidigt sich lediglich durch
Ausspritzen des stinkenden Sekrets, gerät aber leicht in Zorn
und greift dann auch an.
335
Stint - Stirling-Maxwell
In der Gefangenschaft wird sie sehr zahm und entleert ihre
Drüse nur, wenn sie stark gereizt wird. Man benutzt das Fell
als Pelzwerk (s. Skunks), den Drüseninhalt als
nervenstärkendes Mittel.
Stint (Osmerus Cuv.), Gattung aus der Ordnung der
Edelfische und der Familie der Lachse (Salmonoidei), gestreckt
gebaute Fische mit starker, von der der Lachse bedeutend
abweichender Bezahnung und mittelgroßen Schuppen. Der gemeine
S. (Alander, O. eperlanus Lac.), 13-20 und 30 cm lang, auf dem
Rücken grau, an den Seiten silberfarben, bläulich oder
grünlich schimmernd, am Bauch rötlich, lebt in der Nord-
und Ostsee, auch in Haffen und größern
Süßwasserseen Norddeutschlands, bildet stets
größere Gesellschaften, hält sich im Winter in der
Tiefe verborgen, geht im Frühjahr weit in die Flüsse
hinauf (bis Anhalt, Sachsen, Minden) und legt seine kleinen, gelben
Eier aus sandigen Stellen ab. Die Jungen gehen im August ins Meer.
Das Auftreten des Stints ist sehr schwankend: während er in
manchen Jahren in unschätzbarer Menge erscheint, findet er
sich in andern Jahren nur spärlich, ohne daß sich
hierfür bestimmte Gründe angeben ließen. Man
fängt den S. während des Aufsteigens in großen
Massen; er riecht zwar unangenehm, schmeckt aber trefflich.
Vorteilhaft wird er auch als Nahrung für wertvollere Fische in
Teiche gesetzt. Bisweilen benutzt man ihn als Dünger.
Stintzing, Johann August Roderich von, namhafter Romanist
und Literarhistoriker, geb. 8. Febr. 1825 zu Altona, studierte in
Jena, Heidelberg, Berlin und Kiel die Rechte, bestand 1848, nachdem
er sich an der Erhebung der Herzogtümer gegen Dänemark
beteiligt, das Amtsexamen und ließ sich als Advokat in
Plön nieder, siedelte 1851 nach Heidelberg über, wo er
sich 1852 mit der Schrift "Das Wesen von bona fides und titulus in
der römischen Usukapionslehre" (Heidelb. 1852) als
Privatdozent in der juristischen Fakultät habilitierte. 1854
ging er als ordentlicher Prosessor der Rechte nach Basel, 1857 nach
Erlangen, wo ihm der persönliche Adel verliehen ward, 1870 mit
dem Charakter eines Geheimen Justizrats nach Bonn. Er starb 13.
Sept. 1883 durch einen Sturz von einem Berghang in Oberstdorf bei
Sonthofen (Bayern). Seine bedeutendsten Werke sind
litterargeschichtlichen Inhalts, wie: "Ulrich Zasius" (Basel 1857);
"Geschichte der populären Litteratur des
römisch-kanonischen Rechts in Deutschland" (Leipz. 1867);
"Hugo Donellus in Altdorf" (Erlang. 1869); "Geschichte der
deutschen Rechtswissenschaft" (Münch. u. Leipz. 1880-84, 2
Abtlgn.). Auch gab er J. de Wals "Beiträge zur
Litteraturgeschichte des Zivilprozesses" (Erlang. 1866) heraus.
Außerdem erwähnen wir: "Über das Verhältnis
der Legis actio sacramento zu dem Verfahren durch Sponsio
praejudicialis" (Heidelb. 1853); "Friedrich Karl v. Savigny" (Berl.
1862); "Macht und Recht" (Bonn 1876); "Georg Tanners Briefe an
Bonifacius und Basilius Amerbach" (das. 1879).
Stinzomarin, s. Skink.
Stipa L. (Pfriemengras), Gattung aus der Familie der
Gramineen, weitverbreitete, zierliche, ausdauernde Gräser mit
einblütigen, großen Grasährchen, grannenartig
gespitzten Hüllspelzen und lang begrannten, zusammengerollten
Deckspelzen. S. pennata L. (Federgras, Marienflachs, Reihergras),
30-90 cm hoch, mit steifem, hartem Halm, borstenartigen
Blättern, sparsam verästelter Rispe und 30 cm langen,
geknieten, federigen Grannen, wächst auf dürrem Boden,
wird zu Winterbouketts benutzt; ebenso S. capillata L.
(Federhaargras), mit sehr langen, geknieten, kahlen Grannen. S.
tenacissima L. (Macrochloa tenacissima Kunth), mit 90 cm langen,
cylindrischen, halmähnlichen Blättern, wächst in
Spanien und Nordafrika und findet als Esparto (s. d.) ausgedehnte
Verwendung.
Stipendium (lat.), Geldunterstützung, welche
namentlich Studierende auf eine bestimmte Zeit erhalten. Die
Stipendien werden entweder ganz im allgemeinen für Studierende
oder für ein besonderes Fachstudium oder mit
Berücksichtigung eines bestimmten Landes, Ortes, eines Standes
(Adelsstipendien) oder auch der Familienherkunft
(Familienstipendien) vergeben und zwar nach Maßgabe
ausdrücklicher Verfügungen der Stifter, wo solche
vorhanden sind. Vgl. Baumgart, Die Stipendien und Stiftungen an
allen Universitäten des Deutschen Reichs (Berl. 1885). Die
sogen. Reisestipendien werden jungen Gelehrten oder Künstlern
nach Vollendung ihrer Studien zu weiterer Ausbildung auf Reisen
verliehen.
Stipes (Mehrzahl: Stipites, lat.), Stiel, Stengel;
Stipites Dulcamarae, Bittersüßstengel.
Stipula (lat.), Nebenblatt (s. Blatt, S. 1015).
Stipulation (lat.), vertragsmäßige Festsetzung
zwischen zwei oder mehreren Personen, s. Vertrag.
Stirbey (Stirbei, Kalarasch), Hauptstadt des Kreises
Jalomitza in der Walachei, an dem Donauarm Bortscha, nahe dem
großen See von Kalarasch, Silistria gegenüber, Sitz des
Präfekten und eines Tribunals, mit 3 Kirchen, einem Gymnasium
und 7734 Einw. Hier hatten 1854 die Russen sich verschanzt und
schlugen 4. März d. J. einen Angriff der Türken
zurück.
Stirling, Hauptstadt der nach ihr benannten schott.
Grafschaft, am schiffbaren Forth und am Abhang eines steilen
Hügels (mit dem altberühmten S. Castle) gelegen, hat ein
altertümliches Gepräge, eine Kirche aus dem 15. Jahrh.,
ein Militärhospital (in dem ehemaligen Palais der Grafen von
Argyll), eine Kornbörse, ein Versorgungshaus, ein
Athenäum, landwirtschaftliches Museum, Latein- und
Kunstschule, Fabrikation von Wollwaren (Tartans), Gerberei,
Malzdarren, Ölmühlen und (1881) 12,194 Einw. Südlich
davon liegt das Dorf St. Ninian's, mit Nagelschmieden. - Als
"Schlüssel der schottischen Hochlande" spielte das in
unbekannter Zeit erstandene Schloß eine große Rolle. In
der benachbarten Ebene schlug Wallace 1297 die Engländer,
welchen Sieg ein Denkmal verherrlicht. 1304 bemächtigten sich
die Engländer des Schlosses, mußten es aber nach der
Schlacht von Bannockburn (1314) wieder räumen. An diesen Sieg
der Schotten erinnert eine 1877 vor dem Schloß errichtete
Statue von Robert Bruce. 1651 nahm der englische General Monk das
Schloß, und 1745 wurde es von den Hochländern vergeblich
belagert.
Stirling-Maxwell, Sir William, engl. Gelehrter, geb. 1818
zu Kenmure bei Glasgow, ward im Trinity College zu Cambridge
gebildet, lebte längere Zeit in Frankreich und Spanien, ward
1866 durch den Tod seines Onkels John Maxwell Baronet, 1872 Rektor
der Universität Edinburg, 1875 Kanzler der Universität
Glasgow sowie Kommissar am Britischen Museum und an der
National-Porträtgalerie. Er starb 15. Jan. 1878 in Venedig. S.
schrieb: "The annals of the artists of Spain" (1848, 3 Bde.; 2.
Aufl. 1853); "Cloister-life of Charles V." (1852; deutsch, Leipz.
1853) und "Velasquez and his works" (1855; deutsch, Berl.
1856).
336
Stirlingshire - Stöber.
Stirlingshire, Grafschaft im südlichen Schottland,
westlich am Forthbusen der Nordsee, umfaßt 1195 qkm (21,7
QM.) mit (1881) 112,443 Einw. und bildet im NW. ein kahles
Gebirgsland (Ben Lomond 973 m), das ein Strich Moorlandes von den
Campsie Fells (577 m) im Süden trennt, während der
östliche Teil eine Ebene mit fruchtbarem Ackerland darstellt.
Die bedeutendsten Flüsse sind: der Forth, Carron und Endrick.
Die Grafschaft enthält großen Mineralreichtum, besonders
an Steinkohlen und Eisen. Nur 24,9 Proz. der Oberfläche
bestehen aus Ackerland, 14,8 Proz. aus Wiesen, 1,8 Proz. aus Wald.
Die Viehzucht ist von Bedeutung (17,575 Schafe, 28,052 Rinder). Die
Industrie beschäftigt sich mit Wollweberei, Kattundruckerei,
Hüttenbetrieb und Eisengießerei. Der Südosten der
Grafschaft wird von dem Forth-Clydekanal durchzogen, welcher die
Nordsee mit dem Irischen Meer verbindet. - Geschichtlich
merkwürdig ist S. als der Schauplatz heftiger Kämpfe der
Römer mit den Kaledoniern, gegen welche jene den
berühmten Pikten- oder Hadrianswall (s. d.) zwischen dem
Forthbusen und dem Clydebusen errichteten.
Stirm, Karl Heinrich, protest. Theolog, geb. 22. Sept.
1799 zu Schorndorf, ward 1828 Landgeistlicher und 1835 Hofkaplan
und Mitglied des Konsistoriums in Stuttgart. In dieser Eigenschaft
entfaltete er eine einflußreiche Thätigkeit im Kirchen-
und Schulwesen seines Vaterlandes und starb als Prälat und
Oberkonsistorialrat 24. April 1873. Sein bekanntestes Werk ist die
"Apologie des Christentums in Briefen für gebildete Leser" (2.
Aufl., Stuttg. 1856).
Stirn (Frons), bei den Wirbeltieren diejenige Gegend des
Kopfes, welche die Stirnbeine zur knöchernen Grundlage hat,
beim Menschen also der vorderste unterste Teil des Vorderkopfes. Im
gewöhnlichen Leben wird sie mit zum Gesicht gerechnet, das
jedoch für den Anatomen erst unterhalb derselben anfängt.
Beim Menschen ist sie haarlos und ragt weit hervor, während
sie bei den übrigen Säugetieren gewöhnlich behaart
ist und stark hinter dem Mundteil zurücktritt. Bei den
Gliedertieren (Insekten, Krebsen etc.) wird der zwischen den Augen
liegende Teil des Kopfes gleichfalls S. genannt.
Stirnbein, s. Schädel, S. 373.
Stirner, Max, s. Schmidt 4).
Stirngrübler, Schafbremse, s. Bremen, S. 384.
Stirnhöhlen, s. Schädel, S. 373.
Stirnmauer, s. Gewölbe, S. 311.
Stirnnaht, s. Schädel, S. 373.
Stirnrad, Zahnrad, dessen Zähne auf einer
cylindrischen Fläche radial angebracht sind.
Stirnzapfen, am Ende einer Welle etc. befindliche Zapfen,
bei welchen der Druck rechtwinkelig gegen ihre Achse wirkt. Vgl.
Zapfen.
Stirnziegel, in der antiken Baukunst aufrecht stehende
Ziegel in Form von Palmetten und Köpfen, welche an der Ecke
eines Daches angebracht wurden. Vgl. Akroterien.
Stirps (lat.), Stamm.
Stirum, Ort, s. Styrum.
Stitny, Thomas von, Philosoph aus altem böhmischen
Geschlecht, lebte im 14. Jahrh., wahrscheinlich von 1325 bis 1410,
und hat sich als einer der ersten Zöglinge der von Kaiser Karl
IV. 1348 gegründeten Universität zu Prag durch
zahlreiche, meist auf seiner Burg Stitné bei Pilgram
verfaßte philosophische Schriften, die zu den besten
Prosawerken der böhmischen Litteratur gerechnet werden,
bekannt gemacht. Die darin niedergelegte Weltanschauung stimmt mit
der christlich-scholastischen, insbesondere des von ihm als
Autorität verehrten Thomas von Aquino, dem Inhalt nach
überein, unterscheidet sich von derselben jedoch sehr
wesentlich der Form nach, welche vielmehr homiletisch als
syllogistisch ist. Nähert er sich hierin den eifrigen
Predigern seines Zeitalters, den Vorläufern des spätern
Hussitentums, so entfernt er sich anderseits von deren fanatischem
Vernunfthaß, indem er die Vernunft als höchste
Autorität aufstellt. Sein Hauptwerk sind die bisher nur
teilweise veröffentlichten "Gespräche" (hrsg. von Erben,
Prag 1850; von Vrtátko, das. 1873). Vgl. Wenzig, Studien
über Ritter Thomas von S. (Leipz. 1856).
Stoa (griech.), s. v. w. Portikus (s. Halle); auch
gebraucht für die Lehre der Stoiker (s. d.), weil Zenon, der
Stifter dieser Philosophie, seine Vorträge in der S. Poikile
zu Athen zu halten pflegte.
Stobäos, Joannes, aus Stobi in Makedonien, um 500 n.
Chr., ist Verfasser einer philosophischen Blumenlese aus mehr als
500 griechischen Dichtern und Prosaikern, der wir die Erhaltung
zahlreicher Bruchstücke aus jetzt verlornen Schriften
verdanken. Ursprünglich ein Ganzes bildend, ist die Sammlung
im Lauf der Zeit in zwei besondere Werke von je zwei Büchern
getrennt worden: "Eclogae physicae et ethicae" (hrsg. von Gaisford,
Oxf. 1850, 2 Bde.; von Meineke, Leipz. 1860-64, 2 Bde., und
Wachsmuth, Berl. 1884, 2 Bde.) und "Anthologion" oder "Florilegium"
(hrsg. von Gaisford, Oxf. 1822-25, 4 Bde., und Meineke, Leipz.
1856-57, 4 Bde.).
Stobbe, Johann Ernst Otto, angesehener Germanist, geb.
28. Juni 1831 zu Königsberg i. Pr., widmete sich daselbst
zuerst philologischen und historischen Studien, dann der
Rechtswissenschaft und promovierte 1853 mit der Differtation "De
lege Romana Utinensi" (Königsb. 1853), worauf er seine
germanistischen Studien zu Leipzig im nahen Anschluß an
Albrecht und in Göttingen fortsetzte. Nachdem er sich 1855 in
Königsberg als Privatdozent für deutsches Recht
habilitiert hatte, wurde er 1856 zum außerordentlichen und
noch in demselben Jahr zum ordentlichen Professor ernannt. 1859 in
gleicher Eigenschaft nach Breslau versetzt, folgte er 1872 einer
Berufung nach Leipzig an v. Gerbers Stelle. 1880 wurde er zum
Geheimen Hofrat ernannt. Er starb 19. Mai 1887. Seine
hervorragendsten Schriften, sämtlich durch Klarheit und
Gründlichkeit ausgezeichnet, sind: "Zur Geschichte des
deutschen Vertragsrechts" (Leipz. 1855); "Geschichte der deutschen
Rechtsquellen" (Braunschw. 1860-64, 2 Bde.); "Beiträge zur
Geschichte des deutschen Rechts" (das. 1865); "Die Juden in
Deutschland während des Mittelalters" (das. 1866) ; "Hermann
Conring, der Begründer der deutschen Rechtsgeschichte" (Berl.
1870); "Handbuch des deutschen Privatrechts" (das. 1871-85, 5 Bde.;
2. Aufl., Bd. 1 u. 2, 1882-83). Aus seinem Nachlaß erschien
noch "Zur Geschichte des ältern deutschen Konkursprozesses"
(Berl. 1888). Seit 1857 beteiligte er sich an der Redaktion der
"Zeitschrift für deutsches Recht", seit 1862 an der Herausgabe
des "Jahrbuchs des gemeinen deutschen Rechts" von Bekker und
Muther. Vgl. E. Friedberg, O. S. (Berl. 1887).
Stober, rechter Nebenfluß der Oder in Schlesien,
entspringt in der Nähe von Rosenberg, mündet bei
Stoberau; 98 km lang und flößbar.
Stöber, 1) Daniel Ehrenfried, elsäss. Dichter
und Schriftsteller, geb. 9. März 1779 zu Straßburg,
studierte hier und später in Erlangen Rechtswissenschaft und
wurde 1806 zu Straßburg Lizentiat der Rechte. Hier gab er das
"Alsatische Taschenbuch" (1806-1809) heraus, übersetzte
französische Dramen
337
Stobi - Stöcker.
und veröffentlichte nach Pfeffels Tode die "Blätter,
dem Andenken K. G. Pfeffels gewidmet" (Straßb. 1810). Unter
der Restauration gehörte S. zur liberalen Opposition; er
übersetzte die Schriften des Generals Foy, gab politische
Broschüren in Form von Dialogen ("Gradaus") heraus und
veröffentlichte: "Gedichte" (Basel 1814; 3. Aufl., Stuttg.
1821) sowie das volkstümliche "Neujahrsbüchlein vom
Vetter Daniel" (das. 1818) und eine Biographie Oberlins ("Vie de
Frédéric Oberlin", Straßb. 1821), der er seine
"Kurze Geschichte und Charakteristik der schönen Litteratur
der Deutschen" (das. 1826) nachfolgen ließ. Sein letztes
größeres Werk war die Übersetzung von Lamennais'
"Paroles d'un croyant". S. starb 28. Dez. 1835. Seine
"Sämtlichen Gedichte und kleinen prosaischen Schriften"
erschienen in 4 Bänden (Straßb. 1835-36). Zu seinen
besten poetischen Leistungen gehören seine in
elsässischer Mundart geschriebenen Gedichte, die voller Witz
und Humor sind.
2) August, Sohn des vorigen, geb. 8. Juli 1808 zu
Straßburg, studierte 1826-32 Theologie, wirkte 1838-41 als
Lehrer der deutschen Sprache und Litteratur am Kollegium zu
Buchsweiler, 1841-71 als Professor am Kollegium zu Mülhausen
und ward 1864 zugleich zum Oberstadtbibliothekar, 1874 zum
Konservator des von ihm mitbegründeten historischen Museums
ernannt. Er starb daselbst 19. März 1884. Gleich seinem Vater
und Bruder trug er durch seine litterarische Thätigkeit viel
zur Erhaltung des deutschen Wesens im Elsaß bei. Er
veröffentlichte: "Alsabilder", vaterländische Sagen und
Geschichten (mit seinem Bruder Adolf, Straßb. 1836);
"Gedichte" (das. 1842; neue Aufl., Basel 1873); "Oberrheinisches
Sagenbuch", Gedichte (Straßb. 1842); "Elsässisches
Volksbüchlein", Kinder- und Volkslieder, Märchen etc.
(das. 1842; 2. Aufl., Mülh. 1859); "Der Dichter Lenz und
Friederike von Sesenheim" (Basel 1842); "Geschichte der
schönen Litteratur der Deutschen" (Straßb. 1843); "Die
Sagen des Elsasses" (St. Gallen 1852, 2. Aufl. 1858); "Der Aktuar
Salzmann, Goethes Freund" (Mülh. 1855); "Zur Geschichte des
Volksaberglaubens im 16. Jahrhundert" (Basel 1856); "Chr. Fr.
Pfeffel" (daf. 1859); "E Firobe (ein Feierabend) im e Sundgauer
Wirtshaus" , Volksszene in zwei Abteilungen (Musik von Heyberger,
Mülh. 1865, 2. Aufl. 1868); "Jörg Wickram,
Volksschriftsteller und Stifter der Kolmarer
Meistersängerschule" (das. 1866); "Aus alten Zeiten. Allerlei
über Land und Leute im Elsaß" (2. Aufl., das. 1872);
"Erzählungen, Märchen, Humoresken etc." (das. 1873);
"Drei-Ähren", Gedichte (das. 1873, 2. Aufl. 1877); "J. S.
Röderer und seine Freunde" (2. Aufl., Kolm. 1874). Auch gab er
"Elsässische Neujahrsblätter" (mit Otte, Straßb.
1843-48, 6 Bde.), "Erwinia", belletristische Wochenschrift (daf.
1838-39), und "Alsatia", Jahrbuch für elsässische
Geschichte etc. (Mülh. 1850-75, 10 Bde.), zu denen nach
Stöbers Tod noch ein Band "Neue Alsatia" (das. 1885) erschien,
heraus.
3) Adolf, Bruder des vorigen, geb. 7. Juli 1810, studierte
1826-31 in Straßburg Theologie, wurde 1839 Lehrer am
Kollegium zu Mülhausen, 1840 Pfarrer daselbst und ist seit
1860 Präsident des reformierten Konsistoriums und Oberschulrat
zu Mülhausen. Außer den mit dem vorigen herausgegebenen
"Alsabildern" veröffentlichte er: "Gedichte" (Hannov. 1845);
"Reisebilder aus der Schweiz" (St. Gallen 1850, neue Folge 1857);
"Reformatorenbilder" (Basel 1857); "Einfache Fragen eines
elsässischen Volksfreundes" (Mülh. 1872) und einiges
Theologische.
Stobi (Stoboi), Stadt im alten Päonien (Makedonien),
westlich vom Axios (Wardar), bei der Mündung des Erigon, nach
der Diokletianischen Einteilung Hauptstadt der nordwestlichen
Hälfte Makedoniens, wurde 479 von den Ostgoten zerstört,
wird aber in den Kämpfen zwifchen Bulgaren und Byzantinern
noch 1014 erwähnt. Ruinen bei Gradsko.
Stöchaden, s. v. w. Hyèrische Inseln, s.
Hyères.
Stochasmus (griech.), veraltete Bezeichnung für
Wahrscheinlichkeitsberechnung; Stochastik, Lehre von der
Wahrscheinlichkeit.
Stöchiometrie (griech.), chemische Meßkunst,
die Lehre von den Gewichts- und Raumverhältnissen, nach
welchen sich ungleichartige Materien zu neuen gleichartigen
Körpern chemisch verbinden, und die Anwendung derselben zu
chemischen Berechnungen (vgl. Atom und Äquivalent). Die S.
wurde von J. B. Richter gegen Ende des 18. Jahrh. begründet
und seitdem vielfach, unter andern von Meineke, Bischof,
Döbereiner, Gay-Lussac, Berzelius, Liebig, Dumas, Laurent,
Gerhardt u. a. bearbeitet. Vgl. Rammelsberg, Lehrbuch der S. (Berl.
1842); Frickhinger, Katechismus der S. (5. Aufl., Nördling.
1873).
Stock (Caudex), bei den Pflanzen im allgemeinen der mit
Blättern besetzte Stengel; dann der einfache, am Grund nur
durch Nebenwurzeln befestigte, am obern Ende mit einer einzigen
großen Gipfelknospe abschließende, holzige Stamm der
Baumfarne, Cykadeen und baumartigen Monokotyledonen, besonders der
Palmen und Drachenbäume. - Über S. in der Geologie s.
Lagerung der Gesteine.
Stock (engl.), Stamm, Grundlage; übertragen:
Grundkapital von Aktiengesellschaften, dessen einzelne Teile
(Aktien) shares heißen. S.-exchange, "Aktienbörse",
thatsächlich Effektenbörfe, da an derselben auch
Obligationen (bonds), Staatspapiere (funds) und andre Wertpapiere
gehandelt werden; S.-holder, Eigentümer von Stocks; S.-broker,
Makler für Wertpapiere, S.-jobber. Spekulant in Wertpapieren
(vgl. Jobber).
Stockach, Stadt im bad. Kreis Konstanz, an der Stockach
und der Linie Radolfzell-Mengen der Badischen Staatsbahn, 494 m
ü. M., hat eine evangelische und eine kath. Kirche, ein
Bezirksamt, ein Amtsgericht, eine Bezirksforstei, Spinnerei,
Weberei, Teigwarenfabrikation, 3 Kunstmühlen und (1885) 2065
meist kath. Einwohner. - S. war ehedem Hauptstadt der
Landgrafschaft Nellenburg-Thengen, mit welcher es 1645 an
Österreich, 1805 an Württemberg und 1810 an Baden
überging. Hier siegte 25. März 1799 Erzherzog Karl
über die Franzosen unter Jourdan (s. Liptingen).
Stockausschlag, s. Knospe.
Stockbörse, s. Stock.
Stockbücher, s. Grundbücher.
Stöckke und Stockwerke, s. Bergbau, S. 722,
Erzlagerstätten und Lagerung der Gesteine.
Stößer, Adolf, preuß. Hofprediger, geb.
11. Dez. 1835 zu Halberstadt, studierte in Halle und Berlin
Theologie und Philologie, wurde 1863 Pfarrer in Seggerde bei
Halberstadt und 1866 in Hamersleben. 1871 ging er als
Divisionspfarrer nach Metz und 1874 als Hof- und Domprediger nach
Berlin. Das dreiste Auftreten der Sozialdemokratie und ihre
offenkundigen revolutionären Bestrebungen veranlagen S., 1877
in öffentlichen Versammlungen gegen die Führer der
Sozialdemokraten aufzutreten und durch Stiftung einer
christlich-sozialen Partei die Arbeiter für christliche und
patriotische Anschauungen wiederzugewinnen, zugleich aber ihre
Forderungen des Schutzes gegen die Ausbeutung des Kapitals und
338
Stockerau - Stockhausen.
einer bessern sozialen Lage zu unterstützen. Die neue
Partei gewann aber nur an wenigen Orten zahlreichere Anhänger,
da S. durch seinen fanatischen Eifer gegen alles, was liberal
hieß, besonders in kirchlicher Beziehung die Opposition der
öffentlichen Meinung gegen sich herausforderte. Auch ging er
in seinen Agitationen gegen das Judentum oft weiter, als es sich
mit seiner Stellung vertrug. 1879 wurde er von einem
westfälischen Wahlkreis in das Abgeordnetenhaus und 1880 auch
in den Reichstag gewählt, wo er sich der streng konservativen
Partei anschloß. Da S. durch seine sozialpolitische
Thätigkeit die auf der Mitwirkung der
Mittel-(Kartell-)Parteien beruhende Politik der Regierung
störte, so mußte er 1889 versprechen, ferner auf
politische Agitationen zu verzichten. Er veröffentlichte
mehrere Jahrgänge "Volkspredigten" und eine Sammlung seiner
Reden und Aufsätze: "Christlich-sozial" (Berl. 1885).
Stockerau, Marktflecken in der niederösterreich.
Bezirkshauptmannschaft Korneuburg, am Göllersbach und an der
Österreichifchen Nordwestbahn, Sitz eines Bezirksgerichts, mit
Pfarrkirche, Kavalleriekaserne, Realgymnasium, Fabriken für
Ceresin, Kerzen u. Seifen, Farben, Posamentierwaren u. (1880) 5955
Einw.
Stockfagott, f. Rackett.
Stockfalke, s. Habicht.
Stockfäule, f. Rotfäule.
Stockfisch, f. Schellfisch.
Stockfleth, Niels Joachim Christian Vibe, Apostel der
Lappländer, geb. 11. Jan. 1787 zu Christiania, stand erst in
schleswigschen und norwegischen Militärdiensten, studierte
dann Theologie in Christiania und ward 1825 Prediger zu Vadsöe
in Ostfinnmarken, in der Nähe des Nordkaps. Hier sowie in
Lebesby, ebenfalls in Ostfinnmarken, wohin er dann
übersiedelte, war sein Streben auf Herstellung einer
volkstümlichen lappländischen Litteratur gerichtet. Es
erschienen von ihm in lappländischer Sprache eine Fibel, eine
Übersetzung von Luthers "Kleinem Katechismus", eine
lappländische Grammatik (1840) und ein Neues Testament (1850).
Seit 1839 seines Predigerdienstes enthoben, um ungestörter
seinen Studien obliegen zu können, veröffentlichte er
noch : "Lappisk Sproglære" (Christ. 1850) ; "Norsklappisk
Ordbog" (das. 1852); eine Untersuchung "Om de finske Sprogforholde
in Finmarkens og Nordlandenes Amter" (das. 1851) und "Dagbog over
mine Missionsreiser i Finmarken" (das. 1860). Er starb 26. April
1866 in dem Städtchen Sandefjord.
Stockgetriebe, s. Trilling.
Stöckhardt, 1) Julius Adolf, Chemiker, geb. 4. Jan.
1809 zu Röhrsdorf bei Meißen, erlernte die Pharmazie in
Liebenwerda, studierte dann in Berlin, arbeitete nach einer Reise
nach England und Frankreich bei Struve in Dresden, ward 1838 Lehrer
der Naturwissenschaft daselbst, 1839 Lehrer der Chemie und Physik
an der Gewerbeschule in Chemnitz und 1847 Professor der
Agrikulturchemie an der Akademie zu Tharandt, wo er 1. Juni 1886
starb. Früherhin besonders der gewerblichen Chemie, namentlich
in Bezug auf Farbenfabrikation, beflissen, wandte er sich seitdem
vornehmlich der Agrikulturchemie zu und erwarb sich namhafte
Verdienste um dieselbe, besonders auch durch seine zahlreichen
Vorträge in Vereinen und Versammlungen. Er schuf das Institut
der agrikulturchemischen Versuchsstationen, welche sich in der
Folge zu landwirtschaftlichen Stationen erweiterten und für
den Fortschritt der Landwirtschaft höchst bedeutend wurden.
Von seinen Schriften sind hervorzuheben: "Schule der Chemie"
(Braunschw. 1846, 19. Aufl. 1881); "Chemische Feldpredigten
für deutsche Landwirte" (4. Aufl., Leipz. 1857);
"Guanobüchlein" (4. Aufl., das. 1856). Seit 1840 gab er mit
Schober die "Zeitschrift für deutsche Landwirtschaft" heraus
und seit 1855 als Fortsetzung der "Chemischen Feldpredigten" den
"Chemischen Ackersmann" (Lpz.).
2) Ernst Theodor, Landwirt, geb. 4. Jan. 1816 zu Bautzen,
widmete sich der Landwirtschaft und errichtete auf dem von ihm
gepachteten Rittergut Brösa bei Bautzen eine
landwirtschaftliche Lehranstalt, welche bald bedeutenden Ruf
erlangte. 1850 ward er Professor der landwirtschaftlichen
Disziplinen an der höhern Gewerbeschule zu Chemnitz und wirkte
hier sehr wesentlich für die Hebung der Landwirtschaft. 1861
folgte er einem Ruf nach Jena als Professor der Landwirtschaft und
Direktor einer landwirtschaftlichen Lehranstalt. 1862 übernahm
er auch die Direktion der Ackerbauschule zu Zwätzen, und
gleichzeitig war er als Vorsitzender der landwirtschaftlichen
Zentralstelle, der Thüringer Wanderversammlung etc.
thätig. 1872 ward er als Ministerialrat nach Weimar berufen
und gleichzeitig zum Kommissar der landwirtschaftlichen
Zentralstelle, der Gewerbekammer für das Großherzogtum
und zum Immediat-Finanzkommissar der Universität Jena ernannt.
Dem deutschen Landwirtschaftsrat gehört er seit dessen
Gründung an. Er schrieb: "Bemerkungen über das
landwirtschaftliche Unterrichtswesen" (Chemn. 1851); "Die Drainage"
(Leipz. 1852); "Der angehende Pachter" (mit A. Stöckhardt, 2.
Aufl., Braunschw. 1869); "Die Entwickelung der landwirtschaftlichen
Lehranstalt zu Jena 1861-67". Auch redigierte er 1855-66 die
"Zeitschrift für deutsche Landwirte" und 1863-1872 die
"Landwirtschaftliche Zeitung für Thüringen".
Stockhausen, Julius, Konzertsänger (Bariton), geb. 22. Juli
1826 zu Paris als Sohn des Harfenspielers Franz S. aus Köln,
wurde am Pariser Konservatorium gebildet und zeichnete sich schon
während seiner Lehrzeit so vorteilhaft aus, daß ihm von
Habeneck die Leitung der Proben zu den musikalisch-dramatischen
Übungen der Schüler übertragen wurde. Seine
höhere Ausbildung als Sänger erhielt er von Manuel Garcia
in London, woselbst er auch 1848 am Italienischen Theater mit
Glück debütierte. Später wirkte er mit gutem Erfolg
als Bühnensänger in Mannheim und an der Opéra
Comique in Paris. Seine Haupttriumphe feierte S. aber als
Konzertsänger, namentlich steht er als Liedersänger
einzig in seiner Art da. 1862 übernahm er die Direktion der
Hamburger philharmonischen Konzerte, nachdem er das Jahr zuvor in
Gebweiler im Elsaß seine Kräfte als Chor- und
Orchesterdirigent erprobt hatte. Sieben Jahre später folgte er
einem Ruf nach Stuttgart, wo er zum Kammersänger und
Gesangsinspektor ernannt war, gab jedoch diese Stelle im folgenden
Jahr wieder auf, um längere Konzertreisen zu unternehmen. Von
1874 bis 1878 wirkte er in Berlin als Direktor des Sternschen
Gesangvereins und entwickelte zugleich eine ungemein fruchtbare
Lehrthätigkeit. Dann nahm er ein Engagement als erster
Gesanglehrer am Hochschen Konservatorium in Frankfurt a. M. an,
legte indessen 1880 dies Amt nieder und gründete daselbst eine
eigne Schule. S. verdankt seine außerordentlichen Erfolge als
Sänger nicht so sehr seinen natürlichen Stimmmitteln als
vielmehr dem vollendeten Kunstgeschmack, mit welchem er seine
lyrischen Gebilde zu beleben weiß, wobei die tadellose
Reinheit seiner Textesausspache wesentlich mitwirkte. Seine
"Gesangsmethode" erschien in der Edition Peters (Leipz. 1885).
339
Stockholm (Län) - Stockholm (Stadt).
Stockholm, schwed. Län, begreift den östlichen
Teil von Upland und den nordöstlichen Teil von
Södermanland, grenzt im W. an das Län Upsala, im SW. an
Södermanland, ist zu fast 4/5 des Umfanges von der Ostsee und
dem Mälar umgeben und hat (mit der Stadt S.) ein Areal von
7643,7 qkm (138,6 QM.). Die Küstenlandschaften sind bergig und
bewaldet, während weiter im Innern offene Ebenen mit Seen und
Wäldern und größere oder kleinere Bodenerhebungen
abwechseln. Die Bevölkerung zählt ohne die Stadt S.
(1888) 152,160 Seelen. Von der uralten Kultur Uplands zeugen unter
anderm zahlreiche Runensteine. Der Boden ist im ganzen fruchtbar,
doch nimmt das Ackerland nur 14,5 Proz. der Bodenfläche ein,
während auf natürliche Wiesen 9 und auf Wald 51 Proz.
entfallen. Angebaut werden vornehmlich Hafer (1886: 744,000 hl
geerntet), Roggen (353,000 hl), Mengkorn, Gerste und Weizen. 1884
zählte man 21,397 Pferde, 84,389 Stück Rindvieh, 39,823
Schafe, 16,441 Schweine. Von großer Bedeutung sind Fischerei,
Schiffahrt und Handel.
Stockholm (hierzu der Stadtplan, mit Karte der Umgebung
von S.), Haupt- und Residenzstadt des Königreichs Schweden,
liegt am Ausfluß des Mälar in die Ostsee (Salzsee
genannt), welche einen insel- und schärenreichen Busen bildet,
und ist durch Eisenbahnen mit Malmö, Gotenburg, Christiania
und Drontheim verbunden. Die einzelnen Teile der Stadt sind:
Staden, die eigentliche Stadt, in der Mitte des Ganzen auf einer
Insel gelegen, mit den dazu gehörigen kleinern Inseln
Riddarholm und Helgeandsholm; Södermalm ("Südvorstadt")
im Süden, groß und regelmäßig gebaut, aber
sehr uneben, durch zwei Zugbrücken mit der eigentlichen Stadt
verbunden; Norrmalm ("Nordvorstadt") im N., durch die aus
Granitquadern erbaute neunbogige Nordbrücke und seit 1878
durch die westlich davon belegene Wasabrücke mit der Stadt und
durch eine 1861 vollendete eiserne Brücke mit dem Skeppsholm
("Schiffsinsel") verbunden, von wo eine hölzerne Brücke
nach dem Kastellholm führt, welche beide Inseln die
Marineetablissements enthalten; Kungsholm ("Königsinsel") im
W. von Norrmalm; Ladugårdslandet ("Meiereiland") im NO. von
Norrmalm, jetzt Östermalm genannt, die Kasernen enthaltend.
Hierzu kommt noch die mit dem vorigen Stadtteil
zusammenhängende Tiergartenstadt mit Beckholm. Außerdem
liegen bei Södermalm im Mälar die beiden Inseln
Langholmen, mit Straf- und Besserungsanstalt, und Reimersholmen.
Die Stadt enthält 40 öffentliche Plätze und ca. 300
Straßen und Gassen. Die Eisenbahn, welche über den
Mälar mittels einer großen Brücke geführt ist,
durchschneidet einen großen Teil der Stadt. Die eigentliche
Stadt ist an der Salzsee und am Mälar mit einem Kai von Granit
umgeben, welcher sich auch jenseit der Nordbrücke am Norrmalm
noch eine gute Strecke fortsetzt und den Hafen begrenzt. An der
Salzsee zieht sich eine breite Straße, die Schiffbrücke,
hin, an der Westseite mit ansehnlichen Häusern besetzt
(darunter die Bank und das Pack- oder Zollhaus). Am Fuß des
mit einem hohen Obelisken von Granit gezierten Schloßbergs
steht die Statue Gustavs III. (von Sergel) sowie zwischen dem
Mälarsee und der Salzsee die Reiterstatue von Karl XIV. Johann
(von Fogelberg). Plätze am Mälar sind: der
Ritterhausplatz (mit der Statue Gustav Wasas), von wo man über
eine Brücke auf den Riddarholm gelangt, welcher außer
der als Königsgruft benutzten Riddarholmskirche (mit 90 m
hohem Turm, zum Teil Gußeisen, seit 1839) mit fast lauter
öffentlichen Gebäuden (Haus des Reichstags, Hofgericht
etc.) besetzt und mit der Statue des Birger Jarl, des Gründers
der Stadt, geziert ist. Für den täglichen Verkehr
bestimmt sind die Plätze: Mönchsbrücke, Fleischmarkt
und Kornhafen. Unter den Plätzen der innern Stadt ist nur der
Große Markt bemerkenswert wegen des Stockholmer Blutbades vom
8. Nov. 1520, mit dem schönen Börsengebäude. Auf
Norrmalm sind der Gustav Adolfsplatz, mit der Reiterstatue des
Helden und dem königlichen Theater, sodann der
Brunkebergsplatz, der Heumarkt und der Platz Karls XIII. an der
Salzsee (mit der Statue des Königs), endlich auf Blasiiholm
der Berzeliusplatz, mit der Statue des berühmten Chemikers
(von Quarnström), zu bemerken. Die schönsten
Straßen hat Norrmalm, darunter die Regierungs-(Regeringsgata)
u. Königinstraße (Drottninggata). Unter den Kirchen ist
keine von besonderer architektonischer Bedeutung. Die Hauptkirche
St. Nikolai (aus dem 13. Jahrh., 1736-43 umgebaut) wird als
Krönungskirche benutzt. Unter den weltlichen Gebäuden
nimmt das königliche Schloß, am nördlichen Ende der
eigentlichen Stadt, den ersten Rang ein. Es wurde 1697-1753 nach
Nik. Tessins Plänen im edelsten neuitalienischen Stil
aufgeführt und bildet ein großes Viereck mit vier
niedrigern Flügeln an den Ecken und zwei halbrunden, frei
stehenden Flügelgebäuden an der Westseite. Sonst sind von
Gebäuden noch zu nennen: der Palast des Oberstatthalters; in
Norrmalm der Palast des Erbprinzen (gegenwärtig unbewohnt),
die Akademie der Wissenschaften, das Observatorium, das
Nationalmuseum (1850-65 nach Stülers Zeichnungen
aufgeführt), der große Zentralbahnhof, das Gebäude
der Reichsbibliothek (ca. 250,000 Bände) u. a.; auf Kungsholm
die Krankenhäuser und außerhalb der Stadt die
Kriegshochschule Marieberg u. a. Die Stadt besitzt seit 1861 eine
treffliche Wasserleitung. Promenaden sind: das Stromparterre, der
Humlegarten, besonders aber der Tiergarten im O. der Stadt, mit
Villen, Wirtshäusern, Theater, dem königlichen
Lustschloß Rosendal etc. Die Bevölkerung der Stadt
betrug Ende 1887: 227,964 Seelen, meist Lutheraner (1880 nur 577
Römisch-Katholische und 1259 Juden). Die Industrie ist
lebhaft. Die meisten Gewerbe werden fabrikmäßig
betrieben; außerdem gibt es mehrere Zuckerraffinerien,
Tabaks-, Seiden- und Bandfabriken, mechanische Werkstätten
(darunter 3 große), Stearin- und Talgfabriken, Lein- und
Baumwollzeugwebereien, Lederfabriken, Eisengießereien etc.
1883 besaß die Stadt 292 Fabriken, deren Fabrikate einen Wert
von 33 1/2 Mill. Kronen hatten. Der Handel, durch die Lage der
Stadt und gute Häfen sehr begünstigt, ist zwar noch sehr
lebhaft; doch beginnen andre Städte des Landes, namentlich
Gotenburg, mit S. erfolgreich zu rivalisieren. Drei Wasserwege
führen durch die Schären zur Stadt: im N. bei Furusund,
im O. bei Sandhamn und im Süden bei Landsort an Dalarö
vorbei. Da aber diese Wege lang und schwierig sind und der Hafen
jährlich 3-5 Monate lang durch Eis gesperrt ist, so ist die
Anlage eines äußern Hafens bei dem Gut Nynäs, etwa
50 km von der Stadt, projektiert, welcher durch Eisenbahn mit S. in
Verbindung gesetzt werden soll. Die Stockholmer Schiffsdocks sind
neuerdings sehr erweitert worden. Die Stadt be-
Wappen von Stockholm.
UMGEBUNG VON STOCKHOLM. 1 : 15OOOO.
339b
STOCKHOLM
Adolf Fredriks-Kyrka BC1
Arfprinsens-Pal. C3
Baptist-K. C2
Bibliotheket D4
Blasiholmen D3
Bernharden B3
Börsen CD4
Djurgarden F3,4
Dramat. Teater
Drottninggatan D3
Gustav-Adolfs-Torg C3
Helgeandsholm C3
Hötorget C2
Hundegarden D1
Jakobs-K. C3
Johiannis-K. C1
Kanzli C3,4
Karl Johanns-K. E4
Karl XIII Torg CD2,3
Kastellholmen E4
Katharina-K. D5
Konigl. Slottet D3,4
Konigl. Stora Teater C3
Konst. Akademi C3
Kungsholms Kyrka A3
Lodugardslands-K. D2
Lif Gardets-Kas. E2
Mosebacke D5
Musik Akademi B3
National-Museum D3
Nia. Teater D3
Nikolai-K. CD4
Nord. Museum B2
Norrbro C3
Norska Statsmin. Höt. D3
Posthuset C3
Radhuset C4
Regeringsgatan C1-3
Riddarholmen C4
Riddarholms-K. C4
Riddarhuset C4
Riksbanken D4
Serafaner Laz. B3
Skeppsbron D3,4
Skeppsholmen E4
Slöjdskolan C2
Slussen D5
Stortorget CD4
Strömparterren CD3
Sven Lif-Gardets-Kas. F2
Synagoge D2,3
Trädgardsgatan CD2,3
Tyska Kyrka D4
Vetenskaps-Akad. BC4
Wasabro C3
Westerlängatan CD4
Wasagatan BC2,3
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl. Bibliographisches Institut in
Leipzig. Zum Artikel »Stockholm«.
340
Stockhorn - Stockport.
saß 1883 eine Handelsflotte von 277 Schiffen, davon 192
Dampfschiffe von 21,184 Ton. Die innere Kommunikation der Stadt
wird durch viele kleine Dampfschiffe sowie Omnibusse und
Pferdebahnen besorgt. Als Beförderungsmittel des Handels sind
zu nennen: die Reichsbank, die Stockholmer Privatbank, die
Börse, die Seeassekuranz etc. Die Einfuhr besteht vornehmlich
in Getreide (Roggen, Weizen), Mehl, Wein, Reis, Heringen, Ölen
und Ölkuchen, Kupfer, Zink, Baumwolle, Korkrinde, die Ausfuhr
in Eisen und Stahl, Hafer, Teer, Thran, Asphalt. Im
ausländischen Verkehr kamen 1886: 1769 Schiffe von 598,889
Ton. an, 1790 Schiffe von 605,572 Ton. gingen ab. Von
Wohlthätigkeitsanstalten sind das große und das
Freimaurerwaisenhaus, die Murbeksche Erziehungsanstalt, ein
großes Entbindungshaus (auf Kungsholm), ein Taubstummen- und
Blindeninstitut, das Irrenhaus auf Konradsberg zu bemerken. Von
wissenschaftlichen Anstalten hat die Stadt eine Akademie der
Wissenschaften mit Sternwarte und das naturhistorische Relchsmuseum
sowie Akademien der Geschichte und Altertumskunde, der freien
Künste, der Musik, der Kriegswissenschaften, des Landbaues
(mit Versuchsstation). S. besitzt zahlreiche öffentliche
Lehranstalten, darunter zwei für Ausbildung von Lehrerinnen,
und gelehrte Schulen. Fachschulen sind außer der genannten
Kriegshochschule: eine Artillerie- und eine Seekriegsschule, das
Karolinische medizinisch-chirurgische Institut, das gymnastische
Zentralinstitut, eine technische Hochschule, eine Gewerbeschule,
Navigationsschule, Veterinärschule, ein pharmazeutisches und
ein Forstinstitut. Eine Universität ist in der Bildung
begriffen. Von Kunstinstituten verdienen Erwähnung das
Nationalmuseum, welches Sammlungen ägyptischer und
vorhistorischer Altertümer, von Skulpturen, Gemälden und
Kupferstichen enthält, und das für die Völkerkunde
des skandinavischen Nordens wichtige Nordische Museum. Von den
fünf Theatern sind am bedeutendsten das Opernhaus, das Neue
Theater und das Dramatische Theater. S. ist Sitz der
sämtlichen höchsten Reichskollegien u.
Regierungsdepartements sowie zahlreicher auswärtiger
Gesandtschaften und Konsuln (darunter auch ein deutscher
Berufskonsul). Die Ausgaben der Stadt beliefen sich 1884 auf 16,6
Mill. Kronen, das Vermögen auf 43,2 Mill. Kr., die Schulden
auf 41,3 Mill. Kr. In der Umgebung Stockholms liegen das
Lustschloß Haga mit Park, Ulriksdal und auf der
Mälarinsel Lofö Drottningholm, das schönste der
königlichen Lustschlösser, mit herrlichen Parkanlagen.
Die Stadt S. ist wahrscheinlich aus einem Fischerdorf entstanden,
das auf einer der zahlreichen Inseln lag. Als 1187 die Esthen in
Schweden einfielen, erbaute der König Knut Erikson, um die
Räuber abzuhalten, an der Stelle, wo jetzt S. liegt, ein
Schloß, um welches sich nach und nach ein Flecken bildete,
den König Birger 1255 zur Stadt erhob. 1389 wurde S. von der
Königin Margarete von Dänemark belagert und auf Befehl
des gefangenen Königs Albrecht (von Mecklenburg)
übergeben. In der Nähe erfochten 14. Okt. 1471 die
Schweden unter Sten Sture jenen glänzenden Sieg über die
Dänen, welcher der dänischen Herrschaft über
Schweden ein Ende machte. 1497 ward hier von den Schweden ein
abermaliger Sieg über die Dänen erfochten. Christian II.
belagerte die Stadt 1518 vergebens, nahm sie aber 1520 nach einer
neuen Belagerung durch Vertrag ein, worauf im November das
berüchtigte Stockholmer Blutbad erfolgte, bei welchem
Christian, um seinen Thron zu befestigen, mehrere hundert
schwedische Edelleute und Bürger hinrichten ließ. Vgl.
Ferlin, Stockholmstad (Stockh. 1854-58, 2 Bde.); Wattenbach, S.,
ein Blick auf Schwedens Hauptstadt (Berl. 1872); Lundin und
Strindberg, Gamla S. ("Das alte S.", Stockh. 1882); Heurlin,
Illustrated guide to S. (das. 1888).
Stockhorn, s. Freiburger Alpen.
Stockkrankheit (Knoten, Kropf, Wurmkrankheit), eine durch
Älchen (Anguillula) veranlaßte Krankheit des Roggens,
bei welcher die jungen Pflanzen nach Ausgang des Winters dicht bei
einander stehende, schmale und kurze Blätter entwickeln, meist
keinen langen Halm treiben und zuletzt unter Gelbwerden absterben.
Die Parasiten leben in den Stengelgliedern des jungen Halms und im
Grunde der Blattscheiden. Nach Kühn erzeugt dieselbe
Älchenart auch die Kernfäule der Kardenköpfe
(Kardenkrankheit), bei welcher dieselben im Innern sich
bräunen und die Fruchtknoten sich zu verkümmerten
Körnern entwickeln.
Stocklack, s. Lack.
Stockloden, aus dem Stock eines abgehauenen Baumstamms
sich entwickelnde Schößlinge.
Stockmalve, Stockrose, s. Althaea.
Stolkmar, Christian Friedrich, Freiherr von, deutscher
Staatsmann, geb. 22. Aug. 1787 zu Koburg aus einer mit Gustav Adolf
nach Deutschland gekommenen schwedischen Familie, studierte 1805-10
Medizin, ließ sich darauf in Koburg als Arzt nieder, diente
1814 und 1815 als Militärarzt in den Lazaretten am Rhein, ward
1816 Leibarzt des Prinzen Leopold von Koburg, als dieser sich mit
der präsumtiven Thronerbin von England vermählte, und
blieb von da an der einsichtigste, einflußreichste und
uneigennützigste Ratgeber und Vertraute desselben. 1821 ward
er in den Adel- und 1831 in den bayrischen Freiherrenstand erhoben.
Bei den Verhandlungen über die Erhebung Leopolds auf den
griechischen und dann auf den belgischen Thron stand S. dem Prinzen
aufs treueste zur Seite, er war sein Agent bei den Londoner
Konferenzen, und während er ihm von der Annahme der
griechischen Krone abriet, beförderte er seine Wahl zum
König von Belgien und unterstützte ihn durch weise
Ratschläge. Nachdem er 1834 aus seiner Stellung bei Leopold
ausgeschieden, stand er 1837 der Königin Viktoria bei ihrer
Thronbesteigung mit seinem Rat bei, begleitete 1838-39 den Prinzen
Albert von Koburg nach Italien und blieb nach dessen
Vermählung mit der Königin Vertrauter und Hausfreund des
Königspaars. Er nahm, teils in England, teils in Koburg
lebend, an allen wichtigen Verhandlungen beratenden Anteil, war
1848 koburgischer Gesandter beim Bundestag, wo er für die
Einigung Deutschlands unter Preußens Führung zu wirken
suchte, und starb 9. Juli 1863 in Koburg. Vgl. die von seinem Sohn
Ernst von S. (geb. 7. Aug. 1823, gest. 6. Mai 1886) herausgegebenen
"Denkwürdigkeiten aus den Papieren des Freiherrn Chr. F. v.
S." (Braunschw. 1872); Juste, Le baron S. (Brüssel 1873).
Stockmorchel, s. Helvella.
Stockport, Fabrikstadt in Cheshire (England), 8 km
südöstlich von Manchester, am Mersey, über den
fünf Brücken und ein großartiger Eisenbahnviadukt
führen, alt, aber erst in neuerer Zeit infolge der
Baum-wollindustrie zu einer volkreichen Stadt herangewachsen. Sie
ist auf unebenem Terrain unregelmäßig gebaut, hat eine
große eiserne Markthalle, ein Theater, eine Freibibliothek u.
großartige Baumwollindustrie,
341
Stockrose - Stoffwechsel.
ferner Fabriken von Hüten, Maschinen, Bürsten, Eisen-
und Messingwaren und (1881) 59,553 Einw.
Stockrose, s. Althaea.
Stockschnupfen, s. Schnupfen.
Stockschwamm, s. Agaricus V.
Stockflößer, s. Sperber.
Stockteilung, Vermehrungsmethode bei Stauden und kleinen
Sträuchern mit vielen Trieben, besteht im Zerschneiden des
Wurzelstocks in so viele Teile, als sich Triebe oder Knospen daran
befinden.
Stockton, Stadt im nordamerikan. Staat Kalifornien, am
schiffbaren San Joaquin, inmitten eines der ergiebigsten
Weizengebiete, mit 2 Irrenanstalten, bedeutendem Handel und (1880)
10,282 Einw.
Stockton on Tees (spr. tihs), Stadt in der engl.
Grafschaft Durham, am Tees, 6 km oberhalb Middlesbrough , mit South
S. (Yorkshire) durch eine Brücke verbunden. Beide zusammen
haben (1881) 41,015 Einw. S. hat Segeltuchfabriken , Seilerbahnen,
Schiffswerfte, Hochöfen, Gießereien, Glashütten
etc. Zum Hafen gehörten 1887: 26 Seeschiffe von 10,323 Ton.;
Wert der Einfuhr vom Ausland 192,923 Pfd. Sterl., der Ausfuhr
27,641 Pfd. Sterl. S. ist Sitz eines deutschen Konsulats.
Nördlich davon Wynyard, Sitz des Grafen Clarendon.
Stockwerk, in der Baukunst s. Geschoß.
Stockwerksbau, s. Bergbau, S. 725.
Stockwerksporphyr, s. Greisen.
Stoddard, Richard Henry, amerikan. Dichter und
Schriststeller, geb. 2. Juli 1825 zu Hingham (Massachusetts), kam
mit zehn Jahren nach New York, wo er bei einem Erzgießer in
die Lehre gegeben wurde, begann aber früh sich als Mitarbeiter
an Zeitschriften litterarisch zu bethätigen. Von 1853 an
bekleidete er eine Stelle beim Steueramt zu New York, bis er zu
Anfang der 70er Jahre Stadtbibliothekar von New York wurde. Als
Dichter hat S. mit besonderm Erfolg das Gebiet kleiner, sangbarer
Lieder angebaut, die nicht selten an den Ton deutscher Volkslieder
erinnern. Wir nennen von seinen zahlreichen
Veröffentlichungen, die außer poetischen Sachen
hauptsächlich populär-historische Werke umfassen:
"Footprints", Gedichte (1849); "Poems "(1850); "Adventures in
fairy-land", Kindermärchen (1853); "Songs of summer" (1857);
"Town and country" (1857); "Life, travels and books of Alexander
von Humboldt" (1859); "Loves and heroines of the poets", geistvoll
geordnete Sammlung englischer Liebesgedichte (1860); "The king's
bell" (1863); "The story of little Red Riding Hood" (1864); "Under
green leaves" (1865); "The children in the wood" (1866); "Putnam,
the brave" (1869); "The book of the East, and other poems" (1871);
schließlich das wichtige "Memoir of Edgar Allan Poe" (1875),
die "Anecdote biography of Percy B. Shelley" (1876) und "H. W.
Longfellow" (1882). Seine gesammelten "Poetical works" erschienen
1880.
Stoff, s. Materie.
Stoffdruckerei, s. Zeugdruckerei.
Stoffe, s. Gewebe.
Stoffel, Eugène Georges Henri Céleste,
Baron von, franz. Offizier, geb. 1. März 1823 zu Arbon im
Thurgau, erhielt seine Bildung auf der polytechnischen Schule zu
Paris, trat in die Artillerie und zog 1856 durch ein
"Militärisches Wörterbuch" die Aufmerksamkeit des Kaisers
Napoleon III. auf sich, der ihn zu verschiedenen Missionen
verwendete und ihn 1866 als Oberstleutnant und
Militärattaché bei der kaiserlichen Botschaft nach
Berlin schickte. Von hier erstattete er 1866 bis Juli 1870
eingehende, sehr sachkundige Berichte über das deutsche
Heerwesen nach Paris, welche den Kaiser vom Kriege gegen
Deutschland hätten abhalten müssen, wenn sie
gebührend gewürdigt worden wären. Sie wurden nach
dem 4. Sept. 1870, zum Teil noch versiegelt, in den Tuilerien
aufgefunden und 1871 veröffentlicht ("Rapport militaire
écrit de Berlin", Par. 1871; deutsch, Berl. 1872). Im Krieg
1870/71 war S. zuerst in der Operationskanzlei des Kaisers, entkam
nach der Kapitulation von Sedan, befehligte beim Ausfall von Paris
30. Nov. bis 2. Dez. 1870, dann auf dem Mont Avron mit Auszeichnung
die Artillerie, ward aber, weil er Thiers' Armeereorganisation
opponierte und eifriger Bonapartist war, nicht befördert und
nahm 1872 seinen Abschied, ja er wurde wegen Beleidigung des
Berichterstatters im Prozeß Bazaine, des Generals
Rivière, 1873 zu drei Monaten Gefängnis verurteilt. Er
setzte die Geschichte Cäsars von Napoleon III. fort ("Histoire
de Jules César: guerre civile", Par. 1887, 2 Bde.).
Stoffmühle, s. v. w. Holländer, s. Papier, S.
674.
Stoffwechsel, die Gesamtheit der chemischen Vorgänge
im Organismus, auf welchen die Lebenserscheinungen beruhen, und
durch welche der Organismus als solcher erhalten wird. Der
Organismus lebt, indem er fortwährend Stoffe aufnimmt, diese
umwandelt, assimiliert und in integrierende Teile seines
Körpers verwandelt, während andre, ältere Teile des
Körpers aus dem Verband, in welchem sie bis dahin standen,
ausscheiden, umgewandelt und aus dem Körper entfernt werden.
Unterscheidet sich das Reich der Organismen von der unbelebten
Natur wesentlich durch den S., so sind wieder Pflanzen und Tiere
durch die besondere Art des Stoffwechsels voneinander verschieden,
aber so, daß sie durch diese Verschiedenheit innig
zusammenhängen. Die Pflanzen nehmen aus Luft und Boden
anorganische Verbindungen (Kohlensäure, Wasser und Ammoniak
oder Salpetersäure und gewisse Salze) auf und bilden unter dem
Einfluß des Lichts und unter Abscheidung von Sauerstoff
organische Verbindungen von zum Teil sehr komplizierter
Zusammensetzung. Über die hierbei verlaufenden Prozesse wissen
wir sehr wenig. Aus Kohlensäure und Wasser entstehen
Kohlehydrate, Fette und andre Verbindungen, durch Einwirkung von
Ammoniak auf einige derselben wahrscheinlich die weitverbreiteten
Amidosubstanzen und aus diesen eiweißartige Körper. Die
Pflanzen atmen aber auch: sie nehmen Sauerstoff auf, und unter
dessen Einfluß wird ein Teil der gebildeten organischen
Substanz oxydiert. Immerhin tritt dieser Prozeß gegen den der
Ernährung, der Bildung organischer Substanz, stark
zurück, und so präsentiert sich der S. der Pflanze
wesentlich unter dem Bild eines Reduktionsprozesses, bei welchem
lebendige Kraft (die Wärme der Sonnenstrahlen) in Spannkraft
umgesetzt wird. Im Gegensatz zu den Pflanzen nehmen die Tiere als
Nahrungsmittel wesentlich organische Stoffe auf, direkt oder
indirekt die wichtigsten Pflanzenbestandteile; sie sind nicht im
stande, wie die Pflanzen, aus unorganischen Stoffen synthetisch
organische zu bilden, vielmehr bedürfen sie der letztern, die
nach verhältnismäßig geringer Wandlung zu
Bestandteilen des tierischen Organismus werden und dann einer
rückschreitenden Metamorphose unterliegen, unter Mitwirkung
des eingeatmeten Sauerstoffs oxydiert und in Form sehr einfacher
chemischer Verbindungen ausgeschieden werden. Der tierische S. ist
mithin im wesentlichen ein Oxydationsprozeß, als dessen
Endglieder Kohlensäure, Wasser und Ammoniak, die Nah-
342
Stoffwechsel - Stoffwechselgleichungen.
rungsstoffe der Pflanzen, auftreten. Die von den Pflanzen
aufgespeicherte Spannkraft gibt das Tier hauptsächlich in Form
von Wärme und Arbeit wieder aus. Die zum Teil sehr
verwickelten Vorgänge des tierischen Stoffwechsels sind noch
wenig bekannt. Die Nahrungsstoffe: Eiweißkörper, Fette,
Kohlehydrate, Salze, werden durch die Verdauungssäfte mehr
oder weniger verändert, die Produkte werden dem Blut und durch
dieses den Geweben zugeführt, um letztere zu ernähren.
Gleichzeitig findet eine Abnutzung der Gewebe statt, die
Abnutzungsprodukte gelangen in das Blut, unterliegen hier einer
weitern Umbildung und werden schließlich ausgeschieden: die
stickstoffhaltigen Substanzen wesentlich in der Form von Harnstoff
(der leicht in Kohlensäure und Wasser zerfällt) durch die
Nieren, die schwefelhaltigen durch die Leber, die letzten
Oxydationsprodukte, Kohlensäure und Wasser, durch Lunge und
Haut. Die Energie, mit welcher der S. verläuft, ist sehr
verschieden. Der Säugling verbraucht an Nahrungsmitteln
täglich 1/7 seines Körpergewichts, später 1/5, der
Erwachsene 1/20. Während des Schlafs ist der S. wesentlich
vermindert, bei Bewegung und Arbeit beträchtlich erhöht,
aber auch im hungernden Tier steht der S. nicht still, der
hungernde Organismus lebt von sich selbst, bis die
Möglichkeit, dies zu thun, erschöpft ist. Da das
Körpergewicht des erwachsenen und gesunden tierischen
Körpers konstant bleibt, so müssen die durchschnittlichen
täglichen Zufuhren genau die durchschnittlichen Ausgaben
decken, es muß ein Zustand des Gleichgewichts zwischen
Einnahmen und Ausgaben vorhanden sein, und in der That haben genaue
Versuche ergeben, daß bei Berechnung des Gehalts der Nahrung
und der Ausscheidungsstoffe an Kohlenstoff, Wasserstoff,
Sauerstoff, Stickstoff und Salzen im wesentlichen dieselben Zahlen
erhalten werden. Ein gut beköstigter gesunder Mensch verliert
in 24 Stunden bei mäßig bewegter Lebensweise durch die
Atmung etwa 32, die Hautausdünstung 17, den Harn 46,5, den Kot
4,5 Proz. der gesamten Exkretionsmasse, und zwar scheidet die
Atmung aus: Wasser 330, Kohlensäure 1230, die
Hautausdünstung Wasser 660, Kohlensäure 9,8, der Harn
Wasser 1700, Harnstoff 40, Salze 26 g, der Kot Wasser 128, andre,
meist organische Substanzen 53 g. Die Bilanz zwischen Einnahmen und
Ausgaben des Körpers bezieht sich auf den
Durchschnittsmenschen, der weder ungewöhnlichen
äußern Einflüssen ausgesetzt ist, noch von
einzelnen Funktionen, namentlich der Muskelthätigkeit, einen
einseitigen Gebrauch oder Nichtgebrauch macht. Derselbe vollbringt
ein bestimmtes Mittelmaß der Leistungen, d. h. von innern
Bewegungen, von nach außen übertragener mechanischer
Arbeit und von Wärmeeinheiten. Für die beiden letztern
Verausgabungen verlangt er ein bestimmtes Äquivalent an
Zufuhren. Dafür ist er im stande, diese Leistungen Tag
für Tag in derselben Größe zu wiederholen, ohne
daß sein Körpergewicht oder die proportionale Menge der
Einzelbestandteile seines Körpers wesentliche
Veränderungen erleidet. Dieses Durchschnittsverhältnis
kann aber bedeutend abgeändert werden, und zwar entweder durch
Veränderung der Zufuhren, dann ändern sich natürlich
auch die Leistungen, ja unter Umständen sogar der Körper
selbst; oder durch Veränderung der Leistungen, welche nun
wiederum eine entsprechende Modifikation der Zufuhren erheischt.
Wenn die Zufuhren steigen, so sind zwei Erfolge möglich.
Entweder nehmen die Verausgabungen in äquivalenter Weise zu,
der Körper leistet jetzt mehr (an mechanischer Arbeit und
Wärmebildung), aber er verändert sein Gewicht nicht; oder
die Verausgabungen steigen nicht oder doch nicht in gleichem Grad
mit der Zufuhr, dann vermehrt sich das Körpergewicht, es wird
mehr Stoff angesetzt. Werden die Zufuhren mäßig
gemindert, so zehrt der Körper, insoweit das Bedürfnis
nicht von außen her gedeckt wird, aus eigne Kosten, er
verliert allmählich an Gewicht. Mit Abnahme der
Körpermasse sinken auch die Umsetzung gen, überhaupt die
Leistungen; es muß aber ein Punkt kommen, wo die geminderten
Zufuhren hinreichen, die nunmehrigen Verausgabungen zu decken. Auf
diesem neuen Beharrungszustand bleibt der mager gewordene
Körper stehen, und zwar, wenn die Zufuhren nur eine
mäßige Herabsetzung erfahren haben, im Zustand relativer
Gesundheit. Werden endlich die Zufuhren bedeutend geschmälert
oder gänzlich aufgehoben, so magert der Körper ab, um so
schneller, je beträchtlicher die Nahrungsentziehung; er wird
immer leistungsunfähiger und geht endlich dem Hungertod
entgegen. Der Gesamtstoffwechsel bewegt sich auch im normalen
Zustand innerhalb einer bedeutenden Breite, das Körpergewicht
wechselt nicht unbeträchtlich. Damit gehen aber auch
Schwankungen der Funktionen Hand in Hand; doch gibt es
genügende Ausgleichungsmittel, welche das Bestehen des
Organismus sichern und ihn den jedesmaligen Verhältnissen
anpassen. Eins der wichtigsten Ausgleichungsmittel besteht darin,
daß der schlecht genährte Körper wenig, der reich
beköstigte viel verausgabt. Auch die Individualität ist
von dem verschiedensten und mannigfachsten Einfluß auf den S.
Der Einfluß des Körperzustandes auf die Intensität
und Richtung des Stoffwechsels tritt besonders hervor in gewissen
Krankheiten, wo der S. manchmal ganz sein gewohntes Geleise
verlassen hat, z. B. in der Zuckerharnruhr. Besonders interessante
Beispiele hierfür bieten die heftigern Fiebergrade. Beim
Unterleibstyphus z. B. kann die tägliche Harnstoffmenge auf
fast das Doppelte steigen, obschon der Kranke sich nicht bewegt und
die stickstoffhaltige Zufuhr so gut wie vollständig
abgeschnitten ist, er sich also unter Bedingungen befindet, unter
welchen der normale Körper nur sehr wenig Harnstoff bilden
würde. So verschieden auch der S. sich gestalten mag infolge
äußerer Verhältnisse oder im Individuum selbst
liegender Ursachen, so handelt es sich doch dabei im wesentlichen
immer um dieselben Vorgänge und zwar sogar unter der
abweichendsten Bedingungen der Ernährung. Das hungernde Tier
so gut wie das wohlgenährte scheidet Harnstoff,
Kohlensäure und Wasser aus. Das Tier mag ausschließlich
von Fleischnahrung oder von Pflanzenkost leben, der Organismus mag
gesund oder schwer erkrankt sein, er mag gemästet oder
gehörig genährt, unzureichend beköstigt oder im
Verhungern begriffen sein: er lebt zunächst immer nur auf
Kosten seiner eignen Bestandteile. Der S. wird somit zunächst
ausschließlich bestimmt durch den jedesmaligen Zustand der
Gewebe, Organe und Säfte des Körpers, und die uns noch
unbekannten vitalen Energien der Gewebe und Organe geben bei der
Bestimmung des Stoffumsatzes, der Anbildung wie der
Rückbildung, sowohl in Bezug auf Qualität als
Quantität den Hauptausschlag. Vgl. Moleschott, Der Kreislauf
des Lebens (5. Aufl., Mainz 1876-86, 2 Bde.); Voit, Physiologie des
allgemeinen Stoffwechsels und der Ernährung (Leipz. 1881);
Wilckens, Briefe über den tierischen S. (Bresl. 1879); Seegen,
Studien über S. (Berl. 1887).
Stoffwechselgleichungen, s. Respirationsapparat.
343
Stohmann - Stokes.
Stohmann, Friedrich Karl Adolf, Agrikulturchemiker und
Technolog, geb. 25. April 1832 zu Bremen, studierte in
Göttingen und London, war 1853-1855 Assistent von Graham und
arbeitete in der Folge in mehreren chemischen Fabriken. 1857 wurde
er Assistent von Henneberg erst in Celle, dann in Weende bei
Göttingen, und hier beteiligte er sich an den klassischen
Untersuchungen Hennebergs über die Ernährung der
Haustiere. 1862 begründete er die landwirtschaftliche
Versuchsstation in Braunschweig, 1865 folgte er einem Ruf nach
München, ging aber noch in demselben Jahr nach Halle und
übernahm 1871 die Leitung des
landwirtschaftlich-physiologischen Instituts in Leipzig. Er
schrieb: "Handbuch der technischen Chemie" (auf Grundlage von
Payen, Précis de chimie technique, mit Engler, Stuttg.
1870-1874, 2 Bde.); "Biologische Studien" (Braunschw. 1873);
"Handbuch der Zuckerfabrikation" (2. Aufl., Berl. 1885); "Die
Stärkefabrikation" (das. 1878); "Encyklopädisches
Handbuch der technischen Chemie" (auf Grundlage von Muspratts
"Chemie", 4. Aufl. mit Kerl, Braunschw. 1886 ff.).
Stöhrer, Emil, Mechaniker, geb. 25. Sept. 1813 zu
Delitzsch, lernte bei Wießner in Leipzig und gründete
1846 daselbst ein eignes Geschäft, welches er 1863 seinem Sohn
Emil (geb. 2. März 1840) Übergab. Er gründete darauf
in Dresden ein zweites Geschäft, speziell für
elektro-therapeutische Apparate, übergab dasselbe 1880
ebenfalls seinem Sohn, mußte aber nach dessen Tod, 26. Dez.
1882, beide Geschäfte wieder übernehmen. Er konstruierte
weitverbreitete Batterien und Induktionsapparate und 1846 den
ersten mit Wechselströmen eines Magnetinduktors betriebenen
Zeigertelegraphen, auch einen elektrochemischen und
elektromagnetischen Doppelschreiber.
Stoiker, griech. Philosophenschule, welche sich
gleichzeitig mit dem Epikureismus entwickelte und ihren Namen von
dem Säulengang (stoa) hat, wo der Gründer derselben,
Zenon aus Kittion auf Kypros, in Athen zu lehren pflegte (340-260
v. Chr.). Zenons Lehrbegriff ward zum Teil im Kampf mit der
jüngern Akademie durch seine nächsten Schüler und
Anhänger, Kleanthes aus Assos in Troas, Chrysippos aus Soli in
Kilikien (280-210), bestimmter ausgebildet, während andre, wie
Ariston aus Chios und Heryllos aus Karthago, sich ihm vorzugsweise
nur in der Strenge der sittlichen Denkart angeschlossen zu haben
scheinen. Ein allgemeines Merkmal der Lehre der S. liegt in dem
Bemühen, die Philosophie in einer einfachen und
gemeinverständlichen Form und mit vorherrschender
Rücksicht auf das praktische Leben zu entwickeln, daher die
eigentliche Bedeutung derselben in ihrer Ethik zu suchen ist,
welcher sie zwar die Physik beiordnen, weil diese die allgemeinsten
Grundbestimmungen für jene darbiete, die Logik aber
unterordnen, so daß diese ihnen mehr für ein Werkzeug
als für einen Teil der Philosophie gilt. In der Logik ward die
Erfahrung als Grundlage aller Erkenntnis statuiert, insofern alle
Vorstellungen in einem Leiden der Seele durch den Eindruck des
Vorgestellten bestehen sollen. In Übereinstimmung hiermit geht
auch ihre Physik von dem Satz aus, daß alles, was Ursache
sei, Körper sei, welcher Begriff bei ihnen wesentlich durch
den Gegensatz von Thun und Leiden bestimmt wird.
Demgemäß unterscheiden sie die Materie als das
qualitätslose leidende und Gott als das thätige und
bildende Prinzip, so jedoch, daß nicht das eine wirklich
getrennt von dem andern existiere, sondern die wirkliche Kraft in
dem Stoff selbst vorhanden sei. So wie daher die Welt
vernünftig und göttlich ist, so hat auch jeder einzelne
Teil seinen besondern Anteil an der allgemeinen Vernunft. Diese
bestimmte schon Zenon, sich an die Naturlehre des Heraklit
anschließend, als ein denkendes, lebendiges Feuer, welches
sich in stetigen Übergängen und nach einem bestimmten
unausweichlichen Gesetz in die Elemente und die daraus entstehenden
besondern Bedingungen verwandle, um nach periodischem Kreislauf
wieder in die ursprüngliche Einheit zurückzukehren
(Weltverbrennung). In genauem Zusammenhang mit dieser Physik steht
der oberste Grundsatz der Ethik, welcher für deren
höchsten Endzweck die Übereinstimmung mit der Natur
erklärt. Die Unabhängigkeit der sittlichen Gesinnung
stellten sie der äußerlich erscheinenden Handlung und
deren zufälligen Umständen gegenüber. Einer
selbständigen Fortbildung war das System an sich nicht
fähig. Die wesentlichste Umbildung erfuhr die stoische Lehre
durch Panaitios und Posidonios, welche auch hauptsächlich ihre
Verpflanzung nach Rom bewirkten. Durch Wechselwirkung der stoischen
Philosophie und des römischen Geistes aufeinander entwickelte
sich hier aus ersterer eine räsonnierende praktische
Popularphilosophie von zum Teil fromm-erbaulichem Charakter. Unter
dem Despotismus der Cäsaren erhielt der Stoizismus eine
politische Bedeutung, denn zu ihm flüchteten sich
größtenteils die Oppositionsmänner; er wurde ein
Gegenstand der Verfolgung, bis er mit Marcus Aurelius Antoninus auf
den Kaiserthron kam und kaiserliche Fürsorge demselben noch
einmal Geltung und Anhang erwarb. Nach der Zeit der Antonine
verschwindet er völlig aus der Geschichte, in dem allgemeinen
philosophischen und religiösen Synkretismus aufgehend, in
welchen die antike Weltanschauung sich auflöste. Vgl.
Tiedemann, System der stoischen Philosophie (Leipz. 1776, 3 Bde.);
Ravaisson, Essai sur le stoicisme (Par. 1856); Noack in der
Zeitschrift "Psyche", Bd. 5 (Leipz. 1862); Winckler, Der Stoizismus
(das. 1878); Weygoldt, Die Philosophie der Stoa (das. 1883) ;
Ogereau, Essai sur le système philosophique des stoiciens
(Par. 1885); L. Stein, Die Psychologie der Stoa (Berl. 1886-88, 2
Bde.); Zeller, Philosophie der Griechen, Bd. 3.
Stoische Philosophie, s. Stoiker.
Stoizismns, Lehre der Stoiker (s. d.); streng moralisches
oder vielmehr finsteres, freudenloses Leben.
Stoke Poges (spr. stohkpódschis), Dorfin
Buckinghamshire (England), bei Slough, mit Denkmal des Dichters
Gray, der hier seine Elegie schrieb, u. 109 Einw.
Stokes (spr. stohks), 1) George Gabriel, Mathematiker und
Physiker, geb. 13. Aug. 1819 zu Skreen in Irland, studierte zu
Cambridge und wurde 1849 Professor der Mathematik daselbst. Seit
1854 ist er auch Sekretär der Royal Society. S.' Arbeiten
erstrecken sich über das Gebiet der reinen Mathematik, der
Mechanik und der mathematischen und experimentellen Physik. Seine
theoretischen Untersuchungen beschäftigen sich
hauptsächlich mit Hydrodynamik, der Theorie des Lichts und der
Theorie des Schalles, seine experimentellen Arbeiten vorwiegend mit
den Erscheinungen des Lichts. Eine seiner hervorragendsten Arbeiten
ist die über die Fluoreszenz des Lichts, deren Natur er zuerst
erkannte. Die frühern Beobachter, Brewster und Herschel,
glaubten in der Erscheinung eine eigentümliche Zerstreuung des
Lichts zu erkennen; S. wies aber nach, daß die
fluoreszierenden Substanzen in der That selbst leuchtend werden,
indem sie das auf sie treffende Licht in sich aufnehmen, und indem
dadurch die Moleküle der Körper in Schwingungen geraten.
S. begründete durch diese Ar-
344
Stokessche Regel - Stolberg.
beiten gleichzeitig die richtige Theorie der Absorption des
Lichts. In der Folge beschäftigte er sich viel mitder
Absorptions-Spektralanalyse und untersuchte den ultravioletten Teil
des Spektrums. Gesammelt erschienen seine "Mathematical and
physical papers" (Cambr. 1880-83, 2 Bde.), deutsch die Vorlesungen:
"Das Licht" (Leipz. 1888).
2) Whitley, engl. Keltolog, geb. 28. Febr. 1830, studierte in
Dublin Rechtswissenschaft und Philologie, insbesondere Keltologie,
begab sich als Barrister 1862 nach Indien (Madras), wurde zwei
Jahre später zum Sekretär des Legislative Council zu
Kalkutta ernannt und war 1877-82 Law Member of the Council of the
governor general of India (s. v. w. Justizminister), in welcher
Stellung er sich um die Gesetzgebung Indiens große Verdienste
erwarb. Seine wichtigsten keltologischen Arbeiten sind: "Irish
glosses" (Dubl. 1860); "Three Irish glossaries" (Kalk. 1868);
"Goidelica", Sammlung altirischer Texte (2. Aufl., Lond. 1872);
"Fis Adamnain" (Simla 1870); "A Cornish glossary" (Lond. 1870);
"The life of Saint Meriasek, a Cornish drama" (das. 1872);
"Middle-Breton hours" (Kalk. 1876); "Three middle Irish homilies"
(das. 1879); "Togail Troi. The destruction of Troy" (das. 1881);
"On the calendar of Oengus" (Dubl. 1881); "Saltair na Rann" (Oxf.
1883). Neuerdings erschienen von ihm "The Anglo-Indian codes"
(Lond. 1887-88, 2 Bde.).
Stokessche Regel, s. Fluoreszenz.
Stoke upon Trent (spr. stóhk oponn trent),
schmutzige Stadt in Staffordshire (England), im Distrikt der
Potteries (s. d.), hat einen großartigen Bahnhof (mit den
Bildsäulen Wedgwoods und Mintons), ein Athenäum, eine
Kunstschule, Fabriken für Porzellan und Steingut (Minton,
Copeland and Sons u. a.) und (1881) 19,261 Einw.
Stola (lat.), langes, faltiges, bis auf die Knöchel
herabreichendes und unten mit einer Falbel (instita) verziertes
Kleid der römischen Frauen, das auch vom Pontifex maximus
getragen ward; jetzt Festgewand der katholischen Geistlichen, bei
denen es jedoch nur aus einer langen Binde von weißer Seide
oder Silberstoff besteht, die, mit drei Kreuzen am Ende versehen,
bei den Priestern über beide Schultern und die Brust
kreuzweise, bei den Diakonen bloß über die linke
Schulter nach der rechten Hüfte zu herabhängt (s. Alba,
Abbild.). Ein ähnliches Gewandstück trugen auch die
ältern französischen und englischen Könige.
Stolac, Bezirksstadt in Bosnien (Kreis Moftar), an der
Bregava, hat eine weitläufige, mit Türmen versehene
uralte Burg, ein Bezirksgericht, (1885) 3397 meist mohammedan.
Einwohner und Weinbau.
Stolberg (Stollberg), ehemalige Grafschaft am
südlichen Fuß des Harzes, deren Gebiet, 429 qkm (7,8
QM.) mit 33,000 Einw., seitdem die Landeshoheit auf Preußen
übergegangen ist (seit 1815), zwei Standesherrschaften,
S.-Stolberg und S.-Roßla, im Regierungsbezirk Merseburg,
Kreis Sangerhausen, bildet. - Die Stadt S. (S. am Harz), Hauptort
der Standesherrschaft S.-Stolberg, in einem engen Waldthal an der
Tyra, 297 m ü. M., hat eine evang. Kirche, ein gräfliches
Konsistorium, ein Waisenhaus, ein Amtsgericht, Bergbau auf Eisen
und Kupfer, eine Zigarren- und eine Pulverfabrik, 2
Sägemühlen und (1885) 2140 Einw. über der Stadt das
gräfliche Residenzschloß mit ansehnlicher
Bibliothek.
Stolberg (Stollberg), Stadt im preuß.
Regierungsbezirk und Landkreis Aachen, an der Vicht, Knotenpunkt
der Linien M'Gladbach-S., Langerwehe-Herbesthal, S.-Alsdorf,
Stolberger Thalbahn, Eschweiler-Velau, S.-Münsterbusch und
Morsbach-S. der Preußischen Staatsbahn, hat 2 evangelische
und 2 kath. Kirchen, ein uraltes Schloß (nach der Sage
Jagdschloß Karls d. Gr.), ein Amtsgericht, eine
Handelskammer, Sayettspinnerei, großartige Zink- und
Messingindustrie, Eisengießereien, Dampfkesselfabriken,
Bleihütten, Kupferhämmer, Glasfabriken mit
Glasschleiferei, ein Walzwerk, Fabriken für Spiegelglas,
Maschinen, Nähnadeln, Haken und Schlingen, Messing- u.
Eisendraht, ferner Gerberei, Kalkbrennerei, Seifensiederei, eine
große chemische Fabrik (Waldmeisterhütte) der
Gesellschaft Rhenania, Bergbau auf Steinkohlen, Eisen, Blei, Galmei
und Zinkblende und (1885) 11,835 meist kath. Einwohner. Die
Messingindustrie der Stadt wurde im 16. und 17. Jahrh. durch aus
Frankreich und Aachen vertriebene Protestanten begründet.
Stolberg, altadliges Geschlecht aus Thüringen,
welches bis ins 11. Jahrh. zurückreicht, und dessen Stammland
die Grafschaft S. in Thüringen ist. Schon 1412 in den
Reichsgrafenstand erhoben, vermehrte es seinen Besitz durch
Erwerbung der Grafschaften Hohnstein, Wernigerode, Königstein,
von welch letzterer jetzt nur noch Gedern und Ortenberg dem Haus
angehören, Wertheim und Rochefort in Belgien, die 1801
verloren ging, sowie des hennebergischen Fleckens Schwarza. Von den
beiden Linien, in welche sich das Geschlecht früher teilte,
der Harz- und der Rheinlinie, erlosch erstere 1631. Letztere teilte
sich 1645 in die Linien: S.-Wernigerode, S.-Stolberg und
S.-Roßla. Die erste hat außer der Grafschaft
Wernigerode im Harz nebst Schwarza noch große Besitzungen in
Schlesien, dem Großherzogtum Hessen und Hannover und wird
gegenwärtig durch Graf Otto von S., geb. 30. Okt. 1837,
repräsentiert (s. S.-Wernigerode 2). Dieser Linie
gehörten an: Graf Ferdinand von S., geb. 18. Okt. 1775, gest.
20. Mai 1854 in Peterswaldau als preußischer Geheimrat, und
Graf Anton von S., geb. 23. Okt. 1785, gest. 11. Juli 1854, der bis
1840 Oberpräsident der Provinz Sachsen und von 1842 bis 1848
zweiter Chef des Ministeriums des königlichen Hauses war.
Dessen Sohn war Graf Eberhard von S., gest. 1872 (s. S.-Wernigerode
1). Die Linie S.-Stolberg, die ein Areal von 200 qkm besitzt,
blüht in dem Hauptast, repräsentiert durch den Grafen
Alfred von S., geb. 23. Nov. 1820, preußischen Standesherrn,
und einem Nebenast, dessen Chef derzeit Graf Günther von S.,
geb. 22. Nov. 1820, ist. Ein Oheim desselben war Graf Joseph von
S., geb. 12. Aug. 1804, gest. 5. April 1859 in Mecheln, bekannt
durch die Stiftung des Bonifaciusvereins (s. d.). Der Stifter
dieses Nebenastes war Graf Christian Günther von S., gest. 22.
Juni 1765 als dänischer Geheimrat, der Vater der als Dichter
bekannten Grafen Christian und Friedrich Leopold zu S. Die Linie
S.-Roßla, deren Besitzungen in Preußen, dem
Großherzogtum Hessen und Anhalt 300 qkm betragen, wird
gegenwärtig durch Graf Botho August Karl, Standesherrn in
Preußen und Hessen, geb. 12. Juli 1850, vertreten. Vgl. Graf
Botho zu S.-Wernigerode, Geschichte des Hauses S. 1210-1511
(Magdeb. 1883) ; Derselbe, Regesta Stolbergica (das. 1886).
Stolberg, 1) Christian, Graf zu, Dichter, der Linie
S.-Stolberg angehörig, geb. 15. Okt. 1748 zu Hamburg, Sohn des
Grafen Christian Günther, studierte seit 1769 in Halle,
1772-74 in Göttingen, wo er dem Göttinger Dichterbund (s.
d.) beitrat, erhielt 1777 die Amtmannsstelle zu Tremsbüttel in
Holstein und vermählte sich hier mit der in vielen
345
Stolberger Diamanten - Stolberg-Wernigerode.
seiner Gedichte gefeierten Luise, Witwe des
Hofjägermeisters v. Gramm, einer gebornen Gräfin von
Reventlow. Nach 23jähriger musterhafter Verwaltung
seines Amtes legte er dasselbe (1800) nieder und lebte
fortan auf seinem Gut Windebye bei Eckernförde. Er
starb 18. Jan. 1821. Seine kleinern "Gedichte" (Elegien, Lieder,
Balladen etc.) sind mit denen seines Bruders zuerst 1779 in Leipzig
(neue Aufl. 1822) erschienen; ebenso die "Schauspiele mit
Chören" (1787), von
denen ihm "Belsazar" und "Otanes" angehören. Beiden
Brüdern gemeinsam waren auch die "Vaterländischen
Gedichte" (Hamb. 1810, 2. Aufl. 1815), in
welchen sie freilich an die neue Zeit einen veralteten
Maßstab legten. Christian lieferte außerdem "Gedichte
aus dem Griechischen" (Hamb. 1782) und eine
Übersetzung des Sophokles (Leipz. 1787, 2 Bde.) in
fünffüßigen Iamben, Übertragungen, die
für ihre Zeit nicht ohne Wert waren. Seine sämtlichen
poetischen Arbeiten befinden sich in der Ausgabe der
"Werke der Brüder S." (Hamb. 1820-25, 20 Bde.);
eine Auswahl aus den Gedichten beider gab Kreiten heraus
(Paderb. 1889).
2) Friedrich Leopold, Graf zu, jüngerer Bruder des vorigen,
Dichter und Schriftsteller, geb. 7.
Nov. 1750 in dem holsteinischen Flecken Bramstedt, gehörte
in Göttingen, wo er von 1772 an studierte,
gleichfalls zu dem erwähnten Dichterbund. Nach Beendigung
der Universitätsstudien wurde er als königlicher
Kammerjunker dem dänischen Hof attachiert
und bekleidete später (1777) den Posten eines Lübecker
Geschäftsträgers bei der dänischen Regierung.
Vermählt (1782) mit der mehrfach von ihm besungenen Agnes,
einer Gräfin von Witzleben, lebte er mehrere Jahre ganz seinem
häuslichen Glück und den Musen. Nach dem Tod seiner
Gattin bekleidete er den Gesandtschaftsposten in Berlin und schritt
hier 1790 zu
einer zweiten Vermählung mit der Gräfin Sophie von
Redern. Von Berlin ging er 1791 als Präsident der
fürstbischöflichen Regierung nach Eutin, wo er mit
Voß den alten Bund der Freundschaft neu knüpfte
und durch ihn wieder zu litterarischer Thätigkeit
angespornt wurde. Nach einer Reise durch die Schweiz und Italien
legte er 1800 seine sämtlichen Ämter nieder, zog nach
Münster und trat mit Weib und Kindern (die älteste,
später dem Grafen Ferdinand von S.-Wernigerode vermählte
Tochter ausgenommen) zur römisch-katholischen Kirche
über. Von Stolbergs alten Freunden machten namentlich
Voß und Jacobi ihrem Unwillen über den Abtrünnigen
durch den Druck, ersterer auf ebenso derbe und bittere wie
letzterer auf eine würdevolle Weise, Luft. Stolbergs
litterarische Thätigkeit beschränkte sich seitdem
vorzugsweise auf seine "Geschichte der Religion Jesu
Christi" (Hamb. 1807-18, 15 Bde.; fortgesetzt von Fr. v. Kerz,
Bd. 16-45, Mainz 1825-48, und von Brischar, Bd. 46-53, das.
1850-64) und ein tendenziös gefärbtes "Leben Alfreds d.
Gr." (Münst.
1815, 2. Aufl. 1837), Werke, die durchgehend von
der geistigen Befangenheit ihres Urhebers zeugen, und auf
asketische Produkte, die kein Blatt in feinen Lorbeerkranz flechten
konnten. "Gedichte", "Schauspiele mit Chören" und
"Vaterländische Gedichte"
gab er mit seinem Bruder gemeinsam heraus. Stolbergs Lyrik ist
vielfach altertümelnd, in ihrer Freiheitsbegeisterung ganz vag
und phrasenhaft, oft gesucht einfachen Gepräges; sie stand im
allgemeinen noch unter den Einwirkungen Klopstocks. Als Prosaiker
versuchte er sich auch in einem Roman: "Die Insel" (1788), und
einer weitschweifigen "Reise durch Deutschland, die Schweiz,
Italien u. Sizilien" (1794);
als Übersetzer trat er mit der ersten Übertragung der
Iliade, einer vorzüglichen Nachdichtung von vier
Tragödien des Äschylos und mehreren Schriften Platons
hervor. S. starb 5. Dez. 1819 auf dem Gut Sondermühlen bei
Osnabrück, nachdem er kurz zuvor "Ein Büchlein von der
Liebe" (Münst. 1820, 5. Aufl. 1877)
vollendet hatte. Seine Schriften nehmen den größten
Teil der "Werke der Brüder S." (Hamb. 1820-1825, 20 Bde.) ein.
Vgl. Nicolovius, F. L., Graf
zu S. (Mainz 1846), mehr apologetische Parteischrift
als Lebensbeschreibung; Menge, Graf F. L. S. und
seine Zeitgenossen (Gotha 1863, 2 Bde.): Hennes, Aus Fr. L. v.
Stolbergs Jugendjahren (das. 1876);
Janssen, F. L., Graf zu S. (3. Aufl., Freiberg 1882).
3) Auguste Luise, Gräfin zu, Schwester der vorigen, geb. 7.
Jan. 1753 zu Bramstedt, wurde durch
ihre Brüder mit Klopstock, Miller und andern Mitgliedern
des Göttinger Dichterbundes bekannt und
trat auch mit Goethe in Briefwechsel, den sie übrigens
persönlich nie kennen lernte. Sie heiratete 1783 den
dänischen Minister Grafen A. P. Bernstorff, wurde
1797 Witwe und starb 30. Juni 1835. Vgl. "Goethes Briefe an die
Gräfin Auguste zu S." (mit Einleitung von W. Arndt, 2. Aufl.,
Leipz. 1881).
Stolberger Diamanten, Bergkristalle vom Auerberg im
Unterharz.
Stolberg-Wernigerode, 1) Eberhard, Graf von,
Präsident des preuß. Herrenhauses, geb. 11. März
1810 zu Peterswaldau bei Reichenbach i. S., Sohn
des 1854 gestorbenen Generalleutnants und Ministers Grafen Anton
aus der schlesischen Seitenlinie des Hauses S., diente zuerst in
der Armee, verwaltete dann die Fideikommißherrschaft
Kreppelhof bei
Landeshut in Schlesien, ward 1853 erbliches Mitglied des
Herrenhauses, in welchem er sich durch seine schroff feudale
Gesinnung hervorthat und bald zum Präsidenten gewählt
wurde, und war 1867-69 konservatives Mitglied des norddeutschen
Reichstags.
1864 organisierte er die Johanniter-Lazarettpflege mit solchem
Eifer und Geschick, daß ihn der König
1866 zum Kommissar und Militärinspektor der freiwilligen
Krankenpflege bei der Feldarmee ernannte. In dieser Eigenschaft
gründete der Graf den "Preußischen Verein zur Pflege im
Feld verwundeter und erkrankter Krieger". 1869 zum
Oberpräsidenten von Schlesien ernannt, starb er 8. Aug. 1872
kinderlos zu Johannisbad in Böhmen.
2) Otto, Graf von, Chef des Hauses, geb. 30. Okt. 1837 zu Gedern
in Hessen, Sohn des Erbgrafen Hermann (geb. 30. Sept. 1802, gest.
24. Okt. 1841),
besuchte das Gymnasium in Duisburg und, nachdem er seinem
Großvater, Grafen Heinrich, 16. Febr. 1854
gefolgt war, die Universitäten Göttingen und
Heidelberg, diente 1859-61 als Offizier in der preußischen
Armee, ward 1867 zum Oberpräsidenten von Hannover ernannt,
welches Amt er bis 1873 mit Takt, Umsicht und großem Erfolg
verwaltete, im
März 1876 Botschafter des Deutschen Reichs zu Wien
und 1. Juni 1878 Stellvertreter des Reichskanzlers
und Vizepräsident des preußischen Staatsministeriums.
Dies Amt legte er 20. Juni 1881 nieder und ward 1884
Oberstkämmerer und stellvertreten-der Minister des
königlichen Hauses, welches letztere
Amt er 1888 aufgab. 1867-78 Mitglied des Reichstags, 1872-86
Kanzler des Johanniterordens, 1872 bis 1877 Präsident des
Herrenhauses und 1875 Vorsitzender der außerordentlichen
Generalsynode, gehört er zur gemäßigt konservativen
Partei. Er ist erster Vorsitzender des Zentralkomitees der
deutschen Vereine und des preußischen Vereins vom Roten
Kreuz.
346
Stolgebühren - Stollenschrank.
Stolgebühren (Jura stolae), die nach der Stola (s.
d.) benannten Gebühren, welche die Geistlichen für
kirchliche Handlungen, namentlich Taufen, Trauungen, Abnahme der
Beichte und Begräbnisse, beziehen. Schon zu Ende des 5. Jahrh.
war eine Taxe für alle geistlichen Verrichtungen vorhanden;
doch floß das von den Laien dafür in den Opferstock der
Kirche gelegte Geld anfangs der Kirchenkasse zu, die davon den
Pfarrern ihren Anteil gab. Erst später war jeder Parochus
befugt, die S. für sich allein einzunehmen. Auch in der
protestantischen Kirche bilden die S. (als zufällige Einnahmen
jetzt gewöhnlich Accidenzien oder Kasualien genannt) einen
Teil der Einnahmen des Pfarrers; doch sind sie in Deutschland
vielfach abgeschafft und durch festen Gehalt ersetzt worden.
Stoliczka (spr. -litschka), Ferdinand, Paläontolog,
geboren im Mai 1838 in Mähren, war nach Vollendung seiner
Studien mehrere Jahre ein thätiges Mitglied der geologischen
Reichsanstalt zu Wien und wurde 1862 als Mitarbeiter an der
Geological Survey ofIndia nach Kalkutta berufen. Seine Arbeiten
sind meist paläontologischen Inhalts. Eine Reihe von
Aufsätzen behandelt die Kreidefossilien Südindiens.
Daneben publizierte er wichtige zoologische Arbeiten in den
Schriften der Asiatic Society of Bengal, deren Sekretär er
seit 1868 war. 1864 und 1865 machte er Forschungsreisen nach dem
englischen Tibet, nahm 1873 als Geolog an der Forsythschen
Gesandtschaftsreise nach Kaschgar teil, ging dann mit Oberst Gordon
und Kapitän Trotter nach dem Tschatyrkul im Thianschan,
über die Pamirs nach Wachan und zurück, starb aber auf
dem Marsch 19. Juni 1874 in Murghi am Shayok, unfern des
Sasserpasses in Ladak. Vgl. Ball, Memoir of the life and work of F.
S. (Lond. 1886).
Stolidität (lat.), Albernheit, Dummheit.
Stoljetow, Nikolai Grigorjewitsch, russ. General, geb.
1834, trat 1855 als Offizier in ein Regiment der Kaukasusarmee,
avancierte in derselben bis zum Oberstleutnant und ward 1867 zum
Chef der Kanzlei der Militärverwaltung von Turkistan ernannt.
Kurz darauf zum Obersten befördert, erhielt er 1872 das
Kommando des uralischen Infanterieregiments. Nicht lange nachher
ward ihm die Leitung der Amu Darja-Expedition, einer
wissenschaftlichen Unternehmung und zugleich auch
militärischen Rekognoszierung, übertragen. 1875 zum
Generalmajor befördert, erhielt er 1877 den Auftrag, die
bulgarischen Druschinen (Milizbataillone) zu organisieren, und an
der Spitze von sechs bulgarischen Bataillonen nahm er an Gurkos
erstem Zug über den Balkan teil, kämpfte 31. Juli 1877
bei Eski-Sagra mit und hatte den ersten Anprall Suleiman Paschas
auf dem Schipkapaß auszuhalten. Auch beim zweiten
Balkanübergang im Winter 1877-78 befehligte er eine Brigade.
Nach dem Frieden von San Stefano ward er an der Spitze einer
großen Gesandtschaft nach Kabul zum Emir von Afghanistan
geschickt, um diesen zum Widerstand gegen die Engländer
aufzureizen, zog sich aber mit diesem nach Turkistan zurück,
als die Engländer in Afghanistan einrückten.
Stollberg, 1) Stadt in der sächs.
Kreishauptmannschaft Zwickau, Amtshauptmannschaft Chemnitz,
Knotenpunkt der Linien S.-Chemnitz und St. Egidien-Zwönitz der
Sächsischen Staatsbahn, 418 m ü. M., hat 2 Kirchen, ein
neues Rathaus, eine Realschule, ein Amtsgericht, eine bedeutende
Strumpfwarenfabrik (800 Arbeiter), Strumpfstuhl-, Zigarren-,
Metallwaren- u. Kartonagenfabrikation, Maschinenbau, mechanische
Weberei und Zwirnerei, Dampfsägewerke und (1885) 6541 fast nur
evang. Einwohner. Dabei das Dorf Hoheneck mit dem hoch gelegenen
gleichnamigen Schloß (jetzt Arbeitshaus für Männer)
und (1885) 1210 Einw. -
2) S. Stolberg.
Stollbeulen (Ellbogenbeulen), bei Pferden
Geschwülste an der hintern Seite und auf der Spitze des
Ellbogens, die infolge von Quetschungen der Haut und Unterhaut
entstehen. Diese Quetschungsentzündung wird in einzelnen
Fällen durch den Druck der Stollen des Hufeisens während
des Liegens der Pferde mit untergeschlagenen Füßen
hervorgerufen (daher der Name), kommt aber auch bei stellenlosen
Hufeifen und unbeschlagenen Pferden vor. Die Entzündung
breitet sich gewöhnlich auf das benachbarte Bindegewebe aus;
die zunächst mit Blut gefüllten Hohlräume werden
durch Wucherung und Verdichtung des Bindegewebes zum
größten Teil wieder ausgefüllt, und die Geschwulst
wird infolgedessen fest und derb (Stollschwamm). In der ersten Zeit
bildet sich in der Geschwulst nicht selten eine Eiterung. Die
Behandlung verlangt Abstellung der Ursache fortgesetzter
Quetschung; bei frischer Entzündung sind kühlende Mittel,
sonst Entleeren der Flüssigkeit, Einreibungen mit grüner
Seife und Einspritzungen von Jodtinktur angezeigt. Veraltete,
speckartige Stollschwämme können nur durch Ätzmittel
oder auf operativem Weg entfernt werden. Besonders
zweckmäßig ist das Abbinden der S., weil mit demselben
die Verheilung ohne Zurücklassung einer narbigen
Deformität erzielt wird. Übrigens stören S. den
Dienstgebrauch der Pferde wenig, beeinträchtigen aber oft das
gute Aussehen. Die alte Annahme, daß S. am häufigsten
bei lungenkranken Pferden vorkommen, ist unbegründet.
Stolle, Ludwig Ferdinand, Belletrist, geb. 28. Sept. 1806
zu Dresden, studierte in Leipzig die Rechte und
Staatswissenschaften, widmete sich dann zu Grimma und seit 1855 in
Dresden der Litteratur und starb in letzterer Stadt 29. Sept. 1872.
Durch die Herausgabe des humoristisch-politischen Volksblattes "Der
Dorfbarbier" (1844-63) in weitern Kreisen bekannt geworden, fand er
mit feinen zahlreichen historischen und humoristischen Romanen, von
denen wir nur "1813" (Leipz. 1838, 3 Bde.), "Elba und Waterloo"
(das. 1838, 3 Bde.), "Deutsche Pickwickier" (das. 1841, 3 Bde; 3.
Aufl. 1878), "Napoleon in Ägypten" (das. 1843, 3 Bde.) und
"Die Erbschaft in Kabul" (das. 1845) namentlich anführen, wie
mit seinen Erzählungen und Novellen ("Frühlingsglocken",
"Moosrosen" etc.) zahlreiche Leser. Sie wurden unter dem Titel:
"Des Dorfbarbiers ausgewählte Schriften" (2. Aufl., Leipz.
1859-64, 30 Bde.; neue Folge, Plauen 1865, 12 Bde.) gesammelt.
Außer "Gedichten" (Grimma 1847) gab er auch die lyrische
Sammlung "Palmen des Friedens" (Leipz. 1855, 5. Aufl. 1873) heraus
und schrieb zuletzt das Idyll "Ein Frühling auf dem Lande"
(das. 1867).
Stollen, ein möglichst horizontaler, vom Tag
ausgehender, nach Umständen verzweigter unterirdischer
Grubenbau, welcher verschiedenen Zwecken dient; in der Poetik ein
Teil der Strophe der alten Minnelieder (s. Aufgesang und
Abgesang).
Stollenrösche, der vom Mundloch eines Stollens bis
zum nächsten Wasserlauf geführte Graben.
Stollenschrank, ein auf Pfosten (Stollen) ruhender
Schrank mit Doppelthüren, im Mittelalter und in der
Renaissancezeit vornehmlich in den Rheinlanden verfertigt. Die
Pfosten waren meist durch eine Rückwand und unten durch ein
Querbrett verbunden. S. Tafel "Möbel", Fig. 10.
347
Stollhofen - Stolze.
Stollhofen, Dorf im bad. Kreis Baden, unweit des Rheins,
hat (1885) 1139 Einw., ehemals Mittelpunkt der Stollhofer Linien,
die, jetzt vollständig verschwunden, im spanischen
Erbfolgekrieg vom Markgrafen Lndwig von Baden bis zu seinem Tod
(1707) behauptet, nachher von den Franzosen genommen wurden.
Stolnik (russ.), Titel eines Hofbeamten im moskowitischen
Großfürsten- und Zartum; Truchseß.
Stolo(lat.), in der Botanik s. v. w. Ausläufer (s.
d.).
Stolp, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk
Köslin, an der Stolpe, Knotenpunkt der Linien Stargard i.
P.-Zoppot und Neustettin-Stolpmünde der Preußischen
Staatsbahn, 35 m ü. M., hat 3 evang. Kirchen (darunter die
Marienkirche mit hohem Turm und die im 13. Jahrh. erbaute
Schloßkirche), eine altlutherische und eine kath. Kirche,
eine Synagoge, ein altes Schloß und (1885) mit der Garnison
(3 Eskadrons Husaren Nr. 5) 22,442 Einw. (darunter 542 Katholiken
und 867 Juden), welche Eisengießerei und Maschinenbau,
Tabaks-, Zigarren-, Bernsteinwaren und Lederfabrikation,
Wollspinnerei, Dampftischlerei, Ziegelbrennerei, Lachsfischerei
etc. betreiben; auch hat S. 2 große Mahl- und 5
Sägemühlen. Der Handel, unterstützt durch eine
Reichsbanknebenstelle, ist lebhaft in Getreide, Vieh, Spiritus,
Holz, Fischen und Gänsen. S. ist Sitz eines Landgerichts,
zweier Oberförstereien, einer
Mobiliar-Brandversicherungsgesellschaft und hat ein Gymnasium,
verbunden mit Realprogymnasium, ein Fräuleinstift, ein
Invalidenhaus, ein Krankenhaus, ein Militärlazarett und 2
Hofpitäler. Zum Landgerichtsbezirk S. gehören die sieben
Amtsgerichte zu Bütow, Lauenburg, Pollnow, Rügenwalde,
Rummelsburg, Schlawe und S.
Wappen von Stolp.
Stolpe, Küstenfluß in Hinterpommern,
entspringt aus dem Stolper See im Regierungsbezirk Danzig, nimmt
die Bütow, Kamenz und Schottow auf, ist flößbar und
mündet nach einem Laufe von 150 km bei Stolpmünde in die
Ostsee.
Stolpen, Stadt in der sächs. Kreishauptmannschaft
Dresden, Amtshauptmannschaft Pirna, an der Wesenitz und der Linie
Neustadt-Dürrröhrsdorf der Sächsischen Staatsbahn,
auf steilem Basaltberg, hat ein Amtsgericht, ein dreitürmiges
altes Schloß, in welchem die Gräfin Cosel (s. d.)
1716-65 gefangen saß, Messerfabrikation und (1885) 1367
Einw.
Stolpmünde, Flecken im preuß. Regierungsbezirk
Köslin, Kreis Stolp, an der Mündung der Stolpe in die
Ostsee und an der Linie Neustettin-S. der Preußischen
Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, eine Navigationsvorschule, ein
Seebad, 2 Dampfschneidemühlen, Schiffahrt, Holz- und
Spiritushandel und (1885) 1974 fast nur evang. Einwohner. Vgl.
Zessin, Das Ostseebad S. (Stolp 1885).
Stolze, Friedrich, Frankfurter Dialektdichter, geb. 21.
Nov. 1816 zu Frankfurt a. M., ward von seinem Vater zum
Kaufmannsstand bestimmt, verließ diesen aber nach des Vaters
Tod, um sich den schönen Wissenschaften zuzuwenden, und
ließ sich nach mehrfachen Reisen als Schriftsteller in seiner
Vaterstadt nieder, wo er von 1852 an die im Dialekt geschriebene
"Frankfurter Krebbelzeitung" und daneben seit 1860 mit dem Maler
Schalk die "Frankfurter Laterne" herausgab, die beide 1866 bei der
Besetzung Frankfurts durch die Preußen unterdrückt
wurden. S. lebte seitdem in Stuttgart, dann in der Schweiz, kehrte
aber nach erfolgter Amnestie nach Frankfurt zurück, wo er die
Redaktion der "Frankfurter Laterne" von neuem übernahm. Er
veröffentlichte: "Skizzen aus der Pfalz" (Frankf. 1849);
"Gedichte in hochdeutscher Mundart" (das. 1862); "Gedichte in
Frankfurter Mundart" (das. 1865, 6. Ausl. 1883; 2. Bd., 1884);
"Novellen und Erzählungen in Frankfurter Mundart" (das.
1880-85, 2 Bde.) u. a.
Stolz kommt mit der Eitelkeit (s. d.) darin überein,
daß er, wie diese, als Wirkung des Ehrtriebs auf den Besitz
persönlicher Vorzüge Wert legt, unterscheidet sich aber
von dieser dadurch, daß dieselben nicht eben durchaus
unbedeutende oder gar nur vermeintlich besessene (wirkliche oder
vermeintliche körperliche Schönheit u. dgl.) Güter
sind, sondern wahre und tatsächlich besessene, sogar sittlich
wertvolle Güter (Charakterfestigkeit, wissenschaftliche oder
künstlerische Leistungsfähigkeit u. dgl.) sein
können. Geht derselbe so weit, daß er, um sich zu
behaupten, lieber äußere Vorteile opfert, so heißt
er edler S. Überschätzt er seinen Wert oder
läßt sich durch das Gefühl desselben zur
Geringschätzung andrer verleiten, so geht er in Hochmut (wie
die Eitelkeit in gleichem Fall in Hoffart) über.
Stolz, Alban, bekannter kathol. Theolog, geb. 8. Febr.
1808 zu Bühl im Badischen, ward 1833 zum Priester geweiht und
gab seit 1843, wo er Repetent am theologischen Konvikt zu Freiburg
i. Br. wurde, den vielgelesenen "Kalender für Zeit und
Ewigkeit" heraus. Seit 1848 war er Professor der Pastoraltheologie
und Pädagogik an der theologischen Fakultät. Mehr jedoch
wirkte er durch eine Unzahl von asketischen und kirchenpolitischen
Schriften, wie er denn überhaupt als der originellste und
fruchtbarste aller populären Vertreter des deutschen
Ultramontanismus gelten darf. Er starb 16. Okt. 1883. Von
größern Werken sind anzuführen: "Spanisches
für die gebildete Welt" (8. Aufl., Freiburg 1885); "Besuch bei
Sem, Ham und Japhet" (5. Aufl., das. 1876), beides
Reisefrüchte. Die meisten seiner zahlreichen Schriften
(gesammelt, Freiburg 1871-87, 15 Bde.) wurden in fremde Sprachen
übersetzt. Vgl. Hägele, Alban S. (3. Aufl., Freiburg
1889).
Stolze, Heinrich August Wilhelm, Begründer des nach
ihm benannten stenographischen Systems, geb. 20. Mai 1798 zu
Berlin, besuchte das Joachimsthalsche Gymnasium daselbst, um sich
zum Studium der Theologie vorzubereiten, mußte aber
beschränkter Vermögensverhältnisse wegen 1817 eine
Anstellung im Büreau der Berliner Feuerversicherungsanstalt
annehmen. Schon 1815 beim Eintritt in die Prima wurde S. auf den
Gedanken geführt, zur Erleichterung der Arbeitslast sich mit
der Kurzschrift bekannt zu machen, und der große Umfang
seiner neuen Berufsarbeiten lenkte ihn 1818 abermals und
ernstlicher auf die Stenographie. Er erlernte 1820 das
Mosengeilsche System, fand es aber feinen Erwartungen nicht
entsprechend. Von da ab versuchte er selbst neue Wege einzuschlagen
und machte die Stenographie zum Gegenstand seiner besondern
Beschäftigung, indem er alle ihm zugänglichen ältern
und neuern Systeme der Kurzschrift durcharbeitete. Das Studium der
Lautphysiologie und der damals jungen Sprachwissenschaft zeigte
ihm, welche Kürzungsvorteile eine Stenographie aus der
Beachtung des Wesens der Laute und aus dem Anschluß an die
Etymologie ziehen könne. Durch das Erscheinen von
Gabelsbergers Redezeichenkunst und W. v. Humboldts Werk über
die
348
Stolze - Stölzel.
Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues wurde S. aus die
Idee der symbolischen Vokalbezeichnung geführt. Er gab 1835
seine Stelle bei der Feuerversicherungsanstalt auf und widmete sich
ganz der Ausarbeitung seiner Stenographie, welche 1840
abgeschlossen und 1841 mit Unterstützung des preußischen
Kultusministeriums in dem "Theoretisch-praktischen Lehrbuch der
deutschen Stenographie" (Berl.) veröffentlicht ward. Weitere
Publikationen von S. sind: "Ausführlicher Lehrgang der
deutschen Stenographie" (Berl. 1852, 9. Aufl. 1886); "Anleitung zur
deutschen Stenographie" (das. 1845, 52. Aufl. 1889);
"Stenographisches Lesebuch" (das. 1852, 2. Aufl. 1861);
"Normalübertragung der Aufgaben etc." (das. 1865). Seit 1852
war S. Vorsteher des stenographischen Büreaus des Hauses der
Abgeordneten in Berlin und starb daselbst 8. Jan. 1867. Vgl.
Michaelis, Nachruf an W. S. (Berl. 1867); Derselbe, Festrede zur
Übergabe der S.-Büste etc. (das. 1882); Kreßler, W.
Stolze (das. 1884); Käding, Die Denkmäler Stolzes (das.
1889). Das Ziel, welches S. im Auge hatte, war nicht die Schaffung
eines Werkzeugs zum Redennachschreiben, sondern das höhere der
Herstellung eines allgemeinen Erleichterungsmittels bei jeder
ausgedehntern Schreibthätigkeit. Vollständigkeit und
Genauigkeit der Lautbezeichnung galten ihm ebensosehr als
Grundbedingungen wie die Kürze. Erst später, nachdem die
Stolzesche Stenographie in den preußischen Kammern Eingang
als Mittel zum Nachschreiben der Reden gefunden, fügte S.
für diesen Zweck weitere Bestimmungen hinzu, die aber nicht
erschöpfend waren und sich als hinderlich bei der Erreichung
des eigentlichen Ziels erwiesen. Systemreformen von 1868 und 1872
gingen daher wieder auf Stolzes ursprüngliches Ziel
zurück, eine weitere von 1888 schuf abermals wesentliche
Vereinfachungen. In dieser neuesten Gestalt ist das System etwa
viermal kürzer als die gewöhnliche Schrift und erfordert
ungefähr 10 Unterrichtsstunden. Seine Zeichen bildete S. nach
Gabelsbergers Vorgang aus Teilzügen der gewöhnlichen
Schrift und verteilte dieselben nach bestimmt ausgesprochenen
Grundsätzen auf das Alphabet. Die meisten Vokale bezeichnet er
symbolisch durch Stellung des Wortbildes zur Schriftlinie, durch
kurzen oder langen Bindestrich sowie durch Druck oder Nichtdruck im
begleitenden Konsonanten. In der hierbei durchgeführten Idee,
den sonst bedeutungslosen Bindestrich als Träger der
Vokalsymbolik zu verwenden, liegt neben Erhebung der Kurzschrift zu
höherer Bestimmung Stolzes Hauptverdienst um die Fortbildung
der Stenographie. Endlich werden gewisse häufig vorkommende
Wörter und Silben durch feststehende, aus Teilen des Ganzen
gebildete Abkürzungen (Siglen) bezeichnet. Das Stolzesche
System ist auf eine Reihe fremder Sprachen übertragen worden,
nämlich auf das Niederländische, Schwedische, Englische;
Lateinische, Italienische, Französische, Portugiesische,
Spanische; Russische, Serbische; Magyarische. Eine nennenswerte
staatliche Fürsorge genießt die Stolzesche Stenographie
nicht, sie verdankt ihre Ausbreitung fast allein der
Privatthätigkeit ihrer Anhänger. In einigen Lehranstalten
Preußens und der Schweiz wird sie fakultativ, in mehreren
preußischen Militärschulen obligatorisch gelehrt; die
amtliche Kommission zur Prüfung der Stenographielehrer in
Budapest prüft sowohl Kandidaten, welche das Stolzesche, als
solche, die das Gabelsbergersche System vortragen wollen. Im
deutschen, schwedischen und ungarischen Reichstag, im
preußischen, anhaltischen und württembergischen Landtag,
in mehreren preußischen Provinziallandtagen und im
Großen Rat zu Bern dient die Stolzesche Stenographie wie
deren Übertragungen teils allein, teils neben andern Systemen
zur amtlichen Aufnahme der gehaltenen Reden. Zur größten
Verbreitung als Verkehrsschrift ist das Stolzesche System in der
Schweiz gelangt; ferner besitzt es in seinem Ursprungsland
Preußen sowie in ganz Nord- und Mitteldeutschland außer
Sachsen das Übergewicht, während es in Österreich
und Süddeutschland neben der staatlich gepflegten
Redezeichenkunst Gabelsbergers nicht aufgekommen ist. Von den
Stolzeschen Lehrmitteln wurden mehr als 1/4 Mill. Exemplare
abgesetzt. Infolge der oben erwähnten Systemrevisionen von
1868, 1872 und 1888, denen sich ein Teil der Schule widersetzte,
enstand eine Spaltung in die kleine, unter sich wieder geteilte
altstolzesche und die numerisch bedeutend überwiegende
neustolzesche Richtung. Beide Richtungen zusammen zählen
gegenwärtig 450 Vereine (der älteste und zugleich erste
des europäischen Kontinents der zu Berlin seit 1844) mit
10,500 Mitgliedern und werden durch 20 Fachzeitschriften vertreten,
deren älteste, das "Archiv für Stenographie", seit 1849
erscheint. Nach Gegenden und Provinzen sind diese Vereine in
Verbänden zusammengefaßt. Jede der beiden Stolzeschen
Richtungen besitzt eine eigne Organisation; an der Spitze der
Neustolzeaner steht der Vorstand des Verbandes Stolzescher
Stenographenvereine (Sitz Berlin), während die vereinigten
altstolzeschen Körperschaften in dem Vorstand der
Verbände (Sitz Berlin) eine leitende Stelle besitzen. Aus dem
Stolzeschen System sind mehrere abgeleitete Systeme hervorgegangen,
z. B. die von Erkmann (1876), Velten (1876), Lentze (1881). Vgl.
"Systemurkunde der deutschen Kurzschrift von W. S." (Berl. 1888);
Stolze, Anleitung zur deutschen Stenographie (52. Aufl., das.
1889); Derselbe, Ausführlicher Lehrgang der deutschen
Stenographie (9. Aufl., das. 1886); Frei, Lehrbuch der deutschen
Stenographie (9. Aust., Wetzikon 1889); Käding, Der Unterricht
in der Stolzeschen Stenographie (2. Aufl., Berl. 1885);
Knövenagel und Ryssel (Altstolzeaner), Vollständiges
praktisches Lehrbuch der deutschen Stenographie (7. Aufl., Hannov.
1886); Simmerlein, Das Kürzungswesen in der stenographischen
Praxis (4. Aufl., Berl. 1887); Knövenagel, Redezeichenkunst
oder deutsche Kurzschrift? (3.Aufl., Hannover 1880); F. Stolze,
Gabelsberger oder S.? (Berl. 1864); Häpe, Die Stenographie als
Unterrichtsgegenstand (Dresd. 1863); Kaselitz, Kritische
Würdigung der deutschen Kurzschriftsysteme von S.,
Gabelsberger und Arends (Berl. 1875); Miller, Die Stenographien von
S. und Faulmann (Wien 1886); Steinbrink, Zur Entstehungsgeschichte
des Stolzeschen Systems (im "Archiv für Stenographie" 1885);
Müller, Die Organisationsbestrebungen der Stolzeschen Schule
(Berl. 1883); Krumbein, W. S. und der Entwicklungsgang seiner
Schule (Dresd. 1876); Mitzschke, Museum der Stolzeschen
Stenographie (2. Aufl., Berl. 1877); Alge, Geschichte der
Stenographie in der Schweiz (Gossau 1877); "Serapeum der
Stolzeschen Stenographie" (Berl. 1874, Nachtrag 1876).
Stölzel, 1) Karl, Technolog, geb. 17. Febr. 1826 zu
Gotha, studierte in Jena und Heidelberg Staatswirtschaftslehre,
dann Naturwissenschaft und besonders Chemie in Berlin und unter
Liebigs Leitung in Gießen. Er habilitierte sich 1849 in
Heidelberg als Privatdozent, war in der Folge Lehrer an den
Gewerbeschulen zu Kaiserslautern und Nürnberg und
349
Stolzenau - Stopfbüchse.
wurde 1868 als Professor der chemischen Technologie und
Metallurgie an die technische Hochschule in München berufen.
S. war auch bei den Weltausstellungen zu London 1851, Paris 1867
und Wien 1873 amtlich beschäftigt und an der Berichterstattung
über die letzten beiden beteiligt. Sein Hauptwerk ist die
"Metallurgie" (Braunschw. 1863-86, 2 Bde.).
2) Adolf, Rechtsgelehrter, Bruder des vorigen, geb. 28. Juni
1831 zu Gotha, studierte in Marburg und Heidelberg, war 1860-66
Richter beim Kasseler Stadtgericht und Obergericht, trat dann in
den preußischen Staatsdienst und wurde 1872 zum
Kammergerichtsrat, 1873 zum Ministerialrat in Berlin ernannt, wo er
gleichzeitig seit 1875 als Mitglied der obersten
Justizprüfungsbehörde fungiert, deren Präsident er
seit 1886 ist. Von seinen zahlreichen rechtswissenschaftlichen
Arbeiten sind hervorzuheben das im Verein mit andern anonym
herausgegebene "Handbuch des kurhessischen Zivil- und
Zivllprozeßrechts" (Kassel 1860-61, 2 Bde.); "Die Lehre von
der operis novi nunciatio und dem interdictum quod vi aut clam"
(Götting. 1863): "Kasseler Stadtrechnungen aus der Zeit von
1468 bis 1553" (Kassel 1871); "Die Entwickelung des gelehrten
Richtertums in deutschen Territorien" (Stuttg. 1872) ; "Das Recht
der väterlichen Gewalt" (Berl. 1874); "Das
Eheschließungsrecht im Geltungsbereich des preußischen
Gesetzes vom 9. März 1874" (das. 1874 u. öfter);
"Wiederverheiratung eines beständig von Tisch und Bett
getrennten Ehegatten" (das. 1876); "Deutsches
Eheschließungsrecht nach amtlichen (Ermittelungen als
Anleitung für die Standesbeamten" (das. 1876 u. öfter);
"Karl Gottlieb Svarez" (das. 1885); "Brandenburg-Preußens
Rechtsverwaltung und Rechtsverfassung, dargestellt im Wirken ihrer
Landesfürsten und obersten Justizbeamten" (das. 1888, 2 Bde.).
Schon 1872 zum Ehrendoktor der Universität Marburg promoviert,
wurde S. 1887 zum ordentlichen Honorarprofessor der
Universität Berlin ernannt.
Stolzenau, Flecken und Kreishauptort im preuß.
Regierungsbezirk Hannover, an der Weser, hat eine evang. Kirche,
ein Schloß, ein Amtsgericht, Branntweinbrennerei,
Seifenfabrikation, Lachsfischerei, Wollhandel, Schiffahrt und
(1885) 1483 Einw.
Stolzenfels, Bergschloß im preuß.
Regierungsbezirk und Kreis Koblenz, am linken Rheinufer, bei dem
Dorf Kapellen, war im Mittelalter häufig die Residenz der
Erzbischöfe von Trier und ward 1689 von den Franzosen in
Trümmer gelegt. 1836-45 ward das Schloß nach Schinkels
Plan im mittelalterlichen Stil in großartiger Weise neu
aufgeführt und im Innern mit allerlei Kunstwerken, darunter
Freskomalereien von Deger, Lasinsky, Stilke etc.,
geschmückt.
Stolzer Tritt, in der Reitkunst, s. Piaffe.
Stolzit, s. Wolframbleierz.
Stoma (griech.), Mund, Mündung.
Stomachika (lat.), die Verdauung anregende Mittel, s.
Digestivmittel.
Stomachus (lat.), der Magen.
Stomakace (griech.), Mundfäule, s.
Mundkrankheiten.
Stomatitis (griech.), Entzündung der
Mundschleimhaut, s. Mundkrankheiten.
Stomatoskop (griech.), Instrument zur Untersuchung des
Mundes, besonders der Zähne, beruht auf einer Durchleuchtung
derselben mittels galvanisch weißglühenden Drahts, der
von einem Glasmantel umgeben ist, oder mittels des Drummondschen
Kalklichts und soll die ersten Anfänge von Erkrankungen
erkennbar machen; vgl. Beleuchtungsapparate.
Stone (engl., spr. stohn, "Stein"), Handelsgewicht, s.
Avoirdupois.
Stone (spr. stohn), Stadt in Staffordshire (England), am
Trent, mit Brauereien und (1881) 5669 Einw.
Stonehaven (spr. stóhn-hewen), Hauptstadt von
Kincardineshire (Schottland), an der Mündung des Carron in die
Nordsee, hat einen kleinen Hafen, Fischerei und (1881) 3957 Einw.
Dabei das Schloß Dunnottar (s. d.).
Stonehenge (spr. stohn-hendsch, "hängender Stein"),
eins der imposantesten vorgeschichtlichen Bauwerke bei Amesbury in
der englischen Grafschaft Wilts auf der Heide von Salisbury. Der
Bau bestand einstmals aus einem kreisrunden Säulengang von ca.
88 m im Durchmesser, welcher einen Kreis von einzeln stehenden
mächtigen Steinen (Menhirs) umgab. Innerhalb dieses zweiten
Kreises folgte ein eiförmiger Ring aus Trilithen (zwei
aufrecht stehende Steine, welche eine Felsplatte tragen) und in
diesem wiederum Menhirs in gleicher Anordnung. Dieser vierfache
Ring von unbehauenen oder nur roh zugehauenen Granitblöcken
war von einem Wassergraben umgeben. Ungefähr 30 m von dem
äußern Ring entfernt ragt ein einzeln stehender
Felsblock empor; am Horizont schließt ein andrer gewaltiger
Ring von Felsblöcken dieses merkwürdige Bauwerk, welches
die meisten Archäologen als ein von einer Nekropole umgebenes
Heiligtum betrachten, ein.
Stonington, Hafenstadt im nordamerikan. Staat
Connecticut, Grafschaft New London, am Long Island-Sound, hat
Seebäder, Dampfschiffsverbindung mit New York und Boston und
(1880) 1755 Einw.
Stonsdorf (Stohnsdorf), Dorf im preuß.
Regierungsbezirk Liegnitz, Kreis Hirschberg, östlich von
Warmbrunn, hat eine evang. Kirche, ein Schloß, Bierbrauerei,
Likörfabrikation und (1885) 680 Einw.; dabei der Prudelberg,
470 m hoch, mit wunderbaren Felspartien.
Stonyhurst (spr. stóhni-hörrst),
Jesuitenseminar und Schule in Lancashire (England), in einem
Seitenthal des Ribble, 10 km nördlich von Blackburn, 1794
gegründet.
Stoof, altes Hohlmaß, besonders in den russischen
Ostseeprovinzen, =1,275-1,530 Liter.
Stoos (Stoß), Luftkurort im schweizer. Kanton
Schwyz, 1293 m ü. M., südöstlich von Brunnen, hoch
über dem Vierwaldstätter See, unterhalb der Fronalp.
Stoósz, Bergstadt im ungar. Komitat Abauj-Torna,
hat (1881) 1076 slowakische und deutsche Einwohner, Eisenwerke und
Messerfabriken. 1 km entfernt liegt (622 m ü. M.) der
klimatische Kurort S. mit Wasserheilanstalt u. eisenhaltigen
Quellen.
Stopfbüchse (Stopfbuchse), Maschinenelement, welches
eine Öffnung in einer Gefäßwand dampf-, luft- oder
wasserdicht machen soll, wenn durch dieselbe eine bewegliche
Stange, z. B. die Kolbenstange einer Dampfmaschine, hindurchgeht.
Es hat in der Regel die nebenstehende Form; a ist die
Gefäßwand mit dem Stopfbüchsenunterteil, b die
Brille, welche durch Schrauben gegen erstere angedrückt werden
kann. Der
Stopfbüchse.
350 Stopfen - Storch.
Raum c enthält das Dichtungsmaterial (Packung), aus
Hanfzöpfen mit Talg oder einer mit Talkum gefüllten
Baumwollschnur oder aus Asbest bestehend. Durch Anziehen der
Schrauben wird die vollkommene Dichtigkeit hergestellt. Die
vielfach gemachten Versuche, die bisher gebräuchlichen, oft zu
erneuernden Packungsmaterialien durch eine dauerhaftere
Metallliderung, wie bei den Kolbendichtungen, zu ersetzen, haben
bisher noch zu keinem brauchbaren Resultat geführt.
Stopfen, eine Nadelarbeit, durch welche die fehlenden oder
zerrissenen Fäden einer Strickarbeit oder eines Gewebes
ersetzt werden. Man bedient sich beim S. einer Strickarbeit
desselben Materials, aus dem das beschädigte Stück
hergestellt ist. Zum S. eines Kleiderstoffs nimmt man am besten
ausgezogene Fäden eines neuen Stücks desselben Stoffes.
Bei leinenen Geweben verwendet man Glanzgarn, bei baumwollenen
Stopfgarn (Twist). Die Stopffäden dürfen nur lose gedreht
sein, damit sie gut füllen. Die Stopfnadeln sind lang, vom
Anfang bis zum Ende fast gleich stark, haben ovales Öhr und
stumpfe Spitze. Da die Stopfe möglichst genau das Gewebe
nachahmen soll, gibt es verschiedene Stopfstiche (Leinen-,
Köper-, Damast-, Tüll-, Strickstopfstiche etc.). Die
Gewebestopfen unterscheiden sich durch die zur Herstellung des
Musters verschiedene Anzahl der aufgenommenen Fäden. Die
Strickstopfe bildet Maschen, die Tüllstopfe ahmt die
eigentümliche, aber gleichmäßige Art des Gewebes
nach. Zur Herstellung einer Gewebestopfe zieht man zuerst die
parallel nebeneinander liegenden Kettenfäden ein und danach
die quer durchlaufenden Einschlagfäden, mit welchen man das
Muster bildet. Beide müssen so weit durch den Stoff gezogen
werden, wie derselbe schadhaft ist. Alle Gewebestopfen werden auf
der linken Seite ausgeführt. Zum S. einer Strickerei verwendet
man außer der Maschen- auch die Gitterstopfe, welche
vollkommen der Leinwandstopfe gleicht. Die Fäden des
Tülls laufen in drei Richtungen. Man zieht zuerst die
schrägen, sich kreuzenden Fäden ein und dann die
wagerechten, welche die andern befestigen.
Stopfer, s. Steckling.
Stoppelrübe, s. Raps.
Stoppelschwamm, Pilz, s. v. w. Hydnum repandum.
Stoppine (ital.), ein früher zur Entzündung von
Geschützladungen dienendes Ende Zündschnur in
Papierhülse, auch die Zündschnur selbst.
Stor (schwed.), in zusammengesetzten Ortsnamen
vorkommend, bedeutet "groß".
Stör (Acipenser L.), Gattung aus der Ordnung der
Schmelzschupper und der Familie der Störe (Acipenserini),
Fische mit gestrecktem, mit fünf Reihen großer,
gekielter Knochenschilder bedecktem Körper, gestreckter,
unbeweglicher Schnauze, unten mit vier Barteln und
unterständigem, weit nach hinten gerücktem, kleinem,
zahnlosem Maul. Der Kopf ist von Knochenplatten dicht und
vollständig eingehüllt, und über dem Kiemendeckel
befindet sich jederseits ein Spritzloch. Die nicht mit Knochen
belegten Hautstellen sind durch kleinere oder größere
Knochenkerne oder Knochenspitzen rauh. Die zwei Flossenpaare sowie
die drei unpaarigen Flossen werden von gegliederten, biegsamen
Knochenstrahlen gestützt, nur die beiden Brustflossen besitzen
außerdem einen starken Knochen als ersten Flossenstrahl. Die
kurze Rückenflosse steht dicht vor der Afterflosse, das nach
aufwärts gebogene, den obern Lappen der großen
Schwanzflosse bildende Schwanzende ist sensenförmig
gekrümmt. Der gemeine Stör (A. Sturio L., s. Tafel
"Fische II", Fig. 20), bis 6, meist nur 2 m lang, mit
mäßig gestreckter Schnauze, einfachen Bartfäden,
dicht aneinander gereihten, großen Seitenschildern und vorn
und hinten niedrigen, in der Mitte hohen Rückenschildern, ist
oberseits bräunlich, unterseits weiß, bewohnt den
Atlantischen Ozean, die Nord- und Ostsee und das Mittelmeer, geht,
um zu laichen, bis Mainz, Minden, Böhmen, Galizien und liefert
viel Elbkaviar und Hausenblase. Der Sterlett (A. Ruthenus L.), 1 m
lang, bis 12 kg schwer, mit langgestreckter, dünner Schnauze,
ziemlich langen, nach innen gefransten Bartfäden, nach hinten
an Höhe zunehmenden und in eine scharfe Spitze endigenden
Rückenschildern, ist oberseits dunkelgrau, unterseits heller,
bewohnt das Kaspische und Schwarze Meer und steigt in der Donau bis
Ulm empor; er liefert Kaviar und Hausenblase. Der Scherg
(Sternhausen, Sewruga, A. stellatus Pall.), 2 m lang, bis 25 kg
schwer, mit sehr langer, schwertförmiger, spitzer Schnauze,
einfachen Bartfäden, voneinander getrennten Seiten- und nach
hinten an Höhe zunehmenden, in eine Spitze endigenden
Rückenschildern, ist auf dem Rücken rötlichbraun,
oft blauschwarz, an den Seiten und am Bauch weiß, bewohnt das
Schwarze und Kaspische Meer und liefert Kaviar und Hausenblase. Der
Osseter (Esther, Waxdick, A. Gueldenstaedtii Brandt), 2-4 m lang,
mit kurzer, stumpfer Schnauze, einfachen Bartfäden u.
sternförmigen Knochenplättchen, ist dem S. ähnlich
gefärbt, bewohnt die Flußgebiete des Schwarzen und
Kaspischen Meers, gelangt bisweilen nach Bayern, liefert Kaviar und
Hausenblase. Der Hausen (A. Huso L.), bis 8 m lang und 1600 kg
schwer, mit kurzer Schnauze, platten Bartfäden, vorn und
hinten niedrigen, in der Mitte höhern Rückenschildern und
kleinen, voneinander getrennt stehenden Seitenschildern, ist
oberseits dunkelgrau, unterseits schmutzig weiß, bewohnt das
Schwarze Meer und liefert die größte Menge des
russischen Kaviars, auch Hausenblase. Die Störe leben am
Grunde der Gewässer und bewegen sich in Sand oder Schlamm halb
eingebettet langsam fort, mit der Schnauze Nahrung suchend. Diese
besteht aus Würmern, Weichtieren und Fischen, welch letztere
sie jagend verfolgen. Sie wandern in Gesellschaften von März
bis Mai, legen ihre zahlreichen Eier am Grunde der Flüsse ab
und kehren bald ins Meer zurück, während die Jungen
lange, vielleicht zwei Jahre, in den Flüssen verweilen. Im
Spätherbst gehen sie wieder in die Flüsse, um, mit den
Köpfen in den Schlamm vergraben, Winterschlaf zu halten. Durch
die rücksichtslose Verfolgung hat die Zahl der Störe
stark abgenommen. Die großartigsten Fischereien befinden sich
in den Strömen, welche ins Schwarze und Kaspische Meer
münden, an den Mündungen der Wolga, des Dnjestr, Dnjepr,
der Donau und in der Meerenge von Jenikale oder Kaffa. Das Fleisch
aller Störe ist wohlschmeckend und kommt frisch, gesalzen und
geräuchert in den Handel. Es wurde schon von den Alten
hochgeschätzt, und in England und Frankreich gehörte es
zu den Vorrechten der Herrscher, Störe für den eignen
Bedarf zurückzuhalten.
Stör, Fluß in der preuß. Provinz
Schleswig-Holstein, entspringt südwestlich von
Neumünster, ist 75 km lang (40 km schiffbar) und mündet
rechts unterhalb Glückstadt bei Störort in die Elbe.
Storax, Storaxbalsam, s. Styrax.
Storaxbaum, Pflanzengattung, s. v. w. Styrax;
amerikanischer S., s. Liquidambar.
Storch (Ciconia L.), Gattung aus der Ordnung der Reiher-
oder Storchvögel und der Familie der Störche (Ciconiidae)
, verhältnismäßig plump ge-
351
Storch - Storchschnabel.
baute Tiere mit langem, kegelförmigem, geradem, an den
scharfen Schneiden stark eingezogenem Schnabel, hohen, weit
über die Fersengelenke hinauf unbefiederten Beinen, unten
breiten Zehen, deren äußere und mittlere bis zum ersten
Gelenk durch eine Spannhaut verbunden sind, stumpfen, glatten
Krallen, langen, breiten, ziemlich stumpfen Flügeln, in
welchen die dritte und vierte Schwinge am längsten sind,
kurzem, abgerundetem Schwanz und oft nackten Stellen an Kopf und
Hals. Sie sind über alle Erdteile verbreitet, am
häufigsten in den heißen; sie bevorzugen ebene,
wasserreiche, waldige Gegenden, ruhen nachts und nisten auf
Bäumen, einzelne aber mit Vorliebe auf Gebäuden. Sie
fliegen sehr schön, gehen schreitend, waten gern im Wasser,
schwimmen aber nur im Notfall; ihre Stimme besteht nur in Zischen,
dafür klappern sie mit dem Schnabel besonders in der Erregung
sehr laut. Sie leben gesellig, manche als halbe Haustiere, ohne
indes jemals ihre Selbständigkeit aufzugeben. Sie stellen
allen Tieren nach, welche sie bewältigen können, und sind
sehr raubgierig; einzelne fressen auch Aas. Der weiße S.
(Adebar, Ebeher, Honoter, Haus-, Klapperstorch, C. alba L.), 110 cm
lang, 225 cm breit, ist weiß mit Ausnahme der schwarzen
Schwingen und längsten Deckfedern; die Augen sind braun, der
kahle Fleck um dieselben grauschwarz, Schnabel und Füße
sind rot. Er bewohnt Europa mit Ausnahme des höchsten Nordens,
auch Vorderasien, Persien, Japan, die Atlasländer und die
Kanaren, ist aber höchst selten in England, in fast ganz
Griechenland seit dem Unabhängigkeitskrieg ausgerottet;
häufig findet er sich in Norddeutschland und Westfalen; im
Gebirge ist er unbekannt. Im Winter durchschweift er ganz Afrika
und Indien. In Norddeutschland erscheint er etwa Mitte März
und weilt bis Mitte August. Er baut sein Nest aus groben Reisern
auf starken Bäumen, am liebsten auf den Dächern der
Häuser in Städten und Dörfern, und das
wiederkehrende Paar bezieht stets das alte Nest wieder. Er
nährt sich von Fröschen, Schlangen, Eidechsen, nackten
Schnecken, Fischen, Regenwürmern, Mäusen,
Maulwürfen, jungen Hasen, mancherlei Insekten (Bienen!),
plündert aber auch die Nester aller Bodenbrüter,
verschlingt die Eier und die Jungen und zeigt bisweilen große
Mordlust. Die unverdaulichen Bestandteile seiner Nahrung speit er
in Gewöllen aus. Der angeschossene S. kann Menschen und Hunden
gefährlich werden. Die Ehe des Storchenpaars wird im
allgemeinen für das ganze Leben geschlossen, doch hat man
mehrfach Fälle von Untreue beobachtet. Das einmal
begründete Nest wird von demselben Paar lange Jahre benutzt,
aber jährlich ausgebessert. Mitte oder Ende April legt das
Weibchen 2-5 weiße Eier und brütet sie in 28-31 Tagen
aus. Vor dem Abzug versammeln sich alle Störche einer Gegend,
und unter großem Geklapper bricht endlich das ganze Heer auf.
Man kann die Jungen leicht zähmen, so daß sie auf dem
Hof unter dem andern Geflügel herumlaufen. Der schwarze S. (C.
nigra Bechst.), 105 cm lang, 198 cm breit, ist schwärzlich,
mit grünem und Purpurschiller, an Brust und Bauch weiß;
das Auge ist braun, Schnabel und Fuß rot. Er bewohnt Mittel-
und Südeuropa, viele Länder Asiens, im Winter Afrika,
brütet in ruhigen Waldungen der norddeutschen Ebene, weilt bei
uns von Ende März bis August, hat die Lebensweise des
Hausstorchs, ist aber viel scheuer und wird oft der Fischerei
schädlich. Bei uns brütet er einzeln, in Ungarn aber
bildet er Siedelungen, in welchen 20 und mehr Nester in kurzen
Entfernungen voneinander stehen. Das Weibchen legt 2-5 Eier und
brütet dieselben in vier Wochen aus. Der S. ist allenthalben
ein gern gesehener Gast, der mitunter selbst abergläubische
Achtung genießt, indem sein Nest das Haus gegen Blitz und
Feuersgefahr schützen soll. Auch bei den mohammedanischen
Völkern wird er sehr respektiert, weil er zur Verminderung
schädlicher Reptilien viel beiträgt. In der Mythologie
repräsentiert der S. die regnerische winterliche Jahreszeit.
Aus der Wolke oder dem Winter kommt die junge Sonne, das
Heldenkind, heraus, daher der deutsche Kinderglaube, daß die
Störche die Kinder aus dem Wasser bringen.
Storch, Ludwig, Schriftsteller, geb. 14. April 1803 zu
Ruhla bei Eisenach, studierte in Göttingen und Leipzig
Theologie, wandte sich jedoch, von Not und Beruf getrieben,
früh der schriftstellerischen Laufbahn zu, welche sich
äußerlich zu einer vielbewegten gestaltete und ihm den
Segen einer ruhigen Existenz und eines festen Aufenthalts nicht zu
gewähren vermochte. Am längsten hielt es ihn in Leipzig
und Gotha. Seit 1866 lebte er zu Kreuzwertheim in Franken, wo er 5.
Febr. 1881 starb. Storchs Talent ist ein begrenztes; doch erfreuen
seine "Erzählungen und Novellen" (Leipz. 1853-62, 31 Bde.),
wenn sie auch des tiefern poetischen Gehalts ermangeln, ebenso wie
seine "Gedichte" (das. 1854) als der Ausdruck eines patriotisch und
freisinnig gestimmten Geistes und eines warm empfindenden
Gemüts. Die beliebtesten unter den erzählenden Schriften
waren: "Der Freiknecht" (Leipz. 1829, 3 Bde.); "Die Freibeuter"
(das. 1832, 3 Bde.); "Der Jakobsstern" (Frankf. 1836 bis 1838, 4
Bde.); "Die Heideschenke" (Bunzl. 1837, 3 Bde.); "Max von Eigl"
(Leipz. 1844, 3 Bde.); "Ein deutscher Leinweber" (das. 1846-50, 9
Bde.) und "Leute von gestern" (das. 1852, 3 Bde.). Seinen
"Poetischen Nachlaß" gab Alex. Ziegler (Eisenach 1882)
heraus.
Storchnest, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Posen,
Kreis Lissa, hat eine evangelische und eine kath. Kirche, ein
Demeritenhaus (Disziplinarstrafanstalt für Geistliche) und
(1885) 1693 Einw.
Storchschnabel, Pflanzengattung, s. Geranium.
Storchschnabel (Pantograph, früher auch Affe), ein
zuerst von Christ. Scheiner 1635 in seiner "Pantographia seu ars
delineandires quaslibet" beschriebenes Instrument zur
Übertragung von Zeichnungen in verkleinertem oder
vergrößertem Maßstab. Die jetzt üblichste
Einrichtung zeigt die beistehende Figur. AB, BC, CD, DA sind vier
Lineale, die in den Punkten A, B, C, D drehbar miteinander
verbunden sind. Eine Ecke C, auf dem Zeichentisch befestigt, bildet
den Drehpunkt (Pivot), die diagonal gegenüberliegende Ecke A
trägt den Fahrstift, welcher mittels einer Handhabe auf der zu
reduzierenden Zeichnung geführt wird. D und B sind mit Kugeln
oder Rollen versehen. Eine fünfte, parallel AD verstellbare
Leitschiene trägt den Zeichenstift G, welcher mit AG in
gerader Linie liegt. Er wird so eingestellt, daß der Abstand
GC zu CA sich verhält wie der Maßstab der reduzierten
Zeichnung zur Originalzeichnung. Soll eine Zeichnung
vergrößert werden, so wird G der Fahrstift und A der
Zeichenstift. Die Schienen erhalten eine einfache Teilung mit
Nonien oder eine transversale Teilung. Bei den schweben-
352
Storchschnabelgewächse - Störungen.
den Pantographen fällt die Schiene AD fort, das Instrument
hängt mittels Drähte an einem kranenartigen Gestell, so
daß nur der Fahrstift auf der Zeichnung ruht. Das Instrument
ist mit einer Libelle, das Gestell mit Dosenniveau versehen.
Storchschnabelgewächse, s. Geraniaceen.
Storchvögel (Reihervögel), s. v. w.
Watvögel.
Storck, Wilhelm, Romanist und Übersetzer, geb. 5.
Juli 1829 zu Letmathe in Westfalen, studierte von 1850 an in
München, Münster und Bonn, später noch in Berlin
Philologie und wurde 1859 außerordentlicher, 1868
ordentlicher Professor der deutschen Sprache und Litteratur an der
Akademie zu Münster, wo er außer seiner Fachwissenschaft
zeitweise auch Sanskrit sowie Provencalisch, Italienisch, Spanisch
und Portugiesisch lehrt. Litterarisch hat er sich namentlich als
Übersetzer verdienten Ruf erworben. Seinem Werk "Lose Ranken.
Ein Büchlein Catullischer Lieder" (Münst. 1867) und dem
"Buch der Lieder aus der Minnezeit" (das. 1872) folgten als sein
Hauptwerk "Luis de Camoens' sämtliche Gedichte. Zum erstenmal
deutsch" (Paderb. 1880-85, 6 Bde.), denen sich "Hundert
altportugiesische Lieder" (das. 1885) und "Ausgewählte Sonette
von Anthero de Quental" (das. 1887) anschlossen. S. hat auch
Ausgaben der Gedichte von L. Ponce de Leon (Münst. 1853), Juan
de la Cruz und Teresa de Jesus (das. 1854) sowie des
Minnesängers von Sahsendorf (das. 1868) besorgt.
Store (franz., spr. stör), s. v. w. Rouleau (s.
d.).
Store (engl., spr. stohr), Vorrat, Lager.
Storfjord (auch Wijbe Jans Water), Meerbusen im
südlichen Teil von Spitzbergen, zwischen der Hauptinsel
einerseits, Barentsinsel und Edgeinsel anderseits. Zwischen den
Inseln führen die Walter Thymen-Straße und der Helissund
nach O. Im SO. liegen die Tausend Inseln.
Störkanal, s. Elde.
Storkow, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Potsdam,
Kreis Beeskow-S., am Dolgensee und am Storkower Kanal, der, 28 km
lang, aus dem Scharmützelsee in die Dahme führt, hat eine
evang. Kirche, ein Amtsgericht, eine Dampfmahl- und
Ölmühle, Tabaksfabrikation und (1885) 2025 Einw. Die
Herrschaft S. kam 1555 durch Kauf an Brandenburg.
Storm, Theodor Woldsen, Dichter und Novellist, geb. 14.
Sept. 1817 zu Husum in Schleswig, studierte Rechtswissenschaft zu
Kiel und Berlin, wo er mit dem Brüderpaar Theodor und Tycho
Mommsen in nähere Verbindung trat, und ließ sich nach
abgelegter Staatsprüfung 1842 als Advokat in seiner Vaterstadt
nieder, verlor aber 1853 als Deutschgesinnter sein Amt und ward
hierauf erst als Gerichtsassessor zu Potsdam, dann als Landrichter
zu Heiligenstadt angestellt. Nach der Befreiung Schleswig-Holsteins
ging er 1864 nach Husum zurück, wo er zunächst zum
Landvogt, 1867 zum Amtsrichter und 1874 zum Oberamtsrichter
befördert wurde. Seit 1880 als Amtsgerichtsrat quiesziert,
siedelte er nach dem Kirchdorf Hademarschen über, wo er 3.
Juli 1888 starb. S. nimmt unter den Lyrikern, besonders aber unter
den Novellisten der Gegenwart einen vordersten Rang ein. Als
ersterer führte er sich mit dem im Verein mit den beiden
Mommsen herausgegebenen "Liederbuch dreier Freunde" (Kiel 1843) in
die Litteratur ein; "Sommergeschichten und Lieder" (Berl. 1851) und
ein Band "Gedichte" (das. 1852, 8. Aufl. 1888) folgten nach.
Besonders letztere brachten ihm stets wachsende Anerkennung ein.
Der Dichter S. erweist sich als eine tiefsinnige, dabei frische und
warmblutige Natur, welche den tausendmal besungenen uralten Themen
der Lyrik den Stempel des eigensten Empfindens und Genießens
aufdrückt. Reicher und mannigfaltiger noch sind seine Gaben
auf dem Gebiet der Novellistik. Nachdem er 1852 mit der
vielgelesenen, poetisch duftigen Novelle "Immensee" (31. Aufl.,
Berl. 1888) aufs glücklichste debütiert, ließ er
zahlreiche andre Erzählungen und Novellen erscheinen, die
sämtlich Stimmungsbilder von einer Tiefe, Zartheit und Kraft
der Empfindung sind, wie sie nur eine ursprüngliche und echte
Dichternatur schaffen kann. Der Kreis des Lebens, den er
darzustellen liebt, ist eng, aber innerhalb dieses engen Kreises
waltet Lebensfülle und Lebensglut; der norddeutsche
Menschenschlag mit seiner Eigenart, seinem tiefinnerlichen
Phantasie- und Gemütsreichtum findet sich in Storms
Geschichten in einer fast unerschöpflichen Mannigfaltigkeit
der Charaktere geschildert. Dabei ist seine Vor-tragsweise
künstlerisch fein und durchgebildet. Die Titel seiner meist
vielfach aufgelegten Novellen sind: "Im Sonnenschein", drei
Erzählungen (Berl. 1854); "Ein grünes Blatt", zwei
Erzählungen (das. 1855); "Hinzelmeier" (das. 1856); "In der
Sommermondnacht" (das. 1860); "Drei Novellen" (das. 1861); "Lenore"
(das. 1865); "Zwei Weihnachtsidyllen" (das. 1865); "Drei
Märchen" (Hamb. 1866; 3. vermehrte Aufl. u. d. T.:
"Geschichten aus der Tonne", 1888); "Von jenseit des Meers"
(Schlesw. 1867); "Zerstreute Kapitel" (Berl. 1873); "Novellen und
Gedenkblätter" (Braunschw. 1874); "Waldwinkel etc." (das.
1875); "Ein stiller Musikant. Psyche. Im Nachbarhause links" (das.
1877); "Aquis submersus" (Berl. 1877); "Carsten Curator" (das.
1878); "Neue Novellen" (das. 1878); "Drei neue Novellen"
("Eekenhof" etc., das. 1880); "Die Söhne des Senators" (das.
1881); "Der Herr Etatsrat" (das. 1881); "Schweigen" und "Hans und
Heinz Kirch" (das. 1883); "Zur Chronik von Grieshuus" (das. 1884);
"Ein Bekenntnis" (das. 1887); "Der Schimmelreiter" (das. 1888) etc.
Außerdem besitzen wir von S. eine wertvolle kritische
Anthologie: "Hausbuch aus deutschen Dichtern seit Claudius" (4.
Aufl., Braunschw. 1877). Eine Gesamtausgabe seiner Schriften
erschien in 18 Bänden (Braunschw. 1868-88). Vgl. Erich
Schmidt, Theodor S. (in "Charakteristiken", Berl. 1886), und die
Biographien von Schütze (das. 1887) und Wehl (Altona
1888).
Stormarn, Landschaft im südlichen Teil der
preuß. Provinz Schleswig-Holstein, bildet ein Dreieck,
welches im N. durch die Stör von dem eigentlichen Holstein, im
O. durch die Trave von Wagrien und durch die Bille von
Sachsen-Lauenburg, im SW. durch die Elbe von Hannover geschieden
wird. Sie war mit Holstein stets denselben Fürsten unterthan.
Ein Teil derselben bildet jetzt den Kreis S. mit Wandsbeck als
Kreisstadt.
Storno (Ritorno), s. v. w. Ristorno (s. d.).
Stornoway (spr. stórno-ue), Hafenstadt auf der
Ostküste der Hebrideninsel Lewis, mit großartigem
Fischereibetrieb (Kabeljau, Heringe und Leng) und (1881) 2627 Einw.
Zu seinem Hafengebiet gehören (1887) 695 Fischerboote. S. ist
Sitz eines deutschen Konsuls.
Storozynetz, Hauptort einer Bezirkshauptmannschaft in der
Bukowina, am Sereth, mit Bezirksgericht und (1880) 4852 Einw.
Storthing, die reichsständige Versammlung von
Norwegen (s. d., S. 250).
Störungen (Perturbationen), in der Astronomie die
durch die Anziehung der übrigen Körper des Sonnensystems
bewirkten Änderungen in der Bewegung der Planeten und Kometen
um die Sonne
353
Story - Stosch.
sowie der Monde um ihre Hauptplaneten. Gehörte nur ein
einziger Planet zur Sonne, so würde sich dieser genau nach den
beiden ersten Keplerschen Gesetzen (s. Planeten, S. 109) bewegen.
Durch die Anziehung der Massen der übrigen Planeten wird aber
der Planet gezwungen, von dieser Bewegung abzuweichen. Ein Teil
dieser Abweichungen wiederholt sich nach Verlauf eines gewissen
Zeitraums sowohl der Art als der Größe nach, es sind
dies die periodischen S.; andre, die säkularen S., gehen immer
in derselben Richtung weiter und veranlassen also dauernde
Änderungen der Planetenbahnen. Laplace hat gezeigt, daß
die großen Achsen der Planetenbahnen und daher auch die
Umlaufszeiten keinen säkularen S. unterworfen sind; auch die
Exzentrizitäten und Neigungen der Bahnen unterliegen nicht
eigentlichen säkularen, aber doch periodischen S. von so
langer Dauer, daß sie den Charakter säkularer haben.
Dagegen sind die Längen der Perihelien und der Knoten
säkularen S. unterworfen und können daher im Lauf der
Jahrtausende alle Werte von 0-360° annehmen. Die S. der
großen Planeten sind von Leverrier untersucht worden, der
auch durch eine umgekehrte Störungsrechnung den Planeten
Neptun entdeckte. Weit beträchtlicher als die S., welche die
großen Planeten erleiden, die ziemlich weit voneinander
entfernt sind und sich nahezu in derselben Ebene bewegen, sind
diejenigen, welche die kleinen Planeten und die Kometen erfahren,
weil sie nicht selten in die Nähe größerer
Planeten, namentlich des Jupiter, kommen. Die S. des Mondes
rühren fast ausschließlich von der Sonne her, die von
den Planeten verursachten sind sehr unbedeutend. Die
bemerkenswertesten S. des Mondes sind: die von Ptolemäos (130
n. Chr.) entdeckte Evektion (s. d.), die Variation, von Abul Wefa
im 10. Jahrh. und später von Tycho Brahe entdeckt, welche
ihren größten Wert, 0,65° Länge, in den vier
Oktanten, d. h. den zwischen den Syzygien und Quadraturen in der
Mitte liegenden Punkten, erreicht, in letztern aber verschwindet,
und die jährliche Gleichung, welche die Länge des Mondes
6 Monate lang vermehrt und 6 Monate lang vermindert, in der
mittlern Entfernung der Erde von der Sonne (Anfang April und
Oktober) aber verschwindet. Bemerkenswert sind noch ein paar kleine
S. des Mondes, die von der Sonnenparallaxe und der Abplattung der
Erde abhängen, so daß man umgekehrt aus der Mondbewegung
diese Größen berechnen kann (vgl. Erde und Sonne). Vgl.
Dziobek, Die mathematischen Theorien der Planetenbewegungen (Leipz.
1888).
Story, 1) Joseph, nordamerikan. Staatsmann und
Rechtsgelehrter, geb. 18. Sept. 1779 zu Marblehead bei Boston, ward
als Advokat in seiner Vaterstadt 1805 in das Unterhaus von
Massachusetts gewählt, 1811 zum Richter an dem
alljährlich sich in Washington zur Kongreßzeit
versammelnden Bundesgerichtshof berufen und 1829 zum Professor der
Rechte an der Harvard-Universität zu Cambridge bei Boston
ernannt. Als solcher hatte er über Naturrecht,
Völkerrecht, See- und Handelsrecht, Billigkeitsrecht und
Staatsrecht der Vereinigten Staaten zu lesen und verfaßte
über fast alle diese Disziplinen Lehrbücher, die auch in
England für klassisch gelten. Das für Deutschland
bedeutendste unter diesen Werken sind die "Commentaries on the
constitution of the United States" (4. Aufl., Bost. 1873, 2 Bde.;
deutsch im Auszug, Leipz. 1838). Nach diesen sind hervorzuheben
seine "Miscellaneous writings, literary, critical. juridical and
political" (Bost. 1835). S. starb 10. Sept. 1845 in Cambridge. Vgl.
W. Story, Life and letters ofJ. S. (Lond. 1851).
2) William Wetmore, nordamerikan. Bildhauer und Dichter, Sohn
des vorigen, geb. 19. Febr. 1819 zu Salem in Massachusetts,
studierte Rechtswissenschaft und war eine Zeitlang als praktischer
Jurist thätig, wandte sich dann aber ausschließlich der
Kunst und Litteratur zu und ließ sich 1848 in Rom nieder, wo
er noch lebt. S. schuf teils Idealgestalten, welche sich durch
Größe der Auffassung, geistige Vertiefung und
meisterhafte Marmorbearbeitung auszeichnen, wie z. B. Kleopatra,
Sappho, Judith, Medea, eine Sibylle, Moses, Saul, teils
Porträtstatuen, wie z. B. die seines Vaters, Peabodys
(London), E. Everetts (Boston) und das Nationaldenkmal in
Philadelphia. Von seinen poetischen Werken nennen wir: "Nature and
art" (1844); "Poems" (1847; neue Ausg. 1885, 2 Bde.); "A Roman
lawyer in Jerusalem" (1870, Versuch einer Rettung des
Verräters Judas); die "Tragedy of Nero" (1875); die
Dichtungen: "Ginevra da Siena" (1866, in "Blackwood's Magazine"),
"Vallombrosa" (1881), "He and she, or a poet's portfolio" (1883, 8.
Aufl. 1886) und "Fiammetta, a summer idyl" (1885). Außer der
Biographie seines Vaters (s. S. 1) schrieb er noch: "Roba di Roma,
or walks and talks about Rome" (Lond. l862, 7. Aufl. 1875), wozu
1877 eine Fortsetzung unter dem Titel : "Castel St. Angelo"
erschien; "Proportions of human figure; the new canon" (1866);
"Graffiti d'Italia" (1869, 2. Aufl. 1875) u. a.
Stosch, 1) Philipp, Baron von, Kunstkenner, geb. 22.
März 1691 zu Küstrin, widmete sich theologischen und
humanistischen Studien und suchte dann auf Reisen seine Kenntnis
der alten Kunstdenkmäler auszubilden. Später lebte er als
englischer Agent in Rom und seit 1731 in Florenz, wo er 7. Nov.
1757 starb. Er hinterließ einen reichen Schatz von
Kunstsachen aller Art, Landkarten, Kupferstichen, Zeichnungen (324
Folianten, jetzt in der kaiserlichen Bibliothek zu Wien), Bronzen,
Münzen, besonders aber geschnittenen Steinen, deren Katalog
Winckelmann ("Description des pierres gravées du feu baron
de S.", Flor. 1760) herausgab. Friedrich II. kaufte 1770 die
Hauptsammlung, mit Ausnahme der etrurischen Gemmen, die nach Neapel
verkauft waren, der Prinz von Wales die Sammlung von Abgüssen
neuerer Münzen. Eine Auswahl von Gemmen aus dem Stoschschen
Kabinett, das Merkwürdigste der alten Mythologie
zusammenfassend, findet sich in Schlichtegrolls "Dactyliotheca
Stoschiana" (Nürnb. 1797-1805, 2 Bde.) erläutert. Vgl.
Justi, Briefe des Barons Phil. v. S. (Marb. 1872).
2) Albrecht von, Chef der deutschen Admiralität, geb. 20.
April 1818 zu Koblenz, erhielt seine Erziehung im Kadettenkorps und
trat 1835 als Sekondeleutnant in das 29. Infanterieregiment, ward
1856 Major im Großen Generalstab, 1861 Chef des Generalstabs
des 4. Armeekorps und Oberst, 1866 Generalmajor. Im Kriege gegen
Österreich war er Oberquartiermeister der zweiten Armee, vom
Dezember 1866 bis 1870 Direktor des
Militärökonomiedepartements im Kriegsministerium, ward
1870 Generalleutnant, erhielt im Krieg 1870/71 den schwierigen
Posten eines Generalintendanten der deutschen Heere und erwarb sich
auf demselben durch seine musterhafte Leitung des
Verpflegungswesens die allergrößten Verdienste. Im
Dezember 1870 ward er zum Generalstabschef des Großherzogs
von Mecklenburg und nach dem Friedensschluß zum
Generalstabschef bei der in Frankreich bleibenden
Okkupationsarmee
354
Stoß - Stösser.
ernannt. Am 1. Jan. 1872 ward er Chef der deutschen
Admiralität und Staatsminister sowie Mitglied des Bundesrats
und 1875 zum General der Infanterie und Admiral befördert. S.
entwickelte eine große Energie und Thatkraft, indem er
wissenschaftliche Institute (Seewarte, hydrographisches Büreau
und Marineakademie) schuf, die deutsche Kriegsflotte
beträchtlich vergrößerte, den Bau der Schiffe auf
einheimischen Werften ermöglichte und die straffe Disziplin
der preußischen Landarmee auf die Marine übertrug. Das
letztere Bestreben stieß allerdings vielfach auf Widerstand
seitens der ältern Seeoffiziere. Auch für das
Unglück des Großen Kurfürsten wurde S.
verantwortlich gemacht, zumal er den Admiral Batsch (s. d.) eifrig
in Schutz nahm. Er erhielt 20. März 1883 auf sein Gesuch den
Abschied und lebt in Östrich am Rhein.
Stoß , das Zusammentreffen eines in Bewegung
befindlichen Körpers mit einem andern ebenfalls in Bewegung
oder in Ruhe befindlichen Körper. In Beziehung auf die
Richtung, in welcher beide Körper zusammentreffen, macht man
folgende Unterschiede. Man nennt den S. zentral, wenn die Richtung,
in welcher er erfolgt, mit der Verbindungslinie der Schwerpunkte
beider Körper zusammenfällt; ist diese Bedingung nicht
erfüllt, so nennt man ihn exzentrisch. Ferner nennt man den S.
gerade, wenn die Richtung, in welcher er erfolgt, auf der
Berührungsfläche beider Körper senkrecht steht; ist
dies nicht der Fall, so nennt man ihn schief. Treffen zwei Massen
(m und m'), die sich mit verschiedenen Geschwindigkeiten (v und v')
in derselben Richtung fortbewegen, in geradem, zentralem S.
zusammen, so üben sie, während sie sich berühren,
einen Druck aufeinander aus, infolge dessen die Geschwindigkeit des
vorangehenden vermehrt, die des nachfolgenden vermindert wird. Da
dieser Druck auf beide Massen während derselben Zeit wirkt, so
müssen sich die hervorgebrachten
Geschwindigkeitsveränderungen umgekehrt verhalten wie die
Massen. Sind also c und c' die Geschwindigkeiten der Körper
nach dem S., so verhält sich $c-v:v'-c'=m':m$, woraus folgt,
daß $mc+m'c'=mv+m'v'$. Das Produkt einer Masse mit ihrer
Geschwindigkeit nennt man ihre "Bewegungsgröße"; die
vorstehende Gleichung drückt also aus, daß die Summe der
Bewegungsgrößen vor und nach dem S. die nämliche
ist. Sind die beiden Körper unelastisch, so gehen sie, nachdem
jeder eine Abplattung erfahren hat, vereinigt mit
gemeinschaftlicher Geschwindigkeit weiter, d. h. es ist $c'=c$ und
folglich $(m+m')c=mv+m'v'$. Die gemeinsame Geschwindigkeit nach dem
S. ($c$) ergibt sich demnach, wenn man die Summe der
Bewegungsgrößen durch die Summe der Massen dividiert.
Bewegen sich die Körper in entgegengesetzter Richtung, so ist
die Geschwindigkeit des einen negativ zu rechnen. Mit dem S.
unelastischer Körper ist ein Verlust an lebendiger Kraft
verbunden, welcher für die Zusammendrückung der
Körper, Erzeugung von Wärme, Schall etc. verbraucht wird.
Sind die Körper dagegen vollkommen elastisch, so gleicht sich
die Formänderung sofort wieder aus, indem jeder Körper
seine ursprüngliche Gestalt wieder annimmt; ein Verlust an
lebendiger Kraft findet also hier nicht statt, sondern die Summe
der lebendigen Kräfte muß vor und nach dem S. die
nämliche sein, d. h. es muß $mc^2+m'c'^2=mv^2+m'v'^2$
sein. Diese Bedingung, mit der obigen, daß die Summe der
Bewegungsgrößen ungeändert bleibt,
zusammengenommen, erlaubt auch in diesem Fall, die
Endgeschwindigkeiten c und c' zu bestimmen. Sind z. B. die
elastischen Massen einander gleich, so geht jede nach dem S. mit
derjenigen Geschwindigkeit weiter, welche die andre vor dem S.
besaß: sie vertauschen ihre Geschwindigkeiten. Eine ruhende
Billardkugel z. B., welche von einer bewegten zentral getroffen
wird, nimmt die Geschwindigkeit der letztern an, während diese
an ihrer Stelle in Ruhe bleibt.
Stoß, in der Schweiz die Viehzahl, welche auf ein
Kuhrecht gehalten werden kann (s. Alpenwirtschaft); in der
Jägersprache der Schwanz des Auerhahns (s. Spiel, S. 142).
Stoß, 1) fahrbarer Paß der Appenzeller Alpen
(997 m), führt von Altstätten (470 m) im St. Gallischen
Rheinthal steil hinauf zur Paßhöhe und nun mit geringem
Gefälle abwärts nach Gais (934 m). Hier 17. Juni 1405
Sieg der Appenzeller über Herzog Friedrich von
Österreich. -
2) Luftkurort, s. Stoos.
Stoß, Veit, Bildhauer und -Schnitzer, geboren um
1438 oder 1440 zu Nürnberg, ging 1477 nach Krakau und war dort
bis 1496 thätig. Er schuf daselbst von 1477 bis 1484 den
Hochaltar für die Marienkirche, in dessen Mittelschrein Tod
und Himmelfahrt der Maria in überlebensgroßen,
vollrunden Figuren, auf dessen Flügeln Szenen aus dem Leben
Christi und der Maria in Reliefs dargestellt sind. Nach dem Tode
des Königs Kasimir IV. 1492 arbeitete S. dessen Grabmal aus
rotem Marmor für die Kathedrale zu Krakau. Gleichzeitig
entstand die in Marmor ausgeführte Grabplatte des Erzbischofs
Zbigniew Olesnicki im Dom zu Gnesen und bald darauf der Altar des
heil. Stanislaus für die Marienkirche zu Krakau. 1496 kehrte
S. nach Nürnberg zurück, wo er ebenfalls eine sehr
fruchtbare Thätigkeit in der Anfertigung von in Holz
geschnitzten Altären, Gruppen und Einzelfiguren entfaltete,
deren Umfang zur Zeit noch nicht festgestellt ist. Seine Hauptwerke
sind: ein Relief mit der Krönung der Madonna im Germanischen
Museum zu Nürnberg, eine Statue der Madonna in der
Frauenkirche, der Englische Gruß in der Lorenzkirche (1518
von Anton Tucher gestiftet), vom Gewölbe des Chors
herabhängend und die Figuren des Engels und der Maria in einem
mit sieben Medaillons geschmückten Kranz darstellend (von
einem der Medaillons die Figur der Maria auf Tafel "Bildhauerkunst
VI", Fig. 3), die Meisterschöpfung des Künstlers, und die
Rosenkranztafel im Germanischen Museum. In den Köpfen seiner
Figuren spricht sich innige und zarte Empfindung aus; doch ist die
Formengebung noch gebunden und der Faltenwurf von der krausen
Manier des spätgotischen Stils beherrscht. S. war ein
unruhiger Bürger, welcher dem Rat von Nürnberg viel
Verdruß bereitete. Wegen Fälschung wurde er gebrandmarkt
und beging Verrat an seiner Vaterstadt, den er mit Gefängnis
büßen mußte. Er starb 1533. Vgl. Bergau, Der
Bitdschnitzer Veit S. und seine Werke (Nürnb. 1884).
Stöße, die Wände der Stollen und
Schächte.
Stößen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Merseburg, Kreis Weißenfels, hat eine evang. Kirche, eine
Zuckerfabrik und (1885) 1404 Einw.; nahebei Braunkohlengruben.
Stösser, Franz Ludwig von, bad. Staatsmann, geb. 21.
Juni 1824 zu Heidelberg aus einer alten, aus Straßburg
stammenden Beamtenfamilie, studierte in Heidelberg Rechts-, Staats-
und Finanzwissenschaft und ward 1855 als Universitätsamtmann
und Mitglied des Spruchkollegiums an der dortigen Universität
angestellt. 1859 wurde er Amtsvorstand in Eppingen und 1862 in
Konstanz, wo er als Mitbegründer des Volkswirtschaftlichen
Vereins für die
355
Stößer - Stoy.
Errichtung von Vorschußvereinen eifrig thätig war und
zu den Führern der deutschen Partei gehörte. Nachdem er
1866-69 den Posten eines Stadtdirektors von Heidelberg bekleidet
hatte, wurde er zum Rat im Ministerium des Innern und zum
Landeskommissar für die Kreise Mosheim, Heidelberg und Mosbach
befördert. Seit 1871 Mitglied der Zweiten Kammer, wurde er
1876 zum Präsidenten des Ministeriums des Innern an Jollys
Stelle ernannt. Nachdem er das Gemeindesteuerwesen zum
Abschluß gebracht hatte, legte er Anfang 1880 der Zweiten
Kammer einen Gesetzentwurf über die Prüfungen der
katholischen Geistlichen vor, der aber nicht den Beifall der
liberalen Mehrheit der Kammer fand und erst in veränderter
Gestalt angenommen wurde. Bei Gelegenheit der Vereinfachung der
badischen Staatsverwaltung ward daher S. 20. April 1881 seines
Ministerpostens enthoben u. zum Senatspräsidenten des
Oberlandesgerichts ernannt und mit der Leitung des evangelischen
Oberkirchenrats beauftragt.
Stößer, f. v. w. Habicht.
Stoßfuge, beim Vermauern von Steinen die senkrechte
Fuge im Gegensatz zur wagerechten Lagerfuge; bei Bogen die mit der
Bogenlinie konzentrische Fuge. Vgl. Gewölbe, S. 311.
Stoßheber, s. Hydraulischer Widder.
Stoßherd, s. Aufbereitung, S. 53.
Stoßmafchine, f. Hobelmaschinen, S. 588, und
Lochen.
Stoßvogel, s. v. w. Habicht.
Stoßwerk, s. v. w. Prägmaschine, s.
Münzwesen, S. 895.
Stötteritz, Dorf in der sächs. Kreis- u.
Amtshauptmannschaft Leipzig, südöstlich bei Leipzig, hat
Eisengießerei und Maschinenfabrikation, Dampfbierbrauerei,
Zigarrenfabrikation, Ziegelei u. (1885) 4980 Einw. In der Nähe
die Irrenanstalt von Thonberg (s. d.).
Stottern und Stammeln, Bezeichnung der fehlerhaften
Sprachweisen, regelwidrigen Lautbildungen und Lautverbindungen,
welche nicht auf einem Mangel in dem anatomischen Bau der
Sprachorgane, sondern lediglich auf mangelhafter Beherrschung
derselben durch den Willen beruhen. Dieser Fehler ist namentlich
bei jüngern Individuen sehr häufig. Er tritt zurück
oder verschwindet, wenn das stotternde Individuum für sich
allein spricht, wenn es singt, mit Pathos deklamiert etc. Sobald
aber diese den Stotternden unbefangen machenden Einflüsse
wegfallen, so tritt ein Mißverhältnis zwischen den
Bewegungen ein, welche zur Lautbildung, und denjenigen, welche zur
Ausatmung dienen. Der Stotternde verweilt nämlich bei seinen
Sprechversuchen unwillkürlich auf der jeweiligen Artikulation
der Sprachorgane zu lange und vermag den Vokal nicht unmittelbar
anzufügen, so daß der exspiratorische Fluß der
Sprache durch die zur Lautbildung erforderlichen Muskelaktionen
nicht momentan, wie im normalen Sprechen, sondern anhaltend
unterbrochen wird. Merkel bezeichnet daher das Stottern einfach als
einen Sprachfunktionsfehler, der darin besteht, daß die
Muskelkontraktionen, die wir zum Zweck der Lautbitdung vornehmen,
nicht von den Ausatmungsbewegungen überwunden werden
können, wie es eigentlich geschehen sollte. Das
Mißverhältnis beruht wahrscheinlich zum großen
Teil auf einem angebornen Moment, welches wir nicht näher
kennen, zum Teil aber sicher auch in einer falschen Erziehung und
Gewöhnung der für die Sprache thätigen
Muskelgruppen. Die Beseitigung des Stotterns erfordert immer
längere Zeit und Geduld, zumal wenn das Übel schon lange
gedauert hat und der Stotternde über die erste Jugend hinaus
ist. Der Stotternde muß tief einatmen, mit voller Lunge und
mit enger Stimmritze ausatmen lernen; die gewaltsame Aktion der
lautbildenden Organe muß mechanisch verhindert und der
Fluß der Rede durch rhythmische Hilfsmittel
herbeigeführt und erhalten werden. Zu diesem Zweck müssen
besondere sprachgymnastische Übungen unter der Leitung eines
mit der Natur des Stotterns vertrauten Lehrers angestellt werden.
Abgesehen von dem eigentlichen Stottern, gibt es auch noch eine
Unfähigkeit, gewisse Sprachlaute zu bilden; diesen
Sprachfehler pflegt man als Stammeln zu bezeichnen. Die Fehler,
welche man hierzu rechnen muß, sind fast so zahlreich, als es
verschiedene Buchstaben gibt. Bemerkenswert ist ein Stammeln,
welches in fehlerhafter Verbindung von Silben und Wörtern
besteht und bei Kindern, namentlich bei Mädchen von 9-10
Jahren, öfter als Symptom des Veitstanzes vorkommt.
Gebildetere Personen, welche in der Jugend an einem solchen Fehler
litten, lernen zuweilen allmählich den Fluß der Rede
dadurch herstellen, daß sie beliebige fremdartige Töne,
Silben oder selbst Wörter (in welchen besonders der Laut ng
und gn vorwaltet) stellenweise ihrer Rede beimischen und damit die
Pausen und Unterbrechungen ausfüllen, welche sonst entstehen
würden. Vgl. Merkel, Anthropophonik (Leipz. 1856);
Kußmaul, Die Störungen der Sprache (2. Aust., das.
1881); Gutzmann, Das Stottern (2. Aufl., Berl. 1887); Coen,
Therapie des Stammelns (Stuttg. 1889); Derselbe, Das
Stotterübel (das. 1889).
Stotternheim, Dorf im sachsen-weimar. Verwaltungsbezirk I
(Weimar), an der Linie Sangerhausen-Erfurt der Preußischen
Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, eine Saline (Luisenhall) mit
Solbad und (1885) 1301 Einw.
Stou, 2239 m hoher Berggipfel der Karawanken in
Kärnten.
Stour (spr. staur), Name mehrerer Flüsse in England,
deren wichtigster bei Harwich in die Nordsee fällt.
Stourbridge (spr. staur-bridsch), Stadt im
nördlichen Worcestershire (England), südwestlich von
Dudley, am Stour, hat wichtige Fabrikation von Glas und Glaswaren,
Töpferwaren, feuerfesten Ziegeln und Schmelztiegeln,
Eisenwerke und (1885) 9757 Einw.
Stourdza, s. Sturdza.
Stourport (spr. staur-port), Fabrikstadt in
Worcestershire (England), an der Mündung des Stour in den
Severn, mit Spinnerei, Teppichweberei und (1881) 3358 Einw.
Stout (engl., spr. staut), in England gebrautes starkes,
dunkles Bier, wird vielfach gemischt mit dem hellern Ale oder
Bitter getrunken ("s. and bitter").
Stowe (spr. stoh), Harriet Eliz., s. Beecher 2).
Stowmarket (spr. stohmarket), Stadt in der engl.
Grafschaft Suffolk, am schiffbaren Gipping, hat Fabrikation von
Kunstdünger und landwirtschaftlichen Geräten und (1881)
4052 Einw.
Stoy, Karl Volkmar, namhafter Pädagog, geb. 22. Jan.
1815 zu Pegau, studierte in Leipzig und Göttingen Theologie,
habilitierte sich 1843 als Privatdozent der Philosophie in Jena, wo
er zugleich ein pädagogisches Seminar sowie eine
Erziehungsanstalt gründete, ward 1845 Professor der
Philosophie, 1857 Schulrat; 1865 folgte er einem Ruf an die
Universität zu Heidelberg, begab sich mit Urlaub 1867 nach
Bielitz, um dort ein Lehrerseminar nach seinen Grundsätzen
einzurichten, und kehrte 1868 nach Heidelberg zurück. Seit
1874 wirkte er wieder als Professor und Schulrat in Jena und starb
daselbst 23. Jan. 1885.
356
Strabane - Stradivari.
Seiner philosophischen Richtung nach gehört S. zur Schule
Herbarts. Von seinen Schriften sind hervorzuheben: "Schule und
Leben" (Jena 1844-51, 5 Hefte); "Hauspädagogik in Monologen
und Ansprachen" (Leipz. 1855); "Haus- und Schulpolizei" (Berl.
1856); "Zwei Tage in englischen Gymnasien" (Leipz. 1860);
"Encyklopädie, Methodologie und Litteratur der Pädagogik"
(2. Aufl., das. 1878); "Organisation des Lehrerseminars" (das.
1869); "Philosophische Propädeutik" (das. 1869-70, 2 Tle.) und
zahlreiche Aufsätze in der "Allgemeinen Schulzeitung", die S.
1870-82 herausgab. Vgl. Fröhlich, Stoys Leben, Lehre und
Wirken (Dresd. 1885); Bliedner, S. und das pädagogische
Universitätsseminar (Leipz. 1886).
Strabane (spr. strebänn), Stadt in der irischen
Grafschaft Tyrone, am Mourne (Lifford gegenüber), mit
Leinweberei, Flachshandel und (1881) 4196 Einw.
Strabismus (griech.), s. Schielen.
Strabon, griech. Geograph, geboren um 60 v. Chr. zu
Amasia in Kappadokien aus einer griechischen Familie, unternahm
ausgedehnte Reisen im Gebiet des Mittelmeers, östlich bis
Armenien, westlich bis Etrurien und kam 29 v. Chr. nach Italien, wo
er sich in Rom längere Zeit aufhielt. Am besten waren ihm aus
eigner Anschauung Kleinasien, Griechenland, Italien und
Ägypten bekannt. Sein Werk "Geographica" (17 Bücher) ist
neben dem des Ptolemäos die Hauptquelle der alten Geographie;
namentlich wurde die Kenntnis des westlichen und nördlichen
Europa durch S. sehr gefördert. Von den Ausgaben sind die von
Kramer(Berl. 1844-52, 3 Bde.; kleine Ausg. 1852, 2 Bde.),
Müller und Dübner (Par. 1853-56, 2 Bde.) und Meineke
(Leipz. 1852-53, 3 Bde.) hervorzuheben. Die beste Übersetzung
des Werkes ist die von Groskurd (Berl. 1831-33, 4 Bde.).
Strabotomie (griech.), Schieloperation.
Stracchino (spr. strackino), s. Käse, S. 584.
Strachwitz, Moritz Karl Wilhelm, Graf von, Dichter, geb.
13. März 1822 zu Peterwitz in Schlesien, studierte zu Breslau
und Berlin und lebte dann auf seinem Gut Schebetau in Mähren
seiner Muse. Auf einer Reise in Venedig erkrankt, starb er bereits
11. Dez. 1847 in Wien. Seine Gedichte: "Lieder eines Erwachenden"
(Bresl. 1842, 5. Aufl. 1854), "Neue Gedichte" (das. 1848, 2. Aufl.
1849) und "Gedichte" (Gesamtausg., das. 1850; 7. Aufl., Berl. 1878)
bekunden ein selbständiges, kräftiges Talent und eine
männlich starke Individualität, welche in der
Begeisterung für das Edle wie im Kampf gegen das Gemeine
gleiche Tiefe der Empfindung offenbarte, so daß sein
früher Tod einen Verlust für die deutsche Dichtung in
sich schloß. Auch nach formeller Seite reihen sich S.'
Gedichte durch ihre hohe künstlerische Durchbildung,
Prägnanz und Frische des Ausdrucks den besten lyrischen
Dichtungen der Neuzeit an.
Strack, 1) Johann Heinrich, Architekt, geb. 24. Juli 1805
zu Bückeburg, absolvierte das Feldmesserexamen und kam dann in
das Atelier Schinkels. 1834 machte er mit Ed. Meyerheim eine
Studienreise in die Altmark, als deren Ausbeute die
"Architektonischen Denkmäler der Altmark Brandenburg" mit Text
von Kugler (Berl. 1833) erschienen. 1838 wurde er Baumeister und
war nun bis 1843 als Lehrer der Architektur an der Artillerie- und
Ingenieurschule, seit 1839 als solcher an der Kunstakademie und
später in gleicher Eigenschaft an der Bauakademie zu Berlin
thätig. Studienreisen führten ihn mit Stüler nach
England und Frankreich, mit Rauch nach Dänemark. 1845 ward ihm
die Oberleitung des Baues des Schlosses Babelsberg bei Potsdam
übertragen. Im Winter 1853/54 begleitete er den Prinzen
Friedrich Wilhelm (Kaiser Friedrich) auf einer Reise durch Italien
und Sizilien und baute für denselben 1856-58 das alte Palais
König Friedrich Wilhelms III. in Berlin aus. 1862 weilte er im
Auftrag der preußischen Regierung mehrere Monate in Athen, wo
er das Dionysostheater am Abhang der Akropolis auffand; 1866-76
erbaute er die Berliner Nationalgalerie, und gleichzeitig entstand
das Siegesdenkmal auf dem Königsplatz. Von seinen weitern
Bauten sind zu nennen: die Petri- und Andreaskirche in Berlin und
Schloß Frederiksborg bei Kopenhagen. Er starb 12. Juni 1880
in Berlin. Von bleibendem Wert ist seine Schrift "Das griechische
Theater" (Berl. 1863).
2) Hermann, protestant. Theolog, geb. 6. Mai 1848 zu Berlin,
studierte daselbst und in Leipzig, wurde 1872 Lehrer in Berlin,
arbeitete 1873-76 mit Unterstützung der preußischen
Regierung in St. Petersburg und ist seit 1877
außerordentlicher Profefsor der Theologie in Berlin. Unter
seinen Schriften sind zu nennen: "Prolegomena critica in Vetus
Testamentum hebraicum" (Leipz. 1873); "Katalog der hebräischen
Bibelhandschriften in St. Petersburg" (das. 1875, zusammen mit
Harkowy); "Prophetarum posteriorum codex Babylonicus
Petropolitanus" (das. 1876); "Die Sprüche der Väter" (2.
Aufl., Berl. 1888); "Hebräische Grammatik" (2. Aufl., Karlsr.
1885); "Elementarschule und Lehrerbildung in Rußland" (in
"Rußlands Unterrichtswesen", Leipz. 1882); "Lehrbuch der
neuhebräischen Sprache und Litteratur" (mit Siegfried, das.
1884); die Streitschrift "Herr Adolf Stöcker" (das. 1886);
"Einleitung in das Alte Testament" (3. Aufl., Nördling. 1888)
und gab mit Zöckler den "Kurzgefaßten Kommentar zu den
Heiligen Schriften Alten und Neuen Testaments" (das. 1888 ff.)
heraus. 1885 begründete er die Zeitschrift für
Judenmission "Nathanael".
Strada (ital.), Straße; S. ferrata, Eisenbahn.
Stradbroke (spr. sträddbrok), große Insel an
der Südostküste der britisch-austral. Kolonie Queensland,
welche mit der Moretoninsel, von der sie durch den Rouskanal
getrennt ist, die Moretonbai (s. d.) bildet; hat einen Leuchtturm.
Beide Inseln sind auf der Westküste bewohnt.
Stradella, Stadt in der ital. Provinz Pavia. Kreis
Voghera, am Aversa und an der Eisenbahn Alessandria-Piacenza, mit
Industrie in Seide, Leder, Weinstein und Weingeist und (1881) 6344
Einw.
Stradella, Alessandro, Sänger und Komponist, geb.
1645 zu Neapel, wo er auch seine Ausbildung erhielt, begab sich
später nach Venedig und von dort, nachdem er die Geliebte
eines vornehmen Venezianers entführt hatte, nach Rom. Hier
entging er mit Glück einem von seinem Nebenbuhler gegen ihn
veranstalteten Attentat und floh nach Turin, wo er bei einem
zweiten, von Venedig aus gegen ihn unternommenen Mordversuch schwer
verwundet wurde. Ein dritter sollte für ihn
verhängnisvoll werden; denn als er 1678 einem Ruf nach Genua
gefolgt war. um für den Karneval die Oper "La forza dell' amor
paterno" in Szene zu setzen, wurde er am Tag nach seiner Ankunft
auf seinem Zimmer erdolcht gefunden. über sein Leben und seine
Werke, unter denen er selbst das Oratorium "San Giovanni Battista"
als sein vorzüglichstes bezeichnet hat, gibt P. Richards
Arbeit "S. et les Contarini" (in der Pariser Musikzeitung "Le
Menestrel" 1865, Nr. 51; 1866, Nr. 18) ausführliche und
zuverlässige Auskunft.
Stradioten, s. Stratioten.
Stradivari, Antonio, der größte Meister
des
357
Straelen - Strafe.
Violinbaues, geb. 1644 zu Cremona aus einer alten Cremoneser
Patrizierfamilie, war Schüler von Niccolo Amati, zeichnete
seine ersten, für seinen Meister gearbeiteten Violinen mit
dessen Namen, verheiratete sich 1667 und fing wohl um dieselbe Zeit
an für eigne Rechnung zu arbeiten. Von seinen Söhnen
wurden zwei ebenfalls Geigenbauer, nämlich Francesco, geb. 1.
Febr. 1671, gest. 11. Mai 1743, und Omobono, geb. 14. Nov. 1679,
gest. 8. Juli 1742. Beide arbeiteten mit dem Vater gemeinsam und
waren selbst fast schon Greise, als ihr Vater 18. Dez. 1737 starb.
S. baute eine sehr große Zahl Instrumente und zwar ebenso
vorzügliche Celli wie Violinen, Bratschen und Violen der
ältern Art (Gamben etc.), Lauten, Guitarren, Mandolinen etc. ;
seine letzte bekannte Violine ist von seiner Hand mit 1736 datiert.
Sein Sohn Francesco zeichnete von 1725 ab mit seinem Namen, Omobono
arbeitete einige Instrumente mit ihm zusammen, "sotto la disciplina
d'A. S."; er scheint mehr mit der Beschaffung des Materials und dem
Vertrieb als mit dem Bau der Instrumente zu thun gehabt zu haben.
Vater und beide Söhne ruhen in einem gemeinschaftlichen Grab.
Vgl. Fétis, Antoine S. (Par. 1856); Lombardini, Ceuni sulla
celebre scuola cremonese etc." (1872); Niederheitmann, Cremona (2.
Aufl., Leipz. 1884).
Straelen, Flecken im preuß. Regierungsbezirk
Düsseldorf, Kreis Geldern, unweit der Niers und an der Linie
Venloo-Haltern der Preußischen Staatsbahn, hat eine kath.
Kirche, Seiden- und Samtweberei, Ölmühlen und (1885) 5928
meist kath. Einwohner.
Strafabteilungen, in Preußen die durch das
Militärstrafgesetz von 1873 in Militärgefängnisse
umgewandelten Strafanstalten, in welchen an degradierten
Unteroffizieren und Gemeinen Festungs- (jetzt Gefängnis-)
Strafe vollstreckt wurde.
Strafanstalten, s. Gefängniswesen.
Strafaufschub (Aufschub des Strafverfahrens), die
vorläufige Aussetzung der Vollstreckung einer
rechtskräftig zuerkannten Strafe. Solange ein Strafurteil noch
nicht rechtskräftig ist, d. h. solange es noch durch ein
ordentliches Rechtsmittel, wie Berufung oder Revision, angefochten
werden kann, ist die Strafe nicht vollstreckbar. Wird innerhalb der
dazu gesetzten Frist ein solches Rechtsmittel eingelegt, so kann
die erkannte Strafe nicht vollstreckt werden, bis über das
Rechtsmittel entschieden ist (sogen. Suspensiveffekt des
Rechtsmittels). Ist aber eine Strafe rechtskräftig erkannt, so
ist sie zu vollstrecken, doch kann nach der deutschen
Strafprozeßordnung (§ 488) ein S. gewährt werden,
wenn durch die sofortige Vollstreckung dem Verurteilten oder seiner
Familie erhebliche, außerhalb des Strafzwecks liegende
Nachteile erwachsen würden. Der S. darf aber in solchen
Fällen den Zeitraum von vier Monaten nicht übersteigen;
er kann an eine Sicherheitsleistung oder an andre Bedingungen
geknüpft werden. In einigen andern Fällen muß ein
S. eintreten; so, wenn der Verurteilte eine Freiheitsstrafe zu
verbüßen hat und in Geisteskrankheit verfällt,
ebenso bei andern Krankheiten, wenn von der Strafvollstreckung eine
nahe Lebensgefahr für den Verurteilten zu besorgen steht, oder
wenn dieser sich in einem körperlichen Zustand befindet, bei
welchem eine sofortige Vollstreckung mit der Einrichtung der
Strafanstalt unverträglich ist (Strafprozeßordnung,
§ 487). Bei Todesurteilen tritt insofern stets ein S. ein, als
sie nicht eher vollstreckt werden dürfen, bis die
Entschließung des Staatsoberhaupts, und in denjenigen Sachen,
in denen das Reichsgericht in erster Instanz erkannt hat, die
Entschließung des Kaisers ergangen ist, von dem
Begnadigungsrecht keinen Gebrauch machen zu wollen. An schwangern
oder geisteskranken Personen dürfen Todesurteile nicht
vollstreckt werden. Durch einen Antrag auf Wiederaufnahme (s. d.)
des Verfahrens wird dle Vollstreckung des Urteils nicht gehemmt.
Das Gericht kann jedoch einen S. oder eine Unterbrechung der
Vollstreckung anordnen. Strafbefehl (Strafmandat,
Strafverfügung), bei Übertretungen und geringfügigen
Vergehen der Erlaß des Strafrichters, welcher dem
Beschuldigten ohne vorgängiges Gehör eine bestimmte
Strafe festsetzt. Diese Strafe wird vollstreckbar, wenn der
Beschuldigte nicht binnen einer Woche nach der Zustellung
Einwendung (Einspruch) dagegen erhebt. Im Fall eines Einspruchs
wird zur Hauptverhandlung geschritten. Nach der deutschen
Strafprozeßordnung darf die in dem S. angedrohte Strafe nicht
über 150 Mk. Geldstrafe oder sechs Wochen Freiheitsstrafe
hinausgehen. Bei Übertretungen können auch
Polizeibehörden Strafbefehle erlassen und Haft bis zu 14 Tagen
oder Geldstrafe verfügen. Derartige Strafbefehle heißen
Strafverfügungen im Gegensatz zum S. des Amtsrichters und zum
Strafbescheid (s. d.) der Verwaltungsbehörde. Vgl. Deutsche
Strafprozeßordnung, § 447 ff., 453 ff.;
Österreichische, § 460 ff.
Strafbescheid, die von einer Verwaltungsbehörde bei
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften über die Erhebung
öffentlicher Abgaben und Gefalle erlassene Straffestsetzung.
Binnen einer Woche kann in solchen Fällen von dem
Beschuldigten auf gerichtliche Entscheidung angetragen werden. Vgl.
Deutsche Strafprozeßordnung, § 459 ff.
Strafbills, engl. Ausnahmegesetze, welche in Bezug auf
besondere Verbrechen und aufrührerische Zustände erlassen
werden.
Strafe, das wegen eines begangenen Unrechts über den
Thäter verhängte Übel oder Leiden. Unter den Begriff
der S. in diesem weitesten Sinn fällt zunächst diejenige
S., welche ein Ausfluß der Erziehungsgewalt und eines
gewissen Aufsichtsrechts ist, wie es namentlich dem Lehrer den
Schülern, dem Dienstherrn dem Gesinde, dem Lehrherrn dem
Lehrling gegenüber zusteht. Ferner gehört hierher die
eigentliche Disziplinarstrafe, welche die vorgesetzte
Dienstbehörde vermöge ihrer Disziplinargewalt (s. d.) dem
Unterbeamten gegenüber bei Ordnungswidrigkeiten auszusprechen
befugt ist; ebenso die Ordnungsstrafe, welche eine öffentliche
Behörde androhen und in Vollzug setzen kann, um die Befolgung
amtlicher Verfügungen zu erzwingen, z. B. bei Vorladungen zu
Terminen u. dgl. Auch die Konventionalstrafe, d. h. die
vertragsmäßig festgesetzte S. für den Fall der
Nichterfüllung einer übernommenen Verbindlichkeit,
fällt unter den Begriff der S. in dieser Allgemeinheit. Im
engern Sinn aber versteht man unter S. nur die sogen. Rechtsstrafe,
d. h. diejenige S., welche unmittelbar auf eine Gesetzesvorschrift
zurückzuführen und gegen den Übertreter der letztern
auszusprechen ist. Hierbei ist dann wiederum zwischen Privatstrafe
und öffentlicher S. zu unterscheiden, je nachdem die S. an den
Verletzten oder an den Staat zu verbüßen ist, und zwar
sind die Privatstrafen in der Gegenwart auf ein Minimum reduziert.
Die öffentlichen Strafen aber werden wiederum in
Polizeistrafen und Kriminalstrafen eingeteilt, je nachdem es sich
nur um die Übertretung einer polizeiltchen Vorschrift oder um
das Zuwiderhandeln gegen ein eigentliches Strafgesetz handelt. Nach
den Strafmitteln wird zwischen Todesstrafe, Frei-
358
Straferkenntnis - Strafgerichtsbarkeit.
heits- und Vermögensstrafen unterschieden. Die früher
üblichen qualifizierten Todesstrafen sind ebenso wie die
verstümmelnden und die in körperlicher Züchtigung
bestehenden Leibesstrafen, wenigstens in allen zivilisierten
Ländern, abgeschafft. Ehrenstrafen kommen nach Abschaffung
gewisser beschimpfender Strafarten, wie z. B. der Prangerstrafe,
nur noch als Nebenstrafen, d. h. als die Folgen anderweiter, in
erster Linie erkannter Strafen, vor. Das Strafensystem des
deutschen Reichsstrafgesetzbuchs (§ 13 ff.) insbesondere ist
folgendes. A. Hauptstrafen: 1) Die mittels Enthauptung zu
vollstreckende Todesstrafe (s. d.). 2) Freiheitsstrafen: a)
Zuchthausstrafe, entweder lebenslänglich oder zeitig, im
Mindestbetrag von einem und im Höchstbetrag von 15 Jahren. Die
dazu Verurteilten sind zu den in der Strafanstalt
eingeführten, nach Befinden auch zu öffentlichen Arbeiten
außerhalb der Strafanstalt anzuhalten. Die Zuchthausstrafe
zieht die dauernde Unfähigkeit zu öffentlichen
Ämtern, zum Dienst im Heer und in der Marine nach sich. b)
Gefängnisstrafe (Höchstbetrag 5 Jahre, Mindestbetrag ein
Tag). Die dazu Verurteilten können in der Gefangenanstalt auf
eine ihren Fähigkeiten und Verhältnissen angemessene
Weise, außerhalb der Anstalt jedoch nur mit ihrer Zustimmung
beschäftigt werden. Auf ihr Verlangen sind die
Gefängnissträflinge in angemessener Weise zu
beschäftigen. c) Festungshaft, lebenslänglich oder zeitig
und zwar im Mindestbetrag von einem Tag, im Höchstbetrag von
15 Jahren. Dieselbe besteht lediglich in Freiheitsentziehung mit
Beaufsichtigung der Beschäftigung und Lebensweise der
Gefangenen; sie wird in Festungen oder in andern dazu bestimmten
Räumen vollzogen (sogen. Custodia honesta). Dabei wird
achtmonatige Zuchthausstrafe einer einjährigen
Gefängnisstrafe, achtmonatige Gefängnisstrafe einer
einjährigen Festungshaft gleich geachtet. d) Haft, einfache
Freiheitsentziehung im Mindestbetrag von einem Tag, im
Höchstbetrag von 6 Wochen. 3) Geldstrafe, deren Mindestbetrag
bei Verbrechen und Vergehen auf 3 Mk., bei Übertretungen auf 1
Mk. fixiert ist. 4) Verweis, der ausnahmsweise bei jugendlichen
Personen unter 18 Jahren und nur bei besonders leichten Vergehen
und Übertretungen zulässig ist. Die Deportation (s. d.)
ist dem Strafsystem des deutschen Strafgesetzbuchs unbekannt. B.
Nebenstrafen: 1) Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte (s. d.);
2) Polizeiaufsicht (s. d.); 3) Ausweisung (s. d.) von
Ausländern; 4) Überweisung (s. d.) an die
Landespolizeibehörde; 5) Einziehung oder Konfiskation von
Verbrechensgegenständen. Gegen Militärpersonen kommen
nach dem deutschen Militärstrafgesetzbuch (§ 14 ff.)
folgende Strafen (Militärstrafen) zur Anwendung: Die
Todesstrafe, welche im Feld stets, außerdem nur dann, wenn
sie wegen eines militärischen Verbrechens erkannt worden,
durch Erschießen zu vollstrecken ist; als Freiheitsstrafen
Arrest (s. d.), Gefängnis und Festungshaft. Ist
Zuchthausstrafe verwirkt, oder wird auf Entfernung aus dem Heer
oder der Marine oder auf Dienstentlassung erkannt, oder wird das
militärische Dienstverhältnis aus einem andern Grund
aufgelöst, so geht die Strafvollstreckung auf die
bürgerlichen Behörden über. Wo die allgemeinen
Strafgesetze Geld- und Freiheitsstrafe wahlweise androhen, darf,
wenn durch die strafbare Handlung zugleich eine militärische
Dienstpflicht verletzt worden ist, auf Geldstrafe nicht erkannt
werden. Endlich kommen als besondere Ehrenstrafen gegen
Militärpersonen vor: Entfernung aus dem Heer oder der Marine,
gegen Offiziere Dienstentlassung, gegen Unteroffiziere Degradation
und gegen Unteroffiziere und Gemeine Versetzung in die zweite
Klasse des Soldatenstandes.
Straferkenntnis, s. Urteil.
Strafford, Thomas Wentworth, Graf von, engl. Staatsmann,
geb. 13. April 1593 aus einer alten Familie der Grasschaft York,
trat 1621 in das Unterhaus, wo er der Politik Jakobs I. und Karls
I. Opposition machte. Bald aber veranlaßte ihn sein Ehrgeiz,
seinen Frieden mit dem Hof zu machen; nach Buckinghams Ermordung
ernannte ihn der König 1628 zum Peer und 1629 zum Mitglied des
Geheimen Rats und Präsidenten der Regierung der Nordprovinzen.
Wentworth ward bald neben dem Bischof Laud die festeste Stütze
Karls I., dessen Bestrebungen, die Macht der Krone bis zur
Unumschränktheit zu steigern, an ihm den kräftigsten
Helfer fanden. 1632 als Statthalter nach Irland gesandt, brachte er
dort, allerdings nur durch despotische Herrschaft, das Ansehen des
Königtums zu unbedingter Anerkennung. Beim Ausbruch des
schottischen Aufstandes 1638 drängte er dem irischen Parlament
die Bewilligung reichlicher Subsidien für die
Unterdrückung der Bewegung ab und ward hierfür von Karl
I. zum Grafen von S. und Lord-Lieutenant von Irland erhoben. Nach
der Auflösung des Kurzen Parlaments von 1640 kommandierte er
während des Kampfes gegen die Schotten die königlichen
Truppen in Yorkshire. Als dann aber der König sich
genötigt sah, das Parlament wieder zu berufen, erhob 11. Nov.
1640 das Haus der Gemeinen gegen ihn die Anklage auf Hochverrat,
weil er dem König zum Kriege gegen das Volk und zur
Untergrabung der Grundgesetze des Reichs geraten habe. S.
verteidigte sich sehr geschickt, und seine Freisprechung bei den
Lords schien gesichert, als das Unterhaus auf Haslerighs Antrag den
Weg des gerichtlichen Verfahrens verließ und durch die Bill
of attainder den verhaßten Minister wegen Hochverrats zum Tod
verdammte. Die Lords, vom Volk terrorisiert, traten mit 7 Stimmen
Mehrheit diesem Beschluß bei; als der König schwankte,
denselben zu bestätigen, beschwor S. ihn in einem
großherzigen Brief, ihn um seines eignen Heils willen zu
opfern. Da unterzeichnete der Monarch 10. Mai 1641 das Urteil, und
Straffords Haupt fiel 12. Mai 1641 unter dem Schwerte des Henkers.
Nach der Restauration Karls II. wurde seine "Ehre
wiederhergestellt"; sein ältester Sohn erhielt Titel und
Peerswürde des Vaters. Seine Briefe etc. wurden 1740 in 2
Bänden veröffentlicht. Vgl. Lally-Tollendal, Vie du comte
de S. (Lond. 1795, 2 Bde.; Par. 1814); Cooper, Life of Thom.
Wentworth Earl of S. (Lond. 1874).
Strafgerichtsbarkeit (Kriminalgerichtsbarkeit, peinliche
Gerichtsbarkeit, Jurisdictio criminalis), die Befugnis zur
Ausübung der Rechtspflege auf dem Gebiet des Strafrechts. Als
Ausfluß der Staatsgewalt kann die Ausübung der S. nur
dem Staat und seinen Organen zustehen, wie dies im deutschen
Gerichtsverfassungsgesetz vom 27. Jan. 1877 (§ 15)
ausdrücklich erklärt ist. Diese Ausübung der S. ist
aber regelmäßig den ordentlichen Gerichten und nur
ausnahmsweise in leichtern Fällen den Polizeibehörden
übertragen. Nach der deutschen Strafprozeßordnung
(§ 453 ff.) darf sich die Strafgewalt der letztern nur auf
Übertretungen erstrecken, auch kann die Polizeibehörde
keine andre Strafe als Geldstrafe oder Haft bis zu 14 Tagen
aussprechen; indes ist dem Beschuldigten derartigen
Strafverfügungen der Polizeibehörde gegenüber
nachgelassen, binnen einer Woche nach der Bekanntmachung der Strafe
auf gerichtllche Entscheidung anzutragen. Wer die S. aus-
359
Strafgerichtsverfassung - Strafprozeß
zuüben hat, ist in der Gerichtsverfassung (s. Gericht), und
wie, d. h. in welcher Form, sie auszuüben ist, im
Strafprozeßrecht bestimmt (s. Strafprozeß). Die dabei
zur Anwendung kommenden Strafnormen bilden den Gegenstand des
Strafrechts (s. d.).
Strafgerichtsverfassung, s. Gericht, S. 166.
Strafgefetzbuch, umfassendes Gesetz über die von der
Staatsgewalt zu ahndenden verbrecherischen Handlungen und über
die Strafen, welche dieselben nach sich ziehen. Von den einzelnen
Verbrechen handelt der besondere Teil, während die allgemeinen
strafrechtlichen Grundsätze in dem allgemeinen Teil
dargestellt sind. Der allgemeine Teil des deutschen
Strafgesetzbuchs insbesondere handelt im ersten Abschnitt von den
Strafen, im zweiten vom verbrecherischen Versuch, im dritten von
der Teilnahme am Verbrechen und im vierten Abschnitt von den
Gründen, welche die Strafe ausschließen oder mildern. Im
besondern Teil sind dann die einzelnen Verbrechen, Vergehen und
Übertretungen sowie deren Bestrafung behandelt (s.
Strafrecht).
Strafgewalt, s. Strafrecht, S. 362.
Strafkammer, s. Landgericht.
Strafkolonien, s. Kolonien, S. 956, und Deportation.
Strafkompanie (Disziplinartruppen), in Frankreich,
Italien und Rußland Truppenteile, in welche Soldaten
strafweise versetzt werden.
Strafliste, s. Strafregister.
Strafmandat, s. Strafbefehl.
Strafpolitik, s. Strafrecht, S. 362.
Strafprozeß (Strafverfahren, Kriminalprozeß,
franz. Procédure oder Instruktion criminelle), das
gerichtliche Verfahren, welches in denjenigen Fällen Platz
greift, in denen es sich um die Untersuchung und Bestrafung von
Verbrechen handelt; auch Bezeichnung für das
Strafprozeßrecht, d. h. für die Gesamtheit der
Rechtsgrundsätze, welche jenes Verfahren normieren. Die
Zusammenstellung solcher Normen in einem ausführlichen Gesetz
wird Strafprozeßordnung genannt, so die
Strafprozeßordnung für das Deutsche Reich vom 1. Febr.
1877, die österreichische Strafprozeßordnung vom 23. Mai
1873 und der Code d'instruction criminelle Napoleons I. von 1808.
Der S. gehört im weitesten Sinn zum Strafrecht und wird
ebendeswegen auch als sogen. formales Strafrecht dem materiellen
Strafrecht (s. d.) gegenübergestellt. Während der
bürgerliche oder Zivilprozeß, in welchem über
Privatstreitigkeiten zu entscheiden ist, ursprünglich von den
Römern dem Privatrecht zugerechnet wurde und diesem jedenfalls
auch heute noch nahesteht, kann über die ausschließlich
öffentlich-rechtliche Natur des Strafprozesses ein Zweifel
nicht obwalten. Während nämlich die Mehrzahl der
Privatrechtsansprüche ohne gerichtliche Hilfe durch
freiwillige Leistung von seiten des Schuldners erfüllt wird,
kann der Strafanspruch des Staats gegen Übelthäter ohne
förmliches Verfahren niemals verwirklicht werden. Niemand kann
sich unter Verzichtleistung auf den Prozeß einer
öffentlichen Strafe freiwillig unterwerfen oder auf ein
Strafurteil des Richters verzichten, denn die Rechte, in welche die
Strafe eingreift, sind vom Standpunkt des einzelnen aus
unverzichtbar; eine Regel, die eine geringfügige Ausnahme bei
Geldbußen nur insoweit erleidet, als bei
Polizeiübertretungen der Schuldige sich einem Zahlungsbefehl
(sogen. Strafmandat) freiwillig unterwerfen kann. Der Unterschied
zwischen Zivilprozeß und S. tritt, zusammenhängend mit
diesem Prinzip, auch darin hervor, daß der Strafrichter der
materiellen Wahrheit in ganz anderm Maß bei der Prüfung
der Thatsachen und der Handhabung der Prozeßregeln
nachzustreben hat, als dies im Zivilverfahren zulässig ist, wo
die sogen. formale Wahrheit eine hervorragende Rolle spielt. So ist
z. B. im Zivilverfahren der Wahrhaftigkeit eines den
klägerischen Anspruch anerkennenden Beklagten nicht weiter
nachzuforschen, während das Geständnis eines Angeklagten
immer noch einer Prüfung von seiten des Richters zu
unterwerfen ist, ehe die Verurteilung zur Strafe ausgesprochen
werden kann. Auf den untersten Stufen staatlicher Kultur sehen sich
diese beiden Grundformen des Prozesses allerdings sehr
ähnlich, weil das Verbrechen zunächst als
Schadenzufügung aufgefaßt wird und der unmittelbar
Verletzte mit der Geltendmachung seiner Forderungen auch
gleichzeitig die staatlichen Interessen vertritt. Auf dieser Stufe
steht der altgermanische S. mit seinem Grundsatz: "Wo kein
Ankläger ist, da ist auch kein Richter". Die Verwirklichung
des staatlichen Strafrechts ist dabei von dem Verhalten der
Parteien abhängig (sogen. Privatklageprozeß im engern
Sinn). Auf einer höhern Entwicklungsstufe steht das
Strafverfahren da, wo jeder Bürger, unabhängig von einer
ihm selbst widerfahrenen Verletzung, als Ankläger die Rechte
der staatlichen Gesamtheit wahrnehmen kann. Dieser Art waren die
Einrichtungen in den antiken Republiken, zumal in Griechenland und
Rom; insbesondere bietet uns das Recht der römischen Republik
in ihrer Blütezeit ein klassisch vollendetes Muster des
staatsbürgerlichen Anklageprozesses dar. Wenn freilich der
Sittenverfall um sich greift und Verbrechen häufig werden, so
muß die Anklagethätigkeit der einzelnen
Staatsbürger als unzulänglich erscheinen. Die
gewöhnlichen Folgen des staatsbürgerlichen
Anklageprozesses in solchen Zeiten sind alsdann: zunehmende
Straflosigkeit, Bestechung des Anklägers durch reiche
Verbrecher, Erpressungsversuche durch Androhung einer Anklage gegen
Unschuldige, die ein gerichtliches Verfahren fürchten,
Aussetzung von Prämien oder Denunziantenbelohnungen, um von
Staats wegen eigennützige Menschen zur Anklägerschaft
anzureizen. Schon die Römer hatten, wie auch die Athener, alle
Schattenseiten der staatsbürgerlichen Anklage in den
spätern Zeiten zu erfahren. Gleichwohl blieb auch das
ältere kirchlich-kanonische Recht bei dieser Organisation der
Strafverfolgung stehen. Erst im 13. Jahrh. tritt in dem deutschen
auf volks-tümlicher Basis ruhenden Anklageprozeß ein
bemerkenswerter Umschwung ein. Schon in den ältesten
Anschauungen der christlichen Kirche lag nämlich die sittliche
Anforderung begrün-det, daß der sündige Christ zur
Selbstbeschuldigung im Beichtstuhl und zur Reinigung mittels
Buße durch sein Gewissen verpflichtet sei. In ihren
Sendgerichten wahrte die Kirche diese Anzeigepflicht in der
Anwendung auf Dritte. Sie hielt in ihrer Gerichtsbarkeit darauf,
daß gewisse stark verdächtigte Personen sich durch Eid
zu reinigen hatten von den gegen sie vorliegenden Beschuldigungen
(sogen. Reinigungseid). Diese vereinzelten, übrigens auch
schon im römischen Recht bemerkbaren Anfänge eines
amtlichen Einschreitens wurden nun durch Innocenz III. seit dem
Ende des 12. Jahrh. auf dem dritten lateranischen Konzil der
Anknüpfungspunkt zu einer Ausbildung des sogen.
Inquisitionsprozesses (Untersuchungsprozesses). Ursprünglich
war dieser Inquisitionsprozeß als Ausnahme gedacht neben dem
Fortbestand des ältern Anklageverfahrens als der Regel.
Dennoch entsprach das neue Verfahren so sehr den vorhandenen
Bedürf-
360
Strafprozeß (geschichtliche Entwickelung).
nissen, daß es nicht nur in den geistlichen
Gerichtshöfen bald herrschend wurde, sondern auch in der
weltlichen Justiz mehr und mehr die Oberhand gewann. Der Richter
hatte hiernach von Amts wegen überall einzuschreiten und alle
Verhältnisse der Beschuldigung und Verteidigung kraft seines
Amtes zu erforschen. Von bestimmten Rechten der Parteien konnte
somit keine Rede sein. Man unterschied dabei die Generalinquisition
als das einleitende Stadium von der Spezialinquisition als der
Untersuchung, die ihre Richtung bereits gegen bestimmte Personen
genommen hatte. Zugleich ward bei der Ketzerinquisition die
Heimlichkeit des Verfahrens vorgeschrieben und, unter
Anknüpfung an das römische Recht, die Folter angewendet.
So war gegen das Ende des Mittelalters der Inquisitionsprozeß
in den kontinentalen Ländern herrschend geworden, mit ihm die
Schriftlichkeit des Verfahrens an Stelle der Mündlichkeit und
die Entwickelung eines Instanzenzugs. Eine Ausnahme machte nur
England, wo im Zusammenhang mit dem Schwurgericht (s. d.) sich die
altgermanischen Prozeßeinrichtungen in wesentlichen
Stücken erhielten, so daß England noch gegenwärtig
der einzige Kulturstaat ist, in dem sich der alte
Anklageprozeß, wenn schon mannigfach modifiziert, bis zur
Gegenwart erhalten hat. Die (peinliche) Halsgerichtsordnung Kaiser
Karls V. von 1532 (die sogen. Carolina) schloß sich in ihrem
strafprozessualischen Inhalt eng an die bestehenden
Verhältnisse der damaligen Zeit an. Sie begünstigte
namentlich die Schriftlichkeit, worin man damals ein Schutzmittel
gegen willkürliche Verfolgungen erblicken mußte, und
schrieb deswegen die Zuziehung von Gerichtsschreibern (Aktuaren)
als wesentlichen Prozeßorganen vor. Ein hervorragendes
Verdienst erwarb sich die Carolina dadurch, daß sie das in
Deutschland völlig zerrüttete Beweisverfahren neu
ordnete, indem von ihr eine feste Beweistheorie aufgestellt wurde.
Niemand sollte ohne ausreichenden, vollen Beweis verurteilt werden.
Einen vollen Beweis lieferten aber nur das Geständnis, die
übereinstimmende Aussage mindestens zweier Zeugen oder der
richterliche Augenschein, wohingegen eine Verurteilung auf Grund
sogen. Anzeigen oder Indizien ausgeschlossen wurde. Jeder
unvollständige, auch der zur Verurteilung nicht genügende
Indizienbeweis konnte jedoch durch peinliche Frage (Folter)
ergänzt werden, so daß das auf der Folter abgelegte und
hinterher bestätigte Geständnis die Verurteilung
begründete.
So gestaltete sich der S. seit der Mitte des 17. Jahrh. in der
Hauptsache für ganz Deutschland zu derjenigen Form des
Verfahrens, welche der sächsische Jurist Carpzov bezeugt: der
reine Untersuchungsprozeß, daher erstes Einschreiten des
Richters, dem die Kriminalpolizei untergeben ist,
Voruntersuchungsführung des Richters im Sinn der durch
Zwangsmittel oder Kunstgriffe herbeizuführenden
Geständnisse, genaue Aufzeichnung aller Ermittelungen in den
Kriminalakten, nach der Erschöpfung der Beweisaufnahme
Aktenschluß, Einforderung einer Verteidigungsschrift in den
schwersten, Zulassung einer solchen in minder schweren Fällen,
Versendung der Akten von den Untersuchungsgerichten
(Inquisitoriaten) an das urteilende Gericht, das entweder in der
Sache selbst nach Lage der Akten auf Vortrag eines Referenten
endgültig erkennt, oder weitere Beweisaufnahme anordnet, oder
die peinliche Frage erkennt. An Rechtsmitteln kennt der
Untersuchungsprozeß nur das der weitern Verteidigung zu
gunsten des Inquisiten. Die Urteilsvollstreckung leitet der
Untersuchungsrichter. Die alte Beweistheorie fand ihren Mittelpunkt
in der Folter. Sobald diese (zuerst durch Friedrich d. Gr.) in
Deutschland abgeschafft wurde, was allgemein gegen das Ende des 18.
Jahrh. geschah, mußte das Gebäude des
Inquisitionsprozesses ins Wanken kommen. Schon in der Mitte des
vorigen Jahrhunderts, zumal nachdem man durch Montesquieu und
Voltaire mit den englischen Einrichtungen bekannt geworden war,
bestand auf dem Kontinent eine dem alten S. ungünstige Meinung
innerhalb der gebildeten Klassen. Die Überlieferung des alten
Inquisitionsprozesses war indessen so fest in Deutschland
eingewurzelt, daß die Kriminalordnung von Preußen
(1805) und der bayrische S. (1813) gleichwie auch Österreich
an dem alten Verfahren noch im 19. Jahrh. zäh festhielten.
Erst mit der allgemeinen Bewegung der Geister 1848 vollzog sich der
längst notwendig gewordene Bruch. Die meisten deutschen
Staaten führten ein öffentliches und mündliches
Anklageverfahren ein, und die Grundrechte des deutschen Volkes
bestimmten die wesentlichen Grundsätze der Reform. Längst
vor 1848 hatten aber Theorie und Wissenschaft die Notwendigkeit
einer durchgreifenden Besserung der Strafprozeßeinrichtungen
dargethan. Das Muster, das man 1848 und in den folgenden Jahren
vorzugsweise zu befolgen sich entschloß, bot der
französische Prozeß, der in den linksrheinischen
Landesteilen deutscher Staaten aus dem Napoleonischen Zeitalter
bestehen geblieben war. Frankreich selbst hatte im ersten Beginn
der Revolution 1789 mit der Beseitigung des alten Strafprozesses
Ernst gemacht. Während das Verfahren selbst den deutschen
Zuständen des Strafprozeßrechts sich erheblich
näherte, hatte Frankreich aus dem Mittelalter eine Magistratur
ererbt, deren Stellung nachmals von entscheidender Bedeutung und
Vorbildlichkeit für den gesamten europäischen Kontinent
werden sollte: die Staatsanwaltschaft (ministère public),
hervorgegangen aus den königlichen Prokuratoren, welche die
fiskalischen Interessen der Krone bei den Gerichten wahrzunehmen
ursprünglich bestimmt gewesen waren und nach und nach einen
erheblichen Einfluß auf den Gang des Strafprozesses erlangt
hatten. Aus diesen Elementen der königlichen
Prozeßvertretung formte die französische Revolution die
Staatsbehörde, zu deren wesentlichen Funktionen die Betreibung
der öffentlichen Anklage (action publique), die Sammlung der
Belastungsbeweise, die Vornahme schleuniger, einen Aufschub nicht
gestattender Beweiserhebungen, die Vertretung der Anklage im
öffentlichen Verfahren, die Einlegung von Rechtsmitteln und
die Vollstreckung der Urteile gehören. Der französische
Prozeß, im Code d'instruction criminelle von 1808 zum
Abschluß gekommen, bedeutet den Untersuchungsprozeß mit
äußerlicher Anklageform. Das Wesen des echten
Anklageprozesses bedingt nämlich die Annahme des
Parteibegriffs und die Gleichheit der Parteirechte. Davon kann aber
nach französischem Recht keine Rede sein. Der Staatsanwalt ist
eine Behörde, unabhängig vom Richter, für etwaige
Ausschreitungen der gerichtlichen Disziplin nicht unterworfen, dem
Wort nach beauftragt mit der Wahrung des Gesetzes, ohne Garantien
der persönlichen Unabhängigkeit, absetzbar und den
Weisungen der Justizminister unterthan, dennoch aber wiederum in
manchen Dingen dem richterlichen Amt bezüglich der
Geschäftsführung übergeordnet, wofern er als Organ
der Justizaufsicht thätig zu sein hat. Diesem
französischen Muster entsprechend ist denn auch in den
deutschen Gesetzen die öffentliche Anklagebehörde in
Deutschland seit 1848
361
Strafprozeß - Strafrecht.
in der Mehrzahl der deutschen Staaten eingerichtet worden. Die
Staatsanwaltschaft ist demgemäß das ausschließlich
berechtigte Organ der Strafverfolgung. Eine Beschränkung des
sogen. Anklagemonopols liegt nur darin, daß nach einmal
erhobener Anklage der Richter die Untersuchung auch gegen den
Antrag der Staatsanwaltschaft weiter fortführen und
verurteilen kann, nach französischem Recht sogar die
Staatsbehörde zur Erhebung der Anklage durch die
Appellhöfe angehalten werden darf, daß ferner in
gewissen fiskalischen Angelegenheiten (z. B. in Zollstrafsachen und
Steuerkontraventionen) administrative Organe an die Gerichte gehen
können, und daß bei sogen. Antragsdelikten die
Staatsbehörde an den Strafantrag des Verletzten gebunden ist.
Die Mängel der kontinentalen Prozeßorganisation treten
vorwiegend darin hervor, daß die Staatsbehörde durch
unterlassene Anklageerhebung gleichsam mitbeteiligt wird an der
Ausübung des Begnadigungsrechts und, in Abhängigkeit von
den jeweilig herrschenden Parteiströmungen, wenig geneigt sein
wird, den Ausschreitungen des Beamtentums wirksam entgegenzutreten.
Auf den deutschen Juristentagen wurde daher wiederholt die
Zulassung der sogen. subsidiären Privatanklage für
diejenigen Fälle befürwortet, in denen die
Staatsbehörde ihr Einschreiten verweigert. In dem Zeitraum
zwischen 1848 und 1877 war übrigens das Strafprozeßrecht
in Deutschland sehr verschiedenartig gestaltet. Eine Gruppe von
Gesetzgebungen behielt die ältern, auf der Basis der
Inquisitionsprozedur ruhenden Gesetze bei und verknüpfte damit
in äußerlicher Weise die Einrichtungen der
Staatsanwaltschaft, des Schwurgerichts, der Öffentlichkeit und
Mündlichkeit im Hauptverfahren (so in Preußen und
Bayern). Eine zweite Gruppe verhielt sich gegen alle Reformen
ablehnend (z. B. Mecklenburg). Eine dritte Klasse ließ neue,
einheitlich gearbeitete Strafprozeßordnungen ergehen, indem
man sich bald den französischen Mustern enger anschloß
(so in Hannover, Rheinhessen), bald die Erfahrungen des englischen
Rechts verwertete (Braunschweig), bald in mehr selbständiger
Behandlung das Prozeßrecht ordnete (Baden, Württemberg,
Sachsen). Diesen Verschiedenheiten ist schließlich durch die
Reichsstrafprozeßordnung vom 1. Febr. 1877 in Verbindung mit
dem Gerichtsverfassungsgesetz 27. Jan. 1877 ein Ende gemacht
worden. Auch dieses neue Recht ruht auf der Grundlage des
französischen Strafprozesses. Die Grundzüge des
gegenwärtigen Rechtszustandes sind folgende: 1) Dreiteilung
der Strafgerichtsbarkeit in der untern Instanz in der Weise,
daß die leichten Straffälle von Amtsgerichten unter
Zuziehung von Schöffen, die mittelschweren Vergehen von den
Strafkammern der Landgerichte, die schweren Verbrechen von
Geschwornen abgeurteilt werden (s. Gericht, S. 166). 2) Einrichtung
der Staatsanwaltschaft (s. d.) wesentlich nach französischem
Muster. Nur ausnahmsweise bei Beleidigungen und leichten
Körperverletzungen tritt der Privatkläger an die Stelle
des Staatsanwalts. 3) Beibehaltung der schriftlichen und geheimen
Voruntersuchung im Gegensatz zu den in England geltenden Regeln der
Öffentlichkeit und Mündlichkeit. Der zur Führung der
Voruntersuchung bei den Landgerichten bestellte
Untersuchungsrichter darf an dem Hauptverfahren nicht teilnehmen.
Notwendig ist die Voruntersuchung indes nur bei den
schwurgerichtlichen Fällen. 4) Beweiserhebung im
Hauptverfahren durch den Richter im Gegensatz zu der englischen
Form des Kreuzverhörs, wonach die Parteien selbst die von
ihnen vorgeführten Zeugen befragen unter Zulassung der
Gegenfrage von seiten des Prozeßgegners. 5) Beibehaltung des
Verhörs der Angeklagten, das dem englischen Recht fremd blieb.
6) Beseitigung aller die richterliche Überzeugung
einschränkenden Beweisregeln mit alleiniger Ausnahme der auf
die Vereidigung der Zeugen und Sachverständigen
bezüglichen Vorschriften, während in England ein
gerichtsgebräuchliches System von Beweisregeln bestehen blieb.
7) Öffentlichkeit (s. d.) und Mündlichkeit des
Hauptverfahrens; erstere neuerdings etwas eingeschränkt. 8)
Das Institut der notwendigen, erforderlichen Falls von Amts wegen
zu veranlassenden Verteidigung in schweren Verbrechensfällen.
9) Beseitigung des Rechtsmittels der Berufung gegen
landgerichtliche Erkenntnisse, was die hauptsächlichste, ihrem
Wert nach zweifelhafte Abweichung vom französischen Recht
bildet. Die Wiedereinführung der Berufung gegen die Urteile
der landgerichtlichen Strafkammern wird vielfach angestrebt.
Gegenwärtig ist die Berufung nur gegen Erkenntnisse der
Schöffengerichte zulässig. Sie geht an die Strafkammer
des Landgerichts. Urteile der Strafkammern der Landgerichte und der
Schwurgerichte sind nur durch das Rechtsmittel der Revision (s. d.)
anfechtbar. Die Revision befaßt sich lediglich mit der
Rechtsfrage, nicht mit der Thatfrage. 10) Erweiterung des
Rechtsmittels der Wiederaufnahme des Verfahrens zum teilweisen
Ersatz der Berufung und zur Anfechtung der Thatfrage. Besondere
Verfahrensregeln gelten gegen ungehorsam Ausbleibende (sogen.
Kontumazialverfahren). Auch bestehen Ausnahmegerichte für den
Fall des Belagerungszustandes und für Anklagen auf Hochverrat
gegen das Reich, für welche der höchste Reichsgerichtshof
kompetent ist.
[Litteratur.] Für das ältere Recht vor 1848:
Mittermaier, Das deutsche Strafverfahren (4. Aufl., Heidelb. 1846,
2 Bde.); Feuerbach, Betrachtungen über die Öffentlichkeit
und Mündlichkeit der Gerichtspflege (Gieß. 1821 u.
1824); Martin, Lehrbuch des Kriminalprozesses (5. Aufl. von Temme,
Leipz. 1857). Für das Übergangsstadium von 1848-77:
Planck, Systematische Darstellung des deutschen Strafverfahrens auf
Grundlage der neuen Strafprozeßordnungen seit 1848
(Götting. 1857); Zachariä, Handbuch des deutschen
Strafprozesses (das. 1861-68). Für die neue deutsche
Reichsstrafprozeßordnung: Kommentare von Dalke (2. Aufl.,
Berl. 1880), Hahn (2. Aufl., das. 1884 ff.), Keller (2. Aufl., Lahr
1882), Löwe (5. Aufl., Berl. 1888), Puchelt, Schwarze, Thilo
u. a.; v. Holtzendorff, Handbuch des deutschen
Strafprozeßrechts, in Einzelbeiträgen mehrerer Verfasser
(das. 1877-79, 2 Bde.); Lehrbücher des deutschen
Strafprozeßrechts von v. Bar (das. 1878), Dochow (3. Aufl.,
das. 1880), John (2. Aufl., Leipz. 1882), Meves (3. Aufl., Berl.
1880), Stenglein (Stuttg. 1887) u. a. Für den
österreichischen S.: Ullmann, Österreichisches
Strafprozeßrecht (2. Aufl., Innsbr. 1882); Herbst,
Österreichisches Strafprozeßrecht (Wien 1872);
Kommentare zur österreichischen Strafprozeßordnung von
Mayer (das. 1876, 4 Bde.), Mitterbacher (das. 1882) u. a. Für
den französischen Prozeß: das klassische Werk von
Faustin Hélie, Traité de l'instruction criminelle (2.
Aufl., Par. 1866-67, 8 Bde.); Richard-Maisonneuve, Droit
pénal et d'instruction criminelle (4. Aufl., das. 1881).
Für England: H. Stephen, Criminal law (4. Aufl., Lond. 1887);
Glaser, Das englisch-schottische Strafverfahren (Erlang. 1851).
Strafrecht (Kriminalrecht, früher auch "peinliches
Recht" , lat. Jus poenale , franz. Droit criminel, engl. Criminal
Law, ital. Diritto criminale),
362
Strafrecht (Allgemeines).
im objektiven Sinn der Inbegriff der Rechtsnormen über
strafbare Verbrechen; im subjektiven Sinn die Befugnis, wegen
verübten Unrechts Strafe zu verhängen (Strafgewalt,
Strafzwang, Jus puniendi). Das S. im objektiven Sinn enthält
die Grundsätze, welche der Staat bei der Ausübung seines
Rechts, zu strafen (S. im subjektiven Sinn), zur Anwendung zu
bringen hat. Wie nun jeder Teil der Rechtswissenschaft sich
philosophisch, dogmatisch, historisch und rechtspolitisch behandeln
läßt, so wird auch bezüglich des Strafrechts
zunächst zwischen natürlichem (allgemeinem,
philosophischem) und positivem (dogmatischem) S. unterschieden.
Ersteres enthält die strafrechtlichen Grundsätze, welche
wir durch Denken als die der Idee der Gerechtigkeit und den
sozialen Verhältnissen entsprechenden erkennen, letzteres
dagegen ist das geltende S. eines bestimmten Staats. Die
historische Behandlung des Strafrechts beschäftigt sich mit
seiner geschichtlichen Entwickelung, während die
strafrechtspolitische Untersuchung (Kriminalpolitik, Strafpolitik)
sich mit der zweckmäßigen Weiterentwickelung der
einzelnen Strafrechtsinstitute befaßt. Was das positive S.
anbetrifft, so haben gegenwärtig fast alle zivilisierten
Staaten umfassende strafrechtliche Kodifikationen aus- und
durchgeführt, deren Ergebnis sich in einem einheitlichen
Strafgesetzbuch darstellt. Daneben enthalten aber Spezialgesetze
(Nebengesetze) noch besondere Strafvorschriften, und so entsteht
der Gegensatz zwischen allgemeinem und besonderm S. in diesem Sinn.
Das S. ist ein Teil des öffentlichen Rechts, und zwar
gehören, um die Strafgewalt des Staats wirksam werden zu
lassen, drei Materien des öffentlichen Rechts zusammen: das S.
enthält die Strafgebote und -Verbote der Staatsgewalt, die
Strafgerichtsverfassung schafft die staatlichen Organe für
ihre Anwendung (s. Gericht), und der Strafprozeß (s. d.)
regelt ihre Thätigkeit. Strafprozeß und
Strafgerichtsverfassung werden wohl auch unter der Bezeichnung
"formelles S." zufammengefaßt, indem man alsdann das
eigentliche S. als "materielles S." bezeichnet. Jede Verwirklichung
des staatlichen Strafrechts setzt ferner dreierlei voraus: 1) eine
durch die gesetzgebende Macht ergangene Strafdrohung; 2) ein in
Gemäßheit dieser Androhung vom Richter nach den Formen
des Strafprozesses ergangenes Strafurteil; 3) eine in
Gemäßheit des Strafurteils bewirkte Strafvollstreckung.
Jeder dieser Sätze enthält auch gleichzeitig eine
Negation. Keine Strafe kann nämlich auf Grund freiwilliger
Unterwerfung eines sich selbst Anklagenden oder bei Ergreifung auf
frischer That vollzogen werden, so daß eine sogen.
Lynchjustiz mit dem Bestand eines geordneten Staatswesens
unverträglich ist. Anderseits kann aber auch der Richter
niemals eine Strafe erkennen, die nicht auf gewisse Handlungen oder
Unterlassungen im voraus angedroht war (nulla poena sine lege
poenali); ein Grundsatz, der von so großer Wichtigkeit ist,
daß er vielfach in die Urkunden des neuern Verfassungsrechts
aufgenommen wurde. Im konstitutionellen Staat liegt dabei der
Nachdruck darauf, daß Strafdrohungen nur in der Form des
Gesetzes, nicht auch in Gestalt sogen. Verordnungen der Monarchen
oder der Verwaltungsbehörden ergehen dürfen, noch viel
weniger aber der Richter befugt ist, gemeinschädliche oder
unsittliche Handlungen auf Grund einer von ihm angenommenen
Strafwürdigkeit mit Strafe zu belegen. Wie aber der Richter an
die Schranken des Gesetzes überall gebunden ist, so bleibt
auch wiederum der Gesetzgeber an die Schranken der Rechtsidee
gebunden. Die wissenschaftliche Entwickelung der letztern und die
notwendige Begrenzung der Strafgesetzgebung ist eine der
wichtigsten Aufgaben der Rechtswissenschaft. Die wesentlichen
Schranken, welche der Betätigung der Strafgesetzgebung
gegenwärtig auf Grundlage allgemein wissenschaftlicher
Erkenntnis gezogen werden, sind aber folgende: 1) Zeitliche,
insofern das Gesetz niemals hinterher bezogen werden darf auf
früher straflos gewesene Handlungen. Mißbräuchlich
waren daher die in der englischen Rechtsgeschichte vorkommenden
Bills of attainder, wonach im Weg der Gesetzgebung gewisse
Handlungen nicht für die Zukunft für strafbar
erklärt, sondern hinterher bestraft wurden. In der Hauptsache
gilt also der Satz, daß Strafgesetze keine rückwirkende
Kraft haben in Beziehung auf die früher vor ihrer Geltung
begangenen, straflos oder minder strafbar gewesenen Handlungen. 2)
Örtliche Grenzen. Der Wille des Strafgesetzgebers ist nur
innerhalb des von ihm beherrschten Staatsgebiets verpflichtend;
niemand hat das Recht, Ausländern im Ausland bindende Befehle
zu erteilen: das Gesetz ist territorial. Von diesem Grundsatz gibt
es indessen Ausnahmen, welche sich einerseits aus dem praktischen
Bedürfnis eines wirksamen Rechtsschutzes, anderseits aus dem
mangelhaften Zustand des Völkerrechts ergeben. Jeder Staat
bestraft seine Unterthanen heutzutage wegen gewisser auch im
Ausland begangener Verbrechen, und meistenteils werden
ausnahmsweise auch Ausländer wegen einzelner im Ausland
begangener Missethaten schwersten Ranges (z. B. Hochverrat,
Münzverbrechen) einer Ahndung unterworfen. Die Begrenzung
dieser Strafgewalt gegenüber dem Ausland ist jedoch noch heute
eine der schwierigsten und streitigsten Angelegenheiten der
Wissenschaft. Während nämlich einige von einem sogen.
Territorialitätsprinzip ausgehen und danach die im Ausland
begangenen Missethaten grundsätzlich straflos lassen wollen,
huldigen andre (Mohl, Geyer, Carrara) einer Anschauung, die als
Weltrechtsprinzip (Weltordnungsprinzip) bezeichnet wird und den Ort
der That regelmäßig gar nicht beachtet, endlich wieder
andre dem sogen. Personalitätsprinzip, wonach wenigstens die
Unterthanen des Staats an die heimischen Strafgesetze auch im
Ausland überall gebunden bleiben sollen. 3)
Gegenständliche Schranken. Das einfach Unsittliche oder
Irreligiöse scheidet aus dem Gebiet der Strafgesetzgebung aus,
was um so wichtiger für das heutige S. ist, als in
frühern Zeiten die Strafgesetzgebung überall mit
religiösen und kirchlichen Elementen stark versetzt war,
vornehmlich im Mittelalter, wo der Einfluß des kanonischen
Rechts überwog. Der Strafzwang des Staats wird ferner nur da
angewendet, wo der Zivilzwang nicht ausreicht, d. h. der Zwang zur
Erfüllung, zur Erstattung, zum Ersatz und zur Herausgabe. In
letzterer Beziehung lehrt uns aber die Geschichte des Strafrechts,
daß die Ansichten über das Verbrecherische in einer
starken Umwandlung begriffen sind. Vom Standpunkt des
gegenwärtigen Wissens aus ist zu sagen, daß die Grenze
der kriminalistischen Handlungen gegenüber der
zivilrechtlichen Materie nach einer einfachen, allgemein
gültigen Formel nirgends gezogen werden kann. Der
Strafgesetzgeber hat vielmehr notwendig, wenn er die
verbrecherischen Handlungen richtig erkennen will, zwei
Gesichtspunkte zu vereinigen: den ethischen, wonach nur die
jeweilig unsittlichen Handlungen dem Volksbewußtsein auch als
verbrecherisch erscheinen können, und den kriminalpolitischen,
wonach eine empfindliche, dauernde Schädigung oder
Gefährdung
363
Strafrecht (Theorien).
der gesellschaftlichen Gesamtordnung von gewissen Handlungen zu
besorgen ist. Wie verschieden in diesem Stück die Denkweise
der Kulturvölker ist, zeigt sich am deutlichsten darin,
daß die Römer den Diebstahl nur als eine
Privateigentumsverletzung mit zivilen Folgen (von Ausnahmen
abgesehen) behandelten, während für uns der Diebstahl das
wichtigste aller Verbrechen geworden ist. Betrachtet man ferner die
Masse der regelmäßig als verbrecherisch erklärten
Handlungen, so wird man nicht umhin können, drei Gruppen von
Tatbeständen zu sondern: 1) solche Verbrechen, deren Inhalt
ein nach Ort und Zeit besonders wandelbarer ist und sich in hohem
Maß veränderlich zeigt. Es sind dies vorzugsweise die
sogen. politischen oder Staatsverbrechen, in denen sich das
nationale Element der einzelnen Gesetzgebungen kundgibt. Weil diese
Thatbestände als schlechthin unsittlich nicht gelten
können, begründen sie auch keine Ablieferungspflicht
unter zivilisierten Staaten; 2) solche Verbrechen, die
vergleichungsweise einen annähernd gleichen Inhalt zu allen
Zeiten gehabt haben und deswegen das kosmopolitische Element der
Rechtsordnung repräsentieren: Mord, Totschlag, Fälschung,
Betrug, Notzucht etc.; 3) solche, bei denen die rechtswidrige
Verletzung des Privatwillens die Schädigung der allgemeinen
Interessen überwiegt und deswegen die Bestrafung von dem
Antrag des Verletzten abhängig gemacht wird (sogen.
Antragsdelikte). In dieser letztern Gruppe liegen die
Berührungspunkte zwischen zivilem u. kriminellem Unrecht.
Mit dem eigentlichen Grund und Zweck der Strafe
beschäftigen sich die Strafrechtstheorien. Es besteht aber in
dieser Hinsicht durchaus keine wissenschaftliche
Übereinstimmung. Die bisherigen, äußerst
zahlreichen Straftheorien sind nach folgenden Gesichtspunkten
klassifiziert worden: I. Relative Theorien
(Nützlichkeitstheorien), welche die Strafe als ein Mittel
betrachten, durch welches der Staat berechtigt ist, die ihm
obliegenden Wohlfahrtszwecke zu fördern. II. Absolute
Theorien(Gerechtigkeits-, Vergeltungs-, auch
Vergütungstheorien, im Unterschied von
Verhütungstheorien), welche die Strafe, unabhängig von
gewissen Zweckbestimmungen, als schlechthin
pflichtmäßige Bethätigung der im Staat waltenden
sittlichen Idee auffassen. III. Gemischte Theorien (auch
Vereinigungstheorien), welche sowohl die absolute Notwendigkeit der
Strafe als auch ihre Zweckmäßigkeit hervorheben.
Die wichtigsten relativen Theorien waren: die
Abschreckungstheorie, wonach durch den Strafvollzug andre von dem
Begehen von Verbrechen abgehalten werden sollen; die
Androhungstheorie (Theorie des psychologischen Zwanges), namentlich
von Feuerbach vertreten, wonach die Menschen durch die
Strafandrohung von verbrecherischen Handlungen abgeschreckt werden
sollen, von Bauer Warnungstheorie genannt. Hierher gehören
ferner die sogen. Präventionstheorie, welche den einzelnen
Verbrecher durch die Strafe von der Begehung weiterer Verbrechen
abhalten will, also eine "Spezialprävention" im Gegensatz zu
der "Generalprävention" der Androhungstheorie beabsichtigt,
namentlich von Grolman aufgestellt; dann die Besserungstheorie
Röders, wonach die Sicherung der Gesellschaft durch Umstimmung
des verbrecherischen Willens vermöge der strafweisen
Nacherziehung erreicht werden soll; endlich die Theorie des durch
Strafe zu leistenden moralischen Schadenersatzes von Welcker und
die Theorie der in der Strafe bewirkten gesellschaftlichen Notwehr
gegen das Verbrechen, die schon von Beccaria und von Blackstone im
vorigen Jahrhundert aufgestellt und in Deutschland von Martin
verteidigt ward. - Zu den absoluten Theorien zählen
vorzugsweise: die Wiedervergeltungstheorie Kants, gestützt auf
den kategorischen Imperativ der Gleichheit zwischen Strafübel
und Verbrechensübel (nachmals weiter entwickelt von Henke,
Zachariä, Berner), und die Gerechtigkeitstheorie Hegels,
wonach das Verbrechen Negation des Rechts und die Strafe Negation
der Negation, also Affirmation des Rechts, sein soll. Auch die
Theorie der religiösen Sühnung der göttlichen
Weltordnung, wie solche von ultramontanen oder
lutherisch-orthodoxen Rechtslehrern verfochten wird, gehört
hierher. - Die Vereinigungstheorien (vertreten von Abegg, Berner,
Heinze, Merkel u. a.) beruhen auf einer doppelten
Entwickelungsreihe. Entweder wird die Nützlichkeitsrelation
als Grund der Strafe anerkannt und der Verfolgung der
Nützlichkeitszwecke eine Schranke an der Gerechtigkeitsidee
gegeben, oder die Gerechtigkeit soll das sittliche Fundament der
Strafe abgeben, wobei aber die Zweckwidrigkeit eine Grenze für
die Verwirklichung der Rechtsidee bezeichnet. Endlich hat man auch
(Abegg) den Identitätsbeweis von Nützlichkeit und
Gerechtigkeit auf dem Boden des Strafrechts zu führen
unternommen. Zum endgültigen Austrag ist der Streit um die
Strafrechtstheorie noch nicht gebracht worden.
Was Deutschland anbelangt, so beruhte der ältere
Strafrechtszustand vor dem 16. Jahrh. auf denselben formellen
Grundlagen wie das gesamte Recht überhaupt: auf ältern
germanischen Rechtsgewohnheiten, auf der spezifischen Wirkung
kirchlich-kanonischer Anschauungen, endlich auf der Rezeption des
römischen Rechts. Merkwürdig genug gelangte Deutschland
1532 unter Karl V. zu einem einheitlichen Straf- und
Strafprozeßgesetzbuch (Constitutio Criminalis Carolina = C.
C. C.), welches unter den Denkmälern der deutschen
Rechtsgesetzgebung früherer Jahrhunderte unzweifelhaft den
hervorragendsten Platz verdient. Diese notdürftig, mit
großen Schwierigkeiten erreichte, den Fortbestand alter
germanischer Gewohnheiten und des römischen Rechts aber
anerkennende Gesetzgebungseinheit zersetzte sich im 18. Jahrh.
vollständig, insofern der Gerichtsgebrauch die alten, mit der
fortschreitenden Humanität unvereinbaren Leibesstrafen
beseitigte. Friedrich d. Gr. erkannte zuerst die Notwendigkeit
einer umfassenden neuen Kodifikation. Das alte gemeine Recht wurde
mehr und mehr durch die Partikularstrafgesetzbücher aus den
einzelnen Ländern verdrängt, und so entstand der
Unterschied zwischen gemeinem und partikulärem deutschen S.
Dem vorigen Jahrhundert gehören das Josephinische Gesetzbuch
von 1787 und das Allgemeine preußische Landrecht von 1794 an.
Von weitreichendem Einfluß ward der französische Code
pénal von 1810,. welcher in Frankreich noch
gegenwärtig, wenn schon mannigfach modifiziert, in
Gültigkeit ist (auch in Holland und in revidierter Gestalt
selbst in Belgien). Verhältnismäßig minder
bemerkbar war dieser Einfluß in den vor 1848 entstandenen
deutschen Strafgesetzbüchern, unter denen das bayrische,
dessen Urheber Feuerbach war, hervorragt und das braunschweigische
von 1840 und badische von 1845 besonders erwähnenswert sind
(außerdem: Königreich Sachsen 1838, Hannover 1840 und
Hessen-Darmstadt 1841). Dagegen war nach 1848 der Einfluß des
französischen Rechts dadurch gesteigert, daß man in der
Eile sich zur Annahme des französischen
Strafprozeßmusters bestimmen ließ. Kein Gesetzbuch hat
sich jedoch dem
364
Strafrechtstheorien - Strafregister.
Code pénal in seiner Technik so eng angeschlossen wie das
preußische vom 14. April 1851, das nach 1866 und 1867 auch in
den neueinverleibten Landesteilen zur Geltung gelangte. Der Periode
von 1848 bis 1870 gehören außerdem folgende
Strafgesetzbücher an: Nassau 1849, Thüringen (nebst
Anhalt, aber ohne Altenburg) 1850, Oldenburg 1858, Bayern 1861,
Lübeck 1863, Hamburg 1869. In einigen wenigen Ländern
(Mecklenburg, Bremen, Schaumburg-Lippe, Kurhessen) hatte sich das
alte gemeine Recht im Gerichtsgebrauch erhalten. Schon 1848
erkannte man allgemein das Willkürliche der strafgesetzlichen
Zersplitterung in Deutschland; die Grundrechte verordneten ein
einheitliches deutsches Strafgesetzbuch, und auch der erste
deutsche Juristentag in Berlin erklärte auf v. Kräwels
Antrag die Strafrechtseinheit für notwendig. In die
norddeutsche Bundesverfassung ging dieser nationale Wunsch als
Verfassungsartikel über. Auf der äußerlichen
Grundlage des preußischen Strafgesetzbuchs von 1851 ruhend,
entstand alsdann das ehemalige norddeutsche Strafgesetzbuch vom 31.
Mai 1870, das demnächst nach Begründung des Kaisertums in
veränderter Redaktion als deutsches Reichsstrafgesetzbuch vom
15. Mai 1871 noch einmal publiziert ist, seit 1. Jan. 1872 in ganz
Deutschland gilt und auch im Reichsland eingeführt wurde.
Nicht alles S. ist für Deutschland einheitlich geordnet.
Neben dem Reichsstrafrecht besteht ein Landesstrafrecht innerhalb
derjenigen Materien, die von Reichs wegen nicht geordnet wurden
oder der Gesetzgebung der einzelnen Staaten ausdrücklich
überlassen blieben. Im großen und ganzen trägt das
Reichsstrafgesetzbuch den Grundzug der Milde, die
hauptsächlichsten Mängel des preußischen
Strafgesetzbuchs sind beseitigt. Solange jedoch das vom Reichstag
erforderlich erachtete Strafvollzugsgesetz fehlt, bleibt die
strafrechtliche Einheit unvollständig. Einzelnen
fühlbaren Mißgriffen des Strafgesetzbuchs hat die
Strafrechtsnovelle vom 26. Febr. 1876 abgeholfen. Ein
Militärstrafgesetzbuch ist 20. Juni 1872 für das Deutsche
Reich erlassen. Der Entwurf eines österreichischen
Strafgesetzbuchs und das ungarische von 1878 schließen sich
dem deutschen an. Gegenwärtig gilt in Österreich noch das
Strafgesetzbuch vom 27. Mai 1852. Neuere Strafgesetzbücher
sind die der schweizerischen Kantone Zürich (1871), Genf
(1874), Schwyz (1881) u. a., das Strafgesetzbuch der Niederlande
(1881), Belgien (1867), Dänemark (1866), Schweden (1864),
Island (1869), Ungarn (1878), Bosnien (1881), Rußland (1866),
Spanien (1870), Rumänien (1864) und Serbien (1860). In England
fehlt ein Strafgesetzbuch.
[Litteratur.] Unter den ältern Lehrbüchern des
deutschen Strafrechts sind die Werke von Feuerbach, Grolman,
Mittermaier, Wächter, Heffter und Abegg hervorzuheben. Neuere
Lehrbücher von Berner (15. Aufl., Leipz. 1888), Hugo Meyer (4.
Aufl., Erlang. 1886), Schütze (2. Aufl., Leipz. 1874), v. Bar
(Bd. 1, Berl. 1882), v. Lißt (2. Aufl., das. 1884) und v.
Wächter (Vorlesungen, Leipz. 1881). Vgl. auch v. Holtzendorff,
Handbuch des deutschen Strafrechts in Einzelbeiträgen
(verschiedene Verfasser, Berl. 1871^77). Kommentare des
Reichsstrafgesetzbuchs von Oppenhoff (11. Aufl., Berl. 1888),
Schwarze (5. Aufl., Leipz. 1884), Olshausen (2. Aufl., Berl. 1886,
2 Bde.), Rüdorff (13. Aufl., das. 1885) u. a. Grundrisse zu
Vorlesungen von Binding (3. Aufl., Leipz. 1884), Geyer (Münch.
1884 f.) u. a. Herbst, Handbuch des österreichischen
Strafrechts (7. Aufl., Wien 1883, 2 Bde.); Janka,
Österreichisches S. (Prag 1884); Nypels, Le droit pénal
francais progressif et comparé (Par. 1864). Zeitschriften:
"Der Gerichtssaal" (seit 1874 verschmolzen mit der von v.
Holtzendorff seit 1861 herausgegebenen "Allgemeinen deutschen
Strafrechtszeitung"); Goltdammers "Archiv für
preußisches (und seit 1871 auch für deutsches) S.";
"Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft" (seit
1881); "Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza"
(seit 1874). Die Entscheidungen des deutschen Reichsgerichts in
Strafsachen werden unter dem Titel: "Rechtsprechung des deutschen
Reichsgerichts in Strafsachen" von den Mitgliedern der
Reichsanwaltschaft herausgegeben.
Strafrechtstheorien, s. Strafrecht, S. 363.
Strafregister (Strafliste), das amtliche Verzeichnis der
in dem Bezirk der Registerbehörde ergehenden gerichtlichen
Verurteilungen. Wird dann aus diesem allgemeinen S. ein Auszug
angefertigt, enthaltend die Bestrafungen einer einzelnen bestimmten
Person, so erhält man die Strafliste (das Strafregister,
Strafverzeichnis) ebendieser Person. Ein solches S. ist für
die rechtliche Beurteilung einer Person vielfach von großer
Wichtigkeit. Für das Deutsche Reich ist jetzt durch Verordnung
des Bundesrats vom 16. Juni 1882 die Führung von
Strafregistern allgemein vorgeschrieben (vgl. "Zentralblatt
für das Deutsche Reich", S. 309). In diese S., welche nach
bestimmten Formularen zu führen sind, werden alle durch
richterliche Strafbefehle, polizeiliche Strafverfügungen,
Strafurteile der bürgerlichen Gerichte, einschließlich
der Konsulargerichte, sowie durch Strafurteile der
Militärgerichte ergehenden rechtskräftigen Verurteilungen
eingetragen und zwar wegen eigentlicher Verbrechen und Vergehen
sowie wegen folgender Übertretungen: Bruch der Polizeiaufsicht
oder der Ausweisung aus dem Reichsgebiet, Landstreicherei,
Bettelei, das strafbare Verhalten derjenigen Personen, welche sich
dem Spiel, dem Trunk oder dem Müßiggang dergestalt
hingeben, daß sie in einen Zustand geraten, in welchem zu
ihrem Unterhalt oder zum Unterhalt derjenigen, zu deren
Ernährung sie verpflichtet, durch Vermittelung der
Behörde fremde Hilfe in Anspruch genommen werden muß,
gewerbsmäßige Unzucht unter Verletzung polizeilicher
Vorschriften, Arbeitsscheu der aus öffentlichen Armenmitteln
Unterstützten und selbstverschuldete Obdachlosigkeit.
Ausgenommen sind die Verurteilungen in den auf Privatklage
verhandelten Sachen, in Forst- und Feldrügesachen, wegen
Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften über Erhebung
öffentlicher Abgaben und Gefälle und wegen gewisser
militärischer Verbrechen und Vergehen. In die S. sind ferner
die Beschlüsse der Landespolizeibehörden über die
Unterbringung verurteilter Personen in ein Arbeitshaus oder deren
Verwendung zu gemeinnützigen Arbeiten, desgleichen die aus dem
Ausland eingehenden Mitteilungen über dort erfolgte
Verurteilungen einzutragen. Bezüglich derjenigen Verurteilten,
deren Geburtsort nicht zu ermitteln oder außerhalb des
Reichsgebiets gelegen ist, wird das S. bei dem Reichsjustizamt in
Berlin geführt, während im übrigen die
Registerführung den zuständigen Behörden
bezüglich aller Personen obliegt, deren Geburtsort im Bezirk
derselben gelegen ist. Diese Behörden sind in Preußen
und in den meisten übrigen deutschen Staaten die Staatsanwalte
bei den Landgerichten, in Bayern und in Bremen die Amtsanwalte, in
Sachsen und Baden die Amtsgerichte, in Württemberg die
Ortsvorstände jeder Gemeinde und in Elsaß-Lothringen die
Gerichtsschreibereien der Landgerichte. Die Auf-
365
Strafsachen - Strafverfahren.
sicht und Leitung der Registerführung liegt unter allen
Umständen der Staatsanwaltschaft bei den Landgerichten ob. Die
nötigen Mitteilungen über die erfolgten Verurteilungen
sind von den betreffenden Behörden an die Registerbehörde
des Geburtsorts oder, sofern diese Behörde der mitteilenden
Behörde nicht bekannt ist, an die Staatsanwaltschaft
desjenigen Landgerichts, zu dessen Bezirk der Geburtsort
gehört, zu richten. Ist der Geburtsort nicht zu ermitteln oder
außerhalb Deutschlands gelegen, so ergeht die Mitteilung an
das Reichsjustizamt. Diese Strafnachricht erfolgt nach
vorschriftsmäßigem Formular. Gerichtlichen und andern
öffentlichen deutschen Behörden ist auf jedes eine
bestimmte Person betreffende Ersuchen über den Inhalt der S.
kostenfrei amtliche Auskunft zu erteilen. Ersuchen und Auskunft
erfolgen nach vorgeschriebenem Formular. Inwieweit auswärtigen
Behörden solche Auskunft zu erteilen, bestimmt die jeweilige
Landesregierung und in Ansehung des bei dem Reichsjustizamt
geführten Registers der Reichskanzler. Eine internationale
Regelung dieser Sache steht in Aussicht. Vgl. Hamm, Die
Einführung einheitlicher S. (Mannh. 1876).
Strafsachen, diejenigen Rechtsangelegenheiten, bei
welchen es sich um die Untersuchung und Bestrafung von Verbrechen
handelt. Ihre Behandlungsweise bestimmt sich nach den
Rechtsgrundsätzen über den Strafprozeß (s. d.).
Strafsenat, Abteilung des Reichsgerichts (s. d.) oder
eines Oberlandesgerichts (s. d.), welche mit der Bearbeitung von
Strafsachen betraut ist.
Strafurteil (Straferkenntnis), die in einer
strafrechtlichen Untersuchung erteilte richterliche Entscheidung,
teilt sich in Haupt- oder Endurteile (sententiae detinitivae) und
Zwischenurteile (s. interlocutoriae). Die erstern sind
Entscheidungen in der Hauptsache, durch die ein Strafprozeß
zu Ende gebracht wird; die andern werden gegeben, bevor die
Untersuchung das zur Fällung eines Endurteils nötige
Resultat geliefert hat, wie z. B. ein Beschluß über
Eröffnung des Hauptverfahrens, über Zulässigkeit der
Untersuchungshaft, Ablehnung eines Richters etc. Im engern Sinn
versteht man jedoch unter S. nur dasjenige gerichtliche Urteil,
welches das Hauptversohren abschließt (Endurteil), sei es
durch Verurteilung, sei es durch Freisprechung, sei es endlich
durch Einstellung des Verfahrens. Manche Kriminalisten bezeichnen
endlich als S. lediglich das verurteilende Endurteil (s.
Urteil).
Strafverfahren, sowohl Bezeichnung für eine einzelne
strafrechtliche Untersuchung als für das Verfahren
überhaupt, welches zum Zweck der Untersuchung und Bestrafung
von verbrecherischen Handlungen stattfindet. Die Einleitung eines
Strafverfahrens (einer strafrechtlichen Untersuchung, eines Straf-,
Kriminalprozesses) ist heutzutage der Regel nach Sache der
Staatsanwaltschaft. Nur ausnahmsweise ist es dem Verletzten
überlassen, sein durch strafbares Unrecht angeblich verletztes
Recht vor Gericht selbst zu verfolgen, so nach deutschem
Strafprozeßrecht bei einfachen Beleidigungen und bei leichten
Körperverletzungen im Weg der Privatklage (s. d.). Die
Staatsanwaltschaft, bei leichtern Vergehen und Übertretungen
die Amtsanwaltschaft, schreitet ein auf erstattete Anzeige, welche
jedoch nicht nur bei dem Staats- oder Amtsanwalt, sondern auch bei
den Behörden und Beamten des Polizei- und Sicherheitsdienstes
sowie bei den Amtsgerichten angebracht werden kann. Bei
Antragsverbrechen (s. d.), welche nur auf Antrag des Verletzten
strafrechtlich verfolgt werden, bedarf es eines förmlichen
Antrags. Das S. selbst zerfällt in ein Vorverfahren und ein
Hauptverfahren. Ersteres hat den Zweck, festzustellen, ob gegen
eine bestimmte Person wegen eines bestimmten Verbrechens das
Hauptversohren zu eröffnen sei. Zweck des Hauptverfahrens
dagegen ist es, festzustellen, ob der Angeklagte des ihm zur Last
gelegten Verbrechens schuldig sei. Bezüglich des Vorverfahrens
ist zwischen dem Vorbereitungsverfahren (Ermittelungs-,
Skrutinialverfahren) und der Voruntersuchung (s. d.) zu
unterscheiden. In dem erstern ist hauptsächlich die
Staatsanwaltschaft mit Unterstützung der Polizeibehörden
thätig. Sie kann aber auch den Einzelrichter in Anspruch
nehmen, welch letzterer bei Gefahr im Verzug schleunige
Untersuchungshandlungen auch von Amts wegen vorzunehmen hat. Das
Vorbereitungsverfahren richtet sich zunächst nicht notwendig
gegen eine bestimmte Person; es handelt sich vielmehr bei demselben
vor allen Dingen um die Frage, ob überhaupt ein Verbrechen
vorliegt, und im Bejahungsfall demnächst allerdings auch um
die Ermittelung des Thäters. Bei der Voruntersuchung dagegen
steht ein bestimmter Angeschuldigter und ein bestimmtes Verbrechen
in Frage. Die Voruntersuchung wird von dem Richter
(Untersuchungsrichter) geführt, und Zweck derselben ist es,
durch Klarstellung des Sachverhalts eine Entscheidung darüber
zu ermöglichen, ob das Hauptverfahren gegen den
Angeschuldigten zu eröffnen, oder ob derselbe außer
Verfolgung zu setzen sei. Die Eröffnung des Hauptverfahrens
(s. d.) setzt eine Anklageschrift der Staatsanwaltschaft voraus;
sei es, daß sie auf Grund des Vorbereitungsverfahrens, sei
es, daß sie auf Grund der Voruntersuchung eingereicht wird.
Das Vorbereitungsverfahren schließt entweder mit der
Einleitung der Voruntersuchung, oder mit der Eröffnung des
Hauptverfahrens, oder aber mit der Einstellung (s. d.) des
Strafverfahrens durch den Staatsanwalt ab. Ist dagegen eine
Voruntersuchung geführt, so beschließt das Gericht
darüber, ob das Hauptverfahren zu eröffnen, oder ob das
S. definitiv oder vorläufig einzustellen sei. Das
Hauptverfahren selbst findet vor dem erkennenden Gericht (s. d., S.
166) statt. Der Schwerpunkt des Hauptverfahrens, wie derjenige des
ganzen Strafverfahrens, liegt in der Hauptverhandlung (s. d.).
Diese schließt mit dem Urteil ab, welches entweder ein
freisprechendes oder ein verurteilendes und nur ausnahmsweise auf
Einstellung der Untersuchung gerichtet ist. Natürlich braucht
durchaus nicht jede Strafsache alle drei Stadien des
Strafverfahrens, Vorbereitungsverfahren, Voruntersuchung und
Hauptverhandlung, zu durchlaufen. Doch ist die Voruntersuchung bei
den vor das Reichsgericht oder vor das Schwurgericht gehörigen
Strafsachen notwendig, bei den Schöffengerichtssachen dagegen
unzulässig (deutsche Strafprozeßordnung, § 176). An
das S. in erster Instanz kann sich ein Verfahren in der Instanz der
Rechtsmittel (s. d.), möglicherweise auch einmal ein Verfahren
zum Zweck der Wiederaufnahme des Verfahrens anschließen. Dem
rechtskräftigen verurteilenden Straferkenntnis folgt die
Strafvollstreckung. Als besondere Arten des Strafverfahrens sind
nach der deutschen Strafprozeßordnung folgende zu nennen: 1)
das S. bei dem amtsgerichtlichen Strafbefehl (s. d.); 2) das S.
nach vorangegangener polizeilicher Strafverfügung (s. d.); 3)
das S. bei dem Strafbescheid (s. d.) der Verwaltungsbehörden
(administratives S.); 4) das Verfahren gegen Abwesende, welche sich
der Wehrpflicht entzogen haben; 5) das S. bei Einziehungen und
366
Strafverfügung - Strahlapparate.
Vermögensbeschlagnahmen (objektives S.). Bei dem letztern
besteht die Eigentümlichkeit, daß die Hauptverhandlung
auch dann stattfindet, wenn die Strafverfolgung oder Verurteilung
einer bestimmten Person nicht ausführbar ist. Im einzelnen
richtet sich das S. nach den Vorschriften des
Strafprozeßrechts (s. Strafprozeß).
Strafverfügung, s. Strafbefehl.
Strafversetzung, Disziplinarstrafe, welche in der
Versetzung eines Beamten in ein andres Amt von gleichem Rang
besteht; zumeist mit einer Schmälerung des Gehalts verbunden,
welche z. B. nach dem deutschen Reichsbeamtengesetz vom 31.
März 1873, § 75, nicht über ein Fünftel des
Diensteinkommens betragen soll. Statt der Verminderung des
Diensteinkommens kann auch eine Geldstrafe ausgesprochen werden,
welche ein Drittel des jährlichen Diensteinkommens nicht
übersteigt.
Strafverzeichnis, s. Strafregister.
Strafvollstreckung, s. Zwangsvollstreckung.
Strafzwang, s. Strafrecht, S. 362.
Stragelkaffee, s. Astragalus.
Strahl, Vogel, s. Star.
Strahlapparate, mechanische Vorrichtungen zum Heben oder
Fortschaffen von flüssigen, gasförmigen oder
körnigen und schlammigen Körpern mittels eines unter
Druck, also mit einer gewissen Geschwindigkeit, ausströmenden
Strahls einer Flüssigkeit oder Luftart. Die hierbei
erforderliche Bewegungsübertragung von der bewegenden auf die
Förderflüssigkeit findet nicht, wie etwa bei den
Kolbenpumpen, durch direkten Druck, sondern durch die bei der
Ausströmung angesammelte lebendige Kraft statt. An Fig. 1
läßt sich der Vorgang erklären. Der aus dem
kegelförmigen Mundstück (Düse) M des Rohrs A
austretende Strahl reißt die ihn umgebende Flüssigkeit,
welche durch das Rohr B in den Raum D gelangen kann, mit sich in
die Mündung (Fangdüse) des Rohrs C fort. Die beim
Eintritt in das Rohr C in der Mischflüssigkeit vorhandene
Geschwindigkeit wird durch allmähliche Erweiterung von C in
Druck umgewandelt, welcher die Überwindung einer gewissen
Steighöhe oder das Eindringen in einen unter Druck stehenden
Raum gestattet. Bei der Übertragung der Geschwindigkeit von
der bewegenden auf die bewegte Flüssigkeit finden bedeutende
Kraftverluste statt, welche den Nutzeffekt der S. um so
ungünstiger beeinflussen, je größer der Unterschied
zwischen dem spezifischen Gewicht der beiden zur Verwendung
kommenden Flüssigkeiten ist; mithin werden die S. die Kraft
des bewegenden Mediums am besten übertragen, wenn der bewegte
Körper denselben Aggregatzustand hat wie jenes (wenn also z.
B. Wasser durch einen Wasserstrahl, Luft durch einen Dampfstrahl
bewegt wird). Trotzdem werden vielfach S. mit Medien verschiedenen
Zustandes verwendet (der bei weitem verbreitetste Strahlapparat,
der Injektor, wirkt mit Dampf auf Wasser), einerseits, weil die S.
außerordentlich einfach und billig sind, keiner besondern
Kraftmaschine bedürfen, sehr geringe Dimensionen haben und
wegen Mangels aller beweglichen Teile weder Reparatur- noch
Schmierkosten verursachen, anderseits, weil die bei Verwendung von
Dampf auftretende Erwärmung der Förderflüssigkeit
oft erwünscht ist (z. B. in Badeanstalten, bei Dampfkesseln
etc.). Wegen der genannten Vorzüge haben die S. in den letzten
Jahrzehnten eine ausgedehnte Verwendung überall da gefunden,
wo eine gute Ausnutzung der vorhandenen Betriebskraft erst in
zweiter Linie berücksichtigt zu werden braucht. Um die
Verbreitung der S. und die Anpassung derselben an alle
möglichen speziellen Verhältnisse haben sich in
Deutschland besonders Gebr. Körting in Hannover verdient
gemacht.
Verwendungsarten der S. 1) Das bewegende Medium ist
tropfbarflüssig (Druckwasser mit natürlichem oder
künstlichem Gefälle). - Wasserstrahlpumpen (s. Pumpen)
eignen sich zum Entwässern von Kellern und Baugruben, zum
Entleeren von Jauchegruben, nach Körting als Hilfsapparate in
Bergwerken etc. Bei Körtings Schlammelevatoren (Fig. 2) zum
Reinigen der Brunnen von Triebsand, Fortschaffen von Baggerschlamm,
Heben von Kohlenschlamm etc. wird ein Teil des durch das Rohr b
zufließenden Betriebswassers bei a ausgespritzt, um den
Schlamm etc. aufzurühren, worauf derselbe mit viel Wasser
durch eine Wasserstrahlpumpe d gehoben wird und bei c
abfließt. Wasserstrahlluftpumpen finden in Apotheken und
Laboratorien Verwendung. Körtings Wasserstrahlkondensatoren,
s. Dampfmaschine, S. 462. Wassertrommelgebläse (s.
Gebläse, S. 977) sind die ältesten, schon seit
Jahrhunderten bekannten S., welche in verbesserter Form in
Laboratorien gebraucht werden. 2) Das bewegende Medium ist
luftförmig (fast ausschließlich Dampf).
Dampfstrahlgebläse (s. Gebläse, S. 978) finden entweder
zum Eindrücken von Luft Verwendung (Körtings
Unterwindgebläse bei Feuerungsanlagen, Rührgebläse,
welche durch Einblasen von Luft in die umzurührende
Flüssigkeit arbeiten, Luftdruckapparate zur Absorption von
Gasen durch Flüssigkeiten, Regeneriergebläse für
Gasreinigungsapparate, Kohlensäuregebläse für
Zuckerfabriken etc.), oder dienen zum Ansaugen von Luft oder andern
Gasen (Blasrohr an Lokomotiven, Körtings
Schornsteinventilatoren, Ventilatoren für Bergwerke,
Ventilatoren für Trockenapparate, Filtrierapparate,
Papiermaschinen, Dampfstrahlgasexhaustoren für
Teerschwelereien und Gasfabriken, Exhaustoren für
Eisenbahnbremsen etc.). Lnftstrahlgebläse werden in Bergwerken
mit komprimierter Luft betrieben und dienen zur Ventilation vor
Ort. Körtings Ventilator für Eisenbahnwagen benutzt den
durch die Bewegung des Wagens und den
367
Strahlbeinslahmheit - Strahlenbrechung.
Wind hervorgebrachten Luftstrom. Ein solcher Ventilator (Fig. 3)
wird oben auf die Wagendecke gesetzt und mit dem Innern des Wagens
durch eine Röhre C verbunden. Der Luftstrom tritt durch A in
den Raum B und wirkt hier saugend, so daß durch C Luft
emporsteigt und mit der Betriebsluft bei D ins Freie tritt. Ein
kleiner Schieber, welcher unterhalb des Saugrohrs C angebracht
wird, gestattet die Regulierung der Ventilation von seiten der
Passagiere. Der ganze obere Teil ist um den Zapfen E drehbar und
kann sich deshalb immer nach der Zug-, resp. Windrichtung
einstellen. Injektoren (s. d.) benutzen die Kondensierung des aus
dem zu speisenden Kessel entnommenen Betriebsdampfs durch das
Förderwasser dazu, dem letztern eine Geschwindigkeit zu
erteilen, welche höher ist als die dem Druck in dem Kessel
entsprechende Wassergeschwindigkeit. Es ist das dadurch
möglich, daß der Dampf, der bei seinerAusströmung
aus der Dampfdüse des Injektors unter der Einwirkung des
Kesseldrucks eine viel bedeutendere Geschwindigkeit annimmt als ein
unter gleichem Druck ausströmender Wasserstrahl, diese bei der
Kondensation mit dem Förderwasser austauscht.
Dampfstrahlpumpen oder Ejektoren, welche zum Fördern von
Wasser mittels eines Dampfstrahls dienen, wirken, was die
Kraftausnutzung betrifft, sehr ungünstig, können aber
doch da, wo es auf die Übertragung der Wärme ankommt,
recht vorteilhaft sein, so zur Wasserförderung in
Badeanstalten, zum Füllen der Tender aus Brunnen von der
Lokomotive aus, als Zirkulationsvorrichtungen für Bleich- und
Waschapparate etc. Zum Heben von Säuren, Laugen, sauren
Wassern etc. fertigt Körting Dampfstrahlpumpen von Porzellan.
Körtings Dampfstrahlfeuerspritzen sind als Hausspritzen,
Fabrikspritzen etc. da zweckmäßig, wo Dampfkessel
vorhanden sind; es bedarf dann nur der Öffnung eines
Dampfventils, um die Spritzen in Betrieb zu setzen.
Dampfstrahlschlammelevatoren sind in ähnlicher Weise wie die
Wasserstrahlschlammelevatoren konstruiert.
Dampfstrahlanwärmeapparate wirken in der Weise, daß ein
Dampfstrahl, welcher in das anzuwärmende Wasser
eingeführt wird, das umgebende Wasser ansaugt, seine
Wärme an dasselbe abgibt und es mit einer gewissen
Geschwindigkeit vor sich hertreibt, so daß immer neue
Wasserteile zum Apparat gelangen. Zerstäuber dienen zur
nebelartigen Verteilung von wohlriechenden Flüssigkeiten
mittels eines Luftstrahls (die sogen. Rafraichisseure oder
Refrigeratoren), von Petroleum in Feuerungsanlagen mittels eines
Dampfstrahls etc. Um feste Körper durch einen Dampfstrahl zu
heben, wird die Geschwindigkeit des Dampfes zunächst auf
atmosphärische Luft übertragen. Bei einem Kornelevator
(Fig. 4 u. 5) wird das Heben des Getreides dadurch bewirkt,
daß mittels des Dampfstrahlapparats r in dem
Sammelgefäß d eine Luftverdünnung hervorgebracht
wird, die sich in das Steigrohr e fortsetzt, die mit großer
Geschwindigkeit nachtretende Luft reißt das im
Fülltrichter a (Fig. 5) befindliche Korn empor bis in das
Sammelgefäß d (Fig. 4), wo infolge der plötzlichen
Geschwindigkeitsverringerung das Korn zu Boden fällt,
während staubförmige Verunreinigungen mit der Luft durch
r und f abgehen; g ist das Dampfzuführungsrohr.
Strahlbeinslahmheit, s. Hufgelenkslahmheit.
Strahlblüten, s. Kompositen.
Strahlegg, Gebirgssattel zwischen dem Finsteraarhorn und
Schreckhorn in den Berner Alpen, 3373 m hoch, schwierige, aber sehr
lohnende Gletscherpartie.
Strahlenblende, s. Zinkblende.
Strahlenbrechung, die Veränderung der Richtung,
welche die Lichtstrahlen bei ihrem Übergang aus einem Mittel
in ein andres erleiden. Tritt der Lichtstrahl aus einem
dünnern Medium in ein dichteres über, so wird er nach dem
Einfallslot zu gebrochen. Dies findet z.B. statt, wenn das Licht
der Gestirne in unsre Atmosphäre tritt, und wir sehen daher
die Gestirne nicht nach der Richtung hin, wo sie sich wirklich
befinden, und wo wir sie sehen würden, wenn die
Atmosphäre fehlte. Diese Veränderung des scheinbaren
Ortes der Gestirne nennt man die astronomische S. oder Refraktion.
Sie vermindert alle Zenitdistanzen, d. h. wir sehen alle Gestirne
in einer größern Höhe, als wir sie ohne Refraktion
sehen würden,
368
Strahlende Materie - Stralsund.
und zwar ist diese Vermehrung der Höhe um so bedeutender,
je näher dem Horizont ein Stern steht: während sie im
Zenith gleich Null ist, beträgt sie im Horizont 33-35
Bogenminuten. Daher ist die S. auch Ursache, daß die Gestirne
für jeden Ort früher auf- und später unterzugehen
scheinen, als sie in der That durch den Horizont dieses Ortes
gehen. Dies hat zunächst eine Verlängerung des Tags zur
Folge (bei uns um 4 Minuten), die in der Polarzone am
beträchtlichsten ist, da dort die Sonne mehrere Tage, ja
Wochen über dem Horizont gesehen wird, obschon sie unter ihm
steht. Die S. ist ferner der Grund, warum Sonne und Mond nahe am
Horizont stark abgeplattet erscheinen.
Strahlende Materie, s. Geißlersche Röhre, S.
30.
Strahlenkranz wird in der antiken Kunst allen Lichtgottheiten
gegeben, vorzugsweise dem Helios (Sol), der Selene, der Eos,
dem Phosphoros und Hesperos (vgl. Nimbus). - In der Anatomie
(Corona ciliaris) s. Auge, S. 74.
Strahlerz (Klinoklas, Abichit, Aphanesit, Siderochalcit),
Mineral aus der Ordnung der Phosphate, findet sich in
glasglänzenden, monoklinen Kristallen und in
radialstängeligen Aggregaten, ist spangrün bis
blaugrün, glasglänzend, kantendurchscheinend, Härte
2,5-3, spez. Gew. 4,2-4,5, besteht aus wasserhaltigem
Kupferarseniat Cu3As2O8 + 3H2CuO2, mit 50 Proz. Kupfer, findet sich
auf englischen Kupfererzgängen und bei Saida.
Strahlgebläse, s. Strahlapparate.
Strahlkies, s. Markasit.
Strahlpumpe, s. Strahlapparate.
Strahlstein, s. Hornblende.
Strahlsteinschiefer, Gestein, s. Hornblendefels.
Strahltiere, s. Radiaten.
Strahlungsmesser, s. Radiometer.
Strahlzeolith, s. Desmin.
Strähne, s. Strang und Garn, S. 911.
Strait (engl., spr. streht), Straße, Meerenge.
Straits Settlements (spr. strehts), engl. Provinz auf der
hinterindischen Halbinsel Malakka, 3742 qkm (68 QM.) groß mit
(1887) 536,000 Einw., besteht aus den unter sich durch
Vasallenstaaten getrennten Inseln und Landschaften: Singapur
(Insel), Wellesley mit Pinang (Insel) und Malakka. Sitz des
Gouverneurs ist Singapur. 1886 betrugen die Einfuhr 20,151,763, die
Ausfuhr 17,459,312 Pfd. Sterl., der Schiffsverkehr 7,491,099 Ton.,
die öffentlichen Einnahmen 671,427, die Ausgaben 626,302, die
Schuld 40,700 Pfd. Sterl. Es waren eine Eisenbahn von 45 km und
Telegraphenlinien von 611 km Länge im Betrieb. Bis 1867
unterstanden die S. der indischen Regierung, seither dem englischen
Kolonialamt.
Strakonitz, Stadt im südwestlichen Böhmen, an
der Wotawa und der Staatsbahnlinie Wien-Eger, Sitz einer
Bezirkshauptmannschaft und eines Bezirksgerichts, mit einem
Schloß des Johanniterordens aus dem 13. Jahrh., einer
Dechantei- und 3 andern Kirchen, bedeutender Fabrikation von
Wirkwaren und orientalischen Fes, Bierbrauerei, lebhaftem Handel
und (1880) 5835 Einw. S. ist Geburtsort des Dichters Celakovsky.
Dabei Neu-S. mit 2064 Einw.
Stralau (Stralow), Dorf im preuß. Regierungsbezirk
Potsdam, Kreis Niederbarnim, auf einer Halbinsel in der Spree und
an der Berliner Ringbahn, mit Berlin durch Dampfschiffahrt
verbunden, hat eine evang. Kirche, Jutespinnerei und -Weberei,
Teppich-, Anilin-, Margarin-, Palmkernöl-, Palmkernmehl-,
Maschinen- und Schwefelkohlenstofffabrikation, Gärtnerei,
Fischerei u. (1885) 737 Einw. S. ist ein uraltes Fischerdorf;
alljährlich findet hier 24. Aug. eins der bekanntesten
Berliner Volksfeste, der "Stralauer Fischzug", statt. Vgl.
Beringuier in "Der Bär" 1876.
Stralsund, Hauptstadt des gleichnamigen Regierungsbezirks
in der preuß. Provinz Pommern und Stadtkreis, bis 1873 auch
Festung, am Strelasund, der Rügen vom Festland scheidet,
Knotenpunkt der Linien Berlin-S., Angermünde-S., Rostock-S.
und S.-Bergen der Preußischen Staatsbahn, hat 3 Land- und 4
Wasserthore, 5 evangelische und eine kath. Kirche, eine Synagoge
und (1885) mit der Garnison (2 Bat. Infanterie Nr. 42) 28,984 Einw.
(darunter 998 Katholiken und 126 Juden), welche Spielkarten-, Lack-
und Firnis-, Zigarren-, Strohhülsen-, Leinenwaren-,
Glaceehandschuh-, Konserven-, Seifen-, Stärke-, Maschinen-,
Kumt-, Möbel- und Thonwarenfabrikation, Fischerei,
Ziegelbrennerei, Bierbrauerei etc. betreiben, auch hat S. eine
große Öl- und eine Dampfkunstmühle mit
Getreidebrennerei. Der Handel, unterstützt durch eine
Handelskammer und eine Reichsbanknebenstelle wie durch die lebhafte
Schifffahrt (dabei regelmäßiger Postdampferverkehr mit
Malmö in Schweden), befaßt sich vorzugsweise mit
Heringen, geräucherten Aalen, Steinkohlen, Getreide und
Hülsenfrüchten, Kolonialwaren, Wolle, Öl etc. Die
Reederei zählte 1887: 164 Schiffe zu 21,712 Registertonnen, in
den Hafen liefen ein 1886: 701 Schiffe zu 86,522 Registertonnen; es
liefen aus: 598 Schiffe zu 82,737 Registertonnen. S. hat ein
Gymnasium, ein Realgymnasium, eine Prüfungskommission für
Steuermänner und Schiffer, eine Navigationsschule, eine
Taubstummenanstalt, ein durch seine Fassade interessantes Rathaus
(1306) mit Rügenschen Altertümern, ein Theater, eine
Anstalt für Irre und Sieche, ein Fräuleinstift, eine
Lotsenstation, ein Seebad etc. Sonst ist S. Sitz einer
königlichen Regierung, eines Amtsgerichts, einer
Forstinspektion, eines Hauptzollamtes, von 9 Konsuln etc. Auf dem
Knieperkirchhof das Grab Ferdinand v. Schills. - S. wurde 1209 von
Jarimar I., Fürsten von Rügen, gegründet und bald
eins der bedeutendsten Mitglieder der Hansa. Obwohl den
Herzögen von Pommern unterthan, wußte sich die Stadt
auch später im Besitz einer fast reichsfreien Stellung zu
erhalten. 1429 belagerten die Dänen die Stadt, erlitten aber
auf der kleinen vor der Stadt gelegenen Insel Strela eine
Niederlage, woher jene Insel den Namen Dänholm erhalten hat.
1628 schloß S. ein Bündnis mit Gustav Adolf von Schweden
und wurde von Wallenstein belagert. Die Belagerung dauerte vom 23.
Mai bis 4. Aug., an welchem Tag Wallenstein mit einem Verlust von
12,000 Mann unverrichteter Sache abziehen mußte. Im
Westfälischen Frieden 1648 wurde S. an Schweden abgetreten. Am
15. Okt. 1678 mußte es sich nach einem heftigen Bombardement
dem Großen Kurfürsten ergeben, kam aber schon 1679 an
Schweden zurück. Im Nordischen Krieg wurde die Stadt 1715 von
den vereinigten Preußen, Sachsen und Dänen belagert und
23. Dez. von den Schweden durch Kapitulation geräumt, aber
ihnen schon 1720 zurückgegeben. Im Juli 1807 kamen die
Franzosen durch Kapitulation in den Besitz der Stadt und
ließen die Festungswerke schleifen. Am 31. Mai 1809 wurde die
von Schills Freischar besetzte Stadt von Dänen,
Holländern
369
Stralzio - Strandläufer.
und Oldenburgern erstürmt. Durch den Kieler Frieden vom 14.
Jan. 1814 kam S. nebst ganz Schwedisch-Pommern an Dänemark und
von diesem durch Vertrag vom 4. Juni 1815 an Preußen. Vgl.
Mohnike und Zober, Stralsundische Chroniken (Strals. 1833-34, 2
Bde.); Kruse, Geschichte der Stralsunder Stadtverfassung (das.
1848); Fock, Wallenstein und der Große Kurfürst vor S.
(Bd. 6 der "Rügensch-pommerschen Geschichten", Leipz.
1872).
Der Regierungsbezirk S. (s. Karte "Pommern") umfaßt 4010
qkm (72,83 QM.) mit (1885) 210,165 Einw. (darunter 207,004
Evangelische, 4268 Katholiken und 196 Juden), und fünf
Kreise:
Kreise QKilometer QMeilen Einwohner Einw. auf 1QKil.
Franzburg 1102 20,01 41985 38
Greifswald 962 17,47 58551 61
Grimmen 959 17,42 35606 37
Rügen 968 17,58 45039 47
Stralsund (Stadt) 9 0,34 28894 -
Stralzio (ital. stralcio, "gütlicher Vergleich"), in
Österreich s. v. w. Liquidation, Geschäftsauflösung;
stralzieren, s. v. w. liquidieren.
Stramberg, Stadt in der mähr. Bezirkshauptmannschaft
Neutitschein, an der Lokalbahn Stauding-S., mit altem Schloß,
Baumwollweberei, Samtbandfabrikation, Kalkbrennerei und (1880) 2282
Einw.
Stramin, s. Kanevas.
Strand, s. Küste.
Strand (spr. strännd), eine der Hauptverkehrsadern
Londons, verbindet Charing-Croß mit der City. Zahlreiche
Theater liegen dort oder in der Nähe.
Strandämter, s. Strandung.
Strandbatterien, s. Festung, S. 187.
Strandbehörden, s. Strandung.
Strandberg, Karl Wilhelm, schwed. Dichter und Publizist,
geb. 16. Jan. 1818 zu Stigtamta in Södermanland, studierte zu
Lund, ließ sich 1840 in Stockholm als Schriftsteller nieder
und übernahm in der Folge die Redaktion der "Post- och
Inrikes-Tidningar" ("Post- und Reichszeitung"), die er bis zu
seinem Tod führte. Er starb 5. Febr. 1877 als Mitglied der
schwedischen Akademie. Als Dichter erwarb er sich zuerst durch
seine unter dem Pseudonym Talis Qualis veröffentlichten,
politisch gefärbten "Sangar i pansar" ("Geharnischte Lieder",
1835), durch die ein Zug nordischer Kraft und Einfachheit geht,
einen gefeierten Namen. In spätern Jahren erschien ein zweiter
Band Gedichte, die einen weichern und innigern Ton anschlugen, aber
sich nicht minder als die ersten durch begeisterte Vaterlandsliebe,
Adel der Gesinnung u. Formvollendung auszeichneten. Umfangreicher
als seine Originalarbeiten sind seine vortrefflichen metrischen
Übersetzungen, unter denen wohl der genialen Übertragung
von Byrons "Don Juan" und poetischen Erzählungen der erste
Rang gebührt. Seine "Samlade vitterhetsarbeten" erschienen
Stockholm 1877-78 in 2 Bänden.
Strandelster, s. v. w. Austerndieb (s. d.).
Strandgut, die von einem gescheiterten, gestrandeten oder
sonst verunglückten Schiff geretteten Güter und
Schiffstrümmer. Dabei wird unterschieden zwischen S. im engern
Sinn, den bei einer Seenot geborgenen Gegenständen;
Seeauswurf, Gegenständen, welche außer dem Fall einer
Seenot von der See auf den Strand geworfen werden; Strandtrift
(strandtriftigem Gut), Gegenständen, die von der See gegen den
Strand getrieben und vom Strand aus geborgen wurden; Wrackgut,
versunkenen Schiffstrümmern oder sonstigen Gegenständen,
die vom Meeresgrund heraufgebracht sind, und Seetrift (seetriftigem
Gut), von welchem man dann spricht, wenn ein verlassenes Schiff
oder sonstige besitzlos gewordene Gegenstände, in offener See
treibend, von einem Fahrzeug geborgen werden. Alles S. ist an den
Empfangsberechtigten gegen Bezahlung der Bergungskosten
herauszugeben. Die Ermittelung des Empfangsberechtigten ist nach
der deutschen Strandungsordnung vom 17. Mai 1874 Sache der
Strandämter (s. Strandung). Ist der Empfangsberechtigte auch
durch das Aufgebotsverfahren nicht zu ermitteln, so werden
Gegenstände, welche in Seenot vom Strand aus geborgen sind,
desgleichen Seeauswurf und strandtriftiges Gut dem Landesfiskus,
versunkenes und seetriftiges Gut aber dem Berger überwiesen.
Die Höhe der Bergungskosten richtet sich nach den Bestimmungen
des deutschen Handelsgesetzbuchs (s. Bergen). Von
beschädigten, auf dem Weg des öffentlichen Ausgebots
verkauften Strandgütern ist auf Antrag nur ein Zoll von 10
Proz. zu entrichten. Inländische Strandgüter, welche nach
dem Auslaufen verunglücken, sind frei vom Eingangszoll.
Strandhafer, s. Elymus.
Strandhauptmann, s. Strandung.
Strandlachs, s. Forelle.
Strandläufer (Tringa L.), Gattung aus der Ordnung
der Watvögel (Grallae) und der Familie der Schnepfen
(Scolopacidae), Vögel mit geradem Schnabel, der länger
als der Lauf, aber kürzer als der nackte Teil des Fußes,
an der Spitze verdickt und verbreitert und nur an den Rändern
der Oberschnabelspitze hornig ist. In den mittellangen, spitzen
Flügeln ist die erste Schwinge am längsten, der Schwanz
ist kurz, abgerundet, die Füße sind kurz, dick, der Lauf
länger als die Mittelzehe, die Krallen sind kurz, stark
gekrümmt. Die S. leben in den nordischen Gegenden der Alten
und Neuen Welt an Gewässern, in deren Uferschlamm sie ihre
Nahrung suchen; im Winter wandern sie, meist den Küsten
entlang, in Scharen südwärts, im Frühling wieder
nordwärts, nur selten geraten sie ins Binnenland. Alle haben
im Sommer ein anders gefärbtes Gefieder als im Winter. Die
etwa 25 Arten umfassende Gattung ist in mehrere Gattungen:
Actodromas Kaup., Calidris IU., Limicola Koch, Arquatella Baird und
Pelidna Cuv., geteilt worden. Roststrandläufer (Kanutsvogel,
T. canuta L.), 25 cm lang, im Sommer oberseits schwarz mit
rostroten Flecken, weißlichen Federspitzen und rostgelben
Federsäumen, unterseits dunkel braunrot, im Winter oberseits
aschblau, unterseits weiß, an der Unterkehle dunkel gefleckt
; der Schnabel schwarz, der Fuß grauschwarz. Er bewohnt den
Norden der Alten Welt und weilt in Deutschland von August bis Mai
an der Küste der Nord- und Ostsee, nistet aber nur im hohen
Norden. Er ist sehr beweglich, fliegt und schwimmt gut und besitzt
eine laute, pfeifende Stimme. Die Nahrung besteht in allerlei
Kleingetier. Der Zwergstrandläufer (Raßler, T.
[Actodromas] minuta Kaup), 14 cm lang, im Sommer oberseits schwarz
mit rostroten Federkanten, an der Oberbrust hell rostfarben, fein
braun gefleckt, unterseits weiß, im Winter oberseits dunkel
aschgrau, braunschwarz gestrichelt; das Auge ist braun, der
Schnabel schwarz, der Fuß grünlichschwarz. Er bewohnt
den hohen Norden, findet sich aber an fast allen Meeresküsten
Europas, Asiens, Afrikas und Australiens und weilt bei uns von
August bis April. Er nistet in den Tundren Europas und Asiens.
Seine Eier (s. Tafel "Eier II", Fig. 17) sind trüb
gelblichgrau bis ölgrün,
370
Strandlinien - Strangulieren.
aschgrau und dunkelbraun gefleckt. DerAlpenstrandläufer (T.
[Pelidua] alpina Cuv.), 15-18 cm lang, im Sommer oberseits
rotbraun, schwarz gefleckt, unterseits weiß mit schwarzen
Schaftstrichen, an Unterbrust und Vorderbauch schwarz, im Winter
oberseits aschgrau, unterseits weißlich; das Auge ist braun,
Fuß und Schnabel schwarz. Er bewohnt den hohen Norden,
brütet aber schon in Deutschland, wo er von August bis Mai
verweilt, durchstreift im Winter mit Ausnahme von Australien und
Polynesien die ganze Erde und erscheint auch oft in Scharen im
Binnenland und im Gebirge. Er nistet an sandigen oder feuchten
Stellen in der Regel nicht weit vom Meer auf dem Boden; die vier
schmutzig ölfarbenen, dunkel ölbraun gefleckten Eier (s.
Tafel "Eier II", Fig. 19) werden vom Weibchen allein
ausgebrütet. Das Fleisch des Alpenstrandläufers ist sehr
schmackhaft, und er wird daher in großer Zahl auf den
Schnepfenherden erlegt oder gefangen.
Strandlinien, die durch den Anprall der Meereswogen an
den die Küste bildenden Felsen und an Klippen hervorgebrachten
Linien, welche sich zusammen mit Anhäufungen von
Geröllen, Bruchstücken der Gehäuse von
Meeresbewohnern und Zusammenschwemmungen von Meerestangen
(Strandterrassen) sowie auch den Ansätzen (Balanen) oder den
Einbohrungen (Bohrmuscheln) von Seetieren als ein das Ufer
umziehender Saum oft meilenweit in ununterbrochenem Zusammenhang
verfolgen lassen. Steigt das Land, und verschiebt sich dadurch die
Grenzlinie zwischen Wasser und Land, so bleiben diese Signale als
Produkte eines frühern, jetzt nicht mehr vorhandenen Zustandes
zurück und bilden als alte S. für die Geologie wichtige
Anhaltspunkte zur Kontrolle der Hebungserscheinungen (vgl. Hebung).
Die Küsten Skandinaviens, Schottlands, Italiens etc. bieten
zahlreiche Beispiele solcher oft zu dritt und mehr
übereinander hinziehender alter S.
Strandpfeifer, s. Regenpfeifer.
Strandpflanzen, die den Seeküsten
eigentümlichen Gewächse, von denen manche auch im
Binnenland an Salinen als sogen. Salzpflanzen vorkommen; von
Kräutern zahlreiche Chenopodiaceen, unter denen besonders die
Gattungen Salsola und Salicornia zu nennen sind, ferner: Glaux
maritima, Plantago maritima, Triglochin maritimum, Aster Tripolium,
Artemisia maritima, Statice Limonium, Eryngium maritimum, Juncus
maritimus, Lepturus filiformis, Crambe maritima. Cochlearia
officinalis, Ammophila arenaria; von Holzpflanzen: Hippophae
rhamnoides, in Südeuropa Pinus maritima und Pinus Pinea.
Strandrecht, s. Grundruhrecht.
Strandtrift (strandtriftiges Gut), Gegenstände, die
infolge eines Seeunfalls von der See gegen den Strand getrieben und
von dem Strand aus geborgen werden. Vgl. Strandung.
Strandung, das Auflaufen und Festsitzen eines Schiffs auf
dem Strand, auf einer Klippe oder auf einer Sandbank. Wird die S.
absichtlich bewirkt, um das Scheitern des Schiffs zu vermeiden, so
gehört der dadurch verursachte Schade zur großen Havarie
(s. d.). Die in verbrecherischer Absicht mit Gefahr für das
Leben andrer herbeigeführte S. wird nach dem deutschen
Strafgesetzbuch (§ 323) mit Zuchthaus nicht unter fünf
Jahren und, wenn dadurch der Tod eines Menschen verursacht worden
ist, mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren oder mit
lebenslänglichem Zuchthaus bestraft. Wurde eine S.
fahrlässigerweise verursacht, so tritt (§ 326)
Gefängnisstrafe ein. Wer endlich ein Schiff, welches als
solches oder in seiner Ladung oder in seinem Frachtlohn versichert
ist, sinken oder stranden macht, wird mit Zuchthaus bis zu zehn
Jahren und zugleich mit Geldstrafe von 150-6000 Mk. bestraft
(§ 265). Für das Deutsche Reich ist das Strandungswesen
im übrigen durch die Strandungsordnung vom 17. Mai 1874
geregelt. Dieselbe handelt namentlich von den Strandbehörden,
welchen die Sorge für die Rettung und Bergung der in Seenot
befindlichen Personen und Güter anvertraut ist, ferner von dem
Verfahren der Bergung und Hilfsleistung in Seenot, von den
Bergungs- und Hilfskosten und von den
Privatrechtsverhältnissen in Ansehung des sogen. Strandguts
(s.d.). Als Strandbehörden fungieren Strandämter, welche
das Strandgut zu verwalten und den Empfangsberechtigten,
nötigen Falls nach einem Aufgebotsverfahren, zu
übermitteln haben. Den Strandämtern sind Strandvögte
untergeordnet, welchen das eigentliche Hilfs- und Rettungswerk
obliegt. Ihrer Aufforderung zur Hilfsleistung müssen alle
anwesenden Personen nachkommen, sofern sie dazu ohne erhebliche
eigne Gefahr im stande sind. Sie sind ferner befugt, zur Rettung
von Menschenleben die erforderlichen Fahrzeuge und
Gerätschaften in Anspruch zu nehmen und jeden Zugang zum
Strand zu benutzen. Der Vorsteher eines Strandamtes
(Strandhauptmann) kann zugleich zum Strandvogt bestellt werden.
Diese Strandbeamten sind Beamte der betreffenden Landesregierungen.
Vgl. die Instruktion zur Strandungsordnung vom 24. Nov. 1875
("Zentralblatt für das Deutsche Reich" 1875, S. 750).
Strandvogt, s. Strandung.
Strandwolf, s. Hyäne.
Strang (Strähne), ein Garnmaß, 1) für
Leinengarn: = 10 Gebinde à 120 Fäden = 1200 Fäden
= 2743,15 m; 2) für Baumwollgarn: a) englisch: = 560
Fäden à 1 1/2 Yards = 840 Yards = 768,08 m, b)
französisch: = 10 Gebinde à 70 Fäden = 700
Fäden = 1000 m; 3) für Wollgarn: A. Kammgarn: a) deutsche
Weife: 1 S. = 7 Gebinde à 80 Fäden = 560 Fäden
(à 1 1/2 Yards) = 768,08 m, b) englische Weife: 1 S. = 7
Gebinde à 80 Fäden à 1 Yard = 512,05 m; B.
Streichgarn: a) preußische Weife: 1 S. = 20 Gebinde à
44 Fäden = 880 Fäden à 2 1/2 preußische
Ellen = 1467,265 m, b) sächsische Weife (für
Vicunnagarn): 1 S. = 5 Gebinde à 80 Fäden = 400
Fäden à 2 alte Leipziger Ellen = 452 m, c)
böhmische Weife: 1 S. = 20 Gebinde à 44 Fäden =
880 Fäden à 2 Wiener Ellen = 1371,28 m; 4) für
Seide: 1 S. = 4 Gebinde à 3000 Fäden à 1 m =
12,000 m.
Strange (spr. strehndsch), Robert, Kupferstecher, geb.
26. Juli 1721 auf der orkadischen Insel Pomona, ging nach Edinburg
und schloß sich dort an den Prätendenten an, nach dessen
Sturz er nach Paris flüchtete und unter Le Bas studierte. 1751
kam er nach London, reiste 1759 nach Italien, lebte dann mehrere
Jahre in Paris und zuletzt in London, wo er 5. Juli 1792 starb. Er
stach Blätter nach italienischen Meistern, besonders nach
Tizian, auch nach van Dyck, die von schöner Wirkung sind. Zur
Zeit der dominierenden Schwarzkunst kultivierte S. den edlern
Linienstich. Vgl. Dennistoun, Memoirs of Sir R. S. (Lond. 1855, 2
Bde.).
Stranggewebe, in der Pflanzenanatomie das gesamte Gewebe
der Gefäßbündel im Gegensatz zu dem Grundgewebe und
Hautgewebe (s. d.).
Strangulieren (lat.), jemand erwürgen, indem man ihm
einen Strang um den Hals legt und damit
371
Strangurie - Straßburg.
die Luftröhre zuzieht, jedoch ohne den Hinzurichtenden
dabei in die Höhe zu ziehen (s. Erdrosselung). Das S. war
früher bei den Türken die gewöhnliche Todesstrafe
und geschah bei den Vornehmen meist mittels einer ihnen
überschickten seidenen Schnur.
Strangurie (griech.), s. Harnzwang.
Stranitzky, Joseph Anton, Schauspieler und
Theaterprinzipal, geb. 10. Sept. 1676 zu Schweidnitz i. Schl.,
studierte zu Breslau und Leipzig, begleitete daraus einen
schlesischen Grafen auf einer Reise nach Italien und ging nach
seiner Rückkehr zur Bühne über. Im J. 1706 tauchte
er in Wien auf, pachtete 1712 das Stadttheater am Kärntnerthor
und wirkte hier bis zu seinem Tode, der am 19. Mai 1727 erfolgte.
S. war der berühmteste Hanswurst seiner Zeit, ein Meister im
Extemporieren und bei aller Derbheit reich an echter Komik. Er
hatte aus Italien eine Menge von Szenen und Entwürfen
mitgebracht, aus denen er Stücke zusammensetzte, die zum Teil
auch gedruckt wurden, und veröffentlichte unter dem Titel:
"Ollapatrida des durchgetriebenen Fuchsmundi" (1722) eine Sammlung
dramatischer Skizzen (d. h. Gespräche Hanswursts mit allerlei
Leuten über allerlei Gegenstände in Versen und Prosa).
Auch gab er eine "Lustige Reyßbeschreibung, aus Salzburg in
verschiedene Länder" (o. J.) und "Hannswurstsche Träume"
(o. J.) heraus. Vgl. Schlager, Wiener Skizzen (neue Folge, Wien
1839); "Der Wiener Hanswurst", ausgewählte Schriften von S. u.
a. (das. 1885 ff.).
Stranniki, Sekte, s. Raskolniken.
Stranraer (spr. -rähr), Hafenstadt in Wigtownshire
(Schottland), im Hintergrund von Loch Ryan, mit Austern- und
Heringsfischerei und (1881) 6342 Einw. Eine Dampferlinie verbindet
S. mit Belfast. Zum Hafen gehören (1887) 169 Fischerboote.
Strapaze (ital.), ermüdende Anstrengung;
strapazieren, anstrengen, ermüden; strapaziös,
ermüdend, beschwerlich.
Strasburg, 1) (Brodnica) Kreisstadt im preuß.
Regierungsbezirk Marienwerder, an der Drewenz und der Linie
Jablonowo-Lautenburg der Preußischen Staatsbahn, 75 m ü.
M., hat eine evangelische und eine kath. Kirche, ein Gymnasium, ein
Amtsgericht, ein Hauptzollamt, Ziegelbrennerei und (1885) mit der
Garnison (ein Infanteriebataillon Nr. 14) 5462 meist kath.
Einwohner. S. wurde 1285 neben der schon 1268 vorhanden gewesenen
Burg angelegt. -
2) (S. in der Ukermark) Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Potsdam, Kreis Prenzlau, an der Linie Stettin-Mecklenburgische
Grenze der Preußischen Staatsbahn, hat 2 evang. Kirchen, ein
Amtsgericht, ein Kriegerdenkmal, eine Zuckerfabrik, ansehnliche
Schuhmacherei, Töpferei und Ofenfabrikation, eine
Eisengießerei und Maschinenfabrik, Lederfabriken, Molkerei
und (1885) 5894 meist evang. Einwohner.
Strasburger, Eduard, Botaniker, geb. 1. Febr. 1844 zu
Warschau, studierte seit 1864 in Bonn und Jena Naturwissenschaft,
besonders Botanik, und habilitierte sich, nachdem er 1867
promoviert hatte, 1868 in Warschau als Privatdozent an der
Hochschule, folgte aber schon 1869 einem Ruf als
außerordentlicher Professor und Direktor des botanischen
Gartens nach Jena und wurde 1871 zum ordentlichen Prosessor
ernannt. Er bereiste wiederholt Italien und 1873 mit Häckel
den Orient, besonders Ägypten und das Rote Meer. 1881 folgte
er einem Ruf an die Universität Bonn. S. arbeitet vorzugsweise
auf histologisch-entwickelungsgeschichtlichem Feld und speziell
über die pflanzlichen Befruchtungsvorgänge und die
Entwickelung der Befruchtungsorgane. Von seinen ältern
Arbeiten sind hier zu nennen: "Die Befruchtung bei den Koniferen"
(Jena 1869); "Die Bestäubung der Gymnospermen" (das. 1872) und
"Die Koniferen und die Gnetaceen" (das. 1872). Durch seine
Untersuchungen über die Pflanzenzelle, besonders in den
Schriften: "Über Zellbildung und Zellteilung" (Jena 1875; 3.
Aufl., das. 1880) und "Studien über Protoplasma" (das. 1876)
u. a., wirkte S. wesentlich umgestaltend auf die Fortentwickelung
der modernen Botanik ein. Von seinen fernern Arbeiten sind noch
hervorzuheben: "Über Befruchtung und Zellteilung" (Jena 1878);
"Die Angiospermen und die Gymnospermen" (das. 1879); "Die Wirkung
des Lichts und der Wärme auf die Bewegung der
Schwärmsporen" (das. 1878); "Über den Bau und das
Wachstum der Zellhäute" (das. 1882); "Das botanische
Praktikum" (2. Aufl., das. 1887); "Das kleine botanische
Praktikum"(das. 1884); "Histologische Beiträge" (das. 1888
ff.).
Straschiripka, Johann von, Maler, s. Canon
Straschniks, die russischen Grenzwächter.
Straß, s. Edelsteine, S. 315, und Glas, S. 388.
Straßburg, ehemals reichsunmittelbares Bistum im
oberrheinischen Kreise, schon in der Merowingerzeit entstanden,
umfaßte anfangs Ober- und Unterelsaß nebst der Ortenau
und einem Teil des Breisgaues; später wurden Teile des
Elsaß zu gunsten der Bischöfe von Speier und Basel davon
abgetrennt. Das bischöfliche Territorium enthielt im
Niederelsaß sieben Ämter: Zabern, Kochersberg,
Dachstein, Schirmeck, Benfeld, Markolsheim und Wengenau; im
Oberelsaß: das Amt Rufach, die Vogtei Obersultz und die Lehen
Freundstein, Herlisheim u. a. sowie diesseit des Rheins: das Amt
Ettenheim und Herrschaften in derOppenau, wie Oberkirch und eine
Zeitlang Ulmburg; zusammen 1322 qkm (24 QM.) mit 30,000 Einw. und
350,000 Gulden Einkünften. Der Bischof stand unter dem
Erzstift Mainz, war deutscher Reichsfürst und blieb es auch,
als er für das linksrheinische Land 1648 die Lehnshoheit
Frankreichs anerkennen mußte, für seine diesseit des
Rheins liegenden Besitzungen. Die französischen Besitzungen
des Hochstifts wurden gleich zu Anfang der Revolution eingezogen;
der in Schwaben gelegene Teil derselben (165 qkm mit 35,000 Guld.
Einkünften) aber ward 1803 als Fürstentum Ettenheim dem
Kurfürsten von Baden überlassen. 1802 wurde das ganze
Elsaß dem Straßburger Sprengel überwiesen und das
Bistum dem Erzbischof von Besancon untergeordnet; es steht jedoch
seit 1871 unmittelbar unter dem Papst. Unter den Bischöfen von
S. sind am bekanntesten: Leopold II. Wilhelm, Erzherzog von
Österreich (1614-62, s. Leopold 20), Franz Egon und Wilhelm
Egon von Fürstenberg (s. Fürstenberg 2 u. 3) und der
Kardinal Louis René, Prinz von Rohan (s. d.). Vgl.
Grandidier, Histoire de l'église et des
évêques-princes de Strasbourg (Straßb. 1775-78,
2 Bde., bis zum 10. Jahrh. reichend); Fritz, Das Territorium des
Bistums S. (das. 1885).
Straßburg (hierzu der Stadtplan), Hauptstadt des
deutschen Reichslandes Elsaß-Lothringen, des Bezirks
Unterelsaß sowie des Land- und Stadtkreises S., Festung
ersten Ranges, liegt 5 km vom Rhein entfernt, an der schiffbaren
Ill, die hier die Breusch aufnimmt, am Rhein-Rhônekanal,
welcher hier mit der Ill sich vereinigt, sowie am Rhein-Marnekanal,
der nördlich der Stadt von der Ill ausgeht und als Illkanal
diese mit einem Rheinarm (Kleiner Rhein) verbindet, unter 48°
35' nördl. Br. und 7° 45' östl. L. v. Gr., 150 m
ü. M., u. zerfällt in ihrem Weichbild in acht Kantone.
Die eigentliche (innere) Stadt wird durch die zwei-
[Artikel Straßburg.]
Namen-Register zum ,Plan von Straßburg'.
Die Buchstaben und Zahlen zwischen den Linien (E 2) bezeichnen
die Felder der Karte.
Meyers Konv.-Lexikon, 4, Aufl.
Aar (Nebenarm der 111) E2
Akademie EF3
Akademie-Straße EF3
Allerheiligen-Gasse BC3
Alter Weinmarkt B4
Alt-St.-Peter-Kirche B4
Alt-St.-Peter-Platz B4
Am hohen Steg C3
Am Roseneck C2
Am Schießrain DE1
Anatomie D5,6
An d. Gewerbslauben C4
An der Esplanade FG3,4
Andlauer Straße B6
Apfjel-Straße D2
Arnold-Platz G2
Arsenal F3
Artillerie-Kaserne E4
Artillerie-Wallstraße DE5
Auf d. verbrannten Hof D3
Auf den Eisgruben BC5
Aurelien-Platz A5
Bahnhof, Zentral- A4
Bahnhof-Platz A4
Bahnhof-Ring A4
Bahnhof-Staden B3,4
Ballhaus-Gasse E4
Bank, Els.-Lothringer CD3
Bank, Reichs- C3
Barbara-Gasse, St. C4
Bauhof G4
Bei der Heuwage F4
Bergherrn-Gasse BC3
Bezirks-Gefängnis B5
Bezirks-Präsidium E2,3
Bibliothek D4
Bischöflicher Palast D3
Blauwolken-Gasse C3
Blessig-Straße F3
Botanischer Garten E3,F2
Brand-Gasse D3
Braut-Platz EF2
Broglie-Platz CD3
Brücke, Neue D4
Bruderhoffs-Gasse D3,4
Brumather Straße A3
Bucksweiler Straße AB2
Bürger-Hospital D5
Chirurgie C5
Citadelle H3,4
Citadellen-Allee G4
Clemens-Gasse B3
Clemens-Platz B3
Contades D1
Desaix-Staden B4
Deutsche Straße D1, 2
Dietrich-Staden E2,3
Dom-Platz D4
Düntzmühl-Kanal BC5
Ehnheimer Str., Ober- A6
Eiserne-Manns-Platz C4
Eisgruben, Auf den BC5
Elisabethen-Gasse, St. C5
Elsässer Straße F2
Elsaß-Lothring. Bank CD3
Elsbeth-Wallstraße C5,6
Esplanade G3
Esplanade, An der FG3,4
Esplanaden-Gasse F3
Esplanaden-Straße FG4
Feg-Gasse F3,4
Ferkel-Markt D4
Finkmatt C3
Finkmatt-Straße BC2
Finkweiler-Gasse BC5
Finkweiler-Staden C5
Fischart-Straße F2
Fischer-Gasse E3
Fischer-Staden E3
Fischerthor-Kaserne E3
Fisch-Markt D4
Fisch-Markt, Alter D4
Gasanstalt B3
Gaul-Staden EF4
Gedeckte Brücken B5
Gefängnis, Bezirks- B5
General-Kommando D3
Gerbergraben-Platz C4
Gerbergraben-Straße C4
Gestüt C5
Gewerbslauben, An d. C4
Goethe-Straße F2
Goldgießen D5
Grandidier-Straße E3
Groß-Metzig D4
Grünenbruch-Gasse B3
Gutenberg-Denkmal CD4
Gutenberg-Platz CD4
Gutleut-Gasse B2,3
Gymnasium C3
Hafen-Platz B5
Hafen-Staden B6
Hafen-Wallstraße B6
Hagenauer Platz B2
Handels-Gericht CD4
Haupt-Zollamt B3
Helenen-Gasse, St. C4
Helenen-Platz, E2
Hennen-Gasse E4
Hermann-Straße FG3
Heuwage, Bei der F4
Hospital, Bürger- D5
Hospital, Militär- F4
Johannes-Staden, St. B4
Juden-Brückchen D3
Juden-Gasse D3
Jung-St.-Peter-Kirche C3
Jung-St.-Peter-Platz C3
Junker-Straße E1
Justiz-Palast C3
Käfer-Gasse D4
Kagenecker Gasse B3,4
Kalbs-Gasse DE3,4
Kanal B4,CD2
Kasino, Deutsches Zivil- C3
Kasino, Offizier- CD3
Kasino, Zivil- C2
Katholisches Seminar D3,4
Kaufhaus-Gasse D4,5
Kellermann-Staden C3
Kinderspiel-Gasse B4
Kläber-Platz C4
Kleber-Staden BC3
Klöber-Denkmal C4
Klotz-Straße E2
Knoblochs-Gasse CD4,5
Koch-Staden E2,3
Kollegien-Haus EF2
Kommandantur C3
Königsbrücke E3
Königshofener Straße A5,6
Königs-Straße DE2,3
Krämer-Straße D4
Kreis-Direktion D3
Kriegs-Thor II A3
Kronenburger Ring AB3
Kronenburger Straße A3,B3,4
Kronenburger Thor A3
Kronenburger Wall-Straße A3
Krutenau-Straße E3 4
Kühnen-Gasse AB4
Langen-Straße BC4
Lazarett-Wallstraße EF4
Lehrer-Seminar C5
Lezai-Marnesia-Stad. D3
Lobstein-Straße F3
Lyceum D4
Magazin-Gasse A2,3
Magdal.-Gasse St. DE4
Manteuffel-Kaserne C1
Margareten-Gasse, St. AB5
Margareten-Kaserne AB5
Margareten-Wallstr AB5
Markt, Neuer C4
Martins-Brücke C5
Meisen-Gasse C3
Metzgergießen D4,5
Metzger-Platz E4,5
Metzger-Straße DE4,5
Metzger-Thor E5
Metzgerthor-Station E6
Militär-Baracken A6,G3
Militär-Hospital F4
Möller-Straße D2
Molsheimer Straße AB6
Moscherosch-Straße G2
Mühlen-Plan BC4,5
Müllenheim-Staden E1, 2
Münster D4
Münster-Gasse CD3
Münster-Platz D4
Murner-Straße F2
Musik-Kiosk D3
Musik-Konservator C3,4
Mutziger Straße A5
Neuer Markt C4
Neukirche C3,4
Neukirch-Platz C3,4
Niklaus-Brücke D5
Niklaus-Kaserne F3
Niklaus-Platz, St. F3
Niklaus-Staden, St. D4,5
Ober-Ehnheimer Str. A6
Odilien-Straße A6
Oktroi E5,H4
Palast-Straße D2
Pariser Brücke B3
Pariser -- Staden B3,4
Pflanzbad B4
Pionier-Kaserne DE3
Polizei-Direktion D3
Post D4
Präfektur D3
Protest. Predigerstift C5
Raben-Brücke D4
Raben-Platz D4
Rathaus D3
Reformierte Kirche C4
Reichsbank C3
Renn-Gasse, Große AB4,5
Renn-Gasse, Kleine A4
Ring, Bahnhof A4
Ring, Kanal Hl,2
Roseneck, Am C2
Rosheimer Straße A5
Rothauer Straße A6
Ruprechtsauer Allee Fl,2
Saarburger Straße A2,3
Schöpflin-Staden CD2,3
Schießrain, Am DE1
Schiffahrts-Kanal B4,5
Schiffleut-Gasse E4
Schiffleut-Staden DE4
Schimper-Straße F3
Schirmecker Ring AB6
Schirmecker Thor A6
Schlachthaus B5
Schlachthaus-Platz B5
Schlachthaus-Staden B4,5
Schleuse, Große B5
Schloß D4
Schlosser-Gasse C4
Schloß-Platz D4
Schwarzwald-Straße GH2
Schweighauser Straße F2
Seelos-Gasse A4
Seminar, Kathol. D3,4
Seminar, Kathol. Lehrer- C5
Spieß-Gasse D4
Spital-Platz D5
Spital-Thor D5
Spitzmühl-Kanal B5
St. Aurelien-Kirche A5
St.--Johannes-Kirche B4
St.-Ludwigs-Kirche C5
St.--Magdal.-Kirche E4
St.--Peterkirche, Alt- B4
St.--Peterkirche, Jung- C3
St.--Stephan-Kirche E3
St.-Thomas-Kirche C5
St.-Wilhelm-Kirche E3
Steg, Am hohen C3
Stein-Brücke C3
Stein-Platz B2
Stein-Ring C1,2
Stein-Straße BC2,3
Stein-Thor B2
Stephans-Brücke, St. E5
Stephans-Platz, St. D3
Stephans-Staden, St. E3
Sternwarte G2
Steuer-Direktion C5
Storch-Gasse B2,3
Sturmeck-Staden CD2
Synagoge C4
Tabaks-Magazin D4,5/C5
Tabaks-Manufaktur E3,4
Telegraphen-Amt B4
Theater D3
Theater-Brücke D2
Thomanns-Gasse C3
Thomas-Brücke, St. C5
Thomas-Platz, St. C4,5
Thomas-Staden, St. CD5
Tränk-Gasse F4
Türkheim-Staden B4,5
Umleitungs-Kanal FG5
Universität F2
Universität, (Alte, im Schloß) D4
Universitäts-Platz E2
Universitäts-Straße F2,3
Verbindungsbahn CD6
Verbrannten Hof, Auf dem D3
Vieh-Gasse EF3,4
Vogesen-Straße B-E2
Vorbrucker Straße A6
Waisen-Gasse E4
Waisenhaus E4
Waisen-Platz E4
Wärterhaus B6,D6
Waseneck, Am D2
Wasselnheimer Straße A5,6
Wasserturm F4
Wein-Markt, Alter B4
Weißenburger Straße B2
Weißenturm--Platz A5,6
Weißenturm-Ring A5
Weißenturm-Straße AB4,5
Weißenturm--Thor A5,6
Weißenturm-Wallstraße A4
Wilhelmer-Gasse E3
Wilhelms-Brücke E3
Wimpfeling-Straße F2
Zaberner Ring B2
Zaberner--Wall-Straße AB2
Zarrer Straße A6
Zentral-Bahnhof A4
Zeughaus F4
Zeughaus-Gasse F4
Zollamt, Haupt- B3
Zoll-Büreau A3
Zornmühl-Kanal BC5
Zürcher Straße E3,4
STRASSBURG Maßstab 1:19000.
372
Straßburg (Beschreibung der Stadt).
Wappen von Straßburg.
armige Ill in drei Teile geteilt, hat elf Thore u. durch die
engen, unregelmäßigen Straßen ein
altertümliches Aussehen. Ein neuer Stadtteil, im NO. liegend
und aus dem durch Hinausschieben der Festungswerke gewonnenen
Terrain errichtet, ist bereits stark bebaut. Von öffentlichen
Plätzen verdienen Erwähnung: der Kléberplatz mit
dem ehernen Standbild Klébers, der Gutenbergplatz mit der
Statue Gutenbergs (von David d'Angers), der Broglieplatz, der
Schloßplatz etc. Außer den genannten Denkmälern
sind noch zu nennen: das Denkmal des Generals Desaix hinter dem
Theater und das Denkmal des Präfekten Lezay-Marnesia auf einer
Rheininsel. Unter den zu gottesdienstlichen Zwecken bestimmten
Gebäuden (7 evangelische, eine reformierte und 6 kath. Kirchen
und eine Synagoge) ist das katholische Münster ein
Meisterstück altdeutscher Baukunst, 110 m lang, 41 m breit, im
Mittelschiff 30 m hoch. Den Grundstein zu dem gegenwärtigen
Bau legte 1015 Bischof Werner; 1277 begann unter Bischof Konrad von
Lichtenstein Erwin von Steinbach den Bau der Fassade und der
Türme, den nach seinem Tod (1318) sein Sohn Johannes (bis
1339) fortsetzte und Hans Hültz aus Köln 1439 zum
Abschluß brachte. Aber nur der nördliche Turm (142 m
hoch) erreichte seine Vollendung, der südliche wurde
bloß bis zur Plattform gebracht. Das Münster vereinigt
fast alle Baustile des Mittelalters: spätromanisch sind
Krypte, Chor u. Querschiff, selbst ein Teil des untern Schiffs;
weiterhin findet ein Übergang zum gotischen Spitzbogen statt,
der in der Fassade bis zur Vollendung gedieh. Von vorzüglicher
Schönheit ist das Hauptportal mit zahlreichen Statuen u. einer
großen Fensterrose (50 m im Umfang). Noch sind die herrlichen
Glasmalereien aus dem 14. und 15. Jahrh., die Kanzel, ein
Meisterwerk von Johann Hammerer (1486), die vortreffliche Orgel von
Silbermann und die berühmte astronomische Uhr von
Schwilgué (1839-42 neuhergestellt) hervorzuheben (vgl.
Strobel, Das Münster in S., 13. Aufl., Straßb. 1874;
Kraus, Straßburger Münsterbüchlein, das. 1877). Von
den evangelischen Kirchen verdienen die Neue Kirche (an Stelle der
alten, 1870 eingeäscherten neuerbaut) und die Thomaskirche
(13. u. 14. Jahrh.) mit dem Denkmal des Marschalls Moritz von
Sachsen (von Pigalle) Erwähnung. Hervorragende Gebäude
sind ferner: der neue Kaiserpalast, das Schloß (ehemals
bischöfliche Residenz, später Universität, jetzt
Universitäts- und Landesbibliothek), das Stadthaus und das
Theater am Broglieplatz (beide nach der Einäscherung von 1870
neuerbaut), der Statthalterpalast, das neue
Universitätsgebäude, das Bezirkspräsidium, das
Landgerichtsgebäude, das Offizierkasino, das
Aubettegebäude am Kléberplatz, das Gebäude der
Lebensversicherungsgesellschaft Germania, das Bürgerhospital,
die Manteuffelkaserne, der Zentralbahnhof, die Westmarkthalle etc.
Die Bevölkerung beläuft sich (1885) mit der 10,523 Mann
starken Garnison (Infanterieregimenter Nr. 105, 126, 132 und 138,
je 2 Infanteriebataillone Nr. 99 und 137, ein Ulanenregiment Nr.
15, ein Feldartillerieregiment Nr. 15, ein
Fußartillerieregiment Nr. 10 und ein Pionierbataillon Nr. 15)
auf 111,987 Seelen, darunter 52,306 Evangelische, 55,406
Katholiken, 363 andre Christen u. 3767 Juden.
DerStaatsangehörigkeit nach waren 68,993
Elsaß-Lothringer, 40,103 andre Reichsangehörige u. 2891
Ausländer. Die Industrie ist bedeutend und in fortdauernder
Steigerung begriffen. S. hat Fabriken für Maschinen,
Meterwaren, Tabak, musikalische Instrumente (Pianinos, Orgeln),
Wachstuch, Tapeten, Schokolade, Teigwaren, Senf, Öfen, Papier,
Leder, Möbel, Bürsten, Hüte, Chemikalien, Seife,
Wagen, künstliche Blumen und Federn, Strohhüte,
Handschuhe, Bijouteriewaren etc. Bekannt sind die
Gänseleberpasteten und die Bierbrauereien von S. Ferner gibt
es Wollspinnereien, Gerbereien, Färbereien, Buchdruckereien,
große Mühlwerke etc., auch hat S. eine große
Artilleriewerkstätte. Der lebhafte Handel, unterstützt
durch eine Handelskammer und eine Reichsbankhauptstelle wie durch
andre Geldinstitute, durch das verzweigte Eisenbahnnetz (S. ist
Knotenpunkt der Eisenbahnen S.-Weißenburg,
S.-Deutsch-Avricourt, S.-Kehl, S.-Schiltigheim,
S.-Königshofen, S.-Basel, S.-Rothau und S.-Lauterburg), durch
vortreffliche Landstraßen, durch die schiffbare Ill, den
Ill-, Rhein-Rhône- und Rhein-Marnekanal und durch eine
Pferdebahn, welche die innern Stadtteile mit den Vororten
verbindet, ist besonders bedeutend in Steinkohlen, Kolonial- und
Lederwaren, Papier, Tabak, Eisen, Getreide, Wein, Holz,
Gänseleberpasteten, Sauerkraut, Schinken, Hopfen,
Gartengewächsen der verschiedensten Art etc. An Bildungs- und
andern ähnlichen Anstalten hat S. die 1872 neugegründete
Kaiser Wilhelms-Universität (Sommersemester 1888: 828
Studierende), die neue Universitäts- und Landesbibliothek mit
ca. 600,000 Bänden (größtenteils durch freiwillige
Gaben entstanden und zum Ersatz für die in der Nacht vom 24.
zum 25. Aug. 1870 verbrannte Stadtbibliothek bestimmt), ferner ein
protestantisches Gymnasium (1538 gegründet), ein Lyceum
(katholisches Gymnasium, verbunden mit Realgymnasialabteilung), 2
Realschulen, eine höhere katholische Schule, ein
Priesterseminar, ein evangelisches Schullehrer- und ein
evangelisches Lehrerinnenseminar, 2 Taubstummenanstalten, ein
Konservatorium, ein Kunstmuseum, ein Kunstgewerbemuseum, ein
Naturalienkabinett, ein Stadttheater, eine Bezirksfindel- und
Waisenanstalt, zahlreiche Sammlungen etc. In S. erscheinen
fünf Zeitungen. Die städtischen Behörden zählen
36 Gemeinderatsmitglieder. Sonst ist S. Sitz des kaiserlichen
Statthalters, des Ministeriums und der höchsten
Landesbehörden für Elsaß-Lothringen, des
Bezirkspräsidenten für Unterelsaß, einer
Polizeidirektion für den Stadt- und einer Kreisdirektion
für den Landkreis S., eines katholischen Bischofs, des
Oberkonsistoriums für die Kirche Augsburgischer Konfession und
des jüdischen Konsistoriums, eines Land- und eines
Handelsgerichts, eines Bergreviers etc. An
Militärbehörden befinden sich dort: das Generalkommando
des 15. Armeekorps, die Kommandos der 31. und 33. Division, der 61.
und 66. Infanterie-, der 31. Kavallerie- und der 15.
Feldartilleriebrigade, die 3. Ingenieur-, eine Artilleriedepot- und
die 10. Festungsinspektion, ein Gouverneur, ein Stadtkommandant
etc. Die Festungswerke, deren Anlage 1682-84 von Vauban mit der auf
der Ostseite der Stadt liegenden fünfeckigen Citadelle
begonnen wurde, haben seit 1870 eine bedeutende Erweiterung und
Verstärkung erfahren. Ein Teil der Befestigung ist im NO.
hinausgerückt, und 13 Forts, 4-8 km vom Mittelpunkt der Stadt
entfernt, krönen die umliegenden Höhen, 3 davon auf der
badischen Seite des Rheins bei Kehl. Die Stärke der Werke wird
dadurch noch bedeutend erhöht, daß durch die Ill und den
Rhein-Rhônekanal ein großer Teil der Umgegend von S.
unter Wasser
373
Straßburg (Geschichte der Stadt).
gesetzt werden kann. Die Umgebung der Stadt (s. die Karte) ist
zwar flach, gleicht aber ihrer Fruchtbarkeit halber einem
großen Garten. Die außerhalb der Umwallung liegenden
Orte: Rupprechtsau, Neudorf, Neuhof, Königshofen und
Grünenberg sind der Stadt einverleibt. - Zum
Landgerichtsbezirk S. gehören die 14 Amtsgerichte zu Benfeld,
Bischweiler, Brumath, Hagenau, Hochfelden, Illkirch, Lauterburg,
Niederbronn, Schiltigheim, S., Sulz unterm Wald, Truchtersheim,
Weißenburg und Wörth.
[Geschichte.] Unter der Regierung des Kaisers Augustus entstand
auf der Stelle des heutigen S. eine städtische Ansiedelung,
Argentoratum, welche der achten Legion als Standquartier diente.
Durch den großen Sieg bei S. 357 über die Alemannen
rettete Kaiser Julian die Rheingrenze, doch schon um 406 fiel das
Elsaß jenem germanischen Volksstamm zu. Damals ging die Stadt
in Flammen auf, ward aber bald neu erbaut und in der Karolingerzeit
durch die Neustadt im W. vergrößert. Hier schwuren 14.
Febr. 842 Ludwig der Deutsche und Karl der Kahle den Eid
gegenseitiger Treue, der in altromanischer und altdeutscher Sprache
erhalten ist. Seit der Begründung des Bistums (s. unten) hob
sich die Bedeutung der Stadt; doch blieb sie noch lange Eigentum
des Bischofs, der den Schultheißen ernannte. Wie andre
bischöfliche Städte, wußte sich auch S.
allmählich größere Selbständigkeit zu
verschaffen: an die Stelle der bischöflichen Ministerialen
trat ein aus der Bürgerschaft hervorgehender Rat, und die
Richter der Stadt, die Consules, sprachen vom Bischof
unabhängig Recht. Aber die Reichsfreiheit hat erst Philipp von
Schwaben S. verliehen und Bischof Heinrich III. von Stahleck
(1245-60) anerkannt. Sein Nachfolger Walther von Geroldseck ward
1262, als er die Stadt wieder unterwerfen wollte, bei
Oberhausbergen geschlagen. Für die hohe Blüte
Straßburgs in dieser Zeit zeugen nicht nur Namen wie
Gottfried von S., Meister Eckard, Johannes Tauler, sondern vor
allem das Münster (über dessen Entstehung s. oben). Der
Familienhaß zweier Adelsgeschlechter führte 1332 zur
Aufnahme der Zünfte in den Rat, zu den bisherigen vier
Stadtmeistern trat zugleich als Vertreter der Handwerker ein auf
Lebenszeit gewählter Ammeister. Die Stadt schloß sich
1381 dem Städtebund zu Speier an und leistete ein Jahrhundert
später den Schweizern gegen Karl den Kühnen bei Granson
und Nancy erfolgreiche Unterstützung. In S. hat der Mainzer
Gutenberg die erste Druckerpresse aufgestellt, hier haben einige
Jahrzehnte später die Dichter Sebastian Brant und Thomas
Murner sowie der Humanist Wimpfeling gewirkt. Die Bedeutung der
Stadt war damals weit größer, als man nach ihrer
geringen Bevölkerung (um 1475 nur 20,700 Seelen) erwarten
sollte. Die Reformation fand früh Eingang, besonders infolge
des rastlosen Eifers Martin Butzers, der 1523 in S. eine Zuflucht
fand. Doch erst nach Abschaffung der Messe 1529 kann die Stadt als
protestantisch gelten. In der gefährlichen Zeit der
religiösen Streitigkeiten und Fehden hatte sie einen
vorzüglichen Führer in dem gelehrten und welterfahrenen
Jakob Sturm (s. d.), welcher ihr z. B. nach dem Schmalkaldischen
Krieg einen billigen Frieden vom Kaiser erwirkte. Durch ihn wurde
S. auch eine Stätte der Wissenschaft, besonders als der
Philolog Johannes Sturm sich hier niederließ. Ihm
gegenüber vertrat das deutsch-volkstümliche Element in
der Litteratur der Straßburger Johann Fischart. Für
ihren Rücktritt von der Union belohnte Kaiser Ferdinand II.
die Stadt 1621 mit der Errichtung der Universität.
Während des Dreißigjährigen Kriegs ersparte die auf
reichsstädtischer Tradition beruhende und durch innere
Parteiungen geförderte Neutralitätspolitik S. viel Elend.
Im Westfälischen Frieden blieb es dem Reich erhalten. Ludwig
XIV. ließ 1680 durch die Reunionskammer in Breisach den
Spruch fällen, daß S. für die der Krone Frankreich
gehörenden, aber noch in städtischem Besitz befindlichen
Vogteien von Wasselen, Barr und Illkirchen dem König den
Huldigungseid zu leisten habe. Die Stadt wagte keine ablehnende
Antwort zu erteilen, nur seitens des Reichs wurden Verhandlungen
eröffnet; aber Ludwig XIV. sandte 1681 mitten im Frieden
Louvois mit 30,000 Mann gegen das wehrlose S. Nicht der Verrat
einzelner Ratsmitglieder, wie das Volk meinte, nicht die Ränke
des bestochenen Bischofs Egon von Fürstenberg, sondern die
Erkenntnis der Aussichtslosigkeit jeglichen Widerstandes
führte 30. Sept. die Übergabe der Stadt herbei. Der
Friede von Ryswyk 1697 bestätigte diese Annexion, und auch der
von Utrecht änderte nichts daran, nachdem Deutschland einmal
versäumt hatte, die Zeit der Ohnmacht Frankreichs (1710) zur
Wiedererwerbung Straßburgs zu benutzen. Hier begünstigte
die neue Regierung mit Erfolg die Ausbreitung des katholischen
Bekenntnisses, vermochte aber nicht, der Stadt ihr deutsches Wesen
zu rauben. Für dessen Erhaltung sorgte besonders die
Universität, an welcher der Theolog Spener, die Sprachforscher
Scherz und Oberlin und der Historiker Schöpflin lehrten. Die
französische Revolution zertrümmerte die Vorrechte der
alten deutschen Reichsstadt; an die Spitze trat ein Maire, ihm
standen zur Seite 17 Munizipalräte und 36 Notabeln, welche
alle aus unmittelbaren Volkswahlen hervorgingen. Nach dem Fall des
Königtums blieb der Stadt die Schreckensherrschaft nicht
erspart; auch hier wurde 1793 ein Revolutionstribunal eingerichtet,
dem der deutsche Emigrant Eulogius Schneider vorstand. Erst unter
dem ersten Kaiserreich schwanden die partikularistischen Neigungen,
welche noch das 18. Jahrh. kennzeichnen. S., das Napoleon I. die
Wiederherstellung seiner in den Revolutionsstürmen verfallenen
Universität zu danken hatte, ward wirklich eine
französische Stadt. Der Versuch Ludwig Napoleons 30. Okt.
1836, sich hier von der Garnison zum Kaiser ausrufen zulassen,
mißlang. Am 13. Aug. 1870 begann die Einschließung der
Stadt durch General v. Werder, den Befehlshaber der badischen
Division. Die hartnäckige Verteidigung durch den Kommandanten,
General Uhrich, und die Beschießung des unbefestigten Kehl
veranlaßten v. Werder zu einem Bombardement (24.-27. Aug.),
welches die kostbare Bibliothek zerstörte und den Turm des
Münsters beschädigte. Doch da die Beschießung kein
Resultat hatte, schritt der deutsche Befehlshaber zur regelrechten
Belagerung. Am 12. Sept. war die dritte Parallele fertig; schon war
Bresche in den Hauptwall geschossen und alles zu einem Sturm
vorbereitet, als 27. Sept. die Festung kapitulierte. Die Besatzung
(noch 17,000 Mann) wurde kriegsgefangen, 1200 Kanonen und
zahlreiches Kriegsmaterial wurden eine Beute der Sieger (s. Plan
der Belagerung von S. bei Artikel "Festungskrieg"). Die
deutschfeindliche Haltung der Stadtbehörde in S.
veranlaßte die kaiserliche Regierung, 7. April 1873 den
Bürgermeister Lauth seines Amtes zu entsetzen und den
Gemeinderat, dessen überwiegende Mehrheit sich gegen diese
Maßregel aussprach, zunächst auf zwei Monate, dann auf
ein Jahr zu suspendieren. Mit der Wahrnehmung der Geschäfte
des Magistrats wurde der Polizeidirektor Back betraut, unter
welchem das Gemeindeschul-
374
Straßenbahnen - Straßenbau.
wesen ausgebildet, Straßenbahnen gebaut, eine
Wasserleitung hergestellt und die großartige Stadterweiterung
nach Ankauf der alten Festungswerke durchgeführt wurden. Erst
1886 wurde wieder die Wahl eines Gemeinderats gestattet, welche
deutschfreundlich ausfiel, und Back zum Bürgermeister ernannt.
Vgl. Silbermann, Lokalgeschichte der Stadt S. (Straßb. 1775);
Frese, Vaterländische Geschichte der Stadt S. (das. 1791-95, 4
Bde.); v. Apell, Argentoratum (Berl. 1884); Schmoller,
Straßburgs Blüte im 13. Jahrhundert (Straßb.
1875); "Straßburger Chroniken", herausgegeben von Hegel
(Leipz. 1870-71, 2 Bde.); Rathgeber, Reformationsgeschichte der
Stadt S. (Stuttg. 1871); Holländer, S. im französischen
Krieg 1552 (Straßb. 1888); Reißeissen,
Straßburger Chronik 1667-1710 (hrsg. von Reuß, das.
1877; Nachtrag 1879); Schricker, Zur Geschichte der
Universität S. (das. 1872); Wagner, Geschichte der Belagerung
von 1870 (Berl. 1874-77, 3 Bde.); "Urkunden und Akten der Stadt S."
(Straßb. 1880-86, Bd. 1-4); Kindler und Knobloch, Das goldene
Buch von S. (das. 1885 ff.); Ludwig, S. vor hundert Jahren (Stuttg.
1888); Krieger, Topographie der Stadt S. (Straßb. 1885).
Straßenbahnen, s. v. w.
Straßeneisenbahnen.
Straßenbau. Die Straßen zerfallen in Land- und
Stadtstraßen. Erstere verbinden zwei Ortschaften
miteinander, und wenn dies nicht durch eine gerade und ebene
Straße möglich ist, so haben die Vorarbeiten
demgemäß die beste Trace auszumitteln, was an Ort und
Stelle oder mit Hilfe von Karten geschehen kann, in welche
Höhenkurven (Schichtenlinien, Niveaukurven) eingetragen sind.
Man sucht dabei die notwendigen Unterbauarbeiten thunlichst zu
vermindern. Krümmungen sind bei Straßen, sofern sie die
Länge nicht unnötigerweise sehr vergrößern,
ohne Nachteil; von wesentlicher Bedeutung sind aber stärkere
Steigungen. Eine allgemeine Regel für die größte
gestattete Steigung läßt sich nicht geben: sie muß
der ortsüblichen Wagenladung entsprechen. Man darf sie heute
steiler wählen als früher, da der schwere Frachtverkehr
größtenteils durch die Bahnen besorgt wird; Laissle
empfiehlt 3 Proz. für Hauptstraßen zu der Ebene, 5-6
Proz. im Hügelland, 7 Proz. im Gebirge. Die Breiten der
Fahrbahnen und Bankette wechseln mit der Frequenz der Straße
und betragen für zwei sich ausweichende Wagen und
Fußgänger bez. 4,5-5,5 und 1-1,25 m. Ein Sommerweg, d.
h. ein nicht befestigter Streifen für leichte Wagen, Vieh
etc., dessen Anlage sich dort empfiehlt, wo der Unterbau billig,
die Befestigung der Fahrbahn teuer ist, erfordert eine Breite von
2,5-3m, ein Weg für zwei sich ausweichende Reiter 1,5-2 und
ein Materialstreifen 1-1,25m Breite. Statt der letztern werden auch
in Entfernungen von 100-200m besondere Lagerplätze für
das Unterhaltungsmaterial angelegt; dagegen erscheint es
fehlerhaft, einen Teil der Fußwege zum Lagerplatz für
Straßenmaterial zu verwenden. Die Straßengräben
erhalten, je nach der zu gewärtigenden Wassermenge, eine
Sohlenbreite von 0,25-0,5 bei einer Tiefe von 0,5-1m und nach der
größern oder geringern Kohäsion des Erdreichs 1-1
1/3füßige Böschungen. Die gewöhnliche
Befestigung der Landstraßen bildet die Versteinung oder
haussierung. Die Dicke der Versteinung soll in der Mitte mindestens
25-30, an den Rändern 20-25cm und die zur Beförderung des
Wasserabflusses dienende Wölbung ihrer Oberfläche (Pfeil)
etwa 1/38 bis 1/32 ihrer Breite betragen. Nach Umpfenbach
genügt eine Abdachung (zwei geneigte Ebenen) von 1/40-1/30
oder eine Wölbung (Kreisbogen), welche 1/30-1/30 der
Straßenbreite zur Pfeilhöhe hat. Die Steinbahn kann mit
einer Packlage hergestellt werden, d. h. mit einem 13-15cm hohen
Unterbau aus Steinen, die man auf die breite Seite (Kopf) stellt,
deren Zwischenräume man oben auskeilt, und die man mit einer
in der Straßenmitte 12-17cm hohen Schicht zerschlagener
walnußgroßer Steine (Decklage) bedeckt. Manchmal
faßt man die Packlage mit größern Randsteinen
(Bordsteinen) ein, und um die Zwischenräume der Decksteine
auszufüllen und hierdurch das Einfahren der Straße zu
erleichtern, wird zuweilen eine bis zu 5cm starke Schicht Kies in
einer oder mehreren Lagen auf derselben ausgebreitet.
Schließlich ist die Straße stets mit einer schweren
Straßenwalze mehrmals zu überfahren. Viele
Straßenbanmeister ziehen die makadamisierte Straße
(nach ihrem Erfinder Mac Adam) vor, bei welcher
gleichmäßig kinderfaustgroße Steinstücke auf
dem trocknen Untergrund in dünnen Lagen aufgetragen werden,
bis sie eine 25-30cm hohe Lage bilden, die man zum Schluß bei
feuchter Witterung tüchtig überwalzt. Wo Steine mangeln,
legt man Kiesstraßen an, verwendet das gröbere Material
zu unterst, das feinere in den darüberliegenden Schichten und
mengt der obersten, damit sie besser binde, etwas Lehm bei.
Zur Befestigung der Fahrbahn (des Fahrdammes) städtischer
Straßen ist Chaussierung trotz der billigen Anlage wenig
geeignet: sie nutzt sich rasch ab, erfordert daher öftere
Erneuerung und ist teuer in der Unterhaltung, gibt
außerordentlich viel Staub und Schmutz, ist
wasserdurchlässig, mit Einem Wort, nur in wenig belebten
Straßen verwendbar. Den Vorzug verdient Pflaster aus
natürlichen oder künstlichen Steinen, auch aus
Gußeisenblöcken, Holzpflaster und Asphalt. Das ehemals
sehr verbreitete rauhe Pflaster aus Gerollen wird mehr und mehr von
dem regelmäßigen Reihenpflaster verdrängt, dessen
Steine an der Oberfläche rechteckig bearbeitet sind. Die
Oberfläche muß eine Wölbung von 1/100-1/60 der
Breite erhalten, und des bessern Auftretens der Pferde sowie des
raschern Wasserabflusses wegen sollen die Reihen senkrecht zur
Straßenrichtung laufen. Die untere Fläche der Steine
soll nicht kleiner sein als etwa 2/3 der obern, und die Höhe
der Steine darf nicht zu sehr wechseln, sonst drücken sie sich
ungleich in die Bettung ein. Am besten, aber in manchen Gegenden zu
teuer, ist Würfelpflaster aus parallelepipedisch bearbeiteten
Steinen, welche, wenn sie thatsächlich Würfel sind, wie
in Wien (18cm Seitenlänge), ein mehrmaliges Umwenden
gestatten. Die Größe schwankt: so hat Brüssel
Prismen von 10cm Breite, 16cm Länge, 13cm Höhe, Turin
Platten von 60cm Länge, 30cm Breite, 15-20cm Höhe. Die
Steine erhalten eine etwa 25cm dicke Unterlage (Bettung) bloß
von Sand oder von Kies und Sand darüber. Wo der Boden leicht
beweglich ist, wie in Berlin, gibt man eine starke Unterlage von
geschlagenen Steinen, auf diese eine Kiesdecke, welche vor dem
Aufsetzen der Würfel festgewalzt wird. Der Pflasterer
(Steinsetzer) setzt die Steine des gewöhnlichen Pflasters
zunächst etwa 5cm höher, als sie später liegen
sollen; dann wird das Pflaster mit Sand überdeckt und
abgerammt. Gut ist es, wenn bei der nunmehr folgenden abermaligen
Sandüberdeckung der Sand durch Wasserspülnng in die Fugen
getrieben wird. Häufig, namentlich unter Wagenständen u.
dgl., werden die Fugen durch Einguß von Zementmörtel
oder Asphalt wasserundurchlässig gemacht, um das Eindringen
der Jauche, also eine Infizierung des Untergrundes, zu
375
Straßenbau.
verhindern. In England wird vielfach statt der Sandunterlage
eine ungefähr 25 cm starke Betonunterlage angeordnet und
dadurch große Haltbarkeit erzielt, allerdings unter
störender Erschwerung aller Ausbesserungen an unter der
Fahrbahn liegenden Rohrleitungen und Telegraphenkabeln.
Pflastersteine dürfen mit der Zeit nicht zu glatt werden und
müssen hart und fest sein, Bedingungen, welche von allen
Felsarten Granit mit am besten erfüllt. Man hat bei
verschiedenen, namentlich holländischen, Stadt- und
Landstraßen statt natürlicher Steine bis zur Verglasung
hartgebrannte Ziegel, Klinker, benutzt, welche ähnlich wie
andres Reihenpflaster unterbettet und so aufgestellt werden,
daß ihre breite Seite die Dicke der Steindecke bildet.
Gußeisenpflaster besteht aus vielfach durchbrochenen
großen Gußeisenplatten (bis 100 kg schwer), die auf der
geebneten Unterlage verlegt werden und zur Vermeidung einseitigen
Setzens untereinander in Verbindung stehen. Die Durchbrechungen
werden mit Sand und Kies ausgefüllt, um dem Pflaster
Rauhigkeit zu geben. Es hat sich bis jetzt nicht bewährt.
Holzpflaster besteht aus 15-17 cm hohen Holzblöcken von
rechteckigem, selten sechseckigem Querschnitt, welche auf einer
Unterlage von Sand, Beton oder hölzernen, manchmal in Teer
getränkten Dielen ruhen. Man füllt die Fugen, welche
zuweilen Filzeinlagen erhalten, mit Sand, einer Mischung von Sand
und Asphalt oder Mörtel. Man verwendet meist Tannenholz und
imprägniert die Blöcke oder taucht sie vor dem Versetzen
in heißen Teer. Eine Verbindung der Klötze durch
hölzerne Dübel ist wenig üblich. Holzpflaster ist in
der Anlage eher billiger als Reihenpflaster, scheint aber bei
starkem Verkehr sehr zu leiden. Es bewirkt ein geräuschloses
Fahren und empfiehlt sich aus diesem Grund für Thoreinfahrten
und enge, stark belebte Gassen sowie seines geringen Gewichts wegen
als Brückenbelag. In England wird es viel verwendet, so z. B.
in zahlreichen Straßen der Londoner City; auch in Berlin ist
es an mehreren stark frequentierten Stellen benutzt worden.
Asphaltstraßen werden aus Stampfasphalt (kom- primiertem
Asphalt) hergestellt. Dieser besteht aus natürlichem
Asphaltstein, d. h. Kalkstein, der zwischen 7 und 11 Proz. Bitumen
enthalten muß und sich z. B. im Val de Travers (Kanton
Neuenburg), bei Seyssel (Aindepartement), Limmer (Hannover) und auf
Sizilien findet. Der rohe Stein wird zwischen gerieften Walzen
zerkleinert und hierauf auf 120-130° erhitzt, wobei er zu
Pulver zerfällt. Zur Herstellung der Fahrbahn, welche eine
Wölbung von 1/100-1/300 erhält, wird das Pulver in
großen Eisenpfannen abermals erhitzt und dann auf der
vorgerichteten Betonunterlage von 10-20 cm Stärke aufgetragen
und mit heißen Rammen, auch wohl einer heißen Walze
verdichtet; schließlich wird mit einer Art Plätteisen
die Oberfläche vollends geglättet und mit etwas feinem
Sand überstreut. Die aufgetragene Schicht ist 5/7mal so stark
als die spätere gestampfte, 4-6 cm dicke Asphaltlage. Da es
auf eine gleichmäßige Unterlage wesentlich ankommt,
bedarf bei nachgiebigem Untergrund die Betonlage selbst eines
Grundbaues aus festgewalztem Kleinschlag. Im allgemeinen
dürften die Kosten der Herstellung von Asphaltstraßen
geringer sein als die von Granitwürfelpflaster, die der
Unterhaltung größer. Die Vorteile der
Asphaltstraßen sind: Ebenheit der Fahrbahn, also leichte
Fortbewegung der Fuhrwerke, große Reinlichkeit,
Wasserundurchlässigkeit, geräuschloses Fahren; die
Nachteile sind: leichtes Stürzen der Pferde, schwierige
Ausbesserung bei nassem Wetter, also insbesondere im Winter.
Übrigens hat es sich gezeigt, daß die Gefahr der
Stürzens sehr abnimmt, wenn Pferd und Kutscher sich an den
Asphalt gewöhnen, und daß, während sich auf
vereinzelten Asphaltbahnen viele Unfälle zutragen, auf einem
größern mit Asphalt befestigten Straßennetz die
Anzahl der Stürze verhältnismäßig nicht mehr
bedeutend ist; bezüglich der Häufigkeit von
Fußkrankheiten der Pferde soll sogar Asphalt dem Pflaster
vorzuziehen sein. Künstliche Steine aus Asphalt haben sich
bisher nicht behaupten können. Fußwege städtischer
Straßen liegen meist zu beiden Seiten des Fahrdammes,
besitzen ein schwaches Quergefälle gegen die
Straßenmitte zu und liegen mit ihrer gewöhnlichen
Begrenzung, den Randsteinen (Bordsteinen, Bordschwellen), 5-20 cm
über dem anstoßenden tiefsten Teil der Fahrbahn, welcher
als Gosse (Straßenrinne, Kandel, Rinnstein) zur
Wasserableitung dient. Neben versteinten Fahrbahnen findet man
manchmal einfach mit Kies überdeckte Fußwege (Gehwege),
sonst stellt man Trottoirs aus Pflaster, Plattenbelag,
Stampfasphalt oder Gußasphalt her. Hausteinplatten kann man
unmittelbar auf den festgestampften Untergrund in Mörtel
legen; Thonplättchen mit ebener oder gerippter Oberfläche
erfordern schon eine Betonunterlage von 8-10 cm Stärke oder
mindestens eine Kiesbettung. Zum Gußasphalt (der mit dem
bereits beschriebenen Stampfasphalt nicht zu verwechseln ist)
verwendet man den im Handel vorkommenden Asphalt-Goudron, d. h.
eine Mischung von natürlichem Asphaltpulver (s. oben) mit
ungefähr 5 Proz. reinem Erdharz (Goudron). Der Asphalt-Goudron
wird an der Baustelle in Kesseln geschmolzen unter Zusatz von noch
etwas Erdharz und so viel Kies, daß etwa 35 Proz. Kies in der
neuen Mischung enthalten sind, welche man, wenn sie genügend
heiß ist, auf die Unterlage ausbreitet. Letztere ist gemauert
oder besteht aus einer 8-10 cm starken Betonschicht. Die
Gußasphaltdecke wird meist in zwei Lagen hergestellt und
erhält eine Dicke von 15 bis 20 mm, in Thoreinfahrten etwa 30
mm.
Geschichtliches. Kunststraßen legte man schon in den
ältesten Zeiten an. Die Spuren der Römerstraßen,
welche sich über das ganze Gebiet des römischen Reichs
zerstreut vorfinden, haben dem neuern S. zum Vorbild gedient. Die
römischen Kunststraßen erhielten, wie Plinius und Vitruv
berichten, zuerst ein Substrat von einer Art Beton, welches einer
20 cm starken Steinplattenschicht (statimen) als Unterlage diente.
Auf letztere kam eine neue, ebenfalls 20 cm starke Schicht in
Mörtel versetzter Steine (rudus), welche durch eine 8 cm
starke Betonschicht (nucleus) bedeckt wurde, auf der dann die
eigentliche Straßendecke (summum dorsum) aus Pflaster oder
Kies hergestellt wurde. Manchmal fehlte jedoch eine oder die andre
Lage, oder es wurden Lehmschichten zwischengeschaltet u. dgl. mehr.
An den Seiten erhielt der Straßendamm Böschungen oder
(bisweilen mit Stu-fen versehene) Strebemauern. Augustus,
Vespasian, Trajan und Hadrian haben Bauten der Art anlegen lassen,
die uns jetzt fast unglaublich erscheinen. Nachdem diese
Straßen nach dem Umsturz des Reichs in Verfall geraten,
ließ Karl d. Gr. die alten Kunststraßen wieder
ausbessern und neue anlegen. In Deutschland reichen die ersten
Spuren eines geregelten Straßenbaues nicht über das 13.
Jahrh. zurück. Doch waren diese Ausführungen noch
höchst mangelhaft. Infolge des mit der Entwickelung eines
regern Geschäfts- und Verkehrslebens wachsenden
Bedürfnisses
376
Straßenbauordnnng - Straßeneisenbahnen.
an Kunststraßen gründete man in Frankreich 1720 ein
besonderes Korps der Ingenieure, in dessen Hand man den mit
verhältnismäßig bedeutendem Kostenaufwand
verknüpften Straßen- und Brückenbau legte.
Vervollkommt wurde diese Einrichtung noch durch die Gründung
der École des ponts et chaussées 1795, durch welche
Ingenieure für S. wissenschaftlich ausgebildet wurden.
Später wurde durch ähnliche Organisationen und technische
Bildungsanstalten der S. auch in andern Staaten gefördert. Die
Fortschritte der neuesten Zeit betreffen weniger die durch die
Eisenbahnen ihrer frühern Bedeutung teilweise beraubten
Landstraßen als die Anlage städtischer Straßen,
wie z. B. die Neuenburger Asphaltindustrie, von einigen später
in Vergessenheit geratenen Anfängen abgesehen, erst 1832 durch
den Grafen Sassenay be-gründet wurde; die erste Verwendung des
Stampfasphalts erfolgte später durch den Ingenieur Merian aus
Basel. Vgl. Umpfenbach, Theorie des Neubaues, der Herstellung und
Unterhaltung der Kunststraßen (Berl. 1830); Wedeke, Handbuch
des Chaufseebaues etc. (Quedlinb. 1835); Launhardt, Über
Rentabilität u. Richtungsfeststellung der Straßen
(Hannov. 1869); Ahlburg, Der S. mit Einschluß der
Konstruktion der Straßenbrücken (Braunschw. 1870); v.
Kaven, Der Wegebau (2. Aufl., Hannov. 1870); Zur Nieden, Der Bau
der Straßen und Eisenbahnen (Berl. 1878); Heusinger v.
Waldegg, Handbuch der Ingenieurwissenschaften, Bd. 1 (2. Aufl.,
Leipz. 1884); Osthoff, Wege- und S. (das. 1882); Dietrich, Die
Asphaltstraßen (Berl. 1882); Derselbe, Baumaterialien der
Steinstraßen (das. 1885).
Straßenbauordnung, s. Bebauungsplan.
Straßenbeleuchtung durch Laternen kannte man schon im
Altertum zu Rom, Antiochia etc., wenigstens in den
Hauptstraßen und auf öffentlichen Plätzen. In Paris
wurde 1524, 1526 und 1553 den Einwohnern befohlen, von 9 Uhr abends
an die Straßen durch Lichter an den Fenstern der Sicherheit
wegen zu erleuchten. Schon im November 1558 brannten die ersten, an
den Häusern oder auf Pfählen angebrachten Laternen, und
1667 war die Stadt in solcher Weise vollständig erleuchtet.
Diesem Beispiel folgten London 1668, Amsterdam 1669, Berlin 1679,
Wien 1687, Leipzig 1702, Dresden 1705, Frankfurt a. M. 1707, Basel
1721 und im Lauf des 18. Jahrh. bei weitem die Mehrzahl der
größern Städte, namentlich in Deutschland. Erst im
19. Jahrh. fing man an, die Lampen mit Reverberen zu versehen und
sie in der Mitte der Straßen aufzuhängen. Den
bedeutendsten Fortschritt hat die S. durch die Gasbeleuchtung (s.
Leuchtgas) gemacht, zu welcher in neuester Zeit das elektrische
Licht getreten ist.
Straßeneisenbahnen (engl. Tramways, Trambahnen, von
Tram = Schiene mit vorspringendem Rand, Grubenschiene),
Schienenwege, welche 1793 von J. Burns und Outram in Derbyshire
statt auf hölzerne Lang- und Querschwellen auf
Steinblöcke gelegt wurden (daher auch Outram ways genannt), u.
auf denen Wagen zur Beförderung von Passagieren oder
Gütern meist mittels Pferde (Pferdebahnen) oder Maschinen mit
geringerer Geschwindigkeit als auf der Eisenbahn fortbewegt werden.
Die Möglichkeit der Rentabilität derartiger Bahnen beruht
auf der Thatsache, daß die Transportarbeit, welche ein Pferd
auf den S. zu verrichten im stande ist, d. h. Anzahl der Menschen
mal Kilometer täglich, wegen der verminderten Reibung eine
wesentlich größere ist als auf Chaussee oder
Steinpflaster, und daß daher die Straßeneisenbahn trotz
billiger Fahrpreise die nicht geringen Anlagekosten durch
Betriebsersparnisse zu verzinsen vermag. Bei diesen Bahnen, deren
lebhafte Entwickelung erst dem letzten Jahrzehnt angehört,
haben die eigenartigen Verhältnisse auch viele eigenartige,
von den Lokomotivbahnen wesentlich abweichende Oberbausysteme
veranlaßt. Am häufigsten wendet man Schienen an, welche
mit dem Straßenpflaster genau in gleicher Höhe liegen,
also den Verkehr des übrigen Fuhrwerkes nicht stören und
mit einer schmalen Rinne versehen sind, worin die Spurkränze
der Räder laufen. Übereinstimmend mit den
Lokomotivbahnen, ist die Spurweite der S. in Europa fast allgemein
1,435 m. Bei eingeleisigen Bahnen sind sogen. Weichen in gewissen
Zwischenräumen vorhanden, d. h. kurze Strecken Nebengeleise,
in welches einer von zwei sich begegnenden Wagen einbiegen kann, um
den andern vorüber zu lassen. Die Schienen bestehen in der
Regel aus einer Hauptschiene, worauf der Radkranz läuft, und
einer durch die Spurrinne von ersterer getrennten Gegenschiene,
welche den Zweck hat, die Spurrinne gegen das Straßenmaterial
zu begrenzen, um sie leichter reinigen zu können. In Kurven
bleibt bei der äußern Schiene die Spurrinne weg, so
daß der Wagen nur innen geführt ist, da sich sonst die
Räder festklemmen würden. In Fig. 1 ist a die
Hauptschiene, b die Gegenschiene der zuerst für die
Berlin-Charlottenburger Pferdebahn angewendeten Schiene, die
später durch die leichtere (Fig. 2) ersetzt wurde. Beide waren
auf die durch Querschwellen getragenen hölzernen Langschwellen
geschraubt, was den Nachteil hatte, daß das Regenwasser
leicht durch die Schraubenlöcher in das Innere des Holzes
drang und rasch Fäulnis veranlagte. Um dies zu vermeiden, hat
man mancherlei andre Befestigungsmittel der Schienen vorgeschlagen
und angewendet, z. B. schmiedeeiserne Bügel unter die Schiene
genietet, welche die Langschwelle umgreifen und seitlich an
dieselbe festgenagelt (Pariser Linie Pont de Courbevoie-Suresnes)
oder festgekeilt sind. In den Vereinigten Staaten sind die S. sehr
entwickelt. Die Straßen haben daselbst meist sehr wenig
Wölbung, was für die Anlage der Geleise vorteilhaft ist.
Die Schienen ruhen auf fichtenen Langschwellen, die wiederum auf
meistens eichenen Querschwellen befestigt sind und zu beiden Seiten
um 0,3 m das Geleise überragen dürfen. Der Abstand
derselben wechselt zwischen 1 und 1,8 m und sinkt auf 0,6 m, wenn
die Langschwellen ganz wegbleiben. Sie sind auf geschlagene Steine
gelagert; die ganze Bahn wird sorgfältig drainiert
(trockengelegt). Die Geleisebreite beträgt 1,59 m. In den
Kurven ist die äußere Schiene flach, die innere aber mit
einer hohen Gegenschiene versehen, um die Fortbewegung in gerader
Linie, Entgleisung, zu verhüten. In Wien, wo die S. seit 1868
bestehen, 1874 bereits eine Länge von 50 km doppelgeleisiger
Strecke besaßen und 34 Mill. Passa-
377
Straßeneisenbahnen.
giere während des Ausstellungsjahrs 1873 beförderten,
liegen die Schienen bei 1,455 m Spurweite aus eichenen
Langschwellen von 237 mm im Quadrat und diese auf Querschwellen,
die in Schotter gebettet sind. Die Vergänglichkeit der
Holzschwellen, durch welche Betriebsstörungen und bedeutende
Reparaturkosten erwachsen, hat neuerdings zur Anwendung eiserner
Langschwellen oder zur direkten Lagerung der Schienen auf das
Straßenmaterial geführt. Im letztern Fall
(Stuttgart-Berg-Kannstätter Pferdebahn) müssen die
Schienen eine beträchtliche Breite erhalten, um den Druck auf
eine genügend große Grundfläche zu verteilen.
Einige Systeme besitzen den großen Vorzug, daß die
Wagen die Schienen beliebig verlassen können, um
entgegenkommenden Wagen auszuweichen. Man hat dies durch schwach
ausgehöhlte Schienen und entsprechend abgerundete
Radkränze, ferner durch eine dritte Schiene erreicht, in die
ein fünftes kleineres Rad als Leitrad eingreift, während
die vier Wagenräder mit gewöhnlichen Radkränzen auf
flachen Schienen laufen (Perambulatorsystem). Das Leitrad kann
mittels eines Trittes vom Kutscher gehoben werden, worauf der Wagen
im stande ist, aus dem Geleise abzulenken. Erspart wird die dritte
Schiene auf der Berliner Linie Alexanderplatz-Weißensee,
indem hier die vier Laufräder der Wagen ohne Spurkränze
auf den Schienen laufen und anfangs nur durch ein fünftes, auf
der linken Schiene laufendes kleines Spurrad, welches, am vordern
Ende des Wagens an einem Hebel sitzend, ebenfalls durch einen
Fußtritt vom Kutscher ein- und ausgelegt werden konnte, auf
dem Geleise gehalten wurden. Nach etwa halbjährigem Betrieb
brachte man zur größern Sicherheit des Geleisehaltens
zwei an einem gemeinschaftlichen Hebel sitzende Spurräder an.
Dieses System gestattet den Pferdebahnbetrieb in den engsten
Straßen, da nur ein einziges Geleise notwendig ist, indem zum
Ausweichen je ein Wagen durch Aushebung der Spurräder das
Geleise verläßt, bis der andre vorbei ist. Die Schiene
besteht hier aus zwei gleichen, ebenen Laufflächen von ca. 40
mm Breite, mit einem Zwischenraum von 30 mm für die Spur. Es
ist zu erwarten, daß dieses System eine bedeutende Zukunft
hat, namentlich weil das hier benutzte Schienensystem den
Wagenverkehr nicht im geringsten stört. Neuerdings wird
vielfach auf den Straßenbahnen die Betriebskraft der Pferde
durch Dampfkraft ersetzt. Man benutzt Lokomotiven von 15-100
effektiven Pferdekräften mit Rauchverbrennungs- und
Kondensationsvorrichtungen und möglichst ruhigem Gang, um die
Passagiere und Fußgänger nicht zu belästigen und
Pferde nicht scheu zu machen. Solche Dampfstraßenbahnen sind
besonders in Oberitalien in beträchtlicher Ausdehnung
vorhanden und vermitteln den Personen- und Güterverkehr
zwischen Ortschaften abseits der Eisenbahnen. Auch feuerlose
Lokomotiven sind für S. benutzt worden, ebenso Dampfwagen, bei
welchen die Dampfmaschine in dem für die
Personenbeförderung bestimmten Wagen angebracht ist (s.
Lokomotive, S. 890). Ein in Amerika mehrfach in Anwendung
befindliches Straßenbahnsystem mit Dampfbetrieb (Taubahnen,
Kabel-, Seilbahnen) benutzt stationäre Dampfmaschinen und zur
Übertragung der Zugkraft auf die Wagen ein unter dem
Straßenplanum laufendes Stahldrahtseil ohne Ende. Die Bahn
selbst ist eine zweigeleisige, und die beiden Seiltrümer sind
so gelegt, daß das eine fortwährend nach derselben
Richtung hinlaufende Trum unter dem einen Geleise, das andre in
entgegengesetzter Richtung bewegte unter dem zweiten Geleise
bleibt, entsprechend dem Lauf der hin- und hergehenden Wagen. Damit
das Seil weder den sonstigen Wagenverkehr behindert, noch selbst
einer Beschädigung oder Beschmutzung ausgesetzt ist, zugleich
aber die Ankuppelung der Wagen gestattet, liegt unter jedem Geleise
ein Rohr unter dem Straßenplanum, in welchem zahlreiche um
horizontale Achsen drehbare Leitrollen zur Aufnahme des etwa 25 mm
starken Seils dienen. An den beiden Enden der ganzen Strecke wird
das Seil aus einem Geleise in das andre durch horizontale
Wenderollen von 2,4 m Durchmesser übergeleitet. Die
Röhren sind auf ihre ganze Länge an der Oberseite
geschlitzt, um eine Verbindung zwischen Wagen und Seil zu
ermöglichen, und zwar ist der Schlitz so viel von der
Rohrmitte entfernt angebracht, daß einerseits kein Schmutz
auf das Seil und die Leitrollen fallen und anderseits ein vom Wagen
durch den Schlitz hinabreichender Kuppelungsarm den an den
Gefällewechseln über dem Seil befindlichen
Ablenkungsrollen ausweichen kann. Eine von dem Wagen herabreichende
Stahlschiene wird mittels einer an ihrem untern Ende angebrachten,
vom Führerstand des Wagens aus mittels Hebels zu handhabenden
Seilklemme mit dem Seil verkuppelt. Diese Klammer hat die Form
einer Zange und ist mit zwei das Seil erfassenden Klemmbacken aus
weichem Gußeisen versehen. Das Anhalten und Weiterfahren an
den Haltestellen erfolgt durchaus stoßfrei und wird von dem
Kondukteur durch Lösen und Schließen der Klemme besorgt.
Die Betriebsmaschine ist ungefähr in der Mitte der ganzen
Bahnstrecke aufgestellt und liegt seitwärts von der Bahn, so
daß an dieser Stelle eine rechtwinkelige Ablenkung des dem
nächstliegenden Geleise angehörigen Seiltrums erfolgen
muß, um das Seil nach der Betriebsscheibe hinzuleiten. Dieser
Ablenkung des Seils kann die Seilklemme aber nicht folgen und
muß daher kurz vor der Ablenkungsstelle gelöst und
gleich hinterher wieder angeschlossen werden, während der
Wagen infolge seines Beharrungsvermögens die kurze
dazwischenliegende Strecke frei durchführt. Ein ähnliches
Manöver muß bei Kurven gemacht werden, und damit hier
die bedeutend längere Strecke ohne Seilantrieb sicher
durchfahren werden kann, sind die Geleise vor der Kurve etwas
ansteigend ausgeführt, um in der Kurve eine zur sichern
Weiterbeförderung des Wagens erforderliche Neigung zu
erhalten. Für den Betrieb wird nicht jeder Wagen einzeln an
das Seil angeschlossen, sondern man fährt mit einem kleinen
Zug von zwei gewöhnlichen Straßenbahnwagen und einem
davor befindlichen Kuppelungswagen, welch letzterer aber
außer dem Kondukteur noch Passagiere aufnimmt. Auf der
Hängebrücke zwischen New York und Brooklyn wird eine
Taubahn mit einem 38 mm dicken, 3492 m langen Drahtseil betrieben.
Dasselbe wird mit 15 km Geschwindigkeit in der Stunde täglich
20 Stunden lang in Betrieb erhalten. 10-20 Wagen werden
gleichzeitig angehängt, ihr Gewicht beträgt
durchschnittlich je 10 Tonnen. Die Wagen folgen in
Zeitabständen von 0,6-1,2 Minuten, so daß täglich
1200 ganze Reisen (hin und zurück) ausgeführt werden.
über Elektrische Eisenbahnen s. d. Vgl. Clark, Tramways. their
construction and working (Lond. 1878; deutsch von Uhland, Leipz.
1880, 2 Bde.); "Die Straßen- und Zahnradbahnen" (Organ
für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, Supplementband 8,
Wiesb. 1882); "Zeitschrift für das gesamte Lokal- und
Straßenbahnwesen" (das., seit 1881); "Zeitschrift für
Transportwesen und
378
Straßenkehrmaschinen - Strategie.
Straßenbau" (Berl., seit 1884); v. Lindheim, Die
Straßenbahnen, Statistisches etc. (Wien 1888); Huber, Das
Tramwayrecht (Zürich 1889).
Straßenkehrmaschinen sind zuerst am Ende der 20er Jahre
in England eingeführt worden; sie ahmen entweder das
Kehren mit Handbesen oder Krücken nach, und das arbeitende
Werkzeug macht eine fast geradlinige oder schlingende
fortschreitende Bewegung, oder das Bürsten- und Besensystem
arbeitet ausschließlich bei rotierender Bewegung, oder es
wird endlich der Besen wie eine endlose Kette in eine geradlinig
fortschreitende und gleichzeitig drehende Bewegung versetzt. Die
Maschinen der ersten Klasse sind am wenigsten brauchbar, die zweite
Klasse zählt die meisten Konstruktionen, von denen die
neueste
mit schräg liegender Cylinderbürste den Schmutz in
geradlinige Häufelstreifen zusammenkehrt. Sie unterscheidet
sich von der ältern Konstruktion dadurch, daß die
Cylinderbürste von dem einen Laufrad ab mittels konischer
Räder und durch Benutzung eines Hookschen Gelenks bewegt wird,
während der Betrieb der ältern Maschine durch eine
endlose Kette erfolgt. Um die gleiche von einer Maschine gereinigte
Straßenfläche in einer Stunde nur mit Handbesen zu
kehren und zu häufeln, sind 33-36 geübte Leute
nötig. Zur dritten Klasse gehören die Maschinen, bei
denen das Besensystem ein schräg liegendes Paternosterwerk
bildet, das den Schmutz auf einer festen schiefen Ebene
aufwärts schiebt und einem Sammelkasten übergibt,
während eine Brause die Straße schwach befeuchtet.
Straßenlokomotive, s. Lokomobile, S. 883 f.
Straßenraub, s. Raub.
Straßenrecht auf See (Seestraßenrecht,
Seestraßenordnung), Grundsätze und seepolizeiliche
Vorschriften, welche die Sicherung der Schiffe auf See, namentlich
vor dem Zusammenstoß mit andern Fahrzeugen, bezwecken.
Früher entschied in dieser
Hinsicht lediglich "das Herkommen auf See" , während in
neuerer Zeit die Seestaaten, England voran, dazu übergegangen
sind, im Verordnungsweg die
nötigen Vorschriften für ihre Schiffsführer zu
erlassen. Auf Anregung Frankreichs wurden dann jene Vorschriften
einer Revision unterzogen, um dieselben
möglichst in Einklang zu bringen und ihnen so einen
internationalen Charakter zu verleihen. Die betreffenden
deutschen Verordnungen stimmen mit den englischen ("Revidierte
Vorschriften zur Verhütung von Kollisionen auf See vom 14.
Aug. 1879, in Verfolg der Zusatzakte zum
Kauffahrteischiffahrtsgesetz
von 1862", nebst Nachtrag vom 21. Aug. 1884) zum Teil
wörtlich überein. Die nötige Strafbestimmung
enthält das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich
(§ 145). Es bedroht mit Geldstrafe bis zu 1500 Mk.
ein Zuwiderhandeln gegen die vom Kaiser erlassenen Verordnungen
1) zur Verhütung des Zusammenstoßes der Schiffe auf See,
2) über das Verhalten der Schiffer nach einem
Zusammenstoß von Schiffen auf See, 3) in betreff der Not- und
Lotsensignale für Schiffe auf See und auf den
Küstengewässern. In ersterer Beziehung sind nun die
Verordnungen vom 7. Jan. 1880 und 16. Febr. 1881 erlassen,
während in zweiter die Verordnung vom 15. Aug. 1876
maßgebend ist, welche die Schiffsführer
verpflichtet,
nach einem Zusammenstoß dem andern Schiff und den dazu
gehörigen Personen Beistand zu leisten, soweit sie dazu ohne
erhebliche Gefahr für das eigne Schiff und die darauf
befindlichen Personen im stande sind. Dazu kommt dann endlich die
Not- und Lotsensignalordnung vom 14. Aug. 1876; letztere,
ebenso
wie die Verordnung vom 15. Aug. 1876, im wesentlichen der
englischen Merchant Shipping Act von
1873 entnommen. Was die Verhütung des Zusammenstoßes
von Schiffen auf See anbetrifft, so besteht die Vorschrift,
daß jedes Segelschiff auf Backbord eine rote, auf Steuerbord
eine grüne Laterne zu führen hat und keine andre; jeder
Dampfer außerdem eine weiße Topplaterne, ein Schlepper
zwei weiße Topplaternen übereinander; ein vor Anker
liegendes Schiff an einer gut sichtbaren Stelle und nicht
höher als 6 m über dem Schiffsrumpf eine weiße
Ankerlaterne und keine andre. Mit Bezug auf das Ausweichen
gilt im allgemeinen die Regel, daß das mit den besten
Mitteln zum Manövrieren ausgestattete Schiff dem andern
ausweicht; ein Dampfer muß daher einem Segelschiff stets
ausweichen, ebenso das überholende Schiff dem vorangehenden.
Bewegen sich zwei Schiffe auf gerader Linie gegeneinander, so haben
sich dieselben mit den Backbordseiten zu passieren; kreuzen sich
die Kurse zweier Segelschiffe, welche den Wind von verschiedenen
Seiten haben, so muß dasjenige, welches den Wind von Backbord
hat, dem andern aus dem Wege gehen; nur in dem Fall, wenn ersteres
dicht am Wind segelt und das andre raumen Wind hat, muß
letzteres ausweichen; haben beide Schiffe den Wind von derselben
Seite, oder segelt eins derselben vor dem Wind, so weicht das
luvwärts befindliche aus. Vgl. Gray, Bemerkungen über das
S.
(deutsch von Freeden, Oldenb. 1885).
Straßeureinigungsmaschinen, s.
Straßenkehrmaschinen.
Straßmann-Damböck, Marie, hervorragende
Schauspielerin, geb. 16. Dez. 1827 zu Fürstenfeld in
Steiermark, betrat 1843 zuerst zu Innsbruck die Bühne
mit glücklichem Erfolg und folgte von Brünn aus, wo
sie als tragische Liebhaberin wirkte, 1845 einem Ruf
nach Hannover, der eigentlichen Wiege ihres Ruhms.
Als sie 1849 ehrenvolle Anträge von Wien, Berlin,
Stuttgart, München erhielt, entschied sie sich für
letzteres, verheiratete sich daselbst mit dem Heldenspieler
Straßmann und siedelte mit demselben 1868 an das
Stadttheater zu Leipzig über, das sie jedoch schon 1870
mit dem Wiener Burgtheater vertauschte. Früher im Fach der
Liebhaberinnen glänzend, ging sie bereits in Hannover in das
der Heldinnen und weiblichen Charakterrollen über und
leistete, unterstützt durch reiche äußere Mittel,
besonders in der Darstellung dämonischer und hochtragischer
Gestalten Ansgezeichnetes. Zu ihren Hauptrollen auf diesem Gebiet
gehörten Antigone, Iphigenie, Medea, Judith, Thusnelda,
Jungfrau, Deborah etc. In der letztern Zeit wandte sie sich dem
Fach der Heldenmütter zu.
Straßnitz, Stadt in der mähr.
Bezirkshauptmannschaft Göding, an der Lokalbahn
Wessely-Sudomeritz unweit der March (Kettenbrücke), mit
Bezirksgericht,
Piaristenkollegium, Schloß, Weinbau, Dampfmühle,
Spiritus-, Preßhefe- und Malzfabrikation und (1880)
5229 Einw.
Strategem (griech., oder nach dem Franz. Stratagem),
Kriegslist.
Strategen, bei den alten Athenern die 10
gewählten
Befehlshaber größerer Heeresabteilungen, welche an
den Schlachttagen das Oberkommando, im Frieden in täglichem
Wechsel den Oberbefehl führten. Ihr Amt dauerte ein Jahr (vgl.
Phalanx). Vgl. Hauvette-Besnault, Les stratèges
athéniens (Par. 1885). Jetzt bedeutet Stratege allgemein s.
v. w. kriegskundiger Heerführer, Kriegsleiter (vgl.
Strategie).
Strategie (griech.), Kriegsleitungslehre, Feldherrnkunst,
die Lehre von der Heer- oder Truppenführung auf dem
Kriegsschauplatz bis zum Schlachtfeld, hier
379
Stratford - Stratifizieren.
wird sie Taktik. Die S. entwirft den Kriegsplan und wacht
über dessen Ausführung; sie leitet die Kriegshandlung
selbst und gibt ihr Richtung und Ziele. Sie bestimmt also im
allgemeinen, wann, wohin und auf welchen Wegen die Truppen
marschieren, wann sie schlagen sollen etc. Diese Anordnungen
hängen wesentlich von den Nachrichten ab, die man über
den Feind erhält; der Feldherr muß ferner außer
den materiellen eignen und feindlichen Kräften und der
Beschaffenheit des Kriegsschauplatzes auch die Charaktere der
Führer, den Zustand und die Stimmung der Heere wie der
Landeseinwohner in Betracht ziehen. Dadurch wird die S. zu einer
schwer auszuübenden Kunst. Hauptgrundsätze der S. sind:
getrennt marschieren und rechtzeitige Vereinigung zur Schlacht;
keine Zeit verlieren; errungene Erfolge mit allem Nachdruck
benutzen und auch mitten im Siegeslauf an die Möglichkeit
denken, geschlagen zu werden, und deshalb aus Sicherung des
Rückzugs stets bedacht sein. Obwohl die Grundsätze der S.
einfach sind, so ist doch die Kriegführung selbst sehr
schwierig; indessen haben die Schnelligkeit des heutigen
Nachrichtenwesens wie die zahlreichen Verkehrswege und
Verkehrsmittel die Heeresleitung gegen früher sehr
erleichtert, so daß Operationen getrennter Heeresteile auch
aus rückwärtiger Stellung geleitet werden können.
Vgl. Friedrich II., OEuvres militaires; Napoleon, Maximes de
guerre; Erzherzog Karl, Grundsätze der S. (Wien 1814, 3 Bde.);
Valentini, Die Lehre vom Krieg (Berl. 1821-23, 4 Bde.); Jomini,
Précis de l'art de guerre (deutsch, das. 1881); die Werke
des Generals v. Clausewitz (s. d.); v. Willisen, Theorie des
großen Kriegs (2. Aufl., Leipz. 1868, 4 Bde.); Rüstow:
Der Krieg und seine Mittel (das. 1856), S. und Taktik der neuesten
Zeit (Stuttg. 1872-75, 3 Bde.), Die Feldherrenkunst des 19.
Jahrhunderts (3. Aufl , Zürich 1878); Leer, Positive S. (a. d.
Russ., 2. Aufl., Wien 1871); Blume, Strategie (2. Aufl., Berl.
1886), und die Litteratur bei Art. Taktik.
Stratford (spr. strättförd), Stadt in der
britisch-amerikan. Provinz Ontario, am Avon, nördl. von
London, Knotenpunkt mehrerer Eisenbahnen, mit (1881) 8239
Einwohnern.
Stratford de Redcliffe (spr. réddkliff),
eigentlich Sir Stratford Canning, Viscount de Redcliffe, brit.
Diplomat, geb. 6. Jan. 1788 als Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns
zu London, Vetter des Ministers George Canning (s. d.), war bereits
1809 britischer Gesandtschaftssekretär in Konstantinopel. 1814
ging er als bevollmächtigter Minister nach Basel, wo er an der
Abfassung der Schweizer Bundesakte teilnahm. 1815 war er
während des Kongresses in Wien und ging dann in diplomatischen
Sendungen nach Washington und Petersburg. Im Februar 1826 wurde er
Gesandter in Konstantinopel und wirkte für Beilegung der
Differenzen zwischen der Türkei und Griechenland. Da indes die
Pforte seine Vorschläge verwarf, verließ er 1827
Konstantinopel, ging 1828 als außerordentlicher Gesandter
nach Griechenland und kehrte sodann, nachdem er an den Pariser
Konferenzen zur Feststellung der Grenzen dieses Königreichs
teilgenommen, nach England zurück. Im Oktober 1831 abermals
zum Gesandten in Konstantinopel ernannt, nahm er wiederum an den
Verhandlungen über die Regulierung der Grenzen Griechenlands
teil und sah seine Bestrebungen durch den Londoner Vertrag vom 7.
Mai 1832 gekrönt. 1833 und 1834 war er außerordentlicher
Gesandter zu Madrid und Petersburg. 1841 ging er wieder als
Gesandter nach Konstantinopel und war hier nun 16 Jahre lang
unermüdlich thätig, den russischen Einfluß in der
Türkei zu bekämpfen und auch jedes Vorwiegen eines
französischen oder österreichischen Einflusses zu
verhindern. Schon 1852 war er mit dem Titel Viscount de Redcliffe
zum Peer erhoben worden. Im Juli 1858 nach England
zurückgekehrt, nahm er seinen Sitz im Oberhaus ein; 1869
erhielt er den Hosenbandorden. Ohne seitdem an der aktiven Politik
teilzuhaben, galt er doch immer als eine der ersten
Autoritäten in Sachen der orientalischen Fragen und erhob
namentlich in den Verwickelungen seit 1876 wiederholt seine Stimme,
nicht durchweg die Maßregeln des Ministeriums Beaconsfield
billigend. Er starb 14. Aug. 1880 auf seinem Landsitz Fermt Court
in Kent. Er veröffentlichte einen Band Gedichte ("Shadows of
the past", Lond. 1865), ein theolog. Werk: "Why am I a Christian?"
(1873); "Alfred the Great in Athelnay" (1876) u. a.
Stratford le Bow (spr. li boh), Vorstadt von London, in
der engl. Grafschaft Essex, östlich von Lea, mit (1881) 36,455
Einw. Vor der St. Johannskirche steht ein Denkmal zur Erinnerung an
die hier 1555-56 verbrannten Protestanten. S. hat zahlreiche
Fabriken (s. Ham).
Stratford on Avon (spr. ehw'n), Stadt in Warwickshire
(England), am Avon, mit Lateinschule, Getreide- und Malzhandel und
(1881) 8054 Einw. S. ist besonders denkwürdig als Geburts- und
Sterbeort Shakespeares, dessen noch vorhandenes Geburtshaus vom
Shakespeare-Verein angekauft wurde. Im Chor der schönen
Stadtkirche befinden sich das Grab und Denkmal des Dichters; vor
dem Stadthaus steht eine Statue desselben. Auch ist ein besonderes
"Shakespeare-Gebäude" (mit Theater und Bibliothek) errichtet
worden.
Strath (gäl.), s. v. w. breites kultiviertes Thal,
im Gegensatz zu Glen (s. d.).
Strathaven (spr. strath-éhw'n oder strehw'n),
Stadt in Lanarkshire (Schottland), am Avon, 12km südwestlich
von Hamilton, mit Schloßruine und (1881) 3812 Einw.
Strathclyde (spr. strath-klaid') , s. v. w. Clydesdale,
d. h. Thal des Clyde, Landschaft im südwestl. Schottland,
bestand bis 1124 als unabhängiges Königreich.
Strathmore (spr. strath-móhr), fruchtbare
Thalebene in Schottland, welche sich von Stonehaven bis zum Clyde
erstreckt und im N. durch die Hochlande, im Süden durch die
Sidlaw- und Ochillhügel begrenzt wird.
Strathnairn (spr. -nern), Hugh Henry Rose, Lord, engl.
General, geb. 1803 zu Berlin, wo sein Vater britischer Gesandter
war, trat 1820 in die Armee und ward, nachdem er den Grad eines
Oberstleutnants erreicht hatte, nacheinander Generalkonsul in
Syrien, Gesandtschaftssekretär in Konstantinopel und
britischer Kommissar im französischen Hauptquartier
während des Krimkriegs. Beim Ausbruch des indischen Aufstandes
erhielt er ein selbständiges Kommando und zeichnete sich so
aus, daß er bei der Rückkehr Lord Clydes nach Europa
diesem im Generalkommando der britischen Truppen in Indien folgte,
in welcher Stellung er sich große Verdienste um die
Reorganisation der indischen Armee erwarb. Von 1865 bis 1870
kommandierte er die britischen Truppen in Irland, 1866 wurde er zum
Baron S. und zum Peer erhoben und 1877 zum Feldmarschall ernannt.
Er starb 16. Okt. 1885 in Paris ohne Nachkommen.
Stratifikation (lat.), die Schichtung der Gesteine;
Stratigraphie, die Lehre von derselben.
Stratifizieren (neulat., "schichtenförmig legen"),
das Einschlagen von Samen (Weißdorn, Quitte, Clematis etc.),
welche erst keimen, nachdem sie ein Jahr und länger in der
Erde gelegen, oder auch von Samen,
380
Stratiokratie - Strauß.
welche an der Luft bald ihre Keimfähigkeit verlieren, wie
Aesculus, Castanea, Fagus, Juglans, Magnolia, Quercus u. a. Man
benutzt hierzu Sand, Erde, Spreu, Sägespäne u. a., womit
man die Samen vermischt und bedeckt und so in einem
Gefäß in einen trocknen Keller stellt; bei hartschaligen
Samen, z. B. Weißdornkernen, dürfen diese Stoffe einen
geringen Grad von Feuchtigkeit besitzen. Größere Massen
gräbt man im Erdboden ein, um sie dem Temperaturwechsel zu
entziehen. Sobald der Keim sich zu zeigen beginnt, gießt man
die Samen ein; ist das Würzelchen schon lang geworden,
muß es abgekneipt werden.
Stratiokratie (griech.), Soldatenherrschaft.
Stratiomys, Waffenfliege; Stratiomydae (Waffenfliegen),
Familie aus der Ordnung der Zweiflügler, s. Waffenfliegen.
Stratioten (griech., "Soldaten", auch Stradioten),
halbwilde leichte Reiter aus Albanien und Morea, die im Solde der
Venezianer standen, im 15. Jahrh. auch im französischen und
spanischen Heer dienten, trugen türkische Tracht ohne Turban,
ein Panzerhemd und kleinen Helm und führten als Waffen eine
bis 4 m lange, an beiden Enden mit Eisen beschlagene Wurflanze,
breiten Säbel und Gewehr.
Stratiotes L. (Wasserscher, Krebsscher), Gattung aus der
Familie der Hydrocharideen, untergetauchte oder nur mit den
Blattspitzen auftauchende, aloeartige Wasserpflanzen mit dicht
rosettenartig gestellten, sitzenden, breit linealen, zugespitzten,
stachlig gezahnten, starren Blättern, zusammengedrücktem
Blütenschaft und diözischen Blüten. S. aloïdes
L. (Meeraloe), mit schwertförmig dreikantigen Blättern,
weißen Blüten und sechsfächeriger Beere, in
stehenden und langsam fließenden Gewässern
Norddeutschlands, meist gesellig, eignet sich gut für
Aquarien.
Stratocumulus (lat.), die geschichtete Haufenwolke, s.
Wolken.
Stratos, alte Bundeshauptstadt des wahrscheinlich
illyrischen Volkes der Akarnanen (Mittelgriechenland), im
Binnenland in der fruchtbaren Ebene des Acheloos gelegen,
strategisch wichtig. Im Peloponnesischen Krieg mit Athen
verbündet, schlug S. 429 den Angriff der Ambrakioten
zurück, wurde etwa um 300 von den Ätoliern besetzt und
blieb in deren Gewalt, bis 189 v. Chr. die Römer es den
Akarnanen zurückgaben. Die sehr ausgedehnten, mit Türmen
und stattlichen Thoren (daher der heutige Name Portäs)
versehenen Stadtmauern und Reste eines Tempels liegen beim
Walachendorf Surovigli.
Strato von Lampsakos, peripatetischer Philosoph,
Theophrasts Schüler und Nachfolger als Vorstand der
Aristotelischen Schule im Lykeion zu Athen, starb daselbst 240 v.
Chr. Seiner vorwiegenden Beschäftigung mit der Physik halber,
während er die Ethik fast vernachlässigte, hieß er
der "Physiker". Von seinen Schriften ist nichts erhalten geblieben.
Vgl. Nauwerk, De Stratone Lampsaceno (Berl. 1836).
Stratum (lat.), Schicht.
Stratus (lat.), die Schichtwolke, s. Wolken.
Strauben, feines, in steigender Butter gebackenes
Gebäck aus einem Teig von Mehl, Zucker und Weißwein, den
man durch einen im Kreis geschwenkten Trichter in die heiße
Butter rinnen läßt.
Stranbfuß der Pferde, s. Igelfuß.
Straubing, unmittelbare und Bezirksamtsstadt im bayr.
Regierungsbezirk Niederbayern, an der Donau, Knotenpunkt der Linien
Neufahrn-S. und Passau-Würzburg der Bayrischen Staatsbahn, 318
m ü. M., hat 7 Kirchen, ein Schloß, einen schönen
Marktplatz mit Dreifaltigkeitssäule, eine Studienanstalt, eine
Realschule, ein Schullehrer- und ein bischöfliches
Knabenseminar, ein Waisenhaus, eine Taubstummen- und eine
Idiotenanstalt, 4 Klöster, mehrere Hospitäler etc., ein
Landgericht, eine Filiale der königlichen Bank in
Nürnberg, eine Bankagentur der Bayrischen Notenbank,
bedeutende Ziegel-, Kalk- und Zementfabrikation, Gerberei,
Bierbrauerei, Getreidehandel und (1885) mit der Garnison (ein
Infanteriebataillon Nr. 11) 12,804 meist kath. Einwohner. Zum
Landgerichtsbezirk S. gehören die 7 Amtsgerichte zu Bogen,
Kötzting, Landau a. I., Mallersdorf, Mitterfels, Neukirchen
bei Heiligblut und S. - Die Stadt, an deren Stelle schon in der
Römerzeit eine Ansiedelung, Sorbiodurum, bestand, soll um 1208
von Ludwig von Bayern gegründet worden sein. Bei der Teilung
Niederbayerns (1353) wurde eine Linie Bayern-S. von Wilhelm und
Albrecht begründet, die 1425 mit Johann I. ausstarb, worauf
wegen S. ein Streit (Straubinger Erbfall) entstand. Durch
König Siegmund wurde 1429 S. dem Herzog Ernst von
Bayern-München verliehen. 1435 wurde hier Agnes Bernauer (s.
d.) von der Donaubrücke in den Strom gestürzt. Vgl.
Wimmer, Sammelblätter zur Geschichte der Stadt S. (Straub.
1882-86, 4 Hefte).
Strauch (Frutex), ein Holzgewächs, dessen Stamm
gleich vom Boden an in Äste geteilt ist, wodurch allein es
sich von den Bäumen unterscheidet. Daher können manche
Sträucher künstlich baumartig gezogen werden durch
Abschneiden der untern Äste, und Bäume können unter
ungünstigen äußern Verhältnissen
strauchförmig werden. Vgl. Halbstrauch.
Strauchkraut, f. Datisca.
Strauchweichsel, s. Kirschbaum, S. 789.
Strausberg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Potsdam, Kreis Oberbarnim, am Straussee und an der Linie
Berlin-Schneidemühl der Preußischen Staatsbahn, hat eine
evang. Kirche aus dem 16. Jahrh., ein Realprogymnasium, eine
Landarmen- und Korrektionsanstalt, ein Amtsgericht, Federbesatz-,
Flanell-, Schnittwaren- und Teppichfabrikation und (1885) 6525
meist evang. Einwohner. S. wird zuerst 1238 urkundlich
erwähnt.
Strauß (Struthio L.), Gattung aus der Ordnung der
Straußvögel (Ratitae) und der Familie der Strauße
(Struthionidae), mit der wohl einzigen Art S. camelus L. (s. Tafel
"Straußvögel"). Der S. ist 2,5 m hoch, 2 m lang, 1,5
Ztr. schwer; er besitzt einen sehr kräftigen Körper,
einen langen, fast nackten Hals, einen kleinen, platten Kopf, einen
mittellangen, stumpfen, vorn abgerundeten, an der Spitze platten,
mit einem Hornnagel bedeckten, geraden Schnabel mit biegsamen
Kinnladen, bis unter das Auge reichender Mundspalte und offen
stehenden, länglichen, ungefähr in der Mitte des
Schnabels befindlichen Nasenlöchern, große,
glänzende Augen, deren oberes Lid bewimpert ist, unbedeckte
Ohren, hohe, starke, nur an den Schenkeln mit einigen Borsten
besetzte, nackte Beine mit groß geschuppten Läufen und
zwei Zehen, von denen die innere mit einem großen, stumpfen
Nagel bewehrt ist, ziemlich große, zum Fliegen aber
untaugliche, mit doppelten Sporen versehene Flügel, welche
anstatt der Schwingen schlaffe, weiche, hängende Federn
enthalten, einen kurzen, aus ähnlichen Federn bestehenden
Schwanz, mäßig dichtes, ebenfalls aus schlaffen,
gekräuselten Federn gebildetes Gefieder und an der Mitte der
Brust eine unbefiederte, hornige Schwiele. Beim Männchen sind
alle kleinen Federn des Rumpfes schwarz, die langen Flügel-
und Schwanzfedern blendend weiß, der Hals hochrot, die
Schenkel fleischfarben; beim Weib-
381
Strauß (Vogel) Strauß (Personenname).
chen ist das Kleingefieder braungrau, nur auf den Flügeln
und in der Schwanzgegend schwärzlich, Schwingen und
Steuerfedern sind unrein weiß, das Auge ist braun, der
Schnabel horngelb. Der S. bewohnt die Steppen und Wüsten
Afrikas und Westasiens vom Süden Algeriens bis tief ins
Kapland hinein, auch in den Steppen zwischen Nil und Rotem Meer, in
den Wüsten des Euphratgebiets, in Arabien und Südpersien,
überall nur, soweit ein wenn auch spärlicher
Pflanzenwuchs den Boden bedeckt und Wasser vorhanden ist, durcheilt
aber auch völlig pflanzenlose Striche. Er lebt in Familien,
die aus einem Hahn und 24 Hennen bestehen, macht auch, wo das Klima
dazu zwingt, Wanderungen und rottet sich dann zu Herden zusammen.
Er überholt im Lauf ein Rennpferd und breitet dabei seine
Flügel aus. Sein Gesicht ist außerordentlich scharf, und
auch Gehör und Geruch find ziemlich fein. Dagegen ist er sehr
dumm und flieht vor jeder ungewohnten Erscheinung. Oft findet man
ihn in Zebraherden, die von seiner Wachsamkeit u. feiner
Fähigkeit, weite Strecken zu übersehen, Vorteil ziehen.
Er nährt sich von Gras und Kraut, Körnern, Kerbtieren und
kleinen Wirbeltieren, verschlingt jedoch auch Steine, Scherben
etc., ist aber keineswegs gefräßig. Wasser trinkt er in
großer Menge. Der S. nistet in einer runden Vertiefung im
Boden, in welche die Hennen zusammen etwa 30 Eier legen,
während weitere Eier um das Nest herum zerstreut werden. Eine
Henne legt etwa 12-15 Eier. Das Ei ist 14-15,5 cm lang, 11-12,7 cm
dick, schön eiförmig, gelblichweiß, heller
marmoriert, wiegt durchschnittlich 1440 g und besitzt einen
schmackhaften Dotter. Die Bebrütung geschieht
hauptsächlich oder ausschließlich von seiten des
Männchens, und nur im Innern Afrikas werden die Eier
stundenlang verlassen, dann aber mit Sand bedeckt. Nach 45-52 Tagen
schlüpfen die Jungen aus, welche mit igelartigen Stacheln
bedeckt sind, die sie nach zwei Monaten verlieren; sie erhalten
dann das graue Gewand der Weibchen, und im zweiten Jahr färben
sich die Männchen und werden im dritten zeugungsfähig.
Das Nest und die Jungen werden von dem S. sorgsam bewacht und
verteidigt. Der S. erträgt die Gefangenschaft sehr gut, und in
Innerafrika wird er allgemein zum Vergnügen gehalten.
Gezüchtet hat man den S. zuerst 1857 in Algerien, bald darauf
wurden auch in Florenz, Marseille, Grenoble u. Madrid junge
Strauße erbrütet, und seit 1865 datiert die
Straußenzucht im Kapland, wo 1875 über 32,000
Strauße gehalten wurden und die Zucht gegenwärtig einen
der wichtigsten Erwerbszweige des Landes bildet. Man hält die
Tiere wenn möglich auf einem großen eingefriedeten, mit
Luzerne besäeten Feld und über läßt sie sich
selbst, wendet aber auch vielfach künstliche Brut an und
rühmt die größere Zähmbarkeit der auf diese
Weise erhaltenen Tiere, welche sich auch außerhalb der
Umzäunung auf die Weide treiben lassen. Von acht zu acht
Monaten schneidet man die wertvollen Federn ab. Straußenjagd
wird in ganz Afrika leidenschaftlich betrieben. Man ermüdet
das Tier und erlegt es schließlich durch einen heftigen
Streich auf den Kopf; in den Euphratsteppen erschießt man den
brütenden Vogel auf dem Nest, erwartet, im Sand vergraben, das
andre Tier und erlegt auch dieses. Am Kap ist die
Straußenjagd seit 1870 gesetzlich geregelt. Als die
schönsten Straußfedern gelten die sogen. Aleppofedern
aus der Syrischen Wüste; auf sie folgen die Berber-, Senegal-,
Nil-, Mogador-, Kap- und Jemenfedern. Zahmen Straußen
entnommene Federn sind immer weniger wert als die von wilden. Die
Eier und das Fleisch werden überall gegessen. Die Eierschalen
dienen in Süd und Mittelafrika zu Gefäßen, in den
koptischen Kirchen zur Verzierung der Lampenschnüre.
Altägyptische Wandgemälde lassen erkennen, daß der
S. im Altertum den Königen als Tribut dargebracht wurde, die
Federn dienten damals schon als Schmuck und galten als Sinnbild der
Gerechtigkeit. Bei den Assyrern war der S. wahrscheinlich ein
heiliger Vogel, die ältesten Skulpturen zeigen mit
Straußfedern verzierte Gewänder. Vielfach berichten die
Alten über Gestalt und Lebensweise des Straußes.
Heliogabal ließ einst das Gehirn von 600 Straußen
auftragen, und bei den Jagdspielen des Kaisers Gordian erschienen
300 rot gefärbte Strauße. Auch von den alten Chinesen
werden Straußeneier als Geschenk für den Kaiser
erwähnt. Die Bibel zählt den S. zu den unreinen Tieren.
Seit dem Mittelalter gelangten die Federn auch auf unsre
Märkte. Vgl. Mosenthal und Harting, Ostriches and
ostrich-farming (2. Aufl., Lond. 1879).
Strauß, 1) Friedrich, protest. Theolog, geb. 24.
Sept. 1786 zu Iserlohn, ward 1809 Pfarrer zu Ronsdorf im Herzogtum
Berg, 1814 in Elberfeld und 1822 als Hof und Domprediger und
Professor nach Berlin berufen, wo er 1836 zum Oberhofprediger und
Oberkonsistorialrat ernannt ward. Seit 1859 in den Ruhestand
versetzt, starb er 19. Juli 1863. Außer vielen
Predigtsammlungen veröffentlichte er: "Glockentöne, oder
Erinnerungen aus dem Leben eines jungen Predigers" (Elberf. 181220,
3 Bdchn.; 7. Aufl., Leipz. 1840); "Helons Wallfahrt nach Jerusalem"
(Elberf.182021,4Bde.); "Das evangelische Kirchenjahr in seinem
Zusammenhang (Berl. 1850) ; "Abendglockentöne" (das.
1868).
2) Johann, Tanzkomponist, geb. 14. März 1804 zu Wien,
wirkte als Violinist im Lannerschen Tanzorchester, bis er 1824 ein
selbständiges Orchester er richtete, mit dem er rasch die
Gunst des Publikums eroberte. Später machte er mit seinem
Orchester auch Kunstreisen und erntete allenthalben
enthusiastischen Beifall. Er starb 25. Sept. l 849 in Wien als k.
k. Hofballmusikdirektor. Die Zahl seiner Werke beläuft sich
auf 249. Eine Gesamtausgabe seiner Tänze (für Klavier, 7
Bde.) gaben Breitkopf u. Härtel heraus. - Sein Sohn Johann,
geb. 25. Okt. 1825, übernahm nach des Vaters Tode dessen
Orchester, mit dem er neue ausgedehnte Kunstreisen machte, und hat
sich ebenfalls durch zahlreiche ansprechende Tänze ("An der
schönen blauen Donau", "Künstlerleben", "Wiener Blut"
etc.) sowie neuerdings durch die Operetten: "Indigo" (1871), "Die
Fledermaus" (1874), "Cagliostro" (1875), "La Tsigane" (1877),
"Prinz Methusalem" (1877), "Das Spitzentuch der Königin"
(1881), "Der lustige Krieg" (1881), "Eine Nacht in Venedig" (1883),
"Der Zigeunerbaron" (1885) u. a. in den weitesten Kreisen bekannt
gemacht.
3) David Friedrich, der berühmte Schriftsteller, geb. 27.
Jan. 1808 zu Ludwigsburg in Württemberg, bildete sich in dem
theologischen Stift zu Tübingen, ward 1830 Vikar, 1831
Professoratsverweser am Seminar zu Maulbronn, ging aber noch ein
halbes Jahr nach Berlin, um Hegel und Schleiermacher zu hören.
1832 wurde er Repetent am theologischen Seminar zu Tübingen
und hielt zugleich philosophische Vorlesungen an der
Universität. Damals erregte er durch seine Schrift "Das Leben
Jesu, kritisch bearbeitet" (Tübing. 1835, 2 Bde.; 4. Aufl.
1840) ein fast bei spielloses Aufsehen. S. wandte in demselben das
auf dem Gebiet der Altertumswissenschaften begründete
382
Strauß (Personenname).
und bereits zur Erklärung alttestamentlicher und einzelner
neutestamentlicher Erzählungen benutzte Prinzip des Mythus
auch auf den gesamten Inhalt der evangelischen Geschichte an, in
welcher er ein Produkt des unbewußt nach Maßgabe des
alttestamentlich jüdischen Messiasbildes dichtenden
urchristlichen Gemeingeistes erkannte. Die Gegenschriften gegen
dieses Werk bilden eine eigne Litteratur, in der kaum ein
theologischer und philosophischer Name von Bedeutung fehlt. Seine
Antworten auf dieselben erschienen als "Streitschristen"
(Tübing. 1837). Für die persönlichen
Verhältnisse des Verfassers hatte die Offenheit seines
Auftretens die von ihm stets schmerzlich empfundene Folge,
daß er noch 1835 von seiner Repetentenstelle entfernt und als
Professoratsverweser nach Ludwigsburg versetzt wurde, welche Stelle
von ihm jedoch schon im folgenden Jahr mit dem Privatstand
vertauscht wurde. Früchte dieser ersten (Stuttgarter)
Muße waren die "Charakteristiken und Kritiken" (Leipz. 1839,
2. Aufl. 184) und die Abhandlung "Über Vergängliches und
Bleibendes im Christentum" (Altona 1839). Von einer
versöhnlichen Stimmung sind auch die in der 3. Auflage des
"Lebens Jesu" (1838) der positiven Theologie gemachten
Zugeständnisse eingegeben, aber schon die 4. Auflage nahm sie
sämtlich zurück. 1839 erhielt S. einen Ruf als Professor
der Dogmatik und Kirchengeschichte nach Zürich; doch erregte
diese Berufung tm Kanton so lebhaften Widerspruch, daß er
noch vor Antritt seiner Stelle mit 1000 Frank Pension in den
Ruhestand versetzt ward. 1841 verheiratete sich 5. mit der
Sängerin A. Schebest (s. d.), doch wurde die Ehe nach einigen
Jahren getrennt. Sein zweites Hauptwerk ist: "Die christliche
Glaubenslehre, in ihrer geschichtlichen Entwickelung und im Kampf
mit der modernen Wissenschaft dargestellt" (Tübing. 1840 1841,
2 Bde.), worin eine scharfe Kritik der einzelnen Dogmen in Form
einer geschichtlichen Erörterung des Entstehungs- und
Auflösungsprozesses derselben gegeben wird. Auf einige kleine
ästhetische und biographische Artikel in den "Jahrbüchern
der Gegenwart" folgte das Schriftchen "Der Romantiker auf dem Thron
der Cäsaren, oder Julian der Abtrünnige" (Mannh. 1847),
eine ironische Parallele zwischen der Restauration des Heidentums
durch Julian und der Restauration der protestantischen Orthodoxie
durch den König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen. 1848
von seiner Vaterstadt als Kandidat für das deutsche Parlament
ausgestellt, unterlag S. dem Mißtrauen, welches die
pietistische Partei unter dem Landvolk des Bezirks gegen ihn
wachrief. Die Reden, welche er teils bei dieser Gelegenheit, teils
vorher in verschiedenen Wahlversammlungen gehalten hatte,
erschienen unter dem Titel: "Sechs theologischpolitische
Volksreden" (Stuttg. 1848). Zum Abgeordneten der Stadt Ludwigsburg
für den württembergischen Landtag gewählt, zeigte S.
wider Erwarten eine konservative politische Haltung, die ihm von
seinen Wählern sogar ein Mißtrauensvotum zuzog, in
dessen Folge er im Dezember 1848 sein Mandat niederlegte. Seiner
spätern, teils in Heidelberg, München und Darmstadt,
teils in Heilbronn und Ludwigsburg verbrachten Muße
entstammten die durch Gediegenheit der Forschung und schöne
Darstellung ausgezeichneten biographischen Arbeiten: "Schubarts
Leben in seinen Briefen" (Berl. 1849, 2 Bde.); "Christian
Märklin, ein Lebens und Charakterbild aus der Gegenwart"
(Mannh. 1851); "Leben und Schriften des Nikodemus Frischlin"
(Frankf. 1855); "Ulrich von Hutten (Leipz. 858; 4. Aufl., Bonn
1878), nebst der Übersetzung von dessen "Gesprächen"
(Leipz. 1860); "Herm. Samuel Reimarus" (das. 1862); "Voltaire,
sechs Vorträge" (das. 1870; 4. Aufl., Bonn 1877); ferner
"Kleine Schriften biographischen, litteratur- und
kunstgeschichtlichen Inhalts" (Leipz. 1862; neue Folge, Berl.
1866), woraus "Klopstocks Jugendgeschichte etc." (Bonn 1878) und
der Vortrag "Lessings Nathan der Weise" (3. Aufl., das. 1877)
besonders erschienen. Eine neue, "für das Volk bearbeitete"
Ausgabe seines "Lebens Jesu" (Leipz. 1864; 5. Aufl., Bonn 1889)
ward in mehrere europäische Sprachen übersetzt. Einen
Teil der hierauf gegen ihn erneuten Angriffe wies er in der gegen
Schenkel und Hengsten berg gerichteten Schrift zurück: "Die
Halben und die Ganzen" (Berl.1865), wozu noch gehört: "Der
Christus des Glaubens und der Jesus der Geschichte, eine Kritik des
Schleiermacherschen Lebens Jesu" (das. 1865). Noch einmal, kurz vor
seinem 8. Febr. 1874 zu Ludwigsburg erfolgten Tod, erregte S.
allgemeines Aufsehen durch seine Schrift "Der alte und der neue
Glaube, ein Bekenntnis" (Leipz.1872; 11.Aufl., Bonn 1881), in
welcher er mit dem Christentum definitiv brach, alle gemachten
Zugeständnisse zurücknahm und einen positiven Aufbau der
Weltanschauung auf Grundlage der neuesten, materialistisch und
monistisch gerichteten Naturforschung unternahm. S.' "Gesammelte
Schriften" hat Zeller herausgegeben (Bonn 187678, 11 Bde.; dazu als
Bd. 12: "Poetisches Gedenkbuch", Gedichte). Vgl. Hausrath, D. F. S.
und die Theologie seiner Zeit (Heidelb. 187678, 2 Bde.); Zeller,
S., nach seiner Persönlichkeit und seinen Schriften
geschildert (Bonn 1874).
4) (S. und Torney) Viktor von, Schriftsteller, geb. 18. Sept.
1809 zu Bückeburg, studierte zuerst in Bonn und Göttingen
die Rechte, sodann Theologie, um in die kirchlichen Kämpfe der
Gegenwart, in denen er durchaus auf seiten der Orthodoxie stand,
besser gerüstet eingreifen zu können, und wurde 1840 zum
Archivrat in Bückeburg ernannt. Schon seine ersten Dichtungen:
"Gedichte" (Bielef. 1841), "Lieder aus der Gemeine" (Hamb. 1843),
die Epen: "Richard" (Bielef. 1841) und "Robert der Teufel"
(Heidelb. 1854), erwiesen neben echt poetischem Talent und einer
seltenen Formbegabung die Entschiedenheit seines
religiös-konservativen Standpunktes. 1848 zum Kabinettsrat des
regierenden Fürsten von Schaumburg-Lippe, später auch zum
Bundestagsgesandten ernannt, fand er auch auf politischem Feld
vielfach Gelegenheit, diese konservativen Anschauungen zu
bethätigen. 1866 mit dem Rang eines Wirklichen Geheimen Rats
aus seiner amtlich en Stellung ausgeschieden, lebte er zuerst in
Erlangen, seit 1872 in Dresden, eine vielseitige litterarische
Thätigkeit entwickelnd. Bereits 1851 in den
österreichischen Adelstand erhoben, fügte er später
seinem Namen auch den seiner Gattin, einer gebornen von Torney,
bei; 1882 ernannte ihn die Universität Leipzig zum Doktor der
Theologie. Es erschienen von ihm noch: "Lebensfragen in sieben
Erzählungen" (Heidelb. 1846, 3Bde.); die dramatischen
Dichtungen: "Gudrun" und "Polyxena" (beide Frankf. 1851) und "Judas
Ischariot" (Heidelb. 1855); "Weltliches und Geistliches in
Gedichten und Liedern" (das. 1856); der Roman "Altenberg" (Leipz.
1866, 4 Bde.); "Novellen" (das.1872, 3 Bde.); die epische Dichtung
"Reinwart Löwenkind" (Gotha 1874); "Lebensführungen",
Novellen (Heidelberg 1881, 2 Bde.), und "Die Schule des Lebens",
drei Novellen (das. 1885). Aus seinem Studium de Chinesischen
gingen ein Werk über Laotse" (Leipz. 1870) und eine
meisterhafte Übertragung des älte-
383
Sträußchen - Streckbarkeit.
sten chinesischen Liederbuchs, des "Schiking" (Heidelb. 1880),
hervor, mit der er den Geist der ältern chinesischen Kultur,
soweit er sich poetisch geoffenbart, vollständig
erschloß. Von seinen sonstigen Schriften sind zu
erwähnen die Biographie des Polycarpus (Heidelb. 1860);
"Meditationen über das erste Gebot" (Leipz. 1866); "Essays zur
allgemeinen Religionswissenschaft" (Heidelb. 1879) und "Der
altägyptische Götterglaube" (das. 1888, Bd. 1).
5) Friedrich Adolf, Sohn von S. 1), ebenfalls Theolog, geb.
1.Juni 1817 zu Elberfeld, wurde Hilfsprediger an der Hof- und
Domkirche und, nachdem er das Morgenland bereist hatte, 1847
Divisionsprediger und 1859 Professor in Berlin, seit 1870
Hofprediger zu Potsdam und starb daselbst 16. April 1888. Er
schrieb unter anderm: "Sinai und Golgatha. Reise ins Morgenland"
(Berl. 1846; 11. Aufl. 1882); "Die Länder und Stätten der
Heiligen Schrift" (mit seinem Bruder Otto S., Stuttg. 1861 ; 2.
Aufl., Leipz. 1876) ; "Liturgische Andachten" (1850; 4. Aufl.,
Berl. 1886) und "Trost am Sterbelager" (2. Aufl., das. 1874).
Sträußchen (der Bienen), s.
Büschelkrankheit.
Straußelster, s. Würger.
Straußgras, s. Agrostis.
Straußhyazinthe, s. Muscari.
Straußvögel (Ratitae, hierzu Tafel
"Straußvögel", auch Kurzflügler [Brevipennes] oder
Laufvögel [Cursores]), eine der Hauptgruppen der Vögel,
in erster Linie durch den Bau ihres Brustbeins charakterisiert, das
nicht, wie bei allen andern Vögeln, einen hohen Knochenkamm
zum Ansatz der Flugmuskeln besitzt, sondern flach bleibt. Die
Flügel sind mehr oder weniger verkümmert und können
höchstens zur Beschleunigung des Laufs dienen. Der ganze
Knochenbau weicht ferner in manchen Punkten wesentlich von dem der
übrigen, d. h. der fliegenden, Vögel ab: so sind die
Knochen nicht hohl und mit Luft erfüllt, sondern fest und
schwer (namentlich sind die Hinterbeine sehr massiv); so bleiben
die Schädelknochen in der Jugend noch lange Zeit voneinander
getrennt; so verwachsen die einzelnen Teile des
Schultergürtels zu einem einzigen Knochen; so sind die
Schlüsselbeine rückgebildet etc. Der Oberarm ist entweder
lang, wie bei den Straußen im engern Sinn, oder sehr kurz
oder ganz und gar verkümmert. Die Zahl der Zehen wechselt
zwischen zwei und vier und gibt ein gutes Unterscheidungsmerkmal
für die Unterabteilnngen der S. ab. Der Schnabel ist stets
flach, meist auch kurz. Die Zunge ist sehr klein. Ein Kropf fehlt
meistens; der Magen ist außerordentlich muskulös und
derb ("Straußenmagen"); die Gallenblase fehlt bei einigen
Formen. Der untere Kehlkopf ist nirgends vorhanden. Auch die
Bürzeldrüse fehlt. Im männlichen Geschlecht sind die
Begattungsorgane zum Teil sehr gut entwickelt (s. Vögel). Das
Gefieder entbehrt durchaus der Schwung- und Steuerfedern; die
Federn selbst unterscheiden sich von den gewöhnlichen
Vogelfedern dadurch, daß die Strahlen nicht
zusammenhängen, sondern lockere Büschel bilden, und sind
daher weich und wie Flaumfedern anzufühlen. An den
Konturfedern sind bisweilen ein oder zwei Afterschäfte von
gleicher Größe mit dem Hauptschaft vorhanden. Manche
Stellen am Kopf, Hals und an der Brust bleiben ganz nackt. Die S.
sind meist ansehnliche Vögel und haben namentlich unter den
Fossilen riesige Vertreter. In der Schnelligkeit des Laufs
übertreffen einige von ihnen sogar die besten Renner unter den
Säugetieren. Sie be-wohnen meist die Steppen und Ebenen der
Tropen und nähren sich von Vegetabilien; vielfach lebt ein
Männchen mit mehreren Weibchen zusammen. Die zuweilen sehr
großen Eier werden vorzugsweise vom Männchen
bebrütet. In der Gegenwart fehlen die S. in Europa, waren
jedoch einst vorhanden, wie die Funde in England darthun. Ihre
Existenz in den frühern Epochen der Erdgeschichte war so lange
möglich, wie noch nicht die großen Raubtiere aufgetreten
waren; zur Zeit ist die Gruppe im Aussterben begriffen und hat
sogar in historischer Zeit sich wesentlich vermindert (s. unten).
Sie umfaßt nur noch 5 Gattungen mit 20 Arten, zu denen noch 5
Gattungen und 14 Arten jüngst ausgestorbener hinzukommen. Als
schwimmender Strauß ist der neuerdings in der Kreide von
Kansas aufgefundene Hesperornis zu betrachten, dessen Schnabel aber
mit Zähnen besetzt war; er leitet zu den Reptilien über
(s. Vögel). Abgesehen von ihm teilt man die S. in 6
Familien:
1) Äpyornithiden (Aepyornithidae) mit der Gattung Aepyornis
(3 Arten). Bewohnten Madagaskar, wo man im Alluvium Teile des
Skeletts und die enormen Eier (achtmal größer als
Straußeneier) gefunden hat. A. maximus ist vielleicht der
Vogel Rok der Sage.
2) Palapterygiden (Palapterygidae) mit 2 Gattungen und 4 Arten.
Füße dreizehig, Flügel sehr verkümmert. Lebten
auf Neuseeland.
3) Moas oder Dinornithiden (Dinornithidae) mit 2 Gattungen und 7
Arten. Füße zweizehig, Flügel fehlten
wahrscheinlich ganz. Lebten auf Neuseeland zum Teil noch mit
Menschen zusammen und leben in kleinern Arten dort vielleicht auch
jetzt noch. Hierher Dinornis giganteus oder Moa (s. d.).
4) Kiwis oder Schnepfenstrauße (Apterygidae). Schnabel
sehr lang, Nasenlöcher an seiner Spitze, Flügel und
Schwanz nicht hervortretend, Beine sehr stark, Füße
vierzehig. Hierher die Gattung Apteryx (Kiwi, s. d.) mit 4 Arten,
sämtlich von Neuseeland.
5) Kasuare (Casuaridae). Schnabel ziemlich lang, hoch, Schwanz
nicht hervortretend, Hals kurz, Füße dreizehig. Hierher
die Gattungen Casuarius (Kasuar, s. d., 9 Arten, Australien und
benachbarte Inseln) und Dromaeus (Emu, s. d., 2 Arten,
Australien).
6) Strauße (Struthionidae). Schnabel breit, flach, Hals
und Läufe sehr lang, Flügel zum Teil verkümmert,
Füße drei- oder zweizehig. Hierher die Gattungen Rhea
(amerikanischer oder dreizehiger Strauß, oder Nandu, 3 Arten,
Südamerika) und Struthio (afrikanischer oder zweizehiger
Strauß, s. Strauß, 2 Arten, Afrika, Arabien,
Syrien).
Strazze (v. ital. stracciafoglio) , s. v. w. Kladde (s.
d.); Strazzen, s. v. w. Lumpen oder Hadern.
Streatham (spr. stréttam), Vorstadt von London, 10
km im SSW. der Londonbrücke, hoch gelegen, mit chemischen
Fabriken, dem von Johnson besuchten Thrale House und (1881) 21,611
Einw.
Streator (spr. strihtór), Stadt im nordamerikan.
Staat Illinois, am Vermilion River, 130 km südwestlich von
Chicago, Hauptknotenpunkt von Eisenbahnen, mit (1880) 5157
Einw.
Strebe, im Bergbau Grubenholz, welches zur
Unterstützung des Gesteins oder der Zimmerung in geneigter
Stellung eingetrieben wird.
Strebebau, s. Bergbau, S. 725.
Strebebogen, in der got. Baukunst an Kirchen ein von dem
obern Teil der Mauer des Mittelschiffs zur Sicherung derselben
über das Dach des Seitenschiffs bis zum äußern
Strebepfeiler hinübergeschlagener Bogen (s. Tafel "Dom zu
Köln II", Fig. 4 u. 8). Die Strebepfeiler sind viereckig aus
den Mauern hervortretende Stützen, welche ein Gegengewicht
gegen den Gewölbeschub des Innern bilden sollen, meist durch
Absätze gegliedert und von Fialen gekrönt sind. Vgl.
Baustil, S. 527.
Strebepfeiler, s. Strebebogen und Pfeiler.
Streckbarkeit, s. Dehnbarkeit.
Straußvögel.
Strauß (Struthio camelus). 1/16. (Art. Strauß.)
Nandu (Rhea amcricana). 1/10. (Art. Nandu.)
Helmkasuar (Casuarius galeatus). 1/8. (Art. Kasuar.)
Kiwi (Apteryx australis). 1/20 (Art. Kiwi.)
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl.
Bibliographisches Institut in Leipzig.
Zum Artikel »Straußvögel
384
Streckbett - Streichen der Schichten.
Streckbett, orthopädische Vorrichtung, besteht in
einer Bettstelle mit Matratze, woran sich Apparate befinden, durch
welche der verkrümmte Körper mittels Zugs (an Kopf, Hals,
Becken, Füßen), auch wohl mittels Drucks (z. B. von der
Seite her), eine Zeitlang in der Richtung erhalten wird, die er
behufs der Beseitigung gewisser Krümmungen oder Streckung
gewisser verkürzter Muskeln oder Sehnen etc. einnehmen soll.
In der neuern Chirurgie bedient man sich der Streckbetten nur in
frischen und subakuten Fällen, namentlich bei Beinbrüchen
der untern Extremität, Entzündungen der Gelenke,
Resektionen etc., hier aber mit dem segensreichsten und
eklatantesten Erfolg. Für veraltete Fälle,
Verkrümmungen der Wirbelsäule und des Brustkorbs ist man
von dem Gebrauch der Streckbetten fast ganz
zurückgekommen.
Strecke, ein Grubenbau innerhalb der Lagerstätten,
deshalb (zum Unterschied von Stollen und Schacht) fast immer ohne
Mundloch über Tage, in seiner Längsrichtung wesentlich
horizontal, in der Regel von andern Grubenbauen aus angelegt. In
der Jägersprache heißt S. das nach beendeter Jagd in
Reihen zusammengelegte Wild, das bei großen Jagden nach
Wildart, Geschlecht und Stärke geordnet und dann von dem
Jagdherrn und den Gästen besichtigt wird, wobei die
verschiedene Totsignale geblasen werden. Nach altem Brauch darf
niemand über das gestreckte Wild wegschreiten. Zur S. bringen,
s. v. w. ein Wild erlegen.
Strecker, Adolf, Chemiker, geb. 21. Okt. 1812 zu
Darmstadt, studierte in Gießen Chemie und Naturwissenschaft,
wurde 1842 Lehrer an der Realschule in Darmstadt, 1846
Privatassistent Liebigs in Gießen und habilitierte sich 1848
an der dortigen Universität als Privatdozent. 1851 folgte er
einem Ruf an die Universität Christiania, wurde 1860 Professor
der Chemie in Tübingen und 1870 in Würzburg, wo er 9.
Nov. 1871 starb. Er lieferte eine vielbenutzte Bearbeitung von
Regnaults "Lehrbuch der Chemie" (Braunschw. 1851, nach seinem Tod
fortgeführt von Wislicenus) und schrieb: "Das chemische
Laboratorium der Universität Christiania" (Christ. 1854);
"Theorien und Experimente zur Bestimmung der Atomgewichte"
(Braunschw. 1859).
Streckfuß, 1) Adolf Friedrich Karl, Dichter und
Übersetzer, geb. 20. Sept. 1778 zu Gera, studierte in Leipzig
die Rechte, ward 1819 Oberregierungsrat zu Berlin, 1840 Mitglied
des Staatsrats und starb daselbst 26. Juli 1844. S. hat sich
namentlich durch seine Übersetzungen von Ariostos "Rasendem
Roland" (Halle 1818-20, 5 Bde.; 2. Aufl. 1840), von Tassos
"Befreitem Jerusalem" (Leipz. 1822, 2 Bde.; 4. Aufl. 1847) und
Dantes "Göttlicher Ko-mödie" (Halle 1824-26, 3 Bde. ; 9.
Aufl. 1871) einen Platz in der deutschen Litteratur erworben. Seine
eignen Werke bestehen in lyrischen und epischen Dichtungen
("Gedichte", neue Ausg., Leipz. 1823; "Neuere Dichtungen", Halle
1834) sowie in Erzählungen (Dresd. 1814 u. Berl. 1830).
2) Adolf, Schriftsteller, Sohn des vorigen, geb. 10. Mai 1823 zu
Berlin, studierte, nachdem er die Landwirtschaft praktisch erlernt,
1845-48 auf der landwirtschaftlichen Akademie zu Möglin und
Eldena, wurde 1848 beim Ausbruch der Revolution in Berlin in die
demokratische Bewegung gerissen und war für dieselbe auch
schriftstellerisch thätig. In den folgenden Reaktionsjahren
wurde er wegen des Werkes "Die große französische
Revolution und die Schreckensherrschaft" (Berl. 1851, 2 Tle.) in
den Anklagestand versetzt, indessen vom Schwurgericht
freigesprochen; doch unterblieb die Vollendung des Werkes. S.
ergriff nun die gewerbliche Thätigkeit und kehrte erst beim
Regierungsantritt des Prinz-Regenten zur Schriftstellerei
zurück, daneben sich vorzugsweise dauernd dem Kommunaldienst
seiner Vaterstadt widmend. 1862 wurde er zum Stadtverordneten, 1872
zum Stadtrat ernannt. Von seinen Schriften sind, abgesehen von
zahlreichen Romanen und Erzählungen ("Die von Hohenwald",
1877; "Schloß Wolfsburg", 1879, etc.), zu erwähnen: "Vom
Fischerdorf zur Weltstadt. 500 Jahre Berliner Geschichte" (4.
Aufl., Berl. 1885, 4 Bde.); "Berlin im 19. Jahrhundert" (das.
1867-69, 4 Bde.) und "Die Weltgeschichte, dem Volk erzählt"
(das. 1865 bis 1867).
Streckmaschiue (Streckwerk, Strecke), in der Spinnerei
eine Vorrichtung zum Parallellegen der Fasern und zum Ausstrecken
der Lagen zu Bändern mit Hilfe von Streckwalzen (s. Spinnen,
S. 149); in der Appretur eine Vorrichtung zum Strecken der Gewebe
in die Breite, um die Einschlagfäden in gerade Richtung zu
bringen.
Streckmuskeln (Extensoren), die Antagonisten der Flexoren
(Beugemuskeln), die durch ihre Zusammenziehung bewirken, daß
das vorher gebeugte Glied gestreckt wird.
Streckverse (Polymeter), bei Jean Paul Fr. Richter
Bezeichnung für kurze Sätze oder Aphorismen, welche in
einer Art rhythmischer Prosa und meist in überschwenglicher
Form poetischen Empfindungen Ausdruck geben. Auch W. Menzel
veröffentlichte einen Band "Streckverse" (Heidelb. 1823).
Streckwalzen, Streckwerk, s. Streckmaschine.
Street (engl., spr. striht), Straße.
Strehla, Stadt in der sächs. Kreishauptmannschaft
Leipzig, Amtshauptmannschaft Oschatz, an der Elbe, hat eine evang.
Kirche, ein altes Schloß, Fabrikation von Leim und
künstlichem Dünger, Schiffahrt, Kohlenhandel und (1885)
2173 Einw.
Strehlen, 1) Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk
Breslau, an der Ohlau, Knotenpunkt der Li-nien Breslau
-Mittelwalde, S.-Nimptsch und S.-Grottkau der Preußischen
Staatsbahn, hat 2 evangelische, eine altlutherische, eine
reformierte und eine kath. Kirche, ein Gymnasium, ein Amtsgericht,
eine Zuckerfabrik, einen großen Steinbruch, Ziegelbrennerei,
lebhafte Getreide-, Woll- und Viehmärkte und (1885) mit der
Garnison (2 Eskadrons Husaren Nr. 4) 8854 meist evang. Einwohner.
Dabei das jetzt in S. einverleibte Dorf Woiselwitz, bekannt durch
den beabsichtigten Verrat des Barons Warkotsch an Friedrich d. Gr.
Vgl. Görlich, Geschichte der Stadt S. (Bresl. 1853). -
2) Dorf in der sächs. Kreishauptmannschaft Dresden,
Amtshauptmannschaft Dresden-Altstadt, 3 km südöstlich von
Dresden, mit dem es durch Pferdebahn verbunden ist, hat eine
königliche Villa, eine Dampfmahlmühle, Ziegelbrennerei
und (1885) 2106 Einw.
Strehlenau, s. Niembsch von Strehlenau.
Strehlitz, Stadt, s. Großstrehlitz.
Streichbrett, s. Pflug, S. 973.
Streichen, seemännisch das Gegenteil von
heißen (s. d.), also herunterziehen, z. B. die Segel oder die
Flagge. Wenn zu den Zeiten der Segelschiffahrt ein Schiff, das
verfolgt wurde, seine Segel strich, so gab es sich damit verloren;
daher figürlich die Segel s., s. v. w. sich ergeben.
Streichen der Schichten, die Richtung, in welcher sich
eine Gesteinsschicht oder ein Gang horizontal weiter erstreckt
(streicht). Sie wird durch den Winkel
385
Streichendes Feld - Streiter.
bestimmt, welchen eine in der Schichtungsfläche oder in der
Grenzfläche des Ganges gedachte Horizontallinie (Streichlinie)
mit der Magnetnadel bildet. Die Streichlinie steht senkrecht zur
Falllinie (s. Fallen der Schichten), und durch gleichzeitige Angabe
des Streichens und Fallens ist die Schicht oder der Gang im Raum
vollständig orientiert. Der Winkel gegen die Nordsüdlinie
wird entweder (neuerdings häufiger) in Graden angegeben oder
(früher ausschließlich) in Stunden (horae), indem man
sich den Limbus des Kompasses in zweimal 12 oder auch in 24 Stunden
(à 15°) und diese in Achtelstunden (à 1° 52'
30'', den Einheiten mißbräuchlich als Dezimalstellen
angefügt) geteilt denkt. Eine Schicht, welche hora 6 (oder
hora 18 zu 6) streicht, wird sich hiernach in westöstlicher
Richtung horizontal weiter erstrecken und gegen S. oder N.
einfallen. Horizontale (söhlige) Schichten streichen nach
allen Richtungen gleichzeitig.
Streichendes Feld, s. Gestrecktes Feld.
Streichinstrumente. Die heute allein in der europäischen
Kunstmusik gebräuchlichen S.: Violine, Bratsche,
Violoncello und Kontrabaß sind das Schlußergebnis einer
vielleicht tausendjährigen langsamen Entwickelung; sie sind
sämtlich nach demselben Prinzip gebaut, wie schon ein
flüchtiger Blick auf ihre äußern Umrisse lehrt.
Diese der Bildung eines edlen, vollen Tons günstigste Bauart
wurde etwa zu Ende des 15. Jahrh. zunächst für die
Violine gefunden und allmählich auf die größern
Arten der S. übertragen, so daß Cello, Bratsche und
Kontrabaß erheblich später die ältern S., welche
Violen hießen (Viola da braccio, Viola da gamba und Violone),
verdrängten (vgl. Viola und Violine). Wie alt die S. sind, ist
nicht recht festzustellen; noch ist kein Denkmal aus
vorchristlicher Zeit aufgefunden, welches die Abbildung eines
Streichinstruments aufweist. Nach gewöhnlicher Annahme ist der
Orient die Wiege der S.; doch ist dieselbe schlecht genug
begründet, nämlich damit, daß die arabischen
Musikschriftsteller des 14. Jahrh. die S. Rebab oder Erbeb und
Kemantsche kennen. Obgleich nichts auf eine wesentlich frühere
Existenz dieser Instrumente bei ihnen hinweist, hat man doch daraus
geschlossen, daß das Abendland sie von den Arabern nach der
Eroberung Spaniens erhalten habe, während auf der andern Seite
eine große Zahl Beweise vorhanden sind, daß seit dem 9.
Jahrh., wo nicht länger, das Abendland Instrumente dieser Art
kannte. Es genüge hier, darauf hinzudeuten, daß die
älteste Abbildung eines Streichinstruments (in Gerberts "De
musica sacra" wiedergegeben), eine einsaitige "Lyra" , die dem 8.
oder 9. Jahrh. angehört, eine der spätern Gigue sehr
ähnliche Gestalt aufweist, daß wir aus dem 10. Jahrh.
eine Abbildung der keltischen Chrotta (s. d.) haben, und daß
bereits im 11.-12. Jahrh. mancherlei verschiedene Formen der S.
nebeneinander bestanden. Es hielten sich jahrhundertelang
nebeneinander zwei prinzipiell verschiedene Formen der S., von
denen die (vermutlich minder alte) mit plattem Schallkasten aus der
Chrotta hervorging, die andre mit mandolinförmig
gewölbtem Bauch aber (die altdeutsche Fidula) wahrscheinlich
germanischen Ursprungs ist. Auch das frühere Vorkommen der
Drehleier deutet auf einen abendländischen Ursprung der S. Die
ältesten S. hatten keine Bünde; diese tauchen erst zu
einer Zeit auf, wo die nachweislich von den Arabern importierte
Laute anfing, sich im Abendland auszubreiten, d. h. im 14. Jahrh.,
und um dieselbe Zeit tauchen auch allerlei andre Wandlungen im
Äußern der S. auf (große Saitenzahl, die Rose),
welche den Einfluß der Laute verraten. Im 15.-16. Jahrh.
finden wir zahlreiche verschiedene Arten großer und kleiner
Geigen nebeneinander, die dann sämtlich von den
Violineninstrumenten verdrängt wurden. Zur Erklärung der
so verschiedenartigen äußern Umrisse der S. älterer
Zeit sei noch darauf hingewiesen, daß für diejenigen,
welche eine größere Saitenzahl (über 3) und
demzufolge einen höher gewölbten Steg hatten, die
Seitenausschnitte nötig wurden, und man ging in der
Vergrößerung der letztern so weit, daß
schließlich Instrumente zu Tage kamen, deren
Schallkörper beinahe die Gestalt eines x hatte. Für die
Instrumente mit höchstens 3 Saiten bedurfte es der
Saitenausschnitte nicht, u. sie behielten daher auch ihren
birnenförmigen Schallkasten noch lange Zeit (s. Gigue).
Streichmaß (Streichmodel), s.
Parallelreißer.
Streichorchester, s. Orchester.
Streichquartett, das Ensemble von 2 Violinen, Bratsche
und Violoncello sowie eine Komposition für diese Instrumente
(s. Quartett).
Streichquintett, das Ensemble von 2 Violinen, 2 Bratschen
und Cello oder 2 Violinen, Bratsche und 2 Celli, auch wohl von 2
Violinen, Bratsche, Cello und Kontrabaß, selten von 3
Violinen, Bratsche und Cello oder andre Zusammenstellungen. In
ähnlicher Weise sind auch Streichsextette, Septette etc. in
verschiedenartiger Zusammenstellung möglich.
Streichschalen, s. Schleifsteine.
Streichwolle, s. Wolle.
Streifen, in der Jägersprache s. v. w.
Abstreifen.
Streifenbarbe, s. Seebarbe.
Streifenfarn, s. Asplenium.
Streifenruderschlange, s. Wasserschlangen.
Streifkorps, s. v. w. Fliegendes Korps (s. d. und
Freikorps).
Streifzug, s. Raid.
Streik (engl. strike, "Schlag, Streich", franz.
Grève, daher in Belgien Grevist, der Anteilnehmer am S.), s.
Arbeitseinstellung.
Streitaxt, Hieb- und Wurfwaffe, bei den Römern als
securis gebräuchlich, im Mittelalter aus einem
beilförmigen Eisen auf der einen und einer Art Hammer auf der
andern Seite bestehend, zwischen denen oft noch eine gerade, zum
Zustoßen geeignete Spitze in der Stielrichtung hervorragte.
Die S. war auf einem kurzen Stiel befestigt und bis zum 16. Jahrh.,
bei den Kaukasusvölkern bis in die neueste Zeit,
gebräuchlich (s. Fig. 1 u. 2). Über prähistorische
Streitäxte s. Metallzeit und Steinzeit.
Streitbefestigung, s. Litiskontestation.
Streitberg, Dorf im bayr. Regierungsbezirk Oberfranken,
Bezirksamt Ebermannstadt, 483 m ü. M. an der forellenreichen
Wiesent, in der sogen. Fränkischen Schweiz, hat eine protest.
Kirche, Burgruinen, ein Mineralbad nebst Molkenkuranstalt und
(1885) 283 Einw. In der Nähe ein gelber Marmorbruch.
Streiter, Joseph, Schriftsteller, geb. 8. Juli 1804 zu
Bozen, studierte in Innsbruck die Rechte, ward Rechtsanwalt in
Cavalese, dann in Bozen, 1861
386
Streitgedichte - Strelitz.
Bürgermeister daselbst, 1866 Abgeordneter der Bozener
Handelskammer im Landtag, legte 1871 sein Amt nieder und starb 17.
Juli 1873 auf Payersberg bei Bozen. Er schrieb: "Jesuiten in Tirol"
(Heidelb. 1845); "Die Revolution in Tirol" (Innsbr. 1851); "Studien
eines Tirolers" (Berl. 1862); "Blätter aus Tirol" (Wien 1868);
auch mehrere Dichtungen, wie: "Heinrich IV.", Tragödie (1844),
"Der Assessor", Lustspiel (1858), u. a. Nicht bloß als
Abgeordneter und Bürgermeister, sondern auch als
Schriftsteller bekämpfte er mutig den mächtigen
Klerus.
Streitgedichte, eine Art altdeutscher Dichtungen, worin
die Vorzüge verschiedener Gegenstände voreinander oder
die Erwägung, was an einem Gegenstand das Bessere sei, als
Streit unter Personifikationen dargestellt wurde. Die frühste
Veranlagung dazu haben wohl die uralten, schon in der frühern
lateinischen Poesie des Mittelalters vorkommenden allegorischen
Sommer- und Winterstreite gegeben; seit dem Ende des 13. Jahrh.
werden dergleichen Dichtungen sehr häufig und finden sich
unter dem Namen "Kampfgespräche" noch bei Hans Sachs. Auch der
"Wartburgkrieg" (s. d.) ist hierher zu rechnen.
Streitgenossen (Litiskonsorten), im bürgerlichen
Rechtsstreit die in einer Parteirolle vereinigten Personen, sei es
als Kläger (Mitkläger), sei es als Beklagte
(Mitbeklagte). Ob eine solche Streitgenossenschaft
(Litiskonsortium) eintreten soll oder nicht, das hängt in der
Regel von der freien Entschließung der Klagpartei ab. Ich
kann z. B. die Erben meines verstorbenen Schuldners wegen meiner
Forderung einzeln verklagen, oder ich kann diese Forderung in einer
und derselben Klage gegen die sämtlichen Erben verfolgen.
Besteht in Ansehung des Streitgegenstandes eine Rechtsgemeinschaft,
oder sind mehrere Personen aus demselben tatsächlichen und
rechtlichen Grund berechtigt oder verpflichtet, so können
dieselben eben gemeinschaftlich klagen oder verklagt werden; ja,
dies kann nach der deutschen Zivil-Prozeßordnung auch schon
dann geschehen, wenn gleichartige und auf einem im wesentlichen
gleichartigen tatsächlichen und rechtlichen Grund beruhende
Ansprüche oder Verpflichtungen den Gegenstand des
Rechtsstreits bilden. Die Zivilprozeßordnung kennt aber auch
eine notwendige Streitgenossenschaft, welche dann eintritt, wenn
das streitige Rechtsverhältnis allen S. gegenüber nur
einheitlich festgestellt, oder wenn nach bestehender
Rechtsvorschrift ein Rechtsanspruch nur von mehreren zusammen oder
gegen mehrere zusammen wirksam geltend gemacht werden kann. Dies
ist z. B. nach preußischem Recht bei Grundstücken der
Fall, welche im Miteigentum von mehreren Personen stehen. Das Recht
zur Betreibung des Prozesses steht aber auch im Fall einer
notwendigen Streitgenossenschaft jedem Streitgenossen zu; er
muß aber, wenn er den Gegner zu einem Termin ladet, auch die
übrigen S. laden. Vgl. Deutsche Zivilprozeßordnung,
§ 56 ff., 95, 434; v. Amelunxen, Die sogen. notwendige
Streitgenossenschaft der deutschen Zivilprozeßordnung (Mannh.
1881).
Streithammer, Hammer mit Schaft, als Waffe schon im
Altertum gebräuchlich, im Mittelalter aus einem
stählernen Hammer mit gegenüberstehender scharfer,
rückwärts gebogener Spitze und kurzer Stoßklinge am
vordern Ende bestehend (s. Figur). Er wurde vom Fußvolk auf
langem Schaft, von Reitern an kurzem Stiel, am Sattel hängend,
geführt.
Streitkolben, aus der Keule hervorgegangene Schlagwaffe,
meist eiserner Stiel mit Handgriff und schwerem Knopf am andern
Ende. Letzterer erhielt geeignete Formen zum Durchbohren der
Panzer. Der S. wurde meist von Reitern bis ins 16. Jahrh.
geführt; vgl. Morgenstern.
Streitkolbenbaum, s. Casuarina.
Streitverkündigung (Litisdenunziation), im
bürgerlichen Rechtsstreit die von seiten einer Partei an einen
Dritten ergehende Aufforderung, ihm in dem Prozeß zur Seite
zu treten und zum Sieg zu verhelfen. Die betreffende Partei wird
Streitverkünder (Litisdenunziant) genannt, die dritte Person
ist der Litisdenunziat. Eine S. erfolgt dann, wenn eine Partei
für den Fall des Unterliegens im Prozeß einen
Rückanspruch gegen den Litisdenunziaten zu haben glaubt. Ich
habe z. B. eine Ware gekauft, und diese Ware macht mir jemand im
Weg der Klage streitig. Ich kann alsdann meinem Verkäufer den
Streit verkünden, weil ich im Fall meiner Verurteilung zur
Herausgabe der Sache einen Ersatzanspruch an den Verkäufer
habe. Außerdem kann eine S. aber auch in dem Fall erfolgen,
daß die Hauptpartei den Anspruch eines Dritten (des
Litisdenunziaten) besorgt. Der Kommissionär kann z. B.
für Rechnung des Kommittenten einen Prozeß führen.
Verliert er denselben, so kann unter Umständen der Kommittent
mit einem Schadenersatzanspruch hervortreten. Der Kommissionär
wird daher gutthun, dem Kommittenten von dem Rechtsstreit
Mitteilung zu machen, um ihn zur Teilnahme an demselben zu
veranlassen. Die S. erfolgt nach der deutschen
Zivilprozeßordnung durch die Zustellung eines Schriftsatzes,
in welchem der Grund der S. und die Lage des Rechtsstreits
anzugeben sind. Abschrift des Schriftsatzes ist dem Gegner
mitzuteilen. Tritt der Dritte dem Streitverkünder bei, so wird
er dessen Nebenintervenient (s. Intervention, S. 1005); lehnt er
den Beitritt ab, oder erklärt er sich nicht, so wird der
Rechtsstreit ohne Rücksicht auf ihn fortgesetzt. Vgl. Deutsche
Zivilprozeßordnung, § 69 ff.; Kipp, Die
Litisdenunziation im römischen Zivilprozeß (Leipz.
1887).
Streitwagen dienten entweder dazu, die Streiter im
Gefecht schneller fortzuschaffen, worauf diese beim
Zusammenstoß mit dem Feind vom Wagen herab kämpften oder
auch zu diesem Zweck abstiegen, oder sie sollten durch ihren
Einbruch den Feind selbst schädigen, wie die Sichelwagen (s.
d.). Die S., von einem Wagenführer gelenkt, von einem, auch
mehreren Kämpfenden besetzt, finden sich namentlich beiden
Griechen (s. Figur) in ihrer Heldenzeit und ersetzten die Reiterei.
Im Mittelalter waren die S. stark bemannt und dienten den
Armbrustschützen auch wohl gleichzeitig als Verschanzung, wie
bei den Hussiten und Vlämen im 14. Jahrh., die ihre
Walkerkarren (ribeaudequins) sogar mit Geschützen
besetzten.
Strelitz, Herzogtum (auch Herrschaft Stargard genannt),
einer der beiden Bestandteile des Groß-Herzogtums
Mecklenburg-Strelitz, östlich von Meck-
[Luzerner Streithamm er (14. Jahrh.).]
[Griechischer Streitwagen.]
387
Strelitzen - Stricken.
lenburg-Schwerin gelegen und außerdem von Brandenburg und
Pommern umschlossen, 2548 qkm (46,28 QM.) groß mit 82,288
Einw. Darin die Stadt S. (Altstrelitz), südlich bei
Neustrelitz (s. d.) und an der Linie Berlin-Stralsund der
Preußischen Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, ein altes
Schloß (jetzt Straf- und Irrenanstalt), ein Amtsgericht,
Leder- und Tabaksfabrikation, starken Pferdehandel und (1885) 3096
Einw.
Strelitzen (russ. Strjelzi, "Schützen"), russische
Leibwache, ward vom Zaren Iwan Wasiljewitsch dem Schrecklichen in
der Mitte des 16. Jahrh. errichtet und machte, zuweilen 40-50,000
Mann stark, die ganze Infanterie Rußlands aus. Mit ihnen
erkämpften jener Zar und dessen Nachfolger die großen
Siege, die Rußlands Macht gründeten. Sie waren aber eine
wilde, zuchtlose Soldateska, achteten weder Gesetze noch Disziplin
und empörten sich bei dem geringsten Anlaß. 1682
rebellierten sie und übten bei dem Thronwechsel nach dem Tode
des Zaren Feodor eine Zeitlang einen politischen Einfluß.
Peter d. Gr. suchte daher die Macht der S. nach und nach zu
schwächen, indem er ihnen ein Vorrecht nach dem andern entzog,
bis er es ohne Gefahr unternehmen durfte, sie ganz aufzulösen.
Zur Beobachtung Polens an die litauische Grenze postiert,
empörten sie sich im Sommer 1698, wurden aber in einer offenen
Feldschlacht von dem General Gordon geschlagen. Nahezu 2000 der
Rebellen wurden gefangen genommen und mit beispielloser Grausamkeit
gefoltert und hingerichtet. Die Regimenter der S. wurden
aufgelöst. Die Reste derselben nahmen noch wiederholt an den
folgenden Rebellionen während der Regierung Peters d. Gr.
teil.
Strelna, kaiserliches Lustschloß im russ.
Gouvernement St. Petersburg, mit schönem Park, nach dem Muster
des Versailler Schlosses 1711 von Peter I. angelegt, liegt an der
Baltischen Bahn, 9,5 km von Peterhof am hohen Ufer des Finnischen
Meerbusens, hat in den zwei dazu gehörigen Dörfern
Farmen, Schulen, eine Papierfabrik und 1350 Einw.
Strelno (Strzelno), Kreisstadt im preuß.
Regierungsbezirk Bromberg, an der Linie Mogilno-S. der
Preußischen Staatsbahn, hat eine evangelische und eine kath.
Kirche, eine Synagoge, ein Amtsgericht und (1885) 4332 meist kath.
Einwohner.
Stremayr, Karl, Edler von, österreich. Minister,
geb. 30. Okt. 1823 zu Graz, studierte daselbst die Rechte, trat bei
der k. k. Kammerprokuratur in den praktischen Staatsdienst, war
1848-49 Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung, ward dann
Supplent des römischen Rechts an der Universität und
Staatsanwaltssubstitut in Graz, 1868 von Giskra als Ministerialrat
in das Ministerium des Innern berufen und war dreimal, vom 1. Febr.
bis 12. April 1870, vom Mai 1870 bis 7. Febr. 1871 und seit 25.
Nov. 1871 bis 15. Febr. 1879, Unterrichtsminister. Er führte
die Aufhebung des Konkordats durch und brachte die neuen
Unterrichts- und Kirchengesetze im Reichsrat zustande, verstand es
aber dennoch, mit dem katholischen Klerus ein gutes Verhältnis
aufrecht zu erhalten. Nach dem Rücktritt des Ministeriums
Auersperg übernahm S. 15. Febr. 1879 zunächst den Vorsitz
des Ministerrats und ging im August 1879 als Justizminister mit
einstweiliger Verwaltung des Unterrichtsministeriums in das
Taaffesche Kabinett über, nahm aber 1880 seine Entlassung und
schied aus dem politischen Leben. Er ward zum zweiten
Präsidenten des obersten Gerichtshofs und 1. Jan. 1889 zum
Mitglied des Herrenhauses ernannt.
Stremma, neugriech. Flächenmaß, = 1000 qm.
Strenae (lat.), bei den alten Römern Geschenke, die
man sich zu Anfang des neuen Jahrs mit Glückwünschen zu
übersenden pflegte, bestanden in Lorbeer- und Palmenzweigen,
Süßigkeiten und Früchten, die wie bei uns mit
Goldschaum überzogen wurden. Eine letzte Spur derselben hat
sich in den französischen Étrennes (s. d.) erhalten.
Der Name S. hängt mit der alten sabinischen Segensgöttin
Strenia zusammen, welcher die römische Salus entsprach.
Strenger Arrest, s. Arrest.
Strenglot, s. Lot, S. 920.
Strengnäs, alte Stadt im schwed. Län
Södermanland, am Mälar, ist seit dem Brand von 1871 neu
aufgebaut, hat eine in ihrem Kern aus dem 13. Jahrh. stammende
Domkirche mit den Grabmälern Karls IX. u. a., eine gute
bischöfliche Bibliothek und (1885) 1614 Einw. S. steht mit
Stockholm in regelmäßiger Dampferverbindung. Seit dem
Anfang des 12. Jahrh. ist es Bischofsitz.
Strenuität(lat.), Hurtigkeit, Betriebsamkeit.
Strepitoso (ital.), lärmend, rauschend.
Strepsiceros, s. Antilopen, S. 639.
Strepsiptera, s. Fächerflügler.
Stretford, Stadt in Lancashire (England), 3 km
südwestlich von Manchester, hat Baumwollfabriken,
Schweineschlächtereien und (1881) 19,018 Einw.
Stretto (ital., "gedrängt"), in der Musik
Bezeichnung für die Engführungen in der Fuge; auch eine
längere, lebhafter vorzutragende Schlußpassage, wie sie
häufig am Ende von Konzertsätzen auftritt, desgleichen
ein schnell bewegter Satz am Ende des Opernfinales etc. heißt
S. (Stretta).
Streu (Stallmist), s. Dünger, S. 219 f.
Streu, rechtsseitiger Nebenfluß der
Fränkischen Saale im bayr. Regierungsbezirk Unterfranken,
entspringt auf der Hohen Rhön und mündet bei
Heustreu.
Streublau, s. Schmalte.
Streukügelchen, kleine Kügelchen von Zucker,
deren sich die Homöopathie zur Verabreichung der kleinsten
Dosen ihrer Arzneien bedient.
Streupulver, s. Lycopodium.
Streuzucker, s. Dragée.
Strich, deutsche Bezeichnung für Millimeter.
Strichfarn, s. Asplenium.
Strichprobe, s. Goldlegierungen.
Strick, in der Jägersprache 2-3 zusammengekoppelte
Wind- oder Hatzhunde.
Stricken, die Herstellung von Maschen mit Hilfe eines
Fadens und zweier Nadeln. Als Material gebraucht man Seide, Wolle
oder Baumwolle. Die Nadeln werden aus Stahl, Holz oder Knochen
angefertigt, sind 20-50 cm lang, von oben bis unten gleich stark
und an den Enden etwas zugespitzt. Wenn man nur mit zwei Nadeln
strickt, so sind diese an einem Ende mit einem Knopfe versehen,
damit die Maschen nicht abgleiten können. Auf die eine Nadel
werden durch Knüpfen Maschen aufgelegt; diese Nadel nimmt man
in die linke Hand und legt den an der letzten Masche hängenden
Faden über den Zeigefinger um die andern Finger; mit der von
der rechnen Hand gehaltenen zweiten Nadel sticht man in die erste
Masche, faßt mit der Nadel den straff angezogenen Faden,
zieht ihn durch die Masche hindurch und läßt diese von
der Nadel heruntergleiten. Dadurch, daß der Faden ohne
Unterbrechung fortläuft, sind alle Maschen miteinander
verbunden. Man unterscheidet Rechts- oder Glatt- und Linksstricken.
Beim Rechtsstricken sticht man von vorn in die Masche und zieht den
Faden von hinten nach vorn durch, beim Linksstricken ist es
umgekehrt. Ist die Strickarbeit lappen-
388
Stricker - Strickmaschine.
oder streifenartig, so bedient man sich zweier Nadeln und wendet
jedesmal am Ende der Nadel das Strickzeug um. Will man ein Rund
stricken, so braucht man fünf Nadeln. Auf vier verteilt man
die Maschen, mit der fünften strickt man. Der Faden wird ohne
Unterbrechung von der letzten Masche einer Nadel durch die erste
der nächsten gezogen. Durch die Abwechselung von Rechts- und
Linksstricken, Ab- und Zunehmen, Verschränken u. andre Arten
von Maschenbilden kann man verschiedene Muster in die Strickerei
bringen. Strickarbeiten werden zu fast allen Kleidungsstücken
verwendet (Strümpfe, Röcke, Jacken, Hauben etc.). In
neuerer Zeit werden Strickereien vielfach durch Maschinen
hergestellt (s. Strickmaschine). Das S. soll bereits im 13. Jahrh.
in Italien bekannt gewesen, nach andern aber erst im 16. Jahrh. in
Spanien erfunden worden sein. Von hier gelangte es nach England u.
Schottland, u. 1564 wird William Rider als erster Strumpfstricker
in England genannt. Um dieselbe Zeit gab es in Deutschland
Hosenstricker, und noch lange wurde das S. von Männern
ausgeübt. Vgl. Heine, Schule des Strickens (Leipz. 1879);
Hillardt, Das S. (3. Aufl., Wien 1887).
Stricker (der Strickäre), mittelhochd. Dichter, von dessen
Lebensverhältnissen nur bekannt ist, daß er in
Österreich um 1240 lebte. Er verfaßte einen "Daniel von
Blumenthal" (noch ungedruckt), eine Bearbeitung des "Rolandslieds"
(hrsg. von Bartsch, Quedlinb. 1857), kleine Erzählungen,
Gleichnisse, Fabeln, die man damals unter dem Namen Beispiele
zusammenfaßte (mehrere hrsg. von Hahn, das. 1839), und
besonders die Schwanksammlung "Der Pfaffe Amis", die älteste
derartiger Dichtungen, deren Inhalt die Schwänke und
Gaunerstreiche eines geistlichen Herrn, des Amis, bilden (hrsg. von
Benecke in den "Beiträgen zur Kenntnis der altdeutschen
Sprache etc.", Götting. 1810-32, 2 Bde.; neuerdings von
Lambelin "Erzählungen und Schwänke", 2. Aufl., Leipz.
1883; deutsch von Pannier, das. 1878). Vgl. Jensen, Über den
S. als Bispeldichter (Marb. 1886).
Strickland, 1) Agnes, engl. Geschichtschreiberin, geboren
um 1808 zu Rorydonhall in Suffolkshire, schrieb teilweise unter
Mitwirkung ihrer Schwester Jane S. unter anderm: "Historic scenes"
(neue Aufl., Lond. 1852); "Lives of the queens of England from the
Norman conquest" (das. 1840-49, 12 Bde.; neue Ausg., das. 1864, 6
Bde.; in verkürzter Fassung, das. 1867); "Letters of Mary,
queen of Scots" (das. 1843, 3 Bde.); "Lives of the queens of
Scotland and English princesses connected with the royal succession
of Great Britain" (das. 1850-59, 8 Bde.); "Lives of the bachelor
kings of England" (das. 1861); "Life of the seven bishops committed
to the Tower in 1688" (das. 1866). Ihre Arbeiten zeichnen sich
durch fleißiges Quellenstudium, übersichtliche Anordnung
des Materials und anziehende Darstellung aus. S. erhielt 1871 auf
Gladstones Antrag eine Pension aus der Staatskasse, starb aber
schon 8. Juli 1874. Ihr Leben beschrieb ihre Schwester Jane S.
(Lond. 1887).
2) Hugh Edwin, Geolog, geb. 2. März 1811 zu Righton in
Yorkshire, studierte zu Oxford, begleitete 1835 den Obersten
Hamilton auf dessen Reise in den Orient und veröffentlichte
als Frucht dieser Reise: "Bibliographia zoologiae et geologiae"
(Lond. 1847-54) und "The Dodo and its kindred" (das. 1848).
Später unterstützte er als Professor der Geologie in
Oxford Murchison in den Vorarbeiten zu dem "Siluriansystem". Er
starb 14. Sept. 1853. Vgl.Jardine, Memoirs and letters of H. E. S.
(Lond. 1858).
Strickmaschine. Das Stricken bezweckt die Bildung eines
Maschengebildes in der Weise, daß stets der Faden als
Schleife durch eine bereits vorhandene Masche hindurchgezogen wird,
während beim Wirken umgekehrt der Faden erst zur Schleife
gebogen und die vorhandene Masche über diese Schleife
ge-schoben wird. Demnach ist das Werkzeug (Nadel) der S. auch so
konstruiert, daß es durch eine Masche hindurchgeht, einen
Faden greift und beim Durchziehen durch die Masche in eine solche
umbildet. Den Vorgang und die Nadeleinrichtung zeigen Fig. 2-6. Die
Nadel g besitzt einen Haken a und unter diesem eine Klappe b,
welche sich mit a zu einer Öse schließen, übrigens
auch ganz zurückfallen kann. In jeder Masche befindet sich
eine solche Nadel, welche in einem Nadelblatt (Fig. 1) nur eine
Vertikalbewegung durch Führung in einer Nute erhält,
durch den Stab c am Herausfallen verhindert und durch den
verstellbaren Anschlag d in der Bewegung begrenzt wird. Eine Reihe
von Nadeln sind nun (Fig. 1) parallel nebeneinander so angeordnet,
daß sie mit den Köpfen g vortreten, und über das
Nadelbrett läßt sich an einem Schlitten ein sogen.
Schloß hin und her bewegen, dessen Hauptteile aus dem
dreieckigen Nadelheber e und den beiden Nadelsenkern ff bestehen.
Diese drei Stücke bilden eine hinauf und wieder hinab gehende
Rinne, welche beim Hin- und Hergehen des Schlosses die aus den
Nuten hervorsehenden Nadelköpfchen g aufnimmt und, an ihnen
anfassend, die Nadeln hinauf und wieder hinab schiebt. Ein sich mit
dem Schloß zusammen bewegender Fadenführer legt in den
Haken der Nadel, wenn diese in der höchsten Stelle steht, den
zu verstrickenden Faden ein. Die schon auf der Nadel befindliche
Masche hebt beim Sinken der Nadel die Klappe b und schließt
mit ihr den Haken zu einer Öse, über die sie dann bei der
tiefsten Nadelstellung selbst von der Nadel abrutscht (Fig. 3 u.
4). Der im Haken befindliche Faden bildet beim Wiederaufsteigen der
Nadel (Fig. 5) die neue Masche, durch welche die . Klappe b
zurückgeschlagen wird. In der höchsten Stel-
Fig. 1-6. Strickmaschine (Nadelbewegung).
389
Stricknadeln - Strikt.
lung hat die Klappe die Masche vollständig passiert, und
nachdem neuer Faden gefaßt ist, wiederholt sich der Vorgang,
sobald die betreffende Nadel von dem an dem Nadelbett entlang
gehenden Schloß erfaßt wird. Bei der von Bickford in
New York gebauten Maschine stehen die Nadeln im Kreis herum in
einem cylindrischen Nadelbett, und das Schloß wird im Kreis
um sie her bewegt (Rundstuhl). Es können auf solcher Maschine
schlauchförmige Sachen gestrickt werden, deren Maschenzahl im
Durchmesser gleich der Nadelzahl der Maschine ist. Mehr Maschen
nebeneinander, als Nadeln vorhanden sind, können auf keiner
Maschine gestrickt werden; weniger Maschen geben aber auf der
Bickford-Maschine stets nur ein plattes, nie ein rund geschlossenes
Stück. Lamb in Chicopee Falls (Massachusetts) stellte zuerst
zwei Nadelreihen, welche schräg stehen, in zwei ebenen Betten
versetzt, einander gegenüber. Strickt hier ein Schloß
auf dem einen Bett hingehend, so strickt ein andres auf dem zweiten
Nadelbett beim Zurückgehen, und da nur ein Fadenführer
mit Fadenspanner beiden Schlössern folgt, so geht der Faden
von einer Nadelreihe auf die andre über und strickt so
geschlossen rund, auch dann, wenn an einem oder beiden Enden beider
Betten eine Anzahl nebeneinander liegender Nadeln außer
Thätigkeit gestellt ist. Fig. 6 zeigt eine Nadel in
Ruhestellung; das Köpfchen g kann von dem darüber
hinweggehenden Nadelheber nicht mehr gefaßt werden. Jede
beliebige Maschenzahl ist so bei geschlossenem Rundstricken
möglich. Legt man die Masche der letzten arbeitenden Nadel
beider Reihen mit auf die neben ihr arbeitende Nadel und stellt sie
selbst in Ruhe, so nimmt die Maschine ab. Bei geeigneter
Wiederholung kann man so einen Strumpf bis zur letzten Masche
zustricken. Ähnlich läßt sich ein Zunehmen
bewerkstelligen. Durch gewisse Vorkehrungen werden auch die Hacken
in Strümpfe gestrickt, ohne daß eine
vervollständigende Naht nachher nötig ist. Besondere
Mechanismen ermöglichen, die Nadelsenker ff nach Bedarf derart
verschieden zu stellen, daß sie die Nadeln weniger oder mehr
in die Nuten hinabziehen, wobei festere oder losere Maschen
entstehen; auch kann man jeden Nadelsenker sowie die Nadelheber
ganz außer Thätigkeit stellen. Bei letztern thut dies
die Maschine, wenn sie dazu eingestellt ist, selbstthätig je
nach der Bewegungsrichtung des Schlosses. Läßt man in
geeigneter Weise beide Nadelreihen in einer Bewegungsrichtung
zusammenwirken, so kann man rechts und links platt gestrickte Waren
erhalten. Mittels Ausladens gewisser Nadeln, Verstellens der
Nadelbetten gegeneinander und variierten Ein- und Abstellens der
Nadelheber können die mannigfaltigsten Muster erzielt werden,
die durch Aufeinanderfolgenlassen verschieden gefärbter Garne
noch zu vermehren sind. Die Lambsche Maschine hat eine hohe
Vollkommenheit erreicht, so daß geübte Arbeiter damit an
einem Arbeitstag 8 Paar lange Frauenstrümpfe und bis 20 Paar
Männersocken vollenden können (s. Wirkerei).
Stricknadeln, s. Nadeln, S. 974.
Stricto jure (lat.), nach strengem Recht. Stricto sensu,
im strengen Sinn.
Stride (engl., spr. streid', "weiter Schritt"), Ausgriff
eines Pferdes, besonders bei Rennpferden die Weite des
Galoppsprungs, die Räumigkeit der Bewegung; ein Pferd mit
gutem S. deckt mit jedem Sprung viel Terrain.
Stridor (lat.), das zischende, pfeifende
Atmungsgeräusch, welches bei Kehlkopfverengerung entsteht.
Stridores (Schwirrvögel), s. Kolibris.
Stridulantia (Singzirpen), Familie aus der Ordnung der
Halbflügler, s. Cikaden.
Striegau, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk
Breslau, am Striegauer Wasser (Nebenfluß der Weistritz),
Knotenpunkt der Linien Kamenz-Raudten und S.-Bolkenhain der
Preußischen Staatsbahn, hat eine evangelische und eine
große gotische kath. Kirche, ein Progymnasium, eine
Strafanstalt (im ehemaligen Karmeliterkloster), ein Amtsgericht,
bedeutende Granit- und Basaltbrüche, Granitschleiferei,
Buchbinderwaren-, Zigarren-, Bürsten-, Peitschen-, Stuhl-,
Leder- und Zuckerfabriken und (1885) 11,784 meist evang. Einwohner.
Nahebei die bis 355 m hohen Striegauer Berge mit hübschen
Anlagen. S. erhielt 1242 deutsches Stadtrecht. Nach S. wird auch
die Schlacht bei dem 7 km entfernten Hohenfriedeberg (s. d.)
benannt.
Striefen, Dorf in der sächs. Kreis- und
Amtshauptmannschaft Dresden, östlich von Dresden, hat
bedeutende Kunst- und Handelsgärtnerei, Bierbrauerei und
(1885) 8011 Einw.
Strigel, 1) Bernhard, Maler, der früher sogen.
Meister der Sammlung Hirscher, geboren um 1460 zu Memmingen,
bildete sich nach Zeitblom und Burgkmair, war zumeist in seiner
Vaterstadt, zeitweilig auch in Wien thätig, wo er von Kaiser
Maximilian geadelt wurde und das Vorrecht erhielt, den Kaiser
allein porträtieren zu dürfen, und starb 1528 in
Memmingen. Er hat sowohl Bildnisse, unter denen das
Familienporträt des Kaisers Maximilian in der kaiserlichen
Galerie zu Wien und das des kaiserlichen Rats Cuspinian im Berliner
Museum hervorzuheben sind, als Kirchenbilder gemalt, welche sich in
Berlin (Museum), München (Pinakothek und Nationalmuseum),
Nürnberg (Moritzkapelle) und Donaueschingen befinden. Vgl.
Bode im "Jahrbuch der königlich preußischen
Kunstsammlungen", Bd. 2 (Berl. 1881).
2) Viktorin, namhafter luther. Theolog, geb. 1514 zu Kaufbeuren,
bildete sich in Wittenberg unter Melanchthons Leitung und wurde
1548 als Professor der Theologie zu Jena angestellt. Hier in den
synergistischen Streit verwickelt, ward er 1559 vier Monate lang in
Haft gehalten, ging 1562 als Professor nach Leipzig und von da nach
Wittenberg, endlich 1567 nach Heidelberg, wo er zum Calvinismus
übergetreten sein soll und 26. Juni 1569 starb. Sein Hauptwerk
sind die "Loci theologici" (Neust. a. d. H. 1581-84, 4 Bde.). Vgl.
Otto, De Victorino Strigelio (Jena 1843).
Strigen (Striges), nach dem Volksglauben der Alten
vogelähnliche Unholdinnen, welche in der Nacht unheimlich
umherschwirren und den Kindern in der Wiege das Blut aussaugen
etc.
Strigiceps, s. Weihen.
Strigidae (Eulen), Familie aus der Ordnung der
Raubvögel, s. Eulen, S. 905.
Strij (spr. strei), Abraham van, holländ. Maler,
geb. 1753 zu Dordrecht, malte Genrebilder aus dem häuslichen
Leben in der Art von Metsu, aber auch Porträte, Landschaften
und Viehstücke im Geschmack von A. Cuijp. Er stiftete 1774 die
Gesellschaft Pictura in Dordrecht und starb 1826 daselbst. - Sein
Bruder Jacob van S. (1756-1815) schloß sich in Landschaften
und Tierstücken so eng an A. Cuijp an, daß seine Bilder
oft mit denen seines Vorbildes verwechselt werden. Es sollen auch
einige derselben zum Zweck der Täuschung mit dem Namen von
Cuijp bezeichnet worden sein.
Strike (engl., spr. steik), s. Streik.
Strikt (lat.), genau, streng, pünktlich.
390
Striktur - Stringocephalenkalk.
Striktur (lat.), die auf einzelne Stellen
beschränkte und unnachgiebige organische Verengerung eines mit
einer Schleimhaut ausgekleideten Kanals. Solche Strikturen kommen
vor an der Speiseröhre, am Magen und Darm, in den
Thränenkanälen, in der Luftröhre, in der
Harnröhre u. a. O. Sie entstehen entweder dadurch, daß
die Schleimhaut des betreffenden Kanals an einer mehr oder weniger
umschriebenen Stelle nach vorangegangener Verschwärung in ein
festes Narbengewebe umgewandelt wird, welches sich zusammenzieht,
schrumpft und nun wie ein fester um den Kanal herumgelegter Ring
diesen bleibend zusammenschnürt; oder sie beruhen auf der
Einlagerung von Krebsmasse in das Schleimhautgewebe, wodurch sich
dieses beträchtlich verdickt, unnachgiebig wird und den Kanal
auf verschieden große Strecken verengert. Die Strikturen der
Speiseröhre beruhen meist auf Krebseinlagerung, seltener auf
Narbenbildung infolge von Verbrennungen oder Einführung von
ätzenden und scharfen Substanzen (Vergiftung mit
Schwefelsäure, Ätzkali). Die Strikturen des Magens sind
bedingt entweder durch Magenkrebs oder durch die sich stark
zusammenziehenden Narben, welche nach einem Magengeschwür
zurückbleiben. Ähnliches gilt von den Strikturen des
Darms, welche außerdem auch noch infolge der
Verschwärung der Schleimhaut beim Ruhrprozeß entstehen
können. Die Strikturen der Harnröhre, welche
überwiegend beim männlichen Geschlecht vorkommen, sind
fast immer die Folge einer Tripperentzündung. Die Folgen der
Strikturen bestehen darin, daß der betreffende Kanal mehr
oder weniger unwegsam wird, daß die Massen, welche durch den
Kanal hindurchgehen sollen, an der S. aufgehalten und unter
Umständen in umgekehrter Richtung wieder entleert werden.
Daher ist bei der S. der Speiseröhre das Schlingen erschwert,
die Speisen werden meist sofort wieder ausgewürgt. Bei
Strikturen des Magens wird der Speisebrei, welcher nicht in den
Zwölffingerdarm gelangen kann, durch Erbrechen wieder nach
außen entleert. Bei Strikturen des Darms treten
Stuhlverhaltung, einfaches oder Kotbrechen, bei Strikturen der
Harnröhre erschwertes Harnen, Ablenkung des dünnen
Harnstrahls, tropfenweises Abgehen des Urins etc. ein.
Natürlich werden in allen diesen Fällen auch noch
subjektive Symptome der S. vorhanden sein, wie Schmerz, Gefühl
von Druck in der betreffenden Gegend etc. Die Behandlung der
Strikturen kann nur da eine direkte sein, wo wir sie mit unsern
mechanischen Hilfsmitteln erreichen können, wie in der
Speiseröhre, der Harnröhre und im Mastdarm, während
die Strikturen des Magens und Darms an sich keiner Behandlung
zugänglich sind. Krebsige Strikturen geben unter allen
Umständen eine schlechte Prognose, die narbigen Strikturen im
allgemeinen eine bessere; doch sind auch sie sehr schwierig und oft
nur unvollkommen zu beseitigen. Der hierzu eingeschlagene Weg
besteht darin, daß man durch Einführung von glatten
cylinderförmigen Körpern den verengerten Kanal
allmählich zu erweitern sucht, indem man Cylinder von immer
zunehmender Dicke anwendet. Bei Strikturen der Speiseröhre
verwendet man hierzu die sogen. Schlundsonde, beim Mastdarm die
sogen. Mastdarmbougies, bei Strikturen der Harnröhre starre
oder elastische Sonden und Bougies aus verschiedenen Substanzen.
Erreicht man hiermit den beabsichtigten Zweck nicht, und ruft die
S. eine gefährliche Harnverhaltung hervor, so muß man
dem Harn auf operativem Weg Abfluß verschaffen, entweder
durch den Blasenstich oder durch den Harnröhrenschnitt (hinter
der S.). Der künstliche Abweg für den Harn muß so
lange offen gehalten werden, bis es gelungen ist, von vorn oder von
hinten her der S. beizukommen und den normalen Weg für den
Harn wieder zu eröffnen. Die neuere Chirurgie beginnt auch die
Strikturen der Thränengänge und der Luftröhre mit
Erfolg zu behandeln. Vgl. die Schriften von Dittel (Stuttg. 1880),
Thompson (deutsch von Casper, Münch. 1888), Distin-Maddick
(deutsch, Tübing. 1889).
Strindberg, August, schwed. Schriftsteller, geb. 22. Jan.
1849 zu Stockholm, ist einer der talentvollsten Vertreter der
jüngsten Dichterschule in Schweden, welche der Richtung G.
Brandes' (s. d.) folgt. Er trat bereits 1872 mit einem Drama:
"Master Olof", hervor, das, besonders in einer spätern
Umarbeitung (1878), von bedeutender Wirkung war, erregte aber erst
mit seinem Roman "Röda rummet" (1879) die allgemeinste
Aufmerksamkeit. S. bezeichnet das Buch als "Schilderungen aus dem
Schriftsteller- und Künstlerleben" und geißelt darin mit
überlegener Satire die konventionellen gesellschaftlichen und
staatlichen Verkehrtheiten. Noch schonungsloser thut er dies in
"Det nya riket" (1882), welches seitens der reaktionären
Presse einen wahren Sturm von Angriffen gegen den Verfasser
hervorrief, welche diesen veranlagten, ins Ausland zu gehen.
Seitdem lebt er abwechselnd in Frankreich, Italien und der Schweiz.
Im J. 1883 erschienen, in demselben Geist gehalten: "Svenska
öden och äfventyr" (3 Bde.) und "Dikter p°a vers och
prosa", 1884 eine Sammlung kleinerer Abhandlungen unter dem Titel:
"Likt och olikt", ein Gedichtcyklus: "Sömngangarnätter",
und eine Novellensammlung: "Giftas" (letztere auch französisch
u. d. T.: "Les mariés"). Wegen einiger Auslassungen
über das Sakrament des Altars wurde "Giftas" konfisziert und
gegen den Verleger Anklage wegen Beschimpfung kirchlicher
Einrichtungen erhoben, worauf S. von Genf, wo er eben wohnte, nach
Stockholm reiste und dort vor Gericht seine Verteidigung so
glänzend führte, daß er gegen alle Erwartung von
den Geschwornen freigesprochen wurde. In "Giftas" behandelt S. das
Verhältnis zwischen Mann und Frau vom Standpunkt des Russen
Tschernyschewsky (s. d.) aus; noch mehr aber tritt seine
Verwandtschaft mit diesem in dem folgenden Werk: "Utopier i
verkligheten" (1885), hervor, worin er in novellistischer Form
"verwirklichte Utopien" schildert und auf diesem Weg den Nachweis
zu liefern sucht, daß eine Lösung der Arbeiterfrage im
Sinn des Sozialismus ersprießlich und möglich sei. Von
sonstigen Werken Strindbergs sind zu nennen die Schauspiele.
"Gillets hemlighet" (1880), "Herr Bengts hustru" (1882) und
"Lycko-Pers resa" (1882), seine kulturhistorischen Arbeiten:
"Svenska folket i helg och söken" (1882) und "Gamla Stockholm"
(im Verein mit Claes Lundin, 1882); ferner: "Svenska
berättelser" (1883); "Tjensteqvinnans son" (1886);
"Hemsöborna" (1887); "Skärkarlslif" (1888); "Fröken
Julie" etc. Durch seinen Kampf gegen die übertriebene
Frauenvergötterung, welche in der schwedischen Litteratur
durch Ibsens "Dukkehjem" angebahnt wurde, hat sich S. in den
letzten Jahren viele Feinde erworben, besonders unter den
jüngern Vertretern der Frauenemanzipation.
Stringéndo (ital., spr. strindsch-), musikal.
Vortragsbezeichnung, s. v. w. immer schneller, bis zur
nächsten Tempobezeichnung.
Stringieren (lat.), eng zusammenziehen, genau nehmen;
streifen; stringent, zwingend, bündig.
Stringocephalenkalk, s. Devonische Formation.
391
Stringocephalus - Stroganow.
Stringocephalus, s. Brachiopoden.
Strinnholm, Andreas Magnus, schwed. Geschichtsforscher,
geb. 25. Nov. 1786 in der Provinz Westerbotten, studierte zu
Upsala, schrieb zuerst "Svenska folkets historia under konungarna
af Wasaätten" (Stockh. 1819-24, 3 Bde.), die er aber mit der
Erbvereinigung von Westeräs 1544 abbrach, und begann, nachdem
er eine Zeit hindurch am statistischen Archiv zu Stockholm
beschäftigt gewesen, 1830 eine vollständige Geschichte
Schwedens nach den Quellen zu bearbeiten, von welcher unter dem
Titel: "Svenska folkets historia fran äldsta till nuvarande
tider" (das. 1835-54; daraus einzelne Abschnitte deutsch von Frisch
u. d. T.: "Wikingszüge, Staatsverfassung und Sitten der alten
Skandinavier", Hamb. 1839-41, 2 Bde.) 5 Bände erschienen,
welche bis 1519 reichen. Der erste Teil dieses Werkes ward von der
schwedischen Akademie mit dem höchsten Preis gekrönt.
Auch die kürzere "Sveriges historia i sammandrag" (Stockh.
1857-60, 3 Bde.) blieb unvollendet. S. ward 1845 Mitglied der
Akademie der Wissenschaften und starb 18. Jan. 1862 in
Stockholm.
Strix, s. Eulen, S. 907.
Strizzo (ital., Mehrzahl Strizzi), s. Louis.
Strjetensk, Stadt im sibir. Gebiet Transbaikalien,
Haupthafen am obern Amur, mit einem Hospital und verschiedenen
Faktoreien. Die Ladenbesitzer sind fast durchgängig deutsch
sprechende Juden.
Ströbeck, Pfarrdorf im preuß. Regierungsbezirk
Magdeburg, Kreis Halberstadt, hat eine evang. Kirche und (1885)
1251 Einw., die seit alter Zeit als Schachspieler in Ruf stehen.
Alljährlich bei der Osterprüfung wird in der Schule ein
Wettspiel um sechs als Prämien ausgesetzte Schachbretter
veranstaltet.
Strobel, Adam Walther, elsäss. Geschichtsforscher,
geb. 23. Febr. 1792 zu Straßburg, seit 1830 Professor am
Gymnasium daselbst, starb 28. Juli 1850. Sein Hauptwerk ist die
"Vaterländische Geschichte des Elsaß" (Straßb.
1840-49, 6 Bde.), die Heinr. Engelhardt (für die Zeit
1789-1815) vollendete. Außerdem veröffentlichte S.:
"Sebastian Brants Narrenschiff" (Quedlinb. 1839) samt dessen
kleinern Gedichten; Closeners "Straßburger Chronik" (Stuttg.
1841); "Mitteilungen aus der alten Litteratur des nördlichen
Frankreich" (Straßb. 1834); "Französische Volksdichter"
(Baden 1846); "Das Münster in Straßburg" (Straßb.
1845, 14. Aufl. 1876) u. a. Auch an dem "Code historique et
diplomatique de la ville de Strasbourg" (Straßb. 1843, 2
Bde.) nahm S. hervorragenden Anteil.
Strobilus (lat.), s. v. w. Zapfen, s. Koniferen.
Stroboskopische Scheibe, s. Phänakistoskop.
Strobus Loud., Gruppe der Gattung Pinus (s. Kiefer, S.
714).
Strodtmann, Adolf, Dichter und Schriftsteller, geb. 24.
März 1829 zu Flensburg als Sohn des auch als Dichter bekannten
Pädagogen Sigismund S. (gest. 12. Sept. 1888; "Dichtungen", 2.
Aufl., Hamb. 1888), beteiligte sich 1848 als Kieler Student an der
Erhebung seines Heimatlandes, ward in einem der ersten Gefechte
verwundet und fiel in dänische Gefangenschaft. Befreit, setzte
er seine Studien in Bonn fort, wo er zu Kinkels Schülern
gehörte, dichtete seine revolutionären "Lieder der Nacht"
(Bonn 1850) und wurde wegen des in denselben enthaltenen Gedichts
"Das Lied vom Spulen" von der Universität verwiesen. Er ging
zunächst nach Paris und London, wo er die Biographie
"Gottfried Kinkel" (Hamb. 1850, 2 Bde.) schrieb, begab sich 1852
nach Amerika, gründete eine bald wieder eingehende
Buchhandlung, lebte dann als Journalist in New York und
Philadelphia, ließ auch ein aus den Reminiszenzen der
deutschen Revolution erwachsenes Gedicht: "Lotar", erscheinen. 1856
nach Deutschland zurückgekehrt, ließ er sich in Hamburg
nieder, wo er das Bürgerrecht erwarb und eine ausgebreitete
litterarische Thätigkeit entwickelte. Der poetischen
Erzählung "Rohana, ein Liebesleben in der Wildnis" (Hamb.
1857; 2. Aufl., Berl. 1872) folgten seine "Gedichte" (Leipz. 1858,
3. Aufl. 1880), "Ein Hohes Lied der Liebe" (Hamb. 1858) und die
Zeitgedichte "Brutus, schläfst du?" (das. 1863). Gleichzeitig
widmete sich S. dem eingehenden Studium Heines, von dessen Werken
er eine Gesamtausgabe (Hamb. 1866-68, 20 Bde.) veranstaltete. Im
Zusammenhang damit stand sein biographisches Buch "Heinrich Heines
Leben und Werke" (Berl. 1869, 2 Bde.; 3. Aufl. 1884). 1870
begleitete S. als Korrespondent mehrerer großer Zeitungen die
dritte deutsche Armee auf ihrem Siegeszug nach Frankreich und
veröffentlichte aus den Eindrücken dieser Tage:
"Alldeutschland in Frankreich hinein!" (Berl. 1871). Nach dem
Feldzug ließ er sich in Steglitz bei Berlin nieder, wo er 17.
März 1879 starb. Als poetischer Übersetzer hatte er
zuerst eine Anzahl Gedichte neuerer amerikanischer Lyriker
meisterhaft übertragen; es folgten dann: "Die Arbeiterdichtung
in Frankreich" (Hamb. 1863); "Tennysons ausgewählte
Dichtungen" (Hildburgh. 1868); "Shelleys Dichtungen" (das. 1867, 2
Bde.); die "Amerikanische Anthologie" (das. 1870) sowie zahlreiche
Übersetzungen prosaischer Werke aus dem Französischen,
Dänischen und Englischen, darunter Montesquieus "Persische
Briefe" (Berl. 1866), Eliots "Daniel Deronda" (das. 1876-77),
Brandes' "Hauptströmungen der Litteratur des 19. Jahrhunderts"
(das. 1872-76, 4 Bde.), I. Simes "Lessing" (das. 1878). Auch
kritisch und litterarhistorisch vielfach thätig,
veröffentlichte er: "Das geistige Leben in Dänemark"
(Berl. 1873); "G. A. Bürgers Briefe" (das. 1874, 4 Bde.);
"Dichterprofile. Litteraturbilder aus dem 19. Jahrhundert" (Stuttg.
1878).
Stroganow, angesehene russische, jetzt gräfliche
Familie, hat zum Ahnherrn Anikij S., der zu Ende des 15. Jahrh.
große Salinen und Eisenwerke im Ural besaß, und dessen
Söhne Jakow und Grigorij sich durch Erfindungen sowie
großartige Einrichtengen im Berg- und Salzwesen bekannt
machten und sich zur Zeit Iwan Wasiljewitsch' des Schrecklichen
zwischen der Kama und nördlichen Dwina ansiedelten. Indem sie
den Kosakenhetman zum Schutz ihrer Besitzungen herbeiriefen, trugen
sie mittelbar zur Eroberung Sibiriens bei. Iwan Wasiljewitsch
verlieh den Brüdern bedeutende Vorrechte und Handelsmonopole;
dieselben brachten den ganzen Handel Sibiriens an sich und wurden
Besitzer von mehr als 100 Städten, Kolonien und
Hüttenwerken, wozu später noch Goldwäschen kamen. Im
Polenkrieg zu Anfang des 17. Jahrh. rüsteten die Stroganows
ein eignes Armeekorps aus und trugen zur Rettung Rußlands
bei, wofür sie der Zar mit der Befugnis belohnte, ihre eigne
Soldateska zu haben und freie Jurisdiktion über ihre
Untergebenen zu üben. Peter d. Gr. nahm jedoch 6. Mai 1722 den
Repräsentanten der Familie, den Brüdern Alexander,
Nikolaus und Sergei S., die sämtlichen Vorrechte ihrer Ahnen
und verlieh ihnen hierfür bloß den Baronstitel.
Gri-gorij Alexandrowitsch S., geb. 1770, russischer Diplomat und
1826 in den Grafenstand erhoben, rettete 1821 als russischer
Gesandter in Konstantinopel durch sein energisches Auftreten vielen
tausend Grie-
392
Stroh - Strohseile.
chen das Leben; starb 19. Jan. 1857. Paul Alexandrowitsch S.,
geb. 1774 in Frankreich, focht mit großer Auszeichnung in den
Napoleonischen Kriegen und leistete dem Kaiser Alexander
Diplomatendienste. 1809 nahm er teil an der Besetzung der
Alandsinseln. Hierauf war er im Türkenkrieg thätig. 1812
focht er insbesondere bei Walutina Gora und bei Borodino, weniger
erfolgreich bei Malojaroßlawez. 1814 nahm er teil an den
Schlachten bei Craonne und Laon. Der Schmerz um den Verlust seines
Sohns, welcher bei Craonne fiel, beugte ihn so sehr, daß er
auf einer Seereise 1817 starb. Der älteste Sohn des Grafen
Grigorij Alexandrowitsch, Graf Sergei, geb. 1795, General der
Kavallerie, bis 1835 Gouverneur von Riga und Minsk, dann bis 1847
Kurator des Universitätsbezirks von Moskau, erwarb sich als
Besitzer eines Teils der von seinen Vorfahren angelegten Salz- und
Hüttenwerke Verdienste um Hebung der Gewerbe, Künste und
Wissenschaften und machte sich auch als russischer Altertumskenner
bekannt. Seit 1857 Leiter der archäologischen Ausgrabungen,
welche auf Kosten des kaiserlichen Kabinetts in verschiedenen
Teilen Rußlands vorgenommen wurden, veröffentlichte er
die Resultate in den "Comptes-rendus de la commission
archeologique" 1860. Unter seiner Leitung erscheint auch ein
"Recueil d'antiquités de la Scythie" (1866 ff.). 1859 zum
Generalgouverneur von Moskau ernannt, schied er bald wieder aus
dieser Stellung und wurde Kurator des damaligen Thronfolgers
Nikolaus. Als solcher stand er dem jungen Großfürsten
bis zu dessen Tod zur Seite. Hiernächst wurde er zum
Vorsitzenden des Hauptkomitees der russischen Eisenbahnen ernannt
und starb 10. April 1882 in Petersburg. Sein Bruder, Graf
Alexander, war 1839-41 Minister des Innern, ward 1855 zum
Generalgouverneur von Neurußland und Bessarabien ernannt und
1856 mit der Wiederherstellung von Sebastopol beauftragt. Sein Sohn
Grigorij, ehemaliger Gardeoberst und seit September 1856
kaiserlicher Statthalter, war seit 1856 mit der verwitweten
Herzogin von Leuchtenberg (gest. 24. Febr. 1876) morganatisch
vermählt und starb 20. Febr. 1879.
Stroh, alle ihrer reifen Körner beraubten Halme und
Stengel von Feldfrüchten, im engern Sinne nur die des
Getreides. S. dient als Futter (chemische Zusammensetzung etc. s.
Futter) und als Einstreu, außerdem benutzt man Getreidestroh
als Brennmaterial (in Lokomotiven von besonderer Konstruktion), zum
Decken der Dächer, zu Matten, Geweben, künstlichen
Blumen, Zierarbeiten, als Packmaterial, zu Seilen, zur Darstellung
von Cellulose für Papierfabrikation etc. Besonders wichtig ist
die Strohflechterei (s. d.), welche langer, langgliederiger Halme
von gleichmäßiger Stärke bedarf. Man benutzt das S.
von Sommerweizen und Sommerroggen und baut erstern für diesen
Zweck in Italien (bei Florenz), letztern im Schwarzwald, wobei man
sehr dicht säet und zu gröbern Flechtarbeiten geeignete
Halme aus dem gemähten reifen Getreide ausliest oder zu
feinern Arbeiten das Getreide bald nach der Blüte bei
trockner, heißer Witterung schneidet. Das S. muß
schnell trocknen, eventuell unter Dach, und wird nun auf dem Rasen
gebleicht und schließlich geschwefelt.
Strohblumen, s. v. w. Immortellen (s. d.); auch
künstliche Blumen aus gehaltenem Stroh, wie sie auf
Damenhüten getragen werden.
Strohelevator (Stacker, Stackmaschine), Apparat, um das
von der Dampfdreschmaschine ausgedroschene Stroh zum Zweck der
Errichtung eines Feimens anzuheben. Der S. besitzt als
Hebevorrichtung ein endloses Kettenband, mit hervorstehenden,
gekrümmten Zähnen besetzt, welches, von der Dampfmaschine
betrieben, das aus den Strohschüttlern der Dreschmaschine in
den Elevator gelangende Stroh anhebt. Der Apparat muß nach
verschiedenen Richtungen, und um dem sich vergrößernden
Feimen folgen zu können, in der Höhe stellbar sein. In
Deutschland haben die Strohelevatoren keine ausgedehnte Verbreitung
gefunden; in England und Ungarn sind dieselben dagegen vielfach in
Anwendung.
Strohfiedel (Holzharmonika, Gigelyra, hölzernes
Gelächter), das bekannte, bei den Tiroler Sängern
beliebte Schlaginstrument, welches aus abgestimmten, mit
Klöppeln geschlagenen Holzstäben besteht, die auf einer
Strohunterlage ruhen. Wie dasselbe zum Namen "Fiedel" und
"Gigelyra" kommt, ist bisher noch nicht untersucht worden. Die S.
wird bereits in Virdungs "Musica getuscht" (1511) erwähnt.
Strohflechterei, die Kunst, aus Stroh (s. d.)
verschiedene Gegenstände, wie Hüte, Kappen,
Arbeitstaschen, Schuhe, Zigarrentaschen, feine Tressen etc., durch
Flechtarbeit herzustellen. Diese Kunst, etwa seit Anfang dieses
Jahrhunderts in Italien blühend, hat sich von dort auch
über andre Länder verbreitet. Das zur Flechtarbeit
bestimmte Stroh stammt von einer besondern Sorte Sommerweizen
(Marzolano) oder Sommerroggen (s. Stroh) und wird nach dem Bleichen
nach den Knoten in 20-24 cm lange Stücke geteilt, die man von
neuem bleicht und sehr sorgfältig sortiert. Das sehr feine
italienische Stroh wird in ungespaltenen Halmen verarbeitet und
dann flach gepreßt; das minder feine Stroh andrer Länder
wird mittels eines Werkzeugs (Strohspalter) mit sternförmig
gestellten Schneiden in 7-15 Streifen (Zähne) gespalten. Aus
11-13 solchen Streifen werden zunächst lange Tressen
geflochten, die man nach dem Waschen und Pressen mittels einer
feinen Naht zu Hüten etc. zusammenfügt. Das fertige
Stück wird abermals gewaschen, gebleicht und zuletzt
geglättet. Die feinsten Strohflechtereien liefert Toscana, von
wo auch viele Tressen und sortiertes Stroh ausgeführt werden.
In Vicenza werden ebenfalls sehr feine, bei Mantua und Lodi aber
geringere Waren hergestellt. Die Schweiz liefert den italienischen
nahekommende Tressen in Freiburg, geringere in Aarau, Glarus, Genf.
Ebenso hoch steht die Industrie in Belgien, während Frankreich
nur gröbere Landware zu erzeugen scheint. In England sind
Bedford, Hertford, Bux Hauptsitze der S. In Deutschland blüht
diese Industrie in Sachsen, im Schwarzwald, auch in den
schlesischen Webereidistrikten und vor allem in Lindenberg bei
Lindau, wo sie schon 1765 bestand. Böhmen, Tirol und Krain
liefern geringere Tressen. Die Tressen bilden überhaupt die
gewöhnliche Handelsware, welche in allen größern
Städten in den sogen. Strohhutfabriken vernäht wird.
Strohmänner nennt man bei Aktiengesellschaften
diejenigen, welche als Bevollmächtigte mit offener oder
verdeckter Vollmacht, als Borger oder Mieter von meist aus den
Depots von Bankiers entliehenen Aktien neben wirklichen
Aktionären in den Generalversammlungen der Gesellschaft
erscheinen.
Strohrost, s. Rostpilze, S. 989.
Strohschüttler, s. Dreschmaschine, S. 139.
Strohseile werden mit der Hand oder auf
Strohseilspinnmaschinen dargestellt, die eine
eigentümliche Konstruktion besitzen oder den Watermaschinen
nachgebildet sind. S. dienen in der Landwirtschaft, in der
Metallgießerei zur Kernbildung, zum Umhüllen von
Dampfleitungsröhren, als Packmaterial etc.
393
Strohstoff - Strongyliden.
Strohstoff (Strohzeug), die aus Stroh durch Kochen mit
Lauge isolierte und auf Holländern gemahlene Cellulose, welche
in der Papierfabrikation benutzt wird.
Strohwitwer (entsprechend dem englischen Grasswidow,
"Graswitwe"), der zeitweilig von der andern Hälfte verlassene
Ehegatte. Stroh steht hier für Bett, wie in der Klage Marthas
im "Faust": "Und läßt mich auf dem Stroh allein!"
Strom, s. v. w. Fluß, besonders ein
größerer, welcher sich unmittelbar ins Meer
ergießt.
Stroma, Insel im Pentland Firth (Nordküste
Schottlands), mit dem gefürchteten Swelkiestrudel.
Stromatik (griech.), Teppichwebekunst.
Strombau, s. Wasserbau.
Stromberg, Bergrücken im württemberg.
Neckarkreis, zwischen Zaber (zum Neckar) und Metter (zur Enz),
erreicht im Scheiterhäule eine Höhe von 473 m.
Stromberg, 1) Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Koblenz, Kreis Kreuznach, am Hunsrück, am Guldenbach und an
der Eisenbahn Langenlonsheim-Simmern, 195 m ü. M., hat eine
evangelische und eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, eine
Oberförsterei, Eisenhüttenwerke mit Blech- und
Gußwarenfabrikation, Kalkbrennerei und (1885) 1021 Einw.
Dabei die Burg Goldenfels und die Ruine Fustenburg. - 2) Flecken
und Wallfahrtsort im preuß. Regierungsbezirk Münster,
Kreis Beckum, hat eine kath. Kirche, eine Burgruine, eine
Bandfabrik, Steinbrüche und (1885) 1534 Einw. Dabei die
Stromberger Hügel, im Monkenberg 190 m hoch, wohin man
neuerdings die Varusschlacht verlegt.
Stromboli, s. Liparische Inseln.
Stromenge, die Stelle eines Stroms, wo das Bett durch
Felsen so verengert wird, daß dadurch das Wasser mehr Tiefe
und einen schnellen Fluß bekommt.
Stromeyerit, s. Kupfersilberglanz.
Stromkorrektion, s. Wasserbau.
Strommesser, s. Rheometer.
Strömö, Insel, s. Färöer, S. 58.
Stromprofil, rechtwinkeliger, senkrechter Querschnitt
eines Flusses oder Kanals.
Stromregulator, s. v. w. Rheostat.
Stromschicht (Zahnfries), s. Fries.
Stromschnelle, die Stelle eines Stroms, welche in einer
frühern Zeit ein Wasserfall gewesen ist, dessen
Felsfläche sich aber jetzt infolge langjähriger
erodierender Thätigkeit des Wassers der horizontalen Ebene
mehr genähert hat. Ist das Strombett, wie z. B. bei dem Nil,
ein steileres, so nennt man seine Stromschnellen Katarakte
(s.d.).
Strömstad, kleine Hafenstadt im schwed. Län
Gotenburg, am Skagerrak, 15 km von der norwegischen Grenze, in
kahler und wilder Gegend, mit Seebad und (1885) 2417 Einw.; brannte
1876 zu zwei Drittteilen nieder. S. ist Sitz eines deutschen
Konsulats.
Stromtiefenmesser, s. Rheobathometer.
Stromvermessung, s. Flußvermessung.
Stromwender (Gyrotrop, Kommutator), Vorrichtung, um den
galvanischen Strom nach Belieben umzukehren, zu schließen
oder zu öffnen. Von den zahlreichen Formen mögen die
folgenden als Beispiele dienen. Der S. von Pohl (Fig. 1) besteht
aus einem Brettchen A mit sechs Quecksilbernäpfchen b c d e f
g, von welchen d mit g und c mit f durch die Drähte h und i
verbunden sind. Die beiden dreiarmigen Metallbügel k l m und n
o p sind durch den Glasstab q zu einer Wippe vereinigt, deren
mittlere Arme l und o in die Näpfchen b und e tauchen; in
diese Näpfchen sind auch die Enden der Poldrähte der
Batterie eingesenkt, während die Enden der Leitung r, in
welcher der Strom wechseln soll, in die Näpfe f und g tauchen.
Liegt die Wippe wie in der Figur, so nimmt der Strom den Weg b l k
g r f n o e und durchfließt die Leitung r in der Richtung des
Pfeils; legt man aber die Wippe um, so daß ihre Arme m und p
resp. in die Näpfe e und d eintauchen, so macht der Strom den
Weg b l m c i f r g [h] d p o e und fließt demnach in der
Leitung r in entgegengesetzter Richtung wie vorhin. Der S. von
Ruhmkorff (Fig. 2) besteht aus einer Elfenbeinwalze c, welche mit
zwei diametral gegenüberliegenden Messingwülsten d und e
versehen ist und von der metallenen Achse a b getragen wird. Diese
Achse geht nicht durch die Walze durch, sondern besteht aus zwei
Stücken, deren vorderes a mit dem Wulst d, das hintere b mit
dem Wulst e leitend verbunden ist. Die beiden Teile der Achse
stehen durch ihre messingenen Lager mit den Klemmschrauben f und g,
welche die Poldrähte aufnehmen, in Verbindung, während
die Klemmschrauben h und i, in welche die Enden der Leitung r
geklemmt werden, auf den Messingblechstreifen k und l, die gegen
die Walze federn, leitend aufgesetzt sind. Wird die Walze mittels
des Knopfes so gedreht, daß d mit k, e mit l in
Berührung sind, so ist die Bahn des Stroms g b e l i r h k d a
f; stellt man die Walze aber so, daß d gegen l und e gegen k
federn, so kehrt sich der Strom um, indem er jetzt den Weg g b e k
h r i l d a f einschlägt. Berühren die Messingwülste
die Blechstreifen nicht, so ist der Strom unterbrochen. Vgl.
Magnetelektrische Maschinen.
Stromzölle, s. Zölle.
Strongyliden (Strongylidae), Familie der Nematoden oder
Fadenwürmer, fadenförmige Eingeweidewürmer mit
rundlichem Körper, endständiger, von Papillen umgebener,
bald enger, bald klaffender Mundöffnung und am Hinterleibsende
im Grund einer schirm- oder glockenförmigen Tasche liegender
männlicher Geschlechtsöffnung. Der Palisfadenwurm
(Eustrongylus gigas Rud.), der größte Spulwurm, ist rot,
besitzt je eine Längsreihe von Papillen auf den Seitenlinien,
sechs vorspringende Mund-
394
Strontian - Strophe.
papillen und eine weit nach vorn gerückte weibliche
Geschlechtsöffnung, lebt vereinzelt meist im Nierenbecken
verschiedener Raubtiere, besonders der Fischotter und Robben,
selten im Rind, Pferd und Menschen. Das Weibchen wird gegen 1 m
lang und etwa 12 mm dick, während das Männchen nur 1/3
dieser Länge erreicht. Über die Entwicklungsgeschichte
ist nichts Sicheres bekannt; wahrscheinlich wird der Jugendzustand
durch Fische übertragen. Mehrere Arten der Gattung Strongylus
Müll. leben in Haustieren, so S. paradoxus Mehlis in den
Bronchien des Schweins, S. filaria Rud. in den Bronchien des
Schafs, S. micrurus Mehlis in Aneurysmen der Arterien des Rindes.
Dochmius duodenalis Dub. (Ancylostomum duodenale Dub.), 10-18 mm
lang, lebt im Zwölffingerdarm und Dünndarm des Menschen,
besonders in den Nilländern, beißt mit seiner starken
Mundbewaffnung Wunden in die Darmhaut, saugt Blut aus den
Darmgefäßen und erzeugt die sogen. ägyptische
Chlorose. In der Jugend lebt dieser Wurm in andrer Form (als sogen.
Rhabditis, s. Nematoden) frei und wird erst später zum
Schmarotzer. Andre Arten leben im Hund, Schaf, Rind und in der
Katze. - Im Pferd als lästiger Parasit findet sich
Sclerostomum equinum Duj. vor. Dieser Wurm wird 20-40 mm lang, lebt
ebenfalls eine Zeitlang in Rhabditisform frei und gelangt mit dem
Wasser in den Darm des Pferdes. Von hier aus dringt er in die
Gekrösarterien, erzeugt dort Erweiterungen (Aneurysmen) und
tritt dann in den Darm zurück, um in ihm geschlechtsreif zu
werden. Nach den Untersuchungen von Bollinger ist die Kolik der
Pferde in den meisten Fällen auf Verstopfungen der Arterien
mit dem genannten Wurm zurückzuführen. - Cucullanus
elegans Zed., der Kappenwurm, lebt in Flußfischen; seine
Jugendform haust in kleinen Wasserflöhen (Cyklopiden). Das
Weibchen wird etwa 10, das Männchen nur 5 mm lang.
Strontian (Strontianerde, Strontiumoxyd) SrO entsteht bei
heftigem Glühen von salpetersaurem S. als graue, poröse,
unschmelzbare Masse, welche sich wie Baryumoxyd verhält und
mit Wasser farbloses Strontiumhydroxyd (Strontiumoxydhydrat,
Strontianhydrat) SrOH2O bildet. Dies kristallisiert aus
wässeriger Lösung mit 8 Mol. Kristallwasser, reagiert
stark alkalisch, wirkt ätzend, zieht begierig Kohlensäure
an und bildet mit Säuren die Strontiansalze. Man hat es
für die Zuckerfabrikation verwertet.
Strontian (spr. stronnschien), Dorf in der schott.
Grafschaft Argyll, am obern Ende des Loch Sunart, mit Bleigruben
und (1881) 691 Einw.
Strontianit, Mineral aus der Ordnung der Carbonate,
findet sich in rhombischen, säulen- oder nadelförmigen,
auch spießigen Kristallen, auch in derben und in faserigen
Massen, ist weiß, oft grünlich, seltener gräulich
und gelblich, durchsichtig bis durchscheinend, glasglänzend,
Härte 3,5, spez. Gew. 3,6-3,8, besteht aus kohlensaurem
Strontian SrCO3, meist mit einem Gehalt von isomorph beigemischtem
Calciumcarbonat (Aragonit). Er tritt gewöhnlich auf
Erzgängen auf, so bei Freiberg, am Harz, bei Hamm in Westfalen
(hier auf Gängen im Kreidemergel), in Salzburg, bei Strontian
in Schottland (daher der Name), und dient zur Darstellung von
Strontiumpräparaten. Das westfälische Vorkommen wird
für die Zuckerfabrikation ausgebeutet.
Strontiansalze (Strontiumsalze, Strontiumoxydsalze)
finden sich zum Teil in Mineralien, Quellwasser und Pflanzen. Am
verbreitetsten sind der schwefelsaure (Cölestin) und der
kohlensaure Strontian (Strontianit), aus welchen alle übrigen
S. mittelbar oder unmittelbar dargestellt werden. Sie sind farblos,
wenn die Säure ungefärbt ist, und verhalten sich im
allgemeinen wie die Barytsalze. Aus ihren Lösungen fällt
Schwefelsäure sehr schwer löslichen weißen,
schwefelsauren Strontian, der aber immer noch löslicher ist
als schwefelsaurer Baryt, so daß eine durch Schütteln
desselben mit destilliertem Wasser dargestellte Lösung in
Chlorbaryumlösung noch eine Ausscheidung von schwefelsaurem
Baryt hervorbringt. Mehrere S. färben die Flamme rot und
werden in der Feuerwerkerei benutzt. In neuerer Zeit ist Strontian
auch für die Zuckerfabrikation wichtig geworden.
Strontium Sr, Metall, findet sich in der Natur als
schwefelsaures (Cölestin) und kohlensaures Strontiumoxyd
(Strontianit), ganz allgemein als Begleiter des Baryts, auch,
wenngleich nur spurenweise, in Kalkstein, Marmor, Kreide, in
Mineralwässern, im Meerwasser und in Pflanzenaschen. Man
erhält es durch Zersetzung von geschmolzenem Chlorstrontium
durch den galvanischen Strom oder von Strontiumoxyd durch Kalium
als schwach gelbliches, dehnbares Metall vom spez. Gew. 2,54,
Atomgew. 87,2; es schmilzt bei mäßiger Rotglut, zersetzt
Wasser bei gewöhnlicher Temperatur, oxydiert sich an der Luft
sehr leicht und verbrennt beim Erhitzen mit glänzendem Licht
zu Oxyd. Es ist zweiwertig und bildet mit Sauerstoff Strontiumoxyd
(Strontian) SrO, welches zu den alkalischen Erden gerechnet wird,
und Strontiumsuperoxyd SrO2. Seine Verbindungen gleichen denen des
Baryums. Strontianit wurde 1790 durch Crawfurd und Cruikshank vom
Witherit unterschieden; Klaproth wies 1793 die Strontianerde nach,
und das Metall stellte Davy 1808 dar.
Strontiumchlorid (Chlorstrontium) SrCl2 entsteht beim
Lösen von Strontianit (kohlensaurer Strontian) in heißer
Salzsäure, wird aber meist aus Cölestin (schwefelsaurer
Strontian) dargestellt, indem man denselben durch Glühen mit
Kohle in Schwefelstrontium verwandelt und dies mit Salzsäure
zersetzt. Es bildet farblose Kristalle mit 6 Mol. Kristallwasser,
vom spez. Gew. 1,603, schmeckt scharf, bitter, salzig, löst
sich leicht in Wasser und Alkohol, verwittert an der Luft, wird
beim Erhitzen wasserfrei und schmilzt bei 829°. Es färbt
die Alkoholflamme rot und wird in der Feuerwerkerei benutzt.
Strontiumoxyd, s. Strontian.
Strontiumsulfuret (Schwefelstrontium) SrS entsteht, wenn
man Cölestin (schwefelsauren Strontian) mit Kohle heftig
glüht, ist farblos, verhält sich wie Baryumsulfuret (s.
d.) und bildet namentlich auch mit Wasser kristallisierbares
Strontiumsulfhydrat SrSH2S. Das durch Glühen von
schwefelsaurem Strontian mit Kohle erhaltene S. phosphoresziert
nach der Bestrahlung durch Sonnenlicht schwach gelblichgrün.
Erhitzt man aber das Salz in Wasserstoff, so erhält man
grün, blau, violett oder rötlich leuchtende und beim
Glühen von kohlensaurem Strontian mit Schwefel blau oder
smaragdgrün leuchtende Präparate.
Strophäden (jetzt Strivali oder Stamphanäs),
zwei kleine Inseln im Ionischen Meer, südlich von Zante;
galten für den Wohnsitz der Harpyien.
Strophe (griech.), in der Poesie, insbesondere der
lyrischen, die Verbindung mehrerer Verse zu einem metrischen
Ganzen, dessen Maß und Ordnung den einzelnen Teilen eines
Gedichts zu Grunde liegt und sich demnach wiederholt. Man sagt
deshalb: ein Gedicht besteht aus so und so viel Strophen. Bei
den
395
Strophion - Strubberg.
Griechen bildete die S. einen Teil der Chorgesänge auf dem
Theater, die sich in S., Antistrophe ("Gegenstrophe"), die der
erstern genau nachgebildet war, und Epode ("Nachgesang"), mit
eigner metrischer Form, gliederten. Die lyrische Poesie behielt
diese Benennungen bei, wie in den Pindarischen Oden; andre lyrische
Gedichte des Altertums kennen die Epode und Antistrophe nicht,
sondern bestehen aus Strophen mit regelmäßig
wiederkehrendem Metrum. Die Alten teilten die Strophen nach der
Anzahl ihrer Verse in zwei-, drei- und vierzeilige (Distichen,
Tristichen und Tetrastichen) und nach ihren Erfindern und andern
Merkmalen in Alkäische, Sapphische, choriambische und andre
Strophen. Die einzelnen Verse derselben hießen Kola und
bildeten ein andres Einteilungsmerkmal. Strophen, deren Verse ein
gleiches Metrum hatten, galten zusammen nur als ein Kolon und
hießen Monokola; solche, in denen zwei, drei oder vier
Versarten wechselten, Dikola (z. B. das Sapphische Metrum), Trikola
(z. B. das Alkäische Metrum) und Tetrakola. In der Poesie des
Mittelalters und der neuern Zeit betrachtet man neben dem
regelmäßig wiederkehrenden Versmaß besonders die
Einteilung in Aufgesang und Abgesang (s. d.) sowie den Reim als
Prinzip bei der Strophenbildung, während in den
allitterierenden altdeutschen Dichtungen eine strophische
Gliederung noch nicht vorkommt. Erst in der Zeit des deutschen
Minnegesangs entstand eine künstliche Strophenbildung, die
auch auf die epische Poesie ihren Einfluß hatte. Die
bekanntesten Strophen dieser Periode sind: die Nibelungenstrophe,
Hildebrandstrophe, die Titurel- und die fünfzeilige
Neidhartstrophe. Im weitern Verlauf haben die Dichter der neuern
Zeit, von dieser Grundlage des Mittelalters ausgehend, eine
großartige Mannigfaltigkeit in der Strophenbildung
entwickelt. Vgl. Seyd, Beitrag zur Charakteristik und
Würdigung der deutschen Strophen (Berl. 1874).
Strophion (griech.), Stirnbinde der griechischen Frauen
und Priester, auch Gürtel; bei den römischen Frauen ein
Busenband, welches unter den Brüsten zur Aufrechterhaltung
derselben getragen wurde.
Strophulus, Flechtenausschlag bei Kindern.
Stroppen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Breslau,
Kreis Trebnitz, westlich von der Station Gellendorf, hat eine
evang. Kirche und (1885) 749 Einw.
Strosse, stufenförmiger Absatz in einem Grubenbau,
dann auch Abbaustoß beim Strossenbau.
Strossenbau, s. Bergbau, S. 724.
Stroßmayer, Joseph Georg, kroat. Bischof, geb. 4.
Febr. 1815 zu Essek in Slawonien, studierte in Pest Theologie,
empfing 1838 die Priesterweihe und ward Professor am Seminar zu
Diakovár, dann kaiserlicher Hofkaplan und Direktor des
Augustianiums in Wien und 1849 Bischof in Diakovár. Auf dem
vatikanischen Konzil trat er mit ungewöhnlichem Freimut gegen
das Dogma von der päpstlichen Unfehlbarkeit auf und hielt am
längsten von allen Bischöfen seinen Widerspruch aufrecht,
unterwarf sich aber doch und führte 1881 eine slawische
Pilgerschar nach Rom. Hauptsächlich widmete sich S. der
kroatischen Volkssache, ward einer der Führer der kroatischen
Nationalpartei und verwandte seine reichen Einkünfte zur
geistigen Hebung der Nation: er errichtete Volksschulen,
gründete ein Seminar für die bosnischen Kroaten, stellte
das alte nationale Kapitel der Illyrier, San Girolamo degli
Schiavoni in Rom, her, ließ durch A. Theiner "Vetera
monumenta Slavorum meridionalium historiam illustrantia" (Rom 1863)
herausgeben, veranstaltete eine Sammlung der kroatischen Lieder und
Volksbücher, betrieb die Errichtung der Akademie und
Universität zu Agram und baute eine prächtige Kathedrale
in Diakovár. Auch ist er eifrig bemüht, durch Zulassung
der slawischen Liturgie die Südslawen der
römisch-katholischen Kirche zuzuführen.
Strotten, s. v. w. Molken.
Stroud (spr. straud), Stadt in Gloucestershire (England),
südlich von Gloucester, hat Tuch- und Walkmühlen,
Scharlachfärberei und (1881) 7848 Einw.
Strousberg, Bethel Henry (ursprünglich Strausberg),
Finanzmann, geb. 20. Okt. 1823 zu Neidenburg, ging nach dem Tod
seiner Eltern als zwölfjähriger Knabe nach England,
ließ sich dort taufen und legte dabei die früher von ihm
geführten Namen (nach seiner Angabe Bartel Heinrich) ab. Er
trat dort in das Geschäft seiner Oheime, begann für
Journale zu schreiben und wurde Eigentümer von Sharpes "London
Magazine", welches ihm einen erheblichen Gewinn abwarf. Auch war er
für Lebensversicherunggesellschaften thätig. Später
siedelte er nach Berlin über und fand hier 1861 Gelegenheit,
als Vertreter englischer Häuser die Tilsit-Insterburger und
die Ostpreußische Südbahn auszuführen. Dann
übernahm er für eigne Rechnung die Ausführung
folgender Bahnen: der Berlin-Görlitzer, der
Rechte-Oderuferbahn, der Märkisch-Posener, Halle-Sorauer und
Hannover-Altenbekener Bahn, ferner der Brest-Grajewo-, der
Ungarischen Nordostbahn und der rumänischen Eisenbahnen,
zusammen 400 Meilen. Er wandte, da ihm zur Ausführung so
gewaltiger Unternehmungen weder Kapital noch Kredit auch nur
annähernd ausreichend zu Gebote standen, das System an, als
Generalunternehmer die Lieferanten der Bahn durch Aktien zu
bezahlen. Er kaufte ferner die ausgedehnte Herrschaft Zbirow in
Böhmen, die Egestorffsche Lokomotivenfabrik zu Linden bei
Hannover, viele Gruben, Hütten etc. Als 1870 die Koupons der
rumänischen Bahnen nicht eingelöst werden konnten, begann
das Kartenhaus seiner Unternehmungen zusammenzufallen. Er geriet
1875 in Preußen, Österreich und Rußland in
Konkurs, wurde in Moskau verhaftet, nach langem Prozeß zur
Verbannung verurteilt und konnte erst im Herbst 1877 nach Berlin
zurückkehren. In der Haft schrieb er seine Selbstbiographie
("Dr. S. und sein Wirken", Berl. 1876). Auch veröffentlichte
er "Fragen der Zeit", 1. Teil: "Über Parlamentarismus" (Berl.
1877), und eine Denkschrift über den Bau eines
Nordostseekanals (das. 1878). Er starb in großer
Dürftigkeit 31. Mai 1884 in Berlin. Vgl. Korfi, Bethel Henry
S. (Berl. 1870).
Strozzi, Palast, s. Florenz, S. 383.
Strozzi, Bernardo, Maler, genannt il Prete Genovese und
il Cappuccino, geb. 1581 zu Genua, war daselbst, später in
Venedig thätig, wo er 1644 starb. S. malte im naturalistischen
Stil des Caravaggio viele Fresken und Ölbilder, die meist
etwas roh sind, aber kräftiges Leben und feuriges Kolorit
zeigen; besonders vortrefflich sind seine Porträte.
Strubberg, 1) Friedrich August, unter dem Pseudonym
Armand bekannter Schriftsteller, geb. 18. Mai 1808 zu Kassel, trat,
zum Kaufmannsstand bestimmt, in ein amerikanisches Haus in Bremen
ein, durchstreifte dann jahrelang Amerika nach allen Richtungen,
übernahm später unter schwierigen Verhältnissen das
Direktorium des "Deutschen Fürstenvereins in Texas", machte
die Feldzüge gegen Mexiko mit und kehrte 1854 nach Deutschland
zuruck. Er starb 3. April 1889 in Gelnhausen. S. hat seine
Erlebnisse und Beobachtungen in einer Reihe von Werken
396
Strudel - Struensee.
dargelegt, die eine Zwittergattung von Roman und
ethnographischer Schilderung bilden, und von denen die Skizzen "Bis
in die Wildnis" (Berl. 1858, 4 Bde.; 2. Aufl. 1863) das meiste
Aufsehen erregten, der Roman "Sklaverei in Amerika" (Hannov.1862, 3
Bde.) dagegen das meiste poetische Leben hat. Von den übrigen
nennen wir nur: "Amerikanische Jagd- und Reiseabenteuer" (Stuttg.
1858, 2. Aufl. 1876); "An der Indianergrenze" (Hannov. 1859, 4
Bde.), in ethnographischer Hinsicht das lehrreichste Werk, und die
beliebte Jugendschrift "Karl Scharnhorst" (3. Aufl., das. 1887).
Zuletzt veröffentlichte er zwei Dramen: "Der Freigeist"
(Kassel 1883) und "Der Quadrone" (das. 1885).
2) Otto von, preuß. General, geb. 16. Sept. 1821 zu
Lübbecke in Westfalen, wurde im Kadettenkorps erzogen und trat
1839 als Sekondeleutnant in die Armee ein. Nachdem er die
Kriegsakademie besucht hatte, wirkte er 1846-49 als Lehrer am
Kadettenkorps, nahm 1849 am badischen Feldzug teil, ward dann im
topographischen Büreau des Generalstabs beschäftigt und,
nachdem er zwei Jahre zur Erlernung der französischen Sprache
in Paris zugebracht hatte, 1854 als Hauptmann in den Großen
Generalstab versetzt. Er wurde dem Militärgouvernement am
Rhein beigegeben, an dessen Spitze der Prinz von Preußen
(Kaiser Wilhelm I.) stand, und erhielt 1858 den Adelstitel und den
Majorsrang. Im Jahr 1861 wurde er Flügeladjutant des
Königs und Lehrer an der Kriegsakademie. Als Oberstleutnant
gehörte er 1863 der internationalen Militärkommission in
Serbien an, nahm am dänischen Feldzug, namentlich an der
Erstürmung der Düppeler Schanzen, teil, ward 1865 Oberst
und Kommandeur des 4. Gardegrenadierregiments in Koblenz, an dessen
Spitze er 1866 den böhmischen Feldzug mitmachte, und
befehligte 1870-71 die 30. Infanteriebrigade im 8. Korps vor Metz,
bei Amiens, Bapaume und St.-Quentin. Nach Beendigung des Kriegs
organisierte er die Landwehrbehörden in Elsaß-Lothringen
und erhielt 1873 als Generalleutnant das Kommando der 19. Division.
Im November 1880 wurde er zum Generalinspekteur des
Militärerziehungs- und Bildungswesens und 1883 zum General der
Infanterie ernannt.
Strudel, ein Wasserwirbel oder eine Stelle, an der sich
das Wasser kreis- oder spiralförmig nach unten der Tiefe zu
dreht, wobei sich bisweilen in der Mitte eine trichterförmige
Vertiefung bildet. Solche S. haben zur Voraussetzung reißende
Strömungen, wie sie im offenen Meer nirgends vorhanden sind;
sie finden sich auch in engen Meeresstraßen selten vor. Der
Malstrom (s. d.) bei den Lofoten und die Charybdis in der Meerenge
von Messina sind die bekanntesten Wirbel dieser Art, jedoch ist die
Bewegung in denselben keineswegs so verderblich, wie sie von der
Sage dargestellt wird, und bereitet nur kleinen Fahrzeugen
ernstliche Schwierigkeiten. Unterhalb der Niagarafälle und in
den Stromengen des Congo unterhalb Vivi entwickeln sich ebenfalls
derartige S. Der Donaustrudel unterhalb Grein in
Oberösterreich auf der Nordseite der Insel Wörth hat seit
1866 durch Sprengungen seine Gefährlichkeit für die
Schiffahrt verloren. Von besonderm Interesse sind die S., welche
sich in den obern Läufen der Flüsse infolge der
Unebenheiten des Grundes namentlich in Verbindung mit
Wasserfällen und Stromschnellen bilden. Die Erosionswirkung
derselben kennzeichnet sich durch die Bildung von
Strudellöchern oder Riesentöpfen (s.d.).
Strudel, in Bayern und Österreich beliebte
Mehlspeise aus dünn aufgetriebenem Nudel- oder Hefenteig, der,
mit Obst, gewiegtem Fleisch, Schokolade, Krebsen, Mandeln, Mark,
Rosinen etc. bedeckt, zusammengerollt und in einer Kasserolle
gebacken wird.
Strudelwürmer (Turbellaria), s. Platoden.
Struensee, 1) Karl Gustav von, preuß. Minister,
geb. 18. Aug. 1735 zu Halle, Sohn Adam Struensees, des Verfassers
des alten Halleschen Gesangbuchs, Predigers an der Ulrichskirche
daselbst, dann zu Altona, studierte in Halle Mathematik und
Philosophie und wurde 1757 Professor an der Ritterakademie zu
Liegnitz. Hier benutzte er seine Muße, die Anwendung der
Mathematik auf die Kriegskunst zu studieren, und gab
"Anfangsgründe der Artillerie" (3. Aufl., Leipz. 1788) und
"Anfangsgründe der Kriegsbaukunst" (das. 1771-74, 3 Bde.; 2.
Aufl. 1786) heraus, das erste bessere Werk in diesem Fach in
Deutschland. Auf Veranlassung seines Bruders ging er 1769 nach
Kopenhagen, wo er eine Anstellung als dänischer Justizrat und
Mitglied des Finanzkollegiums erhielt. Nach dem Sturz seines
Bruders 1772 wurde er von Friedrich d. Gr. als preußischer
Unterthan reklamiert, so daß man ihn frei in sein Vaterland
entlassen mußte. Nachdem er längere Zeit auf seinem Gut
Alzenau bei Haynau in Schlesien den Wissenschaften gelebt, ward er
1777 zum Direktor des Bankkontors in Elbing ernannt, 1782 als
Oberfinanzrat und Direktor der Seehandlung nach Berlin berufen,
1789 vom König von Dänemark unter Hinzufügung des
Namens v. Karlsbach geadelt und 1791 zum preußischen
Staatsminister und Chef des Accise- und Zolldepartements ernannt.
Obwohl von stattlicher Persönlichkeit und bedeutenden Gaben,
dabei streng rechtlich, vermochte S., durch den Neid und die
Feindseligkeit seiner hochadligen Kollegen behindert, doch nicht
die freisinnigen Reformen im Finanzwesen durchzuführen, welche
er in seinen Schriften empfohlen hatte. Er starb 17. Okt. 1804.
Vgl. v. Held, Struensee (Berl. 1805).
2) Johann Friedrich, Graf von, dän. Minister, Bruder des
vorigen, geb. 5. Aug. 1737 zu Halle, studierte in seiner Vaterstadt
Medizin, ward 1759 Stadtphysikus zu Altona und 1768 Leibarzt und
Begleiter des jungen Königs Christian VII. von Dänemark
auf dessen Reise durch Deutschland, Frankreich und England. Schnell
erwarb er sich die Gunst des Königs und ward 1770 auch mit der
Erziehung des Kronprinzen beauftragt und zum Konferenzrat und
Lektor des Königs und der Königin Karoline Mathilde (s.
Karoline 1) ernannt. Die von ihrem Gatten mit Gleichgültigkeit
behandelte Königin fand bald Interesse an seinem Umgang und
glaubte in ihm den Mann gefunden zu haben, mit dessen Hilfe sie die
ihr abgeneigte dänische Adelsaristokratie stürzen
könnte. Nachdem S. ein besseres Einvernehmen zwischen dem
König und der Königin hergestellt, wußte er die
bisherigen Günstlinge und Minister vom Hof zu entfernen,
zuerst den Grafen von Holck, an dessen Stelle sein Freund Brandt
als königlicher Gesellschafter eintrat, dann auch den
verdienten Minister Grafen Bernstorff, und Ende 1770 hob er den
ganzen Staatsrat auf. Die Königin und S. herrschten nun
unumschränkt, indem sie den schwachen König von den
Staatsgeschäften fern hielten. Bald entspann sich zwischen
ihnen ein näheres Verhältnis. Während Karoline
Mathilde S. zärtlich liebte und ihre Gefühle oft
unvorsichtig verriet, war diesem die Neigung der Königin
besonders deswegen von Wert, weil er sich durch sie in seiner
Machtstellung zu behaupten hoffte. Seine Herrschaft über den
eingeschüchterten König
397
Struktur - Strümpfe.
war so groß, daß er sich schließlich sogar die
Vollmacht erteilen ließ, Kabinettsbefehle ohne
königliche Unterschrift auszufertigen. Es ward ein neues
Ministerium gebildet, S. selbst aber im Juli 1771 zum
Kabinettsminister ernannt. Abweichend von der bisher verfolgten
Politik, suchte S. Dänemark von dem Einfluß
Rußlands frei zu machen und dafür mit dem
stammverwandten Schweden eine enge Verbindung herzustellen. Im
Innern wollte er nach dem Muster Friedrichs II. von Preußen
durch einen aufgeklärten Despotismus gewerbliche
Thätigkeit, Wohlstand und freiheitliche Bildung
begründen. Die Finanzen wurden geordnet, die Abgaben
verringert, viele der Industrie und Handel hemmenden Fesseln
gelöst, Bildungsanstalten gegründet, die strengen
Strafgesetze gemildert, die Folter abgeschafft und alle Zweige der
Verwaltung nach Vernunftgrundsätzen geordnet; doch ging S.
dabei mit zu rücksichtsloser Eile zu Werke, verfeindete sich
mit allen hervorragenden Persönlichkeiten, reizte das Volk
durch Verdrängung der S. unbekannten dänischen Sprache zu
gunsten der deutschen und ward daher als Tyrann verschrien,
insbesondere von der orthodoxen Geistlichkeit. Dazu ward sein
Verhältnis zu der Königin verdächtigt, namentlich
als diese 7. Juli 1771 eine Tochter gebar. An der Spitze der ihm
feindlichen Partei stand die herrschsüchtige Stiefmutter
Christians VII., Juliane Maria, Prinzessin von
Braunschweig-Wolfenbüttel, und an sie schlossen sich mehrere
einflußreiche Männer an, darunter der
Kabinettssekretär Guldberg und der General Rantzau-Aschberg.
Am frühen Morgen des 17. Jan. 1772 drangen diese Verschwornen
in das Schlafzimmer des Königs und zwangen denselben zur
Unterzeichnung des Befehls zur Verhaftung der Königin,
Struensees und Brandts. S. ward in Ketten auf die Citadelle
gebracht und eines Anschlags gegen die Person des Königs, um
ihn zur Abdikation zu zwingen, des strafbaren Umgangs mit der
Königin, der Anmaßung und des Mißbrauchs der
höchsten Gewalt angeklagt. Auf sein Geständnis eines
verbrecherischen Umgangs mit der Königin begab sich eine
zweite Kommission zur Königin nach Kronborg, um aus dieser ein
gleiches Geständnis herauszulocken, was auch gelang. Die
königliche Ehe ward getrennt, S. aber "eines großen,
todeswürdigen Verbrechens wegen" 6. April zu grausamer
Hinrichtung verurteilt. Ebenso lautete das Urteil gegen Brandt als
Genossen Struensees. Nachdem der König das Urteil
bestätigt hatte, erfolgte 28. April 1772 die Exekution, indem
ihnen erst die rechte Hand, dann der Kopf abgeschlagen und der
Rumpf zerstückelt wurde. Beide Verurteilte fielen dem
Haß der von ihnen schwer beleidigten Adelsaristokratie zum
Opfer. Michael Beer und Heinrich Laube machten Struensees Schicksal
zum Gegenstand gleichnamiger Trauerspiele. Bouterwek lieferte einen
seiner Zeit anerkannten Roman. Vgl. Höst, Geheimer
Kabinettsminister Graf J. F. S. und sein Ministerium (deutsch,
Kopenh. 1826); Jenssen-Tusch, Die Verschwörung gegen Karoline
Mathilde von Dänemark und die Grafen S. und Brandt (Jena
1864); Wittich, Struensee (Leipz. 1878).
3) Gustav Otto von (pseudonym Gustav vom See),
Romanschriftsteller, geb. 13. Dez. 1803 zu Greifenberg in Pommern,
studierte zu Bonn und Berlin die Rechte, ward 1834 Regierungsrat in
Koblenz und 1847 Oberregierungsrat in Berlin. Er starb 29. Sept.
1875 in Breslau. Unter seinen ältern Romanen (gesammelt Bresl.
1867-69, 18 Bde.; neue Ausg. 1876, 6 Bde.) verdienen "Die Egoisten"
(1853), "Vor fünfzig Jahren" (1859) und "Herz und Welt" (1862)
hervorgehoben zu werden. Seine stärkste Produktivität
entfaltete der talentvolle und gebildete Erzähler in den
letzten Jahrzehnten seines Lebens, wo er unter andern die Romane:
"Wogen des Lebens" (Bresl. 1863, 3 Bde.), "Gräfin und
Marquise" (Leipz. 1865, 4 Bde.) mit der Fortsetzung "Ost und West"
(Bresl. 1865, 4 Bde.), "Arnstein" (das. 1868, 3 Bde.), "Valerie"
(das. 1869, 4 Bde.), "Falkenrode" (Hannov. 1870, 4 Bde.), "Krieg
und Friede" (Berl. 1872, 4 Bde.), "Gänseliese" (Hannov. 1873,
3 Bde.), "Ideal und Wirklichkeit" (das. 1875, 3 Bde.), "Erlebt und
erdacht", Novellen (das. 1875, 2 Bde.), "Die Philosophie des
Unbewußten" (das. 1876, 3 Bde.) etc. erscheinen
ließ.
Struktur (lat. structura), die Art und Weise der
äußern und innern Zusammenfügung eines zu einem
Ganzen aus einzelnen, verschiedenartigen Teilen verbundenen
Körpers; insbesondere in der Geologie das innere Gefüge
der Gesteine, wie es durch die Form, die gegenseitige Lage, die
Verteilung und die Art der Verbindung der Gesteinselemente und der
accessorischen Bestandteile bedingt wird; über die einzelnen
Strukturformen vgl. Gesteine.
Struma, s. Kropf.
Struma (Karasu, der alte Strymon), Fluß in der
europ. Türkei, entspringt in Bulgarien am Westabhang der
Witosch (Skomios), bildete im Altertum die Ostgrenze Makedoniens
und mündet nach ca. 300 km langem Lauf in den Golf von Orfani
(Strymonischer Meerbusen), nachdem er kurz vorher den See Tachyno
(Kerkine im Altertum) durchflossen hat.
Strumiza (Strumdscha), Stadt im türk. Wilajet
Saloniki, am Flusse S. (Nebenfluß des Struma), Sitz eines
griechischen Erzbischofs, mit altem Schloß, 6 Moscheen und
ca. 15,000 Einw., von denen etwa die Hälfte Mohammedaner.
Strümpell, Ludwig, Philosoph und Pädagog, geb.
23. Juni 1812 zu Schöppenstädt im Braunschweigischen,
studierte zu Königsberg (unter Herbart) Philosophie und
Pädagogik, wurde Erzieher in Kurland, habilitierte sich 1843,
wurde 1844 außerordentlicher, 1849 ordentlicher Professor der
Philosophie und Pädagogik an der russischen Universität
Dorpat, siedelte 1871 als kaiserlich russischer Staatsrat a. D.
nach Leipzig über, wo er als Honorarprofessor der Philosophie
thätig ist. Von seinen zahlreichen, im Geist Herbarts
verfaßten Schriften sind hervorzuheben: "Erläuterungen
zu Herbarts Philosophie" (Götting. 1834); "Die Hauptpunkte der
Herbartschen Metaphysik" (Braunschw. 1840); "Vorschule der Ethik"
(Mitau 1844); "Entwurf derLogik" (das. 1846); "Der
Kausalitätsbegriff und sein metaphysischer Gebrauch in der
Naturwissenschaft" (Leipz. 1872); "Die Geisteskräfte der
Menschen, verglichen mit denen der Tiere" (gegen Darwin, das.
1878); "Psychologische Pädagogik" (das. 1880); "Grundriß
der Logik" (das. 1881); "Grundriß der Psychologie" (das.
1884); "Einleitung in die Philosophie vom Standpunkt der Geschichte
der Philosophie" (das. 1886). Die "Geschichte der griechischen
Philosophie" (Leipz. 1854-61, 2 Bde.) blieb unvollendet. - Sein
Sohn Gustav Adolf, geb. 28. Juni 1853, seit 1886 ordentlicher
Professor der Medizin in Erlangen, schrieb: "Lehrbuch der
speziellen Pathologie und Therapie der innern Krankheiten" (5.
Aufl., Leipz. 1889, 2 Bde.).
Strümpfe (franz. Bas [de chausses]) waren anfangs
von Leder oder Wollenzeug genäht und mit den Hosen verbunden
(Strumpfhosen). Gestrickte, von den Beinkleidern getrennte S.
sollen erst im 16. Jahrh. und zwar zuerst in England in Gebrauch
gekommen sein. Man sagt, Königin Elisabeth sei die erste
gewesen,
398
Strumpfwaren - Struve.
die sich ihrer bediente. Indes besaß schon ihr Vater
Heinrich VIII. ein Paar gestrickte seidene Beinkleider (tricots),
die er aus Spanien zum Geschenk erhalten haben soll, und die damals
noch für ein seltenes Prachtstück galten. Ende des 16.
Jahrh. waren S. von farbiger und weißer Seide (filet de
Florence) mit gestickten Zwickeln schon weiter verbreitet. S. als
Ornatstück der Bischöfe, violettblau von Farbe, waren
genäht, anfangs aus Leinen, später aus Seide oder Samt.
Strumpfbänder kamen ebenfalls bereits in der zweiten
Hälfte des 16. Jahrh. auf und wurden bald kostbar verziert. Im
18. Jahrh. wurden Strumpfbänder aus Gold- oder Silberstoff mit
Metallschnallen auch von Männern zur Befestigung der Kniehosen
und S. getragen.
Strumpfwaren, s. Wirkerei.
Strunk (Stipes), kurzer, dicker Stengel; insbesondere der
Stiel der Hutpilze (s. Pilze, S. 71).
Strunkschwamm, s. Sparassis.
Struthio, Strauß; Struthionidae (Strauße),
Familie aus der Ordnung der Straußvögel.
Struve, 1) Friedrich Adolf August, Begründer der
Mineralwasserfabrikation, geb. 9. Mai 1781 zu Neustadt bei Stolpen,
studierte seit 1799 in Leipzig und Halle Medizin, ließ sich
1803 in seiner Vaterstadt als Arzt nieder, kaufte 1805 die
Salomonisapotheke in Dresden und bemühte sich fortan um die
künstliche Nachbildung der Mineralwässer, die er zu
großer Vollkommenheit brachte. Er richtete viele Anstalten
für Mineralwässerfabrikation ein und starb 29. Sept. 1840
in Berlin. Er schrieb: "Über Nachbildung der natürlichen
Heilquellen" (Dresd. 1824-1826, 2 Hefte). - Sein Sohn Gustav Adolf,
geb. 11. Jan. 1812 zu Dresden, studierte in Berlin, hielt dann in
Dresden Vorlesungen über Chemie und übernahm die Leitung
der väterlichen Geschäfte, die er wesentlich ausdehnte.
Er bereitete auch neue Mineralwässer, indem er Chemikalien in
reinem, mit Kohlensaure imprägniertem Wasser löste, u.
schuf auf diese Weise sehr wertvolle Arzneiformen. Er starb 21.
Juli 1889 in Schandau, nachdem er 1880 die Leitung der
Geschäfte seinem Sohn Oskar, geb. 5. Juli 1838 zu Dresden,
gest. 28. Nov. 1888 in Leipzig, übergeben hatte.
2) Friedrich Georg Wilhelm von, Astronom, geb. 15. April 1793 zu
Altona, studierte 1808-11 in Dorpat erst Philologie, dann
Astronomie, ward 1813 Observator und 1817 Direktor der Sternwarte
zu Dorpat, 1839 Direktor der neu erbauten Nikolai-Zentralsternwarte
zu Pulkowa bei St. Petersburg. Er widmete sich vorzugsweise der
Beobachtung der Doppelsterne und veröffentlichte:
"Observationes Dorpatenses" (Dorp. 1817-39, 8 Bde.) sowie
"Catalogus novus stellarum duplicium" (das. 1827), "Stellarum
duplicium mensurae micrometricae" (Petersb. 1831) und "Stellarum
fixarum, imprimis compositarum positiones mediae" (das. 1852); er
bestimmte ferner die Parallaxe von a [alpha] Lyrae und gab
Untersuchungen über den Bau der Milchstraße in den
"Études d'astronomie stellaire" (das. 1847). Ferner
organisierte S. die sämtlichen russischen Sternwarten,
führte 1816-19 eine Triangulation Livlands aus und leitete
1822-52 die große russisch-skandinavische, einen
Meridianbogen von 25° 20' umfassende Gradmessung, über
welche er in "Arc du méridien entre le Danube et la Mer
Glaciale" (Petersb. 1857-60, 2 Bde.) berichtet hat, wie auch die
Ausführung eines Nivellements zwischen dem Kaspischen und
Schwarzen Meer (1836-37), dessen Bearbeitung durch S. 1841
erschien, und geographische Ortsbestimmungen in Sibirien, der
europäischen und asiatischen Türkei. Nach schwerer
Krankheit im J. 1858 übergab er 1862 sein Amt seinem Sohn Otto
Wilhelm (s. unten) und starb 23. (11.) Nov. 1864 in Petersburg.
Ausgezeichnet war die Beobachtungsgabe Struves und das Geschick,
Beobachtungsfehler zu ermitteln und unschädlich zu machen. Er
wurde zum Wirklichen Staatsrat ernannt und geadelt.
3) Otto Wilhelm von, Astronom, Sohn des vorigen, geb. 7. Mai
1819 zu Dorpat, wurde 1837 Gehilfe des Vaters daselbst, dann in
Pulkowa, später zweiter Astronom und Vizedirektor, 1862
Nachfolger seines Vaters. Er war auch 1847-62 beratender Astronom
des russischen Generalstabs, dessen astronomisch-geodätische
Arbeiten er leitete, lieferte eine neue Bestimmung der
Präzessionskonstanten (1841), eine Durchmusterung des
nördlichen Himmels, welche 500 neue Doppelsternsysteme ergab,
Arbeiten über den Saturn und dessen Ringe, Bestimmung der
Masse des Neptun, entdeckte einen innern Uranustrabanten,
ermittelte die Parallaxe verschiedener Fixsterne, machte
Beobachtungen über die Veränderlichkeit im Nebel des
Orion und kleiner, in demselben verteilter Sterne und veranstaltete
zahlreiche Beobachtungen über Kometen, Doppelsterne und Nebel.
1851 wies er bei Gelegenheit der Sonnenfinsternis nach, daß
die Protuberanzen dem Sonnenkörper angehören, auch
beteiligte er sich an der Gradmessung, die sich über 69
Längengrade zwischen Valentia in Irland und Orsk an der
asiatischen Grenze erstreckt. Er schrieb: "Übersicht der
Thätigkeit der Nikolai-Hauptsternwarte während der ersten
25 Jahre ihres Bestehens" (Petersb. 1865) und gab heraus:
"Observations de Poulkowa" (das. 1869-87, 12 Bde.).
4) Gustav von, republikan. Agitator und Schriftsteller, geb. 11.
Okt. 1805 in Livland, studierte die Rechte in Deutschland und ward
dann oldenburgischer Gesandtschaftssekretär zu Frankfurt a.
M., ging aber bald als Advokat nach Mannheim. Seine Muße
widmete er phrenologischen Studien, als deren Früchte eine
"Geschichte der Phrenologie" (Heidelb. 1843) und ein "Handbuch der
Phrenologie" (Leipz. 1845) erschienen. Auch redigierte er das
"Mannheimer Journal" und ward infolge der oppositionellen Haltung
dieses Blattes wiederholt zu Gefängnisstrafe verurteilt. 1846
gründete er den "Deutschen Zuschauer". Nach der Pariser
Februarrevolution machte er im April 1848 im badischen Seekreis mit
Hecker den bewaffneten Putsch zur Einführung der Republik und
floh nach dessen Mißlingen in die Schweiz. Ein bewaffneter
Einfall, den er 21. Sept. mit andern politischen Flüchtlingen
auf badisches Gebiet machte, mißglückte wieder, und er
selbst ward nach dem Treffen bei Staufen 25. Sept. im Amtsbezirk
Säckingen verhaftet und vom Schwurgericht zu Freiburg 30.
März 1849 wegen versuchten Hochverrats zu 5 1/3 Jahren
Einzelhaft verurteilt und zu deren Abbüßung nach
Bruchsal abgeliefert. Infolge der badischen Volkserhebung schon 24.
Mai wieder frei geworden, beteiligte er sich in Mieroslawskis
Hauptquartier an derselben und entfloh nach dem Scheitern dieses
neuen Aufstandes in die Schweiz, von da im April 1851 nach New
York, wo er seine "Allgemeine Weltgeschichte" im radikalen Sinn
(New York 1853-60, 9 Bde.; 8. Abdruck, Koburg 1866) schrieb. Im
nordamerikanischen Bürgerkrieg machte er als Offizier in einem
New Yorker Regiment die Feldzüge von 1861 und 1862 mit, kehrte
aber im Sommer 1863 nach Europa zurück und lebte in Koburg,
seit 1869 in Wien, wo er 21. Aug. 1870 starb. Von seinen
übrigen Schriften sind zu erwähnen: "Politische Briefe"
(Mannh. 1846);
399
Struvit - Stuart.
"Grundzüge der Staatswissenschaft" (Frankf. 1847 bis 1848,
4 Bde.); "Das öffentliche Recht des Deutschen Bundes" (Mannh.
1846, 2 Bde.); "Geschichte der drei Volkserhebungen in Baden" (Bern
1849); "Das Revolutionszeitalter" (New York 1860, 7. Aufl. 1864);
"Diesseit und jenseit des Ozeans" (Koburg 1864, 4 Hefte);
"Geschichte der Neuzeit" (7. Aufl., das. 1864); "Die Pflanzenkost,
die Grundlage einer neuen Weltanschauung" (Stuttg. 1869); "Das
Seelenleben des Menschen" (Berl. 1869). - Seine Frau Amalie S.,
geborne Düsar, welche sich an den republikanischen
Unternehmungen ihres Mannes eifrig beteiligte und, gleichzeitig mit
diesem arretiert, bis 16. April 1849 in Haft blieb, schrieb:
"Erinnerungen aus den badischen Freiheitskämpfen" (Hamb. 1850)
und "Historische Zeitbilder" (Brem. 1850, 3 Bde.). Sie starb im
Februar 1862 in New York.
Struvit (Guanit), Mineral aus der Ordnung der Phosphate,
findet sich in rhombischen, ausgezeichnet hemimorph entwickelten
Kristallen, ist im frischen Zustand gelblich oder bräunlich,
glasglänzend, halbdurchsichtig bis undurchsichtig, Härte
1,5-2, spez. Gew. 1,66-1,75, zerfällt bei der Verwitterung in
ein weißes Pulver und besteht aus wasserhaltiger,
phosphorsaurer Ammoniakmagnesia (NH4)MgPO4+6H2O. S. ist hier und da
als ein offenbar sehr junges Produkt an Orten gefunden worden, an
denen menschliche oder tierische Abfallstoffe sich aufhäuften,
so unter der Nikolaikirche in Hamburg, in den Abzugskanälen
einer Dresdener Kaserne, zu Braunschweig und Kopenhagen, auch im
Guano (Guanit) der afrikanischen Küste und bei Ballarat in
Australien.
Strychuin C21H22N2O2, Alkaloid, findet sich neben Brucin
in den Brechnüssen (Krähenaugen) von Strychnos nux vomica
(0,28-0,5 Proz.) und in der Rinde dieses Baums (falsche
Angosturarinde), in den Ignatiusbohnen von S. Ignatii (1,5 Proz.),
im Schlangenholz von S. colubrina, in der Wurzelrinde von S.
Tieuté und dem daraus bereiteten Pfeilgift. Zur Darstellung
fällt man wässerigen Auszug von Krähenaugen mit
Alkohol, das verdampfte und wieder gelöste Filtrat mit
Kalkmilch, extrahiert den Niederschlag mit Alkohol, verdampft,
entfernt aus dem Rückstand das Brucin mit kaltem Weingeist und
reinigt das S. durch Umkristallisieren. S. bildet farb- und
geruchlose Kristalle, schmeckt äußerst bitter, hinterher
metallisch, ist sehr schwer löslich in Wasser, Alkohol und
Äther, etwas leichter in Chloroform, Benzol, zersetzt sich vor
dem Schmelzen bei 312°, ist nur in sehr geringen Mengen
sublimierbar, reagiert alkalisch und bildet meist
kristallisierbare, äußerst bitter schmeckende Salze, von
denen das salpetersaure S. C21H22N2O2.HNO3 in Wasser und Alkohol
schwer löslich ist. S. ist eins der stärksten Gifte und
wirkt besonders auf die motorischen Teile des Nervensystems; sehr
geringe Mengen erzeugen Starrkrampf, und meist wird durch Teilnahme
der Brustmuskeln an dem Starrkrampf schnell der Tod durch
Erstickung herbeigeführt. Morphium, Blausäure, Akonitin,
Curare und namentlich Chloralhydrat wirken dem S. entgegen. Vgl.
Falck, Die Wirkungen des Strychnins (Leipz. 1874).
Strychnos L., Gattung aus der Familie der Loganiaceen,
Bäume und (oft hoch schlingende) Sträucher, zum Teil
bewehrt, mit gegenständigen, kurzgestielten, ganzrandigen
Blättern, weißen oder grünlichen, häufig
wohlriechenden Blüten in achsel- oder endständigen,
dichten und fast kopfigen oder in kleinen, trugdoldigen oder in
rispigen Dichasien und meist kugeligen Beeren. Etwa 60 durchweg
tropische Arten. S. nux vomica L. (Krähenaugenbaum,
Brechnußbaum, s. Tafel "Arzneipflanzen II"), ein Baum mit
kurzem, dickem Stamm, eiförmigen, kahlen Blättern,
endständigen Trugdolden und großer, kugeliger,
orangefarbener, mehrsamiger Beere, in deren weißer,
gallertartiger Pulpa 1-8 Samen liegen, wächst in Ostindien,
besonders auf der Koromandelküste, auch auf der
Malabarküste, auf Ceylon, in Siam, Kotschinchina und
Nordaustralien und liefert in den Samen die offizinellen
Krähenaugen (Brechnüsse, Semen Strychni, Nux vomica).
Diese sind flach kreisrund, bis 3 cm breit und 0,5 cm dick,
graugelb, anliegend behaart und dadurch glänzend, mit
warzenförmig erhöhtem Mittelpunkt, schwer zu pulvern und
zu schneiden, schmecken sehr stark und anhaltend bitter und wirken
höchst giftig. Sie enthalten Strychnin, Brucin (und Igasurin),
gebunden an Igasursäure, und werden hauptsächlich als
Stomachikum bei Dyspepsie, Diarrhöe und Obstipation benutzt.
In den Arzneischatz wurden sie vielleicht durch die Araber
eingeführt und in Deutschland durch Valerius Cordus, Bauhin
und Geßner im 16. Jahrhundert näher bekannt. Die
schwärzlich aschgraue Rinde des Baums kam zu Anfang dieses
Jahrhunderts, der Angosturarinde beigemischt, in den Handel
(falsche Angosturarinde), ist jetzt aber wieder völlig
verschwunden. S. Tieuté Lesch. (Upasstrauch, Tschettek) ist
eine 25-30 m lange, einfache, astlose, armdicke Schlingpflanze,
welche mit ihren Ranken in den Urwäldern Javas die Bäume
erklettert, und aus deren Wurzelrinde ein furchtbares Pfeilgift,
das Upas-Tieuté, dargestellt wird. S. toxicaria Schomb.,
eine Schlingpflanze Guayanas, welche mit beindicken Gewinden andre
Stämme umschlingt, ferner S. Gobleri Planch. am Orinoko, S.
Castelnoeana Wedd. am obern Amazonas, S. Schomburgkii Kl., S.
cogens Beuth. und S. Crevauxii Planch. in Guayana liefern Curare.
S. potatorum L. (Atschier) ist ein Baum Indiens, dessen
Früchte von der Größe einer Kirsche und
genießbar sind, und dessen Samen (Klärnüsse)
schlammiges Wasser klar und trinkbar machen sollen. S. colubrina L.
(Schlangenholzbaum), ein Schlingstrauch in Ostindien etc., liefert
das Schlangenholz, welches gegen Schlangenbiß benutzt
wird.
Stryi, Stadt in Galizien, am Flusse S. (Nebenfluß
des Dnjestr), Knotenpunkt der Staatsbahnlinien Zagorz-Husiatyn und
Lemberg-Lawoczne, ist Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines
Bezirksgerichts, hat eine römisch-katholische und eine
griechisch-kath. Kirche, ein Schloß, ein Realgymnasium,
Dampfsäge, Gerberei und (1880) 12,625 Einw. (darunter 5450
Juden). S. ist 1886 größtenteils abgebrannt.
Strymon, Fluß, s. Struma.
Strzelecki (spr. -letzki), Paul Edmund, Graf von,
austral. Entdeckungsreisender, geb. 1796 in Preußen, wurde in
England erzogen und machte die ausgedehntesten Reisen in Nord- und
Südamerika, Westindien etc. Er besuchte die Südseeinseln,
Java, Teile von China, Ostindien und Ägypten, entdeckte 1840
die Gegend südlich von den Australischen Alpen, welche er
Gippsland benannte, erforschte die Blauen Berge von
Neusüdwales und 1841 und 1842 noch Vandiemensland; starb 6.
Okt. 1873 in London. Er schrieb "Physical description of New South
Wales and Van Diemen's Land" (Lond. 1845).
Stuart (spr. stjuh-ert), altes Geschlecht in Schottland,
das diesem Reich und England eine Reihe von Königen gegeben
hat. Es stammt von einem Zweig der anglo-normännischen Familie
Fitz-Alan ab, der sich in Schottland niederließ und unter
David I. die
400
Stuart - Stubbs.
erbliche Würde des Reichshofmeisters (steward, daher der
Name S.) erwarb. Walter S. heiratete um 1315 eine Tochter des
schottischen Königs Robert I. Bruce, auf deren Nachkommen nach
dem Erlöschen des königlichen Mannesstamms die Thronfolge
in Schottland überging. Als Roberts I. Sohn David II. 1370
ohne männliche Erben starb, bestieg Walter Stuarts Sohn als
Robert II. den schottischen Thron und ward der Gründer der
Dynastie, welche nach dem Ableben der Königin Elisabeth von
England mit Jakob VI. (I.), dem Sohn der Maria S., (1603) auch die
Krone dieses Reichs erhielt. Von einem Seitenzweig der Stuarts
stammen die Grafen von Lennox her, welche infolge der
Vermählung des Matthew S., Grafen von Lennox, mit Margarete
Douglas, einer Enkelin Heinrichs VII. von England, auch auf den
englischen Thron Ansprüche erwarben. Der Sohn dieser Ehe war
Heinrich Darnley (s. d.), der Gemahl der Maria S. und Vater
König Jakobs I. von England. Als mit dessen Enkel Jakob II.
(s. d.) der Mannesstamm der Stuarts 1688 aus England vertrieben
worden war, beschäftigten diese die öffentliche
Aufmerksamkeit nur noch durch die fruchtlosen Versuche, die
verlornen Reiche wiederzuerlangen. Diese nahm zuerst Prinz Jakob
Eduard, der Prätendent, der sich Jakob III. nannte und 1766
starb, dann dessen ältester Sohn, Karl Eduard, auf. Derselbe
lebte nach der Schlacht bei Culloden (1746), die seinen
Unternehmungen in Schottland ein Ziel setzte, als Graf von Albany
in Italien und starb kinderlos 31. Jan. 1788 in Rom. Weiteres
über ihn s. Karl 28). Er war mit der Tochter des Prinzen
Gustav Adolf von Stolberg-Gedern, Luise Maria Karoline (gest. 1824,
s. Albany, Gräfin), vermählt. Sein einziger Bruder,
Heinrich Benedikt, der 1747 die Kardinalswürde erhielt, lebte
zuletzt von einem Jahrgeld, welches ihm vom britischen Hof gezahlt
wurde, in Venedig und starb 13. Juli 1807 in Frascati, nachdem er
seine Ansprüche auf den britischen Thron auf Karl Emanuel II.
von Sardinien vererbt hatte. König Georg IV. ließ ihm in
der Peterskirche zu Rom von Canova ein Denkmal errichten. Seine
Familienpapiere kaufte die britische Regierung an und ließ
sie veröffentlichen ("S. papers", Lond. 1847). Von
Nebenzweigen des Stuartschen Stammes leben noch zahlreiche Glieder
in Schottland, England und Irland. Vgl. Vaughan, Memorials of the
S. dynasty (Lond. 1831, 2 Bde.); Klopp, Der Fall des Hauses S.
(Wien 1875-87, 14 Bde.).
Stuart (spr. stjuh-ert), 1) John Mac Douall, austral.
Entdeckungsreisender, geb. 1818 in Schottland, begleitete Sturt
1844-46 auf seiner Expedition und erforschte 1858 mit nur Einem
Begleiter einen großen Teil des Landes zwischen dem
Torrenssee und der Westgrenze von Südaustralien. 1859
unternahm er zwei neue Forschungsreisen ebenfalls in der Umgegend
der Torrenssees, versuchte dann 1860 von Süden aus den
Kontinent nach dem Norden zu durchwandern, erreichte 1861 zum
zweitenmal den 17.° südl. Br. und drang endlich bis zur
Nordküste durch, die er 24. Juli 1862 am Vandiemengolf
erreichte. Er starb 5. Juni 1866 in Nottingham Hill. Seine
Forschungen erschienen unter dem Titel: "Explorations in Australia"
(2. Aufl., Lond. 1864).
2) James E. B., amerikan. General, geb. 6. Febr. 1833 in Patrick
County (Virginia), wurde zu West Point ausgebildet, trat 1855 als
Offizier in ein Reiterregiment, ging beim Ausbruch des
Bürgerkriegs (1861) zu den Konföderierten über und
wurde Oberst eines Reiterregiments. Er zeichnete sich durch seine
kühnen Unternehmungen in der Flanke und im Rücken des
Feindes aus, erhielt bald als General den Befehl über ein
Reiterkorps, befehligte 1863 den linken Flügel des
südstaatlichen Heers, ward aber schon 11. Mai 1864 im Gefecht
bei Yellow Tavern gegen Sheridan schwer verwundet und starb 12. Mai
in Richmond. Vgl. Mac Clellan, Life and campaigns of Major-General
J. E. B. S. (Bost. 1886).
Stuart de Rothesay (spr. roth-sse), Charles, Lord, brit.
Diplomat, geb. 2. Jan. 1779, ward 1808 bei der Gesandtschaft in
Spanien angestellt, 1810 zum englischen Bevollmächtigten bei
der provisorischen Regierung in Lissabon ernannt und fungierte
sodann als Botschafter von 1815 bis 1820 und 1828 bis 1830 zu Paris
und von 1840 bis 1844 zu St. Petersburg. 1824 brachte er in Rio de
Janeiro den Vertrag zu stande, durch den die Unabhängigkeit
Brasiliens von Portugal bestätigt war. Seit 1828 war er
britischer Peer; seine Verdienste um Portugal erwarben ihm die
Titel eines Grafen von Machico und Marquis von Angoa. Er starb 6.
Nov. 1845 auf seinem Landsitz Highcliff in Hampshire.
Stub, Ambrosius, dän. Dichter, geb. 1705,
absolvierte 1725 die Schule zu Odense, kam aber nicht weiter
vorwärts und mußte lange Zeit sein Brot als Bibliothekar
und Schreiber von Gutsbesitzern auf Fünen verdienen, welche
nicht selten in brutalem Übermut ihren Scherz mit ihm trieben.
Schließlich kam er nach Ribe, wo er 1758 als armer
Schulmeister starb. S. hat eine Menge Gedichte und Lieder
geschrieben, von denen einige von der finstern religiösen
Stimmung der Zeit beeinflußt zu sein scheinen, während
andre reizend und zierlich im Schäferstil der Zeit gehalten
sind oder von Scherz und Lebenslust strotzen. Solange er lebte,
unbeachtet geblieben, fanden sie nach seinem Tod (zum erstenmal
gedruckt 1771) allgemeinen Beifall und die weiteste Verbreitung,
und jetzt wird S. mit Recht als Vater der neuern dänischen
Lyrik betrachtet. Eine neue Ausgabe seiner "Samlede Digte" mit
Biographie besorgte Fr. Barfod (5. Aufl., Kopenh. 1879).
Stubai, linkes, vom Rutzbach durchströmtes
Seitenthal der Sill in Nordtirol, Bezirkshauptmannschaft Innsbruck,
mit (1880) 4246 Einw., die besonders Viehzucht und Fabrikation von
Eisen-, Blech- und Stahlwaren betreiben, und den Hauptorten:
Mieders (mit Bezirksgericht), Vulpmes und Neustift. S. gibt den
Stubaier Alpen ihren Namen, die einen Hauptteil der Ötzthaler
Gruppe (s. Ötzthal) bilden und im Zuckerhütl (3508 m)
kulminieren. Vgl. Pfaundler und Barth, Die Stubaier Gebirgsgruppe
(Innsbr. 1865).
Stübbe, s. Kohlenklein.
Stubbenkammer, s. Rügen.
Stubbs (spr. stöbbs), William, namhafter engl.
Geschichtschreiber, geb. 21. Juni 1825 zu Knaresborough in Essex,
studierte zu Oxford, wurde 1848 Geistlicher, 1862 Bibliothekar zu
Lambeth, 1866 Professor der neuern Geschichte zu Oxford und 1869
Kurator der großen Bodleyschen Bibliothek daselbst. 1875
erhielt er die Pfründe des Rektorats zu Cholderton und ward
1884 Bischof von Chester. Abgesehen von einer großen Anzahl
von meist mustergültigen Ausgaben mittelalterlicher Chroniken
und Urkunden, hat er sich besonders durch seine "Constitutional
history of England" (2. Aufl., Oxf. 1875-78, 3 Bde.) bedeutende
Verdienste erworben, außerdem "Select charters and other
illustrations of English history" (1870) und "Lectures on study of
mediaeval and modern history" (das. 1886) veröffentlicht.
401
Stübchen - Stuck
Stübchen, altes Flüssigkeitsmaß im
nördlichen und westlichen Deutschland, in Hamburg = 3,62 Lit.,
in Hannover = 3,89 L., in Bremen = 3,22 L.
Stuben (ungar. Stubnya), höchst gelegener ungar.
Badeort im Komitat Turocz, Eigentum der nahen Stadt Kremnitz, mit
alkalisch-salinischen, bei Rheuma, Gicht und Hautkrankheiten
wirksamen Thermen von 46,5° C. S. ist Station der Ungarischen
Staatsbahn.
Stubenarrest, s. Arrest.
Stubenfliege, s. Fliegen, S. 373.
Stubensandstein, s. Triasformation.
Stubenvögel (Käfigvögel, hierzu Tafel
"Ausländische Stubenvögel"). Die Liebhaberei für S.
ist uralt. In Indien, Japan und China richtet man schon seit
Jahrtausenden kleine Vögel zu Kampfspielen ab. Alexander d.
Gr. brachte den ersten Papagei von seinem Zug aus Asien mit, und
auch später haben bei Eroberungen und Entdeckungen
prächtige Schmuckvögel die Triumphzüge der
Heimkehrenden verherrlichen müssen. Aus Amerika, wo die
Peruaner seit alten Zeiten Papageien zähmten, brachte Kolumbus
diese Vögel nach Europa. In Deutschland fanden der Fink und
der Dompfaff in manchen Landstrichen, wie in Tirol, im Harz und in
Thüringen, begeisterte Freunde, und dem Vogelmarkt, der sich
in manchen Städten, wie namentlich in Berlin,
außerordentlich entwickelte, verdankt auch die Wissenschaft
manche Bereicherung. Viel größere Verbreitung als irgend
ein heimischer Vogel fand aber der Kanarienvogel, dem sich seit dem
Beginn des vorigen Jahrhunderts andre überseeische Sing- und
Schmuckvögel anschlossen. Schon 1790 gab Vieillot ein
besonderes Werk über dieselben heraus. Zu Bechsteins Zeit
wurden 72 Arten fremdländischer Vögel nach Deutschland
eingeführt, und 1858 gab Bolle ein Verzeichnis von 51 Arten.
Zehn Jahre später nahm aber diese Liebhaberei einen ganz
außerordentlichen Aufschwung, und wenn damals die Zahl der
eingeführten Arten auf 250 veranschlagt werden konnte, so hat
sich dieselbe bis 1878 auf nahezu 700 gesteigert. Neben den
Singvögeln, wie Spottdrossel und andre Drosseln,
Grasmücken, Finken, Starvögel, Bülbüls etc.,
spielen gegenwärtig besonders die Prachtfinken (Astrilds und
Amadinen), Witwenvögel (Widafinken), Weber, Reisvogel,
Tangaren, Sonnenvogel, Dominikanerfink, Kardinal und Papageien die
größte Rolle und erregen ein besonderes Interesse
dadurch, daß sie in der Gefangenschaft leicht zur Brut
schreiten. Die Tafel zeigt eine Auswahl der beliebtesten
ausländischen S. Man züchtet sie vielfach in sogen.
Vogelstuben oder Heckkäfigen, und der Handel mit den bei uns
gezüchteten fremdländischen Vögeln erreicht bereits
einen namhaften Betrag. Trotz der großen Mannigfaltigkeit der
fremdländischen sind aber auch die einheimischen Vögel
noch immer ein bedeutsamer Gegenstand der Liebhaberei. Sprosser,
Nachtigall, Schwarzplättchen, von Südeuropa her Stein-
und Blaudrossel sind von großer Wichtigkeit für den
Vogelhandel, dann nicht minder verschiedene Grasmücken, Rot-
und Blaukehlchen, Meisen, Drosseln, Hänfling, Stieglitz,
Edelfink, Gimpel u. a. m., welche auch zugleich zahlreich nach
Nordamerika und andern Weltteilen ausgeführt werden.
Neuerdings züchtet man auch vielfach einheimische Finken und
selbst Insektenfresser in Volieren und Vogelstuben. - Was die
Gesundheitszeichen aller S. betrifft, so ist darüber folgendes
zu sagen: jeder Vogel muß munter und frisch aussehen,
natürliche Lebhaftigkeit, glatt anliegendes, am Unterleib
nicht beschmutztes Gefieder, nicht trübe oder matte Augen,
nicht verklebte oder schmutzige Nasenlöcher, keinen spitz
hervortretenden Brustknochen haben; er darf nicht traurig, struppig
oder aufgebläht dasitzen und nicht kurzatmig sein;
abgestoßenes Gefieder, fehlender Schwanz und beschmutzte
Federn bergen nicht immer Gefahr, doch muß bei
Wurmvögeln dann wenigstens ein voller Körper vorhanden
sein. Die Fütterung soll der Ernährung im Freileben
gleichen, und daher lassen sich keine allgemein gültigen
Regeln geben. Die hauptsächlichsten Futtermittel für alle
Körnerfresser sind Hanf, Kanariensame, Hirse, Hafer u. a. m.,
für die Insektenfresser: frische oder getrocknete
Ameisenpuppen, Mehlwürmer, Eierbrot, Eikonserve u. dgl. wie
auch süße Beeren und andre Früchte. Unentbehrlich
sind auch Kalk (Sepia, wohl auch Mörtel von alten Wänden)
und sauberer, trockner Stubensand. Reinlichkeit, sorgfältige
Bewahrung vor Zugluft, Nässe, schnellem Temperaturwechsel,
plötzlichem Erschrecken und Beängstigen sind die
hauptsächlichsten Hilfsmittel zur Erhaltung der Gesundheit
für alle S. Vgl. die Schriften von Ruß (s. d.);
Friderich, Naturgeschichte der deutschen Zimmer-, Haus- und
Jagdvögel (3. Aufl., Stuttg. 1876); Reichenbach, Die
Singvögel (als Fortsetzung der "Vollständigsten
Naturgeschichte"); Gebr. Müller, Gefangenleben der besten
einheimischen Singvögel (Leipz. 1871); Lenz, Naturgeschichte
der Vögel (5. Aufl., Gotha 1875); A. E. Brehm, Gefangene
Vögel (Leipz. 1872-75, 2 Bde.); Chr. L. Brehms "Vogelhaus",
neubearbeitet von Martin (3. Aufl. , Weim. 1872), und die
Zeitschrift "Die gefiederte Welt" (hrsg. von Ruß, Berl., seit
1872).
Stüber (holländ. Stuiver), frühere
Scheidemünze in den Niederlanden (20 S. = 1 Gulden); in
Ostfriesland etc. (72 S. = 1 preußischen Thaler); auch alte
schwedische Silbermünze, s. v. w. Ör (s. d.).
Stubica, Badeort im kroatisch-slawon. Komitat Agram, 8 km
von Krapina-Teplitz, mit vielen indifferenten Thermen von 58,7°
C.
Stuck (ital. stucco), Mischung von Gips, Kalk und Sand,
welche in der Baukunst sowohl zum Überzug der Wände als
zur Verfertigung der Gesimse und Reliefverzierungen dient. Man
unterscheidet je nach der Zubereitung: Weißstuck, Kalkstuck,
Graustuck, Glanzstuck (ital. stucco lustro), Leinölstuck.
Schon die alten Griechen wandten eine Art S. als Überzug bei
nicht in Marmor aufgeführten Bauten an. Die eigentliche
Stuckaturarbeit zur Verzierung hieß bei den Römern Opus
albarium oder coronarium und ward von ihnen vielfach an Decken und
Wänden, meist bemalt oder vergoldet, angewandt. Nachdem die
Kunst lange in Vergessenheit geraten war, soll sie zuerst von
Margaritone um 1300 von neuem erfunden worden sein. Vervollkommt
ward dieselbe namentlich durch den Maler Nanni von Udine zur Zeit
Raffaels, wie die nach diesem benannten Logen im Vatikan zeigen.
Recht in Aufnahme kam aber die Stuckaturarbeit in Deutschland und
anderwärts erst mit dem Rokokostil zu Anfang des 18. Jahrh.
Zur Stuckaturarbeit muß das feinste Material angewandt
werden. Die Masse wird in weichem Zustand aufgetragen und erst,
wenn sie etwas hart und zäh geworden, mit den Fingern und dem
Bossiereisen in beliebige Formen gebracht. Gute Stuckaturarbeit
trotzt jeder Witterung. Eine Art S. ist auch der sogen. Gips- oder
Stuckmarmor, mit welchem man Säulen etc. bekleidet, um ihnen
ein marmorartiges Ansehen zu geben. Vgl. Heusinger v. Waldegg, Der
Gipsbrenner (Leipz. 1863); Fink, Der Tüncher, Stuckator etc.
(das. 1866).
Meyers Konv.- Lexikon, 4. Aufl., xv. Bd.
26
AUSLÄNDISCHE STUBENVÖGEL.
1. Helenafascäuclxen (Habropyga. Astrild).-
2. Grauer Astrild ( Habropyga cinerea). -
3. Tigerfink (Pytelia ampdava).-
4. Zebrafink ( Zonaeginthus casta.notis) (1-4 Ait.^4strU<fj).
~
5. Bandvogel (Spermestes fasciai-a).-
6. Erz amadme, Meines Eisterchen (Spermestes cucullata) (5,6 ATI
. ^tmacUnen,). -
7. Schwarzköpfiger Webervoge| (HyphAntornis toxtor) (Art.
Webervögel]. -
8. Paradieswitwe (Vidua paradisea) (Art. wwwanmS/Ä). -
9. Beisvogel (Padda oryzivora) (Art. Retevogel}. -
10. Tangara ('Rhamphocehis Tyrasiliensis) (Art. Tan#aren). -
11. Socopvogel (I,eiofhrix Juteus) (Art. SomunvoffA) -
12. Dominikanerfink (Paroraria dominicana)..-
13. Kardinal,
virginische Nachtigall (Cardinalii viriniatius ) ( 12, 13
Aj-t.Kas°£isi<tf)o
402
Stück - Studieren.
Stück, s. v. w. Geschütz.
Stuckatur, s. Stuck.
Stücke in Esther, s. Esther.
Stückelalgen, s. v. w. Diatomaceen, s. Algen, S.
343.
Stückelberg, Ernst, Maler, geb. 22. Febr. 1831 zu
Basel, ging 1850 auf die Antwerpener Akademie, von da nach Paris,
1854 nach München, 1856 nach Italien, wo er ein Jahrzehnt
blieb, und ließ sich dann in Basel nieder. Von seinen
poetisch empfundenen und zart gemalten Bildern sind die
hervorragendsten: Prozession im Sabinergebirge (1859-60, Museum zu
Basel); Kirchgang aus "Faust" (1865); der Kindergottesdienst,
Marionetten, Jugendliebe (Museum in Köln); Echo und Narkissos,
als Pendants; Zigeuner an der Birs; der Eremit von Maranno; das
helvetische Siegesopfer. 1877 malte er ein großes Fresko:
Erwachen der Kunst, in der Kunsthalle zu Basel, und im selben Jahr
erhielt er den ersten Preis für Entwürfe zu Fresken der
neuen Tell-Kapelle am Vierwaldstätter See, welche er bis 1887
ausführte.
Stückelung (franz. coupure), im Münzwesen und
bei Wertpapieren die Festsetzung der Teilmünzen und der
Appoints (s. d.).
Stückfaß, Gebinde Wein, in Frankfurt a. M. = 8
¼ Ohm, in Leipzig = 4, in Nürnberg = 15 bis 15 ½
Eimer Visiermaß. Das dänische Stykfad à 5 Oxhoft
= 11,231 hl.
Stückgießerei, s. v. w.
Geschützgießerei (s. d.).
Stückgut, Bronze zu Geschützen.
Stückgüter (auch zählende Güter),
Waren, welche nach der Zahl (Groß, Dutzend, Schock, Ballen
etc.) angegeben werden, beim Eisenbahn- und Wassertransport
diejenigen, welche nicht in ganzen Wagen- oder Schiffsladungen,
sondern als besondere Frachtstücke oder Kolli (s. d.)
aufgegeben werden. Vgl. Eisenbahntarife.
Stückjunker, im 17. und 18. Jahrh. Name des
Fähnrichs bei der Artillerie.
Stückkugel, s. Geschoß, S. 213.
Stücklohn, s. Arbeitslohn, S. 759.
Stuckmarmor, s. Gips, S. 357.
Stückzahlung, s. v. w. Abschlagszahlung.
Stückzinsen, bei Wertpapieren derjenige Teil vom
Betrag des nächstfälligen Zinskoupons, welcher auf die
seit dem letzten Zinstermin verflossene Zeit entfällt.
Stud., Abkürzung für Studiosus, Student; z. B.
Stud. arch. nav., für St. architecturae navalis, Studierender
des Schiffbaues (an technischen Hochschulen); Stud. phil.,
Studierender der Philosophie; Stud. philol., Studierender der
Philologie; Stud. rer. nat., für St. rerum naturalium,
Studierender der Naturwissenschaften.
Stud., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung
für B. Studer (s.d.).
Stud-book (engl., spr. stodd-buck), "Gestütbuch",
das Verzeichnis der in einem Land vorhandenen Vollbluttiere nebst
deren Pedigree (s. d.).
Studemund, Wilhelm, namhafter Philolog, geb. 3. Juli 1843
zu Stettin, studierte 1860-63 in Berlin und Halle, hielt sich
1864-66 zu wissenschaftlichen Zwecken in Italien auf und fertigte
besonders eine Abschrift des berühmten Mailänder
Palimpsestes des Plautus, privatisierte dann in Halle, verglich
1867 bis 1868 in Verona auf Anregung der Berliner Akademie das
Palimpsest des Gajus, wurde 1868 außerordentlicher und 1869
ordentlicher Professor der Philologie in Würzburg, 1870 in
Greifswald und 1872 in Straßburg, wo er auch die Leitung des
philologischen Seminars übernahm. Seit 1885 als ordentlicher
Professor und Mitdirektor des philologischen Seminars an der
Universität Breslau wirkend und 1889 zum Geheimen
Regierungsrat ernannt, starb er daselbst 9. Aug. 1889. S. ist
hochverdient um die lateinische Paläographie und die Kritik
des Plautus sowie um die griechischen Musiker und Metriker. Er
veröffentlichte: "De canticis Plautinis"
(Inauguraldissertation, Berl. 1864), "Studien auf dem Gebiet des
archaischen Lateins" (Bd. 1, das. 1873), "Analecta Liviana" (mit
Th. Mommsen, Leipz. 1873), "Gaji institutionum codicis Veronensis
apographum" (das. 1874), eine Handausgabe des Gajus (mit P.
Krüger; 2. Aufl., Berl. 1884), "Anecdota varia graeca musica,
metrica, grammatica" (das. 1886) und zahlreiche Abhandlungen,
besonders zu Plautus, von dessen "Vidularia" er auch eine Ausgabe
besorgte (Greifsw. 1870, 2. Aufl. 1883).
Student (lat.), s. Studieren.
Studer, Bernhard, Geolog, geb. 21. Aug. 1794 zu
Büren im Kanton Bern, studierte anfangs in Bern Theologie,
wandte sich aber mathematischen und naturwissenschaftlichen Studien
zu und wurde 1815 Lehrer am Gymnasium zu Bern, studierte dann in
Göttingen und Paris Geologie und Astronomie, begleitete
Leopold v. Buch auf mehreren Alpenreisen und widmete sich seitdem
hauptsächlich der Erforschung der Alpen. 1825 erhielt er die
für ihn errichtete Professur der Geologie in Bern, die er bis
1873 innehatte. Er starb 2. Mai 1887 in Bern. Von seinen Schriften
sind zu nennen: "Monographie der Molasse" (Bern 1825); "Geologie
der westlichen Schweizeralpen" (Heidelb. 1834); "Anfangsgründe
der mathematischen Geographie" (2. Aufl., Bern 1842); "Die
Gebirgsmasse von Davos" (das. 1837); "Lehrbuch der physikalischen
Geographie und Geologie" (das. 1844-47, 2 Bde.); "Hauteurs
barometriques prises dans le Piémont, en Valois et en
Savoie" (mit Escher von der Linth, das. 1843); "Geologie der
Schweiz" (das. 1851-53, 2 Bde.); "Einleitung in das Studium der
Physik und Elemente der Mechanik" (das. 1859); "Geschichte der
physischen Geographie der Schweiz" (Zürich 1863); "Über
den Ursprung der Schweizer Seen" (Genf 1864); "Zur Geologie der
Berner Alpen" (Stuttg. 1866); "Index der Petrographie und
Stratigraphie der Schweiz" (Bern 1872); "Gneis und Granit der
Alpen" (Berl. 1873). Auch bearbeitete er mit Escher von der Linth
die treffliche "Carte géologique de la Suisse" (Winterth.
1853, 2. Aufl. 1870, in 4 Blättern) und eine
Übersichtskarte in 1 Blatt. In den letzten Jahren widmete er
sich besonders der auf seine Anregung von der Schweizerischen
Naturforschenden Gesellschaft beschlossenen Herausgabe von
"Beiträgen zu einer geologischen Karte der Schweiz" und der
geologischen Kolorierung der großen Schweizerkarte von
Dufour. 1885 legte er das Präsidium der schweizerischen
geologischen Kommission nieder. - Sein Vetter Gottlieb S., geb.
1804 zu Bern, lebt als Bibliothekar daselbst und ist bekannt als
Mitbegründer des Schweizer Alpenklubs und durch die wertvollen
Schriften: "Berg- und Gletscherfahrten" (mit Ulrich und Weilenmann,
Zürich 1859-63, 2 Bde.); "Über Eis und Schnee. Die
höchsten Gipfel der Schweiz und die Geschichte ihrer
Besteigung" (Bern 1869-83, 4 Bde.).
Studie (v. lat. studium), Übungsstück,
Vorarbeit zu einem Kunstwerk, besonders in der Malerei etc.
Studienanstalten, in Bayern amtliche Bezeichnung der
Gymnasien; s. Gymnasium, S. 962.
Studieren (lat.), wissenschaftlich forschen, etwas
wissenschaftlich betreiben; zu diesem Zweck eine Hochschule
besuchen. Student, Studiosus, ein Stu-
403
Studio - Stuhlzwang.
dierender, besonders auf einer Hochschule (vgl.
Universitäten).
Studio (Bruder S.), scherzhaft für Studiosus,
Student.
Studium (lat., Mehrzahl: Studien), wissenschaftliche
Forschung sowie der Gegenstand derselben; auch Werkstätte
eines bildenden Künstlers (ital. studio). Als akademisches S.
pflegt man die Bildungszeit zu bezeichnen, die jemand auf der
Universität zubringt.
Studjianka, Dorf, s. Borissow.
Studley Royal (spr. stoddli reu-el), s. Ripon.
Stuer, Lehngut in Mecklenburg-Schwerin, am Plauer See,
hat eine evang. Kirche, eine Burgruine, eine besuchte
Wasserheilanstalt und (1885) 173 Einw.
Stuerbout (spr. stührbaut), Maler, s. Bouts.
Stufe, ein Stück Gestein oder Erz; Fundstufe, am
Fundort von dem gefundenen Mineral genommene Probe; auch ein vom
Markscheider oder einem Bergbeamten in das Gestein eingehauenes
Merk- oder Grenzzeichen.
Stufenerz, s. v. w. Stuferz.
Stufengebete (Staffelngebete) heißen die Gebete,
welche am Anfang der Messe von dem Celebranten und dem Altardiener
auf der untersten Stufe des Altars gesungen werden.
Stufenjahre, s. Klimakterische Jahre.
Stufenlieder, s. Psalmen.
Stufenscheibe, s. Riemenräderwerke.
Stufenschnitt, in der Heraldik, s. Heroldsfiguren.
Stuferz (Stufferz), derbes Erz; edle Stuferze, reine
gediegene Erzstücke, welche keiner Aufbereitung auf Pochwerken
etc. bedürfen.
Stuhl, früher Bezeichnung gewisser hoher
Gerichtsbarkeiten, z. B. Schöppenstuhl; in Siebenbürgen
früher s. v. w. Gerichtsbezirk (daher Stuhlrichter etc.).
Stühle. Über die S. der Alten s. Sella. Im
frühern Mittelalter kommt der Stuhl noch selten vor und
dann nur als Thronstuhl für hohe Würdenträger oder
als Ehrensitz für das Familienhaupt. Die übrigen
Familienmitglieder setzten sich auf Schemel, Bänke, Truhen,
Klappstühle, Sessel. Am Ende des 11. Jahrh. findet man Schemel
mit Rückenlehnen im täglichen Gebrauch, doch immer nur
noch bei Vornehmen. Im 13. Jahrh. wird die Sitzplatte sechs- bis
achteckig, und das Gerät hat die entsprechende gleiche Zahl
von Beinen oder Stützen; für den Richterstuhl besteht aus
jener Zeit die Vorschrift, daß er vierbeinig sein soll.
Ebenfalls im 13. Jahrh. fertigte man auch schon S. aus dünnen
Eisenstäben, deren Sitze aus Riemen oder Gurten bereitet und
mit Kissen belegt wurden. Sehr kostbar waren und blieben das ganze
Mittelalter hindurch die byzantinischen und römischen
Prachtstühle, die besonders hohe und mit Schnitzereien
gezierte Rücklehnen sowie geschweifte oder gedrechselte
Säulen und Füße hatten. Ein solcher Prachtstuhl,
der in der Regel mit einem gestickten oder gewirkten Überzug
bedeckt war, stand nie frei, sondern meist vor der Mitte einer
Wand.
Stuhlfeier Petri, s. Petri Stuhlfeier.
Stuhlgericht, s. v. w. Femgericht.
Stuhlherr (Gerichtsherr), bei den frühern
Patrimonialgerichten der Inhaber der Patrimonialgerichtsbarkeit (s.
d.); bei den Femgerichten (s. d.) des Mittelalters der Inhaber des
sogen. Freistuhls und der Patronatsherr des Gerichts.
Stühlingen, Stadt im bad. Kreis Waldshut, an der
Wutach und der Linie Oberlauchringen-Weizen der Badischen
Staatsbahn, 501 m ü. M., Hauptstadt der dem Fürsten von
Fürstenberg gehörigen gleichnamigen Standesherrschaft,
hat ein Bergschloß (Hohenlupfen), ein Hauptzollamt, eine
Bezirksforstei, Baumwollzwirnerei, Gerberei, eine Kunstmühle
und (1885) 1244 Einw. 1849 wurden hier römische Mauern mit
Mosaikboden gefunden.
Stuhlrohr, s. v. w. Spanisches Rohr.
Stuhlverstopfuug (Obstruktion), Hemmung der normalen
Darmentleerung. Die S. ist keine selbständige Krankheit,
sondern nur das Symptom einer solchen und begleitet eine
große Zahl von Darmleiden. Entweder hat die S. ihre Ursache
darin, daß an irgend einer Stelle des Darmrohrs eine
Verengerung, Einklemmung oder Verschlingung eingetreten ist, welche
mechanisch das Hineingelangen des Inhalts in den Mastdarm und seine
Entleerung hindert, oder es liegt bei freier Wegsamkeit eine mehr
oder weniger vollständige Lähmung der Darmbewegung
(Peristaltik) dem Übel zu Grunde. Eine solche Trägheit in
der wurmförmigen Zusammenziehung kann künstlich durch
sogen. stopfende Mittel, Tannin und besonders Opium, hervorgerufen
werden; gemeiniglich ist sie eine Folge vorausgegangener abnorm
lebhafter Bewegungen, wie sie bei Darmkatarrhen,
Darmentzündungen, choleraähnlichen Durchfällen oder
beim Typhus vorkommen; zuweilen ist die üble Angewohnheit der
seltenen Stuhlentleerung schuld an der S., in noch andern
Fällen mag eine organische Erkrankung des Nervenapparats,
welcher in der Darmwand selbst liegt, die Ursache der sogen.
habituellen S. (Hartleibigkeit) sein. Die leichtern Grade der S.,
welche ungemein häufig nach kleinen Diätfehlern
auftreten, weichen der Anwendung milder Abführmittel, wie
Rizinusöl, Senna, oder dem Gebrauch einiger Gläser
Bitterwasser. Die hartnäckigen Fälle erfordern eine
sorgfältige Behandlung des ursachlichen Darmleidens; bei
habitueller S. ist die Diät zu regeln, für Bewegung und
Erhaltung eines guten Allgemeinbefindens zu sorgen und bei
bestehender hypochondrischer Verstimmung künstlich durch milde
Arzneien vollständige und tägliche Öffnung des
Leibes zu schaffen.
Stuhlweißenburg (ungar. Szekesfehervar, lat. Alba
regia), königliche Freistadt im ungar. Komitat
Weißenburg und Knotenpunkt der Süd- und Ungarischen
Westbahn, hat einen Dom, unter dem außer alten
Königsgräbern auch die Basilika Stephans des Heiligen
gefunden wurde, eine bischöfliche Residenz mit Bibliothek, 3
Klöster, eine schöne Seminarkirche, ein neues Theater,
eine große Honvedkaserne, ein Denkmal des Dichters
Vörösmarty (von Vay) und (1881) 25,612 Einw., die
lebhaften Handel (bedeutend sind die Pferdemärkte) und Gewerbe
treiben. S. hat ein katholisches Obergymnasium, ein
Priesterseminar, eine Real- und eine Handelsschule, ein
Militärhengstedepot und ist Sitz des Komitats, eines
römisch-katholischen Bischofs, Domkapitels und Gerichtshofs. -
Von Stephan dem Heiligen zur Krönungsstadt erhoben, war S.
seitdem meist Residenz und Begräbnisstätte der
ungarischen Könige, bis erstere zur Zeit des Königs Bela
IV. nach Ofen verlegt wurde. 1543 fiel die Stadt den Türken
durch Kapitulation in die Hände. Infolge der hier 3. Nov. 1593
und 6. Sept. 1601 von den Kaiserlichen über die Türken
erfochtenen Siege kam die Stadt wieder in den Besitz der erstern,
aber schon 1602 durch Meuterei der Besatzung von neuem in die
Gewalt der Türken, welche sie erst 1688 verließen.
Stuhlwinde, s. Aufzüge, S. 70.
Stuhlzeug, Roßhaargewebe zum Beziehen von
Möbeln.
Stuhlzwang (Tenesmus), das schmerzhafte Drängen zum
Stuhl, wobei aber nur geringe Kotmassen
404
Stuhm - Stumpfsinn.
entleert werden, oder welches auch gänzlich erfolglos
bleibt. Der S. beruht auf krampfhafter Zusammenziehung der
Muskulatur des Dickdarms und des Afterschließmuskels und ist
konstantes Symptom der Dickdarmentzündungen bei Katarrhen,
namentlich des Mastdarms, bei Reizungen durch Würmer und
vornehmlich bei Ruhr, Typhus etc. Der S. hört mit erfolgtem
Stuhl auf, oder dauert noch eine Weile fort; er kann ein
äußerst quälendes Symptom darstellen.
Stuhm, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk
Marienwerder, an zwei Seen und an der Linie Thorn-Marienburg der
Preußischen Staatsbahn, hat eine evangelische und eine kath.
Kirche, ein altes Schloß, Amtsgericht, Pferdemärkte und
(1885) 2238 Einw.
Stuhmsdorf, Dorf im preuß. Regierungsbezirk
Marienwerder, Kreis Stuhm, hat eine kath. Kirche und 602 Einw. Hier
wurde 12. Sept. 1635 unter französischer Vermittelung ein
Waffenstillstand auf 26 Jahre zwischen Schweden und Polen
geschlossen.
Stuhr, Peter Feddersen, Geschichtsforscher, geb. 28. Mai
1787 zu Flensburg, ließ sich nach beendetem akademischen
Studium 1810 in Heidelberg nieder und machte sich durch seine
Polemik gegen Niebuhr in der Schrift "Über den Untergang der
Naturstaaten" (Berl. 1817) bekannt. Nachdem er den Feldzug von 1813
in der hanseatischen Legion und den von 1815 in der
preußischen Landwehr, dann im 6. Ulanenregiment mitgemacht,
erhielt er eine Anstellung als Sekretär bei der
Militärstudienkommission in Berlin und 1826 eine
außerordentliche Professur daselbst. Er starb 13. März
1851 in Berlin. Von seinen Arbeiten sind noch hervorzuheben: "Die
Staaten des Altertums und die christliche Zeit in ihrem Gegensatz"
(Heidelb. 1811); "Die Religionssysteme der heidnischen Völker
des Orients" (Berl. 1836) und der Hellenen" (das. 1838); "Die drei
letzten Feldzüge gegen Napoleon" (Lemgo 1832, Bd. 1); "Der
Siebenjährige Krieg" (das. 1834); "Geschichte der See- und
Kolonialmacht des Großen Kurfürsten" (Berl. 1839);
"Forschungen und Erläuterungen über Hauptpunkte der
Geschichte des Siebenjährigen Kriegs" (Hamb. 1842, 2
Bde.).
Stuiben, Berg in den Algäuer Alpen, südwestlich
von Immenstadt, 1764 m hoch, mit Wirtshaus.
Stuifen, Bergkegel an der Nordwestseite des Albuch
(Schwäbischer Jura) im württembergischen Jagstkreis,
erreicht 756 m Höhe.
Stuiver, Münze, s. Stüber.
Stüler, Friedrich August, Architekt, geb. 28. Jan.
1800 zu Mühlhausen in Thüringen, bildete sich zu Berlin
nach Schinkel, bereiste 1829 und 1830 Frankreich und Italien, ward
Hofbauinspektor und 1832 Hofbaurat und Direktor der
Schloßbaukommission. Unter Friedrich Wilhelm IV.
eröffnete sich ihm ein bedeutender Wirkungskreis. Außer
den "Vorlegeblättern für Möbeltischler" , welche er
mit Strack in 4 Heften (1835 ff.) herausgab, sind unter seinen
architektonischen Entwürfen die im "Album des
Preußischen Architektenvereins" (Potsd. 1837 ff.)
erschienenen hervorzuheben, ferner die zu dem neuen Rathaus in
Perleberg, zum Wiederaufbau des Winterpalais in Petersburg, zu den
Schloßbauten in Boitzenburg, Basedow, Arendsee, Dalwitz und
zu der katholischen Kirche in Rheda. Seine bedeutendste
Schöpfung ist das Neue Museum in Berlin. Auch der Kuppelbau
auf dem Triumphbogen des Hauptportals des königlichen
Schlosses ist sein Werk. Andre Bauten von ihm sind: die Alte
Börse zu Frankfurt a. M. (1844), die Matthäus-, Jacobus-,
Markus- und Bartholomäuskirche in Berlin, mehrere
Prachtanlagen im Park von Sanssouci, die Nikolaikirche zu Potsdam,
die Vollendung des großherzoglichen Schlosses zu Schwerin,
die Universität zu Königsberg, das Nationalmuseum zu
Stockholm, die Akademie zu Pest. Endlich lieferte er eine Menge
dekorativer Zeichnungen für Gußwerke,
Porzellangefäße, Silberarbeiten etc. S. starb 18.
März 1865 in Berlin.
Stultitia (lat.), Thorheit; Stultus, Thor.
Stumm, Karl Ferdinand, Freiherr von, Industrieller, geb.
30. März 1836 zu Saarbrücken, besuchte die
Universitäten Bonn und Berlin und übernahm sodann die
Leitung der von seinem Vater gegründeten großen
Eisenhüttenwerke in Neunkirchen. 1870/71 führte er als
Rittmeister der Landwehr eine Ulanenschwadron; auch erhielt er von
der Regierung den Titel eines Geheimen Kommerzienrats. Er wurde
1867 gleichzeitig in das preußische Abgeordnetenhaus und den
Reichstag gewählt und gehörte dem erstern bis 1870, dem
andern bis 1881 und wieder seit 1889 an. 1882 wurde er zum Mitglied
des Herrenhauses ernannt und 1888 in den Freiherrenstand erhoben.
Mitglied der deutschen Reichspartei, unterstützte er
namentlich die wirtschaftlichen Reformen Bismarcks, sowohl die
schutzzöllnerische Tarifreform von 1879 als die
Maßregeln für den Schutz des Handwerks und der Arbeiter.
Sein Bruder Ferdinand, Freiherr von S., geb. 1843 zu Neunkirchen,
machte als Offizier die Feldzüge gegen Dänemark (1864) u.
Österreich (1866) mit, nahm 1868 am Feldzug der Engländer
gegen Abessinien teil, trat 1869 zur diplomatischen Laufbahn
über, kämpfte aber 1870/71 im Kriege gegen Frankreich und
ward 1883 zum Gesandten in Darmstadt, 1885 in Kopenhagen, 1887 in
Madrid ernannt. 1888 ward er Botschafter des Deutschen Reichs in
Madrid und in den Freiherrenstand erhoben.
Stummelaffe (Colobus Illig.), Gattung aus der Familie der
Schmalnasen (Catarrhini) und der Unterfamilie der Hundsaffen,
stehen den Schlankaffen (s. d.) sehr nahe, haben aber an den
Vorderhänden nur Daumenrudimente; ihr Leib ist schlank, die
Schnauze kurz, der Schwanz sehr lang; sie besitzen
Gesäßschwielen, aber keine Backentaschen. Die Guereza
(C. Guereza Rüpp.), 65 cm lang, mit 70 cm langem Schwanz, ist
schwarz mit silbergrauer Kehle und Stirnbinde und grauer
Seitenmähne u. Schwanzquaste; er bewohnt Abessinien, lebt fast
nur auf Bäumen, ist höchst behende, durchaus harmlos und
nährt sich von Blättern, Früchten und Insekten. Zu
derselben Gattung gehören der Bärenstummelaffe (C.
ursinus Wagn.), in Westafrika, und der Teufelsaffe(C. Satanas
Wagn.), auf Fernando Po.
Stumme Rollen, im Theaterwesen Rollen, in welchen der
Schauspieler nicht spricht oder singt, sondern sich einzig und
allein durch die Gebärdensprache zu verstehen gibt (z. B. in
der "Stummen von Portici").
Stummheit, das Unvermögen, artikulierte Laute
hervorzubringen, zeigt sich bei Krankheiten des Gehirns
(Schlagfluß, Epilepsie etc.) und der Sprachwerkzeuge, auch
bei Taubheit (Taubstummheit).
Stumpf, s. Juxtabuch.
Stumpfsinn (Stupor), ein Seelenzustand, bei welchem alle
Thätigkeit des Gehirns daniederliegt. Teils als
selbständige Geisteskrankheit, teils als Teilerscheinung
mannigfacher Symptomenkomplexe (Melancholie, paralytische
Geistesstörung) aufgefaßt, stellt der S. den
höchsten Grad des Schwachsinns dar, welcher durch die
gänzliche Aufhebung aller willkürlichen psychischen wie
motorischen Äußerungen charakterisiert ist. Man sieht
diese Kranken im Zustand völliger Geistesabwesenheit und
Regungslosigkeit durch Tage und Wo-
405
Stunde - Sturdza.
chen verharren; keine Frage wird beantwortet, kein
äußerer Eindruck kommt zum Bewußtsein, das
Gefühl gegen Frost und Hitze, gegen Schmerzen und andere
Sinneseindrücke ist verloren. Der Harn u. Speichel
fließen unwillkürlich ab, die Kranken verunreinigen
sich, sie müssen künstlich ernährt werden, da sie
sonst verhungern oder verdursten würden. Zuweilen ist mit dem
S. eine eigentümliche Starrsucht (Flexibilitas cerea)
verbunden, bei welcher die Muskeln gespannt, ja bretthart sind und
in der einmal eingenommenen Stellung ohne Regung, ohne
Ermüdung verharren. Die Ursache dieses Zustandes ist
unbekannt. Der S. geht zuweilen in Genesung über, sofern er
akut und als einzige Geistesstörung auftritt; bildet er den
Ausgang chronischer, in Schwachsinn übergehender
Geisteskrankheiten, so führt er ziemlich jäh den letzten
Abschnitt dieser Leiden zu Ende.
Stunde, der 24. Teil eines Tags, der wieder in 60 Minuten
à 60 Sekunden geteilt wird. Die Zeichen dafür sind h,
d. h. hora oder S., m und s; es ist also 5 h 12 m 51,5 s soviel wie
5 Stunden 12 Min. 51,5 Sek. Die meisten zivilisierten Völker
fangen jetzt die erste S. des Tags im bürgerlichen Leben nach
dem Eintritt der Mitternacht an zu zählen, zählen aber
nur bis 12 und beginnen zu Mittag wieder von vorn, so daß der
Tag in zweimal 12 Stunden (Vormittag [a. m. = ante meridiem] und
Nachmittag [p. m. = post m.]) zerfällt. In einem großen
Teil Italiens aber zählte man bis zur neuesten Zeit die
Stunden vom Sonnenuntergang an fortlaufend von 1-24. Ebenso pflegen
die Astronomen zu zählen, aber von Mittag an. S. als
Wegmaß (Wegstunde) = 5km.
Stundenglas, s. v. w. Sanduhr.
Stundenkreis, jeder größte Kreis der
Himmelskugel, welcher durch beide Pole geht, also den Äquator
senkrecht schneidet, gleichbedeutend mit Deklinationskreis; vgl.
Himmel, S. 545.
Stundenwinkel, der Winkel zwischen dem Deklinationskreis
eines Sterns und dem Meridian; vgl. Himmel, S. 546.
Stundisten (russ. Stundisty, vom deutschen "Stunde" im
Sinn von Betstunde), Name einer um 1870 im Gouvernement Kiew
gebildeten religiösen Sekte, die in Südrußland
weite Verbreitung gefunden hat. Die S. verwerfen jede
Priesterherrschaft, die Sakramente und äußern
gottesdienstlichen Gebrauche und begegnen sich, indem sie das
Hauptgewicht auf die religiöse Erweckung legen, mannigfach mit
dem protestantischen Pietismus.
Stundung, Fristerteilung von seiten des Gläubigers
dem Schuldner gegenüber in Ansehung einer an und für sich
fälligen Forderung. Die nach gemeinem deutschen Recht auch
gegen den Willen des Gläubigers zulässige S. durch die
Staatsgewalt ist nach der deutschen Zivilprozeßordnung nicht
mehr statthaft.
Stupa, s. Tope.
Stupefaktion (lat.), Bestürzung; Stupefacientia,
betäubende Mittel; stupend, erstaunlich.
Stüpfelmaschine, s. Schablonenstechmaschine.
Stupid (lat.), stumpfsinnig, dumm.
Stupor (lat.), Erstarrung, dumpfe Starrheit; als
Geisteskrankheit s. v. w. Stumpfsinn (s. o.).
Stupp, Quecksilberruß, s. Quecksilber.
Stuprum (lat.), außerehelicher Beischlaf; Stuprata,
die Geschändete, Geschwächte; Stuprator, der
Schwängerer.
Stur, 1)(Stúr, spr. schtur) Ludewit, slowak.
Schriftsteller u. Patriot, geb. 23. Okt. 1815 zu Uhrowez im
ungarischen Komitat Trentschin, protestantischer Abkunft, studierte
in Preßburg und Halle und bekleidete 1840-43 eine Professur
am Lyceum zu Preßburg, der Hauptpflanzstätte der
litterarischen und patriotischen Bewegung der Slowaken, der er sich
mit Begeisterung anschloß. Fortan ganz der Litteratur
zugewendet, verteidigte er in mehreren Schriften in deutscher
Sprache die Rechte der Slowaken gegen die Angriffe der Magyaren und
gründete 1845 die Zeitung "Slovenske narodnie Novini"
("Slowakische Nationalzeitung") mit der litterarischen Beilage
"Orol Tatranski" ("Der Adler von der Tatra"), worin er sich statt
des bisher üblichen Tschechischen der slowakischen
Volkssprache (und zwar im Dialekt seiner Heimat) bediente, die
hierdurch zur Schriftsprache bei den protestantischen Slowaken
erhoben wurde. Im J. 1847 wurde S. von Altsohl in den Reichstag zu
Preßburg gewählt, wo er mit glänzender Beredsamkeit
für die Rechte seines Volkes auftrat; nach Ausbruch des
Aufstandes 1848 floh er nach Wien, nahm dann am
Slowakenkongreß zu Prag teil, blieb aber nach wie vor der
Hauptleiter der Bewegung gegen die Ungarn, die sogar einen Preis
auf seinen Kopf setzten. Später in Zurückgezogenheit
seinen litterarischen Arbeiten lebend, starb er 12. Jan. 1856
infolge einer Wunde, die er sich auf der Jagd zugezogen hatte. Von
seinen Schriften sind noch "Zpevy i pisne" ("Gesänge und
Lieder", Preßb. 1853) und das in tschechischer Sprache
abgefaßte Werk "Über die Volkslieder und Märchen
der slawischen Stämme" (Prag 1853) zu erwähnen. Auch
hinterließ er im Manuskript ein deutsch geschriebenes Werk
aus den Jahren 1852 bis 1853, das eine Darstellung seiner Theorie
des Panslawismus enthält und in russischer Übersetzung
von Lamanskij unter dem Titel: "Das Slawentum und die Welt der
Zukunft" (Mosk. 1867) erschien.
2) Dionys, Geolog und Paläontolog, geb. 1827 zu Beczko
(Ungarn), besuchte die hohen Schulen von Modern und Preßburg,
studierte in Wien und Schemnitz, wurde 1850 Mitglied der k. k.
geologischen Reichsanstalt in Wien und 1877 Vizedirektor derselben.
Er lieferte zahlreiche Arbeiten, namentlich über
Pflanzenpaläontologie, und schrieb: "Geologie der Steiermark"
(Graz 1871, mit Karte); "Die Kulmflora des
mährisch-schlesischen Dachschiefers"(Wien 1875); "Die
Kulmflora der Ostrauer und Waldenburger Schichten" (das. 1877);
"Die Karbonflora der Schatzlarer Schichten" (das. 1885-87) u.
a.
Stura, Fluß in der ital. Landschaft Piemont,
entspringt auf der Höhe des Monte Argentera in den Seealpen,
tritt vor Cuneo in die oberitalienische Tiefebene und mündet
bei Cherasco in den Tanaro; 110 km lang. Noch drei andre
Wasserläufe im Piemontesischen heißen S.
Sturdza (Stourdza), moldauische Bojarenfamilie, die
urkundlich bis in den Anfang des 15. Jahrh. hinaufreicht. Gregor S.
war unter dem Fürsten Kallimachi Kanzler der Moldau und
leitete die Abfassung des 1817 erschienenen moldauischen
Gesetzbuchs. Als nach der langen Fremdenherrschaft der Fanarioten
der Hospodarensitz der Moldau wieder von Rumänen eingenommen
wurde, waren es zwei Sturdzas, die nacheinander denselben
besetzten: Johann S. (1822-28) und Michael S. (1834 bis 1. Mai
1849). Die Regierung beider war sehr erschwert durch das auf den
Donaufürstentümern lastende russische Protektorat. Johann
S. mußte einer russischen Besitznahme der Moldau weichen, die
1828-34 währte. Michael Sturdzas (geb. 14. April 1795, gest.
8. Mai 1884 in Paris) 14jährige Regierung wurde verhaßt
durch den russischen Zuschnitt, den er dem Fürstentum zu geben
sich bemühte (s. Walachei, Ge-
406
Sture - Sturm
schichte). Vgl. "Michel Stourdza et son administration"
(Brüssel 1848); "Michel Stourdza, ancien prince regnant de
Moldavie" (Par. 1874). Sein Sohn Gregor, geb. 1821, ist ein
Hauptvertreter der russischen Partei in Rumänien.
Außerdem haben sich einen Namen gemacht:
1) Alexander S., geb. 29. Nov. 1791, Sohn eines moldauischen
Bojaren, der als politisch Kompromittierter 1792 nach Rußland
auswanderte, erhielt seine Bildung in Deutschland und suchte sich
nach seiner Rückkehr nach Rußland der dortigen Regierung
als loyaler Publizist bemerklich zu machen. Seine Schrift
"Betrachtungen über die Lehre und den Geist der orthodoxen
Kirche" (deutsch, Leipz. 1817) erwarb ihm die Würde eines
russischen Staatsrats. Auf dem Kongreß zu Aachen schrieb er
im Auftrag seines Kaisers ein "Memoire sur l'etat actuel de
l'Allemagne" (deutsch in den "Politischen Annalen" 1819), worin er
unter andern ungerechten Urteilen über Deutschland namentlich
die deutschen Universitäten als Pflanzschulen
revolutionären Geistes und des Atheismus hinstellte. Die
bedeutendsten Gegenschriften sind: "Coup d'oeil sur les universites
de l'Allemagne" (Aach. 1818) und von Krug (Leipz. 1819). S. zog
sich 1819 nach Dresden zurück, wo er sich mit einer Tochter
Hufelands verheiratete, und 1820 auf seine Güter in der
Ukraine und lebte später zu Odessa, sich der Einrichtung und
Leitung wohlthätiger Anstalten, unter andern eines
Diakonissenvereins, widmend. Er starb 25. Juni 1854 zu Mansyr in
Bessarabien. Von seinen übrigen Schriften ist hervorzuheben
"La Grece en 1821" (Leipz. 1822). Nach seinem Tod wurden
herausgegeben: "OEuvres posthumes religieuses, historiques,
philosophiques et litteraires" (Par. 1858-61, 5 Bde.).
2) Demeter S. von Miclauscheni, rumän. Staatsmann und
Schriftsteller, geb. 10. März 1833, studierte in München,
Göttingen, Bonn und Berlin, war 1857 Kanzleichef des Diwans ad
hoc der Moldau, 1866 einer der eifrigsten Mitarbeiter an dem Sturz
des Fürsten Alexander Cusa, 1866 bei der Wahl des Fürsten
Karl von Hohenzollern als Mitglied (Minister der öffentlichen
Arbeiten) der provisorischen Regierung thätig und bekleidete
im Kabinett Bratianus 1876-88 wiederholt den Ministerposten der
öffentlichen Arbeiten, der Finanzen, des Äußern und
des Unterrichts. Als Generalsekretär der rumänischen
Akademie leitet er die Herausgabe von zwei großen
Quellenwerken über rumänische Geschichte (Hurmuzakis
"Documente privitoare la Istoria Romanilor", Bukar. 1876-89, 11
Bde., u. Sturdzas "Acte si Documente privitoare la Istoria
Renascerei Romaniei", das. 1888-89, 3 Bde.). Er schrieb mehrere
historische und numismatische Abhandlungen, z. B. "La marche
progressive de la Russie sur le Danube" (Wien 1878); "Rumänien
und der Vertrag von San Stefano" (das. 1878); "Übersicht der
Münzen und Medaillen des Fürstentums Rumänien,
Moldau u. Walachei" (das. 1874); "Memoriu asupra numismaticei
romanesci" (Bukar. 1878).
Sture, altadliges Geschlecht in Schweden, das 1716
erlosch. Sten S. der ältere, Reichsvorsteher von Schweden,
Sohn Gustav Amundssons S. und Schwestersohn Karl Knutsons, ward
nach dessen Tod 1470 Reichsvorsteher und besiegte den
Dänenkönig Christian I. 10. Okt. am Brunkeberg. Er
errichtete 1476 die Universität zu Upsala, führte die
Buchdruckerei in Schweden ein und versöhnte sich 1497 mit
König Johann von Dänemark, der bloß den Titel eines
Königs von Schweden führte, während S. Regent war.
Er starb 13. Dez. 1503 in Jönkoping, wahrscheinlich an Gift.
Vgl. Palmen, Sten Stures strid med konung Hans (Helsingf. 1884);
Blink, Sten S. den äldre och hans samtider (Stockh. 1889). Ein
Seitenverwandter von ihm, Svante Nilsson S., folgte ihm als
Reichsvorsteher. Derselbe setzte den Krieg gegen die Dänen
fort, eroberte Kalmar, welches dieselben besetzt hielten, und
schlug Johann zu wiederholten Malen, starb aber schon 2. Jan. 1512
in Westeras, worauf sein Sohn Sten S. der jüngere 23. Juli
1512 zum Reichsverweser erwählt wurde. Er unterlag in der
Schlacht bei Bogesund, in welcher er verwundet wurde, den
Dänen und starb auf dem Weg nach Stockholm 3. Febr. 1520.
Seine Leiche wurde nach dem Stockholmer Blutbad auf einem
Scheiterhaufen verbrannt.
Sturluson, s. Snorri Sturluson.
Sturm, heftiger Wind (s. d.). Im Feldkrieg heißt S.
der entscheidende Angriff auf eine vom Feind besetzte Stellung,
Ortschaft, Schanze etc., wobei es zum Handgemenge (s. d.) kommt,
wenn der Feind standhält. Der S. auf Festungswerke ist in der
Regel nur nach vorhergegangenem förmlichen Angriff
möglich (s. Festungskrieg, S. 190).
Sturm, 1) Jakob S. von Sturmeck, elsäss. Staatsmann,
geb. 10. Aug. 1489 zu Straßburg, stammte aus einer edlen
Familie des Niederrheins, widmete sich zuerst dem Studium der
Theologie auf der Universität zu Freiburg, dann der
Rechtswissenschaft in Lüttich und Paris. 1525 wurde er zum
erstenmal Stadtmeister in seiner Vaterstadt. Schon früh
schloß er sich der Reformation an und nahm 1529 an dem
Religionsgespräch zu Marburg teil, sonderte sich dann aber von
den Lutheranern , weil er ihnen die Schuld an der Spaltung der
Evangelischen zuschrieb, und überreichte 1530 im Namen
Straßburgs und andrer Städte auf dem Reichstag zu
Augsburg die Confessio tetrapolitana. Um die Aufnahme seiner
Vaterstadt in den Schmalkaldischen Bund zu erreichen, machte er
1532 Luther einige Zugeständnisse. Fortan leitete er
Straßburgs Angelegenheiten mit großer Umsicht und
vertrat ihre Interessen auf mehreren Gesandtschaften mit Geschick.
Auch gelang es ihm, 1547 nach der Schlacht bei Mühlberg die
von Karl V. auferlegte Kontribution zu ermäßigen. S. hat
die Bibliothek und ein Gymnasium in Straßburg begründet,
das bald erfreulich gedieh (s. S. 2). Er starb 30. Okt. 1553 in
Straßburg. Vgl. Baum, Jakob S. (3. Aufl., Straßb.
1872); Baumgarten, Jakob S. (das. 1876).
2) Johannes von, verdienter Schulmann, geb. 1. Okt. 1507 zu
Schleiden in der Eifel, besuchte das Gymnasium der Hieronymianer zu
Lüttich, vollendete seine Studien auf der Universität
Löwen, ward 1530 akademischer Lehrer der klassischen Sprachen
in Paris und 1537 Rektor des neugegründeten Gymnasiums zu
Straßburg, welches unter seiner Leitung europäischen Ruf
erlangte. Als eifriger Calvinist mit den Lutheranern in Streit
über die Annahme der Konkordienformel verwickelt, verlor S.
1582 seine Stelle und starb 3. März 1589 in Straßburg.
Kaiser Karl V. verlieh ihm den Reichsadel. Sturms Studienordnung,
im wesentlichen auf Melanchthons Grundsätzen erbaut, war das
Vorbild für zahlreiche Schulpläne des 16. und 17. Jahrh.
und hatte namentlich auch wesentlichen Einfluß auf die Ratio
studiorum der Jesuiten. Vgl. Schmidt, La vie et les travaux de Jean
S. (Straßb. 1855); Laas, Die Pädagogik des J. S. (Berl.
1872); Kückelhahn, J. S., Straßburgs erster Schulrektor
(Leipz. 1872); Paulsen, Geschichte des gelehrten Unterrichts (das.
1885).
407
Sturmbock - Sturmvogel.
3) Jakob, Kupferstecher und Naturforscher, geb. 21. März
1771 zu Nürnberg, gest. 28. Nov. 1848 daselbst, verdient durch
seine ikonographischen Werke über die deutsche Flora und
Fauna, nach Sturms Tod fortgesetzt von seinem Sohn Johann Wilhelm
S. (geb. 19. Juli 1808, gest. 7. Jan. 1865 in Nürnberg),
nämlich: "Deutschlands Flora in Abbildungen nach der Natur"
(Nürnb. 1798-1855, 163 Hefte mit 2472 Tafeln; 1. Abt.:
Phanerogamen, 96 Hefte, bearbeitet von Hoppe, Schreber, Sternberg,
Reichenbach und Koch; 2. Abt.: Kryptogamen mit Ausschluß der
Pilze, 31 Hefte, von Launer und Conde; 3. Abt.: Die Pilze, 36
Hefte, von Ditmar, Rostkovius, Conde, Preuß, Schnizlein und
F. v. Strauß); "Deutschlands Fauna in Abbildungen nach der
Natur" (das. 1805-57; Vögel, Amphibien, Mollusken,
Käfer).
4) Julius, Lyriker, geb. 21. Juli 1816 zu Köstritz im
Reußischen, studierte zu Jena Theologie und wirkte seit 1857
als Pfarrer in Köstritz, bis er 1885 mit dem Titel eines
Geheimen Kirchenrats in den Ruhestand trat. Von seinen Dichtungen
sind hervorzuheben: "Gedichte" (Leipz. 1850, 5. Aufl. 1882);
"Fromme Lieder" (das. 1852, 11. Aufl. 1889); "Zwei Rosen oder das
Hohelied der Liebe" (das. 1854); "Neue Gedichte" (das. 1856, 2.
Aufl. 1880); "Neue fromme Lieder und Gedichte" (das. 1858, 3. Aufl.
1880); "Für das Haus", Liedergabe (das. 1862); "Israelitische
Lieder" (3. Aufl., Halle 1881) und "Von der Pilgerfahrt" (das.
1868); ferner die neue Sammlung "Lieder und Bilder" (Leipz. 1870, 2
Tle.); "1870. Kampf- und Siegesgedichte" (Halle 1870); "Spiegel der
Zeit in Fabeln" (Leipz. 1872); "Gott grüße dich" (das.
1876, 3. Aufl. 1887); "Das Buch für meine Kinder" (das. 1877,
2. Aufl. 1880); "Immergrün", neue Lieder (das. 1879, 2. Aufl.
1888); "Märchen" (das. 1881, 2. Aufl. 1887); "Aufwärts!",
neue religiöse Gedichte (das. 1881); "Neues Fabelbuch" (5.
Aufl., das. 1881); "Dem Herrn mein Lied", religiöse Gedichte
(Brem. 1884); "Natur, Liebe, Vaterland", neue Gedichte (Leipz.
1884); "Bunte Blätter" (Wittenb. 1885); "Palme und Krone",
Lieder zur Erbauung (Brem. 1887). Tief religiöser Sinn,
Innigkeit der Empfindung und echt deutsche Gesinnung zeichnen die
Dichtungen Sturms durchweg aus. Er gab auch die Anthologie
"Hausandacht in frommen Liedern unsrer Tage" (Leipz. 1870, 5. Aufl.
1883) und unter dem Pseudonym Julius Stern die Märchensammlung
"Das rote Buch" (das. 1855) heraus.
5) Eduard, österreich. Abgeordneter, geb. 8. Febr. 1830 zu
Brünn, studierte in Olmütz und Brünn die Rechte,
ward 1852 Advokat zu Brünn und 1856 in Pest. 1861 nach
Brünn zurückversetzt, beteiligte er sich daselbst an der
Gründung und Förderung vieler öffentlicher Vereine
und Anstalten. 1865 ward er zu Iglau in den mährischen Landtag
und von diesem 1867 in das österreichische Abgeordnetenhaus
gewählt, dem er seitdem ununterbrochen angehörte. Er ist
Mitglied der verfassungstreuen Partei und ein vortrefflicher
Redner. 1870 siedelte er als Advokat nach Wien über, schadete
aber hier in der Zeit des Gründungsschwindels seinem Ansehen
sehr durch seine Beteiligung an unsoliden finanziellen
Unternehmungen.
Sturmbock (Mauerbrecher), s. Aries.
Sturmbretter, s. Fußangeln.
Sturmfeuer, mit Pulver oder heftig brennenden Stoffen
gefüllte Fässer, Töpfe, Säcke etc., welche
ehemals brennend auf den die Bresche stürmenden Feind
geschleudert wurden.
Sturmflut, der durch andauernden auf die Küste zu
wehenden Sturm hervorgerufene ungewöhnlich hohe Wasserstand.
Sturmfluten haben mit dem Wechsel der Gezeiten keinen notwendigen
Zusammenhang und treten zu allen Mondphasen auf, das Wasser steigt
und fällt in denselben nur weniger gleichförmig als
sonst. Ebb- und Flutstand werden um gleiche Beträge über
das gewöhnliche Maß emporgetrieben. Wenn sich bei
starkem Wind hohe Wellen bilden, auf deren Hinterseite der Wind
drückt, so daß die Wellenkronen sich
überstürzen, dann findet offenbar nicht mehr ein Hin- und
Herschwingen, sondern ein teilweises Vorwärtsbewegen des
Wassers statt. Hält der Sturm einige Zeit an, so ist die
Wassermasse, welche er vor sich hertreibt, sehr bedeutend, und wenn
die Küste, welche dem Sturm ausgesetzt ist, diesem eine offene
Bucht zuwendet, so kann dort ein mächtiger Wasserstau
stattfinden. Für die deutsche Bucht der Nordsee sind daher
andauernde schwere Stürme aus nordwestlicher Richtung die
gefürchtetsten. Bei den höchsten Sturmfluten der letzten
hundert Jahre stieg das Wasser bei Kuxhaven jedesmal nach
tagelangem Sturm aus W. bis NW. über den mittlern
Hochwasserstand: 22. März 1791 um 3 m, 3. Febr. 1825 um 3,18
m, 2. Jan. 1855 um 3,03 m. Bei der großen S. vom November
1872 wehte zwei Tage lang der Sturm aus der Richtung NO. bis ONO.
und trieb in der Ostsee die Wassermassen von der livländischen
Küste geradeswegs bis in die Buchten von Travemünde und
Kiel hinein, am erstern Ort einen Wasserstand von 3,38 m, am
letztern einen solchen von 3,17m über Mittelwasser
verursachend. Die Orkane der Tropen geben Anlaß zu ungeheuern
Sturmfluten, von denen die in der Bucht von Bengalen die
berüchtigtsten sind. Am 1. Dez. 1876 kamen durch eine solche
S. im Delta des Brahmaputra nahe an 200,000 Menschen um. Die
außerordentliche Verminderung des Luftdrucks in diesen
Orkanen ist für das Steigen des Wassers hier noch besonders
günstig. Vgl. Mayer, Über Sturmfluten (Berl. 1873);
Lentz, Flut und Ebbe und die Wirkungen des Windes auf den
Meeresspiegel (Hamb. 1879).
Sturmhaube (Sturmhut), s. Helm, S. 364.
Sturmhaube (Große und Kleine), Berggipfel, s.
Riesengebirge.
Sturmhut, Pflanzengattung, s. v. w. Aconitum.
Sturmpfähle, s. Palissaden.
Sturmrose, s. Kompaß.
Sturmschritt (früher auch Chargierschritt), beim
Militär die beim Vorgehen zum Angriff beschleunigte Gangart,
die zuletzt in vollen Lauf übergeht.
Sturmschwalbe, s. Sturmvogel.
Sturmsignale, die bei Sturmwarnungen gegebenen Signale,
s. Wetter.
Sturmsold, die den Soldaten für eine gewonnene
Schlacht oder die Erstürmung einer befestigten Stadt ehedem
gezahlte Belohnung, von der sich die heute noch gebräuchlichen
Douceurgelder herleiten.
Sturm- und Drangperiode, s. Deutsche Litteratur, S.
748.
Sturmvogel (Procellaria L.), Gattung aus der Ordnung der
Schwimmvögel und der Familie der Sturmvögel
(Procellariidae), kleine Vögel mit schlankem Leib,
großem Kopf, kurzem Hals, sehr langen, schwalbenartigen
Flügeln, mittellangem Schwanz, kleinem, schwächlichem,
geradem, an der Spitze herabgebogenem Schnabel, kleinen,
schwächlichen, langläufigen Füßen mit drei
langen, schwachen, durch Schwimmhäute verbundenen Vorderzehen
und rudimentärer Hinterzehe. Die Sturmschwalbe (Gewittervogel,
Petersläufer, Procellaria [Thalassidroma] pelagica L., s.
Tafel "Schwimmvögel II"), 14 cm lang, 33 cm breit, mit
abgestutztem
408
Sturmwarnungen - Stuttgart.
Schwanz, rußbraun, auf dem Oberkopf schwarz, auf dem
Bürzel, Steiß und an den Wurzeln der Steuerfedern
weiß und an den Spitzen der Flügeldeckfedern
trübweiß, und der Sturmsegler (P. Leachi Rchb.), 20 cm
lang, 50 cm breit, mit verhältnismäßig langem, tief
gegabeltem Schwanz, der vorigen ähnlich gefärbt, bewohnen
den Atlantischen und Stillen Ozean mit Ausnahme des höchsten
Nordens, leben meist auf hoher See, erscheinen nur zur Brutzeit am
Land, fliegen bald höher in der Luft, bald unmittelbar
über den Wogen, welche sie bald mit den trippelnden
Füßchen, bald mit den Spitzen der Schwingen
berühren, und lassen sich selten auf das Wasser nieder, um
auszuruhen. Sie sind hauptsächlich in der Nacht thätig,
nähren sich von allerlei Seetieren, brüten in
selbstgegrabenen Höhlen nahe der See und legen ein einziges
weißes Ei, welches wahrscheinlich von beiden Geschlechtern
ausgebrütet wird. Sie sind vollkommen harmlos, verlieren,
ihrem Element entrückt, gleichsam die Besinnung und sind auf
dem Land ganz hilflos. Angegriffen, suchen sie sich nur durch
Ausspeien von Thran zu verteidigen. Den Schiffern gilt die
Sturmschwalbe als Unglücksbote. Der Eissturmvogel (Fulmar, P.
[Fulmarus] glacialis Steph., s. Tafel "Schwimmvögel II"), 50
cm lang, 110 cm breit, ist weiß, auf dem Mantel
möwenblau, mit schwärzlichen Schwingen, braunen Augen,
gelbem Schnabel und Füßen, bewohnt das Nördliche
Eismeer, fliegt und schwimmt vortrefflich und kommt fast nur zur
Brut ans Land, auf welchem er sich sehr hilflos zeigt. Er
nährt sich von Fischen und Weichtieren, ist sehr
gefräßig und zudringlich, lebt und brütet gesellig
auf allen hochnordischen Inseln und legt nur ein weißes Ei;
gleichwohl werden auf Westmanöer bei Island jährlich
über 20,000 Junge ausgenommen, und trotzdem nimmt die Zahl der
Vögel von Jahr zu Jahr zu.
Sturmwarnungen, s. Wetter.
Sturnus, Star; Sturnidae (Stare), Familie aus der Ordnung
der Sperlingsvögel (s. d.).
Sturt (spr. stört), Charles, Australienreisender, in
England geboren, wollte 1827 einen in Zentralaustralien vermuteten
See entdecken und fand, dem Macquariefluß folgend, zu Anfang
1828 den Darlingfluß und, 1829 mit einer neuen
Forschungsreise betraut, den Murrayfluß. Begleitet von Stuart
(s.d. 1), führte er 1844-45 eine dritte große Reise aus,
auf der er den Cooper Creek entdeckte und nordwestlich bis fast in
das Zentrum des Kontinents vordrang. Er starb 16. Juni 1869 zu
Cheltenham in England. Seine ersten beiden Reisen beschrieb er in
"Two explorations into the interior of Southern Australia etc."
(Lond. 1833, 2 Bde.), die dritte in "Narrative of an expedition
into Central Australia etc." (das. 1848, 2 Bde.).
Sturz, der eine Thür oder ein Fenster oben
abschließende, horizontal aufliegende Teil, in der primitiven
Baukunst meist ein schwerer Steinblock oder Balken aus Holz.
Sturz, Helferich Peter, Schriftsteller, geb. 16. Febr.
1736 zu Darmstadt, studierte in Göttingen die Rechte und
Ästhetik, erhielt 1763 eine Anstellung zu Kopenhagen im
Departement der auswärtigen Angelegenheiten, 1770 bei dem
Generalpostdirektorium, ward 1773 Regierungsrat und zwei Jahre
später Etatsrat zu Oldenburg und starb 12. Nov. 1779 in
Bremen. S. war einer der geschmackvollsten deutschen Prosaiker, wie
seine "Erinnerungen aus dem Leben des Grafen von Bernstorff" (1777)
und seine "Briefe eines Reisenden" (1768) mit ihren trefflichen
Charakterschilderungen bekunden. Seine Schriften erschienen
gesammelt in 2 Bänden (Leipz. 1779-1782). Vgl. Koch, Helf.
Peter S. (Münch. 1879).
Sturzblech, dünnste Sorte Eisenblech.
Stürze, die starke Erweiterung der
Blechblasinstrumente an der dem Mundstück entgegengesetzten
Seite.
Sturzenbecker, Oskar Patrik, unter dem Namen Orvar Odd
bekannter schwed. Dichter und Schriftsteller, geb. 1811 zu
Stockholm, studierte und promovierte in Upsala, trat kurz darauf in
die Redaktion des "Aftonblad" in Stockholm ein und erwarb sich bald
einen Namen als gewandter und geistreicher Feuilletonist.
Später lebte er teils in Helsingborg, wo er mehrere Jahre lang
den "Öresundsposten" herausgab, teils in Kopenhagen; er starb
im Februar 1869 auf seinem Landsitz in der Nähe von
Helsingborg. Unter seinen Prosaschriften verdienen die meisterhaft
ausgeführten feuilletonartigen Skizzen: "Grupper och
personagen fran igar" ("Gruppen und Persönlichkeiten von
gestern") und "La Veranda" besondere Auszeichnung; auch viele
seiner Gedichte sind durch ihre frische, lebhafte Stimmung
anziehend. Seine gesammelten Werke erschienen in 5 Bänden (2.
Aufl., Stockh. 1880-82).
Stürzfurche, s. Brache.
Sturzgüter, beim Beladen von Schiffen durch die
Luken in den Schiffsraum gestürzte Güter, z. B. Kohlen,
Getreide, Erze u. dgl.
Stutereien (Gestüte), s. Pferde, S. 949.
Stuttgart (hierzu der Stadtplan), Haupt- und
Residenzstadt des Königreichs Württemberg, des
württembergischen Neckarkreises und des Stadtdirektionsbezirks
S., liegt in einer kesselförmigen, reizenden Erweiterung des
Nesenbachthals, das 1 km von der Stadt in das Neckarthal
ausläuft, von Weinbergen, Gärten und Villen rings
umgeben, unter 48° 46' nördl. Br. und 9° 10'
östl. L. v. Gr., 249 m ü. M., und wird durch die 1100 m
lange Königs- und die sich an diese anschließende
Marienstraße in die "obere" (im NW.) und die "untere Stadt"
(im SO.) geteilt, von denen letztere auch die Altstadt in sich
schließt. Außer den genannten Straßen sind die
Neckar-, Olga-, Reinsburg-, Silberburg- und Rote
Bühlstraße sowie unter den Plätzen der
Schloßplatz, der Alte Schloßplatz, die Planie, der
Dorotheen-, der St. Leonhards- und der Charlottenplatz, der
Feuerseeplatz und der Marktplatz hervorzuheben. Den
Schloßplatz zieren schöne Anlagen, inmitten deren sich
die 18 m hohe, mit einer Konkordia gezierte
Jubiläumssäule (1841 zur Feier des 25jährigen
Regierungsjubiläums König Wilhelms errichtet) erhebt, auf
dem Alten Schloßplatz steht das von Thorwaldsen modellierte
Standbild Schillers. Von den öffentlichen Anlagen und
Promenaden sind noch zu nennen: der Schloßgarten (mit der
Danneckerschen Nymphengruppe, der Eberhardsgruppe von Paul
Müller, der Hylasgruppe und den zwei Pferdebändigern von
Hofer), welcher sich bis in die Nähe von Kannstatt zieht, der
Silberburggarten (Eigentum der Museumsgesellschaft), die Planie mit
den neuerrichteten Denkmälern Bismarcks u. Moltkes
(Büsten, von Donndorf modelliert), der Stadtgarten, die
Anlagen bei der Seidenstraße, die neue Weinsteige etc. Von
den zu gottesdienstlichen Zwecken bestimmten Gebäuden (9
evangelische, eine reformierte und eine kath. Kirche und eine
Synagoge) Wappen von Stuttgart.
STUTTGART.
Akademie E3
Alexander-Straße C-F3-5
Alleen-Straße C-E1
Archiv E3
Archiv-Straße E3,4
Augusten-Straße AB3
Bach-Straße, Obere CD4
Bach-Straße, Untere D3
Bahnhof D2
Bahnhof-Straße E1
Band-Straße D3
Baugewerk-Schule CD2
Berg-Straße C2
Bibliothek C3
Blumen-Straße E4
Böblinger Straße B4,5
Böheim-Straße A5
Bopser Brunnen D5
Bopser Straße C4,5
Bopser Weg D5
Bothanger Straße A2
Breite-Straße C3
Brunnen-Straße D4
Büchsen-Straße C2,3
Bürger-Hospital C2
Bürger-Museum C3
Bürger-Schule B2
Calwer Straße CD3
Charlotten-Platz DE3,4
Charlotten-Straße E4
Christophs-Straße C4
Classon Villa F3
Cotta-Straße B5
Dannecker-Denkm. D3
Diakonissen-Anstalt B1
Diemershalden F4,5
Dobel-Straße E5
Dorotheen-Straße u. Platz D3
Eberhards-Standbild D3
Eberhards-Straße CD4
Eich-Straße D3
Enge-Straße D3
Englische Kirche D4
Eßlinger Berg, Oberer F4
Eßlinger Straße D4
Etzel-Straße CD5
Eugens-Denkmal F3
Eugen-Straße EF3
Falbenhennen-Straße C5
Falkert-Straße B1
Fangelsbach-Friedhof B5
Fangelsbach-Straße B4,5
Färber-Straße D4
Feuer-See B3
Filder-Straße AB5
Finanzministerium E2
Forst-Straße AC1
Friedrichs-Straße D1,2
Furthbach-Straße B1
Gaisburg-Straße E4
Garnison-Kirche C1
Garten-Straße C23
Gebel-Straße A4
Gerber-Straße C4
Gewerbe-Halle CD1
Gewerbe-Museum C3
Goethe-Straße D1
Graben-Straße D3
Güter-Bahnhhof E1
Gutenberg-Straße AB3
Hasenberg-Straße A1-4
Hauptstätter Straße BD4
Hauptzollamt EF1
Hebammen-Schule D1
Hegel-Straße C1
Heiler E4
Herdweg C1
Hermanns-Straße B3
Herzog-Straße B3
Heslacher-Straße A5
Heu-Straße C2
Heusteig-Straße BD5
Hirsch-Straße CD3
Hohe-Straße C2
Hohenheimer Straße DE5
Holzgärten, Königl. C1
Holz-Straße D3,4
Hoppenlau-Friedhof C1
Hoppenlau-Straße C1,2
Hospital-Kirche C2
Hospital-Platz C2
Hospital-Straße C2
Hühnerdieb F3
Ilgen-Platz D4
Ilgen-Straße D3
Immenhofen-Straße BC5
Infanterie-Kaserne B3
Jäger-Straße DE1
Jakob-Straße D4
Johannes-Straße B1-3
Johannes-Kirche B3
Jubiläums-Säule D3
Justiz-Palast E3,4
Kanal-Straße E4
Kanonen-Weg F3
Kanzlei-Straße D1,2
Karls-Linde A4
Karls-Straße D3
Kasernen-Straße BC2
Katharinen-Hospital D1
Katharinen-Platz D4
Katharinen-Stift D2
Katharinen-Straße D4
Katholische Kirche, Alte DE2
Katholische Kirche, Neue B4
Keppler-Straße D1,2
Kerner-Straße F2,3
Kolb-Straße AB5
Königsbau D2
Königs-Straße CE2,3
Königs-Thor E2
Korps-Kommando DE1
Kreuser-Straße D1
Kreuz-Straße D4
Kriegsberg, Mittlerer E1
Kriegsberg, Unterer D1
Kriegsberg-Straße CE1
Kriegs-Ministerium DE4
Kronprinz-Straße CD3
Kronprinzen-Palais C2,3
Kühlesteig E5
Kunstausstellung, Permanente C3
Kunst-Verein D2
Landhaus-Straße F2
Lange-Straße C2,3
Lazarett-Straße D4
Legions-Kaserne C3
Lehen-Straße B5
Lerchen-Straße AC1
Liederhalle C2
Lindenspür-Straße AB1
Linden-Straße CD2,3
Loge Wilhelm B3
Loge zu den 3 Zedern D4
Lorenz-Straße D45
Ludwigsburger Straße EF1
Ludwigs-Spital B1
Ludwigs-Straße AB2
Maler-Straße F3
Marien-Platz A5
Marien-Straße B4
Markt-Halle D3
Markt-Platz D3
Markt-Straße D34
Marstall E2
Militär-Spital B2
Militär-Straße AB2
Minsterium des Äußern CD3
Möricke-Denkmal B4
Moser-Straße EF3
Mozart-Straße C5
Münze EF2
Münz-Straße D3
Museum für bildende Künste F3
Museum, Oberes D2
Museum, württemb. Altertümer E3
Neckar-Straße EF2,3
Nadler-Straße CD3
Naturalien-Kabinett E3
Neue Brücke C3
Olga-Spital A2
Olga-Straße CE4,5
Orangerie E1
Paulinen-Straße BC3,4
Paulinen-Straße, Verlängerte B2,3
Pfarr-Straße D4
Polizei C3
Polytechnische Schule D1
Postamt D2
Posthof C3
Post-Platz, Alter C3
Post-Straße C3
Prinzen-Palais D3
Prinzessinnen-Palais E3,4
Rathaus D3
Realgymnasium C1
Reinsburg A4
Reinsburg-Straße AB4
Reiter-Kaserne E1
Reuchlin-Straße A3
Röer-Straße B5
Rosen-Straße DE4
Rosenberg-Straße AC1
Rote-Straße C2,3
Rote Bühl-Straße AC3
Sankt Johannes-Kirche B3
Sankt Leonhards'Krche D4
Sankt Leonhards-Platz D4
Sankt Leonhards-Str D4
Sänger-Straße F2,3
Schellen-König F5
Schelling-Straße CD2
Schiler-Denkmal D3
Schiller-Straße E1
Schlachthaus C1
Schloß, Altes D3
Schlosser-Straße C4,5
Schloß-Garten EF1,2
Schloß-Kirche E3
Schloß, Königliches DE3
Schloß-Platz D2,3
Schloß-Platz, Alter D3
Schloß-Straße AD2
Schmale-Straße C3
Schul-Straße D3
Schützenhaus F3
Schützen-Straße F2,3
Schwab-Denkmal C2
Schwab-Straße D1,2
See-Straße D1,2
Seiden-Straße C1,2
Sennefelder-Straße A1-3
Silberburg B4
Silberburg-Straße B1-4
Silcher-Straße B2
Sonnenberg-Straße E5
Sophien-Straße C3,4
Stadt-Direktion D3
Stadt-Garten D1,2
Stafflenberg E5
Ständehaus D2,3
Stein-Straße C-D3
Stifts-Kirche D3
Stiftskirchen-Platz D3
Strohberg-Straße B5
Stützenburg DE5
Synagoge C2
Tannen-Straße A5
Telegraphen-Amt D2
Theater E2
Thor-Straße C4
Tübinger Straße C4
Tübinger Thor BC4
Turm-Straße D5
Turnhalle, Erste C2
Uhland-Denkmal E2
Uhlands-Höhe F3
Uhlands-Straße E4
Ulrich-Straße E3
Urban-Straße EF2-4
Vera-Straße F3
Vogelsang-Straße A2,3
Wagner-Straße D4
Waisenhaus D3
Wannen-Straße AB3,4
Wasser-Reservoir F5
Weber-Straße DE4
Wein-Straße C3
Weißenburg-Straße C5
Wilhelms-Platz CD4
Wilhelms-Straße D4,5
Wilhelms-Thor D5
Zorn, Villa B4
Zuchthaus A2
Zucker-Fabrik E1
Zwinger, Im D3,4
409
Stuttgart (Beschreibung der Stadt).
sind hervorzuheben: die Stiftskirche (1436-1531 erbaut), mit
zwei Türmen; die Leonhardskirche (1470 bis 1491 im gotischen
Stil erbaut), mit einem steinernen Kalvarienberg von großem
Kunstwert; die Hospitalkirche (1471-93 erbaut), mit vielen
Grabmälern (darunter das Reuchlins) und dem Modell der
Christusstatue von Dannecker; die prachtvolle, 1865-76 im gotischen
Stil von Leins aufgeführte Johanniskirche; die englische
Kirche; die neue Garnisonkirche von Dollinger (1879) im romanischen
Stil; die alte und die von Egle 1873-79 erbaute neue katholische
Kirche und die 1860 im maurischen Stil aufgeführte Synagoge.
Von weltlichen Gebäuden sind zu nennen: das Neue
Residenzschloß im französischen
Renaissancestil(1746-1807 erbaut); das Alte Schloß, in dessen
Hof sich das bronzene Reiterstandbild des Grafen Eberhard im Bart
(von Hofer) befindet; das 1845-46 umgebaute Hoftheater mit vier
ehernen Statuen von Braun; die sogen. Akademie, ein Nebenbau des
Schlosses (früher Sitz der Karlsschule, jetzt die
königliche Handbibliothek, den königlichen Leibstall, die
Schloßwache etc. enthaltend); der im italienischen Stil
erbaute Wilhelmspalast; das Kronprinzenpalais, im römischen
Palaststil aufgeführt (gegenüber das Denkmal Danneckers);
das Palais des Prinzen Hermann von Sachsen-Weimar; das
Ständehaus; das Museum der bildenden Künste (1838 bis
1843 im italienischen Palaststil erbaut), mit der Reiterstatue des
Königs Wilhelm, von Hofer; der Königsbau (1856 bis 1860
von Leins aufgeführt), mit Läden und der Börse in
den untern und mehreren großen Sälen in den obern
Räumen; das Rathaus (1456 erbaut); die Gebäude des
Staatsarchivs und der Naturaliensammlungen; das
Kanzleigebäude; das neue Justizgebäude; der Hauptbahnhof;
das neue Postgebäude; das Museum; das 1860-65 von Egle erbaute
Polytechnikum; die Blumen- und Gemüsehalle; das Schlachthaus
etc.
Die Zahl der Einwohner belief sich 1885 mit der Garnison (ein
Regiment und 2 Bataillone Infanterie Nr. 119 und 125 und ein
Ulanenregiment Nr. 19) auf 125,901 Seelen (gegen 107,289 im J.
1875), darunter 106,282 Evangelische, 16,067 Katholiken und 2568
Juden. Die industrielle Thätigkeit ist nicht unbedeutend. Ganz
besonders treten hervor die Bierbrauereien, die Farben-,
Pianoforte-, Harmonium-, Kassen-, Möbel-, Parkettboden-,
Zigarren-, Chemikalien- und Wagenfabrikation, die Eisen- und
Glockengießerei und die Fabrikation von Reiseartikeln.
Außerdem gibt es Fabriken für Trikot- und Wollwaren,
Baumwollen- u. Wollenzeuge, Teppiche, Leder, Papier, Posamentier-
und Kautschukwaren, Parfümerien, Bijouterie-, Glas-,
Porzellan-, Gold- und Silberwaren, mechanische und optische
Instrumente, Maschinen, Schokolade etc. Der Handelsverkehr,
unterstützt durch eine Handels- und Gewerbekammer, eine
Börse, durch zahlreiche Banken (darunter eine
Reichsbankhauptstelle), viele Wechsel und Geldgeschäfte etc.,
ist recht bedeutend; im Buchhandel ist S. nach Leipzig sogar der
wichtigste Platz in Deutschland. Die Stadt zählt über 100
Buch- und Kunsthandlungen, zahlreiche Buchdruckereien, Schrift- und
Stereotypengießereien, litho-, xylo- und photographische
Anstalten etc. Alljährlich findet hier eine
Buchhändlermesse für Süddeutschland statt. Bekannt
sind auch die Tuchmesse sowie die dortigen Karte der Umgebung von
Stuttgart Hopfen- und Pferdemärkte. Den Verkehr nach
außen hin fördern die Linien Bretten-Friedrichshafen und
S.-Freudenstadt der Württembergischen Staatsbahn, für
welche S. den Knotenpunkt bildet; eine Zahnradbahn führt nach
dem auf der Filderebene liegenden, durch seinen guten Rotwein und
seinen Obstbau bekannten Dorf Degerloch und weiter nach Hohenheim;
den Verkehr in der Stadt und mit der nächsten Umgebung
vermitteln zwei Pferdebahnlinien. An Wohlthätigkeitsanstalten
besitzt S. das Bürgerhospital, das Armenhaus, die
Olgaheilanstalt, die Paulinenhilfe (orthopädische
Heilanstalt), die Nikolauspflege für blinde Kinder, die
Paulinenpflege etc. sowie mehrere Wohlthätigkeits- und
zahlreiche andre gemeinnützige Vereine. Unter den
Bildungsanstalten steht das Polytechnikum (Wintersemester 1888-89:
248 Studierende) obenan. Außerdem befinden sich in S. eine
Baugewerk-, eine Kunst- und eine Kunstgewerbeschule, ein
Konservatorium, eine höhere Handels-, eine Tierarznei- und
eine Landes-
410
Stütze - Stüve.
hebammenschule und eine Turnlehrerbildungsanstalt; ferner 2
Gymnasien, ein Realgymnasium, eine Reallehranstalt, ein Privatlehr-
und Erziehungsinstitut, ein Lehrerinnenseminar und zahlreiche
niedere Schulanstalten. Unter den Sammlungen für Kunst und
Wissenschaft ist die königliche Sammlung, bestehend aus einer
Bibliothek von über 400,000 Bänden, Gemälde-,
Skulpturen-, Antiken-, Münzen- und Naturaliensammlung, die
wichtigste. Außerdem gehören hierher: die Sammlung
vaterländischer Altertümer, die Gemäldesammlung des
Museums der bildenden Künste und die des Kunstvereins, die
permanente Kunstausstellung, die mit der Zentralstelle für
Handel und Gewerbe verbundenen Sammlungen, die
Präparatensammlung der Tierarzneischule, der zoologische
Garten etc. Groß ist die Zahl der in S. erscheinenden
Zeitschriften und politischen Zeitungen. S. ist Geburtsort des
Philosophen Hegel, des Architekten Heideloff, der Dichter Hauff,
Schwab u. a. S. ist Sitz des Staatsministeriums und sämtlicher
Zentralstellen des Landes, eines Oberlandes- und eines
Landgerichts, eines Oberbergamtes und eines Bergamtes, des
evangelischen Konsistoriums, des katholischen Kirchenrats und der
israelitischen Oberkirchenbehörde, einer
Militärintendantur, eines Gouverneurs, der
Oberrechnungskammer, einer Stadtdirektion, einer Münze
(Münzzeichen F) etc.; ferner des Generalkommandos des 13.
Armeekorps, des Kommandos der 26. Division, der 51. Infanterie- und
26. Kavalleriebrigade. Die städtischen Behörden setzen
sich zusammen aus 25 Gemeinderats- und 25
Bürgerausschußmitgliedern. - In der Umgebung der Stadt
sind bemerkenswert: das am Ende des Schloßgartens liegende
und zum Stadtdirektionsbezirk gehörige Berg (s. d.) mit
königl. Villa, die königl. Lustschlösser Rosenstein
und Wilhelma; gegenüber die Stadt Kannstatt (s. d.); im
Süden die Silberburg, ein Vergnügungsort der Bewohner von
S.; über derselben die 340 m hohe Reinsburg mit schönen
Villen am Abhang; weiterhin die Uhlandshöhe über dem
Schießhaus, 350 m ü. M., mit Anlagen, einem Pavillon und
der Uhlandslinde; ferner der Bosper, 481 m ü. M., und die
Schillerhöhe, in deren Nähe das Dorf Degerloch (s. oben);
im SW. der Stadt das Jägerhaus mit Aussichtsturm,
sämtlich mit schöner Aussicht; das Lustschloß
Solitüde mit Wildpark; endlich die Feuerbacher Heide.
Urkundlich kommt S., das seinen Namen von einem Gestütgarten
oder Fohlenhof führt, zuerst 1229 vor. 1312 wurde es dem
Grafen Eberhard entrissen und ergab sich an Eßlingen, wurde
jedoch 1316 wieder ausgeliefert. Seitdem haben die Grafen von
Württemberg hier ihren Sitz gehabt und es 1482 zur Hauptstadt
der württembergischen Lande gemacht. Doch verlegte Herzog
Eberhard Ludwig 1727 und nochmals Karl Eugen 1764 die Residenz
für mehrere Jahre nach Ludwigsburg. Bis 1822 stand S. unter
einer eignen Regierung, seitdem sind Stadt und Bezirk mit dem
Neckarkreis vereinigt und bilden ein eignes Oberamt unter dem Namen
einer Stadtdirektion. Vom 6.-18. Juni 1849 hielt der Rest der
deutschen Nationalversammlung, das sogen. Rumpfparlament, in S.
seine Sitzungen. Im September 1857 fand hier eine Zusammenkunft
zwischen Alexander I. von Rußland und Napoleon III. statt.
Vgl. Pfaff, Geschichte der Stadt S. (Stuttg. 1845-47, 2 Bde.);
Wochner, S. seit 25 Jahren (das. 1871); Nick, Chronik und Sagenbuch
von S. (das. 1875); "S. Führer durch die Stadt und ihre
Bauten" (Festschrift, das. 1884); "Beschreibung des
Stadtdirektionsbezirks S." (hrsg. vom statistisch-topographischen
Büreau, das. 1886); Hartmann, Chronik der Stadt S. (das.
1886).
Stütze, örtlich auch Stützel genannt, im
Bauwesen meist lotrechter hölzerner oder eiserner Pfosten zur
Unterstützung einer Decke oder eines Daches, seltener
geneigte, einem Seitendruck widerstehende Strebe. Die S. ist ein
insbesondere im Gegensatz zur Säule interimistischer
schmuckloser Träger und besteht entweder aus einem runden oder
vierkantigen beschlagenen Holzstamm auf Holz- oder Steinunterlage,
oder aus gußeisernen, im Querschnitt meist
kreuzförmigen, zusammengeschraubten Barren auf gemauertem
Fundament, oder aus winkel- oder I-förmigen Façoneisen,
welche zu kreuz- oder H-förmigen Querschnitten zusammengesetzt
und an eine gußeiserne, mit einem gemauerten Fundament
verankerte Unterlagsplatte geschraubt werden.
Stutzen, kurzes Gewehr, das zum Abschießen gegen
die Brust gestützt wurde; dann verkürztes, leichteres,
gezogenes Gewehr der Jäger und Scharfschützen.
Stützerbach, Dorf im preuß. Regierungsbezirk
Erfurt, Kreis Schleusingen, im Thüringer Wald, 587 m ü.
M., mit evang. Kirche, Hohlglas- und Glasinstrumentenfabrikation
und (1885) 1081 Einw. Dabei der gleichnamige weimarische Ort mit
675 Einw.
Stützpunkte, Punkte, an die sich irgend etwas, z. B.
ein Hebel, stützt oder lehnt. Im Kriegswesen sind taktische S.
solche Örtlichkeiten, z. B. Anhöhen, Ortschaften etc.,
die meist befestigt, für die Verteidigung besonders
günstig sind, ihr als Stütze dienen; strategische S. sind
meist große Festungen, auf welche sich operierende Armeen
zurückziehen können.
Stützzapfen, Zapfen, bei welchem der Druck zum
größten Teil in der Längenrichtung desselben wirkt.
Man unterscheidet hierbei Spurzapfen und Kammzapfen, je nachdem der
Druck nur von der Stirnfläche des Zapfens oder von seitlichen,
mit dem Zapfen fest verbundenen Ringen aufgenommen wird.
Stüve, Johann Karl Bertram, hannöv. Staatsmann,
geb. 4. März 1798 zu Osnabrück, ließ sich 1820
daselbst als Advokat nieder und war, 1830 zum Schatzrat
gewählt, seit 1831 in freisinniger Richtung auf dem Landtag
thätig. 1832 veröffentlichte er die Schrift "Über
die gegenwärtige Lage des Königreichs Hannover" (Jena).
1833 wurde er Bürgermeister seiner Vaterstadt. Nach der
Thronbesteigung des Königs Ernst August 1837 und nach der
durch denselben verfügten Vertagung des Landtags
veröffentlichte S. eine "Verteidigung des
Staatsgrundgesetzes". Am 20. März 1848 übernahm er unter
Graf Bennigsen das Ministerium des Innern, dessen Programm auf
Beseitigung der privilegierten Landesvertretung, Reform der
Administration und Justiz, Selbständigmachung der Gemeinden,
Freigebung der Presse, Einrichtung von Schwurgerichten etc.
lautete. Dagegen war er in der deutschen Sache der Bildung eines
kleindeutschen Bundesstaats unter preußischer Leitung abhold
und suchte die Sonderrechte der Kleinstaaten sowie die Verbindung
mit Österreich aufrecht zu erhalten. Im Oktober 1850 legte er
sein Portefeuille nieder, blieb aber als Bürgermeister seiner
Vaterstadt (seit 1852) ein hervorragendes Mitglied der
Ständeversammlung, bis er wegen Differenzen mit dem
Bürgervorsteherkollegium 1864 sich veranlaßt sah, sein
Amt als Bürgermeister von Osnabrück niederzulegen. 1869
übernahm er auf kurze Zeit das Amt eines
Bürgervorstehers; er starb 16. Febr. 1872. Im J. 1882 wurde
sein Denkmal auf dem Marktplatz in Osnabrück enthüllt.
Obwohl liberal und echt deutsch gesinnt, ver-
411
Stygisch - Styrax
mochte er sich doch nicht mit der neuen Wendung der Dinge in
Deutschland zu befreunden. Die Annexion Hannovers und die Einigung
Deutschlands unter Preußen widerstrebten ihm ebensosehr wie
die Freizügigkeit und Gewerbefreiheit. Litterarisch
beschäftigte er sich mit der Geschichte Osnabrücks. Er
gab den 3. Band von Mösers "Osnabrückischer Geschichte"
(Berl. 1824) und den 3. Band von Fridericis "Geschichte
Osnabrücks aus Urkunden" (Osnabr. 1826) heraus; von seinen
selbständigen Arbeiten erwähnen wir: eine Darstellung des
Verhältnisses der Stadt Osnabrück zum Stift (Hannov.
1824); "Geschichte des Hochstifts Osnabrück" (Bd. 1 u. 2, das.
1853-1872; Bd.3, 1882); "Wesen und Verfassung der Landgemeinden in
Niedersachsen und Westfalen" (Jena 1851); "Untersuchungen über
die Gogerichte in Westfalen und Niederfachsen" (das. 1870) u.
a.
Stygisch (griech.), der Styx, d. h. der Unterwelt,
angehörig; daher s. v. w. fürchterlich, schauerlich.
Styl (griech.), s. Stil.
Stylidiaceen, dikotyle, etwa 100 Arten umfassende,
vorzugsweise in Australien einheimische Pflanzenfamilie aus der
Ordnung der Kampanulinen; von ihren nächsten Verwandten durch
ihre beiden mit dem Griffel in eine auf dem Eierstock stehende
Säule verwachsenen Staubgefäße verschieden.
Styliten (griech., Säulenheilige), eine im 5. Jahrh.
im Morgenland aufgekommene Klasse christlicher Asketen, welche ihr
Leben auf der Spitze hoher Säulen stehend zubrachten (s.
Simeon 3). Die S. hielten sich in Syrien und Palästina bis ins
12. Jahrh.; im Abendland fand ihr Beispiel keine Nachahmung.
Stylobat (griech.), aus der Vereinigung einzelner
Postamente (Stereobate) entstandenes fortlaufendes, abgestuftes
Fußgestell der Säulen; Säulenstuhl.
Stylodisch (styloidisch, griech.),
griffelförmig.
Stylograph (griech.), Fabrikname für einen mit Tinte
gefüllten Schreibgriffel; Füllfederhalter.
Stylographie (griech.), ein von dem Kupferstecher
Schöler in Kopenhagen erfundenes Verfahren zur leichtern
Herstellung von Kupferdruckplatten durch Gravierung in eine nicht
leitende Masse, von welcher dann zuerst eine erhabene, dann von
dieser eine vertiefte Platte auf galvanischem Weg abgeformt
werden.
Stylolithen (griech., "Säulensteine"),
stengelartige, gestreifte oder geriefte Gebilde in Kalken und
Mergeln, besonders im Muschelkalk, 1-30 cm lang und von 1 mm bis zu
mehr als 1 cm im Durchmesser. Die Längsachse der S. steht
gewöhnlich senkrecht zur Schichtungsfläche, doch gibt es
auch liegende S. Die Entstehung wird bald auf Erosion
zurückgeführt, bald mit der Entwickelung von Gasen in
Zusammenhang gebracht, am richtigsten aber wohl als Folge von Druck
und Pressung von noch plastischem Material aufgefaßt,
wofür Experimente, durch welche es Gümbel gelang, S.
künstlich darzustellen, sprechen. Eine verwandte Erscheinung
ist der Nagelkalk (Tutenmergel), konische, mit einer rohen innern
Struktur versehene Körper, ineinander gesteckten Tüten
vergleichbar, die hier und da im Lias vorkommen.
Stylosporen, die bei Kernpilzen in besondern
Fruchtbehältern, den Pykniden, durch Abschnürung an
Hyphenenden entstehenden Sporen (s. Pilze, S. 72 f.).
Stylus (lat.), Griffel, s. Blüte, S. 69.
Stymphalische Vögel (Stymphaliden), im griech.
Mythus Raubvögel mit ehernen Flügeln und Federn, die sie
wie Pfeile abschießen konnten, hausten am Stymphalischen See
in Arkadien und wurden von Herakles verscheucht.
Styphninfäure, s. Resorcin.
Styptische Mittel (Styptica), s. v. w. blutstillende
Mittel, s. Blutung, S. 90.
Styr, rechter Nebenfluß des Pripet im westlichen
Rußland, entspringt in Ostgalizien unweit der russischen
Grenze und mündet nach einem Laufe von über 500 km.
Styraceen, dikotyle Pflanzenfamilie aus der Ordnung der
Diospyrinen, durch die der Blumenkrone angewachsenen
Staubblätter und das ganz oder halb unterständige Ovar
von den nächstverwandten Ebenaceen und Sapotaceen verschieden.
Die nur Holzpflanzen enthaltende Familie zählt über 220
Arten, welche meist im tropischen Asien und Amerika einheimisch und
wegen der eigentümlichen aromatischen Harze (Storax, Benzoe),
welche ihre Stämme enthalten, zum Teil wichtige Arzneipflanzen
sind.
Styracinen, s. Diospyrinen.
Styrax Tourn. (Storaxbaum), Gattung aus der Familie der
Styraceen, an allen Teilen, mit Ausnahme der Blattoberseite, mit
Schuppen besetzte oder sternhaarig filzige, selten kahle
Sträucher oder Bäume mit ganzrandigen oder schwach
gesägten Blättern, meist weißen Blüten in
achsel- oder endständigen, einfachen oder zusammengesetzten
Trauben und kugeliger oder eiförmiger, ein- bis dreisamiger
Frucht. Etwa 60 Arten meist in den Tropengebieten Asiens und
Amerikas, spärlich im gemäßigten Asien und
Südeuropa. S. Benzoin Dryand. (Benzoebaum), mittelgroßer
Baum mit gestielten, eiförmig länglichen, lang
zugespitzten, oberseits kahlen, unterseits weißfilzigen
Blättern, innen braunroten, außen und am Rand
silberweißen Blüten und holziger,
weißlich-brauner, nicht aufspringender Frucht, wächst
auf Java und Sumatra, in Siam und Kotschinchina, wird auch
kultiviert und liefert die Benzoe. S. officinalis L. (echter
Storaxbaum), ein Strauch oder kleiner Baum mit kurz gestielten,
breit länglichen, unterseits weißfilzigen Blättern,
endständigen, nickenden, zwei- bis vierblütigen Trauben
mit wohlriechenden Blüten und filziger grüner
Steinfrucht, wächst in den östlichen
Mittelmeerländern nördlich bis Dalmatien und lieferte
früher Styrax, der gegenwärtig allein von Liquidambar
orientalis gewonnen wird.
Styrax (Storax, Judenweihrauch), ein Balsam, welcher aus
der Rinde des Amberbaums, Liquidambar orientalis Mill., im
südlichen Kleinasien und Nordsyrien durch Behandeln mit warmem
Wasser und Abpressen gewonnen wird. Er ist zäh,
dickflüssig, schwerer als Wasser, grau, etwas
grünbräunlich, undurchsichtig, wird beim Erwärmen
braun und durchsichtig, trocknet nicht an der Luft, löst sich
in Alkohol und Äther, riecht angenehm, schmeckt scharf
aromatisch, kratzend, besteht aus Zimtsäurestoresinäther,
Zimtsäurephenylpropyläther, Zimtsäurezimtäther,
freier Zimtsäure, Äthylvanillin, Styrol etc. Man benutzt
ihn in der Parfümerie und als Mittel gegen Krätze. Die
Produktion beträgt jährlich etwa 800 Ztr. S. wird schon
von Herodot erwähnt und kam durch die Phöniker nach
Griechenland. Neben oder vor dem Liquidambarstyrax war aber auch
das feste Harz von Styrax officinalis L. im Gebrauch, welches etwa
seit Beginn unsers Jahrhunderts nirgends mehr in einiger Menge
gewonnen wird. Die bei der Bereitung des S. ausgepreßte Rinde
wird getrocknet und dient mit nicht gepreßter Borke in der
griechischen Kirche als Christholz neben Weihrauch zum
Räuchern; früher kam sie als Cortex Thymiamatis in den
Handel. Gegenwärtig wird sie vielfach zerkleinert und mit S.
zu einem schmierigen oder ziemlich trocknen Gemenge verarbeitet,
welches als Styrax calamita von Triest aus
412
Styrum - Suber.
in den Handel kommt, statt jener Rinde aber oft auch nur
Sägespäne enthält. Aus dem amerikanischen
Liquidambar styraciflua L. gewinnt man durch Einschnitte in den
Stamm einen braungelben, ziemlich festen S. (Sweet gum), der
besonders von Kindern gern gekaut wird.
Styrum (Stirum), Fabrikort im preuß.
Regierungsbezirk Düsseldorf, Kreis Mülheim a. d. Ruhr,
unweit der Ruhr und an der Linie Ruhrort-Holzwickede der
Preußischen Staatsbahn, hat eine evangelische und eine kath.
Kirche, ein Schloß (Stammort der Grafen von S.), ein
großes Eisenwerk (zu Oberhausen), Fabrikation von feuerfesten
Steinen und Leim und (1885) 8896 meist kath. Einwohner.
Styx, in der griech. Mythologie älteste Tochter des
Okeanos und der Tethys, eilte zuerst von allen Göttern mit
ihren Kindern Zelos (Eifer), Nike (Sieg), Kratos (Kraft) und Bia
(Gewalt), die sie von Pallas, dem Sohn des Titanen Krios, geboren,
dem Zeus gegen die Titanen zu Hilfe. Dafür behielt er ihre
Kinder bei sich im Olymp, sie selbst erhob er zur Eidesgöttin
der Unsterblichen. Sie wohnt als Nymphe des mächtigen Flusses
S., der als ein Arm des Okeanos unter die Erde fließt und
(nach späterer Vorstellung) die Unterwelt neunmal
durchströmt, im äußersten Westen in einem von hohen
Felsen überschatteten und von silbernen Säulen getragenen
Haus. Ist ein Streit unter den Göttern nur durch Eidschwur zu
lösen, so holt Iris von ihrem heiligen Wasser in goldener
Kanne, und wehe demjenigen, der bei diesem Wasser falsch
schwört. Den Fluß S. hat man später in dem jetzt
Mavronéri genannten arkadischen Gewässer
wiedergefunden.
Su (türk.), s. v. w. Wasser, Fluß.
Suada (Suadela, lat.), s. v. w. Peitho (s. d.); dann
überhaupt Rede- und Überzeugungsgabe.
Suaheli (Sawahili, "Küstenbewohner"), die Bewohner
der Sansibarküste Ostafrikas und der vorliegenden Inseln, ein
durch die beinahe tausendjährige Vermischung der
eingewanderten Araber mit den eingebornen Negern der großen
südafrikanischen Völkerfamilie sowie durch das
jahrhundertelang fortgesetzte Einführen von Sklaven aus allen
Teilen des Innern entstandenes Mischvolk, welches alle
Schattierungen der Haut von den schwarzen Eingebornen bis zu den
hellen Arabern und alle Zwischenstufen der
Körperbeschaffenheit beider Rassen zeigt. Die Sprache der S.,
das Kisuaheli, bildet mit den übrigen Sprachen von Sansibar
zusammen die nördlichste Gruppe der östlichen Abteilung
des großen Bantusprachstammes (s. Bantu). Grammatiken
derselben lieferten Krapf (Tübing. 1850) und Steere (3. Aufl.,
Lond. 1884), der auch die nahe verwandte Kihian- oder Yaosprache
bearbeitete (das. 1871), ein Wörterbuch Krapf (das. 1882). Die
S. bilden das Hauptkontingent unter der Bevölkerung des
Sultanats Sansibar, und ihre Sprache ist das allgemeine
Verständigungsmittel von Ostafrika. Auch die frühere
Bevölkerung der Komoren ist zu den S. zu rechnen.
Suakin (Sauâkin), Hafenstadt in Nubien, am Roten
Meer, auf einer Küsteninsel in einem Becken, zu welchem
zwischen Korallenbänken ein schmaler, gewundener Kanal
führt. In diesem liegt eine zweite Insel, welche als
Quarantäne dient. Die Stadt hat eine Anzahl Moscheen mit
Minarets, steinerne, mit Schnitzwerk schön verzierte
Häuser und wird von Arabern, Türken, Leuten aus
Hadramaut, Griechen und Maltesern bewohnt. Sie ist durch eine feste
Brücke mit dem aus Mattenhütten bestehenden El Kef auf
dem gegenüberliegenden Ufer verbunden, dessen Bewohner die
Inselstadt mit Lebensmitteln und Trinkwasser versorgen. Um El Kef
gegen die Überfälle der Mahdisten zu schützen, hat
man den Ort mit Befestigungen umgeben. Die Einwohnerzahl der
Doppelstadt ist (1882) 11,000. Vor dem Krieg verkehrten hier
jährlich 760 europäische Schiffe und arabische Barken von
172,000 Ton., welche Reis, Datteln, Salz, Kauris und
europäische Waren gegen Gummi, Elfenbein, Straußfedern,
Felle, Wachs, Moschus, Getreide, Kaffee sowie Sklaven, Maulesel und
wilde Tiere eintauschten. Die Ausfuhr wertete früher 5,2 Mill.
Mk. S. ist auch Einschiffungshafen für Mekkapilger
(jährlich 6-7000). Auf der großen Karawanenstraße
zwischen hier und Berber am Nil verkehrten früher
jährlich 20,000 beladene Kamele. Englische Dampfer vermitteln
den Verkehr mit Suez; von dort läuft eine ägyptische
Linie über Dschiddah nach S. und nach Massauah. Ein Kabel geht
nach Suez und Dschiddah. Gegenwärtig ist S. von einer
englischen Garnison besetzt.
Suardi, Bartolommeo, s. Bramantino.
Suarez, Franz, berühmter kathol. Theolog, geb. 5.
Jan. 1548 zu Granada, wirkte als Professor in Segovia und
Valladolid, nach einem Aufenthalt in Rom wieder in Alcalá,
Salamanca und Coimbra; starb 25. Sept. 1617 in Lissabon. Unter
seinen Werken (Lyon u. Mainz 1632 ff., 23 Bde. ; Vened. 1740, 23
Bde.; Par. 1859, 26 Bde.; Auszug von Migne, das. 1858, 2 Bde.)
befindet sich eine "Defensio fidei catholicae" (1613), gegen die
kirchlichen Maßnahmen Jakobs I. von England gerichtet. Vgl.
Werner, Franz S. (Regensb. 1861, 2 Bde.).
Suasorisch (lat.), überredend; Suasorien,
Überredungsmittel, Überredungsgründe.
Sub (lat.), unter.
Subaltern (lat.), untergeordnet, unter einem andern
stehend; Subalternbeamte, Beamte, welche nicht die höhern
Staatsprüfungen abgelegt haben und im Büreaudienst oder
sonst in untergeordneter Thätigkeit angestellt sind;
Subalternoffiziere, die niedrigste Rangstufe der Offiziere (s. d.),
zu welcher die Premier- und Sekondeleutnants gehören.
Subalternation (neulat.), in der Logik dasjenige
Verhältnis, wo eins unter dem andern enthalten ist, daher das
besondere (bejahende und verneinende) Urteil im Verhältnis zum
allgemeinen subalterniert, aber auch der Unterordnungsschluß
Subalternationsschluß heißt.
Subapenninenformation, s. Tertiärformation.
Subäraten (lat.), versilberte röm.
Kupfermünzen.
Subclavia (arteria, vena s.),
Schlüsselbeinschlagader, -Blutader.
Sub conditione (lat.), unter der Bedingung.
Subconductio (lat.), s. v. w. Aftermiete (s. d.).
Subdatarius (lat.), s. Dataria.
Subdelegat (lat.), Unterbevollmächtigter.
Subdiakonus, in der abendländischen Kirche seit dem
3. Jahrh. Gehilfe des Diakonen, erst seit Innocenz III. zu den
Ordines majores gerechnet; in der protestantischen Kirche der
zweite Hilfsprediger an einer Kirche.
Sub dio (sub Jove, lat.), unter freiem Himmel.
Subditius (lat.), untergeschoben.
Subdivision (lat.), Unterabteilung.
Subdominante (lat.), s. v. v. Unterdominante (s.
Dominante).
Subdominus (lat.), Unter- oder Afterlehnsherr; s.
Afterlehen und Lehnswesen, S. 633.
Suber (lat.), Kork, Korkbaum; Suberin, die reine
Korksubstanz (s. Kork); suberös, korkartig.
413
Subert - Sublimation.
Subert (spr. schubert), Franz Adolf, tschech. Dichter,
geb. 1845 zu Techonice, studierte in Prag, war Mitredakteur des
"Pokrok" und Sekretär des Böhmischen Klubs und ist seit
1883 Direktor des böhmischen Nationaltheaters. Er schrieb zwei
gehaltvolle historische Erzählungen: "Die Gefangennehmung des
Königs Wenzel" und "Georg Podiebrad" ; ferner das Lustspiel
"Petr Volk z Rozmberka" , ein fesselndes Intrigenstück aus der
Zeit des Bruderzwistes im Haus Habsburg, das Trauerspiel
"Probuzenci" ("Die Erwachten", 1882), aus der Zeit des
österreichischen Erbfolgekriegs und der
bayrisch-französischen Invasion in Böhmen. Wie dieses,
fußt auch das folgende: "Jan Vyrawa" (1886), in dem Kampf
zwischen den leibeignen Bauern und den Großgrundbesitzern.
Seine jüngsten Stücke sind: "Laska Raffaelova" ("Die
Liebe Raffaels", 1887), eine Frucht seiner italienischen Reisen und
Studien, die sich durch schwungvolle Diktion auszeichnet, indessen
in der Komposition viel zu wünschen übrigläßt,
und "Praktikus" (1888), worin S. seine genauen Kenntnisse der
journalistischen Welt in gar zu drastischen Effekten verwertet. Im
ganzen ist ihm mehr Fleiß und Routine als angebornes
dramatisches Talent nachzurühmen.
Subfeudum (lat.), s. Afterlehen.
Subhastation(lat.), öffentliche Versteigerung eines
Gegenstandes (vgl. Hasta), erfolgt entweder auf Antrag des
Eigentümers (freiwillige) oder auf Anordnung der Behörde
(notwendige), insbesondere um mit dem Erlös Gläubiger zu
befriedigen. Im engern Sinn versteht man unter S. die gerichtliche
Versteigerung von Immobilien und unter Subhastationsordnung ein
ausführliches Gesetz über die gerichtliche
Zwangsvollstreckung (s. d.) in Grundstücke. Subhastieren,
öffentlich versteigern.
Sub hodiérno dië (lat.), unter heutigem
Tag.
Subiáco (das röm. Sublaqueum), Stadt in der
ital. Provinz Rom, am Teverone, eng von Bergen umschlossen, hat
einen dem Papst Pius VI. 1789 errichteten Triumphbogen, ein
Kastell, Reste Neronischer Bauten, Fabrikation von Hüten,
Leder, Töpferwaren, Papier, Glocken, Ackerbauwerkzeugen etc.
und (1881) 6503 Einw. Die Umgebung von S. ist die Wiege des
Benediktinerordens; noch finden sich von zwölf dort erbauten
Klöstern zwei schon im 6. Jahrh. gestiftete vor: Santa
Scolastica und Sacro Speco mit der Felsengrotte, in die sich St.
Benedikt zurückzog. Im erstgenannten Kloster stellten die
deutschen Buchdrucker Sweynheym und Pannartz 1464 die ersten in
Italien gedruckten Bücher her. Vgl. Gregorovius, Lateinische
Sommer (5. Aufl., Leipz. 1883).
Subito (ital.), schnell, plötzlich, sofort.
Subjekt (lat. subjectum), jeder Begriff, der in der
Voraussetzung gedacht wird, daß ihm ein andrer, das
Prädikat (s. d.), in einem Urteil als Merkmal beigelegt oder
abgesprochen werde; dann der Vorstellende im Gegensatz zu dem
Vorgestellten oder dem Objekt (s. d.); auch s. v. w. Person (oft im
verächtlichen Sinn). In der Musik bezeichnet S. das Thema
einer Fuge (s. d.); man spricht von Fugen mit 2 Subjekten
(Doppelfuge), 3 Subjekten (Tripelfuge), wo mehrere Themata
selbständig durchgeführt werden.
Subjektion (lat.), Unterwerfung; als Redefigur s. v. w.
Aufwerfung und Selbstbeantwortung einer Frage (z. B. bei Herder:
"Wes ist der Erdenraum? Des Fleißigen"). Subjizieren,
unterwerfen, unterordnen; eingeben, an die Hand geben.
Subjektiv (lat.), dem Subjekt eigen, persönlich, in
der individuellen Natur des Denkenden oder Empfindenden
begründet (vgl. Objekt).
Subjektivismus (neulat.), eine Weltauffassung, welche, im
Gegensatz zur objektiven, d. h. im Objekt (s. d.), in der Natur der
(vorgestellten oder empfundenen) Sache, begründeten,
Betrachtung der Dinge, viel mehr im Subjekt (s. d.), d. h. in der
(individuellen) Natur des Vorstellenden oder Empfindenden, ihren
bestimmenden Ursprung hat. Derselbe ist theoretisch, wenn er
dasjenige, was dem (individuellen) Subjekt wahr scheint,
ebendeshalb für wahr, praktisch, wenn er dasjenige, was dem
(individuellen, eignen) Subjekt nützt, ebendeshalb für
gut (und erlaubt) erklärt, und fällt in ersterer Hinsicht
mit der Lehre der Sophisten ("Der Mensch ist das Maß aller
Dinge": Protagoras), in letzterer mit der (Un-)Moral des
Eigennutzes und des Egoismus zusammen. Dadurch, daß der S.
die Existenz von Objekten weder leugnet, noch sich für den
Schöpfer derselben erklärt, unterscheidet er sich vom
(subjektiven) Idealismus (z. B. Fichtes) dadurch, daß er sich
gegen das Dasein anderer Subjekte (außer ihm) zwar
gleichgültig verhält, dasselbe aber nicht
ausschließt, vom (theoretischen und praktischen) Solipsismus
(z. B. M. Stirners).
Subjektivität (neulat.), subjektives Wesen,
subjektive Auffassung und Darstellung, im Gegensatz zu
Objektivität (s. d.). Vgl. Subjektivismus.
Subjizieren (lat.), s. Subjektion.
Sub Jove (lat.), unter freiem Himmel.
Sub judice (lat., "unter dem Richter"), noch
unentschieden (von Prozessen).
Subjungieren (lat.), unterordnend anknüpfen.
Subjunktiv (lat.), s. v. w. Konjunktiv, s. Verbum.
Subkonträr heißt in der Logik das besonders
bejahende im Verhältnis zum besonders verneinenden Urteil,
weil es unter dem allgemein bejahenden und dieses unter dem
allgemein verneinenden steht, welche beide einander konträr
entgegengesetzt sind.
Subkutan (lat.), unter der Haut befindlich.
Sublevieren (lat.), erleichtern, unterstützen,
aushelfen; besonders einen Teil der Amtslast übernehmen;
Sublevant, Helfer, Amtsgehilfe.
Sublim (lat.), erhaben.
Sublimat (lat.), jedes Produkt einer Sublimation,
speziell s. v. w. Quecksilberchlorid (ätzendes S.).
Sublimation (lat.), Operation, welche zum Zweck hat,
starre, flüchtige Körper von nicht flüchtigen zu
trennen. Von der Destillation (s. d.) unterscheidet sich die S. nur
dadurch, daß ihr Produkt, das Sublimat, starr und nicht
flüssig ist. Die zur S. dienenden Apparate bestehen aus einem
Teil, in welchem der zu sublimierende Körper erhitzt wird, und
einem andern, geräumigern, in welchem sich die Dämpfe
verdichten. Bisweilen (Kalomelbereitung) genügt ein einziges
Gefäß, z. B. ein Glaskolben, dessen Boden in einem
Sandbad erhitzt wird. Der flüchtige Körper verwandelt
sich in Dampf, der sich an den obern Wandungen des Kolbens wieder
verdichtet. Das Sublimat bildet dann einen nahezu
halbkugelförmigen Kuchen. Bei der S. mancher Substanzen
(Benzoesäure, Pyrogallussäure) ist es praktisch, sie auf
einer Metallplatte oder in einer flachen Schale zu erhitzen und die
Dämpfe in einem Hut von Papier, den man auf die Platte oder
Schale setzt, aufzufangen. In der Technik benutzt man Töpfe
aus Steinzeug, welche über einer Feuerung in Sand eingebettet
stehen und mit ihrem Hals bis an eine eiserne Platte reichen,
welche für jeden Topf eine Öffnung besitzt. Das Sublimat
wird in kleinen irdenen Töpfen aufgefangen, welche man
über die Mündungen der größern stülpt.
Häufig sublimiert man auch in eisernen Kesseln, die über
einer Feuerung eingemauert und innen bisweilen mit feuerfesten
Stei-
414
Sublokation - Substantiv.
nen ausgekleidet werden. Man verschließt sie fest mit
einem eisernen Deckel, der nur ein kleines Loch zum Entweichen
nicht kondensierbarer Gase enthält. Derartige einfache
Apparate sind nur anwendbar, wo die Dämpfe des zu
sublimierenden Körpers sich sehr leicht kondensieren lassen.
In andern Fällen ist es notwendig, die Dämpfe aus dem
Gefäß, in welchem sie sich gebildet haben, abzuleiten
und in besondern Räumen zu verdichten. Dies geschieht z. B.
bei der S. des Schwefels, dessen Dämpfe in großen
gemauerten Kammern verdichtet werden. Sind die Dämpfe des zu
sublimierenden Körpers nicht entzündlich, so ist es
vorteilhaft, sie durch einen Luftstrom, den ein Ventilator liefert,
in die Kondensationsräume zu treiben. Dies geschieht auch
dann, wenn man das Sublimat in Form eines feinen Pulvers und nicht
als kompakte Masse erhalten will, und zwar kann man statt der Luft
auch irgend ein indifferentes Gas oder Wasserdampf anwenden. Manche
Sublimate entstehen bei der Einwirkung von Gasen auf starre
Körper, z. B. wenn man ein Bündel von Eisendraht in dem
Hals einer tubulierten Retorte erhitzt und trocknes Chlor
hindurchleitet. Es entsteht dann Eisenchlorid, welches sich in der
Retorte verdichtet. Bisweilen kann man mit der S. eine Reinigung
der Substanz von flüchtigen Verunreinigungen, z. B. von
empyreumatischen Stoffen, in der Art verbinden, daß man die
Beschickung mit Holz- oder Teerkohle mischt, welche jene
Verunreinigungen zurückhält. Manche Sublimate bilden
feste Kuchen (Zinnober, Quecksilberchlorür und -Chlorid,
kohlensaures Ammoniak, Salmiak); andre bilden Kügelchen
(Schwefelblumen) oder isolierte kleinere oder größere
Kristalle (Benzoesäure, Pyrogallussäure, Jod); alle aber
zeichnen sich meist durch große Reinheit aus. Daher benutzt
man auch die S. in der Analyse, um an wohl ausgebildeten Kristallen
den sublimierenden Körper zu erkennen.
Sublokation (lat.), Aftermiete (s. d.).
Sublunarisch (lat.), unter dem Mond befindlich.
Subluxation (lat.), eine Verrenkung, wobei die
Gelenkflächen nicht gänzlich voneinander gewichen sind,
sondern sich noch teilweise berühren.
Submarin (lat.), unterseeisch.
Submergieren (lat.), untertauchen, unter Wasser setzen;
Submersion, Untertauchung.
Subministrieren (lat.), behilflich sein, an die Hand
gehen; Subministration, Vorschubleistung, namentlich bei
Unterschleifen.
Submiß (lat.), unterwürfig.
Submission (Summission, lat.), die Vergebung
öffentlich ausgebotener Arbeiten, bez. Materiallieferungen an
den Mindestfordernden auf Grund schriftlich eingereichter geheimer
Angebote. Dieselbe ist eine allgemeine, wenn jedermann zur
Konkurrenz zugelassen wird, eine beschränkte oder engere, wenn
von vornherein eine Auswahl getroffen, die Zulassung vom Nachweis
bestimmter Fähigkeiten, Berufs-, Staats- oder
Gemeindeangehörigkeit, Kapitalbesitz zur Kautionsstellung u.
dgl. abhängig gemacht wird. über Bedeutung, Vorteile und
Mißstände der S., dann über die in der neuern Zeit
vorgeschlagenen und durchgeführten Maßregeln zur
Besserung vgl. F. C. Huber, Das Submissionswesen (Tübing.
I885). S. auch Staatsschulden, S. 204.
Suboles (Soboles. lat.), in der Botanik s. v. w.
Ausläufer.
Subordination (lat.), "Unterordnung", Dienstgehorsam;
beim Militär die Pflicht des Untergebenen, jedem Befehl seines
Vorgesetzten sich ohne Widerrede zu fügen, die Grundlage aller
Disziplin und Mannszucht (vgl. Insubordination). In der Logik ist
S. der Begriffe dasjenige Verhältnis derselben, vermöge
dessen ein Begriff zum Umfang eines andern, ihm übergeordneten
gehört (vgl. Koordinieren).
Suboxyd und Suboxydul, s. Oxyde.
Sub poena (lat.), unter Androhung einer Strafe.
Subreption (lat.), Erschleichung (s. d.), insbesondere
durch Angabe falscher Thatsachen (vgl. Obreption).
Subrogieren (lat.), jemand in eines andern Stelle setzen;
einem sein Recht abtreten.
Sub rosa (lat.), im Vertrauen, unter der Bedingung der
Verschwiegenheit. Der Ausdruck bezieht sich auf den Brauch im
Altertum, daß man bei Gastmählern eine Rose als Symbol
der Verschwiegenheit über den Gästen auszuhängen
pflegte.
Subsekutiv (lat.), nachfolgend.
Subsellien (lat.), Schulbänke; s.
Schulgesundheitspflege, S. 649.
Subsemitonium modi, der Halbton unter der Tonika, also
die große Septime in der aufsteigenden Tonleiter, der Leitton
der Tonart.
Subsequenz (lat.), das Nachfolgende.
Subsidien (lat.), ursprünglich bei den Römern
das dritte Treffen der Schlachtordnung, welches den beiden ersten
Treffen im Notfall zu Hilfe zu kommen hatte, später
überhaupt die Reserve in der Schlachtordnung; dann Bezeichnung
für Hilfsmittel überhaupt, daher "in subsidium",
subsidiär (subsidiarisch), s. v. w. unterstützend,
hilfeleistend. Namentlich versteht man unter S. Gelder, die im Fall
eines Kriegs vermöge eines besondern Vertrags
(Subsidientraktats) ein Staat dem andern zahlt (s. Allianz). In
England werden mit dem Ausdruck Subsidiengelder (grants,
"Bewilligungen") auch diejenigen Gelder bezeichnet, welche vom
Parlament jährlich für die Land- und Seemacht bewilligt
werden. Charitativsubsidien, die ehedem von der reichsfreien
Ritterschaft dem Kaiser entrichteten zeitweiligen Abgaben.
Sub sigillo (lat.), unter dem Siegel (der
Verschwiegenheit); vgl. Beichtsiegel.
Subsistieren (lat.), Bestand haben; seinen Unterhalt
haben; Subsistenz, Lebensunterhalt.
Subskribieren (lat.), unterschreiben, auf etwas
unterzeichnen, eine Subskription (s. d.) eingehen.
Subskription (lat.), die Verpflichtung durch
Namensunterschrift zur Teilnahme an einem Unternehmen oder zur
Annahme einer Ware, besonders einer litterarischen Arbeit oder
eines Kunstwerks, aber auch zur Übernahme von Aktien oder zur
Beteiligung an einer Anleihe (s. Staatsschulden, S. 204). Die S.
bewirkt für den Subskribenten rechtliche Verbindlichkeit, wenn
auch vom andern Teil alle Versprechungen sowohl hinsichtlich der
Zeit der Lieferung als auch der Beschaffenheit des zu liefernden
Gegenstandes eingehalten werden. Der Subskriptionspreis ist oft
niedriger gestellt als der spätere Kaufpreis. Das Sammeln von
Subskribenten durch Buchhandlungsreisende wird nicht als
Hausiergewerbe behandelt.
Sub sole (lat.), unter der Sonne.
Substantiell (lat.), wesenhaft, wesentlich (s. Substanz);
derb, kräftig (von Speisen); materiell; Substantialität,
Wesenheit, Selbständigkeit.
Substantiv (Nomen substantivum, Haupt-, Dingwort), in der
Grammatik Bezeichnung einer Person oder Sache oder eines Begriffs.
Der Ausdruck S. findet sich im Altertum noch nicht, sondern ist
erst bei den Grammatikern des Mittelalters aufgekommen, die ihn aus
dem lateinischen substantia ("Stoff") bildeten. Er drückt
besonders den Gegensatz dieser Wort-
415
Substanz - Subtraktion
klasse zu den Eigenschaftswörtern (Adjektiven) aus, die
bloß ein einzelnes Merkmal bezeichnen. Schon die Alten
teilten das S. in verschiedene Klassen ein; die noch jetzt
allgemein gebräuchlichen Einteilungen sind folgende. Je
nachdem ein S. ein bestimmtes, persönliches Wesen oder eine
ganze Gattung von Personen, Sachen oder Begriffen bezeichnet,
heißt es Nomen proprium (Eigenname) oder Nomen appellativum
(Gattungsname). Das Appellativum kann wieder Abstractum oder
Concretum sein, je nachdem es entweder etwas bloß Gedachtes
oder Vorgestelltes, oder etwas wirklich im Raum Vorhandenes
bedeutet. Andre Unterarten des Nomen appelativum sind die
Collectiva (Sammelwörter), die eine Gesamtheit von Individuen
bezeichnen, wie z. B. Volk, Menge, Schar, und die Materialia
(Stoffwörter), wie Gold, Wasser, Wein, Getreide. Für die
historische und vergleichende Sprachforschung sind alle diese
Unterschiede nicht vorhanden, da die Substantiva aller Arten und
selbst die Adjektiva und Partizipia fortwährend ineinander
übergehen, auch die Eigennamen stets aus einem Appellativum
entstanden sind und auch wieder zu einem solchen werden
können, wie z. B. Cäsar ursprünglich "Töter,
Mörder" bedeutete, dann ein Beiname des Gajus Julius
Cäsar, hierauf der gewöhnliche Titel der römischen
und später der deutschen "Kaiser", zuletzt in manchen
Fällen im Deutschen wieder ein Eigenname geworden ist. Das S.
ist neben dem Verbum der wichtigste der Redeteile, und es gibt
keine Sprache, der das S. fehlt. Die Flexion der Substantiva durch
angehängte Kasusendungen (s. Kasus) heißt
Deklination.
Substanz (lat.), im gewöhnlichen Sinn das Grund
wesen, das Wesentliche oder der Hauptinhalt einer Sache, der Stoff,
im Gegensatz zum Accidens (s. d.), der zufälligen, nicht
wesentlichen Eigenschaft eines Dinges. So bezeichnet man z. B.
Kapitalien als S. eines Vermögens im Gegensatz zum Ertrag oder
den Zinsen als seinen Accidenzien. In der Philosophie ist S. das
unbekannte Seiende, welches als beharrlich und bleibend
gegenüber allem Wechsel der Erscheinung gedacht wird und dem
Vielen und Mannigfaltigen die Einheit gibt. Hinsichtlich der
Bestimmung des Wesens dieser S. gehen die philosophischen Systeme
auseinander. Ob es eine Vielheit von Substanzen gebe (Monaden des
Leibniz, reale Wesen Herbarts), oder ob nur eine anzunehmen sei (S.
des Spinoza), ob dieselbe oder dieselben geistiger oder materieller
Natur seien, darüber ist der alte Streit bis auf den heutigen
Tag nicht entschieden.
Substituieren (lat), an eines andern Stelle setzen.
Substitut (lat.), ein Amts- oder Stellvertreter;
Beigesetzter, Nachgeordneter im Amt, auch s. v. w. Nacherbe (s.
Substitution).
Substitution (lat.), Stellvertretung, Einsetzung eines
Stellvertreters, namentlich seitens eines
Prozeßbevollmächtigten, der seine Vollmacht auf einen
andern überträgt; Substitutorium, die zur Beurkundung
dessen ausgestellte Urkunde. Im Erbrecht versteht man unter S. eine
eventuelle Erbeinsetzung oder, wie der Entwurf eines deutschen
bürgerlichen Gesetzbuchs (§ 1804 ff.) es nennt, die
Nacherbfolge, welche dann vorliegt, wenn der Erblasser einen Erben
in der Weise einsetzt, daß derselbe erst, nachdem ein andrer
Erbe geworden ist, von einem bestimmten Zeitpunkt oder Ereignis an
Erbe sein soll. Mit diesem Moment hört der bisherige Erbe
(Vorerbe) auf, Erbe zu sein, und die Erbschaft fällt dem
Nacherben zu. Dahin gehört zunächst die
Vulgarsubstitution, d. h. die Einsetzung eines zweiten Erben
(Substituten, Nacherben) für den Fall, daß der erst
ernannte nicht Erbe wird; ferner die Pupillarsubstitution, darin
bestehend, daß der Vater seinem unmündigen Kind einen
Erben ernennen darf für den Fall, daß dieses nach ihm
noch unmündig versterben sollte; endlich die
Quasipupillarsubstitution (substitutio quasi pupillaris s.
exemplaris), vermöge deren es allen Aszendenten freisteht,
einem blödsinnigen Abkömmling einen Substituten zu
ernennen für den Fall, daß das Kind im Blödsinn
verstirbt, jedoch nur in betreff des Vermögens, welches der
Blödsinnige von dem Aszendenten hat, nicht seines anderweiten.
Der Entwurf eines deutschen bürgerlichen Gesetzbuchs kennt nur
eine Art der Nacherbfolge, bestimmt aber (§ 1851)
bezüglich der eventuellen Erbeinsetzung für einen
Abkömmling folgendes: "Hat der Erblasser einem
Abkömmling, welcher zur Zeit der Errichtung der letztwilligen
Verfügung keinen Abkömmling hat, für die Zeit nach
dessen Tod einen Nacherben bestimmt, so ist anzunehmen, daß
die Einsetzung des Nacherben auf den Fall beschränkt sei, wenn
der Vorerbe keinen Abkömmling hinterlasse". In der Chemie
heißt S. oder Metalepsie die Vertretung eines Atoms oder
einer Atomgruppe in einer chemischen Verbindung durch ein
Äquivalent eines andern Elements oder einer andern Atomgruppe.
Bei der Einwirkung von Chlor auf manche organische Verbindungen
können ein oder mehrere Atome Wasserstoff in Form von
Chlorwasserstoff austreten, während gleich viel Atome Chlor
die Stelle des ausgetretenen Wasserstoffs einnehmen. Auf diese
Weise entstehen chlorhaltige Verbindungen (Substitutionsprodukte),
die, obgleich chlorhaltig, noch den Charakter ihrer Muttersubstanz,
aus der sie entstanden sind, besitzen. Behandelt man
Essigsäure C2H4O2 mit Chlor, so entstehen der Reihe nach
Monochloressigsäure C2H3ClO2, Dichloressigsäure
C2H2Cl2O2, Trichloressigsäure C2HCl3O2, und alle diese
Säuren zeigen noch den Charakter und die Basizität der
Essigsäure. Wie Chlor verhalten sich auch Brom und Jod und
gewisse Atomgruppen, wie NO2, NH2, SO2. Ebenso können an die
Stelle von Sauerstoff Schwefel, Selen oder Tellur, an die Stelle
von Stickstoff Phosphor, Arsen oder Antimon treten, ohne daß
der Charakter der betreffenden chemischen Verbindungen
geändert wird. Daraus muß man schließen, daß
der Charakter der organischen Substanzen bis zu einem gewissen Grad
weniger von der Natur ihrer Bestandteile als vielmehr von der Art
der Verbindung, von der Stellung, welche letztere einnehmen,
abhängig ist. Diese Thatsachen führten in der Chemie zur
Aufstellung der Typentheorie durch Dumas und Laurent und der
Kerntheorie durch Laurent, und wenn beide auch nicht allgemeine
Geltung erlangt haben, so bildeten sie doch die Brücke zu den
neuen, jetzt herrschenden Anschauungen.
Substitutionsverfahren, s. Zucker.
Substrat (lat.), Unterlage, Grundlage; der vorliegende
Fall; in der Logik s. v. w. Substanz.
Substruktion (lat.), Unter-, Grundbau.
Subsultus tendinum (lat.), Sehnenhüpfen (s. d.).
Subsumieren (lat.), unter etwas zusammenfassen, mit
begreifen, etwas folgern; Subsumtion, Zurückführung des
Besondern auf ein Allgemeines; Voraussetzung, Annahme; subsumtiv,
voraussetzend.
Subtil (lat.), zart, fein; spitzfindig.
Subtrahendus (lat.), s. Subtraktion.
Subtraktion (lat.), in der Arithmetik die zweite der vier
Spezies, welche zu zwei gegebenen Zahlen, dem Minuendus und dem
Subtrahendus, eine
416
Subtropen - Suchitoto.
dritte, die Differenz (den Unterschied), findet, die, zu dem
Subtrahendus addiert, den Minuendus gibt. Das Zeichen der S. ist -
oder -, gelesen minus oder weniger, z. B. 12-4=8. Das Verfahren bei
S. mehrzifferiger Zahlen besteht gewöhnlich darin, daß
man die einzelnen Ziffern des Subtrahendus von den (nach Befinden
um 10 vermehrten) des Minuendus subtrahiert, z. B. 25831-16543 wird
gerechnet 3 von 11 gibt 8, 4 von 12 gibt 8, 5 von 7 gibt 2, 6 von
15 gibt 9, 1 von 1 gibt 0; in Österreich und auf einzelnen
Schulen anderwärts rechnet man dagegen: 3+8 ist 11, 5
(nämlich 4+1)+8 ist 13, 6(5+1)+2 ist 8, 6+9 ist 15, 2+0 ist 2.
Das Resultat ist also 9288. Das letztere Verfahren ist vorzuziehen,
weil man bei Gewöhnung an dasselbe bei der Division die
abzuziehenden Tellprodukte nicht hinzuschreiben braucht, sondern
gleich den Rest angeben kann.
Subtropen, der zu beiden Seiten der Tropen gelegene
Gürtel, ausgezeichnet durch die Gleichmäßigkeit der
Temperatur, umfaßt die Gegenden mit ausgesprochenem
Winterregen. Subtropisch, dem Tropischen sich annähernd, z. B.
subtropische Vegetation.
Subulirostres, s. v. w. Pfriemenschnäbler.
Sub una specie (lat.), unter einerlei Gestalt,
nämlich nur des Brotes, wie die Katholiken das Abendmahl
genießen; sub utraque specie, unter beiderlei Gestalt (vgl.
Abendmahl und Hussiten).
Subura, im alten Rom eine zwischen dem Kapitol und
Esquilinus befindliche Niederung, durch welche eine sehr belebte,
mit zahlreichen Tavernen und Bordellen besetzte Straße
führte.
Subvention (lat.), Beihilfe, Unterstützung,
insbesondere aus öffentlichen Mitteln.
Subverfion (lat.), Umsturz; subversiv, Umsturz
bezweckend; subvertieren, umstürzen, zerstören.
Sub voce (lat.), unter dem und dem Wort.
Subzow, Kreisstadt im russ. Gouvernement Twer, am
Einfluß der Wasusa in die Wolga, mit 5 griechisch-russ.
Kirchen und (1885) 4191 Einw.
Succedaneum (lat.), Ersatz, Notbehelf.
Suceedieren (lat.), nachfolgen, in ein
Rechtsverhältnis als Berechtigter eintreten (s.
Rechtsnachfolge).
Succeß (lat.), glücklicher Erfolg.
Succession (lat.), s. Rechtsnachfolge.
Successive (lat.), nach und nach, allmählich.
Successor (lat.), Rechtsnachfolger.
Succinate, s. Bernsteinsäure.
Succinit, s. v. w. Bernstein; auch eine bernsteinfarbige
Varietät des Granats.
Succiusäure, s. Bernsteinsäure.
Succinum (lat.), Bernstein.
Succus (lat.), Saft, S. entericus, Darmsaft; dann
besonders Pflanzensaft; z. B. S. Citri, Zitronensaft; S. Juniperi
inspissatus, Wacholdermus, eingedampfter Saft frischer
Wacholderbeeren; S. Liquiritiae (Glycyrrhizae), Lakritzen, Extrakt
der Süßholzwurzel; S. Sambuci inspissatus, Fliedermus,
der eingedampfte Saft der Holunderbeeren.
Suche, Jagdmethode, bei welcher man das Wild mit dem Hund
aufsucht, um es beim Verlassen seiner Lagerstätte zu
schießen; auch die Nachsuche auf angeschossenes Wild mit dem
Schweißhund.
Suchenwirt, Peter, der berühmteste Wappendichter des
14. Jahrh., im Österreichischen geboren, begleitete 1377 den
Herzog Albrecht III. von Österreich auf seinem Kriegszug nach
Preußen, lebte später in Wien und starb nach 1395. Unter
seinen zahlreichen Dichtungen (hrsg. von Primisser, Wien 1827)
behauptet die poetische Erzählung "Von Herzog Albrechts
Ritterschaft" (Ritterzug) den ersten Platz.
Sucher, kleines Fernrohr mit großem Gesichtsfeld,
welches mit einem größern astronomischen Fernrohr
derartig verbunden ist, daß die Achsen beider Instrumente
genau parallel sind. Hierdurch wird die Auffindung eines Objekts am
Himmel, welche mit dem großen Instrument allein wegen der
Kleinheit seines Gesichtfeldes schwierig wäre, wesentlich
erleichtert. Denn richtet man das Instrument so, daß der zu
betrachtende Gegenstand in der Mitte des Gesichtsfeldes des Suchers
erscheint, so wird er auch für das größere Fernrohr
im Gesichtsfeld sich befinden.
Sucher, Joseph, Komponist und Dirigent, geb. 1843 zu St.
Gotthardt in Ungarn, erhielt seinen ersten Musikunterricht in Wien
als Sängerknabe der kaiserlichen Hofkapelle, studierte
später die Rechte, widmete sich aber schließlich ganz
der Musik und übernahm nach absolviertem gründlichen
Studium der Komposition unter Leitung Sechters die Direktion des
Wiener akademischen Gesangvereins. Nachdem er dann zeitweilig auch
als Kapellmeister der Komischen Oper fungiert hatte, folgte er 1876
einem Ruf als Theaterkapellmeister nach Leipzig, wo er sich
namentlich um die Vorführung der Wagnerschen Musikdramen
großes Verdienst erwarb. Im folgenden Jahr verheiratete er
sich mit der Sängerin Rosa Hasselbeck, einer Zierde der
Leipziger Oper. 1879 wurden beide an das Stadttheater nach Hamburg,
1888 an das Berliner Opernhaus berufen.
Suchet (spr. ssüschä), Louis Gabriel, Herzog
von Albufera, franz. Marschall, geb. 2. März 1770 zu Lyon,
trat 1792 als Freiwilliger in die Lyoner Nationalgarde, focht 1794
und 1795 in Italien unter Laharpe, ward 1797 Brigadegeneral und
befehligte 1798-1800 als Divisionsgeneral erst in der Schweiz, dann
in Italien. Nach dem Frieden von Lüneville 1801 wurde S. zum
Generalinspektor der Infanterie ernannt und erhielt 1804 eine
Division im Lager von Boulogne. In den Feldzügen von 1805,
1806 und 1807 zeichnete sich seine Division, die erste des 5. Korps
unter Lannes, vielfach aus. Nach dem Frieden von Tilsit befehligte
S. das 5. Korps in Schlesien und führte gegen Ende 1808
dasselbe nach Spanien. Nach Saragossas Fall übernahm er im
April 1809 das Kommando der Armee von Aragonien, siegte bei Mavia,
Belchite und Lerida und eroberte Tortosa und Tarragona, womit er
sich den Marschallsstab erwarb. 1812 schlug er Blake abermals bei
Sagunto und eroberte 9. Jan. Valencia, wofür er den
Herzogstitel erhielt. Nachdem er Anfang 1814 über die
Pyrenäen zurückgegangen, erklärte er aus seinem
Hauptquartier Narbonne 14. April die Anerkennung Ludwigs XVIII. und
schloß einen Waffenstillstand mit Wellington. Bei der
Rückkehr Napoleons I. von Elba ließ er sich jedoch von
demselben das Kommando der Alpenarmee übertragen, drang 14.
Juni in Savoyen ein, ward aber von den Österreichern
zurückgeworfen. Bei Ludwigs XVIII. Rückkehr verlor er die
Pairswürde, erhielt dieselbe aber 1819 zurück. Er starb
3. Jan. 1826 in Marseille. In Lyon ist ihm ein Denkmal errichtet.
Seine "Mémoires sur les campagnes en Espagne depuis 1808
jusqu'en 1814" (2. Aufl., Par. 1834, 2 Bde.) veröffentlichte
sein Stabschef Saint-Cyr-Nuguas. - Suchets Sohn Napoléon S.,
Herzog von Albufera, geb. 23. Mai 1813, war 1852-70 Mitglied des
Gesetzgebenden Körpers, starb 23. Juli 1877 in Paris.
Suchitoto (spr. ssutschi-), Hauptstadt des Departements
Cuscutlan im mittelamerikan. Staat Salvador, auf einer Anhöhe
beim Rio Lempa, hat Anbau von Mais, Zuckerrohr etc. und (1878) 5826
Einw.
417
Suchona - Südafrikanische Republik.
Suchoua (Ssuchona), einer der beiden Quellströme der Dwina
im russ. Gouvernement Wologda, kommt aus dem Kubenskischen See,
wendet sich bald nach NO. und behält diese Richtung bis zur
Vereinigung mit dem Jug bei. Die Länge dieses im ganzen Lauf
schiffbaren Flusses beträgt 580 km. Durch den Kanal des
Herzogs Alexander von Württemberg steht der Fluß mit der
Ostsee wie mit dem Kaspischen Meer in Verbindung.
Sucht, in der Medizin ein veraltetes Wort, das nur noch
in Zusammensetzung vorkommt, wahrscheinlich gleichen Stammes mit
"Seuche" und "siechen", früher ganz allgemein Krankheit, hat
sich dann erhalten in Schwind-, Wasser-, Fett-, Gelbsucht etc.
Süchteln, Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Düsseldorf, Kreis Kempen, unweit der Niers und an der Linie
Viersen-S. der Krefelder Eisenbahn, hat eine evangelische und kath.
Kirche, starke Samt- und Samtbandweberei, Seidenfärberei,
Zeugdruckerei, Flachsbereitung, Appreturanstalten, Gerberei,
Ziegeleien, Ölmühlen und (1885) 9465 meist kath.
Einwohner. Nahe der Stadt auf einem Höhenzug das
Kriegerdenkmal und ein Aussichtsturm mit prachtvoller Fernsicht
sowie auf dem Heiligenberg die alte Irmgardiskapelle, ein
vielbesuchter Wallfahrtsort.
Suchum Kale (Soghum Kala), befestigte Gebietshauptstadt
in der russ. Statthalterschaft Kaukasien, am Schwarzen Meer, mit
vortrefflichem, gegen alle Winde geschütztem Hafen, aber nur
(1879) 1947 Einw. Der Ort steht auf den Ruinen des alten
griechischen Dioskurias, einer Gründung der Milesier, wurde
1809 von den Russen erobert, aber erst 1829 im Frieden von
Adrianopel von der Türkei abgetreten und erhielt nun
ansehnliche Magazine und einen schönen Bazar. 1854 wurde es
von den Russen bei Annäherung einer
englisch-französischen Flottille eiligst geräumt,
teilweise zerstört und von den Abchasen, welche die
türkische Flagge aufpflanzten, geplündert. Im September
1855 landete Omer Pascha mit einem türkischen Korps und begann
von hier aus die Operationen gegen Tiflis. Im Mai 1877 wurde der
Ort abermals von den Türken besetzt, aber, da die
beabsichtigte Insurgierung der Bergvölker nicht gelang, im
September wieder geräumt und darauf von den Abchafen
verbrannt.
Suckow, Albert, Freiherr von, württemberg.
Kriegsminister, geb. 13. Dez. 1828 zu Ludwigsburg, Sohn des 1863
verstorbenen Obersten Karl von S. (Verfassers der
militärischen Erinnerungen aus der Napoleonischen Zeit: "Aus
meinem Soldatenleben", Stuttg. 1863), der, ein Mecklenburger, in
der Rheinbundszeit in württembergische Dienste getreten war,
und der als Schriftstellerin unter dem Pseudonym Emma von Niendorf
bekannten Freifrau Emma v. Callatin (gest. 1876 in Rom). 1848 wurde
S. Leutnant der Artillerie, seit 1861 als Hauptmann mit der Leitung
der Kriegsschule betraut. 1866 als Major
Militärbevollmächtigter im Hauptquartier der Bayern, nahm
er an den Waffenstillstands- und Friedensverhandlungen mit
Preußen teil, ward Adjutant des Kriegsministers v. Wagner,
den er bei der Einführung des preußischen Heersystems
unterstützte, sodann Oberst und Generalquartiermeister, 24.
März 1870 als Generalmajor Chef des Kriegsdepartements und
machte sich um die Organisation der württembergischen Division
und ihre Ergänzung und Verpflegung während des Kriegs
hochverdient. Er wurde dafür 19. Juli d. J. zum
Generalleutnant und Kriegsminister befördert, als welcher er,
mehrmals in das preußische Hauptquartier in Frankreich
gesandt, die Militärkonvention mit Preußen und die
Reichsverträge abschloß; er erhielt eine Dotation von
300,000 Mk. S. nahm 1874 seinen Abschied und lebt zu Baden-Baden.
Gegen Arkolay (Streubel) schrieb er die Broschüre "Wo
Süddeutschland Schutz für sein Dasein findet?" (Stuttg.
1869).
Sucre (spr. ssuhkre), 1) Stadt in Bolivia, s. Chuquisaca.
- 2) (Puerto de S.) Einfuhrhafen der Stadt Cariaco (s. d.) in
Venezuela.
Sucre (spr. ssuhkre), Antonio José de,
Präsident von Bolivia, geb. 1793 zu Cumana in Venezuela, trat
1810 in die südamerikanische patriotische Armee, diente
1814-17 im Generalstab und dann unter Bolivar gegen Neugranada,
brachte den Spaniern mehrere Niederlagen bei und entschied als
Oberbefehlshaber der republikanischen Truppen durch den Sieg bei
Ayacucho 9. Dez. 1824 die Befreiung Südamerikas vom spanischen
Joch. Er erhielt hierfür durch den Kongreß von Bolivia
den Titel Großmarschall von Ayacucho und ward 1825 von der
Republik Bolivia zum lebenslänglichen Präsidenten
erwählt, legte aber infolge der innern Unruhen 1. Aug. 1828
diese Würde nieder und ward im Juni 1830 bei Pasto unweit
Cartagena, wo er für Bolivar zu wirken suchte, meuchlings
erschossen.
Suczawa (spr. ssutschawa), Stadt in der Bukowina, unweit
des Flusses S. (Nebenfluß des Sereth), über den hier
eine Brucke zur Station S.-Itzkany (mit Grenzzollamt) der
Lemberg-Jassyer Eisenbahn führt, dicht an der rumänischen
Grenze, ist Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines
Kreisgerichts, hat ein Obergymnasium, eine alte
griechisch-oriental. Kathedrale mit dem Grab des heil. Johann von
Novi, Landespatrons der Bukowina, Burgruinen, eine nichtunierte
Armeniergemeinde, Bierbrauerei, ansehnlichen Speditionshandel und
(1880) 10,104 Einw. S. war ehedem die Hauptstadt der Moldau und als
solche ein großer und blühender Ort.
Südafrikanische Republik, seit 1884 offizieller Name
des früher Transvaal genannten Freistaats in Südafrika
(s. Karte bei Artikel "Kapland"), erstreckt sich von dem
Vaalfluß im Süden über den Wendekreis hinaus bis
zum Limpopo im N. und wird im W. und N. begrenzt von
Britisch-Betschuanaland, im O. von Portugiesisch-Ostafrika und
Swasiland, im Süden von der Neuen Republik, Natal und der
Oranjefluß-Republik und umfaßt 308,200 qkm (5597 QM.)
mit Einschluß der Neuen Republik (s. d.), als Distrikt
Vrijheid einverleibt, 315,590 qkm (5681 QM.). Die Bodengestaltung
der Republik wird wesentlich bedingt durch den Verlauf zweier
Gebirge. Durch das eine derselben, die Drakenberge mit der 2188 m
hohen Mauchspitze, ein nordsüdlich sich hinziehendes Plateau,
das steil gegen O. abfällt, gegen W. aber sich allmählich
abdacht, wird das Land geteilt in eine größere und
höher gelegene westliche Hälfte und eine kleinere
östliche, welch letztere in eine sandige Ebene übergeht,
aus welcher als Grenzscheide gegen portugiesisches Gebiet der lange
nordsüdlich verlaufende Höhenzug des Lebombo hervorragt.
Das zweite Gebirge besteht aus einer Reihe westöstlich
verlaufender Ketten (Magalisberge, Witwatersrand), welche wiederum
die S. R. in einen südlichen höhern Teil, das Hooge Veld,
und einen nördlichen tiefern, das Bosch Veld, trennen. Diese
Bergzüge bilden auch in klimatischer Beziehung eine Scheide.
Im Hochfeld sind die Tage im Winter zwar warm, nachts aber sinkt
das Thermometer gewöhnlich unter den Gefrierpunkt, und die
Drakenberge sind häufig mit Schnee bedeckt, im Buschfeld aber
sind die Winter milder,
418
Südafrikanische Republik.
und es gedeihen dort Kaffee, Baumwolle, Zuckerrohr u. a. Auch
östlich von den Drakenbergen ist es wärmer; infolge der
vom Indischen Ozean her wehenden Südostpassate ist die
Ostseite regenreich, während die westlichen Hochebenen arm an
Regen sind. Die Regenzeit fällt in den Sommer. In dieser Zeit
herrschen im Buschfeld Fieber, während das Hochfeld eine der
gesündesten Gegenden der Erde ist. Hier leben die Buren im
Sommer, im Winter ziehen sie mit ihren Herden ins Buschfeld. Die
Pflanzenwelt in den einzelnen Gebieten ist sehr verschieden. Das
Land trägt fast durchgehends den Charakter der Steppe, aber
während das Hochfeld fast ganz aus weiten, einförmigen
Grassteppen besteht, ist das Buschfeld mit dichtem, vielfach
undurchdringlichem Strauchwerk bedeckt, in dem man nur einzelne
offene Stellen antrifft. Hier finden sich auch Adansonien und andre
tropische Gewächse. In Klüften am Ostabhang des
Tafellandes trifft man noch majestätische Urwälder aus
Gelbholzbäumen (Taxus elongata), Eisen- und Stinkholz und
Mimosen; Akazien, Proteen, Euphorbia candelabrum etc.
charakterisieren die Hochebenen der Mittelstufen. Mais, Kafferkorn,
Hirse, Bohnen, Erbsen, Melonen werden kultiviert. In der Tierwelt
herrschen Antilopen vor, Springböcke finden sich auf den
grasreichen Hochebenen noch in Herden. Gnus, Zebras und Quaggas,
Giraffen, Büffel, Elefanten und Nashörner sind selten
geworden, ebenso Löwen, Leoparden und Hyänen sowie der
Strauß. Krokodile hausen in den Flüssen; giftige
Schlangen sind zahlreich, in den nordwestlichen, nördlichen
und östlichen Grenzgebieten erschwert die Tsetsefliege die
Viehzucht. Von einheimischen Haustieren fanden die Europäer
Rinder, Schafe mit Fettschwänzen, Ziegen und Hunde vor, Pferde
und Merinoschafe wurden eingeführt. Viehzucht bildet die
Hauptbeschäftigung der Ansiedler. Sehr fruchtbar sind die
kahlen Hochebenen des Südens. Mais, Korn, Hirse,
Hülsenfrüchte, Zuckerrohr, Wein gedeihen hier sehr gut.
Das Land ist reich an Gold, Silber, Kupfer, Graphit, Nickel,
Kobalt, Blei, Steinkohle, Zinn, Salz, Alaun u. a. Gold wurde seit
1871 gefunden, in größern Mengen aber erst seit 1883 auf
den Goldfeldern von De Kaap (Barberton) und Witwatersrand
(Johannesburg); ausgeführt wurde über die Kapkolonie und
Natal 1871 bis Mitte 1888 für 1,266,530 Pfd. Sterl.;
Silbererze gewinnt man in der Nähe von Pretoria. Die
weiße Bevölkerung wird auf 60-75,000 Seelen
geschätzt, zum größten Teil Buren, nur 12-15,000
Europäer, unter den letztern auch zahlreiche Deutsche, die auf
mehreren von hannöverschen Missionären gegründeten
Ansiedelungen wohnen. Dazu kommt seit den letzten Jahren eine
20,000 Köpfe starke Bevölkerung, meist englischer
Abstammung, auf den genannten Goldfeldern. Die Zahl der Kaffern
(Betschuanen, Basuto u. a.) ermittelte der Zensus von 1886 zu
299,848 Seelen, die Gesamtbevölkerung kann daher zu 490,000
angenommen werden. Das Christentum hat trotz zahlreicher
Missionäre nur teilweise unter den Eingebornen Platz
gegriffen. Die Beschäftigung der Bevölkerung ist
ausschließlich Naturalwirtschaft. Die Ausbeutung der
großen natürlichen Reichtümer des Landes wird
erschwert durch den Mangel an genügenden
Transportverhältnissen. Die Ausfuhr besteht in Wolle,
Rindvieh, Cerealien, Leder, Fellen, Früchten, Tabak, Butter,
Branntwein, Straußfedern und Elfenbein, außerdem Gold.
Die Einfuhr (1887: 1,695,978 Pfd. Sterl.) besteht in
Industrieprodukten. Der Handel nimmt seinen Weg, da die S. R. vom
Meer abgeschloffen ist, über D'Urban, Port Elisabeth und
Kapstadt, wird sich aber, nachdem die im Bau begriffene Eisenbahn
von der Delagoabai bereits bis zur Grenze (81 km) vollendet ist und
jetzt nach Pretoria weitergeführt wird, zum großen Teil
über die portugiesische Kolonie richten. Telegraphenlinien
bestehen zwischen Pretoria und Standerton, Heidelberg und Heilbron
im Oranjefreistaat und von Pretoria nach den Kaap-Goldfeldern, im
ganzen 1116 km, im Bau sind 895 km. Das Land wird eingeteilt in 16
von Landdrosten verwaltete Distrikte, an der Spitze steht ein auf
fünf Jahre gewählter Präsident, eine aus 46 vom Volk
erwählten Mitgliedern bestehende Legislative hat die
Gesetzgebung. Staatskirche ist die niederdeutsch-reformierte, doch
sind alle Konfessionen geduldet. Die Staatseinnahmen fließen
meist aus direkten Steuern und Zöllen; dieselben betrugen
1887: 668,433 Pfd. Sterl., die Ausgaben 721,073 Pfd. Sterl. Die
öffentliche Schuld beträgt 430,000 Pfd. Sterl., davon
250,000 Pfd. Sterl. an die englische Krone; das Staatsvermögen
besteht in Ländereien im geschätzten Wert von mehreren
Millionen Pfund Sterling. Ein stehendes Heer gibt es nicht; im
Kriegsfall werden sämtliche Bürger aufgeboten. Hauptstadt
ist Pretoria.
Geschichte. Die Transvaalrepublik wurde gegründet durch
holländische Buren, welche englische Mißwirtschaft aus
der Kapkolonie zunächst nach Natal und dann von dort über
die Drakenberge trieb, wo sie 1848 die Oranjefluß-Republik
und die anfänglich getrennten, aber 1852 durch Pretorius zur
Republik Transvaal vereinigten Freistaaten Potschefstroom,
Zoutpansberg und Lydenburg bildeten. Diese Republik wurde in
demselben Jahr von England anerkannt. Als aber das Transvaal mit
Portugal in Unterhandlungen trat zum Zweck der Erbauung einer
Eisenbahn nach der Delagoabai, wodurch die Ausfuhr des Freistaats
von Natal, über welchen sie den Weg nehmen mußte,
abgelenkt worden wäre, benutzte England einen für die
Buren verderblichen Raubzug des Kaffernhäuptlings Sikukuni, um
1877 das Transvaal zu annektieren unter dem Vorgeben, dadurch die
christliche Bevölkerung schützen zu wollen, in Wahrheit
aber, um sich das bedrohte Handelsmonopol zu sichern. Die Proteste
der Buren blieben unbeachtet. In dem nun folgenden Aufstand
erlitten die Engländer bei ihrem Versuch, in das Gebiet der
Republik einzudringen bei Laings-Nek (24. Jan. 1881), am Ingogo (8.
Febr.) und am Majubaberg (27. Febr.) empfindliche Niederlagen, so
daß England es vorzog, dem Land durch Vertrag vom 3. Aug.
1881 seine Unabhängigkeit wiederzugeben. In der 1884
abgeschlossenen Konvention nahm das Land den alten Namen
"Südafrikanische Republik" wieder an. Die
Souveränität der britischen Krone wurde wesentlich
beschränkt, indem nur Verträge und Verbindlichkeiten,
welche die Republik mit einem Staat oder Volk (außer dem
Oranjefreistaat) oder mit einem eingebornen Volksstamm einzugehen
beabsichtigt, der englischen Krone zur Genehmigung zu unterbreiten
sind. Als 1881 die im Westen der Republik neuentstandenen
Burenfreistaaten Stellaland und Goschen sich bildeten, trat
letzteres unter den Schutz der Südafrikanischen Republik, doch
mußte derselbe auf einen von seiten Englands erhobenen
Protest zurückgezogen werden. Zugleich proklamierte England
sein Protektorat über das zwischen Transvaal und den deutschen
Besitzungen an der Westküste Afrikas liegende Gebiet und
über einen Landstreifen nördlich von Transvaal, somit die
Buren nach diesen Seiten völlig einschließend. Und als
1884 der Bu-
419
Sudak - Südaustralien.
renfreistaat Nieuwe Republik entstand, wodurch die Buren einen
Weg zum Indischen Ozean gewinnen wollten, annektierte England auch
hier das sämtliche noch freie Land und nötigte die Buren,
ihre Ansprüche auf die Meeresküste zurückzuziehen.
Somit war die S. R. rings von englischem Gebiet umschlossen. Nur
nach der Delagoabai blieb noch ein Weg durch portugiesisches
Gebiet, und hier ist denn auch bereits der Anfang zu einer
Eisenbahn gemacht worden, welcher das Innere der Republik mit
diesem Hafen verbinden soll (s. oben). Ein 1888 gemachter Versuch,
die Burenrepublik in einem alle von Europäern gegründeten
Staaten Südafrikas umfassenden Zollverband zu vereinigen,
verlief ohne Ergebnis, vielmehr schlossen sich die
Oranjefluß-Republik und die S. R. enger aneinander durch
einen Zollverband. Vgl. Jeppe, Die Transvaalsche Republik (Gotha
1868); E. v. Weber, Vier Jahre in Südafrika 1871-75 (Leipz.
1878,2 Bde.); Aylward, Transvaal of to-day (neue Ausg.,Lond. 1881);
Roorda-Smit, Die Transvaalrepublik und ihre Entstehung (2. Aufl.,
deutsch, Köln 1884); Nixon, Complete story of the Transvaal
(Lond. 1885); Bellairs, The Transvaal war 1880-81 (das. 1885);
Klössel, Die südafrikanischen Republiken (Leipz. 1888);
Heitmann, Transvaal (das. 1888); Jeppe, Transvaal Book. Almanac for
1887 (Maritzburg 1887); Merensky, Erinnerungen aus dem
Missionsleben in Südostafrika (Bielef. 1888).
Sudak (Ssudak), Flecken im russ. Gouvernement Taurien, am
Schwarzen Meer und am Südabhang der Krimschen Berge, 40 km von
Feodosia, hat bedeutenden Exporthandel in Wein und getrockneten
Früchten. Es war schon im 8. Jahrh. ein wichtiger Handelsplatz
der Byzantiner und kam im 13. Jahrh. in den Besitz der Venezianer.
1365 entrissen die Genuesen die Stadt den Venezianern und erbauten
eine Festung, deren Überreste noch heute erkennbar sind. Zu
Ende des 14. Jahrh. setzten sich die Türken hier fest, bis
nach dem Untergang des krimschen Chanats die russische Herrschaft
begann. Eine gleichnamige deutsche Kolonie liegt 3 km entfernt.
Südamerika, s. Amerika.
Sudamina (lat.), Schweiß- oder
Hitzblätterchen, Schweißfriesel (s. Friesel).
Sudan (Nigritien, Nigerland), vom arabischen
áswad, "schwarz", plur.: sud, der Teil des Binnenlandes von
Nordafrika, welcher im N. von der Sahara begrenzt wird, im
Süden bis an den Äquator, im W. bis an den Fuß der
innern Bergländer von Senegambien und Guinea, im O. bis an die
zwischen Dar Fur und Kordofan liegende Wüste sowie bis an den
Fuß der abessinischen Gebirge reicht und etwa 16 Breiten- und
36-40 Längengrade umfaßt (s. Karte "Ägypten etc.").
S. begreift hiernach außer dem langen und breiten Thal des
mittlern Nigerlaufs auch die östlich von letzterm unter
gleichen Breitengraden gelegenen sowie die im Süden bis an den
Äquator sich erstreckenden Länder (Bambarra, Dschinni,
Haussa, Bornu, Mandara, Baghirmi, Wadai, Dar Fur etc.). Die
ägyptische Geschäftssprache bezeichnet mit Sudanland
(Beled es= S.) insbesondere die Länder Dar Fur, Kordofan und
Senaar. Vgl. Afrika und die einzelnen Länderartikel. S. ward
1874 von den Ägyptern erobert und ägyptische Provinz.
1881 aber erhob sich der Mahdi (s. d.) im S. und riß
während des Aufstandes Arabi Paschas in Ägypten die
Herrschaft an sich. Ein Versuch der Ägypter unter Hicks
Pascha, S. wiederzu erobern, endete mit der Vernichtung des
ägyptischen Heers bei Kaschgil (3. Nov. 1883). Die
Engländer schickten darauf im Januar 1884 Gordon, der
ägyptischer Gouverneur Sudans gewesen war, nach S., um die
Bevölkerung auf friedliche Weise wiederzugewinnen, sandten
aber gleichzeitig ägyptische Truppen unter Baker Pascha nach
Suakin am Roten Meer, um von hier aus in S. einzudringen. Der erste
Versuch der Ägypter hatte ihre Niederlage am Teb (4. Febr.
1884) gegen Osman Digma zur Folge. Nachgesandte englische Truppen
unter General Graham siegten zwar über die Aufständischen
bei Teb (29. Febr.) und bei Tamanieb (13. März) über
Osman Digma, doch wurde der weitere Vormarsch ins Innere
aufgegeben. Gordon richtete in Chartum durch gütliche
Verhandlungen nichts aus und wurde sogar von den
Aufständischen eingeschlossen. Die Engländer rückten
unter General Wolseley nilaufwärts vor, um ihn zu entsetzen,
doch kamen sie zu spät: 26.Jan. 1885 wurde Chartum von den
Anhängern des Mahdi erstürmt und Gordon getötet. Die
ägyptische Regierung verzichtete nun auf die Wiedereroberung
Sudans. Vgl. Nachtigal,Sahara und S. (Berl. u.Leipz. 1879-89, 3
Bde.); James, The wild tribes of the Soudan (2. Aufl., Lond. 1884);
Wilson u. Felkin, Uganda und der ägyptische S. (deutsch,
Stuttg. 1883); Paulitschke, Die Sudanländer (Freiburg 1884);
Buchta, Der S. unter ägyptischer Herrschaft (Leipz. 1888).
Sudation (lat.), das Schwitzen; Sudatorium, Schwitzbad,
Schwitzkasten.
Südaustralien, britisch-austral. Kolonie, begreift
den ganzen mittlern Teil des Australkontinents (s. Karte
"Australien") zwischen dem Indischen Ozean im Süden und dem
Timormeer im N., dem 129.° östl. L. v. Gr. im W. (gegen
Westaustralien) und Queensland, Neusüdwales und Victoria im O.
und besteht aus dem 983,655 qkm (17,864 QM.) großen
eigentlichen S., das vom Südlichen Ozean bis zum 26.°
südl. Br. reicht, und dem 1,356,120 qkm (24,628 QM.)
großen Nordterritorium nördlich davon. Über das
letztere s. den betreffenden Artikel. Das eigentliche S. hat zwei
tief ins Land eindringende Meereseinschnitte: den Spencergolf und
den Golf St. Vincent, gebildet durch die Halbinseln Eyria, York und
Kap Jervis; östlich von letzterm dringt auch die Encounterbai,
in welche der Murray mündet, tiefer ein. Vor dem Vincentgolf
liegt die große Känguruhinsel, die einzige bedeutendere
der Küste. Vom Kap Jervis im Süden erstreckt sich
nordwärts die MountLoftykette und daran anschließend die
Flinderskette (aus Sandstein, Schiefer und Kalkstein bestehend) mit
den höchsten Erhebungen (nicht über 1000 m) des Landes.
Nur auf diesen Bergen und in deren nächster Nachbarschaft
sowie in dem schönen Mount Gambierdistrikt mit ausgestorbenen
Vulkanen, Basalt- und Tropfsteinhöhlen im SO. fällt
hinreichender Regen, um das Land genügend für den
Ackerbau zu befeuchten. Von Süden nach N. schwindet derselbe
mehr und mehr, auch gegen W. und O. zu herrscht große
Dürre, die Gawlerberge auf der Eyriahalbinsel sind völlig
dürr und kahl. Beständig fließende Flüsse gibt
es daher außer dem Murray, der die Kolonie im SO.
durchfließt und vor seiner Mündung die
Süßwasserseen Alexandrina und Albert bildet, gar nicht,
die zahlreichen Seen (Torrens, Eyre, Frome, Gairdner u. a.) sind
nur schreckliche Salzsümpfe und ihre Nachbarschaft meist
traurige Wüste. Doch gibt es um den Eyresee zahlreiche zu Tage
tretende Quellen in freilich unfruchtbarer Gegend, auch hat man in
neuester Zeit durch Bohrungen große Waffervorräte
erschlossen. Das Klima ist durchaus gesund, in Adelaide steigt die
Temperatur im Januar bis
27*
420
Südbrabant - Südcarolina.
45° C. und sinkt im August bis 2° C.; Gewitter,
Hagelschlag und heftige Regengüsse sind namentlich im Sommer
häufig, dann machen sich auch die aus dem Innern wehenden
glühenden Winde sehr zum Schaden der Vegetation bemerkbar. Die
einheimische Pflanzen- und Tierwelt unterscheidet sich in nichts
von denen des übrigen Australien. Die europäischen
Ansiedler haben die Orange, Olive, den Pfirsich- und Feigenbaum,
den Weinstock sowie Weizen, Gerste, Hafer, Kartoffeln u. a.
eingeführt; namentlich zeichnet sich die Kolonie durch ihren
vorzüglichen Weizen aus, der nebst Mehl Absatz in England
findet, auch der Wein gewinnt jetzt dort Freunde. Von den 1,9 Mill.
Hektar kultivierten Landes waren 1885 mit Wetzen bestellt 776,981
Hektar, mit Wein bepflanzt 1836 Hektar. Infolge ihrer Trockenheit
eignet sich die Kolonie vornehmlich für Schafzucht; man
zählte 1884: 6,696,406 Schafe, 389,726 Rinder, 168,420 Pferde
und 163,807 Schweine. An Mineralien ist das Land reich. Die
frühern außerordentlichen Erträge von Kupfer
(Kapunda, Wallaroo, Moonta, Blinman) haben zwar sehr nachgelassen,
und die Bearbeitung der Silber-, Blei- und Eisengruben hat man ganz
aufgegeben; dafür findet man Wismut und Gold, letzteres in
neuester Zeit in der ganzen mittlern Gebirgskette vom Süden
bis zum hohen Norden. Kohle aber hat man trotz eifriger Forschungen
bis jetzt nirgends entdeckt, dieselbe muß aus Newcastle und
Neusüdwales eingeführt werden. Die Bevölkerung
(1887: 317,446, wovon 65,199 männlich, 52,247 weiblich) ist
fast ganz britisch; die Zahl der Deutschen, welche in der
Hauptstadt stark vertreten sind und eine Reihe ganz deutscher
Ortschaften gegründet haben, wie Hahndorf, Lobethal, Tanunda
u. a., mag 30,000 betragen. Die der sehr zusammengeschmolzenen
Eingeborgen (s. Tafel "Ozeanische Völker", Fig. 1 u. 2),
welche man 1836 noch auf 12,000 schätzte, wurde 1881 auf 5628
ermittelt. Hinsichtlich der Religion folgen ihrer numerischen
Stärke nach aufeinander: Anglikaner, Katholiken, Wesleyaner,
Lutheraner, Presbyterianer etc. Die Industrie entwickelt sich
kräftig; nennenswert sind die Mahlmühlen (meist mit
Dampfbetrieb), Anstalten für den Bau landwirtschaftlicher
Maschinen und Geräte, Gerbereien, Brauereien. Der
auswärtige Handel geht zum allergrößten Teil
über den Hafen der Hauptstadt, Port Adelaide, dann über
Port Augusta. Ausgeführt werden namentlich Wolle (1884
für 2,6, 1887 nur für 2 Mill. Pfd. Sterl.), ferner
Weizen, Mehl, Kupfer, Häute und Felle, Talg, Gerberrinde, im
ganzen 1884 für 6,6, 1887 nur für 5,3 Mill. Pfd. Sterl.
Die Einfuhr (1887 nur 5,1 Mill. Pfd. Sterl.) besteht in Geweben,
Eisenwaren, Thee, Zucker etc. Der Tonnengehalt der in allen
Häfen der Kolonie ein- und ausgelaufenen Schiffe betrug
1,677,833 Ton., die Kolonie besaß selber eine Handelsflotte
von 230 Segelschiffen von 27,640 T. und 94 Dampfern von 10,890 T.
Die Eisenbahnen hatten Ende 1887 eine Länge von 2272 km, die
Telegraphenlinien von 8756 km. Eine große Telegraphenlinie
läuft von Adelaide quer durch den Kontinent nach Port Darwin
im N. zum Anschluß an ein untermeerisches Kabel, wodurch
Australien in direkte Verbindung mit Europa gebracht wird; eine
andre große Linie geht nach Westaustralien. Die Verfassung
ist der englischen nachgebildet; dem Gouverneur steht ein
verantwortliches Ministerium, Oberhaus und Unterhaus zur Seite. Die
Einnahmen betrugen 1887: 2,014,102, die Ausgaben 2,145,135, die
Schuld der Kolonie 19,168,500 Pfd. Sterl. Für das Schulwesen
wurde in jüngster Zeit viel gethan, und der Schulbesuch ist
ziemlich allgemein; die höhern Schulen sind meist
Gründungen religiöser Gemeinden oder Privatanstalten. In
Adelaide besteht eine Universität nach englischem Muster,
öffentliche Bibliotheken sind an vielen Orten vorhanden; die
Presse ist stark vertreten. Für die Verteidigung der Kolonie
besteht ein Freiwilligenkorps, auch besitzt die Kolonie ein kleines
Kriegsschiff. Vgl. Trollope, South Australia and West Australia
(Lond. 1874); Harcus, South Australia (das. 1876); Stow, South
Australia (Adelaide 1883); Jung, Der Weltteil Australien, Bd. 2
(Leipz. 1882).
Südbrabant, belg. Provinz, s. Brabant.
Sudbury (spr. ssöddberi), Stadt in der engl.
Grafschaft Suffolk, am Stour, hat Seiden- und Samtweberei,
Ziegelbrennerei, Malzdarren, eine Kornbörse und (1881) 6584
Einw.
Südcarolina (South Carolina, abgekürzt S. C.),
einer der südlichen Staaten der nordamerikan. Union, am
Atlantischen Meer zwischen Nordcarolina und Georgia gelegen,
zerfällt der Bodengestaltnng nach in drei scharf geschiedene
Teile: Unter-, Mittel- und Oberland. Das erstere, das sich von der
See aus etwa 130 km weit landeinwärts erstreckt, ist niedrige
Ebene und besteht größtenteils aus Pine Barrens,
unterbrochen von Sümpfen und Savannen; es gehören zu ihm
die sogen. Sea Islands, vom Festland durch Flußarme
abgetrennte Inseln. Das Mittelland, in der Breite von 50-70 km,
besteht hauptsächlich aus Sandhügeln; das Oberland
dagegen, im W., ist ein ziemlich steil aufsteigendes romantisches
Hochland, aus dem sich die Berge der Blue Ridge bis zur Höhe
von 1220 m erheben. Noch 60 Proz. des Staats sind bewaldet,
vorwiegend mit Föhren. Die Hauptflüsse sind: der Great
Pedee (Yadkin), Santee, Ashley, Edisto und Savannah, der
Grenzfluß gegen Georgia. Die mittlere Jahrestemperatur bewegt
sich zwischen 15 und 20° C., und es fallen 1200-1500 mm Regen.
S. hat ein Areal von 78,616 qkm (1609,4 QM.) mit (1880) 995,577
Einw., worunter 604,332 Farbige. Die Schulen wurden 1886 von
183,966 Kindern besucht; 21 Proz. der über 10 Jahre alten
Weißen und 78 Proz. der Farbigen sind des Schreibens
unkundig. An höhern Bildungsanstalten bestehen 9 Colleges mit
1075 Studenten. Die Landwirtschaft beschäftigt 76 Proz. der
Bevölkerung, und 1,677,330 Hektar sind der Kultur gewonnen.
Gebaut werden namentlich Mais, Reis (an der Küste) und Hafer,
Bataten, Baumwolle (1880: 522,548 Ballen) und Zucker. An Vieh
zählte man 1880: 61,000 Pferde, 67,000 Maultiere, 365,000
Rinder, 119,000 Schafe und 628,000 Schweine. Die Fischereien
beschäftigten 1880: 1005 Personen mit 523 Booten. Gold wird im
W. gewonnen, und auch Eisen, Kupfer und Blei kommen vor. Dagegen
werden Porzellanerde, Bausteine und namentlich Phosphorite in
bedeutenden Mengen gewonnen, und die Herstellung eines
künstlichen Düngers aus denselben beschäftigte 1880:
9059 Arbeiter. Wichtig ist noch die Gewinnung von Teer und
Terpentin (4619 Arbeiter). Sonst ist die Industrie unbedeutend,
doch gab es 1880 bereits 14 Baumwollfabriken mit 2018 Arbeitern.
Der Staat besitzt (1886) 227 Seeschiffe von 12,806 Ton. Gehalt und
ein Eisenbahnnetz von 2772 km. Die alte Verfassung von 1775, eine
der am wenigsten demokratischen, wurde 1868 durch eine neue
ersetzt, durch welche den Farbigen die Rechte von Bürgern
verliehen wurden. Die gesetzgebende Gewalt wird ausgeübt von
einer General Assembly, welche aus einem Senat von 35 Mitgliedern
und einem Repräsentantenhaus von 124 Mit-
421
Süden - Südliches Kreuz.
gliedern besteht. Der Governor und die höhern Beamten
werden auf 2 Jahre vom Volk gewählt. Die Richter ernennen der
Governor und die Assembly auf 6 Jahre. Die Einnahmen beliefen sich
1885 auf 1,065,001 Dollar; die Staatsschuld betrug 1887: 6,399,742
Doll. Hauptstadt ist Columbia, die bedeutendste Stadt aber
Charleston. - S. bildete seit der Trennung von Nordcarolina 1729
(s. Carolina) eine besondere Kolonie und schloß sich 1775 der
Erhebung gegen England an, nach deren Sieg es einen Staat der Union
bildete. Im Bürgerkrieg 1861-65 war S. einer der eifrigsten
Staaten der Konföderation des Südens und war in der
letzten Periode desselben 1865 Kriegsschauplatz. Die früher
wohlgeordneten Finanzen wurden durch den Krieg und die
nachfolgenden Wirren gänzlich zerrüttet, und die
Staatsschuld war 1875 zur angeblichen Höhe von 68 Mill. Mk.
angewachsen, betrug jedoch thatsächlich noch weit mehr.
Süden, s. v. w. Mittag.
Suderode, Dorf im preuß. Regierungsbezirk
Magdeburg, Kreis Aschersleben, bei Gernrode, am Nordfuß des
Harzes und an der Linie Frose-Quedlinburg der Preußischen
Staatsbahn gelegen, hat eine evang. Kirche, ein besuchtes Bad
(Beringer Brunnen, s. d., 1887: 3364 Kurgäste) und (1885) 1189
Einw. Vgl. Reinhardt, Bad S. (Suderode 1881).
Süderoog, eine der nordfriesischen Inseln im
schleswigschen Wattenmeer, südwestlich von Pellworm.
Sudeten (sudetisches Gebirgssystem), im weitern Sinn
geographische Bezeichnung einer Anzahl nach Form und geognostischer
Beschaffenheit sehr verschiedener Gebirgszüge und
Gebirgsgruppen, die sich vom Elbdurchbruch an in
südöstlicher Richtung bis zu der Einsenkung erstrecken,
welche das deutsche Bergland von den Karpathen trennt (s. Karte
"Schlesien"). Die Längenachse dieser Gebirgsmasse beträgt
340, die Breite 60-90 km. Die Kuppen und Hochkämme ragen zum
Teil über die obere Grenze der Nadelholzregion (1230 m) hinaus
und zeigen hinsichtlich der Form der Gipfel und der Thalränder
wie des Pflanzenwuchses alpinen Charakter, während das
hügelige Vorland gut kultiviert ist. Das
südöstlichste und ausgedehnteste Glied dieses
Gebirgssystem ist das Mährisch-Schlesische Gebirge, bestehend
aus dem Mährisch-Schlesischen Gesenke (Gessénike),bis
zu 777 m Höhe, das zwischen Oder und Betschwa auch Odergebirge
heißt, als dem südöstlichsten, und dem
Altvatergebirge oder den S. im engern Sinn, im Altvater 1490 m
hoch, als dem nordwestlichsten Teil. Vom Altvater breiten sich die
allmählich abfallenden Züge nach Süden und SO., N.
und NW. gegen die Thäler der Oder und Oppa strahlenartig aus,
indem die nördlichen Verzweigungen in der Bischofskuppe noch
886 m hoch ansteigen, sich dann aber in das Tiefland der obern Oder
verflachen. Nordwestlich streicht ein Querzug nach NO., der
Hunsrück, der nur eine kurze Strecke über 1000 m hoch ist
und steil gegen das Neißethal bei Neiße abfällt.
In der Längenachse der Gebirgsmasse nach NW. streicht das
Reichensteiner Gebirge, mit dem Jauersberg (882 m), bis zu dem
Warthaberg (619 m), wo das Durchbruchstal der Glatzer Neiße
(280-290 m) diesen Gebirgszug begrenzt. Von dem Knotenpunkt des
Hunsrücks nach SW. zieht sich längs der
böhmisch-schlesischen Grenze das Glatzer Schneegebirge, mit
dem Großen oder Spieglitzer Schneeberg (1424), dann von dem
südlichen Ende der Grafschaft Glatz das Habelschwerdter
Gebirge, mit dem Kohlberg (963 m), nach NW., und von diesem durch
das Thal der Erlitz geschieden, laufen die Böhmischen
Kämme oder das Adlergebirge, mit der Hohen Mense (1085 m),
beinahe parallel. Nördlich von letztgenannter Kuppe trennt ein
tief einschneidender Paß die an ihrem Nordende durch die
sumpfige Hochfläche der Seefelder (784 m) verbundenen
Habelschwerdter Gebirge und Böhmischen Kämme, zusammen
auch Erlitzgebirge genannt, von dem scharf begrenzten
Sandsteinplateau der Heuscheuer, auf dessen bewaldeter, 750 m hoher
Fläche sich die Kuppe der Großen Heuscheuer (920 m)
erhebt. Weiter nach NW. liegt ein andres zerklüftetes
Sandsteinplateau, das Adersbacher Gebirge (780 m). Von dem
Durchbruch der Neiße bei Wartha aber gegen NW. erstreckt sich
in der Längenachse des südlichen Sudetenzugs das
Eulengebirge, mit der Hohen Eule (1000 m), bis an die Weistritz,
und aus dem nördlichen Vorland desselben steigt der Zobten
(718 m) empor. Westlich von der Weistritz breitet sich eine
Berglandschaft aus, die mit dem Gesamtnamen Niederschlesisches
Steinkohlengebirge, in einzelnen Teilen auch Waldenburger und
Schweidnitzer Gebirge benannt wird, im Hochwald 840, im Sattelwald
778, im Heidelberg 954 m erreicht und im. W. in das bis zum Bober
reichende Katzbachgebirge (Hohe Kullge 740 m) übergeht. Der
bedeutend niedergedrückte und verbreiterte Hauptkamm zieht
sich nach NW. im Überschargebirge (640 m) bis an die
Boberquelle fort. Dann folgen von Süden nach N. sich
aneinander reihend das Rabengebirge, der Schmiedeberger Kamm, mit
dem Forstberg (982 m), und der Landeshuter Kamm, mit dem
Friesenstein (800 m), sämtlich mit breiten, dicht bewaldeten,
abgerundeten Kuppen. Da, wo das Rabengebirge und der Schmiedeberger
Kamm bei den Grenzbauden zusammentreffen, beginnt das
Riesengebirge, das eigentliche Hochgebirge des Systems, mit der
1603 m hohen Schneekoppe, dem südlich parallel der
Böhmische Kamm (Brunnberg 1502 m) zieht, und an das sich im
NW. das Isergebirge, mit der 1123 m hohen Tafelfichte,
anschließt. Das Ende des ganzen Gebirgssystems bildet das
Lausitzer Gebirge, im Jeschken 1013, in der Lausche 796 m hoch,
welches sich links der Neiße und an der
sächsisch-böhmischen Grenze hinzieht. Von diesem, als dem
letzten Gliede des ganzen Gebirgssystems, treten einzelne
Vorhöhen, darunter die vulkanische Landskrone (432 m) bei
Görlitz, auf preußisches Gebiet über. Näheres
s. die einzelnen Artikel.
Südfall, eine der nordsriesischen Inseln im
schleswigschen Wattenmeer, südöstlich von Pellworm.
Südfrüchte, aus Südeuropa, bez. Nordafrika
frisch, trocken oder eingemacht eingeführte, den dortigen
Ländern eigenartige Fruchtsorten, wie z. B. Apfelsinen,
Zitronen, Datteln, Feigen, Traubenrosinen etc.
Sudhaus, der Teil einer Bierbrauerei, in welchem die
Würze gekocht wird.
Südhollaud, Provinz, s. Holland, S. 655.
Sudler, bei den Landsknechten (s. d.) der Koch; Sudlerin,
die Marketenderin.
Südliche Krone, Sternbild, s. Krone, S. 248.
Südlicher Kontinent, s.
Südpolarländer.
Südliches Dreieck, Sternbild der südlichen
Hemisphäre, zwischen Paradiesvogel, Altar, Lineal und
Winkelmaß, Zirkel und Kentaur, nahe der Milchstraße,
mit einem Stern zweiter, zwei dritter Größe.
Südliches Eismeer, s. Eismeer, S. 487.
Südliches Kreuz, kleines Sternbild der
südlichen Halbkugel, im engsten Teil der Milchstraße,
rechts neben der dunkeln Region des sogen. Kohlensacks, unweit des
Pols der Ekliptik gelegen. Es wird gebildet durch vier helle
Sterne, welche in den Ecken
422
Südliches Kreuz (Orden) - Südpolarländer.
eines Vierecks stehen,dessen Diagonalen das Kreuz darstellen;
der eine Arm des letztern, an dessen Ende der Hauptstern erster
Größe steht, ist länger als der andre (s. Figur).
Schon Vespucci gedenkt desselben auf seiner dritten Reise (1501),
und von Corsali (1517) wird es bereits als "Wunderkreuz"
bezeichnet. Dante (im Eingang seines "Fegfeuers") kannte es
wahrscheinlich aus arabischen Quellen. Das Sternbild ist
Flaggenzeichen der Deutschen Ostafrikanischen Gesellschaft (s.
Tafel "Flaggen II"). Danach ist auch benannt der Orden vom
südlichen Kreuz, höchster brasilischer Orden, gestiftet
1. Dez. 1822 vom Kaiser Dom Pedro I. zur Erinnerung an seine
Berufung auf den Thron und so benannt mit Anspielung auf die
geographische Lage des Reichs, in welchem sich das Sternbild des
südlichen Kreuzes zeigt. Der Orden hat vier Klassen:
Großkreuze, Dignitäre, Offiziere und Ritter. Die
Dekoration besteht in einem fünfarmigen, weiß
emaillierten Goldkreuz, durchwunden von einem Kranz aus Kaffee- und
Tabaksblättern, an einer goldenen Kaiserkrone hängend.
Der goldene Mittelavers zeigt Dom Pedros Bild mit der Umschrift :
"Petrus I., Brasiliae Imperator", der blaue Revers ein Kreuz aus 19
Sternen mit der Umschrift: "Bene merentium Praemium". Die
Großkreuze, Dignitäre und Offiziere tragen das Kreuz und
eine Plaque, bestehend aus dem Kreuz mit goldenen Strahlen zwischen
den Armen, dem Mittelrevers und der Krone, die Dignitäre das
Kreuz am Hals, die beiden letzten Klassen auf der Brust. Das Band
ist himmelblau. Die Großkreuze sind Exzellenzen, den
Dignitären gebührt die Senhoria. Auch sind Pensionen mit
dem Orden verknüpft.
Südlicht, s. Polarlicht.
Süd-Nordkanal, Kanal in der Provinz Hannover, der
bedeutendste unter den neuen Anlagen in den Mooren auf der linken
Emsseite (Bourtanger Moor), zum Zweck der Kultivierung derselben.
Er hat eine Länge von 71 km, eine Breite von 15,7 m und wird
zu beiden Seiten (wie der Ems-Vechtekanal) von Wegen begleitet. Der
Kanal verläßt bei Nordhorn den Ems-Vechtekanal und zieht
sich nach N. durch die großen Moore in geringer Entfernung
von der niederländischen Grenze bis Rhede, wo er sich mit dem
Rhede-Bellingwolder Kanal verbindet und mit diesem zur Ems geht.
Zahlreiche Seitenkanäle sind aus ihm in die Moore
geführt, auch mehrfach Verbindungen mit dem
niederländischen Kanalsystem hergestellt.
Sudogda (Ssudogda), Kreisstadt im russ. Gouvernement
Wladimir, am Flusse S., mit (1885) 1987 Einw. Im Kreise sind 15
Fabriken, welche Kristall- und Glaswaren liefern.
Sudorifera (lat.), s. Schweißtreibende Mittel.
Südpol, s. Pol und Magnetismus.
Südpolarexpeditionen, s.
Südpolarländer.
Südpolarländer (antarktische Länder), alle
diejenigen Länder und Inseln, welche innerhalb oder in der
Nähe des südlichen Polarkreises liegen. Manche nehmen das
Vorhandensein eines großen Festlandes oder antarktischen
Kontinents im S. an, andre bezweifeln die Existenz eines solchen
und denken an größere oder kleinere Inselgruppen. Was
man bis jetzt entdeckt hat, ist folgendes:
Südsüdöstlich von der Südspitze Amerikas liegen
zwischen 63 1/2 und 65° südl. Br. Trinity- und Palmerland,
1821 von Powell und Palmer entdeckt; weiter südlich in der
Breite des Polarkreises das 1832 von Biscoe entdeckte Adelaiden-
und Grahamsland und aus der Ostseite des Trinitylandes das 1838 von
Dumont d'Urville entdeckte Louis-Philippeland nebst der Insel
Joinville. Von der schon 1599 von Dirk Gerrits gesehenen, aber erst
1819 von W. Smith wirklich entdeckten Inselkette Südshetland
ist jener Teil des antarktischen Landes durch die
Bransfieldstraße geschieden. Südwestlich davon liegt die
Alexanderinsel und unter derselben Breite die hohe Peterinsel,
beide 1821 von Bellingshausen entdeckt. Weiter westlich ist nur
Wasser und Eis, kein Land gesehen worden. Erst unter 170-160°
östl. L. v. Gr. entdeckte James Clark Roß (1841-42) die
hohe Küste eines schneebedeckten Landes, welches er
Victorialand nannte, und welches zahlreiche Berge von 3000 bis 4000
m Höhe trägt, darunter die Vulkane Erebus (3770 m),
Terror (3318 m) und den 4570 m hohen Melbourne als höchsten
der gesehenen Gipfel. Zwischen 165-95° östl. L. v. Gr.,
unter dem Polarkreis, verzeichneten Dumont d'Urville, Balleny und
Wilkes (1839-40) eine Reihe Inseln und unzusammenhängender
Küstenstrecken, die unter dem Namen Wilkesland
zusammengefaßt werden; einzelne Strecken sind:
Adélieland, Clarieland, Sabrinaland, Knoxland,
Terminationinsel. Weiter westlich von Wilkesland liegt Kempland
sowie das 1831 von Biscoe entdeckte Enderbyland, beides
wahrscheinlich nur Inseln. Auch die schon weiter nördlich
liegende, von Cook 1775 entdeckte, 1819 von Bellingshausen
untersuchte Sandwichgruppe, das ebenfalls von Cook untersuchte,
schon 1675 von Laroche entdeckte Südgeorgien und die 1821 von
Palmer und Powell aufgefundenen, 1822 von Weddell besuchten
Südorkneyinseln werden hierher gerechnet. Man schätzt das
Areal der S. auf 660,000 qkm (12,000 QM.). Falls ein antarktischer
Kontinent wirklich vorhanden ist, kann derselbe höchstens an
einer Stelle (Australien gegenüber) den 70. Breitengrad
wesentlich überschreiten und muß aus der atlantischen
Seite weit von demselben entfernt bleiben. Hier erreichte Weddell
im Februar 1823 unter 33° 20' westl. Länge in fast
eisfreiem Meer die Breite von 74° 15'. - Die eisige Öde
der antarktischen Felseninseln beschränkt das Pflanzen- und
Tierleben fast ganz auf den Ozean; doch sind Klippen und
Berghänge mit zahllosen Vögeln bedeckt. Thätiger
Vulkanismus tritt besonders im Bereich des Victorialandes in
großartigster Weise auf. Die Temperaturbeobachtungen weisen
naturgemäß auf die niedrige Sommerwärme und geringe
Winterkälte eines durchaus ozeanischen Klimas hin. Seitdem die
Challenger-Expedition 1874 über den Polarkreis vordrang und
Dallmann 1873-74 Grahamsland untersuchte, und seit der Fahrt der
Gazelle (1874-75) ist die Erforschung der S. wiederholentlich von
Deutschland aus angeregt worden. Namentlich aber war man in
Australien dafür thätig, und die dortigen geographischen
Gesellschaften erlangten die Bewilligung einer namhaften Summe
durch die dortigen Regierungen; da die englische Regierung aber
ihre Beihilfe versagte, so kam ein Unternehmen nicht zu stande.
423
Südpreußen - Suetonius.
Südpreußen, ehemalige Provinz des
Königreichs Preußen, aus dem 1793 zu Preußen
geschlagenen Teil Großpolens bestehend, umfaßte die
frühern Woiwodschaften Posen, Gnesen, Kalisch, Sieradz,
Lentschiza, Rawa und Plozk, zusammen 60,570 qkm (1100 QM.) mit
1,335,000 Einw. (s. "Geschichtskarte von Preußen"). 1795 kam
noch ein Teil der Erwerbungen der dritten polnischen Teilung mit
Warschau hinzu. Im Frieden von Tilsit (1807) wurde S. zu dem
Großherzogtum Warschau geschlagen, nach dessen Auflösung
Preußen 1815 das jetzige Großherzogtum Posen
zurückerhielt, der übrige größere Teil aber zu
Rußland kam. Vgl. Holsche, Geographie und Statistik von
West-, Süd- und Neuostpreußen (Berl. 1804, 3 Bde.).
Südpunkt (Mittagspunkt), derjenige der beiden
Schnittpunkte des Meridians mit dem Horizont, welcher dem
Südpol näher liegt.
Sudra, die vierte und unterste Klasse in der altindischen
Kastenordnung, welche die verschiedenen Handwerker, Pachtbauern,
Tagelöhner, Diener etc. umfaßte. In der Gegenwart gehen
die S. in den Mischkasten auf, stehen jedoch noch innerhalb der
Kastenordnung. Sie bilden die große Mehrzahl des indischen
Volkes, gelten auch den orthodoxen Hindu als rein, wohnen deswegen
innerhalb der Ortschaften, gehen aber nicht unter dem Namen S.,
sondern unter den besondern Kastenbezeichnungen, die sich jede der
vielen Gruppen der S. beilegte.
Sudsalz, das in den Salinen gewonnene Kochsalz im
Gegensatz zum Steinsalz.
Südsee, s. Stiller Ozean.
Südseegesellschaft, s. Handelskompanien, S.86.
Südseeinsulaner, die Bewohner der Inseln der
Südsee, die Polynesier, Mikronesier, Melanesier (s. Ozeanien,
S. 584 ff.), welche eine Abteilung der großen malaiischen
Rasse bilden und (wahrscheinlich im 1. Jahrh. unsrer Zeitrechnung)
von W. nach O. sich über alle Inselgruppen verbreiteten. Nach
allem, was vorliegt, dürfen wir annehmen, daß in den
Samoa- und Tongainseln der Ursitz dieser östlichen Abteilung
der malaiischen Rasse nach ihrer Absonderung von der westlichen zu
suchen ist. Von diesem Zentrum aus scheinen sie dann sämtliche
polynesische Inseln der Südsee bevölkert zu haben.
Südseeschwindel, s. Handelskrisis, S. 88.
Südseethee, s. Ilex.
Sudsha (Ssudsha), Kreisstadt im russ. Gouvernement Kursk,
am Flusse S., mit (1885) 4979 Einw. In der Nähe
Sandsteinbrüche.
Südslawen, Gruppe der slawischen Völker in
Südosteuropa. Dazu gehören die Slowenen in den Ostalpen
Österreichs, die Serben und Bosniaken, Kroaten, Slawonier und
die Bulgaren (s. Slawen und Slawische Sprachen).
Sudur (arab., Mehrzahl von Sadr, s. d.), Rangbezeichnung
der hohen geistlichen Würdenträger im türkischen
Staat.
Südwestinseln (Serwatty), eine zur niederländ.
Residentschaft Amboina gehörige Inselgruppe des Indischen
Archipels, erstreckt sich von den Kleinen Sundainseln und Timor an
östlich bis Timorlaut und umfaßt die größere
Insel Wetter und die kleinern Kisser, Damma, Roma, Moa, Sermattan,
Lakor, Baber u. a. mit einem Gesamtumfang von 5236 qkm (95 QM.) und
etwa 47,000 Einw. (meist Malaien). Für den Handel liefern sie
Wachs, Schildpatt, Trepang, Sago, Holz.
Süd-Wilhelmskanal (Zuid-Willemsvaart), Kanal in den
niederländ. Provinzen Nordbrabant und Limburg, 122 km lang,
1822-26 gegraben, führt von Herzogenbusch über Helmond
und Weert, dann durch belgisches Gebiet nach Maastricht. Zweige
dieses Kanals sind: der Kanal nach Eindhoven und der Helenavaart
nach den Fehnen des Peel.
Sue (spr. ssüh), Joseph Marie, genannt
Eugène, franz. Romandichter, geb. 10. Dez. 1804 zu Paris,
machte als Militärarzt 1823 den Feldzug nach Spanien, dann
mehrere Fahrten nach Amerika und Westindien mit, besuchte 1827
Griechenland und nahm an der Schlacht bei Navarino teil. Hierauf
trat er aus dem Militärdienst, um zur Malerei
überzugehen, veröffentlichte aber auf Zureden von
Freunden eine Romandichtung: "Kernock le pirate" (1830), ward durch
den günstigen Erfolg des Buches veranlaßt, sich ganz der
Schriftstellerei zu widmen, und wurde der Begründer des
Seeromans in Frankreich. Nachdem er noch eine Reihe Werke in diesem
Genre, besonders die unhistorischen "Histoire de la marine
française" (1835-37, 5 Bde.) und "Histoire de la marine
militaire chez tous les peuples" (1841), veröffentlicht,
wandte er sich dem Sittenroman zu, wobei er sich besonders in
greller Ausmalung sittlichen Verderbnisses gefiel; so in den durch
zahllose Übersetzungen verbreiteten "Mystères de Paris"
(1842, 10 Bde.). Der beispiellose Erfolg dieses Produkts
führte den Verfasser dem sozialen Roman zu. Hierher
gehören: "Le Juif errant" (1845, 10 Bde.; von gleichem Erfolg
wie die "Mystères"); "Martin, l'enfant trouvé" (1846,
12 Bde.); "Les sept péchés capitaux" (1847 bis 1849,
16 Bde.); "Les mystères du peuple" (1849, 16 Bde.), vor den
Assisen in Paris als unmoralisch und aufrührerisch verurteilt;
"La famille Jouffroy" (1854, 7 Bde.); "Les secrets de l'oreiller"
(1858, 7 Bde.) u. a. 1850 zum Deputierten erwählt, hielt er
sich zur äußersten Linken, wurde nach dem Staatsstreich
1851 aus Frankreich verbannt und lebte seitdem zu Annecy in
Savoyen, wo er 3. Aug. 1859 starb. Auch als dramatischer Dichter
für die Boulevardstheater hatte er sich versucht, doch ohne
besonderes Glück. Auf dem Gebiet des Romans hat S. in Bezug
auf Phantasie, sprudelnde Erfindungskraft und Erzählertalent
wenige Rivalen unter seinen Landsleuten. Seine Mittel sind zwar
teilweise zu tadeln und sein Realismus oft mehr als derb; aber
seiner unwiderstehlichen Macht, den Leser gefangen zu halten, kann
man die Bewunderung doch nicht versagen.
Suecia, neulat. Name für Schweden.
Suedoise (franz., spr. sswedoahs'. "Schwedin"), eine in
Frankreich sehr beliebte süße Speise aus
Apfelmarmelade.
Sues, Stadt, s. Suez.
Suessouer (Suessones), tapferes und mächtiges Volk
in Gallia belgica, das über 50,000 Bewaffnete stellte, und
dessen König Divitiacus vor Cäsars Zeiten der
mächtigste unter den Fürsten Galliens war, bewohnte einen
ausgedehnten und fruchtbaren Landstrich zwischen Seine und Aisne
und besaß zwölf Städte, unter welchen Noviodunum,
später Augusta Suessonum (Soissons), die Hauptstadt war.
Suetonius, Gajus S. Tranquillus, röm.
Geschichtschreiber, lebte um 70-140 n. Chr., widmete sich zu Rom
rhetorischen und grammatischen Studien, trat dann daselbst als
gerichtlicher Redner auf, ward unter Hadrian zum Magister
epistolarum ernannt, verlor aber diese Stelle wieder und scheint
sich von nun an ausschließlich der schriftstellerischen
Thätigkeit gewidmet zu haben. Er verfaßte 120 die fast
vollständig erhaltenen Biographien der zwölf Kaiser von
Julius Cäsar bis Domitian ("De vita Caesarum"), welche in
einfacher und klarer Sprache eine
424
Sueven - Suezkanal.
Menge wertvoller Notizen über die betreffenden Kaiser
enthalten. Außerdem besitzen wir noch Teile einer Schrift:
"De grammaticis et rhetoribus" (hrsg. von Osann, Gieß. 1854),
und Biographien des Terenz, Horaz, Lucanus (letztere
unvollständig) sowie Reste einer Biographie des ältern
Plinius, alles wahrscheinlich Überreste eines
größern von ihm verfaßten Werkes: "De viris
illustribus". Von andern Schriften sind nur die Namen und
unbedeutende Fragmente erhalten; die ebenfalls seinen Namen
führenden Biographien des Vergilius und Persius sind
wahrscheinlich unecht. Ausgaben lieferten Burmann (Amsterd. 1735, 2
Bde.), Oudendorp (Leid. 1751), Ernesti (Leipz. 1748, 2. Aufl.
1772), Wolf (das. 1802, 4 Bde.) und Roth (das. 1858); neuere
Übersetzungen Reichardt (Stuttg. 1855 ff.), Stahr (2. Aufl.,
das. 1874, 2 Bde.) und Sarrazin (das. 1883, 2 Bde.). Des S.
übrige Schriften außer den "Vitae" sind besonders
herausgegeben von Reifferscheid (Leipz. 1860).
Sueven (Suevi), Name eines german. Völkerbundes,
welcher wohl die im Osten der Elbe vorhandenen, weniger von
Ackerbau als von Jagd und Viehzucht lebenden kriegerischen,
wanderlustigen ("schweifenden") Stämme umfaßte,
später Name eines einzelnen Volkes. Cäsar, welcher die
nach Gallien eingedrungenen S. unter Ariovist 58 v. Chr. besiegt
hatte, begreift unter diesem Namen die hinter den Ubiern und
Sigambern wohnenden Germanen und berichtet, daß sie 100 Gaue
mit je 10,000 streitbaren Männern gezählt, aber sich bei
seinem Rheinübergang weit, nach dem Wald Bacenis,
zurückgezogen hätten. Sie sollen keine festen Wohnsitze
gehabt haben, sondern alljährlich zum Teil auf kriegerische
Unternehmungen ausgezogen sein. Tacitus nennt das ganze
östliche Germanien von der Donau bis zur Ostsee Suevia. Die
Hermunduren gelten ihm als das vorderste, die Semnonen als das
angesehenste, die Langobarden als das kühnste unter den
suevischen Völkern. Der Dienst der Nerthus (Hertha) war allen
S. gemeinschaftlich. Der Markomanne Marbod vereinigte suevische
Völker unter seinem Zepter, und noch später, zu Marcus
Aurelius' Zeiten, werden Markomannen und Quaden als S. bezeichnet.
In der Zeit der Völkerwanderung beschränkte sich der Name
S. auf die Semnonen. Ein Teil derselben nahm 406 an dem
Verwüstungszug des Radagaisus teil. 409 drangen sie dann mit
den Vandalen und Alanen über die Pyrenäen nach Spanien
vor und breiteten sich unter Rechila nach Süden über
Lusitanien und Bätica aus. Rechilas Sohn Rechiar verlor 456
gegen den westgotischen König Theoderich II. Sieg und Leben,
und sein Nachfolger Remismund wurde von Eurich zur Anerkennung der
Oberhoheit der Westgoten gezwungen. König Theodemir trat vom
Arianismus zum Katholizismus über. 585 ward das suevische
Reich dem westgotischen einverleibt. In Deutschland hat sich der
Name S. in dem der Schwaben erhalten.
Suez (Sues), Stadt in Ägypten, an der Nordspitze des
Roten Meers, welches hier in den Golf von S. ausläuft, an der
Mündung des Suezkanals (s. d.) in denselben und der Eisenbahn
Kairo-Ismailia-S., mit (1882) 10,919 Einw., worunter 1183
Ausländer. Die Stadt besteht aus dem arabischen Viertel und
dem regelmäßig angelegten europäischen Viertel mit
großen Warenlagern, Magazinen der Peninsular and
Oriental-Dampfergesellschast und einer vizeköniglichen Villa.
Nordöstlich die Mündung des hier 2 m ü. M. liegenden
Süßwasserkanals mit großem Schleusenwerk,
nordwestlich ein großes englisches Hospital. Zu den
Hafenanlagen, welche in S. weit ins Meer hinausgebaut sind,
führt ein 3 km langer Damm; auf diesem läuft die
Eisenbahn zum Bassin der Kanalgesellschaft mit Leuchtturm und der
Statue des Leutnants Waghorn. Das große Hafenbassin, Port
Ibrahim genannt, wird durch eine mächtige Mauer in den Kriegs-
und den Handelshafen geschieden und kann 500 Schiffe fassen. Der
Handel hat sich aber nicht hier konzentriert, sondern mehr nach
Port Said und Alexandria gezogen, und S. ist mehr ein
Durchgangspunkt geblieben. 1886 betrug die Einfuhr 594,385, die
Ausfuhr 42,697 ägyptische Pfund. Die Stadt ist Sitz eines
deutschen Konsuls. Wahrscheinlich steht S. auf der Stätte des
alten Klysma, von den Arabern Quolzum genannt. Es war vor der
Entdeckung des Seewegs nach Indien um das Kap als Hauptniederlage
europäischer und indischer Waren ein blühender Platz,
verfiel aber danach und zählte bei Beginn der Kanalbauten nur
1500 Einw.
Suezkanal, Seekanal zur Verbindung des
Mittelländischen und des Roten Meers mittels Durchschneidungen
der nur 113 km breiten Landenge von S. (s. das Nebenkärtchen
auf der Karte "Mittelmeerländer"). Dieser Kanal ist gleichsam
von der Natur vorgezeichnet, indem der Isthmus selbst nur als eine
den Golf von S. fortsetzende Bodensenkung zu betrachten ist, die an
ihrer höchsten Stelle, bei El Gisr, nur 16 m ü. M. liegt,
und deren Durchstechung durch drei Seen (Ballah-, Timsah- und
Bittersee) nochwesentlich erleichtert werden mußte. Bereits
im 14. Jahrh. v. Chr. wurde der Bau eines vom Nil zum Timsahsee und
von da zum Roten Meer führenden Kanals durch die beiden
großen Herrscher Sethos I. und Ramses II. ausgeführt, um
ihre Flotte aus dem einen ins andre Meer bringen zu können.
Dieser Kanal (altägypt. ta tenat, "der Durchstich") ging
wahrscheinlich durch Vernachlässigung zu Grunde, und erst
gegen Ende des 7. Jahrh. v. Chr. unternahm es Necho (616-600), ein
Sohn Psammetichs I., einen neuen Kanal vom Nil ins Rote Meer zu
bauen, der aber durch Orakelspruch (weil er nur den "Fremden"
nützen würde) gehemmt wurde, nachdem sein Bau schon
120,000 Menschen das Leben gekostet hatte. Erst Dareios Hystaspis
(521-486) vollendete das Werk des Necho, welches unter den
Ptolemäern dann noch bedeutend verbessert wurde. Doch schon zu
Kleopatras Zeit war der Kanal teilweise wieder versandet, und was
unter den Römern, namentlich unter Kaiser Trajan (98-117 n.
Chr.), für den Kanal geschah, scheint nicht von großer
Bedeutung gewesen zu sein. Nachdem die Araber Ägypten erobert
hatten, war es Amr, der Feldherr des Kalifen Omar, welcher im 7.
Jahrh. den Kanal von Kairo nach dem Roten Meer wiederherstellte und
zu Getreidetransporten benutzte; im 8. Jahrh. aber war er schon
wieder gänzlich unbrauchbar, und heute bezeichnen nur noch
schwache Spuren das alte Werk, an dem einst Pharaonen, Perser,
Ptolemäer, römische Kaiser und arabische Kalifen bauten.
Das Verdienst, zuerst wieder auf die Vorteile eines maritimen
Kanals zwischen dem Mittel- und dem Roten Meer hingewiesen zu
haben, gebührt Leibniz, der in diesem Sinn 1671 an Ludwig XIV.
schrieb. Bonaparte ließ gelegentlich seiner Expedition nach
Ägypten 1798 durch den Ingenieur Lepère Vermessungen
zum Bau eines direkten Kanals machen. Leider gelangte Lepère
zu dem schon damals als falsch bezeichneten Ergebnis, daß der
Spiegel des Roten Meers 9,908 m höher liege als der des
Mittelmeers. Dies schreckte von weitern Versuchen ab. Als endlich
1841 durch barometrische Messungen englischer Offiziere der Irrtum
nachgewiesen werden war, versuchte Metternich 1843 vergeblich,
Mehemed Ali dafür zu
425
Suffeten - Suffolk.
interessieren, bis endlich 1854 Ferdinand v. Lesseps (s. d.) bei
dem Vizekönig Said Unterstützung fand. Nach
Überwindung von mancherlei Schwierigkeiten erhielt dieser
endlich 5. Jan. 1856 von der Pforte einen Ferman zur Konzession des
Kanalbaues und zur Bildung einer Aktiengesellschaft. Diese
Gesellschaft trat unter dem Namen Compagnie universelle du canal
maritime de Suez zusammen und erhielt ein Privilegium auf 99 Jahre,
nach welcher Zeit der Kanal an Ägypten fällt. Am 25.
April 1859 erfolgte zu Port Said, am Nordende des Kanals, der erste
Spatenstich. Das Maß der zu bewältigenden
Schwierigkeiten war ein ungeheures. Alles Material, alle Werkzeuge,
Maschinen, Kohlen, Eisen, jedes Stück Holz mußte aus
Europa geholt werden. 1862 waren von den 1800 Lastkamelen der
Kompanie allein 1600 zum täglichen Transport des Trinkwassers
für 25,000 Arbeiter in Anspruch genommen, so daß die
tägliche Ausgabe für Trinkwasser 8000 Frank betrug. Es
war also vor allen Dingen erst nötig, den
Süßwasserkanal zu vollenden, welcher vom Nil Trinkwasser
nach dem Isthmus führen sollte. Bei Sagasig zweigt derselbe
sich vom Nil ab, führt zunächst in östlicher
Richtung nach Ismailia und von da südlich bis Suez;
Schleusenwerke geben die Möglichkeit, ihm eine
größere oder geringere Wassermenge zuzuführen. Auf
dem Spiegel erreicht er eine Breite von 17, am Grund von 8 m; doch
ist er nur 2 1/2 m im Durchschnitt tief. Seine Vollendung erfolgte
29. Dez. 1863, wodurch eine Jahresausgabe von 3 Mill. Fr. erspart
wurde. Mit Maschinenkräften, die bis 22,000 Pferdekräfte
repräsentierten, wurde trotz mancher Unglücksfälle
(Ausbruch der Cholera und darauf folgende Desertion sämtlicher
Arbeiter), trotz diplomatischer und finanzieller Schwierigkeiten
rüstig weitergearbeitet, so daß schon 18. Nov. 1862 die
Wasser des Mittelmeers in den Timsahsee einströmen konnten, zu
dessen Ausfüllung 80 Mill. cbm notwendig waren. Am
nordwestlichen Gestade dieses Sees entstand die Residenz der
Kanalverwaltung, die Stadt Ismailia, zu welcher die neue Eisenbahn
von Kairo und Alexandria hingeführt wurde, während die
alte Wüstenbahn Kairo-Suez aufgegeben ward. Am 18. März
1869 erfolgte der Einlaß der Mittelmeerwasser in den
Bittersee, und 16. Nov. 1869 fand im Beisein vieler
Fürstlichkeiten und einer ungeheuern Schar geladener
Europäer die Eröffnung des Kanals unter Festlichkeiten
statt, die dem Chedive 20 Mill. Fr. gekostet haben sollen. Die
Länge des Kanals beträgt 160 km, die Breite am
Wasserspiegel 58-100 m, an der Sohle 22 m, die Tiefe 8 m. Er
beginnt am Mittelmeer bei Port Said mit zwei ungeheuern in das Meer
hinausgebauten Molen von 2250 und 1600 m Länge, welche den
Vorhafen von Port Said bilden und den durch westliche
Strömungen herbeigeführten Nilschlamm abhalten. Der Kanal
tritt dann in südlicher Richtung in den Menzalehsee ein, wo er
an beiden Seiten von Dämmen eingerahmt ist, verläßt
denselben bei Kilometer 45 und erreicht die El Kantara genannte
Bodenerhebung, welche er durchschneidet, um 4 km weiter in den
Ballahsee einzutreten. Nachdem er aus diesem wieder ausgetreten,
folgen die Stationen El Ferdane und El Gisr; dann tritt der Kanal
in die weite, blaue Fläche des Timsahsees ein, an dessen
Nordwestende Ismailia liegt, und den er bei Tusûn
verläßt, um die 16 km lange Felsenschwelle des Serapeums
zu durchbrechen. Die nun bei Kilometer 95 folgenden Bitterseen
bilden eine schöne, etwa 220 qkm große
Wasserfläche, die rings von Wüsten umgeben und am Ein-
und Austritt des Kanals mit Leuchttürmen versehen ist. Bei El
Schaluf, am Südende der Bitterseen , machen sich bereits Ebbe
und Flut des Roten Meers bemerkbar, das bei Kilometer 156 erreicht
wird. Südöstlich von der Stadt Suez ist die Kanalrinne
noch 4 km weit in das Meer geführt, um endlich bei 9 m Tiefe
die Reede von Suez zu erreichen. Die Baukosten des Kanals beliefen
sich auf etwa 19 Mill. Pfd. Sterl., von denen 12,800,000 durch
Aktienzeichnungen aufgebracht wurden, während den Rest der
Chedive deckte. Letzterm kaufte England 1875 die übernommenen,
noch unplacierten Aktien (177,602 Stück im Wert von 3,5 Mill.
Pfd. Sterl.) ab. Bis Ende 1884 wurden mit Einschluß der
Verbesserungen für den Kanal verausgabt 488 Mill. Fr., wogegen
die Aktiva 76,7 Mill. Fr. betrugen. Die Einnahmen der Gesellschaft
ergaben 1872 zum erstenmal einen Überschuß von 2 Mill.
Fr., der 1887 auf 29,7 Mill. Fr. stieg. Auch der Schiffsverkehr
beweist den vollständigen Erfolg des Unternehmens. Es
benutzten den Kanal 1887: 3137 Schiffe von 5,903,024
Nettotonnengehalt, davon 2330 englische, 185 französische, 159
holländische, 159 deutsche, 82 österreichisch-ungarische,
138 italienische etc. Die Zahl der Reisenden betrug 182,998 mit
Einschluß von Soldaten. Die Einnahmen bezifferten sich auf
60,5, die Ausgaben auf 30,8 Mill. Fr. Was die Abkürzung der
Entfernungen zwischen Europa und den östlichen Ländern
betrifft, so beträgt dieselbe für die Dampferfahrt nach
Bombay von Brindisi 37, von Triest 37, von Genua 32, von Marseiile
31, von Bordeaux 24, von Liverpool 24, von London 24, von Amsterdam
24, von Hamburg 24 Tage. Danach lassen sich die Zeitersparnisse in
der Fahrt nach andern Häfen berechnen. Freilich ist auch in
Rücksicht zu ziehen, ob die zu transportierenden Waren den
kostspieligen Kanalzoll (10 Fr. pro Tonne Nettogewicht) zu tragen
vermögen. Manufakturen, Stahl, feine Metallwaren, Seide, Thee,
Kaffee, Baumwolle etc. dürfen als unbedingt kanalfähige
Güter gelten, während eine lange Fracht vertragende
Güter vorteilhafter den Weg um das Kap nehmen. Vgl. Lesseps,
Lettres, journal et documents à l'histoire du canal de Suez
(Par. 1881, 5 Bde.); Volkmann, Der S. und seine Erweiterung (in
"Kanäle", Berl.1886); Krukenberg, Die Durchflutung des Isthmus
von S. (Heidelb. 1888).
Suffeten ("Richter"), die obersten Magistratspersonen in
Karthago (s. d., S. 566).
Sufficit (lat.), es genügt, reicht hin.
Suffisance (franz., spr. ssüffisängs),
Selbstgefälligkeit, dünkelhafte Selbstgenügsamkeit;
süffisant, gegenügend; selbstgefällig,
eingebildet.
Suffix (lat.), Nachsilbe, am Ende eines Wortes
angehängte Silbe; s. Flexion.
Suffizient (lat.), genügend, ausreichend.
Sufflenheim, Flecken im deutschen Bewirk
Unterelsaß, Kreis Hagenau, am Eberbach, hat Fabriken für
Töpferwaren und feuerfeste Steine, Bauholzhandel und (1885)
3158 meist kath. Einwohner.
Suffocatio (lat.), Erstickung (s. d.).
Suffolk (spr. ssöffok), engl. Grafschaft, an der
Nordsee, 3820 qkm (69,4 QM.) groß mit (1881) 356,893 Einw.,
ist im allgemeinen wellenförmig und meist sandig und verflacht
sich nach der Küste, wo Strecken von Marschland vorkommen. Die
bedeutendsten Flüsse sind: der Stour (Grenzfluß gegen
Essex), Orwell, Wavenay (Grenzfluß gegen Norsolk) und Ouse
mit dem Lark. Ackerbau und Viehzucht stehen auf hoher Stufe. Man
hält hier eine Rasse von ungehörnten Kühen, welche
ungemein viel Milch geben; das Suf-
426
Suffolk - Suggestion.
folkschaf gibt kurze, aber sehr feine Wolle. 63 Proz. der
Oberfläche sind unter dem Pflug, 18 Proz. bestehen aus Wiesen.
1888 zählte man 41,534 Ackerpferde, 63,258 Rinder, 422,150
Schafe und 130,887 Schweine. Im Bau landwirtschaftlicher Maschinen
leistet S. Bedeutendes, andre Zweige der Industrie sind ohne
Belang. Hauptstadt ist Ipswich.
Suffolk (spr. ssöffok), engl. Adelstitel, zuerst der
Familie Clifford als Grafen, seit dem 14. Jahrh. der Familie Pole
als Herzöge von S. Der letzte aus diesem Haus ward 1513
hingerichtet. Heinrich VIII. verlieh den Titel seinem
Günstling Charles Brandon, dem Gemahl seiner Schwester Maria,
dessen Schwiegersohn Henry Gray von Eduard VI. 1551 zum Herzog von
S. erhoben wurde. Derselbe ward nebst seiner Tochter Johanna Gray
(s. Gray 1) 1554 enthauptet. Demnächst erhielt Lord Thomas
Howard, Sohn des vierten Herzogs von Norfolk, der 1597 zum Baron
Howard ernannt war, 1603 den Titel eines Grafen von S. Schon in dem
Kampf gegen die unüberwindliche Flotte Philipps II. hatte er
sich ausgezeichnet, unter Jakob I. wurde er 1603 Geheimrat und 1605
Lord-Oberkämmerer, in welcher Eigenschaft er sich bei der
Entdeckung der Pulververschwörung hervorthat. 1614-18 war er
Lord-Großschatzmeister, wurde aber 1618 entlassen, wegen
Bestechlichkeit angeklagt und in den Tower gesetzt, aus dem er
jedoch nach einigen Tagen wieder befreit wurde. Er starb 1626. Sein
zweiter Sohn wurde 1626 zum Grafen von Berkshire erhoben und ist
Stammvater der jetzigen Grafen von S. und Berkshire;
gegenwärtiger Chef des Hauses ist Charles John Howard, Graf
von S. und Berkshire, geb. 7. Nov. 1804.
Suffragan (lat.), jedes zu Sitz und Stimme (suffragium)
berechtigte Mitglied eines Kollegiums von Geistlichen; insbesondere
der (einem Erzbischof untergeordnete) Diözesanbischof.
Suffrage universel (franz., spr. ssüffrahsch
üniwersséll), s. Allgemeines Stimmrecht.
Suffragium (lat.), die Stimme, die der röm.
Bürger in den Komitien (s. d.) oder als Richter in
Kriminalprozessen (judicia publica) abgab; auch die Abstimmung im
ganzen und das Stimmrecht selbst.
Suffrutex (lat.), s. Halbstrauch.
Suffusion (lat., Hyphämie), diffuse Blutunterlaufung
von größerer Ausdehnung in die Gewebsmaschen, wie sie
namentlich unter der Haut bei Quetschungen, Schlägen mit
stumpfen Instrumenten in seltenen Fällen spontan vorkommen, z.
B. bei Blutfleckenkrankheit, Skorbut u. dgl.
Sûfismus (Sofismus), der Mystizismus der
Mohammedaner, nach welchem der Mensch ein Ausfluß (Emanation)
Gottes ist und zur Wiedervereinigung mit demselben
zurückstrebt. Seine Anhänger heißen Sufi
("Wollbekleidete"), da sie nach der Sitte der ersten Gründer
im 3. Jahrh. nach Mohammed nur wollene Kleidung trugen, was aber
heute nicht mehr der Fall ist. Die Sûfi unterscheiden drei
Stationen in ihrem Orden: die der Methode, auf welcher der Moslem
die vorgeschriebenen Reinigungen und Gebete äußerlich
vollbringt; die der Erkenntnis, auf der er erkennt, daß alle
äußerliche Religionsübung keinen wahren Wert hat,
und sich vielmehr dem Studium der heiligen sûfistischen
Schriften und beschaulichem Versenken in die Gottheit widmet;
endlich die der Gewißheit, auf welcher er sich als eins mit
der Gottheit weiß und daher über alle Askese erhaben
ist. Als Stifter des S., der namentlich in Kleinasien und Persien,
auch in Indien Ausbreitung fand, wird ein arabischer Perser aus
Irak genannt; für seine bedeutendsten Vertreter gelten der
persische Dichter Dschelal eddin Rumi und Frerid eddin Attar aus
Nischabur wie auch die berühmten Dichter Hafis und Saadi. Vgl.
Tholuck, S., sive Theosophia Persarum pantheistica (Berl. 1821);
Kremer, Geschichte der herrschenden Ideen des Islams (Leipz. 1868);
Palmer, Oriental mysticism (Lond. 1867); Gobineau, Les religions et
les philosophes dans l'Asie Centrale (2. Aufl., Par. 1866).
Suganathal (Val Sugana),Flußthal der Brenta, soweit
sie tirolisches Gebiet durchströmt, zieht sich von den Quellen
der Brenta ab über 50 km bis zur italienischen Grenze, wo es
bei Tezze in eine wilde Schlucht übergeht, enthält die
Seen von Caldonazzo und Levico, hat südliche Vegetation, Wein-
und Seidenkultur und ca. 70,000 Bewohner. Wichtige Orte sind
Pergine, Levico, Borgo und der Badeort Roncegno. Der Name wird von
dem Volksstamm der Euganeer abgeleitet, welche hier angesiedelt
waren.
Sugatag (spr. schú-), Dorf im ungar. Komitat
Marmaros, bei Marmaros-Sziget, mit großem Salinenwerk
(jährliche Produktion 165,000 metr. Ztr. Salz). Vom Bergwerk
führt eine 20 km lange schmalspurige Bahn nach
Marmaros-Sziget.
Suger (spr. ssühsche), franz. Kirchenfürst und
Staatsmann, geb. 1081 zu St.-Omer, seit 1122 Abt zu St.-Denis,
hatte unter Ludwig VI. und Ludwig VII. bedeutenden Einfluß
auf das Staatswesen, verbesserte die Justiz, beförderte
Ackerbau, Handel und Gewerbe, begünstigte die Städte, war
während Ludwigs VII. Kreuzzug 1147-49 Reichsregent, hob die
Macht des Königtums und starb 12. Jan. 1151. Er schrieb unter
anderm: "Vita Ludovici VI." (hrsg. von Molinier, Par. 1887) und "De
rebus in sua administratione gestis" (bei Duchesne, "Scriptores",
Bd. 5). Sein Leben beschrieben Combes (Par. 1853) und Nettement (3.
Aufl., das. 1868).
Suggerieren (lat.), einem etwas eingeben, ihn
beeinflussend zu etwas veranlassen.
Suggestion (franz., "Eingebung"), die
Einflößung bestimmter Vorstellungen in der Hypnose (s.
Hypnotismus). Die Erfahrungen der letzten Jahre haben bewiesen,
daß die geistige Beeinflussung der durch die Hypnotisierung
ihres selbständigen und logischen Denkens beraubten Personen
viel weitere Ausdehnung zuläßt, als man bis dahin
geneigt war, zu glauben, und daß dadurch erstaunliche
Wirkungen erzielt werden können. Richet in Paris will einer
Dame von mittlern Jahren nacheinander suggeriert haben, sie sei
eine Bäuerin, eine Schauspielerin, ein alter General, ein
Prediger, eine Nonne, eine alte Frau, ein kleines Kind, ein junger
Mann etc., und sie habe sich jedesmal der eingebildeten Rolle
gemäß betragen. In einem kürzlich zu Pforzheim
verhandelten Prozeß handelte es sich um Personen, die in der
künstlich erregten Wahnvorstellung, Hunde zu sein, auf andre
gehetzt worden waren. Der bekannte Psycholog J. Delboeuf in
Lüttich hat einer Person sogar mit Erfolg vorgeredet, sie sei
ein geheizter eiserner Ofen oder eine brennende Petroleumlampe. Dem
Träumenden mangelt eben jede Logik und Fähigkeit, sich
durch eignes Denken einer gebieterischen Wahnvorstellung zu
entreißen. Man begreift die Gefährlichkeit der Macht
eines gewissenlosen Hypnotiseurs über seine Opfer, und es sind
bereits mehrere Fälle vor die Gerichte gekommen, in denen
Frauen unter dem Vorgeben, mit ihrem Gatten zu verkehren,
gemißbraucht oder zu schriftlichen Schenkungen
veranlaßt worden sind. Es ist somit höchst bedenklich,
sich ohne Beisein einer Vertrauensperson hypnotisierenzu lassen.
Einige
427
Suggestion mentale - Suifon.
forscher, namentlich Charkot in Paris, dem aber auch
Krafft-Ebing in Graz, Obersteiner in Wien und andre deutsche
Autoritäten in neuerer Zeit beigestimmt haben, gehen noch
weiter und behaupten, es ließen sich durch S. Eindrücke
aus Körper- und Gemütsleben hervorbringen, die über
die Hypnose hinauswirken und so Heilwirkungen,
Charakteränderungen, erziehliche Einflüsse etc.
befördern könnten. Krafft-Ebing will einer Person die
Körpertemperatur, die sie am nächsten Morgen zeigen
sollte, und ein französischer Arzt einer andern durch die
Eingebung, sie werde mit glühendem Eisen gebrannt, sogar
Brandblasen erzeugt haben. Auch zu persönlichen Angriffen,
Verbrechen etc. nach der Hypnose soll durch S. ein Anstoß
gegeben werden können. Diese Angaben bedürfen aber noch
sorgfältiger Prüfung. Vgl. Obersteiner, Der Hypnotismus
mit besonderer Berücksichtigung seiner klinischen und
forensischen Bedeutung (Wien 1887); v. Krafft-Ebing, Eine
experimentelle Studie auf dem Gebiet des Hypnotismus (Stuttg.
1888); Bernheim, Die S. und ihre Heilwirkung (Wien 1888).
Suggestion mentale (franz., spr.
ssüggschestióng mang-tall), die angebliche
Gedankenübertragung ohne Berührung; s. Gedankenlesen, S.
990.
Suggestivfragen (eingebende Fragen), verfängliche
Fragen des Richters an den Angeklagten oder an Zeugen, welche so
gestellt werden, daß die von letztern erst anzugebenden
Thatsachen schon von dem Richter in die Frage hineingelegt werden;
nach moderner Rechtsanschauung unstatthaft.
Sughlio, stark gewürzte Fleischbrühe, welche
mit Weißwein statt Wasser bereitet wird, dient zum Kochen von
Maccaroni, Geflügel und Wild.
Sugillation (lat.), der Austritt von Blut in die Gewebe
nach Zerreißung kleinerer Gefäße. Der Ausdruck ist
aus den Worten sub ciliis ("unter den Augenlidern") entstanden und
bedeutet ursprünglich als Succiliatio die so häufigen bei
Schlägerei vorkommenden roten Flecke der Augenlider, welche
später alle Regenbogenfarben durchmachen und in der
Volkssprache schlechtweg als blaues Auge bekannt sind.
Suheir, arab. Dichter, s. Sohair.
Suhl (Suhla), Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Erfurt, Kreis Schleusingen, an der Südseite des Thüringer
Waldes im Thal der Hasel und an der Linie Plaue-Ritschenhausen der
Preußischen Staatsbahn, 438 m ü. M., hat 2 evang.
Kirchen, ein Amtsgericht, eine Oberförsterei, eine
Reichsbanknebenstelle und (1885) 10,602 meist evang. Einwohner.
Hauptnahrungszweig derselben ist Eisenwaren- und Gewehrfabrikation,
welch letztere seit Jahrhunderten in großem Ruf steht und
nicht nur Kriegswaffen aller Art, sondern auch Jagdgewehre und die
verschiedensten Luxuswaffen liefert. Andre Gewerbe sind:
Barchentweberei, Holzwaren-, Porzellan-, Lederfabrikation,
Maschinenbau etc. Über der Stadt erhebt sich der Domberg mit
dem Ottilienstein (520 m), einem aussichtsreichen Porphyrfelsen. S.
wird urkundlich zuerst 1330 als Dorf erwähnt, das durch Kauf
an die Grafen von Henneberg kam und 1527 Stadtrecht erhielt; seit
1815 gehört es zu Preußen. Vgl. Werther, Chronik der
Stadt S. (Suhl 1846-47, 2 Bde.).
Suhle, morastige Vertiefung, in welche sich Rot- und
Schwarzwild, besonders bei trocknem, heißem Wetter,
niederlegt, um sich darin zu kühlen und vom Ungeziefer,
namentlich den Hirschlausfliegen, zu reinigen. Der Hirsch
schlägt gewöhnlich zuerst mit dem Vorderlauf den Morast
zu einer breiartigen Masse, legt sich dann hinein und wälzt
sich behaglich darin umher. Beim Austreten aus der S.
schüttelt er sich den Schmutz ab und reibt (marlt) sich dabei,
wie namentlich auch die Sauen, an Bäumen. In Revieren, in
welchen es an natürlichen Suhlen fehlt, schlägt man
muldenförmige Vertiefungen mit strengem Letten aus, damit das
darin zusammenlaufende Wasser nicht in den Boden einsickern
kann.
Suhler Weißkupfer, s. Nickellegierungen.
Suhm, Ulrich Friedrich von, Freund Friedrichs d.Gr., geb.
29. April 1691 zu Dresden, studierte in Genf, kam 1720 als
kursächsischer Gesandter an den Berliner Hof, trat hier mit
dem damaligen Kronprinzen (Friedrich II.) in enge Verbindung und
stand mit demselben auch nach seinem Abgang von Berlin (1730) noch
in philosophischem Briefwechsel, der nach dem Tode des Königs
unter dem Titel: "Correspondance familiaire de
Frédéric II avec U. F. de S." (2 Bde.) erschien. 1737
ward S. Gesandter am russischen Hof; er starb im November 1740.
Sühneverfahren, gerichtliches Verfahren zum Zweck
der gütlichen Beilegung eines Rechtsstreits. Nach der
deutschen Zivilprozeßordnung (§ 268) kann das Gericht in
jeder Lage eines bürgerlichen Rechtsstreits die gütliche
Beilegung desselben oder einzelner Streitpunkte versuchen oder die
Parteien zum Zweck des Sühneversuchs vor einen beauftragten
oder ersuchten Richter verweisen. Auch kann zum Zweck des
Sühneversuchs das persönliche Erscheinen der Parteien vor
Gericht angeordnet werden. In Ehesachen muß dem Verfahren vor
dem Landgericht in der Regel ein Sühnetermin vor dem
Amtsgericht vorhergehen, bei welchem der Ehemann seinen allgemeinen
Gerichtsstand hat. Die Parteien müssen zu diesem
Sühneversuch persönlich erscheinen (§ 570 ff.).
Handelt es sich ferner um eine geringfügigere Rechtssache,
welche im einzelrichterlichen Verfahren vor dem Amtsgericht zu
verfolgen ist, so kann der Kläger zunächst seinen Gegner
zum Zweck eines Sühneversuchs vor das Amtsgericht laden
lassen. Kommt hier ein Vergleich nicht zu stande, so wird auf
Antrag beider Parteien sofort zur Verhandlung des Rechtsstreits
geschritten, indem alsdann die Klagerhebung durch den
mündlichen Vortrag der Klage erfolgt (§ 471). Bei
einfachen Beleidigungen ist nach der deutschen
Strafprozeßordnung (§ 420) die Erhebung der Klage erst
dann zulässig, wenn vor der zuständigen
Vergleichsbehörde die Sühne fruchtlos versucht worden
ist. Hierüber hat der Kläger mit der Klage eine
Bescheinigung einzureichen. Die Vergleichsbehörde ist in den
meisten deutschen Staaten der Schiedsmann (s. d.), der auch die
gütliche Beilegung von privatrechtlichen Streitigkeiten
versuchen kann.
Suicidium (lat.), Selbstmord.
Suidas, griech. Lexikograph, um 970 n. Chr., Verfasser
eines Worterklärungen und Notizen (namentlich biographische)
über die alten Schriftsteller enthaltenden lexikalischen
Werkes. Eilig und ohne Kenntnis und Kritik aus ältern
Wörterbüchern, Scholien und grammatischen Schriften
zusammengeschrieben, leidet es an zahlreichen schweren Mangeln und
Irrtümern, ist aber dennoch durch die Fülle nur hier
erhaltener Nachrichten besonders für die Litteraturgeschichte
von unschätzbarem Wert. Neuere Ausgaben besorgten Gaisford
(Oxford 1834, 3 Bde.), Bernhardy (Halle 1834-53, 2 Bde.) und Beker
(Berl. 1854). Vgl. Daub, De Suidae biographicorum origine et fide
(Leipz. 1880).
Suifon (Suifun), Fluß im Südussuriland
(ostsibirisches Küstengebiet), welcher in der Mandschurei
entspringt und sich im Sichota Alin durch eine Felsspalte in die
Peters d. Gr.-Bai Bahn bricht. Die
428
Sui juris - Suleiman Pascha.
Mündung des S. ist nur für Schiffe von 1,5 m Tiefgang
zugänglich.
Sui juris (lat.), sein eigner Herr, mündig.
Suina (Schweine), Familie der paarzehigen Huftiere.
Suinter, s. v. w. Wollschweiß.
Suir (spr. schuhr), Fluß in Irland, entspringt in
der Grafschaft Tipperary, fließt an Thurles, Caher, Carrick
und Clonmel vorbei und vereinigt sich unterhalb Waterford mit dem
Barrow (s. d.).
Suite (franz., spr. sswiht), Folge, Gefolge, besonders
von Militärpersonen, welche den Landesherrn oder höhere
Vorgesetzte bei Besichtigungen begleiten; Offiziere, welche zu
Dienststellungen außerhalb der Truppe berufen sind, wie z. B.
Lehrer an den Militärbildungsanstalten, werden "à la
s." ihres Truppenteils geführt, d. h. sie bleiben in dessen
Listen, bis ihre Wiedereinrangierung in denselben oder einen andern
Truppenteil erfolgt. - In der Musik ist S. (Partie, Partita) eine
der ältesten mehrsätzigen (cyklischen) Formen, die ihren
Ursprung in den Musikvorträgen der Kunstpfeifer hat, welche
schon im 16.-17. Jahrh. Tänze verschiedener Nationalität,
kontrastierend in Tempo und Takt, aber in der Tonart
zusammenstimmend, nacheinander vortrugen und eine solche Folge
Partie benannten. Der Name und die Form wurden im 17. Jahrh. von
den deutschen Klavierkomponisten aufgegriffen, welche auch die in
ähnlicher Weise aus mehreren Stücken zusammengesetzten
Variationen (Doubles) als Partie bezeichneten. Durch diese sowie
durch die Violinkomponisten (Corelli) wurden allmählich die
Formen der Tanzstücke erweitert, es begannen aber bald die
verschiedenen Teile durch überhandnehmende Figuration, wie sie
der Violine gemaß war, ihre charakteristischen Merkmale zu
verlieren, und es ist das Verdienst der französischen
Klavierkomponisten (Couperin), die Rhythmik wieder schärfer
präzisiert zu haben. Ihre letzte Ausbildung erfuhr die
Kammersuite durch J. S. Bach. Neben den Tanzstücken fanden
später auch die Introduktion, das Präludium, die Fuge,
die Tokkata, der Marsch und das Thema mit Variationen Aufnahme in
die S. In neuerer Zeit ist die S. auf volles Orchester
übertragen und zu großem Umfang ausgestaltet worden,
besonders durch Franz Lachner, der in seinen Suiten große
kontrapunktische Meisterleistungen hingestellt hat. Die vier
charakteristischen Teile der ältern S. sind: Allemande,
Courante, Sarabande und Gigue; wurden mehr Sätze eingeschoben
(Intermezzi: Gavotte, Passepied, Branle, Bourrée, Menuett,
auch Doubles über ein Tanzstück), so geschah das in der
Regel zwischen Sarabande und Gigue. Selten erscheint ein
eingeschobener Satz vor der Sarabande. über den Charakter der
einzelnen Sätze s. die Spezialartikel.
Suiten (vulgär Schwieten gesprochen), mutwillige,
lose Streiche; Suitier (Schwietjeh), Streichemacher, lustiger
Bruder.
Sujet (franz., spr. ssüscheh), s. v. w. Subjekt;
Gegenstand, besonders Stoff einer Rede etc.
Sukkade (ital.), kandierte Schale verschiedener
Citrus-Arten, besonders Zitronat.
Sukkador, Holzart, s. Jacaranda.
Sukkuba (lat.), nach dem mittelalterlichen Volksglauben
ein dem Inkubus (s. d.) ähnlicher weiblicher Nachtgeist (vgl.
Alp).
Sukkulent (lat.), saftig, kraftvoll, nahrhaft; Sukkulenz,
Saftfülle, Nahrhaftigkeit.
Sukkulenten (Succulentae), 1) Fettpflanzen, im
allgemeinen alle Gewächse mit fetten, saftreichen
Blättern oder mit sehr dicken, fleischigen, grünen
Stengeln mit rudimentären Blättern oder ganz ohne solche,
daher die meisten aus den Familien der Krassulaceen, Kakteen,
Mesembryanthemeen und den Gattungen Aloe, Agave etc. Die
oberirdischen Stengel dieser Pflanzen sterben meist nicht, wie die
der echten Kräuter, alljährlich ab, sondern dauern mit
ihren Blättern mehrere, oft viele Jahre. Sie können
Trockenheit der Umgebung länger als andre Gewächse
schadlos ertragen, weil ihre Transpiration äußerst
gering ist, so daß ihr ungewöhnlicher Wasserreichtum in
den voluminösen Organen zurückgehalten wird. -
2) (Opuntinae) Ordnung im natürlichen Pflanzensystem unter
den Dikotyledonen, Choripetalen mit dicken, fleischigen
Blättern oder, wenn diese nicht ausgebildet sind, mit
fleischigem, kugeligem bis säulenförmigem oder
zusammengedrücktem, grünem Stamm, die Blüten mit
Kelch- und Blumenblättern, welche, meist in großer
Anzahl, bald in Quirlen, bald in Spiralen geordnet sind, ebenso
gestellten Staubgefäßen und unter-, seltener
oberständigem Fruchtknoten mit meist wandständiger
Placenta, umfaßt die Familie der Kakteen und in einigen
Systemen auch die der Mesembryanthemeen. S. Tafel "Kakteen".
Sukkumbeuzgeld, Buße, welche im bürgerlichen
Rechtsstreit der mit einem Rechtsmittel (Berufung, Revision etc.)
Abgewiesene an die Staatskasse zu entrichten hat. Wo
partikularrechtlich in Deutschland ein S. vorkam, ist es durch die
deutsche Zivilprozeßordnung beseitigt. Das französische
Recht kennt dagegen das S. in der Form eines Einsatzes, welchen der
Beschwerdeführer an die Staatskasse verliert, wenn seine
Beschwerde abgewiesen wird. Das S. bezweckt die Verhütung des
leichtfertigen Gebrauchs von Rechtsmitteln.
Sukkumbieren (lat.), unterliegen, verlieren; Sukkumbenz,
das Unterliegen.
Sukkurrieren (lat.), beispringen, zu Hilfe eilen.
Sukkurs (lat.), Hilfe, Beistand, Unterstützung;
Sukkursale, Filiale eines Handlungshauses etc.
Sulamith (hebr., d. h. Mädchen aus Sulem oder
Sunem), die Braut im Hohenlied Salomos (7, 1).
Suleika, pers. Frauenname, unter welchem Goethe im
"Westöstlichen Diwan" seine Freundin Marianne v. Willemer (s.
d.) verherrlicht.
Suleiman, s. Soliman.
Suleimankette (Suleimankoh), Meridiangebirge im
östlichen Afghanistan, an der Grenze gegen Indien, erreicht im
Takht i Suleiman 3441 m Höhe, geht im W. in ein Hochland
über, fällt steil gegen Indien ab und ist von hier nur in
tief eingeriffenen, schwer zugänglichen Flußthälern
zu übersteigen.
Suleiman Pascha, türk. General, geb. 1838 in
Thrakien, wurde in der Militärschule erzogen, trat 1854 in die
Armee, ward schon 1862 Kapitän und kämpfte mit
Auszeichnung in Montenegro, wurde darauf als Bataillonskommandeur
in die Kaisergarde versetzt und 1867 nach Kreta gesandt, wo er
namentlich bei Erstürmung des Bergs Rova ein hervorragendes
strategisches Talent entwickelte, und, nach Konstantinopel
zurückgekehrt, Professor der Litteratur an der Kriegsschule.
Er schrieb in dieser Zeit mehrere wissenschaftliche Werke,
namentlich eine allgemeine Geschichte in drei Bänden und eine
Grammatik der türkischen Sprache, kämpfte unter Redif
Pascha in Jemen, avancierte dann zum Generalmajor und Unterdirektor
der Militärschule, endlich zum Direktor derselben, die er nach
europäischem Muster erweiterte und verbesserte, und nahm an
der Verschwörung zur Entthronung Abd ul Asis' teil. 1875
zum
429
Sulfat - Sulla.
Divisionsgeneral (Ferik) befördert, befehligte er im
serbischen Krieg 1876 zuerst eine Division, dann ein Korps, nahm
Knjaschewatz und die Höhen von Djunis und drang als einer der
ersten in Alexinatz ein. 1877 ward er zum Muschir und
Oberkommandanten von Bosnien und der Herzegowina ernannt,
verproviantierte Nikschitz und rückte in Montenegro ein, wurde
aber im Juli, als die Russen in Rumelien eindrangen,
zurückgerufen. Er warf dieselben bei Eski Zagra zurück,
griff sie 21.-26. Aug. vergeblich im Schipkapaß an, wobei er
seine vortreffliche Armee zu Grunde richtete, setzte auch im
September seine Angriffe hartnäckig fort, ward 2. Okt.
Oberbefehlshaber der Donauarmee, richtete aber nichts aus und ging
im Januar 1878 mit einem Teil derselben über den Balkan
zurück. Bei Philippopel ward 16. und 17. Jan. sein Heer
völlig zersprengt, S. im März zu Konstantinopel verhaftet
und vor ein Kriegsgericht gestellt und 2. Dez. besonders wegen
seines Verfahrens in Rumelien zur Degradation und zu 15 Jahren
Festung verurteilt, aber vom Sultan begnadigt. Er starb 15. April
1883. Vgl. Macrides, Procès de S. (Konstant. 1879).
Sulfat, s. v. w. schwefelsaures Natron; in der
Färberei s. v. w. schwefelsaure Thonerde; Sulfate, s. v. w.
Schwefelsäuresalze; z. B. Kaliumsulfat, schwefelsaures
Kali.
Sulfatofen, s. Soda, S. 1047.
Sulfide, s. Schwefelmetalle.
Sulfindigosäure, s. Indigo, S. 919.
Sulfite, s. v. w. Schwefligsäuresalze; z. B.
Natriumsulfit, schwefligsaures Natron.
Sulfobasen, s. Schwefelmetalle.
Sulfocarbonate, s. Schwefelkohlenstoff.
Sulfocyan, s. v. w. Rhodan.
Sulfonal (Diäthylsulfondimethylmethan), ein
Oxydationsprodukt einer Verbindung von Äthylmerkaptan mit
Aceton, bildet farb-, geruch- und geschmacklose, gut lösliche
Kristalle und kann als schlafbringendes Mittel dem Morphium und
Chloral an die Seite gestellt werden, ja es übertrifft
dieselben in mancher Hinsicht, da es deren nachteilige Wirkung auf
Puls, Atmung und Körpertemperatur nicht teilt. Bei
Schlaflosigkeit durch Herzfehler, fieberhafte Krankheiten, welche
die Anwendung von Morphium oder Chloral ausschließen, leistet
S. ausgezeichnete Dienste, ebenso besonders bei Schlaflosigkeit aus
nervösen Ursachen, bei Geisteskrankheiten und bei Kindern. Der
Schlaf tritt erst nach einer halben bis ganzen Stunde ein, aber er
ist tief, dauert 6-8 Stunden, und Nebenwirkungen, wie Kopfschmerz
etc., treten selten ein.
Sulfopurpursäure, s. Indigo, S. 919.
Sulfosalze, s. Salze, S. 245, u. Schwefelmetalle.
Sulfosäuren, s. Säuren und Schwefelmetalle.
Sulfostannat, s. Zinnsulfide.
Sulfozon, mit schwefliger Säure imprägnierte
Schwefelblumen, dient als Desinfektionsmittel und gegen Parasiten
auf Pflanzen.
Sulfur (Sulphur, lat.), Schwefel; S. auratum Antimonii,
S. stibiatum aurantiacum, Goldschwefel, s. Antimonsulfide; S.
depuratum, gewaschene Schwefelblüte, s. Schwefel, S. 724; S.
jodatum, Jodschwefel, aus 1 Teil Schwefel und 4 Teilen Jod
zusammengeschmolzen; S. praecipitatum, Schwefelmilch, s. Schwefel,
S. 725; S. stibiatum rubeum, Stibium sulfuratum rubeum,
Mineralkermes, s. Antimonsulfide; S. sublimatum,
Schwefelblumen.
Sulfüre, Sulfurete, s. Schwefelmetalle.
Sulfuröl, s. Olivenöl.
Sulina, der zweite Hauptmündungsarm der Donau (s.
d., S. 54 u. 55). An der Südseite desselben liegt im
rumänischen Kreis Tultscha (Dobrudscha) die Stadt S., mit
Leuchtturm und 5000 Einw., Sitz eines Pilotenkorps, Freihafen (seit
1879) und Hauptstationsort für die Dampsschiffahrt nach
Odessa. S. wurde 8. Okt. 1877 von den Russen beschossen und arg
verwüstet.
Sulingen (Suhlingen), Flecken und Kreishauptort im
preuß. Regierungsbezirk Hannover, hat eine evang. Kirche, ein
Amtsgericht, bedeutende Sensenfabrikation und (1885) 1645 Einw.
Hier 3. Juni 1803 Konvention zwischen Franzosen und
Hannoveranern.
Sulioten, albanes. Volksstamm im Südendes Paschaliks
Janina, dem alten Epirus, leitet seinen Ursprung von einer Anzahl
Familien ab, welche im 17. Jahrh. vor dem türkischen Druck in
den Gebirgen von Suli in der Nähe der Stadt Parga eine
Zuflucht suchten. Sie bekennen sich zur griechisch-katholischen
Kirche und sprechen als Muttersprache das Griechische, zugleich
aber auch das Albanesische. Neben Viehzucht und etwas Ackerbau war
ihr Hauptgewerbe das der Klephthen und Armatolen, worin sie sich
vorzüglich durch List und Ausdauer hervorthaten; besonders
galten ihre Angriffe den benachbarten Türken, gegen deren
Übermacht sie bei einem einfachen, aber ausharrenden
Verteidigungssystem geraume Zeit standhielten. Sie erlagen erst
1803 und verließen nun ihre bisherigen Wohnsitze, indem sie
erst nach Parga, dann, durch die Drohungen und Intrigen Ali Paschas
auch von da vertrieben, nach den Ionischen Inseln sich wandten.
Hier traten sie in den Militärdienst der verschiedenen
Mächte (Rußlands, Frankreichs, Englands), welche damals
nacheinander diese Inseln besaßen. Ali Pascha, 1820 in Janina
von den Türken unter Churschid Pascha eingeschlossen und von
den Albanesen verlassen, suchte bei den S. Hilfe und räumte
ihnen die Festung Kiagha ein. Die S. folgten seiner Einladung,
gerieten aber durch den Übertritt der albanesischen
Häuptlinge zu Churschid Pascha und den unglücklichen
Ausfall des im Sommer 1822 von Griechenland aus zu ihrer
Unterstützung unternommenen Feldzugs in große
Bedrängnis und mußten im September ihre Feste Suli den
Türken einräumen. Gegen 3000 S. wurden damals auf
englischen Schiffen nach Kephalonia gebracht, während sich die
übrigen in die Gebirge zerstreuten. Viele von ihnen
beteiligten sich tapfer an dem griechischen Freiheitskampf und
gelangten in Griechenland später zu Ansehen und Würden,
so die Botzaris und Tzavellas. Vgl. Perräbos, Geschichte von
Suli und Parga (neugriech., Vened. 1815, 2 Bde.; engl., Lond.
1823); Lüdemann, Der Suliotenkrieg (Leipz. 1825).
Sulkowski, eine aus Polen stammende, den Adelsfamilien
Lodzia und Sulima von Haus aus angehörige, seit 1752
reichsfürstliche Familie in Posen und
Österreichisch-Schlesien, blüht in den beiden Linien von
Reisen und von Bielitz, welche beide vom Grafen, seit 1752
Fürsten Alex. Jos. v. S. (gest. 1762) abstammen. Ersterer
gehörte an Anton Paul, Fürst S., geb. 31. Dez. 1785, der
nach Poniatowskis Tod einige Zeit die Reste der polnischen Armee
kommandierte und dann Generaladjutant des Kaisers Alexander I.
ward; starb 13. April 1836. Ihm folgte sein Sohn August Anton,
Fürst S., geb. 13. Dez. 1820, im Ordinat Reisen und in der
Grafschaft Lissa, und nach dessen Tod (20. Nov. 1882) Fürst
Anton, geb. 6. Febr. 1844. Herzog von Bielitz ist gegenwärtig
Fürst Joseph S., geb. 2. Febr. 1848.
Sulla, 1) Lucius Cornelius, röm. Diktator, geb. 138
v. Chr. als der Sprößling einer der Gens
430
Süllberg - Sullivan.
Cornelia angehörigen patrizischen Familie, war nach einer
teils in leichtsinnigen Vergnügungen, teils in litterarischen
Beschäftigungen verbrachten Jugend 107 im Jugurthinischen
Krieg Quästor des Konsuls Marius und trug dadurch wesentlich
zur glücklichen Beendigung des Kriegs bei, daß er den
König Bocchus von Mauritanien durch geschickte Unterhandlungen
zur Auslieferung des Jugurtha bewog. Er wurde darauf 93
Prätor, und nachdem er sich im Marsischen Krieg als
Führer einer Abteilung des römischen Heers besonders
ausgezeichnet hatte, ward er für 88 zum Konsul erwählt
und mit der Führung des (ersten) Mithridatischen Kriegs
beauftragt. Als er sich bereits nach Nola in Kampanien zu seinem
Heer begeben hatte, wurde in Rom durch die Volkspartei unter
Führung des Volkstribunen P. Sulpicius Rufus der Oberbefehl im
Mithridatischen Krieg Marius übertragen. S. kehrte daher an
der Spitze seines Heers nach Rom zurück, schlug seine Gegner
und ächtete die hervorragendsten unter denselben, traf auch
einige Anordnungen, die dazu dienen sollten, die Ruhe in der Stadt
zu sichern, widmete sich dann aber zunächst völlig der
Führung des ihm aufgetragenen Kriegs, ohne sich um die
Vorgänge in Rom zu bekümmern, wo sich seine Gegner bald
unter den größten Grausamkeiten der Gewalt
bemächtigten, Marius 86 zum siebentenmal Konsul wurde und
große Heere gesammelt wurden, um den gefürchteten Kampf
mit S. bestehen zu können. Als dieser den Krieg mit
Mithridates glücklich beendigt hatte (s. Mithridates), kehrte
er an der Spitze von 40,000 Mann nach Italien zurück,
überwand in einer Reihe von Schlachten seine Gegner, zuletzt
den jüngern Gajus Marius bei Sacriportus und ein
hauptsächlich aus Samnitern bestehendes Heer unter den Mauern
von Rom, und wurde dann 82 zum Diktator auf unbestimmte Zeit
ernannt. Als solcher suchte er zunächst seine Stellung zu
sichern, indem er eine große Menge seiner Gegner
proskribierte, d. h. ihre Namen durch Proskriptionslisten bekannt
machte und auf ihren Kopf einen Preis setzte, und indem er die
Ländereien der in dem blutigen Bürgerkrieg Umgekommenen
unter seine Veteranen verteilte und 10,000 Sklaven die Freiheit
schenkte, die ihm als ihrem Patron gewissermaßen als
Leibwache dienten. Dann aber erließ er, hauptsächlich zu
dem Zweck, der Republik eine aristokratische Verfassungsform zu
geben, eine Reihe von Gesetzen (Leges Corneliae), unter denen die
Zurückgabe der Gerichte an den Senat und die Herabsetzung der
Macht der Volkstribunen auf ihr ursprüngliches geringes
Maß besonders hervorzuheben sind. Als er aber sein Ziel
erreicht zu haben glaubte (er liebte es, sein Gelingen nicht seinem
Verdienst, sondern seinem Glück beizumessen, und ließ
sich daher gern den Glücklichen, Felix, nennen), legte er 79
die Diktatur nieder und zog sich nach Puteoli zurück, wo er,
ohne sich jedoch den öffentlichen Angelegenheiten völlig
zu entziehen, hauptsächlich seinem Vergnügen lebte, starb
jedoch schon 78. Er schrieb in lateinischer Sprache
Denkwürdigkeiten seines Lebens, deren letztes Buch sein
Freigelassener Epicadus vollendet und die Plutarch in seiner
Biographie des S. benutzt hat. Neuere Biographien lieferten
Zachariä (Heidelb. 1834) und Lau (Hamb. 1855).
2) Faustus Cornelius, Sohn des vorigen, geboren um 88 v. Chr.,
diente im dritten Mithridatischen Krieg unter Pompejus und war der
erste, der 63 die Mauern des Tempels von Jerusalem erstieg; 54
bekleidete er die Quästur. Im Bürgerkrieg stand er auf
seiten des Pompejus, mit dessen Tochter er verheiratet war. Nach
der Schlacht bei Pharsalos floh er nach Afrika; nach der Schlacht
bei Thapsos (46) fiel er in Cäsars Hände und ward von
dessen Soldaten ermordet.
3) Publius Cornelius, Bruderssohn des Diktators S., ward 66 v.
Chr. zum Konsul für das folgende Jahr gewählt, aber,
bevor er sein Amt antrat, wegen Amtserschleichung (ambitus)
angeklagt und verurteilt. Dann wurde er 62 wieder wegen Teilnahme
an der Catilinarischen Verschwörung angeklagt, aber von
Hortensius und Cicero verteidigt und freigesprochen. Im
Bürgerkrieg war er Legat Cäsars und befehligte bei
Pharsalos den rechten Flügel. Er starb 45.
Süllberg, s. Blankenese.
Sülldorf, Dorf im preuß. Regierungsbezirk
Magdeburg, Kreis Wanzleben, hat eine evang. Kirche, eine Zucker-
und eine Thonwarenfabrik, Kalk- und Ziegelbrennerei, ein Solbad und
(1885) 1133 Einw.
Sulliv., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung
für William S. Sullivant, geb. 1803 zu Franklinton, gest. 1873
in Columbus (Bryolog).
Sullivan (spr. ssölliwän), 1) Timothy Daniel,
irischer Politiker, geb. 1827 zu Bantry in der Grafschaft Cork,
nahm als Herausgeber und Eigentümer der Zeitung "Nation" sowie
andrer der irischen Nationalpartei als Organe dienender
Zeitschriften an den politischen Kämpfen seiner Landsleute in
den letzten Jahrzehnten hervorragenden Anteil. 1850-85 war er
für Westmeath Mitglied des Parlaments, welchen Sitz er 1885,
für Dublin gewählt, seinem jüngern Bruder, Donal S.,
überließ. 1886 wurde er Lord-Mayor von Dublin und 1887
einstimmig wieder- und 1880-82 als Parlamentsmitglied für
Meath gewählt. Auch ein dritter Bruder, Alexander Martin S.,
geb. 1830, seit 1855 Mitarbeiter an der "Nation", seit 1876
Parlamentsmitglied für Louth und in demselben Jahr Lord-Mayor
von Dublin, seit 1876 irischer und seit 1877 englischer
Rechtsanwalt, gest. 17. Okt. 1884, hat in der irischen Partei eine
bedeutende Rolle gespielt.
2) Arthur, engl. Komponist, geb. 13. Mai 1842 zu London, war
Chorknabe in der königlichen Vokalkapelle, als er zum
Stipendiaten der Mendelssohn-Stiftung erwählt wurde (1856).
Seine fernere musikalische Ausbildung erhielt er zunächst in
der Royal Acaderny of music in London, wo besonders Bennett sein
Lehrer war, und 1858-61 am Konservatorium in Leipzig. Er wurde
darauf 1861 Nachfolger Bennetts als Kompositionsprofessor an der
Akademie, 1876 Direktor der National training school for music in
London und 1880 Vorstandsmitglied des Royal college of music
daselbst. S. ist der hervorragendste unter den jüngern
englischen Komponisten, hat jedoch weniger originelle
Erfindungstraft als wohlgeschulte Gestaltungskunst. Seine
bekanntesten Werke sind die Musik zu Shakespeares "Sturm",
"Kaufmann von Venedig" und "Heinrich VIII.", das Ballett
"L'île enchantée" (1864), die Ouvertüren: "The
sapphire necklace" und "In memoriam", eine Symphonie in E dur, die
Oratorien: "The light of the world", "The prodigal son" und "The
martyr of Antioch", mehrere Kantaten, Kammermusikstücke und
Klavierkompositionen sowie zahlreiche Lieder und Operetten, wie:
"Cox and Box" (1866), "The contrabandista", "Her Majesty's ship
Pinafore", "Jolanthe", "The pirates of Penzance". "The Mikado",
"The golden legend" (1887) u. a., die namentlich in England und
Amerika großen Erfolg hatten. 1883 wurde S. von der
Königin in den Ritterstand erhoben.
431
Süllö - Sulpicius.
Süllö, s. Sander.
Sully (spr. ssülli), Maximilian von Béthune,
Baron von Rosny, Herzog von, franz. Staatsmann, geb. 13. Dez. 1560
zu Rosny bei Nantes, ward in der reformierten Kirche erzogen und
zugleich mit Heinrich von Navarra unterrichtet. Er nahm mit
Auszeichnung an den Feldzügen des jungen Königs von
Navarra teil und kämpfte bei Coutras (1587) und bei Ivry
(1590) mit. Ein strenger Calvinist, stolz und schroff, trat er auch
seinem königlichen Freund, besonders seiner Verschwendung und
Ausschweifung, wiederholt mit Energie entgegen; doch vereinte beide
bald wieder die gemeinsame Liebe zum Vaterland. Deswegen riet er
auch 1593 Heinrich zur Annahme des Katholizismus, um den
Bürgerkrieg zu beendigen. 1597 an die Spitze der Finanzen
gestellt, tilgte er eine Staatsschuld von 200 Mill. Livres, erwarb
den größten Teil der verschleuderten Domänen
zurück, hob eine Menge überflüssiger Ämter auf,
ordnete und vereinfachte das Steuerwesen, baute Straßen,
führte die Seidenkultur und andre Erwerbszweige ein und
begünstigte den Ackerbau; diesen und die Viehzucht
erklärte er für die Brüste, von denen Frankreich
sich nähre. Seit 1601 auch Großmeister der Artillerie
und Oberaufseher über alle Befestigungen des Landes, stellte
er in kurzem die öffentliche Ruhe wieder her, namentlich durch
Vernichtung vieler Räuberbanden. Auf Heinrichs Zug nach
Savoyen (1600) eroberte S. die für unüberwindlich
gehaltenen Festungen Montmelian und Bourg. Nach dem Frieden
übernahm er unter dem Titel eines erblichen Kapitäns der
Häfen, Flüsse und Kanäle das Departement der
öffentlichen Bauten, hob Zölle auf, erklärte den
Getreidehandel für frei, legte Kanäle an und leistete in
dieser Stellung viel für Verbesserung der Kommunikationsmittel
des Landes. Zugleich leitete er auch die auswärtigen
Verhandlungen. 1604 wurde er zum Gouverneur von Poitou und 1606
für sein Gut Sully an der Loire zum erblichen Herzog ernannt.
Dabei erwarb er für sich selbst ein bedeutendes Vermögen.
Nach der Ermordung Heinrichs IV. (14. Mai 1610) ward er seiner
Stellung am Hof entbunden und von diesem auf sein Schloß S.
verwiesen; doch bediente sich auch Ludwig XIII. öfters seines
Rats und ernannte ihn 1634 zum Marschall; er starb 21. Dez. 1641.
Wichtig für die Geschichte seiner Zeit, obwohl nicht durchaus
zuverlässig, sind seine in Stil und Form ungenießbaren
"Memoires" (Amsterd. 1634, 2 Bde.; 2 Supplementbände 1662),
die vom Abbé L'Ecluse (das. 1745, 8 Bde.) modernisiert, aber
auch sehr verändert und gefälscht wurden. Vgl. die
biographischen Schriften von Legouvé (Par. 1873), Gourdault
(3. Aufl., Tours 1877), Bouvet de Cresse (das. 1878), Dussieux
(Par. 1887) und Chailley (das. 1888); Ritter, Die Memoiren Sullys
(Münch. 1871).
Sully - Prudhomme (spr. ssülli-prüdómm),
Rene Francois Armand, franz. Dichter, geb. 16. März 1839 zu
Paris, wurde nach dem frühen Tod seines Vaters von einem
Oheim, dem Notar Sully, an Kindes Statt angenommen, widmete sich
dem Studium der Rechtswissenschaft, lebte dann aber ganz seinen
litterarischen Neigungen und veröffentlichte 1865 seine ersten
Gedichte: "Stances et poèmes", die das Glück hatten,
von Sainte-Beuve bemerkt zu werden, der namentlich auf das formell
vollendete und eine tiefe Innigkeit des Gefühls bekundende
Gedicht "Le vase brise" aufmerksam machte. Als weitere Sammlungen
folgten: "Les épreuves", "Les écuries d'Augias",
"Croquis italiens", "Les solitudes", "Impressions de la guerre",
"Les destins", "Les vaines tendresses", "La France" (Sonette), "La
revolte des fleurs" u. a. S. ist in diesen Dichtungen den Idealen
seiner Jugend treu geblieben; die Reinheit, die ihn kennzeichnete,
die Tiefe der Empfindung, der Adel des Gedankens wurden nie durch
Mißklänge getrübt, und die philosophierende
Richtung, die in seinen letzten Werken den Vorrang behauptet, hat
in ihrem Streben nach Aussöhnung zwischen einer schmerzvollen
Wirklichkeit und einer höhern Gerechtigkeit ebenfalls etwas
Wohltuendes. S. schrieb außerdem ein Lehrgedicht: "La
Justice" (1878), übersetzte den Lukrez (neue Ausg. 1886) und
veröffentlichte ein kunsthistorisches Werk: "L'expression dans
les beaux arts". Seine "OEuvres complètes" erschienen
1882-88 in 5 Bänden. Seit 1881 ist S. Mitglied der
französischen Akademie.
Sully sur Loire (spr. ssülli ssürr loahr),
Stadt im franz. Departement Loiret, Arrondissement Gien, an der
Loire und der Eisenbahn von Argent nach Beaune la Rolande, hat ein
schönes Schloß (mit Statue Sullys, der hier 1604-41
wohnte) und (1881) 2037 Einw.
Sulmirschütz (Sulmirzyce), Stadt im preuß.
Regierungsbezirk Posen, Kreis Adelnau, hat (1885) 3130 meist kath.
Einwohner.
Sulmo, Stadt, s. Solmona.
Sulphur (lat.), s. Sulfur.
Sulpicia, röm. Dichterinnen: 1) S., s. Tibullus;
2) S., unter Domitian lebende Verfasserin von erotischen
Gedichten, die bis auf wenige Reste verloren sind; eine ihren Namen
tragende "Satira" von 70 Versen, eine ziemlich frostige Betrachtung
der traurigen Lage der Gelehrten unter Domitian, ist ein ihr
untergeschobenes Machwerk aus spätrömischer Zeit (hrsg.
von Bährens in "De Sulpiciae quae vocatur satira. Jena 1873,
und in den "Poetae latini minores", Bd. 5, Leipz. 1883; auch
häufig in Verbindung mit Persius und Juvenal).
Sulpicius, angesehenes röm. Geschlecht, aus mehreren
Familien mit verschiedenen Beinamen (Camerinus, Galba, Gallus,
Longus, Paterculus Peticus, Prätextatus, Rufus und Saverrio)
bestehend. Publius S. Galba befehligte 210 v. Chr. und in den
folgenden Jahren die gegen König Philipp III. von Makedonien,
den Verbündeten Hannibals, ausgesandte Flotte und führte
als Konsul 200 und dann auch noch einen Teil des Jahrs 199 gegen
denselben Philipp den Oberbefehl. Servius S. Galba erlitt 151 als
Prätor eine Niederlage in Lusitanien, ließ im folgenden
Jahr viele tausend Lusitanier niederhauen, nachdem er sie unter der
Vorspiegelung, ihnen fruchtbare Ländereien anzuweisen, zur
Ergebung verlockt hatte, wurde deshalb 149 angeklagt, wandte aber
durch seine Beredsamkeit die Verurteilung von sich ab. 144
bekleidete er das Konsulat. Sein gleichnamiger Enkel war einer der
Verschwornen gegen Cäsar und wurde nebst den übrigen
Mördern Cäsars 43 von Oktavian geächtet; er ist der
Urgroßvater des Kaisers Galba. Publius S. Rufus, geb. 124,
wird von Cicero als Redner gerühmt, zeichnete sich 89 im
Bundesgenossenkrieg durch die Unterwerfung der Marruciner auch als
Feldherr aus und wurde für das Jahr 88 zum Volkstribun
erwählt. Sein Gesetzvorschlag, die mit dem Bürgerrecht
ausgestatteten Bundesgenossen in alle Tribus zu verteilen, fand auf
seiten der von den Konsuln Sulla und Quintus Pompejus Rufus
geführten Optimatenpartei den heftigsten Widerstand. Hierdurch
wurde er bewogen, sich an Gajus Marius anzuschließen, und
brachte daher ein Gesetz durch, daß der Oberbefehl gegen
Mithridates
432
Sultan - Sulze.
von Sulla (s. d. 1) auf Marius übertragen werden sollte.
Sulla aber schlug seine Gegner innerhalb der Mauern Roms und
ächtete die vornehmsten derselben, darunter auch S., der auf
seiner Villa entdeckt und getötet wurde. Der Sklave, der ihn
verraten, ward von Sulla zwar freigelassen, aber darauf vom
Tarpejischen Felsen gestürzt.
Sultan (arab., "Herr, Mächtiger"), gewöhnlicher
Titel mohammedan. Herrscher im Orient, besonders des osmanischen
Reichs. Auch den Frauen der Sultane wird der Titel Sultanin
beigelegt, in der Türkei aber nur der wirklichen Gemahlin des
Sultans sowie seinen Töchtern, welche Chanimsultaninnen
("Frauen von Geblüt") genannt werden. Die Mutter des
Großherrn heißt Walide S.
Sultanabad, Hauptstadt der pers. Provinz Irak Adschmi,
1844 m ü. M., wurde erst zu Anfang dieses Jahrhunderis
gegründet, hat die Form eines Rechtecks, durch zahlreiche
Türme verstärkte Mauern und treibt lebhaften Handel mit
Teppichen, von denen die meisten nach Europa gehen; der Wert dieser
Ausfuhr belief sich 1877 auf 1,600,000 Mk.
Sultanshuhn, s. Purpurhuhn.
Sultepec, Bergwerksort im mexikan. Staat Mexiko, 2340 m
ü. M., in engem Thal, mit (1880) 7613 Einw. Dabei kamen Gold,
Silber, Kupfer, Eisen, Blei, Zinn, Antimon, Zinnober und andre
Metalle vor.
Sulu (Joloinseln), eine Gruppe kleiner gebirgiger, aber
fruchtbarer Inseln im Ostindischen Archipel zwischen der
Nordostspitze von Borneo und der Südwestspitze von Mindanao,
2456 qkm (45 QM.) groß mit 75,000 malaiischen Bewohnern, die
sich zum Islam bekennen und früher als kühne
Seeräuber weithin berüchtigt waren. Trotzdem sie mehrmals
durch französische, spanische und niederländische
Schiffe, auch vom Radscha Brooke von Borneo, schwer gezüchtigt
wurden, hörten ihre Seeräubereien nicht auf, bis Spanien
von den Philippinen aus 1876 die Hauptinsel S. besetzte und den
ganzen Archipel dem Generalkapitanat der Philippinen einverleibte.
Das Recht Spaniens auf den Archipel wurde auch 1885
vertragsmäßig von Deutschland und England anerkannt.
Seitdem bilden das Einsammeln eßbarer Vogelnester und die
Perlenfischerei die ergiebigste Einnahmequelle der Insulaner, deren
geringer Handel fast ganz in den Händen von Chinesen aus
Manila ruht. Die Stadt S. wurde bei ihrer Einnahme 1876 durch die
Spanier niedergebrannt, aber von spanischen Genieoffizieren neu
aufgebaut und durch Sträflingsarbeit befestigt. Nach dem
Archipel führt der südlich bis Celebes sich erstreckende
Meeresteil den Namen Sulusee. S. Karte "Hinterindien".
Sulz, 1) Oberamtsstadt im württemberg.
Schwarzwaldkreis, am Neckar und an der Linie Plochingen-Villingen
der Württembergischen Staatsbahn, 427 m ü. M., hat eine
evang. Kirche, ein Amtsgericht, ein Hauptsteuer- und ein
Kameralamt, eine Saline, ein Solbad und (1885) 1895 meist evang.
Einwohner. -
2) (Obersulz, franz. Soultz) Stadt und Kantonshauptort im
deutschen Bezirk Oberelsaß, Kreis Gebweiler, an der Eisenbahn
Gebweiler-Lautenbach, hat eine alte kath. Kirche, ein Amtsgericht,
eine Oberförsterei, Seidenspinnerei, Seiden- und
Baumwollweberei, Eisengießerei und (1885) 4511 meist kath.
Einwohner. Westlich der 1432 m hohe Sulzer Belchen, der
höchste Gipfel der Vogesen. -
3) (S. unterm Wald) Stadt und Kantonshauptort im deutschen
Bezirk Unterelsaß, Kreis Weißenburg, an der Eisenbahn
Straßburg-Weißenburg, hat eine evangelische und eine
kath. Kirche, ein Amtsgericht, Bergbau auf Petroleum, Asphalt und
Eisen, eine Petroleumraffinerie, Hopfenbau und (1885) 1566 Einw.
-
4) Bad, s. Schongau.
Sülz, Dorf im preuß. Regierungsbezirk und
Landkreis Köln, 2 km südwestlich von Köln, hat
Spinnerei, Fabrikation von Maschinen, Goldleisten,
Buchdruckerschwärze, Bürsten und Lack, Ziegelbrennerei
und (1885) 2496 Einw.
Sulza (Stadtsulza), Stadt im sachsen-weimar.
Verwaltungsbezirk Weimar II (Apolda), an der Ilm, Knotenpunkt der
Linie Neudietendorf-Weißenfels der Preußischen
Staatsbahn und der Eisenbahn Straußfurt-Großheringen,
134 m ü. M., hat eine evang. Kirche, eine Baugewerkschule, ein
besuchtes Solbad (1887: 2225 Kurgäste), Wollwarenfabrikation
und (1885) 2105 Einw. Dabei die zu Meiningen gehörige Saline
Neusulza mit drei Gradierwerken. Vgl. Rost, Führer und
Ratgeber durch Bad S. (Sulza 188l).
Sulzbach, 1) Bezirksamtsstadt im bayr. Regierungsbezirk
Oberpfalz, an der Linie Nürnberg-Furth i. W., 400 m ü.
M., hat 3 Kirchen, ein Schloß (jetzt Gefängnis für
weibliche Sträflinge), ein Amtsgericht, starken Hopfenbau und
(1885) mit der Garnison (ein Infanteriebataillon Nr. 6) 4670 meist
kath. Einwohner. In der Nähe die Wallfahrtskirche Annaberg,
zahlreiche Eisensteingruben und ein großes
Eisenhüttenwerk. Das ehemalige gleichnamige deutsche
Fürstentum, dessen Hauptstadt S. war, und das 1028 qkm (19
QM.) mit 32,000 Einw. umfaßte, erscheint am Ende des 11.
Jahrh. als Grafschaft, kam 1305 an Bayern und fiel dann mit der
Oberpfalz an die Pfalz. Die Pfalzgrafen von S. waren eine
Nebenlinie derer von Pfalz-Neuburg (seit 1614) und folgten unter
Karl Theodor 1742 in der Kurpfalz, 1777 in Bayern (vgl. Pfalz, S.
933). -
2) Flecken im württemberg. Neckarkreis, Oberamt Backnang,
an der Murr und der Linie Waiblingen-Hessenthal der
Württembergischen Staatsbahn, 260 m ü. M., zur Grafschaft
Löwenstein gehörig, hat eine evang. Kirche, ein
Schloß (Lautereck), Gerberei, Schuhmacherei, Holzhandel,
Viehzucht und (1885) 2660 Einw. -
3) Dorf im deutschen Bezirk Oberelsaß, Kreis Kolmar, in
einem Thal der Vogesen, hat eine kath. Kirche, eine Mineralquelle
mit Bad und (1885) 756 Einw. -
4) Dorf im preuß. Regierungsbezirk Trier, Kreis
Saarbrücken, an der Linie Wellesweiler-Saarbrücken der
Preußischen Staatsbahn und einer Industriebahn, hat eine
evangelische und eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, eine
Steinkohlengrube, Eisenerzbergbau, Koks- und Glasfabrikation, eine
chemische Fabrik und (1885) 11,177 meist kath. Einwohner.
Sulzbacher Alpen, s. Steiner Alpen.
Sulzbad, Dorf im deutschen Bezirk Unterelsaß, Kreis
Molsheim, an der Eisenbahn Zabern-Schlettstadt, hat eine kath.
Kirche und (1885) 772 Einw. In der Nähe das Bad S. mit zwei
Mineralquellen, welche Chlor, Soda, Brom, Jod und Eisenoxyd
enthalten und namentlich gegen Hautkrankheiten und Rheumatismus
angewendet werden, sowie der besuchte Wallfahrtsort Avolsheim. Vgl.
Eissen, Soultzbad près Molsheim (Par. 1857).
Sulzberg (Val di Sole), s. Noce.
Sulzburg, Stadt im bad. Kreis Lörrach, am Sulzbach
und am Fuß des Schwarzwaldes, 339 m ü. M., hat eine
evang. Kirche, ein altes Schloß, eine Bezirksforstei,
vortrefflichen Weinbau, Weinhandel, eine Dampfsägemühle
und (1885) 1152 meist evang. Einwohner. Nahebei in einem
hübschen Waldthal das Bad S. mit alkalischer Kochsalzquelle
von 15° C.
Sulze, s. Salzlecke.
433
Sülze - Sumatra.
Sülze, kalte Fleischspeise, bereitet aus in
säuerlicher, stark gewürzter Brühe gekochtem und
fein geschnittenem Fleisch, welches mit der durchgeseihten, zu
Gelee eingedickten Brühe vermischt wird. Das Ganze
läßt man in einer Schüssel erstarren.
Sülze, Stadt im Großherzogtum
Mecklenburg-Schwerin, Herzogtum Güstrow, an der Recknitz, hat
eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, eine Dampfmolkerei, eine
Saline, ein Solbad und (1885) 2342 fast nur evang. Einwohner.
Sulzer, 1) Johann Georg, Ästhetiker, geb. 5.Okt.
1720 zu Winterthur, erhielt seine Bildung in Zürich und ging
1742 nach Berlin, wo er mit Euler und Maupertuis in nähere
Verbindung trat und 1747 die Professur der Mathematik am
Joachimsthaler Gymnasium, 1763 an der neugestifteten Ritterakademie
erhielt und auch in die Akademie der Wissenschaften aufgenommen
ward. Durch Kränklichkeit 1773 genötigt, seine Professur
niederzulegen, starb er 27. Febr. 1779. Sein Hauptwerk ist die
einst vielbenutzte "Allgemeine Theorie der schönen
Künste" (neue Ausg., Leipz. 1792-94, 4 Bde.), zu welcher
Blankenburg "litterarische Zusätze" (das. 1796-98, 3 Bde.)
sowie Dyk und Schulze "Nachträge" (das. 1792-1808, 3 Bde.)
lieferten. S. suchte darin die Wolfsche Philosophie mit den
Ansichten der Franzosen und Engländer eklektisch in
Übereinstimmung zu bringen. Vgl. seine "Selbstbiographie"
(Berl. 1809).
2) Salomon, Begründer des modernen Synagogengesangs, geb.
30. März 1804 zu Hohenems in Vorarlberg, lebt als emeritierter
Oberkantor der israelitischen Gemeinde und Professor am
Musikkonservatorium in Wien. S. veröffentlichte eine Sammlung
gottesdienstlicher Gesänge: "Schir Zion" (Wien 1845-66, 2
Bde.), die sich in allen Synagogen einbürgerten. Vgl.
"Gedenkblätter an Oberkantor S. S." (Wien 1882).
Sulzer Belchen, s. Belchen 2) und Sulz 2).
Sulzmatt, Flecken im deutschen Bezirk Oberelsaß,
Kreis Gebweiler, in einem engen Thal der Vogesen, hat eine kath.
Kirche, Baumwollspinnerei und -Webe-rei, Spinnerei von Flockseide,
guten Weinbau und (1885) 2807 Einw. In der Nähe das Bad S. mit
mehreren Mineralquellen, darunter einem Sauerbrunnen und einer
Schwefelquelle, die bei Gliederschmerzen und Hautkrankheiten zu
Bädern gebraucht wird. Vgl. Bach, Des eaux alcalines de
Soultzmatt (Straßb. 1853).
Sumach, Pflanzengattung , s. Rhus.
Sumarokow, Alexander Petrowitsch, russ. Dichter, geb. 14.
Nov. (a. St.) 1718 zu Moskau, versuchte sich in fast allen
Gattungen der Poesie, besonders in der Satire, und gilt als
Schöpfer des russischen Dramas, insofern er zuerst nationale
Lust- und Trauerspiele (nach dem pseudoklassischen Muster der
Franzosen) lieferte. Er wurde von der Kaiserin Katharina II. zum
Staatsrat erhoben und starb 1. Okt. (a. St.) 1777 in Moskau. S. war
auch der erste Direktor des russischen Hoftheaters. Von seinen
Dramen, die mehr nach ihrem sittlichen Gehalt und historischen Wert
als nach Form und Konzeption zu beurteilen sind, stehen die
Tragödien: "Horew", "Sinaw und Trubor" und "Mstislaw" oben an.
Unbedeutend sind seine Komödien wie seine Epen etc.; dagegen
zeichnen sich viele seiner Satiren durch Kühnheit und Energie
der Gedanken aus und lassen in S. einen feurigen Verfechter des
Rechts und der Wahrheit erkennen. Seine gesammelten Werke
erschienen zuletzt in St. Petersburg 1787. Vgl. Bulitsch, Sumarokow
(Petersb. 1854).
Sumatra, die westlichste und nächst Borneo die
größte der Sundainseln (s. Karte "Hinterindien"), wird
durch die Sundastraße von Java, durch die Straße von
Malakka von der Halbinsel Malakka getrennt und vom Äquator
mitten durchschnitten. Die von NW. nach SO. langgestreckte Insel
hat ein Areal, das offiziell auf 406,705 qkm (7386,2 QM.) angegeben
wird, nach Behm und Wagner aber 428,813 qkm (7787,7 QM.)
beträgt, ohne die Inseln an der Westküste (Babi, Nias,
die Batu-, Mantawi-, Poggiinseln, Engano) mit einem Areal von
14,421 qkm (261,9 QM.), welche, in derselben Richtung wie die
Hauptinsel streichend, wie die Trümmer einer zweiten Insel
erscheinen. Die Westküste ist hoch, und unter ihren
zahlreichen Buchten und Ankerplätzen ist die Bai von Tapanuli
die geräumigste und sicherfte; dagegen ist die Ostküste
niedrig und mit Strandmorästen bedeckt; nach innen zu steigt
das Land ganz allmählich auf, um sich endlich in
Hügelreihen an die Gebirgskette Boukit-Barissan
anzuschließen, welche S. in ihrer ganzen Länge
durchzieht. Durch dieselbe wird S. in einen schmalen, gebirgigen
westöstlichen und einen größern, von Tiefland
erfüllten östlichen Teil geschieden. Aus dem Gebirge
erheben sich 19 Vulkane, darunter 6 noch thätige: der
Indrapura (3833m), Dempo (3200m), Ophir oder Pasaman (2927 m),
Merapi (2660 m), Salasi und Ipo, zugleich die beträchtlichsten
Bodenerhebungen auf der Insel. Verheerende Ausbrüche (wie der
des Tambora, der über 12,000 Menschen das Leben kostete) haben
wiederholt stattgefunden. Am Südostende bilden die
Ausläufer der Parallelketten des Gebirges drei Landspitzen,
zwischen denen die Lampong- und die Kaiserbucht ins Land
hineintreten. Infolge der orographischen Verhältnisse sind die
Flüsse der Westküste unbedeutend, doch kann der Singkel
20 km von seiner Mündung aufwärts durch einheimische
Boote befahren werden. Dagegen wird die Ostseite von einer Anzahl
wasserreicher Flüsse (Rokan, Siak, Indragiri, Jambi, Palembang
oder Musi, Tulan-Bawan) durchzogen, die teilweise 150 km und weiter
aufwärts selbst von größern Kriegsschiffen befahren
werden können. Unter den Seen ist der Sinkara der
bedeutendste. Das Klima ist heiß und in den sumpfigen
Niederungen bei 27-32° C. Maximaltemperatur ungesund, in 1200 m
hohen Lagen aber bei einem Maximum von 24° C. zuträglich.
Der Wechsel des Monsuns ist auf den beiden Seiten des Äquators
ein entgegengesetzter. Die Tierwelt zeigt mehr Verwandtschaft mit
der von Borneo als der von Java. Affenarten sind zahlreich, sehr
häufig ist der Königstiger; sonst sind noch zu
erwähnen der Elefant, zwei Rhinozerosarten, der Tapir,
Nebelpanther; die Flüsse wimmeln von Kaimans (Crocodilus
biporcatus). Die Pflanzenwelt ist außerordentlich reichhaltig
und üppig. Als Repräsentant derselben kann die dort
heimische Rafflesia Arnolda gelten, ein Schmarotzergewächs mit
der größten Blüte der Welt (bis 1 m im Durchmesser
und über 5 kg schwer). S. hat in seinen ungeheuern
Wäldern eine Fülle von nutzbaren Holzarten und erzeugt
zugleich durch Kultur eine Reihe von Massenprodukten zur Ausfuhr,
wie Reis, Zucker, Tabak, Indigo, Baumwolle, Katechu, Kautschuk,
Guttapercha, Benzoe, Rotang, Kampfer, Betel- und Kokosnüsse,
eingeführt ist die Kultur von Kaffee, Muskatnüssen u. a.
An Metallen finden sich, und zwar reichlich, Gold, Kupfer, Zinn,
Eisen, auch Steinkohlen. Die Bevölkerung, deren Zahl man auf
3,8 Mill. berechnet, gehört zur malaiischen Rasse; im SO.
wohnen die Lampong, in der Mitte die Passumah und Redschang, nach
N. hin
434
Sumatrakampfer - Sumerier.
die Batta und Atschinesen. Als besonderer Stamm hausen,
abgeschieden von der übrigen Bevölkerung, noch die
Orang-Kubu ohne feste Wohnsitze. Die Unterschiede zwischen den
verschiedenen Völkerschaften sind hauptsächlich bedingt
durch das Maß, in welchem arabisch-islamitische,
indo-javanische und europäische Einflüsse nacheinander
auf dieselben eingewirkt haben. Die Mehrzahl der Bewohner bekennt
sich zum Islam, und zwar sind sie meist fanatische Mohammedaner;
die Batta dagegen sind Heiden, die Passumah und Redschang zwar
nicht dem Namen, aber der That nach. Ackerbau und Schiffahrt sind
Hauptbeschäftigungen; Seeräuberei und Menschenraub waren
früher eingebürgert. Die industrielle Thätigkeit
beschränkt sich auf das Weben baumwollener Kleiderstoffe und
Arbeiten in Gold, mit Benutzung sehr einfacher Geräte. Ihr
Gemeinwesen ist sehr zersplittert. Die wichtigsten
Ausfuhrhäfen sind Padang und Palembang. Die Insel wurde seit
der Eroberung von Atschin und Siak fast ganz den Niederländern
unterworfen. Sie teilen dieselbe administrativ ein wie folgt:
QKilom. QMeilen Bevölkerung 1885
Gouvernement Westküste 121171 2200,6 1192661
Benkulen 25087 455,6 149923
Lampongsche Distrikte 26155 475,0 118889
Palembang 140873 2558,4 627914
Ostküste 42321 768,6 171399
Atschin 51098 928,0 544634
Unter dieser gezählten Bevölkerung von 2,805,420
Seelen, welche gegen die oben angeführte Berechnung um 1 Mill.
zurücksteht, wurden 3944 Europäer, 62,053 Chinesen und
2549 Araber ermittelt. überall, wohin die Macht der
Holländer reicht, sind seit 1876 Sklaverei und Leibeigenschaft
aufgehoben worden. S. ward den Europäern durch den Portugiesen
Lopez de Figueira 1508 zuerst bekannt. Die Portugiesen errichteten
daselbst Handelsfaktoreien, wurden aber zu Ende des 16. Jahrh. von
den Holländern verdrängt, die 1620 auf der Insel festen
Fuß faßten. Neben dem Sultan von Bantam auf Java hatte
damals der Herrscher von Atschin (Atjeh) die meiste Macht auf S.
Zwischen 1659 und 1662 gelang es den Niederländern, die
Südwestküste ihrer Schutzherrschaft zu unterwerfen, und
1664 bemächtigten sie sich Indrapuras, Salidas und mehrerer
andrer Plätze, 1666 auch Padangs. Weiter im Süden hatten
sich seit 1685 die Engländer zu Benkulen festgesetzt, und
zwischen beiden regte sich bald lebhafte Eifersucht. 1803 fiel der
ganze südliche Teil der Ostküste mit Palembang ebenfalls
unter niederländische Herrschaft. Die Niederländer und
Engländer schlossen 1824 einen Vertrag, wonach diese gegen
Einräumung der niederländischen Besitzungen auf der
Halbinsel Malakka auf ihre Niederlassung auf S. zu gunsten der
Niederländer verzichteten. 1835 unterwarfen sich letztere auch
die Fürsten von Dschambi, und in einem Kriege gegen die
Atschinesen erweiterten sie ihren Besitz an der Westküste, wie
sie auch das malaiische Oberland des Reichs Menangkabu und zugleich
einen Teil der Battaländer unter ihre Botmäßigkeit
brachten. Es bestehen seitdem neben ihrem Reich nur noch die beiden
Reiche Atschin und Siak; auch ist ein Teil der Korintjier und Batta
im Innern noch unabhängig. Nachdem sich die Niederländer
durch die Abtretung Guineas an England dessen Zustimmung zur
Unterwerfung Atschins gesichert, begannen sie 1873 einen Krieg
gegen dies Reich (s. Atschin), der aber nur langsam und unter
großen Verlusten fortschritt. Vgl. Miquel, S., seine
Pflanzenwelt und deren Erzeugnisse (Leipz. 1862); Mohnike, Bangka
und Palembang, nebst Mitteilungen über S. (Münst. 1874);
Rosenberg, Der Malaiische Archipel (Leipz. 1878) ; Bock, Unter den
Kannibalen auf Borneo etc. (Jena 1882); Marsden, History of S.(3.
Ausg., Lond. 1811); Marre, S. Histoire des rois de Pasey (Par.
1875); Bastian, Indonesien, Teil 3 (Berl. 1886); Verbeek,
Topographische en georgische beschrijving van een gedeelte Van
Sumatra's westkust (1886).
Sumatrakampfer, s. v. w. Borneokampfer, s. Kampfer.
Sumatrawachs (Geta-Lahoe), der eingedickte Milchsaft von
Ficus ceriflua Jungh., ist aschgrau, härter als Bienenwachs,
spez. Gew. 0,963 bei 16°, fast vollständig löslich in
Äther, wenig in kaltem Alkohol, schmilzt bei 61°.
Sumba (auch Sandelbosch, "Sandelholzinsel"), eine der
Kleinen Sundainseln, durch die Sandelboschstraße von Floris
und Sumbawa geschieden, im Besitz der Holländer, aber unter
einheimischen Häuptlingen und zur Residentschaft Timor
gehörig, hat mit dem südwestlich gelegenen kleinen Savu
ein Areal von 11,360 qkm (206 QM.) und etwa 200,000 Einw. Das
Innere ist ein Tafelland von 1000 m Höhe mit gesundem Klima.
Produkte sind: Baumwolle, Sandelholz, Pferde, Geflügel. An der
Westküste der Ort Manukaka
Sumbawa (Sumbaua), eine der Kleinen Sundainseln, zwischen
Lombok und Floris, 13,980 qkm (254 QM.) groß, mit gebirgigem
und vulkanischem Boden, gut bewässert und sehr fruchtbar
(Sandelholz, Baumwolle, Tabak, Reis), hat etwa 150,000 Einw.
malaiischer Rasse und Bekenner des Islam. Die Insel bildet einen
Teil des niederländischen Gouvernements Celebes und
zerfällt in drei unter Radschas stehende Reiche: S., Bima und
Dompo; Sitz des niederländischen Residenten ist Bima. Vom 5.
bis 11. April 1815 fand hier ein Ausbruch des 4300 m hohen Vulkans
Tambora (Temboro) statt, welcher dabei zusammenstürzte, so
daß er jetzt nur noch 2339 m Höhe hat. Ein großer
Teil des umliegenden Landes wurde mit Asche bedeckt, und über
12,000 Menschen kamen ums Leben.
Sumbulwurzel, s. Ferula.
Sümeg (spr. schü-), Markt im ungar. Komitat
Zala, mit Sommerschloß des Veszprimer Bischofs,
Franziskanerkloster, (1881) 5029 ungar. Einwohnern, Weinbau und
Bezirksgericht.
Sumerier (Akkadier), altes Volk, welches in frühster
Zeit das Euphrat- und Tigrisland ("Land Sumir und Akkad") bewohnte
und eine nicht flektierende, agglutinierende Sprache redete, also
nicht semitischen Ursprungs war. Sie besaßen bereits eine
bedeutende Kultur, welche die Semiten, Babylonier und Assyrer, die
spätern Einwohner jenes Gebiets, neben denen sich aber die S.
noch lange behaupteten, von ihnen annahmen, und von der uns in den
bilinguen (assyrisch-sumerischen) Thontäfelchen der Bibliothek
Assurbanipals ansehnliche Reste, Lieder, Hymnen, Gesetzsammlungen,
astronomische und astrologische Schriften etc., erhalten sind. Ihre
ältesten Herrschaftssitze und Priesterstädte befanden
sich im untern Euphratgebiet, das nach einem ihrer Stämme auch
Chaldäa genannt wurde (vgl. Babylonien). Die S. besaßen
die Keilschrift (s. d.), welche nicht bloß Babylonier und
Assyrer, sondern auch Meder und Perser von ihnen überkamen,
beobachteten die Himmelskörper, Sonne, Mond und fünf
Planeten, welche sie als Götter verehrten, und nach denen sie
die sieben Tage der Woche,
435
Sumiswald - Sumpfbiber.
deren Einteilung von ihnen herrührt, benannten; die Namen
der Göttin Istar (Astarte), des Mondgottes Sin, des
Löwengottes Nergal u. a. sind in die semitische Religion
übergegangen. Ihre religiösen Hymnen, mitunter von tiefem
Gefühl, sind den Psalmen der Bibel ähnlich. Ihren
Rechnungen legten sie das Sexagesimalsystem zu Grunde, welches sich
bei der Einteilung unsrer Tagesstunden in Minuten und Sekunden, der
Grade etc. bis auf den heutigen Tag erhalten hat. Vgl. Lenormant,
Études accadiennes (Par. 1872-80); Derselbe, Études
cunéiformes (das. 1878-80); Derselbe, La langue primitive de
la Chaldée et les idiomes touraniens (das. 1875) ; Haupt,
Die sumerischen Familiengesetze (Leipz. 1879); Derselbe, Die
akkadische Sprache (Berl. 1883).
Sumiswald, Gemeinde im schweizer. Kanton Bern, Bezirk
Trachselwald, im untern Emmenthal, am Grünenbach, hat eine
schöne Kirche aus dem 16. Jahrh. und (1888) 5738 Einw., welche
Landwirtschaft, Viehzucht, Fabrikation von Leinwand und Uhren und
Handel mit Käse betreiben. Unweit das Schloß
Trachselwald, ehemals Sitz einer Deutschordens-Kommende, jetzt
Armenhaus.
Summarischer Prozeß, diejenige Prozeßart, bei
welcher zum Zweck der Beschleunigung des Verfahrens Abweichungen
von dem regelmäßigen Prozeßgang und
Abkürzungen des letztern statuiert sind. Den Gegensatz bildet
der ordentliche bürgerliche Prozeß, und zum Unterschied
wird der summarische auch der "außerordentliche Prozeß"
genannt. Die moderne Gesetzgebung, welche für alle
Rechtsstreitigkeiten ein schleunigeres Verfahren an Stelle des
schwerfälligen gemeinrechtlichen Prozeßganges
einführte, hat die Fälle des summarischen Prozesses
wesentlich eingeschränkt. So kennt die deutsche
Zivilprozeßordnung als eigentlichen summarischen Prozeß
nur noch den Exekutiv- oder Urkundenprozeß (s. d.) und den
Wechselprozeß (s. d.); außerdem gehören noch das
sogen. Mahnverfahren (s. d.) hierher sowie der Arrest (s. d.) und
die "einstweiligen Verfügungen" (s. d.). Auch im
Strafprozeß ist in geringfügigen Fällen ein
summarisches Verfahren gestattet (s. Mandatsprozeß). Vgl.
Deutsche Zivilprozeßordnung, (§ 555-567, 628-643;
Deutsche Strafprozeßordnung, § 447-452.
Summarium (lat.), kurz gefaßter Hauptinhalt einer
Schrift etc.; daher summarisch, dem Hauptinhalt nach
zusammengefaßt.
Summation (lat.), s. Addition.
Summe (lat. Summa), in der Arithmetik das Resultat einer
Addition (s. d.). Summenformel oder summarisches Glied einer Reihe
nennt man den algebraischen Ausdruck, der die S. einer bestimmten
Anzahl von Gliedern der Reihe in allgemeinen Zeichen (Buchstaben)
ausdrückt.
Summis desiderantes affectibus (lat.), Bulle des Papstes
Innocenz VIII. von 1484 zu gunsten der Hexenprozesse (s. Hexe, S.
103).
Summisten, im Gegensatz zu den Sententiariern Bezeichnung
der spätern Scholastiker, welche sogen. Summen (summae
theologiae), d. h. selbständige Lehrgebäude der
Theologie, lieferten, wie Alexander von Hales, Albertus Magnus,
Thomas von Aquino u. a.
Summitates (lat.), pharmazeut. Bezeichnung der
blühenden Stengelspitzen oder auch der ganzen obern Teile der
Pflanzen; S. Sabinae, Sadebaumspitzen.
Summum bonum (lat.), s. Höchstes Gut.
Summumjus summa injuria (lat.), röm.
Rechtssprichwort: "das höchste Recht (d. h. das Recht, wenn es
auf die Spitze getrieben wird) ist die höchste
Ungerechtigkeit".
Sumner (spr.ssömmner), Charles, am erikan.
Staatsmann, geb. 6. Jan. 1811 zu Boston, studierte an der
Harvard-Universität, dann an der juristischen Akademie in
Cambridge, ward 1834 Advokat in Boston, dann Referent des
Bezirksgerichtshofs der Vereinigten Staaten, lehrte auch an der
Universität Cambridge Staats- und Völkerrecht, bereiste
1837-40 Europa und gab Veseys "Reports" mit Anmerkungen heraus
(1844-46, 20 Bde.). In der Politik schloß er sich zuerst der
Whigpartei, 1848 aber, da er mit der Kriegserklärung gegen
Mexiko nicht einverstanden war und schon damals die Aufhebung der
Sklaverei verlangte, der Freibodenpartei an. 1850 wurde er in den
Bundessenat gewählt, wo er sich als hervorragender Redner und
heftiger Gegner der Sklaverei auszeichnete. Infolge einer
glänzenden, aber scharfen Rede gegen die Sklaverei aus
Anlaß des Kansas-Nebraskakonflikts (19. und 20. Mai 1856)
ward er 22. Mai von einem Repräsentanten aus Südcarolina,
Preston Brooks, körperlich gemißhandelt, so daß er
erkrankte und in Europa Erholung suchen mußte. 1859 nahm er
seinen Sitz im Senat wieder ein, ward einer der Führer der
neuen republikanischen Partei, unterstützte mit Eifer und
Erfolg die Wahl Lincolns und nahm unter dessen Präsidentschaft
als Vorsitzender des Senatskomitees für auswärtige
Angelegenheiten eine hervorragende Stellung in den
öffentlichen Angelegenheiten der Union ein. Auch die Rechte
des Kongresses Johnson gegenüber hatten an ihm einen
energischen Verteidiger. Ebenso trat er mutig und offen gegen Grant
auf, dessen Wahl er unterstützt hatte, als derselbe in der
Domingofrage eine Annexionspolitik verfolgte und die
schändlichste Korruption in der Verwaltung einreißen
ließ. S. verlor daher 1871 den Vorsitz im auswärtigen
Komitee, obwohl er das Recht der Union in der Alabamafrage noch
zuletzt ausführlich verteidigt hatte ("The case of the United
States", 1872). 1872 unterstützte er Greeleys Kandidatur und
starb 11. März 1874 in Washington. Er schrieb: "White slavery
in the Barbary States" (Bost. 1853). Gesammelt erschienen seine
Werke in 12 Bänden (Bost. 1871-75), seine Reden Boston 1851, 2
Bde., und 1855. Vgl. Lester, Life and public services of Charles S.
(New York 1874); Pierce, Life and letters of Ch. S. (Lond. 1877, 2
Bde.).
Sumpf, ein Gebiet mit stagnierendem Wasser, welches durch
Gegenwart von Schlamm und Vegetation nicht schiffbar ist, aber auch
nicht betreten werden kann und niemals austrocknet. Am
häufigsten finden sich Sümpfe an Ufern solcher
Flüsse, welche mit geringem Gefälle große Ebenen
durchlaufen (Oder, Warthe, Netze, Theiß, Deltasümpfe),
ferner auf großen, wenig geneigten, waldbedeckten Ebenen, wo
Quell- und Regenwasser keinen genügenden Abfluß haben,
und an Küsten (Maremmen und Valli in Italien, Swamps in
Nordamerika). Die Vegetation der Sümpfe (vgl. Sumpfpflanzen)
ist verschieden, je nachdem Wasser oder Erde vorherrschen; oft
finden sich große Strecken mit Wald bedeckt, und die
absterbenden Pflanzen bilden mächtige Torflager. Meist sind
die Sümpfe berüchtigt durch ihre
gesundheitsschädlichen Ausdünstungen; kulturfähig
werden sie erst, wenn eine hinreichende Ableitung des stagnierenden
Wassers gelingt; andernfalls verwertet man sie nur durch
Rohrnutzung und Erlenwuchs. - Im Bergbau heißt S. der tiefste
Teil des Schachts, in welchem die Wasser behufs Hebung und
Entfernung aus dem Bergwerk gesammelt werden.
Sumpfbiber (Schweifbiber, Myopotamus
436
Sumpfbussard - Sundainseln.
Geoffr.), Säugetiergattung aus der Ordnung der Nagetiere
und der Familie der Trugratten (Echimyina). Der Koipu (M. Coypu
Geoffr., s. Taf. "Nagetiere II"), 40-45 cm lang, mit fast ebenso
langem, drehrundem, geschupptem und borstig behaartem Schwanz,
untersetztem Leib, kurzem, dickem Hals, dickem, langem, breitem,
stumpfschnäuzigem Kopf, kleinen, runden Ohren, kurzen,
kräftigen Gliedmaßen, fünfzehigen Füßen,
an den hintern Füßen mit breiten Schwimmhäuten und
stark gekrümmten, spitzigen Krallen, ist oberseits
dunkelbraun, an den Seiten rot-, unterseits schwarzbraun, an der
Nasenspitze und den Lippen weiß oder hellgrau. Er bewohnt das
gemäßigte Südamerika vom 24.-43.° südl.
Br., vom Atlantischen bis zum Stillen Ozean und lebt paarweise an
Seen und Flüssen in selbstgegrabenen Höhlungen, fast
ausschließlich im Wasser. Auf dem Land bewegt er sich
langsam, dagegen schwimmt er vortrefflich, taucht aber schlecht. Er
nährt sich hauptsächlich von Gras, frißt aber auch
Wurzeln, Blätter, Körner. Das Weibchen wirft 4-6 Junge.
Man jagt den S. des kostbaren Pelzes halber, welcher als Rakunda
Nutria (amerikanisches Otterfell) in den Handel kommt, und in
manchen Gegenden ist das Tier fast schon ausgerottet. Das
weiße Fleisch wird an vielen Orten von den Eingebornen
gegessen. Alt eingefangene S. gehen bald zu Grunde, jung
eingefangene sind sehr lebhaft.
Sumpfbussard, s. Weihen.
Sumpfkresse, s. Taxodium.
Sumpfdlstel, s. Cirsium.
Sumpfeiche, s. Casuarina.
Sumpferz, s. v. w. Raseneisenerz.
Sumpffieber, diejenigen schweren Formen des
Wechselfiebers, welche in Sumpfgegenden endemisch vorkommen und
durch das sogen. Malariagift bedingt werden. S. Malaria und
Wechselfieber.
Sumpfgarbe, s. Ptarmica.
Sumpfgas, s. Methan.
Sumpfgras, s. Cladium.
Sumpfmiasma, s. v. w. Malaria.
Sumpfotter, s. Nörz.
Sumpfpflanzen, diejenigen Pflanzen, welche im sumpfigen
oder mit Wasser bedeckten Boden wurzeln, mit dem übrigen Teil
in der Luft wachsen. Dies sind besonders: Phragmites communis,
Glyceria spectabilis und fluitans, Phalaris arundinacea, Scirpus
lacustris, viele Arten Riedgräser (Carex), Eriophorum, Typha,
Sparganium, Alisma plantago, Sagittaria sagittaefolia, Acorus
Calamus, Iris Pseudacorus, Hippuris vulgaris, Rumex hydrolapathum,
Nasturtium palustre, N. amphibium, Cicuta virosa, Sium, Oenanthe,
Epilobium palustre, E. pubescens, Lythrum salicaria, Caltha
palustris, Myosotis palustris, Pedicularis palustris, Veronica
Beccabunga. Menyanthes trifoliata, Equisetum limosum.
Sumpfporst, s. Ledum.
Sumpfrodel, s. Pedicularis.
Sumpfsassafras, s. Magnolia.
Sumpfseidelbast, s. Dirca.
Sumpfvögel, s. v. w. Watvögel (s. d.).
Sumpfzeder, s. Taxodium.
Sumter (spr. ssömmtter), Fort auf einer
künstlichen Insel am Eingang des Hafens von Charleston im
nordamerikan. Staat Südcarolina, 1845-55 erbaut, wurde 14.
April 1861 vom Konföderiertengeneral Beauregard genommen,
womit der Bürgerkrieg begann, und, obwohl im August 1863 durch
ein Bombardement zerstört, bis 14. April 1865 gegen die
Unionstruppen verteidigt. Vgl. Crawfurd, Story of S. (New York
1888).
Sumtion (Sumption, lat.), Annahme, hypothetischer Satz;
in der katholischen Kirche das Nehmen und Genießen der
Hostie.
Sumtum (lat.), genommene Abschrift.
Sumtus (lat.), Aufwand, Kosten; sumtibus publicis. auf
Staatskosten; sumtuös, kostspielig.
Sumy (Ssumy), Kreisstadt im russ. Gounernement Charkow,
am Pfiol und der Sumyer Bahn (Linie Merefa-Woroschba), hat 9
Kirchen, ein Gymnasium, eine Realschule, ein Mädchengymnasium,
Fabriken für Zucker, Talg, Lichte und Leder und (1885) 15,831
Einw. An der Grenze von Groß- und Kleinrußland gelegen,
bildet S. einen wichtigen Verkehrspunkt für die Ukraine und
treibt namentlich Handel mit Pferden, Getreide und Sandzucker. S.
wurde im 17. Jahrh. an Stelle der alten Ansiedelung Lipenski von
Kleinrussen gegründet.
Sun, s. v. w. Sunnhanf.
Sunbury (spr. ssönnberi). 1) Dorf in der engl.
Grafschaft Middlesex, an der Themse, oberhalb Hampton Court, mit
(1881) 4297 Einw.; dabei Pumpwerke und großartige
Filtrierbecken von zwei Londoner Wassergesellschaften sowie
Brutteiche des Vereins zum Schutz der Themsefischerei. -
2) Stadt im nordamerikan. Staat Pennsylvanien, bei der
Vereinigung der zwei Arme des Susquehanna, mit lebhaftem
Kohlenhandel und (1880) 4077 Einw.
Sund (Öresund), Meerenge zwischen der dän.
Insel Seeland und der schwedischen Landschaft Schonen, die
gewöhnliche Durchfahrt aus der Nordsee in die Ostsee (s. Karte
"Dänemark"), ist 67 km lang, an der schmälsten Stelle
zwischen Helsingborg und Helsingör ungefähr 4 km breit
und wird von der dänischen Festung Kronborg auf Seeland
beherrscht. Seit dem Anfang des 15. Jahrh. erhob Dänemark bei
Helsingör von allen vorüberfahrenden Schiffen einen Zoll,
den Sundzoll, dessen Berechtigung durch Verträge von den
andern Seemächten anerkannt war. Völlig befreit von
demselben waren nur die sechs Hansestädte Lübeck,
Hamburg, Rostock, Stralsund, Wismar und Lüneburg sowie
Stettin, Kolberg und Kammin, während einzelnen Staaten, wie
Schweden, Holland, England und Frankreich, eine
Ermäßigung bewilligt war. Der Sundzoll zerfiel in die
Schiffsabgabe von durchschnittlich mindestens 12 Speziesthlr. und
den Warenzoll, der 1-1 1/2 Proz. betrug, und brachte Dänemark
1853 (bei 21,000 passierenden Schiffen) eine Einnahme von 2,530,000
Thlr. Nachdem die Vereinigten Staaten 1855 ihren mit Dänemark
bestehenden Vertrag gekündigt und erklärt hatten, den
Sundzoll nicht mehr zu zahlen, trat im Januar 1856 zu Kopenhagen
eine von fast allen europäischen Staaten beschickte Konferenz
zusammen, durch welche laut Vertrags vom 1. April 1857 der
bisherige Sundzoll gegen eine Entschädigungszahlung von
30,476,325 dän. Reichsthlr. abgeschafft wurde. Vgl. Scherer,
Der Sundzoll, seine Geschichte etc. (Berl. 1845).
Sund., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung
für C. I. Sundevall, geb. 22. Okt. 1801 zu Högestad bei
Ystad, gest. 5. Febr. 1875 als Professor und Direktor des Museums
in Lund (Zoolog).
Sundainseln, ostind. Archipel zwischen dem Chinesischen
Meer und dem Indischen Ozean, erstreckt sich vom Südwesten der
Halbinsel Malakka bis zu den Molukken und dem Nordwesten
Australiens, umfaßt ein Areal von 1,626,669 qkm (29,542 QM.)
mit 28 Mill. Einw. und zerfällt in die sogen. Großen S.:
Sumatra, Java, Borneo und Celebes, und die Kleinen S., als deren
wichtigste Bali, Lombok, Sumbawa, Floris, Sumba und Timor zu nennen
sind. Diese
437
Sundalselv - Sundwig.
Zusammenfassung von Inselgruppen und Inseln ist aber weder
geographisch noch ethnographisch voll berechtigt, man hat daher die
Bezeichnung S. auf die von der Makassar- und der Sapistraße
(zwischen Sumbawa und Komodo) westlich gelegenen Inseln
beschränken wollen. Der weitaus größte Teil der S.
steht unter mittelbarer oder unmittelbarer Herrschaft der
Niederländer; nur das nordöstliche Timor sowie Solor
beanspruchen die Portugiesen. S. Karte "Hinterindien".
Sundalselv, norweg. Fluß, entspringt am Fuß
der Snehätta im Dovrefjeld und mündet im Amt Romsdal in
die Südostspitze des Tingvolds- oder Sundalsfjords. Sein Thal,
Sundalen genannt, gehört unter die wildesten Felsenthäler
Norwegens.
Sundanesen, malaiischer Volksstamm, im westlichen Teil
von Java, der als Mittelglied zwischen den Malaien der Halbinsel
Malakka, den Javanen und Batta gelten kann.
Sundasee (Meer von Java), der Teil der südasiat.
Gewässer, welcher sich zwischen Sumatra, Java, Borneo und
Celebes erstreckt.
Sundastraße, Meerenge zwischen den Inseln Sumatra
und Java in Ostindien, verbindet den Indischen Ozean mit der
Sundasee. In dieser Straße liegen mehrere vulkanische Inseln:
Prinzeninseln, Thwart de Way, die durch die in neuester Zeit
erfolgten Ausbrüche bekannt gewordene Insel Krakatau u. a.
Sünde, die sittliche Abnormität unter
religiösem Gesichtspunkt, jede mit Freiheit geschehene
Abweichung von dem erkannten göttlichen Gesetz. Obwohl Paulus,
welcher die Lehre von der S. begründet hat, als Anfang der
allgemeinen Sündhaftigkeit nach jüdischer Weise den
Sündenfall Adams voraussetzt, so leitet er doch zugleich die
S. spekulativ aus dem Fleisch (s.d., S. 363 f.) ab. Damit war das
Problem gegeben, an dessen Auflösung die Kirchenlehre sich
zerarbeitete, indem sie den historischen Anfang mit dem moralischen
Ursprung in Einklang zu bringen suchte. Übrigens unterscheidet
sie: Erbsünde (s.d.) und die aus dieser erst hervorgehende
Thatsünde (peccatum actuale); rücksichtlich der Form,
unter welcher das Gesetz auftritt, Begehungssünde (p.
commissionis), die Übertretung des Verbots, und
Unterlassungssünde (p. omissionis); rücksichtlich der
Handlung selbst innere Sünden (peccata interna), unerlaubte
Gedanken und Entschließungen, und äußere
Sünden (p. externa), unerlaubte Reden und Thaten; nach dem
Grade der in ihr liegenden Verkehrtheit vorsätzliche oder
Bosheitssünden (p.voluntaria), die unmittelbar aus einem
bösen Entschluß hervorgehenden Handlungen, und
unvorsätzliche oder Schwachheits-, übereilungssünden
(p. involuntaria. ex infirmitate, temeritate oriunda). Unter der
Matth. 12, 31 f. erwähnten unvergeblichen S. wider den
Heiligen Geist versteht man den definitiven Unglauben der im
Bösen verhärteten, eigne bessere Überzeugung
erstickenden Persönlichkeit. Darauf und auf 1. Joh. 5, 16. 17
beruht die besonders in der katholischen Praxis bedeutungsvolle
Einteilung der Sünden in vergebliche oder büßliche
(peccata remissibilia sive venialia) und unvergebliche oder
Todsünden (p. irremissibilia sive mortalia), die den Verlust
des Gnadenstandes nach sich ziehen, ohne daß sie jedoch von
der katholischen Lehre in einem bestimmten Katalog zusammengestellt
worden wären. Vgl. Jul. Müller, Die christliche Lehre von
der S. (6. Aufl., Bresl. 1878, 2 Bde.).
Sündenbock, s. Asasel und Transplantation.
Sündenfall, die erste Sünde, die nach dem mosaischen
Bericht Adam (s. d.) und Eva begingen. Über ihre Folgen s.
Erbsünde.
Sündenvergebung (Remissio s. Condonatio peccatorum),
die von Gott ausgehende Wiederherstellung des durch die Sünde
gestörten Verhältnisses des Menschen zu ihm. Vgl.
Sünde und Beichte.
Sunderbands (Sunderbans), Name für das sumpfige, von
unzähligen Kanälen durchzogene Inselgewirr des untersten
Gangesdelta, zwischen Hugli, Meghna und Bengalischem Meerbusen, an
dem es sich 264 km lang hinzieht, 15,477 qkm (281 QM.) groß.
Bewohnt sind nur die höhern westlichen und östlichen
Teile, wo die Einwohner in kleinen Weilern leben und namentlich
Reis, aber auch Zuckerrohr und Jute bauen. Das durchaus ebene Land
ist namentlich nach der Meeresseite zu von undurchdringlichem
Dschangelwald bedeckt, ein vorzüglicher Schutz gegen die
häufigen Sturmfluten, die dennoch zuweilen große
Verheerungen anrichten. Der Wald, meist Staatseigentum, liefert
große Mengen von Nutz- und Brennholz (jährlich für
590,000 Pfd. Sterl.).
Sünderhanf, die männliche Hanfpflanze.
Sunderland (spr. ssonderländ), Seestadt in der engl.
Grafschaft Durham, an der Mündung des Wear in die Nordsee, hat
mit den Vorstädten Bishop's Wearmouth, Monk Wearmouth und
Southwick (1881) 116,542 Einw. Eine eiserne Brücke von 30 m
Höhe verbindet die beiden von großartigen Docks
eingefaßten Flußufer. Der Eingang zum Hafen wird durch
zwei Dämme (594 und 539 m lang) gebildet und durch Batterien
geschützt. Die neuern Stadtteile sind meist geschmackvoll
gebaut; die Altstadt aber, besonders nach dem Hafen zu, ist eng und
winkelig. S. hat eine Börse, ein theologisches
Methodistenseminar, Athenäum mit Museum, Theater, einen Park
mit Statue des hier gebornen Generals Havelock, großartige
Schiffswerften (2600 Arbeiter), Maschinenbauwerkstätten,
Glashütten, Töpfereien, Eisengießereien etc. Zum
Hafen gehörten 1887: 329 Schiffe von 227,301 Ton. Gehalt und
52 Fischerboote. 1887 wurden Waren im Wert von 633,691 Pfd. Sterl.
nach dem Ausland ausgeführt und für 441,281 Psd. Sterl.
von dort eingeführt. S. ist Sitz eines deutschen Konsuls.
Dicht dabei liegt Southwick (8178 Einw.) mit Kohlengruben und
Eisenwerken.
Sundewitt, Halbinsel in der preuß. Provinz
Schleswig-Holstein, durch den Alsener Sund von der Insel Alsen
geschieden, hat fruchtbaren Boden und eine hügelige
Oberfläche; sie war in den deutsch-dänischen Kriegen von
1848 bis 1849 und 1864 wiederholt Kriegsschauplatz (s.
Düppel). Vgl. Döring, Führer durch Alsen und S.
(Sonderb. 1877).
Sündflut, s. Sintflut.
Sundgau (Südgau), ehemals s.v.w. Oberelsaß, im
Gegensatz zum Nordgau (Unterelsaß); insbesondere die Umgegend
von Mülhausen.
Sundsvall, Hafenstadt im schwed. Län Westernorrland,
nahe der Mündung des Indalself, Ausgangspunkt der Eisenbahn
S.-Drontheim, in welche bei Ange die von Stockholm kommende
Nordbahn mündet, hat Eisenindustrie, Sägemühlen,
bedeutende Ausfuhr von Holz und Eisen und (1887) 10,726 Einw. 1887
sind im Zollbezirk von S. vom Ausland angekommen 1139 Schiffe von
413,695 Ton., abgegangen 1453 Schiffe von 544,827 T. Im Juni 1888
wurde S. durch eine Feuersbrunst fast ganz eingeäschert. S.
ist Sitz eines deutschen Konsuls.
Sundwig, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Arnsberg,
Kreis Iserlohn, hat Eisengießerei, ein Messingwalzwerk,
Drahtzieherei, Fabrikation von Drahtstif-
438
Sundzoll - Superga.
ten, Nägeln etc. und (1885) 877 meist evang. Einwohner.
Dabei das Felsenmeer, ein Kesselthal mit großen Felsen aus
devonischem Kalk, und die Sundwiger Höhle.
Sundzoll, s. Sund.
Suñer (spr. ssunjer), Luigi, ital.
Lustspieldichter, von spanischer Abkunft, geboren um 1832 zu
Havana, kam noch im kindlichen Alter nach Florenz, wo er eine
zweite Heimat fand. Sein erstes Lustspiel: "I gentiluomini
speculatori" (1859 zu Florenz aufgeführt), fußte auf der
Idee, die damals auf dem Schlachtfeld besiegelte Allianz
Frankreichs und Italiens in zwei Hauptpersonen des Stückes
symbolisch zu verkörpern. Durchgreifend wirkten aber erst die
folgenden Komödien: "I legitimisti" (1861) und "Spinte o
sponte". Einen Fortschritt bekundete er dann in den Lustspielen:
"L'ozio" (1863), "Una piaga sociale", "Caleche" (später mit
dem Titel: "Ogni lasciata è persa") und besonders "Le
amiche" (1873). Mit "Una legge di Licurgo" (1869) begann er sich
ernstern sozialen Problemen zuzuwenden. Es folgten das Proverb "Chi
ama teme", das Lustspiel "La gratitudine" und ein in Beziehung auf
Plan und Komposition vorzügliches Werk, welches einen Vers des
Dante zum Titel hat: "Amor ch'a nullo amato amar perdona".
Sungari, rechter mächtiger Nebenfluß des Amur
in der chinesischen Mandschurei.
Sunion (Sunium), die 60 m hohe Südspitze des alten
Attika, mit berühmtem Tempel der Athene, wovon noch 9 (Ende
des 17. Jahrh. noch 19) Säulen stehen, daher das Vorgebirge
jetzt KapKolonnäs heißt; war seit 413 v. Chr. zum Schutz
der nach Athen bestimmten Getreideschiffe mit Mauern umgeben,
welche diese Landspitze zu einer Art Festung machten.
Sunn, s. v. w. Sunnhanf.
Sunna (arab., "Weg, Richtung"), die Tradition, welche auf
ein Wort oder eine That des Propheten Bezug hat und in solchen
Fällen als Gesetz gilt, wo der Koran sich entweder gar nicht
oder in zweideutiger Weise ausspricht. Später mehrfach
gesichtet und in besondern Büchern niedergelegt, bildet die S.
jetzt neben dem Koran die hauptsächlichste Religionsquelle
für den rechtgläubigen Moslem. Die berühmteste unter
den sechs anerkanntesten Sammlungen ist die von El Bochari um 840
n. Chr. unter dem Titel: "Eddschâmi essahîh"
("Zuverlässige Sammlung") veranstaltete, 7275
Überlieferungen enthaltend, welche Bochari aus einer Anzahl
von 600,000 als die am meisten beglaubigten ausgewählt hatte
(hrsg. von Krehl, Leiden 1862-72, 3 Bde.).
Sunnar (arab.), Ordensgürtel christlicher
Mönche, bei den Mohammedanern als Zeichen des Unglaubens
verpönt.
Sunnhanf (Madras-, Bombayhanf, ostindischer Hanf), die
Faser der über ganz Indien und die Sundainseln verbreiteten
und vielfach kultivierten Crotalaria juncea, wird in sehr roher
Weise zubereitet und hat deshalb, obwohl die Faser an und für
sich sehr fein ist, einen verhältnismäßig nur
geringen Wert. Das Handelsprodukt ist blaßgelblich, mit
lebhaftem Seidenglanz, und dem Hanf sehr ähnlich. Man benutzt
den S. zu Seilerwaren, Packtuch etc., in England auch zur
Papierfabrikation.
Sunniten, diejenigen Mohammedaner, welche neben dem Koran
die Sunna (s. d.) als Religionsquelle annehmen und die ersten
Kalifen, Abu Bekr, Omar und Othman, als rechtmäßige
Nachfolger Mohammeds anerkennen, während die Schiiten (s. d.)
diese Würde nur Ali und dessen Nachkommen beilegen. Das
geistliche Oberhaupt der S. unter dem Titel Kalif ist der
türkische Sultan. Zu ihnen gehören fast sämtliche
Moslems in Afrika, Ägypten, Syrien, der Türkei, in
Arabien und der Tatarei. Vgl. Mohammedanische Religion.
Süntel, Teil des Wesergebirges, nördlich von
Hameln, erreicht in der Hohen Egge 441 m Höhe.
Suomi, s. Finnische Sprache.
Suovetaurilia (lat.), das große Sühnopfer am
Schluß des Lustrum in Rom, wobei auf dem Marsfeld ein Schwein
(sus), ein Schaf (ovis) und ein Stier (taurus) geschlachtet
wurden.
Supan, Alexander, Geograph, geb. 3. März 1847 zu
Innichen in Tirol, studierte zu Graz, Wien, Halle und Leipzig,
wurde 1871 Realschullehrer in Laibach, habilitierte sich 1877 als
Privatdozent der Geographie an der Universität Czernowitz,
wurde 1880 Professor und siedelte 1884 nach Gotha über, wo er
seitdem die Redaktion von "Petermanns Mitteilungen" führt, um
welche er sich besonders durch die Begründung des
geographischen Litteraturberichts verdient machte. Er schrieb:
"Lehrbuch der Geographie für österreichische
Mittelschulen" (6. Ausl., Laib. 1888); "Studien über die
Thalbildung in den Tiroler Zentralalpen und in Graubünden" (in
den "Mitteilungen der Wiener Geographischen Gesellschaft" 1877) ;
"Statistik der untern Luftströmungen" (Leipz. 1881);
"Grundzüge der physischen Erdkunde" (das. 1884); "Archiv
für Wirtschaftsgeographie", 1. Teil: Nordamerika 1880-85 (als
Ergänzungsheft zu "Petermanns Mitteilungen" 1886).
Superarbitrium (lat.), ein Schiedsspruch oder Gutachten
höherer, bez. höchster Instanz.
Superb (lat.), stolz, prächtig, herrlich;
Superbiloquenz, Großsprecherei, übermütig stolze
Sprache.
Supercherie (franz., spr. ssupärsch'rih),
Überlistung, hinterlistiger Streich.
Superchloride, Superchlorüre, s. Chlormetalle.
Supercilia (lat.), Augenbrauen.
Superdividende (lat.), derüber den erwarteten oder
durch Zinsgarantie festgesetzten Betrag hinausgehende Teil der
Dividende (s. d.). Vgl. Aktie, S. 263.
Supererogationes, s. Opera supererogationis.
Superfizies (lat.), Oberfläche, in der Rechtssprache
dasjenige, was auf fremdem Grund und Boden erbaut oder auf solchem
gepflanzt ist. Der Regel nach erstreckt sich das Eigentum an dem
Grund und Boden auch auf die S. (superficies solo cedit). Ferner
wird mit S. (superfiziarisches Recht, Gebäuderecht, Baurecht,
Platzrecht) das erbliche und veräußerliche dingliche
Recht an einem auf fremdem Grund und Boden stehenden Gebäude
verstanden, vermöge dessen dem Berechtigten (Superfiziar)
während der Dauer des Rechts die Ausübung der Befugniffe
des Eigentümers zusteht. Der Entwurf eines deutschen
bürgerlichen Gesetzbuchs (§ 961 ff.) gebraucht statt
dessen die Ausdrücke Erbbaurecht und Erbbauberechtigter und
versteht unter Erbbaurecht das veräußerliche und
vererbliche Recht, auf oder unter der Oberfläche eines
Grundstücks ein Bauwerk zu haben. Hiernach gehört auch
das vererbliche und veräußerliche Kellerrecht mit zu dem
superfiziarischen Recht.
Superflua non nocent (lat., "das Überflüssige
schadet nicht"), besser zu viel als zu wenig.
Superfoecundatio (Superfoetatio) . s.
Überfruchtung.
Superga, La, die 10 km von Turin gelegene Grabeskirche
der Könige des Hauses Savoyen, welche König Amadeo I.
1717-37 durch Juvara in Form eines elliptischen Rundbaues mit
achtsäuliger Vor-
439
Superintendent - Suppé.
halle und hoher Kuppel auf einem 678 m hohen Berg erbauen
ließ.
Superintendent (lat.), Oberaufseher, Inspektor; besonders
in evangelischen Landeskirchen der erste Geistliche einer Ephorie,
welcher Wirksamkeit und Wandel der Geistlichen sowie die Verwaltung
der Kirchenärare etc. zu überwachen hat. Über
sämtlichen Superintendenten einer Provinz oder einer
Landeskirche steht der Generalsuperintendent. In
Süddeutschland wird der S. Dekan genannt.
Superior (lat.), der Obere, Vorsteher.
Superior City (spr. ssjupíhriör ssitti), Dorf
im nordamerikan. Staat Wisconsin, im Hintergrund des Obern Sees, 11
km von Duluth und eine der Kopfstationen der Nord-Pacificbahn,
schon 1854 gegründet, aber trotz seines guten Hafens mit nur
(1880) 655 Einwohnern.
Superiorsee (Lake Superior), s. Oberer See.
Superkargo, s. Kargo.
Superlativ (lat.), s. Komparation.
Supernaturalismus (Supranaturalismus, lat.), in der
Theologie im allgemeinen der Glaube an eine unmittelbare, der
natürlichen Vernunft, welche von der Sünde verfinstert
ist, durchaus unerreichbare Offenbarung Gottes. In dieser Form ist
er hauptsächlich durch Augustin begründet worden und
bildet den allgemeinen Schematismus für die gesamte
christliche, insonderheit für die altprotestantische Dogmatik,
der zufolge durch die Erbsünde alle moralische Kraft im
Menschen vernichtet, die Vernunft unfähig ist, in Sachen des
Heils (in rebus spiritualibus) zu entscheiden, und nur zur
Erfüllung der bürgerlichen Gerechtigkeit (justitia
civilis) hinreicht. Insbesondere wird mit dem Namen S. in der
Theologie diejenige Richtung bezeichnet, welche sich zu Ende des
vorigen und zu Anfang dieses Jahrhunderts gegenüber dem
Rationalismus (s. d.) konstituierte, mit welchem sie übrigens
die fehlerhafte Auffassung der Religion als einer gleichartigen
Fortsetzung des Welterkennens über die Schranken des
Sichtbaren hinaus teilte.
Supernumerarius (lat.), ein Überzähliger,
über die gewöhnliche (Beamten-) Zahl Angestellter.
Superoxyd, s. Oxyde.
Superphosphat, saurer phosphorsaurer Kalk, ein
Düngerpräparat, welches aus verschiedenen Rohmaterialien
mit hohem Gehalt an unlöslichem basisch phosphorsauren Kalk
dargestellt wird, indem man das letztere Salz durch Behandeln mit
Schwefelsäure in löslichen sauren phosphorsauren Kalk
überführt, wobei sich außerdem schwefelfaurer Kalk
(Gips) bildet. Bleibt hierbei wegen unzureichender
Schwefelsäure ein Teil des basischen Phosphats unzersetzt, so
bildet dies mit dem sauren Phosphat unlösliches neutrales
Phosphat; ähnlich wird auch bei Gegenwart von Thonerde und
Eisenoxyd ein Teil der Phosphorsäure wieder unlöslich
(Zurückgehen des Superphosphats), und da nun das Präparat
hauptsächlich durch seinen Gehalt an löslicher
Phosphorsäure Wert erhält, so sind von dessen Bereitung
eisenoxyd- und thonerdereiche Materialien auszuschließen, und
man muß hinreichend Schwefelsäure anwenden, um das
basische Phosphat vollständig in saures
überzuführen. Man verarbeitet auf S. namentlich
Knochenmehl, Knochenkohle, Knochenasche, Koprolithen, Phosphorit,
Baker- und Sombreroguano etc. und benutzt zum Aufschließen
derselben Kammersäure, Pfannensäure oder auch die
Schwefelsäure, welche bei der Bereitung des Nitrobenzols
zurückbleibt, oder solche, die zum Reinigen des Solaröls
gedient hat. 1 Teil Phosphorsäure erfordert zum
Aufschließen 1,72 Teile Schwefelsäure von 60° B.,
und reiner basisch phosphorsaurer Kalk gibt, mit solcher Säure
zersetzt, ein S. mit 25,6 Proz. löslicher Phosphorsäure.
Zur Vermischung der nötigen Falls staubfein zerkleinerten
Materialien mit der Säure benutzt man mit Blei ausgeschlagene
hölzerne Kasten oder gemauerte Behälter, oft unter
Anwendung eines mechanischen Rührwerkes, läßt dann
das Präparat liegen, bis es durch Bindung des Wassers
abgetrocknet ist, worauf es zerkleinert und gesiebt wird.
Namentlich bei Verarbeitung von Phosphoriten müssen die
Behälter mit einem hölzernen Mantel bedeckt werden, um
Dämpfe von Chlor- und Fluorwasserstoffsäure in die Esse
leiten zu können. Mineralische Phosphate werden viel leichter
aufgeschlossen, wenn man 7-10 Proz. der Schwefelsäure durch
Salzsäure ersetzt oder Kochsalz hinzufügt. Häusig
mischt man auch das S. mit stickstoffhaltigen Substanzen, wie
schwefelsaurem Ammoniak oder Chilisalpeter, ferner Horn, Leder,
Lumpen, welche gedämpft und dann gemahlen werden, auch mit
Leimbrühe vom Dämpfen der Knochen etc. Vgl. Marek,
Über den relativen Düngewert der Phosphate (Dresd.
1889).
Superporte (neulat., ital. soprapporto), ein über
einer Zimmerthür angebrachtes, mit dieser gleich breites, aber
niedriges Bild in Malerei, Stuck, Weberei etc.; besonders bei den
Dekorateuren des Barock- und Rokokostils beliebt.
Superrevision (lat.), nochmalige Prüfung.
Supersedeas (lat., "laß ab"), in England Befehl,
das Verfahren einzustellen.
Superstition (lat.), Aberglaube; superstitiös,
abergläubisch.
Supertara, s. Tara.
Suphan, Bernhard Ludwig , Literarhistoriker, geb. 18.
Jan. 1845 zu Nordhausen, studierte in Halle und Berlin
Altertumswissenschaft und veröffentlichte die
preisgekrönte Schrift "De Capitolio romano commentarius"
(1867), wandte sich dann aber dem Studium der deutschen Litteratur,
besonders des 18. Jahrh., zu und war in dieser Richtung ein
eifriger Mitarbeiter der "Preußischen Jahrbücher" und
des "Goethe-Jahrbuchs". Seit 1868 lebte er, im höhern Lehrfach
beschäftigt, in Berlin, bis er 1887 einem Ruf als Direktor des
Goethe-Archivs nach Weimar folgte. Große Verdienste hat sich
S. um die Wiedererweckung Herders erworben, von dessen
"Sämtlichen Werken" er eine kritische und mustergültige
Ausgabe in 33 Bänden (Berl. 1877 ff.) veranstaltete.
Supination (lat.), s. Pronation.
Supinum (lat.), in der lat. Sprache eine besondere Form
des Zeitwortes, eigentlich ein Verbalsubstantiv der vierten
Deklination, wovon jedoch nur zwei Kasus gebräuchlich sind.
Das S. auf um drückt den Zweck aus ("um zu"), das S. auf u den
Inhalt oder Betreff eines Adjektivums u. dgl. (schwer "zu" sagen).
Vgl. Jolly, Geschichte des Infinitivs im Indogermanischen
(Münch. 1874).
Suppé, Franz von, Komponist, geb. 18. April 1820
zu Spalato (Dalmatien), studierte auf der Wiener Universität,
um sich dem Staatsdienst zu widmen, folgte aber seiner
überwiegenden Neigung zur Musik und bildete sich unter Leitung
Seyfrieds in der Komposition aus. Später bekleidete er
nacheinander die Kapellmeisterstellen am Josephstädter
Theater, am Theater an der Wien und zuletzt am Carl-Theater u.
komponierte gleichzeitig Quartette, Ouvertüren, Symphonien,
Lieder und Operetten, von denen namentlich letztere wegen ihres
populären, gefälligen Wesens allgemeine Verbreitung
gefunden haben. Man könnte S. den "deutschen Offenbach"
nennen.
440
Suppeditieren - Surate.
jedoch ist er in seiner Musik gemütvoller als letzterer.
Die bekanntesten Operetten von S. sind: "Flotte Bursche", "Die
schöne Galathea", "Zehn Mädchen und kein Mann", "Franz
Schubert", "Fatinitza", "Boccaccio" und "Donna Juanita".
Suppeditieren (lat.), Unterstützung
gewähren.
Suppenkräuter, Kräuter, welche zum Würzen
der Suppen verwendet werden: Petersilie, Kerbel, Portulak,
Schnittlauch, junge Sellerieblätter, Sauerampfer, Spinat.
Suppentafeln, s. v. w. Bouillontafeln; auch Konserven,
welche neben löslichen Fleischbestandteilen
Hülsenfrüchte etc. enthalten.
Suppléant (franz., spr. ssüppleang),
Aushelfer, stellvertretender Ersatzmann, Substitut.
Supplement (lat.), Nachtrag, Ergänzung, besonders
Nachtrag zu einem Buch. In der Mathematik heißt S. eines
Winkels seine Ergänzung zu 180°, S. eines Bogens seine
Ergänzung zu einem Halbkreis. Zwei sphärische Dreiecke
heißen Supplementar- oder Polardreiecke, wenn die Seiten
eines jeden die Supplemente der Winkel des andern sind.
Supplementar, auch suppletorisch, s. v. w. ergänzend.
Supplicium (lat.), Todesstrafe.
Supplieren (lat.), ergänzen, ausfüllen; daher
Supplent, in Österreich s. v. w. Hilfslehrer.
Supplik (lat.), Bittschrift; Supplikant, derjenige, von
welchem eine solche ausgeht.
Supplikationen (lat.), bei den Römern
öffentliche Buß-, Dank- oder Betfeste, wobei in
feierlicher Prozession die Tempel der Götter besucht und an
diese Gebete gerichtet zu werden pflegten. Die Anordnung derselben
besorgten die Pontifices.
Süpplingenburg (Suplinburg), Pfarrdorf im
braunschweig. Kreis Helmstädt, an der Schunter, hat (1885) 574
Einw. Das alte Schloß S. ist das Stammhaus der Grafen von S.,
die schon zur Zeit Karls d. Gr. als eins der angesehensten
sächsischen Dynastengeschlechter erwähnt werden, und
denen Kaiser Lothar (1125-1137) angehörte.
Supplizieren (lat.), um etwas nachsuchen, bitten.
Supponieren (lat.), unterschieben, unterstellen.
Support (franz., spr. ssüppor. "Stütze,
Träger"), bei Drehbänken oder Hobelmaschinen die
Vorrichtung, durch welche das Werkzeug eine feste Stellung und
sichere Führung erhält.
Supposition (lat.), Annahme, Voraussetzung;
Unterschiebung, z. B. eines Testaments, eines Kindes etc.
Suppofitum (lat.), Unterlage, das Vorausgesetzte.
Supprimieren (lat.), unterdrücken; Suppression,
Unterdrückung; Verheimlichung.
Suppuratio (lat.), Eiterung.
Supputation (lat.), Überrechnung,
Überschlag.
Supralapsarii (lat.) , s. Infralapsarii.
Supranaturalismus, s. Supernaturalismus.
Suprasl, Flecken im russ. Gouvernement Grodno, am Flusse
S. (zum Bug), mit 2000 Einw. In der Nähe lag einst das
griechisch-kathol. Mönchskloster S., mit bedeutender
Bibliothek, wovon jetzt noch die Klosterkirche vorhanden ist.
Supremat (lat., "Obergewalt"), die päpstliche
Machtvollkommenheit, namentlich gegenüber den Bischöfen
(s. Primat). Supremateid (oath of supremacy) hieß in England
der ehedem von allen Parlamentsmitgliedern abzuleistende Eid, worin
der Krone die oberste Kirchengewalt zugesprochen, der katholische
Glaube und der Primat des Papstes negiert und die alleinige
Berechtigung der protestantischen Thronfolge ausgesprochen ward;
eingeführt von Heinrich VIII., 1791 wieder aufgehoben.
Süptitz, Dorf, 5 km westlich von Torgau, mit 769
Einw., war der Mittelpunkt der Schlacht bei Torgau (s. d.) 3. Nov.
1760.
Sur, Hafenstadt im asiatisch-türk. Wilajet Scharm,
am Mittelländischen Meer, nördlich von Akka, mit
Überresten des alten Tyros (darunter eine alte
Kreuzfahrerkirche, angeblich Barbarossas Grabstätte) und 5000
Einw.
Sura (Ssura), rechtsseitiger Nebenfluß der Wolga,
entsteht im Gouvernement Simbirsk, strömt nördlich durch
die Gouvernements Saratow, Pensa, Simbirsk und Kasan, hat teils
steile, teils flache Ufer und mündet bei Wassil im
Gouvernement Nishnij Nowgorod. Er ist 1038 km lang, von Pensa an
schiffbar und wird viel mit Flößen befahren.
Surabaja (Soerabaya), niederländ. Residentschaft an
der Nordküste der Insel Java, Madura gegenüber, 6029 qkm
(109,5 QM.) groß mit (1885) 1,856,635 Einw., darunter 7607
Europäer, 15,077 Chinesen und 2304 Araber, besteht
größtenteils aus fruchtbarem, von den Flüssen
Brantes und Solo bewässertem und gut kultiviertem Boden, der
Reis, Zucker, Kaffee und Baumwolle produziert. An der
Südostgrenze erhebt sich der Pananggungan zu 1685 m. Die
gleichnamige Hauptstadt an der Meerenge von Madura, durch Industrie
und Handel gleich bedeutend, hat einen schönen, durch zwei
Forts verteidigten Hafen, ein Seearsenal, Maschinenfabriken,
Werften, Metallgießereien, eine Kanonenbohrerei, 36
Zuckerfabriken, mehrere Möbelfabriken, eine Münze, ist
Sitz des obersten Gerichtshofs für die östlichen
Residenzien und der Kommandos für die östliche
Militärdivision sowie eines deutschen Konsuls und hat 127,403
Einw., worunter 6317 Europäer, 7436 Chinesen und 1443 Araber.
Eine Eisenbahn führt von S. nach Pasuruan und Malang, eine
andre über Surakarta und Samarang nach Dschokdschokarta.
Bedeutende Ausfuhr von Zucker, Kaffee, Häuten, Tabak,
Kapokwolle.
Surakarta (Solo), niederländ. Residentschaft auf der
Insel Java, 5677 qkm (113,1 QM.) groß mit (1885) 1,053,985
Einw., darunter 2694 Europäer und 7543 Chinesen. Das Land ist
zum Teil sehr gebirgig (höchste Spitzen auf der Ostgrenze der
3.269 m hohe Lawu, im W. der 3115 m hohe Merbabu und der 2806 m
hohe Merapi), zum Teil sehr fruchtbar und reich bewässert;
Hauptfluß ist der Solo. Die Residentschaft ist im Besitz des
Susuhanan, d. h. Kaisers, von S. und des Fürsten Paku Allam.
Diese haben gegen bedeutende Jahresgehalte ihre Rechte an die
niederländische Regierung abgetreten, welche einen Residenten
in der Hauptstadt S. (1880: 124,041 Einw.) unterhält, wo auch
die beiden genannten Fürsten wohnen. Die Stadt hat mit
Samarang, Dschokdschokarta und Surabaja Eisenbahnverbindung.
Surash (Ssurash), 1) Kreisstadt im russ. Gouvernement
Tschernigow, am Iput, mit (1886) 4825 Einw. Im Kreis lebhafte
Tuchfabrikation und Strumpfwirkerei. -
2) Stadt im russ. Gouvernement Witebsk, an der Düna, mit
(1885) 5085 Einw., wurde 1564 auf Befehl des polnischen Königs
Siegmund August aus strategischen Rücksichten erbaut und
diente namentlich als Festung an der Düna zum Schutz
Weißrußlands gegen das Moskowiterreich.
Surate, Distriktshauptstadt in der britisch-ind.
Präsidentschaft Bombay, 22 km von der Mündung des Tapti,
hat (1881) 109,844 Einw., lebhaften Handel sowie eine evangelische
Mission und war der erste Ort an der Westküste, wo 1612 die
Englisch-Ostindische Kompanie eine Faktorei und Citadelle
anlegte.
441
Surbiton - Surrogat.
Surbiton (spr. ssörbit'n), Stadt in der engl.
Grafschaft Surrey, an der Themse, dicht bei Kingston, hat
zahlreiche Landsitze und (1881) 9406 Einw.
Surburg, Flecken im deutschen Bezirk Unterelsaß,
Kreis Weißenburg, im N. des Hagenauer Waldes und an der
Eisenbahn Straßburg-Weißenburg, hat eine kath. Kirche,
Wollspinnerei, 2 Mühlen und (1885) 1298 Einw. Nahebei ein
Oratorium an der Stelle, wo der heil. Arbogast im 7. Jahrh. als
Einsiedler wohnte, bevor er Bischof von Straßburg wurde.
Surcot (franz., spr. ssürkoh, auch Surcotte), s. v.
w. Cotte-hardie.
Surdität (lat.), s. v. w. Taubheit.
Sure (arab.), Bezeichnung der einzelnen Kapitel des
Korans, welche angeblich durch den Engel Gabriel an Mohammed
gesondert abgeliefert worden sind. Jede S. zerfällt in mehrere
Ajes (Koransätze).
Sure (spr. ssühr), Fluß, s. Sauer.
Surenen, Hochgebirgspaß im östlichen
Flügel der Berner Alpen (2305 m), zwischen Uri-Rothstock und
Titlis, beginnt im Unterwaldner Thal Engelberg (1010 m) und senkt
sich mit steilem Abstieg zum Urner Reußthal (Attinghausen,
451 m ü. M.).
Surenrinde, s. Cedrela.
Suresnes (spr. ssürähn), Flecken im franz.
Departement Seine, Arrondissement St.-Denis, an der Seine,
über welche vom Boulogner Wäldchen eine Brücke
herüberführt, am Fuß des Mont Valérien und
an der Bahnlinie Paris-St.-Cloud-Versailles , mit Villen,
Bleicherei, Färberei und Druckerei und (1886) 7683 Einw.
Surettahorn, Berggipfel, s. Err, Piz d'.
Surgères (spr. ssürschähr), Stadt im
franz. Departement Niedercharente, Arrondissement Rochefort, an der
Eisenbahn Niort-La Rochelle, hat ein altes Schloß, eine
interessante Kirche, Geldschrankfabrikation, Branntweinbrennerei
und (1881) 3203 Einw.
Surinam, Küstenfluß im holländ. Guayana,
mündet unterhalb Paramaribo und ist in der Küstenebene
für große Boote schiffbar.
Surinam, Land, s. v. w. Niederländisch-Guayana, s.
Guayana, S. 895.
Surja, in der wed. Mythologie die Personifikation der
Sonne, der Sonnengott. Er fährt auf einem goldenen Wagen mit
drei Sitzen und drei Rädern, den die kunstfertigen Ribhu, die
sich mit den Zwergen der nordischen und deutschen Sage vergleichen
lassen, geschaffen haben. Er schaut auf Recht und Unrecht bei den
Menschen, behütet den Gang der Frommen und beachtet das
Treiben eines jeden. In den wedischen Liedern wird seine
Thätigkeit unter verschiedenen Namen gepriesen, die vielleicht
ursprünglich die Sonnengötter verschiedener Stämme
bezeichneten.
Surlet de Chokier (spr. ssürlä d' schockjeh),
Erasmus Louis, Baron, belg. Staatsmann, geb. 27. Nov. 1769 zu
Lüttich, war unter der französischen Regierung Maire in
Ginglom bei St.-Trond, 1800-1812 Mitglied des Großen Rats,
dann des Gesetzgebenden Körpers und nach der Bildung des neuen
Königreichs der Niederlande durch königliche Wahl
Mitglied der Zweiten Kammer. 1818 durch die Regierung entlassen,
ward er in der Provinz Limburg wieder gewählt und gehörte
von 1828 bis 1830 zu den hervorragendsten Mitgliedern der
Opposition. Nach dem Ausbruch der belgischen Revolution begab er
sich mit den übrigen Abgeordneten der südlichen Provinzen
nach dem Haag, bestand jedoch auf Trennung beider Länder
hinsichtlich der Verwaltung, ward zum Abgeordneten des
Nationalkongresses erwählt, im November 1830 Präsident
desselben und, als der Herzog von Nemours die Krone ausschlug, 26.
Febr. 1831 provisorischer Regent von Belgien. Nachdem der Prinz
Leopold 21. Juli 1831 seinen Einzug in Brüssel gehalten, legte
S. seine Gewalt in die Hände des Präsidenten des
Kongresses nieder. Er lebte seitdem zurückgezogen in Ginglom
und starb 7. Aug. 1839. Vgl. Juste, Surlet de Chokier (Brüssel
1865).
Surmulet, s. Seebarbe.
Surnia, s. Eulen, S. 905.
Surone, Gewicht in Santo Domingo, à 100 Libra = 46
kg; in Mittelamerika à 150 Libra = 69 kg; s. auch
Seronen.
Surplus (franz., spr. ssürplüh),
Überschuß, Rest; im Handel auch s. v. w. Deckung (s.
d.).
Surrah, Stadt, s. Mogador.
Surre (arab.), die auf Kosten der türkischen
Regierung ausgerüstete, unter Leitung des S.-Emini stehende
Karawane, welche die vom Sultan und den Landesgroßen für
die Kaaba und die heilige Stadt Mekka bestimmten Geschenke
alljährlich befördert.
Surrey (spr. ssörri), engl. Grafschaft zwischen den
Grafschaften Middlesex, Kent, Sussex, Southampton und Berks, hat
1963 qkm (35,6 QM.) Areal mit (1881) 1,436,899 Einw., wovon 980,522
auf London kommen. Die Grafschaft ist zum größten Teil
fruchtbares Hügelland; die Mitte wird von Kreidehügeln
(Downs) durchzogen, der hügelige Süden kulminiert im
Leith Hill (303 m). Nördlich bildet die Themse die Grenze und
nimmt hier den Wey und Mole auf. Ackerbau und Viehzucht bilden die
Haupterwerbszweige der außerhalb Londons lebenden Einwohner.
Außer Getreide werden namentlich Hopfen und Gemüse
gezogen. 32,2 Proz. der Oberfläche sind unter dem Pflug, 29,2
Proz. bestehen aus Wiesen. 1888 zählte man 13,057 Ackerpferde,
45,864 Rinder, 81,982 Schafe und 25,238 Schweine. Hauptstadt ist
Guildford.
Surrey (spr. ssörri), Henry Howard, Earl of, engl.
Dichter, geb. 1517 zu Kenning Hall in Suffolk, ältester Sohn
des Herzogs von Norfolk, trat 1540 in den Kriegsdienst und
befehligte bereits 1544 das englische Heer als Feldmarschall auf
dem Zug nach Boulogne, ward aber dann von dem argwöhnischen
König Heinrich VIII. ohne allen Grund des Hochverrats
angeklagt und trotz seiner männlichen und begeisterten
Selbstverteidigung 21. Jan. 1547 im Tower zu London enthauptet. S.
war seit Chaucer der erste bedeutendere Dichter der Engländer.
Seine Gedichte sind selbständige Nachahmungen Petrarcas,
weniger durch hohen Flug der Phantasie als durch Anmut und Zartheit
sowie durch Reinheit und Eleganz der Sprache ausgezeichnet; unter
ihnen stehen die Liebesgedichte an Geraldine (nach H. Walpole
wahrscheinlich die noch sehr jugendliche Lady Elizabeth Fitzgerald)
obenan. S. führte das Sonett und die ungereimten
fünffüßigen Jamben in die englische Sprache ein.
Auch vermied er die vielen Latinismen seiner Vorgänger aus der
Schule Chaucers und Dunbars. Seine "Songs and sonnets" erschienen,
mit denen seines Freundes Thomas Wyatt u. a., zuerst 1557 u.
öfter; eine neue Ausgabe besorgte Bell (1871).
Surrogat (lat.), Ersatzmittel, besonders für einen
Rohstoff oder ein Fabrikat, welches meist der Wohlfeilheit halber
Anwendung findet und möglichst annähernd die
Eigenschaften der Substanz besitzen soll, welche es zu ersetzen
bestimmt ist. Häufig ist die Anwendung von Surrogaten durch
die Verhältnisse geboten, weil der ursprünglich
angewandte Rohstoff zu teuer geworden oder überhaupt nicht in
genügender Quantität zu beschaffen ist (Anwendung von
Esparto, Holzstoff etc. statt Hadern in der Papierfabrikation),
442
Sursee - Susdal.
in der Regel aber bedeutet die Anwendung von Surrogaten eine
Verminderung der Qualität des Fabrikats (wie in dem
angeführten Beispiel Surrogierung der Hadern durch Thon,
Schwerspat etc., der Wolle durch Kunstwolle, des Malzes durch
Stärkezucker, Glycerin) und oft geradezu eine Fälschung.
Insofern aber Surrogate immer Ersatzmittel sind, dürfen sie
doch nicht mit den Fälschungsmitteln verwechselt werden.
Gefärbte Steinchen in Kleesaat sind kein S. der Kleesaat, denn
sie sind völlig wertlos, während z. B. Kaffeesurrogate,
wie Zichorie, Runkelrübe, Getreide, Hülsenfrüchte,
zwar nicht den Kaffee ersetzen können, wohl aber wie dieser
ein Getränk liefern, welches in mancher Hinsicht dem Kaffee
ähnlich ist. Aber auch diese Surrogate werden
Fälschungsmittel, wenn der Händler sie gemahlenem Kaffee
beimischt und die Mischung als Kaffee verkauft.
Surfee, Bezirkshauptstadt im schweizer. Kanton Luzern, am
Sempacher See, unweit der Bahnlinie Olten-Luzern, mit (1888) 2135
Einw.
Sursum (lat.), aufwärts, empor; S. corda! Empor die
Herzen! im katholischen Kult Aufforderung an das Volk, welches
darauf antwortet: Habemus ad dominum, d. h. wir haben sie zu dem
Herrn (gerichtet).
Surtaxe (frz., spr. ssürtax), Nachsteuer,
Steuerzuschlag, insbesondere Zollzuschlag (im Gegensatz zu Detaxe,
Zollherabsetzung). Über S. d'entrepôt und S. de pavillon
s. Zuschlagszölle.
Surtout (franz., spr. ssürtuh), Überrock,
Überzieher, kam gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts in
Gebrauch und wurde später, ähnlich dem englischen
Reitrock, mit mehreren übereinander hängenden
Schulterkragen versehen; dann ein größerer, mit
Blumenvasen und Fruchtschalen geschmückter Tafelaufsatz aus
Silber oder Kristall.
Surtur, in der nord. Mythologie ein Riese, welcher, mit
glühendem Schwert bewaffnet, in Muspelheim als
unversöhnlicher Feind der Asen herrscht und beim Weltuntergang
eine große Rolle spielt; s. Götterdämmerung.
Surukuku, Schlange, s. Lachesis.
Surville (spr. ssürwill), Clotilde de, geb. 1405 zu
Vallon in Languedoc, wurde lange für die Verfasserin einer
1803 von Vanderburg herausgegebenen Sammlung sehr graziöser
Gedichte, meist lyrischen Inhalts, gehalten; aber Anachronismen in
Form und Inhalt machen es wahrscheinlich, daß dieselben von
Jos. Etienne de S. herrühren, der 1798 wegen royalistischer
Umtriebe erschossen wurde, und welcher sich durch diese
Mystifikation für die Verschmähung seiner Poesien am
Publikum rächen wollte. Auch Nodier mißbrauchte den
Namen der S. ("Poésies inédites de C. de S.", 1826).
Vgl. Vaschalde, C. de S. et ses poésies (Valence 1873);
König, Étude sur l'au- thenticité des
poésies de Clotilde de S. (Halle 1875).
Survilliers (spr. ssürwiljeh), Graf von, der von
Joseph Bonaparte (s. d. 1, S. 183) 1815 angenommene Name.
Sus (lat.), Schwein.
Süs, Gustav, Maler, geb. 10. Juni 1823 zu Rumbeck in
Kurhessen, widmete sich auf der Kasseler Akademie, später im
Städelschen Institut in Frankfurt a. M. bei Professor
Passavant und Jakob Becker der Malerei. Um seine Existenz zu
fristen, schrieb er Kindermärchen, die er selbst illustrierte.
Sie fanden großen Beifall und wurden zum Teil ins Englische
und Französische übersetzt. Hervorzuheben sind: "Der
Kinderhimmel" , "Hähnchen und Hühnchen", "Der Wundertag",
"Das Kind und seine liebsten Tiere", "Was der Nußbaum
erzählt", "Das Wettlaufen zwischen dem Hasen und Igel",
"Froschküster Quack" u. a. Von 1848 bis 1850 malte er in der
Heimat Studien und Porträte. Seitdem lebte er in
Düsseldorf, wo er noch ein Jahr die Akademie besuchte. Hier
machte er die Darstellung von Tieren, namentlich Geflügel, zu
seiner Hauptaufgabe. Manche seiner trefflichen Bilder, die meist
von einem humoristischen Grundgedanken ausgehen, sind durch
Farbendruck und Photographie weit verbreitet, wie: der erste
Gedanke und die Kükenpredigt. Er starb 23. Dez. 1881.
Sufa (Schuschan, "Lilienstadt", heute Ruinen Sûs),
Hauptstadt der altpers. Provinz Susiana, seit Kyros Winterresidenz
der persischen Könige, lag mitten im Land zwischen den
Flüssen Choaspes (Kercha) und Kopratas (Dizful Rud) und hatte
eine stark befestigte Burg, welche den königlichen Palast und
eine Hauptschatzkammer der persischen Könige enthielt. In ihr
feierten Alexander und seine Feldherren ihre Vermählung mit
Perserinnen. Dareios, Xerxes und ihre Nachfolger bis auf Artaxerxes
II. haben nach den dort gefundenen Inschriften die Prachtsäle
erbauen lassen, in deren Trümmern seit 1850 von Williams,
Loftus und Churchill, neuerdings (seit 1885) von Dieulafoy gegraben
worden ist. Vgl. Oppert, Les inscriptions susiennes (Par. 1873);
Dieulafoy, L'acropole de Suse (das. 1888).
Susa, Kreishauptstadt in der ital. Provinz Turin, an der
Dora Riparia, der Mont Cenisstraße und durch die Zweiglinie
Bussoleno-S. mit der Mont Cenisbahn verbunden, ist Sitz eines
Bischofs und eines Hauptzollamts, hat eine Kathedrale (aus dem 11.
Jahrh.), ein Gymnasium, eine technische und eine Notariatsschule,
starken Obst- und Weinbau, Industrie in Eisen, Leder und Seide und
(1881) 3305 Einw. S. ist das römische Segusio. Dabei die
Ruinen des Stammschlosses der Markgrafen von S., das Fort La
Brunette und ein dem Augustus 8 v. Chr. vom König Cottius
errichteter Triumphbogen.
Susandschird (arab.), Nadelmalerei, die älteste, in
Persien geübte Art der Teppichfabrikation, bei welcher die
Fäden nicht mit den Händen geknüpft, sondern mit der
Nadel zu einem Gewebe verarbeitet wurden. Vgl. Karabacek, Die
persische Nadelmalerei S. (Leipz. 1881).
Susanna, Hebräerin zu Babylon, die nach dem
apokryphischen Buch "Historie von S. und Daniel" von zwei
Ältesten aus Israel, die sie vergebens zu verführen
gesucht, des Ehebruchs mit einem Unbekannten angeklagt und zum Tod
verurteilt, im letzten Augenblick aber durch die Eingebung und den
Scharfsinn des jungen Daniel, den spätern Propheten, errettet
wurde. Ihre Geschichte wurde namentlich im 16. Jahrh. vielfach
dramatisch behandelt, so in dem an zahlreichen Orten gegebenen
Magdeburger "Schönen Spiel von der S." (1534), von P. Rebhuhn
(1534), v. Bartfelt (1559), Nik. Frischlin (1589), Herzog Heinrich
Julius von Braunschweig (1593), Hans Sachs (1557) u. a., in
neuester Zeit von K. L. Werther (1855). Vgl. Brüll, Das
apokryphische Susannabuch (Frankf. 1877); Pilger, Die
Dramatisierungen der S. im 16. Jahrhundert (Halle 1879).
Suscipere et finire (lat.), "beginnen und zu Ende
führen", Wahlspruch des Hauses Hannover.
Suscitieren (lat.), erregen, aufmuntern; Suscitation,
Erweckung, Ermunterung.
Susdal (Ssusdal), Kreisstadt im russ. Gouvernement
Wladimir, hat 25 griechisch-russ. Kirchen, 4 Klöster,
bedeutende Baumwollweberei, Gemüsebau und (1885) 6668 Einw.
S., schon 1024 erwähnt, war bis 1170 Hauptstadt eines
Fürstentums (s. Wladi-
443
Susemihl - Sussex.
mir, Gouvernement) und kann als die Wiege des nachmaligen Staats
Moskau betrachtet werden. Die Stadt wurde mehrmals von den Tataren
zerstört.
Susemihl, Franz, namhafter Philolog, geb. 10. Dez. 1826
zu Laage in Mecklenburg-Schwerin, studierte 1845-48 zu Leipzig und
Berlin, wirkte als Lehrer in Güstrow und Schwerin,
habilitierte sich 1852 in Greifswald und wurde daselbst 1856
außerordentlicher, 1863 ordentlicher Professor der
klassischen Philologie. Seine Hauptwerke sind: "Die genetische
Entwickelung der Platonischen Philosophie" (Leipz. 1855-60, 2
Bde.); "Aristoteles über die Dichtkunst" (griech. und deutsch,
das. 1865, 2. Aufl. 1874); "Aristotelis Politicorum libri VIII cum
vetusta translatione G. de Moerbeka" (das. 1872); "Aristoteles'
Politik" (griech. und deutsch, das. 1879, 2 Bde.); ferner zu
Aristoteles Textausgaben der "Ethica Nicomachea" (das. 1880), der
"Magna Moralia" (das. 1883), der "Ethica Eudemia" (das. 1884), der
"Oeconomica" (das. 1887). Außerdem hat er mehrere Platonische
Dialoge übersetzt und zahlreiche Abhandlungen, besonders
über die alten Philosophen, geschrieben.
Susiana, altpers. Landschaft, am Persischen Meerbusen
zwischen Medien, Persis und Babylonien gelegen, das jetzige
Chusistan, wurde vom Choaspes (Kercha), Euläos (Kuren) und
Kopratas (Dizful Rud) bewässert und von den Kossäern,
Elymäern, Susianern und Uxiern bewohnt. Hauptstadt war Susa.
S. Karte "Reich Alexanders d. Gr.".
Suso (Seuse), Heinrich, Mystiker, geb. 1295 zu
Überlingen, nannte sich nach der Mutter (der Vater war ein
Herr v. Berg), studierte in Köln Theologie und widmete sich
seit 1308 in einem Kloster zu Konstanz einem streng asketischen
Leben mit schweren Kasteiungen, durchzog, 40 Jahre alt, Schwaben,
gewann in den Frauenklöstern vielen Anhang und lebte etwa seit
1348 in Ulm, wo er 1366 starb. Sein Hauptwerk ist das "Buch von der
ewigen Weisheit". Seine Mystik zeigt weder reformatorische
Tendenzen noch selbständige Spekulation, doch ist er wegen des
Vorwiegens des sinnig-poetischen Elements als "Minnesinger in Prosa
und auf geistlichem Gebiet" bezeichnet worden. Seine Werke (zuerst
Augsb. 1482 u. 1512) wurden von Diepenbrock (4. Aufl., Regensb.
1884) und von Denifle (deutsche Schriften, Augsb. 1878-80) neu
herausgegeben. Vgl. Preger, Die Briefe Heinrich Susos (Leipz.
1867); Denifle in der "Zeitschrift für deutsches Altertum"
(1875); Preger (das. 1876); Derselbe, Geschichte der deutschen
Mystik, Bd. 2 (Leipz. 1882).
Suspekt (lat.), verdächtig.
Suspendieren (lat.), zeitweilig aufheben, einstellen;
zeitweilig außer Wirksamkeit, Amtstätigkeit setzen.
Suspension (lat.), Dienstenthebung (s. Disziplinargewalt,
S. 5).
Suspensiv (lat.), aufschiebend; daher suspensive
Rechtsmittel, solche, welche den Eintritt der Rechtskraft eines
Urteils und die zwangsweise Vollstreckung desselben verhindern;
Suspensivbedingung, eine aufschiebende Bedingung, von welcher der
Beginn eines Rechtsverhältnisses abhängt.
Suspensorium (lat., Tragbeutel), Verbandstück,
vorzüglich eine gewisse Art von Tragbinden, bestimmt, einen
hängenden Teil des Körpers in einer gewissen Höhe zu
halten und zu tragen, wird besonders angewendet bei
Entzündungen des Hodensacks und der Hoden sowie der weiblichen
Brust.
Suspicion (lat.), Verdacht, Argwohn; suspiciös,
argwöhnisch, mißtrauisch.
Susquehanna, der Hauptstrom des nordamerikan. Staats
Pennsylvanien, entsteht aus zwei Quellflüssen, von denen der
östliche aus dem Otsegosee im Staat New York kommt,
während der westliche auf dem Alleghanygebirge in
Pennsylvanien entspringt. Nach der Vereinigung beider (bei Sunbury)
strömt der Fluß südlich, dann südöstlich
und fällt bei Havre de Grace im Staat Maryland in die
Chesapeakebai des Atlantischen Ozeans. Seine bedeutendsten
Nebenflüsse sind: der Chenango, Tioga und Juniata. Der S. hat
mehrere Wasserfälle und Stromschnellen, richtet oft
große Überschwemmungen an, wird aber im Sommer
öfters ziemlich seicht und hat daher ungeachtet seines 650 km
langen Stromlaufs und 62,000 qkm großen Stromgebiets als
Wasserstraße nur eine geringe Bedeutung; doch begleiten
denselben fast seiner ganzen Länge nach schiffbare
Kanäle.
Sueß, Eduard, Geolog, geb. 20. Aug. 1831 zu London,
studierte in Prag und Wien, wurde 1852 Assistent am
Hofmineralienkabinett zu Wien, erhielt 1857 die Professur der
Geologie daselbst, war 1863 bis 1873 Mitglied des Wiener
Gemeinderats und Referent der Wasserversorgungskommission, wurde
1869 Mitglied des niederösterreichischen Landtags, 1870-74
Mitglied des Landesausschusses und als solcher mit der
tatsächlichen Durchführung der neuen
Volksschulgesetzgebung in Niederösterreich beschäftigt.
1873 in den Reichsrat gewählt, bewährte er sich als
glänzender Redner der Linken, namentlich in dem Kampf gegen
den Ultramontanismus. Er schrieb : "Böhmische Graptolithen"
(Wien 1852); "Brachiopoden der Kössener Schichten" (das.
1854); "Brachiopoden der Hallstätter Schichten" (das. 1855);
"Der Boden der Stadt Wien" (das. 1862); "Über den
Löß" (das. 1866); "Charakter der österreichischen
Tertiärablagerungen" (das. 1866, 2 Hefte); "Äquivalente
des Rotliegenden in den Südalpen" (das. 1868); "Lagerung des
Steinsalzes von Wieliczka" (das. 1868); "Die tertiären
Landfaunen Mittelitaliens" (das. 1871); "Bau der italienischen
Halbinsel" (das. 1872); "Erdbeben des südlichen Italien" (das.
1874); "Der Vulkan Venda bei Padua" (das. 1875); "Die Entstehung
der Alpen" (das. 1875); "Die Zukunft des Goldes" (das. 1877) und
als Hauptwerk "Das Antlitz der Erde" (1883-88, Bd. 1-2), in welchem
er namentlich für die Lehre von der Gebirgsbildung neue Bahnen
eröffnete.
Sussanin, Iwan, ein Bauer aus Kostroma, soll 1613 dem
Zaren Michail Romanow das Leben gerettet haben, als die Polen
demselben nachstellten, verlor aber dabei das Leben; seine
Nachkommen erhielten allerlei Vorrechte (s. Belopaschzen). Er ist
der Held von Glinkas Oper "Das Leben für den Zaren".
Kostomarow wies die Unzuverlässigkeit der historischen
Tradition in betreff Sussanins nach.
Süßbohne, s. v. w. Apios tuberosa.
Süßerde, s. v. w. Berylliumoxyd, s.
Beryllium.
Süßer See, s. Salziger See.
Sussex (spr. ssöss-) engl. Grafschaft zwischen den
Grafschaften Kent, Surrey und Hampshire, mit 3777 qkm (68,6 QM.)
Areal und (1881) 490,505 Einw. Die Kreidehügel der Southdowns
mit dem 269 m hohen Butser Hill durchziehen die Grafschaft von W.
nach O. und endigen, allmählich der Küste
nähertretend, im steilen Beachy Head. Nördlich von diesem
Weideland liegt der Bezirk der Wealds und Forest Hills, früher
mit ausgedehnten Waldungen bedeckt. Der Strich längs der
Küste ist meist eben und ungemein fruchtbar. Die wichtigsten
Flüsse sind: Arun, Adur-Ouse und Rother. Viehzucht und
Ackerbau sind Haupt-
444
Sussex - Süßwasserformationen.
erwerbszweige. Von der Oberfläche bestehen 35,5 Proz. aus
Ackerland, 37,3 aus Wiesen u. 16 Proz. aus Wald; 1888 zählte
man 24,789 Ackerpferde, 105,470 Rinder, 476,986 Schafe und 42,501
Schweine. Die Industrie ist ohne Bedeutung. Die Eisengewinnung hat
seit 1809 aufgehört. Hauptstadt ist Lewes. - S. war der
Landungsplatz der meisten Völker, welche England heimsuchten.
Julius Cäsar landete bei Pevensey, der Angelsachse Ella unfern
Chichester; letzterer gründete 477 das Reich Suth - sex
("Südsachsen"), welches 688 an Wessex fiel; Wilhelm der
Eroberer erkämpfte hier den Sieg von Hastings (1066).
Sussex (spr. ssöss-) Augustus Frederick, Herzog von,
sechster Sohn Georgs III. von England, geb. 27. Jan. 1773,
studierte zu Göttingen, hielt sich dann vier Jahre in Rom auf
und heiratete daselbst im April 1793 Augusta Murray, die Tochter
des katholischen Grafen von Dunmore in Schottland. Wiewohl er dabei
seinen Familienrechten entsagt hatte, erklärte doch Georg III.
auf Grund eines Hausgesetzes der englischen Dynastie diese ohne
seine Erlaubnis geschlossene Ehe für ungültig. Nachdem
sich der Prinz 1801 von seiner Gemahlin, welche ihm zwei Kinder,
die den Namen Este (s. d.) erhielten, geboren, getrennt hatte,
wurde er 1801 zum Peer von England mit dem Titel eines Herzogs von
S., Grafen von Inverneß und Baron von Arklow ernannt. Im
Parlament hielt er sich meist zur Oppositionspartei und wirkte im
liberalen Sinn für die Emanzipation der Katholiken, die
Abschaffung des Sklavenhandels, die Parlamentsreform etc. Obgleich
auf den Genuß seiner Apanage beschränkt, sammelte er
doch eine besonders an Ausgaben und Übersetzungen der Bibel
sowie an Handschriften sehr reichhaltige Bibliothek, welche Th.
Jos. Pettigrew (Lond. 1827, 2 Bde.) beschrieben hat. Auch war er
eine Zeitlang Präsident der königlichen Gesellschaft der
Wissenschaften. Nach dem Tod seiner ersten Gemahlin heiratete er
1831 gleichfalls ohne königliche Genehmigung Lady Cecily
Underwood, Tochter des irischen Grafen von Arran, Witwe von Sir
George Buggin, die 1840 zur Herzogin von Inverneß erhoben
wurde. Er starb 21. April 1843 im Kensingtonpalast.
Süßgras, s. Glyceria.
Süßgräser, s. v. w. Gramineen, s.
Gräser.
Süßholz, Pflanzengattung, s. v. w.
Glycyrrhiza; indisches oder amerikanisches S., s. Abrus; wildes S.,
s. v. w. Astragalus glycyphyllus oder Polypodium vulgare.
Süßholzpasta, s. Lederzucker.
Süßholzsaft, s. Lakritzen.
Süßklee, s. v. w. Esparsette, s.
Onobrychis.
Sußmann-Hellborn, Louis, Bildhauer, geb. 20.
März 1828 zu Berlin, war daselbst fünf Jahre lang
Schüler von Wredow, studierte von 1852 bis 1856 in Rom, machte
dann längere Reisen und ließ sich 1857 in Berlin nieder,
wo er unter anderm von 1882 bis 1887 als artistischer Leiter der
königlichen Porzellanmanufaktur fungierte. Auf einen schon in
Rom entstandenen trunkenen Faun (1856, Nationalgalerie in Berlin)
folgten andre Genre- und mythologische Gestalten, z. B. eine
haarflechtende Italienerin, ein Amor in Waffen, eine verlassene
Psyche und ein Knabe als Kandelaberträger. Später wandte
er sich auch der monumentalen Porträtstatue zu und schuf das
Marmorstandbild eines jugendlichen Friedrich d. Gr. (1862) für
das Rathaus in Breslau und einen schon bejahrten Friedrich d. Gr.
(1869) sowie Friedrich Wilhelm III. für das Rathaus in Berlin,
eine 1878 enthüllte Bronzestatue Friedrichs d. Gr. für
die Stadt Brieg und die sitzenden Statuen von Hans Holbein und
Peter Vischer für das Kunstgewerbemuseum in Berlin, zu dessen
Begründern er gehört. Unter seinen Genrefiguren der
spätern Zeit sind noch ein Fischer mit der Laute, der
Volksgesang und Dornröschen (in der Berliner Nationalgalerie)
hervorzuheben.
Süßmayer, Franz Xaver, Komponist, geb. 1766 zu
Steyr, erhielt seine Ausbildung als Zögling der
Benediktinerabtei zu Kremsmünster sowie später in Wien
durch Mozart und Salieri, wurde 1792 zweiter Kapellmeister am
dortigen Hoftheater und starb als solcher 7. Sept. 1803 mit
Hinterlassung zahlreicher, zu seiner Zeit geschätzter Vokal-
und Instrumentalwerke. Mit Mozart intim befreundet, erhielt er kurz
vor dessen Tod von ihm den Auftrag, einige Arien zur Oper "Titus"
zu vollenden; auch gab er nach Mozarts Tode dem berühmten
"Requiem" desselben den vollständigen Abschluß, indem er
einzelnes in der Instrumentation, was Mozart nur angedeutet hatte,
ausführte und die erste Fuge: "Kyrie", auf die Worte: "cum
sanctis tuis in aeternum" wiederholte und zum Schlußchor des
Werkes machte.
Süßmilch, Name für eine Abart des
Pharospiels, welches sich vom eigentlichen Pharo dadurch
unterscheidet, daß keiner der Spieler ein eignes "Buch"
bekommt, dagegen ein Buch offen auf den Tisch gebreitet wird, von
dessen 13 Blättern jeder Spieler eins beliebig besetzt.
Süß Oppenheimer, Joseph, berüchtigter
württemberg. Finanzminister, ein Jude, geb. 1692 zu
Heidelberg, widmete sich dem Handelsstand und trat durch
verschiedene Geldgeschäfte mit dem Herzog Karl Alexander von
Württemberg in Verbindung, der ihm erst die Direktion des
Münzwesens übertrug und ihn endlich bis zum Geheimen
Finanzrat und Kabinettsminister erhob. Als solcher besetzte S. alle
Stellen mit seinen Kreaturen, ließ 11 Mill. Gulden falsches
Geld prägen, errichtete ein Salz-, Wein- und Tabaksmonopol,
verkaufte um große Summen Privilegien, zog eine große
Menge Juden ins Land und drückte das Volk mit Abgaben aller
Art. Durch dies alles zog er den allgemeinen Haß auf sich,
und nach dem Tode des Herzogs (12. März 1737) wurde er
verhaftet, vor ein Gericht gestellt und als Staatsverbrecher in
seinem Staatsgewand 4. Febr. 1738 in einem besondern Käfig
aufgehängt. Hauff machte sein Leben zum Gegenstand einer
Novelle ("Jud Süß"). Vgl. Zimmer, Joseph S. (Stuttg.
1873).
Süßwasser, das reine Quellwasser und die aus
diesem sich bildenden Bäche, Flüsse, Teiche, Seen etc.,
im Gegensatz zu dem salzigen Wasser der Meere, einzelner Salzseen
und der Solquellen. Charakteristisch ist nicht sowohl das
gänzliche Fehlen als der sehr geringe Gehalt (z. B. im
Rheinwasser 0,14 Teile Chlornatrium in 10,000 Teilen Wasser) an
Salzen, besonders Chlornatrium.
Süßwasserformationen, in der Geologie
Ablagerungen, die aus ihren organischen Resten schließen
lassen, daß sie aus Süßwasser sich niederschlugen.
Die Reste der Bewohner von süßem Wasser müssen in
solchen Ablagerungen entschieden vorherrschen und sichere Anzeichen
an sich tragen, daß sie keinem weitern Transport unterlegen
sind, da Süßwasserformen jedenfalls häufiger in die
See als umgekehrt Seebewohner in süßes Wasser
eingeschwemmt werden. Reine S. sind für jüngere
Formationen charakteristisch und reichen vermutlich nicht über
die Wealdenzeit zurück, werden aber von einigen Geologen
selbst noch in der Steinkohlenformation angenommen, in-
445
Süßwasserkalk - Sutsos.
dem die Anthrakosien als Süßwasserformen gedeutet
werden, während die Gegner echte
Süßwasserkonchylien erst aus dem braunen Jura gelten
lassen.
Süßwasserkalk, s. Kalktuff.
Süßwassermolasse, s.
Tertiärformation.
Süßwasserpolyp, s. Hydra.
Süßwasserquarz, s. Quarzit.
Süßwurzel, indianische, s. Cyperus.
Susten, Hochgebirgspaß im östlichen
Flügel der Berner Alpen (2262 m), zwischen Titlis und
Sustenhorn (s. Dammastock), verbindet das bernerische Gadmenthal
(Gadmen 1202 m) mit dem Urner Mayenthal (Wasen 847 m).
Sustentation (lat.), Unterhalt, Versorgung; daher
Sustentationskosten, der Aufwand, welchen die Verpflegung einer auf
öffentliche Kosten zu versorgenden Person verursacht. S.
heißt auch die Apanage (s. d.) einer Prinzessin.
Susu, Negerstamm in Westafrika, zwischen dem Rio
Nuñez und Scarcias, und im Innern. Die S. sind Verwandte der
Mandingo, ihre Sprache ist die allgemeine Handelssprache in den
Faktoreien der Europäer.
Suszipieren (lat.), unter-, auf sich nehmen; Suszeption,
An-, Übernahme, besonders der geistlichen Weihen; suszeptibel,
empfänglich; reizbar.
Sutherland (spr. ssötherländ, "Südland",
mit Bezug auf Norwegen), eine der nördlichen Grafschaften
Schottlands, vom Atlantischen Ozean und der Nordsee bespült,
5451 qkm (99 QM.) groß mit (1881) 23,370 Einw., ist mit
Ausnahme eines kleinen Gebiets an der Ostküste durchaus rauh
und gebirgig und erreicht unweit der Westküste im Ben Hope
926, im Ben More Assynt 1000 m, während das Innere ein von
tief eingeschnittenen Thälern durchzogenes Tafelland mit
vereinzelten Bergen (Ben Klibreck 964 m) bildet. Die bedeutendsten
Flüsse sind: Oykill (mit dem Shin), Brora und Ullie an der
Ostküste, Halladale, Strathie und Naver an der Nordküste;
keiner derselben ist schiffbar, alle aber sind lachsreich. Von den
zahlreichen Landseen sind Loch Shin, Loch Naver und Loch Laoghall
(Loyal) die größten. Das Klima ist rauh und nebelig, der
Boden nur auf kleinen Küstenstrecken zum Ackerbau geeignet;
nur 1,69 Proz. der Oberfläche sind unterdem Pflug, 0,58 Proz.
sind Weide, 1,17 Proz. Wald. Indes läßt der Herzog von
S. seit einer Reihe von Jahren große Strecken Moorlandes
urbar machen. Von größerer Bedeutung sind die Viehzucht
(Rinder, Schafe) und die Fischerei. Das Mineralreich bietet
Halbedelsteine und Steinkohlen (bei Brora an der Ostküste).
Die Industrie beschränkt sich auf Verfertigung von
Wollenzeugen. Hauptstadt ist Dornoch.
Sutherland (spr. ssötherländ), einer der
ältesten schott. Adelstitel, zuerst verliehen 1228 an William,
Grafen von S., der Sage nach Sohn des durch Macbeth ermordeten
Allan, Than von S. Durch Vermählung kam der Titel 1515 an die
Familie Gordon, deren letzte Erbin sich mit George Granville
Leveson-Gower, Marquis von Stafford, vermählte. Dieser, einer
der größten Grundeigentümer in
Großbritannien, wurde 1833 zum Herzog von S. erhoben und
starb 19. Juli 1833. Gegenwärtiger Chef des Hauses ist sein
Enkel George Granville, dritter Herzog von S., geb. 19. Dez.
1828.
Sutinsko, Bad im kroatisch-slawon. Komitat Warasdin (in
Zagorien), mit einer besonders bei Frauenleiden wirksamen
indifferenten Therme von 37,4° C.
Sutorina, zur Herzegowina gehöriges Gebiet, das in
Form einer schmalen Zunge zwischen dalmatischem Territorium an die
Bocche di Cattaro reicht.
Sûtra, s. Weda.
Sutri, Stadt in der ital. Provinz Rom, Kreis Viterbo, das
altetruskische Sutrium, ist Bischofsitz, hat noch aus der
ältesten Zeit erhaltene Thore, ein antikes Amphitheater,
etruskische Gräber und (1881) 2318 Einw. In S. fand 1046 eine
Kirchenversammlung in Heinrichs III. Gegenwart statt.
Sutschawa (rumän. Suceava), Kreis in der
nördlichen Moldau, mit der Hauptstadt Foltitscheni.
Sutschou, eine große Stadt in der chines. Provinz
Kiangsu, am Kaiserkanal, auf Inseln erbaut und von Kanälen
durchschnitten, berühmt wegen der Schönheit und
Intelligenz seiner Bewohner. Es ist der Sitz des chinesischen
Buchhandels, namentlich in Bezug auf die massenhafte Verbreitung
mittelguter Ausgaben klassischer und sonst vielgelesener Schriften.
Auch standen von alters her gewisse Industrien dort in großer
Blüte, wie die Anfertigung roter Lacksachen. Die
Taipingrebellion hat jedoch den Wohlstand der Stadt bedeutend
verringert, und das neue S. läßt sich mit dem alten
nicht vergleichen. Auch eine katholische und eine evangelische
Mission befinden sich daselbst.
Sutsos, Alexandros und Panagiotis, zwei hervorragende
neugriech. Dichter, Neffen von Alexandros S., Fürsten der
Walachei, geb. 1803 und 1806 zu Konstantinopel, wurden auf dem
Gymnasium in Chios gebildet, setzten ihre Studien in Frankreich und
Italien fort und lebten seit 1820 in Paris im Umgang mit Korais und
andern hervorragenden Männern. Erfüllt von lebhafter
Liebe zu ihrem Vaterland, aber unklar in ihren politischen
Anschauungen, traten beide, besonders Alexandros, als erbitterte
Gegner des Präsidenten Kapo d'Istrias und später des
Königs Otto auf. Alexandros gab die Stellung eines Professors
an der Universität Athen und eines Historiographen des
Königreichs, die ihm nacheinander übertragen worden, auf,
um sich als Misanthrop ganz von der Öffentlichkeit
zurückzuziehen und als Verbannter im eignen Vaterland 1863 im
Krankenhaus zu Smyrna zu sterben. Panagiotis folgte ihm 1868 zu
Athen im Tod nach. Des letztern ältestes und bestes Gedicht
ist "Der Wanderer" ("Hodoiporos"), ein lyrisches Drama in fünf
Akten, voll von Sentimentalität und unnatürlichen
Situationen, aber von großen Schönheiten der Sprache und
des Versbaues. Ein mythisch-historischer Roman, "Leandros" (Nauplia
1834), schildert das Unterliegen höherer, besonders
politischer, Interessen in dem Kampf mit individueller
Leidenschaft. Reich an lyrischen Schönheiten ist die
Tragödie "Messias" (Athen 1839); weniger bedeutend sind drei
andre Dramen: "Vlachavas", "Karaiskakis" und "Der Unbekannte" (das.
1842). Auf der Höhe seines Talents steht er in seinen Oden
(Hydra 1826; wiederholt als "Odes d'un jeune Grec", Par. 1828).
Außerdem erschienen: erotische Lieder und politische Gedichte
als Anhang zum "Wanderer" ; ein weiterer Band Gedichte unter dem
Titel: "Kithara" (Athen 1835, 1851); eine Fabelsammlung (das. 1865)
sowie eine (unvollständige) Gesamtausgabe der Dichtungen (das.
1851, neue Ausg. 1883). Seine puristischen Grundsätze in Bezug
auf sprachliche Darstellung hat er in der Schrift "Nea schole"
(Athen 1853) und in der Zeitschrift "Helios" entwickelt. Weniger
ideal angelegt, aber bedeutend geistvoller als Panagiotis, begann
Alexandros seine poetische Laufbahn 1824 mit satirischen Gedichten
gegen die damalige Zerfahrenheit der griechischen Zustände,
schrieb 1829 in Paris seine "Histoire de la révolution
grecque" (deutsch, Berl. 1830) und war nach seiner Rückkehr
nach Griechenland un-
446
Sutti - Suworow.
erschöpflich in den bittersten Angriffen gegen Kapo
d'Istrias, die in dem "Panorama tes Hellados" (Nauplia 1833, 2
Bde.) gesammelt sind. Seine weitern politischen Gedichte (1845)
geben namentlich seinem Haß gegen die Bayern Ausdruck. Auch
seine andern Werke verleugnen den satirischen Grundzug nicht, so
besonders die Komödie "Der Verschwender" ("Asotos", 1830), mit
starkem Anschluß an Molière; der politische Roman "Der
Verbannte" ("Exoristos", Athen 1835; deutsch, Berl. 1837) und vor
allen die nach Byrons "Childe Harold" gearbeitete Dichtung "Der
Umherschweifende" ("Periplanomenos", 4 Gesänge, Athen
1839-52). Vgl. über Alexandros S. Queux de Saint-Hilaire im
"Annuaire pour l'encouragement des études grecques" (Par.
1874).
Sutti (Satti), in Indien Bezeichnung einer Witwe, die
sich mit der Leiche ihres Gatten verbrennen läßt. Der
Gebrauch ist den ältesten heiligen Schriften der Inder fremd,
obwohl die Brahmanen, als die englische Regierung 1830 diesen
Gebrauch verbot, denselben durch Fälschung einer Stelle des
Rigweda zu verteidigen suchten. Die Witwenverbrennung kommt nur
noch selten in Vasallenstaaten vor. Vgl. H. Wilson in
"Miscellaneous essays etc." (Lond. 1862); I. Bushby, Über die
Witwenverbrennung (das. 1855); M. Müller, Essays (Bd. 2, S. 30
ff.).
Sutton in Ashfield (spr. ssött'n in äschfild),
Stadt in Nottinghamshire (England), 4 km südwestlich von
Mansfield (s. d. 1), mit Strumpfwirkerei, Kohlengruben und (1881)
8523 Einw.
Sutura (lat.), Naht, Knochennaht.
Suum cuique (lat.), "jedem das Seine", Devise des
preuß. Schwarzen Adlerordens.
Süvern, Johann Wilhelm, Philolog und
einflußreicher preuß. Schulmann, geb. 1775 zu Lemgo,
Schüler F. A. Wolfs und Fichtes, dann Mitglied des Gedikeschen
Seminars für Gelehrtenschulen und Lehrer am Köllnischen
Gymnasium zu Berlin, 1800-1803 Rektor des Gymnasiums zu Thorn,
1804-1807 in gleicher Eigenschaft zu Elbing, dann Professor der
Philologie in Königsberg, wo er namentlich mit Herbart in
Verkehr stand. 1809 trat S. als Referent in die Unterrichtssektion
des preußischen Ministeriums ein und gehörte seit 1817
dem neugebildeten Kultusministerium als Geheimer Staatsrat und
Mitdirektor an. Er starb 2. Okt. 1829 in Berlin. An der
einheitlichen Organisation des preußischen Schulwesens,
namentlich des höhern, nach dem Frieden von Tilsit und nach
den Freiheitskriegen hat S. wesentlichen Anteil. Er ist der
Verfasser des Reglements für die wissenschaftliche
Lehramtsprüfung von 1810, der Reifeprüfungsordnung von
1812 sowie des Normallehrplans für die preußischen
Gymnasien von 1816, den er bereits 1811 ausgearbeitet hatte. Unter
seinem Vorsitz entstand durch Kommissionsberatungen das
Unterrichtsgesetz von 1817, das jedoch wie der Normallehrplan
Entwurf blieb. Auch lieferte er Ausgaben und Übersetzungen von
Äschylos, Sophokles, Aristophanes und geschätzte
Abhandlungen über die dramatische Kunst der Griechen, z. B.
über Aristophanes.
Süvernsche Masse, s. Abwässer, S. 71.
Suwalki (Ssuwalki), russisch-poln. Gouvernement, grenzt
im W. an Preußen, im N. an das Gouvernement Kowno, im O. an
die Gouvernements Wilna und Grodno, im Süden an Lomsha und
umfaßt 12,551 qkm (228 QM.). Das Land ist eben und wird im O.
und N. von dem Niemen als Grenzfluß umflossen, neben welchem
die zum Flußsystem der Weichsel gehörenden Bobr, Netta,
Stawiska, Jastrzebianka zu nennen sind. Die Zahl der Seen ist 480.
Das Klima ist gemäßigt, aber infolge der nördlichen
Lage rauher als in den andern polnischen Gouvernements. Die
mittlere Temperatur ist +6,8° C. Die Bevölkerung betrug
1885: 624,579 Seelen (49 pro QKilometer) und bekennt sich
vorherrschend zur römisch-katholischen Konfession (71 Proz.).
Der Rest entfällt auf Juden, Lutheraner und Reformierte,
Griechisch-Orthodoxe, Altgläubige und Mohammedaner. Die
Altgläubigen (Starowierzen), an Zahl 5000, haben sich vor
mehreren hundert Jahren im südlichen Teil des Gouvernements
niedergelassen, bewohnen fünf Dörfer und genießen
vollständige Freiheit in Bezug auf die Ausübung ihres
Kultus. Die Zahl der Eheschließungen war 1885: 3569, der
Gebornen 20,094, der Gestorbenen 15,558. Der Ackerbau, welcher vier
Fünfteln der Bewohner den Unterhalt gewährt, steht auf
einer niedrigen Entwicklungsstufe. Obst- und Gemüsegärten
sind gänzlich vernachlässigt. Der Betrieb von
Branntweinbrennereien bildet eine bedeutende Aushilfe der
Landwirtschaft, namentlich der größern Güter.
Erheblich ist die Pferdezucht (fünf Privatgestüte). Die
Zucht der wilden Waldbienen liefert schönen, weißen
Honig. Die Forsten bedecken den vierten Teil des Areals und
gehören zum größern Teil der Regierung, welche sie
rationell verwalten läßt, während die
Privatwälder völlig verwahrlost sind. Die Industrie ist
unbedeutend, der Wert ihrer Produktion beziffert sich auf 1 1/3
Mill. Rubel. Ebenso unbedeutend ist der Handel, der in den
Händen der jüdischen Bevölkerung ist.
Haupthandelspunkte sind: Suwalki, Augustowo, Aleksota. Für die
Volksbildung sind (1885) 203 Lehranstalten thätig (darunter 3
Mittelschulen und 2 Fachschulen [ein geistliches und ein
Lehrerseminar]) mit 13,316 Schülern. Die Zahl der Kreise ist
sieben: Augustowo, Kalwary, Mariampol, Seyny, Suwalki, Wladislawow,
Wolkowyschky. S. Karte "Polen und Westrußland". - Die
gleichnamige Hauptstadt, unweit des Wigrischen Sees, zur Zeit der
ersten Teilung Polens angelegt, ist schön und
regelmäßig erbaut, hat ein Knaben- und ein
Mädchengymnasium, lebhaften Grenzverkehr mit Preußen und
(1886) 19,367 Einw.
Suwanee (spr. ssuwáni), Fluß in Nordamerika,
entspringt im Staat Georgia in dem Okeesinokeesumpf und mündet
nach einem Laufe von 320 km im Staat Florida in den Golf von
Mexiko. An seinen Ufern mehrere geschätzte
Schwefelquellen.
Suworow, Alexander Wasiljewitsch, Graf von S.-Rimnikskij,
Fürst Italijskij, berühmter russ. Feldherr, geb. 24. Nov.
1729 zu Moskau, begann im Siebenjährigen Krieg seine
kriegerische Laufbahn, ward 1762 zum Obersten des Astrachanschen
Grenadierregiments ernannt, befehligte beim Ausbruch der polnischen
Insurrektion 1768 den Sturm auf Krakau, drang siegreich bis Lublin
vor und kehrte nach der ersten Teilung Polens als Generalmajor nach
Petersburg zurück. Im Türkenkrieg siegte S. 1774 bei
Turtukai und bei Hirsowa und focht mit Auszeichnung unter Komenskij
bei Kosludschi. Hierauf war er im Kampf gegen Pugatschew
thätig. Sodann kämpfte er in der Krim. Mit der
Beförderung zum Generalleutnant erhielt er 1780 zugleich den
Befehl, gegen die aufständischen Völker am Kaukasus zu
marschieren, und unterwarf dort die Lesghier nach blutigen
Kämpfen, wofür er zum General der Infanterie und
Gouverneur jener Provinzen ernannt wurde. Am 1. Okt. 1787 siegte er
bei Kinburn und 1788 mit den Österreichern unter dem Prinzen
von Sachsen-Koburg bei Fokschani sowie 1789 am Rimnik über die
Türken, wofür er den Beinamen Rim-
447
Suworowinseln - Svendsen.
nikskij erhielt und zum deutschen und russischen Reichsgrafen
erhoben wurde. Am 22. Dez. 1790 erstürmte er die Festung
Ismail, deren Einwohner er niedermetzeln ließ. Den polnischen
Aufstand von 1794 beendigte er rasch durch die Erstürmung von
Praga und die Besetzung von Warschau, wofür er zum
Generalfeldmarschall befördert ward. Hierauf zog er sich auf
sein Landgut Kantschanski im Gouvernement Nowgorod zurück, bis
ihm 1799 Kaiser Paul den Oberbefehl über die Truppen
übertrug, welche mit den Österreichern vereint in Italien
gegen die Franzosen fechten sollten. Er schlug die letztern 27.
April bei Cassano, 17., 18. und 19. Juli an der Trebbia und 15.
Aug. bei Novi, eroberte Alessandria und warf binnen 5 Monaten den
Feind aus ganz Oberitalien. Hierauf zog er nach der Schweiz, um
sich mit Korssakow zu vereinigen. Sein Zug über den St.
Gotthard war mit unbeschreiblichen Anstrengungen verknüpft und
kostete ihm den dritten Teil seines Heers, den größten
Teil der Pferde, alle Lasttiere nebst Geschütz und
Gepäck. Als er endlich das vordere Rheinthal betrat, fand er
die Verbündeten inzwischen von Massena bei Zürich, von
Soult an der Linth, von Molitor bei Mollis geschlagen. Er trat
daher den Rückmarsch durch Graubünden nach Italien und
von da, inzwischen zum Generalissimus aller russischen Armeen
ernannt, im Januar 1800 nach Rußland an. Noch vor seiner
Rückkehr aber fiel er infolge angeblicher Nichtbeachtung
kleinlicher kaiserlicher Dienstbefehle in Ungnade. Krank kam er 2.
Mai 1800 in Petersburg an und starb daselbst 18. Mai. Alexander I.
ließ ihm 1801 auf dem Marsfeld zu Petersburg eine kolossale
Statue setzen. Vgl. Anthing, Kriegsgeschichte des Grafen S. (Gotha
1796-99, 3 Bde.); v. Smitt, Suworows Leben und Heerzüge (Wilna
1833-34); Derselbe, S. und Polens Untergang (Leipz. 1858, 2 Bde.).
Neuere Biographien Suworows lieferten Polewoi (deutsch, Mit. 1853)
und Rybkin (russ., Mosk. 1874). Suworows "Korrespondenz über
die russisch-österreichische Kampagne im Jahr 1799" wurde von
v. Fuchs herausgegeben (deutsch, Glog. 1835, 2 Bde.). - Suworows
Sohn Arkadij Alexiewitsch, geb. 1783, that sich im Feldzug von 1807
hervor, ward Generalleutnant, befehligte eine Division der
Donauarmee unter Kutusow und ertrank 1811 im Rimnik, wo sein Vater
den Sieg über die Türken erfochten hatte. Dessen Sohn
Alexander Arkadjewitsch S.-Rimnikskij, Fürst Italijskij, geb.
1. Juli 1804, russ. Diplomat und General, diente im Kaukasus und in
Polen, wurde mehrmals zu diplomatischen Missionen an deutsche
Höfe verwandt, ward 1848 Generalgouverneur der
Ostseeprovinzen, die er vortrefflich verwaltete, 1861
Generalmilitärgouverneur von Petersburg, dann, als im Mai 1866
dies Amt in Wegfall kam, Generalinspektor der Infanterie. Er starb
12. Febr. 1882 in Petersburg.
Suworowinseln, kleine, nur 5 km große Gruppe auf
einem eine Lagune einschließenden, mit Wasser bedeckten Riff,
zur polynesischen Gruppe der Manihikiinseln gehörig, unter
13° 20' südl. Br. und 163° 30' östl. L. v. Gr.
Die nahe aneinander liegenden Eilande sind mit Gebüsch
bedeckt, haben einige Kokospalmen, aber kein Trinkwasser. Ein
tiefer Kanal führt in das Innere der seichten Lagune. Die
Gruppe wurde Anfang 1889 von England in Besitz genommen.
Suzeränität (franz.), Oberhoheit (s. d.).
Svarez (Suarez, eigentlich Schwartz), Karl Gottlieb
(nicht von spanischer Abkunft), der Schöpfer des
preußischen Landrechts, geb. 27. Febr. 1746 zu Schweidnitz,
studierte 1762-65 in Frankfurt a. O. trat hierauf als Auskultator
bei der Oberamtsregierung zu Breslau in den praktischen
Justizdienst, ward 1771 Rat daselbst und wirkte bei Neugestaltung
der Verhältnisse Schlesiens unter dem Provinzialminister v.
Carmer wesentlich mit zur Begründung des landschaftlichen
Kreditsystems, zur Reorganisation der höhern Schulen wie zur
Anbahnung einer Prozeßreform, welch letztere indessen, durch
den Großkanzler v. Fürst bekämpft, ins Stocken
geriet. Als Carmer an Fürsts Stelle berufen wurde, folgte ihm
S. 1780 als vortragender Rat nach Berlin, um dessen legislatorische
Pläne auszuführen. Auf Grund des Prozeßentwurfs von
1775 bearbeitete er das 1781 publizierte erste Buch des "Corpus
juris Fridericianum" (von der Prozeßordnung), woraus
später die "Allgemeine Gerichtsordnung für die
preußischen Staaten" (Berl. 1794-95, 3 Tle.), ebenfalls sein
Werk, hervorging. Auch in der Gesetzkommission für das
allgemeine Gesetzbuch fiel ihm die Hauptarbeit zu. Er schuf den
"Entwurf eines Allgemeinen Gesetzbuchs" (Berl. 1784-88, 6 Abtlgn.),
ebenso die Schlußredaktion des am 20. März 1791 zur
Publikation gelangten Gesetzbuchs selbst. Nachdem dasselbe infolge
von Gegenströmungen 18. April 1792 auf unbestimmte Zeit wieder
suspendiert war, besorgte S. die durch Kabinettsorder vom 17. Nov.
1793 angeordnete Revision, welche in dem "Allgemeinen Landrecht
für die königlich preußischen Staaten", publiziert
5. Febr. 1794, mit Gesetzeskraft vom 1. Juni, ihren endlichen
Abschluß fand. 1787 zum Geheimen Oberjustizrat befördert
und noch in demselben Jahr zum Obertribunalsrat ernannt, starb S.
14. Mai 1798 in Berlin. Vgl. Stölzel, K. G. S.
(Berl.1885).
Svealand (Svearike), historische Bezeichnung für das
mittlere Schweden mit der Hauptstadt Stockholm.
Svegliato (ital., spr. sweljato), aufgeweckt, munter.
Svendborg, dän. Amt, den südöstlichen Teil
der Insel Fünen nebst den Inseln Taasinge, Langeland, Aeroe
und vielen andern umfassend, 1643 qkm (29,8 QM.) mit (1880) 117,577
Einw. - Die gleichnamige Hauptstadt, in schöner Lage am
Svendborgsund, Endpunkt der Eisenbahnlinie Odense-S., hat 2 Kirchen
und (1880) 7184 Einw. Der Hafen ist etwa 4,5 m tief. Schiffahrt und
Schiffbau sind von großer Bedeutung. Die Handelsflotte
zählte 1886: 286 Schiffe von 26,907 Registertonnen. 1886
liefen 4744 Schiffe mit einer Warenmenge von 51,399 Registertonnen
ein und aus. S. ist Sitz eines deutschen Konsulats.
Svendsen, Johann Severin, norweg. Komponist, geb. 30.
Sept. 1840 zu Christiania, erhielt von seinem Vater den ersten
Unterricht im Violinspiel und ging 1862 als Mitglied einer
ambulanten Musikgesellschaft nach Hamburg, setzte nach
Auflösung derselben, mit einem königlichen Stipendium
versehen, seine Studien in Leipzig fort und widmete sich hier, da
er infolge einer Fingerkrankheit das Violinspiel aufgeben
mußte, ausschließlich der Komposition. 1867 machte er
eine Reise nach Island, lebte dann 1868-1869 in Paris, hierauf
wieder in Leipzig und begab sich 1872 in seine Heimat, von wo aus
er im Herbst 1877, abermals mit einem königlichen Stipendium
ausgerüstet, zu weitern Kunststudien nach Italien ging.
Über London und Paris, wo er wieder anderthalb Jahre
verweilte, nach Christiania zurückgekehrt, dirigierte er hier
wieder die schon früher von ihm geleiteten
Musikvereinskonzerte, bis er 1883 einem Ruf als Hofkapellmeister
nach Kopenhagen folgte. Von seinen Kompositionen sind
hervorzuheben: ein Konzert für Violine, eins für
Violoncello, ferner zwei Quar-
448
Sverdrup - Swan's-down.
tette, ein Quintett und ein Oktett für Streichinstrumente,
eine Einleitung zu Björnsons Tragödie "Sigurd Slembe",
zwei Symphonien, von denen besonders die zweite (in B dur)
günstige Aufnahme fand, "Hochzeitsfest" für Orchester,
Ouvertüre zu "Romeo und Julie" u. a.
Sverdrup, Johan, norweg. Politiker, geb. 1816 auf dem
Schloß Jarlsberg, wo sein Vater die Güter des Grafen
Wedel-Jarlsberg verwaltete, studierte die Rechte, machte 1841 sein
Examen und ließ sich in Laurvik als Anwalt nieder. 1851 wurde
er in das Storthing gewählt, dem er seitdem ununterbrochen
angehörte. Radikalen Anschauungen huldigend, gewann er
für dieselben mehr und mehr Anhänger und bildete sich
durch unermüdliche Thätigkeit eine Partei, welche
besonders in der Landbevölkerung vorherrschte (Bauernpartei)
und allmählich die Majorität im Storthing erlangte. An
ihrer Spitze begann er, zum Präsidenten des Storthings
gewählt, den Kamps gegen das Königtum, das er zu einer
bloßen Ehrenstellung herabdrücken wollte, mit dem Streit
über die Zulassung der Minister zum Storthing, aus dem sich
dann der weitere über das königliche Veto entwickelte, in
welchem S. 1883 den Sieg davontrug, indem das Ministerium
verurteilt wurde. S. wurde 1884 an die Spitze des Ministeriums
gestellt, befriedigte aber durch seine Thätigkeit den
radikalen Teil seiner Anhänger nicht, welche sich von ihm
lossagten, und sah sich aus Rücksicht aus die Konservativen,
von deren Stimmen er abhängig war, zu einer
gemäßigten Politik veranlaßt.
Sverige (schwed.), Schweden.
Sverker, König von Schweden, Enkel Svens des
Opferers, stritt nach dem Erlöschen des Hauses König
Stenkils (1129) mit Magnus um den Besitz der Krone und kam endlich
in den alleinigen Besitz derselben. Nach seiner Ermordung (1155)
versuchten seine Nachkommen vergeblich, sich dauernd auf dem Thron
zu behaupten. Mit Johann Sverkerson erlosch 1222 sein
Geschlecht.
Svetla, Karoline, böhm. Schriftstellerin (eigentlich
Frau Professor Muzak), geb. 24. Febr. 1830 zu Prag, gilt als die
hervorragendste Romanschriftstellerin. Unter ihren zahlreichen
Erzählungen sind die besten: "Vesnicky roman" ("Dorfroman")
und "Kriz a potoka" ("Das Kreuz am Bach"). Eine Gesamtausgabe ihrer
zahlreichen Romane erscheint in der "Narodni bibliotheka". S.
schrieb außerdem viele Aufsätze über Erziehung und
Litteratur; ihre "Memoiren" erfreuen sich der allgemeinen
Aufmerksamkeit. Einige ihrer Werke wurden ins Deutsche,
Französische, Polnische und Russische übersetzt.
Sw., bei botan. Namen Abkürzung für O. Swartz,
geb. 1760, gest. 1818 als Professor in Stockholm; Kryptogamen,
westindische, schwedische Flora.
Swaga, s. Borax.
Swains., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung
für William Swainson, geb. 1789 zu Liverpool, gest. 1855 auf
Neuseeland (Zoolog).
Swammerdam, Jan, Naturforscher, geb. 12. Febr. 1637 zu
Amsterdam, studierte seit 1661 in Leiden Medizin, ging auf einige
Jahre nach Saumur und Paris, kehrte 1665 nach Amsterdam, 1666 nach
Leiden zurück, erwarb dort 1667 die medizinische
Doktorwürde und lebte dann in Amsterdam ausschließlich
seinen schon bisher mit großem Eifer betriebenen
planmäßigen anatomischen Studien. Körperlich
leidend und von einer pietistisch-schwärmerischen
Gemütsstimmung ergriffen, vertiefte er sich später in die
Schriften der chiliastischen Schwärmerin Bourignon, ging 1675
zu ihr nach Schleswig und geleitete sie nach Kopenhagen, kehrte
dann krank nach Amsterdam zurück und starb daselbst 17. Febr.
1680. S. war als Erforscher der kleinern Tierformen von
epochemachender Bedeutung; er erfand auch die Methode, die
Blutgefäße durch Ausspritzung mit Wachs haltbar und der
Untersuchung zugänglich zu machen. In seiner "Allgemeene
verhandeling van bloedeloose diertjens" (Utr. 1669; lat., Leid.
1685) legte er die Grundlage für die erste
naturgemäße Klassifikation der Insekten, und seine
anatomischen Arbeiten über die Insekten, veröffentlicht
in der "Biblia naturae" (hrsg. von Boerhaave, das. 1737-38, 2 Bde.;
deutsch, Leipz. 1752), sind die bedeutendste Erscheinung auf diesem
Felde der Zootomie bis in die neuere Zeit geblieben. Auch
beschäftigte er sich mit der Metamorphose der Insekten und
suchte die Gleichartigkeit der Zeugungsweise bei Tieren aller
Klassen nachzuweisen, indem er die Rolle des Samens feststellte. Er
schrieb noch "Miraculum naturae, seu uteri muliebris fabrica"
(Leid. 1672).
Swampies, Indianer, s. Kri.
Swamps (engl.), Moräste, Sümpfe in Nordamerika,
speziell die am Albemarlesund.
Swamy, Sir Mutu Coomara, gelehrter Ceylonese, geb. 1836
zu Kolombo auf Ceylon, studierte englisches Recht und erlangte als
der erste Nichtchrist in England die Würde eines Barristers
(Anwalts), wurde dann in seiner Heimat Mitglied des Legislative
Council und heiratete eine englische Dame. Seine verdienstlichen
Arbeiten zur Quellenkunde des südlichen Buddhismus: "History
of the tooth relic of Buddha" und "Sutta Nipata, the dialogues and
discourses of Gotama Buddha" (Pâlitexte, mit engl.
Übersetzung, Lond. 1874), trugen ihm die Erhebung in den
englischen Adelstand ein. Er starb 4. Mai 1879 in Kolombo.
Swaneten, zum kartwelischen Stamm gehöriges Volk in
Transkaukasien, das, 12,000 Köpfe stark, die obern Thäler
des Ingur und der Tskenis im Gouvernement Kutais bewohnt. Aus den
Ebenen Mingreliens vertrieben, haben sie sich in eine fast
unzugängliche Gebirgswelt zurückgezogen, wo sie in
Verwilderung und nach dem Gesetz der Blutrache sich beständig
befehdend ein elendes Dasein führen. Not trieb bei ihnen zur
Sitte des Mädchenmordes; Christen sind sie nur dem Namen nach,
ebenso ist ihre Abhängigkeit von Rußland (seit 1853) nur
nominell.
Swanevelt, Herman, holländ. Maler, geboren um 1600
zu Woerden bei Utrecht, begab sich 1623 nach Paris, von da nach
Rom, wo er bis um 1637 lebte, und ließ sich dann, nach kurzem
Aufenthalt in der Heimat, 1652 in Paris nieder, wo er 1653 Mitglied
der Akademie wurde und 1655 starb. Er hat italienische Landschaften
in der Art des Claude Lorrain gemalt, die man zumeist in den
Galerien von Rom und Florenz, aber auch in denen von Paris,
Frankfurt a. M., München und des Haag findet. Hervorragender
sind seine landschaftlichen Radierungen, deren er 116 hinterlassen
hat.
Swanhild, nach nord. Sage Sigurds Tochter von Gudrun,
wurde am Hof ihres Stiefvaters, des Königs Jonakur (den Gudrun
geheiratet, nachdem sie vergeblich den Tod in den Wellen gesucht),
erzogen und sollte König Jormunrekr (d. h. Ermanarich, den
Ostgotenkönig) heiraten. Weiteres s. Jormunrekr.
Swan River, s. Schwanenfluß.
Swan's-down (engl., spr. swónns-daun,
"Schwanendaunen"), eine Art feinen Wollenzeugs, das mit Seide und
Baumwolle gemischt ist.
449
Swansea - Swedenborg.
Swansea (spr. sswónssih), Stadt in Glamorganshire
(Wales), an der Mündung des Tawe in die Swanseabai des
Bristolkanals, mit (1881) 65,597 Einw. S. ist eine wenig anziehende
Stadt, und die den Schlöten seiner zahlreichen
Kupferschmelzhütten entsteigenden Dämpfe verhindern den
Pflanzenwuchs in der ganzen Gegend. Es verdankt seine Blüte
den reichen Kohlenlagern, die es in den Stand setzen, die ihm aus
Cornwall und allen Teilen der Welt zugeschickten Kupfer- und
Zinkerze zu verschmelzen. Außerdem hat es Töpfereien und
Porzellanwerke, Blechfabriken und Schiffbau. Sein Handel ist
bedeutend und wird gefördert durch die im Ästuar des Tawe
angelegten großartigen Docks. Es gehörten zum Hafen
1888: 166 Seeschiffe von 58,727 Ton. Gehalt und 45 Fischerboote.
Die Einfuhr vom Ausland belief sich auf 1,593,752 Pfd. Sterl., die
Ausfuhr dorthin (meist Steinkohlen) auf 2,868,612 Pfd. Sterl. An
öffentlichen Anstalten verdienen Erwähnung die Royal
Institution (mit Museum und Bibliothek), ein Lehrerseminar, eine
Lateinschule, eine Kunstschule und ein Taubstummeninstitut. S. ist
Sitz eines deutschen Konsuls. Dicht dabei liegt Landore mit den
ehemals Siemensschen Stahlwerken.
Swanskin (engl., spr. sswonn-, "Schwanfell"), eine Art
Fanell.
Swantewit (Swentowit), eine slaw. Gottheit,
ursprünglich wohl lichter Sonnen- (und Tages-) Gott
gegenüber Tschernebog (s. d.). Besonders berühmt war sein
Tempel zu Arkona auf Rügen, den König Waldemar I. 1168
zerstörte. S. wurde vierköpfig (nach den vier
Weltgegenden blickend) dargestellt, mit Bogen und Füllhorn
(was beides auf den Regenbogen nach verschiedener Auffassung
desselben als Bogen oder Horn geht). Beim Erntefest wurde das Horn
mit Met gefüllt; aus dem Rest, welcher vom vorigen Jahr in
demselben übriggeblieben, schloß man auf gute oder
schlechte Ernte. Man hielt ihm auch heiige Pferde (zum Zweck der
Weissagung).
Swat (serb.), Hochzeitsgast.
Swat, kleiner Gebirgsstaat nordwestlich von Peschawar, an
der Grenze von Britisch-Indien, mit 100,000 Einw., Afghanen vom
Jusufzaistamm, die sich im 16. Jahrh. hier niederließen und
die ältern arischen Bewohner verdrängten, in einem der
äußern Thäler, die vom Hindukusch nach dem
Kabulfluß sich herabziehen, hat warmes Klima, dichte
Waldungen und trägt Reis, Olivenbäume etc. Europäern
ist das Bereisen des Thals nur in Verkleidung mit Lebensgefahr
möglich. Hauptort ist Allahdand. Alexander d. Gr. durchzog den
untern Teil des Thals. Zu einem gewissen Ruf gelangte S. durch
seinen Akhund (d. h. Lehrer) Namens Abd ul Ghafar, der in Indien,
Zentralasien, Arabien, ja bis Konstantinopel im Ruf eines Weisen
von übernatürlicher Begabung stand, von Privaten als
Schiedsrichter, von mohammedanischen Fürsten um Beirat in
politischen Fragen angegangen wurde und noch 1877 einen Gesandten
des Sultans der Türkei erhielt. Der Akhund verkehrte nicht mit
Europäern, drang auch in Afghanistan auf Abschließung
und bezeigte insbesondere England wie Rußland
gleichmäßig Mißtrauen. 1846 hatte er unter den
Afghanen, die damals vorübergehend Peschawars sich
bemächtigt hatten, den Glaubenskrieg gepredigt; seitdem aber
erkannte der Akhund rückhaltlos die Überlegenheit der
Europäer an und riet im russisch-türkischen Krieg 1877
sowohl seinen Landsleuten als dem Sultan der Türkei davon ab,
die Fahne des Propheten zu entfalten. Dieser einflußreiche
religiöse Führer der Moslems Zentralasiens starb Ende
1877.
Swatau (Schateu), dem europäischen Handel seit 1869
geöffnete Handelsstadt in der chines. Provinz Kuangtung, an
der Mündung des Han in die Fukienstraße, Sitz eines
deutschen Konsuls, einer katholischen und evangelischen Mission,
mit etwa 30,000 Einw.
Swatopluk (Zwentibold), Herzog von Mähren, kam zur
Herrschaft über dieses Land, nachdem er seinen Oheim Rastislaw
gefangen genommen und dem ostfränkischen König Ludwig dem
Deutschen ausgeausiefert hatte, und sicherte sich 871 durch einen
verräterischen Überfall des bayrischen Heers, welches
vernichtet wurde, seine Unabhängigkeit. Er breitete nun sein
Reich nach allen Seiten hin aus. Den Plan seines Oheims Rastislaw,
mit Hilfe des Methodius ein von Deutschland unabhängiges
slowenisches Kirchenwesen in Mähren zu begründen, gab er
später preis, indem er nach Methodius' Tod sich wieder der
bayrischen Kirche zuwandte. Er starb 894, und nach seinem Tod ging
sein Reich zu Grunde.
Sweaborg, Festung im finn. Gouvernement Nyland, am
Finnischen Meerbusen, 5 km südlich von Helsingförs,
dessen Hafen sie deckt, seit 1749 von dem schwedischen
Feldmarschall Grafen A. Ehrenswärd erbaut, liegt auf sieben
Felseninseln, hat ein Zeughaus, bombenfeste Magazine, 2
Schiffsdocks, Werften, ein Monument des Grafen Ehrenswärd etc.
und ohne die Garnison ca. 1000 Einw. - Am 7. April 1808 ging die
Festung durch verräterische Kapitulation des schwedischen
Kommandanten, Admirals Cronstedt, an die Russen über.
Während des Krimkriegs wurde S. von der
englisch-französischen Flotte 8.-11. Aug. 1855 bombardiert und
niedergebrannt.
Sweater (engl., spr. sswetter, "Schwitzer"), in England
Bezeichnung der Vermittler, welche Arbeiten von größern
Unternehmern übernehmen und dieselben unmittelbar an Arbeiter
gegen Lohn vergeben, um aus deren Schweiß (daher
Sweating-System) einen Gewinn herauszuschlagen. Der Ausdruck wird
besonders von Schneidern gebraucht, welche selbständig
für große Magazine arbeiten.
Swedenborg (eigentlich Swedberg), Emanuel von, schwed.
Gelehrter und Theosoph, geb. 29. Jan. 1688 zu Stockholm, Sohn
Jesper Swedbergs, Bischofs von Westgotland, studierte zu Upsala
Philologie und Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaften,
daneben auch Theologie, bereiste 1710-14 England, Holland,
Frankreich und Deutschland und ward 1716 Assessor des
Bergwerkskollegiums zu Stockholm, in welcher Stellung er sich durch
mechanische Erfindungen hervorthat. Zur Belagerung von
Frederikshall schaffte er 1718 sieben Schiffe mittels Rollen
fünf Stunden weit über Berg und Thal. Dies sowie seine
Schriften über Algebra, Wert der Münzen, Planetenlauf,
Ebbe und Flut etc. hatten zur Folge, daß die Königin
Ulrike ihn 1719 unter dem Namen S. adelte. In den folgenden Jahren
bereiste er die schwedischen, sächsischen sowie später
auch die böhmischen und österreichischen Bergwerke. Seine
"Opera philosophica et mineralogica" (1734, 3 Bde. mit 155
Kupferstichen) gaben auf der Grundlage ausgedehnter Studien
über Gegenstände der Naturwissenschaft und der
angewandten Mathematik ein System der Natur, dessen Mittelpunkt die
Idee eines notendigen mechanischen und organischen Zusammenhangs
aller Dinge ist. Nach neuen Reisen (1736-1740) durch Deutschland,
Holland, Frankreich, Italien und England wendete er sein
Natursystem in den Schriften: "Oeconomia regni animalis" (Lond.
1740-41), "Regnum animale" (Bd. 1 u. 2, Haag 1744; Bd. 3, Lond.
1745) und "De cultu et amore
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl., XV. Bd.
29
450
Sweepstake - Swieten
Dei<< (das. 1740, 2 Bde.) auch auf die belebte
Schöpfung, namentlich den Menschen, an. Aber schon das
letztgenannte Werk war nicht mehr streng wissenschaftlich gehalten,
wie sich denn S. von jetzt an ausschließlich theosophischen
Studien hingab, um sich für seinen, wie er behauptete, von
Gott selbst ihm eingegebenen Beruf vorzubereiten, der in nichts
Geringerm bestand als in der Gründung der Neuen Kirche, wie
sie in der Offenbarung St. Johannis verheißen ist. S. glaubte
diese Mission zu erfüllen, indem er das Wort Gottes in der
(nach seinem Sinn) wahren Bedeutung auslegte, ein
vollständiges System einer neuen Religionslehre aufstellte und
die Natur des Geisterreichs und dessen Zusammenhang mit der
Menschenwelt in seltsamen Visionen enthüllte, von denen
mehrere die Aufmerksamkeit Kants erregten und denselben
veranlaßten, S. in seinen "Träumen eines Geistersehers"
(1766) für einen "Schwärmer" zu erklären (vgl. Rob.
Zimmermann, Kant und der Spiritismus, Wien 1879). Die
hauptsächlichsten Werke, welche diese Lehre behandelten,
waren: "Arcana coelestia" (Lond. 1749-56, 8 Bde.; hrsg. von Tafel,
Tübing. 1833-42, 13 Bde.; deutsch, das. 1842-70, 16 Bde.); "De
coelo et inferno" (Lond. 1758; deutsch von Tafel, 3. Aufl.,
Tübing. 1873); "De nova Hierosolyma et ejus doctrina" (Lond.
1758; deutsch von Tafel, Tübing. 1860); "Apocalypsis
explicata" (Lond. 1761; deutsch von Tafel, Tübing. 1824-31, 4
Bde.) und "Vera christiana religio" (Lond. 1771; hrsg. von Tafel,
Stuttg. 1857; deutsch von demselben, Tübing. 1855-58, 3 Bde.).
Um seinen religiösen Bestrebungen ungestört leben zu
können, hatte er schon 1747 seine amtliche Stellung
aufgegeben, bezog jedoch eine königliche Pension. Während
einer Reise, welche er 1771 im Interesse seiner Lehre unternommen
hatte, erkrankte er in London und starb daselbst 29. März
1772. Die Zahl seiner Anhänger (Swedenborgianer) nahm langsam
zu; sie verbreiteten sich, wenn auch nur sporadisch, über
Schweden, Polen, England und Deutschland; am meisten faßte
die "neue Kirche" oder das "neue Jerusalem" (New Jerusalem church)
in England festen Fuß, wo es jetzt 50 Gemeinden geben mag,
sowie in der neuern Zeit auch in Nordamerika. Vgl. Richer, La
nouvelle Jerusalem (Par. 1832-35, 8 Bde.); Tafel, Sammlung von
Urkunden über Swedenborgs Leben und Charakter (Tübing.
1839-42, 3 Bdchn.) ; Derselbe, Abriß von Swedenborgs Leben
(das. 1845); die Biographien von Schaarschmidt (Elberf. 1862),
Matter (Par. 1863) und White (2. Aufl., Lond. 1874), die anonyme
Schrift "E. Swedenborgs Leben und Lehre" (Frankf. 1880); Potts, S.
Concordance (Lond. 1889, Bd. 1).
Sweepstake (engl., spr. sswihp-stehk), Einsatzrennen,
dessen Preis nur aus den Einlagen und Reugeldern der Teilnehmer
(mindestens drei) besteht.
Sweersinsel, s. Wellesleyinseln.
Sweet, bei botan. Namen für R. Sweet,
Handelsgärtner in London, gest. 1839. Geraniaceen, Cistineen.
Flora australasica.
Swell (engl.), s. Dandy.
Swenigorod, Kreisstadt im russ. Gouvernement Moskau, an
der Moßkwa, mit (1885) 2288 Einw.
Swenigorodka, Kreisstadt im russ. Gouvernement Kiew, am
Fluß Tikitsch, hat 3 griechisch-russische und eine kath.
Kirche und (1885) 11,562 Einw.
Swenziany, Kreisstadt im russ. Gouvernement Wilna, eine
der ältesten Ortschaften Litauens, hat eine
griechisch-russische, eine kath. Kirche und (1885) 8517 Einw.
(meist Juden).
Swert, Jules de, Violoncellist und Komponist, geb. 16.
Aug. 1843 zu Löwen in Belgien, erhielt von früher
Kindheit an gründlichen Unterricht von seinem Vater, der
Kapellmeister an der Kathedrale zu Löwen war, und machte schon
im 10. Jahr Kunstreisen durch Belgien und Holland, wo er Servais'
Aufmerksamkeit erregte und, nachdem er ins Brüsseler
Konservatorium eingetreten war, von diesem ausgebildet wurde. 1858
mit dem ersten Preis gekrönt, begab er sich zunächst nach
Paris, von da nach Schweden, Dänemark und Deutschland, wo er
überall mit glänzendem Erfolg konzertierte, und wurde
1865 in Düsseldorf, später in Weimar, bald darauf aber
als Konzertmeister am Hoftheater und zugleich als Lehrer an der
Hochschule zu Berlin angestellt. Diese Stellung verließ er
Anfang der 70er Jahre, um sich ausschließlich der Komposition
zu widmen, und verlegte seinen Wohnsitz nach Wiesbaden. Ende 1888
wurde er zum Professor am königl. Konservatorium zu Gent,
zugleich zum Direktor der Musikakademie und Kapellmeister der
Kursaal-Symphonie-Konzerte zu Ostende ernannt. Seine bisher in die
Öffentlichkeit gedrungenen Werke bestehen in zahlreichen
beachtenswerten Arbeiten für sein Instrument (darunter drei
Konzerte, eine Violoncelloschule. "Gradus ad parnassum"), einer
Symphonie ("Nordseefahrt") und den Opern: "Die Albigenser" (1880,
Wiesbaden) und "Graf Hammerstein" (Mainz, 1884).
Swerts, Jan, belg. Maler, geb. 1825 zu Antwerpen,
Schüler N. de Keysers daselbst, machte sich um die monumentale
Kunst Belgiens dadurch verdient, daß er die Regierung zu
einer Ausstellung von Kartons deutscher Meister in Brüssel und
Antwerpen (1859) veranlaßte. Mit Godefried Guffens hat er
eine Reihe von Wandbildern religiösen und historischen Inhalts
geschaffen, welche sich an die Richtung der neudeutschen Klassiker
anschließen (näheres s. bei Guffens). Seit 1874 Direktor
der Kunstakademie zu Prag, starb er 11. Aug. 1879 in Marienbad.
Sweynheym, Konrad, mit Arnold Pannartz (s. d.) erster
Buchdrucker zu Subiaco bei Rom 1464.
Swiaschsk, Kreisstadt im russ. Gouvernement Kasan, an der
Mündung der Swiaga in die Wolga, hat einige alte Kirchen und
Klöster und (1885) 2883 Einw.
Swiedack, Karl, unter dem Pseudonym Karl Elmar bekannter
österreich. Volksdramatiker, geb. 23. Mai 1815 zu Wien, war
erst Kaufmann, dann eine Zeitlang Artillerist und versuchte sich
endlich als Schauspieler wie auch als Theaterdichter. Sein erstes
Stück: "Die Wette um ein Herz" (1841), hatte einen
ungewöhnlichen Erfolg. Es folgten dann: "Der Goldteufel", in
welchem namentlich der Schauspieler Kunst glänzte, "Dichter
und Bauer" und "Unter der Erde", welch letzteres Stück sich
auf dem Repertoire erhalten hat. In allen bewährte S. ein
glückliches Nachstreben auf der Bahn Raimunds, ebenso nach
1848 in den Dramen: "Des Teufels Brautfahrt" und "Paperl" sowie in
den realistisch angelegten Volksstücken: "Unterthänig und
unabhängig" und "Liebe zum Volk". Dem Meister Ferdinand
Raimund brachte S. seine besondere Huldigung dar in dem
gleichnamigen Charakterbild, das sehr gefiel; auch "Das
Mädchen von der Spule" und andre Volksstücke
bewährten noch seine dichterische Kraft. Als dann das
französische Gesangs- und Ausstattungsstück zur
Herrschaft kam, zog sich S. von der Bühne zurück und
wandte sich der humoristisch-satirischen Journalistik zu. Er starb
2. Aug. 1888 in Wien.
Swieten, Gerard van, Arzt, geb. 7. Mai 1700 zu Leiden,
studierte daselbst und in Löwen, ward Professor der Medizin in
Leiden, 1745 Leibarzt der Kaiserin Maria Theresia, Vorsteher der k.
k. Bibliothek,
451
Swietenia - Swift.
Präsident der medizinischen Fakultät zu Wien, Direktor
des Medizinalwesens in der Monarchie und Bücherzensor. Er
starb 18. Juni 1772 in Schönbrunn. Er schrieb: "Commentarii in
Boerhaavii aphorismos de cognoscendis et curandis morbis" (Leid.
1741-42, 5 Bde.; neue Ausg., Tübing. 1790, 8 Bde.). Vgl. Beer,
Friedrich II. und van S. (Leipz. 1873); Fournier, Gerh. van S. als
Zensor (Wien 1877); W. Müller, Gerh. van S. (das. 1883). -
Sein Sohn Gottfried van S., geb. 1734 zu Leiden, gestorben als
Direktor der kaiserlichen Hofbibliothek zu Wien 29. März 1803,
war ein vertrauter Freund Haydns und Mozarts und bearbeitete
für erstern die Texte zur "Schöpfung" und den
"Jahreszeiten".
Swietenia L. (Mahagonibaum), Gattung aus der Familie der
Meliaceen, mit der einzigen Art S. Mahagoni L. (gemeiner
Mahagonibaum), einem 25-30 m hohen Baum mit weit ausgebreitetem,
dicht belaubtem Wipfel, drei- bis fünfpaarig gefiederten
Blättern, eirund-lanzettlichen, zugespitzten, lederigen
Blättchen, kleinen, weißlichgelben Blüten in
reichen axillären Rispen und braunen, faustgroßen
Samenkapseln. Dieser in Westindien und auf der Landenge von Panama
auf felsigem Boden wachsende Baum liefert das wegen seiner
Polierfähigkeit, Härte und Dauer als Furnierholz sehr
geschätzte Mahagoniholz. Im Handel unterscheidet man dasselbe
teils nach dem Vaterland, teils nach dem Ansehen. Am
geschätztesten ist das aus Jamaica, welche Insel aber infolge
des schonungslosen Fällens der Bäume jetzt nur noch
geringe Quantitäten liefert; das meiste, aber auch
geringwertigste, weil schrammige, grobfaserige Holz kommt von den
Küsten der Hondurasbai. Härter und schöner
gefärbt ist das Mahagoniholz von Haiti, Cuba und den
Bahamainseln (das Inselholz geht im Handel als spanisches
Mahagoni). Es ist schön braun, dunkelt stark an der Luft,
spaltet sehr schwer, spez. Gew. 0,56-0,88, schwindet sehr wenig,
nimmt schöne Politur an und verträgt auch gut
Temperaturwechsel. Da das Mahagoniholz nicht von Würmern
angegriffen wird und im Wasser von ungewöhnlicher Dauer ist,
so ist es auch zum Schiffbau sehr geeignet; außerdem dient es
zu Lagern für Maschinenbestandteile. Es ist seit dem Ende des
16. Jahrh. in Europa bekannt, wohin es von Trinidad gebracht wurde;
aber erst ein Jahrhundert später wurde es für unsern
Weltteil Handelsgegenstand. Während die Spanier es schon im
16. Jahrh. zum Schiffbau verwendeten, datiert seine Benutzung als
Möbelholz erst von 1724. Die bitter adstringierende Rinde
(Amarantrinde) wird in Jamaica gegen Wechselfieber und
Durchfälle angewendet und dient auch zur Verfälschung der
Chinarinde. Nach Einschnitten liefert der Baum ein Gummi, das als
Acajougummi in den Handel kommt. Afrikanisches Mahagoniholz
(Madeiramahagoni), s. v. w. Kailcedraholz; weißes
Mahagoniholz, das Holz von Anacardium; neuholläindisches
Mahagoni, das rote, veilchenartig riechende Holz von einigen
Eucalyptus-Arten.
Swift, Jonathan, polit. Satiriker der Engländer,
geb. 30. Nov. 1667 zu Dublin, zeigte bereits als Knabe jene
Misanthropie und stolze Selbstgenügsamkeit, welche S. als Mann
charakterisieren und ihn zu einer der originellsten, aber auch
abstoßendsten litterarischen Erscheinungen gemacht haben.
Drei Jahre seiner Kindheit brachte er in England zu, kam dann auf
die Schule zu Kilkenny, studierte seit 1682 im Trinity College zu
Dublin und ward 1688 Sekretär Sir William Temples zu Norr Park
in Surrey. Als Temple 1699 starb, gab S. dessen politische
Schriften heraus und ging dann als Kaplan des Earl Berkeley,
Vizekönigs von Irland, dorthin zurück. Seine Pfarrstelle
zu Laracor brachte ihm 400 Pfd. Sterl. jährlich ein. Bis 1710
lebte er daselbst, machte aber alljährlich Besuche in England
und zugleich die Bekanntschaft der leitenden Staatsmänner der
Whigpartei, welche damals das Ministerium in Händen hatten. Zu
gunsten der Whigminister veröffentlichte er 1701 das Pamphlet
"A discourse of the contests and dissensions between the nobles and
commons of Athens and Rome". 1710 unterhandelte S. im Auftrag des
Erzbischofs King, Primas von Irland, über die Abschaffung der
seitens der Iren an die englische Regierung zu zahlenden Zehnten,
und seine Bemühungen waren so erfolgreich, daß er bei
seiner Rückkehr nach Irland mit Glockengeläute empfangen
wurde. Indes sehnte er sich nach England zurück, um dem Herde
der hohen Politik näher zu sein, und da er bei den Whigs nicht
reüssiert hatte, machte er sich kein Gewissen daraus, nunmehr
zu den Tories überzugehen und seine frühern
Parteigenossen mit noch heftigerer Satire zu befehden als zuvor die
Tories. Das Ziel seines Ehrgeizes war ein englischer Bischofsitz;
die Minister waren auch nicht abgeneigt, ihm einen solchen zu
verschaffen, allein ihre Bemühungen blieben fruchtlos, und S.
wurde zu seiner höchsten Enttäuschung nur mit dem Dekanat
von St. Patrick in Dublin bedacht. Während seines nun
folgenden Aufenthalts in Irland (1714-26) wußte er von neuem
den höchsten Grad der Popularität zu erlangen, indem er
in heftigen Pamphleten, besonders in den "Drapier's letters"
("Tuchhändlerbriefe", 1723), gegen die englischen Minister die
Lage des unglücklichen Landes darlegte, was ihm mannigfache
Verfolgungen seitens der Regierung zuzog. Zu seinem Groll über
die Vernichtung seiner ehrgeizigen Hoffnungen kam um jene Zeit der
tragische Ausgang einer Doppelliebe. S. hatte längst ein
inniges Verhältnis mit Esther Johnson (Stella genannt), die er
in Sir Temples Haus hatte kennen lernen, faßte dann eine
zweite Neigung zu einer andern jungen Dame in London, Esther van
Homrigh (Vanessa), der er aber sein Verhältnis zu Stella nicht
zu gestehen wagte. Nach der Entdeckung starb Vanessa aus Gram
(1723) und einige Jahre später (1728) auch Stella, mit der er
sich kurz vorher noch heimlich hatte trauen lassen (vgl. sein
"Journal to Stella". deutsch, Berl. 1866). Allmählich
schwanden seine Geisteskräfte; er starb 19. Okt. 1745 in
Dublin und wurde in der Kathedrale von St. Patrick begraben. Als
Schriftsteller wurde S. berühmt durch die zuerst anonym
herausgegebenen Schritten: "Battle of the books" (1697) und "The
tale of a tub" (1704; deutsch von Boxberger, Stuttg. 1884).
Letzteres ist ein beißendes Pasquill gegen Papismus,
Luthertum und Calvinismus; in den Abenteuern der drei Helden Peter,
Jack und Martin werden die Streitigkeiten jener drei Kirchen
veranschaulicht. Die "Bücherschlacht" ist der Form nach eine
Art Parodie der Homerischen Schlachten und behandelt eine Frage,
die damals das ganze litterarische Europa beschäftigte,
nämlich die Überlegenheit der Alten (Griechen und
Römer) über die Modernen. S. entschied sich für die
erstern und entfaltete dabei, wie im "Märchen von der Tonne",
einen Sarkasmus, der ihn zum gefürchtetsten Pamphletisten
seiner Zeit machte. Seit 1724 war S. mit der Abfassung seines
berühmtesten Werkes: "Travels of Lemuel Gulliver",
beschäftigt, das 1726 erschien und allgemein die höchste
Bewunderung er-
452
Swilajinatz - Swir.
regte, auch in fast alle zivilisierten Sprachen übersetzt
wurde. Es enthält in einfacher und natürlicher Sprache
und unter der Miene der größten Ernsthaftigkeit eine
ergötzliche Satire auf menschliche Thorheit und Schwäche
im allgemeinen, mit zahlreichen Schlaglichtern auf die politischen,
religiösen und sozialen Zustände des damaligen England,
ist aber auch nicht frei von manchem Verletzenden, wozu namentlich
die von Swifts Menschenhaß eingegebene Schilderung der Yahoo
gehört. Von Schriften sind noch anzuführen: die im Verein
mit Pope herausgegebenen "Miscellanies" (1727, 3 Bde.) und die
posthume "History of the four last years of Queen Anne". Seine
Werke wurden herausgegeben von Hawkesworth (Lond. 1755, 14
Quartbände, Oktavausgabe in 24 Bänden), Sheridan (das.
1784, 17 Bde.), Walter Scott (mit Biographie, das. 1814, 19 Bde.;
neue Ausg. 1883, 10 Bde.), Roscoe (das. 1853, 2 Bde.), Purves (das.
1868). Sein Briefwechsel erschien in 3 Bänden (Lond. 1766) und
in Auswahl von Lane Pool (das. 1885). Eine Übersetzung der
humoristischen Werke lieferte Kottenkamp (Stuttg. 1844, 3 Bde.).
Aussprüche von S. sammelte Regis ("Swiftbüchlein",
biographisch-chronologisch geordnet, Berl. 1847). Vgl. auch R. M.
Meyer, I. S. und G. Lichtenberg (Berl. 1886). Sein Leben
beschrieben S. Johnson, Sheridan (Dubl. 1787), Forster
(unvollendet; Bd. 1, bis 1711 reichend, Lond. 1875), H. Craik (das.
1882); kürzer L. Stephen (das. 1882).
Swilajinatz, Flecken im serb. Kreis Tschupria, an der
Resawa, Sitz des Bezirkshauptmanns, mit Kirche, Untergymnasium und
(1884) 4563 Einw. Hier stand die römische Station Idimus.
Swinburne (spr. sswinnbörn), Algernon Charles, engl.
Dichter, geb. 5. April 1837 zu Henley an der Themse (Oxfordshire)
aus einer ursprünglich dänischen Familie, erhielt seine
Bildung in Eton und Oxford und schloß sich schon auf der
Hochschule einer Gruppe junger Männer an, die den Zweck
verfolgte, die englische Kunst umzugestalten. Ohne seine
Universitätsstudien zu beenden, begab er sich dann auf Reisen
und brachte einige Zeit in Florenz bei dem greisen Dichter W.
Savage Landor zu, welchem er seitdem die größte
Bewunderung erwies. Ähnliche Bewunderung hat er immer für
Victor Hngo und für Mazzini ausgesprochen. Er trat zuerst 1860
mit den Dramen: "The queen mother" und "Rosamond" auf, die aber
kaum Beachtung fanden. Dagegen erregte er bald darauf durch seine
von glühender Sinnlichkeit und politischem und religiösem
Radikalismus erfüllten, aber vom höchsten Wohllaut
getragenen Dichtungen ("Poems and ballads", 1866) einen Sturm
ebensowohl ästhetischer Bewunderung wie sittlicher
Entrüstung, welch letztere sich so entschieden aussprach,
daß S. sich in einer besondern Schrift: "Notes on poems and
reviews" (1866), verteidigte, sein Buch aber dem fernern Vertrieb
durch den Buchhandel entzog. Gegenwärtig zählt ihn die
Kritik, die ihn zuerst niederzuschlagen versuchte, zu den
hervorragendsten Erscheinungen der Litteratur Englands. Seine
Dramen, deren Stoff bald dem Altertum, bald der neuern Geschichte
entlehnt und deren Form teils den Griechen, teils Shakespeare
nachgeahmt ist, sind ihres hohen Schwunges, ihrer kraftvollen
Schilderung und ihrer reichen poetischen Einbildungskraft
ungeachtet teils durch antike Fremdartigkeit, teils durch
übermäßige Länge zur Aufführung
ungeeignet. Es sind: die Tragödie "Atalanta in Calydon" (1864;
deutsch von A. Graf Wickenburg, Wien 1878), die Trilogie
"Chastelard" (1865; deutsch von Horn, Brem. 1873), "Bothwell"
(1874, 3. Aufl. 1882), "Erechtheus" (1876) und "Mary Stuart"
(1881), "Marino Faliero" (1885) und "Locrine", Tragödie
(1887). Außerdem hat S. auf dichterischem Gebiet
veröffentlicht: "A song of Italy", ein Mazzini gewidmeter
dithyrambischer Hymnus in republikanischem Sinn" (1867); "Siena, a
poem" (1868); "Ode on the proclamation of the French republic"
(Victor Hugo gewidmet, 1870); die vortrefflichen "Songs before
sunrise" (1871), die zu seinen reifsten Schöpfungen
gehören, und "Songs of two nations" (1875); die "Songs of the
springtides" (1875), welche seine "Birthday ode" an Victor Hugo
enthalten; zwei neue Folgen von "Poems and ballads" (1878 u. 1889),
das epische Gedicht "Tristram of Lyoness" (1882), eine Sammlung
lyrisch-didaktischer Gedichte: "A century of roundels (1883), und
"A midsummer holiday" (1884). In den "Notes of an English
republican on the Muscovite crusade" (1876) trat er Gladstone und
seinem russenfreundlichen Anhang mit Wucht entgegen. Ebenso
bewährte er sich als scharfer Kritiker in einer Reihe von
Schriften, wie: "William Blake" (1868), "Under the microscope",
eine Verteidigung gegen die Anklage der Begründung einer
"fleischlichen Schule der Poesie" (1872), "George Chapman" (1875),
"A note on Charlotte Bronte" (1877), "A study of Shakespeare"
(1879), "Studies in song" (1881), "Study of Victor Hugo" (1886),
"Miscellanies" (1886) u. a. Eine Sammlung seiner kleinern
Prosaschriften erschien unter dem Titel: "Essays and studies"
(1875, 3. Aufl. 1888). S. schreibt auch französische Verse und
hat den altfranzösischen Dichter Villon durch
Übersetzungen in England eingeführt. Vgl. "Bibliography
of A. C. S." (Lond. 1887).
Swindon (spr. sswinnd'n), Stadt in Wiltshire (England),
hat eine Kornbörse, einen Park, großartige
Werkstätten der Westbahn und (1881) 22,374 Einw.
Swinemünde, Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Stettin, auf der Insel Usedom, an der Mündung der Swine und an
der Linie Ducherow-S. der Preußischen Staatsbahn, hat eine
evangelische und eine altluther. Kirche, eine altkatholische
Kapelle, ein israelitisches Bethaus, einen Hafen (Vorhafen von
Stettin), welcher an der Seeseite durch einige Forts befestigt ist,
einen Leuchtturm, elektrische Straßenbeleuchtung, ein
Amtsgericht, ein Hauptzollamt, ein Lotsenkommando, ein Seebad
(1887: 3941 Badegäste), lebhafte Schiffahrt, Fischerei und
(1885) mit der Garnison (ein Füsilierbat. Nr. 34 und ein Bat.
Fußartillerie Nr. 2) 8626 meist evang. Einwohner. Im Hafen
von S. liefen 1886 beladen ein: 557 Schiffe von 270,114 Ton., aus:
240 Schiffe von 71,462 T. S. besaß 1887: 26 Schiffe von 4245
T. Der Ort wurde 1748 von Friedrich d. Gr. an Stelle des Dorfs
Westswine angelegt und erhielt 1765 Stadtrechte. In der Nähe
der Ziroberg mit Aussichtsturm.
Swinton (spr. sswinnt'n), Stadt im westlichen Yorkshire
(England), 8 km nordöstlich von Rotherham, hat Glashütten
und Töpfereien und (1881) 7612 Einw.
Swinton mit Pendlebury (spr. péndelböri),
Fabrikstadt in Lancashire (England), unfern Manchester, mit
Baumwollmanufaktur, Ziegeleien und (1881) 18,107 Einw.
Swir, schiffbarer Fluß im russ. Gouvernement
Olonez, der Abfluß des Onegasees in den Ladogasee, ist 214 km
lang und gehört zu dem großen Wassersystem, welches die
Newa mit der Wolga und dem Weißen Meer verbindet, indem er
zunächst das Verbindungsglied zwischen dem Tichwinschen
Kanal-
453
Swischtow - Sydenham.
system und dem Marienkanalsystem bildet. Der Swirkanal
führt aus dem S. in den Sjas.
Swischtow (Sistov), Kreishauptstadt in Bulgarien, rechts
an der Donau, zwischen Nikopoli und Rustschuk, hat Baumwollweberei,
Gerberei, Schifffahrt, Handel, Weinbau und (1887) 12,482 Einw. Hier
30. Dez. 1790 Friedenskongreß und 4. Aug. 1791
Definitivfriede zwischen Österreich und der Türkei. 1810
durch die Russen zerstört und durch Auswanderung vieler
Bulgaren herabgekommen, gelangte S. erst durch die
Donaudampfschiffahrt zu neuer Blüte. Am 22. Juni 1877 gingen
die Russen von Zimnitza nach S. über die Donau und schlugen
darauf eine Schiffbrücke bei S., über welche ihre Armee
in Bulgarien einrückte.
Swjatoi-Noß, niedriges Vorgebirge im ruff.
Gouvernement Archangel, auf der Halbinsel Kola, westlich am Eingang
in das Weiße Meer.
Swod Sakonow (russ., "Sammlung von Gesetzen"), russisches
Gesetzbuch, enthaltend das in den Ukasen gegebene Recht; publiziert
1833 und seitdem wiederholt herausgegeben.
Syagrius, letzter röm. Statthalter in Gallien, Sohn
des Ägidius, der seit 461 Beherrscher eines Landstrichs im
nordwestlichen Gallien mit der Hauptstadt Soissons gewesen war,
erbte nach des Vaters Tod 476 jenes Gebiet, erweiterte dasselbe und
be-herrschte es, bis er 486 von dem Frankenkönig Chlodwig bei
Soissons besiegt und hingerichtet wurde.
Sybaris, berühmte, von Achäern und
Trözenern um 720 v. Chr. gegründete griech. Pflanzstadt
in der Landschaft Chonia (Lukanien), am Tarentinischen Meerbusen,
gelangte durch die Fruchtbarkeit ihres Gebiets und ihren
blühenden Handel bald zu bedeutender Macht und
Größe. Zu ihrem Gebiet gehörte zur Zeit ihrer
Blüte die ganze Westhälfte des spätern Lukanien,
doch ist ihre Geschichte ziemlich unbekannt. Infolge ihres
großen Reichtums ergaben sich die Bewohner (Sybariten) einem
so üppigen und weichlichen Leben, daß das
"Sybaritenleben" sprichwörtlich wurde. Nachdem die Stadt 510
von den Krotoniaten zerstört worden, legten 443 die Reste der
vertriebenen Sybariten, durch neue Kolonisten aus Griechenland
(darunter Herodot und der Redner Lysias) verstärkt, weiter
landeinwärts von der zerstörten Stadt eine neue an, die
sie nach einer nahen Quelle Thurii nannten. Hannibal ließ
dieselbe 204 plündern; 194 wurde sie römische Kolonie.
Die Zeit ihres Untergangs ist nicht bekannt. Im Winter 1887/88 hat
die italienische Regierung mit der Ausgrabung der Ruinen von S.
begonnen.
Sybel, Heinrich von, deutscher Geschichtschreiber, geb.
2. Dez. 1817 zu Düsseldorf, studierte in Berlin, namentlich
von Ranke angeregt, Geschichte, habilitierte sich 1841 als
Privatdozent der Geschichte zu Bonn, ward 1841 Professor daselbst
und 1846 in Marburg. Er war 1848-49 Mitglied der hessischen
Ständeversammlung und 1850 des Erfurter Staatenhauses, ward
1856 Professor in München, 1857 Mitglied der dortigen Akademie
und 1858 Sekretär der Historischen Kommission. Seit 1861
Professor in Bonn, war er 1862-64 Mitglied des preußischen
Landtags, in welchem er namentlich die polnische Politik Bismarcks
tadelte, ward 1867 nationalliberales Mitglied des konstituierenden
Reichstags des Norddeutschen Bundes, 1874 wieder Mitglied des
Abgeordnetenhauses, in welchem er auf Grund seiner Erfahrungen am
Rhein besonders die Ultramontanen bekämpfte, 1875 Direktor der
Staatsarchive in Berlin, 1876 Mitglied der dortigen Akademie und
1878 Geheimer Oberregierungsrat. Sein Abgeordnetenmandat legte er
1880 nieder. Er veranlaßte die "Publikationen aus den
preußischen Staatsarchiven", die Herausgabe der "Politischen
Korrespondenz Friedrichs d. Gr.", die Gründung der
preußischen historischen Station und ward Mitglied der
Direktion der "Monumenta". Er schrieb: die durch kritische
Schärfe und geistvolle Darstellung ausgezeichnete "Geschichte
des ersten Kreuzzugs" (Düsseld. 1841, 2. Aufl. 1881); "Die
Entstehung des deutschen Königtums" (Frankf. 1844, 2. Aufl.
1881), über welche er mit Waitz in eine lange litterarische
Fehde geriet; "Geschichte der Revolutionszeit von 1789 bis 1795"
(Marb. 1853-58, 3 Bde.; 4. Aufl., Düsseld. 1877), welche auf
Grund eingehender Studien die französische Revolution
namentlich im Zusammenhang mit der damaligen europäischen
Politik beleuchtet, S. aber wieder in einen heftigen Streit mit
Hüffer, Herrmann und Vivenot verwickelte, da S. die
preußische Politik, besonders den Baseler Frieden,
verteidigte, dagegen die österreichische Politik seit 1792
scharf verurteilte. Es folgten: die "Geschichte der Revolutionszeit
von 1795 bis 1800" (Düsseldorf 1872-74, 2 Bde.; 2. Aufl.
1878-79); "Die deutsche Nation und das Kaiserreich" (das. 1862).
Seine "Kleinen historischen Schriften" (Münch. 1863-81, 3
Bde.) enthalten auch seine vorzüglichen Vorträge. 1856
gründete er die noch unter seiner Leitung stehende
"Historische Zeitschrift". S. ist ein ebenso gründlicher,
methodischer Forscher wie glänzender, wirkungsvoller
Darsteller.
Syceesilber (Sissisilber), hochfeines (0,960) Silber in
schuhähnlichen Barren (daher shoes), dient in China als
Tausch- und Zahlungsmittel für den größern Verkehr.
Das große Sissi wiegt 50, das kleine 7,10 oder 19 Taels.
Sydenham (spr. ssíddenhäm), eine der
südlichen Vorstädte Londons, an der Grenze der
Grafschaften Kent und Surrey, berühmt durch den 1853-54 von
Sir Joseph Paxton errichteten Glaspalast (Crystal Palace), bei
dessen Bau die Materialien (ausschließlich Glas und Eisen)
des 1851 im Hyde Park erbauten Ausstellungsgebäudes Verwendung
fanden. Nachdem das nördliche Querschiff 30. Dez. 1866 durch
eine Feuersbrunst zerstört worden, hat der Bau eine
Gesamtlänge von 324 m. Das Mittelschiff ist 22 m breit und 32
m hoch, das mittlere Querschiff 118 m lang, 36,5 m breit und 51,2 m
hoch. Vier Galerien laufen um dasselbe herum. Am westlichen Ende
steht das Händel-Orchester mit Raum für 4000
Künstler und einer Orgel mit 4598 Pfeifen. Ein Konzertsaal und
Theater schließen sich an dasselbe an. Im nördlichen
Teil des Palastes findet man Nachbildungen verschiedener Baustile,
meist in verjüngtem Maßstab, als: einen ägyptischen
Tempel, griechische und römische Wohnhäuser, einige
Räumlichkeiten der Alhambra und Höfe im byzantinischen,
gotischen und italienischen Stil. Das ehemalige "tropische
Departement" ist leider ein Raub der Flammen geworden. Südlich
vom Händel-Orchester liegen vier sogen. Industrial courts,
für den Verkauf von Glas, Kurzwaren, Kunstgegenständen
etc., und die Nachbildung eines pompejanischen Hauses. Im
südlichen Querschiff befinden sich ein von reizenden
Blumenbeeten umgebener Springbrunnen, eine Sammlung ethnologischer
Modelle, Abgüsse einiger der berühmtesten Bildhauerwerke
der Welt etc. Die geräumigen Galerien bieten Raum für
eine Gemäldeausstellung, Lesezimmer, Verkaufsbuden etc. Im
Unterstock endlich liegt ein Aquarium. Großartig sind auch
die Gartenanlagen und die Wasserkünste, welche alle
ähnlichen Werke weit
454
Sydenham - Sydow.
übertreffen; der bedeutendste Wasserstrahl erreicht eine
Höhe von 75 m. Der Kristallpalast, dessen Baukosten sich auf 1
1/2 Mill. Pfd. Sterl. beliefen, ist Eigentum einer
Privatgesellschaft und wird jährlich von über 2 Mill.
Menschen besucht.
Sydenham (spr. ssídenhäm), Thomas, Arzt, geb.
1624 zu Windford-Eagle in Dorsetshire, studierte seit 1642 zu
Oxford und London, erwarb dann in Oxford das Bakkalaureat,
promovierte in Cambridge und ließ sich als Arzt in London
nieder. Er gilt Paracelsus gegenüber, welcher immer nur
umzustürzen bestrebt war, als der "positive" Reformator der
praktischen Medizin. Die Bedeutung der Thatsachen und direkten
Beobachtungen stellte er obenan; die Krankheiten faßte er auf
als Prozesse, die Symptome derselben als etwas rein
Äußerliches, das nach der Konstitution wechseln kann; er
suchte namentlich die verschiedenen Krankheitsformen bestimmt
abzugrenzen, zunächst um für die Anwendung spezifischer
Heilmittel sichere Anhaltspunkte zu gewinnen. Hierbei geriet er
jedoch in eine rein ontologische Auffassung hinein, die ihn sogar
dahin bringt, die Krankheiten nach einem botanischen Schema zu
klassifizieren. S. huldigte im allgemeinen einer energischen
Therapie, in welcher China und Opium und namentlich der
Aderlaß eine hervorragende Rolle spielten. Er starb 29. Dez.
1689. Gesammelt erschienen seine durchweg in lateinischer Sprache
abgefaßten Schriften als "Opera omnia" London 1685 (zuletzt,
das. 1844; in engl. Übersetzung, das. 1848-50, 2 Bde.;
deutsch, Wien 1786-87, 2 Bde.). Vgl. Jahn, Sydenham (Eisenach
1840); Brown, Locke and S. (Edinb. 1866).
Sydney (spr. ssíddni), 1) Hauptstadt der
britisch-austral. Kolonie Neusüdwales, am südlichen Ufer
des Port Jackson und 6 km vom Stillen Ozean, unter 33° 51'
südl. Br. und 151° 11' östl. L. v. Gr. Die Stadt ist
mit Ausnahme des ältesten Teils regelmäßig
angelegt, hat Gas- und Wasserleitung, Dampftrambahnen und besitzt
viele schöne Bauten, wie die Universität, die
anglikanische und die katholische Kathedrale, den Palast des
Gouverneurs, die 13 Bankgebäude, Börse, Generalpostamt,
Rathaus, Museum, Regierungsgebäude, 5 Theater. Von den
öffentlichen Anlagen sind der schöne botanische Garten,
die "Domäne", Hydepark, Prince Alfred-Park u. a. zu nennen,
mit Statuen Sir Richard Bourkes, Cooks und Prinz Alberts. Die Stadt
hatte 1800 erst 200, Ende 1887 aber mit den Vorstädten bereits
348,695 Einw., welche schon lebhafte Industrie treiben. Es bestehen
großartige Leder-, Schuhzeug- und Wollzeugfabriken, 50
Kleiderfabriken, große Dampftischlereien, Wagen- und
Maschinenbauaustalten, Eisengießereien, Brauereien etc. Auf
mehreren mit allen modernen Hilfsmitteln ausgerüsteten Werften
mit Docks werden große Dampfer gebaut. Eine nach dem Innern
führende Eisenbahn verzweigt sich wenige Kilometer von der
Stadt. Der Hafen ist vorzüglich, die größten
Schiffe können an den Kais anlegen; 1887 liefen ein: 1665
Schiffe von 2,109,830 Ton. Zum Hafen von S. gehören 576
Segelschiffe von 63,121 T. und 403 Dampfer von 47,675 T. S. ist
Endstation für die Postdampfer des Norddeutschen Lloyd, der
Messageries maritimes, der großen englischen
Postdampferlinien durch den Suezkanal und über San Francisco
nach Europa und vieler andrer Dampfergesellschaften. Von
Bildungsanstalten besitzt S. außer einer Universität mit
3 theologischen Seminaren mehrere höhere Schulen, eine
Kunstschule mit Bibliothek von 25,000 Bänden und Museum,
öffentliche Bibliothek mit 70,000 Bänden,
Handwerkerinstitut mit 20,000 Bänden. Es erscheinen 6
Zeitungen täglich, 15 wöchentlich, 10 monatlich. Die
Stadt hat zahlreiche Wohlthätigkeitsanstalten und ist Sitz des
Gouverneurs, des Parlaments und der Regierung, eines katholischen
Erzbischofs und eines englischen Bischofs, des obersten
Gerichtshofs, eines deutschen Berufskonsuls (für Australien
und die Südsee) und eines Konsuls, einer Handelskammer u.
Münzstätte. Stadt und Hafen sind durch eine Reihe von
Forts geschützt; außer einem Freiwilligenkorps besitzt
die Stadt kein Militär, ist aber Hauptquartier für die
neun britischen Kriegsschiffe der australischen Station. -
Situationsplan von Sydney
2) Hauptort von Cape Breton Island (s. d.).
Sydow, 1) Karl Leopold Adolf, protestant. Theolog, geb.
23. Nov. 1800 zu Charlottenburg, einer der treuesten Schüler
Schleiermachers, wurde 1836 zum Hofprediger in Potsdam, 1846 zum
Prediger an der Neuen Kirche in Berlin berufen. Von Friedrich
Wilhelm IV. nach England zur Beobachtung der dortigen kirchlichen
Zustände geschickt, gab er ein von der Königin Viktoria
veranlaßtes Gutachten über die schottische
Kirchentrennung heraus: "Die schottische Kirchenfrage" (Potsd.
1845). Bekannt ist er namentlich durch die infolge eines 12. Jan.
1872 im Unionsverein von ihm gehaltenen Vortrags: "Über die
wunderbare Geburt Jesu" (gedruckt in der Sammlung "Protestantischer
Vorträge", Berl. 1873), gegen ihn eingeleitete
Disziplinaruntersuchung geworden, die 5. Juli 1873 mit einem
"geschärften Verweis" endete (vgl. darüber die von S.
veröffentlichten "Aktenstücke", 2. Aufl., Berl. 1873).
Bald darauf trat er in den Ruhestand und starb 22. Okt. 1882. Sein
Leben beschrieb seine Tochter Marie S. (Berl. 1883).
2) Emil von, hervorragender Geograph, geb. 15. Juli 1812 zu
Freiberg in Sachsen, trat 1830 als Leutnant in die preußische
Armee, ward 1843 als Mitglied der
Militärexaminationskommission nach Berlin berufen, wo er
später auch Vorlesungen an der Kriegsakademie hielt, lebte
1855-60 in Gotha und starb 13. Okt. 1873 in Berlin als Oberst und
Abteilungschef im Nebenetat des Großen Generalstabs. Seine
Aufsätze und kritischen Arbeiten über Kartographie in
"Petermanns Mitteilungen", seine zahlreichen Kartenwerke:
"Wandkarten", "Methodischer Hand-
455
Syene - Sylt.
atlas" (4. Aufl., Gotha 1867; neu bearbeitet von H. Wagner, 2.
Aufl. 1889), "Schulatlas in 42 Blättern" (28. Aufl., das.
1876), "Hydrographischer Atlas" u.a., ebenso seine Aussätze in
den "Mitteilungen", "Unsere Zeit" und namentlich in
militärischen Zeitschriften sind zu ihrer Zeit von
großem Wert gewesen. Auch veröffentlichte S.:
"Grundriß der allgemeinen Geographie" (Gotha 1862, 1. Abt.)
und "Übersicht der wichtigsten Karten Europas" (Berl. 1864).
Vgl. "Emil v. S., ein Nachruf" (Berl. 1874).
Syene, Stadt, s. Assuân.
Syenit, gemengtes kristallinisches Gestein, in seinen
typischen Varietäten aus Orthoklas und Hornblende bestehend.
Mit dem Granit (s. d.) ist der S. vermittelst Übergänge,
welche durch Zurücktreten der Hornblende und Ausnahme von
Quarz und Glimmer hervorgerufen werden, eng verknüpft
(Syenitgranit). Neben Orthoklas tritt mitunter gleichzeitig auch
Oligoklas in das Gemenge, der sich dann von dem Orthoklas
häufig durch leichtere Verwitterbarkeit und dadurch bedingte
Trübung unterscheidet. Von accessorischen Bestandteilen ist
außer Magneteisen, Eisenkies, gediegenem Kupfer und
Kupferverbindungen als besonders charakteristisch Titanit
aufzuführen. S. besitzt gewöhnlich mittelkörnige
Struktur; eine porphyrartige entsteht, wenn einzelne Orthoklase in
großern Individuen entwickelt sind, schieferige durch
lagenweise Verteilung der Hornblende oder auch des Glimmers in den
granitischen Varietäten. Absonderungsformen sind selten, doch
kennt man von einzelnen Lokalitäten kugelige und
säulenförmige, erstere namentlich bei beginnender
Verwitterung hervortretend. Die mittlere chemische Zusammensetzung
schwankt zwischen 50-62 Proz. Kieselsäureanhydrid, 15-20
Thonerde, 6-14 Eisenoxydul, 1-6 Magnesia, 4-9 Kalk, 2-5 Natron und
3-7 Proz. Kali. Das spezifische Gewicht ist 2,7 bis 2,9.
Hinsichtlich der Altersverhältnisse und der Hypothesen
über Bildung des Syenits ist auf das, was über Granit
gesagt worden ist, zu verweisen. Die Verwitterung des Syenits
führt häufig zur Blockbildung, deren Residua, lokal
aufgehäuft, sogen. Felsenmeere darstellen. Eins der
berühmtesten ist dasjenige bei Auerbach an der
Bergstraße (s. Felsberg). Als letztes Produkt der
Verwitterung bildet sich ein ockergelber eisenschüssiger Lehm,
oft mit Splittern von Hornblende oder mit aus derselben
entstandenen Chloritschüppchen gemengt. Dem Vorkommen nach ist
der S. gewöhnlich wiederum mit granitischen Gesteinen eng
verknüpft. Besonders entwickelt ist er in Sachsen (Umgegend
von Dresden und Meißen), Thüringen, im Odenwald, in
Mähren, Norwegen, Irland und Nordamerika. Er dient, wie schon
im alten Ägypten, zu architektonischen Zwecken, Säulen,
Obelisken, Vasen etc. Sein Magneteisengehalt, infolge von
natürlichen durch Anlage von Fanggruben unterstützten
Schlämmungsprozessen lokal aufgehäuft, versieht am
Vitosgebirge in der Türkei eine kleine Eisenindustrie mit Erz.
Verwandte Gesteine, teilweise nur als lokale Varietäten des
Syenits zu betrachten, sind: der Monzonit (nach dem Berg Monzoni in
Südtirol so genannt), aus Orthoklas, Oligoklas u. Augit,
accessorisch auch Hornblende, bestehend ; der Zirkonsyenit
Norwegens und Grönlands, welcher neben Orthoklas und
Hornblende Eläolith (s. Nephelin) und Zirkon führt und
sich im Gegensatz zu dem normalen S. durch seinen Reichtum an
accessorischen Bestandteilen (mehr als 50 zum Teil sehr seltene
Mineralspezies) auszeichnet; der Foyait (vom Berg Foya in
Portugal), aus Orthoklas, Hornblende und Eläolith
zusammengesetzt; der Miascit (von Miask im Ilmengebirge), von
Orthoklas, Glimmer und Eläolith, mitunter auch Sodalith,
gebildet.
Syenitgranit (Hornblendegranit), s. Granit und
Syenit.
Syke, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk
Hannover, an der Linie Wanne-Bremen der Preußischen
Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, Schweinehandel
und (1885) 1118 Einw.
Sykomore, s. v. w. Maulbeerfeigenbaum, s. Ficus, auch s.
v. w. Platane und gemeiner Bergahorn.
Sykophanten (griech.), in Athen diejenigen, welche jemand
wegen verbotener Ausfuhr von Feigen denunzierten; sodann die
Denunzianten, welche ein Gewerbe daraus machten, durch Androhung
von falschen Anklagen, Verleumdungen und Schikanen aller Art die
Begüterten zu brandschatzen. Die strengsten Strafen vermochten
in der Zeit der politischen Entartung das Unwesen nicht
auszurotten.
Sykosis, s. Bartfinne.
Sylburg, Friedrich, Philolog, geb. 1536 zu Wetter bei
Marburg, lehrte an den Schulen zu Neuhaus bei Worms und zu Lich in
der Wetterau, ward 1582 Korrektor bei dem Buchdrucker Wechel in
Frankfurt a. M., 1591 bei Commelin in Heidelberg und Bibliothekar
der Universität daselbst; starb dort 17. Febr. 1596. Er war
ein eifriger Förderer des Griechischen. Seine Ausgaben des
Pausanias, Aristoteles, Dionysios von Halikarnaß, Clemens von
Alexandria, des "Etymologicum magnum" u. a. sind ausgezeichnet
durch Genauigkeit der kritischen Methode. Auch bearbeitete er des
Clenardus "Institutiones linguae graecae" (Frankf. 1580) und war
Mitarbeiter des H. Stephanus am "Thesaurus linguae graecae". Vgl.
F. G. Jung, Lebensbeschreibung Fr. Sylburgs (Berleburg 1745);
Creuzer, Opuscula selecta, S. 196 ff.
Syllabarium (lat.), ABC-Buch.
Syllabieren, Buchstaben, richtiger: Laute, zusammen in
Silben aussprechen; syllabisch, silbenweise. Syllabiermethode,
wobei nach Aussprechen der einzelnen Buchstaben die einzelnen
Silben und zuletzt die ganzen Wörter ausgesprochen werden, wie
es z. B. in den Anstalten Pestalozzis geschah.
Syllabus (griech.), Verzeichnis; bekannt besonders der
der päpstlichen Encyklika vom 8. Dez. 1864 beigegebene S.,
eine Aufzählung und Verdammung aller mit der streng
römischen Auffassung nicht verträglichen Prinzipien und
Formen des modernen Lebens (s. Pius 9).
Syllepsis (griech., "Zusammenfassung"), Zusammenziehung
zweier Silben in eine; auch grammatische Figur, durch welche ein
Prädikat auf zwei oder mehrere Subjekte bezogen wird, die in
Bezug auf Person, Numerus und Genus verschieden sind (s.
Zeugma).
Syllogismus (griech.), in der Logik der einfache
Schluß, in welchem die Gültigkeit eines Urteils
(Schlußsatz) durch zwei andre (Vordersätze oder
Prämissen) begründet wird. S. Schluß.
Sylochelidon, Raubseeschwalbe, s. Seeschwalbe.
Sylphen (griech.), im System des Paracelsus
Elementargeister, deren Wohnort die Luft war, und die zum Dienste
der Menschen bereit waren. Ein solcher war z. B. Oberon (s. d.).
Sylphiden heißen die weiblichen Luftgeister.
Sylt (Silt, v. altfries. Silendi, "Seeland"), Insel in
der Nordsee, zum Kreis Tondern der preuß. Provinz
Schleswig-Holstein gehörig, 12-22 km von der schlesischen
Küste entfernt, ist von N. nach Sü-
456
Sylva - Symbiose.
den 36 km lang, 1-14 km breit und zählt 3410 Einw. Der
nördliche Teil der Insel heißt List, die südliche
Halbinsel Hörnum. In der Mitte ragt gegen SO. in das
Wattenmeer ("Haff") eine breite Halbinsel hinein, deren
äußerste Spitze Nösse heißt. Sandklittern
oder Dünen erfüllen die südliche Halbinsel, ebenso
die nördliche Hälfte der nördlichen Halbinsel,
während der mittlere Hauptteil, auf der Tertiärformation
aufgebaut (Morsumkliff am Wattenmeer, Rotes Kliff an der Seeseite),
Geest- und Marschland enthält, von denen das letztere sich
durch Absetzung von Schlamm in das Wattenmeer hinein beständig
vergrößert, während auf der Seeseite Stürme
und die Wellen der Nordsee der Insel ebenso stetig Abbruch thun, so
daß die teilweise bis 30 m hohen Sandberge, in
beständiger Wanderung begriffen, immer mehr landeinwärts
rücken. Im Januar 1300 wurde der Flecken Wenningstadt an der
Westküste, 1362 das Dorf Steidum von den Fluten verschlungen.
Die wichtigsten Orte auf S. sind: Keitum (s. d.) mit 853 Einw.,
Tinnum mit Amtsgericht und 162 und Morsum mit 671 Einw. auf der
östlichen, Rantum auf der südlichen Halbinsel mit 260,
Westerland (s. d.) an der See mit Seebad, Krankenisolierhaus und
899 und Norddörfer mit 295 Einw. Ein Leuchtturm befindet sich
auf einem Hügel südlich von Kampen, Leuchtfeuer an
verschiedenen Stellen der Küste. Die Bewohner sind Friesen,
nur in List Dänen; Kirchen-, Unterrichts- und Gerichtssprache
war von jeher deutsch. In der Nähe des Lenchtturms wurden
neuerlich altheidnische Grabstätten von bedeutendem Umfang
aufgefunden. S. ward im Krieg von 1864 durch den dänischen
Kapitän Hammer schwer heimgesucht, von den Preußen aber
13. Juli in Besitz genommen. Seitdem hat die preußische
Regierung größere Summen zum Schutz der Westseite der
Insel gegen die gefahrdrohenden Abspülungen durch das Meer
verwendet. Der Besuch des Seebades ist in steter Zunahme begriffen.
Regelmäßige Dampferverbindungen finden von Hoyer nach
Keitum statt, von wo jetzt aus Munkmarsch eine
Dampfstraßenbahn nach Westerland führt. Ferner hat S.
Dampferverbindung mit Hamburg über Helgoland. Vgl. Hansen, Die
nordfriesische Insel S. (Leipz. 1859); Meyn, Geologische
Beschreibung der Insel S (Berl. 1876); Kunkel, Der Kurort S. und
seine Heilwirkung (Kiel 1878); Hepp, Wegweiser auf S. (3. Aufl.,
Tondern 1885).
Sylva (lat.), s. Silva.
Sylva, Carmen, Pseudonym der Königin Elisabeth von
Rumänien (s. Elisabeth 10).
Sylvanerz, Sylvanit, s. v. w. Schrifterz (s. d.).
Sylvester, s. Silvester.
Sylvester, James Joseph, Mathematiker, geb. 3. Sept. 1814
zu London, studierte in Cambridge, wurde 1837 Professor der Physik
am University College in London, 1840 Professor der Mathematik an
der Universität von Virginia, 1855 an der Militärakademie
in Woolwich, 1870 an der John Hopkin's University in Baltimore und
1883 Professor der Geometrie in Oxford. Er erfand mehrere
geometrische Instrumente, wie den Plagiographen, den geometrischen
Fächer etc., 1885 veröffentlichte er die "Theorie der
Reciprozienten", durch welche die frühern Hilfsquellen der
modernen Algebra mehr als verdoppelt wurden. S. stellte auch eine
Theorie der Verifikation auf.
Sylvesterorden, s. Goldener Sporn.
Sylvia, Grasmücke.
Sylviidae (Sänger), Familie der Sperlingsvögel
(s. d.); Sylviinae, echte Sänger.
Sylvin (Hövellit, Schätzellit), Mineral aus der
Ordnung der einfachen Haloidsalze, kristallisiert tesseral, findet
sich meist in körnigen oder stängeligen Aggregaten, auch
derb und eingesprengt, ist farblos oder gefärbt,
glasglänzend, durchsichtig, Härte 2, spez. Gew. 1,9-2,0,
besteht aus Chlorkalium und findet sich in größter Menge
in linsenförmigen Einlage-rungen von 3-5 cm Dicke und 2-4 m
Länge im salzführenden Thon bei Kaluschin und wird hier
bergmännisch gewonnen. In Staßfurt findet sich S. im
Kieserit, auch kommt er als vulkanisches Sublimat am Vesuv vor. Er
dient zur Darstellung von Kalisalzen.
Sylvius, 1) Jacob (Dubois), Anatom, geb. 1478 zu Amiens,
studierte in Paris, hielt dort bis zu seinem Tod 1555 unter
großem Beifall anatomische Vorlesungen und bereicherte die
Anatomie durch wichtige Entdeckungen und Erfindungen. Nach ihm sind
die Sylviussche Grube und die Sylviussche Wasserleitung im Gehirn
(s. d., S. 2) benannt. Seine "Opera medica" erschienen in Genf
1630.
2) Franz, Mediziner, s. Boe.
3) Pseudonym, s. Texier 2).
Symbiose (griech.), nach einem von dem Botaniker A. de
Bary eingeführten Kunstausdruck das engere Zusammenleben
mehrerer, gewöhnlich zweier Lebewesen verschiedener Art, die
einander wechselseitig nützen und zusammen besser gedeihen als
jeder der Genossenschafter für sich. Der letztere Umstand
unterscheidet die S. vom Parasitismus, bei welchem der Schmarotzer
(s. d.) einseitig Vorteil zieht und der Wirt einzig Nachteil hat.
Einen Übergang zwischen beiden Verhältnissen macht das
durch I. van Beneden als Mutualismus bezeichnete Verhältnis,
bei welchem z. B. Hautschmarotzer ihrem Wirte durch Verzehren von
Hautabfällen und Absonderungsprodukten Säuberungsdienste
leisten, ein näheres Ineinanderleben und gegenseitiges
Anpassen aber nicht stattgefunden hat. Man kann drei
Hauptfälle der S. unterscheiden: 1) zwischen Pflanzen unter
sich, 2) zwischen Tieren unter sich und 3) zwischen Tier und
Pflanze. Von dem Zusammenleben zweier niederer Pflanzen geben die
aus Pilzen und einzelligen Algen bestehenden Flechten (s. d.) das
lehrreichste und am längsten bekannte Beispiel; die Algen
bereiten dabei im Licht Nahrungsstoffe aus der Luft, während
die davon mitzehrenden Pilzfäden Nahrung aus der Unterlage
ziehen und eine geeignete, Feuchtigkeit zurückhaltende
Hülle bilden. Ein andres derartiges Beispiel bietet die
Mycorhiza (s. d.). Zu der S. zwischen Tieren gehört als das am
längsten bekannte Beispiel das Wohnen des Muschelwächters
(Pinnoteres veterum), einer kleinen Krabbenart, in den Schalen der
Steckmuscheln (Pinna). Die Alten glaubten, der an der
Schalenöffnung liegende Krebs benachrichtige das Muscheltier
durch Kneipen mit den Scheren von nahender Gefahr oder Beute und
erhalte dafür seinen Anteil an der letztern. Sicherer
festgestellt ist der gegenseitige Vorteil bei dem oft geschilderten
"Freundschaftsverhältnis" der Einsiedlerkrebse mit den
Aktinien oder Seerosen, die sich auf den von jenen bewohnten
Schneckenhäusern ansiedeln. Denn die Seerosen sind wegen der
von ihnen ausgeschleuderten Nesselorgane gefürchtete
Meerestiere, die dem namentlich von Sepien verfolgten
Einsiedlerkrebs Schutz gewähren und dafür von ihm an
günstige Beuteplätze geführt werden sowie auch
dreist zulangen, wenn der Krebs ein gutes Beutestück erwischt
hat. Man hat in Aquarien festgestellt, daß Krebse, die man
aus ihren mit Seerosen besetzten Schalen vertrieben, auch die
befreundete
457
Symbiotes - Symbolik.
Seerose zur Übersiedelung veranlassen. Dagegen gehört
das Besetzen der Schalen andrer Krebsarten mit Schwammtieren,
Polypen und Algen mehr unter den Gesichtspunkt des Maskierens (s.
d.). Von den Landbewohnern hat besonders das Wohnen vieler Tiere in
Ameisennestern zahlreiche Studien veranlaßt. Manche
Käfer, wie der blinde Keulenkäfer (Claviger), bringen
ihre ganze Lebenszeit im Ameisennest zu und werden von den
Einwohnern sorgsam gepflegt und behütet, andre, wie der
bekannte Rosengoldkäfer, verleben nur ihre Larvenzeit bei den
Ameisen; die Brut gewisser Blattläuse wird im Winter dort
aufgenommen. Wahrscheinlich sind die meisten dieser sehr
mannigfachen Gäste der Ameisen denselben durch ihre
Absonderungen angenehm, wie dies von den Blattläusen, den
"Milchkühen" der Ameisen, bekannt ist, andre mögen die
Abfälle fressen, und noch andre, zu denen sowohl zahlreiche
Insekten als selbst Amphibien und Vögel gehören, sind
wohl nur geduldete Genossen. Von besonderm Interesse ist die S.
zwischen Pflanzen und Tieren, weil dadurch dauernde organische
Veränderungen sowohl in der äußern Gestalt und
Färbung als in der Lebensweise hervorgebracht und neue Arten
gezüchtet wurden. Dabei kann nun entweder die Pflanze oder das
Tier als Quartiergeber auftreten. Schon längst hatte man im
Körper sowohl der Protisten, wie z. B. der Radiolarien , als
in demjenigen wirbelloser Tiere gewisse gelbe, bräunliche oder
grüne Zellen entdeckt, die denselben, da sie meist nahe an der
Oberhaut liegen, ihre gelbliche, bräunliche oder
grünliche Hautfarbe geben, ohne daß man über ihre
eigentliche Bedeutung für das Leben klar wurde. Ihre Rolle
wurde um so unverständlicher, als Häckel Stärkemehl
in ihnen nachwies, und endlich wurde durch die Untersuchungen von
Geza Enz, O. Hertel, Brandt u. a. nachgewiesen, daß es sich
um einzellige Algen handelt, die in die Körper von Protisten,
Süßwasserpolypen, Seeanemonen und Korallen,
Seewürmern, Quallen und andern Tieren eindringen, in dem
durchsichtigen Gewebe derselben Nahrungsstoffe bilden, sich
vermehren und auch isoliert weiterleben. Daher haben diese durch
einzellige Algen gefärbten Wassertiere die Gewohnheit, ihren
Körper zeitweise dem Sonnenschein oder hellem Tageslicht
auszusetzen, und scheiden dann einen Überschuß von
Sauerstoff, wie Pflanzen, aus, obwohl die Tiere sonst Sauerstoff
als Atmungsstoff verbrauchen. Im beständigen Dunkel gehalten,
siechen diese Tiere dahin, weil sie von den in ihrem Körper
lebenden und nunmehr absterbenden Algen sowohl Sauerstoff als auch
zubereitete Nahrung empfingen. Da die Tiere ihrerseits
Kohlensäure und andre Stoffe ausscheiden, von denen die Algen
leben, so ist hier im engsten Bezirk ein Austausch und Kreislauf
der Lebensstoffe hergestellt, wie er sonst erst im weitern Umkreis
zwischen der Gesamtheit der Tiere und Pflanzen stattfindet. Unter
den umgekehrten Fällen, in denen die Pflanzen ihnen
nützlichen Tieren Obdach und Nahrung darbieten, ist die
Gegenseitigkeit und das Ineinanderleben bei Pflanzen und Ameisen am
auffallendsten. In den Tropen bedürfen zahlreiche Pflanzen
einer beständigen Schutzwache von Ameisen gegen die Angriffe
der sogen. Blattschneider- oder Sonnenschirmameisen, welche die
Blätter niedriger Pflanzen und Bäume rauben und in
wenigen Stunden ganze Baumwipfel entlauben. Pflanzen und Bäume
können sich ihrer nur erwehren, indem sie gewissen kleinen,
mit einem Stachel bewaffneten Ameisen, welche die grimmigsten
Feinde der erstern sind, Wohnung und Kost gewähren. Die sogen.
Ochsenhornakazie und andre Akazienarten beherbergen sie in ihren
vergrößerten hohlen Dornen, die Armleuchterbäume
(Cecropia-Arten) in den hohlen Internodien des Stammes, an denen
sich eine besondere Durchbruchsstelle für die Weibchen
ausgebildet hat, noch andre Pflanzen in beulen- oder
blasenförmigen Austreibungen des Stammes, der Äste oder
Blattstiele. In neuerer Zeit sind sehr zahlreiche, gewissen Ameisen
ständige Wohnung bietende Pflanzen bekannt geworden, und man
hat auch angefangen, gewisse Wucherungen und Haarbüschel in
den Nervenwinkeln der Blätter (z. B. unsrer Linden) für
ähnliche, den Milben als Wohnung dienende Gebilde
("Acaro-Domatien") anzusehen. Im weitern Sinn würden hierher
auch alle die zahllosen gegenseitigen Anpassungen der Blüten
an Insektenbesuch und der Insekten an Honig- und Pollenraub
gehören (s. Blütenbestäubung). Vgl. de Bary, Die
Erscheinung der S. (Straßb. 1879); O. Hertwig, Die S. (Jena
1883); Huth, Ameisen als Pflanzenschutz (Berl. 1886); Derselbe,
Myrmekophile und myrmekophobe Pflanzen (das. 1887); Schimper, Die
Wechselbeziehungen zwischen Pflanzen und Ameisen im tropischen
Amerika (Jena 1888).
Symbiotes, s. Milben, S. 606.
Symblepharon (griech.), Verwachsung des Augenlides mit
dem Augapfel, entsteht meist durch ausgedehnte Verbrennungen oder
Ätzungen der Bindehaut und muß operativ beseitigt
werden.
Symbol (griech., lat. symbolum), Erkennungs- oder
Merkzeichen; daher auch s. v. w. Parole, meist aber gleich Sinnbild
(s. d.) gebraucht. Im heidnischen Kultus war S. ein für den
Geheimdienst gewähltes Sinnbild, besonders eine Formel oder
ein Merkwort, woran sich die in die Mysterien Eingeweihten
erkannten; daher in der christlichen Kirche s. v. w. Sakrament und
insbesondere die sinnlichen Zeichen, welche bei den Sakramenten
gebraucht werden (Wasser, Brot, Wein); endlich auch s. v. w.
Glaubensbekenntnis, als Erkennungszeichen der zu einer
Religionspartei Gehörigen (s. Symbolische Bücher).
Symbolik (griech.), Wissenschaft und Lehre von den
Symbolen (Sinnbildern), insbesondere den religiösen. Die S.
lehrt uns, den hinter einem Zeichen oder Sinnbild verborgenen
tiefern Sinn erkennen, welchem etwas Geistiges, Unsichtbares oder
Undarstellbares zu Grunde liegt. Der Ursprung der S. ist auf die
Hieroglyphen- oder Bilderschrift der alten Ägypter
zurückzuführen, von denen sie durch Vermittelung der
Juden auf die ältesten Christen übergegangen ist. Die
Ägypter symbolisierten ihre Götter durch Tiere,
Verbindungen von menschlichen und tierischen Gestalten oder
Gliedern, Hieroglyphen oder durch mystische Zeichen, welche sich
auf ihren Kult bezogen. So ist z. B. die geflügelte
Sonnenscheibe das Symbol des Siegs des Guten über das
Böse, der Sperber das Sinnbild des Horus, die
Uräusschlange das Zeichen der königlichen Würde. Die
ältesten Christen bedienten sich der Sinnbilder, um sich durch
nicht jedermann verständliche Zeichen vor Verfolgungen zu
schützen. Sie entnahmen dieselben sowohl dem Tier- und
Pflanzenreich als dem Alten und Neuen Testament. Das Lamm war z. B.
das Symbol für den Opfertod Christi, das Kreuz und der Gute
Hirt für Christus selbst, der Weinstock das Sinnbild der
christlichen Verheißung und die Palme das Siegeszeichen der
Märtyrer. Die Zahlensymbolik gehörte im Altertum mehr zur
Astrologie; doch gab es auch bei Juden, Heiden und Christen gewisse
heilige Zahlen. Die Sieben war z. B. die heilige Zahl der
458
Symbolik - Symbolische Bücher.
Juden (siebenarmiger Leuchter), und die Christen deuteten sie
später auf die sieben letzten Worte am Kreuz, auf die sieben
Sakramente, die sieben Werke der Barmherzigkeit etc. Die Drei war
das Zeichen der heiligen Dreieinigkeit und der drei christlichen
Tugenden (Glaube, Liebe, Hoffnung), die Vier das Symbol der vier
weltlichen Tugenden, der vier Elemente etc., die Fünf das
Sinnbild der Wundenmale Christi. Die Tiersymbolik wurde im
Mittelalter sehr umständlich ausgebildet, indem namentlich die
naturwissenschaftlichen Lehrbücher, die sogen. Bestiarien (s.
Bestiaire), gewisse Tiere zu Vertretern besonderer Eigenschaften,
Tugenden und Lastern machten, für welche sie von der bildenden
Kunst als Symbole benutzt wurden. Die vier Evangelisten hatten
schon frühzeitig ihre Symbole (Matthäus einen Engel,
Markus einen Löwen, Lukas einen Ochsen, Johannes einen Adler).
Der Löwe war das Sinnbild der Stärke und des Edelmuts,
der Adler das der königlichen Würde, der Pfau das des
Hochmuts, das Einhorn das der Unschuld, der Hund das der Treue, das
Schwein das der Völlerei etc. Auf mittelalterlichen
Grabsteinen ist der Löwe sehr häufig das Attribut der
Männer, der Hund das der Frauen. Die geläufigsten Tier-
und Pflanzensymbole wurden auch von der Kunst der Renaissance
übernommen und haben sich bis auf die Gegenwart in der Kunst
und im Gebrauch des gewöhnlichen Lebens erhalten. So sind z.
B. Kreuz, Herz und Anker die Symbole von Glaube, Liebe und
Hoffnung. Neben der Tier-, Pflanzen- und Zahlensymbolik gibt es
noch eine Farbensymbolik, die ebenfalls alten Ursprungs ist.
Weiß gilt als Symbol der Unschuld, Grün als das der
Hoffnung, Blau als das der Treue, Rot als das der Liebe etc. Vgl.
Creuzer, S. und Mythologie der alten Völker (3. Aufl., Leipz.
1836-43, 4 Bde.); Bahr, S. des mosaischen Kultus (Heidelb. 1837-39,
2 Bde.; Bd. 1, 2. Aufl. 1874); Münter, Sinnbilder der alten
Christen (Altona 1825); Piper, Mythologie und S. der christlichen
Kunst (Weim. 1847-51, 2 Bde.); W. Menzel, Christliche S. (Regensb.
1854, 2 Bde.). Im engern Sinn versteht man unter S. oder
symbolischer Theologie diejenige Disziplin, welche sich mit den
kirchlichen Bekenntnisschriften und deren Lehrinhalt unter
beständiger Vergleichung der Lehrbegriffe der verschiedenen
Kirchen und Konfessionen beschäftigt. Je nachdem bei der
Aufstellung und Beleuchtung dieser Gegensätze das rein
historische oder das dogmatisch-polemische Interesse vorwaltet, ist
die S. ein integrierender Teil der Dogmengeschichte, oder sie
fällt mit der Polemik (s. d.) zusammen. Eine S. aller
christlichen Kirchenparteien lieferten: Marheineke (Heidelb.
1810-14, 3 Bde.; 1848), Winer (4. Aufl. von P. Ewald, Leipz. 1882),
Köllner (Hamb. 1837-44, 2 Bde.), Guericke (3. Aufl., Leipz.
1861), Matthes (das. 1854), Hofmann (das. 1857), Plitt (Erlang.
1875), Reiff (Basel 1875), Öhler (Tübing. 1876), Scheele
(Upsala 1877 ff.; deutsch, 2. Aufl., Leipz. 1886, 3 Bde.), Wendt
("S. der römisch-katholischen Kirche", Gotha 1880 ff.),
Philippi (Gütersl. 1883), Graul ("Die Unterscheidungslehren
der verschiedenen christlichen Bekenntnisse", 11. Aufl., Leipz.
1884) und namentlich der katholische Theolog Möhler (s. d.),
dessen Werk eine große Reihe protestantischer Entgegnungen,
besonders von Nitzsch und Baur, hervorgerufen und das Interesse an
der katholisch-protestantischen Streitsache neu belebt hat,
während die hierher gehörigen Untersuchungen von Matth.
Schneckenburger (s. d.) neue Bahnen für das Verständnis
der innerprotestantischen Lehrgegensätze eröffnet
haben.
Symbolische Bücher, Schriften, durch welche eine
Kirche den Glauben, an dessen Bekenntnis ihre Mitglieder sich teils
untereinander erkennen, teils von andern religiösen
Genossenschaften unterscheiden, urkundlich bezeugt. Schon die alte
katholische Kirche legte ihren Taufbekenntnissen den aus der
Mysteriensprache entlehnten Namen Symbol bei, da ja auch die Taufe
als ein Mysterium galt. Die theologischen Streitigkeiten des 4. und
der folgenden Jahrhunderte mußten die Zahl der Symbole noch
erhöhen, und dreien von ihnen, dem sogen. Apostolischen (s.
d.), dem Nicäisch-Konstantinopolitanischen (s. d.) und dem
sogen. Athanasianischen (s. d.), verschafften als sogen.
allgemeinen oder ökumenischen Symbolen die weltliche Macht der
Kaiser und das Ansehen der Konzile absolute Geltung in der Kirche.
Die Reformatoren des 16. Jahrh. haben diese allgemeinsten
Grundlagen der christlich-katholischen Weltanschauung nicht
angetastet; zugleich machte sich jedoch das Bedürfnis geltend,
ein gemeinsames Bekenntnis des evangelischen Glaubens abzulegen und
die Unterscheidungslehren, welche zur Trennung von der
römischen Kirche geführt hatten, klar und bestimmt
hinzustellen. In den auf Luthers Tod folgenden theologischen
Streitigkeiten wurde das Unterschreiben derselben insbesondere
für die Geistlichen obligatorisch, namentlich seit 1580 beim
Erscheinen des Konkordienbuchs von den sich dazu bekennenden
Fürsten und Ständen bestimmt ausgesprochen worden war,
daß bei der darin enthaltenen Lehre allenthalben beharrt
werden sollte. Gleichwohl tauchte schon im 17. Jahrh. der Gedanke
auf, daß die Verpflichtung auf s. B. eine unevangelische
Beschränkung der Glaubens- und Gewissensfreiheit sei; das
folgende Jahrhundert regte die Frage an, ob man die Geistlichen auf
sie verpflichten solle, nicht "weil" (quia), sondern "inwiefern"
(quatenus) sie mit der Heiligen Schrift übereinstimmten, und
mit der letztern Formel behalf sich namentlich der Rationalismus.
In unserm Jahrhundert gewann der Grundsatz, daß sich die
Geistlichen streng an die Lehrformen der symbolischen Bücher
zu halten hätten (Symbolzwang), besonders in Norddeutschland
neue Geltung. Selbst wo, wie in Preußen, die Union herrscht,
will man doch bald in der Augsburgischen Konfession, bald in dem
sogen. Apostolikum eine unantastbare Autorität erkennen, ohne
welche eine die Gemüter der Gemeinden verwirrende
Lehrwillkür einreißen müsse. Die Gegner des
Symbolzwanges machen geltend, daß derselbe den
Protestantismus im Prinzip bedrohe und durch Aufhebung der
Lehrfreiheit (s. d.) den Fortschritt in der Wissenschaft
beeinträchtige; sie wollen daher den protestantischen
Geistlichen nur eine pietätvolle, von pädagogischem Takt
geleitete Berücksichtigung der symbolischen Bücher und
ihres Lehrgehalts zur Pflicht gemacht wissen. Fast bei allen
kirchlichen Streitigkeiten der neuern Zeit stand die Frage des
Symbolzwangs im Vordergrund. Über die symbolischen Bücher
der verschiedenen christlichen Religionsparteien s. die besondern
Artikel: Glaubensbekenntnis, Griechische Kirche,
Römisch-katholische Kirche, Lutherische Kirche, Reformierte
Kirche etc. Vgl. Schleiermacher, Über den eigentlichen Wert
und das bindende Ansehen symbolischer Bücher (Frankf. 1819);
Johannsen, Die Anfänge des Symbolzwanges unter den deutschen
Protestanten (Leipz. 1847); Scheurl, Sammlung kirchenrechtlicher
Abhandlungen, Abteil. 1 (Erlang. 1872); Winer, Komparative
Darstellung des Lehrbegriffs der verschiedenen christlichen
Kirchenparteien (4. Aufl. von Ewald, Leipz. 1882).
459
Symi - Sympathie.
Symi (im Altertum Syme, türk. Sumbeki), kleine
türk. Insel an der Südwestküste Kleinasiens, 79 qkm
(1,43 QM.) groß mit der Stadt S., die angeblich 16,000
ausschließlich christliche Einwohner zählt, welche
berühmte Schwammfischer sind.
Symmachie (griech.), Schutz- und Trutzbündnis, von
den griechischen Staaten untereinander geschlossen und zwar meist
so, daß ein mächtigerer (z. B. Athen) die Hegemonie
hatte. Berühmt ist namentlich die S. (Seebund) Athens mit den
Städten und Inseln des Ägeischen Meers 476-404 v.
Chr.
Symmachus, 1) von Geburt ein Samaritaner, später
Jude, vielleicht auch Christ, verfaßte eine griechische
Übersetzung des Alten Testaments.
2) Quintus Aurelius, röm. Redner und Epistolograph, um
340-402 n. Chr., bekleidete unter Theodosius d. Gr. wichtige
Staatsämter, wie die Präfektur 384 und das Konsulat 391,
und war ein unerschrockener Vorkämpfer des sinkenden
Heidentums, dem jedoch selbst seine christlichen Gegner wegen der
Reinheit seines Lebens und seiner Gelehrsamkeit die Achtung nicht
versagen konnten. Außer drei unvollständigen Lobreden
auf Valentinian I. und dessen Sohn Gratian aus dem Jahr 369 und
Bruchstücken von fünf Senatsreden besitzen wir von ihm
eine für die Kenntnis der Zeit und Persönlichkeit des
Verfassers nicht unwichtige Briefsammlung in zehn Büchern,
deren letztes wie bei Plinius die amtliche Korrespondenz
(relationes) des S. und seines Sohns mit den Kaisern enthält.
Eine treffliche Gesamtausgabe seiner Schriften besorgte Seeck (in
den "Monumenta Germaniae historica", Bd. 6, Berl. 1883).
3) Cölius, Papst seit 498, aus Sardinien gebürtig,
ließ 502 auf einer Synode zu Rom jede Einmischung von Laien
in die Angelegenheiten der römischen Kirche verpönen und
starb 19. Juli 514.
Symmelie (griech.), Verwachsung von Gliedern; angeborne
Mißbildung, die an einfachen und Doppelmißbildungen
angetroffen wird, meist an nicht lebensfähigen. Das
gewöhnlichste Beispiel der S. ist die Sirenenbildung (s.
d.).
Symmetrie (griech.), das Ebenmaß oder die
Übereinstimmung bei der Anordnung der Teile eines Ganzen in
Hinsicht auf Maß und Zahl. Die S. zeigt sich besonders darin,
daß sich das Ganze in zwei hinsichtlich der Anordnung des
Einzelnen übereinstimmende Hälften teilen
läßt. S. in diesem Sinn zeigt in der anorganischen Natur
die Kristallform, im Pflanzenreich namentlich die Bildung der
Blüten und Früchte, vorzugsweise aber der Körper der
höhern Tierklassen, bei welchem im normalen Zustand die
gleichen oder ähnlichen Teile an jeder Hälfte dieselbe
Stelle einnehmen. Die Wahrnehmung dieser S. oder
ebenmäßigen Anordnung der gleichartigen Teile wird durch
Hervorhebung eines Mittel- oder Augenpunkts unterstützt und
erleichtert. Doch ist diese strenge S. keineswegs bei allen
Kunstwerken zu beobachten, da sie oft den Eindruck des Steifen,
Unnatürlichen und Gezwungenen hervorbringen würde, wie in
der Stellung und Gruppierung der Figuren in der Malerei und
Plastik, bei Anordnung theatralischer Szenen etc. Am meisten eignet
sie sich für die Architektur, indem das mangelnde symmetrische
Verhältnis der einzelnen Teile eines Bauwerks einen mehr oder
weniger störenden Eindruck hervorbringt. In der Gartenkunst,
wo früher ebenfalls symmetrische Anordnung üblich war,
ist dieser Zwang durch Auskommen der sogen. englischen Anlagen,
welche die Natur nachzuahmen suchen, meist beseitigt worden. Vom
meßbaren Räumlichen ist der Ausdruck S. auch auf
zeitliche Verhältnisse übertragen worden, doch ist hier
der Ausdruck Eurhythmie zutreffender (vgl. Rhythmus). In der
Mathematik ist S. die Übereinstimmung der Teile eines Ganzen
untereinander. Symmetrisch ist z. B. jeder Kreis, jede Ellipse,
jede Parabel und Hyperbel gebildet, auch jedes gleichseitige
Dreieck, Viereck etc. Symmetrische Funktionen mehrerer unbestimmter
Größen, z. B. a, b, c, sind algebraische Ausdrücke,
worin jene Größen alle auf ganz gleiche Art vorkommen,
so daß man sie beliebig miteinander vertauschen kann, ohne
daß dadurch der Wert des Ausdrucks geändert wird: a+b,
ab+ac+bc.
Symmikta (griech., "Vermischtes"), Titel für
Sammlungen von allerhand Aufsätzen etc.
Sympathetisch (sympathisch, griech.), mitleidend,
mitfühlend, auf Sympathie (s. d.) beruhend, seelenverwandt,
gleichgestimmt.
Sympathetische Kuren, Heilungen von Krankheiten, die
nicht durch die Einwirkung von Arznei- oder andern allgemein
bekannten Heilmitteln, sondern durch eine geheimnisvolle Kraft
solcher Körper geschehen, die mit dem Kranken oft gar nicht in
unmittelbare Berührung zu kommen brauchen. Als die hier
wirksame Kraft nahm man eine Sympathie des Menschen- oder
Tierkörpers mit Geistern, Sternen, andern Menschen, Tieren,
Pflanzen, Steinen an, wofür man jedoch die Beweise schuldig
blieb. Man hängt dem Kranken Amulette um, nimmt mit gewissen
Gegenständen Handlungen vor, die auf den entfernten Kranken
einwirken sollen, oder "bespricht" die kranke Stelle durch
Beschwörungen und Gebete. Die Wirksamkeit aller
sympathetischen Mittel ist nicht nur nicht erwiesen, sondern auch
im höchsten Grad unwahrscheinlich; doch ist der Glaube an die
Heilkraft derselben im Volk noch überaus verbreitet. Die
Wirksamkeit sympathetischer Kuren, wenn eine solche überhaupt
vorhanden ist, scheint vornehmlich darauf zu beruhen, daß in
dem Kranken der feste Glaube erweckt werde, daß das Mittel
helfen werde; denn durch diesen wird die Hoffnung auf Genesung und
dadurch die Lebensthätigkeit des Organismus, die
"Naturheilkraft", angeregt, durch welche dann die Krankheit
überwunden wird, wenn dies überhaupt möglich ist. Am
leichtesten wird dies bei Krankheiten geschehen, die im
Nervensystem oder im Seelenleben ihren Sitz haben. S. K. feiern
namentlich auch in solchen Fällen Triumphe, bei welchen oft
eine plötzliche Heilung ohne äußeres Zuthun
erfolgt. So sieht man häufig Warzen in ganz kurzer Zeit
vollständig verschwinden, und wenn gegen dieselben vorher
zufällig eine sympathetische Kur angewandt worden war, so
erscheint dem urteilslosen Beobachter deren Wirksamkeit
erwiesen
Sympathetisches Gefühl, s. Mitgefühl.
Sympathetische Tinte, s. Tinte.
Sympathie (griech., "Mitempfindung"), unwillkürliche
und daher grundlos scheinende Zuneigung zu andern, auch wohl zu
lebendigen oder leblosen Gegenständen, die entweder
physiologische (angeborne S.) oder psychologische (entstandene S.)
Gründe haben und im letztern Fall auf ganz zufälligen und
deshalb den Schein der Grundlosigkeit der S. erzeugenden
Assoziationen beruhen kann (vgl. Antipathie). In der Physiologie
versteht man unter S. (consensus) die Eigenschaft eines Organismus,
vermöge deren durch die gesteigerte oder herabgestimmte
Thätigkeit eines Organs auch die eines andern gesteigert oder
herabgestimmt wird. Diese Erscheinung wird durch das Nervensystem,
das Gefäßsystem oder das Zellgewebe vermittelt, und zwar
wirkt das erstere
460
Sympathikus - Symphoricarpus.
besonders durch psychische Vermittelung oder Reflex. Zu den
Erscheinungen der S. rechnet man die Ausbildung der Stimme mit
eintretender Mannbarkeit, die gleichzeitige Steigerung der
Thätigkeit der Leber, Speicheldrüsen, des Pankreas etc.
zur Zeit der Verdauung, das Niesen bei Einwirkung von Licht auf das
Auge etc. Häufiger aber werden die Erscheinungen der S. in
Krankheiten beobachtet. So ruft die Erkrankung des einen Auges eine
"sympathische" Affektion des andern hervor. Vorzugsweise schreibt
man derartige Verbindungen dem Sympathikus zu. Andre Arten der
Übertragung von Krankheiten, welche früher auch wohl
unter den Gesichtspunkt der S. fielen, werden zur Metastase
gerechnet. Vgl. Idiopathie und Sympathetische Kuren.
Sympathikus (sympathischer Nerv, Eingeweide- oder
sympathisches Nervensystem), derjenige Teil des Nervensystems,
welcher die unwillkürlichen Thätigkeiten des sogen.
vegetativen Lebens regelt und so im Gegensatz zu dem animalen
Nervensystem (Gehirn und Rückenmark) steht. Die zu ihm
gehörigen Nerven verzweigen sich hauptsächlich an den
Eingeweiden. Auch bei niedern Tieren findet sich vielfach ein S.
vor, steht aber immer mit dem animalen Nervensystem an irgend einer
Stelle in Zusammenhang. Letzteres ist auch bei den Wirbeltieren der
Fall, doch wird die Verbindung nicht direkt mit dem Gehirn oder
Rückenmark, sondern mit den Rückenmarksnerven getroffen.
Zu beiden Seiten der Wirbelsäule (s. Tafel "Nerven des
Menschen II", Fig. 5) verläuft nämlich je ein Strang, der
sogen. Grenzstrang oder Stamm des S., welcher aus einer Kette von
Ganglien besteht, von Wirbel zu Wirbel durch einen feinen Nerv mit
dem benachbarten Rückenmarksnerv verbunden ist und mit dem
Steißbeinknoten endet. Vom Grenzstrang gehen dann die
peripherischen Nerven des S. aus und vereinigen sich in der
Nähe der größern Eingeweide zu Geflechten, in
welche, wie überhaupt in den Verlauf dieser Nerven, zahlreiche
kleinere Ganglien eingelagert sind. Ein besonders großes
Geflecht dieser Art ist der Plexus solaris, das Sonnengeflecht, das
unmittelbar unter dem Zwerchfell liegt. Die Herznerven des S.
entspringen bei den höhern Wirbeltieren vom Hals. Auch im Kopf
liegen sympathische Ganglien und Geflechte, so z. B. in den
Speichel- und Thränendrüsen. Die Endungen der
sympathischen Nervenfasern in den von ihnen versorgten Organen
(Herz-, Darm-, Harn-, Geschlechtswerkzeuge etc.) sind noch wenig
bekannt. Gewöhnlich treten sie an die glatten Muskelfasern
heran und veranlassen deren vom Willen unabhängige
Zusammenziehungen. Da sie auch die Muskulatur in den Wandungen der
Blutgefäße als sogen. Gefäßnerven (s. d.)
innervieren, so verengern sie durch ihre Thätigkeit deren
Weite und sind daher von großem Einfluß auf den
Blutzufluß , somit auf die Ernährung der Organe.
Sympathisch (griech.), s. Sympathetisch.
Sympathische Färbung, s. Schutzeinrichtungen.
Sympathisieren (franz.), mit jemand gleich empfinden,
gleiche Neigung haben.
Sympetalae (griech.-lat.), s. Monopetalen.
Symphonie (griech., ital. Sinfonia), ein in Sonatenform
geschriebenes Werk für großes Orchester. Das griechische
Symphonia ("Zusammenklang") ist im Altertum Bezeichnung für
das, was wir jetzt Konsonanz der Intervalle nennen. Als zu Anfang
des 17. Jahrh. in Florenz sich die Oper entwickelte, erhielt die
(sehr kurze) Instrumentaleinleitung den Namen S., welcher
jedenfalls auch schon den Instrumentalstücken der im
Madrigalenstil komponierten Pastorales eigen war. Die S.
entwickelte sich zunächst besonders in der neapolitanischen
Oper. Ihre Vorgeschichte ist durchaus die der Ouvertüre (s.
d.), welche bekanntlich außer in Frankreich auch den Namen S.
weiterführte. Je ausgeführter ihre Form wurde, desto mehr
eignete sie sich zum Vortrag als selbständiges Stück (sie
wurde dann zur Kammermusik gerechnet, da Orchestermusik als deren
Gegensatz noch nicht existierte); um die Mitte des vorigen
Jahrhunderts begannen die Komponisten (Grétry, Gossec,
Sammartini, Stamitz, Cannabich) besondere Symphonien für
allmählich vergrößertes Orchester zu schreiben und
trennten die drei bis dahin noch lose zusammenhängenden Teile
der Ouvertüre. Haydn vollendete die Form durch
Übertragung der indes durch D. Scarlatti und Ph. E. Bach
entwickelten Form des Sonatensatzes, welcher seinerseits erst kurz
vorher von der Ouvertüre den Gegensatz mehrerer Themen
angenommen hatte; Haydn war es auch, der zwischen den langsamen und
den Schlußsatz das Menuett einschob (ebenfalls im
Anfchluß an die Sonate). Viel höher aber steht noch das
Verdienst Haydns, die Orchesterinstrumente nach ihrer Klangfarbe
individualisiert zu haben; damit hat er erst die S. zu dem gemacht,
was sie heute ist. Was Mozart und besonders Beethoven hinzugebracht
haben, ist hauptsächlich die Verschiedenheit ihrer eignen
Natur: der jovialere Haydn scherzt und neckt in seinen Symphonien,
der sinnige Mozart schwärmt, und der finstere,
leidenschaftliche Beethoven grollt oder reißt mit sich fort.
Zudem hat Beethoven das Orchester erheblich vergrößert
(vgl. Orchester). Eine Neuerung von ihm ist auch die Ersetzung des
Menuetts durch das Scherzo sowie in der neunten S. die
Einführung des Chors und die Umstellung der Sätze Adagio
und Scherzo, die seitdem mehrfach nachgeahmt wurde. Beethoven hat
den Inhalt der S. im ganzen bedeutungsvoller, die tiefsten Tiefen
des Seelenlebens ergreifend gestaltet, die einzelnen Sätze zu
längerer Dauer ausgeführt und dem Finale statt der
rondoartigen mehr eine an Form und Charakter dem ersten Satz
nahekommende Gestalt gegeben. Die Symphoniker seit Beethoven haben
die Form nicht mehr weiter zu entwickeln vermocht;
nichtsdestoweniger würde es ein arger Fehlschluß sein,
wollte man sie als ausgelebt ansehen; die Symphonien von Schumann,
von Brahms und Raff beweisen, daß sie noch zur Füllung
mit immer neuem Inhalt tauglich sein wird. Die symphonischen
Dichtungen der neuesten Zeit (Berlioz, Liszt, Saint-Saëns)
sind nicht eigentliche Fortbildungen der Form der S.; der Gedanke
ist schon dadurch ausgeschlossen, daß sie eine eigentliche
definierbare Form überhaupt nicht haben. Sie gehören zur
Kategorie der sogen. Programmmusik (s. d.), deren wesentlichste
Repräsentanten sie sind. Die Programmmusik ist aber eine
gemischte Kunstform, deren Gestaltungsprinzipien nicht
musikalischer, sondern poetischer Natur sind; in erhöhtem
Maß gilt das natürlich von der S. mit Chören
(Symphoniekantate, franz. Ode-symphonie), zu welcher Gattung
Beethovens neunte S. nur bezüglich ihres letzten Satzes
gehört.
Symphonische Richtung, s. Symphonie und
Programmmusik.
Symphoricarpus Juss. (Schneebeere), Gattung aus der
Familie der Kaprifoliazeen, Sträucher mit kurzgestielten,
rundlichen oder eiförmigen, ganzrandigen Blättern,
kleinen, weißen oder rötlichen Blüten in kurzen,
achselständigen Trauben oder Ähren und eiförmiger
oder kugeliger, zweisamiger Beere. Sechs
461
Symphosius - Synandrisch.
nordamerikanische und mexikanische Arten, von denen S. racemosa
Mich. in Nordamerika, mit weißen, sehr schwammigen Beeren,
als Zierstrauch kultiviert wird.
Symphosius (Symposius), röm. Dichter aus dem 4. bis
5. Jahrh. n. Chr., Verfasser einer Sammlung von 100
Rätselgedichten von je drei ziemlich reinen Hexametern (bei
Riese, "Anthologia latina", Bd. 1, Leipz. 1869, und Bährens,
"Poetae latini minores", Bd. 4, das. 1882). Vgl. Paul, De Symposii
aenigmatibus (Berl. 1854).
Symphysis (griech.), feste, knorpelige Verbindung
zwischen zwei Knochen, z. B. S. ossium pubis, Schambeinfuge.
Symphytum L. (Schwarzwurzel, Beinwurzel, Beinwell),
Gattung aus der Familie der Asperifoliaceen, ausdauernde, meist
borstig behaarte Kräuter mit starken Wurzeln, abwechselnden,
ganzen, manchmal am Stengel weit herablaufenden Blättern,
daher geflügelten Stengeln, in Wickelähren gestellten,
röhrenförmigen Blüten und glatten
Nüßchen. Etwa 16 Arten in Europa, Nordafrika, Westasien.
S. asperrimum Bieb., auf dem Kaukasus, mit stachlig behaarten
Blättern und schönen, erst purpurnen, dann himmelblauen
Blüten, findet sich als Zierpflanze in Gärten und ist als
treffliches Viehfutter empfohlen worden. S. officinale L.
(Schwarzwurz, Wallwurz), mit spindeliger, ästiger, außen
schwarzer Wurzel, aufrechtem, 30-90 cm hohem, ästigem,
steifhaarigem Stengel, runzeligen, rauhhaarigen, lang
herablaufenden Blättern und gelblichweißen und
violettroten Blüten, auf feuchten Wiesen, an Ufern der
Flüsse im größten Teil von Europa, war früher
offizinell. S. asperrimum (kaukasische Comfrey) wird als
perennierende Futterpflanze gebaut; sie liebt einen warmen,
zeitweise feuchten und fruchtbaren Lehmboden, eignet sich aber auch
vorzüglich, vegetationsarme Landstrecken mit minder gutem
Boden allmählich unter beschattende Pflanzendecke zu bringen.
Sie liefert bereits im zweiten Jahr ihrer Anpflanzung vier starke
Schnitte mit einem Gesamtertrag von 7500 kg pro Hektar. Der
Nährwert des Krauts kommt dem des Klees sehr nahe. Dasselbe
eignet sich nicht zur Heubereitung, liefert aber gutes
Sauerfutter.
Symplegaden (Insulae Cyaneae), zwei kleine Felsen an der
Mündung des Thrakischen Bosporus in den Pontus Euxinus, die
der Sage zufolge früher fortwährend aneinander
stießen und alle dazwischen hinsegelnden Schiffe
zertrümmerten, bis sie seit der Argonautenfahrt auf des
Orpheus Saitenspiel unbeweglich stehen blieben.
Symploke (griech., "Verknüpfung"), Wortfigur, die
Verbindung von Anaphora und Epiphora (s. d.), z. B. bei Fragen,
welche mit demselben Wort beginnen, und auf welche dieselbe Antwort
erfolgt: Was ist der Thoren höchstes Gut? Geld! Was verlockt
selbst den Weisen? Geld! Was schreit die ganze Welt? Geld!
Sympodium (Scheinachse), s. Stengel, S. 288.
Symposion (griech.), s. v. w. Trinkgelage (s. d.); auch
Titel zweier Dialoge des Platon und Xenophon.
Symptom (griech.), Anzeichen, eine Erscheinung, aus deren
Auftreten man schließt, wie etwas steht; insbesondere
Krankheitszeichen, d. h. die Erscheinungsform, unter welcher sich
eine Krankheit äußert. Gelbsucht ist z. B. das S., unter
dem sich mannigfache Krankheiten des Darms oder der Leber
äußern, Fieber ist S. sehr zahlreicher ansteckender
Krankheiten. Aus der Deutung der Symptome ergibt sich die Diagnose.
Symptomatologie, Lehre von den Krankheitssymptomen (s.
Semiotik).
Symptomatische Mittel, s. Palliativ.
Synagoge (griech.), das Gotteshaus der Israeliten, wie es
sich in und nach dem babylonischen Exil aus Versammlungen zur
Feststellung aller Lebensverhältnisse nach und nach zum
Bethaus ohne Opferkultus entwickelt hat, und dessen zur Zeit Esras
teilweise schon eingeführte Gebetordnung noch heute die
Grundlage des jüdischen Gottesdienstes bildet. In allen
ansehnlichen Städten Judäas waren schon im 1. Jahrh. nach
Esra Räumlichkeiten, wo allsabbatlich und an den Festtagen,
später am zweiten und fünften Tag der Woche, den Markt-
und Gerichtstagen, anfänglich in freier Auswahl, dann nach
festgesetzter Reihenfolge ein Abschnitt aus dem Pentateuch und bald
auch ein Prophetenabschnitt (Haftara) vorgelesen und in
Gemeinschaft gebetet wurde. Auch außerhalb Palästinas,
wo Jerusalem allein 480 Synagogen besessen haben soll, gab es viele
und schöne Synagogen; als größte wird die in
Alexandria erwähnt. Neben dem Bethaus befand sich oft das
Lehrhaus; nicht selten wurde das höhere Studium in jenem
selbst betrieben, was den Namen Judenschule für S.
veranlaßte. Seit dem 5. Jahrh. fanden hinsichtlich der
Anlegung und der Anzahl derselben vielfache beschränkende
Gesetze statt. Die wesentlichsten Bestandteile jeder S. sind: dem
Eingang gegenüber die die Gesetzrollen enthaltende heilige
Lade (Aron Hakodesch), Repräsentant der ehemaligen Bundeslade;
daneben ein Leuchter, dem siebenarmigen Leuchter des Tempels
entsprechend; in der Mitte die Almemor oder Bimah genannte Estrade,
für die Vorlesungen bestimmt, und das ewige Licht. Männer
und Frauen sitzen gesondert. Zur Abhaltung der öffentlichen
Andacht sind mindestens zehn über 13 Jahre alte männliche
Israeliten erforderlich (Minjan). Die Gebete und biblischen
Lektionen verrichtet der Vorbeter; Vorträge an Sabbaten und
Festtagen hält der Rabbiner oder der Prediger. In neuerer Zeit
hat die Orgel in vielen Synagogen Eingang gefunden und ist neben
der hebräischen die Landessprache mehr in Aufnahme gekommen. -
S. in anderm Sinn heißt zuweilen auch die Judenheit, als
Gegensatz zur Christenheit (ecclesia). Die große S.
(kenesseth hagdolah) nennen talmudische und rabbinische Quellen
eine aus 120 Gelehrten bestehende Versammlung, welche unter dem
Präsidium Esras die religiösen Angelegenheiten ordnete;
geschichtlich ist aber darunter nur eine von Esra bis auf Simon den
Gerechten (gestorben um 292 v. Chr.) reichende Thätigkeit der
Schriftgelehrten, die sich auf Redaktion der biblischen
Bücher, Feststellung und Weiterbildung des mündlich
überlieferten Gesetzstoffes der Tradition, auf kulturelle
Einrichtungen und Ähnliches bezog, zu verstehen.
Synalöphe (griech., "Verschmelzung"), die
Vereinigung zweier Silben, namentlich in zwei aufeinander folgenden
Wörtern, entweder durch die Krasis (s. d.) oder durch die
Elision (s. d.).
Synandrae, Ordnung im natürlichen Pflanzensystem
Brauns unter den Dikotyledonen, Sympetalen, mit
regelmäßigen oder zygomorphen Blüten mit
fünfgliederigen Blattkreisen, meist fünf
Staubgefäßen, welche bald unter sich, bald mit dem
Griffel, bald auch allein mit ihren Antheren verwachsen sind, und
mit unterständigem Fruchtknoten, umfaßt die Familien der
Kukurbitaceen, Kampanulaceen, Lobeliaceen, Goodeniaceen, Stylideen,
Kalycereen und Kompositen. Im System Eichlers bilden diese Familien
mit Ausnahme der Kompositen und Kalycereen die Reihe der
Kampanulinen.
Synandrisch (griech.), Bezeichnung für Blüten
mit verwachsenen Staubblättern.
462
Synanthereen - Synesios.
Synanthereen, s. Kompositen.
Synantherin , s. Inulin.
Synaptas, s. Emulsin.
Synapte (Synapta), s. Holothurioideen.
Synäresis (Synizesis, griech.), in der Grammatik s.
v. w. Kontraktion (s. d.).
Synarthrosis (griech.), unbewegliche Knochenverbindung
durch die Naht, die Knorpelfuge (Synchondrosis oder Symphysis) und
die Syndesmosis (feste Vereinigung durch Bänder).
Syncelli (griech. Synkelloi), in der griech. Kirche etwa
seit dem 4. Jahrh. Hilfs- oder Hausgeistliche, Vertraute der
Bischöfe.
Synchondrose (griech.), s. Knochen, S. 877.
Synchronismus (griech., "Gleichzeitigkeit"), in der
Geschichte das Zusammentreffen verschiedener Begebenheiten in einem
und demselben Zeitpunkt. Synchronistische Geschichtserzählung
nennt man daher diejenige, in welcher die in dieselbe Zeit
fallenden Begebenheiten unter verschiedenen Völkern und in
verschiedenen Ländern nebeneinander fortschreitend dargestellt
werden. Zum Studium der Geschichte dienen synchronistische
Tabellen, d. h. Verzeichnisse, in denen in nebeneinander stehenden
Kolumnen die Hauptbegebenheiten der Geschichte verschiedener
Völker angeführt sind.
Syndaktylie (Daktylosymphysis, griech.), Verwachsung der
Finger untereinander. Kommt angeboren vor und ist entweder so
vollkommen, daß man nur am Skelett die einzelnen Finger
getrennt erkennen kann, oder mehr oberflächlich, so z. B.
daß eine Art Schwimmhaut die ersten Fingerglieder verbindet.
Erworben wird S. nach Verbrennungen. Die Behandlung besteht in der
operativen Trennung der Finger, oder sie sucht durch Dehnungen und
Bewegungen narbige Verwachsungen beweglicher zu machen.
Syndesmologie (griech.), Bänderlehre, Teil der
Anatomie (s. d.).
Syndesmose (griech.), s. Knochen, S. 877.
Syndikalkammern (franz. Chambres syndicales), in
Frankreich früher die Vorstände verschiedener
privilegierter Genossenschaften sowie von gewerblichen Vereinen und
Verbänden, dann solche zur Förderung eigner und allgemein
gewerblicher Interessen gebildete genossenschaftliche Verbände
selbst. 1791 verboten, bildete sich doch unter stillschweigender
gesetzlicher Anerkennung eine große Anzahl solcher
Verbände, welche 1883 auch formell gesetzlich anerkannt und
geregelt wurden. Insbesondere bildeten sich nach Aufhebung des
Koalitionsverbots (1864) auch viele S. von Arbeitern mit
ähnlichen Einrichtungen und Zwecken wie die englischen und
deutschen Gewerkvereine. Vgl. Lexis, Gewerkvereine und
Unternehmerverbände in Frankreich (Leipz. 1879).
Syndikat, s. Syndikus.
Syndikatsverbrechen, s. Beugung des Rechts aus
Parteilichkeit.
Syndikus (griech.), der von einer Korporation
(Stadtgemeinde, Stiftung, Verein, Aktiengesellschaft) zu Besorgung
ihrer Rechtsgeschäfte aufgestellte Bevollmächtigte. Die
dem S. zu erteilende Vollmacht heißt Syndikat. Letzteres Wort
wird auch gebraucht für ein Konsortium (s. d.), welches sich
bildet, um eine Börsenoperation etc. durchzusühren.
Syndi-katsklage, Klage auf Entschädigung gegen den Richter,
welcher absichtlich oder infolge groben Versehens ein ungerechtes
Urteil fällte. Vgl. Kronsyndikus.
Synechie (griech.), krankhafte Verwachsung.
Synedrion (griech., neuhebr. sinhedrin und sanhedrin)
oder großes S. hieß die höchste, in der zweiten
Hälfte des jüdischen Staatslebens, nach dem Muster der
großen Synode und des biblischen 70-Ältestenkollegiums
mit Bezug auf das 5. Mos., 17, 9 bezeignete Obergericht, zu
Jerusalem konstituierte, aus 71 Richtern bestehende
Rechtsbehörde in Staats-, Rechte- und Religionssachen, welcher
das aus 23 Richtern zusammengesetzte kleine S. und das
Dreimännergericht untergeordnet waren. Den Vorsitz im S.
führte der vom Richterkollegium zu wählende
Oberpräsident (Nassi) und Gerichtspräsident (Ab-bet-din),
als dessen Stellvertreter die zwei Schreiber galten. Während
unter den Makkabäern das S. weltliche und geistliche
Machtbefugnis hatte, ward ihm unter Herodes die politische, unter
den Römern die richterliche Gewalt entzogen, so daß es
zu einer Art kirchlicher Synode wurde.
Synekdoche (griech., "Mitverstehen"), rhetor. Figur,
durch welche etwas Allgemeines durch ein Besonderes, namentlich ein
Abstraktes durch ein Konkretes, die Gattung durch eine Art, das
Ganze durch einen seiner Teile, die Vielheit durch ein Einzelnes
etc. oder auch umgekehrt veranschaulicht wird. Sie sagt z. B. "der
Römer" für die Römer, "Kiel" für Schiff,
"Jugend" für junge Leute, "Eisen" für Schwert etc.
Synepheben (griech.), Jugendgenossen.
Synergiden, s. Embryosack, S. 598.
Synergismus (griech.), die dogmatische Ansicht, wonach
der Mensch zu seiner Bekehrung "mitwirken" müsse. Einst hatte
Augustinus im Gegensatz zum Pelagianismus (s. d.) und
Semipelagianismus (s. d.) alle derartige Mitwirkung verworfen, und
dieser Ansicht folgte Luther, während Melanchthon den Anteil
der menschlichen Willenskraft je länger, desto bestimmter in
die erhaltene Fähigkeit setzte, der göttlichen
Gnadenwirkung zuzustimmen. Dieselbe Vorstellung war in das
Leipziger Interim übergegangen, und mehrere Theologen,
darunter V. Strigel (s. d.), begünstigten sie. Aber erst
seitdem Joh. Pfeffinger (s. d.) in Leipzig ("De libero arbitrio",
1555) sich für dieselbe erklärt hatte, begannen Amsdorf
und Flacius zu Jena 1558 den sogen. synergistischen Streit. Die
Wittenberger nahmen für Pfeffinger Partei, während der
herzogliche Hof im sogen. Konfutationsbuch (1559) eine offizielle
Widerlegung des S. veröffentlichte und die Verteidiger des
letztern, Strigel und Hügel, 1559 gefangen setzen ließ.
Bald aber schlug die Hofgunst um, zumal als 1560 in der Disputation
zu Weimar Flacius die Erbsünde geradezu für die Substanz
des Menschen erklärte. Jetzt wurde Strigel 1562 wieder
eingesetzt, dagegen 40 dem Flacius anhängende Prediger
abgesetzt. Aber unter dem 1567 zur Regierung gelangten Herzog
Johann Wilhelm von Weimar änderte sich die Lage der Dinge
abermals: durch eine allgemeine Kirchenvisitation wurden die
Überreste ebensowohl des Strigelschen S. als des Flacianischen
Manichäismus unterdrückt, und die Konkordienformel (s.
d.) verdammte beides.
Synergus, s. Gallwespen.
Synesios, neuplaton. Philosoph, geb. 375 n. Chr. zu
Kyrene, studierte in Alexandria als Schüler und Freund der
Hypatia (s. d.) die neuplatonische Philosophie, trat um 408 zur
christlichen Kirche über, ward 410 Bischof zu Ptolemais, starb
aber schon 415. Seine philosophischen Ansichten, die er auch als
Christ beibehielt, legte er in Reden, Briefen, Hymnen und andern
Schriften nieder. Er verrät darin mannigfaltige Kenntnisse,
große Belesenheit und Scharfsinn und gute, gewählte
Diktion. Die beste Gesamtausgabe seiner Werke ist von Petavius
463
Synesis - Synopsis.
(Par. 1631, zuletzt 1640); eine kritische Ausgabe der Reden und
Homilien besorgte Krabinger (Landsh. 1850), der Hymnen Flach
(Tübing. 1875). Vgl. Volkmann, S. von Kyrene (Berl. 1869).
Synesis (griech.), Sinn, Verstand; vgl. Sensus.
Synezeugmenon (griech.), s. v. w. Zeugma.
Syngenesia (griech.), 19. Klasse des Linneschen Systems,
Pflanzen enthaltend, deren Antheren miteinander zu einer Röhre
verwachsen sind, der Familie der Kompositen entsprechend. Daher
Syngenesisten, s. v. w. Kompositen.
Syngramma Suevicum. Name der von Brenz (s. d.)
verfaßten, von Schnepf (s. d.) und zwölf andern
schwäbischen Geistlichen unterschriebenen Gegenschrift gegen
das Buch des Ökolampadius: "De genuina verborum domini (hoc
est corpus meum) expositione", welches das Wort "Leib" als das
"Zeichen des Leibes" fassen wollte.
Synizesis (griech.), s. Synäresis.
Synkarp (griech.), in der Botanik ein Gynäceum,
dessen einzelne Karpelle durch Einschlagen ihrer Ränder
völlig geschlossen sind und miteinander verwachsen; der
Fruchtknoten besitzt in diesem Fall so viel Fächer, wie
Karpelle vorhanden sind.
Synklinale (griech.), s. Antiklinale.
Synkope (griech.), in der Grammatik die Verkürzung
eines Wortes um eine mittlere Silbe (z. B. ewiger statt ewiger
etc.); in der Musik die Zusammenziehung des unbetonten Taktteils
mit dem nachfolgenden betonten zu einer einzigen Note; in der
Medizin s. v. w. plötzliche Entkräftung, Ohnmacht.
Synkrasis (griech.), Vermischung.
Synkratie (griech., "Mitherrschaft"), im Gegensatz zur
Autokratie diejenige Art der Staatsverfassung, nach welcher das
Volk durch seine Vertreter an der Regierung einen gewissen Anteil
nimmt.
Synkretismus (griech.), die ausgleichende Vereinigung
streitender Parteien, Sekten, Systeme etc. durch Abschwächung
der trennenden Gedanken sowie durch Aufstellung von
Lehrsätzen, die jeder nach seiner Meinung deuten kann;
insbesondere seit 1645 die unionistische Theologie des Georg
Calixtus (s. d.), daher die Kontroverse mit ihm als
synkretistischer Streit bekannt ist.
Synodalverfassung, s. Presbyterial- und
Synodalverfassung.
Synode (griech.), Versammlung in kirchlichen
Angelegenheiten, also s. v. w. Konzilium (s. d.).
Diözesansynode (synodus dioecesalis) heißt eine S.,
welche ein Bischof mit den ihm untergebenen Pfarrern,
Provinzialsynode (synodus provincialis) eine solche, welche ein
Erzbischof mit seinen Bischöfen abhält, Nationalsynode
oder allgemeine S. (synodus universalis oder nationalis) eine
solche, zu der die gesamte Geistlichkeit eines Landes unter Vorsitz
eines päpstlichen Legaten zusammentritt, um wichtige, die
kirchlichen Angelegenheiten betreffende Fragen zu erledigen. In der
protestantischen Kirche sind die Synoden die Organe der kirchlichen
Selbstverwaltung und Vertretungskörper der Kirchengenossen
gegenüber dem landesherrlichen Kirchenregiment. Diesen Synoden
ist ein Mitwirkungsrecht bei der kirchlichen Gesetzgebung und
Verwaltung eingeräumt. Nach der Kirchengemeinde- und
Synodalordnung für die östlichen Provinzen Preußens
vom 10. Sept. 1873 umfaßt der Kreissynodalverband
(Kirchenkreis) regelmäßig eine Diözese,
ausnahmsweise auch mehrere kleinere Diözesen. Die Kreissynode
besteht aus sämtlichen innerhalb des Kirchenkreises ein
Pfarramt definitiv oder vikarisch verwaltenden Geistlichen und der
doppelten Zahl der durch die vereinigten Gemeindeorgane auf drei
Jahre gewählten Mitglieder (Synodalen). Die eine Hälfte
dieser gewählten Synodalen wird aus den dermaligen oder
frühern Kirchenältesten, die andre Hälfte von den an
Seelenzahl stärkern Gemeinden aus den angesehenen, kirchlich
erfahrenen und verdienten Männern des Synodalkreises
gewählt. Die Kreissynoden einer Provinz bilden den Verband der
Provinzialsynoden, deren Mitglieder teils erwählt, teils
landesherrlich ernannt werden. Die Generalsynode aber setzt sich
aus 150 von den Provinzialsynoden, 6 von den
evangelisch-theologischen Fakultäten aus ihrer Mitte
gewählten, 30 vom König ernannten Mitgliedern und den
Generalsuperintendenten zusammen (Generalsynodalordnung vom 20.
Jan. 1876). In der Provinz Hannover bestehen Bezirkssynoden und
eine Landessynode; in Schleswig-Holstein Propsteisynoden und eine
Gesamtsynode; in Baden, Bayern und Württemberg
Diözesansynoden und eine Landessynode, und zwar in Bayern
für das rechtsrheinische und für das linksrheinische
Staatsgebiet je eine Landessynode. In Oldenburg sind Kreissynoden
und eine Landessynode, in Hessen Dekanatssynoden und eine
Landessynode eingerichtet; im Königreich Sachsen, in Anhalt,
Braunschweig, Sachsen-Weimar und Sachsen-Meiningen bestehen nur
Landessynoden. Für die Wahrnehmung der laufenden
Geschäfte sind, während die S. nicht versammelt ist, in
der Regel die Synodalvorstände oder Synodalausschüsse
(Synodalräte) berufen (s. Presbyterial- und
Synodalverfassung). Vgl. Kähler, Visitation und S. (Gotha
1886).
Synodische Umlaufszeit, die Zeit zwischen zwei
aufeinander folgenden gleichnamigen Konjunktionen eines Planeten
mit der Sonne; synodischer Monat, die Zeit von einer Konjunktion
von Sonne und Mond bis zur nächsten (von einem Neumond bis zum
folgenden).
Synonymen (griech.), gleichbedeutende oder sinnverwandte
Wörter. Meist stehen die durch solche Wörter
ausgedrückten Begriffe als Unterarten unter einem höhern,
und man gebraucht sie als gleichbedeutend, indem man hier einzelne
Merkmale nicht beachtet, dort dieselben sich hinzudenkt. Im
Interesse der Deutlichkeit und Bestimmtheit des Ausdrucks hat man
aber das Bedürfnis gefühlt, die Bedeutung der S.
festzustellen, wodurch die Wissenschaft der Synonymik entstanden
ist, die vorzüglich auf einer richtigen Kenntnis und feinen
Beobachtung des Sprachgebrauchs beruht. Im Sammeln und
Erläutern der S. ist man erst in neuerer Zeit zu einem
befriedigenden Resultat gelangt. Namentlich sind die S. der
lateinischen Sprache von Dumesnil, Haase, Ernesti, Ramshorn,
Döderlein, Habicht, Lübker, Schmalfeld und Schultz, die
der deutschen Sprache von Aug. Eberhard, Meyer, K. Weigand und Dan.
Sanders behandelt worden.
Synonymie (griech.), Sinnverwandtschaft der Wörter;
rhetorische Figur, nach welcher eine Häufung von Synonymen zur
nachdrücklichen Hervorhebung des Gedankens angewendet wird,
wie Cicero von Catilina spricht: "Abiit, excessit, evasit,
erupit".
Synopsis (griech.), zusammenfassender Überblick,
übersichtliche Zusammenstellung verschiedener denselben
Gegenstand betreffender Schriften; insbesondere S. der Evangelien,
die Zusammenstellung derjenigen Stellen der drei ersten Evangelien,
worin dasselbe in mehr oder minder gleicher Weise berichtet
464
Synoptisch - Synthetische Sprachen.
wird (s. Evangelium, S. 948). Synopsen der letztern Art
lieferten Griesbach, De Wette, Lücke, Planck, Matthäi,
Friedlieb, Anger, Tischendorf, Schulze, Sevin. Vgl. Holsten, Die
synoptischen Evangelien (Heidelb. 1886).
Synoptisch (griech.), übersichtlich,
kurzgefaßt.
Synoptische Karten, Wetterkarten, welche die gleichzeitig
über einem großen (Gebiet herrschende Witterung
darstellen. Dieselben werden nach den an einen Zentralort
telegraphisch eingesandten Witterungsnachrichten zusammengestellt.
Für Deutschland geschieht das von der deutschen Seewarte (s.
d.) in Hamburg, und zwar werden bei der Zeichnung dieser Karten
diejenigen Depeschen zu Grunde gelegt, welche von einer
größern Anzahl von Orten täglich eintreffen und die
Witterung des Morgens 8 Uhr, von einzelnen Hauptstationen
außerdem auch noch die Nachmittags 2 Uhr angeben. Das Gebiet,
aus welchem die deutsche Seewarte ihre Morgentelegramme
erhält, erstreckt sich nach Westen bis nach der Westküste
von Irland, nach Süden bis Corsica und Süditalien, nach
Osten bis Moskau und nach Norden bis Bodö, nördlich vom
Polarkreis. Ganz besonders wertvoll werden die synoptischen Karten
für das Studium der Witterungsveränderungen und sind
daher für das Aufstellen von Wetterprognosen (s. d.) ganz
unentbehrlich (s. Meteorologie).
Synostosis (griech.), Knochenverbindung durch
Knochensubstanz, Knochenverwachsung.
Synovia (griech.), Gelenkschmiere, s. Gelenk.
Synovialhaut, s. Gelenk.
Synovitis, s. Gelenkentzündung.
Syntagma (griech.), Sammlung mehrerer Schriften oder
Aufsätze verwandten Inhalts, dann überhaupt eine
Zusammenstellung verschiedener Bemerkungen; im altgriechischen Heer
eine Abteilung von etwa 250 Mann (s. Phalanx); im Neugriechischen
s. v. w. Verfassung.
Syntax (griech.), die Lehre von der Verbindung der
Wörter zu Sätzen, also die Satzlehre, bildet neben der
Formenlehre als dem ersten den zweiten Hauptteil der Grammatik.
Obwohl sich über die naturgemäße Ordnung der Worte,
wie sie das innere oder logische Verhältnis der in die Rede
aufgenommenen Vorstellungen verlangt, allgemeine Grundsätze
aufstellen lassen, deren Inbegriff die allgemeine S. bilden
würde, so macht doch der eigentümliche Bau der einzelnen
vorhandenen Sprachen für eine jede derselben eine besondere S.
nötig, die wiederum in zwei Hauptteile, die Rektionslehre und
die Topik oder Lehre von der Wortfolge, zerfällt. Die
Begründung der vergleichenden Sprachwissenschaft hat dann auch
zu einer historischen und vergleichenden Betrachtungsweise der S.
Veranlassung gegeben. Die historische S. geht darauf aus, die
Entwickelung und Umbildung der S. in einer und derselben Sprache zu
verfolgen; die vergleichende S. hat die Geschichte der S. in
mehreren Verwandten Sprachen zum Gegenstand. Vgl. Dräger,
Historische S. der lateinischen Sprache (2. Aufl., Leipz. 1878-81,
2 Bde.); Delbrück und Windisch, Syntaktische Forschungen
(Halle 1871-88, Bd. 1-5); Jolly, Ein Kapitel vergleichender S.
(Münch. 1872).
Synthema (griech.), alles, was auf Verabredung beruht;
eine in verabredeten Zeichen bestehendeSchrift; daher
Synthematographie, die Kunst, mit solchen Zeichen in die Ferne zu
korrespondieren.
Synthesis (griech., Synthese), Zusammenstellung,
Verknüpfung (im Gegensatz zur Analysis, d. h. Zerlegung,
Trennung), insbesondere die Verbindung von Vorstellungen und
Begriffen untereinander, wie sie in der Auffassung der sinnlichen
Erscheinungen stattfindet, insofern hierbei die Mannigfaltigkeit
der wahrgenommenen Merkmale in eins zusammenfließt. Hiernach
versteht man unter einer synthetischen Erklärung eine solche,
bei welcher sich der Begriff aus dem zusammenfassenden Denken
ergibt, indem seine Merkmale vorher bekannt sind und auch die Art
ihrer Verknüpfung nicht zweifelhaft ist. Ein synthetisches
Urteil ist ein solches, dessen Prädikat nicht mit dem
Subjektsbegriff schon gegeben ist, wie z. B. in dem Urteil: alle
Körper nehmen einen Raum ein, sondern als eine neue Bestimmung
zu jenem hinzutritt, wie in dem Urteil: jeder Veränderung
liegt eine Ursache zu Grunde. Ist dabei das Urteil von der
Erfahrung abhängig, so wird es (mit Kant) S. a posteriori, im
entgegengesetzten Fall S. a priori genannt. Analog ist die
Unterscheidung der synthetisch (progressiv) und analytisch
(regressiv) gebildeten Schlußreihen, insofern man entweder
von gewissen Prämissen aus fortschreitend Folgerungen zieht,
oder rückwärts zu den letzten Gründen zu gelangen
sucht. Ebenso versteht man unter synthetischer Methode diejenige,
bei welcher, von den Prinzipien ausgehend, die Folgerungen
entwickelt, unter analytischer Methode dagegen diejenige. bei
welcher die Prinzipien aus den Thatsachen abgeleitet werden. - S.
heißt auch die Darstellung chemischer Verbindungen aus den
Elementen oder aus einfachern Verbindungen durch Einführung
von Atomen oder Atomgruppen. Die S. besitzt als
Untersuchungsmethode neben der Analyse (s. d.) eine große
Bedeutung für die Chemie und feierte den ersten Triumph 1828,
als Wöhler den Harnstoff aus den Elementen darstellte. Diese
große Entdeckung blieb aber ganz vereinzelt, bis Berthelot
auf die Wichtigkeit der S. für die organische Chemie hinwies.
Seitdem wurden durch S. unter anderm erhalten: Essigsäure,
Ameisensäure, Alkohol, Benzol, Kreatin, Guanidin,
Krotonsäure, Senföl, Cholin, Vanillin, Pikolin, Indigo,
Muskarin, Coniin etc., auch wurden Methoden ausgearbeitet zur S.
ganzer Körpergruppen, wie der Alkohole, Phenole, Aldehyde,
Säuren, Basen etc. Von besonderm Interesse ist die S. solcher
Verbindungen, welche im Organismus durch den Lebensprozeß
gebildet werden, weil die künstliche Darstellung dieser
Substanzen lehrt, daß in den lebenden Organismen dieselben
Gesetze walten wie in der sogen. toten Natur. Auch für die
Praxis haben die Erfolge der S. hohe Bedeutung und dürften
solche in Zukunft noch mehr gewinnen. Alizarin, Vanillin, Indigo
und Senföl werden künstlich dargestellt und spielen
bereits neben dem Krapp, der Vanille, den aus der Indigopflanze und
den Senfsamen gewonnenen Produkten eine Rolle in der Industrie. Man
hat auch schon synthetisch gewonnenen Alkohol auf den
Industrieausstellungen gezeigt, und da man von der
Ameisensäure und Essigsäure leicht zur Stearin- und
Palmitinsäure gelangen kann, da anderseits auch Glycerin durch
S. darzustellen ist und die genannten Säuren mit dem Glycerin
sich leicht zu Fetten vereinigen lassen, so ist die
Möglichkeit der Gewinnung von Fett ohne Pflanzen und Tiere
gegeben. Die moderne Chemie wendet die S. hauptsächlich an, um
über die Konstitution der Verbindungen Aufschluß zu
erhalten.
Synthetische Sprachen, seit A. W. Schlegel Bezeichnung
für solche Sprachen, in denen die grammatischen
Verhältnisse, wie z. B. im Latein und Griechischen,
vorherrschend auf dem Weg der Flexion gebildet werden, im Gegensatz
zu den analytischen
465
Syntonine - Syphilis.
Sprachen (s. d.), wie Französisch, Italienisch, Deutsch, in
welchen zum gleichen Zweck meistens mit Artikeln,
Hilfszeitwörtern etc. zusammengesetzte Ausdrücke
angewendet werden.
Syntonine, s. Proteinkörper.
Syphax, König der Massäsylier im westlichen
Numidien, ward im zweiten Punischen Krieg von Scipio 207 v. Chr.
für die Sache Roms gewonnen, aber bald darauf dadurch,
daß Hasdrubal ihm seine dem Masinissa verlobte Tochter
Sophonisbe (s. d.) zur Gattin gab, wieder auf die Seite der
Karthager gezogen. Er führte den Krieg gegen Scipio anfangs
nicht ohne Glück, ward aber 203 erst von Scipio, dann im
eignen Land von Lälius und Masinissa geschlagen und gefangen
genommen. Er starb als Gefangener in Tibur, nachdem er vorher (wie
von Polybius und Tacitus berichtet, aber von Livius bestritten
wird) im Triumph des Scipio aufgeführt worden war.
Syphilid, jeder infolge allgemeiner Syphilis auftretende
Hautausschlag.
Syphilis (griech., Lustseuche, Venerie,
Franzosenkrankheit, lat. Luës, Morbus gallicus), die
wichtigste der ansteckenden Geschlechtskrankheiten, da sie nicht
allein örtliche, auf die Stelle der Ansteckung
beschränkte Veränderungen herbeiführt, sondern sich
auf dem Weg der Lymph- und Blutbahn dem ganzen Körper mitteilt
und so zu einer Konstitutionskrankheit wird. Der krankmachende
Stoff (virus syphiliticum) ist seinem Wesen nach noch nicht
erforscht; man vermutet, daß es eine Bakterienart sei, hat
auch schon eine Reihe von Syphilisbacillen aufgefunden, welche mit
mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit als Ursache der S. bezeichnet
wurden, allein sichere Ergebnisse sind bisher noch nicht gewonnen.
Am meisten ist es wohl die Ähnlichkeit der syphilitischen
Gewebsveränderungen mit denen, welche durch die
Tuberkelbacillen hervorgebracht werden, welche den Gedanken an eine
ähnliche bacilläre Ursache immer wach erhält, und
vor allem die Analogie mit andern ansteckenden Krankheiten, bei
denen in den letzten Jahren die Bacillen tatsächlich
aufgefunden sind. Die S. würde alsdann in die Gruppe der
Wundinfektionskrankheiten einzureihen sein. Die Übertragung
findet nur von Mensch zu Mensch statt, Tiere leiden nicht an S.,
die Luft überträgt den Ansteckungsstoff nicht. Der
Hergang der Ansteckung wird in der Regel der Fälle so
vermittelt, daß a) ein mit syphilitischem Geschwur (Schanker)
an der Haut oder Schleimhaut behaftetes Individuum etwas von dem
Wundsekret dieses Geschwürs in eine kleine Schrunde der Haut
eines bis dahin nicht syphilitischen Individuums
überträgt, worauf sich an dieser Stelle ein primäres
Schankergeschwür entwickelt. Diese Art der Übertragung
vollzieht sich gewöhnlich beim Beischlaf an den Genitalien,
kann aber auch von syphilitischen Geschwüren der Lippen, der
Finger etc. aus erfolgen; b) durch Überimpfung von Blut und
Lymphe eines an konstitutioneller S. leidenden Menschen in eine
Wunde eines andern; c) durch Übertritt des Gifts vom Blut
einer syphilitischen Mutter auf das in ihrem Uterus sich
entwickelnde Kind. Die Krankheitserscheinungen sind 1) primäre
oder örtliche, an der Stelle der stattgehabten Ansteckung sich
entwickelnde Entzündungen und Geschwürsbildung; 2)
sekundäre, durch Aufnahme des Gifts in den Körper
bedingte Allgemeinerscheinungen. Manche Ärzte unterscheiden
auch wohl als 3) tertiäre S. solche Erkrankungen, welche noch
jahrelang nach der Ansteckung in verschiedenen innern Organen
beobachtet werden; da diese späten Nachschübe meist an
Leber, Nieren, Gehirn vorkommen, so hat man sie auch als
Eingeweide-S. (viscerale S.) bezeichnet. Die primäre S. ist
eine entzündliche Zellenwucherung, welche, an der Impfstelle
langsam wachsend, einen etwa bohnengroßen Knoten
hervorbringt, welcher sich derb anfühlt und als
Gummigeschwulst im Sinn Virchows aufzufassen ist. Die Zellen dieses
Knotens zerfallen fettig, die dünne bedeckende Hautschicht
wird abgestoßen, nach 4-6 Wochen ist aus ihm ein
Geschwür, der harte Schanker, entstanden. Als hartes,
induriertes Geschwür wird es bezeichnet im Gegensatz zu
einfachen, nicht auf S. beruhenden Hautgeschwüren, welche
nicht immer ihrem Namen "weicher Schanker" entsprechen und daher
leicht zu Verwechselungen Anlaß geben; die Frage, welche von
beiden Geschwürsformen vorliegt, wird oft erst durch die
spätern Folgezustände sicher entschieden. Während
bei einfachen Geschwüren der Verlauf meist ein schneller ist,
das Geschwür bei guter Reinhaltung rasch heilt, höchstens
zur Bildung schmerzhafter Schwellungen der Leistendrüsen
führt, so stellt sich beim syphilitischen Geschwür
langsame schmerzlose Schwellung der Nachbardrüsen ein, welche
den Übertritt des Gifts ins Blut anzeigt und nun die
sekundären Erscheinungen einleitet; man nennt diese
geschwollenen Lymphdrüsen indolente Bubonen. In ihrem nun
folgenden sekundären Stadium, in welchem der Körper mit
dem Gift als durchseucht gedacht wird (daher konstitutionelle S.),
treten gewöhnlich etwa zwei Monate nach der Ansteckung sehr
mannigfache Hautausschläge auf, welche in Form von Flecken,
Knötchen, Schuppenwucherung, nässenden Entzündungen
auftreten und als Syphilid en zusammengefaßt werden. Sie
verursachen höchst selten das Gefühl von Brennen und
Jucken und treten in der Kälte deutlicher hervor als in der
Wärme. Die häufigste Form ist ein rotfleckiger Ausschlag
(Roseola syphilitica), welcher in Gestalt von
halblinsengroßen, runden, geröteten Flecken auf der Haut
des Gesichts, am Rumpf und an den Extremitäten auftritt. Nach
längerm Bestehen bekommen die Flecke ein schmutzig braun-rotes
Ansehen und verschwinden endlich mit schwach kleienförmiger
Abschelferung der Oberhaut. Eine andre Ausschlagsform ist der
Lichen syphiliticus, bestehend aus kupferroten, nicht juckenden
Knötchen, die vereinzelt oder in Gruppen auftreten und an den
verschiedensten Körperstellen vorkommen. Die Psoriasis
syphilitica (Schuppenausschlag) besteht in einer reichlichen
kleienartigen Abschelferung der Epidermis, die auf mehr oder
weniger dicht stehenden, geröteten Hautflecken stattfindet.
Die Psoriasis syphilitica hat die Eigentümlichkeit, daß
sie die Kniee und Ellbogen (wo die nicht syphilitische Psoriasis am
häufigsten vorkommt) immer verschont und dagegen sehr gern an
den Handtellern und an der Fußsohle sich zeigt, die
ihrerseits von nicht syphilitischen Schuppenausschlägen fast
ausnahmslos verschont bleiben. Das pustulöse, aus
Eiterbläschen bestehende Syphilid (Ecthyma syphiliticum)
befällt namentlich den behaarten Kopf und das Gesicht. Aus den
beim Kämmen der Haare etc. zerkratzten Pusteln entstehen
zuweilen tiefe Geschwüre mit gerötetem Hof, welche
äußerst hartnäckig sind. Seltener als die genannten
Hautausschläge kommen die blasen- und
bläschenförmigen Syphiliden vor. Die Blasen hinterlassen
nach ihrem Zerplatzen oder Eintrocknen einen Schorf, unter welchem
sich ein Geschwür entwickelt (Schmutzflechte, Rupia
syphilitica). Große Blasen kommen bei neugebornen Kindern als
Zeichen angeborner S. häufig, bei Erwachsenen um so seltener
vor (Pemphi-
466
Syphilom - Syracuse.
gus syphiliticus. s. Tafel "Hautkrankheiten", Fig. 3).
Außer diesen Ausschlägen kommen auch in der Haut
wirkliche Gummiknoten vor, namentlich im Gesicht und an der Stirn,
wo sie als Corona Veneris bezeichnet werden. Alle diese
syphilitischen oder gummösen Entzündungsknoten,
gleichviel ob sie in der Haut als derbe rote Knoten oder in den
Schleimhäuten als dicke Wucherungen auftreten, oder ob sie in
der Iris, in Leber, Nieren oder Gehirn, Knochenhaut oder
Knochenmark mehr als flache Geschwülste oder große
Knoten hervorwuchern, sie alle haben eine gleiche Struktur wie der
primäre Schankerknoten, sie bestehen aus weichem Bindegewebe
und können 1) bei geeigneter Behandlung verfetten und so
völlig zurückgebildet werden, oder 2) sie können,
wenn sie oberflächlich liegen, geschwürig zerfallen, und
3) sie bilden sich teilweise zurück, teilweise schrumpfen sie
und hinterlassen derbe, strahlige, weiße oder gefärbte
Narben. Durch diese große Mannigfaltigkeit in der
äußern Erscheinung der S. ist es bedingt, daß
nahezu in jedem Organ Erkrankungen vorkommen, welche durch gewisse
Eigentümlichkeiten als spezifisch syphilitische erkannt
werden. Es gibt an der Regenbogenhaut des Auges eine zu
Verwachsungen führende Entzündung (Iritis syphilitica, s.
Tafel "Augenkrankheiten" , Fig. 5), es gibt im Kehlkopf
gummöse Neubildungen, welche große, strahlige Narben
hinterlassen (s. Tafel "Halskrankheiten", Fig. 3); an den Knochen
kommen sowohl knöcherne Auswüchse (Exostosen) als
Defektbildungen, eine Art von Knochenfraß (Caries sicca) vor,
welche durch bohrende Schmerzen (dolores osteocopi) ausgezeichnet
sind. In der Leber bringt die S. Narben hervor, durch welche das
Organ in unregelmäßige Lappen eingeteilt wird (hepar
lobatum), in der Nase führen syphilitische Geschwüre zur
Bildung stinkender Borken (Ozaena syphilitica) und Einfallen der
Nase; im Gehirn und Rückenmark können Lähmungen
aller Art durch gummöse Knoten entstehen; an der Haut wuchern
warzige Gebilde (Feigwarzen, Kondylome) mit breiter Basis und
höckeriger Oberfläche hervor; in den Lungen kann die S.
eine besondere Art der Schwindsucht bedingen, und endlich kommen im
Herzen Geschwülste, im Darm Geschwüre vor, welche der S.
zuzuschreiben sind. Personen, welche an konstitutioneller S.
leiden, erleben oft viele Jahre hindurch immer neue
Organerkrankungen, so daß sie schließlich an
Erschöpfung, nicht selten unter allgemeiner Amyloidentartung
zu Grunde gehen. Die Behandlung richtet sich zunächst auf die
Behandlung des primären Geschwürs. Dieses heilt bei
gründlicher Reinhaltung, event. unter gleichzeitiger Anwendung
von Quecksilber ohne Schwierigkeit. Die konstitutionelle S. wird
mit richtiger und frühzeitiger Anwendung von Quecksilber in
Form von Einreibung von grauer Quecksilbersalbe oder subkutaner
Einspritzung von Sublimat (Lewin) oder innerlicher Darreichung von
Kalomel (Ricord) oft vollständig geheilt. Bei veralteter S.
sind Jodkalium, der Gebrauch von Schwefelbädern, wie Aachen,
Nenndorf und andern warmen Bädern, von guter Wirkung. Die S.
ist von den Eltern auf die Kinder übertragbar. Frauen, welche
zur Zeit der Konzeption bereits an sekundärer S. leiden oder
auch erst während der Schwangerschaft syphilitisch werden,
bringen fast immer unreife, tote Früchte durch Abortus oder
Frühgeburt zur Welt. In andern Fällen wird das Kind zwar
ausgetragen, stirbt aber bei oder kurz nach der Geburt ab. Nur
selten wird das Kind einer syphilitischen Mutter längere Zeit
am Leben erhalten. In diesem Fall sind entweder schon gleich bei
der Geburt Symptome der S. an dem Kind vorhanden, oder die S. ist
noch latent, und die Symptome derselben treten erst nach Wochen
oder Monaten hervor. Die meisten der Kinder mit angeborner S.,
welche am Leben bleiben, haben die Krankheit von dem zur Zeit der
Zeugung syphilitischen Vater geerbt. Es ist sicher konstatiert,
daß die S. vom Vater auf das Kind übergehen kann, ohne
daß die Mutter syphilitisch infiziert ist oder von dem
kranken Kind, welches sie in ihrem Schoß birgt, infiziert
wird. Auch die von einem syphilitischen Vater herstammende vererbte
S. verrät sich in manchen Fällen gleich bei der Geburt
durch deutliche Zeichen, während in andern erst später
charakteristische Störungen auftreten. Die erstere Gruppe von
Fällen bietet für die Behandlung wenig Aussicht, meistens
gehen die Kinder, namentlich wenn schwere Knochenleiden oder
Pemphigus vorhanden sind, zu Grunde. Dagegen hat die Behandlung der
angebornen, aber anfangs latent gebliebenen S. günstige
Erfolge aufzuweisen. Gewöhnlich gibt man den Kindern kleine
Dosen Kalomel oder läßt Sublimatbäder anwenden.
Dabei muß man die Kräfte des Kindes durch Zufuhr einer
möglichst zweckmäßigen Nahrung (Muttermilch)
aufrecht erhalten. Dem syphilitischen Kind eine Amme zu geben, ist
nicht rätlich, weil letztere der Gefahr der Ansteckung
ausgesetzt ist. Die S. erregte zuerst am Ende des 15. Jahrh. als
Franzosenkrankheit (Morbus gallicus) die Aufmerksamkeit der
Ärzte und richtete bei den damaligen Sitten und der Unkenntnis
über ihre zweckmäßige Behandlung furchtbares
Unglück an. Der Name S. ist zuerst von dem Italiener
Fracastoro (1521; vgl. dessen "S. oder gallische Krankheit",
deutsch, Leipz. 1880) gebraucht worden. Vgl. Ricords Vorlesungen
über S. (übersetzt von Gerhard, Berl. 1848); v.
Bärensprung, Die hereditäre S. (das. 1864); Geigel,
Geschichte, Pathologie und Therapie der S. (Würzb. 1867);
Lewin, Die Behandlung der S. mit subkutaner Sublimatinjektion (das.
1869); Zeißl, Pathologie und Therapie der S. (5. Aufl.,
Stuttg. 1888); Weil, Über den gegenwärtigen Stand der
Lehre von der Vererbung der S. (Leipz. 1878); Rosenbaum, Geschichte
der Lustseuche im Altertum (Halle 1888).
Syphilom, Gummigeschwulst, s. Syphilis.
Syphon, s. Siphon.
Syphonoid (griech.), ein mit dem Pulsometer (s. d.)
verwandter Wasserhebeapparat, welcher sich von diesem durch seine
Heberform, durch das Vorhandensein eines besondern Raums für
Dampfkondensation und dadurch, daß er den Dampf nicht direkt
auf die Wasseroberfläche läßt, sondern einen
dazwischengeschalteten, schlecht wärmeleitenden Schwimmer
wirken läßt, durch welchen ein starker Dampfverlust
verhütet und die Steuerung des Dampfes mittels eines Hahns
bewirkt wird, unterscheidet. Vgl. Uhland, Der praktische
Maschinenkonstrukteur, S. 95 (Leipz. 1878).
Syra (bei den Alten und neuerdings wieder offiziell
Syros), 1) eine der Kykladen, fast mitten im Archipel gelegen, 80
qkm (1,45 QM.) groß und bis 431 m hoch, erzeugt Getreide und
Wein und hat (1879) 26,946 Einw., welche vornehmlich vom Handel
leben. Derselbe ist vorwiegend Kommissions- und Speditionshandel
und versorgt fast ausschließlich die sämtlichen Inseln
des Archipels mit ihren Bedürfnissen. Auf S. befindet sich ein
deutsches Konsulat. - 2) (Neu Syra), Stadt, s. Hermupolis.
Syracuse (spr. ssirrakjuhs), Stadt im nordamerikan. Staat
New York, am Südende des Onondagasees, hat ein Irrenhaus, ein
Asyl für Blödsinnige, ein Zuchthaus und (1880) 51,792
Einw. In der Nähe un-
467
Syrakus (Provinz und Stadt).
gemein ergiebige Solen. S. hat außer seinem Salzhandel
noch Hochöfen, Maschinenbau und Brauerei.
Syrakus (Siracusa), Provinz des Königreichs Italien,
umfaßt den südöstlichen Teil der Insel Sizilien,
wird im N. und W. von den Provinzen Catania und Caltanissetta, im
Süden und O. vom Afrikanischen und Ionischen Meer begrenzt und
hat ein Areal von 3697 qkm (nach Strelbitsky 3729 qkm = 67,73 QM.)
mit (1881) 341,526 Einw. Der Boden ist sehr fruchtbar und liefert
Getreide (besonders Weizen, 1887: 586,620 hl), Öl (48,281 hl),
Wein (1,770,942 hl), Südfrüchte in Überfluß,
auch zur Ausfuhr. Von geringerer Bedeutung ist die Viehzucht mit
Ausnahme der Schafzucht (1881: 100,631 Schafe), wichtig dagegen die
Seefischerei. Die Provinz zerfällt in die drei Kreise Modica,
Noto und S. (s. Karte "Sizilien"). Die gleichnamige Hauptstadt
liegt auf der mit dem Festland durch einen Damm verbundenen Insel
Ortygia, am Endpunkt der von Messina kommenden Eisenbahn, ist durch
Wassergräben mit Mauern an der Landseite und durch ein Kastell
an der Südseite der Insel befestigt, hat aber nur einen Umfang
von 4 km (gegen 33 km Umfang des antiken S.). Die Bedeutung der
Stadt liegt in dem großen Hafen, welcher die ganze Bucht
zwischen der Insel Ortygia im N. und dem Vorgebirge Plemmyrion
(Massolivieri) im SO. umfaßt und für die Aufnahme der
größten Flotte geeignet ist. Unter den öffentlichen
Bauten sind hervorzuheben: der Dom Santa Maria del Piliero (in die
gewaltigen Säulen eines dorischen Tempels eingebaut); die
Kirchen San Giovanni (aus dem 12. Jahrh.) und Santa Lucia; der
elegante Palazzo Communale u. a.; ferner von Privatgebäuden:
der gotische Palast Montalto und der Palazzo Lanza. S. hat ein
Lyceum, ein Gymnasium, eine technische Schule, ein Seminar, ein
Museum (mit zahlreichen Antiquitäten, darunter eine Statue der
Venus, ein kolossaler Kopf des Neptun u. a.), eine Bibliothek mit
über 10,000 Bänden, ferner eine Filiale der Nationalbank,
mehrere selbständige Banken, eine Handelskammer,
Wohlthätigkeitsanstalten, Fabrikation von Chemikalien und
Töpferwaren, lebhaften Handel (besonders mit Agrumen, Wein,
Öl, Seesalz etc.) und (1881) 19,389 Einw. Im Hafen liefen
1887: 1215 Schiffe mit 158,084 Ton. ein. S. ist Sitz der
Präfektur, eines Erzbischofs, eines Zivil- und
Korrektionstribunals, eines Assisenhofs etc. sowie mehrerer
Konsulate. Von der Größe der antiken Stadt zeugen nicht
unbedeutende Trümmerreste, so: Überbleibsel von drei noch
sehr altertümlichen dorischen Tempeln, Aquädukte, Reste
der Stadtmauer, ein Altar, die Trümmer der Bergfeste Euryalos,
große Steinbrüche, darunter die Latomia del Paradiso mit
dem "Ohr des Dionysios", einer durch eigentümliche Akustik
ausgezeichneten Grotte, sowie die Latomia dei Cappuccini; das
griechische Theater aus dem 5. Jahrh.; ein römisches
Amphitheater aus der Zeit des Augustus; die Arethusaquelle etc. Aus
altchristlicher Zeit haben sich geräumige Katakomben erhalten.
Schöne Gartenanlagen enthält die Villa Landolina im
antiken Stadtgebiet, wo sich die Grabstätte des Dichters
Platen befindet. Am Kyaneflüßchen, zum Anapo gehend,
gedeiht die Papyrusstaude in besonderer Üppigkeit.
[Geschichte.] S. (Syracusä), im Altertum die
größte und reichste Stadt Siziliens, lag anfangs auf der
hart vor der Küste gelegenen, zuerst von Phönikern
besetzten Insel Ortygia, von wo sich die Stadt später
über das Festland ausbreitete. Zur Zeit ihrer
größten Ausdehnung, wo sie über eine Million
Einwohner zählte, bestand sie aus fünf Hauptteilen: der
Insel Ortygia (Nasos) mit der Quelle Arethusa, den Tempeln der
Artemis und Athene, den großen Getreidemagazinen, dem von
Hieron erbauten Palast und der im nördlichen Teil von
Dionysios I. erbauten Akropolis; der 66 m hoch ansteigenden
Halbinsel Achradina, dem Hauptteil und Mittelpunkt der Stadt, mit
der von Säulengängen umgebenen Agora, dem Prytaneion
etc.; Tycha, dem an den nördlichen Teil von Achradina westlich
anstoßenden, volkreichsten Teil der Stadt; Neapolis, auf der
Südwestseite von Achradina, mit dem Haupttheater und Tempeln
der Demeter, Kora etc.; Epipolä, einer die ganze Stadt
beherrschenden Höhe nordwestlich von Neapolis, welche
Dionysios I. mit einer starken Mauer umgeben ließ, durch das
Fort Euryalos krönte und mit in den Bereich der die Stadt
umgebenden Befestigungen zog. Neapolis und Achradina enthielten
große Steinbrüche (Latomien), welche tief in die Erde
gingen und als Gefängnisse benutzt wurden. S. besaß zwei
treffliche, durch tiese Buchten gebildete Häfen, einen
kleinern (Lakkios) im N. von Ortygia und einen größern,
der mit Ketten gesperrt werden konnte, im W. der genannten Insel.
Südlich von S., in der Nähe der Quelle Kyane, lagen das
Olympieion und der Hafenort Daskon. S. war eine dorische
Niederlassung, 734 v. Chr. von den Korinthern auf Ortygia
gegründet und nach der sumpfigen Ebene Syrako, westlich vom
großen Hafen, benannt. Wiewohl der Zeit nach die zweite
griechische auf Sizilien gegründete Kolonie, wurde sie doch
bald durch Betriebsamkeit und Handel dem Rang nach die erste und
gründete selbst neue Niederlassungen auf Sizilien (Akrä,
Kasmenä, Kamarina u. a.). Sie hatte eine aristokratische
Verfassung. Die Gamoren hatten die Regierung in den Händen,
zuerst mit einem König an der Spitze, später ohne einen
solchen. Aus den Gamoren, den Nachkommen der ersten Kolonisten,
wurden die Magistrate und Mitglieder des Hohen Rats gewählt,
welche das Volk in ihren Versammlungen leiteten. 491 wurde die
Aristokratie der Gamoren von der demokratischen Partei
gestürzt, welche aber keine geordnete Verfassung herzustellen
vermochte. So ward es Gelon (s. d.) leicht, die Gamoren nach S.
zurückzuführen und sich dann selbst 485 der Herrschaft zu
bemächtigen. Unter ihm erreichte S. seine höchste
Blüte, seine Flotten beherrschten die umliegenden Meere, und
die meisten Städte Siziliens standen unter seinem
Einfluß. Namentlich sein Sieg über die Karthager am
Himera 480 machte S. zur mächtigsten Stadt Siziliens. Er
verband die Neustadt auf dem Felsplateau Achradina mit Ortygia
durch einen Damm und umgab das Ganze mit einer kolossalen Mauer,
außerhalb welcher noch die Vorstädte Tycha, Neapolis und
Epipolä entstanden. Auf Gelon folgte sein Bruder Hieron I.
(477-467) und auf diesen der dritte Bruder, Thrasybulos, der aber
schon 466 vertrieben ward. An die Stelle der Tyrannis trat jetzt
eine demokratische Verfassung. Zur Sicherstellung der Demokratie
ward eine dem athenischen Ostrakismos ähnliche Maßregel
in dem Petalismos ("Blättergericht", weil mit beschriebenen
Olivenblättern abgestimmt wurde) eingeführt, doch ward
derselbe als die Ochlokratie nur befördernd bald wieder
aufgehoben. Die innern Unruhen benutzend, strebten sich mehrere von
S. abhängige sizilische Städte frei zu machen und suchten
zu diesem Zweck Unterstützung bei den Athenern nach. Diese,
schon längst eifersüchtig auf die mächtige
Handelsstadt, sandten auch 415 eine große Flotte unter Nikias
und Lamachos nach Sizilien (sizilische
468
Syrdarja - Syrien.
Expedition der Athener 415-413). Die Athener eroberten 414 die
Vorstädte Epipolä und Tycha und
hatten S. schon auf der Landseite eingeschlossen, als nach dem
Tode des Lamachos der Spartaner Gylippos ihre Verschanzungen
durchbrach und sie zwang, sich auf den Angriff zur See zu
beschränken. Unter Führung des Gylippos und des
Hermokrates erbauten die Syrakusier 413 eine Flotte, entrissen den
Athenern ihre befestigte Stellung auf dem Vorgebirge Plemmyrion,
Ortygia gegenüber, und brachten ihnen in einer Seeschlacht
eine Niederlage bei. Durch Demosthenes verstärkt, versuchten
die Athener einen
nächtlichen Angriff auf Epipolä, der mißlang,
lieferten den Syrakusiern, um die Ausfahrt aus dem Hafen zu
erzwingen, eine unglückliche Seeschlacht und wurden, 40,000
Mann stark, auf dem Abzug zu Lande am Assinaros vernichtet. 7000
Gefangene wurden in die Latomien auf Achradina geworfen, wo sie
meist verschmachteten, Nikias und Demosthenes hingerichtet. Unter
dem Einfluß des Volksvorstehers
Diokles wurde darauf in S. eine neue, völlig demokratische
Verfassung eingeführt, deren erste Bestimmung die Wahl der
Magistrate durch das Los war. Zugleich wurden geschriebene, sehr
strenge Gesetze gegeben. Der gleichwohl überhandnehmenden
Zügellosigkeit zu steuern und sich gegen die Eroberungs-
pläne Karthagos zu schützen, übertrug das Volk
dem
tapfern Dionysios I. (s. d.) das Oberkommando über die
Armee, bahnte ihm aber dadurch den Weg
zur Tyrannis (406). Dionysios drängte nach mehreren Kriegen
die Karthager in den westlichen Teil Siziliens zurück und
befestigte die Herrschaft von S. über die Osthälfte der
Insel und einen Teil Unteritaliens. In S. erbaute er auf der
Nordspitze der
Insel Ortygia die Feste Hexapylon und umgab die
Stadt mit einer hohen Quadermauer, welche auch die
Vorstädte Tycha und Epipolä umfaßte und 20 km lang
war; die Einwohnerzahl stieg auf eine Million. Im kleinen
Außenhafen legte Dionysios 50, im großen innern 100
Docks für Kriegsschiffe an. Die wohlbefestigte Regierung
übernahm nach ihm 367 sein
Sohn Dionysios II., ein Wollüstling, der 357 von
Dion vertrieben wurde, aber 346 zurückkehrte. Endlich
nötigte ihn 343 Timoleon, seine Herrschaft niederzulegen.
Letzterer zerstörte die Burg , stellte die demokratische
Verfassung wieder her und zog durch Häuser- und
Äckerverteilung an 60,000 neue Ansiedler in die
entvölkerte Stadt. Die nach seinem Tod entstandenen Unruhen
benutzte Agathokles (s. d.), um sich unter der Verheißung
einer reinen Demokratie zum Tyrannen aufzuwerfen (317). Seine
strenge und gewalttätige Regierung erhielt wenigstens Ruhe im
Innern, wodurch es noch möglich wurde, daß sich S. gegen
die in Sizilien immer weiter fortschreitenden und S. schon
belagernden Karthager halten konnte. Nach Agathokles' Tod (289)
warf sich Mänon, der Mörder jenes, zum Herrscher auf,
ward aber von Hiketas vertrieben, der sich drei Jahre lang
behauptete. Als er gegen die Agrigentiner zu Felde
zog, stritten in der Stadt Thynion und Sostratos
um die Herrschaft. Zur Stillung dieser Unruhen riefen die
Syrakusier den damals in Italien kriegführenden Pyrrhos (277)
herbei, der S. von den Karthagern befreite und seinen Sohn zum
König von
Sizilien einsetzte. Nach seinem Weggang wählten
aber (275) die Syrakusier Hieron II. zu ihrem Feldherrn und 269
zum König. Dieser stand den Römern im ersten und zweiten
Punischen Krieg mit Erfolg bei und sicherte sich dadurch seine
Herrschaft im östlichen Teil der Insel. Sein Enkel und
Nachfolger
(seit 215) Hieronymus trat dagegen im zweiten
Punischen Krieg auf die Seite der Karthager und beschleunigte
dadurch seinen Sturz (214) und den Untergang der
Selbständigkeit von S., das 212 nach
tapferer Verteidigung durch Archimedes von Marcellus erobert
wurde. Seitdem ward S. mit dem östlichen Teil Siziliens
römische Provinz. Der alte Glanz der Stadt verschwand für
immer, und die Bevölkerung nahm immer mehr ab. Vergebens
suchte sie Augustus durch eine Kolonie zu heben. Gegen Ende des 5.
Jahrh. n. Chr. ward S. von germanischen Völkerschaften, die
zur See ankamen, besonders von den Vandalen, 884 aber von den
Sarazenen geplündert. Kaiser Heinrich VI. schenkte 1194 die
Stadt
den Genuesen, die ihm gegen Tankred beigestanden hatten; doch
befreiten sich die Syrakusier mit Hilfe der Pisaner bald wieder. S.
kam hierauf unter spanische Herrschaft und ward Residenz des
Statthalters. Infolge einer Seeschlacht, die bei S. 1718 zwischen
den Engländern und Spaniern geschlagen wurde, mußten die
letztern die Stadt den Österreichern einräumen, bekamen
aber 1755 die Insel Sizilien wieder. 1100,1542, 1693und 1735 litt
S.bedeutend durch Erdbeben. Vgl. Arnold, Geschichte von S. (Gotha
1816); Privitera, Storia di Siracusa
antica e moderna (Neap. 1879, 2 Bde.); Cavallari u. Holm,
Topografia archeologica di Siracusa (Pal. 1884; deutsch bearb. von
Lupus: "Die Stadt S. im
Altertum", Straßb. 1887).
Syrdarja, Fluß, s. Sir Darja.
Syria Dea, Göttin, f. Derketo.
Syrien (türk. Suria), ein Land der asiat.
Türkei, an der Ostküste des Mittelländischen Meers,
bezeichnete ursprünglich den gesamten Umfang des assyrischen
Reichs, bis der Name in abgekürzter Form durch die Griechen
auf die Gebiete westlich des Euphrat beschränkt wurde, und
heute versteht man darunter alles Land zwischen dem Euphrat und der
Arabischen Wüste im O. und dem Mittelmeer im W., dem Taurus im
N. und der Grenze Ägyptens im Süden, d. h. das heutige
Wilajet Surija und die südwestliche Hälfte von Haleb
(Aleppo) sowie die selbständigen
Bezirke Libanon und Jerusalem (s. Karte "Türkisches
Reich"). Infolge des Parallelismus seiner von N. nach Süden
streichenden Gebirge, welche, wenn auch von tiefen Querspalten
durchschnitten, den Taurus im N. mit den von NW. nach SO. ziehenden
Küstengebirgen des Arabischen Meerbusens verbinden, ist
das
Land von ziemlich gleichförmiger
Oberflächenbildung.
Ihrer Ausdehnung und mittlern Höhe nach stehen die
syrischen Gebirge zwar hinter den großen ostwestlich
gerichteten Systemen Asiens zurück, bewirken aber dennoch
infolge ihrer nordsüdlichen Aufrichtung eine sehr ungleiche
Verteilung des Regens. Da im Mittelmeerbecken die Westwinde
vorherrschen, so ist nur der Westabfall des Landes reich an Regen;
dagegen sind die östlichen Abdachungen und innern Hochebenen
sehr arm an Niederschlägen, Quellen und Flüssen und
bilden zum größten Teil vegetationsarme Steppen oder
kahle Wüsten. Während von der Küste weit
landeinwärts die Gebirge durchaus der Kalkformation
angehören und nur stellenweise, wie in der Spalte
des Jordanthals, vulkanische Gebilde zu Tage kommen, treten
dieselben weiter ostwärts und bis tief in die Wüste
hinein, namentlich in der Südhälfte von S., in Hunderten
von Trachyt- und Basaltkegeln einzeln oder in größern
Gruppen und von der verschiedensten Höhe auf (z. B. Dschebel
Hauran 1782 m).
Die größten, als nackte Felsen über die
Waldregion ansteigenden Erhebungen der Kalkgebirge finden sich
469
Syrien (Geschichte).
im N.: der Amanos der Alten (Gjaur Dagh), 1850 m hoch, der
Kasios (Dschebel Akraa), 1770 m, der Libanon, 3063 m;
landeinwärts der Hermon (Dschebel el Scheich), 2860 m, und der
Antilibanon, 2670 m. Die südliche Fortsetzung des Libanon und
Antilibanon (vgl. Palästina) steigt nirgends zu mehr als
1000-1200 m Höhe an; ihre meist abgerundeten Gipfel und
Scheitelflächen sind daher bis oben hinauf angebaut, und
dasselbe gilt von den östlich sich anschließenden
Hochflächen (die alten Landschaften Hauran und Baschan,
700-900 m hoch) und um Damaskus (700 m), die zum Teil aus sehr
ergiebigem Thonboden bestehen. Bei dieser Beschaffenheit der
Oberfläche sind die Flußthäler (von dem nur als
Grenzfluß Bedeutung habenden Euphrat abgesehen) zum
größten Teil kurze Querthäler, in denen nur aus den
höhern Küstengebirgen (Amanos, Kasios, Libanon) eine
größere Wassermenge mit starkem Gefälle unmittelbar
dem Meer zufließt. Die wenigen längern Flüsse
verlaufen in nordsüdlichen Längsthälern zwischen den
Parallelketten des Kalkgebirges und zwar in entgegengesetzter
Richtung nach N. und Süden, weil die bedeutendste
Bodenanschwellung gerade in der Mitte Syriens unter 34°
nördl. Br. liegt. Dort steigt das breite Thal zwischen dem
Libanon und Antilibanon (jetzt Bekaa genannt, im Altertum Bukka) zu
fast 1200 m an und entsendet nach N. den größten
syrischen Strom, den Orontes (El Asi), nach Süden den Lita
(Litani), welcher zuletzt scharf nach W. umbiegt und in einem
kurzen Querthal das Meer erreicht, und in einer östlichen
Parallelfalte den Jordan (s. d.). Was das Klima anlangt, so hat S.
eigentlich nur zwei Jahreszeiten, eine mit, die andre ohne Regen.
Von Anfang Mai bis Ende Oktober ist die regenlose Zeit, mit
vorherrschenden Nordwestwinden; gegen Ende Oktober bezeichnen
Gewitter den Beginn der Zeit, wo Südwest- und Südwinde
Regen bringen. Die Temperaturunterschiede sind bedeutend: im Innern
des Landes, in der Wüste und auf den Hochebenen sinkt das
Thermometer häufig unter 0°, und in Damaskus, Jerusalem
(mittlere Jahrestemperatur +17° C.) und Aleppo fällt
öfters Schnee. Die Sommerhitze in Damaskus und sonst im Innern
ist natürlich bedeutender als an der Küste, wird aber
noch sehr von dem Ghor (Thal des Jordan) übertroffen. S. ist
kein unfruchtbares Land und war einst angebauter als heute. Sein
Küstenland gehört der Mittelmeerflora an, die sich durch
immergrüne, schmal- und lederblätterige Sträucher
und rasch verblühende Frühlingskräuter auszeichnet;
das Plateau hat orientalische Steppenvegetation mit vielen
Dornsträuchern und wenig zahlreichen Bäumen (Labiaten,
Disteln, Eichen, Pistazien, Koniferen etc.); das Ghor (s. d.)
gehört der subtropischen Flora an. Die hauptsächlichsten
Ausfuhrartikel sind: Weizen, Süßholz, Rosenblätter,
Aprikosen, Rosinen, Oliven und Öl, Tabak, Galläpfel,
Seide, Kokons (1877 wurden 1,925,000 kg Kokons und 140,000 kg rohe
Seide produziert) und Südfrüchte. Unter den Haustieren
spielen die Schafe (meist Fettschwänze) eine große
Rolle, nächst ihnen die Ziegen. Das Rindvieh ist klein und
wird nur im Libanon geschlachtet. Der indische Büffel kommt im
Jordanthal vor, das Kamel hauptsächlich in der Wüste;
auch Pferde, Esel, Hühner sind häufig. Die viel
vorkommenden Heuschrecken werden von den Beduinen gegessen. Die
Bevölkerung von S. zerfällt der Abstammung nach in
Nachkommen der alten Syrer (Aramäer), Araber, Juden, Griechen,
Türken und Franken, der Religion nach in Mohammedaner,
Christen verschiedener Bekenntnisse und Juden. Die Syrer nahmen zum
Teil den Islam und die arabische Sprache an, zum Teil blieben sie
Christen. Die Araber zerfallen in seßhafte und Nomaden,
letztere äußerlich Mohammedaner, eigentlich aber
Sternanbeter. Türken sind nur in geringer Zahl vorhanden. Von
der gesamten, auf etwa 2 Mill. Seelen (14 auf 1 qkm)
geschätzten Einwohnerschaft des Landes bekennen sich vier
Fünftel zum Islam. Unter den Christen überwiegen die
fanatischen griechisch-orthodoxen (Patriarchate von Jerusalem und
Antiochia); sie sprechen meist arabisch. Armenier und Kopten finden
sich fast nur in Jerusalem; wichtiger sind die Jakobiten,
namentlich im N. verbreitet, ihrem Glauben nach Monophysiten. Die
römisch-katholische Kirche, vertreten durch Lazaristen,
Franziskaner und Jesuiten, besitzt in S. zwei Filialkirchen, die
griechisch-katholische und die syrisch-katholische, mit gewissen
Vorrechten. Zu ihr gehören auch die Maroniten (s. d.) im
Libanon, deren Patriarch von Rom bestätigt wird. Protestanten,
Bekehrte der amerikanischen Mission, gibt es nur ein paar tausend.
Die Juden zerfallen in spanisch-portugiesische Sephardim und
Aschkenazim aus Rußland, Österreich und Deutschland;
außerdem gibt es ca. 50 Familien der Samaritaner in Nabulus.
Von mohammedanischen Sekten sind aufzuführen: die Drusen (s.
d.) im Libanon und Hauran, zum größern Teil von den
alten Syrern, zum Teil von eingewanderten Araberstämmen
abstammend; die Nossairier (s. d.), welche auf dem nach ihnen
genannten Dschebel Nasairijeh ihre Sitze haben; die Ismaeliten (s.
d.), die mit den berüchtigten Assassinen identisch sind, und
die Metâwile, eine Abart der Schiiten, südlich von den
Drusen im Libanon und in Galiläa zwischen Saida und Tyros.
[Geschichte.] Die Urbewohner Syriens, sämtlich Semiten,
zerfielen in mehrere Stämme, von denen derjenige der
Aramäer (s. Aramäa) oder der eigentlichen Syrer der
bedeutendste war. Das Land zerfiel damals in einzelne Städte
mit Gebieten unter besondern Oberhäuptern. Schon im
frühsten Altertum werden Damaskus, Hamath, Hems oder Emesa,
Zoba u. a. erwähnt. Ein altes wichtiges Emporium war die
Palmenstadt Tadmor oder Palmyra; nicht minder berühmt als
Mittelpunkt des Sonnenkultus war Baalbek oder Heliopolis. Eine
größere Rolle in der Weltgeschichte als die eigentlichen
Syrer spielten die an der Westküste wohnenden Völker, die
Kanaaniter, Phöniker und Israeliten oder Juden. Die
eigentlichen Syrer vermochten sich oft fremder Unterdrücker
nicht zu erwehren; insbesondere machte David einen großen
Teil ihres Landes zu einer Provinz des jüdischen Reichs. Bei
der Teilung desselben rissen sie sich wieder los, und in Damaskus
entstand ein selbständiges Reich, welchem nach und nach die
Häuptlinge der übrigen Städte tributpflichtig
wurden. Nach mannigfachen Schicksalen ward S. 730 v. Chr. von
Tiglat Pilesar II. zu einer Provinz des assyrischen Reichs gemacht;
die Griechen, welche das Land zuerst als assyrische Provinz kennen
lernten, gaben ihm davon den Namen Syria. Nach dem Fall des
assyrischen Reichs ward S. eine Provinz von Babylonien (um 600),
dann von Persien (538) und von Makedonien (333), bis es endlich
durch die Seleukiden 301 wieder zu einem selbständigen Reich
erhoben ward. Der Gründer dieser Dynastie, Seleukos Nikator
(301-280), dehnte die Grenzen seines Reichs nach O. bis zum Oxus
und Indus aus und machte S. zum Mittelpunkt desselben. Durch
Erneuerung und Gründung vieler griechischer Städte
(Seleukeia am Tigris, Seleukeia am Orontes, Antiocheia u. a.)
470
Syringa - Syrische Sprache und Litteratur.
suchte er in seinem Reich, welches 72 Satrapien umfaßte,
den Wohlstand zu heben. Aber seinen Nachfolgern fehlte zum
Zusammenhalten dieses Reichs die nötige Kraft und Energie.
Schon 256 rissen die Parther Iran von S. los und beschränkten
150 das Reich auf das eigentliche S., und auch dieses ward 85
großenteils dem armenischen König Tigranes
unterwürfig, bis es 64 von Pompejus zur römischen Provinz
gemacht wurde. Im 4. Jahrh. n. Chr. trennte Konstantin d. Gr.
Kommagene und Kyrrhestika vom übrigen S. und machte daraus
eine eigne Provinz, Namens Euphratensis; das übrige Land aber
ward später von Theodosius dem jüngern in Syria prima und
Syria secunda eingeteilt. Unter Justinian wurden die wichtigsten
Städte Syriens von den Persern genommen, darunter Antiochia.
Dann brachen 635 die Araber verwüstend ins Land ein, eroberten
es und bekehrten die Einwohner zum größten Teil zum
Islam. Erst unter der Herrschaft der arabischen Kalifen hob sich S.
wieder. Doch ward das Land den Kalifen bald von rebellischen
Statthaltern und diesen wieder durch die turkmenische Miliz
entrissen. Auch durch die Kreuzzüge litt das Land sehr.
Saladin, Sultan von Ägypten, entriß S. 1187 den
Kreuzfahrern wieder, und unter seinen Nachfolgern kam es an die
Mamelucken. Schwer litt es dann durch die Einfälle der
Mongolen unter Dschengis-Chan. 1517 eroberte der Osmanensultan
Selim I. S., und fortan bildete es eine türkische Provinz.
Doch empörten sich die dortigen Paschas häufig gegen die
Pforte. 1833 kam S. unter die Herrschaft Mehemed Alis,
Vizekönigs von Ägypten; durch die Intervention der
europäischen Mächte 1840 aber kehrte es unter die
unmittelbare Herrschaft der Pforte zurück. Der
unaufhörliche Wechsel der Herrscher, verheerende Kriege und
die Barbarei der mohammedanischen Gewalthaber haben Land und Volk
völlig ruiniert, so daß es jetzt wenig mehr als eine
schwach bevölkerte, sterile Einöde voll Ruinen ist. In
neuerer Zeit hat S. namentlich durch die Kämpfe der Drusen (s.
d.) und Maroniten (s. d.) die Aufmerksamkeit Europas wieder auf
sich gezogen; infolge der blutigen Verfolgungen, denen besonders im
Juni 1858 die Maroniten ausgesetzt waren, namentlich der
Christenmetzelei in Damaskus vom Juli 1860 bis Juni 1861, besetzten
französische Truppen das Land. Vgl. Vogüé,
Architecture civile et religieuse du I. au VI. siècle dans
la Syrie centrale (Par. I866-77, 2 Bde.); Derselbe, Inscriptions
sémitiques de la Syrie (das. 1869-77); Burton und Drake,
Unexplored Syria (Lond. 1872); Zwiedineck, S. und seine Bedeutung
für den Welthandel (Wien 1873); Sachau, Reise in S. und
Mesopotamien (Leipz. 1883); Lortet, La Syrie d'aujourd'hui (Reise
1875 bis 1880, Par. 1884); Bädeker, Palästina und S. (2.
Aufl., Leipz. 1880); über die neuere Geschichte: de Salverte,
La Syrie avant 1860 (Par. 1861); Edwards, La Syrie 1840-62,
histoire etc. (das. 1862); Abbé Jobin, La Syrie en 1860 et
1861 (Lille 1862); Jochmus, The Syrian war (Berl. 1883, 2
Bde.).
Syringa L. (Flieder, Syringe, Lilak), Gattung aus der
Familie der Oleaceen, Sträucher mit gestielten,
entgegengesetzten, glatten, ganzrandigen, selten fiederig
eingeschnittenen Blättern, wohlriechenden Blüten in
reichen, endständigen Rispen und länglichen, meist
zusammengedrückten, lederigen Kapseln. Sechs Arten in
Osteuropa und dem gemäßigten Asien. S. vulgaris L.
(gemeiner Flieder, türkischer, spanischer Flieder,
fälschlich Holunder, Jelängerjelieber), ein 2-6 m hoher
Strauch mit herzförmig länglichen Blättern, lila und
weißen Blüten und konkaven Blumenkronabschnitten, soll
1566 durch Busbecq von Konstantinopel nach Flandern gekommen sein
und im Orient wild wachsen; wahrscheinlicher aber stammt er aus den
östlichen Karpathen, aus Ungarn und Siebenbürgen;
gegenwärtig wird er in zahlreichen Formen als Zierstrauch
kultiviert. Das ziemlich feste, schön geflammte Holz wird von
Drechslern und Tischlern benutzt. S. persica L. (persischer
Flieder), ein kleinerer Strauch mit kleinern,
elliptisch-lanzettförmigen Blättern, länger
gestielten, fleisch- oder rosenroten, auch weißen Blüten
und ziemlich flachen Blumenkronabschnitten, wächst in
Daghestan, aber ebensowenig wie der vorige in Persien, wird, wie
auch einige andre Arten und Blendlinge (S. chinensis Willd., S.
Rothomagensis Ren., wahrscheinlich aus S. vulgaris und S. persica
entstanden), als Zierstrauch kultiviert. Ebenso S. Josikaea Jacq.
aus Ungarn, mit elliptischen Blättern und
knäuelförmig zusammengedrängten, eine Rispe
bildenden, tief violettblauen Blüten ohne Duft.
Syrinx, nach griech. Sage Tochter des arkadischen
Flußgottes Ladon, ward, von Pan verfolgt, in ein Schilfrohr
verwandelt, dem der Wind süß klagende Töne
entlockte. Pan schnitt von dem Schilf Röhrchen, eins immer
kleiner als das andre, und bildete hieraus eine Pfeife, der er den
Namen S. gab. Syringen hießen auch die unterirdischen
Begräbnishöhlen der ägyptischen Könige bei
Theben.
Syrische Christen, s. v. w. Nestorianer.
Syrische Sprache und Litteratur. Die syrische Sprache ist
die wichtigste Sprache der aramäischen Gruppe der
semitischen Sprachen (s. Semiten) und tritt zuerst in
palmyrenischen Inschriften des 1. Jahrh. n. Chr. auf. Nachdem sie
im 1. Jahrtausend n. Chr. ihre Blütezeit gehabt, ward sie
seitdem durch die stammverwandte arabische Sprache mehr und mehr
verdrängt und ist jetzt, abgesehen von einigen verderbten
Volksmundarten in Kurdistan und Mesopotamien (bearbeitet von
Nöldeke in "Grammatik der neusyrischen Sprache am Urmiasee",
Leipz. 1868; von Prym und Socin: "Der neuaramäische Dialekt
des Tûr-Abdîn", Götting. 1881, 2 Bde.; von Socin:
"Die neuaramäischen Dialekte von Urmia und Mosul",
Tübing. 1882), welche auf sie zurückzuführen sind,
nur noch Schrift- und Gelehrtensprache. Die besten Grammatiken
derselben lieferten P. Ewald (Erlang. 1826), Hoffmann (Halle 1827;
in neuer Bearbeitung von Merk, 1867-70), Uhlemann (2. Aufl., Berl.
1857) und Nöldeke (Leipz. 1880), kürzer Nestle (mit
Litteratur, Chrestomathie und Glossar, 2. Aufl., Berl. 1888);
Wörterbücher Castellus (hrsg. von Michaelis,
Götting. 1788), Bernstein (Berl. 1857 ff., unvollendet); mit
Glossarien versehene Chrestomathien Hahn und Sieffert (Leipz.
1826), Bernstein und Kirsch (Lond. 1867, 2 Bde.), Oberleibner (Wien
1826), Rödiger (2. Aufl., Halle 1868), Wenig (Innsbr. 1866),
Zingerle (Rom 1871-73), Cardahi (das. 1875) und Martin (Par. 1875).
Eine neue vollständige Sammlung des syrischen Wortschatzes mit
Beiträgen der hervorragendsten Kenner des Syrischen gibt R. P.
Smith heraus ("Thesaurus syriacus", bis jetzt 5 Hefte, Oxf.
1868-80). Die Schrift der Syrer, eine jüngere Nebenform der
phönikischen, die etwas Eckiges und Steifes hat (s. die
"Schrifttafel"), hieß in ihrer ältesten Gestalt
Estrangelo; aus ihr ist die kufische Schrist der Araber, die Mutter
des spätern arabischen, persischen und türkischen
Alphabets, entstanden. Aus der jüngern syrischen Schrift sind
(durch Vermittelung der Nestorianer) die Schriftarten der Uiguren,
Mongolen, Kalmücken u. Mandschu
471
Syrjänen - Syrphus
hervorgegangen. Von der ältesten syrischen Litteratur ist
nichts bekannt. Die zahlreichen erhaltenen Schriftdenkmäler
rühren meist aus den ersten Jahrhunderten n. Chr. her und sind
vorwiegend christlich-theologischen Inhalts. Doch fanden damals
auch die Geschichte und Philosophie sowie die Naturwissenschaften
unter den Syrern Pflege, in welchen Fächern diese im 8. und 9.
Jahrh. Lehrer der Araber wurden, wie sie überhaupt als
Vermittler älterer Kulturen einen großen Einfluß
in Vorderasien ausgeübt haben. Der letzte klassische
Schriftsteller der Syrer ist Bar-Hebräus (gest. 1286),
jakobitischer Weihbischof zu Maraga. Das älteste noch
vorhandene Denkmal der christlich-syrischen Litteratur ist eine
Übersetzung des Alten und Neuen Testaments, die sogen.
Peschito (s. d.). Für die Kirchengeschichte sind die meist
schon mehrfach herausgegebenen Werke der syrischen
Kirchenväter von großem Interesse; eine Auswahl
derselben hat Bickell zu übersetzen begonnen (Kempten 1874
ff.). Unter den historischen Werken ist namentlich die Chronik des
Bar-Hebräus zu erwähnen. Die um das Jahr 515 geschriebene
Chronik des Josua Stylites hat der französische Orientalist
Martin herausgegeben in den "Abhandlungen für die Kunde des
Morgenlandes" (Leipz. 1876). Die berühmte indische
Märchensammlung "Pantschatantra" ist schon im 6. Jahrh. auch
ins Syrische übertragen worden, und diese alte Version (hrsg.
mit Übersetzung u. d. T.: " Kalilag und Damnag" von Bickell,
nebst einer Einleitung von Benfey, Leipz. 1876) ist
ursprünglicher als das auf die Gegenwart gekommene indische
Original. Ebenso sind manche gar nicht mehr oder nicht in ihrer
ursprünglichen Gestalt erhaltene Werke des klassischen
Altertums in syrischen Versionen oder arabischen Übertragungen
derselben bewahrt. Den Text eines syrischen historischen Romans:
"Julianos der Abtrünnige", gab Hoffmann heraus (2. Ausg., Kiel
1887). Die Poesie der Syrer ist lediglich kirchlicher und
liturgischer Art und entbehrt alles wahrhaft dichterischen Geistes.
Der älteste Hymnendichter ist der Gnostiker Bardesanes; neben
ihm ist noch Ephräm der Syrer zu nennen. Die reichsten
Sammlungen syrischer Handschriften besitzen Rom, Paris und das
Britische Museum zu London. Vgl. Nestle, Litteratura syriaca
(Bibliographie, Berl. 1888).
Syrjänen, ein Volk nordfinn. Stammes, wohnt in den
russischen Gouvernements Wologda und Archangel und ist nahe
verwandt mit den Permiern und Wotjaken. Im Gouvernement Archangel
wohnen die S. nur im Kreis Mesen an der Petschora und dem obern
Lauf des Flusses Mesen; in Wologda bilden sie fast die ganze Masse
der ländlichen Bevölkerung in den Kreisen Ustsyssolsk und
Jarensk; ihre Zahl wird auf 85,500 angegeben. Einst wohnten sie an
der Kama und Wjatka und nennen sich deshalb noch beute Kama
-Männer (Komi-mort, Komi-jas und Komi-woitur). Als Stephan,
Bischof von Perm, zu Ende des 14. Jahrh. mit ungewöhnlicher
Energie unter den finnischen Völkern der permischen Gruppe das
Christentum verbreitete und ihre Götzen verbrannte, wanderten
die S. in die Flußgebiete der Petschora, Wytschegda und des
Mesen aus. Die S. sind bekannt durch Fleiß und Ehrlichkeit,
gehören der griechischen Kirche an, unterscheiden sich in
Kleidung und Sitte wenig von den Russen, wohnen in gut gebauten
Dörfern, beschäftigen sich mit Landwirtschaft, Viehzucht,
Jagd und Fischerei und sind wohlhabender als ihre russischen
Nachbarn. Vom Januar bis in den April begeben sie sich in
Gesellschaften von 10-20 Mann tief hinein in die Urwälder, oft
über 500 km von den Wohnstätten, mit Hilfe eines kleinen
Kompasses (madka) und machen Jagd auf Bären, Wölfe,
Luchse, Füchse, Marder und hauptsächlich auf
Eichhörnchen, von welch letztern sie in guten Jahren bis
900,000 Stück verkaufen. Roggen, Gerste, Talg und Häute
schicken sie nach Archangel, Wild nach Petersburg und Moskau,
Eichhörnchen-, Marder- und Fuchsfelle auf die Jahrmärkte
von Nishnij Nowgorod und Irbit. Die Sprache der S. gehört zu
der finnisch-ugrischen Gruppe des uralaltaischen Sprachstammes und
ist am nächsten mit der permischen verwandt. Vgl.
Castrén, Elementa grammaticae syrjaenae (Helsingf. 1844);
Wiedemann, Grammatik der syrjanischen Sprache (Petersb. 1884);
Derselbe, Syrjänäsch-deutsches Wörterbuch (das.
1880).
Syrlin, Jörg, Bildschnitzer, war seit ca. 1450 in
Ulm thätig, wo er eine Anzahl von Chorstühlen,
Singepulten und selbständigen Bildwerken in Holz
ausgeführt hat, unter denen das Chorgestühl im
Münster (1469-74) durch Feinheit der Charakteristik in den
Figuren und durch die naturalistische, von edlem
Schönheitssinn verklärte Detailbehandlung eine erste
Stelle in der deutschen Bildnerei des 15. Jahrh. einnimmt. Er hat
auch den Steinernen Brunnen auf dem Marktplatz zu Ulm geschaffen.
Sein gleichnamiger Sohn ist in Ulm und Blaubeuren ebenfalls als
Bildschnitzer thätig gewesen.
Syrmien, ehemals Herzogtum in Slawonien, benannt nach der
römischen Stadt Sirmium (s. d.), umfaßte den
östlichen Teil der von der Drau, Save und Donau umflossenen
sogen. Syrmischen Halbinsel, stand erst unter den ungarischen
Königen, dann unter den Türken, nach deren Vertreibung
1688 Kaiser Leopold I. das italienische Haus Odescalchi damit
belehnte. Später kam S. an das Haus Albani. Das jetzige
kroatisch-slawonische Komitat S. grenzt an die Komitate
Torontál, Bács-Bodrog und Veroviticz sowie an Bosnien
und Serbien, hat ein Areal von 6848,5 qkm (124,4 QM.), ist gebirgig
(Fruska-Gora), fruchtbar (vorzüglicher Weizen und Wein, Mais,
Obst, Kastanien), hat (1881) 296,678 Einw. (meist Serben) u.
lebhafte Pferde-, Vieh-, Bienen- und Seidenraupenzucht.
Komitatssitz ist Vukovar (s. d.).
Syrnium, s. Eulen, S. 906.
Syrokomla, Wladyslaw (eigentlich Ludwig Kondratowicz),
poln.Dichter, geb. 17. Sept. 1823 zu Jaskowice in Litauen, lebte
bis 1853 als Landwirt in Zalucz am Niemen, später in
Borejkowszczyzna bei Wilna und starb in letzterer Stadt 15. Okt.
1862. S. war kein Dichter von hohem Gedankenflug. aber vom Feuer
echter Begeisterung und tiefem, auf, richtigem Gefühl
erfüllt, zugleich von einer ungewöhnlichen Einfachheit im
Ausdruck. Unter seinen zahlreichen im Volkston gehaltenen
poetischen Erzählungen (Gawedy) sind hervorzuheben: "Urodzony
Jan Deborog", "Janko Cmentarnik", "Noc hetmanska" und "Zgon Acerna"
auf den Tod Klonowicz' (f. d.), dessen trübe Lebensschicksale
ein Spiegelbild der seinigen bildeten. Weniger erfolgreich
versuchte er sich) auf dramatischem Gebiet ("Kaspar Karlinski"
u.a.). S. lieferte auch eine Geschichte der polnischen Litteratur
("Dzieje literatury w Polsce", 2. Ausg., Warsch. 1874, 3 Bde.)
sowie eine treffliche metrische Übersetzung der
polnisch-lateinischen Dichter Janicki, Sarbiewski, Szymonowicz,
Klonowicz u. a. (Wilna 1852, 6 Bde.). Eine Gesamtausgabe seiner
Dichtungen erschien in 10 Bänden (Warsch. 1872). Seine
Biographie schrieb I. I. Kraszewski(Warsch. 1863).
Syrphus, Schwebfliege; Syrphidae, Familie aus der Ordnung
der Zweiflügler, s. Schwebfliegen
472
Syrrhaptes - Szajnocha.
Syrrhaptes, Steppenhuhn.
Syrte, Name zweier Busen des Mittelländischen Meers
an der Küste Nordafrikas. Die Große S. (Dschûnel
Kebrit, auch Golf von Sidra), zwischen der Landschaft Tripolis und
dem Plateau von Barka, bildet den am weitesten nach Süden
einbiegenden Teil des Mittelmeers; die Kleine S. (auch Golf von
Gabes) liegt südlich von der Bai von Tunis zwischen den
Landschaften Tunis und Tripolis.
Syrup (Sirob, arab., lat. syrupus), s. Sirup.
Syrus, röm. Dichter, s. Publilius Syrus.
Sysran (Ssysran), Kreisstadt im russ. Gouvernement
Simbirsk, unweit der Wolga, an der Eisenbahn Morschansk-Orenburg,
hat 7 Kirchen, eine Stadtbank, eine Realschule und (1885) 28,624
Einw., welche Acker- und Gartenbau, Industrie in Leder, Eisen und
Talg und Handel mit Getreide und Salz treiben. S. wurde I683
angelegt.
Syssitien (griech.), gemeinschaftliche Männermahle
in den altdorischen Staaten Griechenlands, besonders Sparta, wo sie
auch Pheiditien hießen. Zur Teilnahme an den täglichen
S. waren alle männlichen Bürger Spartas vom 20.
Lebensjahr an verpflichtet und mußten hierzu einen Beitrag in
Naturalien und Geld entrichten. Das Hauptgericht war die
berühmte schwarze Blutsuppe, Schweinefleisch in Blut gekocht
und mit Essig und Salz gewürzt. An jedem Tisch speisten in der
Regel 15 Personen, welche auch im Krieg Zeltgenossen waren.
System (griech., das "Zusammengestellte"), jedes nach
einer gewissen regelrechten Ordnung aus Teilen zusammengesetzte
Ganze. In diesem Sinn redet man von einem Nervensystem, insofern
die Verbindung der Nerven deren Zusammenwirken zu den Zwecken des
tierischen Lebens bedingt; von einem Tonsystem oder der Reihenfolge
der Töne nach bestimmten Intervallen; von einem
Planetensystem, das durch die Abhängigkeit der Bewegung der
einzelnen Planeten von einem Zentralkörper, der Sonne, zu
stande kommt; ferner von Eisenbahn-, Verwaltungs-, Ackerbausystemen
etc. Insbesondere aber versteht man unter S. ein geordnetes Ganze
von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die vollendete Form aller
wissenschaftlichen Darstellung, welche dadurch gewonnen wird,
daß alle Begriffe aus einem oder einigen höchsten
Prinzipien hergeleitet und entwickelt werden, wobei sich das
Verfahren nach der Art, wie ein Ganzes wissenschaftlicher
Erkenntnisse überhaupt zu stande kommt, verschiedenartig
modifiziert. Die unterste Form systematischer Darstellung oder der
Systematik ist die Klassifikation, insofern dieselbe lediglich die
Verhältnisse logischer Über- und Unterordnung zu
berücksichtigen hat, wobei der Zusammenhang des Mannigfaltigen
mehr ein äußerlicher ist. Diese Systematik gestaltet
sich nicht allein nach der verschiedenen Natur und Erkenntnisquelle
der einzelnen Wissenschaften verschieden, sondern es machen sich
auch innerhalb des Gebiets einer einzelnen Wissenschaft im Lauf der
Zeit Veränderungen nötig, je nachdem man bei Ableitung
und Begründung des Details bald von diesem, bald von jenem
Standpunkt ausgeht, wodurch nicht nur die Form, sondern auch der
Inhalt der Wissenschaft verschiedene Modifikationen erleiden
muß. Die Darlegung der allgemeinen Formen des systematischen
Verfahrens ist Aufgabe der Logik, während deren nähere
Anwendung auf besondere Gebiete wissenschaftlicher Erkenntnis der
einzelnen Wissenschaft überlassen bleibt. In der
Naturwissenschaft versteht man unter S. die wissenschaftliche
Aneinanderreihung der Naturkörper nach gewissen gemeinsamen
Merkmalen zu Arten, dieser zu Gattungen, dieser weiter zu Familien,
Ordnungen und Klassen. Je nachdem man hierbei von einem einzelnen
Merkmal oder einigen wenigen ausgeht oder die Gesamtheit derselben
berücksichtigt, unterscheidet man künstliche und
natürliche Systeme. Künstliche Systeme hat man namentlich
in der Botanik gehabt, z. B. solche, welche nach der Beschaffenheit
des Stammes alle Pflanzen in Kräuter und Bäume trennten,
oder nach der Beschaffenheit der Fortpflanzungswerkzeuge (wie
Linné) oder nach der Frucht (wie Gärtner) einteilten.
Sie wurden schon am Ende des vorigen Jahrhunderts durch das alle
Merkmale gleichmäßig berücksichtigende und der in
der allgemeinen Tracht (Habitus) sich aussprechenden
natürlichen Verwandtschaft Rechnung tragende natürliche
System (von Jussieu) ersetzt (weiteres s. Pflanzensystem). In der
Zoologie hat man niemals eigentlich künstliche Systeme gehabt,
da sich hier die natürliche Verwandtschaft deutlicher
ausprägt; doch hat auch das zoologische S. im einzelnen
selbstverständlich die größten Veränderungen
erfahren. Der Zug der modernen Forschung geht dahin, die
natürlichen Systeme der Lebewesen zu genealogischen Systemen
umzugestalten (vgl. Darwinismus, S. 567 f.). Über Geologische
Systeme s. Geologische Formation.
Systematik (griech.), die Kunst der systematischen
Darlegung (s. System), Anleitung dazu. Systematisch, ein System
bildend, planmäßig.
Système de la nature, Titel des berühmten
philosophisch-materialistischen Buches im Geiste der
französischen Encyklopädisten, das pseudonym 1770
erschien, und als dessen Verfasser jetzt der Baron v. Holbach (s.
d.) gilt.
Systole (griech.), in der Prosodie im Gegensatz zur
Diastole (s. d.) die Verkürzung einer von Natur langen Silbe
durch die Aussprache, welche regelmäßig in der Senkung
des Versfußes unmittelbar vor der folgenden Hebung eintritt,
z. B. "Obstupui steteruntque comae" (Vergil); in der Physiologie
die Zusammenziehung der Herzmuskulatur (weiteres s. Blutbewegung,
S. 60).
Sytschewka (Ssytschewka), Kreisstadt im russ.
Gouvernement Smolensk, an der Wasusa und der Bahnlinie
Wjasma-Rshew, mit (1885) 4984 Einw.
Syzygien (griech.), in der Astronomie gemeinsame
Bezeichnung für Konjunktion und Opposition, also für
diejenigen Stellungen eines Planeten zur Sonne, wo beide, von der
Erde aus betrachtet, entweder gleiche oder um 180° verschiedene
Länge haben.
Szabadka (spr. ssá-), s. Maria-Theresiopel.
Szabolcs (spr. ssáboltsch), ungar. Komitat am
linken Theißufer, grenzt an die Komitate Szatmár und
Bereg im O., Ung und Zemplin im N., Borsod und Szolnok im W. und
Bihar im Süden und umfaßt 4917 qkm (89,3 QM.). Der Boden
bildet eine im O. bewaldete, im W. und NW. aber längs des
Laufs der Theiß mit Sodaseen und Morästen
angefüllte, doch überaus fruchtbare Ebene mit fetten
Weiden. Nur der sogen. Nyir, eine sandige Fläche mit
dünenartigen Erhebungen, ist weniger fruchtbar.
Hauptfluß ist die Theiß mit der Szamos. Die Einwohner
(1881: 214,008), meist Ungarn, betreiben die Rindvieh-, Schaf- und
Schweinezucht im großen. Hauptort des Komitats, welches die
Ungarische Staatsbahn durchschneidet, ist die Stadt
Nyiregyháza.
Szajnocha (spr. schai-), Karl, poln. Dichter und
Geschichtschreiber, geb. 1818 zu Komaro bei Sambor in Galizien,
wurde 1835 als Gymnasiast zu Lemberg wegen eines politischen
Gedichts, das man bei ihm
473
Szalay - Szasz
fand, mit schwerer Gefängnishaft bestraft, die seine
Gesundheit zerrüttete und ihm den Weg zu höherer Bildung
verschloß, und schlug nun die schriftstellerische Laufbahn
ein, indem er Gedichte, Erzählungen und Dramen aus der Vorzeit
Polens in Lemberger Zeitungen veröffentlichte. Bald wandte er
sich jedoch von diesen poetischen Versuchen ab, einem ernsten und
vertieften Studium der polnischen Geschichte zu und ließ als
nächste Frucht desselben zwei mit verdientem Beifall
aufgenommene Schriften erscheinen: "Boleslaw Chrobry" (Lemb. 1848)
und "Pierwsze odrodzenie Polski" ("Die Wiedergeburt Polens", das.
1849), worin die Zeiten Wladislaw Lokieteks und Kasimirs d. Gr.
treu und anschaulich geschildert werden. Bedeutenderes noch
leistete er in "Jadwiga i Jagiello" (Lemb. 1855, 3 Bde.; 2. Aufl.
1861, 4 Bde.), seinem Hauptwerk, das sein Talent für
historische Malerei im vollsten Glanz erscheinen läßt.
S. war inzwischen (1853) Kustos der Ossolinskischen Bibliothek in
Lemberg geworden, doch mußte er die Stelle schon nach wenigen
Jahren wegen Erblindung wieder aufgeben. Er starb, bis zuletzt
litterarisch thätig, 10. Jan. 1868 in Lemberg. Von seinen
Schriften sind noch hervorzuheben: "Lechicki poczatek Polski" ("Der
lechische Ursprung Polens", Lemb. 1858); die vortrefflichen "Szkice
historyczne" (das. 1854-69, 4 Bde.) und "Dwa lata dziejów
naszych" ("Zwei Jahre polnischer Geschichte"), eine Schilderung der
Kriege Polens mit den Kosaken (das. 1865-69, 2 Bde.). Eine Sammlung
seiner historischen Werke (mit Biographie von Kantecki) erschien
unter dem Titel: "Dziela Karola Szajnochy" (Lemb. 1876-78, 10
Bde.).
Szalay (spr. ssállai), Ladislaus von, ungar.
Historiker und Staatsmann, geb. 18. April 1813 zu Ofen, widmete
sich von 1824 bis 1826 in Stuhlweißenburg und Pest
philosophischen und juridischen Studien, begann 1833 die
Advokatenpraxis und ward infolge seiner Schrift "Das Strafverfahren
mit besonderer Rücksicht auf die Strafgerichte" (Pest 1840)
zum Schriftführer der vom Reichstag zur Ausarbeitung eines
Strafkodex niedergesetzten Kommission gewählt. 1843 wurde er
von der Stadt Karpfen als Deputierter zum Reichstag entsendet, wo
er sich der liberalen Opposition anschloß. Er beteiligte sich
seit 1844 teils als Redakteur, teils als Mitarbeiter am "Pesti
Hirlap". Seine Abhandlungen, worin er namentlich für
administrative Zentralisation und Reform des Komitatswesens seine
Stimme erhob, erschienen gesammelt als "Publicistai dolgozatok"
(Pest 1847, 2 Bde.). Sein "Státusférfiak könyve"
(Pest 1847-52) enthält Lebens- und Charakterschilderungen
bedeutender reformatorischer Staatsmänner. Von der ungarischen
Regierung 1848 zu ihrem Gesandten bei der deutschen Zentralgewalt
in Frankfurt ernannt, ging er dann in derselben Eigenschaft nach
London, ward aber hier nicht anerkannt, begab sich darauf in die
Schweiz und kehrte später nach Pest zurück, wo er 1861
zum Reichstagsabgeordneten gewählt wurde. Er starb 17. Juli
1864 in Salzburg. Seine Hauptwerke (in ungarischer Sprache) sind:
"Geschichte Ungarns" (Leipz. 1850-60, 6 Bde.; deutsch von
Wögerer, Pest 1866 bis 1875, 3 Bde.); "Nikolaus
Esterházy von Galantha, Palatinus von Ungarn" (das. 1862-66,
2 Bde.); "König Johann und die Diplomatie" (im "Budapesti
Szemle" 1858-60); "Ungarisch-geschichtliche Denkwürdigkeiten"
(Pest 1858-60, 3 Bde.). Vgl. Flegler, Erinnerungen an L. v. S.
(Leipz. 1866).
Szamarodny (spr. ssá-), s. Tokayer.
Szamos (spr. ssámosch), Nebenfluß der
Theiß in Ungarn, entspringt im Biharer und Aranyoser Gebirge
in zwei Quellflüssen, die sich bei Deés vereinigen,
fließt dann nordwestlich, nimmt die Kraszna auf und
mündet in der Nordwestecke des Szatmárer Komitats bei
Ocsva-Apathi.
Szamos-Ujvár (spr. ssámosch-,
Armenierstadt), Stadt im ungar. Komitat Szolnok-Doboka
(Siebenbürgen), an der Klausenburg-Bistritzer Bahn, Sitz eines
griechisch-kath. Bischofs, mit schöner armenischer Kirche,
altem Schloß, bischöflichem Palais, Franziskanerkloster,
griechisch-katholischer theologischer Akademie, (1881) 5317 meist
armen. Einwohnern, lebhaftem Getreide- und Viehhandel,
Lederindustrie, Landesstrafanstalt und Bezirksgericht. In der
Nähe das Schwefelbad Kérö.
Szanthó (spr. ssánto), Markt im ungar.
Komitat Abauj-Torna, am Hegyaljagebirge, mit (1881) 4279 Einw.,
Weinbau und Bezirksgericht.
Szapary (spr. ssápp-), 1) Ladislaus, Graf,
öfterreich. General, geb. 22. Nov. 1831 zu Pest, trat 1848 in
die österreichische Kavallerie, ward 1857 Major, 1860
Flügeladjutant des Kaisers, 1862 Kommandant des 1. (jetzt 13.)
freiwilligen Husarenregiments, mit welchem er 1866 in Italien
wichtige Dienste leistete, 1869 Generalmajor und Brigadekommandeur
in Pest, 1874 Feldmarschallleutnant und Kommandeur der 20.
Division, mit der er 1878 in Bosnien einrückte. Nach der
Verstärkung der Okkupationsarmee ward er zum Kommandeur des 3.
Armeekorps ernannt, nahm an der völligen Okkupation
hervorragenden Anteil und erhielt im Oktober das
Militärkommando in Temesvár, dann in Kaschau. Er starb
28. Sept. 1883 in Preßburg.
2) Julius, ungar. Staatsmann, Vetter des vorigen, geb. 1. Nov.
1832, ward 1861 Deputierter für Szolnok und in rascher
Karriere Ministerialrat im Ministerium des Innern und
Staatssekretär im Kommunikationsministerium (August 1870),
welcher Stellung er aber schon im Mai 1871 entsagte, um dann 5.
März 1873 Minister des Innern zu werden. Er bekämpfte da
die Schäden des alten Regimes mit Nachdruck und übernahm
bei der Rekonstruktion des Ministeriums Tisza im Dezember 1878 das
Finanzportefeuille, das er bis zum Februar 1887 innehatte.
Szárvady (spr. ssar-). Wilhelmine, s.
Clauß.
Szarvas (spr. ssárwasch). Markt im ungar. Komitat
Békés, an der Körös, Station der
Ungarischen Staatsbahn, mit (1881) 22,504 Einw. (Slawen und
Ungarn), evang. Obergymnasium und Bezirksgericht.
Szász (spr. ssaß). Karl, ungar.
Schriftsteller, geb. 15. Juni 1829 zu Nagy-Enyed in
Siebenbürgen, studierte daselbst und gewann schon 1847 mit
einer poetischen Erzählung einen Preis. Nach der Revolution,
in deren letzten Kämpfen er als Honvéd mit focht,
studierte er Theologie, wirkte als Gymnasiallehrer in
Nagy-Körös, wurde dann calvinistischer Seelsorger zuerst
in Kézdi-Vásárhely, dann in
Kun-Szent-Miklós, vertrat den Fülöpszallaser
Bezirk auf dem Reichstag von 1865 und trat 1867 als Sektionsrat im
Kultusministerium in den Staatsdienst. Zwei Jahre später wurde
er zum Schulinspektor und 1876 zum Ministerialrat im Ministerium
ernannt. S., der Mitglied der Akademie und der
Kisfaludy-Gesellschaft ist und von beiden wiederholt mit Preisen
ausgezeichnet wurde, hat auf dem Felde der Lyrik und poetischen
Erzählung ("Almos", "Salamon") sowie des Dramas ("Zrinyi",
"Herodes", "Georg Frater"), besonders aber als poetischer
Übersetzer eine reiche Thätigkeit entwickelt und unter
anderm das Nibelungenlied, Dantes "Göttliche Komödie",
zwei Bände Gedichte von Goethe, mehrere Dramen von
Shakespeare, Ten-
474
Szászkabánya - Szécsény.
nysons Idylle, Lustspiele von Molière u. a. ins
Ungarische übersetzt. Auch sein Buch "A vilápirodalom
eposzai" ("Die großen Epen der Weltliteratur", Budapest 1882,
2 Bde.) enthält zahlreiche ausgezeichnete
Übersetzungsproben. - Auch seine Brüder, Dominik, geb.
1838, reformierter Bischof von Siebenbürgen, und Béla,
geb. 1840, jetzt Professor der Philosophie in Klausenburg, haben
sich, der erstere auf theologisch-politischem Gebiet, der letztere
als Lyriker, einen litterarischen Namen gemacht.
Szászkabánya (spr.
ssáhßkabanja), Markt im ungar. Komitat
Krassó-Szörény, mit (1881) 2812 Einw., Kupfer-
und Schwefelkiesbergbau, Kupferschmelzhütten und
Bezirksgericht.
Szatmár (spr. ssátt-), ungar. Komitat am
linken Theißufer, von den Komitaten Bereg, Ugocsa, Marmaros,
Szolnok-Doboka, Szilágy, Bihar und Szabolcs begrenzt,
umfaßt 6491 qkm (117,9 QM.), ist im Süden und O.
gebirgig, im übrigen Teil eben und stellenweise sumpfig. Die
Theiß fließt an der Nordgrenze und nimmt die Szamos,
Kraszna und den Tur auf. S. hat (1881) 293,092 Einw. (meist Ungarn)
und ist in der Ebene sehr fruchtbar. In den gebirgigen Gegenden
blüht Rindvieh-, Schaf-, Schweine- und Bienenzucht. Das
Mineralreich liefert Gold, Silber, Kupfer und Antimon; auch sind
Glashütten und Sägemühlen in Betrieb. Hauptort ist
Nagy-Károly. - Die Stadt S. (seit der 1715 erfolgten
Vereinigung der Städte S. und Németi auch S.-
Németi), königliche Freistadt im Komitat S. und Station
der Ungarischen Nordostbahn, liegt an beiden Ufern der Szamos, ist
Sitz eines römisch-kath. Bischofs und Domkapitels sowie eines
Gerichtshofs und einer Finanzdirektion, hat eine Kathedrale, 2
Klöster, ein katholisches und ein reform. Gymnasium, eine
Lehrer- und eine Lehrerinnenpräparandie, eine theologische
Diözesanlehranstalt, ein Seminar und (1881) 19,708 ungar.
Einwohner, die Gewerbe, Handel und auf dem benachbarten S.-Hegy
(einer städtischen Ansiedlung mit 2000 reform. Einwohnern)
auch Weinbau betreiben. S. hat eine Dampfmühle, ein
königliches Tabaksmagazin und am Domplatz eine Büste des
ungarischen Dichters Kölcsey.
Szczawnica (spr. sstschá-), Badeort in der galiz.
Bezirkshauptmannschaft Neumarkt, in den Karpathen, nahe der
ungarischen Grenze, mit mehreren Heilquellen
(alkalisch-muriatischen Säuerlingen, Natron- und
Natronlithion-, jod- und bromhaltigen Quellen), besuchter Trink-
und Badeanstalt (ca. 3000 Kurgäste) und (1880) 2140 Einw.
Széchényi (Szécsényi, beides
spr. sséhtschenji), ein ungar. Adelsgeschlecht, das seit dem
Schluß des 16. Jahrh. emporkommt und vom 17. Jahrh. ab
bedeutende Kirchenfürsten und Staatsmänner aufweist:
1) Georg, 1645 Domherr von Gran, 1647 Bischof von
Fünfkirchen, 1649 von Veszprim, 1658-68 von Raab, 1668-85
Erzbischof von Kalocsa, zugleich Administrator des Raaber Bistums,
1685-95 Graner Primas; ein "Wunder der Freigebigkeit" ("prodigium
munificentiae") genannt.
2) Paul, Pauliner Eremit, in welcher Lebensstellung er die
Ordensprofessur der Theologie und Philosophie bekleidete, Prior und
Generaldefinitor des Ordens, 1676 Bischof von Fünfkirchen und
kaiserlicher Rat, Abt von St. Gotthardt und Propst von Raab, 1687
Bischof von Veszprim.
3) Stephan, Graf von, ungar. Staatsmann, geb. 21. Sept. 1792 zu
Wien, Sohn des durch Stiftung des ungarischen Nationalmuseums
bekannten Grafen Franz von S. (gest. 20. Dez. 1820), diente erst
beim Insurrektionsheer gegen die Franzosen, machte dann in der
regulären Armee die wichtigsten Feldzüge des
europäischen Völkerkriegs mit, schied aber 1825 aus dem
Militärdienst, um sich der Förderung des geistigen und
industriellen Interessen seines Vaterlandes zu widmen. Verdienste
erwarb er sich namentlich durch seine Mitwirkung zur Errichtung
einer ungarischen Akademie, der er 60,000 Gulden
Konventionsmünze überwies, durch seine Verwendungen 1832
zur Errichtung eines ungarischen Nationaltheaters und
Konservatoriums der Musik und zur Erbauung einer festen
Donaubrücke zwischen Pest und Ofen sowie 1834 als Kommissar
für die oberste Leitung der Regulierungsarbeiten am Eisernen
Thor und der Regulierung des Theißbettes. Nach dem Ausbruch
der Revolution von 1848 ward er zum Minister der öffentlichen
Arbeiten ernannt, sah sich aber als Aristokrat von der
demokratischen Partei bald in den Hintergrund gedrängt. Der
Schmerz über den Bruch mit Österreich im Oktober 1848
hatte für ihn eine Geisteskrankheit zur Folge, und er ward in
die Irrenanstalt nach Döbling gebracht, wo er auch nach seiner
scheinbaren Genesung blieb. Er erschoß sich 8. April 1860. Im
J. 1880 wurde ihm in Pest ein Denkmal errichtet. Von seinen
Schriften sind noch hervorzuheben: "Hitel" ("Über den Kredit",
deutsch, Pest 1830), "Világ" ("Licht, oder aufhellende
Bruchstücke und Berichtigung einiger Irrtümer und
Vorurteile"; deutsch, das. 1832) und "Stadium", 1. Teil (Leipz.
1833), das drittbedeutendste, den Reformplan enthaltend, die ihm
den Beinamen "Vater der Reform" erwarben; ferner "A kelet
népe" ("Das Volk des Ostens", Pest 1841); "Politai
programmtöredékek" ("Politische Programmfragmente",
das. 1846) und "Hunnia" (18^8), "Blick auf den Rückblick"
(nämlich auf die Druckschrift "Rückblick" von dem
Minister Bach; anonym, Lond. 1860). Vgl. Lónyay, Graf
Stephan S. und seine hinterlassenen Schriften (deutsch von Dux,
Pest 1875) ; A. Zichy, Die Tagebücher des Grafen Stephan S.
(Budapest 1884). - Sein Neffe Graf Emmerich, geb. 15. Febr. 1825,
ist seit Januar 1879 österreichischer Botschafter in Berlin,
ein andrer Neffe, Graf Paul, geb. 1838, war bis 1888 ungarischer
Handelsminister.
4) Béla, Graf, Asienreisender, geb. 3. Febr. 1837 zu
Budapest, studierte in Berlin und Bonn Staatswissenschaft, bereiste
1863 Nordamerika und schrieb daraus "Amerikai utam" ("Meine
amerikanische Reise", Pest 1865), ging 1865 nach Algerien und trat
im Dezember 1877 von Triest aus, begleitet vom Obersten Kreitner
und dem Geologen L. v. Loczy, eine Reise nach Asien an. Indien,
Japan, Java, Borneo und einen großen Teil von China
durchreisend, gelangte er zwar nicht nach Lhassa, der Hauptstadt
Tibets; aber es war ihm doch möglich, unter vielen Gefahren
wertvolle Daten von solchen Gegenden des Weltteils zu sammeln,
über welche bisher kein Europäer nach direkter Anschauung
geschrieben hatte. Auf der Rückreise kam S. durch Jünnan
und so von China nach Hinterindien. S. war zweimal Abgeordneter
für das Ödenburger Komitat und lebt gegenwärtig in
Budapest. Die Schilderung jener Expedition gibt das Werk seines
Reisebegleiters Kreitner: "Im fernen Osten. Reisen des Grafen S.
1877-80" (Wien 1881). In Verbindung mit Kreitner, Lóczy u.
a. gab er 1883 ein wissenschaftliches Werk über seine Relsen
mit Atlas auf eigne Kosten heraus.
Szécsény (spr. sséhtschenj), Markt
im ungar. Komitat Neográd, mit Franziskanerkloster, einst
berühmtem festen Schloß, (1881) 3097 Einw. und
Bezirksgericht.
475
Szegedin - Szemere.
Szegedin (spr. sségg-), königliche Freistadt
im ungar. Komitat Csongrád, am Zusammenfluß der Maros
und Theiß, Kreuzungspunkt der Österreichisch-Ungarischen
Staats- und der Alföld-Fiumaner Bahn und Dampfschiffstation,
wurde durch die 11. und 12. März 1879 eingetretene furchtbare
Überschwemmung, wobei die Theißfluten den Damm der
Alföldbahn durchbrachen, beinahe ganz vernichtet. Über
5300 Häuser sind teils eingestürzt, teils unbewohnbar
geworden, und erst Mitte August 1879 wurde die Stadt wasserfrei.
Zur Sicherung derselben gegen die fast jährlich wiederkehrende
Hochflut hat man zwei Dammgürtel und einen 9 1/2 m hohen
Ringdamm errichtet und die ganze Stadt, für welche damals 2,9
Mill. Gulden an Liebesgaben eingingen, unter der Leitung des
Regierungskommissars, des jetzigen Grafen Ludwig Tisza,
rekonstruiert. Das heutige S., der Hauptort des Alföld, ist
eine ganz moderne Stadt mit zwei großen, durch mehrere
Radialstraßen verbundenen Ringen, breiten, geraden
Nebengassen, großen Plätzen (darunter der
Széchényiplatz in der Mitte der Stadt) und
zahlreichen Pracht- und Monumentalbauten. Die hervorragendsten
neuen Gebäude sind: das große Rathaus mit imposantem
Turm am Széchényiplatz, das Hotel Tisza
(Redoutengebäude), das Justiz-, Post- und Telegraphen- und das
Finanzpalais, das Theater mit Kiosk und Stephaniepromenade am
Theißufer (an Stelle der frühern Citadelle), das
Gefangenhaus, der Honvéd-Offizierspavillon, die
Honvédkaserne, die Infanteriekaserne mit Offizierspavillon,
die große Mädchenschule, die evangelische u. die reform.
Kirche etc. Über die Theiß führt außer zwei
Eisenbahnbrücken eine monumentale eiserne Bogenbrücke
(nach dem Plan Gustav Eiffels, 405 m lang, samt
Brückenköpfen und Auffahrtrampe 591 m). S. hat (1881)
73,675 ungar. Einwohner, viele Fabriken (für Spiritus, Seife,
Soda, Salami, Zündhölzchen, Tabak, Tuch, Ziegel etc.),
eine Schiffswerfte, lebhaften Handel mit Getreide, Holz, Wolle
etc., bedeutende Viehzucht, Acker-, Tabaks-, Wein-, Gemüse-,
Paprikabau, hervorragende Märkte, einen großen
Schiffsverkehr, eine Staatsoberrealschule, ein kath. Obergymnasium,
eine Lehrerpräparandie und 4 Klöster. S. ist Sitz des
Komitats, eines Honvéd-Distriktskommandos, einer Finanz- u.
Staatsgüterdirektion, eines Gerichtshofs und hat ein
Tabakseinlösungs- und Tabaksmagazin und eine Filiale der
Österreichisch-Ungarischen Bank. - S., schon zu Matthias
Corvinus' Zeiten eine berühmte ungarische Stadt, fiel nach der
Schlacht bei Mohács in Solimans II. Gewalt, welcher sie
stärker befestigen ließ. 1686 wurden die Türken
geschlagen und mußten S. räumen. Hier 3. Aug. 1849
Haynaus Sieg über die aufständischen Ungarn.
Szeghalom (spr. ssé-), Markt im ungar. Komitat
Békés, an der Mündung des Berettyókanals
in die Schnelle Körös, mit (1881) 7537 ungar. Einwohnern,
Ackerbau, bedeutender Rindvieh-, Schaf- u. Schweinezucht und
Bezirksgericht.
Szegszárd (spr. sségssard), Markt und Sitz
des ungar. Komitats Tolna, am Sárviz, mit Nonnenkloster,
Landes-Seidenbauinspektorat, Gerichtshof und (1881) 11,948 Einw.,
die sich mit Wein-, Obst- und Seidenkultur beschäftigen; der
Szegszárder Rotwein gehört zu den besten Weinen
Ungarns.
Szék (spr. ßehk), Stadt im ungar. Komitat
Szolnok-Doboka (Siebenbürgen), mit 4 Kirchen, großem
Stadthaus, (1881) 2759 ungarischen und rumän. Einwohnern,
Salzquellen und Bezirksgericht. S. war ehemals der Hauptort des
Komitats Doboka.
Székely (spr. sséhk-), Bartholomäus,
ungar. Maler, geb. 1835 zu Klausenburg, studierte in München
bei Piloty und in Brüssel bei Gallait und machte sich seit
1860 durch Bilder aus der ungarischen Geschichte, von denen die
Auffindung der Leiche Lndwigs II. zu Mohács, Doboczy
tötet seine Gattin (beide im Nationalmuseum zu Pest), die
Schlacht bei Mohács, die Frauen von Erlau verteidigen ihre
Stadt gegen die Türken und die Flucht Emmerich
Tökölys aus der Festung Lika hervorzuheben sind, bekannt.
Er hat auch zahlreiche Illustrationen gezeichnet (zu
Eötvös, Petöfi u. a.). S. ist Professor an der
königlichen Landesmusterzeichenschule zu Pest und hat eine
Schrift über die Grundprinzipien seines Faches (Budap. 1877)
veröffentlicht.
Székely-Keresztur (spr. ssék-, auch
Szitas-Keresztur), Markt im ungar. Komitat Udvarhely
(Siebenbürgen), an der Ungarischen Staatsbahnlinie
Schäßburg-Székely-Udvarhely, mit (1881) 2968
ungarischen und rumän. Einwohnern,
Staatslehrerpräparandie, unitar. Gymnasium und Fabrikation von
Sieben.
Székely-Udvarhely (spr.
sséhkelj-úddwarhelj), Stadt, Sitz des ungar. Komitats
Udvarhely (Siebenbürgen), am Großen
Küküllö und an der Ungarischen Staatsbahnlinie
Schäßburg-S., mit 2 Kirchen, Burgruine,
Franziskanerkloster und (1881) 5003 ungarischen und rumän.
Einwohnern, die zumeist Tabaksbau, Bienenzucht und verschiedene
Gewerbe betreiben. S. hat ein kath. Gymnasium, ein reform.
Kollegium, eine Staatsoberrealschule und einen Gerichtshof. In der
Nähe das Bad Szejke, mit alkalisch-muriatischer
Schwefelquelle.
Székler (spr. ssék-, ungar.
Székely), ungar. Volksstamm, welcher die östlichen und
nordöstlichen Gegenden Siebenbürgens bewohnt und den
Urtypus des Magyarentums am treuesten bewahrt hat. Ihre alte
Freiheit behauptend, galten die S. bis 1848 als adlig, hatten
freies Jagd- und Weiderecht, leisteten keine Frondienste und
unterstanden nur ihren eignen Richtern. Obgleich treffliche
Grenzwächter, sträubten sie sich doch lange gegen den
regulären Militärdienst und wurden erst nach
Unterdrückung eines Aufstandes dazu vermocht, ein
Husarenregiment und zwei Infanterieregimenter zu stellen. Sie waren
1848 und 1849 die tapfersten Verfechter des Magyarentums in
Siebenbürgen, und an ihrer Spitze vornehmlich erfocht Bem
seine Siege. Sodann verloren sie mit ihrer Verfassung auch ihre
Vorrechte und wurden den übrigen Landesbewohnern
gleichgestellt. Das Land der S. war bis 1876 in fünf sogen.
Stühle eingeteilt; jetzt bildet es zumeist die Komitate
Udvarhely, Csik und Háromszék. Vgl. Hunfalvy,
Ethnographie Ungarns (Leipz. 1877); v. Herbich, Das
Széklerland, geologisch beschrieben (Pest 1878). Die
Volkspoesien der S. wurden von Kriza ("Székely
vadrózsák". "Wilde Rosen der S.", 1863)
gesammelt.
Széll (spr. ssell), Koloman, ungar.
Finanzminister, geb. 8. Jan. 1842 zu Rátót im
Eisenburger Komitat, studierte in Pest und Wien, ward 1867 zum
Deputierten in den Reichstag gewählt und war aus allen
bisherigen Reichstagen eins der thätigsten Mitglieder sowie
1868-75 Schriftführer des ungarischen Abgeordnetenhauses. 1875
wurde S. Finanzminister und führte große Ersparnisse
ein. Wegen der großen Kosten der bosnischen Okkupation nahm
er Ende 1878 seine Entladung und wurde Präsident der
Ungarischen Kreditbank in Pest.
Szemere (spr. ssé-), Bartholomäus, ungar.
Staatsmann und Schriftsteller, geb. 27. Aug. 1812 zu Vatta im
Borsoder Komitat, studierte in Preßburg, praktizierte darauf
im Borsoder Komitat als Advokat, ward
476
Szene - Szilagy.
1842 zum Oberstuhlrichter, 1846 zum Vizegespan in Borsod und von
demselben Komitat als Deputierter in den Reichstag gewählt. Er
erwies sich hier als eins der thätigsten Mitglieder der Partei
des Fortschritts und bearbeitete als Reichstagsschriftführer
eine Reihe der wichtigsten Gesetzentwürfe. Im März 1848
im Ministerium Batthyányi mit dem Portefeuille des Innern
betraut, entschied er sich mit Kossuth für entschlossene
Revolution, übernahm nach dem Rücktritt des Ministeriums
mit jenem die provisorische Leitung der Landesangelegenheiten und
trat auch in den Landesverteidigungsausschuß ein. Im Dezember
1848 als Reichskommissar nach Oberungarn delegiert, bildete er hier
ein Guerillakorps zur Abwehr des eingefallenen Schlikschen Korps.
Nach der Unabhängigkeitserklärung (14. April 1849)
übernahm er das Präsidium des neuen Kabinetts und floh,
nachdem Görgei die Waffen gestreckt, nach Konstantinopel,
machte dann eine Reise nach Griechenland und ließ sich
hierauf in Paris nieder. Hier veröffentlichte er die
vornehmlich gegen Kossuth gerichteten Charakteristiken: "Ludwig
Batthyanyi, A. Görgei und L. Kossuth" (Hamb. 1851). 1865
kehrte er, gebrochen an Leib und Seele, in die Heimat zurück
und starb 18. Jan. 1869 in einer Privatirrenanstalt zu Ofen. Seine
gesammelten Schriften sind 1869 in Pest erschienen.
Szene (griech.), der Platz im Schauspielhaus, wo das
Stück gespielt wird, die Bühne; dann auch der Ort und das
Land, wo die Handlung vorgeht; auch s. v. w. Auftritt (f. d.). Ein
Stück in S. setzen, s. v. w. es zur theatralischen
Aufführung vorbereiten, fertig machen. Szenerie, das auf der
S. oder Bühne vermittelst der Dekorationen etc. dargestellte
Bild; allgemeiner s. v. w. Landschaftsbild, Gegend.
Szenische Spiele (Ludi scenici), bei den Römern
Spiele, welche auf einer Schaubühne (scena), der Sage nach
seit der Pest von 361 v. Chr., aufgeführt wurden und anfangs
nur in Tanz mit Flötenbegleitung, ohne Beimischung von Gesang
und Mimik, die erst später hinzukam, bestanden; vgl.
Komödie.
Szent (ungar., spr. ssent), s. v. w. Sankt.
Szeut-Endre (spr. ssent-. Sankt-Andrä), Stadt im
ungar. Komitat Pest, am rechten Donauufer, 15 km nördlich von
Ofen, Sitz des Ofener griechisch-orientalischen Bischofs, mit
vielen Kirchen, (1881) 4229 deutschen, serbischen und ungar.
Einwohnern, Weinbau und Bezirksgericht. S. heißt auch eine
schmale Donauinsel, welche sich von Waitzen bis gegen Budapest
erstreckt und mehrere Dörfer enthält.
Szentes (spr. ssénntesch), Stadt im ungar. Komitat
Csongrád, liegt an der Kurcza unfern der Theiß und hat
mehrere Kirchen, (1881) 28,712 Einw., starken Weinbau und ein
Bezirksgericht.
Szent-Miklós (spr. ssent-miklösch), Name
mehrerer Orte in Ungarn: 1) Gyergyó-S. (s. d.), Markt im
Komitat Csik. - 2) Kún-S. (s. d.), Markt im Komitat Pest. -
3) Liptó-S. (s. d.), Markt im Komitat Liptau. - 4) Nagy-S.
(s. d.), Markt im Komitat Torontál. - 5) Török-S.,
Markt im Komitat Iasz-Nagy-Kun-Szolnok, an der Ungarischen
Staatsbahn, mit (1881) 16,046 ungar. Einwohnern.
Szent-Peter (Sajó-S., spr.
schájö-ssent-), Markt im ungar. Komitat Borsod, am
Sajó und der Ungarischen Staatsbahnlinie
Fülek-Miskolcz, mit schöner reform. Kirche, (1881) 3230
ungar. Einwohnern, vorzüglichem Weinbau und
Bezirksgericht.
Szent-Tamas (spr. ssent-támäsch), Markt im
ungar. Komitat Bács-Bodrog, am Franzenskanal, mit (1881)
10,609 meist serb. Einwohnern, Getreidebau und Viehzucht.
Szepes-Bela (spr. ssépesch-), eine 1881
entdeckteTropfsteinhöhle von riesigem Umfang im ungar. Komitat
Zips (in der Hohen Tátra, am Berg Kobuly Vrch), zu der man
durch das 8 km lange prachtvolle Tatraseenthal gelangt. Sie ist
Eigentum der Stadt Bela (s. d.), besteht aus mehreren
übereinander liegenden Grotten und zeichnet sich durch die
großartigsten Tropfsteingebilde aus. In der Nähe der
Szepes-Bélaer Tátra-Höhlenhain, klimatischer
Kurort, 763 m ü. M., 10 km von der Bahnstation
Poprád-Felka.
Szepes-Olaszi-Váralja (spr. ssépesch-),
Name der Kaschau-Oderberger Bahnstation für die Städte
Wallendorf und Kirchdrauf (s. d.) im ungar. Komitat Zips. In der
Nähe von Kirchdrauf das Bad Baldócz, mit zwei erdigen,
kalkhaltigen Säuerlingen.
Szerdahely (spr. ssér-, auch Duna-S.), Markt im
ungar. Komitat Preßburg, Hauptort der Schüttinsel, mit
(1881) 4182 ungar. Einwohnern, lebhaftem Vieh- handel und
Bezirksgericht.
Szerencs (spr. ssérentsch), Markt im ungar.
Komitat Zemplin, an der Ungarischen Staatsbahnlinie
Debreczin-Miskolcz, mit altem Schloß und (1881) 2370 ungar.
Einwohnern. In der Umgegend gedeiht vortrefflicher Wein.
Szetschuan, chines. Provinz, s. Setschuan.
Sziget (spr. ssi-), 1) (Szigetvár) Markt und
ehemals bedeutende Festung Im ungar. Komitat Somogy, am
Almás, Station der Fünfkirchen-Barcser Bahn, mit noch
sichtbaren Mauern und Gräben, mehreren Kirchen,
Franziskanerkloster und (1881) 5014 Einw. S. ist denkwürdig
durch den Heldentod Nikolaus Zrinys (s. d.) 15. Sept. 1566 bei der
Vertei- digung der Festung gegen die Türken unter Soliman. -
2) Stadt, s. Marmaros-Sziget.
Szigligeti (spr. ssi-), Eduard (eigentlich Joseph
Szathmary), ungar. Dramatiker, geb. 1814 zu Großwardein,
bildete sich in Pest zum Ingenieur aus, betrat aber 1834 in Ofen
die Bühne und ward dann Sekretär und Regisseur des
Nationaltheaters zu Pest. Von 1834 bis 1872 hat S. gegen hundert
Stücke geschrieben und diese Zahl seitdem noch
beträchtlich über-stiegen. Von seinen Lustspielen und
Tragödien, denen eine gewisse Bühnenwirksamkeit nicht
abzusprechen, wiewohl ihnen jeder tiefere poetische Wert abgeht,
wurden viele von der Akademie mit dem Preis gekrönt.
Besonderes Verdienst erwarb sich S. durch das ungarische
Volksstück (ein von ihm geschaffenes Genre), in welchem er
magyarisches Volksleben schildert und die magyarischen Volkslieder
auf die Bühne bringt. Mehrere seiner hierher gehörigen
Dramen, wie: "Der Deserteur", "Zwei Pistolen", "Der Jude", "Der
Csikós" etc., fanden auch auf deutschen Bühnen Beifall.
Seine Stücke bilden fast ausschließlich das Repertoire
der Provinzialtheater und wandernden Schauspielertruppen Ungarns.
S., der außerdem viele Beiträge zur Geschichte des
magyarischen Schauspielwesens geliefert und eine Dramaturgie ("A
dráma és vál-fajai", Budap. 1874) geschrieben
hat, war Mitglied der ungarischen Akademie und der
Kissaludy-Gesellschaft sowie seit 1873 dramatischer Direktor des
Nationaltheaters. Er starb 20. Jan. 1878.
Szikszo (spr. ssíkssö), Markt im ungar.
Komitat Abauj-Torna, an der Miskolcz-Kaschauer Bahnlinie, mit
reform. Kirche in gotischem Stil, (1881) 3586 Einw., Getreide-,
Wein- u. Obstbau u. Bezirksgericht.
Szilagy (spr. ssílädj), ungar. Komitat am
linken Theißufer, 1876 aus den Komitaten Kraszna,
Mittelszolnok und einem Teil von Doboka gebildet, grenzt im N. an
das Komitat Szatmár, im O. an Szolnok-Doboka, im Süden
an Klausenburg, im W
477
Szilagy-Somlyo - Szymanowski.
an Bihar, umfaßt ein Gebiet von 3671 qkm (66,6 QM.), das
sehr wald- und wildreich ist, und wird vom Kraszna- oder
Bükkgebirge erfüllt und von den Flüssen Kraszna,
Szamos, Berettyo, Szilagy etc. bewässert. S. hat (1881)
171,079 Einw. (Rumänen und Ungarn, meist Griechisch-Unierte),
welche Acker- und Weinbau, Rindvieh- und Schweinezucht treiben.
Sitz des Komitats ist die Stadt Zilah.
Szilágy-Somlyó (spr.
ssiladj-schómljó), Stadt im ungar. Komitat
Szilágy, an der Kraszna, mit Schloß, alter Felsenburg,
1434 von Stephan Bathori erbauter Kirche und Minoritenkloster, hat
(1881) 4189 ungarische und rumän. Einwohner, Weinbau, eine
Mineralquelle, ein Untergymnasium und Bezirksgericht.
Szilicze (spr. ssilize, auch Lednice genannt),
Eishöhle im ungar. Komitat Gömör, in der Nähe
von Rosenau, mit großartigen Eisbildungen.
Szinyák (spr. ssinjak), Badeort im ungar. Komitat
Bereg, nordöstlich von Munkács, mit einer bei Gicht,
Rheuma, Nervosität und Hautleiden heilkräftigen kalten
alkalischen Schwefelquelle.
Szinver-Váralja (spr. ssinjer-wáhralja),
Markt im ungar. Komitat Szatmar, mit (1881) 3691 rumänischen
und ungar. Einwohnern, Weinbau und Töpfereien.
Szkleno (spr. sskléno), berühmtes altes Bad
im ungar. Komitat Bars, liegt im wildromantischen Teplathal, unweit
von Schemnitz, mit acht gegen Rheumatismus, Gicht, Nerven- und
Hautübel wirksamen gipshaltigen Thermen von 45-53,5° C.
Temperatur. Vgl. Bachschitz, Kurort S. (Budap. 1877).
Szlachcic (poln.), s. Schlachtschitz.
Szlatina (spr. sslá-, Akna-S.), Ort im ungar.
Komitat Marmaros, 4,6 km von Marmaros-Sziget, mit dem es durch eine
Schmalspurbahn verbunden ist, hat ein großes Salzbergwerk,
das jährlich ca. 350,000 metr. Ztr. produziert.
Szlávy (spr. sslawi), Joseph, ungar. Staatsmann,
geb. 23. Nov. 1818 zu Raab, trat, nachdem er seine Studien an der
Schemnitzer Bergakademie absolviert hatte, in den Staatsdienst,
zuletzt bei der ungarischen Hofkammer in Ofen, und ward 1848 von
Kossuth mit der Leitung der Montanangelegenheiten in Oravicza
beauftragt. Hier wurde S. nach der Revolution verhaftet; vom
Temesvarer Kriegsgericht zu fünf Jahren Festungshaft in Eisen
verurteilt, verbrachte er zwei Jahre in Olmütz. Dann in
Freiheit gesetzt, lebte er zurückgezogen abwechselnd in
Preßburg und auf seinem Landgut zu Almosd im Biharer Komitat.
1861 wurde er zum Statthaltereirat, 1865 zum Obergespan des Biharer
Komitats, 1867 zum Staatssekretär im Ministerium des Innern,
1870 nach Abdankung des Grasen Miko zum Handelsminister und 1872
zum Ministerpräsidenten ernannt; doch blieb er in dieser
Stellung nur wenige Monate. 1879 wurde er Präsident des
Abgeordnetenhauses, 1880 Reichsfinanzminister und 1882 ungarischer
Kronhüter und Vizepräsident des Oberhauses.
Szliács (spr. ssliatsch, Ribarer Bad),
berühmter und besuchter Badeort im ungar. Komitat Sohl,
südlich von Neusohl, Station des Altsohl-Neusohler
Flügels der Ungarischen Staatsbahn, mit bei Frauenkrankheiten
und Nervenleiden heilsamen, kohlensäurereichen Eisenthermen
(25-32° C.). Vgl. Hasenfeld, Der Kurort S. (3. Aufl., Wien
1878).
Szobráncz (spr. sso-), Bad bei Ungvár im
ungar. Komitat Ung, liegt, gegen N. vollständig
geschützt, an der Südseite des Vihorlátgebirges
und hat vier kalte salz- und schwefelhaltige Quellen und
Schlammbäder.
Szofer, s. Sopher.
Szolnok (spr. ssól-), Stadt, Sitz des ungar.
Komitats Jász-Nagy-Kun-S., Knotenpunkt der
Österreichisch-Ungarischen u. Ungarischen Staatsbahn, an der
Mündung der Zagyva in die Theiß, über die zwei
Brücken führen, mit (1881) 18,247 ungar. Einwohnern, die
Ackerbau, Gewerbe, Fischerei und Handel mit Obst, Bauholz etc.
treiben. S. hat eine königliche Tabaks- u. eine
Maschinenfabrik, ein Franziskanerkloster, ein Obergymnasium, ein
Tabakseinlösungsamt und ein Bezirksgericht.
Szolnok-Doboka (spr. ssól-), ungar. Komitat in
Siebenbürgen, grenzt an die Komitate Szilágy,
Szatmár, Marmaros, Bistritz-Naszód und Klausenburg,
umfaßt 5150 qkm (93,5 QM.), ist besonders im nördlichen
Teil gebirgig und waldreich, wird von der Großen und Kleinen
Szamos durchströmt und hat (1881) 193,677 meist rumän.
Einwohner (Griechisch-Katholische), die Ackerbau, Viehzucht und
Bergbau betreiben. Das Land ist namentlich in den Thälern
fruchtbar (im Süden gedeiht auch Wein) sowie reich an Vieh und
Wild, Salz und Eisen. Hauptort ist Dees.
Szörény (spr. ssörenj), ehemaliges
Komitat in Ungarn, welches 1876 aus dem östlichen Teil der
1873 aufgelösten Banater Militärgrenze errichtet und 1880
mit dem Komitat Krassó vereinigt wurde (s.
Krassó-Szörény). Amtssitz war Karansebes.
Szováta (spr. ssówata), Badeort im ungar.
Komitat Maros-Torda (Siebenbürgen), mit (1881) 1471
ungarischen und rumän. Einwohnern, mehreren Salzseen,
Solbädern und dem höchst merkwürdigen Salzberg, bei
dem das Steinsalz in ganzen Felsen frei zu Tag tritt (s.
Parajd).
Szujski (spr. sch-), Joseph, poln. Historiker und
dramatischer Dichter, geb. 1835 zu Tarnow in Galizien, beendete
seine Studien 1858 zu Krakau, zog sich dann auf sein
väterliches Gut Kurdwanow bei Krakau zurück, war 1868-69
Reichsratsabgeordneter und wurde 1869 ordentlicher Profefsor der
polnischen Geschichte an der Krakauer Universität. 1881 zum
Mitglied des österreichischen Herrenhauses ernannt, starb er
schon 7. Febr. 1883. S. gehörte zur konservativ-monarchischen
Partei. Er veröffentlichte zahlreiche historische, durch
lebensvolle Charakteristik ausgezeichnete Schauspiele ("Samuel
Zborowski", "Halszka z Ostroga". "Hieronim Radziejowski",
"Jadwiga", "Jerzy Lubomirski", "Sawanarola", "Michal Korybut", "Jan
III.", "Kopernikus", "Dlugosz i Kallimach" u. a.), ferner eine
vorzügliche "Geschichte Polens" ("Dzieje Polski", Lemb.
1862-65, 4 Bde.), "Rys driejót literatury zwiawa
niechszescianskiego" (Krak. 1867) und metrische Übersetzungen
von Äschylos, Aristophanes etc. In deutscher Sprache schrieb
er: "Die Polen und Ruthenen in Galizien" (Teschen 1882). Seine
gesammelten Werke erscheinen seit 1885 in Krakau.
Szymanowska (spr. schü-), Sophie, s.
Lenartowicz.
Szymanowski (spr. schü-), Waclaw, poln.
Schriftsteller, geb. 1821 zu Warschau, nach absolvierten Studien
Finanzbeamter, seit 1867 Redakteur des verbreitetsten polnischen
Lokalblattes: "Kurjer warszawski"; starb 21. Dez. 1886. Er schrieb
die Dramen: "Salomon i Sedziwoj", "Dzieje serca"
("Herzensgeschichte"), "Matka" ("Die Mutter"), "Ostatnie chwile
Kopernika" ("Die letzten Augenblicke des Kopernikus"), "Ostatnia
próba" ("Die letzte Probe", 1880) etc.; ferner die
Dichtungen : "Timur Leng" (1872), "Gawedy ("Erzählungen") und
"Satyry" ("Satiren", 1874) etc.
478
T - Tabak.
T.
T (te) t, lat. T, t, der harte oder tonlose dentale
Verschlußlaut. Die Lautphysiologie zeigt, daß er auf
vier verschiedene Arten gebildet werden kann. Von diesen ist das
sogen. alveolare t besonders in Norddeutschland üblich; der
Verschluß wird hier dadurch hervorgebracht, daß man den
vordern Teil der Zunge an das hintere Zahnfleisch (Alveolen) der
Oberzähne anlegt. Dagegen wird das in Süddeutschland
(besonders im z) vorherrschende dorsale t dadurch hervorgebracht,
daß man den vordern Teil des Zungenrückens (Dorsum) dem
Gaumen nähert, während die Zungenspitze herabhängt.
Außerdem pflegt in der norddeutschen Aussprache ein leiser
Hauch dem t zu folgen. Das Sanskritalphabet hat ein besonderes
Zeichen für das cerebrale t, das dadurch entsteht, daß
man den vordern Zungensaum stark in die Höhe biegt und dem
Gaumen nähert; ganz ebenso wird das gewöhnliche t des
Englischen ausgesprochen. Das hochdeutsche t geht, geschichtlich
betrachtet, vermöge der Lautverschiebung (s. d.) auf ein
älteres d zurück, das in den übrigen germanischen
Sprachen noch geblieben ist; man vergleiche z. B. unser toll mit
englisch dull. plattdeutsch doll. Das altgermanische d geht aber
seinerseits auf ein aspiriertes d zurück, das sich z. B. im
Sanskrit als dh, im Griechischen als th zeigt; so finden wir
für das griechische ther im Gotischen dius, im Englischen
deer, während im Hochdeutschen aus dem d wieder ein t geworden
ist: Tier; gotisch ga-daursan, "wagen", englisch to dare,
heißt im Sanskrit dharsh, im Griechischen tharsein. Das th
ist im Englischen ein gelispelter Laut, der zur Klasse der
Reibelaute gehört, ebenso wie das th der Neugriechen, das c in
gewissen spanischen Wörtern. Früher, in der
althochdeutschen Periode, existierte dieser oder ein ähnlicher
Laut auch in der deutschen Sprache; da derselbe aber längst
verschollen ist und das th jetzt überall wie t ausgesprochen
wird, so ist es wenigstens in deutschen Wörtern ganz
überflüssig geworden und wirkt nur störend. Es sind
daher Schreibungen wie Heimath, Monath mit Recht in Abnahme
gekommen; doch ist, obwohl namentlich J. Grimm und andre deutsche
Altertumsforscher einen Vernichtungskrieg gegen das th
eröffneten, dasselbe so festgewurzelt, daß selbst die
reformatorische neue Orthographie es nicht ganz beseitigt. Sie
behält es (außer in Fremdwörtern, wie Katheder,
Theater, Thee) bei in Silben, die nicht schon sonstwie als lang
kenntlich sind, daher z. B. in Thal, Thor, That, thun; nicht aber
in Teil, Tier, Mut, Turm, der Silbe -tum, z. B. in Altertum, und
den meisten andern Fällen. Der Buchstabe t stammt von dem
griechisch-phönikischen Tau ab.
Abkürzungen. Als Zahlzeichen bedeutet im Griechischen
$\tau$' 300, ,$\tau$ 300,000; im Lateinischen T 160, T 160,000. Als
Abkürzung bedeutet T. den römischen Vornamen Titus; im
Handel ist T. = Tara; bei Büchercitaten = Tomus (Band); t =
Tonne.
T., bei botanischen Namen für Tonrnefort (s. d.).
t. a. = testantibus actis (lat.), wie die Akten bezeugen.
T C, in der internationalen Telegraphie =
télégramme comparé (franz.), verglichenes
Telegramm.
T. F., in Frankreich früher den Zuchthanssträflingen
auf die Schulter eingebrannte Buchstaben, = travail forcé,
"Zwangsarbeit"; desgleichen:
T. P. = travaux à perpétuité.
"lebenslängliche Zwangsarbeit".
T. P. L. = twice past the line (engl.), "zweimal die Linie (den
Äquator) passiert", auf den Etiketten mancher Weine.
t. s. = tasto solo (s. d.).
t. s. V. p. = tournez, s'il vous plaît! (franz.), "wenden
Sie gefälligst (das Blatt) um!"
Ta, in der Chemie Zeichen für Tantal.
Ta, Gewicht, s. Pikul.
Taaffe, Eduard, Graf, österreich. Staatsmann, geb.
24. Febr. 1833 zu Prag aus irischem Geschlecht, Sohn des Ministers
von 1848, sodann Präsidenten des obersten Gerichtshofs, Grafen
Ludwig Patrick T. (geb. 23. Dez. 1791, gest. 21. Dez. 1855), ward
mit dem jetzigen Kaiser erzogen, trat 1857 in den Staatsdienst und
durchlief sehr schnell die Stufen der Beamtenlaufbahn. 1861 noch
Statthaltereisekretär, ward T. Ende 1861 Statthaltereirat und
Vorsitzender der Kreisbehörde in Prag. Im April 1863 wurde er
zum Landeschef im Herzogtum Salzburg, im Januar 1867 zum
Statthalter in Oberösterreich, 7. März d. J. nach
Belcredis Sturz zum Minister der innern Angelegenheiten ernannt. T.
hatte bereits 1865-66 dem Landtag Böhmens als Abgeordneter
angehört und damals zur verfassungstreuen Partei gestanden;
Ende März 1867 wählte ihn der fideikommissarische
Grundbesitz Böhmens zu seinem Vertreter im Landtag, und im
April wurde er Mitglied des Reichsrats. Als es sich im Dezember
1867 darum handelte, für die Länder diesseit der Leitha
ein parlamentarisches Ministerium zu berufen, wurde T. Minister der
Landesverteidigung und öffentlichen Sicherheit sowie
Stellvertreter des Ministerpräsidenten Carlos Auersperg. Als
dieser im Herbst 1869 zurücktrat, war T. bis 15. Jan. 1870
Ministerpräsident. Vom 12. April 1870 bis 7. Febr. 1871 war er
wieder Minister des Innern und wurde darauf zum Statthalter von
Tirol ernannt. Nach dem Rücktritt des Ministeriums Auersperg
wurde T. im Februar 1879 Minister des Innern und 12. Aug.
Ministerpräsident und bezeichnete 5. Dez. die "Versöhnung
der Nationalitäten" als sein Ziel. Nachdem sein Versuch, eine
Mittelpartei zu bilden, gescheitert war, stützte er sich ganz
auf die Ultramontanen, Polen und Tschechen, behauptete sich zwar
trotz mancher Ministerwechsel, mußte aber seinen
Anhängern wichtige Zugeständnisse in der Sprachenfrage,
in materiellen Punkten und in der Volksschulsache machen, wodurch
er die liberalen Deutschen gegen sich erbitterte, ohne doch die
slawischen Ansprüche zu befriedigen.
Taasinge (Thorseng), dän. Insel,
südöstlich von Fünen, Amt Svendborg, 69 qkm (1,25
QM.) groß mit (1880) 4529 Einw. und dem Flecken Troense.
Tabagie (franz., spr. -schih). Kneipe.
Tabago, Insel, s. Tobago.
Tabagorohre, s. Bactris und Cocos, S. 194.
Tabak (Nicotiana Tourn.), Gattung aus der Familie der
Solanaceen, ein-, seltener mehrjährige, häufig
drüsenhaarige, klebrige Kräuter, bisweilen halbstrauchig,
selten strauch- oder baumartig, mit einfachen, ganzrandigen, selten
buchtigen Blättern, endständigen Blütentrauben oder
Rispen und trockner, zweifächeriger, vom bleibenden Kelch
umgebener Kapsel mit zahlreichen sehr kleinen Samen. Etwa 50, bis
auf wenige australische und polynesische, in Amerika heimische
Arten. Bauerntabak (N. rustica L.), einjährig, 60-120 cm hoch,
drüsig kurz behaart, klebrig, mit mehr oder weniger
verästeltem Stengel,
479
Tabak (Anbau, Handelssorten).
eiförmigen, oben sitzenden, unten gestielten, gerippten
Blättern, grünlichgelben Blüten in
endständigen, gedrängten Rispen und fast kugeligen
Kapseln, in Mexiko und Südamerika, wird bei uns seltener
gebaut, im Orient aber ausschließlich und liefert den
türkischen T. und Latakia. Gemeiner, virginischer T. (N.
Tabacum L., s. Tafel "Genußmittelpflanzen"), einjährig,
1-2 m hoch, drüsig kurz behaart, klebrig, mit sitzenden (die
untern halbstengelumfassend, herablaufend), länglich
lanzettförmigen, lang zugespitzten Blättern, in
endständiger, ausgebreiteter Rispe stehenden,
langröhrigen, hellroten Blüten und eiförmigen
Kapseln, in Südamerika, wird in den gemäßigten und
subtropischen Klimaten aller Erdteile kultiviert. Der
großblätterige Marylandtabak (N. macrophylla Metzg.)
unterscheidet sich von letzterer Art durch breitere, stumpfe, am
Grund geöhrte, sitzende oder geflügelt gestielte
Blätter und durch den gedrungenern Blütenstand, ist aber
vielleicht nur eine Varietät derselben. Der T. gedeiht im
allgemeinen noch, wo der Winterweizen im ersten Dritteil des Monats
August reif wird; guter T. fordert aber ein Weinklima, und die
feinsten Sorten werden zwischen 15 und 35° gebaut. Der
Normalboden für den T. ist ein kalkhaltiger oder gemergelter
Lehm der Sandkonstitution, welcher leicht erwärmbar und
humushaltig ist. Auch milder Kalkmergelboden paßt noch
für den T., muß aber recht warm liegen. Dem T. geht
Klee, Luzerne, eine beliebige grün untergebrachte Frucht oder
eine Hackfrucht voran; er folgt zwei und mehrere Jahre auf sich
selbst und gibt sogar im zweiten oder dritten Jahr ein feineres
Produkt als im ersten. Der T. entnimmt seinem Standort bedeutende
Mengen Kali, leidet aber durch Chlorverbindungen. Für
Pfeifengut und Deckblätter wirkt Gründüngung oder
untergebrachter Klee mit Rindermistdüngung im Herbst am
günstigsten, und im Spätherbst gibt man eine tiefe
Furche. Auf sandreichem Boden wirkt eine Auffuhr von Moder
vortrefflich. Kurz vor der Bestellung erhält das Land
gartenartige Bearbeitung. Die jungen Pflanzen erzieht man in
Mistbeeten oder in Kasten mit eingeschlagenen Pfählen
(Kutschen); man säet im März, begießt
fleißig, schützt die Pflanzen durch Strohdecken vor
Frost, lichtet die Saat zur Zeit der Baumblüte, verpflanzt die
kräftigsten Pflänzchen 2,5-5 cm weit mit Erdballen in
Gartenbeete, schützt sie auch hier durch Strohdecken vor
Nachtfrösten und bringt sie Ende Mai oder mit der ersten
Junihälfte mit 6-7 Blättern auf den Acker. Man stellt sie
60 cm weit voneinander in 60 cm weit entfernten Reihen und
läßt nach je zwei Reihen einen Weg. Sobald die Pflanzen
angegangen sind, werden sie behackt, beim zweiten Behacken auch
behäufelt und, wenn sich die Blütenrispe entwickeln will,
geköpft, so daß je nach der Varietät 8-12
Blätter stehen bleiben. Später entfernt man auch die aus
den Blattwinkeln entspringenden Seitentriebe (Geizen). Bei der
ersten Behackung gräbt man zwischen je vier Pflanzen
Löcher und gießt mit Wasser verdünnte und mit Guano
gemengte Jauche hinein. Man kann statt dessen auch im Frühjahr
Mist einbringen, doch gibt die Jauche stets ein feineres Produkt.
Wenn der T. etwa 90 Tage auf dem Acker gestanden hat, sind die
Blätter reif; sie werden matt, gelbfleckig, klebrig und
bekommen einen starken Geruch. In diesem Zustand erntet man den
für Deckblätter bestimmten T., Pfeifengut aber erst, wenn
die Blätter anfangen, ihre Ränder einzurollen. Man
verliert dadurch an Gewicht, aber das Produkt wird feiner. Bei der
Ernte bricht man zuerst die untersten Blätter
(Sandblätter), dann die folgenden (Erdblätter) und
zuletzt als Haupternte die übrigen, welche die besten sind.
Bei gutem Wetter knickt man die Blätter nur ein und löst
sie am folgenden Tage ganz ab. Man trocknet sie in einem luftigen
Raum auf Stangengerüsten, indem man sie auf Ruten anspillt
oder an Bindfaden auffädelt, und läßt sie wochen-
und monatelang hängen. Das Ernteverfahren variiert
übrigens mehrfach, und in Amerika nimmt man die ganzen
Pflanzen vom Feld ab, nachdem man sie einige Tage vorher so weit
angehauen hat, daß sie sich umlegen, und hängt sie mit
den Blättern zum Trocknen auf. Der Ertrag schwankt zwischen
900-2000 kg pro Hektar. Behandelt man den Geiz wie die Haupternte,
so gibt auch jener noch einen Ertrag, freilich von geringer
Qualität. Die geernteten Blätter bindet man in kleine
Bündel, trocknet sie an der Luft und unterwirft sie dann einem
Gärungsprozeß, indem man sie in lange, frei stehende
Haufen von 1,25-1,5 m Breite und Höhe aufschichtet
(Brühhaufensetzen, Aufstocken, Lagern) und nach eingetretener
hinreichender Erwärmung der Haufen umschlägt, so
daß die äußern Schichten nach innen zu liegen
kommen. Diese Arbeit wird so oft wiederholt, bis die Blätter
vollständig eingeschrumpft sind und eine mehr oder weniger
dunkelbraune Farbe angenommen haben. Dann setzt man die Bündel
zu sogen. Trockenbänken auf und lagert sie in
größern Haufen. In der Pfalz, welche viele Blätter
als Zigarrendeckblatt versendet, streicht man diese bei
gehörigem Feuchtigkeitsgrad sorgfältig glatt, schichtet
sie zu kleinen Stößen auf und preßt diese. Die
feinern Sorten werden auch entrippt, indem man die beiden
Blatthälften von der dicken Mittelrippe abzieht. Die Rippen
selbst dienen zu Schnupftabak oder, zwischen Stahlwalzen flach
gepreßt, zu Zigarreneinlagen oder billigem Rauchtabak.
Handelssorten. Wirkung des Tabaksgenusses. Die Handelssorten
sind meist nach ihren Produktionsländern benannt; die
wichtigsten sind etwa folgende: 1) Südamerikanischer T. a)
Varinas (Kanaster) aus den Provinzen Varinas, Merida, Margarita
etc. der Republik Venezuela, kommt in 7-8 kg schweren, 4-5 cm
dicken, gesponnenen Rollen in Körben aus gespaltenem Rohr
(canastra, daher der Name) in den Handel; er ist äußerst
mild, mit feinem, weichem, kastanienbraunem Blatt und bildet den
feinsten Rauchtabak. Die besten Rollen bilden den Muffkanaster; b)
Orinokokanaster, sehr stark; c) Ori-nokokanasterblätter; d)
Cumanátabak, dem Varinas gleichstehend; e)
Cumaná-Andouillen oder Karotten; f) brasilischer T. in
Rollen, Zigarren und Zigarretten, gegenwärtig ziemlich beliebt
und stark eingeführt; g) Paraguaytabak, zum Teil sehr stark;
h) Columbiatabak aus Neugranada und den angrenzenden Ländern:
Carmen, Giron-Palmyra, Ambalema, meist Zigarrentabak, dem Varinas
nahestehend; i) mexikanischer T., erst in neuester Zeit in den
großen Markt eingetreten. 2) Westindischer T. a) Cuba oder
Havana, die vorzüglichste aller Sorten, deren ausgesuchteste
und teuerste Blätter Cabanos heißen. Der Havanatabak
wird größtenteils an Ort und Stelle auf Zigarren
verarbeitet; es kommen aber auch Blätter in Bündeln und
Seronen nach Europa, um namentlich als Deckblatt benutzt zu werden,
und fette, schwere Sorten, aus denen man in Spanien den Spaniol
darstellt. Der als Cuba in den Handel kommende T. ist in
verschiedenen Gegenden der Insel gewachsen, kommt zum Teil dem
Havana sehr nahe und dient meist zu Zigarren. Von den verschiedenen
Spezialsorten kommt am häufigsten Yara vor; b) Do-
480
Tabak (chemische Bestandteile, Fabrikation des Rauchtabaks
etc.).
mingo, von der gleichnamigen Insel, Tortuga und Samane, dient zu
Zigarren und Rauchtabak; c) Portorico, von der gleichnamigen Insel,
nächst Varinas der beste Rauchtabak, wird an Ort und Stelle
auch viel auf Zigarren verarbeitet. 3) Nordamerikanischer T. a)
Maryland, allgemein beliebter Rauchtabak, fein, gelb, von
angenehmem, süßem Geruch; die beste Sorte ist der
Baytabak. Ähnlich ist der Ohio-tabak. b) Virginia, lebhaft
braun, teils fette, schwere Sorten für feinen Schnupftabak,
teils leichtere Blätter für mittlern Rauchtabak; c)
Kentucky, zu Zigarren, Rauch- und Schnupftabak benutzt; ihm
schließen sich an die Tabake aus Tennessee und Missouri.
Seedleaf wird in Pennsylvanien, Connecticut und Ohio aus Samen von
Cuba erzogen und dient zu Zigarren. Florida gibt ein
vorzügliches, sehr schön geflecktes Deckblatt. 4)
Asiatischer T. a) Manila, sehr gute Ware, meist an Ort und Stelle
zu Zigarren verarbeitet; b) Java, von feinem Aroma, meist zu
Zigarren verarbeitet; chinesische, japanische und indische Tabake
sind bei uns keine Marktartikel. 5) Europäischer T. Frankreich
produziert in 18 Departements T., welcher zu Schnupf- und
ordinären Rauchtabaken benutzt wird. Auch Algerien liefert
große Quantitäten; die Produktion wird aber im Land
selbst verbraucht. Österreich-Ungarn baut T. in Tirol,
Galizien, namentlich aber in Ungarn am linken Ufer der Theiß.
Der ungarische T. hat ein dünnes, weiches, gelbes Blatt und
eignet sich besonders zu Rauch- und Schnupftabak, wird aber zum
Teil auch zu Zigarren benutzt. Vom holländischen T. ist der
Amersfoorter der beste und besonders zur Fabrikation von
Schnupftabak gesucht; das belgische Gewächs steht dem
holländischen nach. In Deutschland ist die
hauptsächlichste Kulturgegend die Pfalz, wo man namentlich
Zigarrentabak baut, der nicht nur an inländische, Bremer und
Hamburger Fabriken abgesetzt, sondern auch nach Amerika exportiert
wird. Ebenso beziehen Frankreich, Holland, die Schweiz etc.
deutschen T. Italien, Spanien, Portugal haben Tabaksmonopol und
kommen für den europäischen Handel nicht in Betracht.
England baut gar keinen T. Der türkische T. verdankt den
klimatischen und Bodenver-hältnissen, der sorgfältigen
Kultur und Behandlung die vorzügliche Beschaffenheit, welche
ihn mit dem Havana rivalisieren läßt. Alle Provinzen
produzieren T., den besten aber Makedonien in den Thälern von
Karasu, Wardar und Krunea. Die hier erzogenen feinen Sorten: Druma,
Pravista, Demirli, Yenidje, Sarishaban, Ginbeck etc. sind in lange,
dünne Fäden geschnitten, schön goldbraun,
aromatisch, kräftig, trocken und schmackhaft zugleich. Die
Tabake der asiatischen Türkei sind schwerer als die
rumelischen und stärker; von den syrischen Sorten ist der
Latakia und Abou Reha aus der Provinz Saida grob geschnitten, braun
bis schwarz, stark fermentiert. Als türkischer T. geht
übrigens auch viel griechisches und russisches Produkt.
Tabaksblätter riechen narkotisch, schmecken widerlich und
scharf bitter; sie enthalten 16-27 Proz. anorganische Stoffe,
welche zu 1/4-1/3 aus Kalk, oft bis zu 30 Proz. aus Kali bestehen,
auch reich an Phosphorsäure und Magnesia sind. Der
Stickstoffgehalt beträgt 4,5 Proz. Die Basen find
großenteils an organische Säuren gebunden, und die
leichte Einäscherung der Blätter, also die richtige
Brennbarkeit des Rauchtabaks, ist abhängig von der Gegenwart
organischer Kalisalze. Schlecht brennender T. liefert eine an
Kaliumsulfat und Chlorkalium reiche, aber von Kaliumcarbonat freie
Asche. Von großem Einfluß auf die Brennbarkeit des
Tabaks ist auch der Gehalt an Salpetersäure, welcher in der
Hauptrippe 6 Proz., im übrigen Blatt 2 Proz. betragen kann.
Der wirksame Bestandteil der Tabaksblätter ist das Nikotin (s.
d.), von welchem sie wechselnde Mengen enthalten, ohne daß
der Gehalt in erkennbarem Verhältnis zur Güte des Tabaks
stände. Geringere Tabakssorten pflegen reicher an Nikotin zu
sein; doch ist dessen Menge auch von der Zubereitung abhängig,
welcher der T. unterworfen wird. Guter lufttrockner Pfälzer T.
enthält 1,5-2,6 Proz. Nikotin. Andre Bestandteile des Tabaks
sind: Nikotianin (s. d.), Äpfel-, Zitronensäure, Harz,
Gummi, Eiweiß etc. Trockne und gegorne Blätter enthalten
als Gärungsprodukte Ammoniak, auch Trimethylamin und
Fermentöle. Beim Rauchen würden sich aus der Cellulose,
dem Gummi, Eiweiß etc. unangenehm riechende Substanzen
entwickeln; man entfernt daher die an Cellulose reiche Mittelrippe
und sucht durch den Gärungsprozeß und durch Beizen die
übrigen unwillkommenen Bestandteile der Blätter zu
entfernen. Die bei diesen Operationen sich bildenden
Fermentöle tragen wohl zum Aroma des Tabaks wesentlich bei.
Bei dem Verglimmen der Blätter entstehen Ammoniak,
flüchtige Basen, empyreumatische Stoffe, Blausäure,
Schwefelwasserstoff, flüchtige Säuren, Kohlenoxyd,
Kohlensäure etc. Das Nikotin wird vollständig zersetzt;
wohl aber geht Nikotianin in den Tabaksrauch über, und diesem
sowie den Basen (Pyridin, Picolin, Lutidin, Collidin etc.) und dem
Kohlenoxyd sind die Wirkungen desselben zuzuschreiben. Die je nach
Abstammung, Boden- und klimatischen Verhältnissen und nach der
Behandlung milden oder stärkern, angenehm aromatischen oder
scharfen, rauhen Blätter werden für den Handel
sorgfältig sortiert und entsprechend gemischt. Geringere
Sorten werden oft durch jahrelanges Lagern, wobei sie einer
leichten Gärung unterliegen, verbessert; bisweilen laugt man
sie auch mit Wasser, Kalkwasser, Ammoniak, Aschenlauge oder mit
Salzsäure angesäuertem Wasser aus oder röstet sie,
indem man die ganzen oder zerschnittenen Blätter (oft nach dem
Be-sprengen mit Salzsäure oder Essig) auf mäßig
erhitzten eisernen Platten behandelt und dabei auch wohl mit den
Händen rollt (Kraustabak). Am häusigsten unterwirft man
den T. einer Gärung, zu welchem Zweck man ihn mit
Siruplösung oder Fruchtsäften besprengt, auch wohl Hefe,
Weinstein, Salz etc. zusetzt und in die
Gärungsgefäße einpreßt. Durch Ausbreiten an
der Luft, auch wohl durch Rösten wird der Prozeß
unterbrochen, worauf man die Blätter mit gewürzhaften
Brühen besprengt, welchen man auch Salpeter zusetzt, um die
Brennbarkeit zu erhöhen. Zur Darstellung des Rauchtabaks
werden die so weit vorbereiteten Blätter sortiert, entrippt
oder zwischen Walzen geglättet, mit Saucen, deren Bestandteile
(Sirup, Salze, Gewürze), fast in jeder Fabrik anders gemischt
sind, besprengt oder darin eingetaucht, gefärbt und auf der
Spinnmühle oder Spinnmaschine ähnlich wie ein Seil
gesponnen oder geschnitten und dann getrocknet oder geröstet.
Über die Darstellung der Zigarren s.d. -Schnupftabak bereitet
man hauptsächlich aus Virginiatabak, Amersfoorter und andern
holländischen Sorten und benutzt auch wohl polnischen,
ungarischen und Pfälzer T. Die Blätter werden sortiert,
entrippt, mit Saucen gebeizt und der Gärung unterworfen.
Überhaupt ist hier die Anwendung von Beizen und Saucen von
größter Wichtigkeit, und der Rohstoff wird durch die
Anwendung derselben und durch die Gärung viel eindringlicher
verändert als beim Rauchtabak. Nach der Gärung
481
Tabak (Wirkung des Tabaksgenusses, Produktion und
Verbrauch).
werden die Blätter entweder gleich zerschnitten, gestampft,
gemahlen, gesiebt, oder vorher in Karotten geformt. Letztere sind
30cm und darüber lange, nach beiden Enden verjüngte
Rollen von gebeizten Blättern in einer festen Umwickelung von
Bindfaden; man läßt sie längere Zeit lagern und
erzielt dadurch eine eigentümliche Nachgärung, welche
wesentlich zur Verbesserung des Schnupftabaks beiträgt. Um die
kostspielige Arbeit des Karottierens zu ersparen, preßt man
die Blätter auch nur in Kisten zusammen und läßt
sie darin gären. Zum Zerreiben der Karotte dient die
Rapiermaschine, welche ein gröbliches Pulver, Rapé,
liefert. Man benutzt aber auch Stampfen, und die mehlförmigen
Sorten werden nach dem Trocknen auf Tabaksmühlen erzeugt.
Kautabak wird in der Regel aus schwerstem Virginiatabak
dargestellt, den man nach dem Fermentieren und nach dem Behandeln
mit verschiedenen Saucen in fingerdicke Rollen spinnt und
preßt.
Die Wirkung der unveränderten Tabaksblätter beruht auf
dem Gehalt an Nikotin; große Dosen töten unter
klonischen Zuckungen, bei enormen Dosen tritt der Tod sehr schnell
ohne Konvulsionen unter allgemeiner hochgradigster
Muskelschwäche und Bewegungslosigkett ein. In den zubereiteten
Tabaksblättern ist der Nikotingehalt oft auf ein Minimum
vermindert, und beim Rauchen kommt das Nikotin nicht oder kaum in
Betracht. Die ersten Versuche des Tabaksrauchens haben in der Regel
Ekel, Übelkeit, Angst, Beklommenheit, kalten Schweiß,
Muskelzittern, Schwindel, Neigung zur Ohnmacht, nicht selten
Erbrechen und Diarrhöe zur Folge. Wer sich an das
Tabaksrauchen gewöhnt hat, empfindet dabei eine angenehme
Erregung, ein Gefühl allgemeiner Behaglichkeit, unter dessen
Einfluß die Funktionen des Verdauungsapparats befördert
werden. Gleichwohl widerstehen Tabaksraucher dem Hunger beffer als
Nichtraucher. Auch scheint mäßiges Rauchen ohne jeden
schädlichen Einfluß zu sein. Anhaltendes starkes Rauchen
stört dagegen die Verdauung, mindert den Appetit, versetzt die
Schleimhaut des Rachens, auch wohl die des Kehlkopfs, in den
Zustand eines chronischen Katarrhs und erzeugt in geschlossenen
Räumen leichte chronische Augenentzündung. Bisweilen
treten aber auch schwere Symptome auf, welche indes fast stets bei
gänzlicher Enthaltsamkeit wieder verschwinden. Das Schnupfen
bringt weniger Allgemeinerscheinungen hervor, nur
beeinträchtigt es meist den Geruchs- und Geschmackssinn und
erzeugt auch chronischen Rachenkatarrh. Dagegen werden, namentlich
aus Nordamerika, heftige Krankheitssymptome als Folge des
Tabakskauens geschildert, vor allen hochgradige
Verdauungsstörungen und vielfach psychische Alterationen,
tiefe geistige Verstimmung und Willensschwäche. In
Tabaksfabriken haben sich keine Störungen bei den Arbeitern
gezeigt, welche als Folge des Tabaks aufzufassen wären.
Produktion und Verbranch.
Die außereuropäischen Tabaksexporte betrugen in den
Jahren 1883-85 pro Jahr:
Kilogr. Kilogr.
Vereinigte Staaten 109 193 700 Kolumbien .... 2 250 000
Türkei. .......... 32 000 000 Puerto Rico ... 1 757 900
Brasilien .... .... 23 485 000 China ......... 1 557 900
Niederl.-Ostindien.. 19 878 900 Japan. ........ 1 531 100
Philippinen........ 7 452 800 Paraguay. ..... 1 413 500
Britisch-Ostindien 7 259 300 Peru ........ 400 000
Cuba .............. 5 909 900 Mexiko......... 350 000
San Domingo........ 4 832 600 Venezuela...... 286 000
Algerien........... 4 092 700 ---------------
Persien............ 2 600 000 Zusammen: 226 251 300
Meyers Konv -Lexikon, 4. Aufl., Xv. Bd.
Berechnet man die Differenz zwischen Produktion und Export
fnr die Vereinigten Staaten mit nur 100 Mill. kg, für
Japan mit 40, für Britisch-Ostindien mit 160, für
Algerien mit 4 Mill. kg, so ergibt dies, ohne Persien zu
berücksichtigen, eine Jahreserzeugung von 530 Mill. kg, welche
aber der Wirklichkeit bei weitem nicht entspricht, da sie den
Lokalverbrauch aller in dieser Berechnung nicht genannten
Länder unberücksichtigt läßt. Die
europäische Tabaksproduktion (Rohtabak) betrug:
Kilogr.
Österreich-Ungarn . . . 1885 80 752 900
Rußland ...... 1885 51 024 000
Deutsches Reich .... 1884-85 47 193 000
Frankreich ...... 1884 16 262 800
Griechenland ..... 1883 7 680 000
Italien ....... 1884 6 017 900
Belgien ....... 1884 4 713 800
Rumänien ...... Mittelernte 3 000 000
Niederlande ..... 1884 2 976 500
Bulgarien ...... Schätzung 2 320 000
Schweiz ....... 1885 2 000 000
Serbien ....... Schätzung 1 500 000
Bosnien-Herzegowina. . Mittelernte 600 000
Finnland . . . . . . Mittelernte 200 000
------------------------------- Zusammen: 226 240 900
Hiernach ergibt sich eine Gesamtproduktion von mindestens
756 Mill. kg ohne Berechnung des eignen Konsums des
größten Teils der orientalischen, westindischen,
süd- und mittelamerikanischen und afrikanischen
Völkerschaften. Der Tabaksverbrauch pro Kopf und Jahr in
Kilogrammen beträgt: Vereinigte Staaten 2,3, Niederlande 2,9,
Belgien 2,0, Schweiz 2,2, Österreich - Ungarn 2,1, Deutschland
1,5, Schwe-den 0,8, Großbritannien 0,6, Norwegen 1,15,
Rußland 0,6(?), Frankreich 0,95, Italien 0,6, Dänemark
1,6. In Deutschland wird am meisten T. in der oberrheinischen Ebene
und den unmittelbar daran grenzenden Hügelgegenden gebaut. Auf
dieses Gebiet, welchem die Tabaksländereien der bayrischen
Pfalz, Badens, Hessens und Elsaß-Lothringens angehören,
entfallen 70 Proz. des ganzen deutschen Tabakslandes. Als einzelne
Teile desselben lassen sich wiederum die badische und bayrische
Pfalz mit dem südlichen Teil der hessischen Provinz
Starkenburg als die hauptsächlichste Tabaksgegend Deutschlands
(40,8 Proz.), ferner der Tabaksbezirk des badischen Oberlandes,
(13,3 Proz.) und endlich westlich von diesem jenseit des Rheins das
elsässische Tabaksland (14,4 Proz. des gesamten deutschen
Tabakslandes) unterscheiden. Von den übrigen 30 Proz. kommen
auf das rechtsrheinische Bayern, das noch in der Gegend von
Nürnberg und Hof einen Tabaksbezirk von einigem Umfang hat,
3,1 Proz., auf das Königreich Württemberg 0,9 Proz. und
auf das ganze nördlich von Mainz gelegene Deutschland wenig
mehr als ein Viertel des deutschen Tabakslandes. Hier hat der
Tabaksbau nur in der Ukermark und deren nördlicher und
östlicher Fortsetzung gegen das Haff und die Oder sowie an der
obern Oder in der Gegend von Breslau und in der Weichselniederung
einige Bedeutung ; in allen übrigen Gegenden tritt diese
Kultur nur sporadisch auf. Das ukermärkische Tabaksland, das
bedeutendste in Norddeutschland, umfaßt 12,3 Proz. des
gesamten deutschen Tabakslandes. 1871 brachten 22,673 Hektar
717,907 Ztr. in trocknen Blättern, 1887 wurden auf
21,465 Hektar 817,386 Ztr. geerntet (1904 kg auf
1 Hektar), davon entfallen auf Baden 305,548, Preu-
ßen 221,424, Bayern 133,590, Elsaß -Lothringen
100,912, Hessen 28,436, Württemberg 12,128 Ztr. 1888 waren nur
18,130 Hektar mit T. bepflanzt. Die
31
482
Tabakkampfer - Tabakspapier.
Einfuhr betrug 1887 von T. 41,915, von Tabaksfabrikaten 1249,
die Ausfuhr 920, resp. 1398 Ton.
Geschichtliches.
Über das Alter des Tabaksrauchens in China, wo man
Nicotiana chinensis Fisch. benutzt, ist nichts Sicheres bekannt.
Nach Europa gelangte die erste Nachricht vom T. durch Kolumbus,
welcher 1492 die Eingebornen von Guanahani cylinderförmige
Rollen von Tabaksblättern, mit einem Maisblatt umwickelt,
rauchen sah. Fra Romano Pane, den Kolumbus auf Haiti
zurückgelassen hatte, machte 1496 Mitteilungen über die
Tabakspflanze an Petrus Martyr, und durch diesen gelangte dieselbe
1511 nach Europa. Die Eingebornen auf Haiti rauchten den T. als
zusammengerollte Blätter oder zerschnitten aus langen
Röhren. Diese, nach andern die Maisblattrollen, sollen Tabacos
geheißen haben, nach andern soll der Name T. von der Insel
Tobago oder von der Provinz Tabasco in Mittelamerika
herrühren. Eine genaue Beschreibung der Pflanze gab 1525
Gonzalo Hernandez de Oviedo y Valdes, Statthalter von San Domingo.
Später pries der spanische Arzt und Botaniker Nicolas Menardes
in seinem 1571 zu Sevilla erschienenen Buch über Westindien
den T. als Heilpflanze, und nun ward derselbe als Arznei- und
Wunderkraut kultiviert. So auch von Jean Nicot, französischem
Gesandten in Portugal, der 1560 Tabakssamen nach Paris schickte;
ihm zu Ehren benannte Linne die Gattung. Kurze Zeit nachher erhielt
auch Konrad Geßner indirekt von Occo in Augsburg das Kraut
und erkannte es durch Vergleichung mit einer Abbildung, welche ihm
Aretius in Bern nach von letzterm selbst aus Samen gezogenen
Pflanzen entworfen hatte. Geßner machte in Deutschland zuerst
auf den T. und seine medizinischen Eigenschaften aufmerksam. Das
Tabaksschnupfen wurde in Frankreich unter Franz II. üblich, zu
Sevilla in Spanien entstand gleichzeitig eine Schnupftabaksfabrik,
welche den Spansol lieferte. l636 führten spanische Geistliche
das Schnupfen in Rom ein, gegen welches Urban VIII. eine Bulle
erließ, die erst 1724 wieder aufgehoben wurde. 1657 gab
Venedig Fabrikation und Verschleiß des Schnupftabaks in
Pacht. Das Tabaksrauchen wurde durch spanische Matrosen und
englische Kolonisten nach Europa importiert und zwar durch erstere
schon um die Mitte des 16. Jahrh. nach Spanien aus Westindien,
durch letztere 1586 nach England aus Virginia. In Nordamerika
scheint das Rauchen ebenfalls seit uralter Zeit gebräuchlich
gewesen zu sein; bei den Indianern galt es als ein der Sonne und
dem großen Geist gebrachtes Opfer; als Raleigh Virginia
entdeckte, war der Tabaksbau bei den dortigen Eingebornen ganz
allgemein verbreitet. Gegen Ende des 16. Jahrh. war das Rauchen in
Spanien, Portugal, England, Holland, 1605 auch in Konstantinopel,
Ägypten und Indien bekannt, und weltliche und geistliche
Mächte eiferten vergebens gegen die weitere Verbreitung
desselben. 1622 brachten englische und holländische Truppen
das Tabaksrauchen nach dem Rhein und Main, von wo es durch den
Dreißigjährigen Krieg bald in andre Teile Deutschlands
gelangte. Jakob I. von England belegte zuerst den Tabakshandel mit
hohen Steuern. 1616 wurde der erste T. in Holland gebaut, wenig
später in England, 1659 in Wasungen, 1676 in Brandenburg und
1697 in der Pfalz und in Hessen. Schnupfen und Kauen des Tabaks
sind europäische Erfindungen. Da man sich anfangs scheute,
öffentlich zu rauchen, so entstanden in Frankreich,
zunächst in Paris, besondere Lokale, die Tabagies, für
die Freunde des Tabaks, und in Deutschland wurde dieser Name bis
zur Mitte des 19. Iahrh. ganz allgemein für öffentliche
Lokale gebraucht. Bis 1848 war das Rauchen auf den Straßen in
den meisten Ländern Europas verboten. Vgl. Tabakssteuer.
Vgl. Tiedemann, Geschichte des Tabaks (Frankf. 1854); Babo, Der
Tabaksbau (3. Aufl., Berl. 1882); Nessler, Der T., seine
Bestandteile etc. (Mannh. 1867); Schmidt, Fabrikation von Schnupf-
und Kautabak (Berl. 1870); Fries, Anleitung zum Anbau, zur
Trocknung und Fermentation des Tabaks (3. Aufl., Stuttg.1870);
Wagner, Handbuch der Tabaks- und Zigarrenfabrikation (5. Aufl.,
Weim. 1888); Becker, Die Fabrikation des Tabaks (2. Aufl., Norden
1883); Lock, Tobacco; growing, curingand manufacturing (Lond.
1886); Fairholt, Tobacco, it's history and associations (das.
1875); Fermond, Monographie du tabac (Par. 1857); Knoblauch,
Deutschlands Tabaksbau und -Ernte (Berl. 1878); "Statistik des
Deutschen Reichs", Bd. 42: "Tabakbau, Tabakfabrikation etc. im
Deutschen Reich" (das. 1880); Meyer, Aus der Havanna (5. Aufl.,
Norden 1884); Jolly, Etudes hygieniques et medicales sur le tabac
(Par. 1865); Derselbe, Le tabac et l'absinthe (das. 1875);
Dornblüth, Die chronische Tabaksvergiftung (Leipz. 1878);
Hare, The physiological and pathological effects of the use of
tobacco (Lond. 1886); Stinde, Das Rauchen (2. Aufl., Berl. 1887);
Keibel, Wie sollen wir rauchen? (das.1887); "Deutsche
Tabakszeitung" (Berl., seit 1868); Bragge, Bibliotheca nicotiana
(Lond. 1880).
Tabakkampfer, s. Nikotianin.
Tabaksblei, s. Bleiblech.
Tabakskollegium, Abendgesellschaft, welche König
Friedrich Wilhelm I. von Preußen fast täglich abends zu
Berlin, Potsdam oder Wusterhausen um sich versammelte, und zu der
die Vertrauten des Königs (Leopold von Dessau, Grumbkow,
Seckendorff), Minister, Stabsoffiziere, Gelehrte (s. Gundling 2)
und durchreisende Standespersonen gezogen wurden. Die Erholung war
dem König um so erwünschter, als er in diesem vertrauten
Kreise sich völlig gehen lassen, seine eigne Meinung frei
aussprechen zu können und die andrer zu vernehmen glaubte.
Alles Zeremoniell war verbannt; niemand durfte aufstehen, wenn der
König hereintrat. Der König betrachtete sich bloß
als Offizier und als unter seinesgleichen. Man rauchte (aus kurzen
thönernen Pfeifen), und die, welche nicht rauchten,
mußten die Pfeifen wenigstens in den Mund nehmen. Dazu ward
Ducksteiner Bier aufgetragen; im Nebenzimmer stand für den
Bedarf kalte Küche. Die Unterhaltung bezog sich auf
Lektüre von Zeitungen, Bemerkungen über Politik und
Kriegsgeschichte und Besprechung von Tagesneuigkeiten; auch wurden
mancherlei Späße, bisweilen sehr derber Art, getrieben,
namentlich mit Gundling. Von Spielen war nur Schach- und Damenspiel
gestattet. Der Einfluß, den in diesen Abendgesellschaften
namentlich die von Österreich bestochenen Vertrauten auf den
König ausübten, der sich arglos ihnen preisgab, machte
dieselben selbst für die preußische Geschichte wichtig.
Eine Schilderung des Tabakskollegiums liefert die Biographie
Gundlings in Öttingers "Narrenalmanach" für l846, eine
dramatische Darstellung Gutzkows "Zopf und Schwert".
Tabaksmonopol, s. Tabakssteuer.
Tabakspapier, ein mit Zusatz von Tabaksstengeln und
Tabaksrippen hergestelltes Papier, welches als Deckblatt für
Zigarren, auch zu Zigarretten benutzt wird; Bleiblech zum Verpacken
von Schnupftabak.
483
Tabakspfeife - Tabaksteuer.
Tabakspfeife, Instrument, womit man Tabak raucht. Bei den
thönernen oder irdenen Pfeifen bilden Rauchröhre und Kopf
(Verbrennungsraum für den Tabak) nur Ein Stück; die
übrigen Pfeifen bestehen aus mehreren Stücken: Spitze
(Mundstück aus
Horn, Elfenbein oder Bernstein), Rohr aus Holz, Guttapercha oder
biegsamen Geflechten, Saftsack und Kopf. Die irdenen oder
thönernen Tabakspfeifen werden in besondern Fabriken aus einem
feuerfesten, weißen, eisenfreien, seltener farbigen (gelben
oder roten) Thon (Pfeifenthon) gefertigt (s. Thonwaren). Die in
Ungarn, Serbien, den Ländern der untern Donau
gebräuchlichen Thonpfeifen werden aus roten, gelben und
schwarzen Pfeifenerden in eigentümlichen Formen mit niedrigem,
breitem Kopf gefertigt. Wie für die sogen. holländischen
irdenen Pfeifen Gouda der Hauptsitz der Fabrikation ist, so ist er
für die Donauländer Debreczin. Die Produktion der
Goudaer, Kölner etc. Brennereien wurde ehedem auf 60 Mill.
jährlich veranschlagt, hat aber in neuerer Zeit sehr
abgenommen. Viele Pfeifenköpfe werden auch aus Meerschaum (s.
d.) und Maserholz (Ulmer Köpfe) geschnitten. Am bedeutendsten
ist aber die Fabrik-tion der Pfeifenköpfe von Porzellan, deren
Hauptsitz
der Thüringer Wald ist. Vgl. Tschibuk, Nargileh und
Tschimin.
Tabakssteuer. Als entbehrliches, aber doch in
großen Mengen von der erwachsenen arbeitsfähigen
Bevölkerung verbrauchtes Genußmittel bildet der Tabak
ein finanziell sehr ergiebiges und geeignetes Mittel
der Besteuerung. Letztere kommt vor in der Form der
1) Handelsbesteuerung, am einfachsten durchgeführt in
England, wo schon seit 1652 (ebenso für
Irland mit einer Unterbrechung von 1799 bis 1831,
dann für Schottland seit 1782) der Tabaksbau verboten ist
und die Steuer durch reine Verzollung in Verbindung mit Lizenzen
erhoben wird. In Portugal, wo 1664 das Monopol eingeführt
worden war, ist heute für die Lizenz zum Tabaksbau eine
Gebühr zu entrichten. Neue Tabaksfabriken dürfen nach
Gesetz vom 27. Jan. 1887 nicht mehr errichtet, bestehende nicht
erweitert werden. Schweden, welches seinen Tabak
größtenteils aus Rußland bezieht, erhebt nur einen
Zoll, dagegen keine innere Abgabe. Die von Händlern und
Fabrikanten erhobenen Lizenzen können überhaupt nur die
Bedeutung von Ergänzungssteuern haben, da sie eine Belastung
nach der Steuerfähigkeit, bez. dem Geschäftsumfang nicht
ermöglichen, daher mäßige Sätze nicht
überschreiten dürfen. In andern Ländern bildet der
Tabakszoll eine Ergänzung der innern Verbrauchssteuer.
2) Die Rohprodukten- od. Pflanzungssteuer (Urproduzentensteuer)
trifft die inländischen Erzeugnisse an Rohtabak entweder in
der Form der Flächen- oder in der der Gewichtssteuer. Die
Flächensteuer wird nach der Größe der mit Tabak
bepflanzten Fläche bemessen, wobei auch noch Abstufungen nach
der Ertragsfähigkeit des Bodens statthaben können. Im
übrigen nimmt sie keine Rücksicht auf die insbesondere
von Jahr zu Jahr wechselnde Menge und auf Qualität des
erzeugten Tabaks. Diese Steuer bestand in Preußen seit 1828,
nachdem seit 1819 nach
dem Gewicht besteuert worden war, im Zollverein von
1868 bis 1879. Sie wurde 1879 durch die Gewichtssteuer ersetzt,
welche nach dem Gewicht des Tabakserzeugnisses bemessen wird,
während die Flächensteuer für kleine Pflanzungen von
weniger als 4 Ar
Flächengehalt als Regel beibehalten wurde. Das zu
erwartende Ergebnis wird an Ort und Stelle vor der
Ernte amtlich eingeschätzt. Später findet amtliche
Nachzählung und Verwiegung statt. In Belgien (1883) wird
die Steuer nach der Pflanzenzahl bemessen, indem nur in weitern
Grenzen das Gewicht (drei Abstufungen nach der Bodengüte) in
Rechnung gezogen wird. Diese Steuer nimmt keine
Rücksicht auf die Qualität und beengt durch ihre
Kontrollen den Tabaksbau (Kulturzwang, Pflanzung in Reihen und
gleichen Abständen, Verbot der Mischung mit andern Pflanzen,
Vollendung des Köpfens und
Ausgeizens vor Erhebung der Blätterzahl, Vernichtung aller
vor der Ernte stattfindenden Abfälle etc.). Flächen- wie
Gewichtssteuer reizen bei hohen Steuersätzen zur
Verschlechterung des versteuerten Rohtabaks durch Beimengungen,
gestatten nicht eine richtige Bemessung der Ausfuhrvergütung
und bedingen oft lange dauernde Steuervorschüsse.
3) Die Fabrikatsteuer, welche in den Vereinigten Staaten seit
1868, in Rußland seit 1877 besteht,
wird nach Gewicht und Form der aus der Fabrik in den Handel
übergehenden Fabrikate (Rauch-, Schnupftabak, Zigarren etc.)
erhoben. Bei derselben lassen sich Stempelmarken (Banderollen)
anwenden, welche der Fabrikant von der Behörde bezieht und an
seinen Waren in der Art anbringt, daß sie bei dem Verbrauch
zerstört werden müssen, was bestimmte Vorschriften
über die Verpackung etc. sowie eine scharfe Kontrolle des
Tabakshandels nötig macht. Die Fabrikatsteuer ermöglicht
eine wenn auch nicht sehr weit gehende Unterscheidung der
Qualitäten sowie eine genauere Bemessung der
Ausfuhrvergütung, dann ist ihre Erhebung dem wirklichen
Verbrauch zeitlich nahegerückt. Dagegen beansprucht sie
lästige und teure, bis zum Tabaksbau sich erstreckende
Kontrollen,
begünstigt durch ihre Technik den Großbetrieb und
bringt leicht den Tabaksbauer in Abhängigkeit von
letzterm.
4) Die Besteuerung des Tabaks auf dem Weg der Monopolisierung
wurde in Frankreich schon 1674 eingeführt, wo sie mit kurzen
Unterbrechungen (1719-23 und 1723-30) bis 1791 bestand
und 1810 durch Napoleon I. wieder ins Leben gerufen wurde. Das
Tabaksmonopol besteht ferner in Österreich-Ungarn und zwar in
einzelnen Landesteilen ob der Enns schon seit 1670, in allen
Ländern diesseit der Leitha seit 1828 und in der gesamten
Monarchie seit 1851, in Spanien seit 1730, in Mexiko seit
1764, in Italien seit 1865 (ursprünglich verpachtet,
seit
1884 von der Regierung in eignen Betrieb genommen),
Rumänien seit 1865 in der Türkei seit 1884
(Verpachtung), in Serbien seit 1885 (ebenfalls mit Verpachtung an
eine Gesellschaft). Diese Besteuerungsform kommt nur als volles
Tabaksmonopol vor, d. h. der Staat behält sich das
ausschließliche Recht des Ankaufs heimischen Rohtabaks, der
Einfuhr fremder Tabake und das der inländischen
Tabaksfabrikation vor, um durch Vermittelung von konzessionierten
Verkäufern den Tabak zu Preisen zu verkaufen, welche einen
Überschuß über die Kosten als Steuer ergeben. Die
Einfuhr ausländischer Tabaksfabrikate ist in Frankreich ganz
verboten, in Österreich nur ausnahmsweise gegen Lizenzen
gestattet. Der Tabaksbau wird im Inland nur in bestimmten
Anbaubezirken gegen Staatserlaubnis und unter Kontrolle gestattet,
die Erzeugnisse desselben sind gegen alljährlich von der
Verwaltung festgesetzte Preise an dieselbe abzuliefern. Für
und gegen das Tabaksmonopol lassen sich im wesentlichen die
Gründe vorführen, die überhaupt für und wider
die Monopolisierung geltend gemacht werden. Es gestattet
Kostensparung durch Zentralisierung und Minderung des
Zwischenhandels (Frankreich hat nur
^
484
Tabaldie - Tabellen.
16 Staatsfabriken mit etwa 18,000 Arbeitern, während in
Deutschland die Verarbeitung der doppelten Menge Rohtabaks sich auf
fast 11,000 selbständige Betriebe mit etwa 110,000
beschäftigten Personen verteilt), es erspart Kosten der
Kontrolle und Erhebung, gewährt Sicherheit gegen
Fälschung, es ermöglicht, den Steuerfuß der
Qualität anzupassen und denselben nach Bedarf zu ändern,
endlich, und darin besteht seine eigentlich praktische Bedeutung,
läßt es die vollständigste Ausbeutung einer
ergiebigen Steuerquelle zu. Dagegen ist die Monopolisierung mit den
Schattenseiten verknüpft, welche dem weniger beweglichen
Staatsbetrieb mit seiner büreaukratischen Beamtenwirtschaft
überhaupt anhaften. Insbesondere befürchtet man in
Deutschland, es möchte die Staatsgewalt allzusehr alle andern
Lebenskreise überwuchern. Ob nun diese Übelstände
oder jene Vorteile des Monopols überwiegen, dies
läßt sich nur von Fall zu Fall beantworten. In
Deutschland steht der Monopolisierung vorzüglich der Umstand
im Weg, daß hier Industrie und Handel in Tabaken sich lebhaft
entwickelt haben und infolgedessen nicht allein die Frage der
Entschädigung große Schwierigkeiten bereitet, sondern
auch die Änderung in der Steuerform erhebliche wirtschaftliche
Umwälzungen bewirken würde. Das auf den Handel mit
Rohtabak beschränkte Monopol, bei welchem der Staat als
alleiniger Aufkäufer den Tabak mit einem Preiszuschlag an
Händler abgibt, ist noch nirgends zur Durchführung
gekommen.
Im Deutschen Reich war in 1000 Mk. der Ertrag
durchschnittlich jährlich der Tabakssteuer des
Eingangszolls von Tabak der Nettoertrag der Tabaksabgaben im ganzen
auf den Kopf
1871-79 1490 14687 15967 0,37
1881-86 9909 29059 38503 0,84
1886-87 11067 36992 47535 1,02
Die Reineinnahme des Staats aus den Tabaksgefällen war in
Millionen Mark in
Frankreich . . 1815: 25,7, 1883: 242,8
Österreich . . 1869: 59,2, 1883: 76,5
Ungarn . . . 1869: 22,2, 1884: 37,4
Italien . . . 1877: 63,7, 1883: 86,8
Großbritannien 1842: 72,4, 1883: 181,3
Verein. Staaten 1883: 208,6, 1884: 138,6
Auf den Kopf entfiel 1883, bez. 1884 eine Reineinnahme in
Frankreich . . von 6,95 Mk.
Großbritannien 5,10
Spanien . . . 4,32
Österreich . . . 4,16
Verein. Staaten 4,15
Italien . . . 3,30
Ungarn . . . 2,46
Norwegen 1,59 Mk.
Schweden 0,91
Deutschland . 0,81
Rußland 0,65
Dänemark 0,55
Belgien . 0,34
Holland 0,05
Vgl. Mayr, Das Deutsche Reich und das Tabakmonopol (Stuttg.
1878); M. Mohl, Denkschrift für eine Reichstabakregie (das.
1878); Felser, Das Tabakmonopol u. die amerikanische Tabaksteuer
(Leipz. 1878); Derselbe, Zur Tabaksteuerfrage (das. 1878); H.
Pierstorff, Entwickelung der Tabaksteuergesetzgebung in Deutschland
seit Anfang dieses Jahrhunderts (in den "Jahrbüchern für
Nationalökonomie" 1879, Heft 2); Mährlen, Die Besteuerung
des Tabaks im Zollverein (Stuttg. 1868); R. Schleiden, Zur Frage
der Besteuerung des Tabaks (Leipz. 1878); Krükl, Das
Tabaksmonopol in Österreich und Frankreich (Wien 1879);
Creizenach, Die französische Tabaksregie (Mainz 1869);
Aufseß, Über die Besteuerung des Tabaks (Leipz. 1878);
Reinhold, Das Tabaksteuergesetz vom 16. Juli 1879 (das. 1881).
Tabaldie, der Affenbrotbaum.
Tabanus, Bremse; Tabanina (Bremsen), Familie aus der
Ordnung der Zweiflügler.
Tabarieh, Stadt, s. Tiberias.
Tabarka, kleine Hafenstadt in Tunis an der
Nordküste, die aber durch ihr an Metallen und Holz reiches
Hinterland wichtig werden muß, wenn die geplante Eisenbahn
vollendet ist. Davor die gleichnamige kleine Insel mit jetzt sehr
heruntergekommener Korallenfischerei.
Tabascheer, s. Bambusa.
Tabasco, ein Küstenstaat der Republik Mexiko, am
Mexikanischen Meerbusen, 25,241 qkm (458,4 QM.) groß mit
(1882) 104,747 Einw., ist ein vom untern Grijalva und einem Arm des
Usumacinta durchzogenes Flachland, feucht und ungesund, aber
ungemein fruchtbar. Nur an der Südgrenze treten bewaldete
Hügel auf. Hauptprodukte sind: Kakao, Mais, Zuckerrohr,
Kaffee, Piment, Bohnen, Reis, Tabak, Vanille, Sassaparille, die
verschiedensten Nutz- und Farbhölzer. Fabriken gibt es nicht.
Die Hauptstadt San Juan Bautista de T. liegt am Grijalva, 100 km
oberhalb dessen Mündung auf einer Anhöhe in fruchtbarer,
Überschwemmungen ausgesetzter Gegend, hat ein
Regierungsgebäude, ein Colegio Juarez, ein Zollamt und 8000
Einw. An der Mündung des Flusses liegt der Hafen Frontera de
T. mit Leuchtturm und (1880) 2168 Einw. Die Ausfuhr wertete
1883-84: 626,209 Pesos.
Tabasmyrte, s. Pimenta.
Tabatiere (franz., spr. -tjähr),
Schnupftabaksdose.
Tabatieregewehr, das Snider-Gewehr mit
tabaksdosenähnlichem Verschluß, wurde 1870/71 von der
franz. Mobilgarde geführt; s. Handfeuerwaffen, S. 104.
Tabatinga, Stadt in der brasil. Provinz Amazonas, dicht
an der Grenze von Peru am Amazonenstrom, 3375 km oberhalb
Pará, hat lebhaften Handel und ist in der neuesten Zeit als
Dampfschiffstation wichtig geworden.
Tabellen (lat.), auch Tafeln, in Rubriken geordnete
Zusammenstellungen des Gesamtinhalts irgendeines Wissensgebiets.
Derartige T. finden mannigfache Verwendung im Unterrichtswesen,
wenn auch ihr Wert nach dem heutigen Stande der wissenschaftlichen
Pädagogik nicht mehr so hochgeschätzt wird wie ehedem,
indem sie nur nachträglich zur festern Einprägung
einzelner Hauptpunkte oder zum Nachschlagen bei der Vorbereitung
benutzt werden, aber nicht in den Mittelpunkt des Unterrichts
treten sollen. Dahin gehören unter andern Geschichtstabellen,
Regenten- u. Stammtafeln, tabellarische Übersichten
naturhistorischer Systeme, des spezifischen Gewichts der
wichtigsten Naturkörper, des Atomgewichts der Elemente; auch
Logarithmentafeln, Zins- und Zinseszinstabellen für Arithmetik
und Trigonometrie u. a. Wichtiger noch ist die Rolle, welche das
Tabellenwesen in der Statistik spielt. Die gesetzmäßig
wiederkehrenden Zahlenverhältnisse im Wechsel der
Bevölkerung etc. sind von dieser Wissenschaft in feste T.
gebracht worden, auf welchen sich dann die praktischen
Schlußfolgerungen aufbauen, wie z. B. die Berechnung der
Beiträge für Lebensversicherung, Witwenversorgung etc.
auf den Mortalitätstabellen. Auch die Ergebnisse statistischer
Erhebungen über Alters-, Erwerbsverhältnisse,
Nationalvermögen, Gesundheitsstand werden zumeist in Form der
T. sich darstellen. Erhellt hieraus die weitgreifende Bedeutung der
T. für das moderne Leben, so darf anderseits nicht
verschwiegen werden, daß sie im Organismus der Verwaltung oft
unverhältnis-
485
Taberistan - Täbris.
mäßig viel Kraft verzehren, und daß sie, um mit
Sicherheit praktisch verwertet zu werden, ebenso sorgfältig
aufgestellt wie vorsichtig benutzt sein wollen.
Taberistan (Tabaristan), Landschaft im nördlichen
Persien, den gebirgigen Südosten der Provinz Masenderan
umfassend, das Land der Tapuri im alten Hyrkanien, hat
schönes, die Viehzucht begünstigendes Weideland, viel
dichten Wald und Wild, zahlreiche kleine Flüsse und ein
angenehmes Klima. Das Mineralreich liefert besonders Schwefel. Die
teils ansässigen, teils nomadisierenden Einwohner bekennen
sich zum Islam.
Tabernaculum (lat., Tabernakel), s. v. w.
Sakramentshäuschen. In der lateinischen Bibelübersetzung
heißt T. die Stiftshütte der Israeliten, daher bei
Methodisten s. v. w. Bethaus.
Tabernaemontana Arn., Gattung aus der Familie der
Apocynaceen, Sträucher oder Bäume mit
gegenständigen, ganzen Blättern, zu zweien
endständigen, weißen oder gelben, wohlriechenden
Blüten und fleischigen, wenigsamigen Früchten. Viele in
den Tropen weitverbreitete Arten. T. utilis Arn. (Milchbaum von
Demerara, Hya-Hya), ein Baum Guayanas von 9-12 m Höhe, mit
grauer, etwas rauher Rinde, aus welcher bei Verletzungen eine
weiße Milch fließt, die von der des Kuhbaums (s.
Galactodendron) wesentlich verschieden ist, aber, wie diese, als
nahrhaftes, wohlschmeckendes Getränk benutzt werden kann und
frei von aller Schärfe ist. T. dichotoma Roxb. (Evaapfelbaum),
ein immergrüner Baum Ceylons mit wohlriechenden Blüten
und an fadenförmigen Zweigen hängenden, sehr giftigen
Früchten, welche Äpfeln ähneln, aus denen ein
Stück herausgebissen ist. T. coronaria W., mit großen,
weißen, sehr wohlriechenden Blüten, aus Ostindien
stammend, wird als Zierpflanze kultiviert.
Taberne (lat., auch Taferne), Wirtshaus, namentlich
Weinschenke; seltener Herberge.
Tabes (lat.), Auszehrung, Schwindsucht, besonders
Rückenmarksschwindsucht (s. d.); T. meseraica.
tuberkulöse und käsige Zerstörung des Darms und der
Gekrösdrüsen.
Tableau (franz., spr. tabloh), Gemälde; wirkungsvoll
gruppiertes Bild (namentlich im Schauspiel); auch s. v. w.
übersichtlich angeordnete Darstellung. Tableaux vivants ,
lebende Bilder (s. d.).
Table de marbre (franz., "Marmortafel"), in Frankreich
ehemals Name des Marschalls-, Admiralitäts- und besonders des
Oberforstgerichts; früher auch Name der Bühne, auf
welcher die Clercs der Bazoche (s. d.) ihre Theatervorstellungen
gaben.
Table d'hote (franz., spr. tabl doht), "Wirtstafel" in
einem Gasthaus (Hotel) mit festem Preis für das Gedeck, an
welcher die Gäste gemeinschaftlich teilnehmen, ohne sich die
Speisen auswählen zu können.
Tablette (franz.), Täfelchen; Schreibtafel;
Büchergestellchen; Präsentierteller. Tabletterie, kleine
Artikel der Kunsttischlerei, wie Kästchen, kleine
Schränke, Kartenpressen, Damenbretter u. dgl., Gegenstand
einer namentlich in Wien, Nürnberg, Fürth, Berlin,
Dresden, Prag etc. vertretenen Industrie.
Tablinum (lat.), der Teil des altrömischen Hauses,
welcher sich zwischen dem Atrium und dem hintern Raum (Peristylium)
befand und meistens dem Herrn zum Geschäftszimmer diente. S.
Tafel "Baukunst VI", Fig. 4.
Taboga, Insel im Golf von Panama (Zentralamerika), 30 km
südlich von der Stadt Panama, ist etwa 6 km lang, dicht
bewaldet und hat 1568 Einw., die Perlenfischerei treiben.
Taboleira (Platte, Tischplatte), in Brasilien Name der
kaum merklich wellenförmigen, zugleich vorherrschend
dürren Ebenen, welche den Mesas in den Llanos von Venezuela
entsprechen.
Tabor, in der türk. Armee das Infanteriebataillon,
im Kriegsetat etwa 830 Köpfe stark; 3 Tabors bilden 1 Regiment
und 8 Kompanien (Bölük) 1 T.
Tabor (vom türk. thabur, "Lager"), bei den Tschechen
übliche Bezeichnung für Volksversammlung.
Tabor (Atabyrius mons, arab. Dschebel Tûr), Berg in
Palästina, 9 km südwestlich von Nazareth, ein 650 m hoher
stumpfer Kegel, nach der (irrigen) Tradition der Berg der
Verklärung Christi. Am T. schlug Barak den Kanaaniter Sissera
(Richter 4, 6 ff.); Antiochos d. Gr. fand 218 v. Chr. eine Stadt T.
auf dem Gipfel des Bergs; 53 n. Chr. wurde hier von den Römern
unter Gabinius den Juden eine Schlacht geliefert. Später
ließ Josephus den T. befestigen, ebenso 1212 Melek el Adil,
der Bruder Saladins; im April 1799 siegte hier General Kleber
über die englisch-türkische Armee. Heutzutage befinden
sich aus dem Gipfel zwei (nicht alte) Klöster.
Tabor, Stadt im südöstlichen Böhmen, auf
steiler, von der Luschnitz umflossener Anhöhe, 460 m ü.
M., am Kreuzungspunkt der Staatsbahnlinien Wien-Prag und
Iglau-Pisek, hat eine Bezirkshauptmannschaft, ein Kreisgericht,
eine Finanzbezirksdirektion, ein Oberrealgymnasium, eine
landwirtschaftliche Lehranstalt, eine Dechanteikirche und ein
Rathaus (mit Museum), beide aus dem 16. Jahrh., mittelalterliche
Stadtmauern mit Türmen, eine neue Synagoge, ein Theater,
hübsche Anlagen, eine Badeanstalt, eine Sparkasse (2 Mill.
Gulden Einlagen), eine ärarische Tabaksfabrik, Bierbrauerei,
Malzfabrik, Gerberei, Kunstmühlen, starken Vieh- und
Getreidehandel und (1880) 7413 Einw. Den Marktplatz schmückt
seit 1877 ein Denkmal Ziskas. Die Stadt steht an der Stelle der
uralten Festung Kotnow, deren malerische Trümmer noch
vorhanden sind, und wurde 1420 von den Hussiten unter Ziska als
verschanztes Lager (Tábor) erbaut.
Tabora, großer Markt der arabischen
Sansibarhändler, südlich vom Ukerewesee, unter 5°
südl. Br. und 33° östl. L. v. Gr., die vielbesuchte
Zwischenstation aller Reisenden, welche von Sansibar westwärts
nach Innerafrika gehen.
Taboriten, Partei der Hussiten (s. d.), welche sich nach
der Hussitenfeste Tabor (Kotnow) benannte und in politischer wie
religiöser Hinsicht radikale Tendenzen verfolgte, selbst aber
wieder in zahlreiche Sekten zerfiel. Gemeinsame Forderungen
derselben waren die Anerkennung der individuellen Überzeugung
auf Grund der Heiligen Schrift und eine republikanische Verfassung
ohne Unterschied der Stände u. des Eigentums. Ausartungen
waren die Adamiten (s. d.) und Picarden (s. d.). Der niedere Adel,
die Bürgerschaft der Städte und die Masse des Landvolkes
schlossen sich meist den T. an. Ihre Führer waren Nikolaus von
Pistna (Hus) und Ziska, dann die beiden Prokope. Im Kampf gegen die
deutschen Kreuzheere zeigten sie sich tapfer und
unüberwindlich; war die Gefahr vorbei, so wandte sich ihr
Haß gegen die Gemäßigten (Kalixtiner), und sie
verheerten Böhmen und die Nachbarländer durch
Plünderungszüge, bis sie durch die gemäßigte
Partei in der Schlacht bei Böhmisch-Brod 30. Mai 1434
vernichtet wurden. Vgl. Krummel, Utraquisten und T. (in der
"Zeitschrift für historische Theologie" 1871); Preger,
über das Verhältnis der T. zu den Waldesiern (Münch.
1887).
Täbris, Stadt, s. Tebriz.
486
Tabu - Tachometer.
Tabu (Tapu), nach einem aus der Sprache der
Südseeinsulaner herrührenden Wort s. v. w. unverletzlich.
So gelten bei Naturvölkern die Person des Häuptlings,
Begräbnisplätze, Kultstätten etc. an sich als t.;
aber man wußte auch jede beliebige andre Örtlichkeit,
einen Baum, verlassene Wohnungen, ja ein einzelnes
Besitzstück, vor Annäherung, Berührung oder Wegnahme
zu schützen, indem man sie mit einem einfachen Faden, in den
unter bestimmten Zeremonien einige Knoten mit oder ohne Fetische
eingeknüpft worden waren, umgrenzte oder umband (s.
Knotenknüpfen). Die Rassenangehörigen waren
überzeugt, daß bei Verletzung dieses Fadens alle
Übel, die der Knotenschürzer hineingeknüpft hatte,
unfehlbar auf sie fallen würden, und so ersetzte der
Aberglaube die noch unausgebildete Sicherheitspolizei bei den
verschiedensten Naturvölkern, denn unter verschiedenen Formen
findet oder fand sich das T. in allen Erdteilen.
tabula Amalphitana. s. Amalfi.
tabula rasa (lat.), eigentlich abgekratzte, leere
Schreibtafel, auf welcher das mit dem Griffel in den
Wachsüberzug derselben Eingegrabene durch Umkehrung des
Griffels wieder vertilgt worden; daher sprichwörtlich T. r.
machen, s. v. w. alles aufzehren, aufarbeiten, vollständig
beseitigen.
Tabularium (lat.), öffentliches Archiv.
Tabulat (lat.), gedielter Gang in Klöstern etc.
Tabulatur (v. lat. tabula, Tafel), eine seit dem Beginn
des vorigen Jahrhunderts veraltete Tonschrift, welche sich der
Liniensysteme und Notenköpfe nicht bediente, sondern die
Töne nur durch Buchstaben oder Zahlen bezeichnete. Da unsre
Notenschrift auf Linien nur eine abgekürzte
Buchstabentonschrift ist (der Baßschlüssel ist ein
unkenntlich gewordenes F, der Altschlüssel ein c, der
Violinschlüssel ein g), so ist es nicht verwunderlich,
daß die Buchstabentonschrift von A-G älter ist als unser
Notensystem; ihr Ursprung reicht mindestens bis ins 10. Jahrh.
zurück, wenn auch bestimmt nicht bis zu Gregor d. Gr., wie man
früher annahm (vgl. Buchstabentonschrift). Speziell für
die Orgel und für das Klavier war diese sogen. deutsche oder
Orgeltabulatur besonders im 15. und 16. Jahrh. in Deutschland
allgemein üblich; für andre Instrumente, besonders die
Laute (s. d.), hatte man in verschiedenen Ländern verschiedene
eigne Buchstaben- oder Zifferntabulaturen, welche sich aber auf die
Griffe bezogen und je nach Stimmung des Instruments verschiedene
Tonbedeutung hatten. Das Gemeinsame aller Tabulaturen ist eine
eigentümliche Bezeichnung der rhythmischen Werte der Töne
durch über die Buchstaben, resp. Zahlen gesetzte Marken,
nämlich: einen Punkt [....] für die Brevis, einen Strich
| für die Semibrevis, eine Fahne [...] (Häkchen) für
die Minima, eine Doppelfahne [...] für die Semiminima, eine
Tripelfahne für die Fusa und eine Quadrupelfahne für die
Semifusa. Dieselben Zeichen über einem Strich, [...], [...]
etc., galten als Pausen. Später (im 17. Jahrh.) entspricht
aber der Strich | unserm Viertel, [...] dem Achtel, d. h. die
moderne Schreibweise in den kurzen Notenwerten ist von den
Tabulaturen her übernommen worden. Da die Tabulaturen schon im
16. Jahrh. statt der Fähnchen bei mehreren einander folgenden
Minimen etc. die gemeinsame Querstrichelung anwandten, welche die
Mensuralnotenschrift erst zu Anfang des 18. Jahrh. bekam, z. B.
[...] und den Taktstrich durchweg gebrauchten, so sehen jene
Tabulaturen unsrer heutigen Notierung in mancher Beziehung
ähnlicher als die Mensuralnotationen, besonders wenn sie, was
auch vorkam, den Melodiepart auf ein Fünfliniensystem mittels
schwarzer Notenköpfe aufzeichneten, mit denen die rhythmischen
Wertzeichen verbunden wurden. Zahlreiche Druckwerke in
Orgeltabulatur sind auf uns gekommen (von Virdung, Agricola, Paix,
Amerbach, Bernh. Schmid, Woltz u. a.). - Über die T. der
Meistersänger s. Meistergesang.
Tabulett (lat.), Kasten aus dünnen Brettern, worin
wandernde Krämer (Tabulettkrämer, Reffkrämer) ihre
Waren herumtragen.
Tabun (russ.), die in den russischen Steppen und Feldern
weidenden Pferdeherden.
Taburett (franz. Tabouret), Polstersessel, niedriger
Stuhl ohne Arm- und Rücklehne.
Tacamahaca, s. Calophyllum.
Tacchini (spr. tackini), Pietro, Astronom, geb. 21.
März 1838 zu Modena, studierte an verschiedenen
Universitäten Italiens und ward 1859 Direktor der Sternwarte
seiner Vaterstadt. Seit 1863 an der Sternwarte in Palermo
thätig, hauptsächlich mit Beobachtung der Erscheinungen
an der Sonne beschäftigt, gründete er behufs
systematischer spektroskopischer Beobachtung der Sonne mit Secchi
1871 die Italienische Spektroskopische Gesellschaft, in deren
Memoiren er seitdem den größten Teil seiner Arbeiten
veröffentlicht hat. 1874 beobachtete er in Indien den
Venusdurchgang. Gegenwärtig ist T. Direktor des Collegio
Romano zu Rom. Vgl. "Il passaggio di Venere sul Sole dell' 8-9 dec.
1874, osservato a Muddapur" (Pal. 1875).
Tace! (lat.), schweige!
Tacet (lat., auch ital. tace oder taci, abgekürzt
tac., "schweigt") bedeutet in Chor- oder Orchesterstimmen,
daß das Instrument (die Stimme) während der betreffenden
Nummer nicht mitzuwirken hat.
Tachau, Stadt im westlichen Böhmen, an der Mies,
Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines Bezirksgerichts, mit
Dechanteikirche, Franziskanerkloster, Schloß des Fürsten
Windischgrätz, einem Kaiser Joseph-Denkmal, einer Fachschule
für Drechslerei, lebhafter Holzindustrie, Knopffabrikation,
Bierbrauerei und (1880) 4177 Einw. In der Nähe mehrere
Glashütten. Vgl. Stocklöw, Geschichte der Stadt T.
(Tachau 1879).
Tacheometer (Tachymeter), s. Theodolit.
Tachina, Mordfliege; Tachinariae, s. v. w.
Mordfliegen.
Tachira, Sektion des Staats Andes der venezuelan.
Bundesrepublik, an der Grenze von Kolumbien, ist meist gebirgig
(bis 3208 m hoch) und 12,545 qkm (227,8 QM.) groß mit (1873)
68,619 Einw. Landbau bildet die Haupterwerbsquelle, Petroleum ist
gefunden worden. Hauptstadt ist San Christóbal.
Tachograph (griech., "Schnellschreiber"), ein dem
Hektograph ähnlicher Apparat zur leichten Herstellung vieler
Abzüge einer Schrift oder Zeichnung.
Tachometer (griech., Tachymeter,
"Geschwindigkeitsmesser"), mechan. Vorrichtungen zum Messen der
Geschwindigkeit von Maschinen in jedem Augenblick ihrer Bewegung.
Bei allen bisher konstruierten Tachometern wird die
Zentrifugalkraft der sich bewegenden Maschine als treibendes
Element benutzt. Uhlhorn in Grevenbroich bei Düsseldorf hat um
1817 derartige T., namentlich für Baumwollspinnereien, zuerst
konstruiert. Gegen 1844 trat Daniel mit einem T. zum Gebrauch bei
Lokomotiven hervor, bei welchem ein Zentrifugalpendel auf Gewichte
und Federn wirkt und ein Uhrwerk zur Registrierung des Ganges der
Lokomotive mittels Zeichenstifts auf Pappscheiben in
487
Tachopyrion - Tacitus.
Bewegung setzt. Vervollkommt wurde dieses T. durch Dato (s.
Stathmograph). Donkin in England hat das Ausfließen von
Quecksilber zum Messen der Geschwindigkeit benutzt. Dieses
Konstruktionsprinzip ist durch Schäfer und Buddenberg in
Magdeburg für die Praxis weiter entwickelt worden.
Hydrotachometer (Hydrometer) sind Instrumente zur Bestimmung der
Geschwindigkeit fließenden Wassers, also s. v. w. Strommesser
(s. Fluß, S. 410). Vgl. Schell, Die Tachymetrie (Wien
1880).
Tachopyrion (griech.), s. Feuerzeuge.
Tachygraphie (griech.), s. Stenographie.
Tachyhydrit (fälschlich Tachhydrit), Mineral aus der
Ordnung der Doppelchloride, kristallisiert rhomboedrisch, ist
wachs- bis honiggelb, durchsichtig bis durchscheinend,
zerfließt sehr schnell an der Luft (daher der Name) und
besteht aus Chlorcalcium, Chlormagnesium und Wasser
CaCl2+2MgCl2+12H2O. Es findet sich in rundlichen Massen im dichten
Anhydrit der Abraumsalze von Staßfurt.
Tachylyt, Gestein, s. Basalte, S. 414.
Tachymeter, s. v. w. Tachometer; auch ein Distanzmesser
und ein Theodolit besonderer Konstruktion.
Tachypetes, Fregattenvogel.
Tacitus, Marcus Claudius, röm. Kaiser, geb. 200 n.
Chr., leitete sein Geschlecht vom Historiker T. ab und befahl,
dessen Werke in allen Bibliotheken aufzustellen und zehnmal
jährlich auf Staatskosten abzuschreiben. Er ward nach Kaiser
Aurelians Tod und nach einem sechsmonatlichen Interregnum 25. Sept.
275 gegen seinen Willen vom Senat, dem das Heer die Wahl
freigestellt hatte, zum Kaiser erhoben. Er entsprach durch Milde
und Weisheit vollkommen dem Vertrauen, welches ihn auf den Thron
gehoben hatte, führte auch, als 75jähriger Greis, einen
glücklichen Krieg gegen die Alanen, ward aber schon nach sechs
Monaten (April 276) zu Tyana in Kleinasien von den zügellosen
Soldaten erschlagen. Ihm folgte sein Bruder Florianus T., der nach
drei Monaten dasselbe Schicksal hatte.
Tacitus, (Publius?) Cornelius, berühmter röm.
Geschichtschreiber, geboren um 54 n. Chr., war zuerst mit
Auszeichnung als Sachwalter und Redner in Rom thätig, wurde,
wahrscheinlich 79, Quästor, dann, wahrscheinlich 81,
Volkstribun oder Ädil, 88 Prätor, brachte hierauf vier
Jahre, 90-94, vielleicht als Statthalter einer Provinz,
außerhalb der Hauptstadt zu und bekleidete 97 das Konsulat.
In öffentlicher Thätigkeit erscheint er uns zuletzt 100,
wo er mit dem jüngern Plinius, seinem Freund, in einem
bedeutenden Prozeß als Ankläger auftrat. Er starb nach
117. Seine frühste Schrift ist der "Dialogus de oratoribus",
welcher von den Ursachen des Verfalls der Beredsamkeit seit der
Kaiserzeit handelt, eine geistvolle, leider lückenhaft auf uns
gekommene Schrift, wahrscheinlich um 80 verfaßt, die man T.
wegen mancher sprachlicher und stilistischer Verschiedenheiten von
den spätern Schriften mit Unrecht abgesprochen hat. Hierauf
folgten 98 zwei andre kleinere Schriften. "De vita et moribus
Agricolae" und die sogen. "Germania" (eigentlicher Titel: "De
origine, situ, moribus ac populis Germanorum"), ersteres die
Lebensbeschreibung seines Schwiegervaters, letzteres die bekannte,
für uns Deutsche ungemein wertvolle, mit
bewunderungswürdigem Sinn für die Eigentümlichkeiten
eines Naturvolkes abgefaßte Schilderung des damaligen
Deutschland. Des T. beide Hauptwerke aber sind die "Historiae" und
die sogen. "Annales" (eigentlicher Titel: "Ab excessu divi
Augusti"), erstere in 14 Büchern die Geschichte seiner Zeit
von 69 bis 96 n. Chr., letztere, welche später als die
Historien verfaßt und zwischen 115 und 117 herausgegeben
sind, in 16 Büchern die Geschichte des Julisch-Claudischen
Hauses von Augustus' Tode (daher der Titel) von 14 bis 69
enthaltend, so daß beide zusammen ursprünglich die
vollständige Kaisergeschichte von Tiberius bis zum Tode
Domitians umfaßten; von beiden sind nur Teile erhalten, von
den Historien die vier ersten Bücher und ein Teil des
fünften, nicht volle zwei Jahre, 69-70, umfassend, von den
Annalen die sechs ersten (mit einer Lücke zwischen dem
fünften und sechsten Buch), Tiberius' Zeit (14-37), und die
sechs letzten (zu Anfang und zu Ende unvollständigen)
Bücher, Claudius' Regierung und Neros Geschichte 47-68. In
beiden Werken herrscht die annalistische Anordnung des Stoffes
durchaus vor. Sie beruhen auf eingehenden und umfänglichen
Quellenstudien und sorgfältiger Kritik, wenn sie auch
hinsichtlich selbständiger Forschung und genauer Kenntnis
aller Verhältnisse, besonders des Militärischen und der
Örtlichkeiten, nicht an einen Thukydides und Polybios
heranreichen. Stets bemüht, das Thatsächliche zu
ermitteln und vornehmlich die innern Gründe der Ereignisse aus
den Verhältnissen und den handelnden Persönlichkeiten zu
erklären, zeigt T. sich als Meister in der Charakterzeichnung
und der psychologischen Analyse. Seinem Versprechen, ohne
Parteilichkeit (sine ira et studio) zu schreiben, getreu, strebt er
durchaus nach einer objektiven Darstellung, und wenn man auch
vielfach seine subjektive Ansicht durchfühlt, so darf ihm doch
nie absichtliche Färbung und Entstellung vorgeworfen werden,
wie es in neuerer Zeit mehrfach, namentlich in Bezug auf die
Schilderung des Tiberius, geschehen ist (so von Sievers, "Studien
zur Geschichte der römischen Kaiser", Berl. 1870; Stahr,
"Tiberius", 2. Aufl., das. 1873, u. in der Übersetzung der
ersten sechs Bücher der "Annalen", das. 1871; Freytag,
"Tiberius und T.", das. 1870). Voll von Bewunderung für die
ehemalige Tugend u. Größe Roms, ist er im Herzen
Republikaner, aber ebenso überzeugt, daß das
gegenwärtige Rom wegen des Sittenverfalls, den er aufs
schmerzlichste empfindet, die Republik nicht ertrage; daher der
entsagungsvolle und schwermütige, hier und da sogar bittere
Ton, der sich, auch ohne durch Worte ausgedrückt zu werden,
überall in seinen Schriften kundgibt. Im Gegensatz zu der
heitern Anmut und Fülle seiner Erstlingsschrift wird sein Stil
im Fortschreiten seiner schriftstellerischen Thätigkeit immer
ernster und pathetischer und zeigt eine sich steigernde Neigung zur
rhetorischen Färbung und Annäherung an den poetischen
Ausdruck; dazu kommt das Streben nach Kürze des Ausdrucks bis
zur epigrammatischen Zuspitzung, das sich am eigentümlichsten
und großartigsten in den "Annalen" zeigt. Die erste, aber
noch unvollständige Ausgabe erschien Venedig 1470. Die erste,
durch Hinzufügung der sechs ersten Bücher der "Annalen"
vervollständigte Gesamtausgabe ist die von Beroaldus (Rom
1515). Unter den spätern sind hervorzuheben die von Bekker
(Leipz. 1831, 2 Bde.), Ritter (Bonn 1834-1836, 2 Bde.; Cambridge
1848, 4 Bde.), Orelli (Zürich 1846-48, 2 Bde.; neubearbeitet,
Berl. 1877 ff.); Textausgaben von Haase (Lpz. 1855), Halm (4.
Aufl., das. 1883) und Nipperdey (Berl. 1871-76, 4 Bde.). Auch gibt
es eine große Anzahl von guten Ausgaben einzelner Schriften
des T., so der Annalen von Nipperdey und Andresen (8. u. 4. Aufl.,
Berl. 1884 u. 1880, 2 Bde.), der Historien von Heräus (4.
Aufl., Leipz. 1885,2Bde.) und Wolff (Berl. 1886 ff.); des
"Dialogus" von Michaelis (Leipz. 1868), von Andresen (das. 1872 und
in
488
Tacna - Tadschurrabai
der neuen Auflage der Orellischen Gesamtausgabe, Berl. 1877 ff.)
und von Peter (Jena 1877) ; des "Agricola" von Walch (Berl. 1828),
Wex (Braunschw. 1852), Kritz (3. Aufl., Berl. l874), Urlichs
(Würzb. 1875) und Peter (Jena 1876); der "Germania" von Haupt
(3. Aufl., Berl. 1869), Kritz (3. Aufl., das. 1869),
Schweizer-Sidler (2. Aufl., Halle 1874), Holder (Leipz. 1878),
Baumstark (das. 1875-80, 2 Bde.). Unter den deutschen
Übersetzungen sind die von Gutmann (4. Aufl., Stuttg. 1869, 5
Bde.) und Roth (4. Aufl., Berl. 1888) hervorzuheben. Als
Hilfsmittel für die Einsicht in den Sprachgebrauch des T.
dient das "Lexicon Taciteum" von Bötticher (Berl. 1830); ein
neues, weit vollständigeres ist begonnen von Gerber und Greef
(Leipz. 1877 ff.). Vgl. Hoffmeister, Die Weltanschauung des T.
(Essen 1831); Dräger, Über Syntax und Stil des T. (3.
Aufl., Leipz. 1882); Dubois-Guchan, Tacite et son siècle
(Par. 1862, 2 Bde.); Urlichs, De Taciti vita et honoribus
(Würzb. 1879).
Tacna, ehemaliges Departement der südamerikan.
Republik Peru, am Stillen Ozean, vom Rio Zama bis zum Rio Camarones
und im Innern bis jenseit der westlichen Kordilleren reichend,
wurde 1884 an Chile (s. d., S. 1022) abgetreten. Die Küste
steigt steil an. Das Innere besteht aus stufenweise zu den
Kordilleren ansteigenden, meist wüsten Hochebenen. Die wenigen
Flüsse nehmen ihren Lauf durch tiefe Schluchten (Quebradas).
Der Tacorapaß (4170 m, s. d.) verbindet T. mit Bolivia.
Fruchtbare Stellen kommen fast nur im nördlichen Teil des
Departements vor. T. hat ein Areal von 22,500 qkm (408,62 QM.) und
(1885) 29,523 Einw. Die Ausfuhr besteht vorwiegend aus Kupfer,
Zinn, Silber, Gold, Koka, Alpako- und Schafwolle. Hauptstadt ist
San Pedro de T., 560 m ü. M., in hübscher Ebene, am
gleichnamigen Fluß, mit (1876) 7738 Einw. T. ist Sitz eines
deutschen Konsuls. Die Stadt wurde 1605 gegründet, hat ein
Colegio, ein Hospital, ein kleines Theater und eine schöne
Alameda. Eine Eisenbahn verbindet sie mit Arica (s. d.).
Tacoary, Fluß, s. Taquary.
Tacoma, Berg im nordamerikan. Staat Washington, 4400 m
hoch, ein fast erloschener Vulkan mit Gletschern; hieß
früher Mount Rainier.
Tacoma, Stadt im nordamerikan. Staat Washington, am
Pugetsund, Endstation einer Pacificbahn, mit großem
Hotel.
Tacorapaß (auch Gualillos), ein fahrbarer Paß
der Kordilleren in 17°50' südl. Br., verbindet Tacna mit
Bolivia und ist 4170 m hoch. Nördlich von ihm erhebt sich der
Tacora Pik oder Chipicani (6017 m), ein ausgebrannter Vulkan mit
einer Solfatare in seinem zusammengestürzten Krater; an
demselben liegt das Dorf Tacora, eine der höchsten
Wohnstätten der Erde (4000 m).
Tacnarembo, ein Departement des füdamerikan. Staats
Uruguay, ein Hügelland, 21,022 qkm (381,8 QM.) groß mit
(1885) 27,329 Einw., die fast nur Viehzucht treiben (1,034,000
Rinder, 65,000 Pferde, 476,000 Schafe). Gold ist 1859 im Cunapires
entdeckt worden. Hauptstadt ist San Fructuoso mit 3000 Einw.
Tacubaya, Villa, 5 km südwestlich von Mexiko, bei
Chapultepec, mit dem Sommerpalast des Erzbischofs von Mexiko, den
Villen reicher Mexikaner, der Militärakademie (Colegio) und
(1880) 7867 Einw.
Tacullies, f. Carrierindianer.
Tacunga (Llactacunga), Hauptstadt der Provinz Leon in der
südamerikan. Republik Ecuador, am Fuß des Cotopaxi 2780
m ü. M. gelegen, hat ein Colegio, eine Pulverfabrik und 17,000
Einw.
Taeda Koch. Gruppe der Gattung Pinus. s. Kiefer, S.
714.
Tadcaster, alte Stadt in Yorkshire (England), am
schiffbaren Wharfe, zwischen Leeds und York, mit (1881) 2965 Einw.
Es ist das römische Calcaria. Dabei das Schlachtfeld von
Towton (1461), wo Eduard von York das Lancastrische Heer
besiegte.
Tadel, als Äußerung des ästhetischen oder
sittlichen Mißfallens (wie Lob des Gefallens) durch Rede oder
Handlung, unterscheidet sich von diesem selbst dadurch, daß
er unterdrückt werden kann und unter Umständen soll,
während das Mißfallen (und Gefallen) als
unwillkürliches Geschmacks- oder Gewissensurteil sich nicht
hemmen läßt.
Tadema, Maler, s. Alma-Tadema.
Taedium vitae (lat.), Lebensüberdruß.
Tadjainseln, s. Togianinseln.
Tadmor, Stadt, s. Palmyra.
Tadolini, 1) Adamo, ital. Bildhauer, geb. 1789 zu
Bologna, bildete sich auf der Kunstschule daselbst, dann in Ferrara
und Rom und erhielt 1811 eine Professur in Bologna. Von seinen
Werken sind zu nennen: Venus und Amor; Ganymed, der den Adler
tränkt; die Bacchantin, für das Museum Borghese, der Raub
Ganymeds; das Grabmal des Kardinals Lante, für die Stadt
Bologna, und eine große Anzahl Büsten. Zu seinen
kirchlichen Hauptwerken gehört die Statue des heil. Franz von
Sales in der Peterskirche zu Rom. Er arbeitete in der Richtung
Canovas. T. starb 23. Febr. 1868 in Rom.
2) Eugenia, ital. Bühnensängerin, Gattin des
Komponisten Giovanni T. (geb. 1793 zu Bologna, gest. 1872
daselbst), geb. 1810 zu Florenz, trat zuerst daselbst, dann in
Venedig und endlich an der Italienischen Oper in Paris auf. Nach
der Scheidung von ihrem Gatten (1834) kehrte sie nach Italien
zurück, wo sie sich auf allen ersten Bühnen bis 1850 der
größten Beliebtheit zu erfreuen hatte, namentlich in den
von Mercadante ("Schwur") und Donizetti ("Lucia", "Don Pasquale",
"Regimentstochter", "Linda") für sie geschriebenen Opern. Auch
in Wien feierte sie die größten Triumphe.
Tadorna, s. Enten, S. 671.
Tadousac (spr. tadusak), Dorf in der brit.-amerikan.
Provinz Quebec, an der Mündung des Saguenay in den St.
Lorenzstrom, der erste Ort, an welchem die Franzosen in Amerika ein
steinernes Haus bauten, jetzt als Badeort vielbesucht.
Tadsch (Tadschmahal), ein Mausoleum, s. Agra.
Tadschik (auch Dihkan, "Landleute", und Dihvar,
"Dorfbewohner", od. Parsevan, "Perser", genannt), die
ansässige, Ackerbau treibende Bevölkerung Irans, welche
zur iranischen Völkerfamilie gehört und durchgehends die
persische Sprache spricht. Sie finden sich in Ostiran
(Afghanistan), in Kabul und Herat, in Balch, Chiwa, Bochara sowie
in Badachschan bis gegen die Hochebene Pamir und in Kaschgarien
unter dem angeführten Namen, während sie im westlichen
Iran (Persien) unter dem speziellen Namen der Perser (Farsi)
bekannt sind. Als Handel treibendes Volk trifft man sie auch
vielfach außer Landes, östlich bis nach China und
westlich bis Orenburg und Kasan. Die östlichen T.
unterscheiden sich von den Persern durch manche körperliche
Eigenschaften und bewahren auch verschiedene altertümliche
Sitten und Gebräuche. Vgl. Afghanistan, S. 143, Persien, S.
866, etc.
Tadschurrabai, tief eindringende Meeresbucht in
Nordostafrika, an der Danakilküste, westlich von Bab
Ta-dse - Taft. 4^9 el Mandeb, deren Einfahrt im N. Ras Bir, im
S. Ras Dschebuti markiert. In derselben liegen die früher
England, jetzt Frankreich gehörigen Muscha-inseln; an der
Nordseite die Ortschaften Obok (s. d.), Tadschurra, Ambado,
Sagallo. Ta-dse, Volk, s. Orotschen. Tael (spr. tehl, chines.
Liang), Gewicht und Rech-nungsgeld, in China a 10 Mace a 10
Candarin a 10 Käsch; in Schanghai 1 T. = 34,246 g fein Silber,
=6,164 Mk., etwa 2,75 Proz. mehr alsderRegierungs-(Haikuan-) T.
für Zölle und Tonnengelder. Im aus-wärtigen Handel
rechnet man 72 T. = 100 mexikan. Dollar; mithin ist 1 T. = 33,^87 g
fein Silber = 6 Mk. 1 Kanton- T. als Gold- und Silbergewicht =
37,573 g; 16 Taels = 1 Kin oder Kätty; als Han-delsgewicht =
37,79.^ g. Tafalla, Bezirksstadt in der span. Provinz Navarra, an
der Eisenbahn Alsasua-Saragossa, mit altem Schloß und (1878)
6040 Einw. Tafelauffa.^, ein zum Schmuck der Tafel dienendes
Schaustück, zumeist aus Edelmetall (Silber und ver- goldetem
Silber), in neuerer Zeit auch aus Bronze. Der T. hat
gewöhnlich die Gestalt einer flachen, von einem hohen
Fuß getragenen Schale, aus welcher ein kelchförmiger
Aufsatz zur Aufnahme von Blumen emporsteigt. Dieser Grundform
^entspricht der be-rühmte T. von Iamnitzer (s. Tafel
"Goldschmiede-kunst", Fig. 3). Doch wurden in der gotischen und
Renaissan^zeit auch Tafelaufsätze in der Gestalt von
phantastischen oder tropischen Tieren (Elefanten, Straußen
etc.), von Schiffen (das "glückhafte Schiff"), Brunnen,
Festungen etc. angefertigt. Die neuere Gold-schmiedekunst hat die
Tafelaufsätze durch Anordnung von Schalen neben- und
übereinander, durch Verbin-dung von Kristall mit Edelmetall
noch reicher gestaltet. Tafelbai, große Bai an der
Südwestküste des Kap- landes, offen und daher trotz
vielfacher Verbefserun- gen nicht sicher. An derselben liegt die
Kapstadt und hinter dieser der Tafelberg (1072 m), welcher oben
eine 2 km breite vollständige Ebene hat. Tafelbauaue, s.
Heliconia. Tafelberg, s. Tafelbai. Tafelbild, ein auf einer
Holztafel gemaltes Bild; dann im Gegensatz zur Wandmalerei jedes
beweg-liche, also auch auf Leinwand gemalte Bild; danach
Tafelmalerei, die Malerei auf Holzplatten. Tafelbouillou, s.
Bouillontafeln. Tafeldru.k, Zeugdruck mit Applikations- (Tafel-)
Farben, s. Zeugdruckerei. Tafelfichte, die höchste Spi.tze des
Isergebirges (s. d.), 1123 m hoch. Tafelgefchäft (auch
Handverkauf genannt), im Bankgeschäft der Verkauf von Effekten
an die Stamm-kunden der Bank. Tafelgüter (Bona mensalia), zum
Unterhalt des landesherrlichen Hofs, besonders in den ehemaligen
geistlichen Staaten, bestimmte Güter. Sie hießen, wenn
in Lehngütern bestehend, Tafellehen. Vgl. Domäne.
Tafella^, s. Schellack. Tafelland, Hochebene größerer
Ausdehnung; be- sonders eine Hochebene, welche sich nur einseitig
an ein Gebirge anschließt und, aus ungefähr
horizonta-len Schichtsystemen zusammengesetzt, gewöhnlich in
mehreren Stufen gegen das Tiefland abfällt. P la-teau
würde in dieser Ausscheidung des engern Be-griffs als Synonym
von T. aufzufaffen sein. Die Plateaus der Kalkalpen, des Karstes,
die von Süd-afrika u. a. sind Beispiele solcher
Tafelländer. Tafelruude, in der Sage der Kreis von Helden, die
zu des britischen Königs Artus Hofhaltung gehör- ten und
von ihm um eine runde Tafel, um die Gleich-heit der an ihr
Sitzenden zu bezeichnen, an seinen Hoffesten versammelt wurden.
Weiteres s. Artus. Tafelfchiefer, s. Thonschiefer. Tafelspat, s. v.
w. Wollastonit. Tafelstein, s. Edelsteine, S. 314. Täfelwerk^
(Täfelung, Intabulation), Beklei- dung der Wände und
Decken in Zimmern und Sä-len mit gefalzten oder genuteten
Brettern, befser mit Rahmhölzern und Füllungen, welche
beim Schwin- den des Holzes keine Spalten zeigen. Hartes, z. B.
Eichenholz, ist, weil es weniger leicht stockt oder fault, weichem,
z. B. Tannen- oder Kiefernholz, vorzu^ie-hen und bei Anwendung des
letztern das T. in einem Abstand von 15-25 mm von der
Wandfläche anzu- bringen. Bei einfachern Gebäuden wird
das T. mit gekehlten Rahmhölzern, bei Prachtbauten mit
Schnitz-werk versehen. Die Firnisse oder Ölanstriche, welche
man demselben zur Verbesserung seines äußern An-sehens
meist in Naturfarbe gibt, tragen zugleich zum Schutz des Holzes
gegen Feuchtigkeit bei. Die Holz- bekleidung ganzer Wände,
welche un Mittelalter nicht selten und oft sehr kunstvoll
ausgeführt war, wovon unter anderm Nürnberg und die^
Feste Koburg treff-liche Beispiele geben, wird in der Gegenwart
meist auf die untern Teile derselben (Brüstungen, Lam- bris)
beschränkt und das T. hierbei mit Fuß- und Deckleiste
versehen. Vgl. Fink, Der Bautischler (Leipz. 1867-69, 2 Bde.).
Tasseh, türk. Gewicht für Seide, = 1,954 kg. Taffia, f.
v. w. Rum. Tafilet (Tafilelt), große Oase in Marokko, im S.
des Atlas, unter 31° nördl. Br. und 3° 30^ westl. L.
v. Gr., die südlichste einer vom Wadi Sis durchzogen nen Reihe
von Oasen, wird von diesem wie von meh-reren andern Wadis
bewässert, welche aber nur im Frühjahr Wasser führen
und dann im südlichsten Teil der Oase dieSebchaDaya elDura
bilden. Berg- züge, darunter der Dschebel Belgrüll im
NW., um- schließen fast ringsum den 1000 qkm messenden Raum,
welcher wegen der mangelhaften Bewässerung nur für
Dattelpalmen geeignet ist; die Datteln von T. sind aber auch als
die vorzüglichsten der Wüste bekannt, nur selten ist der
Anbau von Weizen, Gerste, Klee möglich. Datteln sind der
bedeutendste Aus-fuhrartikel, daneben gegerbte Felle,
Straußfedern, Sklaven und Goldstaub. Fast alle
europäischen Wa-ren werden in den Bazaren verkauft. Die ca.
100,000 Einw., teils Araber, teils Berber, wohnen in 150
Dörfern oder Ksurs, unter welchen Er Rissani, Sitz des
Gouverneurs, das größere, Abuam aber durch Industrie und
Handel viel bedeutenderist. DieBewoh-ner der einzelnen Ksurs leben
in beständigem Kampf miteinander. Nahe bei Abuam die Ruinen
des im Mittelalter berühmten Sedjelmafsa. Vgl. Rohlfs, Reise
durch Marokko (Brem. l 869). Tafna, Küstenfluß in der
alger. Provinz Oran, bekannt durch die Kämpfe zwischen
Franzosen und Kabylen 26. -28. Ian. 1836. An der T. schlossen di^
Franzosen 30. Mai 1837 Frieden mit Abd el Kader. Taft, großes
Dorf in der persischen Provinz Ira.^ Adschmi, südwestlich
unweit Iezd, mit 5000 Einw , einer der Hauptwohnsitze von
Feueranbetern, besitzt einen hübschen Bazar, ein kleines Fort
und viele schöne Gärten und ist berühmt wegen der
Fabrikation einer vorzüglichen Filzsorte. Taft (Taffet),
lein1vandartig gewebter Stoff aus entschälter Seide mit
Organsinkette und Einschlag von Tramseide, meist schwarz, aber von
verschiedener
490
Taftpapier - Taganrog.
Dichtigkeit. Hiernach unterscheidet man ganz leichten Futtertaft
(Avignon, Florence), etwas schwerern Kleidertaft, Doppeltaft
(Marcelline) und Gros (mit vielen Beinamen, wie de Naples, de
Tours, d'Orleans etc.), welcher auf der Oberfläche eine Art
regelmäßiger Körnung zeigt oder, wenn starke mit
schwachen Fäden wechseln, gerippt erscheint.
Taftpapier, einseitig gefärbtes und mit Glanz
versehenes Papier.
Tag (lat. Diës), entweder die Dauer eines
scheinbaren Umlaufs des Fixsternhimmels oder der Sonne um die Erde,
oder im gewöhnlichen Sinn: die Zeit des Verweilens der Sonne
über dem Horizont, im Gegensatz zur Nacht, während
welcher sie sich unter dem Horizont befindet. Bestimmter nennt man
Sterntag die Dauer eines scheinbaren Umlaufs des Fixsternhimmels
oder einer Rotation der Erde um ihre Achse. Die Dauer des Sterntags
ist so gut wie unveränderlich, wenn auch gewisse
Unregelmäßigkeiten der Mondbewegung eine geringe
Veränderung andeuten, während zugleich in der Wirkung der
Flutwelle (wie schon Kant bemerkt hat) und in den durch
allmähliche Erkaltung der Erde, durch Einstürze u. dgl.
in ihrem Innern bedingten Massenumsetzungen Ursachen für eine
Veränderung gegeben sind. Der Sterntag beginnt im Augenblick
der obern Kulmination des Frühlingspunktes. Er wird in 24
gleich lange Stunden zu 60 Minuten zu 60 Sekunden geteilt;
Zeitangaben in diesem Maß nennt man Sternzeit. Obwohl uns nun
die Natur in der Rotation der Erde um ihre Achfe das
gleichförmigste Zeitmaß darbietet, so ist doch der Auf-
und Untergang der Sonne von so überwiegender Wichtigkeit
für das bürgerliche Leben, daß man in diesem nicht
nach Sterntagen, sondern nach Sonnentagen rechnet. Wahrer Sonnentag
ist die Zeit zwischen zwei aufeinander folgenden mittägigen
Kulminationen der Sonne. Da aber dieser Zeitraum infolge der
Ungleichförmigkeit der Bewegung der Sonne am Fixsternhimmel im
Lauf des Jahrs nicht unbeträchtlichen Veränderungen
seiner Dauer unterliegt (vgl. Sonnenzeit), so benutzt man den
jährlichen Mittelwert desselben unter dem Namen mittler T.
(bürgerlicher T.). Derselbe beträgt 24 Stunden 3 Min.
56,6 Sek. Sternzeit und wird ebenfalls in 24 gleiche Stunden zu 60
Minuten zu 60 Sekunden eingeteilt. Die in diesem Maß
ausge-drückte Zeit heißt mittlere Zeit; sie wird von
unsern mechanischen Uhren angegeben und sowohl im bürgerlichen
Leben als auch in der Wissenschaft angewandt. Die christlichen
Völker beginnen den T. mit Mitternacht und zählen
während desselben ziemlich allgemein zweimal 12 Stunden. Die
Astronomen aber fangen den T. erst mit dem Mittag an und
zählen die Stunden bis 24. Es bedeutet also die astronomische
Angabe "Juli 23, 19h 12m" so viel wie "7 Uhr 12 Min. vormittags am
24. Juli" (h=hora, Uhr; m=Minuten). Man bezeichnet den Zeitraum von
24 Stunden auch als künstlichen T., im Gegensatz zum
natürlichen T., worunter man die Zeit des Verweilens der Sonne
über dem Horizont versteht. Am Äquator beträgt der
letztere jahraus jahrein 12 Stunden; an andern Punkten der Erde ist
dies nur im Frühlings- und im Herbstanfang, wenn die Sonne im
Äquator steht, der Fall. Sobald die Sonne sich nördlich
über den Äquator erhebt, werden auf der nördlichen
Hemisphäre der Erde die Tage immer länger, und für
die Orte zwischen Äquator und Polarkreis (66 1/2° Br.)
erreicht der T. seine größte Dauer, wenn die Sonne im
Wendekreis des Krebses steht (Sommersolstitium). Von da nimmt die
Tageslänge wieder ab, erreicht den Wert von 12 Stunden im
Herbstanfang und den kleinsten Wert (24 Stunden weniger des
längsten Tags), wenn die Sonne im Wendekreis des Steinbocks
steht (Wintersolstitium). worauf er wieder wächst. Für
die südliche Erdhalbkugel dagegen tritt der längste T.
ein, wenn die Sonne im Wendekreis des Steinbocks, der
kürzeste, wenn sie im Wendekreis des Krebses steht. Die
Größe t des halben Tagbogens für den längsten
T. in der Breite f erhält man aus der Formel cos t=-tan f.tan
23 1/2; je 15 Bogengrade entsprechen einer Stunde. Es ergeben sich
auf diese Weise folgende Werte:
Breite f Tagbogen 2t Längster Tag
0° 180° 0,0' 12 Stunden 0 Minuten
5° 184° 21,0' 12 Stunden 18 Minuten
10° 188° 50,5' 12 Stunden 35 Minuten
15° 193° 21,2' 12 Stunden 53 Minuten
20° 198° 10,3' 13 Stunden 13 Minuten
23 1/2° 201° 42,1' 13 Stunden 27 Minuten
25° 203° 20,8' 13 Stunden 33 Minuten
30° 209° 0,7' 13 Stunden 56 Minuten
35° 2l5° 22,5' 14 Stunden 21 Minuten
40° 222° 42,0' 14 Stunden 51 Minuten
45° 231° 25,7' 15 Stunden 26 Minuten
50° 242° 16,3' 16 Stunden 9 Minuten
55° 256° 34,8' 17 Stunden 6 Minuten
60° 277° 26,7' 18 Stunden 30 Minuten
65° 317° 0,8' 21 Stunden 8 Minuten
66 1/2° 360° 0,0' 24 Stunden 0 Minuten
Für den Polarkreis beträgt der längste T. 24
Stunden; für die dem Pol noch näher liegenden Orte aber
geht schon vor der Sommersonnenwende die Sonne nicht mehr unter, es
ist dann immerwährender T., dessen Dauer mit der
Annäherung an den Pol zunimmt und für diesen selbst ein
halbes Iahr beträgt. Dem immerwährenden T. entspricht ein
halbes Jahr später die gleich lange immerwährende Nacht.
Der immerwährende T. währt so lange, als die Poldistanz
(90° weniger der Deklination) der Sonne kleiner ist als die
geographische Breite; seine Dauer ist
1 Monat in 67° 23' Breite 4 Monate in 78° 11' Breite
2 Monate in 69° 51' Breite 5 Monate in 84° 5' Breite
3 Monate in 73° 40' Breite 6 Monate in 90° 0' Breite
Bei verschiedenen orientalischen Völkern, auch den
Israeliten, ferner bei Griechen und Römern wurde im Altertum
der natürliche T. und ebenso die Nacht in 12 gleich lange
Stunden geteilt, deren Dauer in den verschiedenen Jahreszeiten
verschieden war (horae temporales bei den Römern, während
die immer gleich langen horae aequinoctiales hießen). Vgl.
Bilfinger, Der bürgerliche T. (Stuttg. 1888). - T. heißt
auch eine im voraus bestimmte Versammlung, z. B. Landtag,
Reichstag, Fürstentag etc.
Tag, der bergmännische Ausdruck für
Erdoberfläche, im Gegensatz zu den unterirdischen
Grubenräumen, daher die Ausdrücke "über" und
"unterTage".
Tagal, Stadt, s. Tegal.
Tagala (Tekela), Berglandschaft im südlichen
Kordofan, vom Sirga durchflossen.
Tagálen, Volk, s. Philippinen, S. 1004.
Taganai, ein Berg des südlichen Urals, im russ.
Gouvernement Ufa, Kreis Slatoust, 1203 m hoch, berühmt durch
seine Aventurine.
Taganrog, Hafenstadt im russ. Gouvernement
Jekaterinoslaw, am nordöstlichen Ufer des Asowschen Meers, auf
einer Landzunge, 30 km westlich von der Mündung des Don, an
der Eisenbahn Charkow-Rostow gelegen, hat 11 Kirchen (darunter 10
griechisch-russische), eine Synagoge, ein griechisches Kloster
(Jerusalemkloster), ein kleines kaiserliches Palais, in welchem
Alexander I. 1825 starb, ein Denkmal des
491
Tagblindheit - Tagewählerei.
genannten Kaisers (1831 errichtet), 2 Gymnasien (eins für
Knaben und eins für Mädchen), ein Theater, eine
Börse und (1885) 56,047 Einw. (sehr viele Griechen und Juden,
aber auch Armenier, Italiener und Deutsche). T. ist einer der
wichtigsten Handelsplatze Südrußlands. Die weite Reede
ist flach und durch Sandbänke gefährlich. Die Ausfuhr
betrug 1887: 14 Mill., die Einfuhr 2 Mill. Rubel. Ausfuhrartikel
sind hauptsächlich: Weizen, Butter, Leinsaat und Talg;
Gegenstände der Einfuhr: Früchte, Wein, Öl und
Metallfabrikate. Die Gewerbthätigkeit ist gering. Im Hafen
liefen 1887: 868 Schiffe mit 483,152 Ton. ein, außerdem im
Küstenverkehr 1465 Fahrzeuge mit 282,800 Ton. Die
Militär- und Zivilverwaltung liegt in den Händen eines
Stadtpräfekten. T. war ursprünglich eine Festung, die
1698 von Peter I. angelegt und nach ihrer Schleifung infolge des
Friedens am Pruth (1711) von Katharina II. 1769 wiederhergestellt
ward. Es wurde 22. Mai 1855 von einer englisch-französischen
Flotte bombardiert und teilweise zerstört.
Tagblindheit (Nachtsehen, Nyktalopie, Coecitas diurna),
Mangel des Gesichts, der darin besteht, daß die Kranken bei
Tag und besonders gegen Mittag schwachsichtig oder blind sind, mag
sie nun Licht oder Dämmerung umgeben, während sie des
Nachts, vorzüglich gegen Mitternacht, bei Kerzen- oder bei
Mondlicht am besten sehen. Die Krankheit befällt fast immer
beide Augen zu gleicher Zeit. Die wahre T. ist eine rein
periodische Krankheit und hängt nicht von dem Grade des Lichts
ab wie die symptomatische T. Beide beruhen auf einem
Reizungszustand der Retina, in welchem dieselbe helles Licht nicht
verträgt. Als Ursachen der T. werden genannt verschiedene
Krankheiten des Auges und des Körpers überhaupt, ferner
Entwöhnung vom Licht, erbliche Anlage und endemische
Einflüsse. Die Prognose hängt von den Ursachen ab. Die
als reines Lokalleiden der Netzhaut auftretende T. pflegt in 2-3
Monaten zu verschwinden, macht aber bisweilen, selbst zu bestimmten
Jahreszeiten, Rückfälle. Die durch Entwöhnung vom
Licht entstandene T. geht bei falscher Behandlung des Auges leicht
in vollkommene Blindheit über. Außer der Beseitigung der
Ursachen hat die ärztliche Behandlung namentlich darauf zu
sehen, daß der Kranke seine Augen längere Zeit hindurch
vollkommen ruhen lasse und sie erst ganz allmählich dem
Lichtreiz wieder aussetze. In nordischen Ländern ist der
Gebrauch einer Schneebrille als schützendes Mittel zu
empfehlen.
Tagbogen, der Teil des Tagkreises, den ein Gestirn im
täglichen Umschwung um die Erde oberhalb des Horizonts
beschreibt, im Gegensatz zu dem unterhalb des Horizonts gelegenen
Teil, dem Nachtbogen.
Tagebau, im Gegensatz zum Grubenbau Abbauanlagen
über Tag; vgl. Bergbau, S. 723.
Tagebruch, Einsenkung der Erdoberfläche, entstanden
durch Einsturz alter bergmännischer Anlagen.
Tagebuch, s. v. w. Journal (s. Buchhaltung, S. 565). Bei
der doppelten Buchführung paßt die Bezeichnung T. nur
dann, wenn die Übertragungen aus den Vorbüchern
täglich erfolgen, wie dies bei der französischen
Buchhaltung geschieht. Über die Tagebücher der Makler s.
Makler, S. 135.
Tagegelder, s. Diäten.
Tagekranz, s. Hängebank.
Tagelied (Tageweise, Wächterlied), eine Gattung des
mittelalterlichen Minnegesangs, welche balladenartig das Scheiden
zweier Liebenden schildert, woran der Turmwächter, den
anbrechenden Tag verkündend, mahnt. Diese Dichtungsform war in
der Provence erfunden, wurde aber in Deutschland schon früh
nachgeahmt und hier, teils mit der Figur des Wächters, teils
ohne dieselbe als bloßes Scheideduett, bald sehr
populär; als größter Meister derselben erscheint
Wolfram von Eschenbach. Später übernahm das Volkslied die
Pflege der Tageweisen, die in der Reformationszeit auch eine
geistliche Umdeutung erfuhren, wodurch die sogen. geistlichen
Wächterlieder entstanden, als deren letztes das noch heute
gesungene Lied "Wachet auf, ruft uns die Stimme" von Ph. Nicolai zu
nennen ist. Vgl. Bartsch, Gesammelte Vorträge und
Aufsätze (Freiburg 1883); Gruyter, Das deutsche T. (Leipz.
1887).
Tagelöhner, derjenige, welcher gegen Tagelohn
arbeitet. Vgl. Arbeitslohn, S.759.
Tages, nach röm. Mythus der Sohn eines Genius und
Enkel des Jupiter, tauchte bei Tarquinii in Etrurien aus der Furche
eines frisch gepflügten Feldes plötzlich empor und
lehrte, ein Knabe von Ansehen, ein Greis an Weisheit, den Etruskern
die Haruspizien (s. Haruspices), die dann von ihnen in den Libri
tagetici aufgezeichnet wurden.
Tagesbefehl, s. v. w. Parolebefehl, s. Parole.
Tagesgeschäft, Tageskauf, im Gegensatz zum
Lieferungsgeschäft (s. d.) und zum Lieferungskauf (s. d.)
dasjenige Geschäst, bei welchem die Ware unmittelbar (oder
auch je nach den Börsenusancen mit gewisser Frist) nach
Abschluß des Geschäfts übergeben wird.
Tageshelle, s. Diffusion des Lichts.
Tagesordnung, bei beratenden und beschließenden
Versammlungen das Verzeichnis und die Reihenfolge der zur Beratung
kommenden Gegenstände, welche für die jeweiligen
Sitzungen im voraus auf- und festzustellen sind; daher heißt
zur T. übergehen s. v. w. auf einen Antrag etc. nicht weiter
eingehen. Geschieht dies unter der Angabe von Gründen, so
spricht man von einer motivierten T., welche als eine mildere Form
der Ablehnung eines Antrags gilt.
Tagesregent, in der Astrologie derjenige der sieben
Planeten: Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus, Merkur und Mond, der
auf die erste Stunde eines jeden Wochentags kommt, wenn man die
erste Stunde des Sonnabends dem Saturn, die zweite dem Jupiter
etc., die achte wieder dem Saturn u. s. f. in obiger Weise zuteilt.
Sonach sind Saturn, Sonne, Mond, Mars, Merkur, Jupiter und Venus
die Regenten der Wochentage, vom Sonnabend angefangen, weshalb
letztere auch die Namen dies Saturni (engl. saturday). d. Solis
(engl. sunday), d. Lunae (Montag, ital. lunedi) , d. Martis (ital.
martedI) , d. Mercurii (ital. mercord1), d. Jovis (ital. gioved1)
und d. Veneris (ital. venerdi) führen.
Tagewählerei, in Luthers Bibelübersetzung (5.
Mos. 18, 10) der Glaube an Glücks- oder Unglückstage bei
den Juden, der sich aber fast bei allen Kulturvölkern findet
und bis heute nicht geschwunden ist. Über die T. der Griechen
belehrt uns das Hesiodsche Gedicht "Werke und Tage"; bei den
Römern galten alle auf die Iden folgenden Tage als
unglücklich, und dazu kamen die drei großen
Unglückstage: 7. Mai, 8. Juli und 8. Nov., die den Toten
gewidmet waren. An solchen Unglückstagen, deren Zahl sich
durch die Daten verlorner Entscheidungsschlachten oder sonstiger
nationaler Unglücksfälle vermehrte, durften keine neuen
Unternehmungen, Feldzüge, Bauten, Reisen, Ehen etc. begonnen
werden; für die Eheschließung galt auch der ganze Monat
Mai für unglücklich. Bei den alten Germanen galten die
den Hauptgöttern Wuotan und Donar heiligen Wochentage (Montag
und Donnerstag) für Glückstage,
492
Tagewasser - Tahiti.
Dienstag und Freitag für unglücklich, und der Freitag
gilt noch heute unzähligen Menschen als ein Tag, an dem man
nichts beginnen darf. Im Mittelalter dehnte sich die T. bis auf die
im Kalender verzeichneten Tage aus, an denen es gut sei, Haare zu
schneiden, zu purgieren etc. Besonders lebendig ist die T. heute
noch bei den Russen und Finnen, Indern, Chinesen und Japanern. Vgl.
Andree, Ethnographische Parallelen und Vergleiche (Stuttg.
1878).
Tagewasser, im Bergbau das von der Erdoberfläche in
die Grube gelangende Wasser.
Tagewerk, früher ein in manchen Gegenden
Deutschlands gebräuchliches Feldmaß, eigentlich so viel
Land, wie ein Ackersmann in einem Tag bestellen kann, also etwa s.
v. w. Morgen.
Tagfahrt, s. v. w. Termin.
Tagfalter (Diurna, Rhopalocera), Familie aus der Ordnung
der Schmetterlinge (s. d., S. 556).
Taggia (spr. taddscha), Stadt in der ital. Provinz Porto
Maurizio, Kreis San Remo, am Fluß T. und an der Eisenbahn
Genua-Nizza, unweit der ligurischen Küste, an welcher sich ein
kleiner Hafen (Arma di T.) befindet, hat ein Gymnasium, mehrere
Kirchen, Weinbau und (1881) 4046 Einw.
Tagil, Fluß im russ. Gouvernement Perm, kommt aus
dem Ural im Kreis Jekaterinenburg, fließt an den
Hüttenorten Werchne-Tagilsk und Nishne-Tagilsk (s. d.)
vorüber und ergießt sich nach einem Laufe von 270 km in
den Fluß Tura.
Tagkreis, dem Himmelsäquator paralleler Kreis,
welchen ein Gestirn bei der täglichen scheinbaren Rotation des
Himmelsgewölbes beschreibt.
Tagliacozzo (spr. talja-), Stadt in der ital. Provinz
Aquila, Kreis Avezzano, mit hoch gelegenem Schloß und (1881)
3142 Einw. Hier 23. Aug. 1268 Schlacht zwischen Karl von Anjou und
Konradin (s. d.) von Schwaben, in der letzterer besiegt wurde. Vgl.
Köhler, Zur Schlacht von T. (Bresl. 1884).
Tagliamento (spr. talja-), Fluß in Venezien,
entspringt in den Friauler Alpen, fließt anfangs
östlich, wendet sich dann südlich, ist von Latisana an
für Barken schiffbar und mündet nach einem Laufe von 170
km ins Adriatische Meer. An der Mündung liegt der kleine Hafen
Porto del T. Der T. gehört zu den gefährlichsten
Flüssen von Friaul und fließt meist in erhöhtem,
aus Gerölle aufgebautem Bett in dünnen Wasserfäden;
bei Hochwasser überschüttet er aber die Fruchtebene mit
Steinen. Bei Codroipo liegt sein Bett 9 m über der Ebene. -
Nach dem T. war unter Napoleon I. ein Departement Italiens mit der
Hauptstadt Treviso benannt.
Tägliche Lieferung, im Lieferungsgeschäft (s.
d.) derjenige Kauf, bei welchem der Käufer berechtigt ist, bis
zu einem bestimmten Termin an jedem Tag die Lieferung zu
fordern.
Taglioni (spr.taljoni), berühmte Tänzerfamilie,
aus der zuerst Philipp T., geb. 1777 zu Mailand, einen Namen
gewann; er wirkte nacheinander als Ballettmeister beim Theater in
Stockholm, Kassel, Wien, seit 1840 in Warschau, ließ sich
1853 am Comersee nieder und starb daselbst 11. Febr. 1871. Er
verfaßte viele Ballette. Von seinen fünf Kindern, die
sich sämtlich der Tanzkunst widmeten, und von denen die
Töchter in altadlige Geschlechter heirateten, sind Maria und
Paul zu Berühmtheit gelangt. Seine Tochter Maria, geb. 23.
April 1804 zu Stockholm, wirkte seit 1827 an der Großen Oper
in Paris, seit 1832 zu Berlin und zog sich 1847 nach ihrer
Verheiratung mit dem Grafen Gilbert de Voisins nach Italien
zurück. Sie war eine der vollendetsten Tänzerinnen und
ausgezeichnet als Sylphide; starb 23. April 1884 in Marseille. Ihr
Bruder Paul, geb. 12. Jan. 1808 zu Wien, debütierte 1825 in
Stuttgart, wurde 1829 in Berlin engagiert und 1869 zum
Ballettdirektor ernannt. Er verheiratete sich mit der Tänzerin
Amalie Galster, die, seit 1815 am Hoftheater zu Berlin engagiert,
sowohl hier als auf Kunstreisen die Triumphe des Gatten teilte; sie
starb 23. Dez. 1881 in Berlin. Bedeutender als Choreograph denn als
Tänzer hat Paul T. eine große Fruchtbarkeit in der
Schöpfung von Balletten entwickelt, deren bekannteste "Flick
und Flock" und "Fantaska" sind. Er starb 7. Jan. 1884 in Berlin.
Seine Tochter Maria, geb. 1833 zu Berlin, debütierte 1847 in
London mit Glück, war längere Zeit beim königlichen
Ballett zu Berlin, dann am San Carlotheater in Neapel engagiert und
vermählte sich 1866 mit dem Fürsten Joseph
Windischgrätz. Eine jüngere Tochter, Auguste, war eine
Reihe von Jahren als Schauspielerin zu Berlin thätig.
Tagsatzung (Tagleistung), in der Schweiz früher
Bezeichnung des Bundestags, welcher zumeist in Baden, später
in Frauenfeld abgehalten wurde. In der T. führte Zürich
als sogen. Vorort den Vorsitz. Mit der Umwandlung des
eidgenössischen Staatenbundes in einen Bundesstaat kam die T.
in Hinwegfall (s. Schweiz, S. 762).
Tagschmetterlinge, s. v. w. Tagfalter.
Taguan, s. Eichhörnchen, S. 362.
Taguanüsse (Elfenbeinnüsse), die Früchte
von Phytelephas macrocarpa; vgl. Elfenbein.
Tagulandang (Tagulanda), Insel an der Nordostspitze der
Insel Celebes, 140 qkm groß mit 2000 Einw., steht unter einem
Radscha und gehört zur niederländischen Residentschaft
Menado.
Tag- und Nachtgleiche, s. Äquinoktium.
Tagwechsel (Präzisewechsel), s. Wechsel.
Tahaa (Otaha), eine der noch unabhängigen
Gesellschaftsinseln im südöstlichen Polynesien, zur
Leewardgruppe gehörig, 82 qkm groß, gebirgig, doch
fruchtbar, mit mehreren guten Häfen und (1885) 634 Einw.,
welche durch englische Missionäre zum Christentum bekehrt
wurden.
Tahiti (Otaheiti), die unter franz. Protektorat stehende
größte und wichtigste der Gesellschaftsinseln, besteht
aus zwei durch eine schmale Landenge zusammenhängenden
Halbinseln, Taiarapu und Porionuu, und hat einen Flächeninhalt
von 1042 qkm (19 QM.). Die Insel ist von einem Korallenriff
umgeben, welches mehrere Öffnungen zum Einlaufen der Schiffe
sowie mehrere Baien und Buchten mit guten Ankerplätzen hat.
Das Land ist vulkanisch und steigt von der Küste gegen die
Mitte hin im Orohea oder Tobreonu bis 2104 m an. Zahlreiche
Bäche ergießen sich von den Bergen, in ihrem obern Lauf
schöne Kaskaden bildend und in der Regenzeit oft zu
reißenden Flüssen anschwellend. Vom Fuß der Berge
bis zum Strand ist die ganze Insel von einer schmalen Niederung
umgeben, auf welcher die Wohnungen zerstreut liegen. Das Klima ist
sehr gesund ; von einheimischen Produkten sind namentlich
Zuckerrohr (eine der Insel eigne Spezies), Bananen, Pisangs,
Brotfrucht- und Kokosbäume, Yams, Bataten, Arum zu nennen. Die
Bevölkerung wurde zu Cooks Zeiten (wohl zu hoch) auf 120,000
Seelen geschätzt, ist sehr gesunken und betrug 1885 nur 9562,
mit dem benachbarten Morea 11,007 Seelen (davon nur 4673 weiblichen
Geschlechts). Von der Gesamtzahl waren 8577 Eingeborne, 288
Franzosen (davon 132 Mann Garnison), außerdem Engländer,
Amerikaner, Deutsche, eine Anzahl Chinesen und als Arbeiter
eingeführte
493
Tahk - Tahkali.
Polynesier andrer Inseln.
Das Christentum (meist methodistisches) ist durchweg
angenommen; es bestehen bereits 34 Schulen, 1n welchen 1800 Kinder
unterrichtet werden. Als Zeitung besteht der amtliche "Messager de
T." Unter Kultur sind 3093 Hektar, davon 2328 mit Kokospalmen
bepflanzt, der Rest mit Baumwolle, Zuckerrohr, Kaffee, Vanille,
Mais u. a.; die Orangenbäume, von Cook eingeführt,
wachsen wild und liefern reiche Erträge zur Ausfuhr nach
Amerika. Der Großhandel ist in den Händen englischer,
deutscher und nordamerikanischer Häuser. Eingeführt
werden: Spirituosen, Konserven, Hausgerät, Bauholz, Kleider;
ausgeführt: Baumwolle, Apfelsinen, Perlschalen, Kopra,
Trepang. 1887 betrug die Ausfuhr 1,644,308 Mk.: es liefen 172
Schiffe ein und 156 aus. Die Post beförderte durch fünf
Ämter 176,483 Sendungen. Die Ausgaben des Mutterlandes
für die Kolonie betrugen 805,000, das Kolonialbudget 1,27
Mill. Frank. Die wichtigsten Häfen sind Papeete (s. d.),
Papeuriri und Antimaono auf der Südküste, Papaoa
ostnordöstlich von Papeete. Ein monatlicher, von der
französischen Regierung subventionierter Schiffsverkehr
besteht mit San Francisco. Auch eine Eisenbahn von 33 km Länge
besitzt T. Hauptstadt ist Papeete; im Innern in Fatuahua befindet
sich ein Fort, das die ganze Insel beherrscht. Die Flagge s. Tafel
"Flaggen I". Die Insel T. wurde von Quiros 1606 entdeckt und
Sagittaria genannt; genauere Kunde verdanken wir aber erst dem
Engländer Wallis, welcher die Insel 1767 besuchte und Georgs
III.-Insel nannte. Im April 1768 wurde sie von Bougainville
besucht, der sie wegen der Sinnlosigkeit der Weiber Nouvelle
Cythère (Neukythera) taufte. Cook, der sie 1769 mit Forster
genauer untersuchte, gab dem Archipel den Namen
Gesellschaftsinseln. Seitdem ist der Archipel von Wilson, Turnbull,
Bellinghausen, Duperrey, Kotzebue, Beechey, Dumont d'Urville u. a.
besucht und beschrieben worden. Der gesellschaftliche Zustand
Tahitis wurde besonders durch die 1797 erfolgte Ankunft der
englischen Missionäre umgewandelt. Der König Pomare I.
nahm die Missionäre günstig auf, aber erst sein
Nachfolger Pomare II. trat 1812 zum Christentum über.
Vielweiberei und Kindermord, früher an der Tagesordnung,
hörten auf; 1822 zählte man auf T. schon 66 Kirchen und
Kapellen. Da Pomare II. 1821 einen erst 18 Monate alten Sohn,
Pomare III., hinterließ, nahmen die Missionäre, damit
die Fortschritte der Bildung nicht gefährdet würden,
selbst das Staatsruder in die Hand. 1824 erhielt T. eine Art von
Konstitution. Der junge König starb aber schon 11. Jan. 1827,
worauf seine 16jährige Schwester als Pomare Wahine I. auf den
Thron erhoben ward. Die Wirksamkeit der englischen Missionäre
ward gestört, als, durch einen belgischen Kaufmann,
Moerenhout, der sich 1829 auf T. niederlassen, veranlaßt,
französische katholische Missionäre auf T. Fuß zu
gewinnen suchten. Die Königin ließ die letztern
gewaltsam vertreiben, worauf die französische Regierung den
Kapitän Dupetit-Thouars beauftragte, Genugthuung und zugleich
Entschädigung für die vertriebenen Missionäre zu
verlangen. Die Königin mußte nachgeben und die
Ansiedelung katholischer Priester auf der Insel dulden. Auf
Moerenhouts Veranlassung baten 1841 einige Häuptlinge die
französische Regierung um Übernahme des Protektorats
über die Insel. Am 1. Sept. 1842 erschien Dupetit-Thouars
wieder vor Papiti und erzwang durch Drohungen die Anerkennung von
Frankreichs Protektorat. Als er aber 1843 die Absetzung der
Königin proklamierte, entstanden daraus Verwickelungen mit
England. Das französische Gouvernement mußte nachgeben
und behielt bloß das Protektorat, welches aber
allmählich in völlige Herrschaft verwandelt wurde. Der
Code Napoléon gilt als Gesetzbuch, die Richter werden aus
den französischen Zivil- und Militärbeamten genommen. Die
Königin starb 17. Sept. 1877; ihr Nachfolger war ihr Sohn
Arijane, der als Pomare V. eine Scheinregierung führte, die er
1880 in aller Formen Frankreich abtrat. Vgl. Le Chartier, T. et les
colonies françaises de la Polynésie (Par. 1887).
Tahk, Längenmaß, s. Thuok.
Tahkali, s. Carrierindianer.
494
Tahoe - Taine.
Tahoe (spr. tahu), See an der Grenze der nordameri-kan.
Staaten Kalifornien und Nevada, 906 qkm groß, liegt 1902 m
ü. M. und fließt durch den 150 km langen
Truckeefluß in den Pyramid Lake ab.
Tahfil-dar, türk. Steuerbeamter, welcher den
Steuerpachtern beigegeben wird.
Taifun, Wirbelsturm, s. Teifun.
Taikun, f. Shogun.
Taillandier (spr. tajangdjeh), Saint-René
(eigentlich René Gaspard Ernest), franz. Schriftsteller,
geb. 16. Dez. 1817 zu Paris, studierte daselbst und in Heidelberg
die Rechte, daneben Philosophie und schöne Litteratur, ward
1841 Professor der Litteratur zu Straßburg , 1843 zu
Montpellier und erhielt 1863 an Saint-Marc Girardins Stelle den
Lehrstuhlder französischen Poesie an der Sorbonne. 1870-72
fungierte er als Generalsekretär des Erziehungsministers; 1873
wurde er zum Mitglied der Akademie ernannt. Er starb 24. Febr.
1879. T. hat sich mit besonderm Erfolg der Aufgabe gewidmet, seine
Landsleute mit der Geschichte und den litterarischen Arbeiten der
Deutschen bekannt zu machen. Wir nennen von seinen Werken: "Scot
Érigène et la philosophie scholastique" (1843, 2.
Aufl. 1877); "Histoire de la jeune Allemagne" (1849) und
"Études sur la révolution en Allemagne" (1853, 2
Bde.); ferner: "Allemagne et Russie" (1856); "Histoire et
philosophie religieuse" (1860); "Écrivains et poètes
modernes" (1861); "La comtesse d'Albany" (1862); "Maurice de
Saxe"(1865)^ "Tchèques et Magyars" (1869); "Drames et romans
de la vie littéraire" (1870); "Le général
Phil. de Ségur" (1875); "Dix ans de l'histoire d'Allemagne"
(nach der Korrespondenz Friedrich Wilhelms IV. mit Bunsen, 1875);
"Le roi Léopold et la reine Victoria, récits
d'histoire contemporaine" (1878, 2 Bde.); "Études
littéraires: Boursault, etc." (1881). Auch gab er die
Übersetzung des Goethe-Schillerschen Briefwechsels von der
Baronin Carlowitz (1863, 2 Bde.) heraus.
Taille (franz., spr. tallje), der Schnitt eines Kleides;
Wuchs, Körpergestalt, insbesondere der Teil zwischen
Hüften und Brust und das entsprechende Stück der
Frauenkleidung, Leibchen; in der Musik s. v. w. Tenor; basse-t.,
der zweite (tiefere) Tenor (auch s. v. w. Bariton). In Frankreich
bedeutete T. ursprünglich eine Steuer, welche der Lehnsherr
von seinen Vasallen erhob; später überhaupt Staatssteuer,
nachdem sie unter Karl VIL zu einer bleibenden geworden war, um die
ersten stehenden Truppen zu erhalten; beim Pharospiel s. v. w.
Abzug, d. h. eine Tour des Spiels und die Karten dazu in der durch
das Mischen bewirkten Reihenfolge.
Taille-douce (franz., spr. taj-duhß), s. v. w.
Kupferstich (im Gegensatz zu Eau forte, Radierung); Taille-dure,
Stahlstich.
Tailleur (franz., spr. tajör), Schneider.
Taillon (franz., spr. tajong), Nachsteuer.
Taimyr, nördlichste Halbinsel des asiatischen
Festlandes zwischen der Jenisseimündung und dem Chatangabusen,
nach neuern Bestimmungen der schwedischen Polarexpeditionen
zwischen 81 und 114° östl. L. v. Gr. gelegen. Ihre
nördlichste Spitze ist das Kap Tscheljuskin unter 77° 36'
48'' nördl. Br. und 103° 17' 12'' östl. L. Die
Halbinsel wird vom Taimyrfluß, welcher den großen,
über 100 km breiten Taimyrsee durchfließt und sich in
die Taimyrbucht ergießt, in zwei Halbinseln, eine
größere östliche und eine kleinere westliche,
geteilt und von dem in nordöstlicher Richtung streichenden
Byrrangagebirge durchzogen, dessen östliche Teile
Nordenskjöld auf 600-900 m Höhe schätzt. Die T.
liegt jenseit der Baumgrenze, so daß auf ihr die
verschiedenen Formen der Tundra (s. d.) in besonders
charakteristischer Weise zur Entwickelung gelangen. Durchforscht
wurde die T. zur Zeit der großen nordischen Expedition
(1735-43) von Minin, Sterlegow, Prontschischew, Chariton, Laptew,
Tschekin und Tscheljuskin; im J. 1843 drang v. Middendorff bis zur
Taimyrbai vor, und 1878 ist dieser nördlichste Teil der
Ostfeste von der Expedition der Vega umfahren worden.
Tain, 1) (spr. täng) Stadt im franz. Departement
Drôme, Arrondissement Valence, am Rhône und an der
Bahnlinie Lyon-Avignon, mit dem gegenüberliegenden Tournon
durch zwei Hängebrücken verbunden, hat einen
römischen Opferaltar, eine Kaltwasserheilanstalt,
Seidenspinnerei, trefflichen Weinbau (auf dem Eremitagehügel)
und (1881) 2150 Einw. - 2) (spr. tähn) Hafenstadt in der
schott. Grafschaft Roß, am Dornoch Firth, mit Lateinschule
und (1881) 1742 Einw.
Taine (spr. tähn), Hippolyte, angesehener franz.
Schriftsteller, Philosoph und Kritiker, geb. 21. April 1828 zu
Vouziers (Ardennen), erhielt seine Bildung am College Bourbon und
an der École normale in Paris, studierte hierauf Philologie,
um sich dem Lehrfach zu widmen, entsagte aber diesem Plan, nachdem
er bereits durch seine beiden Abhandlungen: "De personis
Platonicis" und "Essai sur les fables de Lafontaine" (1853, 11.
Aufl. 1888) sich den Doktortitel erworben hatte, um sich ganz
seinen wissenschaftlichen Forschungen hingeben zu können. Zwei
seiner ersten Schriften, der von der Akademie gekrönte "Essai
sur Tite-Live" (1854, 5. Aufl. 1888) und "Les philosophes francais
du XIX. siècle" (1856, 6. Aufl. 1888), erregten bereits
durch die Unabhängigkeit der darin ausgesprochenen Ansichten
großes Aufsehen; noch mehr war dies der Fall mit seiner
"Histoire de la littérature anglaise" (1864; 5. Aufl. 1886,
5 Bde.; deutsch, Leipz. 1877-78), die von seiten der orthodoxen und
päpstlichen Partei einen wahren Sturm gegen den Verfasser
erregte, weil man darin anti-spiritualistifche Grundsätze
wahrzunehmen glaubte. Die Arbeit erhielt darum trotz ihres
wissenschaftlichen Werts den akademischen Preis nicht. Als
Entschädigung erhielt der Verfasser durch Vermittelung des
Kaisers eine Professur der Geschichte und Kunstgeschichte an der
Ecole des beaux-arts; auch wurde er 1878 an Lomenies Stelle zum
Mitglied der Akademie erwählt. Von seinen sonstigen,
übrigens von Paradoxien nicht immer freizusprechenden
Schriften sind hervorzuheben : "Voyage aux eaux des
Pyrénées" (1855, 11. Aufl. 1887); "Essais de critique
et d'histoire" (1857, 3. Aufl. 1874) und "Nouveaux essais" (1865,
4. Aufl. 1886); "Notes sur Paris, ou Vie et opinions de Fred. -
Thomas Graindorge", satirische Sittenbilder (6. Aufl. 1880); "Le
positivisme anglais", Studien über St. Mill (1864) ; "Voyage
en Italie" (1866, 6. Aufl. 1889); "Philosophie de l'art en Italie"
(1866, 3. Aufl. 1877); "L'ideal dans l'art", Vorträge (1867);
"Philosophie de l'art dans les Pays-Bas" (1868); "Philosophie de
l'art en Grece" (1869); "De l'intelligence" (5. Aufl. 1888, 2
Bde.); "Notes sur l'Angleterre" (8. Aufl. 1886) u. sein Hauptwerk:
"Les origines de la France contemporaine", das in 2 Teile:
"L'ancien regime" (15. Aufl. 1887) und "La Revolution" (1878-84,
Bd. 1-3; 16. Aufl. 1888), zerfallt. In demselben nimmt T. einen
sehr selbständigen und vielleicht etwas paradoxen, aber auf
ein ungeheures tatsächliches Material gestützten
Standpunkt ein, der bei der demokratischen Schule großen
Anstoß er
495
Taiping - Takelung.
regt hat; er führt nämlich alle vorgeblichen
Großthaten, Entdeckungen und Neuerungen der Revolution auf
ältere Institutionen und Ideen zurück und bringt sie so
in einen organischen Zusammenhang mit dem alten Königtum, wie
ihn die Jünger Michelets und Louis Blancs nimmermehr zugeben
wollen. Als Kunstschriftsteller ist T. in der Analyse der
Kunstwerke unübertroffen.
Taiping, Name der Aufständischen in China 1849 bis
1866 (vgl. China, S. 19).
Taitsing, s. Tsing.
Taiwan, chines. Traktatshafen auf der Insel Formosa und
Hauptstadt derselben, Sitz eines englischen Konsuls, welcher mit
Vertretung der deutschen Interessen betraut ist, mit katholischer
und evangelischer Mission, zählt einschließlich des
nördlicher gelegenen Takao 235,000 Einw. Da Anping, der Hafen
von T., nur eine offene, schlechte Reede ist, bewegt sich der
Verkehr mit dem Ausland über Takao (s. d.).
Tajo (spr. tachho), einer der Hauptflüsse der
Pyrenäischen Halbinsel, entspringt an der Grenze der span.
Provinzen Guadalajara und Teruel, am Westabhang der Muela de San
Juan, fließt in westlicher Hauptrichtung an Aranjuez, Toledo
und Alcantara vorüber und erhält beim Übertritt nach
Portugal, wo er reißend wird und den Namen Tejo annimmt, den
Charakter eines Stroms. Unterhalb Salvaterra teilt er sich in zwei
Arme, den westlichen Tejo novo und den östlichen Mar de Pedro,
welche eine Art Delta, die Lezirias do Tejo, bilden. Alle Arme
münden in die herrliche Bai von Lissabon, welche im W. durch
die breite Entrada do Tejo mit dem Meer in Verbindung steht. Die
regelmäßige Schiffahrt beginnt bei Abrantes, Barken
gehen noch 50 km weiter hinauf; bei Santarem beginnt die
Dampfschiffahrt, und von hier ab befahren ihn auch Seeschiffe. Die
Länge des T. beträgt 912 km, der Quellabstand 675 km, das
Stromgebiet 82,525 qkm (1498,8 QM.). Zuflüsse von rechts sind:
Gallo, Jarama (mit Lozoya, Henares, Tajuna und Manzanares),
Guadarrama, Alberche, Tiétar, Alagon, Ponsul, Zezere; von
links: Guadiela, Almonte, Salor, Zatas uno Canha.
Taka, Längenmaß in Sansibar, à 2 Tobe
à 2 Schucka à 2 War (s. d.).
Takao (Takeu), chines. Traktatshafen an der
Südwestküste der Insel Formosa, südlich von Taiwan
(s. d.), mit dem es nahezu ein zusammenhängendes Ganze bildet.
In dem Hafen von T. verkehrten 1886: 190 Schiffe von 103,076 Ton.,
darunter 58 deutsche von 19,732 T. Die Einfuhr betrug 1887:
1,228,238, die Ausfuhr 585,789 Haikuan Tael.
Takazze (Setit), rechter Nebenfluß des Atbara (s.
d.) in Abessinien.
Takel, in der Seemannssprache s. v. w. Flaschenzug.
Takelung (Takelage, hierzu Tafel "Takelung"), die gesamte
Vorrichtung zum Anbringen und Handhaben der Segel auf einem Schiff:
die Masten, Raaen, Segel und das Tauwerk mit seinen
zugehörigen Blöcken (Rollen, Kloben). Von den Masten
heißt der vordere der Fock-, der mittlere der Groß- und
der hintere der Besahnmast, und alle Rundhölzer, Spieren,
Segel und Taue, die an einem Mast geführt werden, werden mit
den entsprechenden Beiwörtern gekennzeichnet. Bei den
Takelungen mit zwei Masten fehlt bei der Brigg der Besahnmast, beim
Schoner der Fockmast. Der Mast besteht nur bei kleinen Fahrzeugen
seiner Länge nach aus einem Stück, auf Schiffen
gewöhnlich aus drei Stücken. Von diesen ist das
wichtigste der Untermast (Fig 1 I), welcher, mit seinem Fuß
auf dem Kielschwein (s. Schiff, S. 455) stehend, durch alle Decke
geht und mit 1/2-2/3 seiner Länge über das Oberdeck
emporragt. Der hölzerne Untermast besteht aus dem innern Teil
(Herz), welcher, wenn in der erforderlichen Länge vorhanden,
aus Einem Stück gemacht wird, und den um dieses gruppierten
Schalen, die zum Schutz und zur Verstärkung dienen und durch
viele eiserne Ringe unter sich und mit dem Herzen zu einem Ganzen
verbunden sind. Die Masten stehen nicht senkrecht zur Wasserlinie,
sondern nach hinten geneigt, die vordern weniger, die hintern mehr.
Durch Änderung der Neigung der Masten ist man im stande, die
Lage des Segelschwerpunktes, d. h. des Druckmittelpunktes des
Windes auf die Segel, zu modifizieren und dadurch die
Segeleigenschaften des Schiffs zu verbessern. Unter dem obern Ende
des Untermastes (Topp, II) ist derselbe durch zwei Kniee (III)
verstärkt, auf denen die Längs- und Quersalingen (IV und
V) ruhen. Auf letztern endlich ist der Mars (s. d., VI) verbolzt.
Gestützt wird der Untermast nach vorn durch ein Stag (a) und
nach hinten und den Seiten durch die Wanten (b b), starke Taue,
welche mit einem Auge über den Topp des Mastes gestreift, mit
dem andern Ende am Deck, resp in den Rüsten an der Schiffseite
befestigt werden. Die Wanten werden nebenbei benutzt, um
aufzuentern, d. h. in die T. zu klettern; sie sind dazu mit
Querleinen, den sogen. Webeleinen, ausgewebt. Wanten sind
allerdings, heißen darum aber keineswegs "Strickleitern". Die
nächste und Hauptverlängerung des Mastes ist die
Marsstenge (VII), welche mit ihrem Fuß mittels eines
Schloßholzes (Riegels) auf den Längssalingen steht und
weiter oben durch das Eselshaupt (VIII) an dem Untermast
festgehalten wird; sie hat ebenfalls einen Topp (IX), Stagen (a'
a') und Wanten (b' b'), außerdem Stütztaue nach hinten
(Pardunen, c' c'). An ihrem Topp ist in derselben Weise (nur ein
Mars fehlt) die zweite Verlängerung, die Bramstenge (X), durch
ein Eselshaupt (XI) befestigt und durch Stagen (a'' a'''), Wanten
(b'' b'') und Pardunen (c'' c'') gestützt. Ähnlich wie
ein Mast, besteht auch das vorn am Bug befindliche, schräg
liegende Bugspriet aus dem eigentlichen Bugspriet und seinen
Verlängerungen, dem Klüver- und
Außenklüverbaum, welche durch Bug-, Back- und
Wasserstagen nach den Seiten und unten gestützt werden. Das
bisher erwähnte Tauwerk heißt stehendes Gut zum
Unterschied vom laufenden (s. d. und unten), welches seinen Namen
daher hat, daß es über allerlei Rollen und durch
Blöcke läuft, ehe es zur bequemen Handhabung auf dem
Oberdeck bereit ist. Zum stehenden Gut benutzt man häufig
Drahttauwerk, welches dauerhafter und widerstandsfähiger ist.
An den Befestigungsstellen des stehenden Gutes auf dem Oberdeck und
anderwärts sind stets Vorrichtungen vorhanden, um die Spannung
in dem betreffenden Tau zu regulieren, resp. dasselbe
nachzuspannen. Es sind dies meist sogen. Taljereeps, d. h.
flaschenzugartige Apparate ohne Rollen, in neuerer Zeit auch
Spannschrauben. Gegen Witterungseinflüsse wird das stehende
Gut bekleidet und stark geteert, daher es schon
äußerlich an seiner schwarzen Farbe zu erkennen ist. Das
laufende Gut ist braun, wenn aus europäischem Hanf, oder fast
weiß, wenn aus Manilahanf gefertigt. An dem Untermast, dicht
unter dem Topp, hängt die Unterraa (1). Sie wird, wie jede
andre Raa, nach oben durch Toppnanten (d) an ihren Nocken
gestützt und mit Brassen (e) versehen, welch letztere sie in
einer Horizontalebene drehen (anbrassen) können. An den
Unterraaen sind die Untersegel (A A) befestigt, welche nach unten,
also bis zum Oberdeck, gesetzt (ausge-
495a
Takelung der Seeschiffe.
I Untermast.
II Topp.
III Kniee.
IV Längssalingen.
V Quersalingen.
VI Mars.
VII Marsstenge.
VIII Eselshaupt.
IX Topp der Marsstenge.
X Bramstenge.
XI Eselshaupt der Bramstenge.
XII Leesegelspieren.
XIII Gaffel.
A Untersegel.
B Marssegel.
C Bramsegel.
D Oberbramsegel.
E Stagsegel.
F Gaffelsegel.
G Leesegel.
J Jungfern.
P Püttinj
a Stag.
a' Stenge
a'' Bramstengestag.
a'" Oberbramstengestag.
b Wanten,
b'b" Stengewanten.
c' Pardunen.
c"c,"' Bramstenge- }
Oberbramstenge- } Parduncn.
f ^Pferde^,
g Reefleinen.
1 Unterraa.
2 Marsraa.
3 Bramraa
4 Oberbramraa.
Fig. 9. Yawl.
496
Takeu - Takowo-Orden.
spannt) werden. An der Marsstenge, dicht über dem
Eselshaupt (VIII), befindet sich die Marsraa (2), aber zum
Heißen (Aufziehen) mittels des Marsdrehreeps eingerichtet; an
ihr ist das Marssegel (B B) befestigt, dessen Schoothörner
(untere Zipfel) durch Taue, welche Schooten heißen, nach den
Enden oder Nocken der Unterraa hin ausgeholt werden; es wird
zuletzt die ganze Marsraa geheißt und dadurch das Segel
gespannt. Wie die Marssegel, sind die Bram- und Oberbramsegel (C
und D) an den Bram- und Oberbramraaen (3 und 4) eingerichtet. Die
Taljen, resp. Taue, mit denen die Raaen geheißt werden,
heißen Fallen. Sollen die Segel geborgen (eingezogen) werden,
so werden sie mittels der Geitaue und Gordings
zusammengeschnürt, dann gehen Matrosen auf die Raaen, um, in
den Paarden (Pferden, f) stehend, das Segel aufzurollen und
vollends festzubinden. Mars und Untersegel können auch
verkleinert oder gerefft werden und sind dazu mit Reffleinen (g g)
versehen, welche, im Segel befestigt, von demselben mehrere,
gewöhnlich vier, Streifen (jeder = ein Reff) abteilen. Beim
Reffen läßt man die Raa etwas herunter, dann ziehen
Matrosen, welche auf der Raa verteilt sind, das Segel in die
Höhe und befestigen die Reffleine auf der Raa. Etwas
abweichend sind die Schratsegel eingerichtet. Die Normalstellung
der bisher besprochenen Raasegel ist senkrecht zur
Längsrichtung des Schiffs. die der Schratsegel liegt in
derselben. Sie sind entweder Stagsegel (E E) oder Gaffelsegel (F
F). Erstere sind dreieckig: an der obern Ecke, der Piek oder dem
Fallhorn, ist das Fall (s. oben) befestigt; die untere, der Hals,
sitzt fest an irgend einem Mastteil; die hintere, das Schoothorn,
wird durch die Schoot gespannt. Zu den Stagsegeln gehört der
Klüver. Gaffelsegel s. unten. Bei leichtem und günstigem
Wind wird die Segelfläche durch die Leesegel (G G)
vergrößert, dazu die Raaen durch Leesegelspieren (XII)
verlängert, zwischen denen erstere ausgespannt werden. Man
unterscheidet Unter-, Ober- und Bramleesegel, welche resp. die
Unter-, Mars- und Bramsegel seitlich vergrößern.
Auf kleinern Schiffen ist die Schoner- oder Gaffeltakelung
zweckmäßiger als die bisher besprochene Raatakelung,
weil sie leichter zu bedienen ist, und weil mit derselben besser
bei dem Wind (s. Segelmanöver) gesegelt werden kann. Jeder
Mast hat hier nur ein trapezförmiges Hauptsegel, das an einer
Gaffel (XIII) und am Mast selbst befestigt ist und, wie die
Stagsegel, mit einer Schoot gesetzt wird. Über diesem kann ein
zweites, das Gaffeltoppsegel, zwischen den Enden der Gaffel und des
Mastes, der nur eine Stenge hat, angebracht werden (Fig. 7). Am
Bugspriet kommt auch bei dieser T. noch eine Anzahl Stagsegel
hinzu. Neuere und große Schiffe haben nicht selten eiserne
Masten, welche von demselben Durchmesser wie hölzerne, aber
hohl, nur inwendig stark verstrebt, gefertigt werden; zuweilen
bestehen Untermast und Stenge aus einem Stück. Sie sind
dauerhafter und, wo Hölzer von der erforderlichen
Größe schwer zu beschaffen sind, auch billiger; Raaen
stellt man aus demselben Grund zuweilen aus Stahlröhren her.
Auf Kauffahrteischiffen sind doppelte Marsraaen und Patentmarsraaen
vielfach in Gebrauch. Bei letztern kann man schnell, und ohne
daß einer in die T. zu gehen braucht, reffen. Indem
nämlich die Raa gefiehrt (herabgelassen) wird, dreht sie sich,
mittels eines Zahnrades an der mit einer Zahnleiste versehenen
Stenge herunterrollend, und wickelt dabei den obern Teil des
Marssegels um sich selbst auf. Nach den verschiedenen Takelungen
unterscheidet man bei den Seeschiffen: Voll- oder Fregattschiffe
(drei Masten, alle mit Raatakelung, Fig. 2); Barken (drei Masten,
Fock- und Großmast mit Raatakelung, Besahnmast
Gaffeltakelung, Fig. 5); Schonerbarken (nur der Fockmast
Raatakelung, Groß- und Besahnmast Gaffeltakelung, Fig.4);
dreimastige Schoner (alle drei Masten Gaffeltakelung); Briggs (zwei
Masten, beide mit Raaen, Fig. 3); Schonerbriggs (auch Voll- oder
Raaschoner; Fockmast mit Raaen, Großmast mit Gaffeltakelung,
Fig. 6); Schoner (beide Masten mit Gaffeltakelung, Fig. 7).
Einmastige Schiffe mit Raaen gibt es nicht. Die kleinern
(Küsten-) Fahrzeuge unterscheiden sich mehr nach ihrer Bauart,
wie z. B. Kuff, Galjaß, Galjot, und führen dabei eine
der vorerwähnten Takelungen mit geringen Abweichungen. Die
Gesamtsegelfläche wird durch eine Zahl angegeben, deren
Einheit der Flächeninhalt des größten Querschnitts
des Schiffs unterhalb der Wasserlinie ist. Sie beträgt bei den
großen modernen Kreuzern mit Dampfkraft 25-30, bei kleinern
30-40; bei den großen Segelschiffen einer vergangenen Periode
40-50, bei den kleinern 60. Hat man die Gesamtsegelfläche
eines zu erbauenden Schiffs bestimmt, dann muß die T. so
angeordnet werden, daß der Segelschwerpunkt, d. h. der
Angriffspunkt der gesamten zur Wirkung kommenden Windkraft, eine
auf dem Erfahrungsweg bestimmte Lage hat, nämlich etwas vor
dem Schwerpunkt und hinter der Drehachse des Schiffs und in einer
Höhe über der Wasserlinie, welche mit der Stabilität
in Einklang steht. Liegt der Schwerpunkt der Segelfläche zu
weit nach hinten, so wird das Schiff luvgierig, d. h. von der Seite
kommender Wind wird bestrebt sein, den Bug des Schiffs dem Wind
entgegenzudrehen. Liegt der Segelschwerpunkt zu weit nach vorn, so
wird das Schiff leegierig. Etwas luvgierig müssen gute
Seeschiffe sein. Über die T. der Boote s. Boot. Vgl. Sterneck,
T. und Ankerkunde (Wien 1873); Bréart, Manuel de
gréement (4. Aufl., Par. 1875), und die Litteratur bei Art.
Seemannschaft.
Takeu, Stadt, s. Takao.
Takkaceen, monokotyle, nur 8-10 Arten umfassende, im
tropischen Asien, Neuholland und Polynesien einheimische
Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Liliifloren, die zunächst
mit den Dioskoraceen verwandt ist. Die T. wachsen an feuchten
Stellen des Meeresufers und in den Bergwäldern des tropischen
Asien, Afrika und der Inseln des Ozeans.
Takonisches System, eine von amerikanischen Geologen
gebrauchte Bezeichnung sehr alter Gesteinsschichten, in seiner
untern Abteilung mit der Huronischen Formation (s. d.) identisch,
in der obern Abteilung mit den kambrischen Schichten (s. Silurische
Formation) oder dem Untersilur der europäischen Geologen zu
parallelisieren.
Takowo, Graf von, Name, den der frühere König
Milan von Serbien nach seiner Abdankung (1889) annahm.
Takowo-Orden, serb. Zivil- und
Militärverdienstorden, gestiftet von Milosch Obrenowitsch
III., 1876 von Milan IV. erneuert und 15. (27.) Febr. 1878 mit
Statuten versehen. Der Orden hat fünf Klassen:
Großkreuze, Offiziersgroßkreuze, Kommandeure,
Offiziere, Ritter. Die beiden ersten Klassen haben gleiche, nur
durch die Größe unterschiedene Dekorationen, bestehend
in einem grünen Lorbeerkranz, dessen Zweige in einer rot
emaillierten Krone endigen, darauf liegend ein goldenes
Andreaskreuz, in dessen Mitte die
497
Taksim - Taktik.
Chiffer MO steht, von blauem Band umwunden, mit der Devise:
"Für Glauben, Fürst und Vaterland"; dazu einen
achtstrahligen, weiß emaillierten Stern mit dem Takowokrenz
in der Mitte. Die erste Klasse trägt das Kreuz am Band
über die Schulter, die zweite um den Hals, den Stern auf der
Brust; die dritte Klasse trägt nur das Kreuz um den Hals, die
vierte das Kreuz an einem im Dreieck zusammengelegten Band auf der
Brust, die fünfte ein Kreuz ohne Email. Das Band ist rot mit
blauen und weißen Randstreifen.
Taksim (arab.), in den orientalischen Städten das
Reservoir der Wasserleitungen; auch s. v. w. musikalischer Vortrag,
Phantasie.
Takt (ital. Tempo, franz. Mesure), die nach bestimmten
Verhältnissen abgemessene Bewegung der Töne und
Tonverbindungen in der Zeit. Der T. zerfällt in Taktteile, die
hinsichtlich der Zahl je nach der Taktordnung verschieden sind,
immer aber dazu dienen, die verschiedenen Töne, Tonfiguren
etc. nach der Zeit zu messen. Die nächste Unterabteilung der
Taktteile sind die Taktglieder, wie z. B. im Zweivierteltakt die
Viertelnoten Taktteile, die Achtelnoten Taktglieder sind. Der
Anzahl der Taktteile nach unterscheidet man zunächst eine
zweiteilige und eine dreiteilige (gerade und ungerade) Taktordnung.
Beide sind einfache Taktordnungen. Durch Zusammenziehung von je
zwei Abschnitten der zweiteiligen entsteht die vierteilige, durch
Zusammenziehung von je zwei Abschnitten der dreiteiligen die
sechsteilige Taktordnung. Werden je drei Abschnitte der
dreiteiligen Ordnung zusammengezogen, so entsteht die neunteilige
und durch Zusammenziehung von vier Abschnitten der dreiteiligen die
zwölfteilige Taktordnung. Sämtliche Taktordnungen von der
vierteiligen an heißen zusammengesetzter T. Durch den Accent
erhalten die Taktteile verschiedenen innern Wert. Hiernach
unterscheidet man gute oder schwere Taktteile, welche den Accent
haben (Thesis, Niederschlag), und schlechte oder leichte Taktteile,
welche den Accent nicht haben (Arsis, Aufschlag). Aus der obigen
Entwickelung der Taktordnungen ergibt sich, daß in der
zweiteiligen und dreiteiligen der 1., in der vierteiligen der 1.
und 3. Taktteil, in der sechsteiligen das 1. und 4., in der
neunteiligen das 1., 4. und 7. und in der zwölfteiligen das
1., 4., 7. und 10. Taktglied den Accent haben müssen. Die
Taktnoten zweiteiliger Ordnung sind: der Zweizweiteltakt (kleiner
Allabrevetakt), dessen zwei Taktteile aus halben Noten bestehen und
nur durch 2/2 bezeichnet werden; der Zweivierteltakt (2/4) und der
Zweiachteltakt (2/8). Die dreiteilige Ordnung enthält den
Dreizweitel- (3/2), den Dreiviertel- (3/4) und den Dreiachteltakt
(3/8). Der vierteiligen Taktordnung gehören der
Vierzweiteltakt (großer Allabrevetakt), bezeichnet durch
(2/1), 2,2, der Viervierteltakt (gewöhnlich durch C
bezeichnet) und der Vierachteltakt (4/8) an. In der sechsteiligen
Ordnung sind der Sechsviertel- (6/4), Sechsachtel- (6/8) und der
Sechssechzehnteltakt (6/16) zu nennen. Die neunteilige Ordnung
enthält den Neunachteltakt (9/8), die zwölfteilige den
Zwölfachteltakt (12/8) und den Zwölfsechzehnteltakt
(12/16). Die jedesmalige Taktart wird mit den betreffenden Zeichen
oder Ziffern, Taktzeichen genannt, am Anfang des Tonstücks
bemerkt. Die Taktarten mit einer geraden Anzahl von Taktteilen
nennt man gerade, die mit einer ungeraden Anzahl von Taktteilen
ungerade Taktarten (Tripeltakt). Die durch den T. im Rhythmus
gebildeten Abschnitte scheidet man durch die Taktstriche, welche
das Liniensystem senkrecht durchschneiden. Im psychologischen Sinn
bezeichnet T. das verständige Gefühl des Richtigen und
Schicklichen oder die Fähigkeit, aus bloß
äußerer Aufeinanderfolge rasch das innerlich wirklich
Zusammengehörige zu erraten und passend anzuwenden, eine
Eigenschaft, welche besonders dem Frauengeschlecht eigen ist und
als "scheinbare Einfalt" sich von dieser durch Verständigkeit,
vom wirklichen Verstande dagegen durch die Bewußtlosigkeit
unterscheidet.
Taktieren, bei Aufführung eines Musikstücks mit
einem Stab (Taktierstock) den Takt angeben. Die dabei üblichen
Bewegungen sind konventionell feststehend und zwar im wesentlichen
folgende: der erste Taktteil (Taktanfang) wird
regelmäßig durch den Herunterschlag ^ angezeigt, die
übrigen Schläge halten sich mehr unten, und der letzte
geht nach oben ^. Ob der zweite Schlag von rechts nach links oder
von links nach rechts geführt wird, ist einerlei. Die
üblichsten Arten der Taktierung sind der zweiteilige Takt, der
dreiteilige, vierteilige und der sechsteilige Takt (vgl. Takt). Man
schlägt sie in folgender Weise:
Ein Crescendo wird gewöhnlich durch weiter ausholende
Schläge anschaulich gemacht, während die Verkleinerung
der Schläge ein Diminuendo andeuten soll; scharfe Accente,
Sforzati etc. verlangt man durch kurze, zuckende Bewegungen,
Veränderungen des Tempos (stringendo, ritardando) durch
Zuhilfenahme der andern Hand, doch fangen hier bereits die
individuellen Eigentümlichkeiten an. Die Dauer einer Fermate
wird durch Stillhalten des Taktstocks in der Höhe angedeutet,
ihr Ende durch eine kurze Hakenbewegung. Vgl. K. Schröder,
Katechismus des Taktierens und Dirigierens (Leipz. 1889).
Taktik (griech., Aufstellungslehre, Fechtweise), Lehre
von der Führung und dem Verhalten der Truppen auf dem
Gefechtsfeld. Wenn die Strategie der Kriegführung Richtung und
Ziele gibt, so ist die Anordnung zur Ausführung der
Märsche, die Unterbringung und Sicherung der Truppen
während der Ruhe wie die Durchführung der Gefechte die
Aufgabe der T. Man unterscheidet eine niedere oder Elementartaktik,
welche sich nur mit der Thätigkeit der taktischen Einheiten
(Kompanie, Eskadron und Batterie) beschäftigt, und höhere
T.. welche den Gebrauch der größern Truppenverbände
lehrt. Die Vorschriften (Reglements) für Aufstellung, Bewegung
und Gefecht der Truppenkörper ohne Rücksicht auf
Kriegslage, Terrain und Feind bilden das Gebiet der reinen oder
formellen T., die Anwendung dieser Formen im Terrain und dem Feind
gegenüber das Gebiet der angewandten T. Vgl. v. Boguslawski,
Die Entwickelung der T. von 1793 bis zur Gegenwart (2. u. 3. Aufl.,
Berl. 1873-85, 4 Bde.); v. Brandt, Grundzüge der T. (3. Aufl.,
das. 1859); v. Decker, Die T. der drei Waffen (3. Aufl., das.
1851-54, 2 Bde.); v. Griesheim, Vorlesungen über T. (3. Aufl.,
das. 1872); Meckel, Lehrbuch der T. (2. Aufl., das. 1873 ff.);
Derselbe, Elemente der
498
Taktmesser - Talent.
T. (2 Aufl., das. 1883); Pönitz, T. der Infanterie und
Kavallerie (4. Aufl., Adorf 1859, 2 Bde.); Rüstow, Allgemeine
T. (2. Aufl., Zürich 1868); Derselbe, Strategie und T. der
neuesten Zeit (Stuttg. 1872-75, 3 Bde.); v. Lettow, Leitfaden der
T. für die königlichen Kriegsschulen (6. Aufl., Berl.
1884); v. Verdy du Vernois, Studien über Truppenführung
(das. 1873-75, 2 Tle.); Derselbe, Taktische Beispiele (das. 1880) ;
v. Scherff , Von der Kriegführung (das. 1883).
Taktmesser (griech Metronom), einschwingendes Pendel mit
verschiebbarem Gewicht und einer Skala, welche angibt, wie viele
Hin- und Hergänge das Pendel in der Minute macht, je nachdem
das Gewicht gestellt ist. Der T. dient zur genauen Bestimmung des
Tempos, in welchem der Komponist sein Werk ausgeführt wissen
will, und ist daher eine höchst bedeutsame Erfindung, da unser
Allegro, Andante etc. doch Angaben von wenig Bestimmtheit sind. Der
jetzt allgemein verbreitete T. ist der Metronom des Mechanikers
Johann Nepomuk Mälzel (geb. 1772 zu Regensburg, gest. 1838 in
Amerika), 1816 patentiert, doch eigentlich nicht Mälzels
Erfindung, sondern die eines Mechanikus Winkel in Amsterdam. Auf
ihn bezieht sich die seitdem übliche Bezeichnung von
Kompositionen, z. B. M. M. ^ = 100 etc. (die Halben von der Dauer
eines Pendelschlags, wenn das Gewicht auf 100 gestellt ist, d. h.
100 in der Minute). Vorausgegangen waren ihm ähnliche, mehr
oder minder unvollkommene Versuche von Loulié, Stöckel
u. a.
Taktstrich, s. Takt.
Taktvorzeichnuugen, die Bruchzahlen oder Zeichen, welche
am Anfang der Tonstücke, unmittelbar hinter dem Schlüssel
stehen und die Taktart derselben bezeichnen, als ^, ^. 3/4, 6/8
etc. Dieselben sind insofern ungenügend, als sie wohl die Zahl
der Taktteile angeben, aber die eigentlichen Zählzeiten nicht
immer deutlich genug hervorheben, wie z. B. die Vorzeichnung 6/4
nicht erkennen läßt, ob der Takt dreizählig (3/2)
oder zweizählig (2/3) sein soll.
Taku, Befestigungen, welche den Eingang zum
Peihofluß in Ch1na verteidigen, an welchem Peking liegt. Vgl.
Tientsin.
Talanti (Atalanti), Stadt im griech. Nomos Phthiotis und
Phokis, 6 km von der Meerenge von T., welche das griechische
Festland von der Insel Negroponte (Euböa) scheidet, Sitz eines
Bischofs, mit (1879) 1377 Einw.
Talar (lat.), zunächst als Haustracht der kathol.
Geistlichen ein langer, gewöhnlich schwarzer Rock, der weit
und faltenreich vom Hals bis auf die Füße hinabgeht,
woraus sich später der T. als Amtskleid der evangelischen
Geistlichen, der Gerichtspersonen etc. entwickelte.
Talar (pers.), eine längliche Halle, Vorhalle, auch
Empfangssalon der Fürsten.
Talarien (lat.), die Flügelschuhe des Merkur.
Talaro, in Persien, Arabien etc. der
Mariatheresienthaler, = 4,20 Mk.
Talassio (Talassus), röm. Hochzeitsgott, dem
Hymenäos der Griechen entsprechend, gehörte zu den
verschollenen Göttern und wurde nur im Refrain ("Talasse") des
bei der Heimführung der Braut gesungenen Hochzeitsliedes
angerufen. Spätere Deutung machte ihn zu einem beim Raub der
Sabinerinnen beteiligten Genossen des Romulus.
Tala'ut, Gruppe kleiner ostind. Inseln, zwischen Celebes
und den Philippinen, nordöstlich von den Sangirinseln, in
administrativer Hinsicht zur niederländischen Residentschaft
Menado auf Celebes gehörig. Die Inseln, deren bedeutendste
Tulur (Karkelong), Salibabu und Kabruang heißen, sind
sämtlich fruchtbar, gut bevölkert und angebaut.
Talavera de la Réina, Bezirksstadt in der span.
Provinz Toledo, am Tajo, über den eine Steinbrücke mit 25
Bogen führt, und an der Eisenbahn Madrid-Lissabon, hat starke
Töpferei (im 16.-18. Jahrh. Hauptfabrikationsort der nach T.
benannten bemalten Fayencen), Wachszieherei und Bleicherei, eine
große Messe (im August) und (1878) 10,029 Einw. Hier 27. und
28. Juli 1809 Sieg Wellingtons über die Franzosen unter
König Joseph.
Talbot, John, s. Shrewsbury.
Talca, Provinz der südamerikan. Republik Chile,
liegt zwischen dem Rio Mataquito und dem schiffbaren Rio
Máule, reicht vom Stillen Ozean bis zum Kamm der Kordilleren
u. umfaßt 9527 qkm (173 QM.) mit (1885) 133,472 Einw. Landbau
und Viehzucht sind die Haupterwerbszweige. Gold kommt im
Flußsand vor, die Ausbeute aber ist unbedeutend. Die
Hauptstadt San Augustin de T., am Rio Claro, einem Nebenfluß
des Máule, 83 m ü. M., hat eine schöne Kathedrale,
eine höhere Schule, ein Hospital und (1875) 17,496 Einw., die
lebhaften Handel und Handweberei (Ponchos) betreiben. Eine
Eisenbahn verbindet Talca mit Santiago und Concepcion.
Talcahuana, Hafenstadt im südamerikan. Staat Chile,
Provinz Concepcion, 20 km von der Hauptstadt, ist Sitz der
Marinebehörden, hat ein Kriegsarsenal, Schiffwerfte, einen
Molo, an dem die größten Schiffe anlegen können,
und (1875) 2495 Einw. Die Einfuhr in den Hafen von T. betrug 1887:
5,492,628 Pesos, die Ausfuhr 5,504,767 Pesos.
Talch, s. Acacia, S. 74.
Talcium, s. v. w. Magnesium.
Talegalla, Huhn, s. Wallnister.
Taleman (schwed.), der Sprecher des Bauernstandes auf den
schwedischen Reichstagen.
Talent (griech.), ausgezeichnete geistige oder auch
körperliche Befähigung. In diesem Sinn spricht man von
mathematischem, philosophischem, künstlerischem etc., aber
auch technischem, mechanischem etc. T. Der innere Grund der
Verschiedenartigkeit der einzelnen Talente ist, wie alles, was
unter den allgemeinen Begriff der Anlage (s. d.) fällt, ein
Problem der Psychologie. Der Unterschied des Talents vom Genie ist
aber deshalb schwer festzustellen, weil das T. in seinen
höchsten Entfaltungen sich dem Genie bis auf einen
unmerklichen Abstand nähern kann. Im allgemeinen kann man
sagen, daß dem Genie die schöpferische
Ursprünglichkeit, mit der es sich seine eigne Bahn bricht und
neue Wirkungskreise aufthut, daher unter günstigen
Umständen der Kunst und Wissenschaft ganz neue Gebiete
öffnet, als Eigentum zuzusprechen sei, während sich das
T. an das Gegebene hält, das Vorhandene seinem Zweck
gemäß zu benutzen und umzuformen weiß, aber
weniger aus sich selbst produziert und auch weniger seinen eignen
Weg geht. Vgl. Genie.
Talent (griech. tálanton), bei den Griechen die
höchste Einheit für Gewicht und Geld, vorzüglich
Silbergeld, war eingeteilt in 60 Minen à 100 Drachmen
à 6 Obolen. Der Wert des Talents war zu verschiedenen Zeiten
und in verschiedenen Staaten verschieden. Das gewöhnlichste T.
war das von Solon eingeführte kleine attische, welches stets
gemeint ist, wenn T. ohne weitern Zusatz genannt wird. Dasselbe
hielt dem Gewicht nach 26,2 kg, als Geldsumme nach den neuesten
Berechnungen rund 4710 Mk. - Im jetzigen Griechenland ein Gewicht,
= 150 kg
499
Talfourd - Talisman.
Talfourd (spr. tälförd), Sir Thomas Noon, engl.
Dichter, geb. 26. Jan. 1795 zu Doxey bei Stafford, widmete sich der
juristischen Laufbahn, vertrat 1834 bis 1843 Reading im Parlament
und machte sich hier durch das Einbringen und die Verteidigung der
Copyright bill bekannt. 1849 wurde er zum Richter am Court of
Common Pleas ernannt und starb 20. März 1854 während
einer Anrede an den großen Gerichtshof zu Stafford.
Berühmt wurde T. durch seine Trauerspiele ("Dramatical works",
neue Ausg. 1852), deren erstes: "Ion", zugleich sein bestes, 1836
zur ersten Aufsührung kam. Außerdem schrieb er eine
Anzahl politischer und belletristischer Werke, darunter: "The life
of Charles Lamb" (neue Ausg. 1850. 2 Bde.) und "Vacation rambles
and thoughts, recollections of three continental tours" (3. Aufl.
1851. Supplement 1854).
Talg (Unschlitt, Inselt), das Fett der Rinder, Schafe,
Ziegen, Hirsche, ist farblos, riecht schwach eigentümlich, ist
härter bei Trockenfütterung, im warmen Klima und bei
männlichen Tieren, enthält durchschnittlich 75 Proz.
Stearin und Palmitin und 25 Proz. Olein. Rindertalg schmilzt bei
43,5-45°, ist unlöslich in kaltem, schwer löslich in
siedendem Alkohol; Hammeltalg ist härter, brüchig, fast
geruchlos, schwer löslich in Alkohol, schmilzt bei
46,5-47,5°. Ziegentalg ist dem Rindertalg ähnlich, riecht
aber stärker. über Hirschtalg s. d. Zur Gewinnung des
Talgs erhitzt man das zerschnittene Fett (Talglinsen) unter Zusatz
von einigen Prozenten Wasser unter beständigem Umrühren
im kupfernen Kessel, schöpft das geschmolzene Fett ab und
preßt endlich den Rückstand (Griefen, Grieben) aus.
Vorteilhafter schmelzt man die Linsen mit Dampf unter Zusatz von
etwa 1 Proz. Schwefelsäure in hölzernen, mit Blei
ausgeschlagenen Bottichen, bedeckt, um die übelriechenden
Dämpfe abzuleiten, die Kessel und bringt ein mit der Feuerung
in Verbindung stehendes Ableitungsrohr an, welches zur Verteilung
der Dämpfe mit einem Sieb endigt. Die Ausbeute beträgt
75-92 Proz. und ist im allgemeinen beim Schmelzen mit Dampf
größer als beim trocknen Schmelzen. Zur Reinigung wird
der T. wiederholt mit 5 Proz. Wasser, auch mit Alaun-, Salz- oder
Salpeterlösung umgeschmolzen, in kaltes Wasser gegossen und in
Spänen an der Sonne gebleicht. Auch durch Schmelzen mit etwa 1
Proz. Braunsteinpulver, 2 Proz. Schwefelsäure und 30 Proz.
Wasser, Abgießen, Versetzen mit 1 Proz. Oxalsäure und
abermaliges Abgießen kann T. gebleicht werden. Zum
Härten schmelzt man T. mit 0,5 Proz. Schwefelsäure und
0,5 Proz. Salpetersäure, wäscht aus und erhitzt bis zum
Verdunsten des Wassers, oder man rührt 0,007 Proz. Bleizucker
in das geschmolzene Fett ein. Man kann auch geschmolzenen T. auf
20-25° abkühlen lassen und das flüssig gebliebene
Olein abpressen. Das abgepreßte breiförmige Talgöl
dient zur Darstellung von Kunstbutter. Die größte Menge
T. liefert Rußland, im Süden mehr Hammeltalg
(weißer T.), im Norden hauptsächlich Rindertalg (gelber
T.). Je nach der Reinheit und Konsistenz unterscheidet man auch
Lichtertalg und Seifentalg, welch letzterer namentlich aus Sibirien
kommt. Auch Polen, Holland und Dänemark liefern viel und guten
T., welcher, wie die inländische Produktion, in Deutschland
dem russischen vorgezogen wird. Neuerdings wird auch T. aus
Australien und den La Plata-Staaten zugeführt. Man benutzt T.
als Nahrungsmittel, zu Kerzen, zur Darstellung von
Stearinsäure und Seife, in der Lederbereitung, zu
Schmiermitteln etc.
Talg, vegetabilischer, starres Pflanzenfett von
höherm Schmelzpunkt und der Zufammensetzung der echten Fette.
Chinesischer Talg, aus der festen Fettschicht, welche die Samen von
Stillingia sebifera umgibt, in China, Ost- und Westindien durch
Schmelzen und Abpressen gewonnen, ist farblos oder
grünlichweiß, ziemlich hart, schmilzt bei 37-44°,
besteht aus Stearin und Palmitin, reagiert sauer durch einen Gehalt
von Essigsäure und Propionsänre, dient in China und
England zur Darstellung von Kerzen und Seifen. Vateriatalg
(Pineytalg), aus den Samen der ostindischen Vateria indica durch
warmes Pressen gewonnen, ist gelblich, später farblos, riecht
schwach angenehm, schmilzt bei 36,4°, besteht aus festen Fetten
und freien Fettsäuren und enthält 2 Proz. fettes Öl,
dient in England zur Kerzenfabrikation. Virolafett, aus den Samen
von Virola sebifera in Guayana durch Auskochen und Pressen
gewonnen, ist gelblich, innen oft bräunlich mit
punktförmigen Kristallaggregaten, riecht frisch nach
Muskatbutter, wird bald ranzig, schmilzt bei 44°,
vollständig bei 50°, ist nur teilweise verseifbar, dient
zur Kerzen- und Seifenfabrikation. Myricawachs (Myrtle-,
Myrtenwachs), aus den Beeren von Myrica cerifera und M.
carolinensis in Nordamerika, M. caracassana in Neugranada und M.
quercifolia, cordifolia, laciniata am Kap durch Auskochen mit
Wafser gewonnen, ist grünlich, riecht sehr schwach balsamisch,
schmilzt bei 42,5-49°, besteht aus Fetten, wird wie Bienenwachs
und mit diesem gemengt verwendet. Japanisches Wachs, aus den Samen
von Rhus succedanea in China und Japan durch warmes Pressen
gewonnen, ist blaßgelblich, wachsartig, nach längerm
Liegen außen gelb bis bräunlich mit schneeweißem
Anflug, schmilzt bei 52-53°, besteht wesentlich aus Palmitin
und ist von allen vegetabilischen Talgarten die wichtigste. Es
kommt seit 1854 aus Japan und Singapur, zum Teil über China,
in großen Mengen nach Europa und Amerika und wird zur
Kerzenfabrikation und wie Bienenwachs, auch mit diesem gemengt
benutzt. Über die Bassiafette (Schibutter, Galambutter etc.)
s. Bassia.
Talgbaum, mehrere festes Pflanzenfett liefernde Pflanzen,
namentlich: Stillingia sebifera, Vateria indica, Myrica
cerifera.
Talgdrüsen, s. Hautdrüsen.
Talglichte, s. Kerzen, S. 696.
Talgsäure, s. v. w. Stearinsäure.
Talgstoff, s. v. w. Stearin.
Talha, s. Acacia, S. 74.
Talhaka, König, s. Tirhaka.
Talifu, Stadt in der chines. Provinz Jünnan, deren
Bewohner als Hauptbeschäftigung die Bearbeitung von
Marmorplatten betreiben, welche bei dem Dorf Tiensing gebrochen
werden, und die sich durch ihr wunderbares Farbenspiel auszeichnen.
Es war nach 1857 Hauptstadt der aufständischen muselmanischen
Panthai, bis es Ende 1872 wieder von den Chinesen eingenommen
wurde.
Talion [Dehnungsstrich auf dem o] (lat.), Vergeltung
einer Handlung durch eine gleiche; daher Jus talionis, das Recht
der Wiedervergeltung; Poena talionis, die Strafe der Vergeltung,
die in den ältern germanischen Rechten sowie bei den Griechen
und Römern üblich war.
Talipes (lat.), der Klumpfuß.
Talisman, Bild von Metall oder Stein, welchem die Kraft
innewohnen soll, denen, die es tragen, oder in und an deren
Wohnungen es sich befindet, Schutz gegen Krankheit und Zauberei zu
gewähren sowie überhaupt Glück zu bringen. Diese
magischen Bilder
500
Talismanexpedition - Talleyrand.
mit der Metallreligion der alten Akkadier zusammenhängend,
waren besonders im alten Babylon und Ninive im Gebrauch, woselbst
kein Gebäude ohne schützendes Bild (meist
Zwittergestalten von Göttern, Menschen und Tieren) gebaut
wurde. Auch in den arabischen Erzählungen spielt der T. eine
wichtige Rolle. Ähnliche Dinge waren die Skarabäen der
Ägypter, die Abraxasgemmen der Gnostiker (s. Abraxas), die
Alraunen und der Allermannsharnisch des Mittelalters, die
Siegessteine der Wielandsage und die meist nur mit magischen
Zeichen und Sprüchen beschriebenen Amulette (s. d.). Das Wort
T. findet sich in fast allen europäischen Sprachen und wird
aus das arabische tilsam (Zauberbild, Plural tilsamât oder
talâsim) zurückgeführt. Vgl. Lenormant, Die Magie
und Wahrsagekunst der Chaldäer (deutsch, Jena 1878); Fischer
und Wiedemann, Babylonische Talismane (Stuttg. 1881).
Talismanexpedition, 1883, s. Maritime wissenschaftliche
Expeditionen, S. 285.
Taliter qualiter (lat.), so gut es eben geht.
Talith (hebr.), der vom Gesetz (4. Mos. 15, 37 ff.)
gebotene shawlförmige Gebetmantel der Juden.
Talje, im Seewesen s. v. w. Flaschenzug; das bei der T.
zur Anwendung kommende Tau heißt deren Läufer; das an
dem einen Block der T. befestigte Ende des Läufers die feste
Part, das andre Ende desselben die lose oder die holende Part. Um
auf die holende Part eine Zugkraft ausüben zu können, ist
es meist erforderlich, deren Richtung durch einen sogen. Leitblock
zu verändern; der Klappläufer ist ein Leitblock, dessen
obere Backe zum Aufklappen eingerichtet ist, so daß der
Taljenläufer direkt auf die Scheibe des Leitblocks gebracht
werden kann.
Taljereeps, s. Takelung, S. 495.
Talk, Mineral aus der Ordnung der Silikate (Talkgruppe),
kristallisiert wahrscheinlich rhombisch, zeigt nur selten
tafelförmige Kristalle, bildet gewöhnlich schalige,
blätterige, schieferige, auch dichte, weiße,
grünliche oder gelbliche, selten farblose Aggregate. T. ist in
dünnen Lamellen durchsichtig, besitzt Perlmutter- oder
Fettglanz, ist sehr mild und fühlt sich fettig an. Härte
1, spez. Gew. 2,69-2,80. Der chemischen Zusammensetzung nach ist T.
mit Speckstein (s. d.) identisch und entspricht, wie dieser, der
chemischen Formel H2Mg3Si4O12. Oft tritt auch etwas Eisen und
Aluminium in die Zusammensetzung ein. T. ist ein häufiges
Mineral, bildet als Talkschiefer (s. d.) ein einfaches Gestein,
kommt aber auch untergeordnet auf Lagern, Nestern, Gängen, im
Gemenge mit andern Mineralspezies, ferner als Überzug vor.
Hauptfundorte sind: Tirol, Steiermark und die Schweiz. Er dient,
ähnlich wie Speckstein, als Maschinenschmiere, als
Poliermaterial für weiche Gegenstände, in der
Schminkebereitung etc.
Talkeisenstein, s. Magneteisenerz.
Talken, böhm. Hefengebäck aus Butterteig in
Kloßform, wird mit Pflaumenmus bestrichen, mit zerriebenem
Pfefferkuchen bestreut und mit zerlassener brauner Butter
begossen.
Talkerde, s. Magnesia.
Talkhydrat, s. Brucit.
Talkschiefer, einfaches Gestein, schieferiger Talk von
unreinen weißen, gelblichweißen, grünlichgrauen
und lichtgrünen bis ölgrünen Farben, von fettigem
Glanz und großer Weichheit beim Anfühlen. Er kommt
dünn und dickschieferig, als reines Talkgestein, aber auch mit
Quarz und Feldspat gemengt vor. Er bildet Übergänge,
namentlich zu Chloritschiefer. Als accessorische Bestandteile
enthält er: Glimmer, Chlorit, Magneteisen, Strahlstein,
Cyanit, Staurolith, Turmalin, Granat, Asbest, Magnesit, Bitterspat,
Eisenkies, Gold. Er ist ein Glied der huronischen Formation und
meist dem Glimmerschiefer untergeordnet, in welchem er dann oft mit
Chloritschiefern, Hornblendegesteinen, oft auch in Verbindung mit
Serpentin auftritt. Mit Chlorit oder mit diesem und Asbest innig
gemengt, bildet er ein dichtes Gestein, den Topfstein (s. d.). Im
ganzen von beschränkter Verbreitung, tritt der T. auf in den
Alpen, so im Montblanc- und Monte Rosa-Gebirge, in Graubünden
und Oberitalien, in den Tauern und am Bachergebirge, im Apennin, in
Schweden, sehr ausgedehnt im Ural, in Nordamerika, in Brasilien,
hier die Lagerstätte der Topase, des Euklases, sehr
beschränkt im Fichtelgebirge, als Topfstein in
Graubünden, bei Chiavenna (Lapis comensis). Wegen seiner
Feuerfestigkeit benutzt man T. zu Gestellsteinen.
Talkspat, s. Magnesit.
Tallahassee, Hauptstadt des nordamerikan. Staats Florida,
mit Staatenhaus und (1880) 2293 Einw. T. wurde erst 1824 angelegt.
Am 7. Jan. 1861 wurde hier die Sezessionsordinance angenommen.
Tallart (spr. -lar), Camille, Graf von, Herzog von
Hostun, Marschall von Frankreich, geb. 14. Febr. 1652 in der
Dauphiné, focht zuerst unter dem großen Conde in den
Niederlanden, dann 1674 und 1675 unter Turenne im Elsaß und
1678 als Marechal de Camp am Rhein. 1690 überschritt er, um
den Rheingau zu plündern, den Rhein auf dem Eis. Im spanischen
Erbfolgekrieg kommandierte er 1702 ein Korps am Rhein unter dem
Oberbefehl des Herzogs von Burgund. 1703 erhielt er den
Marschallsstab, eroberte Breisach, belagerte Landau und schlug den
zum Entsatz herbeirückenden Prinzen von Hessen bei Speier.
1704 führte er dem Kurfürsten von Bayern 35,000 Mann
Hilfstruppen zu, um mit ihm gemeinschaftlich in Österreich
einzudringen, fiel aber in der Schlacht bei Höchstädt in
englische Gefangenschaft. Nach seiner Befreiung (1712) erhielt er
den Herzogstitel, 1715 die Pairswürde. Seitdem lebte er den
Wissenschaften und der Staatskunst. In seinem Testament ernannte
ihn Ludwig XIV. zum Mitglied des Regentschaftsrats, allein der
Herzog von Orléans vollzog als Regent diese Bestimmung
nicht. 1724 erwählte die Akademie der Wissenschaften T. zu
ihrem Präsidenten. Von Ludwig XV. 1726 zum Staatsminister
ernannt, starb er 20. März 1728.
Talleyrand (spr. tall'rang), altes franz. Geschlecht,
stammt von einem Zweig der Grafen de la Marche, der sich in die
Linien Périgord, welche 1400 erlosch und T. (so benannt nach
einem Gut in Périgord) teilte. Der erste Graf von T. war
Hélier (um 1100). Die drei Linien der Talleyrands stammen ab
von Daniel Marie Anne, Marquis von T., Fürsten von Chalais,
welcher 1745 bei der Belagerung von Tournai blieb und fünf
Söhne hinterließ. Der Stifter der ersten Linie war
Gabriel Marie von T., der von Ludwig XV. den Titel eines Grafen von
Périgord zurückerhielt. Sein Enkel Augustin Marie Elie
Charles, Fürst von T., Herzog von Périgord, geb. 10.
Jan. 1788, diente unter Napoleon I., ward unter den Bourbonen zum
Obersten befördert und starb 11. Juni 1879. Mit seinem Sohn,
dem Fürsten Elie Roger Louis von T., Herzog von
Périgord (geb. 23. Nov. 1809), erlosch die Linie 1883. Der
Stifter der zweiten Linie war Charles Daniel von T., gest. 1788.
Dessen Sohn war der berühmte Diplomat (s. unten). Jetziger
Chef derselben ist Napoléon Louis, Herzog von T.-
501
Talleyrand-Périgord
Périgord, geb. 12. März 1811, seit dem Tod seiner
Mutter, der Herzogin von Kurland (gest. 19. Sept. l862), Herzog von
Sagan; sein Bruder ist Alex andre Edmond, Marquis von
T.-Périgord, geb. 15. Dez. 1813, durch Zession seines Vaters
Herzog von Dino und seit dem Tod seiner Mutter Besitzer der
Herrschaft Deutsch-Wartenberg in Schlesien, die er 1879 an den
ehemaligen preußischen Minister Friedenthal verkaufte. Der
Gründer der dritten Linie war Louis Marie Anne, 1788
französischer Gesandter zu Neapel; dessen vierter Bruder,
Alexandre Angélique, geb. 16. Okt. 1736, widmete sich dem
geistlichen Stand, ward 1777 Erzbischof von Reims und mußte
1791 auswandern, begleitete als Beichtvater den nachmaligen
König Ludwig XVIII. nach Mitau und später nach England.
Nach der Restauration wurde er zum Pair, 1817 zum Erzbischof von
Paris und Kardinal erhoben. In dieser Stellung übte er
großen Einfluß auf die Gestaltung der kirchlichen
Verhältnisse, starb jedoch schon 20. Nov. 1821. Chef der
dritten Linie ist jetzt Charles Angélique, Graf von
T.-Périgord, geb. 8. Nov. 1821, er war 1862 bis 1864
französischer Gesandter zu Berlin, 1864-69 in Petersburg.
Talleyrand-Périgord (spr. tall'rang-perigör),
Charles Maurice, Prinz von T., Fürst von Benevent,
berühmter Diplomat, geb. 13. Febr. 1754 zu Paris, wurde,
obschon erstgeborner Sohn, wegen einer Fußlähmung zum
geistlichen Stand bestimmt. 1780 ward er zum Generalagenten des
Klerus in Frankreich und 1788 zum Bischof von Autun ernannt. Als
Mitglied der Nationalversammlung von 1789 stimmte er 19. Juni 1789
für die Vereinigung des geistlichen Standes mit dem dritten,
ward 16. Febr. 1790 Präsident, trug auf feste Besoldung der
Geistlichkeit, Abschaffung der Zehnten, Verkauf der geistlichen
Güter und Einführung gleichen Maßes und Gewichts in
ganz Frankreich an und entwarf einen freisinnigen Unterrichtsplan.
Beim Bundesfest 14. Juli 1790 hielt er auf dem Marsfeld das Hochamt
am Altar des Vaterlandes, leistete als einer der ersten den Eid auf
die Konstitution und weihte die ersten konstitutionellen Priester.
Infolge davon vom Papst Pius VI. 1791 mit dem Bann belegt, legte er
sein Bistum nieder. 1792 des Royalismus verdächtigt, entfloh
er nach Nordamerika, wo er Handelsgeschäfte trieb. Nach dem
Sturz der Schreckensherrschaft kehrte er 1795 zurück. Nach dem
Staatsstreich vom 18. Fructidor (1797) übernahm er auf kurze
Zeit das Ministerium des Auswärtigen. Er schloß sich
jetzt Bonaparte an, half diesem nach seiner Rückkehr von
Italien beim Staatsstreich vom 18. Brumaire (1799), übernahm
das Portefeuille des Auswärtigen und war seitdem Napoleons
kluger diplomatischer Ratgeber. Die Friedensunterhandlungen von
Lüneville, Amiens, Preßburg, Posen und Tilsit leitete er
vornehmlich; auch das Konkordat, durch welches 1802 der
Katholizismus in Frankreich wiederhergestellt ward, war
größtenteils sein Werk. Zum Dank dafür entband ihn
Papst Pius VII. von den geistlichen Weihen und erteilte seiner
Zivilehe mit Madame Grant die kirchliche Legitimation. Nach
Errichtung des Kaiserthrons ernannte ihn Napoleon zum
Großkämmerer von Frankreich und 1806 zum souveränen
Fürsten von Benevent. Zwar erhob ihn Napoleon noch im August
1807 zum Vizegroßwahlherrn (vice-grand-électeur) und
nahm ihn 1808 mit nach Bayonne und Erfurt; doch war T. gegen die
unaufhörlichen Eroberungskriege, fiel deshalb in Ungnade,
verlor seinen Ministerposten und zog sich 1808 auf sein Landgut
Valençay zurück. Nach der Katastrophe in Rußland
trat er in geheime Unterhandlungen mit den Bourbonen und betrieb
nach dem Einrücken der Verbündeten in Frankreich ihre
Restauration. Als Ludwig XVIII. die Regierung angetreten, wurde T.
zum Fürsten, Pair, Oberkammerherrn und Minister des
Auswärtigen ernannt. Die glänzendsten Triumphe
diplomatischer Kunst feierte er auf dem Kongreß zu Wien, wo
er sich durch das von ihm erfundene Prinzip der Legitimität
zum Mittelpunkt aller Verhandlungen machte. Mit
außerordentlicher Gewandtheit verwirrte er die Interessen der
Mächte und ermüdete den Kongreß, um ihn desto
sicherer zu beherrschen und für Frankreich die möglichst
größten Vorteile zu erlangen. Schon hatte er 5. Jan.
1815 Österreich und England für ein geheimes Bündnis
mit Frankreich gegen Rußland und Preußen gewonnen, als
Napoleons Rückkehr diesen Umtrieben ein Ende machte. Ein
Versuch Napoleons, T. wieder für sich zu gewinnen,
mißlang, und als jener darauf den Fürsten in die Acht
erklärte, rächte sich dieser dadurch, daß er die
Ächtung Napoleons bei den Verbündeten aufs eifrigste
betrieb. Nach der zweiten Restauration übernahm T. aufs neue
das Portefeuille der auswärtigen Angelegenheiten zugleich mit
der Präsidentschaft im Ministerium, legte aber sein Amt noch
vor dem zweiten Pariser Frieden nieder, da die reaktionäre
Hofpartei ihn als Revolutionär verabscheute und
bekämpfte. Der König beider Sizilien schenkte ihm 1816
das Fürstentum Dino; doch übertrug T. den Titel eines
Herzogs von Dino schon 1827 auf seinen Neffen, den Herzog Edmond,
der ihn seinem zweiten Sohn, Alexandre Edmond, vererbte. Nach Karls
X. Thronbesteigung (1824) zog sich T. nach Valençay
zurück. In der letzten Zeit der Restauration gehörte er
in der Pairskammer zur Opposition und war auch an der
Julirevolution nicht unbeteiligt. Er riet, um seine Meinung
befragt, Ludwig Philipp zur Annahme der Krone. Auch ging er als
Botschafter nach London, wo er eine Verständigung über
die griechische und belgische Frage zu stande brachte. Die
Unterzeichnung der Quadrupelallianz 1834, durch welche
zunächst im europäischen Westen das konstitutionelle
Prinzip aufrecht erhalten werden sollte, war sein letztes
diplomatisches Werk. Er lebte fortan zurückgezogen in
Valençay, wo er 17. Mai 1838 starb. Sein Gelst und sein
schlagfertiger, feiner Witz in der Unterhaltung, seine kurze,
treffende Ausdrucksweise sind berühmt. Eine Menge
glücklicher Wendungen werden von ihm überliefert und sind
geflügelte Worte geworden. Die bekannteste (freilich nicht
zuerst von T. herrührende) ist, daß dem Menschen die
Sprache gegeben sei, um seine Gedanken zu verbergen. Sehr bequem,
verstand er vortrefflich die Kunst, andre für sich arbeiten zu
lassen. Egoist im höchsten Grad, war er, von der Sucht nach
Gold abgesehen, fast ohne alle Leidenschaften, verstand es aber
vortrefflich, andrer Leidenschaften für sich auszubeuten. Sein
auf 18 Mill. Frank sich belaufendes Vermögen vermachte er
größtenteils seiner Nichte, der Herzogin von Dino. Von
seinen hinterlassenen Memoiren ist bisher nur ein Auszug ("Extraits
des mémoires du prince T.", Par. 1838, 2 Bde.)
veröffentlicht. Seine Korrespondenz mit Ludwig XVIII.
während des Wiener Kongresses gab Pallain (Par. 1881, 2 Bde.;
deutsch von Bailleu, Leipz. 1887), "Lettres inédites de T.
à Napoléon 1800-1809" (Par. 1889) Bertrand und die
"Correspondance diplomatique de T. La mission de T. à
Londres en 1792" Pallain (das. 1889) heraus. Vgl. Pichot, Souvenirs
intimes sur T. (Par. 1870).
502
Tallien - Talmud.
Tallien (spr. talliâng), Jean Lambert, franz.
Reolutionsmann, geb. 1769 zu Paris, war beim Ausbruch der
Revolution Advokatenschreiber, wurde 10. Aug. 1792 zum
Generalsekretär des neugebildeten revolutionären
Gemeinderats ernannt, Ende d. J. in den Nationalkonvent
gewählt, gesellte sich hier zu der Bergpartei und drang auf
die Verurteilung und Hinrichtung des Königs ohne Aufschub und
Appellation an das Volk. Am Tag der Hinrichtung Ludwigs wählte
ihn der Konvent zum Präsidenten. Im April 1793 ging er als
Konventsdeputierter nach den aufrührerischen westlichen
Departements und veranlagte dort zahlreiche Hinrichtungen. Durch
seine stürmische Beredsamkeit trug er im Mai viel zum Sieg der
Bergpartei über die Girondisten bei. Vom Konvent nach Bordeaux
gesandt, um die der Guillotine Entflohenen ausfindig zu machen,
ließ er sich dort durch die Frau v. Fontenay (s. unten), die
er im Gefängnis kennen lernte, und zu der er eine
glühende Neigung faßte, zu mildern Maßregeln
bestimmen. Als Robespierre seine Geliebte von neuem verhaften
ließ, verband sich T. mit Dantons Anhängern zu seinem
Sturz, den er auch 9. Thermidor (1794) durchsetzte. Hierauf zum
Präsidenten des Wohlfahrtsausschusses gewählt, hob er das
Revolutionstribunal auf, schloß den Jakobinerklub und suchte
überhaupt der Schreckensherrschaft zu steuern. Nach der
Auflösung des Konvents (26. Okt. 1795) trat er in den Rat der
Fünfhundert; doch verlor er in ruhigern Zeiten seine Bedeutung
und verkam. 1798 schloß er sich der Expedition Bonapartes
nach Ägypten an, erhielt dort eine Stelle bei der Verwaltung
der Nationaldomänen und gab ein Journal: "Décade
égyptienne", heraus. Nach Bonapartes Abreise aus
Ägypten wurde er von Menou nach Frankreich
zurückgeschickt, fiel aber in englische Gefangenschaft und
ward nach London gebracht. Nach seiner Rückkehr nach Paris
erhielt er den Posten eines französischen Konsuls zu Alicante,
lebte später, auf einem Auge erblindet, in Paris von einem
Gnadengehalt, den ihm Napoleon I. bewilligte, und starb 20. Nov.
1820. - Seine Gemahlin Jeanne Marie Ignazie Therese, geb. 1775 zu
Saragossa, Tochter des spanischen Finanzmanns, spätern
Ministers Grafen Cabarrus, erhielt eine vorzügliche Erziehung,
entzückte in Paris alles durch ihre Schönheit und Grazie,
heiratete 1790 den alten Marquis de Fontenay, flüchtete mit
diesem vor den Greueln der Revolution nach Spanien, ward aber in
Bordeaux verhaftet, von T. befreit und, nachdem die Ehe mit dem
Marquis geschieden worden, dessen Geliebte. Sie war zwar eine
eifrige Anhängerin der Revolution, bewog aber T. zur Milde und
rettete viele Opfer. Nach einer Rede im Konvent für die Frauen
ward sie auf Robespierres Befehl verhaftet, aber durch seinen Sturz
wieder befreit, worauf sie T. heiratete. Während des
Direktoriums war ihr Salon der gefeiertste und besuchteste von
Paris. Da T. mehr und mehr von seiner frühern Größe
herabsank, trennte sie sich während seiner Abwesenheit in
Ägypten von ihm und heiratete 1805 den Grafen von Caraman,
spätern Fürsten von Chimay (s. d.). Sie starb 15. Jan.
1835 auf dem Schloß Ménars bei Blois.
Tallipotbaum, s. Corypha.
Talma, François Joseph, berühmter franz.
Schauspieler, geb. 15. Jan. 1763 zu Paris, begann seine
öffentliche theatralische Laufbahn im April 1787 auf dem
Théâtre-Français als Seïde im "Mahomet"
von Voltaire und wurde zwei Jahre später Societär dieses
Instituts. Später begründete er das Théâtre
de la République, auf dem er große Triumphe feierte,
gastierte auch in der Provinz sowie in London und Belgien. Die
Wahrheit seiner Darstellungen, die Natürlichkeit des Spiels
und die Treue, mit der er sich zuerst des geschichtlichen
Kostüms statt des modernen französischen bediente,
begründeten eine neue Epoche in der dramatischen Kunst
Frankreichs. Seine Hauptrollen waren: Seïde, Orest,
Vendôme, Hamlet, Regulus, Karl IX., Sulla etc. Napoleon L
hatte ihn oft unter seiner Umgebung, so 1808 zu Erfurt und 1813 zu
Dresden. T. starb 19. Okt. 1826 in Paris. Seine "Réflexions
sur Lekain et sur l'art théâtral" (Par. 1825, neue
Ausg. 1874) zeugen von tiefer Einsicht in das Wesen der
Schauspielkunst. Seine "Mémoires" wurden herausgegeben von
Moreau (Par. 1826) und A. Dumas (das. 1849-50, 4 Bde.). Vgl. Copin,
T. et la revolution (Par. 1886); Derselbe, T. et l'empire (das.
1887). - Auch seine Gattin Charlotte Vanhove, geb. 10. Sept. 1771
im Haag, erst als Mademoiselle Vanhove, dann (bis 1794) als Madame
Petit-Vanhove und zuletzt (seit 1802) als Madame T. bekannt, war
eine der größten Schauspielerinnen ihrer Zeit, zog sich
aber schon 1811 von der Bühne zurück und starb 11. April
1860 in Paris. Sie schrieb "Études sur l'art
théâtral" (Par. 1835).
Talmigold, gelbe Kupferlegierung (z. B. aus 86,4 Teilen
Kupfer, 12,2 Zink, 1,1 Zinn, 0,3 Teilen Eisen), welche als Blech
oder Draht mit Gold plattiert und dann weiter verarbeitet wird. Der
Goldgehalt des Talmigoldes übersteigt zwar selten 1 Proz.;
dennoch ist es den gewöhnlichen vergoldeten Kupferlegierungen
vorzuziehen, da die Plattierung manche Vorteile gewährt. Das
beste T. liefert Tallois in Paris; man unterscheidet es von schwach
vergoldeter Ware durch Auflösen in Salpetersäure, wobei
ein zusammenhängendes dünnes Goldblättchen
zurückbleiben muß.
Talmud (Thalmud, "Lehre, Belehrung^), die Hauptquelle des
rabbinischen Judentums, das bändereiche Schriftdenkmal aus den
ersten fünf Jahrhunderten n. Chr., welches den gesamten
religionsgesetzlichen Stoff der jüdischen Tradition, nicht
systematisch geordnet, sondern in ausführlichen freien
Diskussionen, mit erbaulichen Betrachtungen, Parabeln, Legenden,
historischen und medizinischen Thematen u. a. vermischt,
enthält. Die Entstehungsgeschichte des T. erhellt aus
folgendem. Neben dem im Pentateuch enthaltenen schriftlichen Gesetz
hatte sich ein dieses ergänzendes und erklärendes
mündliches Gesetz von Geschlecht zu Geschlecht vererbt,
welches mit der Erweiterung und Änderung des sozialen Lebens
im Lauf der Zeit derart anwuchs, daß eine Sichtung und
schriftliche Fixierung des ganzen Materials sich als notwendig
erwies. Diese in hebräischer Sprache, der aber bereits
lateinische und griechische Ausdrücke eigen sind, von R.
Jehuda Hanassi im Verein mit gelehrten Zeitgenossen 189 n. Chr.
abgefaßte Sammlung mündlich überlieferter Gesetze
und Gebräuche (Halachot) führt den Namen Mischna
("Wiederholung", nämlich des Gesetzes) und zerfällt in
sechs Ordnungen (Sedarim): 1) Seraim (von den Saaten), 2) Moëd
(Feste), 3) Naschim (Ehegesetze), 4) Nesikin (Zivil- und
Strafgesetze), 5) Kodaschim (Opfer- und Speisegesetze), 6) Taharot
(Reinheitsgesetze). Die von R. Jehuda nicht aufgenommenen Gesetze
wurden später von seinen Jüngern gesammelt und
führen den Namen Boraitha (außerhalb [des Kanons]
stehende), eine noch spätere Sammlung heißt Tossefta. In
den Akademien Palästinas und Babylons bildete die Mischna nun
die Grundlage der gelehrten Verhandlungen, welche, später
gesammelt, Gemara (vollständige Erklärung) oder, mit der
Mischna ver-
503
Talon - Tamarindus.
bunden, T. genannt wurden. Zu Anfang des 4. Jahrh. entstand in
Palästina der jerusalemische T., in aramäischem Idiom
geschrieben, die vier ersten Ordnungen der Mischna behandelnd; um
500 war der babylonische T., bald aramäisch, bald
rabbinisch-hebräisch abgefaßt, redigiert. Von
ältern Mischnaerklärern sind Maimonides, der auch einen
wissenschaftlichen Kodex des T. ("Mischne Thora" oder "Jad
ha-chasaka") abfaßte (1178-80), Bartenora, Liepmann Heller
("Tosefot Jom-tob"), von Übersetzern der Mischna, die schon im
10. Jahrh. ins Arabische, später ins Spanische übertragen
ward, Surenhusius (lateinisch), Rabe (deutsch) und Jost (deutsch
mit hebräischen Lettern), Samter-Baneth, von Lehrbüchern
und Einleitungen zur Mischna die Werke von Geiger, Dukes,
Weiß, Z. Frankel, der auch eine "Einleitung zum
jerusalemischen T." schrieb, und Jakob Brüll zu nennen.
Erklärer des babylonischen T. sind neben Raschi die
Tossafisten (Glossatoren), eine Reihe meist nordfranzösisther
Rabbiner, Rosch (R. Ascher ben Jechiel, 1306-27) u. a.
Wörterbücher verfaßten: R. Natan ben Jechiel aus
Rom ("Aruch", 1101), Buxtorff (2. Aufl. von Fischer, Leipz.
1866-1870, 2 Bde.), Levy (das. 1875-89) und Kohut ("Aruch
completum", auf Grundlage des "Aruch" von R. Natan ben Jechiel,
Wien 1878 ff.); einzelne Traktate übersetzten: ins Lateinische
Riecius, Clarke, Ullmann, Surenhus, Lund, Ludovic, Coccejus,
Hirschfeld, Fagius, Hartmann u. a.; ins Französische Schwab,
Rabbinowicz; ins Deutsche Ewald, Pinner, Samter und Rawitsch. Der
babylonische T. in seinen haggadischen Bestandteilen ist von
Wünsche übersetzt (Leipz. 1886 ff.). Die Methode und
einzelne Disziplinen des T. behandelten: Hirschfeld (Exegese),
Lewysohn (Zoologie des T.), Wunderbar (Medizin), Markus
(Pädagogik), Duschak (Botanik), Bloch (Polizeirecht), Auerbach
(Obligationenrecht), Rabbinowicz (Zivil- und Kriminalrecht),
Zuckermann (Mathematik), Frankel (gerichtlicher Beweis), Fassel
(Zivilrecht, Tugend- und Rechtslehre, Strafrecht) u. a.; eine
Realencyklopädie des T. gab Hamburger (Neustrelitz 1883)
heraus; die Evangelien erläuterte aus T. und Midrasch Aug.
Wünsche (Götting. 1878). Vgl. Rabbinowicz, Kritische
Übersicht der Gesamt- und Einzelausgaben des Babylonischen T.
(Münch. 1877); Deutsch, Der T. (a. d. Engl., Berl. 1869);
Weber, Die Lehren des T. (Leipz. 1886).
Talon (franz., spr. -óng, "Ferse"), bei
Wertpapieren der Erneuerungsschein für die Koupons (s.d.); im
Kartenspiel die nach dem Geben übriggebliebenen Karten, die
Kaufkarten; im Hasard der Kartenstamm, welchen der Bankier abzieht;
im Domino die Kaufsteine.
Talos, nach dem Mythus der Alten ein eherner Riese auf
Kreta, der als Wächter des Minos die Insel täglich
dreimal umkreiste und die Herannahenden durch Steinwürfe
verscheuchte oder mit den Gelandeten ins Feuer sprang und sie so
lange an seine glühende Brust drückte, bis sie
verbrannten. Von seinem Kopf ging eine Blutader bis zur Ferse, wo
sie durch einen Nagel geschlossen war. Als die Argonauten nach
Kreta kamen, ließ Medea den Nagel durch Zaubergesang
herausspringen (oder Pöas, der Vater des Philoktet,
schoß ihn mit dem Bogen heraus), worauf T. verblutete. Sein
Tod ist auf einem ausgezeichneten apulischen Vasengemälde
dargestellt, wo T. infolge des Zaubers der Medea in den Armen der
Dioskuren stirbt. T. gilt für ein altes Symbol des
Sonnengottes und ist mit dem phönikischen Moloch verwandt.
Vgl. Mercklin, Die Talossage und das Sardonische Lachen (Petersb.
1851).
Talpa (lat.), Maulwurf.
Taltal, Hafenort im südamerikan. Staat Chile,
Provinz Atacama, mit 1876 entdeckten Salpeterlagern.
Talus (lat.), Sprungbein.
Talus (franz., spr. -lüh), s. Böschung.
Talvj, Pseudonym, s. Robinson 3).
Taman, Halbinsel zwischen dem Schwarzen und Asowschen
Meer, zum kubanischen Landstrich gehörig, mit der
gleichnamigen Bai und dem kleinen Orte T., war im Altertum Sitz
blühender Kolonien der Griechen, an deren Stellen (z. B. bei
Sennaja, vermutlich der Stätte des alten Phanagoria) seit 1859
erfolgreiche Ausgrabungen veranstaltet wurden. In den aufgedeckten
Kurganen fand man Gerippe von Menschen und Tieren (Pferden) und
viele Geräte meist griech. Ursprungs, die jedoch nicht
über das 4. Jahrh. v.Chr. zurückreichen. Vgl. Görtz,
Archäologische Topographie der Halbinsel T. (russ., Mosk.
1870).
Tamandua, s. Ameisenfresser.
Tamanieh (Tamanib), Dorf in Nubien, südwestlich von
Suakin am Wadi Chab und der über Sinkat nach Berber
führenden Straße. Hier 13. und 25. März 1884
Gefechte des englischen Generals Graham gegen Osman Digma, in
welchem der letztere zwar geschlagen und das Dorf eingenommen und
verbrannt wurde, die Engländer aber ihren Zweck, die Forts
Sinkat und Tokar zu entsetzen, nicht erreichen konnten.
Tamaquna, Stadt im nordamerikan. Staat Pennsylvanien, am
Schuylkill inmitten ergiebiger Kohlengruben, mit (1880) 5730
Einw.
Tamar (Tamer, spr. tähmer), Grenzfluß zwifchen
den englischen Grafschaften Cornwall und Devon, mündet in den
Plymouthsund; 96 km lang. Sein Ästuar bildet die berühmte
Reede Hamoaze. Er ist bis Launceston schiffbar, von wo ein Kanal
nach Budehaven an der Nordküste von Cornwall führt.
Tamara, ital. Würzpulver aus Koriander, Zimt,
Nelken, Fenchel und Anis; wird in der Küche wie Curry-powder
(s. d.) benutzt.
Tamarikaceen (Tamariskenartige), dikotyle, etwa 40 Arten
umfassende Familie aus der Ordnung der Cistifloren, Holzpflanzen,
selten Stauden mit kleinen, oft schuppenförmigen,
blaugrünen, abwechselnden Blättern und
regelmäßigen, zwitterigen, 4-5zähligen, in
Ähren, Köpfen, Trauben oder Rispen stehenden Blüten.
Von den verwandten Familien unterscheiden sich die T.
hauptsächlich durch einen Haarschopf am Samen. In Deutschland
kommt nur Tamarix (Myricaria) germanica Devs. an kiesigen
Flußufern vor, deren Rinde wie auch die der am Mittelmeer
heimischen Tamarix gallica L. früher offizinell war. Der
Familie der T. werden auch die kleinen Gruppen der Reaumurieen und
Fouquiereen beigezählt.
Tamarindus Tourn. (Tamarinde), Gattung aus der Familie
der Cäsalpinieen, mit der einzigen Art T. indica L. (s. Tafel
"Arzneipflanzen II"), ein bis 25 m hoher, immergrüner Baum mit
weit ausgebreiteter, sehr verästelter Krone, abwechselnden,
paarig gefiederten, 10-20jochigen Blättern,
linealisch-länglichen Blättchen, wenigblütigen,
endständigen Blütentrauben, weißen, purpurn
geäderten Blüten und gestielten, bis 15 cm langen, 2,5 cm
breiten, länglichen oder lineal-länglichen, meist etwas
gekrümmten, mäßig zusammengedrückten
Hülsen, welche in dünner, zerbrechlicher, gelbbrauner,
rauher Schale ein schwarzes oder braunes Mus und in diesem rundlich
viereckige, glänzend rotbraune Samen enthalten. Die Tamarinde
ist im tropischen Afrika, südwärts bis zum Sambesi,
heimisch, wohl auch im südlichen
504
Tamarix - Tambow.
Asien und in Nordaustralien, und wird in diesen Ländern und
in Amerika kultiviert. Man genießt die Früchte als Obst,
macht sie auch ein und bereitet daraus kühlende Getränke
und durch Zusammenkneten der entrindeten Früchte das
Tamarindenmus, welches aus Ostindien, Ägypten und (mit Sirup
versetzt) aus Westindien in den Handel kommt. Dasselbe ist
schwarzbraun, riecht säuerlich weinartig, schmeckt
süßlich-sauer, wenig herb und enthält Zucker,
Weinsäure, Pektinsäure, Gummi etc. Es dient als leicht
abführendes Mittel und zu Tabaksaucen. Das feste Holz des
Baums wird von Würmern nicht angegriffen und daher vielfach
benutzt.
Tamarix L. (Tamariske), Gattung aus der Familie der
Tamarikaceen, ästige Sträucher mit kleinen,
schuppenförmigen Blättern, rosafarbenen oder weißen
Blüten in gewöhnlich endständigen, einfachen oder
zusammengesetzten Trauben und mit aufspringenden Kapseln; wachsen
vorzugsweise auf salzhaltigem Boden in der Nähe der
Küsten in den Mittelmeerländern, im mittlern und
südlichen Asien. T. (Myricaria Devs.) germanica L. (deutsche
Cypresse), ein Strauch mit rutenförmigen, zahlreichen
Ästen, sehr kleinen, cypressenartigen, graugrünen
Blättern und weißlichen Blüten, ist in Mittel- und
Südeuropa heimisch und wird als Zierstrauch in Gärten
kultiviert; ebenso T. gallica L., ein Strauch an den Ufern des
Mittelländischen Meers sowie im nördlichen Afrika, in
Kleinasien bis zum Himalaja, dem vorigen ähnlich, mit
punktierten, bläulichgrünen Blättern und
rötlichen, in Rispen stehenden, sehr wohlriechenden
Blüten. Aus einer Spielart, T. gallica mannifera Ehrenb.
(Manna Tamarisca, Tarfabaum), welche im Steinigen Arabien und
besonders am Sinai ganze Wälder bildet, schwitzt infolge des
Stiches einer Schildlaus eine zähe, süße Substanz
aus, welche Zucker und Schleim enthält, von den Mönchen
am Sinai gesammelt und für das Manna der Israeliten ausgegeben
wird. Auch andre Arten, wie T. tetrandra Pall. aus dem Orient, und
T. chinensis Lour. aus Ostasien, beide mit weißlich hellroten
Blüten, werden als Ziersträucher kultiviert.
Tamaro, Monte, eins der drei Häupter des
tessinischen Voralpenlandes, erhebt sich am obern Ende des Lago
Maggiore 1961 m hoch.
Tamarugal (Pampa de T.), wüster Landstrich in der
Provinz Tarapacá des südamerikan. Staats Chile, jenseit
der Küstenkordillere, etwa 1000 m ü. M., bildet eine
nördliche Fortsetzung der Wüste von Atacama und ist reich
an Lagern von Salpeter und Borax.
Tamaschek (Ta-Mascheq), die zum hamit. Stamm
gehörige, von der Sprache der alten Libyer abstammende Sprache
eines Teils der nomadisierenden Stämme Nordafrikas (Tuareg).
Vgl. Hanoteau, Essai de grammaire de la langue tamachek (Par.
1860). Das T. besitzt ein besonderes Alphabet.
Tamatave, Stadt, s. Madagaskar, S. 39.
Tamaulipas, der nördlichste der östlichen
Küstenstaaten von Mexiko, 76,000 qkm (1380 QM.) groß,
besteht aus einem niedrigen Küstenstrich, der sich vom
Tampicofluß bis zur Mundung des Rio Grande del Norte
erstreckt und teilweise durch die langgestreckte Laguna del Madre
vom Meer getrennt wird, reicht 190 km weit den Rio Grande hinauf,
der ihn von den Vereinigten Staaten trennt, und erstreckt sich im
Innern auch über ein reichbewaldetes Hügelland. Das Klima
ist an der Küste heiß und ungesund, im Innern aber
angenehm. Die Bevölkerung (1880: 144,747) besteht
überwiegend aus Mestizen. Angebaut werden: Mais, Weizen,
Baumwolle, Reis, Zuckerrohr, Bohnen, Bataten, Maguey etc. Silber,
Kupfer, Blei und Steinkohlen kommen vor, werden aber noch kaum
ausgebeutet. An der Küste wird etwas Salz gewonnen und in den
Lagunen auch Fischfang betrieben. Die Industrie ist noch ganz
unbedeutend. Hauptstadt ist Victoria. S. Karte "Mexiko".
Tambach, Flecken im Herzogtum Sachsen-Gotha, im
Thüringer Wald, an der Apfelstedt und an der Linie
Georgenthal-T. der Preußischen Staatsbahn, 453 m ü. M.,
hat eine evang. Kirche, eine Oberförsterei, Fabrikation von
Bürstenwaren, Papier, Korken, Porzellan, eine Öl- und
eine Dampfschneidemühle und 2000 evang. Einwohner. Nahebei die
romantischen Thäler Spittergrund und Dietharzer Grund.
Tamberlick, Enrico, Opernsänger (Tenor), geb. 16.
März 1820 zu Rom, studierte erst Theologie und widmete sich
später unter Leitung Guglielmis der Kunst. Er debütierte
1841 in Neapel und ging 1843 nach Lissabon, wo seine Stimme eine
merkwürdige Wandlung durchmachte, indem aus dem tiefen eln
hoher Tenor wurde, später nach Petersburg, wo er zum
kaiserlichen Kammersänger ernannt ward. Nachdem er darauf
Südamerika bereist hatte, trat er endlich (1858) auch an der
Italienischen Oper zu Paris auf und erregte dort durch seinen
vollendeten Vortrag, namentlich auch durch sein phänomenales
hohes Cis Bewunderung. Obwohl in der komischen wie in der ernsten
Oper gleich ausgezeichnet, glänzte er doch am meisten als
Othello, Troubadour, Herzog in "Rigoletto" und Don Ottavio 1868
befand sich T. gerade in Madrid, als Isabella vertrieben wurde, und
erregte als Masaniello einen grenzenlosen Jubel, da man ihm
republikanische Gesinnungen zuschrieb. 1869 erschien er wieder in
Paris und ist dort auch noch 1877 aufgetreten. Er starb daselbst
14. März 1889.
Tambilan (Timbalan), Inselgruppe im Indischen Archipel,
zwischen Borneo und Sumatra, zur niederländischen
Residentschaft Rion gehörig, 72 qkm groß mit 3200
Einw.
Tambohorn, Berg , s. Adula.
Tambora, Vulkan, s. Sumbawa.
Tambour (franz., spr. -bur, vom pers. Tambur, s. d.),
Trommel; auch Trommler, Trommelschläger (s. Spielleute); daher
T. battant, mit schlagendem Trommler, vom Sturmangriff im freien
Feld, wobei der T. den Sturmmarsch schlägt. In der Baukunst
bezeichnet T. einen cylindrischen oder polygonen Unterbau einer
Kuppel (s. Laterne); in der Befestigungskunst eine kleine, meist
aus Palissaden bestehende Anlage zur Deckung der Eingänge in
Dörfer, Feldschanzen, Forts etc. (vgl. Palissaden); bei
Krempelmaschinen die mittlere Trommel.
Tambow, russ. Gouvernement, zu den Zentralgouvernements
Großrußlands gehörig, umfaßt 66,586,7 qkm
(1209 QM.). Das Land ist eben und gehört vorzugsweise der
Kreideformation an. Von nützlichen Mineralien finden sich
Eisen, Kalkstein, Gips und Thon. Der größte Teil des
Gouvernements ist mit Schwarzerde (Tschernosem) bedeckt, und die
beiden südlichsten Kreise tragen sogar den Charakter der
Steppe. Die Oka und der Don berühren auf kurzer Strecke das
Gouvernement; in die erstere mündet die Mokscha mit der Zna,
welche das ganze Gouvernement durchströmen; im S. fließt
die Worona zum Choper. Nur ein Sechstel des ganzen Landes ist mit
Wald bedeckt. Das Klima ist gemäßigt. Die Einwohnerzahl
beträgt (1885) 2,607,881 (39 pro QKilometer). Die Zahl der
Eheschließungen war 1885 22,780, der Gebornen 126,222, der
Gestorbenen
505
Tambur - Tammany-Ring.
83,184. Das Gouvernement T. gehört zu den
ackerbautreibenden ersten Ranges, aber bis auf den heutigen Tag
besteht fast allenthalben noch die Dreifelderwirtschaft. Man
säet hauptsächlich Hafer, Roggen, Buchweizen, im S. auch
Weizen; außerdem baut man Lein und Hanf, Kohl, Gurken,
Rüben, Rettiche, Tabak und Runkelrüben. Das Areal besteht
aus 63,3 Proz. Acker, 18,3 Wald, 13,4 Wiesen und 5 Proz. Unland.
Die Ernte war 1887: 14,2 Mill. hl Roggen, 11,3 Mill. hl Hafer, 4,4
Mill. hl Kartoffeln, 2½ Mill. hl Hirse, Buchweizen 1,1 Mill.
hl, Weizen, Gerste und Erbsen in nicht beträchtlichen Mengen.
Die Ernte ergab beim Roggen durchschnittlich das siebenfache Korn.
Viehzucht wird nur so weit betrieben, als sie zur Befriedigung der
Bedürfnisse des Ackerbaus dient; eine Ausnahme macht die
Pferdezucht. Die Pferde aus den östlichen Stutereien sind sehr
gesucht, finden beständigen Absatz in St. Petersburg und
Moskau und werden auch für die Armee angekauft. Man
zählte 1873: 171 Stutereien mit 525 Zuchthengsten und 3027
Stuten. Der Viehstand überhaupt bezifferte sich 1883 auf
399,478 Stück Rindvieh, 1,326,588 grobwollige und 200,816
feinwollige Schafe, 656,338 Pferde und 269,685 Schweine. Der Wert
der industriellen Produktion ward 1885 auf 25,796,000 Rubel
beziffert. Hervorragend sind: Brennerei (18 Mill. Rub.),
Tuchfabrikation (2,2 Mill. Rub.), Talgsiederei (1,4 Mill. Rub.),
Zuckerfabrikation (1,3 Mill. Rub.), Tabaksindustrie und
Eisengießerei. Die Handelsumsätze des Gouvernements
überschreiten 52 Mill. Rub. Den ersten Platz in Bezug auf den
Handel nimmt die Stadt T. ein, dann Koslow und Morschansk.
Schiffbare Flüsse und mehrere Eisenbahnen begünstigen und
erleichtern den Handel. Die Zahl aller Lehranstalten belief sich
1885 auf 755 mit 48,115 Schülern, darunter 19 Mittelschulen
und 2 Fachschulen (ein geistliches und ein Lehrerseminar). T. wird
eingeteilt in zwölf Kreise: Borissoglebsk, Jelatma, Kirsanow,
Koslow, Lebedjan, Lipezk, Morschansk, Schazk, Spask, T., Temnikow
und Usman. - Die gleichnamige Hauptstadt, an der Bahnlinie
Koslow-Saratow, hat 27 Kirchen (darunter eine evangelische), ein
Priesterseminar, ein klassisches Gymnasium, ein
Mädchengymnasium, ein Lehrerseminar und viele kleinere
Lehranstalten, das Alexander-Institut adliger Fräulein,
Schulen für Feldschere und Hebammen, ein Theater, eine
Stadtbank, eine Abteilung der Reichsbank, viele Fabriken, Handel
mit Getreide, Vieh, Talg und Wolle und (1885) 35,688 Einw. T. ist
Sitz eines griechischen Bischofs.
Tambur (Tanbur), ein arabisch-persisches lautenartiges
Saiteninstrument, das wie die Mandoline mit einem Plektrum gespielt
wurde.
Tamburinen, s. Stickerei, S. 317.
Tamburin (franz. Tambourin, spr. -âng. Handtrommel,
Handpauke), ein mit einer Haut überspannter metallener oder
hölzerner Reif, welcher ringsum mit Schellen oder
Glöckchen besetzt ist. Der Reif wird in der linken Hand in
verschiedenen Wendungen herumgedreht und mit dem Daumen der rechten
Hand auf dem Fell im Kreis umhergefahren oder zur Markierung des
Rhythmus mit der Faust auf dasselbe geschlagen, wodurch ein
verschiedenartiges Getön, Wirbel etc., verbunden mit
Schellengeklingel, hervorgebracht wird. Das Instrument ist bei den
Spaniern, Ungarn, Orientalen etc. zu Nationaltänzen
gebräuchlich (in der Hand der Tänzer selbst).
Tamburini, Antonio, Opernsänger (Baß), geb.
28. März 1800 zu Faenza, machte frühzeitig Gesangsstudien
und wurde schon mit zwölf Jahren für den Opernchor in
seiner Vaterstadt engagiert. Ans Neigung zum Theater verließ
er mit 18 Jahren heimlich das elterliche Haus und debütierte
glücklich in dem Städtchen Cento, von wo er nach und nach
an die größern Bühnen Italiens gelangte, bis er
endlich 1819 in Neapel ein vorteilhaftes Engagement und reichen
Beifall fand. 1825 engagierte ihn der berühmte Impresario
Barbara auf sechs Jahre für seine Unternehmungen in Neapel,
Mailand und Wien. 1832, nachdem er zuvor noch England besucht
hatte, kam T. nach Paris und debütierte als Dandini im
"Aschenbrödel". Von nun an bildete er länger als 20 Jahre
das Entzücken der Pariser, und noch 1854 sang er den Don Juan
mit klangvoller Stimme und jener Leichtigkeit der Tonbildung, die
ihm den Beinamen des "Rubini unter den Baritonisten" verschafft
hatte. Er befuchte von Zeit zu Zeit sein Vaterland und fand auch
mehrmals in Rußland die wohlwollendste Aufnahme. Im Besitz
eines beträchtlichen Vermögens, zog er sich endlich auf
seine Besitzung in Sèvres bei Paris zurück, siedelte
jedoch 1871 nach Nizza über, wo er 9. Nov. 1876 starb. Vgl.
Biez, T. et la musique italienne (Par. 1877).
Tamerlan, s. Timur.
Tamfana, Göttin, s. Tanfana.
Tamías (griech.), Schatzmeister, Rendant, ein
Titel, den in Athen verschiedene Behörden führten, vor
allen aber der auf vier Iahre gewählte Verwalter der
Hauptkasse, welcher von den Apodekten (Generaleinnehmern) alle
für die öffentlichen Ausgaben bestimmten Gelder
abgeliefert erhielt und an die Kassen der einzelnen Behörden
für ihre etatmäßigen Ausgaben verteilte.
Tamias, Backenhörnchen, s. Eichhörnchen, S.
362.
Tamil, die Sprache der Tamulen (s. d.).
Tamina, wilder Gebirgsfluß im schweizer. Kanton St.
Gallen, 26 km lang, entspringt am Sardonagletscher,
durchfließt zunächst das nur im Sommer bewohnte
Alpenthal Kalfeusen; hier liegt Sardona-Alp 1748, die Kapelle St.
Martin 1351 m ü. M. Aus dieser Oberstufe herausgebrochen,
erreicht sie den obersten permanent bewohnten Thalort Vättis
(947 m) und durchfließt nun ein enges Waldthal, wo in einem
Felsschlund die Therme von Pfäfers hervorquillt. Endlich
gelangt der Fluß durch eine Klus zur Rheinebene hinaus. Hier
liegt am Zusammenfluß von Rhein und T. der Badeort Ragaz (503
m).
Tamis (franz., spr. -mih, "Sieb"), s. v. w. Etamin.
Tamise (vläm. Temsche), Marktflecken in der belg.
Provinz Ostflandern, Arrondissement St.-Nicolas, an der Schelde und
der Bahn Mecheln-Terneuzen, mit Flachs- und Baumwollspinnerei,
Segeltuch- u. Holzschuhfabrikation, Brauereien, Salzsiederei,
Schiffbau und (1888) 10,701 Einw.
Tammany-Ring, ein nach seinem Versammlungsort, der
Tammany Hall, benannter Klub in New York, 1789 als ein geheimer
Orden (Columbian Order) gestiftet und ursprünglich
konservativ, später demokratisch. Derselbe bemächtigte
sich mit Hilfe der zahlreich zugewanderten Irländer in den
60er Iahren der einflußreichsten Stellen, namentlich der
Finanzämter, in der Stadtverwaltung. Seine Häupter,
Tweed, Sweeney u. a., beuteten die Ämter, in deren Besitz sie
kamen, zu ihrer Bereicherung aufs frechste und schamloseste aus,
wußten durch Bestechung und Terrorismus alle Wähler nach
ihrem Sinn zu lenken und auch in der Verwaltung und Gesetzgebung
des Staats New York einen höchst verderblichen Einfluß
zu gewinnen. Die Stadt New York belasteten sie mit einer Schuld von
vielen Millionen, ohne da-
506
Tammerfors - Tana.
für etwas zu leisten. Endlich 1871 gelang es der zur
Einsicht gekommenen Bürgerschaft, die Herrschast des
Tammany-Rings durch unabhängige Wahlen zu brechen und die
Häupter dem Strafgericht zu überliefern. Trotzdem
behauptete sich die Tammany Society als demokratischer Verein und
gelangte auch allmählich wieder zu Einfluß, so daß
1889 ihrem Vorsitzenden die einträglichste Stelle der Stadt
New York übertragen wurde.
Tammerfors (finn. Tampere), die bedeutendste Fabrikstadt
Finnlands, im Gouvernement Abo-Björneborg, am Tampereenkoski,
einer Stromschnelle, welche die Seen Näsijärvi und
Pyhäjärvi verbindet, und an der Eisenbahn Tawastehus-T.,
hat Baumwoll- und Leinenspinnereien, Papier- und Wollwarenfabriken,
eine mechanische Werkstatt etc. und (1886) 16,744 Einw. T. ist Sitz
eines deutschen Konsulats. Angelegt wurde die Stadt 1779 von Gustav
III.
Tammus (hebr.), im jüd. Kalender der zehnte
29tägige Monat des bürgerlichen, der 4. des Festjahrs,
welcher von einer gleichnamigen syrisch-phönikischen Gottheit
(Hesek. 8, 14) den Namen erhielt. Der 17. ist ein jüdischer
Fasttag zur Erinnerung an das erste Eindringen der Chaldäer in
Jerusalem. Der Tod des erwähnten Gottes wurde mit lauter
Klage, seine Auferstehung mit Freudengeschrei begangen,
entsprechend dem Dumuzi der Chaldäer, Adonis der Griechen und
Osiris der Ägypter. Vgl. Sonnenkultus.
Tampa, Hafenort im nordamerikan. Staat Florida, an
herrlicher, fisch- und schildkrötenreicher Bai am Golf von
Mexiko, mit (1880) 720 Einw.
Tampicin, s. Ipomaea.
Tampico, Hafenstadt im mexikan. Staate Tamaulipas,
oberhalb der Mündung des Rio de T., der aus der Vereinigung
der Flüsse Panuco und Rio de Tula entsteht und über eine
Barre (3 m Wafser) ins Meer mündet, hat ein Theater, Kasino, 2
Hospitäler und (1880) 5000 Einw. Die Stadt wird zwar auch vom
gelben Fieber heimgesucht, ist aber immerhin gesünder als
Veracruz. Ihr Handel ist bedeutend und wird sich nach Vollendung
der im Bau begriffenen Eisenbahn nach San Luis Potosi sowie des
Kunsthafens noch heben. Zur Ausfuhr (1886: 955,400 Pesos) gelangen:
Edelmetalle, Häute, Sassaparille, Jalappe, Tabak, Vanille,
Wolle und Farbholz. T. ist Sitz eines deutschen Konsuls und wurde
erst 1824 gegründet; November 1862 bis August 1866 war es von
den Franzosen besetzt. T. gegenüber, im Staat Veracruz, liegt
der Pueblo viejo de T., jetzt unbedeutender Ort mit Fischerei und
Salinen.
Tamping, in Singapur Sack von 12 engl. Pfund.
Tampon (franz., spr. tangpóng), Pfropfen; in der
Chirurgie Scharpieballen, Gazepfropfen. Daher Tamponade, die
Ausfüllung einer Körperhöhle oder Wunde mit
Wattepfropfen, namentlich zur Blutstillung angewandt, wenn
Unterbindung unmöglich ist. Vgl. Kolpeurynter.
Tamsel, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Frankfurt
a. O., Kreis Landsberg, an der Linie Berlin-Schneidemühl der
Preußischen Staatsbahn, hat eine evang. Kirche (mit
Grabstätte des Feldmarschalls Hans Adam v. Schöning), ein
Schloß und (1885) 797 Einw.; bekannt durch die öftere
Anwesenheit Friedrichs d. Gr. während seines Aufenthalts in
Küstrin.
Tamsui, chines. Traktatshafen auf der Insel Formosa, am
Nordende desselben, mit 95,000 Einw. In den für
größere Schiffe ungeeigneten und den Teifunen
ausgesetzten Hafen und den des benachbarten Kelung liefen 1886 ein
und aus 273 Schiffe von 118,657 Ton., darunter 78 deutsche von
31,931 T. Die Einfuhr wertete 1887: 1,298,613, die Ausfuhr 44,260
Haikuan Taels. T. ist Sitz eines englischen Konsuls, welcher auch
die deutschen Interessen vertritt. Die Stadt wurde 1. Okt. 1884 von
vier französischen Kriegsschiffen beschossen und die
chinesischen Batterien zum Schweigen gebracht, als aber 8. Okt. die
Franzosen landeten, wurden sie zurückgetrieben.
Tamtam (Gong), ein Schlaginstrument der Chinesen, Inder
etc., bestehend aus einer zum Teil aus edlen Metallen gefertigten
(gehämmerten) Metallscheibe, deren mittelster Teil stark
konkav ist; der breite Rand hat einen ziemlich großen runden
Ausschnitt. Der Ton des Tamtams dröhnt und hallt ungemein
lange nach, seine Wirkung ist sowohl im forte als im piano eine
erschreckende, beängstigende. Das T. wird im neuern
Öpernorchester angewendet, doch ist dasselbe wegen der hohen
Anschaffungskosten (gute Tamtams werden aus China bezogen) ziemlich
selten.
Tamulen, das gebildetste und unternehmendste Volk der
Drawidarasse in Vorderindien, wohnt im sogen. Karnatik, vom Kap
Comorin bis über die Polhöhe von Madras und vom Kamm der
Westghats bis zum Bengalischen Golf. Außerdem gehört zu
den T. auch die Arbeiterbevölkerung des nördlichen und
nordwestlichen Ceylon sowie die Mehrzahl der sogen. Kling (s. d.).
Die Sprache der T. (Tamil oder Tamulisch genannt) wird von 14,8
Mill. Menschen gesprochen; sie besitzt ein eignes, aber mit dem
Sanskritalphabet verwandtes Alphabet, dazu eine ziemlich
reichhaltige, alte Litteratur und ist ohne Zweifel die
interessanteste Sprache vom Drawidastamm. Die Litteratur der T.
reicht mit ihren ältesten erhaltenen Denkmälern bis etwa
ins Jahr 1000 unsrer Zeitrechnung zurück und enthält
neben zahlreichen Übersetzungen aus den Sprachen des
nördlichen Indien auch ausgezeichnete eigne Werke. Als
berühmtestes derselben ist der "Kural" (Kurzzeiler) von
Tiruvalluver zu nennen, ein in vier- oder dreifüßigen
Strophen abgefaßtes gnomonisches Gedicht, mit Sprüchen
über die sittlichen Ziele des Menschen, voll zarter und wahrer
Gedanken, aber krankend an dem Wahn der Wiedergeburt, von dem auf
buddhistischem Weg eine Erlösung erstrebt werden soll. Eine
vollständige Textausgabe des Gedichts mit lateinischer
Übersetzung findet sich in Grauls "Bibliotheca tamulica"
(Leipz. 1854-65, 4 Bde.), die noch andre tamulische Texte mit
lateinischer oder englischer Übersetzung, Glossare und im 2.
Band auch eine Grammatik enthält. Eine Grammatik lieferte noch
J. Lazarus (Lond. 1879). Tamil-englische Lexika lieferten Rottler
(Madras 1834-41) und Winslow (das. 1862), eine Geschichte der
tamulischen Schrift etc. Burnell (in "Elements of South-Indian
palaeography", 2. Aufl., Lond. 1878). Vgl. auch Graul, Reise nach
Ostindien (Leipz. 1854-56, 5 Bde.).
Tamworth, Stadt in Staffordshire (England), am
Zusammenfluß von Tame und Anker, hat eine normännische
Kirche, ein altes Schloß, Baumwollspinnerei etc. und (1881)
4891 Einw. T. ist der Geburtsort Sir Robert Peels, dem hier 1852
eine Bronzestatue errichtet wurde.
Tan, in China s. v. w. Pikul oder Tang.
Tana, 1) (Tanaelv) Fluß in Norwegen, entsteht aus
dem Znsammenfluß des Anarjokka (Enaraelv) und des Karasjokka,
bildet im obern Lauf die Grenze zwischen dem russischen Finnland
und dem norwegischen Amt Finnmarken, fließt in
nordöstlicher Richtung und mündet nach einem Laufe von
280 km in den Tanafjord des Nördlichen Eismeers. - 2) (auch
Dana oder Manga) Fluß in Ostafrika, ent-
507
Tana - Tangaren.
springt am Schneeberg Kenia und mündet unter 2°47'
südl. Br. in die Ungama- oder Formosabai, ein
nördlicherer Mündungsarm, der Osi, bildet die
Südgrenze von Witu. In der Regenzeit kann der T. 180 km
aufwärts befahren werden. Er bildet einen sehr guten
Kommunikationsweg nach dem Innern Ostafrikas und die Nordostgrenze
der britischen Interessensphäre gegen das Somaliland.
Tana, im Mittelalter Name von Asow (s. d.).
Tanab, Flächenmaß in Turkistan, = 3600
Quadratschritt.
Tanacetum L., Gattung aus der Familie der Kompositen, der
Gattung Chrysanthemum sehr nahe stehend und auch mit dieser
vereinigt. T. vulgare L. (Rainfarn), ausdauernd, bis 1,25 m hoch,
mit siederteiligen Blättern, länglich-lanzettlichen,
eingeschnittenen Abschnitten, doldenrispig gehäuften, kleinen,
gelben Blütenköpfchen, nicht strahlenden Randblüten
und mit Harzdrüsen besetzten Achenen mit kurzem Kelchsaum.
Wächst an Wegen und Rainen in Europa. Alle Teile, besonders
die Blüten, riechen beim Zerreiben stark aromatisch,
kampferartig, schmecken gewürzig bitter und enthalten ein
gelbes ätherisches Öl, welches als Wurmmittel verwendbar
ist.
Tanagra, im Altertum Stadt in Böotien, am Asopos
(jetzt Vuriendi), am Einfluß des Baches Thermodon (Laris), wo
man noch den Lauf der Ringmauern erkennt. Jetzt Gremada. Hier 457
v. Chr. Sieg der Spartaner über die Athener, welch letztere
indessen 456 T. eroberten. Noch im 6. Jahrh. n. Chr. blühte
T., dessen Gebiet in neuester Zeit durch die in der Nekropole auf
dem Kokkalihügel gefundenen herrlichen Thonstatuetten von
neuem berühmt geworden ist (s. Terrakotten).
Tanaïs, antiker Name des Don.
Tanak (Tinak), Badeort im russ. Gouvernement Astrachan, 6
km von der Wolga entfernt, mit stark salzhaltigen
Schlammbädern, die bei Rheumatismen und Flechten
vorzügliche Wirkung äußern.
Tánaquil, Gattin des Tarquinius Priscus (s.
d.).
Tanaro, Fluß in Oberitalien, entsteht in den
Seealpen, durchfließt in nördlicher und
nordöstlicher Richtung die Provinzen Cuneo und Alessandria,
wird bei Alessandria für größere Fahrzeuge
schiffbar und mündet nach einem Laufe von 205 km unterhalb
Bassignana rechts in den Po.
Tänaron, Vorgebirge, s. Matapan.
Tanasee (Tsana-, Dembeasee), See im Hochland Abessiniens,
südlich von Gondar, 1755 m ü. M., ist 67 km lang, 15-52
km breit, nach Stecker 2980 qkm (54 QM.) groß. Letzterer
maß 72 m als größte Tiefe in inselfreiem Raum,
Hericourt aber 197 m bei der Insel Meteraha. Mehr als 30
Flüsse ergießen sich in den von malerischen Bergen und
fruchtbaren Hochebenen umgebenen See; der Abai (der Blaue Nil)
fließt in einem bogenförmigen Lauf durch ihn hindurch.
Aus dem klaren Wasser erheben sich viele meist bewohnte
Basaltinseln, deren größte Deg heißt. Der See ist
reich an Fischen und Nilpferden; Krokodile dagegen fehlen. An
seinem östlichen Ufer liegt die Handelsstadt Korata.
Tanbur, Musikinstrument, s. Tambur.
Tandem, Fabrikname eines zweisitzigen Velocipeds.
Tandil, Stadt in der Argentinischen Republik, Provinz
Buenos Ayres, 260 km südsüdwestlich von der Hauptstadt,
bei der Sierra de T. (450 m), hat ein Krankenhaus, 2
Dampfmühlen, eine Seifensiederei und (1882) 3600 Einw.
Tandschor (Tanjore), Hauptstadt des gleichnamigen
Distrikts in der britisch-ind. Präsidentschaft Madras, liegt
am Hauptarm der Kaweri und an der Südbahn, ist ein Sitz
altindischer Gelehrsamkeit, hat großartige Hindubauten, eine
katholische und evang. Mission, lebhafte Industrie und (1881)
54,745 Einw.
Tandur, in der Türkei eine Art Wärmapparat,
welcher mittels einer über einem kupfernen Kohlenbecken
ausgebreiteten Decke hergestellt wird und bei den Frauen in der
Türkei sehr beliebt ist (s. Mangal).
Tanesruft (Hamada), mit scharfkantigen Steinen
übersäete Hochebenen der Sahara (s. d., S. 176).
Tanet-Sande und -Thone, s. Tertiärformation.
Tanfana (Tamfana), Göttin der Marser, hatte einen
Tempel zwischen der Ems und Lippe, den Germanicus 14 n. Chr.
zerstörte. Nach andern führten der Hain und das Heiligtum
selbst diesen Namen.
Tang (Tan), japan. Flächenmaß, = 10 Seh - 300
Tsjubo = 995,73 qm.
Tang, die Meeresalgen, welche die Familien der Fukaceen
und Florideen ausmachen, die hauptsächliche Vegetation des
Meers bilden und durch ihre eigentümlichen, sehr
mannigfaltigen Formen und oft ansehnlichen Dimensionen sich
auszeichnen. Die meisten sind festgewachsen auf dem felsigen
Meeresgrund, an Klippen, Steinen, Schalen von Konchylien etc. und
dienen selbst wieder zahllosen Seetieren zum Aufenthalt und zur
Nahrung; viele Arten leben gesellig und bilden submarine
Wälder, andre fluten mit dem beblätterten Teil an der
Meeresoberfläche, wie die gigantische Macrocystis pyrifera (s.
d.) der Südsee. Vgl. Fucus, Sargassum.
Tanganjika (Msaga der Wakawendi, Kimana der Warungu),
großer See im Innern von Ostafrika, zwischen
3°20'-8°40' südl. Br. und 29°10'-32°30'
östl. L. v. Gr., nach Reichard 780 m ü. M. gelegen,
enthält süßes Wasser und erstreckt sich bei einer
durchschnittlichen Breite von 52 km auf 750 km in die Länge.
Seine an Buchten (Cameron- und Horebai im S., Burtongolf im NW.)
reichen Gestade sind rings von bewaldeten Bergen umgeben und dicht
bevölkert; von allen Seiten fallen zahlreiche Gewässer in
denselben, unter denen jedoch nur der von N. her einmündende
Rusisi bedeutender ist. Als Ausfluß des T. nach W., zum
Lualaba-Congo hin, muß der unter 6° südl. Br.
austretende Lukuga betrachtet werden. Der T. wird von Kähnen
der Eingebornen und arabischen Dhaus befahren; die Ufer sind
produktenreich, sein Wasser beherbergt viele Fische,
Flußpferde und Krokodile. Der wichtigste Ort ist Kawele oder
Udschidschi am Ostgestade, mit arabischer Niederlassung und
Missionsstation; andre nennenswerte Orte und Missionsstationen
sind: Karema, Kawala, Mpala, Kahunda, Pambete. Das Westufer des
Sees gehört dem Congostaat, das Ostufer wird der deutschen
Interessensphäre zugerechnet. Entdeckt wurde der T. 1858 von
Burton und Speke; seine nähere Kenntnis verdanken wir
Livingstone, Cameron u. Stanley, welcher ihn 1875 ganz umfuhr,
ferner Hore, Thomson, Reichard. S. Karte bei "Congo". Vgl. Thomson,
Expedition nach den Seen von Zentralafrika, S. 47 ff. (deutsche
Ausg., Jena 1882); Böhm, Von Sansibar zum T. (Leipz.
1887).
Tangaren (Tanagridae Gray), Familie aus der Ordnung der
Sperlingsvögel, schlank gebaute, zum Teil überaus
prachtvolle Vögel mit schlankem, kegelförmigem, auf der
Rückenfirste wenig, an der Spitze etwas herabgebogenem, vor
derselben meist ausgekerbtem Schnabel, mittellangen Flügeln
und Schwanz, ziemlich kräftigen, kurzen Läufen und Zehen,
starker und langer Hinterzehe und gekrümmten Krallen, bewohnen
die Wälder Amerikas von Paraguay bis Ka-
508
Tangelbaum - Tangentometer.
nada, leben meist gesellig, fliegen gut und bewegen sich auf dem
Boden recht gewandt. Einige sollen ansprechend singen, viele aber
lassen nur unangenehme Laute vernehmen. Sie nähren sich
hauptsächlich von Früchten, zeitweilig von Körnern
und fressen sämtlich auch Insekten. Ihr Nest bauen sie auf
Bäumen oder Sträuchern. Die wandernden Arten brüten
nur einmal im Jahr, während die in wärmern Gegenden
lebenden wohl mehrere Bruten erziehen. Wegen der bestechenden
Schönheit der T. werden viele Arten in Käfigen gehalten,
worin sie bei sorgfältiger Pflege auch ziemlich gut gedeihen.
Die Tapiranga (Rhamphocelus brasiliensis L., s. Tafel
"Stubenvögel") besitzt die Größe des Gimpels, ist
glänzend dunkelblutrot, an den Flügeln und dem Schwanz
schwarz, an den Schwingen und Oberflügeldecken verwaschen
braunrot gesäumt; die Iris ist hochrot, der Schnabel
bräunlichschwarz, die Wurzelhälfte des Unterschnabels
perlmutterweiß, der Fuß schwarz. Das Weibchen ist
oberseits schwarzbraun, am Bürzel und auf der Unterseite
schmutzig rostbraun. Die Tapiranga bewohnt Brasilien und ist in den
Gebüschen sowie in den Rohrbrüchern an den
Flußufern sehr gemein.
Tangelbaum, s. v. w. Kiefer.
Tangénte (lat., Berührungslinie), eine
Gerade, welche mit einer krummen Linie oder mit einer Fläche
zwei zusammenfallende Punkte gemein hat. Man erhält sie, wenn
man erst zwei benachbarte Punkte der Linie oder Fläche durch
eine Gerade (eine Sekante) verbindet und dieselbe dann so weit um
den einen der zwei Punkte dreht, bis der zweite mit diesem
zusammenfällt. Beim Kreis und der Kugel steht die T. senkrecht
auf dem Halbmesser, der nach dem Berührungspunkt geht. Legt
man an einen Punkt einer krummen Fläche beliebig viele
Tangenten, so liegen dieselben in einer Ebene (Tangentialebene). -
In der Trigonometrie ist T. der Quotient aus Sinus und Kosinus.
Beim alten Klavichord hießen so die auf den hintern
Tastenenden stehenden Metallzungen, welche die Saiten nicht
anrissen, wie die Federposen des Kielflügels, sondern nur
streiften (tangierten), daher auf eine ähnliche Weise
tonerzeugend wirkten wie der Bogen der Streichinstrumente (s.
Klavier, S. 816).
Tangentenbussole, Vorrichtung zur Messung der Stärke
eines galvanischen Stroms durch die Ablenkung einer Magnetnadel.
Sie besteht (s. Figur) aus einem kreisförmig gebogenen
Kupferstreifen o, dessen geradlinig nach abwärts gebogene
Enden a b und c d unten mit Klemmschrauben zur Aufnahme der von den
Polen der galvanischen Batterie kommenden Drähte versehen
sind. Im Mittelpunkt des kupfernen Ringes schwebt auf einer Spitze
inmitten eines in Grade geteilten Kreises eine Magnetnadel; der
Ring kann in seinem Fußgestell so gedreht werden, daß
seine Ebene mit der Magnetnadel in ihrer Ruhelage (d. h. mit dem
magnetischen Meridian) zusammenfällt. Sobald nun ein
galvanischer Strom durch den Kupferring geht, wird die Nadel aus
ihrer Ruhelage so weit abgelenkt, bis das Drehungsbestreben der
erdmagnetischen Kraft, welche die Nadel in die Ebene des Ringes
zurückführen will, demjenigen des galvanischen Stroms,
welcher sie senkrecht zu dieser Ebene zu stellen strebt, das
Gleichgewicht hält. Da die Wirkung des Erdmagnetismus auf ein
und dieselbe Magnetnadel als unveränderlich angesehen werden
kann, so läßt sich aus den Ablenkungen, welche
verschiedene Ströme hervorbringen, auf die Stärke dieser
Ströme schließen, und zwar ergibt sich aus obiger
Gleichgewichtsbedingung, daß die Stromstärken sich
verhalten wie die "trigonometrischen Tangenten" der
Ablenkungswinkel. Eine T. zeigt, an welcher Stelle eines
Schließungskreises man sie auch einschalten mag, immer die
gleiche Ablenkung und gibt dadurch kund, daß die
Stromstärke in einer geschlossenen Leitung überall gleich
groß ist. Eine T. zur Messung sehr starker elektrischer
Ströme ist von Obach angegeben worden. Wird durch den Ring
einer gewöhnlichen T. ein sehr starker Strom, z. B. derjenige
einer großen dynamoelektrischen Maschine, geleitet, so
erleidet die Magnetnadel eine Ablenkung von nahezu 90°, welche
allerdings durch eine passende Nebenschließung verringert
werden kann. Da aber der Ring der Bussole nur einen geringen
Widerstand haben darf, die anzubringende Nebenschließung
demnach einen noch geringern, der wegen seiner Kleinheit kaum zu
messen ist, so läßt sich mit der gewöhnlichen T.
eine brauchbare Messung großer Stromstärken nicht
erzielen. Obach hat daher für solche Messungen die T. derart
abgeändert, daß der mit einem Kupferband oder mit
Drahtwindungen belegte Ring um eine mit der Ruhelage der
Magnetnadel zusammenfallende horizontale Achse gedreht und der dem
Ring erteilte Neigungswinkel gegen die Vertikale an einem Teilkreis
abgelesen werden kann. Die Nadel selbst wird nicht auf einer Spitze
balanciert, sondern sie ist, um das bei stärkerm Neigen des
Ringes eintretende Kippen der Nadel zu vermeiden, mit einer in zwei
Lagern drehbaren vertikalen Achse versehen. Die auf die Nadel
ausgeübte Richtkraft des Stroms wird durch diese Einrichtung
in dem Verhältnis von l zu dem Sinus des Neigungswinkels
verringert. Man findet demnach die Stärke des Stroms, wenn man
die wie gewöhnlich aus dem Ablenkungswinkel berechnete
verringerte Stromstärke durch den Sinus des Neigungswinkels
dividiert. Macht man den Ring um seine vertikale Achse drehbar und
dreht denselben der abgelenkten Nadel nach, bis dieselbe wieder auf
dem Nullpunkt der Teilung einsteht, so ist die Stromstärke dem
Sinus des Winkels, um welchen die Nadel abgelenkt ist,
proportional. Dieser Winkel wird an einem horizontalen, mit dem
Stativ fest verbundenen Teilkreis abgelesen. Ein so eingerichtetes
Instrument heißt Sinusbussole.
Tangentialbewegung, s. Zentralbewegung.
Tangentialräder (Partialturbinen), s. Wasserrad.
Tangentometer, von Prüsker in Wien angegebenes
Instrument zum Höhenmessen und Nivellieren, besteht aus
Stativ, worauf mittels Nuß mit Stellschrauben ein um eine
Achse am Okularende auf- und abstellbares Fernrohr ruht,
ähnlich dem Nivellierfernrohr, eher noch wie bei der Kippregel
(s. d.).
509
Tanger - Tanguten.
Die Horizontalstellung des Fernrohrs ist sehr sorgfältig
konstruiert und beruht auf der Horizontalkorrektur einer
Stützplatte als der Grundlage für die Messungen, auf
welcher die Ständer für das Fernrohr befestigt sind, und
auf der darauf selbständig zu bewirkenden Horizontalstellung
des Fernrohrs selbst, also mittels zweier Libellen. Auf der
Stützplatte ist am Objektivende des Fernrohrs ein Lineal
(gerade, nicht Kreisbogen) senkrecht befestigt, an welchem bei
Hebungen das Objektivende auf- und niedergeht und zwar mit einem
entsprechend sich schiebenden Index und Nonius. Bei 0 des Index auf
0 des Lineals und im übrigen einspielenden Libellen ist die
Fernrohrachse horizontal und das Instrument unmittelbar zum
gewöhnlichen Nivellieren mit der Latte zu benutzen. Erhebt
oder senkt man das Fernrohrende, so wird an dem geraden Lineal nun
nicht der Höhen- oder Tiefenwinkel angegeben, wie man ihn zu
Höhenmessungen braucht (mit Theodolit oder Kippregel), sondern
man liest direkt dessen Tangente ab, kann also bei bekannter
Horizontalentfernung des Instruments vom Objekt sofort den
Höhenunterschied ermitteln. Vgl. Prüsker, Der T. (Wien
1879).
Tanger (arab. Tandscha), Seestadt in der marokkan.
Provinz Hasbat, am westlichen Eingang der Straße von
Gibraltar, amphitheatralisch am Abhang eines kahlen Kalkgebirges
erbaut, hat meist unregelmäßige, enge und steil
aufsteigende Straßen, schöne Moscheen, ein
Franziskanerkloster mit Kapelle, dem einzigen christlichen
Gotteshaus im ganzen Reich, mehrere Synagogen und Häuser
europäischer Agenten, eine alte, teilweise verfallene
Citadelle, aber bedeutende Befestigungen am Hafen. Dieser ist zwar
klein und von geringer Tiefe, die Reede aber schön und
ziemlich geräumig. T. ist der bedeutendste Seehandelsplatz
Marokkos und unterhält namentlich einen sehr lebhaften Verkehr
mit Gibraltar. Es liefen 1887: 806 Schiffe von 168,598 Ton. ein;
der Wert der Ladungen betrug im Eingang 8,52, im Ausgang 4,4 Mill.
Mk. Die Konsuln (darunter auch ein deutscher) in T. haben dort eine
bedeutendere Stellung als an irgend einem andern Orte, da sie die
politischen Vertreter ihrer Staaten beim Sultan von Marokko sind.
Da letzterer nicht gestattet, daß Europäer in seiner
Hauptstadt residieren, so läßt er seinen Minister der
auswärtigen Angelegenheiten in T. wohnen, wo derselbe zugleich
Gouverneur ist. Die Einwohner, 20,000 an der Zahl, sind meist
Mauren; dazu kommen Juden spanischen Ursprungs und wenige
Europäer. - T. hieß bei den Römern Tingis und ward
unter Kaiser Claudius Hauptstadt der Provinz Tingitana oder des
westlichen Mauritanien. Die Westgoten eroberten es im 5. Jahrh., im
8. Jahrh. kam es an die Araber. Die Portugiesen brachten es 1471 in
ihre Gewalt. 1662 ward es als Brautschatz der portugiesischen
Infantin Katharina bei deren Vermählung mit Karl II. von
England an letzteres abgetreten, aber wegen der kostspieligen
Unterhaltung 1684 aufgegeben, worauf es die Mauren wieder in Besitz
nahmen. Am 6. Aug. 1844 ward es von einer französischen Flotte
bombardiert, worauf 10. Nov. daselbst der Friede zwischen
Frankreich und Marokko abgeschlossen ward.
Tangermann, Wilhelm (pseudonym Victor Granella),
altkathol. Theolog und Schriftsteller, geb. 6. Juli 1815 zu Essen
an der Ruhr, bezog 1840 die Akademie Münster, vollendete hier
den philosophischen Kursus und begann das Studium der Theologie,
das er 1842-43 in München unter Döllinger, Görres
und Haneberg beendete. Darauf in das erzbischöfliche
Klerikalseminar zu Köln aufgenommen, erhielt er 1845 die
Priesterweihe und ward 1846 Kaplan in Neuß, 1862 in Unkel.
Infolge seiner Weigerung, die vatikanischen Dekrete vom l8. Juli
1870 anzuerkennen, wurde er seines Amtes entsetzt, zog nach Bonn
und übernahm 1872 das Pfarramt bei der neuen altkatholischen
Gemeinde zu Köln. Von seinen Schriften nennen wir: "Wahrheit,
Schönheit und Liebe", philosophisch-ästhetische Studien
(Leipz. 1867); "Patriotische Lieder und Zeitgedichte" (Bonn 1871);
"Aus zwei Welten", Wahrheit und Dichtung (Leipz. 1871); "Diotima",
eine kulturhistorische Novelle (Köln u. Leipz. 1873); "Zur
Charakteristik der kirchlichen Zustände" (das. 1874); "Herz
und Welt", Dichtungen (das. 1876); "Philosophie und Christentum in
ihren Beziehungen zur Kultur- und Religionsfrage" (das. 1876); "Das
liberale Prinzip in seiner ethischen Bedeutung für Staat und
Kirche etc." (3. Aust., Köln 1883); "Sions Harfenklänge"
(Bonn 1886); "Philosophie und Poesie^, Sonettenkränze
(Köln 1886); "Neuer Frühling, neues Leben.
Zeitbetrachtungen" (Essen 1889). Alle diese Schriften stehen mit
der geistigen Richtung, als deren unerschrockener Streiter T.
eingetreten ist, im Zusammenhang, offenbaren aber über ihren
tendenziösen Zweck hinaus eine poetische Anlage u. vertiefte
Bildung.
Tangermünde, Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Magdeburg, Kreis Stendal, am Einfluß der Tanger in die Elbe
und an der Eisenbahn Stendal-T., hat Mauern und Thore aus dem
Mittelalter, die 1376 begonnene gotische Stephanskirche, ein
Schloß, ein spätgotisches Rathaus, eine Schifferschule,
ein Amtsgericht, Zuckerraffinerie, Öl- und Schrotfabrikation,
Bierbrauerei, Schiffbau, Schiffahrt, Getreidehandel, Fischerei und
(1885) 5852 Einw. In der Nähe an der Tanger und der Linie
Leipzig-Wittenberge der Preußischen Staatsbahn die
Tangerhütte mit Raseneisensteingräberei,
Eisengießerei, einem Emaillierwerk und (1885) 200 Einw. - T.
erscheint schon im 12. Jahrh. als Stadt. Die dortige Burg war
wiederholt Residenz der Markgrafen von Brandenburg, besonders zur
Zeit Kaiser Karls IV., wurde aber 1640 von den Schweden
größtenteils zerstört; von dem alten Bau ist noch
der Kapitelsturm übrig. Vgl. Götze, Geschichte der Burg
T. (Stendal 1871).
Tangerwicke, s. v. w. Lathyrus tingitanus.
Tangieren (lat.), berühren; Eindruck machen.
Tanguten (bei den Chinesen Sifan, d. h. westliche
Barbaren), ein den Tibetern nahe verwandtes Volk in den
Alpenländern westlich von den chinesischen Provinzen Schensi
und Setschuan, am obern Lauf der Zuflüsse des Huangho und
Jantsekiang. Sie werden seit 634 n. Chr. in den chinesischen
Annalen öfters erwähnt und sind gegenwärtig den
Chinesen tributpflichtig. Die T. sind von mittlerm, aber
kräftigem Wuchs, mit schwarzem Haar und starkem,
kurzgeschornem Bart, gerader Nase, großen, nicht schmal
geschlitzten Augen und dicken, oft aufgeworfenen Lippen. Ihre
Kleidung, bei beiden Geschlechtern dieselbe, besteht in einer Art
Schlafrock aus Tuch oder Schaffellen. Ihre Unsauberkeit
überschreitet alle Grenzen. Die Sprache der T. gehört zur
tibetischen Gruppe der einsilbigen Sprachen. Die T. sind Nomaden,
welche sich vornehmlich mit Schafzucht befassen; nach der Farbe der
Zelte, unter welchen sie wohnen, unterscheidet man schwarze oder
gelbe T. Ihre Religion ist ein durch allerhand Aberglauben
entstellter Buddhismus. Alle T. werden von eignen Beamten regiert,
welche einem chinesischen Beamten in Sinin (Kansu) unterstellt
sind.
510
Tangwiesen - Tanne.
Tangwiefen, s. Fukusme^e.
Taenia. Bandwurm.
Tanis (ägypt. T'a, T'an, hebr. Zo'an, arab. Sân),
altägypt. Stadt
im nordöstlichen Nildelta, deren zuerst von Mariette, dann
1883-84 von
Flinders Petrie aufgedeckte Ruinen beim heutigen Fischerdorf
Sân el
Hager unweit des Südufers des Menzalesees liegen. Schon
unter der
6. Dynastie um die Mitte des 3. vorchristlichen Jahrtausends
bestehend,
wurde T. um 2100 Residenz der semitischen Hyksoskönige und
später
diejenige der großen Herrscher aus der 19. Dynastie, wie
Ramses' II. und
Merenptahs, deren ersterer in T. einen großartigen Tempel
des
Kriegsgottes Set erbaute, in dessen Ruinen nicht weniger als
14
Obelisken gefunden wurden. In sehr fruchtbarer, wild- und
fischreicher
Gegend gelegen und selbst für Seeschiffe erreichbar, war T.
vor der
Gründung Alexandrias wohl die größte
Handelsstadt Ägyptens, sank aber
später infolge von Landanschwemmungen und des Versandens
der
Tanitischen Nilmündung und wurde wahrscheinlich 174 n.
Chr.
gelegentlich eines Aufstandes zerstört. Vgl. Flinders
Petrie, Tanis
(Lond. 1885, Bd. 1).
Tanjore, Stadt, s. Tandschor.
Tankred, 1) T. von Hauteville, normänn. Ritter im 11.
Jahrh., dessen zehn Söhne, unter ihnen
der berühmte Robert Guiscard und Roger I., 1038
nach Unteritalien zogen, es eroberten und dort das
normännische Reich
gründeten.
2) Berühmter Kreuzfahrer, Enkel des vorigen, von
dessen Tochter Emma aus
ihrer Ehe mit dem Markgrasen Otto dem Guten, geb. 1078,
begleitete 1096
seinen Vetter Bohemund von Tarent auf dem ersten Kreuzzug,
zeichnete
sich bei der Belagerung von Nikäa durch Tapferkeit aus,
besetzte
Tarsos, über dessen Besitz er sich mit Balduin entzweite,
that sich vor
Antiochia hervor, besetzte Bethlehem, erstürmte bei der
Eroberung von
Jerusalem zuerst mit den Seinen die Mauern und pflanzte sein
Banner auf
der Moschee Omars auf. Er blieb auch nach dem Sieg bei Askalon
in
Palästina und erhielt das Fürstentum Tiberias. Nach
dem Tod Gottfrieds
von Bouillon suchte er die Wahl zum König von Jerusalem
vergeblich auf
seinen Vetter Bohemund zu lenken. Als die Sarazenen Bohemund
gefangennahmen und dieser nach seiner Freilassung 1103 nach
Europa ging,
verwaltete er dessen Fürstentum Antiochia und hielt eine
harte
Belagerung durch die Sarazenen aus. Er vergrößerte
das Fürstentum durch
Eroberung von Adana, Mamistra und Laodikea, rettete Edessa vor
der
Einnahme durch die Seldschukken, worauf ihm auch dieses
Fürstentum
übertragen wurde, und eroberte Arta. Er starb 21. April
1112. Vermählt
war er mit Cäcilie, einer natürlichen Tochter des
Königs Philipp I. von
Frankreich. Wenn schon Tankreds Ruhm in der Geschichte
begründet ist,
so ist derselbe doch ganz vorzüglich erhöht worden
durch Tafsos
"Befreites Jerusalem", worin T. ganz als Held
erscheint. Vgl. Raoul von Caen, Gesta Tancredi (in Guizots
"Collection
des mémoires"); Delabarre, Histoire de Tancrède
(Par. 1822), und
Kugler, Boemund und T., Fürsten von Antiochien
(Tübing. 1862).
3) T. von Lecce, König von Sizilien,
natürlicher Sohn des Herzogs Roger
von Apulien und Enkel des Königs Roger II. von Sizilien,
ward nach
Wilhelms des Gütigen Tod 1190 von den Sizilianern in
Palermo zum König
gewählt und verteidigte den Thron mit Glück gegen
Kaiser Heinrich VI. Nach
seinem Tod 22. Febr. 1194 mußte sein unmündiger
Sohn Wilhelm III. auf die Krone verzichten und
starb bald auf der Burg Hohenembs.
Tann, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Kassel, Kreis
Gersfeld, in der
Rhön, an der Ulster und der Linie Fulda-T. der
Preußischen Staatsbahn,
359 m ü. M., hat eine neue gotische evang. Kirche, 3
Schlösser der
Freiherren von der T. (s. Tann-Rathsamhausen),
Holzwarenfabrikation,
Spinnerei und (1885)
1090 meist evang. Einwohner. Die Stadt ward 1866
von Bayern an Preußen abgetreten.
Tanna, 1) (Thana) Hauptstadt eines Distrikts in der
britisch-ind. Präsidentschaft Bombay, auf der Ostseite der
Insel
Salsette, mit einem alten Fort (jetzt Gefängnis),
portugiesischer
Kathedrale und l4,456 Einw. - 2) Eine der südlichsten der
Neuen
Hebriden, 380 qkm (7 QM.) mit 10,000 Einw. Im Innern ein 135 m
hoher,
thätiger Vulkan mit Schwefelquellen an seinem Fuß.
Die Küstenstriche
sind äußerst fruchtbar. Hafenplatz ist
Resolution.
Tanna, Stadt im Fürstentum Reuß j. L., Landratsamt
Schleiz, an der
Eisenbahn Schönberg-Hirschberg, 538 m ü. M., hat eine
evang. Kirche,
Viehmärkte, Holzhandel und (1885) 1636 evang.
Einwohner.
Tannahill, Robert, schott. Dichter, geb. 3. Juni
1774 zu Paisley, trieb die Weberei und dichtete daneben Lieder,
die
durch seines Freundes R. A. Smith Kompositionen bald
volkstümlich
wurden. Auch gab er "Poems and songs" (1807) heraus. Am
bekanntesten
wurden unter seinen Gedichten: "Jessy, the flower of Dumblane"
und "The
song of the battle of Vittoria", die nur von den besten
Dichtungen
Rob. Burns' übertroffen werden. Später verfiel er in
Schwermut und
zuletzt in Wahnsinn; in diesem nahm er sich 17. Mai 1810 selbst
das
Leben. Eine Sammlung seiner Werke nebst Biographie erschien
Glasgow 1838 (neue Ausg. 1879).
Tanne (Picea Don., Abies Lk., hierzu Tafel "Tanne"), Gattung aus
der
Familie der Abietineen, meist hohe Bäume, deren
Hauptäste in
unregelmäßigen Quirlen und deren Nebenäste meist
zweireihig stehen,
mit einzeln stehenden, meist zweizeiligen, flachen, unterseits
längs des
Mittelnervs bläulichweiß gestreiften Nadeln,
aufrechten Zapfen und nach
der Reife von der Achse sich lösenden Zapfenschuppen. Die
europäische
Edeltanne (Weißtanne, P. pectinata Lam., Abies alba Mill.,
A. Picea
L., A. pectinata Dec., A. excelsa L., P. Abies Dur., s. Tafel),
einer
der schönsten Waldbäume mit in der Jugend pyramidaler,
im Alter fast
walzenförmiger, unregelmäßiger, am Wipfel
storchnestartig abgeplatteter
Krone, wird im Schluß über 65 m hoch, hat zuerst
olivenbraune, später
weißgraue Rinde, behaarte, rauhe Zweige, an welchen die
Nadeln nach zwei
Seiten flach gestellt sind. Sie werden 2-3 cm lang und sind am
obern
Ende abgerundet und ausgerandet; die Blüten stehen fast nur
in den
obersten Verzweigungen des Wipfels an vorjährigen Trieben,
die
männlichen Blütenkätzchen sind viel länger
als die der Fichte, die
senkrecht aufgerichteten, 4-6 cm langen weiblichen
Blütenzäpfchen
gelbgrün, die aufrecht stehenden, 14-20 cm langen Zapfen
länglich
walzenförmig, hell grünlichbraun, ihre Deckschuppen
lineal zungenförmig
mit dem zwischen den Fruchtschuppen hervorragenden Teil
rückwärts
gebogen. Nach der Samenreife im Oktober, oft erst im April des
folgenden
Jahrs, löst sich der Zapfen ganz auf, und nur die
spindelähnliche Achse
bleibt am Trieb stehen. Die Samen sind dreikantig,
geflügelt. Die T. hat
eine ziemlich tief gehende Pfahlwurzel und unter der
Oberfläche des
Bodens verlaufende zahlreiche Nebenwurzeln. Die Keimpflanze
besitzt ge-
Tanne.
Tanne (Abies Picea).
1. Zweig mit männlichen Blütenkätzchen.
--
2. Trieb mit weiblichen Blütenkätzchen. -
3. 4. Weibliche Deckschuppe mit der noch kleinen Samenschuppe
von der Innen- und Außenseite, an ersterer unten die
Samenschuppe mit den zwei Samenknospen. --
5. (und die Figur darüber) Die Samenschuppe in
verschiedenen Entwickelungszuständen, wie 3 und 4
vergrößert. --
6. 7. Männliche Blütenkätzchen, als Knospe und
vollkommen entwickelt (doppelte Größe). --
8. Staubgefäße. --
9. Nadel (doppelte Größe). --
10. Querschnitt derselben, ebenso. --
11. Keimpflänzchen. --
12. Stammknospe desselben mit abgeschnittenen Nadeln und
Keimnadeln, vergrößert.
Zum Artikel »Tannen.
511
Tannenberg - Tannenhäher.
wöhnlich 5-7 sehr große Keimnadeln; in der Jugend
wächst die T. viel langsamer als die Fichte, vom 25. oder 30.
Lebensjahr an beginnt aber ein fördersameres Wachstum, welches
länger als bei irgend einem Waldbaum, mit Ausnahme der Eiche,
anhält. Sie erreicht ein sehr hohes Alter. Im allgemeinen
trägt sie später und seltener Früchte als die
Fichte. Ihre Verbreitung ist auch viel beschränkter. Sie
gehört als Waldbaum den höhern Stufen des
mitteleuropäischen Berglandes (Riesengebirge, Erzgebirge,
Böhmerwald, Bayrischer Wald, Fichtelgebirge, Frankenwald,
Schwarzwald, Alb, Jura, Wasgenwald), den
südwesteuropäischen (Burgund, Auvergne, Pyrenäen)
und südosteuropäischen Gebirgslandschaften (Karpathen,
Siebenbürgen, östlicher Balkan, thrakische
Berglandschaft), meist in Höhen von 800-1200 m ü. M. im
mittlern, von 1200 -1900 m im südlichen Europa, an. Die T.
meidet die aufgeschwemmten Bodenarten des Flachlandes und liebt vor
allen den Verwitterungsboden des Urgebirges. Sie gedeiht nur im
Bestandsschluß zur höchsten Vollkommenheit, da sie einen
erheblichen Schirmdruck erträgt und in der Jugend des Schutzes
durch Altstämme bedarf. Ausgedehnte Bestände bildet sie
mit der Rotbuche zusammen, auch mit der Fichte; ihr ganzes
Wuchsverhalten aber stempelt sie zum Betrieb in reinen
Beständen mit höherm Umtrieb (140-150 Jahre). Die T. ist
sturmfest und dem Schneebruch und Insektenschäden wenig
unterworfen, Wildbeschädigungen aber sehr ausgesetzt. Man
verjüngt die Tannenbestände am besten in dunkeln
Samenschlägen; zur Neubegründung von solchen
Beständen wendet man Schirmschläge an. Man pflückt
die Zapfen im September; der Same bedarf des Ausklengens nicht, da
derselbe von selbst ausfällt. Ein Hektoliter Zapfen wiegt 45
kg und ergibt etwa 3 kg gereinigten Samen (4½ kg
geflügelten Samen). Ein Kilogramm reinen Samens enthält
16,000 Körner. Zur Saat verwendet man pro Hektar 25 kg
(Plätzesaat) bis 80 kg (Vollsaat) reinen Samen. Meist macht
man Riefensaaten (0,5 m breit) mit 50 kg Samen pro Hektar. Im
Saatkamp säet man 5 kg pro Ar. Der Same wird höchstens
0,8 cm tief mit Erde bedeckt. Frühjahrssaat ist wegen der
Frostgefahr und des Mäusefraßes vorzuziehen. Saat- und
Pflanzkämpe legt man in frostfreien Lagen, thunlichst in nicht
zu geschlossenen alten Schirmbeständen an. Die
zweijährigen Pflänzlinge werden umgepflanzt (verschult),
im sechsjährigen Alter in die Bestände gepflanzt.
Vielfach werden auch Wildlinge mit Ballen, fünf- bis
sechsjährig, zur Vervollständigung der Kulturen
verwendet. Man benutzt das sehr gleichmäßige und
spaltbare Tannenholz wie Fichtenholz, außerdem namentlich zu
Resonanzböden musikalischer Instrumente. Die T. liefert auch
Harz und Terpentinöl, aber die Rinde ist zum Gerben nicht
geeignet. A. venusta Dougl., in Kalifornien, mit brauner Rinde,
weit herabhängenden untern und unregelmäßig
abstehenden obern Ästen, zugespitzten Nadeln und dreilappigen,
sehr lang zugespitzten Deckblättern, wird über 30 m hoch
und bei uns als Zierpflanze kultiviert, ebenso A. amabilis Dougl.,
an der Westseite Nordamerikas, mit brauner Rinde, in der Jugend auf
beiden Seiten bläulich gestreiften, zuletzt
gleichmäßig grünen, an der Spitze oft ausgerandeten
Nadeln und am Rand gezähnelten Deckblättern, über 60
m hoch werdend. P. balsamea Loud. (A. balsamea Mill., Balsamtanne),
in Nordamerika, südlich bis Virginia, sehr verbreitet, mit
schwärzlichgrauer Rinde, an der Spitze ausgerandeten,
unterseits bläulichweiß gestreiften Nadeln,
gezähnelten Deckblättern und violetten Zapfen, wird 15 m
hoch und bildet eine pyramidale Krone; ihre Blätter und Zweige
riechen gerieben sehr angenehm; sie liefert den Kanadabalsam. P.
Nordmanniana Loud. (A. Nordmanniana Link.), im Kaukasus und im
Pontischen Gebirge, 30 m hoher, meist vom Grund an
regelmäßig mit Ästen besetzter Baum mit
schwärzlichgrauer Rinde, ringsum gestellten, an der Spitze
ausgerandeten, wenigstens am obern Teil gezähnelten und meist
mit verlängerter Spitze versehenen Deckblättern und sehr
großen, meist mit Harz stark bedeckten Zapfen, zählt zu
den schönsten und höchsten Edeltannen, ist
raschwüchsig und vollständig hart und wird daher vielfach
als Zierpflanze kultiviert. P. Pinsapo Loud. (A. Pinsapo Boiss.,
spanische Edeltanne), in den Gebirgen des südlichen Spanien
und Nordafrikas, ein 20-25 m hoher Baum mit grauschwärzlicher
Rinde, ringsum stehenden, zugespitzten, gleichfarbigen oder
unterseits schwach bläulichweiß gestreiften Nadeln,
kurzen, gezähnelten und mit einer besondern Spitze versehenen
Deckblättern und ziemlich großen, am obern Teil etwas
eingedrückten Zapfen, hält in Norddeutschland in
geschützten Lagen ziemlich gut aus. Amerikanische Edeltanne
(P. nobilis Loud., A. nobilis Lindl.), 70 m hoher Baum Kaliforniens
mit kastanienbraunem Stamm, fast ringsum gestellten, nach oben
gekrümmten Nadeln, 16-18 cm langen Zapfen mit
spatelförmigen, oben geschlitzt gezahnten und in eine schmal
lanzettliche Spitze auslaufenden, sehr langen Deckschuppen, eine
der schönsten Edeltannen, bildet in ihrem Vaterland
große Wälder und ist in Norddeutschland vollkommen hart.
Vgl. Schuberg, Die Weißtanne (Tübing. 1888).
Tannenberg, 1) Dorf in der sächs.
Kreishauptmannschaft Zwlckau, Amtshauptmannschaft Annaberg, an der
Zschopau und der Linie Schönfeld-Geyer der Sächsischen
Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, Baumwollspinnerei, Papier- und
Pappenfabrikation, Gorlnäherei und (1885) 1277 Einw. - 2) Dorf
im preuß. Regierungsbezirk Königsberg, Kreis Osterode,
hat (1885) 247 Einw. und ist bekannt durch die Niederlage des
deutschen Ordensheers gegen die Polen und Litauer 15. Juli
1410.
Tannenfalk, s. v. w. Wanderfalk, s. Falken, S. 9.
Tannenfichte, s. v. w. Weimutskiefer.
Tännengebirge, ein Gebirgsstock der
Salzkammergutalpen, vom Salzachthal zwischen Golling und Werfen
östlich gegen die Dachsteingruppe sich hinziehend, im Raucheck
2428 m hoch, verengert mit dem gegenüberliegenden
Haagengebirge das Salzachthal zu enger Schlucht (Paß
Lueg).
Tannenhäher (Nucifraga Briss.), Gattung aus der
Ordnung der Sperlingsvögel, der Familie der Raben (Corvidae)
und der Unterfamilie der eigentlichen Raben (Corvinae),
kräftig gebaute Vögel mit langem, starkem, sanft nach der
Spitze zu abfallendem Schnabel, mittellangen, stumpfen
Flügeln, in welchen die vierte und fünfte Schwinge am
längsten sind, mittellangem, gerundetem Schwanz und starken
Füßen mit kräftigen Nägeln an den mittellangen
Zehen. Der T. (Nußknacker, Berg-, Birkenhäher, N.
caryocatactes Briss.), 36 cm lang, 59 cm breit, ist dunkelbraun,
weiß gefleckt. nur auf Scheitel und Nacken ungefleckt,
Schwingen und Schwanzfedern sind schwarz, letztere an der Spitze
weiß; die Augen sind braun, Schnabel und Füße
schwarz. Der T. bewohnt die Wälder Nordeuropas, Nordasiens und
unsrer Hochgebirge, besonders im Gebiet der Zirbelkiefer. In
Deutschland ist er sehr selten, erscheint aber in manchem Winter
ziemlich häufig; im Norden
512
Tannenklee - Tansillo.
wandert er regelmäßiger, doch im allgemeinen auch
nur, wenn die Zirbelnüsse mißraten sind. Er klettert an
den Bäumen umher und meißelt mit dem Schnabel, wie die
Spechte. Seine Nahrung besteht wesentlich aus Sämereien,
Nüssen, Beeren, Kerbtieren, Schnecken, kleinen Vögeln
etc. Er nistet im März auf Bäumen und legt 3-4 blaß
grünblaue, hellbraun gefleckte Eier, welche das Weibchen in
17-19 Tagen ausbrütet. Er wird nützlich, indem er zur
Verbreitung des Arvensamens an den unzugänglichsten Stellen
beiträgt. In der Gefangenschaft fällt besonders seine
Mordlust auf. Vgl. Tschusi zu Schmidhoffen, Verbreitung und Zug des
Tannenhehers (Wien 1888).
Tannenklee, s. Anthyllis.
Tannenlaus, s. Blattläuse, S. 2.
Tannenpapagei, s. Kreuzschnabel.
Tannenpfeil, s. Kiefernschwärmer.
Tannenroller, s. Spechte.
Tannhausen, Dorf im preuß. Regierungsbezirk
Breslau, Kreis Waldenburg, im Weistritzthal und im Waldenburger
Gebirge, hat eine kath. Kirche, ein Schloß,
Steinkohlenbergbau, mechanische Weberei, Dampfziegelei und besteht
aus den Orten Blumenau (Ober-T.) mit (1885) 1941, Mittel-T. mit
1551 und Erlenbufch (Nieder-T.) mit 356 Einw.
Tannhäuser (Tanhuser), Minnesänger, vermutlich
ein Salzburger oder Bayer, der um die Mitte des 13. Jahrh. am Hofe
Friedrichs des Streitbaren und andrer Fürsten sich aufhielt
und ein abenteuerliches Wanderleben geführt zu haben scheint.
In seinen Liedern schildert er, dem Vorgang Neidharts folgend, mit
Vorliebe das bäuerliche Leben und derbsinnliche Minne,
nebenbei mit allerlei litterarischer Gelehrsamkeit prunkend. Auch
ein didaktisches Gedicht: "Hofzucht", wird ihm beigelegt. Eine
seiner Weisen erhielt sich bei den Meistersängern. Seine
lyrischen Gedichte finden fich im 2. Teil der "Minnesinger" von
Hagen (Leipz. 1838), die "Hofzucht" im 6. Band von Haupts
"Zeitschrift für deutsches Altertum" (das. 1848). An sein
bewegtes Leben und ein ihm beigelegtes Bußlied knüpft
sich die bekannte Sage vom Ritter T., der im Venusberg verweilte,
dann nach Rom pilgerte, um Vergebung seiner Sünden zu
erlangen, und, als ihm diese versagt wurde, verzweiflungsvoll zu
Frau Venus im Hörselberg (s. d.) zurückkehrte. R. Wagner
hat die Sage zu einer Oper verarbeitet. Vgl. Grässe, Der T.
und ewige Jude (2. Aufl., Dresd. 1861); Zander, Die
Tannhäusersage und der Minnesänger T. (Königsb.
1858).
Tannieren, s. Gallieren.
Tannin, s. Gerbsäuren, S. 160.
Tanningensäure, s. Katechin.
Tanninstoffe, s. v. w. Gerbsäuren.
Tann-Rathsamhausen, Ludwig Samson Heinrich Arthur,
Freiherr von und zu der, bayr. General, geb. 18. Juni 1815 zu
Darmstadt als Sohn des 1848 verstorbenen bayrischen Kämmerers
Freiherrn Heinrich von und zu der T. und einer Freiin von
Rathsamhausen aus einer erloschenen elsässischen Familie, trat
1833 als Leutnant in die bayrische Artillerie, ward 1840 in den
Generalstab versetzt, 1844 Adjutant des Kronprinzen Maximilian und
bald Major, ging 1848 beim Ausbruch des Kriegs in
Schleswig-Holstein dahin, wo er in kurzem in das Freischarenwesen
Ordnung zu bringen wußte und bei Altenhof und Hoptrup
glänzende Waffenthaten verrichtete, ward 1849 Chef des
Generalstabs der unter dem Prinzen Eduard von Sachsen-Altenburg
stehenden Division und trat im Juli 1850 als Oberst und
Generalstabschef des Generals Willisen in die
schleswig-holsteinische Armee, mit der er bei Idstedt, Missunde und
Friedrichstadt kämpfte. Nach Bayern zurückgekehrt, ward
er Oberstleutnant und Adjutant des Königs Maximilian II., 1855
Generalmajor, 1860 Generaladjutant des Königs und 1861
Generalleutnant und Generalkommandant in Augsburg, dann in
München. 1866 wurde er zum Generalstabschef des Prinzen Karl,
des Oberbefehlshabers der süddeutschen Kontingente, ernannt,
schloß mit Österreich zu Olmütz die Konvention vom
14. Juni ab und leitete die Operationen der Bayern im Juli, deren
unglücklicher Verlauf von der ultramontanen Presse besonders
T. schuld gegeben wurde, so daß derselbe den Angriffen durch
eine Anklage des "Volksboten" ein Ende machen mußte. (Vgl.
"Die bayrische Heerführung und der Chef des Generalstabs,
Generalleutnant Freiherr v. d. T., vor den Geschworen etc.,
Kissing. 1866.) T. blieb nach dem Kriege Generaladjutant des
Königs und Divisionskommandeur und wurde 1869 zum General der
Infanterie und Kommandeur des 1. bayrischen Korps befördert.
An der Spitze desselben kämpfte er 1870 mit Auszeichnung bei
Wörth, Beaumont und Sedan, erhielt Anfang Oktober den
Oberbefehl über eine aus seinem Korps, der 22.
preußischen Infanterie- sowie der 1. und 4.
Kavalleriedivision gebildete Armeeabteilung, siegte 10. Okt. bei
Orléans, das er besetzte, zog sich nach tapferer Gegenwehr
gegen die französische Übermacht bei Coulmiers 9. Nov.
nach Norden zurück, kämpfte 2.-10. Dez. unter dem
Großherzog von Mecklenburg in mehreren blutigen Gefechten bei
Orléans und kehrte Ende Dezember 1870 zur Zernierungsarmee
vor Paris zurück. Er starb als Kommandeur des 1. bayrischen
Armeekorps 26. April 1881 in Meran. Vgl. Zernin, Freih. Ludw. von
und zu der T. (Darmstadt 1883); Helvig, Ludw., Freih. v. T. (Berl.
1884).
Tannroda, Stadt im weimar. Verwaltungsbezirk Weimar I, an
der Ilm und der Eisenbahn Weimar-T.-Kranichfeld, 294 m ü. M.,
hat eine evang. Kirche, eine Burgruine, eine Oberförsterei,
Korbflechterei, eine Dampfschneide-, Mahl-, Gips- und
Lohmühle, Holzhandel und (1885) 889 Einw.
Tannwald, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmannschaft
Gablonz, an der Bahnlinie Eisenbrod-T., mit Bezirksgericht,
Baumwollspinn- und Webfabrik (23,500 Spindeln und 500 mechanische
Webstühle), Maschinenbauwerkstätte, Glasschleiferei,
Glaskurzwarenindustrie und (1886) 2726 Einw.
Tan-ra, früher Name der Insel Quelpart (s.d.).
Tansillo, Luigi, ital. Dichter, geboren um 1510 zu Venosa
im Neapolitanischen, trat früh in die Armee und erwarb sich
durch seinen Mut nicht minder als durch sein poetisches Talent die
Gunst des Don Garcias, Sohns des Vizekönigs von Neapel, den er
nach Sizilien und später auf der Expedition gegen Tunis (1551)
begleitete. Ein geistreiches, aber schlüpfriges Gedicht: "Il
vendemmiatore" (Neapel 1534, Vened. 1549, Par. 1790; franz. von
Mercier: "Jardin d'amour", das. 1798), begründete seinen
litterarischen Ruf, zog ihm aber das Verdammungsurteil der
römischen Kurie zu. Um dieselbe wieder auszusöhnen,
schrieb er das religiöse Epos "Le lagrime di San Pietro", von
welchem jedoch bei seinen Lebzeiten nur ein Teil gedruckt wurde,
und welches er auch unvollendet hinterließ. Erst nach seinem
Tod erschien das Gedicht, welches im einzelnen große
Schönheiten besitzt, aber durch seine Länge und eine
gewisse Monotonie ermüdet (Vened. 1606). T. starb um 1570.
Außer den genannten Werken hat man
513
Tansimat - Tantieme.
von ihm das dramatische Gedicht "I due pellegrini" (Neap. 1631).
Die Ausgabe seiner "Opere" (Vened. 1738) enthält die beiden
letztgenannten Gedichte und seine "Rime Varie", unter welchen sich
viele gute befinden. Später wurden aus Handschriften
publiziert die beiden Lehrgedichte: "La balia" (Vercelli 1767,
Vened. 1797) und "Il podere" (Tur. 1769, Parma 1797), welch
letzteres zu den besten seiner Gattung in der italienischen
Litteratur gehört, sowie verschiedene "Capitoli" (Vened.
1832-31).
Tansimat,s. Tanzimat.
Tanta, Hauptstadt der ägypt. Provinz Garbieh mit
(1882) 33,750 Einw. (1029 Ausländer), hat große
kommerzielle Bedeutung infolge seiner zentralen Lage im Nildelta,
als Kreuzungspunkt mehrerer Eisenbahnen und Kanäle, des
prächtigen Grabes des wunderthätigen Scheichs Ahmed el
Bedawi und seiner drei großen Messen, von welchen die im
August an 500,000 Menschen hier versammelt. Die hiesige Medresse
wird von nahe an 5000 Schülern besucht und steht nur der von
Kairo nach. T. ist Sitz eines deutschen Konsulats.
Tantal (Columbium) Ta, chemisch einfacher Körper,
findet sich als Tantalsäuresalz im Tantalit, Columbit,
Yttrotantalit, Pyrochlor und andern seltenen Mineralien, wird aus
diesen als schwarzes, sehr widerstandsfähiges Pulver erhalten,
verbrennt beim Erhitzen an der Luft zu Tantalsäureanhydrid
Ta2O5 und gibt beim Erhitzen in Chlor Tantalchlorid TaCl5.
Tantalsäure H3TaO4 verbindet sich mit Basen in mehreren
Verhältnissen. Atomgewicht des Tantals ist 182. T. wurde 1801
von Hatchett entdeckt.
Tautalit, Mineral aus der Ordnung der Tantalate und
Niobate, findet sich in rhombischen, säulenförmigen
kristallen, auch derb und eingesprengt, ist schwarz,
undurchsichtig, unvollkommen metallglänzend, Härte 6-6,5,
spez. Gew. 6,3-8, besteht aus tantal- und niobsaurem Eisenoxydul
Fe(TaNb)2O6 mit Mangangehalt. Eine zinnreiche Varietät ist der
Ixiolith. T. findet sich bei Falun in Schweden, in Finnland etc.,
überall in Granit eingewachsen.
Tantalos, im griech. Mythus König von Lydien oder
Phrygien, Sohn des Zeus und der Pluto, Vater des Pelops und der
Niobe, Großvater des Atreus und Thyestes, durfte als Liebling
des Zeus an den Göttermahlen teilnehmen. Dadurch
übermütig geworden, lud er selbst die Götter ein und
setzte ihnen, um ihre Allwissenheit zu prüfen, das Fleisch
seines eignen Sohns Pelops vor. Nach andern soll er des Zeus
geheime Ratschlüsse ausgeplaudert oder Nektar und Ambrosia vom
Göttertisch entwendet haben. Zur Strafe für diesen Frevel
stürzten ihn die Götter in die Unterwelt, und hier
mußte er (nach der Sage bei Homer) fortwährend den
qualvollsten Hunger u. Durst leiden. Er stand in einem Teich,
während Bäume ihre fruchtbeladenen Zweige über ihn
nieder neigten; aber so oft er davon pflücken oder aus dem
Teich trinken wollte, wichen Früchte und Wasser zurück.
Nach Pindar schwebt er selbst in der Luft, und über seinem
Haupt hängt ein stets den Sturz drohender Felsenblock.
Darstellungen finden sich auf Vasenbildern, z. B. in der
Münchener Sammlung (s. Abbildung).
Tautalusbecher, Vexierbecher, s. Heber, S. 256.
Tantardini, Antonio, ital. Bildhauer, geb. 1829 zu
Mailand, bildete sich an der dortigen Akademie und zeigte schon in
seinen ersten Arbeiten, einer Marmorbüste von Dantes Beatrice,
einer Marmorstatue des Studiums und dem Grabdenkmal der
Sängerin Giuditta Pasta (gest. 1865), ein eifriges Studium der
Antike und der Cinquecentisten. Es folgten eine kolossale Statue
des Moses für Mailand, eine Statue des Märtyrers Arnold
von Brescia (in Desio bei Mailand), die sitzende Muse der
Geschichte an dem Cavour-Denkmal Tabacchis in Mailand und das
Denkmal des Physikers Volta in Pavia. Unter seinen kleinern
Arbeiten, die sich durch meisterhafte Behandlung des Stofflichen
auszeichnen, aber auch unter dem die moderne italienische Plastik
beherrschenden Streben nach Koketterie leiden, sind zu nennen. eine
Figur der Eitelkeit, eine Badende, eine Lesende, eine
Marmorbüste Dantes, der erste Schmerz und Faust und Gretchen.
T. starb 7. März 1879 als Professor der Akademie in
Mailand.
Tantarer, alte ägypt. Stadt, s. Dendrah.
Tant de bruit pour une omelette! (franz.), "so viel
Lärm um einen Eierkuchen!" d. h. um nichts,
sprichwörtlich gewordener Ausruf, der nach einer bekannten
Anekdote auf den Dichter Desbarreaux zurückgeführt
wird.
Tante (franz., mit vorgeschobenem t v. altfranz. ante,
engl. aunt, lat. amita), Muhme, Base, Vaters-, Mutterschwester,
Frau des Oheims etc.
Tantième (franz., spr. tangtíähm, "der
sovielte Teil"), der Anteil, welchen jemand von dem Gewinn eines
Unternehmens bezieht. Das Tantiemesystem bildet den Gegensatz zu
dem Honorarsystem, indem bei dem letztern eine bestimmte und dem
Betrag nach feststehende Vergütung gewährt wird,
während die T. sich nach dem finanziellen Erfolg des
Unternehmens richtet und sich nach Prozentsätzen des
Geschäftsgewinns bestimmt. T. beziehen gewisse Beamte,
Handlungsgehilfen, Provisionsreisende, Arbeiter (s. Arbeitslohn, S.
759), Verwaltungsräte bei Aktiengesellschaften etc. Die T.
kommt aber auch neben festem Gehait vor, wie dies z. B. bei den
Direktoren von Aktiengesellschaften üblich ist. Für
Genossenschaften ist nach dem deutschen Genossenschaftsgesetz von
1889 das Tantiemesystem ausgeschlossen, soweit es sich um die
Bezahlung der Aufsichtsräte handelt. Dagegen ist das
Tantiemesystem bei der Aufführung von dramatischen und
musikalischen Werken das herrschende. Der Komponist wie der Dichter
können hiernach als Autorenanteil einen Bruchteil von der
Einnahme beanspruchen, welche sich beider Aufführung ihres
Werkes (Tantiemevorstellung) ergibt. In Frankreich schon 1791
gesetzlich eingeführt, wurde die Theatertantieme erst seit
1847 von der Generalintendantur der königlichen Schauspiele in
Berlin und ebenso von der Direktion des Burgtheaters in Wien
verwilligt. Jetzt ist die Tantiemezahlung in der
regelmäßigen Höhe von 10 Proz. allgemein
üblich, und die Ausübung einer diesbezüglichen
Kontrolle ist eine Hauptaufgabe der 1871 gegründeten
514
Tantos - Tanzmusik,
Deutschen Genossenschaft dramatischer Autoren und Komponisten,
welche in Leipzig ihren Sitz hat. Im einzelnen Fall ist der
zwischen dem Autor und dem Unternehmer der Aufführung
abgeschlossene Vertrag, im Zweifel die "Theaterpraxis"
maßgebend. Das Bundes- (Reichs-) Gesetz vom 11. Juni 1870,
betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen,
musikalischen Kompositionen und dramatischen Werken, sichert dem
Dichter wie dem Komponisten und ihren Rechtsnachfolgern ihren
Anspruch auf die Vergütung für die Überlassung des
Aufführungsrechts (s. Urheberrecht).
Tantos, s. Rechenpfennige.
Tantra, Name eines spätern brahmanischen Systems,
das ungefähr 500 n. Chr. in Indien entstand und über
Nepal nach Tibet wanderte, wo es einen starken Einfluß auf
den Buddhismus ausübte. Die Anhänger der Tantralehre
(Tantrikas) verehren als Hauptgottheiten Siwa und seine Gattin
Pârwatî, die hier zu strafenden und rächenden
Gottheiten wurden, welche die Verteidigung der Religion des Buddha
übernommen haben. Ihre Schriften, meist Dialoge zwischen
beiden Gottheiten und von der Schöpfung und Zerstörung
der Welt, der Götterverehrung, der Erlangung
übermenschlicher Kräfte etc. handelnd, sind in Europa
noch wenig bekannt.
Tanunda, Ort in Südaustralien, hat 3 deutsche
Kirchen und zählt mit dem nahen Langmeil, Bethanien u. a. 900
Einw. (meist Deutsche).
Tanz, gewisse von Musik begleitete und in einem
bestimmten Zeitmaß ausgeführte körperliche
Bewegungen, die durch technische Fertigkeit und Geschmack in das
Gebiet der Kunst erhoben werden können (Tanzkunst), sowie das
begleitende Musikstück selbst (s. Tanzmusik). Die Tanzkunst
gehört unter die mimischen Künste; wie aber bei der
Pantomime die Bewegungen der Füße den Bewegungen und
Gebärden des übrigen Körpers untergeordnet sind, so
finden im T. umgekehrt die Bewegungen der Füße
gewissermaßen eine Begleitung (Akkompagnement) in den
Bewegungen des übrigen Körpers. Man teilt den T. in den
gesellschaftlichen und den theatralischen. Der gesellschaftliche T.
hat das gemeinschaftliche Vergnügen, die Unterhaltung zum
Zweck und schließt auch die sogen. Nationaltänze, die
als Ausdruck nationaler Eigentümlichkeiten ein besonderes
Interesse haben, in sich. Zu letztern gehören bei den
Deutschen namentlich der Walzer (künstlich zur Allemande
ausgebildet), bei den Franzosen die Menuett und Française,
in England die Anglaise, in Schottland die Ekossäse, bei den
Spaniern die Sarabande und der Fandango, bei den Italienern die
Tarantella und der Saltarello, in Polen die Polonäse, Mazurka,
der Krakowiak etc. Beim theatralischen T., der von
künstlerisch gebildeten Tänzern aufgeführt wird,
unterscheidet man gewöhnlich die grotesken Tänze, die
mehr Ausdruck der Kraft als der Grazie, ungewöhnliche
Sprünge und Gebärden erfordern; die komischen Tänze,
die, ebenfalls lebhaft, sich mitunter bis zum Mutwillen steigern,
und die halben Charaktere, die eine Intrige, eine Liebesaffaire
darstellen und besonders Zierlichkeit und Geschmack verlangen;
hierzu kommt noch das Ballett (s. d.). - Schon in den frühsten
Zeiten des Altertums nahm der T. eine wichtige Stelle ein und zwar
vorzugsweise zur Verherrlichung öffentlicher Feste und als
Teil des Kultus; namentlich konnte in Asien der sinnliche
Götterdienst des Tanzes nicht entbehren. Am meisten wurde aber
die Kunst des Tanzes (Orchestik) bei den Griechen ausgebildet, bei
denen sie auch das ganze Gebärdenspiel mit in sich
schloß und in der innigsten Vereinigung mit Gesang, Poesie
und Schauspielkunst stand (vgl. Flach, Der T. bei den Griechen,
Berl. 1880). Die Römer überkamen Tänze von den
Griechen, eigentliche Nationaltänze hatten sie kaum. Die
Histrionen (Ludier) tankten auf den Theatern nach dem
Flötenspiel, ohne dabei zu singen, und suchten durch
Gebärden Ernsthaftes auf lächerliche Weise nachzuahmen.
Von der altrömischen Bühne ging der T. auf die
italienischen Volkstheater über; die neuere Tanzkunst ist von
den Italienern und Franzosen ausgegangen. Die
Gesellschaftstänze haben mehrfache Wandlungen durchgemacht.
Anfangs wurde bei diesen sogen. niedrigen Tänzen (danses
basses) weder gesprungen, noch gehüpft, sondern man bewegte
sich nur in feierlichem Schritt (pas). Diese Tanzweise fand in
Frankreich unter Ludwig XII., Franz I. und Heinrich II. Eingang.
Unter Katharina von Medici erhielten die Damen üppigere
Kleidung, kurze Röcke etc., und die Tänze selbst wurden
lebhafter; auch verband man Maskeraden mit Bällen und tanzte
die Nationaltänze der Provinzen. Unter Ludwig XIV. legte
Beauchamp den Grund zu dem künstlichen theatralischen T. der
Franzosen, den später besonders Noverre ausbildete. In der
neuern Zeit machten sich besonders die Familien Vestris und
Taglioni im Kunsttanzen berühmt; außerdem sind als
hervorragende Tänzerinnen zu nennen Therese und Fanny
Elßler, Fanny Cerrito, Marie Taglioni, Grisi, Lucile Grahn
und Adele Granzow; als Tänzer A. Saint-Leon, K. Müller,
Paul Taglioni u. a. Geraume Zeit leistete das Ballett der
Großen Oper zu Paris das Höchste in dieser Kunst, bis
ihm in der neuern Zeit das Ballett des Berliner Opernhauses
ebenbürtig zur Seite trat. Vgl. Czerwinski, Tanz und Tanzkunst
(2. Ausg., Leipz. 1882); Derselbe, Die Tänze des 16.
Jahrhunderts (Danz. 1878); Voß, Der T. und seine Geschichte
(Berl. 1868); Angerstein, Die Volkstänze im deutschen
Mittelalter (2. Aufl., das. 1874); Klemm, Katechismus der Tanzkunst
(5. Aufl., Leipz. 1887); Böhme, Geschichte des Tanzes in
Deutschland (das. 1886, 2 Bde., mit Musikbeilagen); Zorn, Grammatik
der Tanzkunst (das. 1887).
Tanzimat (Tansimat, arab.), s. v. w. Anordnungen;
besonders die auf den Hattischerif (s. d.) von Gülhane sich
gründenden organischen Gesetze, welche als Norm für die
Regierung des türkischen Reichs vom Sultan Abd ul Medschid
1844 veröffentlicht wurden. Sie betreffen namentlich auch die
Stellung der christlichen Unterthanen der Pforte, wurden aber nie
ernstlich durchgeführt. Infolge der Reformverpflichtungen,
welche die Pforte nach Ausbruch des Krimkriegs ihren
europäischen Bundesgenossen gegenüber eingehen
mußte, erließ der Sultan 7. Sept. 1854 eine neue
Verordnung, in welcher nicht allein die vollständige
Durchführung der T. befohlen, sondern zu diesem Behuf auch
eine besondere Kommission niedergesetzt ward. Allgemeiner versteht
das türkische Volk unter T. überhaupt Neuerungen.
Tanzkunst (Choreutik), s. Tanz.
Tanzmusik, die bei Gesellschaftstänzen üblichen
Musikstucke, als deren zur Zeit beliebteste zu nennen sind: Walzer,
Mazurka, Schottisch (Polka), Tirolienne (Ländler), Galopp,
Polonäse, Française, Kontertanz (Anglaise) und
Quadrille. Aus verschiedenen Tänzen zusammengesetzt ist der
Kotillon. Haupteigenschaften guter T. sind: gut gruppierte
Rhythmen, fließende, ungesuchte, gefällige und dabei
pikante Melodien mit ansprechender Harmonie und interessanter
Instrumentation. In der Komposition der
515
Tanzwut - Tapeten.
höhern theatralischen T. oder des Balletts haben besonders
Benda, Weigl, Winter, Righini, Adam, Beethoven ("Prometheus"),
Spontini, Weber, Meyerbeer, Halévy, in neuester Zeit
Rubinstein (Ballettmusik in der Oper "Feramors") Ausgezeichnetes
geleistet, während die Musik für gesellschaftliche
Tänze in unsrer Zeit vor allen durch Strauß und Lanner,
denen sich Gungl, Labitzky und Lumbye beigesellten, ausgezeichnete
Pflege fand. In Frankreich stehen an der Stelle der erstgenannten
Walzerkönige die Quadrillenkomponisten Tolbecque, Musard,
Offenbach, Lecocq, als Komponist von Ballettopern L. Delibes. - Die
ältern Tänze waren ursprünglich Tanzlieder, so die
deutschen Ringelreihen und Springtänze, die spanischen
Sarabanden, die französischen Branles, Gavotten, Couranten,
Giguen, Rigaudons, Musetten, Bourrées, Passepieds, Loures
etc., die italienischen Paduanen, Gagliarden, Ciaconen, Passamezzi,
die englischen Ballads, Hornpipes, dänischen Reels etc. Die
Instrumentenspieler verbreiteten die Melodien, und sie mögen
oft genug schon vor dem 16. Jahrh. nur von Instrumenten ohne Gesang
gespielt worden sein. Eine kunstgemäße mehrstimmige
Bearbeitung für Instrumente erfuhren sie, wie es scheint,
zuerst im Anfang des 16. Jahrh., aus welcher Zeit uns viele
gedruckte Sammlungen erhalten sind. Eine Sammlung deutscher
Tanzlieder und Tanzmelodien enthält Böhmes "Geschichte
des Tanzes in Deutschland" (Bd. 2, Leipz. 1886). In eine neue Phase
der Entwickelung traten die Tanzstücke, als man anfing, ihrer
mehrere zu cyklischen Formen zu vereinigen, wobei zunächst die
Einheit der Tonart das Bindemittel bildete. In der daraus
entspringenden Form der Partie (Partita) oder Suite (s. d.), die
besonders für Klavier allein und für Violine allein oder
mit Klavier um die Wende des 17.-18. Jahrh. mit Vorliebe gepflegt
wurde, erfuhren die Tanzstücke erhebliche Weiterungen, so
daß sie statt kurzer achttaktiger Reprisen ausgeführte
Themen, Gegenthemen und Durchführungen erhielten. In unserm
Jahrhundert finden teilweise noch die ältern Tanzstücke
Pflege (besonders das Menuett), sei es in der Form der Sonate oder
Suite oder in noch freiern Zusammenstellungen von Stücken
verschiedener Art oder einzeln (Gavotte), teils sind auch die
neuesten Tänze einer kunstvollen Ausgestaltung unterworfen
worden, so von Haydn (Menuette), Beethoven ("Deutsche Tänze"
und "Kontertänze"), Weber ("Aufforderung zum Tanz", Es
dur-Polonäse, Ekossäsen etc.), Schubert (Walzer,
Ländler, Ekossäsen), Chopin (Polonäsen, Mazurken,
Walzer), Schumann ("Ballszenen", "Faschingsschwänke",
"Karneval"), Brahms ("Walzer", "Ungarische Tänze" etc.), Kiel
("Deutsche Reigen", Walzer für Streichquartett), Liszt ("Valse
de bravour", "Chromatischer Galopp"), Raff (Humoresken, Tarantella
etc.) u. a.
Tanzwut (Tanzsucht), epidemische Volkskrankheit des
Mittelalters, welche besonders in den Jahren 1021, 1278, 1375 und
1418 herrschte. Von religiösem Wahnsinn ergriffen, tanzten
Tausende, bis ihnen Schaum aus dem Mund quoll, Zuckungen sich
einstellten und der Unterleib unförmlich aufschwoll. Dabei
gaben sie vor, während des Tanzes himmlische Visionen zu
haben, und zogen häufig, wie die Flagellanten (s. d.), mit
bekränztem Haupt von Ort zu Ort. Da man die Tänzer
für vom Teufel Besessene hielt, nahm der Klerus allerlei
Beschwörungen vor, obwohl fruchtlos, und die Angehörigen
wandten sich mit Gebet um Hilfe an St. Johannes und St. Veit (daher
Veitstanz). Im 14. Jahrh. trieben am Niederrhein die
Johannistänzer ihr Wesen, welche ihren Tanz zu Ehren des St.
Johannes aufführten. Auch der Tanz der Derwische und der
Schüttlersekten in Nordamerika kann zu diesen
Exaltationszuständen gerechnet werden. Manche mit
tanzähnlichen Bewegungen verbundene körperliche
Krankheitszustände, wie die Reitbahn- oder Manegetouren,
gehören in das Gebiet der sogen. Zwangsbewegungen. S. auch
Tarantel und Veitstanz. Vgl. Hecker, Die T., eine Krankheit im
Mittelalter (Berl. 1832); Derselbe, Die großen
Volkskrankheiten des Mittelalters (das. 1865).
Tao, s. Laotse.
Taormina, Stadt in der ital. Provinz Messina (Sizilien),
Kreis Castroreale, 396 m ü. M., an der Ostküste der Insel
und an der Eisenbahn Messina-Catania reizend gelegen (herrliche
Ausblicke auf den Ätna und das Meer), hat ein wohlerhaltenes,
in griechischer Zeit gegründetes, unter den Römern
umgebautes Theater, ein großes Wasserreservoir für
Bäder (sogen. Naumachia), römische Grabmäler und
andre antike Baureste, ein maurisches Kastell, eine alte Mauer mit
Türmen, interessante gotische Gebäude, einen Dom mit
Zinnenturm und (1881) 2388 Einw. - T. ist an Stelle des nahe
südlich am Kap Schiso 736 v. Chr. von Chalkidiern
gegründeten, 403 von Dionysios von Syrakus zerstörten
Naxos 358 als Tauromenion gegründet worden. Im Sklavenkrieg
wie in den Kämpfen zwischen Oktavian und Sextus Pompejus
heruntergekommen, geriet es, wenn auch durch eine römische
Kolonie ausgefrischt, in Verfall und behauptete nur noch in
arabischer und normännischer Zeit eine strategische
Bedeutung.
Taos, Ort im N. des nordamerikan. Territoriums Neumexiko,
80 km nordnordöstlich von Santa Fé, früher von
Bedeutung, jetzt nur ein ärmliches Dorf.
Taosse, s. Laotse.
Taouata (Tauata, Santa Christina), eine der
Markesssinseln, 70 qkm groß mit (1885) 551 Einw. In dem
Freihafen Port Anna Maria konzentriert sich der Verkehr der Inseln;
hier ist auch der Sitz der französischen Behörden.
Tapachula (spr. -tschula), Stadt, s. Soconusco.
Tapajoz (spr. -schos, Tapayoso), Fluß in Brasilien,
entspringt als Arinos in der Provinz Mato Grosso, wird bald
schiffbar, fließt nordöstlich in die Provinz Para und
fällt dort nach einem Laufe von etwa 1680 km bei Santarem
rechts in den Amazonenstrom. Er bildet mehrere Wasserfälle.
Dampfschiffe befahren ihn von 330 km aufwärts bis zu dem
untersten derselben, der Caxoeira de Apué.
Tapanhoancanga, brasilisches, Gold, Diamant und andre
Edelsteine führendes Trümmergestein, besteht aus eckigen,
großen Fragmenten von Eisenoxyden (Magneteisen, Roteisen,
Brauneisen), durch eisenschüssiges Bindemittel verkittet.
Tapet (lat. tapetum), Teppich oder Decke zur Bekleidung
von Tischen, Wänden, Fußböden etc.; daher "etwas
aufs T. bringen", s. v. w. auftischen, zur Sprache bringen. Aus dem
zum Singular gewordenen Plural tapeta entstand unser Tapete.
Tapeten, Gewebe, Leder oder farbiges und gemustertes
Papier zur Bekleidung der Wände. T. und Teppiche (v. lat.
tapetum. griech. tapes, Decke) haben ihren gemeinsamen Ursprung im
Zelte der wandernden Völkerschaften und gelangten aus diesem
in die Wohnungen der seßhaften Völker. Tyros, Sidon und
Pergamon waren im Altertum berühmt wegen ihrer Teppiche. Aus
dem Orient, wo sich die Bildweberei und Stickerei schon früh
zu hoher Vollkommenheit entwickelt hatte, brachten Araber diese
Kunst nach Europa. Während man in Frankreich und Ita-
516
Tapeten (Fabrikation).
lien die orientalischen Gewebe in Seide nachahmte, verarbeitete
man in dem nördlichern Belgien nur Wolle und lieferte im
14.-17. Jahrh. namentlich in Antwerpen, Brüssel, Brügge,
Courtrai gewirkte T. mit figürlichen Darstellungen nach
Entwürfen hervorragender Künstler. Im 17. Jahrh. galten
solche Wandteppiche, zu welchen selbst Rubens Vorlagen lieferte,
und auf denen später mit Vorliebe Genrebilder von Teniers,
Jagden u. dgl. m. nachgebildet wurden, als kostbares Besitztum.
Sehr geschätzt waren die T. von Arras, unter denen diejenigen,
welche Leo X. nach Kartons von Raffael anfertigen ließ,
besonders berühmt geworden sind (vgl. Arrazzi). Neben den
gewirkten T. fertigte man auch solche aus Seide oder Leinen, die
mit Malereien oder Stickereien geschmückt wurden. Ein solcher
Wandteppich befindet sich zu Bayeux in Frankreich (Departement
Calvados), ein 70 m langer, 0,50 m hoher Leinwandstreifen, aus
welchem in Stickerei mit Leinwandfäden die Eroberung Englands
durch die Normannen dargestellt ist. Aus den Niederlanden gelangte
die Teppich- und Tapetenweberei auch nach Frankreich (um 1550
Schule von Fontainebleau) und Deutschland, und unter Ludwig XIV.
legte Colbert eine Teppichweberei in der Fabrik der Gebrüder
Gobelin an, aus welcher die nach diesen Fabrikanten benannten
Gobelins (s.d.) hervorgingen. Die Herstellung derselben (je nachdem
die Kette senkrecht oder wagerecht aufgezogen wird, Hautelisse-
oder Basselisseweberei genannt) ist ungemein mühsam und
gleichsam ein Sticken oder Malen mit dem Faden. Auf die Kette des
leinwandartigen Gewebes wird das auf durchsichtiges Papier
gezeichnete Muster gelegt und mit Punkten auf die Kette
übertragen, worauf jede Farbe, welche auf der Zeichnung
isoliert steht, in Schußfäden mittels kleiner Spulen aus
freier Hand eingezogen wird. Die Savonnerietapeten (nach dem Ort
ihrer Anfertigung, einer frühern Seifenfabrik in Chaillot,
benannt) ahmen persische und türkische T. nach und erfordern
gleichfalls viel Handarbeit, indem die Noppen einzeln an die
Kettenfäden angeknüpft werden. Schon im 11. Jahrh. wurden
in Spanien Ledertapeten (Cordovatapeten) hergestellt, indem man das
Leder versilberte, polierte und mit goldfarbenem Lack überzog,
worauf die Muster mit hölzernen Modeln eingepreßt und
der Grund von oben mit Bunzen gemustert wurde. Auch trat
später Malerei hinzu. Im 16. Jahrh. wurden Ledertapeten in
Venedig und Sizilien, im 17. Jahrh. in den Niederlanden und
Frankreich, auch in Deutschland und England verfertigt, bis sie im
18. Jahrh. durch Seiden- und Papiertapeten verdrängt wurden.
In neuerer Zeit sind sie wieder in Aufnahme gekommen, doch wird das
Leder meist durch eine Nachahmung aus Papiermasse ersetzt. Ein
billigerer Ersatz der Ledertapeten waren die Wachstuchtapeten,
welche auch mit Wollpulver (Flocktapeten) gemustert wurden. Neben
ihnen sind noch zu erwähnen: die Kattuntapeten der
Holländer, atlas- und damastartig gewirkte seidene T., wie
Brocatelles, Bergamées etc., die mit der Nadel auf Kanevas
ausgeführten Chinatapeten, die Federtapeten (s. d.) etc.
Heutigestags versteht man unter T. die zur Wandbekleidung
angewendeten Papiertapeten, welche in Stücken (Rollen) von
etwa 0,5 m Breite und 10 bis 11 m Länge oder als Borten von
geringerer Breite oder auch in abgepaßten Größen
(Plafond- und Füllungstapeten) einfarbig und gemustert
hergestellt werden. Zur Erzeugung derselben dient im Stoff
gefärbtes oder einseitig mit Farbe überzogenes
(grundiertes) Papier. Man trägt die mit Leimlösung
gemischte Farbe mit Bürsten oder auf der Grundier- (Foncier-)
Maschine auf. Hierbei läuft das Papier von einer Rolle ab
über eine große Trommel, nachdem es von einer Filzwalze
die Farbe erhalten hat, welche durch hin- und hergehende
Bürsten verstrichen wird. Darauf folgt ein Trocknen in einer
Hängemaschine, welche sich unmittelbar an die Grundiermaschine
anschließt. Sollen die T. Glanz erhalten (Glanztapeten), so
werden sie nach dem Grundieren satiniert, indem man sie mit Talkum
abbürstet. Glätte erhalten sie mittels Kalander (s. d.).
So vorbereitet gelangen die Rollen zum Bedrucken, wobei entweder,
wie beim Kattundruck, Druckformen oder neuerdings vielfach
Tapetendruckmaschinen, welche in der Stunde 800-900 m Papier
bedrucken, zur Verwendung kommen. Das Wesen derselben besteht in
Druckwalzen aus Holz, Letternmetall oder Kupfer, in deren
Peripherie die Muster entweder erhaben oder vertieft vorhanden
sind. Eine solche Maschine besteht aus einem Apparat zur
ununterbrochenen Zuführung des Papiers, aus so viel
Druckwalzen, als Farben verwendet werden sollen, aus ebensoviel
Vorrichtungen zum Auftragen der Farben, aus einem
widerstandsfähigen Organ zum Auflegen des Papiers während
des Druckens, endlich aus einer Vorrichtung zum Aufhängen und
Trocknen der bedruckten Papiere. Auch die auf Maschinen gedruckten
T. müssen nachher geglättet werden.
Besondere Arten von T. sind: Veloutierte T. (Wolltapeten,
Samttapeten), auf welchen der Grund oder ein Teil des Musters mit
festklebenden, gefärbten kurzen Wollhärchen (Scherwolle)
oder auch fein zerriebenen Holzspänchen (Holzwolle) derart
bedeckt ist, daß diese Stellen eine dichte und
gleichmäßig wollige Oberfläche zeigen. Das
Veloutieren wird nach dem Drucken dadurch vorgenommen, daß
man die Stellen der T., welche Wolle annehmen sollen, mittels
hölzerner Formen mit einem sehr zähen Leinölfirnis
bedruckt oder bestreicht, dann in einem langen Kasten mit einem
Boden aus Kalbleder oder Pergament ausbreitet, Scherwolle ausstreut
und den Deckel des Kastens schließt. Durch Trommeln auf dem
Boden desselben mit Holzstäben werden die Wollstäubchen
in die Höhe geworfen und verteilen sich herabfallend auf den
T., wo sie an den noch nassen gefirnißten Stellen kleben
bleiben und mit antrocknen. Vergoldete und versilberte T. stellt
man durch Andrucken von Blattgold oder Blattsilber an mit
Leinöl bedruckte Stellen oder durch direktes Bedrucken mit
pulverförmigem Gold, Silber oder Bronze her. Gepreßte
(gaufrierte) T. heißen solche, welchen mittels eines
besondern Walzwerks (Gaufriermaschine) ein Reliefmuster aufgedruckt
ist. Gefirnißte T. Mit dem Firnissen bezweckt man, den T. ein
hohen Glanz zu geben, sie gegen Feuchtigkeit zu schützen, so
daß sie abgewaschen werden können, und
widerstandsfähiger zumachen. Man bedient sich dazu in der
Regel des Kopalfirnisses, der mit großen Bürsten wie
beim Grundieren aufgetragen wird. Namentlich sind es die die
Holzmaserung nachahmenden Holztapeten, welche gefirnißt
werden, um ihnen das Ansehen polierter Holzflächen zu geben.
Iristapeten sind solche, bei denen zwei oder mehrere nebeneinander
aufgetragene Farben durch sanft verwaschene Mitteltöne
ineinander übergehen, woraus ein buntes, dem Farbenreichtum
des Regenbogens zuvergleichendes Ansehen hervorgeht. Die Irisierung
kann entweder beim Grundieren oder beim Drucken vorgenommen werden.
Vgl. Exner, Die T.-
517
Tapetenzellen - Tapir.
und Buntpapierindustrie (Weim. 1869); Hoyer, Fabrikation des
Papiers, der Buntpapiere und T. (Braunschweig 1887); Seemann, Die
Tapete (Wien 1882); Planchon, Étude sur l'art de fabriquer
les tapisseries des gobelins (Par. 1867); Guiffrey, Müntz und
Pinchart, Histoire générale de la tapisserie (das.
1878-85, l00 Tafeln); de Campeaux, Tapestry (Lond. l878); Guiffrey,
La tapisserie depuis le moyen-âge, etc. (Tours 1885);
Müntz, La tapisserie (Par. 1888); Farabulini, L'arte degli
arazzi e la nuova galleria dei Gobelins al Vaticano (Rom 1885);
Havard u. Vachon, Les manufactures nationales (Par. 1889). S. auch
Tapezieren.
Tapetenzellen, s. Embryosack, S. 598.
Tapetum nigrum (lat.), schwärzliche Pigmentlage,
welche die Regenbogenhaut, Strahlenkörper und Aderhaut von
innen bedeckt.
Tapezierbiene (Blattschneider, Megachile Latr.),
Insektengattung aus der Ordnung der Hautflügler und der
Familie der Bienen (Apiariae), Insekten mit sehr breitem Kopf,
stumpfer Unterlippe, welche um die Hälfte länger ist als
die Lippentaster, sehr langer, säbelförmiger Kieferlade,
kurzen, zweigliederigen Tastern und beim Weibchen auf dem
Rücken bedeutend abgeflachtem Hinterleib, welcher nach oben
sticht, während beim Männchen die beiden letzten
Hinterleibsringe nach unten eingekrümmt sind; zahlreiche,
über alle Erdteile verbreitete Arten, welche ihre Nester in
Baumlöcher, Mauerspalten, Erdhöhlen etc. bauen und aus
Blattstücken gewisser Pflanzen fingerhutförmige,
aneinander gereihte Zellen fertigen. Die gemeine T. (M.
centuncularis L.), am Mittelleib braungelb und schwärzlich, am
Hinterleib fast kahl, nur vorn mit graulichen Zottenhaaren, mit
weißen, oft unterbrochenen Bändern und am Bauch mit
rotbraunen Sammelhaaren, fliegt in Europa und Nordamerika und baut
ihr Nest in Baumlöcher, z. B. in den Gang einer
Weidenbohrerraupe, welchen sie zurechtnagt und mit sorgfältig
ausgeschnittenen Blattstückchen, besonders von
Rosenstöcken, tapeziert. Sie füllt die Zellen mit Honig ,
legt in jede ein Ei und verschließt sie mit einem
Blattstück. Eine Zelle steht auf der andern. Die entwickelte
Larve spinnt ein Gehäuse, überwintert, und im
nächsten Frühjahr schlüpft die Biene aus.
Tapezierblei, s. Bleiblech.
Tapezieren, die Wände mit Tapeten überziehen,
im weitern Sinn die Kunst des Dekorateurs, welcher in den Wohnungen
Vorhänge, Gardinen, Portieren etc. anordnet; auch die
Polsterung von Sitzmöbeln gehört in das Gebiet des
Tapeziererhandwerks. Das T. ist zuerst von den Franzosen
künstlerisch ausgebildet worden. Nachdem sie bis um die Mitte
der 60er Jahre den europäischen Geschmack fast allein
beherrscht hatten, machten sich zuerst die Österreicher, seit
Mitte der 70er Jahre auch die Deutschen unabhängig. Vgl.
Reuter, Schule des Tapezierers (2. Aufl., Weim. 1884); "Die
Tapezierkunst" (Berl. 1887); Streitenfeld, Die Praxis des
Tapezierers (48 Tafeln, das. 1888 ff.); Deville, Dictionnaire du
tapissier (Par. 1879-1880, 2 Bde.) und Litteratur bei Tapeten.
Tapferkeit kommt mit dem Mut (s. d.) darin überein,
daß sie wie dieser die Gefahr nicht scheut, aber nicht wie
dieser eine aus körperlicher Organisation entsprungene,
sondern auf Bewußtsein und Willen beruhende Eigenschaft ist
und daher weder, wie die Tollkühnheit (s. d.), aus Unkenntnis,
noch, wie die Verwegenheit, aus Geringschätzung der Gefahr,
sondern im Bewußtsein der Pflicht derselben nicht achtet.
Tapferkeitsmedaillen, militärische Ehrenzeichen,
welche vornehmlich für Unteroffiziere und Soldaten bestimmt
sind, die sich durch eine besonders tapfere That im Krieg
ausgezeichnet haben, während Offiziere Ehrenkreuze und Orden
erhalten. Beinahe sämtliche Staaten haben solche Medaillen,
die, in Gold oder Silber oder Kupfer verliehen, auf der Brust oder
im Knopfloch am Band eines Militärordens getragen werden und
meist mit einer Pension, resp. Zulage zur Löhnung verbunden
sind.
Tapia, Don Eugenio de, span. Dichter und Schriftsteller,
geb. 1785 zu Avila in Altkastilien, studierte zu Toledo und
Valladolid, ließ sich in Madrid als Advokat nieder und
redigierte während des Unabhängigkeitskampfes mehrere
patriotische Blätter. Unter der konstitutionellen Regierung
(1820) ward er Direktor der Staatsdruckerei und Deputierter der
Cortes, deshalb aber nach der Restauration 1823 proskribiert. 1830
zurückgekehrt, wurde er zum Mitglied der
Gesetzgebungskommission sowie zum Generalstudiendirektor und
Mitglied der Akademie ernannt. Er starb 1860. T.
veröffentlichte: "Poesia líricas, satíricas y
dramáticas" (Madr. 1821, 2 Bde., und im 67. Bande der
"Biblioteca de autores españoles", 1877); die satirischen
Schriften: "Viage de un curioso por Madrid" und "Ensayos
satíricos en prosa y verso" (unter dem Namen Machuca); das
umfangreiche juristische Werk "Elementos de jurisprudencia
mercantil" (1828, 15 Bde.; neue Ausg. 1845, 10 Bde.) und eine durch
Reichtum des Inhalts und echt historischen Stil ausgezeichnete
"Historia de la civilisacion española" (l840, 4 Bde.), sein
Hauptwerk.
Tapiau, Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Königsberg, Kreis Wehlau, am Ausfluß der Deime aus dem
Pregel und an der Linie Seepothen-Eydtkuhnen der Preußischen
Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, eine
Oberförsterei, ein Warendepot der Reichsbank, eine
Zuckerfabrik, Biskuitfabrikation, eine Dampfsäge- und eine
Dampfmahlmühle, Dampfbäckerei und (1885) 3059 meist
evang. Einwohner. Dabei ein altes Schloß des Deutschen Ordens
(jetzt die ostpreußische Landarmen- und
Besserungsanstalt).
Tapioka, s. Kassawa.
Tapir (Tapirus L.), Säugetiergattung aus der Ordnung
der Huftiere, repräsentiert allein die Familie der Tapire
(Tapirina), verhältnismäßig kleine, plump gebaute
Tiere mit verlängertem, schmächtigem Kopf, schlankem
Hals, kurzen, aufrecht stehenden Ohren, kleinen Augen,
rüsselförmig verlängerter Oberlippe, drei
Schneidezähnen, einem Eckzahn und oben sieben, unten sechs
Backenzähnen in jedem Kiefer, mittelhohen, kräftigen
Beinen, vorn vier-, hinten dreizehigen Füßen und
stummelhaftem Schwanz. Der indische T. (Schabrackentapir, Tapirus
indicus Desm.), 2,4 m lang, 1 m hoch, mit 8 cm langem Schwanz und
sehr gleichmäßigem Haarkleid, ist am Kopf, Hals und
Vorderteil des Leibes bis hinter die Schulterblätter und an
den Beinen schwarz, sonst grauweiß, lebt in Hinterindien,
Südchina und auf Sumatra und wurde in Europa erst 1772
bekannt. Über sein Freileben ist nichts bekannt. Der
amerikanische T. (T. americanus L.), bis 2 m lang, 1,7 m hoch,
schwärzlich graubraun, mit kurzer, steifer Nackenmähne,
lebt im südlichen und östlichen Südamerika,
während ihn im Norden und Westen sowie in Mittelamerika andre
Arten ersetzen. Er bewohnt dichte Wälder, durch welche er
regelmäßige Pfade bricht, meist einsam oder in kleinen
Familien, erinnert in seinem Wesen vielfach
518
Tapisseriearbeit - Tarabulus.
an die Schweine, wälzt sich in jeder Pfütze, schwimmt
und taucht vortrefflich und läuft längere Zeit auf dem
Grunde der Gewässer hin. Er ist sehr friedlich und furchtsam,
und nur in seltenen Fällen stürzt er blind wütend
auf den Feind. Er hält sich am Tag meist verborgen und ruht,
geht in der Dämmerung und in der Nacht seiner Nahrung nach,
die aus allerlei Pflanzenstoffen, besonders Blättern, besteht,
und richtet in Plantagen oft große Verwüstungen an. Das
Weibchen wirft ein gestreiftes Junge. Fleisch und Fell werden
benutzt, Klauen und Haaren schreibt man Heilkräfte zu. In der
Gefangenschaft hält er gut aus, hat sich aber noch nicht
fortgepflanzt.
Tapisseriearbeit, die Kunst, aus farbigen wollenen oder
seidenen Fäden, Perlen etc. vermittelst der Nadel auf Kanevas
nach Mustern Teppiche, Schuhbesätze, Schmuck für
Ofenschirme, Bürsten, Kasten, Hosenträger u. dgl. m.
anzufertigen. Besondere Geschäfte sorgen für den Bedarf
von Vorlagen und Material. Die T. wird vornehmlich von Dilettanten
betrieben. Während bisher naturalistische Blumenmuster,
Figuren und ganze Bilder nachgeahmt wurden, hat J. Lessing in den
"Altorientalischen Teppichmustern" (Berl. 1877) stilistisch
mustergültige Vorbilder für die Straminstickerei auf
Kanevas geboten. Vgl. Handarbeiten, weibliche.
Tapolcza (spr. tápolza), 1) Markt im ungar.
Komitat Zala, mit Nonnenkloster, (1881) 2913 Einw., Weinbau,
Schwefelquelle, Badeanstalt und Bezirksgericht. - 2) Badeort im
ungar. Komitat Borsod, 3 km von Miskolcz, mit einer ergiebigen
indifferenten Therme von 25° C., die mehrere Teiche bildet.
Tapotement (franz., spr. -pott'mang), das Klopfen bei der
Massage.
Tapp, süddeutsches Kartenspiel mit 36 Blättern
(As bis Sechs), welche wie im Sechsundsechzig rangieren. Drei
Personen sind nötig; jeder erhält 11 Karten, 3 Karten
bleiben als Talon. Coeur ist stets höchste Farbe; die andern
Farben rangieren gleich. Man spielt Coeurfrage (mit Einnehmen des
Talons und Ekartieren), Solo in schlechter Farbe und Coeursolo. Bei
Solo zählt der Talon für den Spieler, darf aber nicht
angesehen werden. Zum Gewinnen muß der Spieler 61 Points
haben. Die Pointzahl, welche er darüber hat, wird ihm bei
Frage zum vierten Teil, bei schlechtem Solo zur Hälfte und bei
Coeursolo voll ausbezahlt. Ein angesagter Tout kostet doppelt.
Tappert, mantelartiges, bis auf die Füße
reichendes Überkleid mit und ohne Kapuze, welches vom Anfang
des 14. bis zum Anfang des 16. Jahrh. in Frankreich, England,
Deutschland und den Niederlanden getragen wurde.
Tappert, Wilhelm, Komponist und Musikschriftsteller, geb.
19. Febr. 1830 zu Ober-Thomaswaldau bei Bunzlau in Schlesien,
erhielt seine Ausbildung von 1848 bis 1850 am Schullehrerseminar zu
Bunzlau sowie von 1856 bis 1858, nachdem er mehrere Jahre als
Schullehrer gewirkt, in Berlin durch Kullak und Dehn. Später
war er wieder mehrere Jahre in Groß-Glogau als Lehrer
thätig, bis er 1866 in Berlin seinen bleibenden Wohnsitz nahm.
Hier hat er als Kritiker, namentlich als Verteidiger der
neudeutschen Schule, Hervorragendes geleistet, redigierte auch von
1878 bis 1881 die "Allgemeine Deutsche Musikzeitung". Außer
zahlreichen Beiträgen für diese sowie für andre
Blätter veröffentlichte er: "Musik und musikalische
Erziehung" (Berl. 1867), "Musikalische Studien" (das. 1868), "Das
Verbot der Quintenparallelen" (Leipz. 1869), "Wagner-Lexikon.
Wörterbuch der Unhöflichkeit, enthaltend grobe,
höhnende, gehässige und verleumderische Ausdrücke,
welche gegen den Meister Richard Wagner etc. gebraucht worden sind"
sowie einen Band "Gedichte" (Berl. 1878) und gab auch Bearbeitungen
altdeutscher Gedichte mit Klavierbegleitung heraus.
Taprobane, alter Name der Insel Ceylon.
Tapti, Fluß in Britisch-Indien, entspringt in den
Zentralprovinzen und mündet nach einem Laufe von 720 km
unterhalb Surate in den Golf von Cambay.
Tapu, s. Tabu.
Tapu (türk.), Besitztitel für Immobilien und
die mit denselben verbundene Steuer.
Taquary (Tacoary), Fluß in der brasil. Provinz Mato
Grosso, entspringt an der Grenze der Provinz Goyaz, hat viele
Krümmungen, bildet mehrere Wasserfälle und mündet
links in den Paraguay.
Taquary, deutsche Kolonie in der brasil. Provinz Rio
Grande do Sul, am schiffbaren Fluß gleiches Namens, 80 km von
Porto Alegre, hat Ausfuhr von Holz und landwirtschaftlichen
Produkten.
Tara (ital., ursprünglich arab., Abzug), das Gewicht
der Umhüllung (Kiste, Faß etc.) verpackter Waren. Der
Unterschied zwischen Gesamtgewicht und T. ist das reine oder
Nettogewicht der Ware. Reine oder Nettotara ist die durch besondere
Wägung eines jeden Stücks ermittelte und in Abzug
gebrachte T.; usanzmäßige, usuelle T. (Uso- oder
Usanztara) ist die durch Herkommen bestimmte T., insbesondere bei
den über See bezogenen Kolonialwaren, für welche das
Bruttogewicht berechnet und als Gewichtsvergütung für die
T. ein durch bestimmtes Prozent (daher auch Prozenttara) als Abzug
an der Kaufsumme verstattet wird. Hierher gehört auch die
gesetzliche T. des Zollwesens, welches, um das Tarieren und die oft
unthunliche Abnahme der Umhüllung zu ersparen, feststehende,
nach Art der Gegenstände und der Verpackungsweise bestimmte
Tarasätze (Zolltara) vom Bruttogewicht der zollpflichtigen
Ware in Abzug bringen läßt. Supertara oder Sopratara ist
die an manchen Orten neben der gewöhnlichen T. vorkommende
besondere Vergütung auf das Gewicht. Reduzierte T., die T.,
welche aus der am Orte der Verpackung festgesetzten Originaltara
nach einem usanzmäßigen Verhältnis in das Gewicht
des Bestimmungsortes umgerechnet wurde. Tarieren heißt das
Abwägen der Warenumhüllung zum Behuf der
Taraermittelung.
Tara, Hügel inmitten der irischen Grafschaft Meath,
10 km südsüdöstlich von Navan. Auf ihm stand der
Palast (Teaghmor) der alten Könige von Irland, und hier
versammelte sich 554 das letzte Parlament unter König Diarmid.
O'Connell hielt hier 1843 eine große Volksversammlung ab.
Tara, Kreisstadt im asiatisch-russ. Gouvernement Tobolsk,
an der Mündung der Tara in den Irtisch, mit (1885) 8654 Einw.,
welche Handel mit Talg, Hauten, Pelzwerk, Getreide und Butter
treiben.
Tarabulus (Tripolis), Stadt im asiatisch-türk.
Wilajet Schâm (Syrien), am Libanon, unweit des Mittelmeers,
hat ein altes Kastell, gegen 20 Moscheen, 18 Kirchen und 7
Klöster, starke Getreideausfuhr, Seiden- und
Baumwollmanufakturen, Schwammfischerei, Handel mit Seide, Seife,
Tabak, Orangen etc., welche die fruchtbare Umgebung liefert, und
17,000 Einw. Schiffsverkehr 1886: 310 Dampfer von 328,686 Ton. und
929 Segelschiffe von 275,747 T. Die Stadt ist Sitz eines deutschen
Konsuls. - T. ist das alte Tripolis, eine phönikische
Bundesstadt. Von den Kreuzfahrern wurde es 1109 erst nach
fünfjähriger Belagerung erobert und war dann 180 Jahre
lang
519
Taracanae pulvis - Taraschtscha.
Sitz einer fränkischen Grafschaft, bis es 1289 vom Sultan
Kilawun erstürmt ward.
Taracanae pulvis, s. v. w. Antihydropin (s. d.).
Tarafa, berühmter arab. Dichter, kurz vor Mohammed,
Neffe des Amrilkais (s. d.), im jugendlichen Alter umgekommen
(worüber eine hübsche Sage in Rückerts
"Morgenländischen Sagen und Geschichten", Stuttg. 1837). Seine
"Moallaka" ist einzeln herausgegeben von Reiske (Leid. 1742) und
Vullers (Bonn 1829), seine sämtlichen Gedichte in Ahlwardts
Ausgabe der sechs alten Dichter (Lond. 1870).
Tarai, s. Himalaja, S. 541.
Tarancon, Bezirksstadt in der span. Provinz Cuenca, am
Rianzares und der Eisenbahn Aranjuez-Cuenca, mit prächtigem
Sck)loß des Herzogs von Rianzares, lebhaftem Handel und
(1878) 4588 Einw.
Tarandus, Renntier.
Taranis, der Donnergott der alten Gallier; Menschenopfer
wurden ihm dargebracht, und Eichen waren sein Idol, weshalb noch
das spätere Mittelalter in Gallien Eichenklötze
verehrte.
Tarantás (russ.), bedeckter Wagen auf langen
Tragbäumen, das gewöhnliche Gefährt bei Relsen auf
russischen Landstraßen.
Tarantel (Tarantula Walck.), Spinnengattung aus der
Ordnung der Webspinnen und der Familie der Zweilungigen
(Dipneumones), Wolfsspinnen, deren vordere Kopffläche steil
abfällt und verhältnismäßig hoch oben auf
einer Querschwiele die vier vordersten, unter sich fast gleichen,
kleinen Augen trägt; je zwei große Augen stehen in den
beiden hintern Reihen, eine mehrzähnige, stark entwickelte
Klaue bewehrt die weiblichen Taster, und von den vier langen
Beinpaaren ist das dritte das kürzeste. Sie spinnen keine
Fangnetze, sondern erjagen ihre Beute im Lauf, jagen aber meist nur
nachts. Die schwarzbäuchige T. (T. melanogastra Walck.),
über 2 cm lang, oberseits gelbbraun, dunkel gezeichnet,
unterseits schwarz, an den Beinen unregelmäßig schwarz
und weiß gefleckt, lebt in Südfrankreich, in der
Türkei und in den pontischen Steppen in steinigen, unbebauten
Gegenden. Die apulischeT. (T. Apuliae Walck., s. Tafel
"Spinnentiere"), 3,5 cm lang, rehfarben, auf dem Hinterleib mit
schwarzen, rötlichweiß eingefaßten Querstrichen,
am Bauch mit schwarzer Mittelbinde, auf dem Vorderleib schwarz,
rötlich gezeichnet, lebt in Spanien und Süditalien, baut
einen etwa 30 cm langen Gang in die Erde, tapeziert diesen mit
Gespinst und überwintert darin, nachdem sie ihn mit
versponnenen Blättern etc. verschlossen hat. Im Sommer jagt
sie auf Heuschrecken und andre Insekten. Den weißen Eiersack,
welcher 600-700 Eier enthält, schleppt sie mit sich herum; die
im Hochsommer ausgeschlüpften Jungen bleiben in der Nähe
der Mutter, bis sie selbständiger geworden sind. Der Biß
der T. hat besonders im Süden und in der heißesten
Jahreszeit üble Folgen, er erzeugt Schmerz, Entzündung,
Ermattung, Unbehagen, Zuckungen, große Reizbarkeit,
Melancholie, Tobsucht. Gewisse Farben und musikalische Dissonanzen
sollen den Zustand verschlimmern, der in der kalten Jahreszeit sich
bessert, aber zuweilen regelmäßig wiederkehrt. Man heilt
die Kranken durch Querschnitte über die Wunde und Einreiben
mit Ammoniak, auch durch Behandeln der Wunde mit Öl oder
Branntwein; in Italien und Spanien aber scheinen mit dem Zustand
eigentümliche Idiosynkrasien verbunden zu sein, und das Volk
heilt sich durch einen wilden Tanz ( "Tarantella"), welcher nach
bestimmten Melodien getanzt wird und heftigen Schweiß
hervorruft; dieser, noch mehr der feste Glaube bringt den
Gebissenen (Tarantati) Genesung. Wahrscheinlich steht dieser
Volksglaube. mit der mittelalterlichen Tanzseuche (Tarantismus),
welche in Apulien und andern Teilen Italiens herrschte, in
Zusammenhang. Vgl. Bergsöe, Über die italienische T. und
den Tarantismus (Kopenh. 1865, dänisch). Tarantella, ein
neapolitanischer, aber wahrscheinlich ursprünglich
tarentinischerTanz, wenn man nicht annehmen will, daß er
seinen Namen von der Wolfsspinne, der Tarantel (s. d.), erhielt.
Die von ältern Schriftstellern mitgeteilten Proben von
Heiltänzen für den Tarantelbiß haben wenig
Ähnlichkeit mit der modernen T. Letztere hat eine
äußerst geschwinde Bewegung (Presto) und steht im 3/8-
oder 6/8-Takt. Wie alle andern Tänze ist auch die T. von der
Kunstmusik aufgegriffen und eine Lieblingsform brillanter
Solostücke (für Klavier, Violine, Cello etc.)
geworden.
Taranto, Stadt, s. Tarent.
Tarantschen, Name für die mit iranischem Blut
vermischten Turko-Tataren im Kuldschagebiet, welche sich von
chinesischen Einflüssen freier gehalten haben als ihre
Nachbarn und Verwandten, die Dunganen. Sie sind Mohammedaner, ohne
aber die Vorschriften des Islam streng einzuhalten. Ihre Vorfahren
wurden von den Chinesen im 18. Jahrh. nach der Eroberung der
Dsungarei aus Ostturkistan in das Ilithal übergesiedelt, teils
wegen ihrer Teilnahme an dem Aufstand von 1756, teils zur
Wiederbevölkerung des verödeten Landes überhaupt.
Während des Dunganenaufstandes bildeten die T. ein eignes
Reich, das infolge von Unruhen von den Russen in Verwaltung
genommen, durch den Vertrag vom 14. Febr. 1881 aber wieder an China
zurückgegeben wurde. Darauf siedelten an 80,000 T. auf
russisches Gebiet über. Sie sind sämtlich Ackerbauer.
Tarapacá, Provinz des südamerikan. Staats
Chile, liegt am Stillen Ozean zwischen Rio Camarones und Rio Loa,
erstreckt sich bis zum Gipfel der Kordilleren, die sie von Bolivia
trennen, und hat ein Areal von 50,006 qkm (908 QM.). Die
Küstenkordillere steigt bis 1770 m an; hinter derselben
breitet sich die wüste Pampa de Tamarugal (1000 m ü. M.)
aus, mit reichen Lagern von Salpeter und Borax (Ausfuhr 1885:
9,478,000 Ztr.). Das Innere bietet Weiden für Schafe, Lamas,
Alpakos und Vicuñas. Ergiebige Silberminen liegen in der
Nähe der Küste, und Guano findet sich in Mengen
nördlich vom Rio Loa bis Patillos. Ackerbau ist nur an wenigen
durch Bewässerung begünstigten Stellen möglich. T.
hat etwa (1885) 45,086 Einw., der Mehrzahl nach Chilenen. Die
Provinz wurde 1883 von Peru an Chile abgetreten. Hauptstadt ist
Iquique. Die ehemalige Hauptstadt T., in 1158 m Meereshöhe im
Innern gelegen, hatte früher ergiebige Silbergruben, ist aber
jetzt nur ein Dorf mit (1876) 1038 Einw.
Tarapoto, Stadt im südamerikan. Staat Peru
(Departement Loreto), 374 m ü. M., an einem Nebenfluß
des Rio Mayo, hat Baumwollweberei und (1876) 4740 Einw. Tarar
(Aspirator), s. Mühlen, S. 848.
Tarare (spr. rár), Stadt im franz. Departement
Rhône, Arrondissement Villefranche, an der Turdine und der
Eisenbahn Lyon-Roanne, mit Handelskammer, Marmorbrüchen,
lebhafter Industrie in Musselin, Tarlatan, Samt, Plüsch,
Stickereien, Druckwaren, Handel und (1886) 11,651 Einw. Westlich
davon der erzreiche Mont T. (719 m).
Taraschtscha, Kreisstadt im russ. Gouvernement Kiew, hat
3 Kirchen und (1885) 15,801 Einw., die sich großenteils mit
Ackerbau beschäftigen.
520
Tarascon - Tardieu.
Tarascon (spr. -kóng), 1) (T. sur Ariége)
Stadt im franz. Departement Ariége, Arrondissement Foix, am
Ariége und an der Eisenbahn Toulouse-T., mit
Schloßruinen, Eisengruben, Wollspinnerei, Fabrikation von
Eisenwaren und (1881) 1404 Einw. - 2) (T. sur Rhône) Stadt im
franz. Departement Rhônemündungen, Arrondissement Arles,
am Rhône, über welchen eine Hängebrücke nach
dem gegenüberliegenden Beaucaire führt, hat alte
Ringmauern, ein auf einem Felsen unmittelbar am Rhône sich
erhebendes, trefflich erhaltenes Schloß (ein festungsartiger
gotischer Bau, einst König Renés Residenz), eine auf
den Resten eines römischen Tempels errichtete gotische Kirche
(Ste.-Marthe), ein Kommunalcollège, Handelsgericht, wichtige
Fabrikation von Wollen-, Seiden-, Baumwollen- und Leinenstoffen
etc., Bereitung von Fleischwürsten ("saucissons d'Arles"),
Schiffbau und (1886) 5881 Einw. T., an der eigentlichen Spitze des
Rhônedeltas gelegen, war immer von großer Bedeutung
für den Verkehr, wie sich auch heute dort die Linien nach
Nîmes, Remoulins und St.-Remy von der Eisenbahn
Paris-Marseiile abzweigen.
Tarasp, die einzige kathol. Gemeinde des Graubündner
Thals Engadin, 1401 m ü. M., mit (1880) 346 Einw.,
berühmt durch ihre Heilquellen. Im Revier Schuls-T.-Fettan
folgen sich in bunter Reihe Säuerlinge, Bitter-, Salz-,
Schwefel- und Stahlwässer. Dem frühern Mangel an
Einrichtungen und Kommunikationen ist abgeholfen; ein
großartiges Etablissement ist zu Nairs. Oberhalb Vulpera
zeigt man die "Todeslöcher", kleine Trichteröffnungen im
Boden, aus deren Spalten Kohlensäure aufsteigt. Die
Löcher haben etwa 1 m Durchmesser und 2-2½ dcm Tiefe,
und die Kohlensäure liegt darin etwa l0 cm hoch. Vgl. Arquint,
Der Kurort T. und seine Umgebung (Chur 1877), und die Schriften von
Killias (9. Aufl., das. 1886), Pernisch (3. Aufl., das.1887).
Tarawera, Vulkan auf der Nordinsel von Neuseeland, im
Seendistrikt, welcher 1886 durch eine Eruption die berühmten
Sinterterrassen des Rotomahanasees vollständig
zerstörte.
Taraxacum Haller. Gattung aus der Familie der Kompositen,
sehr kurzstengelige Kräuter mit grundständiger Rosette
ungeteilter, gezahnter, buchtiger oder schrotsägeförmiger
Blätter, blattlosen, einköfsigen Blütenschäften
und länglichen Achänen mit einfachen, ungleich langen
Pappushaaren. Auf der ganzen nördlichen Erdhälfte
verbreitet. T. vulgare Schrk. (Leontodon T. L., gemeiner
Löwenzahn, Butterblume, Pfaffenröhrlein), sehr gemein an
Wegen, auf Wiesen etc., ausdauernd, stark milchend, mit walzig
spindelförmiger Wurzel, kahlen, lanzettlichen, buchtig
fiederspaltigen Blättern und hohlem, kahlem Blütenschaft
und gelben Blüten, wächst gemein auf der nördlichen
Erdhälfte, die Wurzel mit dem Kraut ist offizinell und wird
gegen Stockungen im Unterleib als mild lösendes Mittel
angewandt. Das Kraut gibt gutes Futter für Ziegen und
Rindvieh; die jungen Blätter benutzt man auch als Salat.
Tarazona, Bezirksstadt in der span. Provinz Saragossa, am
Queiles, in einem rebenbedeckten Hügelgelände, hat ein
Priesterseminar und (1878) 8270 Einw. Die Stadt ist
Bischofsitz.
Tarbagatai, Gebirge im russisch-asiat. Gebiet
Semipalatinsk, an der Grenze gegen die chinesische Mongolei und das
Gebiet Semiretschinsk, erstreckt sich nach O. bis zum See Ulungur
in der Dsungarei und bildet die Wasserscheide zwischen dem
dsungarischen Steppengebiet und dem Saissanbecken. Die mittlere
Kammhöhe des Gebirges ist 2300 m, doch gibt es mehrere 3000 m
hohe Piks. Ewigen Schnee trägt aber erst der östlich
abgezweigte Musstau. S. Karte "Zentralasien".
Tarbert, zwei Fjorde (Lochs) in Schottland, die sich an
ihrem obern Ende bis auf 1½ km nähern und die Halbinsel
von Kintyre (s. d.) fast vom Hauptland abtrennen. Ein Kanal
durchschneidet die Landenge. Das gleichnamige Dorf am
östlichen Loch hat (1881) 1629 Einw.
Tarbert, kleine Hafenstadt in der irischen Grafschaft
Kerry, am Ästuar des Shannon, mit (1881) 712 Einw. Dabei die
befestigte Insel T. mit Leuchtturm.
Tarbes (spr. tarb), Hauptstadt des franz. Departements
Oberpyrenäen und der ehemaligen Grafschaft Bigorre, in
reichbebauter Ebene, am Adour und an der Eisenbahn Bayonne-Toulouse
gelegen, von welcher hier die Linien nach Bagnères, Auch und
Morceux abzweigen, hat eine Kathedrale mit gotischer Kuppel, eine
Kirche St.-Jean aus dem 14. Jahrh., eine stattliche
Kavalleriekaserne (vor derselben steht das Denkmal des Chirurgen
Larrey), einen schönen öffentlichen Garten mit Museum,
ein treffliche Reitpferde lieferndes Gestüt, einen Hippodrom
(jährlich im August große Pferderennen) und (1886)
21,090 (Gemeinde 25,146) Einw., welche Eisengießerei,
Maschinenbau, Fabrikation von groben Wollenstoffen u. Filz und
Marmorschneidemühlen sowie Handel mit Vieh und
landwirtschaftlichen Produkten betreiben. Der Staat besitzt in T.
eine Waffenfabrik und Kanonengießerei. Von Bildungsanstalten
bestehen daselbst ein Lyceum, eine Lehrerbildungsanstalt, ein
geistliches Seminar und eine Bibliothek (16,000 Bände); T. ist
Sitz eines Bischofs, eines Gerichts- und Assisenhofs wie eines
Handelsgerichts. - Die Stadt hieß unter römischer
Herrschaft Tarba und gehörte zu Aquitania tertia, sodann zu
Novempopulania. Mehrmals von den Goten, Arabern und Normannen
zerstört, blühte sie als Hauptstadt der Grafschaft
Bigorre wieder auf, war bis 1370 in der Gewalt der Engländer
und litt später sehr durch die Hugenottenkriege.
Tardando (ital.) , s. v. w. Ritardando (s. d.).
Tardieren (franz.), zögern, zaudern,
säumen.
Tardieu (spr. -djöh), 1) franz.
Kupferstecherfamilie. Nicolas Henri T., geb. 1674 zu Paris,
Schüler Audrans, stach zahlreiche Blätter nach Rigaud,
Lebrun, Domenichino u. a.; starb 1749. Sein Sohn Jacques Nicolas
T., genannt Cochin, geb. 1718, gest. 1795 als Hofkupferstecher des
Kurfürsten von Köln, hat besonders Porträte
gestochen. Von seinen Neffen lieferte Pierre Alexandre T., geb.
1756 zu Paris, Schüler von I. I. Wille, gest. 1844,
schätzbare Porträte und Blätter nach Raffael,
Domenichino, van Dyck, David u. a., während Jean Baptiste
Pierre T., geb. 1746 zu Paris, gest. 1816, und Antoine
François T., geb. 1757 zu Paris, gest. 1822,
Landkartenstecher waren. Des letztern Sohn Pierre T., geb. 1784 zu
Paris, stach Karten zu Werken v. Humboldts, v. Buchs,
Brönsteds, Ségurs u. a. Ambroise T., geb. 1790 zu
Paris, gest. 1837, stach Landkarten, Porträte und
Architekturstücke.
2) Auguste Ambroise, Mediziner, geb. 10. März 1818 zu
Paris, studierte daselbst, wurde 1850 Chefarzt am Spital
Lariboisière, 1861 Professor an der Pariser medizinischen
Fakultät, 1864 beratender Arzt des Kaisers, 1867
Präsident des Komitees für öffentliche
Gesundheitspflege. Er übernahm 1870 die Leitung des Hotel-Dieu
in Paris und starb 12. Jan. 1879. Seine ersten Arbeiten waren
klinischer Natur, später wandte er sich der gerichtlichen
Medizin zu und gewann für diese eine große Bedeutung,
namentlich
521
Tardigrada - Targum.
durch die Ableitung von Erfahrungssätzen aus den
überaus zahlreichen Fällen, die seiner Begutachtung
unterlagen. Seine Hauptwerke sind: "Étude
médico-légale sur l'attentat aux moeurs" (6. Aufl.
1872; deutsch von Theile, Weim. 1860); "Étude
médico-légale et clinique sur l'empoisonnement" (2.
Aufl. 1874; deutsch von Theile u. Ludwig, Erlang. 1868).
Außerdem schrieb er: "Dictionnaire d'hygiène publique
et de salubrité" (2. Aufl. 1862, 4 Bde.); "Étude
médico-légale sur la pendaison, la strangulation et
la suffocation" (2. Aufl. 1879); "Étude
médico-légale sur la folie" (2. Aufl. 1879), "sur
l'avortement" (4. Aufl. 1881) und "sur l'infanticide" (2. Aufl.
1879) u. a.
Tardigrada, s. Spinnentiere, S. 154.
Tarént (Taranto), befestigte Seestadt und
Kreishauptort in der ital. Provinz Lecce, auf einer Insel zwischen
dem großen Golf von T. und dem lagunenartig ins Land
hineinragenden Mare piccolo gelegen, ist durch eine sechsbogige
Brücke und einen alten byzantinischen Aquädukt mit dem
Festland verbunden und Station der Eisenbahn von Bari nach Reggio
di Calabria. Die Lage von T. ist eine so überaus
günstige, daß diese Stadt, wie es im Altertum der Fall
war, zum Organ bestimmt erscheint, durch welches Italien mit dem
Orient in Beziehungen tritt. Es hat im Mare piccolo einen tiefen,
völlig geschützten Hafen, und auch der äußere
Golf bietet in seiner Verengerung mit den beiden vorgelagerten,
trefflich zur Verteidigung geeigneten Inseln San Pietro und Paolo
einer ganzen Flotte sichern Schutz. Zwei Eisenbahnen, die eine an
der ganzen West-, die andre an der Ostseite der Halbinsel bis zum
Golf von T. verlängert, finden hier ihren natürlichen
Endpunkt. Treffliches Quellwasser sprudelt im Mare piccolo wie im
Mare grande selbst empor. So dürfte sich T., namentlich wenn
das Projekt der Verlegung des Kriegshafens von Neapel und der
Werfte von Castellammare dorthin zur Ausführung gelangen
sollte, neuerlich zu großer Bedeutung erheben. Auch der
Handel hebt sich schon einigermaßen. 1886 sind im Hafen 408
Schiffe mit 144,962 Ton. eingelaufen. Der Warenverkehr zur See
(Einfuhr von Kohle, Holz, Getreide, Ausfuhr von Öl, Wein,
Hülsenfrüchten etc.) beläuft sich allerdings erst
auf 65,000 Ton. Fischerei, auch Austernzucht, Handel, Oliven-,
Feigen- u. Weinbau sind die Haupterwerbszweige der als sehr
indolent geltenden Bewohner, deren man 1881: 25,246 zählte.
Die Stadt dehnt sich jetzt nur auf der kleinen felsigen Halbinsel
zwischen den Meeren aus und hat wenig Reste des Altertums wie des
Mittelalters aufzuweisen. Sie ist Sitz eines Erzbischofs, eines
Unterpräfekten, eines Zivil- und Korrektionstribunals, eines
Hauptzollamtes sowie eines deutschen Konsuls und hat ein Lyceum,
ein Gymnasium etc. - T. ist das Tarentum (Taras) der Alten. Taras
wurde 708 v. Chr. von den spartanischen Partheniern unter dem
Herakliden Phalanthos gegründet und durch seine
geschützte Lage und seinen vorzüglichen Hafen eine der
mächtigsten griechischen Pflanzstädte in Unteritalien.
272 ward dieselbe von den Römern erobert, nachdem Pyrrhos, der
für sie seit 280 gegen Rom Krieg geführt, 275 Italien
verlassen hatte. Im zweiten Punischen Krieg ward sie 211 von
Hannibal erobert, die Römer behaupteten sich indes in der Burg
und bemächtigten sich von da aus 209 der Stadt wieder. Diese
ward geplündert und zum Teil zerstört, und gegen 30,000
Einw. wurden in die Sklaverei verkauft. 123 ward die Stadt mit
römischen Bürgern bevölkert und blühte seitdem
wieder auf. Das dortige Erzbistum soll 378 gegründet worden
sein. Im Mittelalter stand die Stadt erst unter den byzantinischen
Kaisern, ward dann von den Sarazenen erobert und endlich dem
Königreich beider Sizilien und mit diesem 1861 dem
Königreich Italien einverleibt. T. ist die Vaterstadt des
Musikers Giovanni Paësiello. Der französische Marschall
Macdonald (s. d.) wurde von Napoleon I. zum Herzog von T. ernannt.
Vgl. Döhle, Geschichte Tarents bis auf seine Unterwerfung
unter Rom (Straßb. 1877); de Vincentiis, Storia di Taranto
(Neap. 1878 ff., 5 Bde.); Gagliardo, Descrizione topogratica di
Taranto (Tarent 1886).
Tarent, Goif von, ein fast viereckiger, zwischen den
Vorgebirgen Santa Maria di Leuca und Nao in die Apenninenhalbinsel
eindringender Golf, der von den Halbinseln von Apulien und
Kalabrien begrenzt wird, im Altertum der Hauptsitz griechischer
Kultur in Unteritalien. Tarent, Metapont, Herakleia, Sybaris,
Thurii, Proton und andre Griechenstädte blühten an seinen
Ufern, denen jetzt, versumpft und ungesund, wie sie sind, zwei
Eisenbahnen, welche sie wieder mit der Ost- und Westküste der
Halbinsel verbinden, neues Leben zuzuführen bestimmt sind.
Tarentaise (spr. -rangtâhs^), Landschaft im franz.
Departement Savoyen, das Hochthal der Isère mit seinen
Seitenthälern, durch welches die Straße über den
Kleinen St. Bernhard führt, reich an Wäldern und Weiden,
von einem kleinen, lebhaften und sich ausfallend von den Umwohnern
unterscheidenden Menschenschlag bewohnt. Wichtigster Ort
Moutiers.
Tarfabaum, s. Tamarix.
Targovist (Tirgovist, Targu-Vestia), ehemals (von
1383-17l6) Hauptstadt der Walachei, jetzt Hauptort des Kreises
Dimbowitza und heruntergekommen, liegt 262 m hoch am Fuß der
Karpathen, durch Zweigbahn mit der Linie Roman-Verciorova
verbunden, und hat 29 griechisch-orthodoxe Kirchen (darunter die
schöne Metropolitankirche), eine alte kath. Kirche, Ruinen des
Schlosses der Woiwoden, ein Tribunal, ein Arsenal (seit 1865),
Gymnasium und 7125 Einw. (ehedem über 40,000).
Targowicz (Targowice), Stadt im russ. Gouvernement Kiew,
Kreis Uman, an der Siniusca, mit 2000 Einw. Hier 14. Mai 1792
Konföderation des polnischen Adels gegen die Konstitution von
1791.
Targum (chald., Plur. Targumim, "Übersetzung"), Name
der chaldäischen Übersetzungen und teilweise
Umschreibungen des Alten Testaments, die vom Beginn des zweiten
jüdischen Staatslebens an, als sich das Bedürfnis
einstellte, den Synagogenbesuchern, welche der hebräischen
Sprache nicht mehr mächtig waren, die Bibelvorlesungen (s.
Sidra, Haftara) zu übersetzen und, wenn erforderlich, durch
Umschreibung zu erklären, entstanden sind. Die
Übersetzung und Deutung geschah durch besonders angestellte
Übersetzer. Jahrhunderte ward, wie dies mit dem
mündlichen Gesetz (s. Midrasch, Talmud) üblich war, das
T. nicht niedergeschrieben. Die erste schriftliche Fixierung
geschah nach dem 3. Jahrh. n. Chr. und zwar mit dem fast
wortgetreuen T. Onkelos (aramäische Form des griechischen
Eigennamens Akylas), einer Pentateuchübersetzung, welche im
Gegensatz zu T. jeruschalmi (das jerusalemische T. des Jonathan ben
Usiel) T. babli heißt und im ostaramäischen Dialekt
abgefaßt ist. Westaramäische Targumim sind zu Ruth,
Esther, Hoheslied, Prediger, Klagelieder, Psalmen, Sprüche,
Hiob und Chronik vorhanden. Sie sind meistens weitschweifige, mit
Geschichte, Sage und Legende verquickte Textum-
522
Tarieren - Tarn-et-Garonne.
schreibungen. Ein vorzügliches Lexikon zu den Targumim gab
Levy (3. Ausg., Leipz. 1881), das T. Onkelos Berliner (Berl. 1884),
eine "Chrestomathia targumica" Merx (das. 1888) heraus.
Tarieren, s. Tara.
Tarif (arab.), ein Verzeichnis verschiedener Waren oder
Leistungen mit beigesetzten Preisen, namentlich ein amtlich
festgestelltes Verzeichnis, daher Zolltarif (vgl.
Handelsverträge), Münz-, Steuertarif, insbesondere im
Verkehrswesen: Droschken-, Post-, Schiff-, Eisenbahntarif etc.
Tarifieren, in einen T. mit bestimmtem Tarifsatz aufnehmen; daher
tarifierte Münzen, solche, welchen durch den gesetzlichen
Münztarif ein bestimmter Kurs gegeben ist.
Tarifa, alte befestigte Stadt in der span. Provinz Cadiz,
an der Straße von Gibraltar, der südlichste Ort des
europäischen Festlandes, mit Hafen und Leuchtturm (auf der
Insel T.) und (1878) 12,234 Einw.; benannt nach dem
Berberhäuptling Tarifa ibn Malik, welcher zuerst in Spanien
landete.
Tarija (spr. -richha), ein Departement der
südamerikan. Republik Bolivia, zwischen den Departements
Chuquisaca und Potosi und der Argentinischen Republik, 296,500 qkm
(5385 QM.) groß. Den Westen durchzieht die östliche
Kordillere, der Osten erstreckt sich durch die Chaco boreal bis zum
Paraguay. Die wichtigsten Flüsse sind der Pilcomayo und der
Tarija (oberer Rio Vermejo), die beide dem Paraguay zueilen. T.
bietet sowohl fruchtbare Ackerländereien als vorzügliche
Weiden und schöne Waldungen dar. An nutzbaren Mineralien ist
es arm. Die Industrie ist ganz unbedeutend. Die Bevölkerung
schätzte man 1882 auf 53,389 Seelen, ohne etwa 50,000 wilde
Indianer. - Die Hauptstadt T., 1770 m ü. M., in fruchtbarem
Thal, wo viel Tabak gebaut wird, hat ein Franziskanerkloster
(ehemals berühmtes Missionskollegium mit Bibliothek) und etwa
8300 Einw.
Tarik, arab. Feldherr, Sohn Zejjads, ward 711 von dem
Oberfeldherrn der Araber in Afrika, Musa, mit 12,000 Mann nach
Spanien geschickt, landete bei Gibraltar (Gebel al T., "Felsen des
T."), besiegte in der siebentägigen Schlacht bei Ieres de la
Frontera 19.-25. Juli 711 die Westgoten unter Roderich, eroberte,
indem er den Sieg rasch verfolgte, den größten Teil der
Halbinsel, wurde aber von dem auf ihn neidischen Musa, obwohl er
ihm seine ungeheure Beute demütig darbrachte, seiner
Würde entsetzt und, mit Ketten belastet, in den Kerker
geworfen, rächte sich zwar nach seiner Befreiung, indem er
Musas Sturz herbeiführte, starb aber unbelohnt und in
Vergessenheit.
Tarlatan (franz. tarlatane), eine Sorte glatter
baumwollener Gaze, welche meist einfarbig hergestellt und zu
Ballkleidern und zum Ausputz benutzt wird. Die Stoffe sind sehr
wohlfeil, vertragen aber das Waschen nicht. Grüner T. ist oft
mit Schweinfurter Grün gefärbt, welches sich staubartig
ablöst und der Trägerin des Kleides durch Einatmen der
arsenikhaltigen Farbe gefährlich werden kann.
Tarma, Stadt im Departement Junin der südamerikan.
Republik Peru, im tiefen, aber fruchtbaren Chanchamayothal, 3053 m
ü. M., hat eine höhere Schule, Fabrikation von Ponchos
etc. aus Vicuñawolle und (1876) 3834 Einw.
Tarn, Fluß im südlichen Frankreich, entspringt
am Fuß des Pic de Malpertus im Lozèregebirge,
durchfließt in vorherrschend westlicher Richtung die
Departements Lozère, Aveyron, T., Obergaronne und
Tarn-et-Garonne und mündet 6 km unterhalb Moissac nach einem
Laufe von 375 km (wovon 148 km schiffbar) rechts in die Garonne.
Nebenflüsse sind rechts: der Aveyron, links: Dourbie und
Agout. Der T. bildet oberhalb Albi den prächtigen, 19 m hohen
Wasserfall Saut de Sabo.
Tarn, franz. Departement, aus den ehemaligen
Diözesen von Albi, Castres und Lavaur des Languedoc gebildet,
grenzt im N. und NO. an das Departement Aveyron, im SO. an Herault,
im S. an Aude, im W. an Obergaronne und im NW. an Tarn-et-Garonne
und hat einen Flächenraum von 5743 qkm (104,7 QM.). Das Land
ist die nach SW. geneigte plateauartige Abdachung des zentralen
Hochfrankreich, im O. gegen 600, im W. wenig über 100 m hoch.
Es lehnt sich im SO. an die rauhen Berge von Lacaune (1266 m), im
S. an die Montagne Noire an. Während es in den höhern
Gebenden nur für Viehzucht und Industrie geeignet ist,
überwiegt nach W. hin in den sich immer breiter öffnenden
fruchtbaren Flußthälern mit dem mildern, fast
mediterranen Klima der Ackerbau, der sich auch auf Wein- und
Seidenkultur erstreckt. Der Hauptfluß ist der Tarn, welcher
fast alle Gewässer des Departements (Rance, Agout, Aveyron u.
a.) aufnimmt. Die Bevölkerung belief sich 1886 auf 358,757
Einw. (darunter ca. 17,000 Reformierte). Von der Oberfläche
kommen (1882) 309,805 Hektar auf Äcker, 52,755 auf Wiesen,
59,510 auf Weinberge, 77,677 auf Wälder, 37,894 Hektar auf
Heiden und Weiden. Hauptprodukte sind: Getreide (3 Mill. hl),
insbesondere Weizen, Roggen und Mais; ferner
Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Hanf und Flachs, Wein (bei
Gaillac und Albi, in guten Jahren bis 1 Mill. hl), Obst, Kastanien,
Rindvieh (117,874 Stück), Schafe (410,177). Schweine
(127,788), viel Geflügel (besonders Hühner und Tauben),
Kaninchen. Der Bergbau liefert Steinkohlen (Gruben bei Carmaux mit
einem Erträgnis von 330,000 Ton.); auch hat das Departement
mehrere Mineralquellen, darunter die von Trébas. Die
Industrie hat namentlich in der Schafwollwarenfabrikation
große Bedeutung; dieselbe verfügt über 55,000
Spindeln, 5000 Hand- und 140 mechanische Webstühle und hat
ihre Hauptsitze zu Castres und Mazamet. Andre Industriezweige sind:
Seidenspinnerei, Gerberei, Fabrikation von Stahl, Sensen, Glas,
Fayence u. a. Der ziemlich lebhafte Handel vertreibt die Natur- und
Industrieprodukte des Landes. Das Departement wird von der
Eisenbahnlinie Figeac-Toulouse und der von ersterer abzweigenden
Linie über Albi nach Castres und Castelnaudary mit
Seitenlinien nach Carmaux und Mazamet durchzogen. Es zerfällt
in die vier Arrondissements: Albi, Castres, Gaillac und Lavaur;
Hauptstadt ist Albi. Vgl. Bastié, Description du
département du T. (Graulhet 1876-77, 2 Bde.).
Tarn-et-Garonne, franz. Departement, aus Teilen der
Guienne (Quercy, Rouergue, Agenais), der Gascogne (Lomagne,
Armagnac) u. des Languedoc (Diözese Montauban)
zusammengesetzt, grenzt im N. an das Departement Lot, im O. an
Aveyron, im SO. an Tarn, im S. an Obergaronne, im SW. und W. an
Gers und Lot-et-Garonne und hat einen Flächenraum von 3720 qkm
(67,8 QM.). Es ist ein Hügelland von 200-300 m Höhe, in
welches die drei großen Flüsse Garonne (mit der Gimone),
Tarn und Aveyron, die sich hier vereinigen, und deren Spiegel bei
ihrem Eintritt in das Departement kaum höher, zum Teil sogar
niedriger als 100 m liegt, breite, überaus fruchtbare
Thäler eingeschnitten haben. Der Schifffahrt dient außer
Garonne und Tarn der Seitenkanal der Garonne. Das Klima ist im
allgemein
523
Tarnkappe - Tarock.
nen mild. Die Bevölkerung belief sich 1886 auf 214,046
Seelen (1861: 232,551), darunter ca. 10,000 Reformierte. Von der
Oberfläche kommen 223,536 Hektar auf Äcker, 22,366 auf
Wiesen, 48,720 auf Weinberge, 48,050 auf Wälder, 10,138 Hektar
auf Heiden und Weiden. Die wichtigsten Produkte sind: Getreide
(durchschnittlich 2 Mill. hl), vor allem Weizen, dann Hafer und
Mais, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Hanf, Flachs,
Futterrüben, Wein (bis zu 1 Mill. hl), Obst, Holz, Seide,
treffliche Pferde, Rindvieh (89,039 Stück), viel
Geflügel, Marmor und Bausteine. Neben dem Ackerbau, als der
Haupterwerbsquelle der Bewohner, ist die Industrie von keinem
großen Belang und nur durch einige Seidenfilanden,
Seidenabfallspinnereien, Papier-, Kerzen- und Seifenfabriken
vertreten. Von größerer Bedeutung ist der Handel mit den
Landesprodukten, für welche Montauban der Hauptstapelplatz
ist. Die Eisenbahn von Bordeaux nach Toulouse (mit der Abzweigung
von Montauban nach Lexos) durchschneidet das Departement. Es
zerfällt in drei Arrondissements: Castelsarrasin, Moissac und
Montauban; Hauptstadt ist Montauban. Vgl. Moulenq, Documents
historiques surleTarn-et-Garonne (Montauban 1879-85, 3 Bde.).
Tarnkappe (v. altd. tarnan, verbergen, auch Tarnhaut,
Nebelkappe), in der deutschen Mythologie ein Mantel, welcher
unsichtbar machte und zugleich die Kraft von zwölf
Männern verlieh. Vgl. Elfen und Zwerge.
Tarnobrzeg, Studt in Galizien, an der Weichsel und der
Eisenbahn Dembica-Rozwadow, Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und
eines Bezirksgerichts, mit (1880) 3460 Einw.
Tarnogrod, Stadt im russisch-poln. Gouvernement Lublin, Kreis
Bjelgorai, an der galizischen Grenze, hat starke Leinweberei und
(1885) 5436 Einw. (viele Juden); geschichtlich merkwürdig
durch den hier 26. Nov. 1715 geschlossenen Bund des polnischen
Adels gegen die sächsische Armee.
Tarnopol, Stadt in Ostgalizien, am Sereth und an der
Eisenbahn Lemberg-Podwoloczyska (Linie nach Odessa), Sitz einer
Bezirkshauptmannschaft, eines Kreisgerichts und einer
Finanzbezirksdirektion, hat ein Obergymnasium, Unterrealschule,
Lehrerbildungsanstalt, Jesuitenkollegium mit Privatgymnasium,
Stärkefabrikation, Dampfmühle, Ziegelbrennerei, lebhaften
Handel und (1880) 25,819 Einw. (darunter 13,500 Juden).
Tarnow, Stadt in Galizien, nahe der Mündung oer
Biala in den Dunajec, Station der Karl Ludwigs-Bahn
(Krakau-Lemberg), in welche hier die Staatsbahnlinie Stroze-T.
einmündet, ist Sitz einer Bezirkshauptmannschaft, eines
römisch-katholischen Bischofs und Domkapitels, eines
Kreisgerichts, einer Finanzbezirksdirektion und eines
Hauptzollamtes, hat eine alte Domkirche, ein schönes Rathaus,
eine theologische Lehranstalt, ein bischöfliches Seminar, ein
Obergymnasium, eine Lehrerbildungsanstalt, mehrere Klöster,
eine Waisenanstalt, Sparkasse, Fabrikation von landwirtschaftlichen
Maschinen, Zichorienfabrik, Glashütte, Dampfmühle,
bedeutenden Handel und (1860) 24,627 Einw. (davon 11,349
Juden).
Tarnow, Fanny, Schriftstellerin, geb. 27. Dez. 1783 zu
Güstrow in Mecklenburg, lebte auf dem väterlichen Gut
Neubuckow, ging 1816 nach dem Tod ihrer Mutter zu einer Freundin
nach Petersburg, wo sie viel mit Klinger verkehrte, verließ
aber des rauhen Klimas wegen Rußland bald wieder und hatte
seit 1820 ihren Wohnsitz in Dresden, seit 1828 in Weißenfels,
zuletzt in Dessau, wo sie 20. Juni 1862 starb. Ihre Romane und
Novellen, deren lange Reihe "Natalie" (Berl. 1811) eröffnete,
und zu denen auch das Buch "Zwei Jahre in Petersburg" (Leipz. 1833)
gehört, waren zu ihrer Zeit bei der Frauenwelt sehr beliebt,
ohne daß sie auf künstlerischen Wert Anspruch machen
könnten. Gesammelt erschienen eine "Auswahl" (Leipz. 1830, 15
Bde.) und "Gesammelte Erzählungen" (das. 1840-42, 4 Bde.).
Vgl. Amely Bölte, Fanny T., ein Lebensbild (Berl. 1865).
Taruowitz, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk
Oppeln, Knotenpunkt der Linien Breslau-T., Kreuzburg-T.,
T.-Schoppinitz und T.-Tarnowitzerhütte der Preußischen
Staatsbahn, 326 m ü. M., hat eine evangelische und eine kath.
Kirche, eine Synagoge, ein Realgymnasium, eine Bergschule, ein
Kreiswaisenhaus, ein Rettungshaus, ein Amtsgericht, eine
Berginspektion, den Vorstand des Oberschlesischen
Knappschaftsvereins, Bergbau auf Eisen, ein großes Eisenwerk,
Fabrikation von Trottoirplatten, Stöcken, Seife, Tüten
und Zigarrenspitzen, Dampfmahl- und Schneidemühlen und (1885)
8618 meist kath. Einwohner. In der Nähe die Friedrichsgrube,
eine Bleierzgrube, deren Erze in der nahen Friedrichshütte
verhüttet werden. T. ward 1526 angelegt und erhielt 1562
Stadtrechte.
Tarnowski, Stanislaus, Graf, poln. Litterarhistoriker,
geb. 7. Nov. 1837 zu Dzikow in Galizien, studierte zu Krakau und
Wien, erlitt 1863-65 anläßlich des Aufstandes eine
zweijährige Haft, begründete dann mit Szujski die
konservative Zeitschrift "Przeglad Polski", war 1867-70
Reichsratsabgeordneter, wandte sich dann aber ganz den
wissenschaftlichen Studien zu und wurde im November 1871 zum
ordentlichen Professor der polnischen Litteratur an der Krakauer
Universität und 1884 zum Mitglied des Herrenhauses ernannt.
Unter seinen zahlreichen literarhistorischen Monographien (in poln.
Sprache), die sich insgemein durch Gründlichkeit, Schärfe
des Urteils und Eleganz der Sprache auszeichnen, sind
hervorzuheben: "Geschichte der vorchristlichen Welt", "Über
den polnischen Roman am Anfang des 19. Jahrhunderts", "Über
den Verfall der polnischen Litteratur im 18. Jahrhundert",
"Über die Lustspiele Fredros". "Shakespeare in Polen" und
insbesondere sein klassisches Hauptwerk: "Die polnischen
politischen Schriftsteller des 16. Jahrhunderts" ("Pisarze
polityczni XVI wieku"; Krak. 1886, 2 Bde.).
Taro, s. Colocasia.
Tarock, kompliziertes Spiel unter drei Personen mit einer
eignen, 78 Blätter starken Karte, die französischen
Ursprungs sein soll. Zu den gewöhnlichen 52 Blättern
kommen noch hinzu: 4 Cavalls (Reiter), 21 Tarocks, Trümpfe
oder Stecher (Karten mit I bis XXI bezeichnet) und ein einzelnes
Blatt, der Skis. Die Kartenfolge läuft in den roten Farben vom
As herab zur Zehn und in den schwarzen umgekehrt von der Zehn herab
zum As. Der Geber gibt in Würfen zu 5 jedem 25 Blätter,
die drei letzten behält er noch für sich, weil er das
Recht hat, 3 Karten in den Skat zu legen. 59 Blätter sind
leere (Latons), 19 aber Zähler. Der König gilt 5, die
Dame 4. der Cavall 3, der Bube 2. Der I (der Pagat), der XXI (der
Mond) und der Skis gelten an sich je 5, können aber beim
Ansagen als Matadore oder als Tarocks unter Umständen noch
besonders zählen. Der Skis (richtiger Sküs, von excuser)
sticht weder, noch wird er gestochen; er erscheint bald als T.,
bald als Laton, bald als Bild, ja auch in allen drei Eigenschaften
zusammen. Als T. benutzt man den Skis, wenn man 9 Tarocks neben ihm
hat (man sagt
524
Tarots - Tarquinius Superbus.
dann 10 Tarocks an), ferner, wenn man T. fordern will oder ein
Mitspieler T. gefordert hat. In letztern Fällen sagt man: "Ich
skisiere (exküsiere) mich!" legt den Skis in seine Stiche und
gibt aus diesen einen Laton oder leeren T. an den ab, welcher den
letzten Stich machte. Als Bild fungiert der Skis beim Ansagen eines
halben (skisierten) Königreichs oder einer halben oder
skisierten Kavallerie (3 Könige, resp. 3 Bilder einer Farbe
und der Skis). 4 Könige gelten als ganzes Königreich, 4
Bilder einer Farbe als ganze oder natürliche Kavallerie. Hat
man zu 15 Latons den Skis, so darf man 16 Latons ansagen. Als Laton
benutzt man auch den Skis, wenn man ein Blatt einer angezogenen
Farbe nicht weggeben will. Da der Skis nicht sticht, kann man nicht
die Vole mit ihm machen, wohl aber sich stichfrei spielen. Man
muß den Skis vor den 5 letzten Blättern ablegen, weil er
sonst dem Gegner zufällt. Hat der Geber Skat gelegt, so folgt
das Ansagen. 10 Tarocks gelten 10, jeder T. über 10 gilt 5,
eine ganze Kavallerie 10 etc. Diese Posten werden jedem Ansagenden
von den Mitspielern sogleich bezahlt. Jede Ansage muß auf
Verlangen aufgezeigt werden. Nach dem Ansagen beginnt das Spiel.
Hierbei wird Farbe bekannt; wer Renonce ist, muß mit einem T.
stechen. Bei den Tarocks sticht die höhere Zahl die niedere.
Soviel man in seinen Stichen über 26 Augen erlangt, hat man
gewonnen, was daran fehlt, muß bezahlt werden. Ein besonderes
Ziel des Spielers ist es, den Pagat zu ultimieren, d. h. den
letzten Stich mit ihm zu machen, bez. das Ultimieren des Pagat zu
verhindern. Für den ultimierten Pagat erhält man von
jedem Mitspieler l0 Points, für den ultimo abgestochenen
muß der Pagatist jedem andern 10 Points geben. Das
Stichfreispielen sagt man an beim 1. oder 13. Stich, die Vole darf
man auch vor den letzten sechs Blättern noch melden. In den
Skat legen darf man alle Latons, alle Bilder mit Ausnahme der
Könige, aber einen T. nur dann, wenn man nur 3 oder weniger u.
nicht den XXI hat. Den Skis legt man nur, wenn man die Vole machen
will. Vgl. Werner, Das moderne Tarockspiel (Wien 1883); Ulmann,
Illustriertes Wiener Tarockbuch (das. 1887).
Tarots (franz., spr. -oh), Tarockkarte (s. Tarock); in
der Typographie s. v. w. Unterdruck, Untergrund auf
Wechselformularen, Wertpapieren etc., ähnlich dem Muster der
Rückseite der Tarockkarte; tarotiert, mit solchem Unterdruck
versehen.
Tarpau, s. Pferde, S.945.
Tarpawlings (spr. tarpáh-), s. Jute, S. 341.
Tarpejischer Fels, südliche Spitze des
Kapitolinischen Hügels in Rom (über der heutigen Kirche
Santa Maria della Consolazione), von wo in den ältern Zeiten
der Republik und dann wieder zur Kaiserzeit Verbrecher und
Vaterlandsverräter hinabgestürzt wurden. Benannt war die
Stätte nach Tarpeja, der Tochter des kapitolinischen Burgvogts
Spurius Tarpejus, durch deren Verrat, wie die Sage berichtet, sich
die Sabiner unter Titus Tatius der wichtigen Burg bemächtigt
hatten, wofür Tarpeja, statt belohnt, von ihnen getötet
wurde. Sie hatte auf dem Felsen auch ihr Grab, wo ihr
alljährlich Totenopfer dargebracht wurden. Vgl. Krahner, Die
Sage von der Tarpeja (Friedland 1858).
Tarporley (spr. tárrporli), altes
Marktstädtchen in Cheshire (England), 16 km
südöstlich von Chester, mit Strumpfwaren- und
Lederhosenfabrikation und (1881) 2669 Einw.
Tarquinii, im Altertum eine durch ihre Kunstübung
berühmte Stadt Etruriens, wahrscheinlich Mutterstadt der
zwölf Bundesstädte, lag auf einem Hügel am
Fluß Marta. Durch die Kriege mit Rom im 4. Jahrh. v. Chr. kam
die Stadt herab und lag schon zur Kaiserzeit in Ruinen. Dieselben
finden sich auf dem Hügel Turchina bei Corneto, namentlich die
griechischen Einfluß verratende Nekropole, deren Aufdeckung
die Museen Europas mit den herrlichsten Vasen und andern
Kunstwerken gefüllt und in Corneto die Gründung eines
etruskischen Museums veranlaßt hat.
Tarquinius Priscus, Lucius, fünfter röm.
König (616-578 v. Chr.), Sohn des Korinthers Demaratos und
einer Tarquinierin, geboren zu Tarquinii, wanderte, da er dort als
Sohn eines Fremdlings keine Ehrenstelle erlangen konnte, auf den
Rat seiner mit der Gabe der Weissagung ausgestatteten Gemahlin
Tanaquil nach Rom aus. Hier machte er sich sowohl beim König
Ancus Marcius als beim Volk sehr beliebt; er wurde daher vom
sterbenden König zum Vormund seiner beiden Söhne ernannt
und konnte sich nach dessen Tod selbst der Herrschaft
bemächtigen. Er vollendete die Unterwerfung Latiums, besiegte
die Sabiner und verwendete die gewonnene Beute zur Ausführung
großer Bauten. Dahin gehören vor allen: der große
Abzugskanal (cloaca maxima), wodurch namentlich das Forum trocken
gelegt wurde, die Anlage des Circus maximus, der Beginn einer
Stadtmauer und des kapitolinischen Tempels. Der dritten
Stammtribus, den Luceres, gewährte er die Aufnahme in den
Senat, indem er aus ihnen als Patres minorum gentium 100 neue
Senatoren den frühern 200 hinzufügte. Da seine Absicht,
drei neue Tribus, wahrscheinlich aus den Plebejern, zu bilden,
scheiterte, begnügte er sich, die Zahl der Ritter, die dadurch
auf 1800 stieg, zu verdoppeln, ohne den drei alten Centurien neue
unter besondern Namen hinzuzufügen. Er wurde von den
Söhnen des Ancus, denen er den Thron entzogen, 578 ermordet,
sein Tod aber durch die Klugheit der Tanaquil so lange verhehlt,
bis es seinem Schwiegersohn Servius Tullius gelungen war, sich die
Nachfolge zu sichern.
Tarquinius Superbus, Lucius, Roms siebenter und letzter
König (534-510 v. Chr.), Sohn des Tarquinius Priscus. Servius
Tullius hatte ihn und seinen Bruder Aruns mit seinen Töchtern,
die beide den Namen Tullia führten, verheiratet, um sie
dadurch zu gewinnen und sie wegen ihrer Verdrängung vom Thron
zu versöhnen. Allein Lucius vereinigte sich mit der
jüngern Tullia, der Gemahlin des Aruns, zu dem
verbrecherischen Plan, Servius Tullius gewaltsam vom Thron zu
stoßen; Aruns und die ältere Tullia wurden durch ihre
beiderseitigen Gatten aus dem Wege geräumt, und nun ließ
sich T. in der Kurie des Senats zum König ausrufen. Als
Servius Tullius herbeieilte, um ihn zur Rede zu stellen,
stieß er den schwachen Greis die Stufen der Kurie hinab und
ließ ihn durch nachgesandte Bewaffnete töten; Tullia
aber, welche sofort ihren Gemahl in der Kurie als König
begrüßte, scheute sich nicht, auf dem Heimweg über
den Leichnam ihres Vaters hinwegzufahren, so daß sie mit
dessen Blut bespritzt zu Hause anlangte. Die Regierung des T.
entsprach der Art und Weise, wie er dieselbe an sich gerissen
hatte. Es gelang ihm zwar, die Latiner völlig zu unterwerfen,
auch wurde die benachbarte Stadt Gabii durch die List und den
Verrat seines Sohns Sextus in seine Gewalt gebracht, und in Rom
selbst setzte er den Bau der unterirdischen Kanäle fort und
vollendete den Bau des kapitolinischen Tempels. Dagegen erbitterte
er das ganze Volk durch Grausamkeit und Willkür und
insbesondere durch die
525
Tarraco - Tarsos.
Härte, mit der er die ärmern Bewohner zu Fronarbeiten
zwang. Als daher, während er selbst mit dem Heer vor dem
belagerten Ardea lag, sein Sohn Sextus die Lucretia (s. d.) entehrt
hatte, rief Junius Brutus das Volk zur Empörung auf; T. eilte
zwar von Ardea nach der Stadt, wurde aber von dieser und nachher
auch vom Lager ausgeschlossen und in Rom die Republik
eingeführt. Vergebens suchte er hierauf mit Hilfe der
Tarquinier, die beim Wald Arsia geschlagen wurden, des Königs
Porsena (s. d.) von Clusium und endlich der Latiner, die am See
Regillus gegen die Römer unterlagen, den Thron
wiederzuerobern. In letzterer Schlacht fielen auch seine Söhne
Titus und Aruns; er selbst starb als Flüchtling 495 in
Cumä. Sextus begab sich nach Gabii, wo er von denen, die
für seinen an Gabii verübten Verrat Rache suchten,
ermordet wurde.
Tarraco, Stadt in dem nach ihr benannten
tarraconensischen Hispanien, im Gau der Cessetaner, eine uralte
Felsenfeste, durch Augustus, der die Verwaltung der Provinz dahin
verlegte, mit einem künstlichen Hafen versehen und mit vielen
Prachtbauten geschmückt, deren Reste das jetzige Tarragona (s.
d.) anfüllen. Die Provinz Hispania Tarraconensis umfaßte
den ganzen nördlichen und östlichen Teil des Landes und
übertraf an Umfang die beiden andern Provinzen
zusammengenommen. Als Hauptvölker sind zu nennen: die
Kontestaner, Edetaner und Cessetaner im O., die Ilergeten,
Vaskonen, Kantabrer, Asturier und Galläken im N., die
Keltiberer und Karpetaner in der Mitte des Landes, die Oretaner und
Bastetaner im S. Hauptstädte waren außer T.: Carthago
Nova, Saguntum, Calagurris, Barcino, Bilbilis, Numantia, Toletum
etc.
Tarragona, span. Provinz, den südlichsten Teil der
Landschaft Katalonien umfassend, grenzt im N. an die Provinz
Lerida, im O. an Barcelona, im S. an das Mittelländische Meer,
im W. an Castellon, Teruel und Saragofsa und hat einen
Flächenraum von 6490 qkm (117,8 QM.). Das Innere des Landes
ist großenteils gebirgig und enthält unter anderm die
Berggruppen des Tosal del Rey (1392 m), Monte Caro (1413 m),
Montsant (1071 m), Puig de Montagut (953 m). Ebenen bilden die
Meeresküste und die Thäler einzelner
Küstenflüsse. Die Provinz enthält den Unterlauf des
Ebro mit dem Mündungsdelta, dann von wichtigern
Küstenflüssen den Francoli und Gaya. Die Bevölkerung
belief sich 1878 auf 330,105 Seelen (51 pro QKilometer) und wurde
1886 auf 345,000 Seelen geschätzt. Produkte sind: Getreide,
sehr viel Öl, Seide, viel Wein (1887 wurden auf 110,060 Hektar
1,6 Mill. hl geerntet), Südfrüchte und andres Obst,
insbesondere Mandeln, Haselnüsse, Johannisbrot, Lakritzen,
dann Bleierz, Braunstein und Salz. Die lebhafte Industrie erzeugt
Baumwoll-, Seiden- und Lederwaren, Steingut, Seife, Papier, Essig,
Weingeist etc. Der Handel findet in mehreren Häfen, dann in
der Küstenbahn Barcelona-Valencia Förderungsmittel. Die
Provinz umfaßt acht Gerichtsbezirke (darunter Reus, Tortosa,
Valls). Die gleichnamige Hauptstadt, an der Mündung des
überbrückten Francoli ins Mittelländische Meer und
an der Küstenbahn, welche hier über Reus nach Lerida
abzweigt, gelegen, zerfällt in die obere,
unregelmäßig gebaute, von starken Festungswerken
umgebene Altstadt und die untere, regelmäßig angelegte,
durch das Fuerte Real verteidigte Neustadt. Im W. liegt das Fort
Olivo, am Hafen das Fort Francoli. Die Stadt hat eine
prächtige, 1120 erbaute gotische Kathedrale, viele andre
Kirchen, ein Instituto, Seminar, eine Normalschule, Akademie der
schönen Künste, ein Altertumsmuseum, ein Theater und
einen guten Hafen. Von Altertümern aus der Römerzeit
finden sich noch die schöne Wasserleitung Puente de las
Ferreras, Ruinen eines Amphitheaters, eines Palastes des Kaisers
Augustus etc., der schöne Triumphbogen Arco de Sura und 6 km
von der Stadt das unter dem Namen des "Turms der Scipionen"
bekannte Denkmal, welches die Asche der Scipionen enthalten soll.
Die Stadt zählt (1886) 23,152 Einw. Die Industrie erstreckt
sich auf Spinnerei und Weberei (insbesondere in Seide, auch in
Jute), Filz-, Spitzenfabrikation u. a. Von großer Bedeutung
sind Handel und Schiffahrt. 1887 sind 1202 Schiffe von 500,723 Ton.
im Hafen eingelaufen. Die Einfuhr hatte einen Wert von 31,2, die
Ausfuhr einen solchen von 32,2 Mill. Pesetas. Hauptartikel sind
beim Import Spiritus (meist aus Deutschland), Getreide (aus
Rußland), Holz, Stockfisch, Kohle, Eisen, Schwefel; beim
Export Wein (705,464 hl), dann Weingeist, Haselnüsse, Mandeln,
Lakritzen, Weinstein. T. ist Sitz des Gouverneurs und eines
Erzbischofs (mit dem Titel "Fürst von T.") sowie eines
deutschen Konsuls. - Die Stadt T. (Tarrakon, röm. Tarraco) war
in der Römerzeit die Hauptstadt des tarraconensischen Spanien.
Während der Völkerwanderung hatte sie unter den
Einfällen der Sueven, Vandalen und Goten viel zu leiden. 714
wurde sie von den Mauren nach dreijähriger Belagerung erobert
und gänzlich verwüstet, über drei Jahrhunderte
später (1038) aber von den Grafen von Barcelona wieder
aufgebaut. Das nach 1038 gegründete Bistum ward 1154 zum
Erzbistum erhoben. 1119 wurde die Stadt von Alfons I. von Aragonien
den Arabern abgenommen. Am 28. Aug. 1811 eroberte sie der
französische General Suchet mit Sturm. Im August 1813 ward sie
von den Engländern belagert, und da Suchet sie nicht
länger behaupten konnte, ließ er die Festungswerke 8.
Aug. 1813 sprengen, wobei die Stadt sehr litt. 1833 ward T.
Hauptstadt der Provinz.
Tarrasa, Bezirksstadt in der span. Provinz Barcelona, an
der Bahnlinie Saragossa-Barcelona, mit Tuch-, Flanell- und
Baumwollfabriken und (1878) 11,193 Einw.
Tarrasbüchsen (tschech. tarras, "Bollwerk, Schirm,
daher auch Schirmbüchsen), in den Hussitenkriegen als
Wallgeschütz und im Feld hinter Schirmen aus Bohlen gebrauchte
Geschütze meist kleinen Kalibers.
Tarrytown (spr.-taun), Dorf im nordamerikan. Staat New
York, am Hudson, mit Taubstummenanstalt, Villen und (1880) 3025
Einw.
Tarsius, s. Koboldmaki.
Tarso, Gebirgsstock in Tibesti (s. d.).
Tarsos, im Altertum Hauptstadt von Kilikien in
Kleinasien, am Kydnos (Tarsus Tschai), vom assyrischen König
Sanherib (705-681) gegründet und seit 607 Sitz eigner,
später unter persischer Hoheit stehender Könige, gelangte
besonders zu Ansehen, als sich unter den Seleukiden viele Griechen
hier niederließen, welche einen schwunghaften Handel trieben.
Die dortige Philosophenschule blühte namentlich unter den
ersten römischen Kaisern. Antonius oder Augustus verlieh der
Stadt das Recht der sogen. freien Städte. Von besonderer
Wichtigkeit war T. in den Partherkriegen der Römer, und selbst
noch unter den Arabern war es eine volkreiche Stadt. Später
sank ihr Wohlstand. T. war auch Geburtsort des Apostels Paulus.
Jetzt Tersus, in der Provinz Adana, mit 8-10,000 Einw. (darunter
viele Sattler, Gerber und
526
Tarsus - Tarudant.
Zeltmacher) und Ausfuhr von Baumwolle, Südfrüchten,
Getreide, Wolle, Sesam etc. Mit Mersina und Adana steht es durch
Eisenbahn in Verbindung.
Tarsus (griech.), die Fußwurzel, d. h. die Knochen
am Anfang des Fußes (s. d.). Bei den Insekten ist T. oder
Fuß der letzte Abschnitt des Beins und besteht selbst wieder
meist aus fünf aneinander beweglichen Gliedern; das letzte von
diesen trägt gewöhnlich zwei Klauen oder Krallen, oft
auch noch sogen. Haftlappen.
Tarsza (spr. tarscha), Eduard, Pseudonym, s. Grabowski
1).
Tartaglia (ital., spr. -tallja, "Stotterer"), Name einer
komischen Maske des neapolitanischen Volkslustspiels.
Tartaglia (spr. -tallja, lat. Tartalen), Niccolò,
Mathematiker, geboren zu Brescia am Anfang des 16. Jahrh., wurde
als Kind von einem Soldaten derart mißhandelt, daß er
zeitlebens stotterte, wovon er den Namen T. (der Stotterer)
empfing. Sein Familienname war bis vor kurzem nicht bekannt; in
seinem 188l von Boncompagni veröffentlichten Testament nennt
er aber einen gewissen Zampiero Fontana als seinen legitimen
leiblichen Bruder. Er studierte Latein, Griechisch und Mathematik,
und von 1530 an war er in Verona, Piacenza, Venedig, Mailand und
zuletzt wieder in Venedig als Lehrer thätig. Er starb 14. Dez.
1557. T. kannte bereits den binomischen Lehrsatz für ganze
positive Exponenten, behandelte Probleme der
Wahrscheinlichkeitsrechnung, nahm zahlreiche Bestimmungen des
spezifischen Gewichts vor und vervollkommte die Ballistik;
hauptsächlich aber ist er berühmt durch seine
Auflösung der kubischen Gleichungen, deren
Veröffentlichung durch Cardanus Anlaß gab zu einem
heftigen litterarischen Streit mit Cardanus und dessen Schüler
Ferrari (vgl. Cardanische Formel).Tartaglias Hauptwerk: "General
trattato de' numeri e misure" (Vened. 1556-60, 3 Bde.),
enthält diese Lösung nicht; der Bericht über
dieselbe ist in seinen "Quesiti ed inventioni diverse" (das. 1554)
enthalten. Der Darstellung Tartaglias, die Hankel ("Zur Geschichte
der Mathematik", Leipz. 1874) reproduziert, hat Gherardi eine andre
entgegengestellt (Grunerts Archiv, 52. Teil). Vgl. Matthiessen,
Grundzüge der antiken und modernen Algebra, S. 367 (Leipz.
1878).
Tartan, der gewürfelte Wollenstoff, den die Schotten
bei ihrer Nationaltracht zu Mänteln und Kilts (s. d.)
verwenden; auch das Kleidungsstück selbst.
Tartane (roman.), bei den Italienern, Spaniern etc. ein
kleines ungedecktes Piratenschiff, später ein Fischerfahrzeug
mit Pfahlmast, großem lateinischen Segel und zwei
Klüvern am Klüverbaum, während die
österreichische T. ein gedecktes, zweimastiges
Küstenfahrzeug mit trapezoidischen Segeln ist. In Spanien
heißt T. auch eine Art zweiräderiger Wagen.
Tartarei, unrichtig für Tatarei (s. d.).
Tartaros, bei Homer tiefer Abgrund unter der Erde, so
weit unter dem Hades, als der Himmel über der Erde ist, durch
eherne Pforten geschlossen; später die ganze Unterwelt oder
derjenige Teil derselben, wo die Verdammten ihre Qualen leiden, im
Gegensatz zu den elysischen Gefilden, dem Aufenthaltsort der
Seligen. Personifiziert ist T. der Sohn des Äther und der
Gäa und von dieser Vater der Giganten. Vgl. Hölle.
Tartarus (lat.), Weinstein, saures weinsaures Kali; T.
ammoniatus, weinsaures Kaliammoniak; T. boraxatus, Boraxweinstein,
s. Borax (S. 210); T. depuratus, Cremor tartari, gereinigter
Weinstein; T. emeticus, stibiatus, Brechweinstein (s. d.); T.
ferratus, martiatus, chalybeatus, Eisenweinstein, s.
Eisenpräparate; T. natronatus, weinsaures Kalinatron; T.
solubilis, tartarisatus, neutrales weinsaures Kali; T. vitriolatus,
schwefelsaures Kali.
Tartas (spr. -tas), Stadt im franz. Departement Landes,
Arrondissement St.-Sever, an der Midouze mit altem Stadthaus und
(1881) 2110 Einw.; steht im Rufe von Krähwinkel.
Tartini, Giuseppe, Violinspieler und Komponist, geb. 12.
April 1692 zu Pirano in Istrien, erhielt seinen ersten
Musikunterricht im Kollegium dei padri delle scuole zu Capo
d'Istria, begab sich 1710 nach Padua, um Jurisprudenz zu studieren,
mußte eines Liebeshandels wegen von da fliehen und fand im
Minoritenkloster zu Assisi Aufnahme, wo er sich mit Eifer dem
Violinspiel und zugleich dem theoretischen Studium der Tonkunst
widmete. Später lebte er mehrere Jahre in Ancona und
vervollkommte sich, angeregt durch den berühmtesten Geiger
jener Zeit, Veracini, den er auf der Durchreise in Venedig
gehört, mehr und mehr auf der Violine; 1721 wurde er bei der
Kirche Sant'Antonio zu Padua als Solospieler angestellt und zwei
Jahre später nach Prag berufen, um bei den Festlichkeiten
gelegentlich der Krönung des Kaisers Karl VI. mitzuwirken.
Nachdem er hierauf noch drei Jahre im Dienste des kunstsinnigen
Grafen Kinsky zugebracht hatte, kehrte er nach Padua zurück
und begründete hier 1728 seine berühmte Geigerschule, aus
der viele treffliche Künstler hervorgingen. Er starb 16. Febr.
1770. Von seinen zahlreichen, durch edlen Gedankengehalt, Schwung
und Korrektheit sich auszeichnenden Violinkompositionen erschienen
neun Sammlungen; neuerdings wurden von David, Alard u. a. einzelne
seiner Werke mit Klavierbegleitung herausgegeben. Die von T.
hinsichtlich der Bogenführung aufgestellten Prinzipien gelten
noch gegenwärtig in den Violinschulen italienischer und
französischer Meister. Als Theoretiker ist er besonders durch
seine Schrift "Trattato di musica secondo la vera scienza
dell'armonia" (Padua 1754) berühmt geworden, in welcher er das
von ihm erdachte, auf den sogen. Kombinationston (s. d.)
begründete Harmoniesystem zur Darstellung bringt.
Tartinischer Ton, s. v. w. Kombinationston (s. d.). Vgl.
Schall, S. 398.
Tartlau, Markt im ungar. Komitat Kronstadt
(Siebenbürgen), bei Kronstadt, mit sehenswerter Kirche, (1881)
3233 deutschen und ruman. Einwohnern und Fischzuchtanstalt.
Tartrate (Tartarate), s. v.w. Weinsäuresalze, z.B.
Kaliumtartrat, weinsaures Kali.
Tartsche, seit dem 13. Jahrh. viereckiger Schild,
namentlich bei Turnieren gebräuchlich, zum Einlegen der Lanze
mit Ausschnitt versehen und an den Brustharnisch angeschraubt (s.
Schild, mit Abbildung); im 15. Jahrh. kleiner Faustschild der
Reiter.
Tartsenflechte, s. v. w. Isländisches Moos, s.
Centraria.
Tartuffe (Tartüff), Name der Hauptperson in
Molières gleichnamigen Lustspiel; danach verallgemeinert s.
v. w. scheinheiliger Schurke; Tartüfferie, Scheinheiligkeit,
Heuchelei. "Lady T." , Titel eines Lustspiels von Mad. de Girardin
(1853).
Tartulin, esthn. Name von Dorpat (s. d.).
Tarudant, Hauptstadt der marokkan. Provinz Sûs, am
Südfuß des Atlas, 52 km östlich vom Atlantischen
Ozean, rechts am Wadi Sûs, ist dem Umfang nach
größer als Fes; der Raum innerhalb seiner mit
Türmen versehenen Umfassungsmauer wird aber meist von
Gärten und Olivenhainen eingenommen; im Ost-
527
Tarumares - Taschenspieler.
teil erhebt sich die starke Kasbah. DieStadt selbst hat enge
Straßen, niedrige Häuser und nur 8300 meist maur.
Einwohner, deren Hauptgewerbe die Anfertigung kupferner
Gefäße aus unpoliertem englischen Metall ist zur Ausfuhr
nach Kuka, Kano, Timbuktu.
Tarumares, Indianerstamm, s. Chihuahua.
Tarussa, Kreisstadt im russ. Gouvernement Kaluga, an der
Oka, mit Fabriken und (1886) 2561 Einw.
Tarutino, 1) Dorf im russ. Gouvernement Kaluga, 32 km von
Borowsk, bekannt durch den am 18. Okt. 1812 errungenen Sieg der
Russen unter Kutusow über die Franzosen, an den ein Denkmal
erinnert. - 2) Deutsche Kolonie in Bessarabien, Kreis Akjerman,
Verwaltungszentrum sämtlicher deutscher Ansiedelungen der
Provinz, mit (1882) 3642 Einw.
Tarvis, Marktflecken im österreich. Herzogtum
Kärnten, Bezirkshauptmannschaft Villach, Hauptort des
Kanalthals, an der Staatsbahnlinie St. Valentin-Pontafel, von
welcher hier die Linie T.-Laibach abzweigt, mit Bezirksgericht,
schöner Kirche, Zementfabrik und (1880) 1506 Einw. T. ist
wegen seiner herrlichen Lage beliebte Sommerfrische und
Touristenstandort. In der Nähe der Luschariberg (1721 m) mit
Wallfahrtskirche, das Dorf Raibl mit ärarischem Bleibergwerk
und der Paß Predil.
Tasa (Teju, Stadt in Marokko, östlich von Fes, mit
3500 Einw., ein strategisch sehr wichtiger Platz mit einer kleinen
marokkanischen Garnison, die aber aus der doppelten Umwallung sich
kaum herauswagt aus Furcht vor dem räuberischen Stamm der
Riati, welcher in Wirklichkeit Herr der ganzen Gegend ist.
Tasbusen, östliche Abzweigung des Obischen
Meerbusens, in dessen westlichen Arm der Pur, in dessen
östlichen der Tas mündet. Zwischen letzterm und dem
Jenissei breitet sich die Tastundra aus.
Tasch ("Stein"), im Mittelalter die türkische
Meile.
Täschelkraut, s. Capsella.
Taschen, Mißbildungen an Pflaumenbäumen, s.
Exoascus.
Taschenberg, Ernst Ludwig, Entomolog, geb. 10. Jan. 1818
zu Naumburg a. S., studierte seit 1837 in Leipzig und Berlin
Mathematik und Naturwissenschaft, ging dann als Hilfslehrer an die
Franckeschen Stiftungen nach Halle und widmete sich beim Ordnen der
bedeutenden Käfersammlung des Professors Germar und bei der
Beschäftigung mit der Insektensammlung des zoologischen
Museums speziell der Entomologie. Er fungierte dann als Lehrer zwei
Jahre in Seesen und fünf Jahre zu Zahna und folgte 1856 einem
Ruf als Inspektor am zoologischen Museum in Halle, 1871 wurde er
zum außerordentlichen Professor ernannt. Taschenbergs
Thätigkeit gipfelte in der Erforschung der praktischen
Bedeutung der Insektenwelt für den Landwirt, Gärtner und
Forstmann. Er schrieb: "Was da kriecht und fliegt, Bilder aus dem
Insektenleben" (Berl. 1861, 2. Aufl. 1878); "Naturgeschichte der
wirbellosen Tiere, die in Deutschland den Feld-, Wiesen- und
Weidekulturpflanzen schädlich werden" (Leipz. 1865); "Die
Hymenopteren Deutschlands" (das. 1866); "Entomologie für
Gärtner und Gartenfreunde" (das. 1871); "Schutz der
Obstbäume und deren Früchte gegen feindliche Tiere" (2.
Aufl., Stuttg. 1879); "Forstwirtschaftliche Insektenkunde (Leipz.
1873); "Das Ungeziefer der landwirtschaftlichen
Kulturgewächse" (das. 1873); "Praktische Insektenkunde" (Brem.
1879-80, 5 Tle.); "Die Insekten nach ihrem Nutzen und Schaden"
(Leipz. 1882); auch bearbeitete er die Insekten für Brehms
"Tierleben (2. Aufl. 1877) und lieferte einige Wand.-tafeln
für den Schulgebrauch. - Sein Sohn Otto, geb. 28. März
1854, außerordentlicher Professor an der Universität
Halle, schrieb: "Die Flöhe" (Halle 1880); "Die Mallophagen"
(das. 1882), "Die Lehre von der Urzeugung" (das. 1882), "Die
Verwandlungen der Tiere" (Leipz. 1882), "Bilder aus dem Tierleben"
(das. 1885) und bearbeitete eine neue Folge der "Bibliotheca
zoologica, 1861-80" (das. 1886 ff.) u. a.
Taschenbücher, jährlich erscheinende
Bücher in kleinem Format, welche früher einen Kalender,
genealogische Nachrichten und allerlei gemeinnützige
Mitteilungen enthielten, nach und nach aber immer mehr
belletristischen, besonders novellistischen, Inhalt aufnahmen und
sich endlich mit wenigen Ausnahmen auf letztern allein
beschränkten, als charakteristisches Merkmal aber fast
sämtlich eine Zugabe an Kupferstichen (von Chodowiecki zuerst
aufgebracht) enthielten. Erwähnung verdienen namentlich das
Viewegsche "Taschenbuch" (Berl. 1798-1803), in welchem 1798 Goethes
"Hermann und Dorothea" erschien; das "Taschenbuch der Liebe und
Freundschaft" (Frankf. 1801-41); die "Urania" (Leipz. 1810-38, neue
Folge 1839-48) u. das "Frauentaschenbuch" (Nürnb. 1815-3l).
Späterhin fing man auch an, für die ernstern
Wissenschaften jährliche T. herauszugeben; hierher
gehören besonders Fr. v. Raumers "Historisches Taschenbuch"
(1830 gegründet, seit 1881 hrsg. von Maurenbrecher), Prutz'
"Literarhistorisches Taschenbuch" (1843-48) u. a. Auch gibt es T.
für Botaniker, Jäger, für das Bühnenwesen
etc.
Taschengeige, s. Quartgeige.
Taschenkrebs, s. Krabben.
Taschenpfeffer, s. Capsicum.
Taschenspieler, Personen, welche verschiedenartige, auf
den ersten Anblick an das Wunderbare grenzende Kunststücke
verrichten. Letztere beruhen auf einer Täuschung des
Zuschauers, die der Künstler hauptsächlich durch
große Gewandtheit in seinen Körperbewegungen, namentlich
Fingerfertigkeit, durch Ablenken der Aufmerksamkeit des Zuschauers
auf Nebendinge vermittelst eines möglichst gewandten Vortrags,
durch Einverständnis mit einigen Gehilfen und Zuschauern,
durch geschickte Benutzung der Chemie und Experimentalphysik,
endlich durch allerhand mechanische Vorrichtungen, Apparate mit
Doppelböden, durchlöcherte Tische und Fußböden
etc. bewirkt. Früher pflegten derartige Künstler alle zu
ihren Stücken nötigen Vorbereitungen in einer
großen Tasche (Gaukeltasche) mit sich herumzutragen (daher
der Name T.). Bei allen gesitteten Völkern finden wir diese
Kunst zur Unterhaltung geübt, vor allen andern berühmt
sind die T. Indiens und Chinas. Auch im alten Griechenland und Rom
waren T. früh beliebt; ebenso finden wir sie in Italien, wo
sie unter dem Namen Praestigiatores, Pilarii (Ballspieler) oder
Saccularii (Taschenkünstler) in Städten und Dörfern
umherzogen. Im Mittelalter waren die umherreisenden Spielleute die
auf den einsamen Burgen allezeit willkommenen Vertreter der
"heitern Kunst" (gaya scienza) zugleich Sänger, Musiker, T.
und Spaßmacher (joculatores), weshalb dieser Name in den
Ableitungsformen Gaukler und Jongleur ihnen verblieben ist. Sie
gerieten früher leicht in den Ruf, Zauberer zu sein; der
berühmte Doktor Faust war einer der geschicktesten dieser
Zunft. In der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts
zeichneten sich Pinetti, Eckartshausen und vor allen Philadelphia,
in neuerer Zeit Bosco, Professor Döbler, Becker, Frickell,
Robert-Houdin, Bellachini, Basch, Hermann als geschickte T. aus.
Eine Menge der ältern Taschenspielerkünste findet man in:
Martius, Unterricht in der
528
Taschentücher - Tasmania.
natürlichen Magie, umgearbeitet von Wiegleb, fortgesetzt
von Rosenthal (Berl. 1786-1805, 20 Bde.). Über die durch die
heutige Physik und Chemie sehr erweiterten Hilfsmittel der modernen
Taschenspielerei vgl. die Werke von Robert-Houdin: Contidences d'un
prestidigitateur (2. Aufl., Par. 1861, 2 Bde.), Comment on devient
sorcier (neue Ausg., das. 1877) und Magie et physique amusante
(das. 1877); ferner Grandpré, Le magicien moderne (das.
1879); Marian, Das Ganze der Salonmagie (Wien 1888).
Taschentücher (Schnupftücher) waren noch im 16.
Jahrh. Luxusartikel, welche zuerst in Italien (s. Facilletlein)
aufkamen und sich von da nach Frankreich, England und dem
übrigen Europa, zunächst nur zum Gebrauch der Damen,
verbreiteten. Schon damals wurden sie mit Spitzen und Stickereien
geschmückt und parfümiert (mouchoir de Venus). Auch im
Orient waren sie anfangs nur ein Vorrecht der Fürsten und
höhern Würdenträger, welche T. im Gürtel
trugen. Das Zuwerfen von Taschentüchern, besonders an Frauen,
war eine Gunstbezeigung und wird heute noch in der Türkei in
diesem Sinn geübt.
Taschi Lhunpo, Klosterftadt im südlichen Tibet,
südwestlich bei Digardschi (s. d.), an einer Bergwand erbaut
und aus 300-400 Häusern bestehend, in denen 3300 Priester mit
Beamten und einem geringen weltlichen Gefolge wohnen. T. ist
Residenz des Pantschen Rinpotsche ("Kleinod des großen
Gelehrten"), gewissermaßen des zweiten Papstes der Buddhisten
Innerasiens, der als eine Verkörperung des Gottes Amitabha
gilt, außerordentliches Ansehen genießt und im
südlichen Teil Tibets Regierungsrechte ausübt. T. hat
eine berühmte Holzdruckerei und Fabrikation von
Gottesbildern.
Taschkent (Taschkund), Hauptstadt des russ.
Generalgouvernements Turkistan im westlichen Zentralasien,
nördlich vom Tschirtschik, einem Zufluß des Jaxartes,
besteht aus einer umfangreichen ummauerten Altstadt von ovaler Form
und einem europäischen Viertel mit geraden Straßen, zu
deren beiden Selten sich Kanäle mit fließendem Wasser
und Baumreihen hinziehen. Die russische Citadelle mit ihren
militarischen Etablissements liegt südlich von der Altstadt.
Die Stadt lst Mittelpunkt der russischen Zivil- und
Militärverwaltung Turkistans, hat zahlreiche
Militärwerkstätten und Arsenale, russische Unter- und
Mittelschulen, ein gutes astronomisches Observatorium, eine
russische Zeitung und Bibliothek von 10,000 Bänden, eine
Geographische Gesellschaft, eine kirgisische Zeitung,
Karawanseraien und lebhaften, sich bereits auf 20 Mill. Rub.
belaufenden Handel mit Rußland und Innerasien. Seit 1873 ist
T. auch mit der europäischen Telegraphenlinie verbunden. Die
Einwohner, ca. 100,000 (80,000 Sarten, 1500 Russen, 120 Deutsche
etc.), fabrizieren Seiden-, Leder- und Filzwaren und grobes
Porzellan, treiben aber meist Handel. Die Stadt, früher
Hauptstadt eines selbständigen Chanats, fiel 1810 vor den
Angriffen Chokands und wurde 1865 von den Russen erobert.
Taschkurgan, Stadt, s. Chulm.
Taschlich (hebr., auch "T. machen"), Bezeichnung eines
altjüd. Gebrauchs, der darin besteht, daß Israeliten am
ersten Nachmittag des Neujahrsfestes an einen Fische enthaltenden
Bach sich stellen und ein Gebet um Vergebung der Sünden
sprechen.
Täschner, ehemals zünftige Handwerker, die
allerlei Lederarbeiten verfertigen, Koffer und Stühle mit
Leder überziehen; meist mit den Beutlern verbunden.
Tasco de Alarcon, alte Bergstadt im mexikan. Staat
Guerrero, 1773 m ü. M., mit prächtiger Pfarrkirche (von
J. de la Borda, einen. reichen Grubenbesitzer, im vorigen
Jahrhundert erbaut), Gold- und Silbergruben und (1880) 12,395 Einw.
im Munizipium. Die schon von den alten Mexikanern angelegten
Zinngruben sind jetzt aufgegeben.
Tasen, Volk, s. Orotschen.
Tasimeter (griech., Mikrotasimeter, "Dehnungsmesser"),
ein von Edison angegebenes, äußerst empfindliches, auf
die vom Mikrophon her bekannte Änderung des galvanischen
Widerstandes der Kohle durch Änderung des Druckes
gegründetes Instrument, mit welchem sich die Ausdehnung der
Körper durch Wärme, Feuchtigkeit etc. nachweisen
läßt. Auf einer starken eisernen Fußplatte erheben
sich, 10 cm voneinander entfernt, zwei kurze, dicke, mit der Platte
in einem Stück gegossene Zapfen, zwischen welche der auf seine
Ausdehnung zu prüfende stabförmige und an seinen Enden
zugespitzte Körper in horizontale Lage gebracht wird. Das eine
Ende des Stäbchens wird aufgenommen von der Höhlung einer
Schraube, welche durch den einen Zapfen hindurchgeht. An den andern
Zapfen ist eine vertikal stehende Platinplatte angeschraubt, welche
zugleich eine cylindrisch ausgehöhlte Scheibe von
Hartkautschuk festhält. Gegen die Platinplatte legt sich eine
Platte von Kohle, auf die folgt ein Platinblech, gegen welches eine
Messingplatte drückt, die mit einer Höhlung zur Aufnahme
des andern Endes des Stäbchens versehen ist. Der zweite Zapfen
einerseits und das Platinblech anderseits sind mit den Drähten
einer Leitung verbunden, in welche ein galvanisches Element und ein
Galvanometer eingeschaltet sind. Dehnt sich nun das Stäbchen
aus und preßt das Platinblech stärker gegen die
Kohlenplatte, so wird der Widerstand vermindert, und das
Galvanometer gibt einen größern Ausschlag. Die
Ausdehnung eines Stäbchens von Hartkautschuk durch die
Wärme der mehrere Zoll entfernt gehaltenen Hand verursacht
eine Ablenkung der Galvanometernadel von mehreren Graden; selbst
ein Glimmerstreifen wird durch die Wärme der Hand noch
merklich affiziert. Ein Stäbchen von Gelatine wird durch den
Wasserdampf eines 7-8 cm entfernten feuchten Stückes Papier
sofort ausgedehnt. Das Instrument eignet sich sonach zu feinen
thermometrischen und hygrometrischen Beobachtungen.
Tasman, Abel Jansz, holländ. Seefahrer, fuhr im
Auftrag van Diemens, des Gouverneurs von Batavia, 1642 mit zwei
Schiffen über Mauritius im südlichen Bogen um Australien
herum, entdeckte dabei Tasmania, ohne es als Doppelinsel zu
erkennen, und kehrte durch die Gruppe der Freundschafts- und der
Fidschiinseln hindurch über Neubritannien nach Batavia
zurück. Auf einer zweiten Fahrt 1644 nahm er die Ost- und
Westküste des Carpentariagolfs auf, doch blieb ihm die
Torresstraße auch diesmal unbekannt. Durch ihn wurde die
Ansicht, daß Australien sich sehr weit nach S. hin erstrecke,
ein für allemal beseitigt. Sei nGeburts- u. Todesjahr sind
nicht bekannt.
Tasmania (früher Vandiemensland), große brit.
Insel an der Südostspitze des Australkontinents (s. Karte
"Australien") und von diesem durch die Baßstraße
getrennt. Sie hat die Form eines unregelmäßigen Dreiecks
und ein Areal von 64,644 qkm (1174 QM.), wozu noch eine Anzahl von
Nebeninseln kommen mit einem Areal von 4122 qkm (74,9 QM.). Von den
letztern sind bedeutender: am Ostende der Baßstraße die
Furneauxgruppe mit der Flindersinsel, Kap Barren-, Clarke- und
Chappellinsel nebst der Kentgruppe, alle von Seehunds- und
Alkenfängern (zum Teil Mischlingen) bewohnt; am Westende:
529
Tasmanische Sprachen - Tassilokelch.
Kingsinsel, Robbinsinsel und die Hunterinseln. Andre
größere Inseln sind: Waterhouse-, Swan-, Scouten-,
Maria-, Bruni- und Huoninsel. Die Westküste von T. ist steil
und felsig und hat nur drei gute Häfen: Port Davy, Pieman's
River und Macquarie Harbour. Häfen der Nordküste sind
Stanley bei Circular Head, Emubai, Port Frederick an der
Merseymündung, Port Dalrymple an der Mündung des Tamar
und Waterhouse Roads zwischen der Anderson- und der Ringaroomabai;
an der Östküste: Georges-, Oyster-, Spring- und
Fortescuebai. Die Süd- u. Südostküste hat zahlreiche
sichere Baien und Häfen: Port Arthur, Storm- und Norfolkbai,
d'Entrecasteauxkanal, Port Esperance, Southport und Recherchebai.
Die Hauptinsel ist von zwei durch eine zentrale Senkung
geschiedenen Gebirgsketten durchzogen. In der östlichen
erreicht Ben Lomond 1527 m; in der westlichen, welche aus einem
durchschnittlich 1000 m hohen Tafelland besteht, erhebt sich der
höchste Berg der Insel, Cradle Mountain, zu 1689 m. Zahlreiche
Ausläufer gehen nach allen Richtungen, nur nicht nach O., aus.
Hier befinden sich auch alle große Seen der Kolonie: der
Große See, St. Clairsee, Arthurs- und Echosee. Aus ihnen
kommen die meisten Flüsse: Derwent, Huon, Tamar (entstanden
aus Nord- und Süd-Esk), Ringarooma. Das Klima ist nicht so
trocken wie das des Festlandes, die Niederschläge sind
regelmäßiger, das Thermometer steigt nicht über
26° C. und sinkt nicht unter -5° C. Tier- und Pflanzenwelt
sind wie die des Festlandes. - Die Einwohner (1887: 142,478 Seelen)
sind fast durchweg Briten oder britischer Abstammung; Deutsche
zählte man 1881 nur 782. Die Religion ist vorwiegend die
protestantische. Hauptnahrungszweige sind Ackerbau und Viehzucht.
Man baut hauptsächlich Weizen, Hafer, Gerste, Kartoffeln. Sehr
reich ist die Insel an Obst, das teils frisch (namentlich nach
Neusüdwales und Victoria), teils als Mus ausgeführt wird.
Der Viehstand der Kolonie war 1887: 29,528 Pferde, 147,092 Rinder,
1,547,242 Schafe, 52,408 Schweine. An Mineralien ist T. reich;
ausgebeutet werden namentlich Zinn, Gold, Wismut, Kohle; auch
Kupfer und Blei werden gefunden. Der Handel führt
europäische Fabrikate und Manufakte ein und führte 1887
aus: Wolle für 415,425, Zinn für 407,857 Pfd. Sterl.,
ferner Obst, Hopfen, Kartoffeln, Gerberrinde, Holz. Die Einfuhr
betrug 1,596,817, die Ausfuhr 1,449,371 Pfd. Sterl. Die Eisenbahnen
hatten 1887 eine Länge von 508 km, die Telegraphenlinien 2301
km. Die Handelsflotte der Kolonie zählte 177 Segelschiffe von
13,341 Ton. und 26 Dampfer von 4601 T., die Zahl der Walfänger
hat mit den Walen sehr abgenommen. Der Tonnengehalt aller ein- und
ausgelaufenen Schiffe war 735,299. Das Unterrichtswesen ist in
geordnetem Zustand; Schulzwang ist eingeführt, und vier
höhere Schulen sind errichtet. Die Royal Society of T. in
Hobart verfolgt allgemein wissenschaftliche Zwecke. Die Kolonie ist
in 18 Grafschaften geteilt, außerdem in besondere
Wahldistrikte. Nach der Verfassung steht an der Spitze der
Verwaltung ein von der Königin von England ernannter
Gouverneur mit verantwortlichen Ministern, Oberhaus und Unterhaus.
Die Staatseinnahmen betrugen 1887: 594,976, die Ausgaben 668,759,
die Staatsschuld 4,109,370 Pfd. Sterl. Hauptstadt ist Hobart.
Die Insel wurde 24. Nov. 1642 von dem holländischen
Seefahrer Tasman entdeckt und zu Ehren seines Auftraggebers, des
indischen Generalgouverneurs Anton van Diemen, Vandiemensland
genannt, ein Name, der 1856 in den jetzigen umgeändert wurde.
Die Insel blieb unbesucht, bis 1772 der Franzose Marion in der
Frederick Hendrick-Bai landete. Fourneaux entdeckte 1773 die
Adventurebai, welche 1777 auch von Cook berührt wurde. Bligh
sah T. 1788 und 1792. d'Entrecasteaux, der Laperouse aufsuchen
sollte, segelte in die Mündungen des Derwent und Huon und
benannte mehrere Punkte. Kapitän Hayes untersuchte T. 1794
noch weiter. Baß bewies 1798 die Inselnatur Tasmanias. Die
Kolonisation der Insel begann 1803 mit der Anlage einer
Verbrecherkolonie am Derwent, die aber schon 1804 nach Hobart
verlegt wurde. T. war nur eine Dependenz von Neusüdwales,
erhielt aber 1824 auf Ansuchen der Kolonisten eigne Verwaltung, und
1853 hörte die Deportation [corr!] auf. Die Eingebornen (s.
Tafel "Ozeanische Völker [corr!]", Fig. 4), welche man
vorfand, waren den Australnegern ganz nahe verwandt, sie wurden
aber teils in vielfachen Kämpfen ausgerottet, teils starben
sie infolge ihrer gewaltsamen Versetzung auf die Flindersinseln bis
auf wenige, welche man nach Hobart zurückführte. Die
letzte ihres Stammes, Trucamini oder Lalla Rookh, starb 1876 in
London. Vgl. Trollope, Victoria and T. (Lond. 1874); Jung, Der
Weltteil Australien, Bd. 2 (Leipz. l882); Fenton, History of T.
(Lond. 1884); Bonwick, The lost Tasmanian race (das. 1884).
Tasmanische Sprachen, s. Australische Sprachen.
Tasnád (spr. táschnahd. Trestenberg), Markt
im ungar. Komitat Szilágy, mit (1881) 3375 ungar.
Einwohnern, vorzüglichem Weinbau und Bezirksgericht.
Tassaert (spr. -ssart), Antoine, niederländ.
Bildhauer, geboren um 1729 zu Antwerpen, wo er seine Ausbildung
erhielt, ging dann nach England und Paris, wo er sich durch eine
Statue Ludwigs XV. bekannt machte. Der Prinz Heinrich von
Preußen beauftragte ihn, mehrere Statuen und Gruppen für
sein Palais in Berlin auszuführen, wohin er um 1770
übersiedelte. Er entfaltete dort eine rege Thätigkeit,
wurde Rektor der Kunstakademie und starb 1788. Er schuf unter
anderm die Statuen der Generale v. Seydlitz und Keith auf dem
Wilhelmsplatz in Berlin (später entfernt) und die Büsten
Friedrichs II. und M. Mendelssohns.
Tasse, s. v. w. Banse, s. Scheune.
Tassenrot, s. Safflor.
Tassilo, Herzog von Bayern, aus dem Geschlecht der
Agilolfinger, mußte 757 die Oberlehnshoheit seines Oheims,
des fränkischen Königs Pippin, anerkennen, suchte sich
aber unter Karl d. Gr. seiner Lehnspflicht zu entziehen, trat zu
diesem Zweck mit seinem Schwager, dem Langobarden Adalgis, und den
Avaren in geheime Verbindung, wurde zwar 787 mit Waffengewalt zur
Unterwerfung gezwungen, erneuerte indes die Verschwörung,
wurde deshalb 788 auf dem Reichstag zu Ingelheim zum Tod
verurteilt, aber begnadigt und in das Kloster Jumièges bei
Rouen eingeschlossen, wo er, nachdem er 794 nochmals feierlich dem
Herzogtum Bayern entsagt, starb. Mit ihm erlosch das Geschlecht der
Agilolfinger.
Tassilokelch, ein im Stift Kremsmünster aufbewahrter
Kelch, welcher um 780 von dem bayrischen Herzog Tassilo und seiner
Gemahlin Luitperga geschenkt wurde und der älteste unter den
erhaltenen ist, der eine Inschrift trägt. Er ist 9½ cm
hoch, aus Kupfer gegoffen und vergoldet und an der Kuppe mit den in
aufgeschweißtes Silber gravierten Brustbildern Christi und
der vier Evangelisten, am Fuß mit den Brustbildern von
Propheten geschmückt Die Inschrift am Fuß lautet:
"TASSILO DVX FORTIS LIVTPIRC VIRGO REGALIS".
530
Tasso (Bernardo und Torquato).
Tasso, 1) Bernardo, ital. Dichter, geb. 1493 zu Bergamo,
studierte in Padua und bekleidete dann verschiedene Stellen in Rom,
Ferrara und Venedig, wo er sich auch bereits als Dichter einen
Namen machte. 1531 trat er als Geheimschreiber in die Dienste des
Fürsten Ferrante Sanseverino von Salerno, begleitete denselben
auf Karls V. Zug nach Tunis, ging dann in Geschäften des
Fürsten nach Spanien, heiratete nach seiner Rückkehr nach
Salerno 1539 die geistvolle Porzia de' Rossi und lebte mit ihr in
Zurückgezogenheit zu Sorrento bis 1547. Dann mit dem
Fürsten von Salerno in die Ungnade des Kaisers gefallen, hielt
er sich an verschiedenen Orten auf und kam 1556, von allem
entblößt, nach Ravenna, von wo ihn der Herzog von Urbino
nach Pesaro berief. 1563 ward er erster Sekretär des Herzogs
Wilhelm von Mantua; er starb 1569 als Gouverneur von Ostiglia. Sein
Hauptwerk ist das romantische Epos "L'amadigi di Francia" in 100
Gesängen (Vened. 1560 u. öfter; am besten, Berg. 1755, 4
Bde.), dessen Stoff größtenteils dem spanischen Roman
vom Amadis entnommen ist. Außerdem verarbeitete er eine
einzelne Episode daraus zu einem besondern Gedicht: "Floridante",
von welchem er aber nur 19 Gesänge vollendete. Von seinem Sohn
wurde es vollendet und herausgegeben (Bologna 1587). Noch sind
seine zum Teil sehr schätzbaren lyrischen Poesien, welche
zuerst als "Amori" (Vened. 1555; vermehrt, das. 1560), dann als
"Rime" (Berg. 1749, 2 Bde.) erschienen, und die Sammlung seiner
"Lettere" (am vollständigsten, Padua 1733-51, 3 Bde.) zu
erwähnen.
2) Torquato, Sohn des vorigen, sowohl durch seinen Dichterruhm
als seine Schicksale bekannter geworden als der Vater, geb. 11.
März 1544 zu Sorrento, wurde in Neapel, Rom und Pesaro (hier
gemeinschaftlich mit dem Sohn des Herzogs von Urbino) erzogen,
begann mit dem 13. Jahr zu Padua das Studium der Rechte und
veröffentlichte vier Jahre später ein episches Gedicht:
"Rinaldo" (Vened. 1562). Da dasselbe Beifall fand, so gab er das
Studium der Jurisprudenz auf, widmete sich zu Bologna, später
zu Padua philosophischen und litterarischen Studien und begann
zugleich, den schon früher gemachten Entwurf zu einem epischen
Gedicht von der Befreiung Jerusalems auszuführen. 1565 berief
ihn der Kardinal Lodovico von Este, dem er seinen "Rinaldo"
gewidmet hatte, nach Ferrara und ernannte ihn zum Hofkavalier mit
einem ansehnlichen Jahrgehalt. Der Dichter ward mit großer
Achtung ausgenommen; namentlich schenkten ihm die Schwestern des
Herzogs Alfons, Lucrezia, die nachmalige Herzogin von Urbino, und
Leonore, ihre Gunst. 1571 reiste T. nach Vollendung der ersten acht
Gesänge seines Epos mit dem Kardinal nach Frankreich, wo er am
Hof Karls IX. die huldvollste Aufnahme fand, kehrte aber aus nicht
sicher bekannten Gründen schon nach einem Jahr nach Ferrara
zurück und trat durch Vermittelung der Prinzessin Leonore in
die Dienste des Herzogs Alfons, der ihn mit großer
Zuvorkommenheit behandelte und ihm volle Muße zu seinen
poetischen Arbeiten gewährte. T. verfaßte zunächst
das Schäferspiel "Aminta", welches sofort in Szene gesetzt
ward, vollendete darauf, nachdem er mehrere Monate zu Castel
Durante bei seiner Gönnerin, der Herzogin von Urbino, verweilt
hatte, im Frühling 1575 sein großes Epos unter dem
Titel: "Goffredo" und begab sich im November d. J. nach Rom, um es
dort nochmals einer gründlichen Prüfung zu unterwerfen.
In Rom wurde er dem Kardinal Ferdinand von Medici, nachmaligem
Großherzog von Toscana, vorgestellt und von diesem
aufgefordert, in seine Dienste zu treten, was T. jedoch aus
Rücksichten der Dankbarkeit gegen das Haus Este ablehnte. Von
jetzt an beginnt die Zeit seiner Leiden, deren eigentliche
Veranlassung noch nicht mit voller Sicherheit ermittelt ist, aber
wohl zum Teil in den Intrigen seiner Neider und Feinde, namentlich
des Staatssekretärs Antonio Montecatino, zum Teil auch in
seiner eignen geistigen Organisation zu suchen sein dürfte.
Bald nach seiner Rückkehr nach Ferrara, wo ihm der Herzog das
eben erledigte Amt eines Historiographen verlieh, bemächtigte
sich die finsterste Melancholie des Dichters. In dieser
Gemütsverfassung zog er 15^7 eines Abends in den Zimmern der
Herzogin von Urbino den Degen gegen einen ihrer Diener, worauf der
Herzog ihn auf kurze Zeit verhaften ließ. Nachdem T. danach
auf einen empfindlichen Brief an den Herzog die Weisung erhalten,
weder an diesen noch an die Herzogin ferner zu schreiben, entfloh
er 20. Juli 1577 mit Zurücklassung seiner Papiere und begab
sich auf Umwegen nach Sorrento zu seiner Schwester Cornelia, welche
daselbst als Witwe lebte. Unter der liebevollen Pflege derselben
erholte er sich einigermaßen, aber die Sehnsucht nach Ferrara
ließ ihm keine Ruhe. Er begab sich nach Rom und erwirkte sich
durch Vermittelung des Geschäftsträgers des Herzogs die
Erlaubnis zur Rückkehr. Er wurde zwar wohlwollend aufgenommen;
allein die Herausgabe seiner Manuskripte verweigerte ihm Alfons, da
er ihn noch immer als einen Gemütskranken betrachtete, in
dessen Händen sie vielleicht vor Vernichtung nicht sicher
wären. Zum zweitenmal floh daher T. aus Ferrara und wandte
sich zum Herzog von Urbino und dann nach Turin (1578). Hier fand er
beim Herzog Karl Emanuel wie bei Filippo d'Este wohlwollende
Aufnahme und schrieb außer verschiedenen andern Produktionen
in Poesie und Prosa die zwei "Dialoghi della nobilità e
della dignità". Nochmals entschloß er sich zur
Rückkehr nach Ferrara, erhielt auch abermals die Erlaubnis
dazu (1579), sah sich jedoch in der Hoffnung, die frühere
Gunst des Herzogs wiederzuerlangen, getäuscht; von dem
Fürsten nicht vorgelassen und von den Hofleuten verachtet,
ergoß er sich in lauten Schmähungen gegen Fürsten
und Hof. Als dies dem Herzog hinterbracht wurde, ließ er ihn
(März 1579) als einen Rasenden in das St. Annenhospital, das
Irrenhaus von Ferrara, bringen. Unerwiesen ist die Behauptung,
daß T. sich des Herzogs Zorn durch seine leidenschaftliche
Liebe zur Prinzessin Leonore, der er einmal in Gegenwart des Hofs
einen Kuß geraubt, zugezogen habe. Daß T. wirklich,
wenn auch mit Unterbrechungen, wahnsinnig war, wurde nur von
wenigen seiner Zeitgenossen bezweifelt. Im St. Annenhospital
verlebte er zuerst zwei Jahre in engem Gewahrsam in einem Zustand
zwischen Gesund- und Kranksein. Oft hatte er ruhige Augenblicke, in
denen er sich auf das schönste bald in Versen, bald in
philosophischen Betrachtungen aussprach; in diese Periode
gehören mehrere der besten seiner "Dialoghi". Am meisten
Kummer machte ihm die Nachricht, daß sein Gedicht in
höchst verstümmelter Gestalt zu Venedig erschienen sei
unter dem Titel: "La Gerusalemme liberata". Nach Ablauf jener zwei
Jahre erhielt er eine bessere Wohnung, durfte Besuche empfangen und
von Zeit zu Zeit ausgehen. Aber vergeblich bot er alles
mögliche auf, seine Freiheit wiederzuerhalten; erst als sich
sein Zustand mehr und mehr verschlimmerte, ließ der Herzog
1586 den Dichter nach mehr als siebenjähriger Gefangenschaft
frei. T. begab sich zuerst nach Man-
531
Tasso - Tassoni.
tua, dann nach Bergamo, wo er den "Floridante" seines Vaters und
sein bereits in Ferrara begonnenes Trauerspiel "Torrismondo"
vollendete, und 1587 nach Rom, wo er zwar sowohl beim Papst als bei
den einflußreichsten Personen wohlwollende Aufnahme fand,
allein ohne daß irgend etwas Wesentliches zu seinen gunsten
geschah. Vergeblich reklamierte er 1588 in Neapel die Mitgift
seiner Mutter und sein väterliches Vermögen, welches
eingezogen worden war, und wechselte in den nächsten Jahren,
nirgends Ruhe findend, mehrmals den Aufenthalt. Trotz dieses
herumschweifenden Lebens entstanden in dieser Zeit mehrere seiner
Werke. So arbeitete er die "Gerusalemme liberata" in eine
"Gerusalemme conquistata" um und schrieb seine "Sette giorni del
mondo creato". Inzwischen hatte Ippolito Aldobrandini, sein alter
Gönner, unter dem Namen Clemens VIII. den päpstlichen
Thron bestiegen, und sein Neffe, der Kardinal Cinzio Aldobrandini,
ein Freund von Kunst und Wissenschaft, versammelte die
ausgezeichnetsten Männer Italiens um sich. Auch T. wurde von
ihm nach Rom berufen und hatte sich hier von seiten des Papstes und
seines Verwandten der glänzendsten Aufnahme zu erfreuen.
Intrigen vertrieben ihn jedoch bald wieder von da, und erst als der
Kardinal Cinzio Aldobrandini, der T. in Rom zu fesseln
wünschte, seinem Oheim vorschlug, T. in feierlicher Weise auf
dem Kapitol zum Dichter zu krönen, kehrte dieser zurück.
Aber bald darauf fiel er in ein hitziges Fieber und starb im
Kloster Sant' Onofrio auf dem Janiculus, wohin er sich hatte
bringen lassen, 25. April 1595, wie es heißt, am Tag vor dem
zu seiner Dichterkrönung festgesetzten. Er ward in der Kirche
des genannten Klosters bestattet. Der Kardinal Bevilacqua von
Ferrara ließ ihm ein Denkmal setzen; ein andres wurde in
neuerer Zeit über seinem Grab errichtet. Auch in Sorrent,
Bergamo, Neapel (von Solari) etc. hat man dem Dichter Statuen
errichtet.
T. gehört zu den fruchtbarsten italienischen
Schriftstellern, und unter seinen poetischen Werken sind fast alle
Gattungen der Dichtkunst vertreten. Sein Hauptruhm aber
gründet sich auf sein Epos "La Gerusalemme liberata", welches
mit Recht zu den Meisterwerken seiner Gattung gerechnet wird,
sowohl wegen der edlen, würdevollen Behandlung des Stoffes,
der vortrefflichen Charakteristik der Hauptpersonen und der
schönen Abrundung des Ganzen als auch wegen der edlen, echt
poetischen Diktion und der musikalischen Schönheit der
Versifikation. Insbesondere sind die geschickt eingewebten Episoden
von großer Schönheit und machen einen Hauptreiz des
Gedichts aus. Zu tadeln ist dagegen der von geschraubten Antithesen
und zugespitzten Wortspielen nicht immer freie Ausdruck. Seine
Umarbeitung des Gedichts in eine "Gerusalemme conquistata", bei
welcher T. den Ausstellungen der Crusca Rechnung trug, ist beinahe
als eine Verirrung zu betrachten und jetzt mit Recht vergessen.
Nächst der "Gerusalemme" ist das Schauspiel "Aminta" Tassos
vorzüglichstes Werk. Sein "Torrismondo" (zuerst Berg. 1587)
gilt für eins der besten italienischen Trauerspiele aus der
ältern Schule; auch seinem "Rinaldo" sowie den religiösen
Gedichten: "Le sette giornate", "Le lagrime di Maria" . "Il monte
Oliveto", "La disperazione di Giuda" fehlt es nicht an schönen
Einzelheiten. Seine aus Sonetten und Kanzonen bestehenden lyrischen
Gedichte ("Rime") endlich gehören zum Teil zu den
schönsten ihrer Art. Von seinen Prosaschriften sind besonders
seine von philosophieschem Geiste durchwehten "Dialoghi" sowie
seine zahlreichen für die Kenntnis der gesamten Zeit wichtigen
"Lettere" (hrsg. von Guasti, Flor. 1852-55, 5 Bde.) hervorzuheben.
Von seinen einzelnen Werken ist namentlich die "Gerusalemme" in
zahllosen Ausgaben verbreitet (erste authentische Ausgaben Parma
1581 u. Mantua 1584; kritische Ausg. von Orelli, Zürich 1838,
von Scartazzini, 2. Aufl., Leipz. 1882). Gesamtausgaben von Tassos
Werken erschienen zu Florenz 1724, 6 Bände, und Venedig
1722-42, 12 Bände; die neueste und vollständigste ist die
von Rosini (Pisa 1820, 30 Bde.). Eine Auswahl ("Opere scelte") in 5
Bänden erschien 1824 in Mailand. Die besten deutschen
Übersetzungen der "Gerusalemme liberata" sind die von Gries
(13. Aufl., Leipz. 1874, 2 Bde.; Stuttg. 1887) und Streckfuß
(mit Biographie, 4. Aufl., Leipz. 1849, 2 Bde.). "Auserlesene
lyrische Gedichte" übersetzte K. Förster (2. Aufl.,
Leipz. 1844). Tassos Biographie schrieb sein Freund Giamb. Manso
(Neapel 1619), vollständiger Serassi (Rom 1785; neue Ausg.,
Flor.1858). Vgl. Rosini, Saggio sugli amori di Torquato T. e sulle
cause della sua prigionia (Pisa 1832); Milman, Life of T. T. (Lond.
1850, 2 Bde.); Cibrario, Degli amori e della prigionia di T. T.
(Tur. 1861); G. Voigt, Torquato T. am Hofe von Ferrara (in Sybels
"Historischer Zeitschrift", Bd. 20, Münch. 1868); Cardona,
Studi novi sopra del T. alienato (in der "Nuova Antologia", Februar
1873); Cecchi, T. T. Il pensiero e le belle lettere italiane nel
secolo XVI (Flor. 1877; deutsch, Leipz. 1880); Ferrazzi, T. T.
(Bassano 1880); Speyer, Torquato T. (im "Neuen Plutarch", Bd. 10,
Leipz. 1884). Unecht sind die von dem Conte M. Alberti
herausgegebenen "Manoscritti inediti di Torquato T." (Lucca 1837
f.).
Tassoni, Alessandro, ital. Dichter, geb. 1565 zu Modena,
studierte in Bologna und Ferrara die Rechte und ward 1597 zu Rom
Sekretär des Kardinals Colonna, den er 1600 nach Spanien
begleitete. Vom Kardinal in persönlichen Angelegenheiten
desselben nach Rom zurückgesandt, ließ er sich dort ganz
nieder, wurde in die Akademien der "Umoristi" und "Lincei"
aufgenommen und eins der eifrigsten Mitglieder derselben. Eine
erste Frucht seiner Arbeiten waren seine "Considerazioni sopra le
rime del Petrarca" (Mod. 1609), wodurch er in eine heftige
litterarische Fehde verwickelt ward, sich aber doch das Verdienst
erwarb, der übertriebenen Verehrung Petrarcas und dem Ansehen
seiner ungeschickten Nachahmer ein Ziel zu setzen. Kaum geringeres
Aufsehen erregten seine "Pensieri diversi" (Rom 1612), in welchen
er den Homer und Aristoteles angriff. 1612 trat er in die Dienste
Karl Emanuels von Savoyen, zog sich aber, als nach langem Warten
seine Beförderung durch Intrigen verhindert wurde, ins
Privatleben zurück, bis 1626 der Kardinal Lodovisio ihn zu
seinem Sekretär und nach des Kardinals Tod Franz I. von Modena
ihn (1632) zu seinem Kammerherrn ernannte. T. starb aber schon
1635. Sein Ruhm beruht vorzugsweise auf seinem heroisch-komischen
Gedicht "La secchia rapita", in 12 Gesängen (Par. 1622),
welches den zwischen den Modenesern und Bolognesern im 13. Jahrh.
über einen von den erstern aus Bologna geraubten Eimer
entstandenen Krieg zum Gegenstand hat. Es ist dies eigentlich das
erste komische Epos der neuern Zeit im strengen Sinn des Wortes und
gehört wegen seiner glücklichen Mischung von Ernst und
Scherz, der Originalität der Gedanken und Bilder, der
Schönheit der echt toscanischen Sprache und der Leichtigkeit
der Versifikation
532
Taste - Tastsinn.
zu den klassischen Werken der Italiener. Die "Secchia rapita"
ist nachher sehr oft wieder gedruckt worden (am besten, Mod. 1744,
Par. 1766, Vened. 1813; deutsch von Kritz, Leipz. 1842). Eine
Anzahl Briefe Tassonis hat Gamba herausgegeben (Vened. 1827).
Taste (ital. Tasto, lat. Clavis), der Teil eines musikal.
Schlaginstruments, der beim Niederdrücken mit dem Finger sich
hinten wie ein Hebel in die Höhe hebt und infolge davon
entweder durch den Schlag eines Hammers (wie beim Pianoforte), oder
durch Öffnen eines Ventils (wie bei der Orgel etc.) die Saite,
Pfeife oder Zunge zum Ertönen bringt. Sämtliche zu einem
Instrument gehörige Tasten nennt man Tastatur oder auch
Klaviatur. Vgl. Klavier.
Taster, s. Palpen.
Tastkörperchen, s. Haut, S. 232.
Tasto solo (abgekürzt t. s.) bedeutet in der
Generalbaßbezifferung, daß zu dem betreffenden
Baßton keine Akkorde gegriffen werden sollen.
Tastsinn (Gefühlssinn), derjenige Sinn, welcher
Über die ganze äußere Körperoberfläche
und den in nächster Nähe dieser gelegenen Teil der
Schleimhäute verbreitet ist und uns vermittelst mechanischer
oder thermischer Reibung über bestimmte Qualitäten und
Zustände der reizenden Objekte sowie deren räumliche
Verhältnisse Auskunft gibt. Der T. verschafft uns zweierlei
ganz verschiedene Empfindungen von spezifischer Natur, nämlich
die Empfindungen des Druckes und der Temperatur. Gehen die Druck-
und Temperatureinflüsse über eine gewisse Grenze hinaus,
so entsteht eine ganz neue Empfindungsform, nämlich der
Schmerz. Es ist nicht bekannt, ob diese Scheidung eine anatomische
Berechtigung hat, d. h. ob für jede der genannten Empfindungen
ein besonderer nervöser Apparat besteht. In der
äußern Haut u. den benachbarten Teilen der
Schleimhäute finden sich eigentümliche nervöse
Nervenendorgane (s. Haut, S. 232), welche aller Wahrscheinlichkeit
nach für das Zustandekommen der Druck- und
Temperaturempfindungen von der größten Bedeutung sind.
Da wir die Empfindungen, welche uns Druck- und
Temperatureinflüsse verursachen, ohne Ausnahme in die
betreffenden Körperteile verlegen (von welchen her sie dem
Gehirn zugeleitet wurden und uns hier zum Bewußtsein kamen),
so unterscheiden wir auch zwei im übrigen völlig gleiche
Eindrücke, welche zwei verschiedene Hautstellen betreffen, als
räumlich gesonderte. Die Organe des Tastsinnes sind also mit
Raumsinn oder Ortssinn begabt. Außerdem fassen wir zwei auf
das Tastorgan nacheinander oder miteinander wirkende Einflüsse
als zeitlich gesonderte oder als gleichzeitige auf. Man kann daher
ebensogut von einem Zeitsinn des Tastorgans wie z. B. von einem
Zeitsinn des Ohrs sprechen. Der Raumsinn zeigt an den einzelnen
Körperstellen sehr verschiedene Grade von Schärfe; man
ermittelt dieselbe am besten mit dem Tastzirkel, einem
gewöhnlichen Zirkel, dessen Spitzen aber nicht so fein sein
dürfen, daß sie die Haut verletzen. Die Spitzen des
Zirkels setzt man auf irgend eine Hautstelle und bestimmt (bei
geschlossenen Augen des zu Prüfenden) den kleinsten Abstand
der Spitzen, bei welchem noch eine zweifache Berührung
wahrgenommen wird. An der Zungenspitze beträgt der kleinste
Abstand, bei welchem zwei Punkte noch als getrennt wahrgenommen
werden, 1 mm. An der ebenfalls noch feinfühligen
Beugefläche des letzten Fingergliedes beträgt der Abstand
bereits 2 mm, an dem roten Teil der Lippen sowie an der
Beugefläche des zweiten Fingergliedes 4, an der Nasenspitze 6
mm, in der Mitte des Oberarms und Oberschenkels sowie an dem
Rücken 35-65 mm. Fortgesetzte Übung erhöht die
Feinheit des Raumsinnes und zwar an sonst minder bevorzugten
Stellen verhältnismäßig mehr als an den feiner
tastenden Hautpartien. Besonders entwickelt ist der Raumsinn des
Blinden. Wie schon erwähnt, haben wir die Tastempfindungen da,
wo die betreffenden Nerven von den Tastobjekten selbst erregt
werden, also an der Oberfläche des Körpers. Unter
Umständen jedoch verlegen wir die Tastempfindungen nach
außen und zwar entweder in nervenlose Teile, welche mit der
tastenden Fläche verbunden sind, oder sogar an das Ende eines
mit der Haut in Berührung kommenden fremden Körpers. Die
Haare z. B. leiten Bewegungen, welche ihnen mitgeteilt werden, bis
zu den empfindenden Hautstellen, aus denen sie hervorwachsen; wir
verlegen aber die dadurch bedingten Empfindungen in die an sich
unempfindlichen Haare. Der Druck, welchen äußere Objekte
auf uns ausüben, wird entweder unmittelbar geschätzt
mittels spezifischer Tastempfindungen (Druckempfindungen) oder
mittelbar dadurch, daß eine von uns gegen den drückenden
Körper ausgeführte willkürliche Bewegung uns zum
Bewußtsein kommt. Im letztern Fall erschließen wir
nämlich die Größe des Druckes oder Gewichts sowohl
aus den begleitenden Muskelgefühlen als auch aus der
Schätzung des Kraftmaßes, des aufzuwendenden
Willensimpulses, welchen wir nötig haben, um dem Objekt
Widerstand zu leisten, oder um es zu heben. Die nämlichen
Hilfsmittel dienen zur Wahrnehmung von Druckunterschieden
(Drucksinn). Man ist im stande, noch zwei Gewichte voneinander zu
unterscheiden, deren Schwere sich wie 40:41 verhält,
vorausgesetzt, daß die Gewichte weder zu schwer noch zu
leicht sind. Zunahme eines auf der Hand lastenden Druckes wird
leichter wahrgenommen als Abnahme desselben. Der Drucksinn zeigt in
den verschiedenen Bezirken der Haut geringere Unterschiede seiner
Feinheit als der Raumsinn. Die Leistungen des Drucksinns sind
geringer als die des Muskelgefühls; durch das letztere
schätzen wir die Druckempfindungen, indem wir die Gewichte auf
die Hand legen und zugleich Bewegungen mit der Hand ausführen.
Die zweite Art von spezifischen Empfindungen, welche uns der T.
vermittelt, sind die Temperaturempfindungen (Temperatursinn). Wir
haben nur innerhalb ziemlich enger Grenzen wirkliche
Temperaturempfindungen. Denn es verursacht uns z. B. das Wasser bei
55° C. keine eigentliche Wärmeempfindung, sondern ein
leises Brennen, während es schon bei einigen Graden unter Null
nicht eigentlich mehr als kalt empfunden wird, sondern uns
Schmerzen verursacht. Temperaturempfindungen entstehen unter
zweierlei Bedingungen, nämlich durch
Temperaturveränderungen der Haut oder durch
Wärmetransmission derselben. Kommt ein Körper, welcher
dieselbe Temperatur wie die Haut besitzt, mit dieser in
Berührung, so erscheint er uns weder kalt noch warm. Letzteres
ist aber sofort der Fall, wenn jener Körper unsre Haut durch
Zuleitung von Wärme höher temperiert, oder wenn er sie
durch Wärmeentziehung abkühlt. Bleibt die Temperatur der
Haut konstant, so haben wir keine oder nur sehr schwache
Wärmeempfindungen; die verschieden temperierte Haut der
Wangen, Hände und Füße z. B. erweckt in uns keine
Temperaturempfindungen. Sind aber die bei konstanter Temperatur der
Haut in einer bestimmten Zeit nach außen abgegebenen oder von
da aufgenommenen Wärmemengen verhältnismäßig
bedeutend, so haben wir das Gefühl anhaltender
533
Tastwerkzeuge - Tataren.
Kälte oder anhaltender Hitze. Objektive
Temperaturempfindungen entstehen somit nicht bloß bei
Veränderungen der Hauttemperatur, sondern auch beim Durchgang
bedeutender Wärmemengen durch die konstant temperiert
bleibende Haut. Wir vermögen zwischen 14 und 29° R. noch
Temperaturunterschiede von 1/5-1/6°, jedoch nur bei sehr
großer Aufmerksamkeit, zu erkennen. Am bevorzugtesten sind in
dieser Beziehung die Zungenspitze, die Gesichtshaut, die Finger.
Die Fähigkeit für Temperaturwahrnehmungen wird durch
verschiedene Umstände vorübergehend beeinträchtigt,
so z. B. schon durch Eintauchen der Hand in Wasser von einigen 50
Grad, durch Schmerzen verschiedener Art u. dgl. Ist eine Hautstelle
durch Eintauchen in niedrig temperiertes Wasser (z. B. von 10°)
abgekühlt worden, so empfindet man beim Einbringen derselben
in Wasser von z. B. 16° einige Sekunden hindurch Wärme, so
lange nämlich, als die Hauttemperatur von 10 auf 16°
steigt. Dann erst folgt anhaltendes Kältegefühl. Die
jeweilige Temperatur der Haut veranlaßt also falsche
Beurteilungen der objektiven Temperatur. Schnelle
Temperaturveränderungen der Haut bedingen lebhaftere
Empfindungen. Kalte Körper, welche die Wärme gut leiten,
wie Metalle, halten wir deshalb (weil sie der Haut die Wärme
schnell entziehen) für viel kälter als andre gleich
kalte, welche schlechte Wärmeleiter sind, wie z. B. Holz,
Stroh etc. Die Hand empfindet das gleiche Gefühl des Brennens
bei Luft von 120°, bei Holz von 80° und bei Quecksilber von
50°, weil die Luft langsamer als das Holz, dieses langsamer als
das Quecksilber die Wärme an den Körper abgibt. Kleine
Hautstrecken verursachen schwächere Temperatureindrücke
als größere. Taucht man z. B. einen Finger der linken
Hand in Wasser von 32° R., die ganze rechte Hand dagegen in ein
solches von 28½°, so erscheint uns letzteres gleich wohl
wärmer als das erstere, während der Unterschied sofort
den wirklichen Verhältnissen entsprechend erscheint, wenn man
beide Hände ganz eintaucht. Die Fundamentalarbeit über
den T. verdanken wir E. H. Weber: "Über T. und
Gemeingefühl" in Wagners "Handwörterbuch der
Physiologie".
Tastwerkzeuge (Tastorgane), die zum Tasten oder
Fühlen dienenden Einrichtungen des tierischen Körpers,
liegen ausnahmslos in der Haut und bestehen aus besondern
Hautzellen, welche nach innen zu mit einer Nervenfaser in
Verbindung stehen, um den empfangenen Reiz zur Wahrnehmung zu
bringen, nach außen gewöhnlich ein Haar oder sonst eine
Vorrichtung zur Erleichterung der Berührung mit einem
Fremdkörper tragen. Bei den meisten Tieren ist nicht die ganze
Haut in gleichem Maß mit Tastwerkzeugen ausgestattet, sondern
diese finden sich meist an besondern Anhängen (Fühlern,
Tentakeln, Gliedmaßen) und dann oft in großer Anzahl.
Bei den Wirbeltieren speziell sind die T. besonders entwickelt in
der Umgebung des Mundes (sogen. Barteln mancher Fische, Tasthaare
oder Schnurrhaare mancher Säugetiere) und vielfach auch an den
Händen und Füßen. Wegen der eigentümlichen
Tastkörperchen s. Haut, S. 232.
Tat, iranischer Volksstamm, welcher mit den verwandten
Guran den äußersten Westen von Iran bewohnt und dort
dieselbe Stelle einnimmt wie die Tadschik im äußersten
Osten. Sie treiben Ackerbau in der Provinz Baku, wohin sie unter
den Sassaniden aus Aserbeidschân eingewandert sein sollen,
die Guran im Zagros. Die Sprache beider Völker nähert
sich dem Persischen.
Tatar-Bazardschik, Stadt in Ostrumelien, an der Maritza
und der nach Konstantinopel führenden Eisenbahn, hat starken
Reisbau und (1887) 15,659 Einw. (ca. ¼ Türken). In der
Umgegend viel Weinbau. T. wurde um 1420 von Tataren gegründet,
welche Sultan Mohammed von Brussa dorthin verpflanzte.
Tatarei (unrichtig Tartarei), im Mittelalter Name
Innerasiens, dessen gegen W. heranstürmende Horden man unter
dem Gesamtnamen der Tataren (s. d.) begriff. Später nannte man
die Kleine oder europäische T. die russischen Gouvernements
Krim, Astrachan und Kasan, im engern Sinn aber insbesondere die
Krim und die Gegenden am untern Dnjepr und Don. Die Große
oder asiatische T., seit dem 13. Jahrh. von ihrem Beherrscher, dem
Sohn Dschengis-Chans, auch Dschagatai genannt, führt jetzt in
den geographischen Werken den allgemeinen. Namen Zentralasien (s.
d.), teilweise auch Turkistan (s. d.). Die Namen chinesische oder
Hohe T. für das östliche und Freie T. für das
westliche (russische) Turkistan sind jetzt außer
Gebrauch.
Tataren, ursprünglich Name eines mongol.
Volksstammes, der aber im weitern Verlauf nicht nur auf die
Mongolen überhaupt, sondern infolge des politischen
Übergewichts, welches dieselben nach Dschengis-Chan in Asien
besaßen, auch auf die ihnen unterworfenen verwandten
Völker übertragen ward. Gegenwärtig bezeichnet man
mit dem Namen T. einen Zweig des uralaltaischen Volksstammes, der
von den Gestaden des Mittelländischen und Schwarzen Meers bis
an die Ufer der Lena in Sibirien eine Reihe von Völkerschaften
umfaßt, als: die Jakuten, die nordöstlichsten Glieder
des Zweigs, an der Lena; die Buruten oder schwarzen Kirgisen, im
chinesischen Turkistan; die Kirgisen oder Kasak (in drei Horden);
die Uzbeken, von Bochara bis zum Kaspischen Meer; die Turkmenen,
südlich vom Oxus bis Kleinasien; die Karakalpaken,
südlich vom Aralsee; die Kumüken, im nordöstlichen
Kaukasus; die Osmanen, die türkischen Bewohner der
europäischen Türkei und teilweise Kleinasiens, und die T.
im engern Sinn. Die letztern werden nach ihrer Lebensweise als
ansässige und nomadisierende T. unterschieden. Ihre Zahl wird
geschätzt auf 1,200,000 im europäischen Rußland,
100,000 im Kaukasus und 70,000 in Sibirien; sie sind alle
Mohammedaner. Die Kasanschen T. haben durch ihre Vermischung mit
Finnen und Russen ihren mongolischen Typus mehrfach
eingebüßt; sie zeichnen sich durch Nüchternheit,
Gastfreiheit und Arbeitsamkeit aus, sind sehr begabt, können
alle lesen und schreiben und ernähren sich vorzugsweise durch
den Handel; ihre Zahl wird auf 450,000 angegeben. Die Krimschen T.
werden in Steppen- und Bergtataren eingeteilt, von denen die
erstern den mongolischen Typus recht rein erhalten haben. Sie
beschäftigen sich vorzugsweise mit Viehzucht, namentlich
Schafhaltung; einige unter ihnen bauen auch Tabak, Arbusen und
Melonen. Der Reichtum der Bergtataren besteht in Frucht- und
Obstgärten. Ihr häusliches Leben ist durch Sauberkeit und
Ordnungsliebe ausgezeichnet. Ihre Zahl wird auf 250,000
geschätzt. Die stark mit Mongolen vermischten Nogaiischen T.
oder Nogaier wohnen, 50,000 Seelen stark, zwischen dem Schwarzen
und dem Kaspischen Meer an den Flüssen Kuban, Kuma, Wolga und
in der Krim. Die Sibirischen T. sind zum größten Teil
ansässig, nur ein kleiner Teil nomadisiert. Ein Hauptstamm
derselben sind die Tureliner, aus denen man die eigentlichen T. und
die nach den von ihnen bewohnten Gegenden benannten Taraischen,
Tobolskischen, Tjumenschen und Tomskischen T. unterscheidet. Zum
Teile leben sie in Städten und
534
Tataren - Tättowieren.
treiben Ackerbau, zum Teile liegen sie dem Ackerbau, der
Viehzucht und der Jagd ob. Weiter gehören zu den Sibirischen
T. die Barabiner in der Steppe Baraba zwischen Ob und Irtisch, ein
gutartiges Naturvolk, das fast ausschließlich Viehzucht und
Fischerei treibt; die Tschulymschen T., am Fluß Tschulym, die
sich schon sehr den Russen genähert haben; die Teleuten (s.
d.), Sagaer, Abakan oder Katschinzen (s. d.), Karagassen (s. d.)
und Reste der einst zahlreichen Ariver und Asanen (s. d.). S. Tafel
"Asiatische Völker", Fig. 7. Die Umbildung des Namens T. in
Tartaren wird auf ein Wortspiel König Ludwigs des Heiligen von
Frankreich zurückgeführt, der denselben von "Tartaros"
ableitete und damit die T. als der Unterwelt Entstiegene bezeichnen
wollte. Vgl. Schott, Älteste Nachrichten von Mongolen und T.
(Berl. 1846); Wolff, Geschichte der Mongolen oder T. (Bresl. 1872);
Vambery, Die primitive Kultur des turko-tatarischen Volkes (Leipz.
1879); Derselbe, Das Türkenvolk (das. 1885); Radloff, Aus
Sibirien (das. 1884, 2 Bde.).
Tataren, irreguläre leichte Reiterei des türk.
Heers, welche im Krieg in Kleinasien aufgeboten wird. Zur
regulären Reiterei des russischen Heers gehört eine
Krim-Tatarendivision, die im Krieg zu einem Regiment von vier
Schwadronen erweitert wird. Die Bezeichnung Tatarennachricht
für unbeglaubigtes Gerücht stammt aus dem Krimkrieg, wo
ein türkischer Tatar nach der Schlacht an der Alma die
unrichtige Nachricht vom Fall Sebastopols brachte.
Tatargebirge, s. Sichota Alin.
Tatargolf (Tatarischer Sund), Meerenge zwischen dem
asiatischen Festland (sibirische Küstenprovinz) und der Insel
Sachalin, welche das Japanische mit dem Ochotskischen Meer
verbindet. Seine schmälste Stelle, die Mamiastraße,
wurde nach dem Seefahrer Mamia Rinzo benannt, welcher 1808 eine
Karte des Golfs verfaßte.
Tatarka, pelzverbrämte niedrige Tuchmütze mit
viereckigem Deckel, 1860 in Osterreich bei den Ulanen
eingeführt, wurde 1876 durch die Czapka (s. d.) ersetzt.
Tati, Missionsstation in Südafrika am
Flüßchen T., unter 21° 50' südl. Br. und
27° 50' östl. L. v. Gr. Der Distrikt wurde bekannter durch
die hier 1868 von Mauch entdeckten goldreichen Quarze.
Tatianus, christlicher Apologet des 2. Jahrh., angeblich
ein Assyrer, wurde durch Justinus Martyr zum Christentum bekehrt,
wandte sich aber nach dem Tod seines Meisters
dualistisch-gnostischen Lehren zu und erwarb sich eine streng
asketische Anhängerschaft. Erhalten ist von ihm eine 176
geschriebene "Oratio ad Graecos" (hrsg. von Otto im "Corpus
Apologetarum", 6. Abteil., 3. Ausg., Jena 1882, und von Schwartz,
Leipz. 1888). Über das von ihm verfaßte "Diatessaron" s.
Evangelienharmonie. Vgl. Daniel, T. der Apologet (Halle 1837);
Zahn, Forschungen zur Geschichte des neutestamentlichen Kanons, Bd.
1 (Erlang. 1881).
Tatihou, franz. Insel, s. Saint-Vaast.
Tatischtschew, Wasilij Nikitisch, russ. Staatsmann und
Schriftsteller, geb. 19. Febr. 1686, entstammte der Schule Peters
d. Gr., machte mehrere Reisen ins Ausland, war unter anderm als
Diplomat in Schweden und als Aufseher des Bergwesens in Sibirien
thätig, bekleidete 1741-45 den Posten eines Gouverneurs von
Astrachan und starb 15. Juli 1750. Er regte zu großen
wissenschaftlichen Unternehmungen an, sammelte das Material zu
einer geographisch-historischen Encyklopädie Rußlands
(hrsg. Petersb. 1793) und schrieb eine mehrbändige Geschichte
Rußlands, welche erst nach seinem Tod (1769-1848, 5 Bde.)
gedruckt wurde. Vgl. Pogow, T. und seine Zeit (Mosk. 1861,
russ.).
Tatius, Titus, nach der Sage König der Sabiner in
Cures, zog wegen des von den Römern an den Sabinerinnen
begangenen Raubes gegen Romulus, besetzte den Quirinalischen und
sodann den Kapitolinischen Berg und beherrschte nach erfolgter
Aussöhnung gemeinsam mit Romulus den Doppelstaat der
Römer und Quiriten, in welchem die zweite Tribus nach ihm
Tatienses oder Titienses genannt ward, bis er bei einem feierlichen
Opfer zu Lavinium von Laurentern, die er beleidigt hatte,
erschlagen ward.
Tatowieren, s. Tättowieren.
Tátra (Hohe T.), s. Karpathen, S. 557.
Tátra-Füred, Badeort, s. Schmeks.
Tatteln (Törteln, Terteln, Derdeln), Spiel unter
zweien mit Pikettkarte, dem Pikett sehr ähnlich. Jeder
erhält 9 Blätter, dann wird Atout aufgeschlagen, und der
Rest der Karten bleibt als Talon, von welchem nach jedem Stich
abgehoben wird. Kartenordnung ist im Nichtatout As, Zehn,
König, Dame etc., im Atout aber Bube, Neun, As, Zehn,
König, Dame. Man zählt nicht Stiche, sondern Augen. As
zählt 11, die Zehn 10, König 4, Dame 3, Bube 2, Atoutbube
aber 20 und Atoutneun 14. Vor dem Ausspiel finden Ansagen statt,
wie im Pikett. Sequenz von drei Blättern heißt "Tattel"
und zählt, sobald der Gegner keine höhere hat; Sequenz
von 4 Blättern heißt "Quart", von 5 Blättern
"Fuß". Eine Quart zählt nicht nur als solche, sondern
auch als zwei Tattel, ein Fuß ebenso als drei Tattel und zwei
Quarten. Drei gleiche Figuren werden von vier gleichen (wenn auch
niedrigern) überboten, sonst schlägt das höhere
Gedritt und Geviert das niedere des Gegners. Die Zehn nimmt bei den
Sequenzen und Kunststücken ihren natürlichen Platz ein.
Farbebekennen wird erst nach Erschöpfung des Talons, in den
letzten 9 Stichen, obligatorisch. Die Atoutsieben raubt. Wer von
den letzten 9 Stichen gar keinen erhält, muß den Matsch
zahlen. Der letzte Stich zählt, auch wenn er leer ist, an sich
10 Points. Bezüglich der Berechnung der Sequenzen und
Kunststücke sowie der Pointszahl, bis zu der man die ganze
Partie spielt, vgl. Pikett. T. kann übrigens auch ohne
Trumpfwahl gespielt werden.
Tattesall (fälschlich Tattersall), Sammelpunkt
für die Freunde des Sports in London, hat seinen Namen von
Richard Tattesall, Training-groom des Herzogs von Kingston, welcher
1795 an der südwestlichen Ecke des Hydeparks ein Etablissement
zur Ausstellung und zum Verkauf von Pferden begründete. Durch
den Enkel Tatesalls wurde das sehr erweiterte Etablissement 1865
verlegt. Ähnliche Einrichtungen in Paris, Berlin etc. haben
denselben Namen angenommen.
Tatti, Jacopo, Bildhauer, s. Sansovino 2).
Tättowieren (richtiger Tatowieren, v. tahit. tatau),
der Gebrauch, gewisse Stoffe, zumal Kohle, in Form von Ruß
oder Tusche (in Europa vielfach Schießpulver) auf
mechanischem Weg, durch Stechen mit Dornen und Nadeln oder durch
Einreiben in die durch Muscheln oder Zähne geritzte Haut eines
Menschen einzuführen, um dadurch möglichst
unvergängliche Zeichnungen hervorzubringen, findet sich bei
beinahe sämtlichen Völkern, den wilden sowohl als den
zivilisierten, der Erde. Er ist vorwiegend auf den Wunsch der
Betreffenden, sich zu verschönern und zu verzieren,
zurückzuführen. Verschiedentlich, zumal da, wo das T. von
Priestern ausgeübt wird sind mit
535
Tatu - Tauben.
demselben Begriffe meist religiöser Art verknüpft, die
ursprünglich nichts mit demselben zu thun haben. Wegen der mit
dem T. verbundenen Schmerzen wird dasselbe bei beiden Geschlechtern
häufig als eine der vielsach grausamen Zeremonien bei der
Feier der eingetretenen Pubertät vollzogen. Es entwickelt sich
auch zum Stammes- oder Häuptlingsabzeichen und kann mehrfach
als ein Ersatz für Kleidung betrachtet werden. Völker mit
dunkler Hautfarbe, wie Neger, Melanesier und Australier, ziehen dem
T. den Gebrauch vor, den Körper mit Narben zu zieren, die auf
der schwarzen Haut, oft künstlich vergrößert,
besser zur Geltung kommen als die dunkelblauen Zeichnungen der
Tättowierung. Zum T. der roten Farbe wird meist Zinnober
verwendet. In der Südsee ist die Sitte des Tättowierens
durch den Einfluß der Missionäre im Aussterben, dagegen
in Hinterindien, Laos, Birma etc., noch lebhaft im Schwange; in
Japan neuerdings verboten. In Europa ist das T., allerdings meist
nur auf einzelne Figuren und Symbole beschränkt, bei Reisenden
aller Gesellschaftsklassen, dann bei Matrosen, Soldaten und
Handwerkern in hohem Grad beliebt und verbreitet. Vgl. Wuttke, Die
Entstehung der Schrift (Leipz. 1872); Lacassagne, Les Tatouages
(Par. 1881); Joest, T., Narbenzeichnen und Körperbemalen
(Berl. 1887).
Tatu, s. Gürteltier.
Tatzmannsdorf (ung. Tarcsa), besuchtes Frauenbad im
ungar. Komitat Eisenburg, an der steirischen Grenze, unweit
Steinamanger, mit einem alkalisch-glaubersalz-eisenhaltigen
Säuerling. Vgl. Thomas, Tatzmannsdorf (Wien 1885).
Tau (Tagh, türk.), Gebirge.
Tau (Seil), s. Tauwerk.
Tau, derjenige wässerige Niederschlag (oder
Ausscheidung eines Teils des in der Atmosphäre enthaltenen
Wasserdampfes), welcher durch eine Erkaltung der an der
Erdoberfläche befindlichen Körper bewirkt wird. Die
Temperatur, bei welcher die Luft mit Wasserdampf gesättigt
ist, d. h. so viel Wasserdampf enthält, als diese Temperatur
zuläßt, nennt man den Taupunkt. Sobald die Temperatur
der an der Erdoberflache zunächst gelegenen Luftschichten
unter den Taupunkt gesunken ist, fängt der Wasserdampf an, aus
ihnen ausgeschieden zu werden und sich in Gestalt kleiner
Wasserkügelchen oder Tauperlen auf die abgekühlten
Gegenstände zu legen. Im gewöhnlichen Leben sagt man:
"der T. fällt"; aber dies ist nach der obigen Erklärung
der Taubildung nicht richtig. Eine für diese genügend
starke Abkühlung der untern Luftschichten tritt jedesmal ein,
so oft bald nach Sonnenuntergang, besonders während der Nacht
und am frühen Morgen, eine kräftige
Wärmeausstrahlung der Erdoberfläche stattfinden kann;
hierzu gehören vor allem klarer Himmel, ruhige Luft und eine
Bodenbedeckung, die leicht ihre Wärme abgibt, z. B.
Rasenflächen und Blätter der Pflanzen. Glänzende und
metallische Gegenstände sowie überhaupt Körper mit
geringem Strahlungsvermögen (s. Wärme) sind für
Taubildung weniger geeignet. Alles, was die nächtliche
Strahlung hindert oder vermindert, wie z. B. ein bedeckter Himmel,
hindert oder vermindert auch die Taubildung. Auch wird eine
Taubildung verhindert oder wenigstens erschwert, wenn die Luft
bewegt ist, weil dann stets von neuem warme Luft mit dem
abgekühlten Erdboden in Berührung kommt und sich dieselbe
daher nicht bis zum Taupunkt abkühlen kann. Ganz besonders
stark ist die Taubildung in den tropischen Gegenden, wo die Luft
viel Wasserdampf enthält und durch die Wärmestrahlung
eine sehr starke Abkühlung erfährt. Das Drosometer, ein
zum Messen des Taues bestimmter Apparat, enthält eine an einer
feinen Zeigerwage befindliche, mit feiner, flockiger Wolle bedeckte
Platte, die sich in der Nacht mit T. bedeckt, und deren
Gewichtszunahme die Taustärke angibt. Die auf diese Weise
erhaltenen Resultate entbehren aber vorläufig noch der
notwendigen Genauigkeit. Wenn der Körper, an welchem sich der
kondensierte Wasserdampf absetzt, unter 0° erkaltet ist, so
kann dieser nicht die flüssige Gestalt annehmen, sondern
erhält die Form von Eisnadeln und bekommt dann den Namen Reif
(s. d.), so daß letzterer nichts andres als gefrorner T.
ist.
Taub, von Gesteinen, s. v. w. keine nutzbaren Mineralien
enthaltend, unhaltig.
Taubahnen, s. Straßeneisenbahnen, S. 377.
Taube Kohle, s. Anthracit.
Tauben (Columbidae, hierzu Tafel "Tauben"), Unterordnung
der Taubenvögel (s. d.). Die große Holz-, Kohl-, Wald-
oder Ringeltaube (Columba Palumbus L.), taubenblau, Kopf u. Brust
rötlichblau, Hals grünlich und purpurn schillernd, an
jeder Seite mit großem, weißem Fleck, Flügel
graublau mit breitem, weißem Streifen am Bug,
Unterrücken und Steiß hellblau, Schwanz mattschwarz, mit
hellerer Querbinde und großem, weißem Fleck, Unterseite
hell graublau, Hinterleib weiß, ist 43 cm lang, findet sich
in ganz Europa und einem großen Teil Asiens, nährt sich
von Getreide und Grassämereien, Schnecken, Regenwürmern,
vorzugsweise aber von Nadelholzsamen, auch Eicheln und Bucheln, im
Sommer von Heidelbeeren u. a. Sie nistet in Nadelholzdickicht,
niedrig oder hoch, auf allerlei Bäumen. Obwohl überaus
scheu und vorsichtig, wohnt sie zuweilen doch inmitten volkreicher
Städte auf den Bäumen der Anlagen, so in Stuttgart und
namentlich in Paris, wo sie zutraulich und dreist von den
Spaziergängern sich füttern läßt. Die kleine
Holz- oder Hohltaube (C. Oenas L.), mohnblau, Kopf aschgraublau,
Hals wie bei der vorigen schillernd, Oberrücken dunkler
graublau, Schwingen schieferblau, nur mit reihenweise stehenden,
schwarzen Flecken, kein Weiß im Flügel, Brust
rötlichgrau, Unterleib schwach rötlich aschgrau, ist etwa
32,5 cm lang. Verbreitung wie die vorige; sie nistet jedoch nur in
Baumhöhlungen und wird, weil diese überall mangeln, immer
seltener. Zugvogel. Die Felsentaube (C. livia L.. s. Tafel
"Tauben", Fig. 1), oberhalb aschgraublau, unterhalb mohnblau, Kopf
hell graublau, Hals wie bei den vorigen metallisch schillernd,
Schwingen aschgrau und Flügel mit zwei schwarzen Binden,
Unterrücken rein weiß, Schwanz dunkel graublau, mit
schwarzem Endsaum, die beiden äußersten Federn mit
weißem Endsaum, Auge hellgelb, Schnabel schwarz,
Füße rot, 34 cm lang, findet sich in fast ganz Europa,
Asien und Nordafrika, doch nur, wo es Felsen gibt, in deren
Höhlungen oder auch in den Löchern alten Gemäuers
sie nistet. Man unterscheidet zwei Varietäten mit weißem
und blauem Unterrücken und nennt letztere auch Bergtaube (C.
glauconotos Br.). Sie nährt sich vorzugsweise von Getreide und
Samen der Vogelwicke und andern Unkräutern. Sie soll die
Stammmutter aller Haustaubenrassen sein. Die Turteltaube (C. Turtur
L.), oberhalb rötlich braungrau, schwarz und aschgrau
gefleckt, Stirn weißlichgrau, Oberkopf und Hals graublau,
letzterer mit vier schwarzen, weiß gesäumten
Querstreifen, Flügel schwärzlich aschgrau, Kehle und
Oberbrust weinrot, ganze Unterseite rötlich graublau,
Hinterleib gräulichweiß, 28,6 cm lang, findet sich in
fast ganz Europa und Asien, besonders in Nadelholz-
536
Tauben (Haustaubenrassen).
wäldern, wandert, wie die vorige, südwärts. Sie
nistet auf mittelhohem Gebüsch, nährt sich namentlich von
Erbsen, Linsen, Wicken und wird vielfach in Käfigen gehalten.
Die Lachtaube (C. risoria L.), blaß rötlich
gelbweiß, mit halbmondförmigem, schwarzem Fleck am
Hinterhals, unterseits heller, Schnabel schwarz, Augen hellrot,
Füße karminrot, 31,2 cm lang, bewohnt Afrika, Mittel-
und Südasien. Außer dem Girren hat sie besondere Laute,
welche menschlichem Lachen einigermaßen ähneln, daher
der Name. Die Wandertaube (C. migratoria L., Ectopistes migratorius
L.), oberhalb schieferblau, unterhalb rötlichgrau, Hals
violettrot schillernd, Schwingen schwärzlich, weiß
gesäumt, Schwanzfedern schwarz, an beiden Seiten hellgrau,
weiß gespitzt, Bauch und Hinterleib weiß, Schnabel
schwarz, Augen und Füße rot, 42,4 cm lang, bewohnt fast
ganz Amerika, vorzugsweise das östliche Nordamerika. Sie
wandert im Herbst und Frühjahr in ungeheuern Schwärmen,
welche in früherer Zeit in angebauten Gegenden großen
Schaden verursachten, gegenwärtig aber durch die
unausgesetzten Verfolgungen sehr stark zusammengeschmolzen sind.
Audubon schätzte den wöchentlichen Bedarf eines
Wandertaubenzugs auf 1,712,000 Scheffel Sämereien und seine
Verbreitung auf einen Raum von 8-10 engl. Meilen, während
seine Brutplätze bei einer Verbreitung von 4-5 engl. Meilen
sich 50 Meilen weit durch die Wälder ziehen sollten, so
daß man auf manchen Bäumen 50-100 Nester fand. Von den
fremdländischen T. gelangen 70 Arten lebend in den Handel und
werden zum Teil als Stubenvögel gehalten.
Haustauben. (Vgl. beifolgende Tafel "Tauben".)
Unsre Haustauben stammen wahrscheinlich von der Felsentaube ab,
von welcher manche unsrer Feldflüchter kaum zu unterscheiden
sind. Die Domestizierung derselben reicht ins graue Altertum
zurück. Inder und Ägypter hatten bereits besondere
Rassen. Auch in neuerer Zeit blüht die Taubenzucht im Orient.
Eine völlig befriedigende Einteilung der Haustauben scheint
noch nicht gefunden zu sein. Die neuern Taubenkundigen
("Peristerologen") verteilen die gegen 10 Rassen mit etwa 80
Unterrassen oder Schlägen unter 4 oder 5 Hauptgruppen.
I. Feld- oder Farbentauben. Im Bau und in der Haltung der wilden
Felsentaube ähnlich, ist Färbung des Gesamtgefieders oder
einzelner Teile entscheidend. Sie neigen mehr oder weniger zum
Felden. Von den etwa 25 Rassen nebst vielen Farbenschlägen
sind die schönsten und beliebtesten: Eistaube, Porzellantaube,
Lerchentaube, Starhals, Blässentaube, Pfaffentaube,
Mäusertaube, Mönchtaube, Deckeltauben, Flügeltauben,
Schwingentauben, Schnippentaube, Farben- (Mohren-) Köpfe,
Elstertaube, Hyacinthtaube, Viktoriataube, Strasser u. a. Bei
vielen der genannten Rassen gibt es Farbenschläge, d. h. die
gefärbten Teile kommen in den vier Hauptfarben (Blau, Schwarz,
Rot, Gelb) oder in verschiedenen Nebenfarben (Mischungen aus den
Hauptfarben) vor; ebenso verschiedene Kopf- und
Beinbefiederungsarten (Haube, Kuppe, Doppelkuppe, Latschen etc.).
Zur II. Gruppe, welche sich durch eigentümliche Stimme
(Trommeln) auszeichnen, gehören die drei Rassen der
Trommeltauben (Trompeter), die Altenburger (Fig. 3), Russische und
Bucharische (Fig. 2).
Die III. Gruppe enthält die durch besondere Federstruktur
des Gesamtgefieders (Locken- [Fig. 4l oder Strupptaube) oder
einzelner Teile desselben (Mähnentaube, Perückentaube
[Fig. 10], Möwentaube) oder zugleich auch durch
größere Anzahl der Schwanzfedern, Haltung derselben und
des Halses (Pfautaube [Fig. 14 u. 15]) gekennzeichneten. Unter den
Lieblingen dieser Gruppe, den Möwentauben (Fig. 11, 12 u. 13),
sind die orientalischen (Sattinetten, Blondinetten, Turbitins)
Muster der Züchtungskunst in Bezug auf Reinheit der
Färbung und Zeichnung.
Die IV. Gruppe, die der Formtauben, begreift drei sehr
voneinander verschiedene Unterabteilungen.
1) Die Huhntauben zeigen in Körperform und Haltung
große Ähnlichkeit mit den Hühnern: länglicher,
spitz zulaufender Kopf, großer, huhnartig gebauter und
getragener Rumpf und Schwanz, S-förmig gebogener Hals, kurze
Flügel, starke, hohe, glatte Beine. Hauptrassen sind: die
Malteser T., die Florentiner, die Monteneur, die Modeneser T.
2) Die Kropftauben (Kröpfer) zeichnen sich durch kleinen
Kopf, langen Hals, schmalen Rumpf, lange, schmale Flügel,
langen Schwanz, langen, dünnen Schenkel und Lauf (glatt oder
bis auf die Zehen herab befiedert) und durch den riesigen Kropf
aus, den möglichst hervorzuheben der lange, schlanke Korperbau
sehr geeignet ist. Man kennt gegen 15 nach den Züchtungsorten
benannte Rassen und Unterrassen. Englische (Fig. 16),
Französische (Fig. 17), Pommersche, Sächsische,
Brünner (Fig. 18), Prager etc.
3) Warzentauben (Schnabeltauben), Kennzeichen: kurzer dicker
oder langer kegelförmiger oder stark nach unten gebogener
Schnabel, mit kleinen bis walnußgroßen Warzen an der
Basis des Oberkiefers und fleischigen Warzenringen um die Augen,
welche bei einigen Rassen den Schädel überragen. Zehn
Rassen mit 8-9 Unterrassen: Lang-, krumm- und kurzschnäbelige
Bagdetten, Berbertauben, Römische T., Montaubantauben,
Belgische Brieftauben. Die englische Bagdette (Karrier, Fig. 19),
mit großen, häßlichen Schnabel- und Augenwarzen,
bei der vom Taubenkopf kaum noch etwas übrig ist, gilt in
England als die Königin der T., für "bezaubernd". Andre
Rassen sind der Englische Dragoner, die Französische Bagdette,
die bogenschnäbelige Nürnberger (Fig. 20), die
kurzschnäbelige Türkische, die Berbertaube (Indianer,
Cyprische Taube, Fig. 2l) und die Römische Taube (Fig.
22).
V. Gruppe, Flugtauben, d. h. Tümmler und Purzler. Das
gemeinsame Kennzeichen dieser beliebten und rassenreichsten ist bei
übrigens verschiedener Kopf- und Schnabelform der
eigentümliche Flug. Sie steigen hoch in die Luft und
überschlagen sich (purzeln) beim Herabfliegen weniger oder
öfter, zuweilen bis auf den Boden herab, manche Rassen auf dem
Boden selber. Man teilt die Tümmler in flachstirnige
Langschnäbel (8 Rassen mit 6-7 Unterrassen, meist deutscher
Zucht), flach- und hochstirnige Mittelschnäbel (9 Rassen) und
in hochstirnige Kurzund Dickschnäbel (11-12 Rassen, meist
englischer und deutscher Zucht). Unter den Englischen Tümmlern
nehmen die Almonds- (Fig. 8), Bart- (Fig. 9) und
Weißkopftümmler den ersten Rang ein und werden nebst den
Kröpfern und Karriers zu hohen Preisen verhandelt. Auch unter
den deutschen, österreichischen und dänischen Rassen
(Berliner [Fig. 6], Danziger, Stralsunder, Braunschweiger,
Hannoveraner, Königsberger, Altstämmer, Wiener, Prager,
Pester, Kopenhagener, Kalotten [Fig.5], Nönnchen [Fig.7],
Elster etc.) gibt es eine Menge sehr schöner und wertvoller
T.
Haltung und Zucht der T. Die wirtschaftlichen Zwecken dienende
Taubenzucht, für welche nur die Feld- oder Farbentauben zu
empfehlen sind, ist eine sehr einfache. Der einfachste
Taubenschlag, womöglich hoch gelegen, und jede gegen die
Unbilden der
TAUBEN.
1. - Felsentaube. -
2. Bucharische Trommeltaube. -
3. Deutsche Trommeltaube. -
4. Lockentaube. -
5. Kalotte. -
6. Berliaer altstämmiger Tümmler. -
7. Nönnchen. -
8. Almond. -
9. Barttümmler. -
10. Perückentaube. -
11. Ägyptisches Möwchen. -
12. Chinesisches Möwchen. -
13. Deutsches Möwchen. -
14. 15. Pfauentaube. -
16. Englischer Kröpfer. -
17. Französischer Kröpfer. -
18. Brünner Kröpfer. -
19. Karrier. -
20. Deutsche Bagdette. -
21. Cyprische Taube. -
22. Römische Taube. -
23. Antwerpener Brieftaube. -
21. Lütticher Brieftaube.
Zum Artikel »Tauben«.
537
Tauben (Taubenzucht, Brieftauben).
Witterung einigermaßen schützende Einrichtung,
Fütterung zur Zeit des Nahrungsmangels (Wicken, Gerste und
andre Sämereien), reines Trinkwasser und alter
Kalkmörtel, allenfalls das Unschädlichmachen eines
boshaften Taubers ist im allgemeinen alles, was das Gedeihen des
Feldflüchters verlangt. Weit schwieriger ist Haltung und
Züchtung der Rassetauben. Geräumige, für die
verschiedenen Rassen geeignete, den Mäusen und Raubtieren
unzugängliche, warme und reinlich gehaltene Schläge,
passende Nester, reine Luft, gesunde Nahrung, oft erneuertes
Trinkwasser sind unerläßliche Vorbedingungen. Sorge
für Pfleger (Ammen) solcher Rassen, welche ihre Jungen nicht
selber füttern können (Kurzschnabeltümmler, Berber,
Kröpfervarietäten, Karriers). Stete Beaufsichtigung der
brütenden und atzenden Paare etc.; richtige Paarung, eine
nicht leicht zu erwerbende Kunst.
Die wichtigsten Krankheiten der T. sind: diphtherische
Schleimhautentzündung (Geflügeltyphoid), Unverdaulichkeit
oder Schwerverdaulichkeit, Darmkatarrh (Durchfall), der Katarrh der
Nase oder der Luftsäcke, durch Schimmelpilze hervorgerufene
Lungenentzündung, Verstopfung des Kropfes, Rachitis,
Vergiftungen durch Bleipräparate, Geflügelpocken
(Gregarinen-Epithelium). Von den Hautleiden haben das
Schmarotzertum der Vogelmilben und Flöhe sowie der Kopfgrind
und das allgemeine Ausfallen der Federn das meiste Interesse. Vgl.
Prütz, Die Krankheiten der Haustauben (Hamb. 1886). Die sogen.
feinen Rassen sind viel häufiger Krankheiten ausgesetzt als
die gewöhnlichen. Zur Vermeidung von Erkrankungen sorge man
für gute Ventilation, vermeide Überfüllung, Zugluft,
zu große Hitze und Kälte des Schlags, gebe nur bestes
und reichliches, aber nicht überreichliches Futter, im Sommer
täglich dreimal frisches, reines Wasser und halte auf
peinlichste Reinlichkeit des Schlags, der Nester und aller
Utensilien; im Sommer tägliche Reinigung des Schlags. Man
vermeidet durch diese Vorbeugemittel die ganze Reihe von meist
gefährlichen Krankheiten der Atmungs- und Verdauungsorgane,
der rheumatischen und andrer Übel. Auf Erkrankung darf man
schließen, wenn die Flügel schlaff herabhängen, der
Schnabel geöffnet, die Zunge und die Mundhöhle trocken
oder mißfarbig sind, ein Ausfluß aus Schnabel und Nase
vorhanden, die Augen entzündet, die Exkremente zu dünn,
grünlich oder zu konsistent und selten sind oder
gänzliche Verstopfung eingetreten ist. Die erkrankten Tiere
sind sofort von den gesunden zu trennen und abgesondert und warm zu
halten. Wenn es sich nicht um besonders wertvolle Tiere handelt,
ist von meist lange dauernden und erfolglosen Kurversuchen lieber
abzusehen; Käfige und sonstige infizierte Räumlichkeiten
sind zu desinfizieren, die gestorbenen oder getöteten Kranken
zu verbrennen oder tief zu vergraben. Unter den geflügelten
Feinden der T. sind Taubenfalke, Habicht und Sperber die
gefährlichsten; gegen Katzen, Marder, Iltis, Wiesel, Ratten
und Mäuse kann man die Schläge von vornherein
schützen; gegen die parasitischen, zum Teil verderblichen
Insekten hilft sorgfältigste und oft wiederholte Reinigung der
Schläge, Nester etc., tägliche Wegnahme des Mistes,
Bestreuung des Bodens mit Asche, Tabaksstaub, des Gefieders mit
persischem Insektenpulver, Einreiben mit verdünntem
Anisöl. Der Nutzen der wirtschaftlichen Taubenrassen wiegt den
Schaden bedeutend auf. Junge und Alte liefern eine gesunde,
leichtverdauliche Speise für Kranke und Genesende und bilden
im Sommer oft die einzige Fleischkost auf dem Land oder einen
einträglichen Marktartikel. Die Gewinnung des Düngers,
dessen Wert für Garten- und Feldbau man höher
schätzen gelernt hat, ist im Orient einziger Zweck der
Taubenhaltung (rings um Ispahan zählt man über 3000
Taubentürme). Franzosen und Italiener ziehen ihn zu
gärtnerischen Zwecken dem Guano vor. Den angeblichen Schaden
an Sämereien, gerade zur Saatzeit, hat man auf Grund
genauester Untersuchungen (Snell hat jahrelang Körner und
Vogelwickensamen in Kropf und Magen gezählt [in einer jungen
Taube 3582], die T. auf seine Äcker gelockt und die besten
Getreideernten erhalten) als großen Vorteil erkannt. de Vitey
und Befroy erachten die Zerstörung der gegen 50,000
Taubentürme in Frankreich durch die Revolution von 1789 als
Nationalunglück. Der wirkliche Schade an Mehl- und
Ölfrüchten zur Zeit der Ernte kommt dagegen nicht in
Betracht.
Brieftauben.
Als Stammeltern der Brieftaube gelten der Karrier und die von
ihm zunächst gezüchtete Drachentaube, dann die Feldtaube,
das Möwchen und der Tümmler. Man unterscheidet wohl 3
oder 4 mehr oder minder ausgeprägte Brieftaubenrassen,
namentlich die Antwerpener (Fig. 23), die Lütticher (Fig. 24)
und die Brüsseler, welche aber in neuester Zeit wieder
weitergebildet wurden, so daß gegenwärtig eine
große Mannigfaltigkeit vorhanden ist. Eine gute Brieftaube
muß aufrechte Haltung, langen Hals, breite Brust, breite und
lange Schwingen, große Muskelkraft in den Flügeln und
blaue oder dunkle Farbe besitzen; ungeduldiges, stürmisches
Benehmen gelten als besonders gute Zeichen. Zu ihrem Dienst
muß die Brieftaube angelernt werden. Während man durch
die den Brieftauben gereichte Nahrung auf Erhöhung des
Flugvermögens durch Stärkung der Muskeln wirkt,
Fettbildung aber unterdrückt, nimmt man mit den Tieren
Flugübungen vor, die ihren Orientierungssinn und ihr
Gedächtnis stählen und allmählich immer weiter
ausgedehnt werden. Natürlich lernen die Tiere nur eine
bestimmte, immer dieselbe bleibende Richtung mit Sicherheit
durchfliegen, d. h. sie müssen im stande sein, den Weg nach
ihrer Heimatsstation von einer Außenstation selbst bei Nacht
und ungünstiger Witterung (Nebel, Regen) zurückzulegen;
nicht aber kann man von ihnen das Fliegen von mehreren
Außenstationen aus verlangen oder gar, daß sie nach
einer andern als der Heimatsstation fliegen, denn nur die Sehnsucht
nach der Heimat, als ein diesen Tieren von der Natur gegebener
Instinkt, macht sie für obige Zwecke geeignet. Deshalb werden
auch die T. verschiedener Flugrichtungen stets getrennt gehalten.
Die Geschlechter sondert man voneinander nach der ersten,
spätestens zweiten Brut, um eine neue Begattung der T. zu
verhindern, welche die Täubin durch Entwickelung des Eies im
Körper reiseuntüchtig machen würde, und ferner auch,
um die Begierde zur Paarung und damit den Drang zu heben, der alten
Heimat zuzufliegen. Im Schlag macht man durch
Lattenverschlüsse Abteilungen, deren jede einzelne freie
Bewegung nach dem Flugloch und Ausflugkasten gestattet, die
untereinander aber nur durch verschließbare
Schiebethüren und Lauflöcher am Boden in Verbindung
stehen.
Das Einüben der T. für eine bestimmte Tour beginnt vom
Mai ab, nach Beendigung des Brutgeschäfts, mit Entfernungen
von 7-8 km und steigt allmählich bis zu 200 km, wobei aber die
T. erst dann in weiterer Entfernung aufgelassen werden, wenn sie
die Tour vom ersten Auflaßort in geradester Richtung und
kürzester Frist zurücklegen. Die Geschwin-
538
Tauben (Taubenpost, Kulturgeschichtliches etc.).
digkeit des Flugs der Brieftaube beträgt 60-70 km in der
Stunde, übertrifft also die der schnellsten
Eisenbahnzüge. Bei 15-20 Meilen Entfernung kommen fast
sämtliche Brieftauben unter günstigen Verhältnissen
heim, mit der zunehmenden Weite aber verringert sich ihre Anzahl.
Als Verlust auf kürzern Flügen schätzt man etwa 10
von 100 T., doch nimmt diese Zahl mit der Entfernung in steigendem
Verhältnis zu. Bei mehr als 100 Meilen Weite ist auf die
Rückkehr überhaupt nicht mehr sicher zu zählen, und
dann bleiben sonderbarerweise gerade die besten und
zuverlässigsten Brieftauben am ehesten aus. Es haben indes auf
eine Entfernung von 1600 km (Madrid-Lüttich) einige der
ausgelassenen T. ihren Heimatsschlag erreicht, und 1886 flogen von
9 Brieftauben eine von London in den Heimatsschlag zu Boston, eine
zweite erreichte New York, eine dritte Pennsylvanien. Die
Antwerpener Vereine wählen für die Konkurse eine Weite
von höchstens 200 Stunden. Wenn die Brieftaube in der Jugend
nicht zu sehr angestrengt wird, so hält sie wohl mehrere Jahre
gut aus, und man hat Brieftauben von 6, 7-10 Jahren, die noch
alljährliche Wettflüge in tüchtigster Weise
mitmachen.
Zu den Auflaßorten werden die T. in besonders
konstruierten, ihre Verpflegung zulassenden Reisekörben per
Kurier- oder Schnellzug unter Aufsicht eines Wärters
befördert. Dort angekommen, werden sie an einem freie
Übersicht gewährenden Ort bei guter Witterung, und
nachdem sie kurz vor dem Abflug noch getränkt, aber nicht
gefüttert worden, aufgelassen; zur Kontrolle ist jedes
einzelne Tier auf den Schwungfedern genau gezeichnet; an den
Schlägen aber befindet sich ein elektrischer Läutapparat,
welcher das Einspringen in den Stall dem Wärter anzeigt.
Sollen die Brieftauben für Kriegszwecke benutzt werden, so
werden sie bei der Mobilmachung aus den Festungen oder sonstigen
Heimatsstationen nach den Außenstationen verschickt und dort
interniert. Die Depeschen werden zu ihrer Beförderung auf
mikrophhotographischem Weg auf ein feines Kollodiumhäutchen
übertragen, deren sich mehrere in einem Federkiel unterbringen
lassen. Dieser wird mit einem Wachspfropfen geschlossen und an eine
Schwanzfeder der Taube angenäht; daß diese Feder, wenn
z. B. ein wenig in der Haut gelockert oder beim Zusammenstoß
mit einem Raubvogel, leicht verloren gehen kann, liegt auf der
Hand; deshalb verlangt das Befestigen der Depesche sehr geschickte
Finger, und man fertigt stets fünf T. mit der gleichen
Nachricht ab; deshalb hat man auch zu einem von den Chinesen seit
undenklichen Zeiten angewandten Mittel gegriffen, um die T. nach
Möglichkeit vor dem Anfall durch Raubvögel zu
schützen. Man befestigt nämlich an die Schwungfedern
Glöckchen von durchdringendem Ton, die von größter
Leichtigkeit sind, das Tier also nur wenig belästigen und, je
schneller die Taube fliegt, desto heller tönend, die
Raubvögel verscheuchen. Durch die Mikrophotographie ist man im
stande, den Inhalt von zwölf großen Journalen auf den
Raum eines Zwanzigpfennigstücks zu konzentrieren; das
Dechiffrieren erfolgt dann nach Vergrößerung mittels
Lupe oder Laterna magika.
Die Benutzung der Brieftauben ist sehr alt, sie findet sich bei
Chinesen, Griechen und Römern und scheint im Morgenland
niemals aufgehört zu haben. Sie blühte besonders im 12.
Jahrh. und später, seitdem der Kalif von Bagdad, Sultan Nur ed
din, die ersten wirklichen Taubenposten eingerichtet hatte. Aus dem
Orient brachten sie die Kreuzfahrer nach Deutschland, wo sie von
Burg zu Burg Nachrichten trugen. Wilhelm von Oranien (1573 und
1574) und Napoleon I. benutzten Brieftauben zur
Nachrichtenbeförderung im Krieg. Nathan Rothschild erhielt von
seinen Agenten durch die Taubenpost die neuesten Nachrichten
über Napoleons Feldzüge und benutzte dieselben zu seiner
Spekulation. Auch zwischen Paris und Brüssel haben
Bankhäuser Kurstauben unterhalten, und das Reutersche
Büreau bediente sich bis 1850 einer Taubenpost zwischen Aachen
und Brüssel. In ganz Belgien war damals bereits, wie noch
heute, die Brieftaubenliebhaberei weit verbreitet, und die ganze
milde Jahreszeit hindurch veranstaltete man allsonntäglich
Wettflüge, welche vom König und den Behörden durch
Aussetzung von Prämien unterstützt wurden. Dieser Sport
verbreitete sich auch nach Frankreich, und 1820 hatte Paris einen
Taubenwettflug. Zu großer Bedeutung gelangte die
Brieftaubenpost 1870 bei der Belagerung von Paris; man sandte dort
im ganzen 534 T. mittels des Luftballons ab, von denen etwa 100
zurückkamen. Eine Taube hat den Weg zehnmal gemacht. Auf diese
Weise wurden 60 Serien von Depeschen nach Paris hinein
befördert, und wenn diese Resultate einer improvisierten
Einrichtung auch nicht sehr glänzende waren, so hatten sie
doch für die belagerte Stadt hohen Wert und veranlaßten
die Militärbehörden nach dem Frieden zu eingehender
Berücksichtigung der Brieftaubenpost. In Frankreich errichtete
man im Jardin d'acclimatation eine Zentralzuchtanstalt und stattete
Paris und Langres derart mit T. aus, daß sie sechs Monate
lang den Verkehr mit vielen andern Stationen unterhalten
können. Taubenhäuser wurden außerdem in Vincennes,
Perpignan, Lille, Verdun, Toul und Belfort errichtet. Aus dem Mont
Valérien besteht eine Spezialschule für Trainierung
junger Tauben. Ein Gesetz verpflichtet alle Besitzer von
Brieftauben, diese im Krieg an die Regierung abzugeben, welche
dadurch einen Zuwachs von 150,000 T. erwarten darf. Ähnliche
Einrichtungen wurden seit 1872 in Deutschland getroffen. Das
gesamte Militärbrieftaubenwesen ist der Inspektion der
Militärtelegraphie, die Stationen (Köln [Zentralstelle],
Mainz, Metz, Straßburg, Posen, Thorn, Wilhelmshaven, Kiel,
Danzig) sind den örtlichen Fortifikationen oder Kommandanturen
unterstellt. Die etwa 350 Brieftaubenvereine Deutschlands,
besonders im Rheinland vertreten, werden im Krieg ihre etwa 50,000
T. der Heeresleitung zur Verfügung stellen. Nächst
Deutschland ist die Kriegstaubenpost besonders in Italien
entwickelt, und auch in fast allen andern Staaten hat man
entsprechende Einrichtungen getroffen. 1876 wurden an der
Nordseeküste, besonders in Tönning an der
Eidermündung, Versuche angestellt, um eine Verbindung der in
See liegenden Leuchtschiffe mit dem Land (55 km) durch T.
herzustellen, und in der That haben die T. bei heftigen
Stürmen die Lotsen herbeigerufen.
Die Taube ist das Symbol des Schöpfungswassers, der
Urfeuchte (der Geist Gottes schwebte über den Wassern wie eine
Taube), Regen u. Schiffergestirn, wegen ihrer Üppigkeit u.
Fruchtbarkeit der Vogel der Venus, für welchen in Syrien
Kolumbarien errichtet wurden. Babylon war die Stadt der Taube, wo
die aus einem Taubenei geborne Semiramis herrschte. Taube,
Phönix und Palme identifizierte die Hieroglyphe als Bilder der
Zeit und der Zeugung. Noch jetzt nisten Scharen wilder T.
ungestört in Mekka, und Freudenmädchen halten Korn
für dieselben feil. Auch den Israeliten war die Taube heilig,
und Jerusalem hieß ebenfalls Stadt der Taube. Die Taube war
das At-
539
Taubenerbsen - Tauberbischofsheim.
tribut Mariens, dann des Heiligen Geistes und später auch
der Apostel. Als Symbol der Auferstehung wurden T. in die
Gräber der Märtyrer gelegt, und die Grablampen (s.
Lampen, Fig. 10) sowie kirchliche Geräte (s. Peristerium)
erhielten Taubengestalt. In Rußland dürfen keine T.
getötet werden, weil sie nach dem Volksglauben die Herbergen
der Seelen Verstorbener sind. Endlich ist auch die Taube Symbol der
ehelichen Liebe und Eintracht. Vgl. Temminck und Prevost, Histoire
naturelle générale des pigeons (Par. 1808-43, 2
Bde.); Bonaparte, Iconographie des pigeons (das. 1857);
Reichenbach, Naturgeschichte der T. (Leipz. 1862); Brehm,
Naturgeschichte und Zucht der T. (Weim. 1857); Öttel,
Geflügelhof (7. Aufl., das. 1887); Neumeister, Das Ganze der
Taubenzucht (3. Aufl. von G. Prütz, das. 1876); Baldamus, Die
Tauben (Dresd. 1878); Prütz, Arten der Haustaube (3. Aufl.,
Leipz. 1878); Ders., Illustriertes Mustertaubenbuch (Hamb. 1884);
Tegetmeier, Pigeons (Lond. 1867); Fulton, The illustrated book of
pigeons (Lond. 1876); Wright, Der praktische Taubenzüchter
(deutsch, Münch. 1880); Bungartz, Taubenrassen (Leipz. 1886);
Derselbe, Brieftaubensport (das. 1888); Lorentz, Die Taube im
Altertum (das. 1886); über Brieftauben die Schriften von
Lenzen (Dresd. 1873), Ruß (Hannov. 1877), Schomann (Rostock
1883); Chapuis, Le pigeon-voyageur belge (Verviers 1866); Puy de
Podio, Brieftauben in der Kriegskunst (deutsch, Berl. 1873); Gigot,
La science colombophile (Brüssel 1889); drei Fachjournale
über Brieftauben in Brüssel und Antwerpen.
Taubenerbsen, s. Caragana.
Taubenfalke, s. v. w. Habicht oder Wanderfalke.
Taubenkropf, Pflanze, s. Fumaria und Corydalis.
Taubenmosaik, s. Mosaik, S. 817.
Taubenpost, s. Tauben, S. 538.
Taubenschießen, ein Sport von
außerordentlicher Grausamkeit, dem hauptsächlich die
vornehmen Stände huldigen. Vor dem Schießstand befinden
sich Blechkasten, deren Wände nur lose zusammengefügt
sind, so daß der Bau zusammenfällt, wenn an einem daran
befestigten Draht gezogen wird. In jeden Kasten wird eine Taube
gesteckt, die man meist vorher durch Ausreißen der Federn und
Ätzen der Wunden, Blenden auf einem oder beiden Augen, Brechen
der Knochen etc. gräßlich verstümmelt hat, damit
sie ihren Aufflug nicht kreisend, sondern gerade aufrecht oder nach
einer bestimmten Seite nimmt. Auf ein Kommandowort des
Schützen wird an dem Draht gezogen, der Kasten fällt
zusammen, die erschreckte Taube fliegt davon, und der Schütze
muß sie so zu treffen suchen, daß sie innerhalb der
Umzäunung zu Boden fällt, sonst gilt der Schuß
nicht. Anlaß zu dem grausamen Sport gab wohl der Vorwand,
sich im Treffen rasch sich bewegender Gegenstände zu
üben. Doch ist dieser Vorwand hinfällig, seitdem Bogardus
eine Vorrichtung erfunden, durch welche mittels einer Feder
Glaskugeln in die Höhe geschleudert werden, und zwar mit
derselben Geschwindigkeit wie der Aufflug einer Taube. Das T.
blüht hauptsächlich in Monaco, England und Belgien und am
Heiligen Damm bei Doberan. In Brüssel und Ostende allein
werden alljährlich etwa 35,000 Tauben dem Blutdurst einiger
vornehmer Müßiggänger geopfert. Baden, Holland und
andre Staaten haben das T. verboten. In England scheiterte ein
diesbezüglicher Gesetzentwurf an dem Widerspruch des
Oberhauses. Vgl. "Aussprüche über die Taube und den
Taubensport", gesammelt von A. Engel (Guden 1888).
Taubenstößer, s. v. w. Habicht.
Taubenvögel (Tauben, Columbae), Ordnung der
Vögel von mittlerer Größe mit kleinem Kopf, kurzem
Hals, schwachem Schnabel, mittellangen Flügeln und kurzen
Spaltfüßen. Die T. stehen den Hühnern in vieler
Beziehung sehr nahe, unterscheiden sich jedoch äußerlich
durch die Form der Flügel und des Schnabels, innerlich durch
den Besitz eines paarigen Kropfes und andre Merkmale von ihnen. Im
Gefieder fehlen zwischen den Konturfedern die Daunen völlig;
die Flügel sind (mit Ausnahme der Dodos) ziemlich lang und
zugespitzt. Der Kamm des Brustbeins ist sehr hoch. Der Schnabel ist
am Grund weichhäutig. Der Magen hat eine sehr starke
Muskelschicht, die Gallenblase fehlt; die Blindsäcke des Darms
sind sehr kurz. Die T. sind durchgängig gute, zum Teil
ausgezeichnete Flieger, aber schlechte Läufer. Zur
Brütezeit leben sie paarweise zusammen und ziehen dann
zuweilen in ungeheuern Scharen umher (Wandertaube). Das Weibchen
legt gewöhnlich 2, selten 1 oder 3 Eier in ein kunstloses
Nest; die Jungen schlüpfen fast ganz nackt aus und werden
durch elne milchartige Flüssigkeit, welche im Kropf der Mutter
abgesondert wird, die ersten Tage hindurch ernährt. Die T.
sind fast auf der ganzen Erde zu finden, haben indessen ihre
größte Artenzahl nicht auf dem Festland, sondern auf den
Inseln der Südsee sowie den Antillen, wo ihre Eier den
Nachstellungen der Vierfüßer und Raubvögel wenig
ausgesetzt sind. Fossil kennt man sie aus Frankreich und England;
in historischer Zeit ausgestorben ist der Dodo. Man unterscheidet
drei Unterordnungen: 1) Dodos oder Dronten (Dididae) mit 2
Gattungen: Didus (Dronte, s. d., von Mauritius) und Pezophaps
(Solitaire, von Rodriguez), noch im 17. Jahrh. lebend und auf den
genannten Inseln sehr zahlreich. Flügel und Schwanz
verkümmert. 2) Erdtauben (Didunculidae), nur die Art
Didunculus strigirostris von den Samoainseln umfassend, mit
gezahntem Unterschnabel, kurzem Schwanz, mäßig langen
Flügeln, starken Läufen und langen Krallen. 3) Tauben
(Columbidae) mit stets ungezahntem Schnabel. Man kennt etwa 50
Gattungen mit über 350 Arten und sondert sie in die Familien:
Gouridae (von Hühnergröße, auf dem Kopf eine
Federkrone; nur die Gattung Goura, auf Neuguinea, Java und den
Bandainseln), Caloenadidae (Lauf lang; nur die Gattung Caloenas;
Nikobaren, Philippinen, Neuguinea), Columbidae (Lauf kurz, Schwanz
mit 12 Steuerfedern) und Treronidae (Lauf kurz, Schwanz mit l4
Steuerfedern). Die beiden letztgenannten Familien sind die
Hauptvertreter der Gruppe.
Taubenweizen, s. Sedum.
Tauber, linksseitiger Nebenfluß des Mains,
entspringt an der Frankenhöhe beim Dorf Michelbach in
Württemberg aus dem Taubersee, durchfließt zunächst
zwischen Rothenburg und Mergentheim den lieblichen Taubergrund im
nordöstlichen Teil des württembergischen Jagstkreises,
tritt unterhalb Mergentheim in den badischen Kreis Mosbach, wo ihr
Thal an Tiefe zunimmt, und mündet, immer in nordwestlicher
Richtung fließend, nach 120 km langem Lauf bei Wertheim. Im
Tauberthal, namentlich im badischen Teil desselben, wird guter Wein
gebaut.
Tauberbischofsheim, Stadt im bad. Kreis Mosbach, an der
Tauber und der Linie Lauda-Wertheim der Badischen Staatsbahn, 183 m
ü. M., hat eine kath. Kirche, ein Gymnasium, eine
Präparanden-, eine Gewerbe- und eine landwirtschaftliche
Kreisschule, ein Bezirksamt, ein Amtsgericht, eine
Bezirksforstei,
540
Taubert - Taubstummenanstalten.
Schuh- und Zigarrenfabrikation, Marmorschneiderei und
-Schleiferei, eine Kunstmühle, Bierbrauerei, Weinbau und
-Handel und (1885) 3325 meist kath. Einwohner. T. war schon 725 ein
bischöflicher Hof mit Kammerkloster, welches im 13. Jahrh. in
ein Spital umgewandelt wurde. Hier 24. Juli 1866 Gefecht zwischen
den Preußen und Württembergern.
Taubert, 1) Wilhelm, Klavierspieler und Komponist, geb.
23. März 1811 zu Berlin, bezog in seinem 16. Jahr die Berliner
Universität, wo er philosophische Kollegien hörte,
zugleich aber auch unter Berger und Klein Komposition studierte,
und wirkte dann hauptsächlich als Lehrer, bis ihm 1831 die
Leitung der Hofkonzerte am Klavier übertragen wurde. Zehn
Jahre später wurde er zum Kapellmeister der königlichen
Oper ernannt, und im Winter 1842/43 rief er die Symphoniesoireen
der königlichen Kapelle ins Leben, welche er auch nach seiner
1870 erfolgten Pensionierung als Opernkapellmeister zu leiten
fortfuhr. Seit 1839 Mitglied der Akademie der Künste, wurde er
1882 zum Präsidenten der musikalischen Sektion derselben
ernannt. Als Komponist hat T. auf allen Gebieten Beachtenswertes
geleistet; von seinen dramatischen Werken verdienen die Opern: "Die
Kirmes" (1832), "Macbeth" (1857), "Cesario" (1874) sowie die auf
Veranlassung Friedrich Wilhelms IV. geschriebene Musik zur "Medea"
des Euripides und die Musik zu Shakespeares "Sturm" Erwähnung,
obwohl sie, wie auch seine zahlreichen Instrumentalwerke, nur einen
Achtungserfolg erzielten. Unbedingten Beifall haben dagegen seine
Lieder gefunden, welche (namentlich die Kinderlieder) durch den
Vortrag einer Jenny Lind, Johanna Wagner, A. Joachim und andrer
Sängerinnen ersten Ranges zu seltener Popularität
gelangten.
2) Ernst Eduard, Komponist, geb. 25. Sept. 1838 zu Regenwalde in
Pommern, studierte zu Bonn Theologie, bildete sich hier unter
Albert Dietrichs sowie später in Berlin unter Kiels Leitung in
der Komposition aus und nahm dann in letzterer Stadt seinen
Wohnsitz. Als Komponist, als Lehrer wie auch als Musikkritiker
nimmt T. in Berlin eine hervorragende Stellung ein. Unter seinen
Werken haben die für Kammermusik sowie eine große Zahl
von Liedern allgemeinen Beifall gefunden.
3) Emil, Dichter, Sohn von T. 1), geb. 23. Jan. 1844 zu Berlin,
studierte daselbst Philologie und Philosophie, wurde Lehrer am
Friedrich Wilhelms-Gymnasium, 1877 Oberlehrer am königlichen
Lehrerinnenseminar und 1886 zum Intendanturrat bei den
königlichen Schauspielen ernannt. Er veröffentlichte
außer Novellen etc. in Zeitschriften: "Gedichte" (Berl.
1865); "Neue Gedichte" (das. 1867); "Jugendparadies, Gedichte
für jung und alt" (das. 1869) und "Juventas. Neue Dichtungen
für jung und alt" (das. 1875); "Waffenklänge"
(Zeitgedichte, das. 1870). Als talentvoller Schilderer von
Naturszenen und lebendiger Erzähler bewährte er sich vor
allem in den poetischen Erzählungen: "Der Goldschmied zu
Bagdad", "Am Kochelsee" und "Die Cikade" (Leipz. 1880), denen "Die
Niobide", Novelle (das. 1880), und "Der Torso", eine
Künstlergeschichte in Versen (das. 1881), das epische Gedicht
"König Rother" (Berl. 1883) u. die Novellen: "Der Antiquar"
(das. l882),"Sphinx Atropos"(das. 1883), "Marianne" (das. 1883),
"Simson" (Gera 1886), "Laterna magika" (das. 1885) und "Langen und
Bangen" (Berl. 1888) etc. nachfolgten.
4) A., Schriftstellerin, s. Hartmann 12).
Taubheit (Surditas), die höhern und höchsten
Grade der Schwerhörigkeit (s. d.). Fälle von absoluter T.
sind selten und beruhen immer auf vollständiger Lähmung
beider Gehörnerven. Vgl. Taubstummheit.
Taubilder (Mosersche Bilder, Hauchbilder). Wenn man mit
einem trocknen, nicht abfärbenden Gegenstand auf eine ebene
Fläche schreibt, so treten die unsichtbaren Schriftzüge
hervor, sobald man auf der Fläche durch Anhauchen eine zarte
Schicht von Wasserbläschen erzeugt, weil die Wasserdämpfe
auf den Schriftzügen anders kondensiert werden als auf der
übrigen Fläche. Legt man auf eine polierte
Metallfläche ein Petschaft, eine Münze oder einen
geschnittenen Stein, so kann man nach einigen Stunden ebenfalls
durch Anhauchen das Gepräge der Münzen auf der
Metallfläche hervorrufen. Auf einer mit Jod geräucherten
Silberplatte kann man T. mit Quecksilberdämpfen hervorbringen,
indem sich diese bald vorzugsweise an denjenigen Stellen
niederschlagen, an welchen eine Berührung stattfand, bald an
den nicht berührten Stellen. Es bedarf sogar nicht einmal der
unmittelbaren Berührung der Metallplatte und des Stempels; es
genügt, wenn letzterer in sehr geringer Entfernung über
der Platte aufgehängt wird. Moser nahm zur Erklärung
dieser Erscheinung die Existenz eines latenten Lichts an; dagegen
wies Waidele nach, daß es sich hier um Molekularwirkungen
zwischen festen und gasförmigen Körpern handelt. Jeder
feste Körper ist für sich mit einer Hülle
verdichteter Luft umgeben, von welcher er durch Glühen, durch
starkes anhaltendes Reiben oder durch Berührung mit
absorbierenden Substanzen befreit werden kann. Wenn nun ein Stempel
auf eine Platte gesetzt wird, so werden sich im allgemeinen die
Oberflächen beider Körper nicht in einem gleichen Zustand
der Reinheit befinden; an den Berührungsstellen geht also
gewissermaßen ein Austausch der Atmosphären vor sich.
Die Platte wird an der Stelle, wo der Stempel lag, je nach den
Umständen mehr oder weniger Gase verdichtet haben als an
andern Stellen, und hier werden also auch die Dämpfe
stärker oder schwächer kondensiert werden. Das Bild wird
mithin ein anderes, je nachdem der Stempel oder die Platte von
ihrer Atmosphäre gereinigt worden war, und man erhält gar
kein Bild, wenn man auf die gereinigte Platte einen gereinigten
Stempel setzt.
Täubling, Pilz, s. Agaricus III.
Taubmann, Friedrich, Gelehrter, geb. 1565 zu Wonsees bei
Baireuth, ward 1595 Professor der Dichtkunst in Wittenberg und
starb daselbst 24. März 1613. Er that viel für Belebung
der humanistischen Studien und bekämpfte mit den Waffen des
Ernstes und Spottes die Verirrungen seiner Zeit. Bekannt ist die
Sammlung seiner witzigen Einfälle und Aussprüche unter
dem Titel: "Taubmanniana" (Frankf. 1713, Münch. 1831), die
manche fremde Zuthaten enthält. Vgl. Genthe, Friedrich T.
(Leipz. 1859); Ebeling, F. T. (3. Aufl., das. 1884).
Taubnessel, stinkende, s. Ballota.
Taubsein der Glieder, s. v. w. Absterben.
Taubstummenanstalten und Taubstummenunterricht. Die für
Erziehung und Unterricht der Taubstummen bestimmten Anstalten
verdanken ihren Ursprung den seit der zweiten Hälfte des 18.
Jahrh. hervortretenden Humanitäts- und
Wohlthätigkeitsbestrebungen. Im Altertum (Aristoteles) wie im
christlichen Mittelalter (Augustinus, römisches Recht) hielt
man die Taubstummen für bildungsunfähig. Auch trug man
öfters sogar religiöse Bedenken, Geschöpfen die
Segnungen der Bildung sozusagen aufzudrängen, denen Gott die
natürliche Befähigung für
541
Taubstummenanstalten und Taubstummenunterricht.
diese Güter versagt habe. Doch wurden im Altertum wie im
Mittelalter einzelne Fälle bekannt, in denen die geistige
Ausbildung Taubstummer gelungen war. So werden im alten Rom zwei
stumme Maler genannt; um 700 n. Chr. hat nach Beda dem
Ehrwürdigen Bischof Johannes von Hagunstald (Hexham) einen
Taubstummen zum Absehen und zum Sprechen gebracht. Rudolf Agricola
(gest. 1485) berichtet als Augenzeuge, daß ein Taubstummer
zum ungehinderten schriftlichen Verkehr mit seiner Umgebung
herangebildet war. Der berühmteste der ältern
Taubstummenlehrer ist der spanische Mönch Pedro de Ponce zu
Sahagun in Leon (gest. 1584), welcher vier Taubstummen die
Lautsprache beibrachte. In Deutschland unterrichtete gleichzeitig
der kurbrandenburgische Hofprediger Joachim Pascha (gest. 1578) mit
Erfolg seine taubstumme Tochter. Zahlreicher treten ähnliche
Leistungen im 18. Jahrh. hervor, in dessen zweiter Hälfte
zuerst geordnete Anstalten für den Unterricht taubstummer
Kinder gegründet wurden. Dies geschah durch die
menschenfreundliche Thätigkeit zweier Männer, des
Abbé Charles Michel de l'Epée zu Versailles (1760,
seit 1791 Staatsanstalt) und Sam. Heinickes zu Eppendorf bei
Hamburg (1768), welch letztern der Kurfürst Friedrich August
von Sachsen 1778 zur Einrichtung einer öffentlichen
Taubstummenanstalt nach Leipzig berief. Seit jener Zeit ist die
Pflicht des Staats und der Gesellschaft, für Erziehung und
Unterricht der Taubstummen in besondern Anstalten Sorge zu tragen,
mehr und mehr zum allgemeinen Bewußtsein gekommen. Trotz
zahlreicher und großenteils gut ausgestatteter Anstalten
dieser Art ist aber dem Bedürfnis selbst unter den gebildeten
Völkern Europas noch bei weitem nicht Genüge geleistet.
Die Unterweisung eines taubstummen Kindes muß übrigens
möglichst schon im elterlichen Haus beginnen. Auch ist es
rätlich, taubstumme Kinder, ehe sie in einer Anstalt Aufnahme
finden können, in der Ortsschule an den technischen
Übungen teilnehmen und den bildenden Umgang mit vollsinnigen
Kindern genießen zu lassen.
Der Taubstummenunterricht soll zunächst und vor allem den
Taubstummen dahin bringen, daß er andre verstehe und sich
ihnen verständlich machen könne, woran sich dann Weckung
und Übung der geistigen Kräfte des Zöglings sowie
Mitteilung der nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten
anknüpfen. In dieser Hinsicht empfiehlt sich, das taubstumme
Kind so viel, wie es der natürliche Fehler zuläßt,
nach der für gesunde Kinder geltenden natürlichen Methode
zu unterrichten. Ganz besonders ist hier auch der sogen.
Handfertigkeitsunterricht, d. h. die Anleitung zu
äußern, zur sinnigen Beschäftigung wie zum
anständigen Fortkommen im bürgerlichen Leben dienenden
Fertigkeiten, am Platz. Dieser Unterricht wird in guten
Taubstummenanstalten mit besonderer Aufmerksamkeit und oft mit
überraschendem Erfolg betrieben (s. Industrieschulen). Die
für den Taubstummenunterricht in Betracht kommenden Mittel der
Verständigung sind: die Zeichen-, die Laut- und die
Schriftsprache. Zu der erstern gehören: die natürliche
Zeichen- und Gebärdensprache, auf welche sich alle Menschen,
besonders aber die Taubstummen, von Haus aus verstehen, und welche
das unentbehrliche Verständigungsmittel für den
anfänglichen Verkehr der zu unterrichtenden Taubstummen mit
dem Lehrer und untereinander ist; die künstliche, methodische
Zeichen- oder Gebärdensprache und die Finger- oder
Handsprache, bei der die Buchstaben des Alphabets durch Finger- und
Handbewegungen dargestellt werden (s. Gebärdensprache
[Fingersprache]). Die beiden letztern sind, als dem eigentlichen
Zweck der Taubstummenbildung (Befähigung des Viersinnigen zum
Verkehr in der Welt) hinderlich, heutzutage aus allen guten
Anstalten verbannt. Aber auch die (leicht überwuchernde)
natürliche Gebärde wird in Deutschland mißtrauisch
angesehen und auf das engstmögliche Gebiet beschränkt.
Bei der Laut- oder Lippensprache (Artikulation) muß der
taubstumme Schüler befähigt werden, durch aufmerksames
Beobachten der Bewegungen der Lippen, der Zunge und zum Teil auch
der Gesichtszüge den Sprechenden zu verstehen und sich andern
durch lautes Sprechen verständlich zu machen. Mit der
Lautsprache geht die Schriftsprache Hand in Hand. Zu der
Lautsprache den Taubstummen zu befähigen, ist zwar schwierig,
muß aber als die eigentliche Aufgabe des
Taubstummenunterrichts betrachtet werden; denn hat der Taubstumme
dieselbe einmal erlernt, so ist er im stande, mit der menschlichen
Gesellschaft in bewußte Wechselwirkung zu treten, wodurch
sowohl seine weitere Bildung als sein äußeres Fortkommen
ungemein erleichert wird. Da auch der ausgebildete Taubstumme weder
die eignen Worte noch diejenigen andrer hört, bringt er es
natürlich nicht zu einer klangvollen und wohlbetonten
Aussprache, wiewohl auch hierin einzelne begabtere Zöglinge
erstaunliche Fortschritte machen. Dagegen gelingt es in guten
Anstalten stets, solche Kinder, die rechtzeitig eintreten (8.-12.
Jahr) und nicht aus andern Ursachen bildungsunfähig sind, zu
einem im wesentlichen lautrichtigen und daher verständlichen
Sprechen anzuleiten. Hierin ist das Ziel angedeutet, welches sich
nach Heinickes Vorgang seit Jahrzehnten alle deutschen und
heutzutage alle gut eingerichteten Anstalten stecken. Der Sieg der
Artikulationsmethode ist namentlich durch die Beschlüsse der
internationalen Kongresse für Taubstummenwesen zu Paris (1879)
und Mailand (1880) entschieden. Heinicke hatte darin schon den
Spanier Ponce, den Schweizer Amann (in Holland um 1700) u. a. zu
Vorgängern. Der Abbé de l'Epée dagegen und nach
ihm Sicard und Guyot hatten sich für die Zeichen- und
Gebärdensprache als das hauptsächliche Mittel des
geistigen Verkehrs für Taubstumme entschieden, ohne die
Artikulation darum ganz auszuschließen. Taubstummenanstalten
gibt es gegenwärtig gegen 400, davon in Europa 340, in
Deutschland 100 und von diesen in Preußen 51. Man
schätzt die Anzahl der Taubstummen in Europa auf etwa 300,000,
wovon 60,000 im schulpflichtigen Alter, aber nur 20,000 in
regelrechter Pflege stehen. In Deutschland genießen von etwa
8000 schulpflichtigen Taubstummen gegen 6600 Anstaltserziehung,
also etwa 8.2 Proz. Dagegen wachsen hier 18, in
Großbritannien 43, in Frankreich gegen 40, in
Österreich-Ungarn gegen 70, in Rußland und andern
Ländern bis zu 90 Proz. der Taubstummen noch ohne
gehörige Bildung auf. Vgl. Hill, Der gegenwärtige Zustand
des Taubstummenbildungswesens in Deutschland (Weim. 1866);
Derselbe, Grundzüge eines Lehrplans für
Taubstummenanstalten (das. 1867); Schöttle, Lehrbuch der
Taubstummenbildung (Tübing. 1874); Walther, Geschichte des
Taubstummenbildungswesens (Bielef. 1882); Derselbe, Die
königliche Taubstummenanstalt zu Berlin (Berl. 1888); Gude,
Gesetze der Physiologie und Psychologie und Artikulationsunterricht
der Taubstummen (Leipz. 1880); Hedinger, Die Taubstummen und
Taubstummenanstalten (Stuttg. 1882); "Beiträge zur Geschichte
und Statistik der Taubstummenbildung" (Berl. 1884): Schneider und
v. Bremen, Volksschulwesen des preußischen Staats (Berl.
542
Taubstummheit - Taucherapparate.
1886-87, 3 Bde.). Zeitschriften: "Blätter für
Taubstumme" (hrsg. von Hirzel, Schwäb.-Gmünd, seit 1855),
"Organ der Taubstummenanstalten" (hrsg. von Vatter, Friedberg, seit
1855) und "Blätter für Taubstummenbildung" (hrsg. von
Walther und Töpler, Berl., seit 1887).
Taubstummheit (Aphonia surdorum, Surdomutitas),
Stummheit, durch Taubheit bedingt, ist entweder angeboren oder
während der Kindheit vor der Zeit entstanden, in welcher die
Kinder gewöhnlich sprechen lernen, nämlich vom 1. oder 2.
bis zum 6. oder 7. Jahr. Viel häufiger, als man früher
annahm, entwickelt sich Taubheit nach ansteckenden
Kinderkrankheiten, Masern und Scharlach, welche einen Katarrh des
Mittelohrs herbeigeführt haben; allmählich verlernen
solche Kinder, denen die Kontrolle der Lautbildung durch das
Gehör fehlt, auch die Sprache, und so kommt volle T. zu
stande. Die Stimmwerkzeuge sind in der Regel von Natur aus
vollkommen gebildet und bleiben nur wegen ihres unterbliebenen
Gebrauchs zum Sprechen in ihrer Ausbildung zurück; die Zunge
ist dick, schwer beweglich, nur zum Kauen und Hinabschlucken
geeignet; der kleine, nicht hervorspringende Kehlkopf
läßt nur zeitweise unwillkürliche und unangenehm
klingende Laute vernehmen; die Stimme ist rauh, unartikuliert,
näselnd und pfeifend oder springt plötzlich aus dem
Baß in den Sopran über; die Silben werden schwierig oder
gar nicht ausgesprochen, und die Artikulation ist mangelhaft. In
gebirgigen Gegenden kommt T. verhältnismäßig
häufiger vor als in den mehr ebenen, denn während sie
sich hier wie 1 zu 1300-1500 verhält, ist das Verhältnis
in der kretinreichen Schweiz wie 1 zu 175. In Sardinien, im
Schwarzwald, in Savoyen, in den Kantonen Bern, Wallis und Aargau
kommt T. nach den vorhandenen Zählungen am häufigsten
vor. Vgl. Hartmann, Taubheit und Taubstummenbildung (Berl. 1880).
Weiteres s. Taubstummenanstalten.
Taucha, Stadt in der sächs. Kreis- und
Amtshauptmannschaft Leipzig, an der Parthe und an der Linie
Leipzig-Eilenburg der Preußischen Staatsbahn, hat eine evang.
Kirche, ein Schloß, eine Korrektions- und Siechenanstalt, ein
Amtsgericht, starke Schuhmacherei, Rauchwaren-Zurichterei und
-Färberei, eine chemische Fabrik, 2 Dampfziegeleien u. (1885)
2778 Einw.
Tauchenten (Fuligulidae), Familie aus der Ordung der
Schwimmvögel (s. d.).
Taucher (Urinatores), Familie aus der Ordnung der
Schwimmvögel, umfaßt die Pinguine, Seetaucher,
Steißfüße und Alken.
Taucherapparate, Vorrichtungen, mittels welcher man
längere Zeit unter Wasser verweilen kann. Da die
geschicktesten Taucher höchstens zwei Minuten in der Tiefe
verharren, so hat man sich bemüht, Mittel zu finden, um das
Atmen unter Wasser möglich zu machen. Hermetisch
anschließende Helme, welche den ganzen Kopf des Tauchers
bedecken, gewähren nur geringe Hilfe, da die in ihnen
enthaltene Luft sehr schnell ihres Sauerstoffs so weit beraubt
wird, daß sie nicht länger eingeatmet werden kann.
Geräumige Glocken (Taucherglocken), welche mit einem Seil in
die Tiefe gelassen werden, bergen für den in ihnen sitzenden
Taucher mehr Luft; aber auch diese ist bald verbraucht. Für
längern Aufenthalt unter Wasser wurden daher die Apparate erst
geeignet, als man sie durch Röhren mit Pumpwerken in
Verbindung setzte, welche sie fortwährend mit frischer Luft
versorgten. Die Pumpe preßt ununterbrochen Luft in die
Glocke, so daß diese ganz wasserleer wird und große
Luftblasen an ihrem unteren Rand entweichen. Auf diesem Prinzip
beruhen unter anderm die großen Apparate, in welchen mehrere
Arbeiter zum Fundamentieren der Brückenpfeiler u. dgl. unter
Wasser arbeiten. Sie bestehen aus cylindrischen oder prismatischen
Gefäßen (caisons) aus Eisenblech, welche unten offen,
oben aber geschlossen sind und durch ununterbrochenes Einpumpen von
frischer Luft unter einem der Wassertiefe entsprechenden Druck
wasserfrei gehalten werden, so daß bequem, wennschon in
komprimierter Luft, darin gearbeitet werden kann. Das Ein- und
Austreten der Arbeiter erfolgt durch eine sogen. Schleuse, eine
enge Kammer, welche nach der freien Luft sowie nach dem Innern des
Caissons durch eine Thür hermetisch abgeschlossen werden kann,
so daß beim Befahren nie eine größere als dem
Inhalt der Kammer entsprechende Luftmenge verloren geht. Indem der
Grund tiefer ausgegraben wird, sinkt der Caisson immer weiter ein
und wird, wenn man auf festem Baugrund angekommen ist, mit Beton
ausgefüllt und so in einen mächtigen Steinblock
verwandelt, auf welchem dann weiter gebaut wird. Der Luftdruck,
unter welchem sich die Arbeiter befinden, beträgt 1
Atmosphäre für je 10 m Wassertiefe u. wirkt nachteilig
auf die Gesundheit (vgl. Komprimierte Luft). Der gewöhnliche
Taucherapparat, Skaphander-Apparat, besteht aus einem wasserdichten
Anzug und einem Helm, der mit der Pumpe verbunden ist, und
gestattet eine freie Bewegung des Tauchers, kann aber leicht durch
den plötzlich auf den Taucher einwirkenden Luftdruck
gefährlich werden. Beim Niedersinken enthält nämlich
die Lunge des Tauchers Luft von gewöhnlicher Spannung und wird
durch die eingeatmete komprimierte Luft zusammengedrückt.
Steigt der Taucher auf, so nimmt der äußere Druck sehr
schnell ab, und dadurch ist die Lunge der Gefahr ausgesetzt, durch
die in ihr enthaltene dichtere Luft zerrissen zu werden. Sehr
wichtig ist daher der Apparat von Rouquairol-Denayrouze, welcher
den Taucher fortwährend mit Luft, die unter gewöhnlichem
Druck in die Lungen gelangt, versorgt. Der Taucher nimmt diesen aus
zwei Kammern bestehenden und mit komprimierter Luft gefüllten
Apparat wie einen Tornister aufgeschnallt mit sich in die Tiefe.
Die eine Kammer wird vermittelst eines Schlauchs direkt durch die
Luftpumpe mit komprimierter Luft gefüllt, während die
andre Kammer durch einen Schlauch und ein Mundstück mit der
Lunge des Tauchers in Verbindung tritt. Beide Kammern stehen nun
durch ein Kegelventil in Verbindung, welches durch den Druck der
komprimierten Luft in der ersten Kammer geschlossen wird, sich aber
durch Saugen an dem Mundstück oder durch
Vergrößerung des Wasserdrucks öffnet. Auf dem zum
Mundstück führenden Rohr ist ein Ventil zum Ausatmen
angebracht. Der Apparat (Regulator) kann ohne und in Verbindung mit
Helm gebraucht werden. Letzterer sowie der damit verbundene
Taucheranzug dient nur als Schutz gegen die Nässe. Mit diesem
Apparat kann sich der Taucher während mehr als 4-5 Stunden
frei und ohne Beschwerden in der Tiefe bewegen, und da sein
Körper durch keinen weitern Apparat belästigt ist, so
vermag er auch anstrengende Arbeiten unter Wasser auszuführen.
Ein andrer Apparat unterscheidet sich von diesem insofern, als der
Taucher nur durch den Mund aus dem Regulator einatmet, die
verbrauchte Luft aber durch die Nase in das Innere seines Anzugs
ausstößt, aus welchem er sie von Zeit zu Zeit durch
Öffnen eines Hahns am Helm ablassen kann. Wird letzteres eine
Zeitlang unterlassen, so füllt sich der Anzug stark mit Luft,
und der Taucher steigt von selbst empor. T. sind schon
543
Taucherglocke - Tauerei.
von Aristoteles beschrieben worden. Die Taucherglocke wird
schon im Altertum erwähnt, Aristoteles spricht indes nur
von einer Taucherkappe, einem umgestürzten Kessel, welcher den
Kopf des Tauchers aufnehmen sollte. Der Würzburger
Mathematiker Kaspar Schott (1608-66) beschrieb in seiner "Technica
curiosa" (1664) eine wirkliche Taucherglocke, und Sinclair
beschrieb in seiner "Ars nova et magna gravitatis et levitatis"
(1669) die Taucherglocke, welche 1588, 1665 u. 1687 angewandt
wurde, um die Schätze der versunkenen spanischen Armada zu
heben. Halley versah 1716 die Taucherglocke mit einer Vorrichtung,
um dem Taucher Luft zuzuführen. Seine 1721 konstruierte
Taucherkappe ist im Prinzip noch heute bei den Arbeiten auf dem
Meeresgrund im Gebrauch. Die T. haben große Bedeutung
gewonnen bei der Korallen-, Bernstein- und Perlenfischerei, bei
Wasserbauten, bei Reparaturen an Schiffen und namentlich auch zum
Torpedolegen. Für größere Tiefen als 45 m
können T., welche den Aufenthalt in komprimierter Luft
bedingen, nicht mehr verwendet werden. Den Taucherapparaten
verwandt sind die Rettungsapparate für Feuersbrünste
(Östbergs Patent), welche aus doppelwandigen Gummianzügen
bestehen, aus denen nach allen Seiten Wasser ausspritzt, welches,
wie auch Luft zum Atmen, durch Röhren zugeführt wird.
Vgl. Respirationsapparat.
Taucherglocke, s. Taucherapparate.
Taucherkolben, s. v. w. Mönchskolben, Plunger; s.
Pumpen, S. 462.
Taucherschiff, s. Unterseeische Fahrzeuge.
Tauchnitz, 1) Karl Christoph Traugott, namhafter
Buchdrucker und Buchhändler, geb. 29. Okt. 1761 zu
Großbardau bei Grimma, gründete 1796 zu Leipzig eine
Druckerei, mit der er 1798 eine Verlagsbuchhandlung verband, und
die er allmählich zu einer der größten Offizinen
Deutschlands erweiterte. Seine Thätigkeit richtete er
namentlich auf die Herstellung von Stereotypausgaben der
griechischen und römischen Klassiker, von
Wörterbüchern und Bibeln. Berühmt ist auch der von
ihm in der Ursprache gedruckte Koran (1834). T. starb 14. Jan. 1836
in Leipzig. - Sein Sohn Karl Christian Philipp T., geb. 4.
März 1798 zu Leipzig, führte das Geschäft in der vom
Vater angebahnten Weise bis 1865 fort, in welchem Jahr dasselbe
durch Kauf in den Besitz von O. Holtze überging. T. starb 16.
April 1884 in Leipzig, sein bedeutendes Vermögen der Stadt
Leipzig zur Errichtung einer wohlthätigen Stiftung
hinterlassend.
2) Christian Bernhard, Freiherr von, Neffe von T. 1),
Buchhändler, geb. 25. Aug. 1816 zu Schleinitz bei Naumburg,
gründete 1837 unter der Firma Bernhard T. in Leipzig eine
Verlagshandlung nebst Druckerei, besonders bekannt durch die 1841
begonnene "Collection of British authors", von welcher bis 1889
über 2550 Bände erschienen sind. Daneben pflegte T.
besonders den Verlag von größern juristischen Werken und
Wörterbüchern sowie von kritischen griechischen und
römischen Klassikerausgaben. Seit 1866 läßt er auch
eine "Collection of German authors", welche die vorzüglichsten
Werke der deutsch en Litteratur in englischer Übersetzung
enthält, und seit 1886 die "Student's Tauchnitz editions",
Ausgaben englischer und amerikanischer Werke mit deutschen
Einleitungen und Anmerkungen, erscheinen. Im J. 1860 wurde T. vom
Herzog von Koburg in den erblichen Freiherrenstand erhoben und 1877
zum Mitglied der sächsischen Ersten Kammer ernannt; auch ist
er großbritannischer Generalkonsul für das
Königreich Sachsen.
Tauenzeichenpapier, aus alten Schiffstauen hrgestelltes
Papier, dient zu Werkstattzeichnungen.
Tauenzien (Tauentzien), Boguslaw Friedrich Emanuel, Graf
T. von Wittenberg, preuß. General, geb. 15. Sept. 1760 zu
Potsdam, Sohn des im Siebenjährigen Krieg berühmt
gewordenen Verteidigers von Breslau und Gönners Lessings, des
Generals Boguslaw Friedrich von T. (geb. 18. April 1710 im
Lauenburgischen, gest. 20. März 1791), trat 1775 in die
preußische Armee, nahm an dem Feldzug von 1793 teil, ward
1795 Oberst und 1801 Generalmajor. Als solcher befehligte er 1806
ein vom Fürsten Hohenlohe bis Saalburg vorgeschobenes
Beobachtungskorps, wurde zwar vom Marschall Soult nach Schleiz
zurückgedrängt, bewerkstelligte aber dann trotz des
unglücklichen Gefechts vom 9. Okt. seinen Rückzug auf die
Hauptarmee. Bei Jena befehligte er die Avantgarde des
Hohenloheschen Korps. Nach dem Frieden zu Tilsit erhielt er als
Generalleutnant das Kommando der brandenburgischen Brigade und
beteiligte sich an der Reorganisation der Armee. 1813 zum
Militärgouverneur zwischen der Oder und Weichsel ernannt,
leitete er die Belagerung von Stettin. Seit August kommandierte er
das meist aus Landwehr bestehende 4. preußische Armeekorps
und focht an der Spitze desselben bei Großbeeren (23. Aug.)
und Dennewitz (6. Sept.). Im Oktober ward sein Korps zur Deckung
des Übergangs über die Elbe bei Dessau
zurückgelassen. Nach der Schlacht bei Leipzig zwang er Torgau
zur Kapitulation (26. Dez.) und nahm Wittenberg in der Nacht vom
13. zum 14. Jan. 1814 mit Sturm, wodurch er sich das
Ehrenprädikat "von Wittenberg" erwarb. Auch Magdeburg fiel
nach engerer Einschließung 24. Mai. Im Feldzug des folgenden
Jahrs erhielt T. das Kommando des 6. Armeekorps; doch war, als er
den französischen Boden betrat, der Krieg durch die Schlacht
bei Waterloo bereits entschieden. Nach dem Frieden erhielt T. den
Oberbefehl über das 3. Armeekorps. Er starb als Kommandant von
Berlin 20. Febr. 1824.
Tauerei (Kettenschiffahrt, Seilschiffahrt, Touage), ein
System der Schleppschiffahrt, bei welchem die auf dem Schiff
stehende Maschine Trommeln in Umdrehung versetzt, um welche man
eine endlose Kette oder ein endloses Seil mehreremal schlingt,
während Kette oder Seil längs des ganzen vom Schiff zu
durchlaufenden Wegs über den Boden hin ausgespannt und an
beiden Enden an letzterm entsprechend befestigt sind. Der auf diese
Weise bewegte Ketten- oder Seildampfer dient in gewöhnlicher
Weise als Schleppschiff (Toueur), welchem die Lastschiffe
angehängt werden. Die ersten Versuche mit der T. wurden 1732
auf Veranlassung des Marschalls Moritz von Sachsen angestellt; zur
Ausführung im großen kam die T. aber erst 1820 in Lyon
auf der Saône durch Tourasse und Courteaut. Die hierbei
verwendeten Schiffe trugen einen sechsspännigen
Pferdegöpel, durch welchen ein Hanfseil auf eine Trommel
aufgewunden wurde. Das andre Ende des Seils war in einer Entfernung
von etwa 1 km am Ufer befestigt, und sobald das Seil
vollständig aufgewunden war, mußte es wieder abgewickelt
werden, während man ein zweites, in gleicher Entfernung am
Ufer befestigtes Seil aufwand. Seit diesen Versuchen wurde das
Prinzip beständig ausgebildet, und 1853 kam die T. in ihrer
heutigen Vollkommenheit auf der Seine in Anwendung. Auch andre
französische Flüsse und Kanäle wurden mit der Kette
versehen, und bald folgten Belgien und Holland dem gegebenen
Beispiel. In Deutschland wurde die erste T. 1866 durch die
Hamburg-
544
Tauerei - Tauern.
Magdeburger Dampfschiffahrtsgeschschaft in Magdeburg auf der
¾ Meile langen Elbstrecke zwischen Neustadt und Buckau
ausgeführt und der Betrieb sogleich mit so großem Erfolg
bewerkstelligt, daß damit die Rentabilität der T.
für die meisten schiffbaren Flüsse außer Zweifel
gesetzt wurde. 1871 wurde die ganze Linie von Magdeburg bis zur
böhmischen Grenze eröffnet und 1873 auch die Strecke von
der Mündung der Saale bis Kalbe in Betrieb gesetzt. Seitdem
hat die T. auch auf andern deutschen Flüssen Verwendung
gefunden, auf dem Rhein seit 1877 (zuerst Ruhrort-Emmerich), auf
Havel und Spree seit 1882 etc. Am großartigsten ist der
Tauereiverkehr in den Vereinigten Staaten von Nordamerika auf
Flüssen und Seen entwickelt. Der in Magdeburg angewandte
Kettendampfer ist mit Ausnahme des Verdecks vollständig aus
Eisen konstruiert, 51,3 m lang, 6,7 m breit und hat 48 cm Tiefgang.
Er besitzt an beiden Enden Steuerruder, welche von der Mitte des
Schiffs aus gemeinsam regiert werden können. Mit Hilfe dieser
Steuerung sowie zweier an jedem Schiffsende angebrachter
beweglicher Arme, welche die Kette zwischen Rollen aufnehmen,
dagegen in horizontaler Richtung fast um 90° drehbar sind, wird
es möglich, das Schiff auch in andrer als der Richtung der
Zugkette zu steuern, ohne daß dadurch die Aufwickelung der
letztern gestört wird. Dies ist für die Anwendung des
Kettenschiffs auf gekrümmten Stromstrecken von großer
Bedeutung. Auf dem Hinterteil des Schiffs befinden sich zwei
Trommeln von 1,1 m Durchmesser und 2,6 m gegenseitiger
Achfenentfernung, von denen jede mit vier Rinnen versehen ist. Die
Kette, welche von dem Schiff auf dessen Vorderseite aus dem Wasser
emporgehoben wird, läuft in einer schräg aufsteigenden,
mit Leitrollen versehenen Rinne zu den Trommeln und schlingt sich
um jede 3½mal, indem sie von der ersten Rinne der ersten
Trommel auf die erste Rinne der zweiten Trommel, dann auf die
zweite Rinne der ersten Trommel etc. übergeht. Zuletzt wird
sie in einer schräg abfallenden Rinne an das hintere Ende des
Schiffs geleitet und sinkt in das Wasser zurück. Die
Betriebsdampfmaschine, welche auf jeder Seite durch eine
wasserdichte Wand vom übrigen Schiffsraum abgeschlossen ist,
hat 60 Pferdekräfte. Das Schiff befördert eine Last, die
so groß ist wie die von 4-6 Güterzügen von 100
Achsen, und überwindet ungleich größere Hindernisse
als ein gewöhnlicher Schlepper. Auf der Oberelbe beträgt
die mittlere Fahrgeschwindigkeit zu Berg 1,4 m pro Sekunde oder
0,66 Meile in einer Stunde. Die Kettenschiffe befördern z. B.
die Lastschiffe von Magdeburg nach Dresden in 72 Stunden,
während Raddampfer dazu 120 Stunden brauchen. In Belgien hat
man sich bemüht, die Kette durch ein Drahtseil zu ersetzen.
Man wendet hierbei die von Fowler für seine Dampfpflüge
konstruierte Klappentrommel an, welche in der Mitte des Schiffs an
der einen Seitenwand angebracht ist. Das Seil legt sich auf diese
Trommel, fällt an jeder Seite vertikal herab und wird durch
zwei kleinere Trommeln in horizontaler Richtung nach dem Vorder-
und Hinterteil des Schiffs geführt, um hier von zwei kleinen
Rollen aufgenommen und in das Wasser geleitet zu werden. Diese
Führungsrollen sind nach allen Seiten drehbar und stellen sich
daher der jedesmaligen Richtung des Schiffs entsprechend. Die
Fowlersche Trommel besitzt an ihrem Umfang eine aus zwei Reihen
beweglicher Backen gebildete Rinne, deren Breite sich nach der
Achse der Trommel hin verringert, so daß das auf derTrommel
liegende Seil um so stärker gespannt wird je tiefer es sich in
die Rinne einlegt. Zur Verhinderung des Abgleitens des Seils beim
Ingangsetzen des Schiffs dienen zwei in der Nähe der Trommel
befindliche Friktionsrollen. Das auf der Maas angewandte Drahtseil
hat 25 mm Durchmesser und ist aus 42 eisernen Drähten
zusammengesetzt. Es wiegt pro Meter 2,25 kg und ist um vieles
billiger als die Kette, welche bei einem Durchmesser von 26 mm 15
kg wiegt. Es gewährt auch den Vorteil, daß es sich, ohne
Erschütterungen des Schiffs zu verursachen, und ohne
Geräusch über die Trommel bewegt, während die Kette
beides in ziemlich hohem Grad hervorbringt. Dagegen soll die Dauer
der Kette 12-14, die des Seils nur 9 Jahre betragen. Die Vorteile,
welche die T. gewährt, sind hauptsächlich folgende: Die
Frachtspesen werden geringer teils wegen des geringern
Kohlenkonsums der Kettenschiffe im Vergleich zu den
gewöhnlichen Dampfschleppschiffen, teils weil die Bedienung
der Fahrzeuge auf den dritten Teil reduziert werden kann. Nach
Meitzen berechnen sich die Kosten der Zugkraft bei einem Schiff von
7000 Ztr. Tragkraft unter gleichen Bedingungen pro Zentner und
Meile für Pferdezug auf 0,16, Schleppdampfer auf 0,04, T. auf
0,01-0,02 Pf. Die Schiffe brauchen weder Masten noch Takelage und
können also um das Gewicht derselben mehr beladen werden. Der
starke Wellenschlag, den die Raddampfer erzeugen, fällt weg,
und die Beförderung wird eine schnellere und
regelmäßigere, so daß bei leidlichem Wasserstand
die Lieferungszeiten genauer innegehalten werden können. Vgl.
"Bateau toueur à vapeur" in Armengauds "Publication
industrielle", Bd. 14 (Par. 1862); Chanoine und Lagrène,
Mémoire sur la traction des bateaux, in "Annales des ponts
et chaussées" 1863; "Die Kettenschiffahrt auf der Elbe" und
Ziebarth, "Über Ketten- und Seilschiffahrt", in "Zeitschrift
des Vereins deutscher Ingenieure", Bd. 11 u. 13 (Berl. 1867 u.
1869); Hoffmann, Über Kettenschleppschiffahrt und deren
Einführung auf der Elbe (Dresd. 1869); Schmidt, Mitteilungen
über die Kettendampfschiffahrt auf der Oberelbe (das. 1870);
Eyth, On towing-boats on canals and rivers by a fixed wire rope and
clip drum, in "Artisan" 1870; Werneburg, Die Kettenschiffahrt auf
dem kanalisierten Main (Frankf. 1880).
Tauern, Name eines Hauptzugs der Deutschen Zentralalpen,
der östlichen Fortsetzung der Zillerthaler Alpen in Salzburg,
Kärnten und Steiermark. Man unterscheidet die Hohen T. und die
Niedern T. Jene erstrecken sich vom Krimmler Achenthal und Ahrnthal
im W. bis zum Großarlthal und Malthathal im O. Dieses
große Stück Gebirgswelt zerfällt in folgende Teile:
1) Die Hohe Tauernkette im eigentlichen Sinn, an der Grenze
Salzburgs einer-, Tirols und Kärntens anderseits, gehört
zu den hochsten und am wenigsten tief eingeschnittenen Teilen der
Alpen, da die Kammhöhe 2600-2900 m erreicht, mehr als 16
Gipfel über 3500 m und an 100 über 3200 m emporragen und
auf 150 km Länge keine fahrbare Straße sich findet. Die
Vergletscherung erreicht in einzelnen Fällen, wie bei der
Pasterze (10 km lang, zweitlängster Gletscher der Deutschen
Alpen), Schlattenkees, Obersulzbacher Gletscher, eine gewaltige
Ausdehnung, erscheint jedoch im allgemeinen geringer als die der
Ötzthaler und Ortlergruppe und ist namentlich in den letzten
zwei Jahrzehnten ansehnlich zurückgegangen. Dagegen sind die
T. teils wegen der Steilheit der Seitenwände ihrer
Thäler, insbesondere aber wegen der tiefen Lage der
Thalsohlen, das an Wasserfällen reichste Gebiet der Deutschen
Alpen. In den höchsten Terrassen der zahlreichen
545
Tauernwind - Taufe.
parallel zum wasserscheidenden Hauptkamm hinaufziehenden
Tauernthäler finden sich malerische Hochseen. Bemerkenswert
sind auch die von den Thalbächen gebildeten Felsenschlunde,
darunter die großartigen Liechtenstein- und Kitzlochklammen.
Die T. bilden wegen ihrer herrlichen, in neuerer Zeit leichter
zugänglich gewordenen Naturszenerien eins der besuchtesten
Reisegebiete in den Alpen. Die schönsten Punkte sind
außer den erwähnten Klammen und abgesehen von den
Gipfeln: Gastein mit Umgebung, Rauriser Goldberg, Fusch und
Ferleiten, Kaprun mit dem Moserboden, Stubachthal, Krimmler
Wasserfälle, Gschlöß, Kalser Thörl, der
Pasterzengletscher. Im Volksmund heißen T. nur die hoch
gelegenen Gebirgspässe, von welchen folgende in den Bereich
dieses Gebirgszugs fallen: der Krimmler T., 2635 m, Übergang
aus der Prettau (von Bruneck her) ins Krimmler Achenthal, zugleich
die Grenze zwischen den Hohen T. und den Zillerthaler Alpen
bildend; der Felber T., 2545 m, welcher, die Großglockner-
von der Großvenedigergruppe scheidend, aus dem Isel- und
Tauernthal (Lienz, Windischmatrei) nach dem Pinzgau (Mittersill)
führt; der Kalser T., 2506 m, mlt Übergang vom Iselthal
über Kals ins Stubachthal im Pinzgau; der Mallnitzer T., 2414
m, zwischen der Hochnarr- und Ankoglgruppe aus dem Möllthal
über Mallnitz ins Gasteinthal führend. Die wichtigsten
Berggruppen und deren Kulminationspunkte in den Hohen T. sind in
der Richtung von W. nach O.: Dreiherrenspitze (3503 m),
Großvenediger (3673 m), Großglockner (3797 m),
Großes Wiesbachhorn (3575 m), Hochnarr (3258 m),
Hochalpenspitze (3355 m). 2) Die Antholzer Gruppe, zwischen
Ahrnthal einer-, Antholz, Stalleralpsattel und Stalleralpenthal
anderseits; höchster Gipfel: Hochgall (3442 m). 3) Das
Deferegger Gebirge, südlich des Deferegger Thals, zwischen dem
Antholzer und untern Iselthal, im Weißspitz (2955 m)
kulminierend. 4) Die Schobergruppe, begrenzt durch den Iselberg
zwischen Lienz und Winklern, der Möll, dem Kalserbach und der
Isel; höchste Punkte sind der Petzeck (3275 m) und der
Hochschober (3243 m). 5) Die Kreuzeckgruppe, zwischen Iselberg,
Möll und Drau, mit dem Kreuzeck (2703 m) und Polinik (2780 m).
- An der Markkarspitze, dicht neben der Arlscharte (2342 m),
spaltet sich der Hauptkamm der östlichen Zentralalpen in einen
nördlichen und südlichen Zug: letzterer, südlich der
Mur, heißt die Kärntnisch-Steirischen Alpen; ersterer,
zwischen der Mur im S., der Enns im N., bildet die Niedern T. oder
Steirischen Alpen, die sich bis zum Schoberpaß oder der
Walder Höhe hinziehen; höchster Punkt ist der Hochgolling
(2872 m). Sie haben keine Gletscher, wohl aber fahrbare Pässe:
den Radstädter T. (1763 m), über den eine Straße
von Radstadt nach St. Michael und in weiterer Fortsetzung über
den Katschbergpaß (1641 m) nach Gmünd und Spittal in
Kärnten führt, und den RottenmannerT. (1760 m), dessen
Straße Lietzen an der Enns mit Judenburg an der Mur
verbindet. Über die Walder Höhe führt die
Rudolfsbahn. Die zentrale Hauptkette der T. besteht aus
kristallinischen Schiefern (Gneis, Glimmerschiefer, Talk- und
Chloritschiefer) mit eingelagertem körnigen Kalkstein und
Serpentin, hier und da auch von Granit durchsetzt. Vgl. v. Sonklar,
Die Gebirgsgruppe der Hohen T. (Wien 1866); Derselbe, Karte (2.
Aufl., das. 1875); Heß, Führer durch die Hohen T. (das.
1886).
Tauernwind, ein in den Norischen Alpen (Tauern)
auftretender kalter Nordostwind; s. Bora.
Taufe (griech. Baptisma, Baptismus), das Sakrament, durch
welches der Täufling mittels Untertauchung oder Besprengung
mit Wasser in die christliche Kirche aufgenommen wird. Heilige
Waschungen findet man fast bei allen alten orientalischen
Völkern (s. Reinigungen) und Spuren von feierlicher Lustration
neben der Beschneidung auch bei den Juden (s. Proselyt), welchen
die körperliche, sogen. levitische Reinheit als das Symbol, ja
Surrogat der innern Reinheit galt. Durch die Wassertaufe weihte
namentlich Johannes der Täufer alle, welche Buße thaten,
für das nahe bevorstehende Gottesreich, und auch Jesus empfing
diese T. im Jordan. Nach seinem Vorbild ließen sich dann
seine Gläubigen taufen. In Paulinischen Kreisen faßte
man die T. als ein mysteriöses Bad der Wiedergeburt auf und
setzte sie mit dem Tod und der Auferstehung Christi in Beziehung,
daher man bald in der T. eine über das Sinnbild des Unter- und
Auftauchens hinausschreitende, geheimnisvolle Verbindung mit
Christum fand. Weil man sie zugleich als das spezifische Organ der
innerlichen Reinigung und Sündenvergebung betrachtete,
verschoben viele, wie Kaiser Konstantin, ihre T. bis ans Lebensende
(procrastinatio baptismi). Erst Augustin aber gab durch seine Lehre
von der Erbsünde der T. eine dogmatische Unterlage und bewies
ihre absolute Notwendigkeit. Die Erbsünde wird durch sie zwar
als Schuld getilgt, doch bleibt die Fleischeslust noch als "Zunder
der Sünde" in dem Getauften. Die Wiederholung der T. war lange
eine Streitfrage, besonders mit Bezug auf die Ketzertaufe. Seit dem
3. Jahrh. sprach sich die Kirche immer bestimmter dahin aus,
daß ein auf die Trinität getaufter Ketzer beim
Übertritt zur orthodoxen Kirche nicht wiederum zu taufen sei.
Die richtig vollzogene T. ist nach katholischer Lehre das die
erstmalige Eingießung übernatürlicher Gerechtigkeit
vermittelnde Sakrament. Auch nach den protestantischen symbolischen
Büchern gewährt die T. Vergebung der Sünde und
Mitteilung des Heiligen Geistes, kann folglich, wenn
rechtmäßig vollzogen, an demselben Individuum nicht
wiederholt werden. Während aber nach der lutherischen Lehre
die T. durch die wunderbare Wirksamkeit des mit dem Wasser
verbundenen Worts außer der Sündenvergebung auch
Wiedergeburt (s. d.), Wiederherstellung der Freiheit des Willens
zum Guten und sogar in Kindern den Glauben wirkt, gilt sie bei
Zwingli als Pflichtzeichen und kirchlicher Einweihungsakt,
überhaupt in der reformierten Kirche mehr als Symbol und
Unterpfand dafür, daß Gott denen, welche zum Glauben
gelangen, die verheißenen Heilsgüter auch zukommen
lassen werde. Beide Kirchen haben auch die Kindertaufe beibehalten,
welche schon seit etwa 200 sporadisch vorgekommen, seit Augustin
allmählich herrschende Sitte geworden war. Weil für
dieselbe kein Befehl Christi und der Apostel vorliegt, und weil die
Kinder überdies auch zu dem Glauben, welcher in der T.
vorausgesetzt ist, nicht befähigt sind, verwarfen die
Wiedertäufer (Mennoniten) dieselbe völlig, indem sie eine
Wiederholung der T. an den Erwachsenen statuierten. Ähnlich
weisen auch die Quäker (s. d.) und die Baptisten (s. d.)
Englands und Nordamerikas die Kindertaufe zurück. Dagegen soll
nach der Lehre der katholischen und evangelischen Kirche die T.
regelmäßig von dem ordinierten Geistlichen verrichtet
werden. Nur in Notfällen soll auch die Laientaufe (Nottaufe)
zugelassen werden. Die unter wörtlicher Beziehung auf die drei
Personen der Trinität vorzunehmende Applikation des
Wassers
546
Taufe eines Schiffs - Taunus.
kann Untertauchung (immersio) oder Besprengung (adspersio oder
infusio) sein. Der erstere Taufmodus ist bis in das 12. Jahrh.
üblich gewesen und findet noch jetzt in der
morgenländischen Kirche statt. Der Exorzismus (s. d.) ist in
der protestantischen Kirche nicht überall abgeschafft worden.
In der alten Kirche wurde die T. in den Kathedralkirchen
vorgenommen, welche besondere Taufkapellen (Baptisterien) hatten.
Nachdem aber die Bischöfe sich nur noch die Konfirmation oder
Firmung (s. d.) ausschließlich vorbehalten hatten, die
Verrichtung der T. dagegen den Presbytern zugewiesen worden war,
brachte man in jeder Kirche Taufsteine an. Später wurden
Haustaufen üblich, mehr noch bei den Lutheranern als bei den
Katholiken. Bei der T. findet nach Luk. 1,59; 2,21, wie bei der
jüdischen Beschneidung, eine Namengebung statt. Wo sich Staat
und Kirche nicht in der Weise der modernen Gesetzgebung auseinander
gesetzt haben, erscheint die T. als notwendige Handlung und kann
daher auch gegen den Willen der Eltern erfolgen; über die T.
selbst muß der Geistliche ein Register führen (s.
Kirchenbuch); die formellen Auszüge daraus (Taufzeugnisse)
gelten als öffentliche Urkunden. Vgl. Höfling, Das
Sakrament der T. (Erlang. 1846-48, 2 Bde.).
Zur T. diente in den Kirchen ursprünglich ein Bassin mit
Wasser, in welchem der Täufling untergetaucht wurde. An seine
Stelle trat später der Taufstein, ein Becken aus Stein auf
hohem Ständer, mit symbolischen Figuren oder auf die T.
bezüglichen Darstellungen, bisweilen auch von Figuren (den
vier Flüssen des Paradieses, Löwen u. a.) getragen.
Solcher Taufsteine sind noch viele aus romanischer Zeit erhalten.
In die Vertiefungen der Steine ließ man seit dem 11. Jahrh.
metallene Becken ein, zu denen sich später metallene Deckel
gesellten, die ebenfalls mit bildlichen Darstellungen verziert
waren und durch Ketten emporgezogen oder durch Arme fortbewegt
wurden, wenn Taufen vollzogen wurden. In spätgotischer Zeit
wurden über die Taufsteine bisweilen Baldachine angebracht. In
neuerer Zeit (seit dem 17. Jahrh.) sind die Taufbrunnen außer
Gebrauch gekommen, und an ihre Stelle sind Taufschüsseln und
Taufkannen getreten.
Taufe eines Schiffs, s. Ablauf.
Tauferer Thal, nördliches Seitenthal des Pusterthals
in Tirol, mit seinen Seitenthälern eins der schönsten
Alpenthäler, im N. und W. von den Zillerthaler Alpen, im O.
und S. von den Hohen Tauern begrenzt, zieht sich von Bruneck bis
zum Krimmler Tauern zuerst nördlich, dann nordöstlich
hinan. Von Bruneck bis Taufers, dem Hauptort des Thals (mit
Bezirksgericht), aus dem gleichnamigen hoch gelegenen Schloß
und den Dörfern Sand und St. Moritzen bestehend, heißt
es das T. T. im engern Sinn, von da bis gegen St. Peter Ahrnthal
und von hier bis zu seinem Schluß an der Birnlucke Prettau.
Nebenthäler sind das Mühlwald-Lappacher, das Rainthal,
das Weißenbachthal und das Mühlbacher Thal. Vgl. Daimer,
Taufers und Umgebung (Gera 1879).
Taufgesinnte, s. Mennoniten.
Taufname, s. v. w. Vorname, s. Name.
Taufstein, s. Taufe, S. 546.
Taufstein, Berg, s. Vogelsberg.
Taufzeugen, s. v. w. Paten.
Taugarn, grobes Hanfgespinst zu den schwersten
Seilerwaren.
Taugras, s. Agrostis.
Tauler, Johannes, deutscher Mystiker, geboren um 1300 zu
Straßburg, trat in den Dominikanerorden und wirkte als
Volksprediger meist in seiner Vaterstadt bis zu seinem 1361
erfolgten Tode. Daß er sich gegen das päpstliche Verbot,
welches den Gottesdienst in Straßburg während der Zeit
des über die Stadt verhängten Interdikts untersagte,
aufgelehnt habe, läßt sich ebensowenig festhalten, wie
daß die in des "Meisters Buch" sich findende
Bekehrungsgeschichte sich auf T. beziehe. Die Abfassung des bisher
allgemein dem T. zugeschriebenen Buches "Von der Nachfolgung des
armen Lebens Christi" muß, wie Denifle und Ritschl
nachgewiesen haben, demselben abgesprochen werden. Taulers Mystik
lernen wir jedoch aus seinen Predigten kennen, sie hält sich
von dem Pantheismus eines Eckart (s. d.) fern. T. fordert,
daß sich der Christ der Gelassenheit befleißige und
innerlich von aller Kreatur frei werde. Ein Feind der von der
katholischen Kirche so laut gepredigten Selbstgerechtigkeit, war T.
ein Verkünder der alles wirkenden göttlichen Gnade. Der
Weg aber, auf dem man nach T. zur Selbstverleugnung gelangt, ist
der der Nachfolge des Lebens Jesu. Vgl. K. Schmidt, J. Tauler
(Hamb. 1841); Denifle, Das Buch von der geistlichen Armut etc.
(Münch. 1877); Derselbe, Taulers Bekehrung (das. 1879); Jundt,
Les amis de Dieu au XIV. siècle (Par. 1879) ; Ritschl in der
"Zeitschrift für Kirchengeschichte" (1880). Taulers Predigten
wurden ins Hochdeutsche übertragen von Hamberger (2. Aufl.,
Frankf. 1872).
Taumelkäfer (Gyrinidae), s. Wasserkäfer.
Taumellolch, s. Lolium.
Taumler, an Drehkrankheit (s. d.) leidende Schafe.
Taunton (spr. tohntön), 1) Hauptstadt der Grafschaft
Somerset (England), am schiffbaren Tone, hat eine gotische Kirche
aus der Zeit Heinrichs VII., ein altes Schloß (jetzt Museum),
eine Lateinschule, zahlreiche milde Stiftungen, etwas Seiden- und
Handschuhfabrikation, lebhaften Handel und (1881) 16,614 Einw. Hier
hielt der berüchtigte Jeffreys 1685 seine Blutgerichte. - 2)
Stadt im nordamerikan. Staat Massachusetts, am schiffbaren
Fluß T., der 25 km unterhalb in die Narragansetbai
mündet, mit Gerichtshof, Irrenanstalt, bedeutender
Gewerbthätigkeit (Bau von Lokomotiven, Kupfer- und
Nagelschmieden, Kurzwaren) und (1885) 23,674 Einw.
Taunus (auch die Höhe, früher Einrich, auch
Einrichgau genannt), ein zum niederrheinischen Gebirge
gehöriger Gebirgszug im preuß. Regierungsbezirk
Wiesbaden (s. Karte "Hessen-Nassau"), breitet sich mit seinen
Nebenzweigen und Vorbergen zwischen dem Main, Rhein und der Lahn
aus und ist ein in seiner gesamten Ausdehnung wohl 90 km langes,
mit Wald bedecktes Gebirge, welches, in der Gegend von Wetzlar aus
dem Lahnthal ansteigend, anfangs als ein mäßig hoher
Bergrücken die Westseite der Wetterau begrenzt, dann in
südwestlicher Richtung sich über Oberursel, Kronberg,
Königstein und Eppstein nach Schlangenbad fortzieht, sich von
da, durch ein kleines Nebenthal unterbrochen, unter dem Namen des
Rheingaugebirges fortsetzt und bei Rüdesheim und Lorch am
Rhein endigt. Auf der Südseite ist der Abfall des Gebirges
ziemlich steil, noch steiler aber auf der Westseite von
Rüdesheim bis Lahnstein, wo er mit seinen obst- und
rebenreichen, von Burgruinen gekrönten Höhen einen
äußerst malerischen Anblick gewährt. Auf der
Nordseite treten felsige Verzweigungen des Gebirges bis hart an die
Lahn vor. Der wenig geschlossene Hauptkamm des Gebirges hat eine
mittlere Höhe von 480 m, über welche sich seine
gerundeten oder abgestumpften Gipfel noch um 300-400 1n erheben.
Der höchste Punkt
547
Taunusschiefer - Taurin.
ist der Große Feldberg (880 m) bei Königstein.
Südwestlich von diesem erhebt sich der Kleine Feldberg (827
m), von diesem südlich der Altkönig (798 m) mit zwei
kolossalen Steinringwällen. Im mittlern Teil der Kette sind zu
bemerken: der Rossert (516 m), der Staufen (452 m), der Trompeter
(540 m) und die Platte nördlich von Wiesbaden (500 m); weiter
nach SW. die Hohe Wurzel (618 m). Die höchste Spitze des
Rheingaugebirges ist die Kalte Herberge (620 m), der
südwestlichste Ausläufer der Niederwald (330 m). Die
Hauptmasse des Gebirges besteht aus Thonschiefer, der hier und da
in Talkschiefer übergeht und auf den Höhen von Quarz
überlagert wird; nach N. schließen sich
Grauwackebildungen an. Bergbau findet auf dem T. nicht statt.
Überall, wo der Boden sich dazu eignet, ist das Gebirge wohl
angebaut, und an den südlichen Abhängen finden sich
herrliche Weinpflanzungen, Obsthaine, Kastanienwäldchen und
selbst Mandelbäume. Von den zahlreichen Gewässern des T.
fließt die Use östlich der Wetter, die Schwarze
südlich dem Main, die Wisper westlich dem Rhein zu,
während die mit längerm Lauf, wie die Aar, Ems und Weil,
nach N. zur Lahn abfließen. Der T. ist besonders durch die
Menge seiner Mineralquellen berühmt, deren mehr als 40 bekannt
und größtenteils benutzt sind, und von denen mehrere zu
den berühmtesten Deutschlands gehören (Wiesbaden,
Schwalbach, Selters, Homburg, Schlangenbad, Soden, Ems etc.). Den
Süd-, West- und Nordfuß des T. begleitet die
Eisenbahnlinie Frankfurt a. M.-Lollar, den Ostfuß die Linie
Frankfurt a. M.-Kassel, während die Linie Höchst- und
Wiesbaden-Limburg das Gebirge durchschneidet und in zwei fast
gleiche Teile teilt und mehrere kürzere Linien in und an das
Gebirge führen. Durch die Bemühungen des Taunusklubs ist
der Touristenverkehr im T. in stetem Steigen begriffen. Vgl.
Schudt, Taunusbilder in Geschichten, Sagen und Liedern (Homb.
1859); Großmann u. a., Die Heilquellen des T. (Wiesb.
1887).
Taunusschiefer, s. Sericitschiefer.
Tauposee, See auf der Nordinsel von Neuseeland, 770 qkm
groß, mit vielen warmen Schwefelquellen.
Taupuukt, s. Tau und Hygrometer, S. 844.
Taura, Dorf in der sächs. Kreishauptmannschaft
Leipzig, Amtshauptmannschaft Rochlitz, mit evang. Kirche,
Handschuhfabrikation und (1885) 2722 Einw.
Taurellus, Nikolaus (eigentlich Öchsle), Philosoph,
geb. 1547 zu Mömpelgard (Montbéliard), das damals unter
württembergischer Herrschaft stand, wirkte erst als Professor
der Medizin in Basel, seit 1580 als Professor der Philosophie zu
Altdorf und starb daselbst 1606. Er hat sich als Gegner des
Aristoteles und des averrhoistischen Aristotelismus und Pantheismus
des Cesalpino (s. d.), insbesondere der Lehre von der Ewigkeit der
Welt, durch die Schriften: "Philosophiae triumphus" (Basel 1573),
"Alpes caesae" (Frankf. a. M. 1597) und "De rerum aeternitate"
(Marb. 1604) bekannt gemacht, in welchen er die Philosophie als
menschliche, der Theologie als geoffenbarter Weisheit als Grundlage
unterzuschieben, aber zugleich mit der letztern insbesondere durch
die Rechtfertigung der zeitlichen Schöpfung aus nichts und des
Sündensalls in Einklang zu bringen suchte. Vgl. Schmid aus
Schwarzenberg, Nikolaus T., der erste deutsche Philosoph (Erlang.
1860).
Taurien, das südlichste Gouvernement Rußlands,
umfaßt die Halbinsel Krim und einen Teil des Festlandes, wird
im S. vom Schwarzen und Asowschen Meer, im W. vom Gouvernement
Cherson, im N. und O. von Jekaterinoslaw begrenzt und hat ein Areal
von 63,553,5 qkm (1154 QM.). Über die Bodenbeschaffenheit des
letztern s. Krim und Taurisches Gebirge. Der festländische
Teil des Gouvernements ist Steppe, deren Boden von Schieferthon,
Quarzsand und Thon eingenommen wird; jedoch finden sich auf dem
Festland auch ausgedehnte, mit schwarzer Erde bedeckte Strecken.
Mineralische Reichtümer sind: Porphyr, roter und grauer Marmor
und vorzügliches Salz aus den Steppenseen. Der einzige
bedeutende Fluß ist der die Nordwestgrenze beruhrende Dnjepr.
Auf demselben wird Holz aus den innern Gouvernements
hinabgeflößt; stromaufwärts geht Salz. Das Klima
ist mild und im allgemeinen gesund, außer am Faulen Meer und
am Dnjeprliman. Die mittlere Jahrestemperatur am Südufer
beträgt +11,6° C., in Simferopol +10°. T. ist eins der
schwach bevölkerten Gouvernements, mit (1885) 1,060,004 Einw.
(16 pro QKilometer), bestehend in Groß- und Kleinrussen,
Tataren, deutschen Kolonisten, Bulgaren, Juden, Griechen und
Armeniern. Die Zahl der Eheschließungen war 1885: 8445, der
Gebornen 51,059, der Gestorbenen 29,843. Die
Hauptbeschäftigung in den nördlichen Teilen ist
Viehzucht, Ackerbau und Salzgewinnung, in den Bergthälern und
am Abhang der Gebirge Garten- und Weinbau. Der Fortschritt im Anbau
der Cerealien ist der rationellen Wirtschaft bei den deutschen
Kolonisten, zumal bei den Mennoniten, aber auch bei den russischen
Sektierern zu verdanken, ist aber überhaupt nicht bedeutend.
Das Areal besteht aus 38,7 Proz. Acker, 47 Wiese und Weide, 6 Wald
und 8,3 Proz. Unland. Die Ernte betrug 1887: 2,6 Mill. hl Weizen,
¾ Mill. hl Roggen, 1,4 Mill. hl Gerste, andres Getreide und
Kartoffeln in kleinern Mengen. Die besten u. ergiebigsten
Weingärten sind am Südufer der Krim vom Kap Aluschta bis
Kap Laspi, und die Fruchtgärten liefern gute Äpfel und
Birnen. Der Viehstand bezifferte sich 1882 auf 485,000 Stück
Rindvieh, 994,600 grobwollige und 2,891,000 feinwollige Schafe,
356,279 Pferde, 118,000 Schweine und 64,900 Ziegen. Hervorragend
ist die Zucht der Merinoschafe; doch auch Rinder- und Pferdezucht,
Bienenzucht und Fischfang (Heringe) werden mit großem Erfolg
betrieben. Der Wert der industriellen Thätigkeit wird 1885 auf
6½ Mill. Rubel angegeben. Der Handel besteht mehr in der
Ausfuhr zur See (Berdjansk, Sebastopol, Feodosia) als zu Land ins
Innere des Reichs. Die Haupausfuhrartikel sind: Weizen, Wolle,
Fische, Salz, Früchte und Wein. Die Zahl aller Lehranstalten
war 1885: 669 mit 40,186 Schülern, darunter 21 Mittelschulen
und 13 Spezialschulen (vorzugsweise Navigationsschulen). Das
Gouvernement zerfällt in acht Kreise, von denen die Kreise
Melitopol, Berdjansk und Aleschki auf dem Festland, Perekop,
Simferopol, Eupatoria, Jalta und Feodosia auf der Halbinsel Krim
liegen. Hauptstadt ist Simferopol.
Taurin C2H7NSO3 findet sich frei oder mit Cholsäure
verbunden (Taurocholsäure) in der Galle der Ochsen und
vieler andrer Tiere, im Darminhalt und Lungengewebe, in Muskeln
wirbelloser Tiere und Fische, entsteht bei Zersetzung der
Taurocholsäure durch Säuren, beim Erhitzen von
isäthionsaurem Ammoniak C2H9SO4, bildet farb-, geruch- und
geschmacklose Kristalle und ist leicht löslich in heißem
Wasser, nicht in Alkohol und Äther, schmilzt und zersetzt sich
gegen 240°; es reagiert neutral, bildet aber mit Basen Salze,
wird durch Kochen mit Alkalien und Säuren nicht verändert
und gibt beim Schmelzen mit Kalihydrat Essigsäure, schweflige
Säure, Ammoniak und Wasserstoff.
548
Tauris - Tauschwert.
Tauris, Stadt, s. Tebriz.
Taurische Halbinsel, s. Krim.
Taurisches Gebirge (Krimsches Gebirge), am Südrand
der Halbinsel Krim im südlichen Rußland, von Balaklawa
im NO. bis zur Straße von Jenikale. Der Hauptrücken
heißt Jaila Dagh (Jailagebirge) und erstreckt sich von
Balaklawa bis Feodosia in einer Länge von 122 km. Das Gebirge
fällt mit schroffem und wild zerrissenem Absturz nach S. in
die See und sinkt unter dem Wasser noch so jäh ab, daß
oft schon in geringer Entfernung vom Ufer das Senkblei keinen Grund
findet; es besteht aus mehreren reichbewaldeten, durch anmutige
Thäler getrennten Parallelketten. Die höchsten Gipfel
sind der Tschadyr Dagh oder Zeltberg (nach Parrot und Engelhardt
1661 m), der Babugan Jaila (l655 m) und der Ai-wassilem (1627
m).
Taurisker, kelt. Volksstamm, welcher in den Ostalpen an
der obern Drau wohnte, ward 13 v. Chr. durch P. Silius und Drusus
der römischen Herrschaft unterworfen. Ihr Name soll sich in
dem der Tauernkette erhalten haben.
Tauriskos, griech. Bildhauer und Bruder des Apollonios
aus Tralles (s. Apollonios 3). Er scheint auch als Maler Bedeutung
erlangt zu haben.
Taurocholsäure, s. Gallensäuren.
Tauroggen, Flecken im litauisch-russ. Gouvernement Kowno,
an der Jura (Zufluß der Memel), 7 km von der
preußischen Grenze, mit Grenzzollamt und 4720 Einw. Hier
unter zeichnete 21. Juni 1807 Kaiser Alexander I. den dem Frieden
von Tilsit vorausgehenden Waffenstillstand. Im nahen Dorf Poscherun
schloß 30. Dez. 1812 der preußische General York mit
dem russischen General Diebitsch die denkwürdige
Waffenstillstands- u. Neutralitätskonvention (Konvention von
T.).
Tauromenion, s. Naxos (Stadt) und Taormina.
Taurus (Tauros, griech. Umformung des nordsemit. tur,
"Gebirge"), das südliche Randgebirge des Hochlandes von
Kleinasien, zieht vom Euphrat westwärts bis an das
Ägeische Meer und bildet einen ununterbrochenen Gebirgszug,
der gegen S. in sehr kurzen Absätzen oder plötzlich und
steil zum Meer abfällt, gegen N. sich sanft zu Hochebenen
abdacht. Das unwegsame Gebirge erreicht in dem östlichen Teil
der Landschaft Kilikien in seinen Gipfeln eine Höhe von
über 3000 m. Der wichtigste Paß ist Gülek-Boghas,
die Kilikischen Pässe der Alten, durch welche die große
Heer- und Karawanenstraße von Kleinasien nach Syrien
führt. Westlich davon führt das Gebirge jetzt den Namen
Bulghar Dagh, östlich Ala Dagh. Hier wird es von zwei
Flüssen durchbrochen, dem Seihun (Saros) und Dschihan
(Pyramos), welche beide in das Mittelländische Meer
münden. Noch zahlreiche andre, aber meist unbedeutende
Flüsse gehen vom T. ins Mittelländische Meer. Weit
wasserärmer ist die Nordseite des Gebirges, wo mehrere
bedeutende, meist salzhaltige Seen liegen. Östlich vom Saros
zweigt sich als mächtiger Seitenarm der Antitaurus (heute
Binbogha Dagh) ab, der, anfangs gegen N., dann gegen NO. ziehend,
zwischen Euphrat und Kisil Irmak (Halys) die Wasserscheide
bildet.
Taus (tschech. Domazlice), Stadt im westlichen
Böhmen, an der Böhmischen Westbahn, in welche hier die
Staatsbahnlinie Janowitz-T. mündet, mit Beirkshauptmannschaft
und Bezirksgericht, Dechanteikirche, Kommunalobergymnasium,
Augustinerkonvent, Zuckerraffinerie, Bandfabrik, Bautischlerei,
Strumpfwirkerei und Topferei, Bierbrauerei, besuchten Märkten
und (1880) 7364 Einw. Bei T. 14. Aug. 1431 Sieg der Hussiten
über das deutsche Kreuzheer. In der Umgebung Glas- und
Porzellanfabriken, Brettsägen und
Zündwarenfabrikation.
Tausch (Tauschgeschäft, Tauschvertrag, Permutatio),
der Vertrag, durch welchen sich jeder von beiden
Vertragschließenden zur wechselseitigen Hingabe einer Sache
an den andern verpflichtet. Im Gegensatz zum Kaufvertrag, wobei
sich der eine Vertragschließende (der Verkäufer) zur
Hingabe der Ware, der andre (der Käufer) zur Übergabe
einer bestimmten Geldsumme, des Preises, verpachtet,
charakterisiert sich der T. eben dadurch, daß beide
Leistungen zugleich den Charakter des Preises und den der Ware an
sich tragen. Der Entwurf eines deutschen bürgerlichen
Gesetzbuchs (§ 502) erklärt denn auch: "Jeder der
Vertragschließenden ist in Ansehung der von ihm versprochenen
Leistung gleich einem Verkäufer und in Ansehung der ihm
zugesicherten Leistung gleich einem Käufer zu beurteilen".
Tausch, bei botan. Namen für J. F. Tausch, geb. 1792
zu Taussing in Böhmen, gest. 1848 als Professor der Botanik in
Prag. Beschrieb die seltenen Pflanzen des gräflich Canalschen
Gartens.
Tauschaninseln, türk. Inselgruppe im Ägeischen
Meer, südlich von der Dardanelleneinfahrt gelegen.
Tauschhandel, s. Barattieren.
Tauschierarbeit, eine Art eingelegter Metallarbeit,
welche frühzeitig in Damaskus geübt wurde und daher auch
Damaszierung (s. d. und Damaszener Stahl) genannt wird. Der
Ausdruck stammt von dem italienischen Tausia her, welches wohl
verwandt ist mit Tarsia; beides bedeutet eingelegte Arbeit, aber
ersteres solche in Metall, letzteres solche in Holz; die
französische technologische Litteratur pflegt für diese
Technik noch die Ausdrücke Incrustation oder Damasquinure zu
gebrauchen. Die T. wird mit Blattgold oder Blattsilber meist auf
Eisen oder Bronze ausgeführt, doch kommen auch Verzierungen
aus einem Edelmetall auf dem andern vor; die Befestigung der
Ornamente auf dem zu diesem Zweck rauh gemachten Grund geschieht
nur durch Druck oder Schlag, nicht durch Bindemittel oder Feuer. In
der Regel ist die Zeichnung in die Oberfläche des Grundmetalls
eingraviert, mitunter derart, daß die Vertiefungen unten ein
wenig breiter sind als oben und daher die überstehenden
Ränder das eingebettete Edelmetall festhalten; doch lassen
sich auch die aus Gold- oder Silberfäden gebildeten oder aus
feinem Blech ausgeschnittenen Ornamente frei auf den aufgerauhten
Grund auflegen; ferner kann man den Grund nachträglich durch
Ätzung vertiefen, so daß die Zeichnung erhaben bleibt.
In Indien, China, Japan ist die T. von alters her bekannt;
Theophilus handelt davon im dritten Buch seiner "Schedula" (Kap.
90: "De ferro"); später in Vergessenheit geraten, fiel Benv.
Cellini diese Technik an türkischen Dolchen auf, und er ahmte
sie nach (vgl. seine Selbstbiographie, Buch 1, Kap. 6). Im 16.
Jahrh. war die T. besonders für Prachtrüstungen beliebt
(Mailand, München, Augsburg etc.), kam jedoch auch bei
Gefäßen und Geräten zur Anwendung; durch die
Waffenfabrikation erhielt sie sich in Spanien (Eibar im Baskenland)
und ist gegenwärtig als Zweig der Goldschmiedekunst wieder
allgemein in Übung. Uneigentlich wird auch die jetzt
gebräuchliche Verzierung des Eisens und der Bronze auf
galvanischem Weg oder vermittelst flüssiger Metallfarben T.
genannt.
Tauschlepper (Taustreicher), s. Ackerkulte.
Tauschuarre, s. Ralle.
Tauschwert, s. Wert.
549
Tauschwirtschaft - Tautochronische Erscheinungen.
Tauschwirtschaft wird oft die heutige auf Privateigentum
und Arbeitsteilung beruhende gesellschaftliche Ordnung genannt,
bei welcher die meisten oder alle für Befriedigung der eignen
Bedürfnisse erforderlichen Güter auf dem Weg des Tausches
(Kaufs) beschafft werden.
Tausend, Einheit der dritten höhern Ordnung im
dekadischen Zahlensystem. Beim Handel mit Stab- und Faßholz
sowie mit Schieferplatten unterscheidet man das Großtausend,
= 1200, von dem ordinären T., = 1000 Stück.
Tausendfuß, s. v. w. Vielfuß.
Tausendfüßer (Myriopoda, Myriopoden), Klasse
der Gliederfüßer (Arthropoden), landbewohnende,
flügellose Tiere mit zahlreichen Körperringen und
Füßen. Der Kopf ist vom Rumpf deutlich abgesetzt,
dagegen zerfällt der letztere nicht, wie bei den Insekten, in
Brust und Hinterleib, sondern bildet einen gleichförmigen,
runden oder platt gedrückten Cylinder. Am Kopf, welcher dem
der Insekten sehr ähnlich ist, befinden sich die zwei
Fühler, die Augen und zwei Kieferpaare. Am Rumpf trägt
jeder Ring ein Paar sechs- bis siebengliederiger Beine, nur bei der
Abteilung der Chilognathen (s. unten) ein jeder, mit Ausnahme der
drei ersten, zwei Paare. Im innern Bau stimmen die T. in den
meisten Punkten mit den Insekten überein. Das Nervensystem
besteht aus dem Gehirn und der sehr langen Bauchganglienkette; die
Augen sind nur selten echte zusammengesetzte (facettierte),
gewöhnlich Gruppen von Einzelaugen, fehlen aber auch wohl
gänzlich. Der Darm durchzieht fast immer in gerader Linie den
Leib vom Mund zu dem am hintern Körperende gelegenen After und
zerfällt in die Speiseröhre mit den in sie mündenden
Speicheldrüsen, den Magendarm mit kurzen Leberschlauchen und
den Enddarm, in welchen auch die zwei oder vier Harnkanäle
(sogen. Malpighische Gesäße) ihren harnartigen Inhalt
entleeren. Das Herz erstreckt sich als pulsierendes
Rückengefäß durch den ganzen Rumpf. Zur Atmung
dienen die Tracheen (s.d.), deren Luftlöcher (Stigmen) an fast
allen Ringen vorhanden sind. Die Geschlechtsorgane (Hode, resp.
Eierstock) sind meist lange, unpaare Schläuche und münden
entweder mit einfacher Öffnung am hintern Körperende oder
mit doppelter (rechter und linker) Öffnung an dem zweiten
Beinpaar aus. Die Eier werden abgelegt; die aus ihnen
hervorkommenden Jungen haben erst wenige (bei den Chilognathen
sogar nur drei) Beinpaare und Ringe, erhalten dieselben aber durch
eine Reihe von Häutungen nach und nach, indem hinten stets
neue Ringe sich abschnüren. Die T. leben unter Steinen oder
Baumrinde, an feuchten, dunkeln Orten und in der Erde; die
Chilopoden ernähren sich räuberisch von Insekten und
andern kleinen Tieren, die Chilognathen von vegetabilischer Kost,
besonders von modernden Pflanzenteilen und Aas. Man kennt 500-600
Arten, welche meist den Tropen angehören. Fossile Reste findet
man im Jura, viel zahlreicher aber im Bernstein. Man teilt die T.
in zwei Gruppen: 1) die Schnurasseln oder Chilognathen
(Chilognatha); je zwei Beinpaare an den mittlern und hintern
Leibesringen; hierher unter andern die Gattung Julus
(Vielfuß, s. d.); 2) die Lippenfüßer oder
Chilopoden (Chilopoda); an jedem Ring nur ein Beinpaar; die beiden
ersten Paare als Kieferfüße dicht an den Mund
gerückt (daher der Name Lippenfüßer); hierher unter
andern die Gattung Scolopendra (Skolopender, s. d.). Vgl. Latzel,
Die Myriopoden der österreichisch-ungarischen Monarchie (Wien
1880-84, 2 Bde.).
Tausendgraufläschchen, f. Spezifisches Gewicht.
Tausendgüldenkraut, f. Erythraea.
Tausendjähriges Reich, s. Chiliasmus.
Tausendschön, s. Amarantus und Bellis.
Tausendundeine Nacht, berühmte alte Sammlung
morgenländ. Märchen und Erzählungen, über deren
Ursprung viel gestritten worden ist. Man hat sie für
indischen, persischen, arabischen Ursprungs gehalten; jedenfalls
haben alle diese Länder ihre Beiträge dazu geliefert. Die
jetzige Gestalt des Ganzen bietet ein anschauliches Bild arabischen
Lebens dar. Das Werk scheint in seinen Grundzügen im 9. Jahrh.
n. Chr. entstanden zu sein, und es mag ihm die ältere
persische Sammlung "Hêsar efschâne" ("Die 1000
Märchen") des Rasti zu Grunde liegen. Das Ganze in seiner
jetzigen Gestalt stammt aus Ägypten und zwar aus dem 15.
Jahrh. und wurde im Abendland erst durch Gallands "Les mille et une
nuits" (Par. 1704-1708, 12 Bde.; in den verschiedenen Auflagen
vermehrt von Caussin de Perceval u. a.) bekannt. Die
vollständigste deutsche Übersetzung der Gallandschen
Bearbeitung ist die von Habicht, v. d. Hagen und Schall (5. Aufl.,
Bresl. 1840, 15 Bde.). Neue, selbständig nach dem Original
gearbeitete Übersetzungen ins Deutsche lieferten Weil (neueste
Ausg., Stuttg. 1889, 4 Bde.) und König (neue Ausg.,
Brandenburg 1876, 4 Bde.), ins Englische Lane (neueste Ausg., Lond.
1877, 3 Bde.). Eine Ausgabe des Originals besorgten Habicht und
Fleischer (Bresl. 1825-1843, 11 Bde.) sowie Macnaghten (Kalk.
1839-42, 4 Bde.). Unter den mannigfachen Nachbildungen der Sammlung
sind Petit de la Croix und Lesages "Mille et un jours" (Par. 1710,
5 Bde.; deutsch von v. d. Hagen, Prenzl. 1836, 11 Bde.), ferner
"Les mille et une heures" (Amsterd. 1733, 2 Bde.) und "Les mille et
un quart d'heure" (Haag 1715-17, 3 Bde.) zu nennen.
Tausig, Karl, Klavierspieler, geb. 4. Nov. 1841 bei
Warschau, war bis zum 14. Jahr Schüler seinem Vaters,
genoß später in Wien noch den Unterricht Boklets,
Thalbergs und Liszts, machte Kunstreisen, lebte dann in Dresden,
1861-62 in Wien und von 1866 an als königlicher Hofpianist in
Berlin, wo er bis 1870 eine Akademie für Klavierspiel leitete.
Er starb bereits 17. Juli 1871 in Leipzig. Als genialer Virtuose
von keinem seiner Zeitgenossen übertroffen, ließ sich T.
so wenig wie sein Vorbild Liszt dazu verleiten, seine Kraft jemals
anders als im Dienste der reinsten Kunst zu verwenden. Gleich
groß als Interpret der klassischen wie der modernen
Klaviermusik, konnte er auch als Lehrer nach allen Seiten anregend
wirken und einen für die Kürze seiner Kunstlerlaufbahn
außerordentlichen Einfluß ausüben. Von seinen
Kompositionen sind nur wenige veröffentlicht. Weite
Verbreitung fanden seine Klavierbearbeitungen Wagnerscher Opern (z.
B. der Klavierauszug der "Meistersinger") und die von ihm
veranstaltete Ausgabe des Clementischen "Gradus ad parnassum". Vgl.
Weitzmann, Der letzte der Virtuosen (Berl. 1868).
Tautazismus (griech.), Häufung von gleichen
Anfangslauten in nacheinander stehenden Silben oder
Wörtern.
Tautochrone (Isochrone, griech.), Linie gleicher
Fallzeit, s. Cykloide und Fall, S. 16.
Tautochronische erfcheinuugen, in der Astronomie
Erscheinungen, welche für alle Beobachter in demselben
absoluten Moment stattfinden, wie die Mondfinsternisse, die
Verfinsterungen der Jupitermonde; auch solche, welche, wie die
Schwingungen eines Pendels, in genau gleichen Zeiträumen
stattfinden.
550
Tautogramm - Taxation.
Tautogramm (griech.), Gedicht mit demselben
Anfangsbuchstaben in allen Zeilen.
Tautologie (griech.), Bezeichnung eines Begriffs durch
zwei oder mehrere gleichbedeutende Ausdrücke (z. B. einzig und
allein, bereits schon). Insofern die T. ganz dasselbe noch einmal,
wenn auch mit andern Worten, fagt, unterscheidet sie sich vom
Pleonasmus (s. d.), der nur mehr, als zur Deutlichkeit unbedingt
erforderlich ist, ausdrückt.
Tauwerk der Schiffe wird vom Reepschläger aus Hanf oder
Manilahanf hergestellt. Man spinnt den Hanf zunächst in
Garne von ca. 340 m Länge, die geteert und in der Anzahl von
2-18 zu Leinen oder zu 18-50 zu einem Kardeel zusammengedreht
werden. 3-5 Kardeele geben eine Trosse, ausmehreren Trossen bildet
man ein Kabel. Trossen und Kabel benennt man nach ihrem Umfang in
Zentimetern (3-50 cm) und nach ihrer Anfertigung: drei-, vier- oder
fünfschäftig; rechts oder links geschlagen (gedreht).
Laufendes Gut ist dreischäftig rechts geschlagen, stehendes
vierschäftig links geschlagen, während die Kardeele, aus
denen letzteres besteht, ebenfalls rechts geschlagen sind. Bei
Drahttauwerk treten Eisendrähte an Stelle der Garne (f.
Drahtseile).
Tavannes (spr. -wánn), Gaspard de Saulx de, franz.
Marschall, geb. 1509 zu Dijon, kam als Page an den
französischen Hof, widmete sich dann der militärischen
Laufbahn, zeichnete sich in den Kriegen unter Franz I. und Heinrich
II. aus, bewies sich in der Zeit der Hugenottenkriege als eins der
fanatischten Häupter der katholischen Partei, ward 1569 nach
den Siegen von Jarnac und Moncontour Marschall und entflammte in
der Bartholomäusnacht 1572 persönlich den Pariser
Pöbel zur Ermordung der Protestanten; starb 1573 auf dem
Schlosse Suilly bei Autun. Seine Briefe an Karl IX. wurden 1857
veröffentlicht, "Lettres diverses" von Barthélemy 1858.
Seine Biographie verfaßte sein Sohn Jean (Lyon 1657). - Sein
Sohn Guillaume de Saulx de T., geb. 1553, gest. 1633,
hinterließ "Mémoires historiques", von 1560 bis 1596
reichend (Par. 1625).
Tavernikus (Tavernicorum regalium magister),
Schatzmeister, ehemals Titel des ungarischen
Reichswürdenträgers, der den königlichen Schatz zu
verwalten hatte, und unter welchem die königlichen Städte
standen. Später wurde die Verwaltung des Schatzes einem eignen
Beamten übergeben, und der T. fungierte als oberster Aufseher
eines Teils der königlichen Städte, der sogen.
Tavernikalstädte, als Mitglied des königlichen Rats und
des obersten Gerichtshofs (Tavernikalgericht). Noch später war
der T. Mitglied der königlich ungarischen Statthalterei und
der Septemviraltafel sowie in Verhinderung des Palatins und des
Judex curiae Präsident der Magnatentafel. Gegenwärtig
besteht die Würde des T.(Tavernikat) nur noch als Titel.
Tavetscher Thal, Alpenthal im schweizer. Kanton
Graubünden, oberhalb Disentis, vom Vorderrhein durchflossen,
mit (1880) 784 Einw. Hauptort ist Sedrun (1398 m).
Tavira, wohlgebaute Stadt in der portug. Provinz Algarve,
an der Südküste, zu beiden Seiten des Rio Sequa, mit
maurischem Kastell, 2 Kollegiatkirchen, Hospital, Schwefelbad
(26° C.), Hafen, Sardellen- und Thunfischfang und (1878) 11,459
Einw.
Tavistock, Stadt in Devonshire (England), nördlich
von Plymouth, am Tavy, der hier zwischen engen Ufern rasch
dahineilt, hat eine Abteiruine, 2 Lateinschulen, Kupfer- und
Bleigruben und (1881) 6914 Einw. Es ist Geburtsort von Franz
Drake.
Taviuni (Vuna), eine der Fidschiinseln,
südöstlich von Vanua Levu und durch die Somo Somo-Passage
von demselben getrennt, 553 qkm. Der Mittelpunkt dieser
schönsten und fruchtbarsten aller Inseln der Gruppe hebt sich
800 m über den Meeresfpiegel und hat auf seiner Spitze einen
See, vermutlich die Ausfüllung eines erloschenen Kraters.
Tavolara (bei den Römern Bucina), unbewohnte Insel
an der Nordostküste der Insel Sardinien, zur italienischen
Provinz Sassari gehörig, hat einen Umfang von 22 km,
beherbergt wilde Ziegen und lieferte ehemals Purpurschnecken.
Tawastehus, Gouvernement im Großfürstentum
Finnland, von den Gouvernements Nyland, Abo, Wasaund St. Michel
begrenzt, 21,584 qkm (392 QM.) groß mit (1886) 240,896 Einw.,
ist im allgemeinen gebirgig, hat eine große Menge Seen und
Flüsse und ist relch bewaldet. Der Boden ist im ganzen
fruchtbar, und der Ackerbau wird mit Erfolg betrieben. - Die Stadt
T. (finn. Hämeenlinna), am See Wanajäjärvi gelegen,
durch Zweigbahn mit der Linie St. Petersburg-Helsingfors verbunden,
hat 4098 Einw. und ist Sitz des Gouverneurs. Dabei Schloß
Kronoborg oder Tawasteborg, von Birger Jarl 1249 erbaut, jetzt
Kaserne und Besserungsanstalt.
Tawastland, Landschaft im Innern von Finnland, etwa dem
Gouvernement Tawastehus entsprechend.
Taxation (lat.), Schätzung oder Wertbestimmung einer
zum Verkauf, zum Austausch oder zur Übergabe bestimmten Sache,
geschieht auf Anordnung einer Staatsbehörde oder auf
Veranlassung von Privatpersonen durch Taxatoren,
Sachverständige, welche von den Parteien in gleicher Anzahl
vorgeschlagen oder gemeinschaftlich gewählt oder von der
Behörde ernannt werden. Wo eine Grundsteuer erhoben wird,
stellt der Staat Taxatoren an, welche die Abschätzungen der
Bodengüte (Bonitierung, s. d.) unter der Anleitung von
Ökonomiekommissaren vornehmen. Gleiches geschieht unter
Mitwirkung der Behörden, wenn Grundstücke auf dem Weg der
Expropriation verkauft werden sollen; bei Truppenbewegungen (z. B.
Manövern), durch welche Saaten vernichtet werden, beiden
Vorkehrungen gegen gefährliche Feinde der Pflanzen, bei
Ausbruch der Rinderpest, Hagelschaden, Viehsterben etc. Die auf
Feldern etc. stehende Kreszenz oder der für diese gemachte
gesamte Bestellungsaufwand wird Gegenstand einer T., um
festzustellen, wieviel ein anziehender Pachter oder Käufer
eines Guts dem Vorgänger an Entschädigung zu zahlen hat,
soweit nicht eine Verpflichtung für ihn vorlag. Schwieriger
ist die T. bei Ablösungen von Gerechtsamen, um zu ermitteln,
welchen Wert die Gerechtsame für den Berechtigten hatten. Je
nachdem die Zeitströmung dem Berechtigten oder dem Belasteten
günstig war, hat man den ermittelten Gesamtjahreswert solcher
Gerechtsame (abzüglich der Kosten) mit 14, 15, 16, 17, 18
multipliziert, um die Ablösungssumme festzustellen. Die T. bei
Gewannwegsregulierungen, Separationen und Meliorationsarbeiten
fordert zunächst eine Feststellung des Wertes aller
Grundstücke, welche verändert oder dem Besitzer genommen
werden sollen; sodann wird der gesamte Kostenaufwand entsprechend
auf die Beteiligten ausgeschlagen und schließlich jedem
wieder ein dem Wert seines frühern Besitztums analoger Wert
überwiesen. Die T. am Schluß eines Geschäftsjahrs
und zu Beginn eines Betriebs (Inventur) besteht in der Ermittelung
des gesamten Vermögens, soweit solches zum Geschäft
verwendet wird. Wieder eine andre Art der T. wird seitens derer,
die
551
Taxationsrevision - Taxodium.
Geld auf Hypothek darleihen wollen, vorgenommen: die Kredit-
oder Grundwerttaxe. Da, wo eine gute Buchführung mit
regelmäßiger Inventur sich findet, bedarf es einer
solchen besondern Taxe nicht. In den meisten Fällen
begnügt man sich aber mit einer durch ortskundige Personen
gerichtlich abgegebenen Taxe der Grundstücke und der
Gebäude, und das gesamte Inventarium, der bewegliche
Vermögensteil, bleibt ausgeschlossen. Vielfach fertigt man
jedoch auch, um die Höhe des zu gewährenden Kredits zu
bemessen, einen besondern Anschlag über das zu erwartende
wirtschaftliche Ergebnis und zwar in etwa derselben Weise an, wie
es bei Kauf und Verpachtung üblich ist, den sogen.
Ertragsanschlag (s. d.). Vgl. Birnbaum, Landwirtschaftliche
Taxationslehre (Berl. 1877); Pabst, Landwirtschaftliche
Taxationslehre (3 Aufl., Wien 1881); v. d. Goltz,
Landwirtschaftliche Taxationslehre (Berl. 1880-82, 2 Bde.).
Vorzügliche Details finden sich in Block, Beiträge zur
Landgüterschätzungskunde (Bresl. 1840), und in dessen
"Mitteilungen landwirtschaftlicher Erfahrungen etc." (das. 1836-39)
sowie in den entsprechenden Werken von v. Flotow, Kleemann, v.
Honstedt, Meyer, Kreyßig etc., in Krämer,
Landwirtschaftliche Berechnungen (Stuttg. 1858), und Graf zur
Lippe, Der landwirtschaftliche Ertragsanschlag (Leipz. 1862).
Taxationsrevision, die periodische Berichtigung, bez.
Fortsetzung der Forsteinrichtung (s. d.) mit Rücksicht auf die
im Wald- und Wirtschastszustand eingetretenen Veränderungen.
Dergleichen Revisionen sollen etwa alle zehn Jahre vorgenommen
werden. Taxe (franz., v. lat. taxare), Würdigung,
Wertschätzung einer Sache, insbesondere durch vereidete
Schätzer (Taxatoren), welche sich vielfach an bestimmte
Taxgrundsätze zu halten haben; dann der öffentlich
festgesetzte Preis für Waren oder Leistungen, daher auch eine
besonders in Süddeutschland übliche Bezeichnung für
Gebühren und verschiedene Verkehrssteuern (z. B.Taxen für
Anstellung und Beförderung, Stempeltaxe etc.). Früher
wurden auch für notwendige Lebensmittel von der Behörde
Taxen (Polizeitaxen) festgesetzt, man hatte Fleischtaxen (s. d.),
Brottaxen (s. d.), Biertaxen (s. d.) etc., dann auch Lohntaxen (s.
d.) und Zinstaxen (vgl. Wucher). Doch sind viele derselben und zwar
in Deutschland durch die Gewerbeordnung als eine Konsequenz der
Gewerbefreiheit aufgehoben worden. Man ging hierbei von der
Überzeugung aus, daß es der Polizei nicht möglich
fei, einen angemessenen Preis zu bestimmen, wie er sich als
Ergebnis der freien Konkurrenz bilde. Insbesondere vermag sie nicht
den mannigfaltigen, rasch wechselnden Produktionsbedingungen und
den veränderlichen Konjunkturen Rechnung zu tragen. Ist die T.
zu hoch angesetzt, so hat sie keine praktische Bedeutung; ist sie
zu niedrig bemessen, so wird sie nicht allein für den
Verkäufer, sondern auch für den Käufer
schädlich wirken, indem sie das Angebot herabdrückt und
eine volle Deckung auch derjenigen Bedarfe verhindert, für
welche gern höhere Preise gezahlt werden. Ein Fehler der
Polizeitaxe ist noch der, daß sie in vielen Fällen den
außerordentlich verschiedenen Qualitäten der einzelnen
Waren sich nicht anzubequemen vermag und auch nicht verhüten
kann, daß sich der Verkäufer durch Verschlechterung der
Ware schadlos halte. Allerdings können Taxen eine Wohlthat
sein, wo die freie Konkurrenz eine beschränkte und eine
Ausbeutung durch monopolistische Preise nicht ausgeschlossen ist.
Sie waren deshalb früher Zwangs- und Bannrechten
gegenüber ein unerläßliches Mittel zum Schutz des
Publikums und sind auch heute noch bei vielen Privilegien und
natürlichen Monopolen (Eisenbahnen) nicht zu entbehren. Die
deutsche Gewerbeordnung läßt darum Taxen zu für
Personen, welche an öffentlichen Orten ihre Dienste oder
Transportmittel anbieten, für Schornsteinfeger, wenn ihnen
Bezirke ausschließlich zugewiesen sind, für
Gewerbtreibende, welche nur in beschränkter Zahl angestellt
sind, insbesondere auch für Apotheker. Die betreffenden
Gewerbtreibenden können jedoch diese Taxen
ermäßigen. Die Bezahlung der approbierten Ärzte
bleibt der freien Vereinbarung überlassen, doch sind Taxen
aufgestellt, welche in streitigen Fällen im Mangel einer
Vereinbarung zur Anwendung kommen sollen. Die Gebührentaxe
für Rechtsanwalte wird durch die Gewerbeordnung nicht
berührt. Über die Preiskurante der Gastwirte s.
Gastwirt.
Taxes assimilées (franz.), in Frankreich die den
direkten Steuern zugesellten Abgaben, wie die Steuer von der Toten
Hand, die Bergbauabgabe etc.
Taxidermie (griech.), die Kunst des Ausstopfens und der
Zubereitung von Tieren für Sammlungen, besteht im wesentlichen
in dem Abbalgen oder in der Entfernung aller
fäulnisfähigen Weichteile aus dem Hautsack, Anfüllen
desselben mit trocknem Sand oder Ausstopfen des Balgs mit
entsprechend geformten Körpern aus Werg und Trocknen des so
weit hergerichteten Tiers in einer möglichst natürlichen
Stellung. Bei größern Tieren zieht man, um die
nötige Festigkeit zu erzielen, Drähte oder
Eisenstäbe durch das Werg, bildet auch wohl den Körper
oder nur einzelne Teile desselben aus festem Stoff nach und
überzieht ihn dann mit der Haut. Der Erfolg ist wesentlich von
der genauen Beachtung der anatomischen Verhältnisse
abhängig, und eine verbesserte Methode, die Dermoplastik, geht
hierin am weitesten, indem sie die Gestalt des Tiers vor dem
Überziehen der Haut durch plastischen Thon naturgetreu
nachbildet. Um der Beschädigung der ausgestopften Tiere durch
Insekten vorzubeugen, benutzt man Arsenikseife, auch Kampfer mit
Seife und Koloquintentinktur und ähnliche Mittel. Vgl.
Naumann, Taxidermie (2. Aufl., Halle 1848); Martin, Praxis der
Naturgeschichte (2. Aufl., Weim. 1876-82, 3 Tle.); Eger, Der
Naturaliensammler (5. Aufl., Wien 1882); Förster, Anleitung
zum Ausstopfen (Osnabr. 1887).
Taxineen (Eibengewächse), Pflanzenfamilie in der
Ordnung der Koniferen (s. d.).
Taxionomie (griech.), Ordnungslehre, Systematik.
Taxis (griech.), die Reposition von
Eingeweidebrüchen (s. Bruch, S. 485).
Taxis, s. Thurn und Taxis.
Taxites Brongn., vorweltliche Pflanzengattung unter den
Koniferen (s. d., S. 1013).
Taxodium Rchd., (Taxodie, Sumpfcypresse, Sumpfzeder,
Eibencypresse), Gattung der Kupressineen, hohe Bäume mit
eirund länglicher Krone und deutlich hervortretendem Stamm,
zerstreut stehenden Ästen, kurzen, auf zwei Seiten mit
hautartigen, linsenförmigen, hellgrünen Blättern
besetzten Zweigen, welche scheinbar ein gefiedertes Blatt
darstellen und meist im Herbst abfallen, monözischen
Blüten und rundlichen, nicht großen Fruchtzapfen am Ende
verkürzter Äste. T. distichum L. (kalifornische Zeder)
ist ein 30-40 m hoher Baum mit wagerecht stehenden Hauptästen,
im Winter abfallenden Zweigen und linienförmigen, oben
abgerundeten, aber mit einer Spitze endigenden Blättern, deren
Mittelnerv auf der Oberfläche eingesenkt ist. Die Wurzeln
breiten sich zum Teil auf der Oberfläche des Bodens aus und
bilden häufig über demselben bis
552
Taxus - Taylor.
1,5 m hohe kegelförmige Knollen. Der Baum findet sich von
Delaware und Virginia bis Florida und Mexiko, auch in Kalifornien,
besonders aufsumpfigem Boden und an Flußufern und wird bei
uns als einer der schönsten Bäume kultiviert. Er erreicht
ein sehr hohes Alter; De Candolle schätzt das Alter der
Cypresse des Montezuma auf nahe an 6000 Jahre. Man pflanzt den Baum
zur Befestigung der Ufer an Kanälen und benutzt das Holz als
weißes Zedernholz. Der Baum findet sich bereits in
Tertiärschichten.
Taxus L. (Eibenbaum), Gattung aus der Familie der
Taxineen, immergrüne Bäume oder Sträucher der
gemäßigten Klimate der nördlichen Halbkugel mit
weißem Splint und rotbraunem harten Kernholz, zerstreut
stehenden, durch die herablaufenden Blattbasen kantigen Zweigen,
lederigen, spiralig dicht gestellten und fast zweiseitswendigen,
linealischen bis ovaloblongen, flachen, oft sichelförmig
gekrümmten, kurz stachelspitzigen Blättern,
diözischen Blüten, auf der Spitze eines Kurztriebes in
den Blattachseln stehenden, fast kugeligen männlichen
Blütenkätzchen und einzeln an der Spitze eines
Kurztriebes stehenden weiblichen Blüten, deren kurze,
napfförmige Hülle sich zu einem fleischigen, hochroten,
den Samen bis fast zur Spitze umhüllenden, aber offenen
Fruchtbecher entwickelt. Man kennt sechs Arten, unter denen eine
europäische. T. baccata L. (gemeiner Taxbaum, Roteibe), ein
bis 12-15 m hoher, meist aber niedrigerer Baum oder (in Kultur)
Strauch mit 2,5 cm langen, am Rand kaum umgeschlagenen, oberseits
dunkelgrünen, unterseits hellgrünen (nicht blauweiß
gestreiften, wie bei der Tanne) Blättern, hell scharlachroten
Scheinfrüchten u. blauvioletten Früchten, wächst in
Wäldern Mittel- und Südeuropas von den britischen Inseln,
dem mittlern Norwegen, Schweden und Rußland
südwärts bis Spanien, Sizilien, Griechenland und zum
Kaukasus, in Deutschland jetzt nur noch sehr zerstreut, besonders
auf Kalkboden in der Eichen- und Buchenregion. Die Eibe findet sich
ferner auf den Azoren, in Algerien, in Vorderasien, am Himalaja, am
Amur; sie soll ein Alter von 2000 Jahren erreichen. Man benutzt sie
zu Lauben, Hecken, und namentlich zu Ludwigs XIV. Zeiten spielte
sie eine große Rolle in den Gärten. Das Holz ist
ungemein fest und fein (deutsches Ebenholz, Eibenholz) und dient zu
Schnitzereien, Haus- und Tischgeräten, ehemals auch zu
Armbrüsten. Die Früchte sind genießbar, von fadem
Geschmack, die Blätter aber giftig, Als Emmenagogum und
Abortivum werden sie noch jetzt vom Volk benutzt. Bei den Alten war
der T. ein Baum des Todes; die Furien trugen Fackeln von Eibenholz,
und die Priester bekränzten sich im innern Heiligtum von
Eleusis mit Myrten- und Taxuszweigen. Mehrere Varietäten,
besonders T. hibernica Mack., mit aufrecht stehenden Zweigen, aus
Irland und andre Arten aus Nordamerika und aus dem östlichen
Asien werden bei uns als Ziersträucher kultiviert.
Tay (spr. teh), Fluß in Perthshire (Schottland),
entspringt als Dochart im Gebirge nördlich vom Loch Lomond,
fließt nordöstlich durch den Loch T., tritt bei Dunkeld
in das fruchtbare Strathmore ein und mündet durch den Firth of
T. in die Nordsee. Der T. ist besonders in seinem obern Lauf sehr
reißend und bildet bei Mones einem schönen Wasserfall.
Seeschiffe können auf ihm mit der Flut bis nach Perth fahren.
Seine bedeutendsten Nebenflüsse sind: der Tummel mit Garry,
die Isla und der Earn. Die großartige Eisenbahnbrücke
über den T., oberhalb Dundee, die 1877 gebaut wurde und 3,2 km
lang war, stürzte Weihnachten 1879 mit einem über sie
hineilenden Zug in die Fluten. Seit 1883 ist indes vom Ingenieur W.
H. Barlow eine neue Brücke erbaut worden, die auf eisernen,
mit Zement gefüllten Cylindern ruht, 3214 m lang und 18,3 m
breit ist, 85 Öffnungen hat (11 zu je 75,3 m) und in der Mitte
sich 23,5 m über den mittlern Wasserstand erhebt.
Taÿgetos (auch Taygeton, jetzt Pentedaktylon,
"Fünffingerberg"), Gebirge im Peloponnes, zieht sich als
Grenze zwischen Lakonien und Messenien von der Grenze Arkadiens bis
zum Vorgebirge Tänaron hinab, eine ununterbrochene Kette
bildend, durch welche nur ein einziger, sehr beschwerlicher
Paß, die sogen. Langada (von Sparta nach Kalamata),
hindurchführt. Die höchsten, mit Schnee bedeckten Spitzen
hießen Taleton (2409 m hoch) und Euoras.
Taylor (spr. tehler), 1) Zachary, zwölfter
Präsident der Vereinigten Staaten von Nordamerika, geb. 24.
Nov. 1784 in Orange County im Staat Virginia, verlebte seine Jugend
in Kentucky, wohin seine Eltern als Farmer übersiedelten, ward
1808 Leutnant in einem Infanterieregiment, 1812, nachdem er mit 50
Mann im Fort Harrison am Wabashfluß 5. Sept. 1812 die
Angriffe zahlreicher Indianerscharen mit Erfolg
zurückgeschlagen, Major und 1832 Oberst des 6.
Infanterieregiments, an dessen Spitze er im Blackhawkkrieg unter
Scott focht. Auch an dem Feldzug gegen die Indianer in Florida 1836
nahm er als General mit Auszeichnung teil, und im Dezember 1837
erfocht er an der Spitze einer Brigade über die Indianer einen
blutigen Sieg am See Okitschobi. Nachdem er das Oberkommando in
Florida noch bis 1840 geführt, erhielt er das Kommando im
ersten, die Staaten Louisiana, Mississippi und Alabama umfassenden
Militärdepartement, 1845 aber den Oberbefehl über die
nach Texas bestimmte Okkupationsarmee. Er überschritt 1846 im
Kriege gegen Mexiko den Rio Grande, nahm nach einer Reihe kleiner
Gefechte Monterey (24. Sept.), erfocht 22. und 23. Febr. 1847 mit
seinen 6000 Mann über Santa Annas 21,000 Mann einen
entscheidenden Sieg und schlug im April noch ein andres Korps
Mexikaner bei Tula. Diese Erfolge hatten ihm solche
Popularität erworben, daß er von der Whigkonvention in
Philadelphia als Kandidat für die Präsidentschaft
aufgestellt, 7. Nov. 1848 mit bedeutender Majorität
gewählt ward und 4. März 1849 sein Amt antrat. Aber
40jährige Kriegsstrapazen hatten seine Gesundheit untergraben,
und er starb nach kurzer unparteiischer Verwaltung schon 9. Juli
1850 in Washington
2) Henry, engl. Dichter und Schriftsteller, geb. 1810 in der
Grafschaft Durham, trat im Kolonialamt in den Staatsdienst,
verheiratete sich mit der Tochter Lord Monteagles, wurde 1873 zum
Ritter erhoben und starb 27. März 1886 in Bornemouth. Als
Dramatiker begann er mit "Isaac Comnenus" (1827); dann folgte die
zweiteilige historische Tragödie "Philip van Artevelde"
(1829), sein Hauptwerk, von ihm selbst als "historischer Roman in
dramatischer und rhythmischer Form" bezeichnet, durch kräftige
Charakteristik ansprechend und reich an wirkungsvollen Szenen. Von
seinen übrigen, wiederholt aufgelegten Stücken nennen
wir: "Edwin the Fair" (1842), "The virgin widow" (1850) und "St.
Clement's eve" (1862). Außerdem schrieb er: "The statesman",
eine Abhandlung voll scharfer und feiner Beobachtungen (1836); "The
eve of the conquest, and other poems" (1847); "Notes from life"
(1847); "Notes from books" (1849); "A Sicilian summer, and minor
poems" (1868) u. a. Seine gesammelten
553
Taylors Lehrsatz - Teano.
"Works" erschienen 1877-78, 5 Bde.; seine "Autobiography" 1885,
2 Bde. Seine "Correspondence" gab Dowden heraus (1888).
3) Tom, engl. Dramatiker und Humorist, geb. 1817 bei Sunderland
als Sohn einer Deutschen, studierte in Glasgow und Cambridge, wurde
Rechtsanwalt, dann Professor der englischen Litteratur am
University College in London, trat 1850 in den Staatsdienst, ward
1854 Hauptsekretär des Gesundheitsamtes und bei Auflösung
dieser Behörde nach 21jähriger Dienstzeit in Ruhestand
versetzt. Inzwischen hatte er als Kunstkritiker der "Times"
bedeutenden Einfluß erworben, als Mitarbeiter des "Punch"
viel Heiteres geschrieben und besonders als dramatischer
Schriftsteller sich hervorgethan. Mehr als 100 Stücke sind aus
seiner Feder hervorgegangen, freilich viele nach fremden Mustern.
"The fool's revenge", "An unequal match". "The ticket-of-leave
man", "Clancarty" haben sich auf der Bühne erhalten, ebenso
die historischen Dramen: "Twixt axe and crown", "Joan of Arc" und
"Anne Boleyn". Während der letzten acht Jahre seines Lebens
war er Herausgeber des "Punch". Er starb 12. Juli 1880 in London.
Auch als Herausgeber der Biographien englischer Künstler, wie
Haydons (1853), Leslies (1859), Reynolds (1865), sowie eines
"Catalogue of the works of Sir J. Reynolds" (1869) hat sich T.
verdient gemacht.
4) Bayard, nordamerikan. Tourist, Schriftsteller, und Dichter,
geb. 11. Jan. 1825 zu Kennett Square in Pennsylvanien, wurde mit 17
Jahren Buchdruckerlehrling in Westchester, widmete sich nebenbei
der Litteratur und den schönen Wissenschaften und machte mit
seinen Ersparnissen 1844-46 eine Fußtour durch Europa,
worüber er in "Views afoot" (1846) berichtete. Darauf lebte er
zu New York als Mitredakteur an der "New York Tribune" und machte
1848, nachdem er seine "Rhymes of travel" veröffentlicht, im
Auftrag des genannten Blattes eine Reise nach Kalifornien, die er
in "El Dorado" (1849) beschrieb. Seine "Poems and ballads"
erschienen 1851, ebenso sein "Book of romances, lyrics and songs".
In demselben Jahr unternahm er eine Reise nach dem Orient und ins
Innere von Afrika. Im Oktober 1852 begab er sich von England
über Spanien nach Bombay und von da nach China, wo er der
amerikanischen Gesandtschaft beigegeben wurde. Darauf begleitete er
Kommodore Perrys Flottengeschwader nach Japan und kehrte Ende 1853
nach New York zurück. Seine Reiseberichte veröffentlichte
er in der "Tribune", später in Buchform: "A journey to Central
Africa" (1854), "The lands of the Saracen" (1855) und "A visit in
India, Japan and China" (1856). Von 1856 bis 1858 von neuem auf
Reisen, besuchte er namentlich Lappland und Norwegen, dann
Griechenland und Kreta, Polen und Rußland. Früchte
dieser Reisen waren die Schriften: "Northern travel" (1857) und
"Travels in Greece and Russia" (1859). Nachdem sich T. 1857 mit der
Tochter des Astronomen Hansen in Gotha vermählt (die in der
Folge viele seiner Schriften ins Deutsche übertrug), baute er
sich in Cedarcroft bei Philadelphia ein Landhaus, wo er
zunächst seinen Wohnsitz aufschlug, verweilte dann 1862-63 als
Gesandtschaftssekretär in Petersburg, machte 1865 einen
Sommerausflug durch die Felsengebirge, war 1866-68 und wiederum
1872-1874 von neuem in Europa, vorzugsweise in Thüringen,
Italien und in der Schweiz, von wo er auch Abstecher nach
Ägypten und nach Island machte, und wurde im Mai 1878 vom
Präsidenten Hayes zum Gesandten der Vereinigten Staaten in
Berlin ernannt, wo ihn 19. Dez. 1878 ein plötzlicher und
früher Tod ereilte. Von Reisebeschreibungen erschienen noch:
"Home and abroad" (1859, 2. Serie 1862), "Colorado" (1867), "Byways
of Europe" (1869) und "Egypt and Iceland" (1875). Seine poetischen
Arbeiten umfassen noch die Sammlungen: "Poems of the Orient"
(i854), "Poems of home and travel" (1855), "The poet's journal"
(1862), das didaktische Gedicht "The picture of St. John" (1866),
die Idylle: "Lars (1873) und "Home pastorals" (1875) sowie mehrere
dramatische Dichtungen: "The masque of the gods" (1872), "The
prophet" (1874), "Prince Deukalion" (1878) und eine meifterhafte
Übertragung von Goethes "Faust" im Versmaß des Originals
(1870-71, 2 Bde.). Außerdem schrieb T. Novellen, wie: "Hannah
Thurston" (l863), "John Godfrey's fortunes" (1865), "The story of
Kennett" (1866), "Joseph and his friend" (1871) u. a., sowie die
Werke: "A school history of Germany" (1874), "The Echo Club"
(1876), eine harmlose Satire auf englische Dichter der Neuzeit, und
die nach seinem Tod erschienenen "Studies in German literature"
(1879) und "Critical essays and notes" (1880). Eine Sammlung seiner
Reisen erschien in 6 Bänden (New York 1881), seine "Complete
poetical works" Boston 1881. Um die Verbreitung der Kenntnis
deutscher Litteratur in Amerika hat sich T. große Verdienste
erworben. Viele seiner Schriften erschienen auch in deutscher
übersetzung, die "Gedichte" von Bleibtreu (Berl. 1879). Vgl.
Conwell, Life, travels and literary career of B. T. (Boston 1879);
Marie Hansen-Taylor und H. Scudder, Life and letters of Bayard T.
(das. 1884, 2 Bde.; deutsch, Gotha 1885).
5) George, Pseudonym, s. Hausrath.
Taylors Lehrsatz, von dem englischen Mathematiker Brook
Taylor (1685-1731) zuerst 1717 in seinem Werk "Methodus
incrementorum" (Berl. 1862) aufgestellte Formel:
f(x+h) = f(x) + h/1 . f'(x) + h2/1.2 . f''(x) + ... ,
wo f'(x), f''(x), ... der erste, zweite etc.
Differentialquotient (s. Differentialrechnung) der Funktion f(x)
sind. Setzt man darin x = 0 und x an die Stelle von h, so
erhält man die Maclaurinsche Reihe:
f(x) = f(0) + x/1 . f'(0) + x2/1.2 f''(0) + ...
welche zur Entwickelung einer Funktion in eine nach Potenzen von
x fortschreitende Reihe dient.
Tayport (spr. téh-), Stadt, s. Ferry-Port on
Craig.
Taytao, Halbinsel an der Ostküste Patagoniens,
südlich von Chonosarchipel, dicht bewaldet, durch zahlreiche
Fjorde eingeschnitten und 1200 m hoch; endet im SW. mit dem steilen
Kap Tres Montes.
Tazette, s. Narcissus.
Tazie (arab., "bemitleiden"), eine Art Passionsspiele auf
das tragische Schicksal Hassans und Husseins sowie der Aliden
insgesamt, welche im schiitischen Persien und Hindostan
während des Monats Muharrem mit besonderer Feierlichkeit
aufgeführt werden. Einzelne derselben sind auch in Europa
durch Übersetzung bekannt geworden. Taziechan, die Sänger
und Darsteller dieser Spiele. Vgl. Gobineau, Les religions de
l'Asie centrale (2. Aufl., Par. 1866).
Te, in der Chemie Zeichen für Tellur.
Teakbaum (Tikbaum), s. Tectona.
Teano (das antike Teanum), Stadt in der ital. Provinz
Caserta, an der Eisenbahn Rom-Neapel, mit Calvi Sitz eines Bistums,
hat eine Kathedrale mit antiken Säulen, Überreste von
Bauwerken der
554
Teb, El - Technische Hochschulen.
alten Stadt (zur Zeit Strabons nach Capua der beeutendste
Binnenort Kampaniens), ein Gymnasium, eine technische Schule, eine
Mineralquelle, Öl- und Getreidehandel und (1881) 4969
Einw.
Teb, El, Oase in Nubien, südlich von Suakin, auf dem
Weg von Trinkitat am Roten Meer nach dem Fort Tokar. Hier 29. Febr.
1884 siegreiches Gefecht des englischen Generals Graham gegen die
Mahdisten, worauf Tokar besetzt wurde.
Teba, Eugenie Marie de Guzman, Gräfin von, s.
Eugenie 1).
Tebbes, Stadt in der pers. Provinz Irak Adschmi, dicht an
der Grenze von Chorasan, liegt in einer von Bergen umrahmten Ebene,
inmitten eines schmalen Kulturgürtels, besitzt Mauern und eine
Citadelle, die sich aber nicht in verteidigungsfähigem Zustand
befinden, hat weder Bazare noch viel Handel und produziert nur
etwas Seide. Das Klima ist sehr heiß, trotzdem T. etwa 630 m
ü. M. liegt. Die Einwohnerzahl dürfte 40,000 nicht
erreichen.
Tebet (hebr.), im jüd. Kalender der 4. Monat des
bürgerlichen, der 10. des Festjahrs, vom Neumond des Januars
bis zu dem des Februars.
Tebriz (Täbris, Tauris), Hauptstadt der pers.
Provinz Aserbeidschân, in einer fruchtbaren Ebene am
Adschitschai 1348 m hoch gelegen, ist im allgemeinen schlecht
gebaut, hat einige Befestigungen, eine verfallene mittelalterliche
Burg mit Zeughaus, eine Villa des Thronfolgers, zahlreiche
(angeblich 318) Moscheen (darunter sehenswert die Ruine der
berühmten blauen Moschee), 5 armenische Kirchen, reiche Bazare
mit fast 4000 Läden, 166 Karawanseraien, Fabrikation von
seidenen und baumwollenen Zeugen, Teppichen und Lederwaren,
bedeutenden Handel und 160-170,000 (darunter ca. 3000 armenische)
Einw. Im 18. Jahrh. sehr heruntergekommen, verdankt die Stadt ihren
erneuerten Wohlstand namentlich dem starken Transitverkehr
über Eriwan, Tiflis und Poti zwischen Europa und Persien,
welcher T. zur ersten Handelsstadt Persiens gemacht hat. - T. wurde
792 von Zobeide, der Gemahlin des Kalifen Harun al Raschid,
gegründet. Am 6. Aug. 1605 hier Sieg der Perser über die
Türken; 1725 wurde die Stadt von den Türken erobert; bis
1828 war sie die Residenz des Kronprinzen Abbas Mirza, wurde aber
im Oktober 1827 von den Russen besetzt, worauf hier 2. Nov. der
Friede zwischen Rußland und Persien zu stande kam, in welchem
letzteres das Chanat Eriwan an Rußland abtrat. Am 23. Sept.
1854 litt die Stadt durch ein Erdbeben.
Tebu, Volksstamm, s. Tibbu.
Tecax (spr. -aß), Stadt im mexikan. Staat Yucatan,
75 km südöstlich von Merida, mit Ruinen altindianischer
Bauten und (1880) 9637 Einw.
Tech (spr. teck), Küstenfluß im franz.
Departement Ostpyrenäen, entspringt an der spanischen Grenze
in den Pyrenäen, fließt nordöstlich durch ein
malerisches Thal (Vallspire) und fällt nördlich von
Argelès in das Mittelländische Meer; 82 km lang.
Technik (griech.), Inbegriff der Regeln, nach denen bei
Ausübung einer Kunst verfahren wird, z. B. T. der Malerei.
Daher Techniker, Kunstverständiger, einer, der mit der innern
Einrichtung, dem Zweck und der Wirksamkeit praktischer Anstalten
vertraut ist, wie z. B. Werkführer von chemischen und andern
Fabriken, Münzmeister etc.; technisch, alles auf Gewerbe oder
auf den materiellen Teil der Künste Bezügliche;
technische Ausdrücke (termini technici), Kunstausdrücke,
die in einzelnen Gebieten der Künste, Gewerbe oder auch der
Wissenschaften in eigentümlicher Bedeutung gebräuchlichen
Ausdrücke; technische Anstalten, s. v. w. polytechnische
Schulen. In der Musik bezeichnet T. das Mechanische, sozusagen
Handwerksmäßige der Kunst, das, was gelernt werden kann
und gelernt werden muß. Man spricht daher sowohl von einer T.
der Komposition als einer T. der Exekution, meint indes, wenn man
den Ausdruck schlechtweg gebraucht, zumeist die letztere. Zur
Ausbildung in derselben hat man in neuerer Zeit die sogen.
technischen Studien aufgebracht, d. h. die Urelemente, aus denen
sich musikalische Phrasen, Passagen, Läufe, Verzierungen etc.
zusammensetzen, werden in kleinen Bruchstücken, ohne
Zusammenhang, rein systematisch geübt.
Technische Artillerie, s. Technische Institute der
Artillerie.
Technische Hochschulen, Lehranstalten zur höchsten
technischen Ausbildung namentlich der auf diesem Gebiet leitenden
Staatsbeamten. Nachdem während der ersten zwei Drittel unsers
Jahrhunderts diese Fachschulen in Deutschland sehr verschieden
organisiert waren und mancherlei Schwankungen zwischen den beiden
Idealtypen der höhern Gewerbeschule und des akademischen
Polytechnikums durchzumachen hatten, ist ihre Entwickelung in den
letzten beiden Jahrzehnten zu einem gewissen Abschluß
gelangt. über den geschichtlichen Hergang finden sich einige
Andeutungen unter Polytechnikum (s. d.). Als dessen
Schlußpunkt kann man die 1879 erfolgte Vereinigung der
Bauakademie und der Gewerbeakademie in Berlin zu einer technischen
Hochschule betrachten, der das provisorische Verfassungsstatut vom
17. März 1879 im wesentlichen den Zuschnitt der technischen
Hochschulen zu Zürich und zu München gab. Von 1877 bis
1880, zuletzt März 1880 in Berlin, unter Beteiligung
staatlicher Kommissare abgehaltene Konferenzen von Abgeordneten
sämtlicher deutscher Anstalten (auch von Zürich, Wien,
Brünn, Graz) trugen viel dazu bei, die Organisation der
technischen Hochschulen einheitlich zu gestalten. Die drei
preußischen Hochschulen erhielten unter dem unmittelbaren
Eindruck dieser Vorgänge neue Verfassungsstatute, und zwar
Hannover und Aachen gleichzeitig 7. Sept. 1880, Berlin 22. Aug.
1882. Damals bezog die Berliner Anstalt auch ein neues,
großartiges Gebäude in Charlottenburg. Jene Statuten
stimmen in den Hauptpunkten wörtlich überein; doch ist
naturgemäß auf die größere Ausdehnung und
eigentümliche Stellung der hauptstädtischen Anstalt
Rücksicht genommen. Die wichtigsten Vorschriften des Berliner
Statuts sind folgende: § 1. Die technische Hochschule hat den
Zweck, für den technischen Beruf im Staats- und Gemeindedienst
wie im industriellen Leben die höhere Ausbildung zu
gewähren sowie die Wissenschaften und Künste zu pflegen,
welche zum technischen Unterrichtsgebiet gehören. Die
technische Hochschule ist dem Minister der geistlichen,
Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten unmittelbar unterstellt.
§ 2. An der technischen Hochschule bestehen fünf
Abteilungen: 1) für Architektur, 2) für
Bauingenieurwesen, 3) für Maschineningenieurwesen
(einschießlich Schiffbau), 4) für Chemie und
Hüttenkunde, 5) für allgemeine Wissenschaften, namentlich
Mathematik und Naturwissenschaften. § 3. Mit den
Vorträgen in den einzelnen Disziplinen sind je nach
Bedürfnis praktische Übungen, Besuch der Sammlungen,
Ausflüge etc. verbunden. § 4. Der Unterricht ist nach
Jahreskursen geordnet; Ferien vom 1. Aug. bis 1. Okt., ferner zu
Weihnachten und zu Ostern je 14
555
Technische Institute der Artillerie - Technologie.
Tage. § 5. Die Wahl der Vorträge und Übungen ist
bis auf gewisse naturgemäße Beschränkungen frei.
Doch werden Studienpläne aufgestellt und empfohlen. § 6.
Lehrer sind die Professoren (vom König ernannt), Dozenten,
Assistenten und Privatdozenten. Die Habilitation dieser (§ 7)
vollzieht sich bei den einzelnen Abteilungen ähnlich wie bei
den Fakultäten einer Universität. Überhaupt
verhalten sich Hochschule und Abteilungen wie Universität und
Fakultäten; jene wird vom Rektor und Senat, diese vom
Abteilungskollegium und seinem Vorsteher verwaltet. Der Rektor wird
alljährlich von den vereinigten Abteilungskollegien
gewählt und bedarf der Bestätigung des Königs; die
Vorsteher werden auf ein Jahr gewählt und vom Minister
bestätigt. Für Kassen- und Verwaltungssachen steht dem
Rektor ein Syndikus zur Seite (§ 8-28). Deutsche werden als
Studierende nur mit dem Reifezeugnis eines deutschen Gymnasiums
oder eines preußischen Realgymnasiums und einer
preußischen Oberrealschule ausgenommen; doch berechtigt der
Besuch der technischen Hochschule auf Grund eines
Oberrealschulzeugnisses allein nicht zu einer Staatsprüfung
für den höhern technischen Dienst. Es muß noch
mindestens die Prüfung im Lateinischen an einem Realgymnasium
hinzutreten. Über das regelrechte Studium in einer der vier
ersten Abteilungen werden auf Grund vorgängiger Prüfungen
Diplome ausgestellt (§ 29-33). Doch können auch
Hospitanten vom Rektor zugelassen werden (§ 34-36). Dieselben
Grundzüge kehren in den Verfassungen sämtlicher deutscher
technischer Hochschulen wieder; doch ist die Zahl der Abteilungen
an mehreren dieser Anstalten größer, indem z. B.
Braunschweig noch eine pharmazeutische Abteilung hat, München,
Zürich u. a. eine landwirtschaftliche. In Deutschland gibt es
gegenwärtig neun t. H.: Berlin, Hannover, Aachen,
München, Dresden, Stuttgart, Karlsruhe, Darmstadt und
Braunschweig (Carolinum, jetzt Carolo-Wilhelminum). Diese neun
Anstalten zählten 1878 zusammen: 535 Dozenten und 6433
Studierende. 1883 war die Zahl der Studierenden um 40 Proz. oder
auf 3900 zurückgegangen. Seitdem fand eine langsame Steigerung
der Besuchsziffer statt, so in den preußischen Anstalten von
1386 (1883) auf 1727 (1888), nämlich Berlin 1098 (gegen 897),
Hannover 418 (gegen 318), Aachen 211 (gegen 171). Von diesen 1727
gehörten den einzelnen Abteilungen an für Architektur
326, Bauingenieurwesen 286, Maschinenwesen und Schiffbau 620,
Chemie und Hüttenkunde 277, allgemeine Wissenschaften 3,
woneben noch 215 Hörer im allgemeinen ohne Bezeichnung einer
bestimmten Abteilung zugelassen waren. Die technische Hochschule zu
München zählte 1887: 612 Hörer, die zu Dresden 370,
die zu Zürich 496. Österreichs sechs t. H. zählten
1884 bei 330 Lehrern 2450 Studierende. Die Gesamtzahl der
Studierenden im Winter 1888/89 betrug 1694 gegen 1619 im Vorjahr
und zwar in Wien 745, Prag (deutsch) 182, Prag (tschechisch) 334,
Brünn 122, Graz 154, Lemberg ebenfalls 154. Davon kamen auf
die allgemeine Abteilung 18, Ingenieurwesen 696, Hochbau 136,
Maschinenbau 508, chemische Technik 214 Studierende. Das ungarische
Josephspolytechnikum zu Budapest hatte 1887 bei 47 Lehrkräften
619 Studierende.
Technische Institute der Artillerie sind in Deutschland die
unter militärischer Leitung stehenden Fabriken zur
Anfertigung von Armeematerial und zwar: Artilleriewerkstätten
zu Spandau, Danzig, Deutz, Straßburg i. E., Dresden,
München; Geschützgießereien zu Spandau, Augsburg;
Feuerwerkslaboratorien zu Spandau, Ingolstadt;
Geschoßfabriken zu Spandau, Teil der
Geschützgießerei, Siegburg, Ingolstadt; Pulverfabriken
zu Spandau, Hanau, Ingolstadt, Gnaschwitz (bei Bautzen);
Schießwollfabrik zu Hanau. Die Arbeiter sind Zivilpersonen;
Meister, Werkführer, Ingenieure etc. sind Beamte. In
Österreich-Ungarn umfaßt die technische Artillerie
(Handwerks-, Zeugsartillerie) das Artilleriearsenal, die
Artilleriezeugsfabrik, die 24 Artilleriezeugsdepots und die
Pulverfabrik in Stein.
Technische Militärakademie, in
Österreich-Ungarn die Artillerie- und Genieschule.
Technisches uud administratives Militärkomitee, in
Österreich-Ungarn ein Organ des Reichskriegsministeriums,
besteht aus Artillerie-, Genieoffizieren und Verwaltungsbeamten und
leitet alle diesen Gebieten angehörigen Versuche.
Technische Truppen, Genie-, Eisenbahn- und Telegraphentruppen;
vgl. Technische Institute der Artillerie.
Technoglyphen (griech.), s. Bildstein.
Technologie (griech., Gewerbskunde), die Lehre von den
Mitteln und Verfahrungsarten zur Umwandlung der rohen Naturprodukte
in Gebrauchsgegenstände. Da diese Umwandlung nur durch eine
Änderung des innern Wesens, d. h. der Substanz, nach den
Gesetzen der Chemie oder durch eine Änderung der
äußern Form oder Gestalt nach den Gesetzen der Mechanik
erfolgen kann, so teilt man das Gebiet der T., das die ganze
Industrie umfaßt, ein in chemische und mechanische T. Die
chemische T. beschäftigt sich mit der Darstellung chemischer
Materialien (Alkalien, Säuren, Salze, Farben, Teerfarben,
Ultramarin etc.), der Brenn- und Leuchtstoffe (Kohle, Stearin,
Leuchtgas etc.), der Nahrungs-, Genuß- und Arzneimittel
(Brot, Bier, Branntwein, Zucker, Chinin etc.), mit der
Färberei, Druckerei, Gerberei, Thonwaren-Fabrikation etc. Die
mechanische T. zieht in ihren Bereich die Bearbeitung der Metalle,
des Holzes und ähnlicher Materialien auf Grund ihrer
Arbeitseigenschaften (Gießfähigkeit, Dehnbarkeit,
Schmiedbarkeit, Teilbarkeit), die Verarbeitung der Faserstoffe
(Spinnerei, Seilerei, Weberei, Pavierfabrikätion), die
Verarbeitung der verschiedenen Produkte (Stickerei, Wirkerei,
Flechterei etc.) etc. Eine Menge Gewerbe gehören
selbstverständlich zum Teil der chemischen, zum Teil der
mechanischen T. an, da sie ihrer Natur nach sowohl chemische als
mechanische Prozesse verlangen (Glas, Thonwaren, Kautschuk
etc.).
Als man anfing, den Gewerben eine wissenschaftliche Grundlage zu
geben, lag es nahe, dies in der Weise zu thun, daß man den
Stoff nach den einzelnen Gewerben ordnete und diese besonders
behandelte (Bierbrauerei, Branntweinbrennerei, Färberei,
Gießerei, Schlosserei, Uhrmacherei, Tischlerei, Drechslerei,
Böttcherei, Baumwoll-, Flachs-, Wollspinnerei etc.). Auf
solche Weise entstand die sogen. spezielle T. als eine Lehrmethode,
welche auch jetzt noch Anwendung findet, wenn es sich um die
Darstellung solcher Gewerbe handelt, die wenig oder gar keine
gemeinsamen Anknüpfungspunkte besitzen. Da dies namentlich in
den chemischen Gewerben der Fall ist, weil in der praktischen
Handhabung der chemischen Gesetze solche Verschiedenheiten
obwalten, daß nur einzelne Gegenstände, z. B.
Feuerungsanlagen, vielen zugleich angehören, so ist hier dle
Methode der speziellen T. die Regel. In der Weiterentwickelung der
T. gewann man jedoch noch eine andre Grundlage für die
Behandlung dadurch, daß man Grup-
556
Technopägnia - Tectona.
pen bildete, indem man alle jene Beschäftigungen, welche in
ihren Prozessen, Mitteln, Manipulationen etc. viele
Ähnlichkeit und Gleichheit besitzen, zusammenfaßte und
ohne Rücksicht auf ihre Einzelheiten ordnete und untersuchte.
Weil dadurch die Behandlung eine allgemeinere wird, so heißt
diese Art der Darstellung allgemeine T. Diese Methode reiht alle
Mittel zu gleichem Zweck (Gußformen, Bohrer, Drehbänke
u. dgl.) aneinander, macht sie dadurch übersichtlich und
stellt sie zum Vergleich nebeneinander, weshalb sie auch
vergleichende T. genannt wird. Einer auf die Weise gewonnenen
Gruppeneinteilung ist namentlich das Gebiet der mechanischen T.
fähig, indem z. B. alle Metallarbeiten, alle Holzarbeiten, die
Spinnerei aller Faserstoffe, die Weberei aller Fäden sich in
einzelne Gruppen zusammenfassen lassen. Da diese Methode
außerdem nicht nur die anregendste und die fruchtbarste ist,
sondern es auch allein ermöglicht, das ausgedehnte Gebiet der
mechanischen Industrie zu beherrschen, so hat sie allgemein als
Lehrmethode in der mechanischen T. Eingang gefunden. Innerhalb der
Gruppen gewinnt man in den Arbeitseigenschaften der Materialien
eine weitere Grundlage für die Anordnung und somit einzelne
Kapitel für die Bearbeitung auf Grund der Schmelzbarkeit
(Gießerei), Dehnbarkeit (Schmieden, Walzen, Drahtziehen),
Teilbarkeit (Scheren, Meißel, Hobel, Bohrer, Sägen,
Fräfen etc.). Die Gewerbskunde wurde zuerst als Bestandteil
der kameralistischen Studien, etwa seit 1772 an der
Universität gelehrt. Beckmann (s. d. 2) wurde durch seine
Schriften, in denen er die einzelnen Industriezweige nach der
innern Verwandtschaft ihrer Hauptverrichtungen behandelte, der
Begründer der T., welcher er auch den Namen gab. Nach ihm
waren Hermbstädt in Berlin und Poppe in Tübingen
bedeutend, die neuere Richtung aber erhielt die T. durch Prechtl
und Altmütter in Wien und namentlich durch Karmarsch in
Hannover, welcher der Begründer der allgemeinen,
vergleichenden T. wurde. Die chemische T. wurde in neuester Zeit
besonders durch Knapp in Braunschweig, Heeren in Hannover, Wagner
in Würzburg, die mechanische durch Hartig in Dresden, Hoyer in
München, Exner in Wien gefördert. Die Litteratur der T.
ist außerordentlich reichhaltig. Als Hauptwerke gelten:
Prechtl, Technologische Encyklopädie oder alphabetisches
Handbuch der T., der technischen Chemie und des Maschinenwesens
(Stuttg. 1829-55, 20 Bde.; Supplemente, hrsg. von Karmarsch 1857
bis 1869, 5 Bde.); Karmarsch und Heeren, Technisches
Wörterbuch (3. Aufl. von Kick und Gintl, Prag 1874 ff.);
Karmarsch, Handbuch der mechanischen T. (6. Aufl. von Fischer,
Leipz. 1888 ff.); Kronauer, Atlas für mechanische T., auf
Grundlage von Karmarsch' "Handbuch", mit Erklärungen (Hann.
1862); Hoyer, Lehrbuch der vergleichenden mechanischen T. (2.
Aufl., Wiesb. 1888); Muspratt-Stohmann, Encyklopädisches
Handbuch der technischen Chemie (4. Aufl., Braunschw. 1886 ff.);
Knapp, Lehrbuch der chemischen T. (3. Aufl., das. 1865-75, 2 Bde.);
Bolley-Birnbaums Sammelwerk: "Handbuch der chemischen T." (das.
1862 ff., 8 Bde., in vielen Teilen); R. Wagner, Handbuch der
chemischen T. (12. Aufl., Leipz. 1886); Payen, Handbuch der
technischen Chemie (deutsch von Stohmann und Engler, Stuttg.
1870-74, 2 Bde.); Wagners "Jahresbericht Über die Leistungen
der chemischen T." (Leipz., seit 1855, jetzt hrsg. von Fischer);
Poppe, Geschichte der T. (Götting. 1807-11, 3 Bde.);
Karmarsch, Geschichte der T. seit der Mitte des 18. Jahrhunderts
(Münch. 1871); Blümner, T. und Terminologie der Gewerbe
und Künste bei Griechen und Römern (Leipz. 1875-1884, 3
Bde.); Noiré, Das Werkzeug und seine Bedeutung für die
Entwicklungsgeschichte der Menschheit (Mainz 1880); Lazarus Geiger,
Zur Entwickelungsgeschichte der Menschheit (2. Aufl., Stuttg.
1878).
Technopagnia (griech.), Kunstspielereien, besonders
Gedichte, deren äußere Form eine bestimmte Figur
darstellt (s. Bilderreime).
Teck, langgestreckter Berg nördlich vor dem
Schwäbischen Jura, südlich von Klrchheim, 774 m hoch. Auf
dem Gipfel die Ruine des Stammschlosses der Herzöge von Teck
und eine Felsengrotte (Sibyllenloch).
Teck, im Mittelalter kleines Herzogtum in Schwaben,
welches von der gleichnamigen Burg auf dem ebenfalls gleichnamigen
Berg im württembergischen Donaukrels den Namen führte.
Dieselbe war ursprünglich im Besitz der Herzöge von
Zähringen und kam 1152 an einen Sohn Konrads, Adalbert I.,
welcher aus dem benachbarten Gebiet und dem durch Erbschaft ihm
zufallenden Ulmburg das Herzogtum T. bildete. Letzteres ging 1381
durch Kauf an Württemberg über, doch starb das
herzogliche Geschlecht erst 1439 mit Ludwig, Patriarchen von
Aquileja, aus. Titel und Wappen des Herzogtums wurden 1495 von
Kaiser Maximilian dem Herzog von Württemberg zugesprochen und
1863 von König Wilhelm den Kindern des Herzogs Alexander von
Württemberg (geb. 9. Sept. 1804, gest. 4. Juli 1885) aus
seiner Ehe mit der Gräsin Rhedey (gest. 1. Okt. 1841)
verliehen; der Sohn desselben, Franz, Herzog von T. (geb. 27. Aug.
1837), seit 1866 mit einer Tochter des Herzogs von Cambridge
vermählt, lebt in London.
Tecklenburg, ehemalige Grafschaft im westfäl. Kreis,
330 qkm (6 QM.) groß mit 18,000 Einw., kam nach dem
Aussterben der Grafen von T. 1262 an die Grafen von Bentheim, 1329
an die Grafen von Schwerin und 1562 an den Grafen Arnold III. von
Bentheim, dessen Sohn Adolf 1606 eine besondere Linie T.
gründete. 1699 folgte Graf Wilhelm Moritz von Solms-Braunfels,
der 1707 T. an Preußen verkaufte. Jetzt gehört die
Grafschaft zum gleichnamigen Kreis im Regierungsbezirk
Münster. Vgl. Essellen, Geschichte der Grafschaft T. (Leipz.
1877). - Die Kreisstadt T., am Teutoburger Wald, 235 m ü. M.,
hat eine evangelische und eine kath. Kirche, eine
Schloßruine, ein Amtsgericht, Zigarrenfabrikation und (1885)
897 meist evang. Einwohner.
Tecoma Juss. (Jasmintrompete), Gattung der Bignoniaceen,
Bäume oder kletternde Sträucher mit gefingerten oder
unpaarig gefiederten Blättern und in Trauben oder Rispen
stehenden Blüten. T. radicans Juss. (virginischer Jasmin),
kletternder Strauch in Virginia, mit 10 m langen, an den Gelenken
wurzelnden Zweigen, unpaarig gefiederten Blättern und
scharlachroten Blüten in endständigen Doldentrauben,
gedeiht bei uns in geschützter Lage im Freien, verlangt aber
im Winter gute Deckung. Auch andre Arten werden als
Ziergehölze kultiviert.
Tectona L. fil. (Teakbaum, indische Eiche), Gattung aus
der Familie der Verbenaceen, große Bäume mit
großen, gegen- oder zu drei wirtelständigen, ganzen,
abfallenden Blättern, großen, endständigen
Blütenrispen mit kleinen, weißlichen oder
bläulichen Blüten und vierfächeriger, vom
aufgeblasenen Kelch umgebener Steinfrucht. Drei tropisch asiatische
Arten. T. grandis L. fil. ein schlanker Baum von 40 m Höhe,
mit großen, eiförmigen, unterseits weißfilzigen
Blättern, weißen Blüten und
haselnußgroßen Früchten, findet sich als Waldbaum
in Ostindien
557
Tecuciu - Teer.
zwischen 25° nördl. bis 2° südl. Br. und
73-120° östl. L. v. Gr., in Hinterindien und auf den
Malaiischen Inseln, liefert vortreffliches Nutzholz, welches
besonders für den Schiffbau von höchstem Wert ist, und
wird in neuerer Zeit sorgfältig kultiviert. Man fällt die
Bäume gewöhnlich zwischen dem 40. und 60. Jahr, wo sie
eine Höhe von 17-20 und eine Stärke von 1,3 m besitzen.
Das Holz wird zum Teil in Asien verarbeitet, kommt aber auch in
großen Mengen nach Europa; das siamesische gilt als das
beste. Es ist hell braunrötlich, wird an der Luft braun bis
braunschwarz, riecht stark, angenehm, besitzt das spez. Gew. 0,89,
ist hart, spaltet sich nicht schwer, läßt sich gut
verarbeiten, soll Eichenholz an Dauer um das Dreifache
übertreffen, wird von Insekten und Pilzen nicht angegriffen.
Es dient auch in Indien zu Tempelbauten, zu Dammkonstruktionen etc.
Die Rinde benutzt man zum Gerben, mit den Blättern färbt
man Seide und Baumwolle purpurrot; auch dienen sie, wie die
Blüten, als Heilmittel.
Tecuciu, s. Tekutsch.
Teda, Volk in Nordafrika, s. Tibbu.
Teddington, Dorf in der engl. Grafschaft Middlesex, an
der Themse, 30 km oberhalb London, bis wohin die Flut steigt, mit
(1881) 6599 Einw.
Tedesco (ital.), deutsch.
Tedeum (lat.), s. v. w. Hymnus auf die Worte des sogen.
Ambrosianischen Lobgesangs (Tedeum laudamus etc.), dessen
ursprüngliche Komposition eine würdige Choralmelodie ist,
während das T. in neuerer Zeit gern für mehrere
Chöre und großes Orchester (nebst Orgel) im großen
Stil komponiert wird. Vgl. Bone, Das T. (Frankf. 1881).
Tedschen, Bezirk in der Transkaspischen Provinz des
asiatisch-russ. Generalgouvernements Turkistan, eine vom Herirud
bewässerte Oase, die früher nur von Tekke-Turkmenen aus
Merw und Atok während des Sommers besucht wurde, um den
fruchtbaren Boden mit Getreide zu besäen, seit 1884 aber in
ihrem nördlichen Teil besiedelt wird und schon 7500 Einw.
(Tekinzen) zählt.
Teer, Produkt der trocknen Destillation vieler
organischer Körper, entsteht stets neben einer
wässerigen, sauren oder ammoniakalischen Flüssigkeit und
einem Gasgemisch. Man gewinnt den T. häufig als Nebenprodukt,
wenn es sich um die Darstellung andrer Produkte der trocknen
Destillation handelt, z. B. bei der Leuchtgasfabrikation, bei der
Darstellung von Holzessig etc.; in andern Fällen ist der T.
das Hauptprodukt, und stets besitzt er großen Wert, seitdem
man zahlreiche in verschiedenster Weise verwertbare Substanzen in
ihm entdeckt hat. Je nach der Natur des der Destillation
unterworfenen Körpers ist der T. von sehr verschiedener
Beschaffenheit; stets aber ist er braun bis schwarz,
dickflüssig, von empyreumatischem Geruch, schwerer als Wasser,
entzündlich, er brennt mit rußender Flamme und gibt an
Wasser und Alkohol lösliche Stoffe ab. Alle Teere sind Gemenge
verschiedenartiger Körper und enthalten stets
Kohlenwasserstoffe, sowohl flüssige als starre, von sehr
verschiedener Flüchtigkeit (wie Benzol, Toluol, Paraffin,
Naphthalin etc.), ferner säureartige Körper (die Phenole,
Karbolsäure etc.) und Basen (Anilin, Chinolin etc.), dann auch
pech- oder asphaltbildende Substanzen von nicht näher
bekannter Beschaffenheit. Wegen ihres Gehalts an Phenolen wirken
die Teere stark fäulniswidrig. Holzteer gewinnt man als
Nebenprodukt bei der Darstellung von Holzkohle, Holzgas (s.
Leuchtgas, S. 735) und Holzessig; doch ist die Teerschwelerei
bisweilen auch Hauptzweck und verarbeitet dann harzreiche
Nadelhölzer teils in Meilern mit trichterförmiger Sohle,
von welcher der T. in ein Sammelgefäß abgeleitet wird,
teils eingemauerte, stehende große eiserne Kessel, in welchen
das Holz erhitzt wird, während man die Teerdämpfe in
einem durch Luft gekühlten Apparat zur Verdichtung bringt. Man
erhält etwa 17 Proz. T. Der Holzteer ist dunkelbraun, riecht
durchdringend, schmeckt widrig scharf und bitter, vom spez. Gew.
1,075-1,160, löst sich größtenteils in Alkohol und
Äther, mischt sich mit Fetten und gibt an Wasser
Essigsäure und brenzlige Stoffe ab. Man benutzt ihn zu
konservierenden Anstrichen, zum Kalfatern der Schiffe, zum Teeren
der Taue etc.; zur Darstellung von Pech und Ruß, auch wird er
destilliert, und man gewinnt hierbei leichte Teeröle
(Holzöl), die wenig Benzol enthalten und meist als Fleckwasser
benutzt werden, schwere Öle, die man auf Ruß verarbeitet
oder zum Imprägnieren von Holz verwertet, auch wohl Paraffin
und Kreosot. Letzteres wird besonders aus Buchenholzteer
dargestellt. Birkenholzteer dient zur Bereitung des Juftenleders.
Torfteer wird durch trockne Destillation des Torfs in
Schachtöfen oder Retorten, ähnlich wie Braunkohlenteer,
dargestellt, auch bei der Verkohlung des Torfs als Nebenprodukt
gewonnen. Er ist ölartig, braun bis schwarzbraun, von sehr
unangenehmem Geruch und dem spez. Gew. 0,896-0,965. Man gewinnt aus
demselben durch Destillation leichte Kohlenwasserstoffe, die wie
Benzin und Photogen benutzt werden (Turfol), schwere, noch als
Leuchtöle verwendbare Öle, Schmieröle, Paraffin und
sehr schwer flüchtige, flüssige Kohlenwasserstoffe, aus
welchen Leuchtgas bereitet wird, als Rückstand Asphalt.
Braunkohlenteer ist sehr verschieden je nach der Beschaffenheit der
Kohle. Im allgemeinen ist er dunkelbraun, riecht widerlich
kreosotartig und erstarrt leicht durch hohen Paraffingehalt. Der
aus Pyropissit gewonnene T. ist butterartig, wachsgelb und bildet
das Rohmaterial der Paraffinfabriken. Man gewinnt daraus durch
Destillation leichte und schwere Öle (Benzin, Photogen,
deutsches Petroleum, Solaröl), Schmieröl und namentlich
Paraffin (s. d.). In ähnlicher Weise gewinnt und verwertet man
T. aus bituminösen Schiefern. Am wichtigsten ist der
Steinkohlenteer (Kohlenteer), den man in Leuchtgasanstalten,
bisweilen auch bei der Koksbereitung als Nebenprodukt gewinnt. Er
ist schwarz bis braunschwarz, übelriechend, dickflüssig,
vom spez. Gew. 1,15-1,22. Er besteht aus flüssigen und festen
Kohlenwasserstoffen (Benzol, Toluol, Cumol, Cymol, Anthracen,
Naphthalin etc.), Säuren (Phenol, Kresol, Phlorol,
Rosolsäure), Basen (Anilin, Chinolin, Toluidin etc.) und
Asphalt bildenden Substanzen. Die quantitative Zusammensetzung des
Teers schwankt je nach der Beschaffenheit der Kohle und der
Ausführung der Destillation. Im allgemeinen entsteht bei
schneller Destillation in hoher Temperatur viel Gas und wenig T.,
welcher arm an Ölen, aber reich an Naphthalin ist. Die
Bestandteile des Steinkohlenteers bilden das Rohmaterial für
mehrere wichtige Industriezweige. Um sie zu gewinnen, unterwirft
man den T. in sehr großen Blasen, liegenden Cylindern oder
kofferförmigen Retorten aus Eisenblech einer Destillation
über freiem Feuer. Es entweichen zuerst Gase, dann gehen mit
steigender Temperatur ammoniakalisches Wasser, leichte Öle,
schwere Öle und feste Kohlenwafferstoffe über, und als
Rückstand bleibt Steinkohlenasphalt, welcher um so härter
ausfällt, je weiter die Destillation bei immer gesteigerter
Temperatur getrieben wurde. Bisweilen treibt man die
flüchtigsten Öle durch Wasserdampf ab, den man di-
558
Teerbutt - Tegel.
rekt in den T. leitet. Der Wasserdampf reißt die
flüchtigen Kohlenwasserstoffe dampfförmig mit sich fort
und wird mit ihnen zugleich in Kühlapparaten verdichtet. Die
erste Verwertung des Teers zur Gewinnung von Leuchtölen
datiert von 1839, wo Selligue und de la Haye in Autun den T. von
bituminösem Schiefer in dieser Weise verarbeiteten. Zu Ende
der 40er Jahre stellte Young bei Glasgow aus Bogheadkohlenteer ein
Mineralöl (Hydrokarbür) und Paraffin dar, und um dieselbe
Zeit entstanden die irischen Öl- und Parafsinfabriken, welche
Torf verarbeiteten. Seit 1850 entwickelte sich die
Paraffinindustrie in Deutschland (vgl. Paraffin). Steinkohlenteer
wurde zuerst etwa 1846 destilliert, um karbolsäurehaltiges
Teeröl zur Imprägnierung von Eisenbahnschwellen
zugewinnen. Das leichte Teeröl wurde nur von Brönner als
Fleckwasser benutzt und galt als lästiges Nebenprodukt, bis es
um 1856 durch die Entwickelung der Anilinfarbenindustrie
allmählich der wichtigste Bestandteil des Teers wurde. Die
erste größere Fabrik zur Verarbeitung von
Steinkohlenteer in Deutschland wurde 1860 in Erkner bei Berlin
gegründet. Erst später gewannen wieder die schwerer
flüchtigen Teerbestandteile, wie Karbolsäure, Naphthalin
und Anthracen, erhöhte Bedeutung. Die leichten
Steinkohlenteeröle werden wegen ihres Gehalts an Benzol und
Toluol hauptsächlich in der Farben-Industrie benutzt,
schwerere karbolsäurehaltige Öle dienen zum
Imprägnieren des Holzes, schwere Kohlenwasserstoffe als
Schmieröl, Naphthalin und Anthracen finden Verwendung inder
Farbenindustrie, ebenso das Phenol, welches aber auch zu sehr
vielen andern Zwecken, namentlich zur Darstellung von
Salicylsäure und in der Medizin, benutzt wird. Aus Toluol und
Naphthalin stellt man auch Benzoesäure dar. Der Asphalt wird
zur Darstellung von Asphaltröhren und Briketten, zum Belegen
von Fußböden etc. benutzt, außerdem dient
Steinkohlenteer auch zu konservierenden Anstrichen, zum Vertreiben
von Ungeziefer, und wo er keinen Absatz findet, verbrennt man ihn
in Gasanstalten zum Heizen der Retorten. Der Steinkohlenteer der
Berliner Gasanstalten liefert:
Benzol und Toluol ... 0,80
Sonstige wasserhelle Öle ... 0,60
Kristallisierte Karbolsäure ... 0,20
Kresol etc. ... 0,30
Naphthalin ... 3,70
Anthracen ... 0,20
Schwere Öle ... 24,00
Steinkohlenpech ... 55,00
Wasser und Verlust ... 15,20
Die Teermenge beträgt bei der Leuchtgasfabrikation 5 Proz.
vom Gewicht der Steinkohlen, und da nun in Berlin jährlich 6
Mill. Ztr. Kohle verarbeitet werden, so erhält man 300,000
Ztr. T., dessen Beschaffenheit aber von der Beschaffenheit der
Kohle abhängig ist. In England verarbeitet man jährlich
3,5, in Frankreich 1, in Deutschland 0,75, in Belgien und Holland
0,45, zusammen 5,7 Mill. Ztr. T., welche an Ausbeute ergeben:
Anthracen 19,000, Benzol 57,000, Naphtha 42,700 Ztr. Von
großer Bedeutung dürfte der T. werden, welcher beim
Raffinieren des Erdöls als Rückstand bleibt, insofern
derselbe, wenigstens derjenige von südrussischem Erdöl,
Produkte liefert, die reich an Benzol, Toluol und Anthracen sind
und daher für die Teerfarbenindustrie ein wertvolles
Rohmaterial bilden. Vgl. Lunge, Destillation des Steinkohlenteers
(Braunschw. 1867); Derselbe, Industrie der
Steinkohlenteerfabrikation (3. Aufl., das. 1888); Bolley-Kopp,
Chemische Verarbeitung der Pflanzen- und Tierfasern (das. 1867-74);
Wagner, übersicht der Produkte der trocknen Destillation der
Steinkohlen (Würzb. 1873); Schultz, Chemie des
Steinkohlenteers (2. Aufl., Braunschw. 1887 ff., 2 Bde.),
Teerbutt, f. v. w. Flunder, s. Schollen.
Teerfarben, aus Teerbestandteilen dargestellte Farben,
also die farbigen Derivate des Anilins (welches aus Benzol gewonnen
wird), Naphthalins, Anthracens, Phenols etc. Vgl. Schultz, Chemie
des Steinkohlenteers, Bd. 2 (2. Aufl., Braunschw. 1887 ff., 2
Bde.); Nietzki, Organische Farbstoffe (Bresl. 1886); Schultz und
Julius, Übersicht der künstlichen organischen Farbstoffe
(Berl. 1888); Heumann, Die Anilinfarben und ihre Fabrikation
(Braunschw. 1888).
Teerfeuer (Blüse), Feuerzeichen in der Nähe von
Sandbänken, Untiefen, Klippen.
Teergalle, s. v. w. Harzgalle, s. Harzfluß.
Teerjacke, Spitzname der Matrosen (vgl. Jack).
Teeröl, s. Teer.
Teerpappe, s. Dachpappe.
Teerseife, Hebras flüssige, s. Kaddigöl.
Tees (spr. tihs), Fluß im nördlichen England,
entspringt am Croß Fell in Westmoreland, durchfließt
das romantische Teesdale und mündet nach einem Laufe von 153
km unterhalb Middlesbrough in die Nordsee. Seine Einfahrt
schützen zwei große aus Schlacken gebildete
Wellenbrecher, je 3292 m lang.
Teetotalismus (neuengl., spr. ti-), das System der
vollständigen Enthaltsamkeit von dem Genuß alkoholischer
Getränke, wie es Joseph Livesay 1. Sept. 1832 zu Preston
begründete. Die Vorsilbe scheint auf den an die Stelle des
streng verbotenen Branntweingenusses empfohlenen Thee hindeuten zu
sollen. Vgl. Mäßigkeitsvereine.
Tef, s. Eragrostis.
Teffe (früher Ega), kleine Stadt in der brasil.
Provinz Amazonas, an einer seeartigen Erweiterung des Flusses T.,
der 10 km unterhalb in den Amazonenstrom mündet. Handel mit
Waldprodukten und Viehzucht bilden die Haupterwerbsquellen.
Tefilla (hebr.), s. Siddur.
Tefnut, ägypt. Göttin, löwenköpfig
und mit dem Diskus auf dem Haupte dargestellt, gewöhnlich die
Gefährtin des Gottes Schu.
Tegal (Tagal), niederländ. Residentschaft auf der
Nordküste der Insel Java, 3800 qkm (69 QM.) groß mit
(1885) 986,544 Einw., worunter 706 Europäer, 6859 Chinesen und
380 Araber. Das Land ist außerordentlich fruchtbar und
vortrefflich kultiviert. Die gleichnamige Hauptstadt hat einen
Hafen, ein Fort, nicht unbedeutenden Handel und 30,000 Einw.
Tegea, feste Stadt im alten Arkadien, mit eignem Gebiet
(Tegeatis), hatte früher eigne Könige und war die
bedeutendste Stadt Arkadiens, öfters (560, 479, 464) mit
Sparta im Kampf, aber im Peloponnesischen Krieg dessen treuer
Verbündeter. Nach der Schlacht von Leuktra trat es gezwungen
in den Achäischen Bund. Ruinen 6 km sudöstlich von
Tripolitsa (s. d.). In T. stand ein berühmter Prachttempel der
Athene Alea, von Skopas 394 v. Chr. gebaut.
Tegel, Lokalname für einen kalkhaltigen
Tertiärthon des Wiener Beckens, s. Tertiärformation.
Tegel, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Potsdam,
Kreis Niederbarnim, am gleichnamigen Havelsee, 11 km von Berlin und
mit diesem durch eine Pferdebahn verbunden, hat eine evang. Kirche,
eine Schiff- und Maschinenbauanstalt, eine große Mühle,
Wasserwerke für die Stadt Berlin und (1885) 1652 meist evang.
Einwohner. Dabei das durch Schinkel 1822 bis 1824 umgebaute
Schloß T., ehedem Besitzung und Wohnstätte Wilhelms v.
Humboldt, mit sehenswerten Kunstschätzen und schönem
Park, welcher die Grabstätte der Brüder Humboldt
enthält. Vgl. Waagen, Schloß T. und seine Kunstwerke
(Berl. 1859).
559
Tegernsee - Tegner.
Tegernsee, See im bayr. Regierungsbezirk Oberbayern,
Bezirksamt Miesbach, in reizender Gebirgsgegend, 732 m ü. M.,
ist 6 km lang, 2 km breit, 72 m tief, nimmt mehrere kleine
Flüsse auf und ergießt sein Wasser durch die Mangfall in
den Inn. Das gleichnamige Pfarrdorf, an der Ostseite des Sees und
an der Eisenbahn Schaftlach-Gmund, hat eine kath. Kirche, ein
Schloß mit prächtigem Garten und einer
Gemäldesammlung, eine Musik- und eine Zeichenschule, ein
Amtsgericht, ein Forstamt, eine diätetische Naturheilanstalt,
eine Dampfbrauerei und (1885) 1022 kath. Einwohner. Das
Schloß T. war sonst eine gefürstete Benediktinerabtei,
welche zur Zeit Pippins 736 von den Agilolfingern gegründet
und 1803 aufgehoben wurde. Dabei der Parapluieberg mit
prächtiger Fernsicht. Am nördlichen Ende des Sees liegt
der Musterökonomiehof Kaltenbrunn und südlich vom See im
Thal der Weißach Bad Kreuth (s. d.). Vgl. Freyberg,
Älteste Geschichte von T. (Münch. 1822); Krempelhuber,
Der T. und seine Umgebungen (3. Aufl., Münch. 1862).
Tegetthoff, Wilhelm, Freiherr von, österreich.
Admiral, geb. 23. Dez. 1827 zu Marburg in Steiermark, wurde im
Marinekollegium zu Venedig erzogen und trat 1845 als Kadett in die
österreichische Marine ein. 1848-49 machte er die Blockade von
Venedig mit, dann, 1851 zum Fregatten-, 1852 zum
Linienschiffsleutnant befördert, größere
Seeexpeditionen im Mittelländischen Meer, namentlich nach der
Levante, gegen die Barbareskenstaaten und nach verschiedenen
Punkten der afrikanischen Westküste. 1857 zum
Korvettenkapitän ernannt, führte er auf Veranlassung des
Erzherzogs Maximilian eine Expedition an die Küsten des Roten
Meers aus. 1859 begleitete er den Erzherzog auf einer Reise nach
Brasilien, wurde 1860 Fregatten-, 1861 Linienschiffskapitän
und befehligte 1862 das österreichische Geschwader, welches
nach König Ottos Absetzung in den griechischen und
levantischen Gewässern kreuzte. Seine erste eigentliche
Waffenthat war das für die österreichische Flagge
ehrenvolle Seegefecht bei Helgoland gegen die Dänen 9. Mai
1864, wobei er auf dem Flaggenschiff Schwarzenberg bis zu dessen
Brand ausharrte. T. wurde darauf zum Konteradmiral ernannt. Zu
einer glänzenden Rolle war T. im Krieg des Jahres 1866
berufen; die Seeschlacht von Lissa (s. d.) 20. Juli d. J. endete
trotz der bedeutenden Überlegenheit der Italiener mit einem
glänzenden Sieg der Österreicher. T., welcher hierbei
geniale Begabung für Flottenführung bewiesen, ward durch
seine Ernennung zum Vizeadmiral belohnt. Im Juli 1867 erhielt er
den Befehl, die Leiche des erschossenen Kaisers Maximilian von
Mexiko nach Europa überzuführen, und ward Ende Februar
1868 an Stelle des Erzherzogs Leopold zum Generalinspektor und
Kommandanten der Marine, 1. April 1868 zum Geheimrat und Mitglied
des Herrenhauses ernannt, in welchem er zur liberalen
Verfassungspartei gehörte, starb aber plötzlich nach
kurzer Krankheit 7. April 1871 in Wien. In Marburg, Pola und Wien
wurden ihm Denkmäler errichtet. Vgl. "Admiral T. und die
öfterreichische Kriegsmarine" (Meran 1867); A. Beer, Aus
Wilhelm v. Tegetthoffs Nachlaß (Wien 1882).
Tegetthoff-Expedition, 1872-74, s. Maritime
wissenschaftliche Expeditionen, S. 257.
Tegnér, Esaias, berühmter schwed. Dichter,
geb. 13. Nov. 1782 zu Kyrkerud in Wermland, Sohn eines Pfarrers,
ward als Knabe auf einem Kontor beschäftigt, fand aber hier
Gelegenheit zu weiterer Bildung, die er mit solchem Erfolg
benutzte, daß er schon 1799 die Universität Lund
beziehen konnte, wo er sich theologischen und philologischen
Studien widmete und 1805 zum Adjunkten der Ästhetik, 1812 zum
Professor der griechischen Sprache ernannt wurde. Nachdem er 1818
Mitglied der Akademie geworden und die theologische
Doktorwürde erhalten hatte, erfolgte 1824 seine Ernennung zum
Bischof von Wexiö, wo er, gegen das Ende seines Lebens an
zeitweiliger Geistesstörung leidend, 2. Nov. 1846 starb. Seine
ersten größern poetischen Produkte waren das von der
Akademie gekrönte Gedicht "Svea" (1811), das durch tiefen
religiösen Ernst und anmutige Naturschilderungen ergreifende
Idyll "Nattvardsbarnen" (1821; deutsch von Mohnike: "Die
Nachtmahlskinder", 5. Aufl., Halle 1876) und die etwas
sentimentale, aber an schönen lyrischen Episoden reiche
poetische Erzählung "Axel" (1822; deutsch von Vogel, Leipz.
1876), deren Stoff dem Zeitalter Karls XII. entnommen ist. Ein
bereits in Lund begonnenes großes Gedicht: "Helgonabacken",
kam nicht zur Vollendung, ebensowenig seine letzten
größern Dichtungen: "Gerda", deren Fabel der Zeit
Waldemars d. Gr. angehört, und "Kronbruden". Als die
vorzüglichsten unter seinen zahlreichen kleinern Gedichten
sind "Carl XII", der "Epilog vid magister promotionen 1826" und
"Sång till solen" ("Gesang an die Sonne") hervorzuheben. Den
größten Ruhm aber erwarb ihm seine allbekannte Dichtung
"Frithjofs Saga" (Stockh. 1825 u. öfter; Prachtausgabe mit
Illustrationen von J. A. Malmström, das. 1868; mit
Wörterbuch hrsg. von Silberstein, Frankf. 1873), die fast in
alle lebenden Sprachen Europas übersetzt worden ist, ins
Deutsche über 20 mal, unter andern von Amalie v. Helwig
(Stuttg. 1826, neue Ausg. 1879), Mohnike (19. Aufl., Halle 1885),
Berger (11. Aufl., Stuttg. 1887), v. Leinburg (14. Aufl., Leipz.
1885), Viehoff (Hildburgh. 1865), Simrock (mit den
"Abendmahlskindern", 4. Aufl., Stuttg. 1883), Zoller (Leipz. 1875),
Freytag (3. Aufl., Norden 1883). Eine Auswahl der kleinern Gedichte
übersetzten Zeller (Stuttg. 1862) und G. v. Leinburg (2.
Aufl., Leipz. 1885), der auch die "Lyrischen Gedichte"
übertrug (das. 1882). T. schlug in seinen Poesien frei und
unabhängig seinen eignen Weg ein, ebenso fern sich haltend von
der blinden Sucht, die Franzosen nachzuahmen, wie von der neuern
Schule, die nach dem Vorbild Atterboms die deutsche Romantik als
alleiniges Muster der Nachahmung aufstellte. Seine bilderreiche,
bewegliche, leicht erregbare Phantasie, seine reiche Witzesader,
sein lebendiges poetisches Gefühl ließen sich in keine
Fesseln schlagen. Diese Eigenschaften, verbunden mit einer
schönen, echt dichterischen Sprache und rhythmischer
Vollendung, stellen Tegnérs Gedichte unter die bedeutendsten
Erscheinungen auf dem Gebiet der neuern Poesie. Seine kleinern
Gedichte sind entweder Gelegenheitsgedichte voll schöner
Gedanken, männlicher Gesinnung und religiöser Weihe oder
Naturschilderungen voll Gemütlichkeit und Sinn für das
Idyllische. Außer den poetischen Arbeiten sind Tegnérs
"Reden" (deutsch von Mohnike, Strals. 1829) und seine Aufsehen
erregenden, trefflichen "Schulreden" (in Auswahl deutsch von
Mohnike, 2. Aufl., Jena 1882) als Zeugnisse einer eminenten
Rednergabe hervorzuheben. Tegnérs sämtliche Werke
wurden von seinem Schwiegersohn Böttiger gesammelt (Stockh.
1847-50, 7 Bde.; Jubelausgabe, das. 1882 bis 1885, 8 Bde.); seine
nachgelassenen Schriften gab sein Enkel Elof Tegnér (das.
1873-74, 3 Bde.) heraus. Eine Auswahl seiner poetischen und
prosaischen Werke in deutscher Übersetzung gab G. v. Lein-
560
Tegucigalpa - Teichmüller.
burg (Leipz. 1882, 7 Bde.) heraus. 1853 ward in Lund eine
Kolossalstatue des Dichters errichtet. Vgl. Böttiger,
Tegnérs Leben (deutsch, Leipz. 1885); Waldeck,
Tegnérs Stellung zur Theologie und Philosophie (Stuttg.
1863); Brandes, E. Tegnér (in "Moderne Geister", Frankf.
1882), und die biographischen Schriften von Christensen (2. Aufl.,
Leipz. 1883), Peschier (Lahr 1882), Kippenberg (Leipz. 1884).
Tegucigalpa, Hauptstadt des mittelamerikan. Staats
Honduras, Rio Grande, 1036 m ü. M., von Bergen umgeben, mit
vielen schönen Privathäusern, einer in edlem Stil
erbauten Hauptkirche, einer 1847 gegründeten Academia
Literaria (Hochschule) und 12,000 Einw. Die Stadt hat lebhaften
Handel; früher hatte sie auch viel Bergbau.
Tegumént (lat.), s. v. w. Knospendecke, s.
Knospe.
Teheran, Hauptstadt des pers. Reichs, liegt in der
Provinz Irak Adschmi auf einer baumlosen Hochebene, 1170 m ü.
M., südlich vom Elburz, hat an Stelle der frühern
unansehnlichen Häuser und engen, unregelmäßigen
Straßen im letzten Vierteljahrhundert mit Bäumen
bepflanzte Boulevards, Plätze und befahrbare Straßen
erhalten, und die alten Stadtmauern sind durch Erdwälle
ersetzt, welche fast das doppelte Areal umschließen. In der
Mitte der Nordseite liegt der große befestigte Palast des
Schahs mit Gärten, Teichen, dem Zeughaus, den
Gefängnissen, der Militärschule etc. Die Stadt hat 11
Moscheen, eine 1850 gegründete Gelehrtenschule mit Bibliothek,
mehrere theologische Hochschulen, große moderne Bazare,
zahlreiche Karawanseraien und Bäder, Fabrikation von
Eisenwaren, Teppichweberei, Seiden- und Baumwollmanufakturen.
Innerhalb der Stadt, besonders an ihrer Nordseite, finden sich
schöne Gärten. Im Winter, wo der Hof in T. ist,
beträgt die Zahl der Einwohner gegen 200,000 (nach andern nur
120,000), fast lauter Schiiten, von denen im Sommer wegen der
unerträglichen Hitze ein großer Teil (darunter auch die
europäischen Gesandtschaften) nach der am Fuß des Elburz
gelegenen gesündern Landsihaft Schemiran übersiedelt. Die
Stadt ist für den europäischen Verkehr, der vornehmlich
auf der Straße von Poti über Tiflis, Eriwan, Tebriz und
Kazwin hierher stattfindet, wie als Sitz des Hofs, der Großen
des Reichs und der fremden Gesandten von Wichtigkeit. Durch
Neuanlage vieler unterirdischer Wasserleitungen hat sich die
früher steppenartige Umgegend neuerdings in bebautes Land
umgewandelt mit zahlreichen Ansiedelungen, Dörfern und
Palästen. In der Nähe von T. liegen unter andern die
königlichen Lustschlösser Negristan mit schönen
Gärten, Kasr Kadschar, ein kühner, von Feth Ali
ausgeführter terrassenförmiger Bau, und Niaveran im N.;
südlich die Trümmer des alten Rhagä (s. d.).
Tehl, s. v. w. Tael.
Tehri (Tiri), Staat und Stadt in Britisch-Indien, s.
Garwhal 2).
Tehuacan de las Granádos, Stadt im mexikan. Staat
Puebla, südöstlich von der Hauptstadt, 1640 m Ü. M.,
ehemals ein besuchter heiliger Ort der Azteken, mit (1880) 9173
Einw. im Munizipium.
Tehuantepec, Stadt im mexikan. Staat Oajaca, 20 km
oberhalb der Mündung des gleichnamigen Flusses in den Stillen
Ozean und 22 km westlich von einem geräumigen, aber seichten
Haff, mit (1880) 24,438 Einw. in seinem Munizipium (meist
Indianer), liegt an der schmälsten Stelle des
nordamerikanischen Kontinents, auf dem nur 190 km breiten Isthmus
von T., der sich zwischen dem Golf von T. im S. und dem Golf von
Guazacualca des Mexikanischen Meerbusens im N. erstreckt, und
dessen Einsenkung das Hochland von Guatemala von dem Plateau von
Anahuac trennt. Die niedrigste Stelle der Wasserscheide (bei
Tarifa) liegt 207 m ü. M. Diese Stelle veranlaßte schon
frühzeitig das Projekt einer Verbindungsstraße zwischen
dem Atlantischen und dem Stillen Ozean. Nachdem bereits Cortez 1520
einen Kanalbau vorgeschlagen, ließ der Vizekönig
Bucareli 1771 Vermessungen zu diesem Zweck anstellen. Ein Gleiches
geschah 1825 im Auftrag der mexikanischen Regierung. Am 25. Febr.
1842 erhielt endlich der Mexikaner José Garay ein
Privilegium zur Herstellung eines Kanals oder einer Eisenbahn
über den Isthmus. Er trat sein Privilegium (1846) an
Engländer ab, diese (1850) an die Louisiana-Tehuantepec
Company, die auch wirklich, nachdem die Regierungen von England und
Amerika sich 1853 vereinigt hatten, das Unternehmen zu
schützen, einige Dampfer auf den Guazacualca setzte und einen
Überlanddienst nach Ventosa am Stillen Ozean ins Werk setzte.
Die politische Unsicherheit und die erfolgte Eröffnung der
Panamabahn hinderten aber die Ausführung eines Kanals oder
auch einer Eisenbahn. Im J. 1879 wurde abermals eine T.
Interoceanic Railway Company gegründet, und als auch das
Privilegium dieser Gesellschaft ablief, ohne daß etwas
geschehen war, nahm die Regierung das Werk selbst in die Hand. Der
Plan des Kapitän J. B. Eads (1881), eine Eisenbahn zu bauen,
vermöge welcher auch beladene Schiffe von Meer zu Meer
geschafft werden könnten, ist nie mehr als Projekt geworden.
T. ist Sitz eines deutschen Konsuls. Vgl. Shufeldt, T.,
explorations and surveys (Washingt. 1873).
Tehueltschen ("Südvolk") nennen die Araukanier die
Patagonier, während sie die Pampasindianer in Argentinien
Pueltschen ("Ostvolk") nennen.
Teich, größere Ansammlung von Wasser, welche
durch natürliche oder künstliche Ufer eingeschlossen ist
und mittels gewisser Vorrichtungen abgelassen und gespannt
(angefüllt) werden kann. Die Teiche dienen vorzüglich zur
Zucht von Fischen, außerdem zur Bewegung von Rädern und
Maschinenwerken und zur Bereithaltung eines Wasservorrats. Die
Teichfischerei (Teichwirtschaft, s. Fischerei, S. 305) hat infolge
der Vervollkommnung der Bodenkultur an Ausdehnung sehr verloren und
dem einträglichen Feld- und Wiesenbau weichen müssen. Am
ausgedehntesten wird sie noch in Schlesien, Böhmen, in der
Oberlausitz, im Vogtland, im Altenburgischen, Thüringischen,
Halberstädtischen, in Bayern und Holstein und zwar vornehmlich
auf Karpfen betrieben. Große Teiche kann man bald zur
Fischerei, bald auch zum Feld- und Wiesenbau anwenden
(Sämerung). Man legt zu dem Ende den T. im Herbste trocken,
ackert den Grund um, bestellt ihn ein bis drei Jahre lang mit
Feldfrüchten und benutzt ihn dann wieder zur Fischerei, um
nach sechs Jahren das Besäen zu wiederholen. Vgl. D e l i u s,
Die Teichwirtschaft (Berl. 1875); Nicklas, Lehrbuch der
Teichwirtschaft (Stett. 1879); Benecke, Die Teichwirtschaft (2.
Aufl., Berl. 1889); v. dem Borne, Handbuch der Fischzucht und
Fischerei (das. 1886).
Teichhuhn, s. Wasserhuhn.
Teichkolben, s. Typha.
Teichlilie, s. Iris.
Teichlinse, s. v. w. Lemna.
Teichmüller, Gustav, philosoph. Schriftsteller, geb.
19. Nov. 1832 zu Braunschweig, studierte in Tübingen und
vorzugsweise in Berlin unter Trendelenburg Philosophie,
veröffentlichte als Lehrer am
561
Teichmuschel - Teilbarkeit.
Annengymnasium in St. Petersburg 1859 seine philosophische
Erstlingsschrift: "Die Einheit der Aristotelischen Eudämonie",
habilitierte sich 1860 als Privatdozent in Göttingen und ward
1868 als außerordentlicher Professor nach Basel, 1871 als
ordentlicher Professor der Philosophie nach Dorpat berufen, wo er
23. Mai 1888 starb. Neben einer Reihe Aristotelischer Forschungen:
"Beiträge zur Erklärung von Aristoteles' Poetik" (Halle
1866), "Aristoteles' Philosophie der Kunst" (das. 1869) und
"Geschichte des Begriffs der Parusie" (das. 1873), schrieb er:
"Über die Unsterblichkeit der Seele" (Leipz. 1874, 2. Aufl.
1879); "Studien zur Geschichte der Begriffe" (Berl. 1874);
"Herakleitos"(Gotha 1876); "Die Platonische Frage", eine
Streitschrift gegen Zeller (das. 1876); "Frauenemanzipation" (Dorp.
1877); "Darwinismus und Philosophie" (das. 1877) und die
humoristische, gegen den Neukantianismus gerichtete Schrift
"Wahrheitsgetreuer Bericht über meine Reise in den Himmel von
Immanuel Kant" (das. 1878); ferner: die "Neuen Studien zur
Geschichte der Begriffe" (Gotha 1876-79, 3 Bde.); "Über das
Wesen der Liebe" (Leipz. 1879); "Die wirkliche und die scheinbare
Welt; neue Grundlegung der Metaphysik" (Bresl. 1882); "Chronologie
der Platonischen Dialoge" (das. 1881); "Zu Platons Schriften, Leben
und Lehre" (das. 1884); "Religionsphilosophie" (das. 1886); "Neue
Grundlegung der Psychologie und Logik" (das. 1889). Der
Grundgedanke der geschichtlichen Arbeiten Teichmüllers ist
der, die Abhängigkeit des Aristoteles von Platon nachzuweisen
und das Platonische System durch strengere Verknüpfung der
Ideen mit dem Prinzip der Bewegung in Einklang zu bringen, daneben
aber eine eigne, von ihm als "vierte Weltansicht" bezeichnete, dem
Leibnizschen System mannigfach verwandte philosophische Anschauung
geltend zu machen.
Teichmuschel (Entenmuschel, Anodonta Lam.), Gattung aus
der Familie der Flußmuscheln, hat ein dünnes,
zerbrechliches Gehäuse und längliche, ungleichseitige
Schalen mit glatter, brauner Oberhaut. Sie lebt besonders in
stehenden, schlammigen Gewässern, einzelne Arten auch in
Flüssen. Je nach Wohnort, Alter, Nahrung und Geschlecht
weichen die Individuen ungemein voneinander ab, und die
Unterscheidung der zahlreichen Arten ist daher sehr schwierig und
noch keineswegs festgestellt. Die beiden wichtigsten sind die
große Schwanenteichmuschel (A. cygnea L.),
breit-eiförmig, mit geradem oder meist aufsteigend gebogenem
Oberrand und gerundetem, sehr krummlinigem Unterrand, bis 18 cm
breit, und die Cellenser T. (A. cellensis Schröt.),
länglich-eiförmig, mit fast geradem, parallelem Ober- und
Unterrand. Die T. findet sich fast in ganz Europa und vermehrt sich
sehr stark; ein Tier enthält bisweilen an 40,000 junge
Muscheln. Diese entwickeln sich zuerst innerhalb der Kiemen des
Muttertiers, schwärmen dann als kleine, sehr unreife Larven
aus und heften sich mittels eines Byssusfadens an die Flossen von
Fischen an. Der von ihnen als Fremdkörpern verursachte Reiz
hat eine Schwellung in ihrer Umgebung zur Folge; die Haut erhebt
sich zu einem Wall und schließt in 3-4 Tagen die Larve
völlig ein. In einem solchen Gefängnis nun bleibt
letztere über 70 Tage und entwickelt sich dabei bedeutend.
Ursprünglich mit nur einem Schließmuskel versehen,
büßt sie diesen ein und erhält dafür zwei
neue; ferner wachsen ihr Kiemen, Herz, Geschlechtsorgane etc.
Endlich öffnet sich die Haut des Fisches, und die junge
Muschel tritt hervor, um von da ab frei um herzukriechen.
Teichrohr, s. Arundo.
Teichrohrgras, s. Calamagrostis.
Teichrohrfänger, s.Schilffänger.
Teichrose, s. v. w. Nymphaea alba; gelbe T., s. v. w.
Nuphar luteum (Nymphaea lutea).
Teichunke, s. v. w. Feuerkröte, s. Frösche, S.
752.
Teichwirtschaft, s. Teich.
Teichwolframsdorf, Dorf im sachsen-weimar.
Verwaltungsbezirk Neustadt a. O., an der Linie Werdau-Mehltheuer
der Sächsischen Staatsbahn, 311 m ü. M., hat eine evang.
Kirche, eine Burgruine, Kammgarnspinnerei, Harmonikafabrikation u.
(1885) 1946 Einw.
Teifun (Taifun, Tyfon, Typhon), Wirbelstürme in den
chinesischen und japanischen Meeren, kommen zur Zeit des Wechsels
der Monsune (s. d.) vom Juni bis November, am häufigsten im
September und Oktober, vor und unterscheiden sich von den andern
Wirbelstürmen dadurch, daß sie gewöhnlich einen
sehr kleinen Durchmesser (d. h. Breite) besitzen. Ihre Zentra (die
Punkte der Windstille innerhalb des Sturmwirbels), die oft beinahe
stillzustehen scheinen, bewegen sich von O. nach W. oder von OSO.
nach WNW., während die Rotationsrichtung wie bei allen
Wirbelwinden auf der nördlichen Halbkugel, entgegengesetzt der
des Uhrzeigers ist. Sie sind, weil bei ihnen alle sonstigen
Vorzeichen eines herannahenden Sturms fehlen, und weil innerhalb
eines so eng begrenzten Raums, wie ihn der T. einnimmt, die Winde
in ihren Richtungen ungewöhnlich rasch wechseln, für die
Schiffe äußerst gefährlich. Das Wort T. (tai-fung)
ist chinesischen Ursprungs, und zwar heißt fung Wind, und tai
ist eine Bezeichnung der alten Bewohner von Formosa für einen
äußerst heftigen Wind während der Monate Juni bis
September.
Teigdrucke, Abdrücke in einer Teigmasse von
mäßig tief eingeschnittenen Metallplatten mit biblischen
Darstellungen, welche als Vorläufer des von der gestochenen
Kupferplatte genommenen Abzugs gelten. Sie gehören der
Frühzeit des 15. Jahrh. an und sind meist auf Deckeln von
Andachtsbüchern geklebt gefunden worden. Sie sind teilweise
bemalt und vergoldet. Man kennt bis jetzt etwa 20 T.
Teigfarben, s. Pastellfarben.
Teignmouth (spr. tannmoth oder tinn-), Seestadt in
Devonshire (England), an der Mündung des Teign in den Kanal,
hat einen Kursaal für Badegäste, Marmorschleiferei,
Ausfuhr von Granit (aus den Heytorbrüchen), Töpferthon
und Apfelwein und (1881) 7120 Einw. Zum Hafen gehören (1888)
23 Seeschiffe von 2456 Ton. und 76 Fischerboote; Wert der Einfuhr
18,302, der Ausfuhr 7330 Pfd. Sterl. T. ist Sitz eines deutschen
Konsulats.
Teigwaren, Nudeln, Maccaroni, Biskuits.
Teilaccept, s. Accept.
Teilbarkeit, allgemeine Eigenschaft der Körper,
zufolge welcher sich dieselben in kleinere gleichartige Teile auf
mechanischem Weg trennen lassen. Ob die physikalische T. der
Körper bis ins Unendliche gehe, oder ob dieselbe bei gewissen
kleinsten Teilchen (Atomen), die nicht mehr teilbar seien, ihre
Grenze habe, darüber hat man vorzüglich auf dem Gebiet
der Philosophie bis jetzt viel gestritten, weil man hierin einen
wichtigen Schlüssel zur Erforschung des Wesens der Materie zu
finden hoffte (s. Atom). Die Bemühungen um Auffindung der
Grenze, bis zu welcher faktisch die Teilung der Körper
getrieben werden kann, hat zwar noch nicht eine derartige Grenze
ergeben, aber doch gezeigt, daß, wenn eine solche vorhanden
ist, die kleinsten Teilchen nicht mehr meßbar sind. Man nimmt
gegenwärtig an, die mechanische Teilung führe
schließlich auf die Mole, während als die
562
Teilbau - Teiresias.
wirklich kleinsten Teile, in welchen ein Körper im freien
Zustand existieren kann, die Moleküle gelten. Diese bestehen
mit wenigen Ausnahmen aus mindestens zwei Atomen, welche nur durch
chemische Mittel voneinander getrennt werden können.
Teilbau, s. Halbpacht.
Teilfrüchtchen, s. Frucht, S. 755.
Teilhaberschaft, s. Arbeitslohn, S. 759, und
Handelsgesellschaft.
Teilmaschine, Vorrichtung zur Ausführung von Kreis-
oder Längenteilungen, namentlich zur Herstellung der Grad- und
Längenteilungen an Meßinstrumenten. Beide haben den zu
teilenden Kreis oder Stab periodisch um eine genau bestimmte
Strecke zu bewegen und dann durch ein feststehendes sogen.
Reißerwerk einen Strich von bestimmter Länge
auszuführen. Bei der Kreisteilmaschine wird nach Reichenbach
die Originalteilung eines Mutterkreises unter Benutzung des
Mikroskops kopiert oder nach Ramsden der zu teilende Kreis mit
Schraube und Schraubenrad gleichmäßig gedreht und in
passenden Momenten durch das Reißerwerk eingeritzt und
endlich nach Örtling eine Kombination beider Prinzipien
vorgenommen. Reichenbachs Prinzip ist genau, aber zeitraubend, das
von Ramsden ziemlich ungenau; die Kombination nach Örtling
gestattet verhältnismäßig schnelles und genaues
Arbeiten. Vgl. "Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des
Gewerbfleißes in Preußen", Bd. 29, 1850, S. 133. Bei
den Längenteilmaschinen wird die Bewegung des auf einem
Schlitten befestigten Maßstabs in der Regel durch
Mikrometerschraube bewirkt, z. B. die T. von Gebrüder Ehrlich
in Dresden und ähnlich die von Breithaupt in Kassel. Bei der
T. ohne Führungsschraube von Meyerstein in Göttingen und
ähnlich bei der von Nasmyth wird ein Normalmaßstab zu
Hilfe gezogen, dessen Teilung gewissermaßen kopiert werden
muß.
Teilnahme am Verbrechen (Mitschuld, Concursus ad
delictum), die Beteiligung mehrerer Personen an einer strafbaren
Handlung; und zwar spricht man von einer notwendigen T., wenn zu
dem Begriff eines Verbrechens, z. B. zu dem Verbrechen des
Aufruhrs, das Vorhandensein mehrerer Thäter (Mitschuldige,
Komplicen) erforderlich ist, während eine freiwillige T.
vorliegt, wenn ein Verbrechen, z. B. ein Diebstahl, von mehreren
gemeinschaftlich begangen wird, welches aber auch von einer
einzelnen Person verübt werden kann. Die der
gemeinschaftlichen Ausführung vorangehende Verabredung eines
oder mehrerer einzeln bestimmter Verbrechen wird Komplott genannt.
Handelt es sich dagegen um eine Verbindung, welche auf die
Wiederholung von einzeln noch nicht bestimmten Verbrechen gerichtet
ist, so wird dieselbe als eine Bande bezeichnet. Keine T. ist die
Begünstigung (s. o.), weil es sich dabei um einen
nachträglichen Beistand handelt. Nur wenn die
Begünstigung vor Begehung der That zugesagt war, soll sie als
Beihilfe bestraft werden. Im übrigen werden in dem deutschen
Strafgesetzbuch Mitthäter, Anstifter und Gehilfen
unterschieden. Mitthäter sind diejenigen, welche ein
Verbrechen gemeinschaftlich ausführen. Wird dagegen die
verbrecherische That von einer Person (dem physischen Urheber)
ausgeführt, welche hierzu von einer andern (dem
intellektuellen Urheber) durch Geschenke oder Versprechen, durch
Drohung, durch Mißbrauch des Ansehens oder der Gewalt, durch
absichtliche Herbeiführung oder Beförderung eines Irrtums
oder durch andre Mittel vorsätzlich bestimmt worden war, so
erscheint die letztere als Anstifter (mittelbarer, intellektueller,
moralischer, physischer Urheber). Hat dagegen der Teilnehmer dem
Thäter nur wissentlich durch Rat oder That Beihilfe geleistet,
so wird er als Gehilfe bestraft, und zwar kennt das deutsche
Strafgesetzbuch eine strafbare Beihilfe nur bei eigentlichen
Verbrechen und Vergehen, nicht auch bei bloßen
Übertretungen. Von den Mitthätern wird jeder als
Thäter bestraft (§ 47); ebenso wird der Anstifter gleich
dem Thäter bestraft (§ 48). Die Strafe des Gehilfen
dagegen ist geringer als diejenige des Thäters; sie soll sich
nach den Grundsätzen des Versuchs richten und diesen
entsprechend ermäßigt werden (§ 49). Übrigens
ist auch der Versuch der Anstiftung für strafbar erklärt,
wofern es sich um ein eigentliches (schweres) Verbrechen handelt,
zu welchem der Anstifter einen andern, wenn auch ohne Erfolg,
aufforderte. Die lediglich mündlich ausgedrückte
Aufforderung zum Verbrechen wird nur dann bestraft, wenn diese
Aufforderung an die Gewährung von Vorteilen irgend welcher Art
geknüpft war. Auch die Annahme einer solchen Aufforderung ist
strafbar. Das Komplott, bei welchem es noch nicht zum Beginn der
Ausführung der verbrecherischen That gekommen, ist beim
Hochverrat (§ 83) strafbar. Im deutschen
Militärstrafgesetzbuch (§ 59) ist auch die Verabredung
eines Kriegsverrats mit Strafe bedroht. Die Komplotthäupter
(Rädelsführer) sind beim Hochverrat und beim
Landfriedensbruch vom Gesetz als besonders strafbar bezeichnet. Die
Bande ist nach dem Reichsstrafgesetzbuch an und für sich nicht
strafbar. Dagegen macht die bandenmäßige Ausführung
den Diebstahl und den Raub zum schweren Diebstahl, resp. Raub. Vgl.
v. Bar, Zur Lehre vom Versuch und Teilnahme am Verbrechen (Hannov.
1859); Langenbeck, Die Lehre von der T. (Jena 1867); Schütze,
Die notwendige T. (Leipz. 1869).
Teilscheibe, Vorrichtung an Räderschneidmaschinen,
Drehbänken etc. zur Zerlegung von Kreisen in eine bestimmte
Anzahl genau gleicher Teile.
Teilung, Bezeichnung für eine Art der
ungeschlechtlichen Fortpflanzung (s. d.).
Teilung der Arbeit, s. Arbeitsteilung.
Teilungsgewebe, s. Meristem.
Teilungslager, s. Zollniederlagen.
Teilungszeichen, s. Divis.
Teilungszwang, s. Gemeinheitsteilung.
Teilurteil, s. Urteil.
Teilzahlung, s. Abschlagszahlung.
Teinach, Dorf und Badeort im württemberg.
Schwarzwaldkreis in einem schönen, waldreichen Thal an der
Teinach und der Linie Pforzheim-Horb der Württembergischen
Staatsbahn, 398 m ü. M., hat eine evang. Kirche,
kohlensäurehaltige Stahlquellen und alkalisch-erdige
Säuerlinge, welche bei Katarrh der Luftwege, Tuberkulose,
Gicht, Blasenkatarrh etc. getrunken werden, und 405 Einw. Von dem
Wasser werden jährlich gegen 1 Mill. Krüge versandt. In
der Nähe die Stadt Zavelstein (s. d.). Vgl. Wurm, Das Bad T.
(5. Aufl., Stuttg. 1884).
Teint (franz., spr. täng), Gesichts- oder
Hautfarbe.
Teiresias (Tiresias), griech., der Ödipussage
angehöriger Seher, ward in seinen Jünglingsjahren von den
Göttern mit Blindheit geschlagen, weil er den Menschen
Geheimnisse der Götter mitteilte (oder weil er Athene im Bad
gesehen hatte), dann von Zeus mit der Gabe der Weissagung und einem
Leben von sieben Menschenaltern beschenkt. Bei dem Zug der Epigonen
gegen Theben als Gefangener abgeführt, starb er unterwegs an
der Quelle Tilphussa. Er weissagte auch noch in der Unterwelt.
563
Teirich - Telaw.
Teirich, Valentin, Zeichner und Kunstschriftsteller, geb.
23. Aug. 1844 zu Wien, besuchte unter Fr. Schmidt die Kunstakademie
daselbst und bildete sich darauf im Atelier van der Nülls und
auf Reisen zu einem gediegenen Kenner der deutschen und
italienischen Renaissance. Er ward 1868 Dozent, später
Professor an der Kunstgewerbeschule des Österreichischen
Museums und zugleich Dozent am Polytechnikum. In dieser Stellung
schuf er eine große Anzahl von trefflichen Entwürfen
für die Möbel-, Bronze- und Thonwarenindustrie,
begründete 1872 die "Blätter für Kunstgewerbe", die
später von Storck fortgeführt wurden, starb aber schon 8.
Febr. 1877. Er schrieb: "Die moderne Richtung in der Bronze- und
Möbelindustrie" (Wien 1868) und gab heraus: "Die Ornamente aus
der Blütezeit der italienischen Renaissance" (das. 1871);
"Marmorornamente des Mittelalters und der Renaissance in Italien"
(das. 1874; "Kabinett, im Auftrag Sr. Majestät des Kaisers
Franz Joseph I. entworfen" (das. 1874). Nach seinem Tod erschienen.
"Bronzen der italienischen Renaissance" (1878).
Teisendorf, Flecken im bayr. Regierungsbezirk Oberbayern,
Bezirksamt Laufen, an der Sur und dem Fuß der Alpen sowie an
der Linie München-Rosenheim-Salzburg der Bayrischen
Staatsbahn, hat eine kath. Kirche, Öberförsterei,
Bierbrauerei und 630 Einw. In der Nähe die Schloßruine
Raschenberg und Spuren der Römerstraße von Augsburg nach
Salzburg.
Teisserenc de Bort (spr. täß'rang d'bor),
Pierre Edmond, franz. Staatsmann, geb. 1814 zu Chateauroux, ward
auf der polytechnischen Schule gebildet, dann Ingenieur bei der
Verwaltung des Tabaksmonopols, darauf Regierungskommissar bei
verschiedenen Eisenbahngesellschaften, Mitgründer der Bahn
Paris-Lyon-Mittelmeer, im Februar 1871 Mitglied der
Nationalversammlung, wo er sich den konservativen Republikanern
anschloß, war vom April 1872 bis 24. Mai 1873 Minister der
öffentlichen Arbeiten, wurde 1876 Mitglied des Senats und war
vom März 1876 bis 16. Mai 1877 und 13. Dez. 1877 bis Februar
1879 wieder Minister der öffentlichen Arbeiten. Er bekleidete
darauf bis 1880 den Botschafterposten in Wien.
Teiste (Stechente), s. Lumme.
Teja, Stadt in Marokko, s. Thesa.
Tejada, Staatsmann, s. Lerdo de Tejada.
Tejas, letzter König der Ostgoten, war Feldherr des
Totilas, nach dessen Fall bei Tagina 552 er in Pavia zum König
erhoben wurde, sammelte in Oberitalien die Reste der Goten und zog
darauf nach Unteritalien seinem in Cumä von den Römern
belagerten Bruder Aligern zu Hilfe. Hier am Sarnus kämpfte er
einen 60tägigen Verzweiflungskampf gegen die Römer, in
dem er endlich nach heldenhaftem Widerstand mit dem
größten Teil seines Volkes fiel.
Tejo (spr. teschu), Fluß, s. Tajo.
Teju (Tejus Gray), Eidechsengattung aus der Ordnung der
Saurier (Sauria) und der Familie der Schienenechsen (Ameivae),
amerikanische Reptilien mit gestrecktem Körper, meist 2-3
Querfalten an der Kehle, glatten, in quere Binden geordneten
Rückenschuppen, glatten, vierseitigen, in der Fünfform
stehenden Bauchschuppen, an der Basis einstülpbarer Zunge, mit
zwei oder drei Einschnitten versehenen obern Schneidezähnen
und in der Jugend dreispitzigen, im Alter höckerigen
Backenzähnen. Der T. (Salompenter, T. teguixin Gray), bis 2 m
lang, oberseits bräunlichschwarz mit weißgelben und
weißen Flecken und Binden, unterseits rötlichgelb,
schwarz gebändert, bewohnt Südamerika von Guayana bis
Paraguay, lebt hauptsächlich in der Nähe der Küste,
in Plantagen, Gebüschen, Wäldern, gräbt sich
Erdhöhlen unter Baumwurzeln, nährt sich von Früchten
und allerlei kleinen Tieren und wird auf Hühnerhöfen
schädlich durch das Rauben von Eiern und jungem Geflügel.
Er ist sehr schüchtern und flüchtig, leistet aber im
Notfall tapfere Gegenwehr und beißt äußerst
scharf. Man jagt ihn eifrig auch des wohlschmeckenden Fleisches
halber und benutzt dies und besonders das Fett gegen
Schlangenbiß.
Tejuco, Stadt, s. Diamantina.
Tekendorf (ungar. Teke), Stadt im ungar. Komitat
Klausenburg (Siebenbürgen), mit 3 Kirchen, (1881) 2032
ungarischen, rumänischen und deutschen Einwohnern,
Bezirksgericht und Weinbau.
Tekiëh, ein mohammedan. Mönchskloster.
Tekke-Turkmenen (Tekinzen), ein Stamm der Turkmenen,
nördlich vom Kopet Dagh bis zur Sandwüste Karakum und
südöstlich bis Merw in einem mit zahlreichen Festungen
besetzten Gebiet wohnhaft; sie zerfallen in drei Stämme: die
Achal-T., die Tetschen-T. und die Merw-T. Die erstern wurden nach
zweijährigem hartnäckigen Widerstand von den Russen
unterworfen, indem General Skobelew 24. Jan. 1881 ihre Hauptfestung
Gök-Tepe erstürmte. Durch Ukas vom 18. Mai 1881 wurde das
Gebiet der Achaltekinzen mit dem transkaspischen Gebiet vereinigt
und 31. Jan. 1884 auch Merw von den Russen in Besitz genommen.
Tekrit, kleine, früher bedeutendere, von Arabern
bewohnte Stadt im türk. Wilajet Bagdad, am rechten User des
Tigris, etwa 160 km nordnordwestlich von Bagdad auf mehreren
Hügeln, die zum Flusse steil abfallen, mit Ruinen einer alten
Festung und angeblich 2000 Einw.
Tekrur, der einheimische Name für die Osthälfte
des Sudân vom Niger bis Kordofan.
Tektonik (griech.), die Kunst, Räume herzustellen,
in welchen man wohnt, die Baukunst im weitern Sinn; dann auch die
Kunst, Geräte und Möbel unter Berücksichtigung des
Verhältnisses der tragenden und getragenen Teile aus Holz und
andern Materialien zu verfertigen (Möbeltischlerei,
Zimmermannskunst, Gefäßbildnerei etc.).
Tektur (lat.), Decke, Umschlag eines
Aktenstücks.
Tekutsch (rumän. Tecuciu), Kreishauptstadt in
Rumänien (Moldau), am Berlad, Knotenpunkt der Eisenbahnen nach
Galatz, Berlad und Marasesti (Linie Roman-Verciorova), Sitz der
Präfektur und eines Tribunals, mit einem Gymnasium, Weinbau,
Handel und 9081 Einw.
Tela (lat.), Gewebe, z. B. T. cartilaginea,
Knorpelgewebe.
Telabun, s. Eleusine.
Telamon, griech. Heros, Sohn des Äakos und der
Endeis, Bruder des Peleus, flüchtete wegen des an seinem
Halbbruder Phokos verübten Mordes nach Salamis zum Kychreus,
der ihn zum Schwiegersohn erkor und ihm bei seinem Tode die
Herrschaft hinterließ. Seine spätere Gattin Periböa
gebar ihm den Aias. T. begleitete Herakles nach Troja, wo er die
Tochter des Luomedon, Hesione, zum Geschenk erhielt, die ihm den
Teukros gebar, und nahm auch teil an der kalydonischen Jagd und der
Argonautenfahrt.
Telamonen (griech.), in der Architektur, s.
Karyatiden.
Telaw, Kreisstadt im russisch-kaukas. Gouvernement
Tiflis, Hauptort der Landschaft Kachetien, in obst- und weinreicher
Gegend, mit Palästen und den Ruinen alter Befestigungen, einem
Bazar, lebhaftem Handel mit Wein und (1879) 7022 Einw.
564
Telchinen - Telegraph.
Telchinen, in der griech. Mythologie ein aus dem Meer
entsprossenes Urgeschlecht auf der Insel Rhodos. Sie galten
für die ältestem Metallarbeiter und Verfertiger von
Götterbildern und mythischen Waffen und Geräten,
namentlich der Sichel des Kronos und des Dreizacks des Poseidon
(welch letzterer ihnen von Rhea zur Erziehung anvertraut sein
sollte, wie Zeus den rhodischen Kureten), aber auch für
neidische Zauberer und Göttern wie Menschen feindliche
Dämonen. Sie wurden daher von Apollon getötet, nach
andrer Sage von Zeus durch eine Überschwemmung der Insel
vernichtet; nach noch andrer Tradition wanderten sie von Rhodos aus
und zerstreuten sich nach Lykien, Cypern, Kreta und
Griechenland.
Teleangiëktasie (griech.), s. Feuermal.
Telega, russ. Fuhrwerk, s. Kibitka.
Telegonos, im griech. Mythus Sohn des Odysseus und der
Kirke, zog auf Geheiß seiner Mutter aus, den Vater zu suchen,
und ward durch einen Sturm nach Ithaka verschlagen. Als er hier,
von Hunger getrieben, auf den Feldern des Odysseus raubte und
dieser ihm entgegentrat, tötete er seinen Vater, ohne ihn zu
kennen. Auf Geheiß der Athene ging er darauf mit Telemachos
und Penelope zur Kirke zurück und vermählte sich dort mit
Penelope, die ihm den Italos gebar. Er soll Präneste und
Tusculum gegründet haben.
Telegramm (griech.), aus Amerika (1852) stammende
Bezeichnung einer telegraphischen Nachricht (sprachlich richtiger
Telegraphem, wie im heutigen Griechenland üblich). Man
unterscheidet: 1) T. in offener Sprache mit allgemein
verständlichem Inhalt in einer gebräuchlichen Sprache; 2)
T. in verabredeter Sprache in Wörtern, die nur für den
Eingeweihten einen Sinn geben. Die Wörter werden für die
internationale Korrespondenz zugelassenen Wörterbüchern
entnommen und bezeichnen oft ganze Sätze, so daß das T.
sehr kurz und billig wird; 3) T. in chiffrierter Sprache, d. h. aus
Ziffern oder Buchstaben bestehend, zu deren Deutung ein
Schlüssel nötig ist (s. Chifferschrift). Die
Gebühren werden nach einem Einheitssatz für das Wort
berechnet. Größte Länge eines Wortes für T. 1)
im europäischen Verkehr 15, im außereuropäischen
Verkehr 10 Buchstaben, für T. 2) höchstens 10 Buchstaben.
Bei T. 3) sind je 5 Ziffern oder Buchstaben = ein Wort. Worttaxe
(1889) im innern Verkehr Deutschlands 6, für Stadttelegramme 3
Pfennig und im Verkehr mit Algerien-Tunis 27, Belgien 10,
Bosnien-Herzegowina 20, Bulgarien 25, Dänemark 10, Frankreich
15, Gibraltar 25, Griechenland mit Euböa und Poros 40,
griechische Inseln 45, Großbritannien 20 (Grundtaxe 40),
Helgoland 15, Italien 20, Luxemburg 6, Malta 40, Marokko 40,
Montenegro 20, Niederlande 10, Norwegen 20, Österreich-Ungarn
10, Portugal 25, Rumänien 20, Rußland (europäisches
und kaukasisches) 25, Schweden 20, Schweiz 10, Serbien 20, Spanien
25, Tripolis 105, Türkei 45 Pfennig. Dringende Telegramme
(dringend, urgent, D.) werden gegen dreifache Gebühr vor
andern befördert. Bezahlte Antwort (Antwort bezahlt, reponse
payee, R. P.) wird für zehn Worte berechnet, man kann aber
auch für mehr Worte und für dringende Antwort (R. P. D.)
bezahlen. Verglichene Telegramme (Vergleichung, collation, T. C.)
werden von der Ankunftsstelle zurücktelegraphiert, Gebühr
für Vergleichung ein Viertel der Gebühr für das T.
Empfangsanzeige (Empfangsanzeige bezahlt, accuser réception
C. R.), Gebühr gleich T. von zehn Worten. Nachzusendendes T.
(nachzusenden, faire suivre, F. S.) wird innerhalb Europas dem
Empfänger nachgesandt und die Gebühr von letzterm
erhoben. Zu vervielfältigendes T. an mehrere Empfänger in
demselben oder an mehrere Wohnungen desselben Empfängers in
demselben Ort. Gebühr für jede Abschrift 40 Pf. Offen zu
bestellendes T. (remettre ouvert, R. O.) wird unverschlossen
übergeben. P. P. = poste payée, Post bezahlt; X. P. =
exprés payé, Eilbote bezahlt. Seetelegramm
(sémaphorique) für Schiffe in See muß
Empfänger, Namen des Schiffs und der zu benutzenden
Seetelegraphenanstalt enthalten. Berichtigungs- oder
Ergänzungstelegramm: 72 Stunden nach Empfang, resp. Absenduug
eines Telegramms kann man Richtigstellung zweifelhaft erscheinender
Wörter fordern, hat die Gebühr für die
erforderlichen Telegramme zu hinterlegen, erhält dieselbe aber
zurück, wenn Entstellung durch Schuld des Telegraphendienstes
sich ergibt. Die für diese besondern Telegramme angegebenen
Bezeichnungen sind vor das T. zu setzen, sie sind gleich dem Inhalt
des Telegramms gebührenpflichtig, die Abkürzungen
zählen aber nur als ein Wort.
Telegraph (griech., "Fernschreiber", hierzu Tafeln
"Telegraph I u. II"), jede Vorrichtung, welche den Austausch von
Nachrichten zwischen entfernten Orten ohne Zuhilfenahme eines
Transportmittels ermöglicht. Licht, Schall und
Elektrizität sind die Mittel, deren man sich zur Erreichung
dieses Zwecks bedienen kann; doch finden die optischen und
akustischen Telegraphen nur noch zu Signalen, im Eisenbahnbetrieb,
bei der Schiffahrt und im Kriegswesen Verwendung. Optische
Telegraphen sind schon im Altertum angewandt worden; nach
Äschylos erfuhr Klytämnestra die Eroberung von Troja
durch Feuerzeichen auf den Bergen noch in derselben Nacht, obwohl
eine Strecke von 70 Meilen dazwischenlag. Ähnliche Alarmfeuer
waren bei den Feldzügen Hannibals, insbesondere bei den
Schotten, aber auch bei den germanischen und andern
Völkerschaften gewöhnliche Mittel der Telegraphie,
worüber sich unter andern bei Polybios, I. Africanus und
sonstigen Schriftstellern Nachrichten finden. Kleoxenos und
Demokleitos (450 v. Chr.) sollen die Buchstaben des griechischen
Alphabets auf fünf Tafeln verteilt und dann durch Erheben von
Fackeln nach links oder rechts zuerst die Tafel, auf welcher der zu
telegraphierende Buchstabe stand, darauf die Nummer des letztern
selbst bezeichnet haben. Polybios (196) ließ diese
Feuerzeichen durch Röhren beobachten, welche in gewissen
Stellungen fixiert waren. Weitere Ausbildung erhielt der optische
T. erst 1793 durch die Gebrüder Chappe, welche drei Balken an
einem weithin sichtbaren Ort so an einem Gestell befestigten,
daß sie in vielfachen Kombinationen eine große Zahl
bestimmter Zeichen geben konnten. Zwischen Paris und Lille
telegraphierte man mit diesem Apparat, unter Benutzung von 20
Stationen, in 2 Minuten, und seitdem verbreitete sich derselbe sehr
schnell. In neuerer Zeit benutzt man nach dem Vorgang der
Amerikaner während des Bürgerkriegs auch bei der
optischen Telegraphie die Zeichen des Morsealphabets und stellt sie
durch kurze und lange Lichtblitze, Stellung beweglicher Arme,
Tafeln an Stangen oder Flaggen dar. Die Engländer haben im
Kapland und Afghanistan den Heliographen (s. d.) angewendet.
Mackenzie hat mit dem Heliographen den Taster des Morse-Apparats
verbunden und fixierte auf der Empfangsstation die Lichtblitze
photographisch. Spankowski hat die Lichtblitze durch Verbrennung
zerstäubten Petroleums in einer Spiritusflamme, und auf
Telegraph I.
Fig. 3. Schaltung für Kabelstation.
Fig. 13. Korrektionsrad.
Fig. 5. Schriftprobe des Heberschreibapparats.
Fig. 18. Isolier-Doppelglocke.
Fig. 17. Gegensprechschaltung von Canter.
Fig. 16. Gegensprechschaltung von Fuchs.
Fig. 4. Thomsons Heberschreibapparat.
Fig. 19. Querschnitte der Kabel
Zum Artikel »Telegraph«.
Telegraph.
Fig. 1. Casellis Pantelegraph.
Fig. 12. Druckvorrichtung des Hughes-Apparats.
Fig. 10. Hughes-Apparat.
Telegraph II.
Fig. 11. Elektromagnetsystem und Verkuppelung des
Hughes-Apparats.
Fig. 7 Morse-Taste.
Fig. 6. Normalfarbschreiber.
Fig. 2. Thomsons Spiegelgalvanometer.
Fig. 9. Plattenblitzableiter.
Fig. 8. Galvanoskop.
Fig. 14. Stiftbüchse des Hughes-Apparats.
Fig. 15. Schlitten des Hughes-Apparats mit seitlichem
Kontakt.
565
Telegraph (elektrische Telegraphie).
kurze Entfernungen hat man sie durch Öffnen und
Schließen einer hellleuchtenden Lampe hervorgebracht. In
Deutschland, Rußland u. a. O. hat man in gefesselten
Luftballons durch elektrisches Licht ähnliche Zeichen gegeben.
Bruce benutzte einen aus dünnem Stoff gefertigten Luftballon
von 4-5 m Durchmesser, in welchem eine oder mehrere Glühlampen
aufgehängt sind, deren Erglühen durch eine Leitung im
Haltetau hervorgerufen wird; der Luftballon erscheint dann als
glühende Kugel. Die Franzosen haben zwischen Mauritius und
Réunion auf 180 km Entfernung einen optischen Telegraphen
eingerichtet, bei dem die Lichtblitze einer Petroleumflamme durch
Prismen verstärkt werden. Zur Zeichengebung durch bewegliche
Arme bedient man sich im Festungskrieg, auch auf den
Schießplätzen der Artillerie, der vierarmigen
Semaphoren. In gleicher Weise erfolgt die Zeichengebung durch zwei
nebeneinander stehende Leute, die in jeder Hand eine Tafel mit
kurzem Stiel halten; die senkrechte Stellung derselben bedeutet
Punkte, die wagerechte die Striche des Alphabets. Nachts treten an
Stelle der Tafeln farbige Laternen; je nach Vereinbarung bedeutet
die eine Farbe Punkte, die andre Striche. Diese Art des
Telegraphierens bildet den Übergang zum Signalisieren (s.
Signale), wobei gewisse Zeichen oder Armstellungen gewisse
Bedeutung erhalten, die durch ein Signalbuch festgestellt sind.
Die elektrische Telegraphie
beruht auf der schnellen Fortpflanzung der Elektrizität in
metallischen Leitern. Die Versuche, die Reibungselektrizität
zum Telegraphieren zu benutzen, führten zu keinem praktischen
Ergebnis; nachdem aber in der galvanischen oder
Berührungselektrizität eine viel geeignetere Kraftform
entdeckt war, benutzte Sömmerring 1809 die durch die Voltasche
Säule bewirkte Wasserzersetzung zum Telegraphieren, indem er
35 Drähte zu ebenso vielen mit Buchstaben und Ziffern
bezeichneten Wassergefäßen der entfernten Station
leitete. Die hohen Kosten einer solchen Leitung sowie die
Schwierigkeit, einen Strom von erforderlicher Stärke auf
größere Entfernungen zu entsenden, ließen auch
diese Idee als im großen unausführbar erscheinen. In
späterer Zeit hat man die chemische Wirkung des elektrischen
Stroms zur Herstellung von Schreib- und Kopiertelegraphen zu
verwenden gesucht, indem man Papierstreifen mit einer farblosen
Flüssigkeit tränkte, welche durch den Strom in
gefärbte Bestandteile zerlegt ward, z. B. mit einer
Lösung von Jodkalium oder Blutlaugensalz. Derartige
Telegraphen sind angegeben worden von Davy (1838), Bain (1847),
Gintl und Stöhrer (1852), haben aber keine Verbreitung
gefunden.
Der Pantelegraph von Caselli (Fig. 1, Tafel I) war 1865 zwischen
Paris und Lyon im Gebrauch. Ein innerhalb eines eisernen Rahmens
bei D befestigtes langes Pendel mit der Eisenlinse E schwingt unter
Mitwirkung eines Chronometers F und der Batterie B zwischen den
Elektromagneten M M1 und überträgt durch die Zugstange de
seine Bewegung auf die an dem Schlitten f befestigten
Schreibstifte. Letztere bewegen sich demnach hin und her über
den auf den gekrümmten Blechpulten A A1 aufliegenden, chemisch
zubereiteten Papierblättern und rücken zugleich bei jeder
Schwingung um eine Linienbreite auf ihrer Achse vor. Der eine Stift
arbeitet nur auf dem Hingang, der andre auf dem Rückgang; es
können mithin zwei Telegramme zugleich abgegeben werden. Die
Epoche der elektromagnetischen Telegraphie begann 1820 mit
Örsteds Entdeckung, daß eine in der Nähe des
Schließungsdrahts einer Voltaschen Säule aufgestellte
Magnetnadel je nach der Richtung des Stroms nach der einen oder der
andern Seite hin abgelenkt wird. Da hierzu, wenn die Nadel von
zahlreichen Drahtwindungen (Multiplikator) umgeben ist, ein
schwacher Strom ausreicht, so war die Möglichkeit, auf
große Entfernungen zu telegraphieren, gegeben. Jedoch weder
das Telegraphenmodell von Ampère und Ritchie (1820) mit 30
Nadeln und 60 Leitungsdrähten noch dasjenige von Fechner
(1829) mit 24 Nadeln und 48 Drähten eignete sich zur
Ausführung im großen. Erst 1832 versuchte Schilling von
Canstadt, Eine Nadel mit nur zwei Leitungsdrähten anzuwenden
und die verschiedenen Buchstaben durch Kombination mehrerer
Ablenkungen nach rechts und links auszudrücken. Aber schon
1833 hatten Gauß und Weber zu Göttingen zwischen der
Sternwarte und dem physikalischen Kabinett eine auf derselben von
ihnen selbständig gefundenen Idee beruhende telegraphische
Verbindung hergestellt. Von ihnen angeregt, legte Steinheil 1837
zwischen München und Bogenhausen eine ¾ Meile lange
Telegraphenleitung an; er wandte, wie Gauß und Weber, statt
der gewöhnlichen galvanischen Ströme die
Magnetinduktionsströme an und fixierte die Zeichen in Form
einer Schrift, indem seine zwei Magnetnadeln, wenn sie abgelenkt
wurden, auf einen durch ein Uhrwerk vorübergeführten
Papierstreifen Punkte zeichneten. In England wurde der
Nadeltelegraph durch Cooke und Wheatstone eingeführt; ersterer
hatte 1836 in Heidelberg ein Modell des Schillingschen Apparats
gesehen und verband sich 1837 mit Wheatstone zur Verbesserung und
praktischen Verwertung der Schillingschen Erfindung.
Der Nadeltelegraph von Wheatstone und Cooke, welcher auf
englischen Eisenbahnlinien noch gegenwärtig vereinzelt in
Gebrauch ist, enthält zwei auf gemeinschaftlicher horizontaler
Achse befestigte, im Ruhestand vertikal stehende Magnetnadeln,
deren eine sich innerhalb einer Multiplikatorrolle, die andre als
Zeiger auf der Vorderseite des Apparatgehäuses befindet; sie
bilden ein sogen. astatisches Nadelsystem, indem ihre gleichnamigen
Pole nach entgegengesetzten Seiten gekehrt sind. Zum Zeichengeben
dient der im untern Teil des Apparats angebrachte sogen.
Schlüssel, durch dessen Drehung die Nadeln sämtlicher in
die Leitung eingeschalteter Apparate so abgelenkt werden, daß
sie mit der Stellung, die man dem Handgriff jeweilig gegeben hat,
parallel stehen. Durch Kombinationen von Ablenkungen nach rechts
und links werden die Buchstaben ausgedrückt. Der
Doppelnadeltelegraph derselben beiden Erfinder, eine
Zusammensetzung zweier Nadelapparate der eben beschriebenen Art,
erfordert eine doppelte Drahtleitung, gestattet aber eine raschere
Korrespondenz. Die Nadeltelegraphen haben den Vorteil, daß zu
ihrem Betrieb schon sehr schwache Ströme ausreichen; sie
eignen sich deshalb vorzugsweise zur Verwendung auf Kabellinien, wo
sie in der Form empfindlicher Galvanometer auch heute noch benutzt
werden.
Das Spiegelgalvanometer von Thomson (Fig. 2 auf Tafel II),
welches auf den meisten längern Unterseekabeln als
Empfänger dient, besteht aus einer Multiplikatorrolle mit
vielen Umwindungen, innerhalb deren eine ungemein leichte, kleine
Magnetnadel an einem Kokonfaden freischwebend aufgehängt ist.
An der Magnetnadel ist ein kleiner Spiegel befestigt, welcher das
in der Richtung von D einfallende Bild einer dem Instrument
gegenübergestellten Lichtquelle C (gewöhnlich einer
Petroleumflamme) nach E auf einen dunkel gehaltenen Schirm AB
reflektiert. Die
566
Telegraph (Wheatstones Zeigertelegraph, Morses
Schreibapparat).
Schraube s dient dazu, das Lichtbild im Ruhezustand auf den
Nullpunkt einzustellen, der gekrümmte Magnet NS, den
Einfluß des Erdmagnetismus zu neutralisieren, indem man
denselben längs des Stäbchens t verschiebt. Jeder noch so
schwache Strom, welcher die Umwindungen des Galvanometers
durchläuft, lenkt die Nadel ab; mit dieser dreht sich auch der
Spiegel, und das Lichtbild auf der Wand bewegt sich dem
entsprechend von seinem Ruhepunkt nach rechts oder links. Ein bei x
eintretender und bei y zur Erde geführter positiver Strom
bewegt die Nadel und den Lichtschein nach der einen, ein negativer
nach der andern Seite; durch passende Gruppierung der Ablenkungen
wird das Alphabet gebildet. Das Abtelegraphieren erfolgt mit einer
Doppeltaste, welche nach Belieben positive oder negative
Ströme in die Leitung zu schicken gestattet. Fig. 3 (Tafel I)
zeigt die gebräuchlichste Schaltung für zwei durch ein
Unterseekabel K verbundene Stationen A und B. T1 T2 sind die
Doppeltasten, G1G2 die Spiegelinstrumente, B1B2 die Batterien; C1C2
stellen Kondensatoren von beträchtlichem Ladungsvermögen
dar, die behufs Unschädlichmachung der Erdströme zwischen
Kabel und Apparaten eingeschaltet werden; U1U2 endlich sind
Kurbelumschalter, welche beim Geben die Doppeltaste, beim Empfangen
das Galvanometer mit dem Kondensator in Verbindung bringen. Die
Doppeltaste besteht aus zwei Hebeln mit Knöpfen, welche im
Ruhezustand gegen eine obere Querschiene federn, beim Tastendruck
aber diese verlassen und mit der untern Querschiene in leitende
Verbindung treten. Da zwischen beiden Querschienen die Batterie
eingeschaltet ist, während der eine Tastenhebel mit der Erde
E, der andre mit der Leitung in Verbindung steht, so wird beim
Niederdrücken der einen oder der andern Taste entweder ein +
oder ein - Strom in die Leitung fließen.
An die Stelle des Spiegelgalvanometers ist jetzt vielfach der
Heberschreibapparat (Syphon recorder) von Thomson (Fig. 4, Tafel I)
getreten. Eine Multiplikatorolle S aus feinem Drahte, die um einen
Rahmen gewickelt ist, hängt freischwebend und leichtbeweglich
zwischen den Polen eines kräftigen Elektromagnets MM; sie
verhält sich genau wie die Nadel des Spiegelinstruments. Der
ankommende Strom durchläuft die Spule und lenkt sie nach
rechts oder links ab; diese nimmt dabei einen feinen Glasheber t
mit, der durch Kokonfäden mit ihr verbunden ist, und dessen
Spitze einem bewegten Papierstreifen unmittelbar
gegenübersteht, ohne ihn jedoch zu berühren. Der
Glasheber taucht mit feinem kürzern Ende in ein
Tintenfaß aus Metall K, welchem durch eine eigenartig
konstruierte, im Apparat selbst angebrachte Elektrisiermaschine B
stets eine elektrische Ladung erteilt wird, die genügt, um aus
der Heberöffnung nach dem Papierstreifen hin beständig
kleine Tintentröpfchen abzuspritzen. In der Ruhelage des
Multiplikators steht die Heberöffnung über der Mitte des
Streifens; die übergeriffenen Tintentröpfchen zeichnen
mithin eine punktierte gerade Linie mitten auf den Streifen. Lenkt
ein ankommender Stromimpuls die Multiplikatorrolle und mit ihr den
Heber ab, so verwandelt sich die Gerade in eine Schlangenlinie, und
zwar weicht die Punktreihe je nach der Stromrichtung oberhalb und
unterhalb ab (Fig. 5, Tafel I).
Die wichtigste Förderung hat die Telegraphie erfahren durch
die Anwendung von Elektromagneten. Wheatstone bediente sich
derselben zuerst zur Herstellung eines Läutwerkes, welches
seinem Nadeltelegraphen als Alarmvorrichtung beigegeben war, bald
aber auch zur Konstruktion seines Zeigertelegraphen (1839), bei
welchem ein durch ein Uhrwerk getriebener Zeiger durch eine am
Anker eines Elektromagnets angebrachte Hemmungsvorrichtung von der
entfernten Abgangsstation aus nach Belieben vor jedem der am Rande
des Zifferblattes verzeichneten Buchstaben angehalten werden kann.
Auch Kramer, Siemens u. Halske, Froment, Breguet u. a. haben
Zeigertelegraphen konstruiert, die indessen nur selten noch benutzt
werden.
Die größte Verbreitung erlangte der 1836 von Morse
erfundene Schreibapparat. Derselbe besteht aus einem Elektromagnet
mit beweglichem Anker, dessen Hebel auf einem durch Uhrwerk
vorübergeführten Papierstreifen Punkte und Striche
erzeugt. In den Reliefschreibern geschah dies durch einen an dem
freien Ende des Ankerhebels befestigten stählernen Stift,
welcher, sobald der Anker von dem Elektromagnet angezogen wurde,
sich gegen den zwischen zwei Walzen des Laufwerkes durchgezogenen
Papierstreifen anlegte und in demselben kürzere oder
längere Eindrücke hinterließ, je nachdem die zum
Schließen der Batterie dienende Taste nur einen Augenblick
oder längere Zeit niedergedrückt wurde. In neuerer Zeit
finden die Morseapparate vorzugsweise als Farbschreiber Verwendung,
in welchen die Hebelbewegung des Ankers benutzt wird, um den
Papierstreifen gegen ein Farbrädchen oder umgekehrt ein
Farbrädchen gegenden Papierstreifen anzudrücken. Der
Siemenssche Normalfarbschreiber der deutschen
Reichstelegraphenanstalten mit Morsebetrieb ist in Fig. 6 auf Tafel
II abgebildet. E ist der hufeisenförmige Elektromagnet, dessen
Kerne mit Polschuhen U versehen sind. Den Polen gegenüber
befindet sich der hohle, oben aufgeschlitzte Eisenanker K, der
durch eine Preßschraube in dem Messinghebel H1 befestigt ist;
letzterer hat seine Achse im Innern des Apparatgehäuses W. Die
Auf- und Abwärtsbewegung des Ankerhebels wird begrenzt durch
die Kontaktschrauben C1C2 des Messingständers T. In dem Rohr B
befindet sich eine regulierbare Abreißfeder, während
durch Drehung der Mutter M1 das ganze Elektromagnetsystem gehoben
oder gesenkt werden kann. Der federnde Ansatz F2 des Ankerhebels
läßt sich durch die Stahlschraube s höher oder
tiefer stellen; er trägt den Stift t1 und die Achse q1, um
welche sich ein zweiarmiger Hebel H4 gelenkartig bewegen
läßt. Unterhalb H4 befindet sich ein in die vordere
Apparatwange eingeschraubter Stahlstift t2, auf welchen der
längere Arm von H4 sich auflegt, wenn die Schraube s angezogen
wird; der kürzere Arm verläßt dann den Stift t1,
und die beiden Teile F2H4 bilden einen Knickhebel, so daß H4
sich hebt, wenn F2 sich senkt, und umgekehrt. Wird dagegen die
Schraube s nachgelassen, so legt sich der kürzere Arm von H4
gegen t1, und die Bewegungen von F2 und H4 erfolgen im gleichen
Sinn. Im letztern Fall ist der Apparat für Arbeitsstrom
verwendbar, wobei die telegraphischen Zeichen durch das Entsenden
eines Batteriestroms in die vorher stromfreie Leitung gebildet
werden, während die erstere Stellung der Schraube s dem
Arbeiten mit Ruhestrom entspricht, bei welchem die Zeichen durch
Unterbrechungen der für gewöhnlich vom Strom
durchflossenen Leitung entstehen. Der Hebel H4 trägt in seinem
hakenförmig gestalteten Ende die Achse des vom Laufwerk in
drehender Bewegung erhaltenen Farbrädchens O3, welches mit
seinem untern Rand in die Öffnung des Farbgefäßes F
taucht. Durch die Führungswalzen O1O2 wird der Papierstreifen
über r3x1 t oberhalb des Farbrädchens
vorübergeführt,
567
Telegraph (Relais, Morse- und Estienneschrift).
um über die Platte P nach links abzulaufen. T1 ist die
Federtrommel des Laufwerkes mit der Handhabe G zum Aufziehen und
dem Kontrollstern C zur Begrenzung der Federspannung.
Zum Schließen und Öffnen des Stroms dient die in Fig.
7 auf Tafel II abgebildete Taste, ein um die Achse q in dem
Ständer L drehbarer Messinghebel B mit zwei Kontakten R und T,
von denen R im Zustand der Ruhe durch die Wirkung der Spiralfeder F
gegen die Schiene s3 gepreßt wird, während beim Drucken
auf den Knopf O die leitende Verbindung zwischen R und s3
aufgehoben, dagegen zwischen T und s1 hergestellt wird. Ob Strom
vorhanden ist, erkennt man an dem Galvanoskop (Fig. 8, Tafel II),
dessen Zeiger n an einem zwischen Drahtumwindungen in senkrechter
Ebene drehbar aufgehängten Winkelmagnet befestigt ist und je
nach der Richtung des Stroms nach rechts oder links
ausschlägt. Als Schutzmittel gegen Beschädigungen der
Apparate durch den Blitz (s. Blitzableiter) dient der
Plattenblitzableiter (Fig. 9, Tafel II). Die mit den Leitungen und
den Apparaten verbundenen Messingplatten P1P2 haben Querreifeln und
sind innerhalb des Rahmens R mit dem abnehmbaren, auf der
Unterseite mit Längsreifeln versehenen Deckel d so angeordnet,
daß sie für gewöhnlich sowohl untereinander als von
Rahmen und Deckel isoliert bleiben, aber im Bedarfsfall mittels des
Stöpsels s gegenseitig und mit dem Deckel leitend verbunden
werden können. Letzterer steht über den Rahmen und die
Klemmschraube k mit der Erde in Verbindung; etwanige aus der
Leitung kommende Blitzschläge vermögende geringe
Entfernung zwischen Leitungs- und Deckplatte leicht zu
überspringen und werden von dort unschädlich zur Erde
abgeleitet.
Die Verbindung der beschriebenen Apparate untereinander und mit
der Batterie ergibt sich aus den Stromläufen (Textfig. I
für Arbeitsstrom und Textfigur II für Ruhestrom), in
welchen T die Taste, A den Schreibapparat, G das Galvanoskop, B den
Blitzableiter, L B die Linienbatterie, E den zur Erde und L den zur
Leitung führenden Draht bezeichnen.
Wo die Stärke des ankommenden Stroms zur Ingangsetzung der
Schreibapparate nicht ausreicht, schaltet man in die Leitung ein
Relais. Dasselbe besteht aus einem Elektromagnet mit leicht
beweglichem Ankerhebel, welcher durch die anziehende Kraft des
Stroms an eine Kontaktschraube gelegt wird und dadurch eine
Ortsbatterie schließt, deren Strom dann den Schreibapparat in
Bewegung setzt. Relais mit besonders lautem Anschlag dienen unter
dem Namen Klopfer auch zum Aufnehmen von Telegrammen nach dem
Gehör. In den sehr empfindlichen polarisierten Relais sind die
Eisenkerne der Elektromagnetrollen auf Stahlmagneten befestigt und
dadurch dauernd magnetisiert.
Das durch internationale Vereinbarungen festgesetzte
Morsealphabet besteht aus Punkten und Strichen in nachstehender
Gruppierung: [siehe Grafik]
Die wagerechten Elementarzeichen erscheinen auf dem
Papierstreifen sehr gestreckt, was die Leichtigkeit des Ablesens
beeinträchtigt; auch nimmt die Darstellung der Striche durch
längern Tastendruck eine größere Zeit in Anspruch
und vermindert die Leistungsfähigkeit der Apparate. Der
Apparat von Estienne, welcher in neuerer Zeit von der deutschen
Reichstelegraphenverwaltung vielfach verwendet wird, stellt die
Striche und Halbstriche senkrecht zur Längsrichtung des
Papierstreifens und benutzt zur Erzeugung derselben je einen Strom
von gleicher Dauer, aber entgegengesetzter Richtung. An
nachstehendem Wort (Berlin) in Morse- und in Estienneschrift kann
der Unterschied erkannt werden: [siehe Grafik]
Der Estienne-Apparat besitzt an Stelle des Schreibrädchens
zwei Schreibfedern, welche die Farbe durch Kapillarwirkung aus dem
Farbebehälter entnehmen
568
Telegraph (Wheatstones automatischer Apparat, Hughes'
Typendrucktelegraph).
und auf den Streifen übertragen. Sie werden durch die
beiden Zinken eines gabelförmigen Hebels in Bewegung gesetzt,
der sich unter dem Einfluß der Stromwirkungen nach rechts
oder links anlegt. Die Schreibfläche der einen Feder ist
doppelt so breit als diejenige der andern; erstere dient zur
Darstellung der Striche, letztere zur Erzeugung der Punkte. Die
Gabelwelle trägt auf der Rückseite des Apparats eine
Zunge aus weichem Eisen, deren oberes Ende zwischen die Polschuhe
eines Elektromagnets ragt, während das untere Ende durch den
beweglichen Polschuh eines unterhalb des Apparatgehäuses
gelagerten Stahlmagnets eine magnetische Polarisation erhält,
so daß Ströme verschiedener Richtung die Zunge in
entgegengesetztem Sinn ablenken. Zum Betrieb des Apparats dienen
Wechselströme, deren Entsendung mittels einer Doppeltaste
erfolgt.
Eine ausgiebigere Benutzung der Telegraphenleitungen wird auch
durch die automatische Telegraphie erreicht. Sie
überträgt die Abtelegraphierung der Zeichen einer
mechanischen Vorrichtung, die bei vollkommner
Regelmäßigkeit der Schrift eine beträchtlich
größere Geschwindigkeit zu erreichen gestattet, als dies
der menschlichen Hand möglich ist. Wheatstone, dessen
automatischer Apparat in England mit großem Erfolg verwendet
wird, benutzt zum Geben einen gelochten Papierstreifen und zum
Empfangen einen schnell laufenden polarisierten Farbschreiben. Das
Lochen des Streifens geschieht unabhängig von der eigentlichen
Abtelegraphierung an besondern Stanzapparater. Der vorbereitete
Streifen durchläuft sodann den Geber, dessen Thätigkeit
er mittels zweier vertikal stehender Nadeln reguliert, die auf
Kontakthebel wirken und jedesmal in Thätigkeit treten, sobald
ein ausgestanztes Loch dem Nadelende den Durchgang gestattet. Der
Apparat arbeitet mit Wechselströmen, wobei jedem
Elementarzeichen zwei entgegengesetzt gerichtete Ströme von
gleicher Dauer entsprechen, von denen der eine den Schreibhebel des
Empfängers wider den Papierstreifen legt, der andre die
Zurückführung bewirkt. Außer Wheatstone haben noch
Bain, Siemens, Little u. a. automatische Telegraphen
konstruiert.
Nächst dem Morse-Apparat findet im Betrieb der
europäischen Telegraphenverwaltungen der Typendrucktelegraph
von Hughes (Fig. 10, Tafel I) die ausgedehnteste Verwendung. Sein
Mechanismus ist weniger einfach, aber seine Leistungsfähigkeit
bedeutend größer als diejenige des Morse-Apparats, vor
welchem er außerdem den Vorzug besitzt, daß die
Telegramme in gewöhnlicher Druckschrift ankommen, mithin
für jedermann ohne Übersetzung lesbar sind. An der
Vorderseite des Tisches befindet sich die Klaviatur, bestehend aus
28 Tasten, welche mit den Buchstaben, Ziffern und
Interpunktionszeichen beschrieben sind und beim Niederdrücken
die Verbindung zwischen Batterie und Leitung herstellen; dahinter,
zwischen den aufrecht stehenden Apparatwangen, ist das mit einem
Gewicht von 60kg bewegte Laufwerk, verbunden mit einer
Bremsvorrichtung und der in einem gußeisernen
Ansatzstück des Apparattisches gelagerten Regulierlamelle,
angeordnet; links neben dem Laufwerk das Elektromagnetsystem, und
an der Vorderwand des Apparats sieht man die Druckvorrichtung mit
dem Typenrad, wozu noch die auf der rechten Seite befestigte
Papierrolle gehört. Die Vorrichtung auf der linken hintern
Ecke der Tischplatte ist ein Umschalter, welcher die Richtung des
Telegraphierstroms beliebig zu wechseln gestattet. Vgl. Sack, Der
Drucktelegraph Hughes (2. Aufl., Wien 1884).
Das Elektromagnetsystem des Hughes-Apparats (Fig. 11 der Tafel
II) besteht aus einem kräftigen Stahlmagnet in Hufeisenform,
auf dessen Pole zwei von Elektromagnetrollen E umgebene hohle Kerne
von weichem Eisen so aufgesetzt sind, daß dieselben die
Verlängerung der Pole bilden und an ihren obern, mit
Polschuhen versehenen Enden selber entgegengesetzte Magnetpole
besitzen. Den Polschuhen gegenüber und im Ruhezustand auf
diesen aufliegend, befindet sich der flache Eisenanker E1E2,
welcher zwischen zwei Messingständern T um die Zapfenschrauben
s leicht drehbar eingelagert und mit zwei nach unten reichenden
Stahlfedern ee versehen ist, die sich gegen die Stellschrauben b1
b2 anlegen. Unter Mitwirkung dieser Federn erfolgt das Abschnellen
des Ankers, sobald ein Strom von solcher Richtung den Elektromagnet
durchfließt, daß dessen Polarität dadurch
geschwächt wird. Der Anker stößt bei seinem
Abfallen gegen den Hebel einer Sperrvorrichtung, löst diese
aus und bewirkt dadurch die Verkuppelung der Druckvorrichtung mit
dem Laufwerk und den Abdruck desjenigen Zeichens, welches sich in
diesem Moment an der untersten Stelle des Typenrades befindet. Weil
nun die anziehende Kraft des Magnets nicht ausreicht, um den
abgeschnellten Anker unter Überwindung der durch die
Spannfedern ausgeübten Gegenkraft wieder auf die Polschuhe
zurückzuführen, so überträgt Hughes diese
Arbeit der Mechanik des Apparats, indem er durch ein auf der
Druckachse befestigtes Exzenter F1 den rechtsseitigen Arm des
Auslösehebels G wieder emporheben und dadurch den Anker auf
die Polschuhe niederdrücken läßt, die ihn dann bis
zum nächsten Stromimpuls festhalten. Gleichzeitig wird
während dieses Vorganges die Kuppelung selbstthätig
wieder aufgehoben, die Druckachse bleibt stillstehen, und der
Auslösehebel nimmt, nachdem er den Anker
zurückgeführt hat, seine alte Stellung wieder ein.
Die Druckachse bildet die vordere Verlängerung der
Schwungradwelle. Letztere trägt auf ihrem freien Ende ein mit
feinen, schief geschnittenen Zähnen versehenes Sperrrad z und
einen Zapfen, auf welchen die Druckachse mit ihrem hintern,
entsprechend ausgehöhlten Ende aufgeschoben ist. Auf dem
hintern Ende der Druckachse ist das zweiarmige Querstück FF
befestigt, welches einerseits die drehbare Sperrklinke n,
anderseits die gegen die Sperrklinke drückende Feder f
trägt. Ein Ansatzstück F2 legt sich im Ruhestand gegen
den Anschlag G2 des Auslösehebels G, während ein an der
Sperrklinke angebrachter kegelförmiger Ansatz auf einem an dem
Winkel p befestigten prismatischen Stahlstück m, der sogen.
schiefen Ebene, ruht. Senkt sich der rechte Arm des
Auslösehebels G, so gleitet der kegelförmige Ansatz der
Sperrklinke von der schiefen Ebene herunter, die Sperrklinke
gelangt dadurch zum Eingriff in die Zähne des Sperrrades, und
die Verkuppelung der Druckachse mit der an der Bewegung des
Laufwerkes beständig teilnehmenden Schwungradachse tritt ein.
Nach Vollendung einer Umdrehung trifft indessen der Sperrkegel von
rechts her wieder auf den prismatischen Ansatz m, steigt an
demselben in die Höhe u. hebt dadurch den Sperrkamm aus den
Zähnen des Sperrrades; die Verkuppelung wird mithin jedesmal
selbstthätig wieder aufgehoben. Die Druckachse c (Fig. 12,
Tafel I) ist an ihrem vordern, außerhalb des
Äpparatgehäuses L1 befindlichen, in dem Messingwinkel J
gelagerten Teil mit mehreren verschiedenartig geformten Nasen
versehen, welche die Druckvorrichtung in Thätigkeit setzen.
Das Typenrad A trägt auf seiner Peripherie die Buchstaben,
Ziffern und Satzzeichen in erhabener Gravierung;
569
Telegraph (Hughes' Typendrucktelegraph).
es sitzt mit noch zwei andern Rädern, dem in der Figur
sichtbaren Korrektionsrad B und dem sogen. Friktionsrad, auf
derselben Achse, jedoch so, daß nur das Friktionsrad an der
Bewegung des Laufwerkes teilnimmt, während die auf einer
Buchse befestigten vordern Räder sich vollständig frei um
die Achse bewegen und an deren Umdrehungen nur dann sich
beteiligen, wenn sie mit dem Friktionsrad durch eine ähnliche
Einrückvorrichtung, wie sie zur Verkuppelung der
Schwungradwelle mit der Druckachse dient, verbunden werden.
An dem mit 28 scharfen Zähnen versehenen Korrektionsrad B
(Fig. 13, Tafel I) befindet sich der mit dem Typenrad durch eine
besondere Buchse verbundene Figurenwechsel. Letzterer besteht aus
dem zweiarmigen Hebel hh1, dessen Arm h innerhalb eines runden
Ausschnitts der Stahlscheibe w spielt. Je nachdem der eine oder der
andre Vorsprung dieser Scheibe eine Zahnlücke bedeckt, nimmt
der Hebel und damit das Typenrad eine um ein Feld der Zeichenfolge
verschobene Stellung ein. Da nun auf dem Umfang des Typenrades
Buchstaben und Ziffern, bez. Satzzeichen miteinander abwechseln,
erfolgt in dem einen Fall der Abdruck vom Buchstaben, im andern von
Ziffern und Satzzeichen. Das Umlegen des Wechselhebels bewirkt ein
Daumen der Druckachse c, welcher bei jeder Umdrehung in eine
Zahnlücke des Korrektionsrades trifft und dessen Stellung in
der Weise berichtigt, daß er durch den auf die abgerundeten
Zähne desselben ausgeübten Druck das Korrektionsrad und
mit ihm das Typenrad etwas vorschiebt, wenn es
zurückgeblieben, und zurückdrückt, wenn es
vorangeeilt war. Die Lücken unter den Vorsprüngen des
Wechselhebels entsprechen zwei freien Feldern des Typenrades,
welche zur Herstellung der Zwischenräume dienen. Im
Ruhezustand liegt der Korrektionsdaumen auf der an dem Ebonitwinkel
T1 (Fig. 12) befestigten isolierten Feder und stellt dadurch eine
leitende Verbindung zwischen dem Körper des Apparats und dem
Elektromagnet her.
Der Abdruck der Zeichen geht in der Weise vor sich, daß
das Papierband wider die in voller Drehung begriffene Typenscheibe
geschleudert wird und von den mit Druckerschwärze befeuchteten
Typen diejenige abdrückt, welche in dem betreffenden
Augenblick an der tiefsten Stelle des Rades sich befindet. Dieses
Emporschnellen des über die Druckrolle D2 (Fig. 12)
geführten Papierbandes bewirkt ein Daumen der Druckachse,
welcher gegen die obere Nase des um S drehbaren Druckhebels D1
trifft; gleichzeitig findet ein Fortrücken des Papierstreifens
um eine Typenbreite statt, indem durch einen andern Ansatz der
Druckachse der Hebel K1K2 und mit ihm der Arm K4
niedergedrückt wird, wobei dessen hakenförmiger Ansatz in
die Zähne eines mit der Druckrolle verbundenen Sperrrades
eingreift und hierdurch die Druckrolle dreht.
Der dreiarmige Einstellhebel U1U2U3 dient dazu, das
Korrektionsrad und das Typenrad außer Verbindung mit dem
Laufwerk zu bringen und in der Ruhelage festzuhalten. Ein auf den
Knopf o des horizontalen Hebelarms U1 ausgeübter Druck bringt
zunächst den als Träger von o dienenden Stift in
Berührung mit der darunter befindlichen, an dem
Ebonitstück e befestigten Blattfeder, welche über t2T2
unmittelbar mit der Leitung in Verbindung steht; erst wenn
hierdurch der Elektromagnet ausgeschaltet ist, folgt der Hebel dem
Druck nach unten und bewirkt durch einen Ansatz des Arms U2,
welcher die Blattfeder a mit ihrem Stahlansatz v in den Bereich
eines an der Sperrklinke des Korrektionsrades angebrachten Stiftes
bringt, die Aufhebung der Verbindung zwischen dem Korrektions- und
Typenrad und dem Laufwerk. Die Auslösung des Einstellhebels
und Einlösung der Verkuppelung mit dem Sperrrad erfolgt durch
Anschlagen eines Ansatzstiftes der Druckachse wider das
verlängerte Ende von U2.
Die Stromgebung beim Hughes-Apparat erfolgt mittels einer
Klaviatur von 28 Tasten, die in zwei Reihen übereinander
angeordnet sind (Fig. 10); die obere Reihe ist schwarz, die untere
weiß. Alle Tasten, mit Ausnahme der ersten und fünften
weißen, von links anfangend, sind mit je einem Buchstaben und
einem Ziffer-, bez. Satzzeichen versehen. Die weißen Tasten
dienen zur Herstellung der Zwischenräume; sie entsprechen den
Nasen des Wechselhebels und werden deshalb auch angeschlagen, wenn
von Buchstaben auf Ziffern oder umgekehrt übergegangen werden
soll. Die Tastenhebel T (Fig. 14 der Tafel II) haben ihren
Drehpunkt in Achsen, welche an der untern Fläche einer starken
Gußeisenplatte P1 befestigt sind; auf dieser Platte ruht
mittels des flantschartigen Ansatzes R die Stiftbüchse P,
welche an ihrem untern Rand J mit senkrechten Einschnitten versehen
ist. Beim Niederdrücken einer Taste hebt das durch einen
Einschnitt in die Stiftbüchse eingreifende freie Ende des
Tastenhebels T einen darüber ruhenden Kontaktstift S mit
seinem obern hakenförmigen Ende längs der schrägen
Fläche des konischen Ringes k aus der Stiftscheibe N und
bringt ihn in den Weg des um eine senkrechte, innerhalb der
Stahlhülse b gelagerte Achse w über der Stiftscheibe
kreisenden Schlittens, welchem durch konische Verzahnung mit der
Typenradachse gleiche Winkelbewegung mit dem Typenrad erteilt wird.
Beim Loslassen der Taste wird der Stift durch die Feder f in seine
Ruhelage zurückgezogen.
Auf die Schlittenachse w (Fig. 15 der Tafel II) ist eine
Stahlbuchse B mit vorspringenden Rändern aufgeschoben. An der
Achse unwandelbar befestigt, befindet sich das gabelförmig
ausgeschnittene Messingstück G, dessen mittlerer vorragender
Teil an seinem untern Ende ein geschweiftes Stahlstück R1, die
sogen. Streichschiene, trägt. Die beiden äußern
Arme dienen als Achslager für den beweglichen Teil g1,
dessennach außen liegendes Mittelstück den abwärts
gekehrten, abgeschrägten Stahlstreifen e, die Lippe,
enthält. Das andre Ende des beweglichen Teils bildet einen
Winkelhebel, welcher mit einem seitlich angebrachten Stahlstift a
auf dem weitern Rande der Buchse B ruht und diese bei aufsteigender
Bewegung der Lippe e abwärts drückt. An der linken Seite
der vordern Apparatwange unterhalb der Achse des Auslösehebels
ist der Messingwinkel P1 angeschraubt; er bildet das Lager für
den zweiarmigen Kontakthebel HH1. Rechts trägt dieser Hebel
einen seitlich angebrachten Stahlstift, welcher unter den obern
vorspringenden Rand der Hülse greift, so daß beim Auf-
und Niedergang derselben die an dem linken Hebelarm angebrachte
Blattfeder F1 abwechselnd die Kontaktschrauben c1 und c2
berührt, von denen jene mit der Batterie, diese mit der Erde
verbunden ist, während der Hebel selber über den
Körper des Apparats und die Elektromagnetrollen mit der
Leitung in Verbindung steht. Jedesmal, wenn der Schlitten einen
gehobenen Kontaktstift passiert, wird mithin durch das Niedergehen
der Buchse B und des Hebelarms H1 ein Strom in die Leitung gesandt,
der sowohl auf dem gebenden als auf dem empfangenden Amte die
Apparate zum Ansprechen bringt und den Abdruck des betreffenden
Buchstabens bewirkt. Die Umlaufgeschwindigkeit des Schlittens
beträgt 100-120 Umdrehungen in der Minute.
570
Telegraph (Multiplexapparate, Doppel- u. Gegensprechen; Land- u.
Seeleitungen).
Bei allen bis jetzt beschriebenen Telegraphenapparaten bleibt
zur Trennung der einzelnen Buchstaben oder Schriftzeichen die
Leitung eine Zeitlang unbenutzt. In der Multiplex- oder
Vielfachtelegraphie werden diese notwendigen Pausen ausgefüllt
mit der Schriftbildung auf einem zweiten, dritten etc. Apparat,
wobei die Leitung nacheinander mit sämtlichen Apparaten in
Verbindung tritt. Allen Vielfachapparaten gemeinsam ist die
Einrichtung einer kreisförmigen Verteilerscheibe aus
isolierendem Material, auf welcher je nach Anzahl der Apparate eine
größere oder geringere Menge metallischer Sektoren
befestigt sind, die mit den einzelnen Apparatsätzen in
Verbindung stehen. Über diesen Sektoren schleift eine
metallische Feder, an welcher die Leitung liegt; letztere nimmt bei
jeder Umdrehung einmal aus jedem Apparatsatz die entsprechend
vorbereiteten Telegraphierströme auf und führt sie auf
dem andern Amt über eine gleichlaufende Verteilereinrichtung
dem betreffenden Empfangsapparat zu.
Der vierfache T. von Meyer ist auf die Übermittelung von
Morsezeichen berechnet, die an vier Klaviaturen mit je acht Tasten
vorbereitet werden. Der Verteiler enthält 50 voneinander
isolierte Lamellen verschiedener Breite, von denen 32 mit den
Tasten der Klaviaturen verbunden sind, während die
übrigen teils mit der Erde in Verbindung stehen und die
nötigen Zwischenräume bewirken, teils für die
Herstellung des Synchronismus benutzt werden. Die Schriftbildung
erfolgt senkrecht zur Längsrichtung des Papierstreifens in
polarisierten Empfangsapparaten.
Während Meyer und Baudot bei ihrem sechsfachen
Typendruckapparat die Leitung jedesmal für eine Zeit an ein
Apparatpaar legen, welche zur Erzeugung eines telegraphischen
Zeichens ausreicht, läßt Delany die Wechsel so rasch
aufeinander folgen, daß die Nachwirkung in den
Elektromagneten sozusagen die stromlosen Pausen
überbrückt und jeder Apparat ohne Rücksicht auf die
andern arbeitet. Eine schwingende Stimmgabel vermittelt die
Stromsendung durch den Elektromagnet eines phonischen Rades, dessen
Achse eine über der Verteilerscheibe schleifende Kontaktfeder
trägt. Je nach der Anzahl der einzuschaltenden Apparate sind
die Kontaktplatten der Verteilerscheibe untereinander zu Gruppen
vereinigt, so daß jeder Apparat in der Sekunde gleich oft mit
der Leitung in Verbindung tritt. Erfolgt diese Verbindung
häufig genug, z. B. 30 mal in der Sekunde, so wirkt dies
bezüglich des Telegraphierens ebenso, als ob die Leitung
beständig am Apparat läge. Die Delanysche Einrichtung
kann teils mit Morse, teils mit Typendruckapparaten betrieben
werden und vermag angeblich bis zu 72 Telegrammen gleichzeitig zu
befördern.
Den gleichen Zweck einer bessern Ausnutzung der
Telegraphenleitungen hat man auch zu erreichen gesucht durch das
Doppelsprechen (gleichzeitige Beförderung zweier Telegramme
auf demselben Draht in gleicher Richtung) und das Gegensprechen
(gleichzeitige Beförderung in entgegengesetzter Richtung). Bis
jetzt hat sich nur das Gegensprechen bleibenden Eingang erringen
können. Die erste diesem Zweck entsprechende Schaltung wurde
1853 von Gintl vorgeschlagen; ihm folgten Frischen, Siemens u.
Halske, Edlund, Maron u. a. In neuerer Zeit sind einfache Methoden
von Gattino, Fuchs und Canter angegeben worden. Fuchs, dessen
Schaltung in Fig. 16 (Tafel I) schematisch dargestellt ist,
schaltet eine mit einem Hilfshebel a versehene Taste zwischen die
beiden Elektromagnetrollen mm des Schreibapparats, so daß der
abgehende Strom nur die eine, der ankommende aber beide Rollen
durchläuft: bei entsprechender Regulierrung bleibt daher der
Apparat des gebenden Amtes in Ruhe, während der
Empfangsapparat anspricht. Drücken beide Ämter
gleichzeitig Taste, so geben die mit entgegengesetzten Polen an
Leitung liegenden Batterien einen doppelt so starken Strom, der die
magnetisierende Wirkung der einen Rolle entsprechend verstärkt
und auf beiden Ämtern das Ansprechen der Apparate
herbeiführt, wobei jeder Apparat dem Batteriestrom des andern
Amtes gehorcht.
In der Schaltung von Canter (Fig. 17, Tafel I) sind die beiden
Elektromagnetrollen mm des Farbschreibers ebenfalls getrennt, und
die Taste, hier eine gewöhnliche, liegt zwischen ihnen;
außerdem ist zwischen Mittelschiene und Ruheschiene der Taste
ein Rheostat R angebracht, in welchen so viel Widerstand
eingeschaltet wird, daß beim Niederdrücken der Taste der
eigne Apparat nicht anspricht und die magnetisierende Kraft im
Empfangsapparat die gleiche bleibt, ob nur auf einer oder auf
beiden Seiten gearbeitet wird. Die Batterien liegen mit gleichen
Polen an der Leitung. In oberirdischen Leitungen bis zu 350 km
Länge sind mit diesen Schaltungen befriedigende Resultate
erzielt worden; auf größere Entfernungen und in
Kabelleitungen wird ihre Verwendung durch das Auftreten der
Ladungserscheinungen erschwert.
Als Elektrizitätsquellen werden in der Telegraphie
vorzugsweise galvanische Elemente (s. Galvanische Batterie)
benutzt; doch beginnt man neuerdings auch die Dynamomaschinen als
Stromerzeuger für telegraphische Zwecke nutzbar zu machen.
Zum Bau der oberirdischen Telegraphenlinien bedient man sich
imprägnierter Stangen von 7-10 m Länge und 12-15 cm
Zopfstärke, an welche Isolationsvorrichtungen von Porzellan
auf eisernen Stützen festgeschraubt werden. Die deutsche
Reichstelegraphenverwaltung verwendet die von Chauvin angegebene
Doppelglocke (Fig. 18, Tafel I) auf hakenförmiger
Schraubenstütze. Zur Herstellung der Leitungen wird in der
Regel verzinkter Eisendraht von 2,5-5 mm Durchmesser benutzt; in
neuerer Zeit kommt auch Bronze zur Verwendung. Die unterirdischen
Linien bestehen aus Kupferdrähten oder Kupferlitzen, die mit
Guttapercha isoliert sind; gewöhnlich werden 4 oder 7 solcher
Adern zu einem Kabel verseilt und mit einer Schutzhülle von
verzinkten Eisendrähten umgeben. Die in der
Reichstelegraphenverwaltung gebräuchlichen Querschnitte sind
aus Fig. 19 (Tafel I), zu ersehen. Für die Überschreitung
von Gewässern gibt man den Kabeln eine zweite Schutzhülle
von stärkern Drähten und schließt sie
außerdem in verzinkte gußeiserne Gelenkmuffen ein.
Unterirdische Leitungen sind weniger Beschädigungen
ausgesetzt, erfordern aber vorzügliche Isolation und
bedeutende Anlagekosten, während ihre Benutzbarkeit auf
längern Strecken durch die den Kabeln anhaftenden
Ladungserscheinungen eine gewisse Einschränkung erfährt.
Schon bei Entstehung der elektrischen Telegraphie angewendet, haben
dieselben erst seit 1876 eine größere Verbreitung
erlangt, nachdem die deutsche Reichstelegraphenverwaltung mit der
Anlage ihres ausgedehnten unterirdischen Liniennetzes bahnbrechend
vorangegangen war. 1886 besaß Deutschland 5648 km, Frankreich
1661 km, Großbritannien 1146 km und Rußland 289 km
unterirdische Linien.
Ungleich rascher und kräftiger haben sich die
unterseeischen Verbindungen entwickelt. Die großen Seekabel
sind ähnlich konstruiert wie die Landkabel, enthalten aber
wegen der unvermeidlichen Induktion nur Einen Leiter. 1851 wurde
das erste brauchbare
571
Telegraph (Haustelegraphie, pneumatischer T.;
Volkswirtschaftliches, Gesetzgebung).
Seekabel zwischen Dover und Calais ausgelegt, 1866 die erste
Kabelverbindung zwischen Europa u. Amerika hergestellt. 1886
dienten bereits 12 Kabel dem telegraphischen Verkehr beider
Weltteile: 8 davon gehen aus von Großbritannien und Irland, 2
von Frankreich nach Nordamerika; 2 Kabel endlich verbinden Portugal
mit Südamerika. 1887 betrug die Gesamtlänge der
bestehenden unterseeischen Kabel 113,565 Seemeilen, darunter
103,396 Seemeilen im Besitz von Privatgesellschaften und nur 10,169
unter staatlicher Verwaltung.
Besondere Gestaltung erfährt die Telegraphie für
bestimmte Zwecke, namentlich im Eisenbahnwesen, in der Feuerwehr
und im Haus. Die Benutzung im Haus beschränkt sich meist auf
die Anlage von Läutwerken (s. d.), welche mit Tableauanzeiger
verbunden werden, um dort, wo das Läutwerk ertönt, den
Aufgabeort des Signals zu erkennen. Diese Vorrichtungen gestalten
sich zu Diebssicherungen, wenn das Läutwerk bei unbefugter
Öffnung eines Fensters oder einer Thür in Thätigkeit
tritt. Man bringt hier Kontakte an, die am Tag bei offener
Thür, aufgezogenem Rollladen etc. geschlossen sind, dann aber
nicht auf das Läutwerk wirken, weil noch an einer andern
Stelle durch eine Einstellvorrichtung der Strom unterbrochen ist.
Werden nun abends Thüren und Fenster geschlossen (die Kontakte
geöffnet), so schließt man bei der Einstellvorrichtung
den Strom, und das Läutwerk schlägt an, sobald nun eine
Thür oder ein Fenster geöffnet wird; das Tableau zeigt
den Angriffspunkt. Derartige Vorrichtungen können auch zu
andern Zwecken benutzt werden: sie melden an einer entfernten
Stelle, wenn im Dampfkessel der Wasserstand zu niedrig steht, wenn
im Gewächshaus oder in der Trockenkammer eine bestimmte
Temperatur erreicht ist etc. Für manche dieser Zwecke wird die
elektrische durch pneumatische Telegraphie ersetzt. Diese benutzt
dünne, starkwandige Bleiröhren, welche von einem Ort zum
andern eine vollkommen luftdichte Leitung herstellen. Am Aufgabeort
ist in diese ein hohler Gummiball eingeschaltet, der beim
Zusammendrücken die in ihm enthaltene Luft durch das Bleirohr
in eine aus ebenen Wänden gebildete Gummikapsel am andern Ende
der Leitung treibt und dieselbe aufbläst. Diese
Volumveränderung der Kapsel kann leicht benutzt werden, um ein
sichtbares oder, wie bei der pneumatischen Klingel, ein
hörbares Zeichen zu geben. Vorteilhafte Anwendung findet die
pneumatische Verbindung zur Verbindung von Uhren mit einer
Normaluhr (vgl. Uhr).
Volkswirtschaftliches. Gesetzgebung und Verwaltung.
Für die finanzielle Behandlung des Telegraphen kommt
wesentlich in Betracht, daß der T. nur von einzelnen Klassen,
nicht, wie Post und Eisenbahn, von der Gesamtheit aller benutzt
wird. Zur Zeit haben an dem Telegrammverkehr etwa teil: die
Regierungs- und Staatstelegramme mit 12 Proz., die
Handelstelegramme mit 52, die Börsentelegramme mit 13, die
Zeitungstelegramme mit 8 und die Familientelegramme mit 15 Proz. In
Europa entfällt gegenwärtig nur auf 3 Einw. ein
jährlich abgesandtes Telegramm; mindestens drei Viertel der
Bevölkerung stehen dem Telegrammverkehr ganz fern, und es ist
daher zu fordern, daß die Kosten der Telegraphie durch den
Tarif vollständig gedeckt und Zuschüsse aus Staatsmitteln
ausgeschlossen sind.
Die Telegraphie wurde von vornherein durch die meisten Staaten
in öffentliche Verwaltungen genommen; außer Nordamerika
befinden sich nur noch in wenigen andern überseeischen
Ländern die dem öffentlichen Verkehr dienenden
Telegraphen in Privathänden. Großbritannien, der einzige
europäische Staat, wo der Telegraphenbetrieb in
Privathänden länger das Feld behauptete, sah sich 1868
veranlaßt, ungeachtet der Abneigung gegen jede Art
staatlicher Einmischung, welcher in dem englischen Volkscharakter
liegt, die Telegraphen in Staatsverwaltung zu übernehmen. Die
Entschädigung, welche England damals für die noch dazu
unzulänglichen Anlagen der vormaligen Privatgesellschaften
zahlen mußte, betrug erheblich mehr als der Aufwand, welchen
das ganze übrige Europa bis dahin für den Telegraphenbau
verwendet hatte. Die großen überseeischen
Kabelverbindungen sind mit wenigen Ausnahmen im Betrieb von
Privatgesellschaften. Hier begünstigt den Privatbetrieb der
Umstand, daß ein einzelner Staat völkerrechtlich nicht
befugt ist, Telegraphenverbindungen zwischen zwei durch das Meer
getrennten Ländern für sich allein zu monopolisieren,
ferner, daß das mit den Kabelverbindungen verknüpfte
ungewöhnlich hohe Risiko die Bedeutung des spekulativen
Moments erhöht und die Privatthätigkeit besser an die
Stelle der Thätigkeit der öffentlichen Gewalten treten
läßt.
Die Gesetzgebung hat die Regalität der Telegraphen in
Frankreich, Österreich, Großbritannien, Italien, der
Schweiz, Niederlande, Portugal, Serbien, Rumänien,
Griechenland, Britisch- und Niederländisch-Indien
festgestellt, wobei Eingriffe in das staatliche Alleinbetriebsrecht
meist mit Strafe gegen diejenigen, welche einen Telegraphen ohne
Konzession anlegen, bedroht sind. In Deutschland gründet sich
das Telegraphenregal auf Art. 48 der Reichsverfassung, wonach das
Telegraphenwesen für das gesamte Gebiet des Deutschen Reichs
als einheitliche Staatsverkehrsanstalt einzurichten ist. Eine
kodifizierte Gesetzgebung wie die der Post besteht für die
deutsche Telegraphie nicht; vielmehr ist die Regelung des
Verhältnisses zum Publikum verfassungsmäßig der
reglementären Anordnung vorbehalten. Diese Anordnungen sind
durch die Telegraphenordnung vom 13. Aug. 1880 erlassen.
Die Fernsprechanlagen werden in Deutschland ebenfalls als unter
das Telegraphenregal fallend betrachtet, und es werden nach §
28 der Telegraphenordnung die Bedingungen für derartige
Anlagen vom Reichspostamt festgesetzt. Die Berechtigung von
Behörden und Privatpersonen zum Betrieb von Telegraphen ist
neuerdings in Deutschland im Verordnungsweg dahin festgestellt
worden, daß ohne Kontrolle der Telegraphenverwaltung
zugelassen werden können: a) den Landesbehörden die
Anlage von Telegraphen zu Zwecken, welche nicht unter das Ressort
der Telegraphenverwaltung fallen, solange die Anlagen nicht als
Verkehrsanstalten gebraucht werden; b) Privatpersonen die Anlage
von Telegraphen innerhalb der eignen Gebäude und
Grundstücke, vorausgesetzt, daß der Besitzer innerhalb
seiner Grenzen bleibt und mit der Anlage fremde Grundstücke
sowie öffentliche Wege und Straßen nicht
überschreitet.
Das Telegraphenfreiheitswesen (Gebührenbefreiung für
Reichsdiensttelegramme etc.) ist durch kaiserliche Verordnung vom
2. Juni 1877 geregelt. Durch Gesetz sind in Bezug auf das
Telegraphenwesen nur hinsichtlich der Sicherung der
öffentlichen Telegraphenanlagen Bestimmungen in den § 317
bis 320 des Reichsstrafgesetzbuchs getroffen, wonach die
vorsätzliche Beschädigung der Telegraphenanstalten mit
Gefängnis von 1 Monat bis 3 Jahren und die fahrlässige
Störung des Betriebes mit Ge-
572
Telegraph (Verwaltung und Betrieb).
fängnis bis zu 1 Jahr oder mit Geldbuße bis 900 Mk.
bedroht ist.
Die Haftpflicht der Telegraphenverwaltung für die
Beförderung von Telegrammen richtet sich nach den
internationalen Verträgen und nach der Gesetzgebung der
einzelnen Staaten. In Art. 2 und 3 des internationalen
Telegraphenvertrags von St. Petersburg vom 10. (22.) Juni 1875
haben die Telegraphenverwaltungen erklärt, in Bezug auf den
internationalen Telegraphendienst keine Verantwortung zu
übernehmen. In gleicher Weise haben auch die einzelnen Staaten
die Garantie für Telegramme teils durch Gesetz, wie in
Frankreich, Niederlande, Belgien und der Schweiz, teils durch
Verordnung abgelehnt. Die deutsche Telegraphenordnung vom 13. Aug.
1880 bestimmt in § 24 über die Gewährleistung,
daß die Telegraphenverwaltung für die richtige
Überkunft der Telegramme oder deren Zustellung innerhalb
bestimmter Frist nicht garantiert und Nachteile, welche durch
Verlust, Verstümmelung oder Verspätung der Telegramme
entstehen, nicht vertritt. Die entrichtete Gebühr wird jedoch
erstattet: a) für Telegramme, welche durch Schuld des
Telegraphenbetriebs gar nicht oder mit bedeutender Verzögerung
in die Hände des Empfängers gelangt sind, b) für
verglichene Telegramme, welche infolge Verstummelung nachweislich
ihren Zweck nicht haben erfüllen können. Die
zivilrechtliche Haftbarkeit, welche den Telegraphenbeamten nach den
allgemein rechtlichen Grundsätzen für dolus und culpa
obliegt, wird durch die vorstehenden Bestimmungen nicht
berührt. Die Verwaltung und der Betrieb der Telegraphie ist
gegenwärtig in allen größern Staaten, in
Deutschland seit 1876, mit der Postverwaltung vereinigt (s. Post,
S. 275), und besonders in Deutschland wurden erhebliche Erfolge
durch diese Vereinigung erzielt. Nicht nur wurde der
Geschäftsbetrieb der Telegraphenanstalten durchgehend
reorganisiert, sondern es trat auch eine durchgreifende
Vervollkommnung der technischen Telegraphenbetriebseinrichtungen
ein, für deren Ausbildung bei der Finanznot der frühern
selbständigen Telegraphenverwaltungen nicht immer die
erforderlichen Mittel zu Gebote gestanden hatten. In dieser
Beziehung ist namentlich hervorzuheben: die Anlage unterirdischer
Telegraphenlinien; die frühzeitige Einführung des
Fernsprechwesens; die Steigerung des Schnellverkehrs innerhalb der
Reichshauptstadt durch Anlage einer Rohrposteinrichtung, seiner
Zeit der ersten Anlage dieser Art, welche zugleich den
telegrafischen und den brieflichen Verkehr vermittelt; endlich die
Förderung der Anlage neuer internationaler
Telegraphenverbindungen und die Vermehrung der unterseeischen
Kabelverbindungen etc. Weiteres über die
Telegraphengebühren, die internationalen Abkürzungen im
Telegraphenverkehr etc. s. Telegramm. Die gegenwärtige
Entwickelung des Telegraphenwesens in Europa zeigt die nachfolgende
Tabelle:
Übersicht des Telegraphenverkehrs der Länder Europas
im Jahr 1887.
Länder | Staatstelegraphen | Eisenbahn- und
Privattelegraphen | Staatstelegraphenanstalten | Eisenbahn- und
Privattelegraphenanstalten | Eine Telegraphenanstalt entfällt
auf | Beförderte Telegramme (in- und ausländische) | Auf
100 Einw. entfallen aufgelief. Telegramme
| Linien Kilom. _ Leitungen Kilom. | Linien Kilom. _ Leitungen
Kilom. | | |QKilo- _ Einwohner | |
Belgien ........ 6596 2649 4206 89197 31854 3902 11226 317143
2006 24328 1153 5132 70224 822 65 165 11071 109 267 3919 31,6 91,7
36,0 6418 4585 3126 4631470 525071 1346315 21750348 54,8 22,5 37,3
38,0
Bulgarien (1885) ....
Dänemark .......
Deutschland ......
Frankreich (1887/88) . . . 101654 324919 16390 115984 5945 3430
56,4 4151 37435585 80,3
Griechenland (1886) .... 5520 6618 1378 1378 166 7 367,7 12068
845707 34,5
Großbritannien und Irland. 48659 260679 ...- 27149 5208
1602 46,5 5447 55 182 775 140,2
Italien ........ 30932 401 338 86757 718 338 2334 81 26787 690
2192 30 15 1637 ^ 77,4 35,4 628.9 7561 2922 19067 8796264 85843
26,7 27,0
Luxemburg. ......
Montenegro (1885) ....
Niederlande ...... 4903 7494 25706 2790 17234 13987 69510 5568
2797 1583 14142 483 7589 2531 35241 585 358 149 1635 79 299 179
1724 25 50.2 970,1 89,3 491,3 6775 6049 6593 12847 3734065 968833 7
195 146 314234 58,2 37,8 22,9 14,9
Norwegen .......
Österreich (1886) .....
Bosnien, Herzegowina (1886)
Portugal ....... 5137 11948 ^ - 274 1 335,4 16548 919560
14,2
Rumänien (1886) .... 5245 9880 2402 5518 122 195 521,0
15899 1225857 26,4
Rußland (1886) ..... 107571 8345 7060 2843 17853 204033
21304 17102 4035 43446 30645 3844 991 431 8252 62891 12484 5723 86l
20629 1694 179 1115 68 542 1836 765 178 46 340 6293,5 458,7 32,0
427,0 574,9 28765 5016 2190 16936 18970 10290791 1242374 3331155
485398 2481420 9,^ 17,0 85,3 22,5 14,8
Schweden .......
Schweiz ........
Serbien (1886) .....
Spanien (1886) .....
Türkei, europäische (1882) . 23388 41688 ..^... ......
443 21 565,5 14294 1133286 17,^
Ungarn ........ 17633 45381 1479 23794 702 930 197,5 9644
6196830 17,5
[Litteratur.] Rother, Der Telegraphenbau (4. Aufl., Berl. 1876);
Ludewig, Der Bau von Telegraphenlinien (2. Aufl., Leipz. 1870);
Derselbe, Der Reichstelegraphist (4. Aufl., Dresd. 1877); Zetzsche
(Galle), Katechismus der elektrischen Telegraphie (6. Aufl., das.
1883); Derselbe, Handbuch der elektrischen Telegraphie (Berl.
1877-87, Bd. 1-4); Derselbe, Die Kopiertelegraphen,
Typendrucktelegraphen und Doppeltelegraphie (Leipz. 1865);
Derselbe, Die Entwickelung der automatischen Telegraphie (Berl.
1875); Weidenbach, Kompendium der elektrischen Telegraphie (2.
Ausg., Wiesb. 1881); Grawinkel, Die Telegraphentechnik (Berl.
1876); Merling, Die Telegraphentechnik (Hannov. 1879); Canter, Der
technische Telegraphendienst (3. Aufl., Bresl. 1886); Schellen, Der
elektromagnetische T. (6. Aufl. von Kareis, Braunschw. 1882-88);
Derselbe, Das atlantische Kabel (das. 1867); Calgary u. Teufelhart,
Der elektromagnetische T. (Wien 1886); "Beschreibung der in der
Reichstelegraphenverwaltung gebräuchlichen Apparate" (Berl.
1888); Wünschendorff, Traité de
télégraphie sous-marine (Par. 1888; Sack,
Verkehrstelegraphie (Wien 1883; v. Weber, Das Telegraphen- und
Signalwesen der
573
Telegraphenanstalten - Telegraphenschulen.
Eisenbahnen (Weim. 1867); Schmitt, Das Signalwesen der
Eisenbahnen (Prag 1878); Kohlfürst, Die elektrischen
Einrichtungen der Eisenbahnen und das Signalwesen (Wien 1883);
Zetzsche, Geschichte der elektrischen Telegraphie (Bd. 1 des
erwähnten Handbuchs Berl. 1876); Derselbe, Kurzer Abriß
der Geschichte der elektrischen Telegraphie (das. 1874);
Telegraphenbauordnung (Wien 1876); Dambach, Das
Telegraphenstrafrecht (das. 1871); Ludewig, Die Telegraphie in
staats- und privatrechtlicher Beziehung (Leipz.1872); Meili, Das
Telegraphenrecht (2. Aufl., Zürich 1873); Fischer, Die
Telegraphie und das Völkerrecht (Leipz. 1876); Schöttle,
Der T. in administrativer und finanzieller Beziehung (Stuttg.
1883); Über die Militärtelegraphie s. d., über
Haustelegraphie s. Läutewerke, elektrische.
Telegraphenanstalten, die für die Wahrnehmung des
öffentlichen Telegraphendienstes bestimmten Betriebsstellen,
sind jetzt meist mit den Postanstalten (s. d.) vereinigt und, wie
die Postämter, der Oberpostdirektion des Bezirks
untergeordnet.
Telegraphenbeamte. Für den Eintritt in den Beamtendienst
der Telegraphie sind im allgemeinen dieselben Bedingungen wie
für den Postdienst zu erfüllen (s. Postbeamte); in
Deutschland ist jedoch der Eintritt in die ausschließlich
für den technischen Telegraphendienst bestimmten
Beamtenstellen in weiterm Umfang als bei der Post den
versorgungsberechtigten Militärpersonen vorbehalten.
Telegraphenkongresse, internationale Vereinigungen von
Vertretern der Telegraphenverwaltungen im Interesse der
Fortentwickelung der internationalen Telegrapheneinrichtungen. Dem
durch den Deutsch-österreichischen Telegraphenverein,
begründet 25. Juli 1850, gegebenen Beispiel folgten bald die
romanischen Staaten, von denen 1852 Frankreich, Belgien, die
Schweiz und Sardinien einen besondern Verein bildeten, und nachdem
die beiden Vereinsgruppen durch Konferenzen zu Brüssel und
Friedrichshafen 1858 eine gegenseitige Annäherung erstrebt
hatten, traten sie 1865 in Paris zu einem ersten internationalen
Telegraphenkongreß zusammen, durch welchen der internationale
Telegraphenverkehr in einem für ganz Europa gültigen
Vertrag seine Regelung erhielt. Als Einheit des Tarifs nahm er das
Telegramm von 20 Worten (Zwanzigworttarif) an. Die Gebühren
von einem Land zu dem andern wurden im allgemeinen gleich gemacht,
und nur bei Ländern von ausgedehntem Flächenraum wurden
mehrere Tarifzonen gebildet. Der zweite internationale
Telegraphenkongreß zu Wien 1868 vereinigte die asiatischen
Verwaltungen mit der europäischen Vereinsgruppe. Er schuf das
internationale Büreau in Bern als Zentralorgan, welches die
auf die internationale Telegraphie bezüglichen Nachrichten zu
sammeln, die Arbeit der periodischen Konferenzen vorzubereiten hat
und durch Herausgabe des "Journal télégraphique" auch
die Wissenschaft fördert. Auf dem dritten Kongreß zu Rom
1872 kam man überein, die großen
Privatkabelgesellschaften zu den Kongressen zuzulassen, ohne ihnen
jedoch Stimmrecht einzuräumen. Der vierte Kongreß, 1875
zu St. Petersburg, teilte das internationale Vertragsinstrument in
zwei Urkunden, von welchen die erstere, welche sich mit
unveränderlichen Rechtsverhältnissen der Verwaltungen
untereinander und dem Publikum gegenüber befaßt, von den
diplomatischen Vertretern der Staatsregierungen unterzeichnet
wurde, während der Abschluß der zweiten, welche die
reglementären Bestimmungen betraf, nur von den technischen
Delegierten erfolgte. Der St. Petersburger Vertrag ist noch heute
in Gültigkeit; die folgenden Kongresse haben sich nur mit
Abänderung der Ausführungsbestimmungen (Reglement) zu
diesem Vertrag befaßt. Auf dem fünften Kongreß,
London 1879, vereinbarte man das in Deutschland von Stephan ins
Leben gerufene Worttarifsystem, und auf dem sechsten Kongreß,
Berlin 1885, wurde von Stephan der Antrag auf Schaffung eines
Einheitstarifs, wenigstens für den europäischen Verkehr,
eingebracht. Dieser Antrag fand zwar nicht allgemeine Annahme, doch
beschloß der Kongreß weitere Vereinfachungen des
Tarifs, um die spätere Einführung eines Einheitstarifs
vorzubereiten. Nach den Bestimmungen des Berliner Vertrags bildet
sich der internationale Tarif aus einer Gebühr für das
Wort, welche der Staat des Aufgabegebiets und der Staat des
Bestimmungsgegebiets (Terminaltaxen) und die etwa zwischen dem
Aufgabe- und Bestimmungsgebiet liegenden Staaten (Transittaxen)
jeder für sich erhebt. Die Terminaltaxen und die Transittaxen
sind für jeden Staat einheitlich festgestellt. Die
Terminaltaxe wurde einheitlich auf 10 Cent., die Transittaxe auf 8
Cent. für jedes Wort mit der Ermäßigung auf
6¡½ u. 4 Cent. für kleinere Staaten festgesetzt.
Dem internationalen Telegraphenverein gehören zur Zeit an:
Australien (Neuseeland, Neusüdwales, Südaustralien,
Tasmania, Victoria), Belgien, Bosnien-Herzegowina, Brasilien,
Britisch-Indien, Bulgarien, Kap der Guten Hoffnung, Dänemark,
Deutschland, Ägypten, Frankreich (zugleich für Algerien,
Tunis, Kotschinchina u. Senegal), Griechenland,
Großbritannien nebst Gibraltar und Malta, Italien, Japan,
Luxemburg, Montenegro, Natal, Niederlande (zugleich für
Niederländisch-Indien), Norwegen, Österreich-Ungarn,
Persien, Portugal, Rumänien, Rußland, Schweden, Schweiz,
Serbien, Siam, Spanien und Türkei. Außerdem alle
größern Kabelgesellschaften. Im Oktober 1882 trat in
Paris eine Konferenz zusammen, deren Arbeiten zum Abschluß
einer Konvention vom 14. März 1884 über den Schutz der
unterseeischen Kabel führte, welcher 28 Staaten beigetreten
sind.
Telegraphenschulen, Anstalten zur
wissenschaftlich-technischen Ausbildung von Telegraphenbeamten. Die
Telegraphenschule in Berlin ist aus einer 1859 von der
preußischen Telegraphenverwaltung errichteten Fachschule
hervorgegangen, welche den Zweck hatte, sämtliche Beamte der
Telegraphie, nachdem sie bei einem Telegraphenamt die notwendigen
Vorkenntnisse und Fertigkeiten sich angeeignet hatten, für den
Dienst theoretisch und praktisch auszubilden. Infolge der auf dem
wissenschaftlichen Gebiet der Telegraphie errungenen Fortschritte
übertrug die Telegraphenverwaltung die für den lokalen
Telegraphenbetriebsdienst erforderliche theoretische und praktische
Ausbildung der Beamten den Oberpostdirektionen und ließ zum
Besuch der Telegraphenschule nur eine beschränkte Anzahl
solcher Beamten zu, welche eine genügende wissenschaftliche
Vorbildung besitzen und nach ihrem dienstlichen Verhalten zu der
Erwartung berechtigen, daß sie den auf einen höhern
Bildungsgrad berechneten Vorträgen mit Nutzen folgen und sich
später nach Ablegung der höhern
Telegraphenverwaltungsprüfung für die höhern Stellen
der Verwaltung eignen. 1879 wurde die Telegraphenschule in Berlin
zu dem Rang einer technischen Hochschule erhoben. Der Kursus ist
sechsmonatlich und währt vom 1. Okt. bis 1. April.
Jährlich werden zum Besuch der Schule etwa 40 Beamte
einberufen. Eine ähnliche Anstalt besteht in Paris.
574
Telegraphentruppen - Telemeter.
Telegraphentruppen dienen zum Bau wie zur Zerstörung
von Telegraphenanlagen im Krieg. Deutschland und Frankreich
besitzen im Frieden keine T., s. Militärtelegraphie. England
hat im Frieden 1 Telegraphenbataillon in 2 Divisionen, von denen
die eine stets kriegsbereit vollzählig und ausgerüstet,
die andre von der Staatstelegraphenverwaltung beschäftigt ist.
Italien hat 3 Telegraphenabteilungen von je 2 Kompanien zum 3.
Genieregiment gehörig; Österreich besitzt 1 Eisenbahn-
und Telegraphenregiment von 2 Bataillonen zu 4 Kompanien;
Rußland besitzt 17 Kriegs- (Feld-) Telegraphenparke, welche
den Sappeurbrigaden unterstellt sind. Belgien, die Niederlande,
Rumänien, Schweden, Spanien etc. haben im Frieden 1
Telegraphenkompanie.
Telegraphisches Sehen. Bald nach der Erfindung des Telephons
haben viele Physiker versucht, dem Auge auf elektrischem Weg
entfernte Bilder sichtbar zu machen. Die Eigenschaft des Sehens,
unter wechselnder Beleuchtung seinen Widerstand zu verändern,
schien zur Lösung dieser weitern Aufgabe ein geeignetes Mittel
an die Hand zugeben. Das Telektroskop von Senlecq d'Ardres (1877)
und der Telephotograph von Shelford Bidwell (1881) sind Apparate,
welche diesem Gedankengang ihre Entstehung verdanken, aber nicht
leisten, was ihr Name verspricht (s. Telephotographie). Nipkow in
Schöneberg machte einen Vorschlag zu einem elektrischen
Teleskop, welcher auf der Beobachtung beruht, daß Ruß
in intermittierender Bestrahlung tönt. Unter Zuhilfenahme
eines Mikrophons sollen die Schwingungen von berußter
Drahtgaze in elektrische umgewandelt und auf der Empfangsstelle
durch ein Telephon geleitet werden, dessen polierte Membran einen
auffallenden Lichtstrahl in entsprechende Schwingungen versetzt und
dadurch im Auge des Beobachters den Eindruck des übermittelten
Bildes erzeugt. Den Synchronismus der Apparate will Nipkow durch
Anwendung des phonischen Rades erzielen.
Teleki, 1) Joseph, Graf, ungar. Staatsmann und
Historiker, aus der protestantischen siebenbürgischen Familie
T. von Szék, geb. 24. Okt. 1790 zu Pest, studierte in
Göttingen, trat, nachdem er den Westen Europas bereist hatte,
als Sekretär der ungarischen Statthaltern 1818 in den
Staatsdienst und war zuletzt (1842-48) Gouverneur von
Siebenbürgen. Er erwarb sich große Verdienste um die
Gründung und Organisierung der ungarischen Akademie der
Wissenschaften, deren Präsident er viele Jahre hindurch war.
Außer mehreren kleinen Abhandlungen schrieb er als sein
Hauptwerk: "A Hunyadiak kora Magyarországban" ("Das
Zeitalter der Hunyades in Ungarn"), ein nach Quellen bearbeitetes
Werk, von dem 1852-55 fünf Bände wie von der dazu
gehörenden Urkundensammlung drei Bände erschienen sind.
T. starb 16. Febr. 1855.
2) Wladislaw, Graf, ungar. Patriot, geb. 11. Febr. 1811 zu Pest,
studierte die Rechte und Staatswifsenschaften, ward 1839 Mitglied
des siebenbürgischen Landtags, trat 1843 als Magnat in die
Magnatentafel des ungarischen Reichstags und stellte sich mit an
die Spitze der Opposition. Im September 1848 ward er vom
ungarischen Ministerium nach Paris gesandt, um dort die ungarischen
Interessen zu vertreten, und, da er nach der Niederwerfung der
ungarischen Insurrektion im Namen Ungarns gegen die Maßregeln
Österreichs protestierte, in contumaciam verurteilt und in
effigie gehenkt, Er lebte seitdem abwechselnd in Paris und Genf und
wirkte nach Ausbruch des italienischen Kriegs 1859 zu Turin im
Interesse der ungarischen Nationalpartei. Im Dezember 1860 ward er
zu Dresden verhaftet und nach Wien ausgeliefert, dort aber
begnadigt. Im April 1861 in den ungarischen Reichstag gewählt,
hielt er sich zur Linken, geriet aber bei seiner politischen
Richtung mit dem bei seiner Begnadigung gegebenen Versprechen in
Konflikt und erschoß sich in Verzweiflung darüber 8. Mai
1861 in Pest. T. hinterließ auch eine Tragödie: "A
kegyencz" ("Der Günstling").
Telelog (griech., "Fernsprecher"), ein von Ackermann
für die Mitteilung beobachteter Treffergebnisse beim
Schießen der Artillerie erfundener elektrischer Telegraph,
besteht aus einer Drahtleitung, einer Batterie Meidingerscher
Elemente und einem Apparat zur Zeichengebung durch einfache und
dreifache Glockenschläge, die als Elementarzeichen zu einem
Alphabet gruppiert sind. Vgl. Ackermann, Der T. (Rastatt 1877).
Telemachos, im griech. Mythus Sohn des Odysseus und der
Penelope, war bei der Abreise des Vaters zum Trojanischen Krieg
noch ein Kind. Herangewachsen, erhielt er von Athene den Rat, bei
Nestor in Pylos und Menelaos in Sparta Erkundigungen über den
Vater einzuziehen; am letztern Ort erfuhr er, daß derselbe
noch lebe. Nach Hause zurückgekehrt, traf er bei dem Sauhirten
Eumäos seinen von Athene in einen Bettler verwandelten Vater.
Dieser entdeckte sich ihm, und T. stand hierauf dem Vater bei der
Tötung der Freier bei. Seine spätere Geschichte wird
verschieden erzählt (vgl. Telegonos). Die Schicksale des T.
behandelt der berühmte Roman von Fénelon: "Les
aventures de Télémaque".
Telemann, Georg Philipp, Komponist, geb. 14. März
1681 zu Magdeburg, bezog zum Studium der Rechte 1700 die
Universität Leipzig, widmete sich aber hier der Musik mit
solchem Erfolg, daß er schon vier Jahre später die
Organistenstelle an der Neuen Kirche und die Leitung des
studentischen Gesangvereins Collegium musicum übernehmen
konnte. In der Folge wirkte er als Kapellmeister erst in Sorau (an
der Kapelle des Grafen Promnitz), dann in Eisenach, endlich von
1712 an in Frankfurt a. M. Von hier wurde er 1721 als
städtischer Musikdirektor nach Hamburg berufen, wo er 25. Juli
1767 starb. T. stand als ebenso fleißiger wie gewandter
Komponist und als Mann von reicher wissenschaftlicher Bildung bei
seinen Zeitgenossen in höchstem Ansehen. Als er die ihm 1722
angetragene Stellung eines Thomaskantors in Leipzig ausschlug, war
der dortige Rat sehr enttäuscht, auch dann noch, als J. S.
Bach für dies Amt gewonnen war. Die Hoffnungen, welche Hamburg
auf ihn gesetzt, konnte er nur teilweise erfüllen, sofern man
erwartet hatte, er werde die am Anfang des Jahrhunderts
blühende nationale Oper von ihrem inzwischen eingetretenen
Niedergang wieder emporheben, was ihm nicht gelingen sollte. Von
seinen fast unzählbaren Werken (darunter 44 Passionsmusiken
und an 40 Opern) hat nicht ein einziges ihren Schöpfer zu
überleben vermocht.
Telemarken, Landschaft, s. Thelemarken.
Telemeteorograph (griech.), s. Meteorograph.
Telemeter (griech., "Fernmesser"), eine von C. L. Clarke
in New York erfundene Vorrichtung, um die Ablenkungen eines
Manometers, Wasserstandszeigers etc. telegraphisch auf einen
entfernten Zeigerapparat zu übertragen. Der Geber ist mit dem
Empfänger durch drei Leitungen verbunden; ersterer
enthält den Zeiger des Meßinstruments, der sich zwischen
zwei mit ihm um dieselbe Achse mittels eines Sperrrades
verschiebbaren Kontaktfedern bewegt und, je
575
Telemssen - Telesio.
nachdem er sich links oder rechts anlegt, in der einen oder
andern von zwei Leitungen den Stromweg der am Empfangsort
aufgestellten Batterie schließt. In jedem dieser Stromwege
liegen auf der gebenden Seite zwei Elektromagnete, auf der
Empfangsstelle ein dritter, welche beim Stromschluß
nacheinander in Wirksamkeit treten. Der erste stellt einen Nebenweg
zu dem unsichern Zeigerkontakt her und erhöht dadurch die
Sicherheit des Ansprechens; der andre schiebt das Sperrrad des
Gebers um einen Zahn vorwärts, wodurch die Kontaktfedern dem
Zeiger nachgedreht werden, bis dieser wieder frei zwischen beiden
spielt; der Elektromagnet auf der Empfangsstelle endlich bewirkt,
ebenfalls durch Einwirkung aus ein Sperrrad, daß der Zeiger
des Empfangsapparats eine gleiche Ablenkung erfährt. Infolge
der Bewegung beider Sperrräder wird ein neuer Stromweg durch
die dritte Leitung und den dritten Elektromagnet des
Empfangsapparats geschlossen, dessen Anker beim Anziehen
demnächst die Batterieverbindung unterbricht und alle
Elektromagnete in die Ruhelage zurückführt, so daß
bei einem neuen Kontakt des Zeigers nach der einen oder andern
Seite das Spiel sich wiederholen kann. Die Telemeterapparate
verlangen eine sorgfältige Einstellung, sind aber dann gegen
zufällige Erschütterungen unempfindlich. Vgl.
Distanzmesser.
Telemssen, Stadt, s. Tlemsen.
Teleologie (v. griech. telos, Ziel, Zweck), "Lehre von
den Zwecken", diejenige Vorstellungsart der Dinge, d. h. der Natur
und der sozialen Welt, der zufolge die einzelnen Erscheinungen,
Existenzen und Vorgänge auf die in ihnen enthaltenen oder doch
vorausgesetzten zweckmäßigen Beziehungen hin betrachtet
werden. Dieselbe wird neuerlich in dem Maß, als die exakten
Wissenschaften emporkamen, für unfruchtbar, ja dem Fortschritt
des Wissens hinderlich angesehen. Spinoza (s. d.) bezeichnete die
Zwecke, die man in der Natur angetroffen haben wollte, als
menschliche Hineindichtungen; Bacon (s. d. 3) nannte die
Zweckbetrachtung im Gegensatz zu der Erforschung der wirkenden
Ursachen eine gottgeweihte Jungfrau, die nichts gebären
könne. Noch Kant richtete einen Abschnitt seiner "Kritik der
Urteilskraft" gegen die Gültigkeit der Zweckvorstellungen.
Neuerdings hat man in Anknüpfung an Aristoteles, in dessen
Philosophie die den Naturdingen innewohnenden Zwecke eine
große Rolle spielen, die Wiederherstellung einer Art von T.
insofern versucht, als in gewissen Naturerscheinungen, wie im
Instinkt (s. d.) und Trieb (s. d.), Zwecke, die von keinem
Bewußtsein begleitet und also nicht als eigentliche Absichten
gedacht werden (immanente Zwecke), anzutreten sein sollen. In der
sogen. natürlichen Religion hat die T. sowohl bei den
englischen Deiften als in der deutschen Aufklärungsphilosophie
des Reimarus (s. d.) eine Rolle gespielt; aus der Naturwissenschaft
ist sie seit Darwin (s. d.), der an die Stelle des Kanons: Es ist
zweckmäßig, darum ist es, den umgekehrten setzte: Es
ist, darum ist es zweckmäßig, so gut wie
verschwunden.
Teleorman, Kreis in der Großen Walachei, an der
Donau, benannt nach dem Fluß T.; Hauptstadt
Turnu-Magurele.
Teleosaurier, krokodilähnliche Reptilien der
Juraperiode.
Teleostei (Knochenfische), Ordnung der Fische (s.d., S.
298).
Telepathie (griech., "Fernfühlung,
Fernegefühl"), neuerdings in Aufnahme gekommene Bezeichnung
für das angebliche Vermögen einzelner Personen,
räumlich oder zeitlich entfernte Vorgänge zu empfinden.
Vgl. Gedankenlesen und Zweites Gesicht.
Telephon (griech.), s. Fernsprecher.
Telephorus, s. Schneewürmer.
Telephos, im griech. Mythus ein Arkadier, Sohn des
Herakles und der Auge, einer Priesterin der Athene, ward von seiner
Mutter ausgesetzt, aber von einer Hirschkuh gesäugt und von
dem König Korythos erzogen. Beim König Teuthras von
Mysien fand er später die Mutter und ward Schwiegersohn und
Nachfolger des Königs. Als auf dem Zuge gegen Troja die
Hellenen Mysien angriffen, besiegte sie T., ward aber dabei von
Achilleus verwundet. Da die Wunde nicht heilen will und das Orakel
verkündet, daß sie nur der heilen könne, der sie
geschlagen habe, wendet er sich nach Argos, wohin die Griechen
durch Sturm zurückverschlagen sind, flüchtet auf
Klytämnestras Rat mit dem aus der Wiege geraubten Orestes, dem
kleinen Sohn des Agamemnon, auf den Hausaltar und droht, das Kind
zu töten, wenn ihm keine Hilfe würde, worauf Achilleus
mit dem Rost oder den Spänen seiner Lanze die Wunde heilt. Vom
Orakel als Führer nach Troja bezeichnet, zeigt T. den Griechen
den Weg dorthin, weigert sich aber, als Gemahl der Astyoche, einer
Schwester des Priamos, an dem Krieg selbst teilzunehmen. T. wurde
in Pergamon und besonders von den Königen aus dem Haus des
Attalos als Heros verehrt. Auf den in Pergamon jüngst
ausgegrabenen Reliefs des Zeusaltars ist seine Geschichte
dargestellt. Vgl. O. Jahn, T. und Troilos (Kiel 1841 u. Bonn 1859);
Pilling, Quomodo Telephi fabulam veteres tractaverint (Halle
1886).
Telephotographie, die Reproduktion von Bildern durch den
elektrischen Strom in der Ferne. Zuerst 1847 von Bakewell versucht,
hat die Ausführung dieser Idee durch Bidwell 1881 praktische
Gestaltung erhalten. In den Schließungskreis zweier
galvanischer Batterien, die einander entgegenwirken, ist an der
einen Station eine lichtempfindliche Selenzelle, an der andern
Station eine mit befeuchtetem Jodkaliumpapier bedeckte
Messingplatte eingeschaltet, aus welcher ein Messingstift schleift.
Der Widerstand im Schließungskreis wird durch Rheostate so
reguliert, daß kein Strom durchfließt, wenn die
Selenzelle nicht beleuchtet ist. Durch Uhrwerke wird die
Messingplatte mit dem Jodkaliumpapier an dem Stift und ganz
entsprechend eine durchsichtige Glasplatte mit dunkeln Zeichnungen
an der Selenzelle vorbei bewegt. Geht eine helle Stelle der
Glasplatte an der Selenzelle vorbei, so wird unter der Einwirkung
des Lichts ihr Widerstand kleiner, ein der Lichtwirkung
entsprechender Strom geht von der Messingspitze, welche als
positive Elektrode dient, durch das Jodkaliumpapier und bringt
durch Abscheidung von Jod eine dunkle Färbung hervor; man
erhält also eine negative Kopie der Zeichnung, welche die
hellen Stellen des Originals dunkel zeigt.
Telerpeton, s. Eidechsen.
Telesio, Bernardino, ital. Philosoph, geb. 1508 zu
Cosenza in Kalabrien, gest. 1588 daselbst, nachdem er zu Padua, Rom
und Neapel gelehrt und an letzterm Orte die noch heute bestehende
Accademia Telesiana der Naturforscher zur Verdrängung der
Aristotelischen Physik gegründet hatte, hat sich als Gegner
des Aristoteles und Begründer einer neuen, angeblich auf
Erfahrung gestützten Naturphilosophie bekannt gemacht. In
derselben führt er (nach Art der griechischen
Naturphilosophen) die gesamte Erscheinungswelt auf drei
Hauptprinzipien, ein leidendes und körperliches (Materie) und
zwei thätige unkörperliche (Wärme und
576
Teleskop - Tell.
Kälte), zurück, von welchen das erste, welches
beweglich ist, den Himmel und die Gestirne, die letztern, welche
unbeweglich sind, die Erde und deren Bewohner, der Kampf zwischen
beiden aber den Ursprung und das Leben aller Dinge, der seelenlosen
wie der beseelten, den Menschen inbegriffen, bestimmt. Seine
Hauptschrift: "De natura", erschien unvollständig Rom 1568,
vollständig Neapel 1586, seine übrigen Werke Venedig
1590. Vgl. Rixner und Fieber, Leben berühmter Physiker, Heft 3
(Sulzb. 1821); Fiorentino, Bernardino T. (Flor. 1872-74, 2
Bde.).
Teleskop (griech., "Fernschauer"), s. v. w. Fernrohr,
besonders katoptrisches; s. Fernrohr.
Telesphoros (griech., "Vollender"), in der griech.
Mythologie der Gott der Genesung, gewöhnlicher Begleiter des
Asklepios, neben dem er als kleiner, in einen Mantel gehüllter
Knabe erscheint.
Tel est notre plaisir (franz.), "das ist unser Wille",
"so beliebt es uns", vor der Revolution der gewöhnliche
Schluß in Reskripten und Befehlen der Könige von
Frankreich an ihre Beamten.
Telëuten (Tulungut, weiße Kalmücken, auch
Kumanelinzen), mongolischer, aber türkisierter,
ackerbautreibender Volksstamm im sibir. Gouvernement Tomsk, an der
Beja und den Telezker Seen.
Teleutosporen (griech.), eine Art Sporen bei den Pilzen
(s. Pilze, S. 66, und Rostpilze).
Telford, Thomas, Ingenieur, geb. 9. Aug. 1757 zu Eskdale
(Dumfriesshire), erlernte das Maurerhandwerk, ging 1781 nach
Edinburg, 1782 nach London, wo er unter Chambers und Adams weitere
Studien machte. Hier lernte er zugleich die Anlagen der Docks und
Werften kennen, welche 1787 unter seiner Leitung vollendet wurden.
1793 wandte er sich dem Bau von Brücken zu, unter welchen die
gewölbten Brücken über den Severn bei Montfort und
Bewdley sowie über den Dee bei Tongueland und die
gußeiserne Brücke von Buildwas hervorzuheben sind. Bei
dem Bau des Ellesmerekanals (mit den bemerkenswerten
Aquädukten im Chirkthal und von Pont y Cyssylte) 1793
konstruierte T. zuerst gußeiserne Schleusenthore und dann
ganze Schleusen aus Gußeisen. Noch bedeutender war der T.
übertragene Bau des 1823 für die Schiffahrt
eröffneten Kaledonischen Kanals (s. d.). Auch der
Macclesfieldkanal und Birmingham-Liverpool-Junctionkanal sind Werke
Telfords. Unter seinen Hafenbauten sind die von Aberdeen und Dundee
die bedeutendsten. Unter den auswärtigen Aufträgen
Telfords ist der Plan des zur Verbindung des Wenersees mit der
Ostsee bestimmten Götakanals in Schweden hervorzuheben. Das
bedeutendste Werk Telfords ist die 1819-26 erbaute
großartige, zur Verbindung der Insel Anglesea mit dem
Festland von Carnarvon bestimmte Kettenbrücke über die
Menaistraße bei Bangor. Nach demselben System ist die zur
gleichen Zeit von ihm ausgeführte Conwaybrücke erbaut. T.
starb 1831.
Telfs, Dorf in Tirol, Bezirkshauptmannschaft Innsbruck,
in weiter Ebene des Oberinnthals an der Arlbergbahn gelegen, hat
eine hübsche Pfarrkirche mit Freskomalerei, ein
Bezirksgericht, Franziskanerkloster, Bierbrauerei,
Baumwollspinnerei, Tuch- und mechanische Leinweberei und (1880)
2261 Einw.
Telgte, Stadt im preuß. Regierungsbezirk und
Landkreis Münster, an der Ems, zwischen ausgedehnten Heiden,
56 m ü. M., hat eine kath. Kirche mit wunderthätigem
Marienbild, eine Privatirrenanstalt (Rochushospiz), Wollspinnerei
und Wollwarenfabrikation, Bierbrauerei, Mahl-, Walk-, Öl- und
Sägemühlen und (1885) 2271 Einw. T. ist seit 1238
Stadt.
Telinga, ein zu den Drawida (s. d.) gehöriger
Volksstamm in Ostindien, dessen Sprache das Telugu (s. d.), von
ältern Reisenden auch Gentoo ("Heidensprache") genannt,
ist.
Teliosádik (v. griech. telos, "Vollendung"), das
vollkommenste Zahlensystem, nämlich das duodezimale mit der
Grundzahl 12, dessen Verbreitung und gesetzliche Einführung
Joh. Friedrich Werneburg (geb. 1777 zu Eisenach, gest. 1851 als
Professor in Jena) in seiner gleichnamigen Schrift (Leipz. 1800)
"jedem redlichen Mann, ja jeder gebildeten, vernünftigen
Regierung zur Pflicht" gemacht hat.
Tell, das (arab.), das fruchtbare, den Getreidebau
gestattende Land am Atlas in Nordwestafrika, im Gegensatz zu der
unfruchtbaren Sahara. Das T. hat von Marokko bis Biskra in Algerien
eine fast durchgehends gleiche Breite von etwa 190 km.
Tell, Wilhelm, der besonders durch Schillers Dichtung
verherrlichte Held der Schweizersage, angeblich ein Landmann aus
Bürglen im Kanton Uri, Schwiegersohn Walther Fürsts von
Uri. Als er 18. Nov. 1307 dem vom Landvogt Geßler zu Altorf
als Zeichen der österreichischen Hoheit aufgesteckten Hute die
befohlene Reverenz nicht erwies, gebot ihm der Vogt als
berühmtem Armbrustschützen, einen Apfel von dem Haupt
seines Söhnleins zu schießen. Auf die Drohung, das Kind
müsse sonst mit ihm sterben, that T. den Schuß und traf
den Apfel. Als er aber auf die Frage nach dem Zweck des zweiten
Pfeils, den er zu sich gesteckt hatte, antwortete, daß
derselbe, wenn er sein Kind getroffen, für den Vogt bestimmt
gewesen, befahl dieser, ihn gefesselt auf seine Burg nach
Küßnacht überzuführen. Auf dem
Vierwaldstätter See aber brachte ein Sturm das Fahrzeug in
Gefahr, und T. ward seiner Fesseln entledigt, um dasselbe zu
lenken. Geschickt wußte er das Schiff gegen das Ufer, wo der
Axenberg sich erhebt, zu treiben, sprang dort vom Bord auf eine
hervorragende Felsplatte, welche noch jetzt die Tellsplatte
heißt, eilte darauf über das Gebirge nach
Küßnacht zu, erwartete den Vogt in einem Hohlweg, Hohle
Gasse genannt, und erschoß ihn aus sicherm Versteck mit der
Armbrust. Von Tells weitern Lebensschicksalen wird nur noch
berichtet, daß er 1315 in der Schlacht bei Morgarten mit
gefochten und 1354 in dem Schächenbach beim Versuch der
Rettung eines Kindes den Tod gefunden habe. Nachdem schon der
Freiburger Guillimann 1607, dann die Baseler Christian und Isaak
Iselin, der Berner Pfarrer Freudenberger 1752 sowie Voltaire
("Annales de l'Empire") die Geschichte Tells als Fabel bezeichnet
hatten, ist in neuerer Zeit durch die Forschungen Kopps (s. d.) u.
a. in unzweifelhafter Weise aufgezeigt worden, daß dieselbe,
wie überhaupt die gewöhnliche Tradition von der Befreiung
der Waldstätte, einerseits im Widerspruch mit der urkundlich
beglaubigten Geschichte (s. Schweiz, S. 757) steht, und daß
sie anderseits in keinen zeitgenössischen oder der Zeit
näher stehenden Quellen mit irgend einer Silbe erwähnt
wird. Erst gegen Ende des 15. Jahrh. taucht die Tellsage auf und
zwar in zwei Versionen. Die eine, repräsentiert durch ein um
1470 entstandenes Volkslied, die 1482-88 geschriebene Chronik des
Luzerners Melchior Ruß, ein 1512 in Uri verfaßtes
Volksschauspiel u. a., erblickt in T. den Haupturheber der
Befreiung und Stifter des Bundes; die andre, die zuerst in dem um
1470 geschriebenen anonymen "Weißen Buch" zu Sarnen, dann in
der 1507 gedruckten Chronik des Luzerners Etterlin erscheint, gibt
Tells Geschichte nur als zufällige Episode und schreibt die
Verschwörung
577
Tell el Kebir - Tellereisen.
vornehmlich den Stauffacher zu. Erst Tschudi (s. d.) hat die
beiden Traditionen zu der stehend gewordenen Gesamtsage
verknüpft, die dann im Lauf der Jahrhunderte noch mancherlei
Zusätze bekam und durch J. v. Müller und Schiller
Gemeingut geworden ist. Die sogen. Tellskapellen auf der
Tellsplatte, in Bürglen, in der Hohlen Gasse stammen
sämtlich erst aus dem 16. Jahrh. und sind zum Teil
nachweislich zu Ehren von Kirchenheiligen gestiftet worden. In Uri
ließ sich keine Familie T. ermitteln; die Erkenntnisse der
Urnerlandsgemeinden von 1387 und 1388, welche Tells Existenz
bezeugen sollten, sowie die den Namen "Tello" und "Täll"
enthaltenden Totenregister und Jahrzeitbücher von Schaddorf
und Attinghausen sind als Erdichtungen und Fälschungen
nachgewiesen. Die Sage vom Apfelschuß ist ein uralter
indogermanischer Mythus, welcher in anderm Gewand auch in der
persischen, dänischen, norwegischen und isländischen
Heldensage, in welch letzterer der Held Eigil genannt wird, von
dessen Sohn, König Orentel, T. vielleicht den Namen erhalten
hat, vorkommt und in der Schweiz von den Chronisten des 15. Jahrh.
zur Ausschmückung der Befreiungssage verwendet worden ist.
Vgl. Häusser, Die Sage vom T. (Heidelb. 1840); Huber, Die
Waldstätte (mit einem Anhang über die geschichtliche
Bedeutung des Wilhelm T., Innsbr. 1861); Liebenau, Die Tellsage
(Aarau 1864); W. Vischer, Die Sage von der Befreiung der
Waldstädte (Leipz. 1867); Rilliet, Der Ursprung der Schweizer
Eidgenossenschaft (deutsch, 2. Aufl., Aarau 1873);
Hungerbühler, Étude critique sur les traditions
relatives aux origines de la Confédération suisse
(Genf 1869); Meyer v. Knonau, Die Sage von der Befreiung der
Waldstätte (Basel 1873); Rochholz, T. und Geßler in Sage
und Geschichte (Heilbr. 1876); Derselbe, Die Aargauer Geßler
in Urkunden (das. 1877).
Tell el Kebir (Gasassin), ägypt. Dorf, an der
Eisenbahn von Ismailia nach Zagazig und am
Süßwasserkanal, bei dem die Engländer unter
Wolseley 13. Sept. 1882 das Heer Arabi Paschas vernichteten.
Teller kommen bei den german. Völkern schon in den
ältesten Zeiten vor und zwar aus Thon wie aus Metall und
Holz; doch wurden anfangs die Speisen darin bloß aufgetragen,
worauf jeder Tischgenosse sein Stück Fleisch auf eine
Brotschnitte gelegt erhielt, das er mit dem Messer dann
zerkleinerte. Erst im 12. Jahrh. fing man an, den Gästen noch
besondere T. vorzusetzen und zwar anfänglich je einen für
zwei Tischgenossen; dieselben waren bei den Wohlhabenden von Zinn
oder von Silber, im übrigen von gleicher Form wie die
unsern.
Teller, Wilhelm Abraham, protest. Theolog, geb. 9. Jan.
1734 zu Leipzig, ward 1755 Katechet an der Peterskirche daselbst,
1761 Professor der Theologie und Generalsuperintendent in
Helmstädt, 1767 Oberkonsistorialrat und Propst an der
Peterskirche zu Berlin, als welcher er auch unter dem Ministerium
Wöllner die unerschütterliche Säule des
Rationalismus bildete. Seit 1786 Mitglied der Akademie, starb er 9.
Dez. 1804. Von seinen Schriften sind hervorzuheben: das "Lehrbuch
des christlichen Glaubens" (Halle 1764) und das "Wörterbuch
des Neuen Testaments" (Berl. 1772, 6. Aufl. 1805).
Tellereisen (Tritteisen), Fangeisen, an welchem ein
rundliches, tellerförmiges, in einem Kranz b b (Fig. 1)
befestigtes Brett (Teller c) die Bügel a auseinander
hält, indem es zwischen dieselben mittels der Stellhaken
eingeklemmt wird. Sobald das Wild auf den Teller tritt, wird dieser
heruntergedrückt, und zugleich schlagen die Bügel durch
die Triebkraft einer mit ihnen in Verbindung stehenden Feder d
zusammen. Das Wild wird dadurch an dem den Teller
niederdrückenden Lauf gefaßt und dieser zwischen den
Bügeln festgeklemmt. Der Anker an der Kette e hindert das
Entkommen des gefangenen Wildes. Man hat auch Eisen, an welchen der
von Eisenblech gefertigte Teller in der Mitte getrennt, durch
bewegliche Scharniere zusammengehalten wird (Eisen mit gebrochenem
Teller), so daß beim Auftreten dieser in der Mitte nach unten
zusammenklappt und dadurch das Zuschlagen der Bügel bewirkt.
Man verwendet die T. zum Fang von Wölfen, Dachsen,
Füchsen, Ottern, Mardern und kleinem Raubzeug sowie von
Raubvögeln und fertigt sie dazu in sehr verschiedener
Größe. Man legt die T. entweder auf den Wechsel des
Wildes, auf den Eingang zum Bau, auf den Absprung des Marders und
den Ausstieg des Fischotters (s. d.) gut verdeckt in die Erde
gebettet und braucht dann keine Kirrbrocken. Andernfalls
578
Tellerrot - Tellur.
legt man, nachdem das Wild dadurch vorher angekirrt ist, solche
aus und bindet den Fangbrocken auf den Teller, lockt auch durch
eine Schleppe (s. d.) das Raubtier an den Fangplatz. Für
Marder bindet man ein Ei auf den Teller oder hängt einen Vogel
darüber. Um Raubvögel zu fangen, hat der Teller eine
konische Form und wird auf einem in Feld- oder Wiesenstücke
eingeschlagenen Pfahl befestigt (Fig. 2 u. 3), weil sich dieselben
zur Beobachtung der Umgegend gern hierauf niederzulassen
(aufzuhacken) pflegen. Bei Frostwetter ist der Fang unsicher, weil
der Teller festfriert und die Bügel am Losschlagen hindert.
Oft beißen sich auch die gefangenen Tiere, wenn der Knochen
durchgeschlagen ist, den Lauf ab und entkommen. Vgl. v. d. Bosch,
Fang des einheimischen Raubzeugs (Berl. 1879).
Tellerrot (Tassenrot), s. Safflor.
Tellerschnecke, s. Lungenschnecken und Planorbis
multiformis.
Tellez (spr. telljeds), Gabriel, genannt Tirso de Molina,
berühmter span. Dramatiker, von dessen Lebensumständen
nur wenig bekannt ist. Er war um 1585 zu Madrid geboren, trat noch
vor 1613 in den Orden der Barmherzigen Brüder zu Toledo und
bekleidete nach und nach die wichtigsten Stellen in demselben. 1645
wurde er Prior des Klosters Soria und soll als solcher 1648
gestorben sein. T. gehört zu den größten
dramatischen Dichtern Spaniens und nimmt seinen Platz unmittelbar
neben Lope und Calderon ein. Seine Stücke sind teils
Schauspiele (Comedias), teils Zwischenspiele und Autos
sacramentales (im ganzen ursprünglich gegen 300, von denen
jedoch nur der kleinste Teil erhalten ist); sie zeichnen sich durch
ungemeine Originalität und Mannigfaltigkeit der Erfindung,
Kühnheit des Plans, meisterhafte Charakterzeichnung und
hochpoetische Diktion aus. Besonders hervorragend ist T. in seinen
Lustspielen, von denen mehrere sich bis auf den heutigen Tag auf
der spanischen Bühne erhalten haben. Zu den
vorzüglichsten derselben gehören: "Don Gil de las calzas
verdes" (deutsch in Dohrns "Spanischen Dramen", Bd. 1, Berl. 1841),
"La celosa de si misma", "La villana de Vallecas". "No hay peor
sordo que el que no quiere oir", "Marta la piadosa" (deutsch in
Rapps "Spanischem Theater", Bd. 5, Hildburgh. 1870), die geniale
Farce "El amor medico" u. a. Von den ernstern Stücken sind
besonders das hochtragische "Escarmientos para el cuerdo", das
großartige "La prudencia en la mujer", das
mystisch-asketische Drama "El condenado por desconfiado" und der
"Burlador de Sevilla o el convidado de piedra" (franz. bearbeitet
von Molière; deutsch bei Dohrn, Bd. 1, und bei Rapp, Bd. 5),
als die erste dramatische Bearbeitung der Don Juan-Sage,
hervorzuheben. Eine erste (jetzt sehr seltene) Sammlung von T.'
Stücken erschien in 5 Bänden Madrid und Tortosa 1631-36;
andre sind einzeln gedruckt und mehrere noch handschriftlich
vorhanden. Eine neuere Ausgabe der "Comedias" besorgte Hartzenbusch
(Madr. 1839-42, 12 Bde.; Auswahl in der "Biblioteca de autores
españoles", Bd. 5, das. 1850). Die "Autos" von T. finden
sich in der unter seinem wahren Namen herausgegebenen Mischsammlung
"Deleytar a provechando" (Madr. 1635; das. 1775, 2 Bde.).
Tellkampf, Johann Ludwig, Nationalökonom, geb. 28.
Jan. 1808 zu Bückeburg, studierte in Göttingen, woselbst
er sich 1835 als Dozent niederließ, ging 1838 infolge des
Umsturzes der hannöverschen Verfassung nach Amerika und
bekleidete hier bis 1846 die Professur der Staatswissenschaften
erst am Union College, dann am Columbia College in New York und
schrieb außer verschiedenen handelspolitischen Abhandlungen
eine Schrift: "Über die Besserungsgefängnisse in
Nordamerika und England" (Berl. 1844). Im Auftrag der
preußischen Regierung, welche ihn schon zu einer Beratung
über Gefängnisreform hinzugezogen hatte, studierte er
1846 das Gefängniswesen in England, Frankreich und Nordamerika
und wurde in demselben Jahr zum Professor der Nationalökonomie
in Breslau ernannt. 1848 gehörte T. dem
Verfassungsausschuß des Frankfurter Parlaments an, 1849-51
war er Mitglied der preußischen Zweiten Kammer, seit 1855 auf
Präsentation der Universität Breslau Mitglied des
preußischen Herrenhauses, wo er zur liberalen Minorität
gehörte. Im Reichstag, dem er seit 1871 angehörte,
zählte er zur national-liberalen Fraktion. Er starb 15. Febr.
1876. Von seinen zahlreichen Schriften sind zu nennen:
"Beiträge zur Nationalökonomie und Handelspolitik"
(Leipz. 1851-53, 2 Hefte); "Der Norddeutsche Bund und die
Verfassung des Deutschen Reichs" (Berl. 1866); "Die Prinzipien des
Geld- und Bankwesens" (das. 1867); "Essays on law reform,
commercial policy, banks, penitentiaries etc." (Lond. 1857; 2.
Aufl., Berl. 1875); "Selbstverwaltung und Reform der Gemeinde- und
Kreisordnungen in Preußen und Selfgovernment in England und
Nordamerika" (das. 1872). Mit Bergius übersetzte er
MacCullochs "Geld u. Banken" (Lpz. 1859).
Tellskapelle, eine der Lokalitäten, die mit der
Urgeschichte der vier schweizerischen Waldstätte in Verbindung
gebracht sind. Hierher versetzt nämlich die Tradition jenen
Moment, wo der von dem Landvogt Geßler gebundene Tell, als
der Sturm alle Schiffsleute verzagen ließ, seiner Bande los
wurde, das Fahrzeug sicher nach einem Felsvorsprung hinleitete und,
mit seiner Armbrust bewaffnet, dem Schiff entsprang (1307). Die
Kapelle wurde 1880 von neuem erbaut und von Stückelberg mit
Fresken geschmückt. Der Ort ist eine der Dampfschiffstationen
des Vierwaldstätter Sees. Eine zweite T. befindet sich in
Bürglen neben dem Hotel "Wilhelm Tell", eine dritte in der
Hohlen Gasse, zwischen Arth und Küßnacht.
Tellur Te, chemisch einfacher Körper, findet sich in
geringen Mengen gediegen bei Valathna in Siebenbürgen,
gewöhnlich mit Metallen verbunden, z. B. mit Gold als
Schrifttellur, mit Silber als Weißtellur, mit Wismut und
Schwefel als Tetradymit und mit Blei, Antimon und Schwefel als
Blättererz. Einige dieser Mineralien werden auf Silber und
Gold verhüttet. Zur Gewinnung des Tellurs zieht man Tellurgold
oder Tellursilber mit warmer Salzsäure aus, behandelt den
Rückstand mit Königswasser, fällt aus der klaren
Lösung das Gold durch Eisenvitriol und nach dem Filtrieren das
T. durch schweflige Säure. Es ist silberweiß,
glänzend, blätterig-kristallinisch, spröde, Atomgew.
127,7, spez. Gew. 6,24, schmilzt so leicht wie Antimon, ist
flüchtig, verbrennt an der Luft zu farblosem,
kristallinischem, wenig in Wasser löslichem
Tellurigsäureanhydrid TeO2 unter Verbreitung eines
eigentümlichen, schwach säuerlichen Geruchs, löst
sich mit roter Farbe in heißer Kalilauge zu Tellurkalium und
tellurigsaurem Kali, scheidet sich aber beim Erkalten der
Lösung wieder vollständig aus, wird von konzentrierter
Schwefelsäure und Salpetersäure zu farbloser, erdiger,
scharf metallisch schmeckender telluriger Säure H2TeO3 und von
schmelzendem Salpeter zu farbloser, kristallinischer, metallisch
schmeckender Tellursäure H2TeO4 oxydiert. Es verbindet sich
direkt mit den Haloiden, mit Schwefel und vielen Metallen, ist
zweiwertig und in
579
Tellurblei - Temes.
seinem chemischen Verhalten dem Schwefel und Selen ähnlich.
Das gediegene T. wurde von den alten Metallurgen Aurum paradoxum,
Metallum problematicum genannt, Klaproth erkannte es 1798 als neues
Element, und Berzelius studierte es 1832 genauer, stellte es aber
zu den Metallen.
Tellurblei (Altait), seltenes, regulär
kristallisierendes, zinnweißes Mineral aus der Ordnung der
einfachen Sulfuride, besteht aus Blei und Tellur PbTe mit 38,21
Tellur und etwas Silber, findet sich am Altai, in Kalifornien,
Colorado und Chile.
Tellurisch (lat.), was sich auf die Erde (tellus)
bezieht, von dieser abstammt; daher tellurische Einflüsse,
Einwirkung der Erde auf den menschlichen Körper als
Krankheitsursache etc.
Tellurismus (lat.), s. Magnetische Kuren.
Tellurit (Tellurocker), Mineral, natürlich
vorkommendes Anhydrid der tellurigen Säure, TeO2,
äußerst selten mit gediegenem Tellur in Quarz auf
einigen siebenbürgischen Gruben, auch mit andern Tellurerzen
in Colorado vorkommend.
Tellurium (lat.), Maschine zur Versinnlichung der bei der
täglichen Rotation und dem jährlichen Umlauf der Erde um
die Sonne eintretenden Erscheinungen, besonders des durch den
Parallelismus der Erdachse bedingten Wechsels der Jahreszeiten.
Vgl. Wittsack, Das T. (2. Aufl., Berl. 1875).
Tellus ("Erde"), die italische Gottheit der
mütterlichen Erde, daher auch oft T. mater genannt, entspricht
der griech. Gäa (s. d.). Man rief sie bei Erdbeben an (wie
denn ihr Tempel in Rom, am Abhang des vornehmen Quartiers der
Carinen gelegen, 268 v. Chr. infolge eines Erdbebens im Kriege
gelobt worden war), bei feierlichen Eiden zusammen mit dem
Himmelsgott Jupiter, als das allgemeine Grab der Dinge neben den
Manen. Wie die griechische Demeter, galt sie auch als Göttin
der Ordnung der Ehe, insbesondere aber verehrte man sie vielfach in
Verbindung mit Ceres als Göttin der Erdfruchtbarkeit. So
galten ihr die im Januar am Beschluß der Winteraussaat vom
Pontifex an zwei aufeinander folgenden Markttagen angesetzte
Saatfeier (feriae sementivae) und die gleichzeitig auf dem Land
gefeierten Paganalien, bei denen ihr mit Ceres ein trächtiges
Schwein geopfert wurde, ferner das am 15. April für die
Fruchtbarkeit des Jahrs teils auf dem Kapitol, teils in den 30
Kurien, teils außerhalb der Stadt unter Beteiligung der
Pontifices und der Vestalinnen begangene Fest der Fordicidien oder
Hordicidien, bei denen ihr trächtige Kühe (fordae)
geopfert wurden; die Asche der ungebornen Kälber verwahrten
die Vestalinnen bis zum Feste der Palilien (s. Pales), an welchem
sie als Reinigungsmittel verwendet wurde. Neben der weiblichen
Gottheit verehrte man auch einen Gott Tellumo. Vgl. Stark, De
Tellure dea (Jena 1848).
Telmann, Konrad, Pseudonym, s. Zitelmann.
Telmessos (Telmissos), im Altertum Hafenstadt an der
Westküste von Lykien, nahe der Grenze von Karien, als Sitz von
Wahrsagern berühmt. Ruinen beim heutigen Makri (s. Tafel
"Baukunst II", Fig. 14).
Telpherage (spr. téllferidsch, Telpher), von
Fleeming Jenkin erfundene elektrische Eisenbahn, bei welcher die
Wagen wie bei der Seilbahn an Stahldrahtseilen hängend sich
fortbewegen. Die zwei Seile sind an jeder Tragsäule übers
Kreuz stromleitend miteinander verbunden. Die Säulen stehen je
20 m voneinander entfernt, und jeder Zug besteht aus Lokomotive und
zehn Kasten im Gesamtgewicht von 570 und mit einer Tragkraft von
1400 kg. Eine Versuchsbahn wurde 1883 zu Weston bei Hitchin in
England gebaut, eine größere Anlage 1885 zu Glynde in
der Grafschaft Sussex.
Tel-pos (Töll-pos), Berg des nördlichen sogen.
Wüsten Urals im russ. Gouvernement Wologda, gipfelt in zwei
Piks (1687 und 1640 m hoch). Auf der höchsten Terrasse
befindet sich ein See, aus dem ein breiter Bach
hinabstürzt.
Telschi (lit. Telszei), Kreisstadt im litauisch-russ.
Gouvernement Kowno, am See Mastis, hat 2 Synagogen, eine
griechisch-russ. Kirche, eine Adelsschule, eine hebräische
Kreisschule, Handel mit Getreide und Leinsaat und (1886) 11,393
Einw.
Teltow, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Potsdam,
mit Berlin durch eine Dampfstraßenbahn verbunden, hat eine
evang. Kirche, berühmten Rübenbau (Teltower Rüben)
und (1885) 2667 Einw. T. wird zuerst 1232 urkundlich erwähnt.
Der Kreis T. hat Berlin zur Kreisstadt.
Teltower Rübe, s. Raps.
Teltsch, Stadt in der mähr. Bezirkshauptmannschaft
Datschitz, nahe am Ursprung der Thaya, hat ein Bezirksgericht, ein
altes Schloß, eine gotische Dekanats- und 5 andre Kirchen,
eine Landesoberrealschule, eine Dampfmühle,
Schneidemühle, Spiritusbrennerei, Tuchmacherei, Flachsbau und
(1880) 5116 Einw.
Telugu, Sprache des zu den Drawida (s. d.) gehörigen
Volkes der Telinga in Ostindien, an der Ostküste des Dekhan
von Orissa südwärts bis beinahe Madras von ca. 20 Mill.
Menschen gesprochen. Die eigentümliche Teluguschrift ist aus
dem alten Sanskritalphabet abgeleitet, und die mindestens bis ins
12. Jahrh. v. Chr. zurückreichende, nicht unbedeutende, aber
noch wenig gekannte Litteratur besteht ebenfalls zumeist in
Übersetzungen von und Kommentaren zu bekannten Sanskritwerken.
Bearbeitet wurde das T. am besten durch Brown ("T. grammar", Madras
1858; "T. dictionary", das. 1852-53, 2 Bde.); neuere Grammatiken
lieferten Arden (Lond. 1873) und Morris (das. 1889).
Telut, Insel, s. Jaluit.
Telyu, die cymbrische Harfe, s. Harfe.
Tem., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung
für J. E. Temminck, geb. 1778, gest. 1858 in Leiden
(Vögel, Säugetiere).
Temascaltepec, Stadt im mexikan. Staat Mexiko, 30 km
südwestlich von Toluca, in tiefem Thal, hat Weberei
großer Baumwolltücher, verlassene Bergwerke und (1880)
10,267 Einw. (im Munizipium).
Tembek, eine in Persien erzeugte Sorte Tabak, welche nur
aus der Wasserpfeife geraucht wird.
Tembuland, Dependenz des brit. Kaplandes, an der
Südostküste zwischen den Flüssen Bashee und Umtata,
10,502 qkm (191 QM.) groß mit (1885) 122,638 Einw., worunter
8320 Weiße.
Temen, Getreidemaß, s. Ueba.
Temenos (griech.), geweihter Tempelbezirk.
Temes (spr. témesch, bei den Alten Tibiscus),
Fluß in Ungarn, entspringt im Banater Gebirge, fließt
meist durch ein enges Gebirgsthal, tritt bei Lugos in die
ungarische Tiefebene, fließt hier in einem großen,
gegen S. geöffneten Bogen in südwestlicher Richtung und
mündet bei Pancsova in die Donau. Ihr Lauf beträgt 430
km. Anfangs wird sie bloß zum Holzflößen, von
Tomaschevatz an auch zur Schiffahrt benutzt. Sie nimmt links die
Bogonicz und Berzava, rechts die Bistra und Bega auf und speist den
Begakanal. - Das ungar. Komitat T. längs der Maros und
Theiß grenzt im W. an das Komitat Torontál,
580
Temesvar - Tempe.
im N. an Arad, im O. an Krassó-Szörény und im
S. an Serbien, umfaßt 7136 qkm (129,6 QM.) mit (1881) 396,045
Einw. (meist Rumänen und Serben), ist fast durchaus eben, wird
an der Nordgrenze von der Maros, im Innern von der Berzava, der T.,
dem Krassó und der Nera, an der Südgrenze von der Donau
bewässert, hat viele Sümpfe, ein heißes, teilweise
ungesundes Klima, aber sehr fruchtbaren Boden. Getreide und Obst
werden in Fülle gewonnen. Vieh-, Seidenraupen- und Bienenzucht
blühen. Das Komitat wird von den Bahnlinien Arad-Bazias und
Szegedin-Orsova durchschnitten. Sitz desselben ist Temesvár.
Hervorragend ist die Mühlenindustrie (259 Mühlen mit
einer Jahresproduktion von 1,644,000 metr. Ztr. Mehl).
Temesvár (spr. témeschwar), königliche
Freistadt und Festung im ungar. Komitat Temes und Knotenpunkt der
Österreichisch-Ungarischen Staatsbahnlinien Wien-Orsova und
T.-Bazias sowie der Arad-Temesvárer Bahn, liegt am Begakanal
in sumpfiger Gegend, besteht aus der von breiten Glacis- und
Parkanlagen (Stadtpark und Scudierpark) umgebenen Festung (innere
Stadt) und vier Vorstädten. Die Stadt T., welche 13 Kirchen, 4
Klöster und 3 Synagogen besitzt, hat hübsche
Straßen, große Plätze und schöne
öffentliche und Privatbauten, viele Kasernen und elektrische
Beleuchtung. Nennenswert sind die beiden Kathedralen sowie das
Komitatshaus am Losonczyplatz (daselbst steht eine
Mariensäule), das alte Schloß Joh. Hunyadys (jetzt
Zeughaus), ferner das Rathaus und die Militärgebäude am
Prinz Eugen-Platz, wo sich eine 1852 zur Erinnerung an die
Verteidigung Temesvárs errichtete 20 m hohe gotische
Spitzsäule (von Max) erhebt, das Dikasterialgebäude, das
Theater, die neue Synagoge und die Staatsoberrealschule etc. Die
Einwohner (1881: 33,694) sind Deutsche, Rumänen, Serben und
Ungarn und betreiben lebhaften Handel und zahlreiche Gewerbe. T.
hat eine bedeutende Fabrikindustrie: 1 königliche
Tabaksfabrik, 3 Dampfmühlen (darunter die Elisabeth- und
Pannoniamühle mit 200,000 und 100,000 metr. Ztr.
Jahresproduktion), 4 große Spiritusfabriken und -Raffinerien,
ein großes Brauhaus; ferner Fabriken für Tuch, Papier,
Leder, Wolle, Soda, Öl etc., eine Dampfsäge- und viele
Wassermühlen am Begakanal; endlich besitzt T. ein
Obergymnasium, eine Oberreal- und eine höhere
Mädchenschule, eine Handelsschule, mehrere Spitäler, 2
Waisenhäuser, eine Handels- und Gewerbekammer, eine Filiale
der Österreichisch-Ungarischen Bank, ein südungarisches
Museum und einen Tramway, welcher den Verkehr zwischen der Festung
und den Vorstädten vermittelt. T. ist Sitz des Komitats, des
Csanáder römisch-katholischen und eines
griechisch-orientalischen (serbisch-rumänischen) Bischofs,
eines General- und Festungskommandos, eines Gerichtshofs, einer
Finanzdirektion und sonstiger Behörden. - T. ist das Zambara
der Römer. Unter der Avarenherrschaft hieß es Beguey;
unter der ungarischen war es Sitz eigner Grafen und unter dem
ungarischen König Karl Robert eine so blühende Stadt,
daß derselbe 1316 fein Hoflager hierher verlegte. 1443
erbaute Hunyady das Schloß; 1552 ward T. von den Türken
erobert, 1716 durch den Prinzen Eugen vom türkischen Joch
befreit. Damals wurde die jetzige Festung angelegt, die alte Stadt
größtenteils niedergerissen und nach einem neuen Plan
wieder aufgebaut. 1781 ward T. zur königlichen Freistadt
erhoben. 1849 ward es vom ungarischen General Grafen Vecsey seit
25. April belagert, aber durch den Sieg Haynaus über Bem und
Dembinski (9. Aug.) entsetzt. Vgl. Preyer, Monographie der
königlichen Freistadt T. (Temesv. 1853).
Temir-Chan Schura, Gebietsstadt im Gebiet Daghestan der
russ. Statthalterschast Kaukasien, 466 m ü. M., in ungesunder
Gegend, stark befestigt, mit (1879) 4650 Einw.; von alters her
berühmt durch seine ausgezeichneten Dolche und Säbel.
Temme, Jodocus Donatus Hubertus, deutscher
Rechtsgelehrter und belletristischer Schriststeller, geb. 22. Okt.
1798 zu Lette in Westfalen, studierte zu Münster und
Göttingen die Rechte, besuchte dann als Erzieher eines Prinzen
von Bentheim-Tecklenburg noch Heidelberg, Bonn, Marburg, bekleidete
seit 1832 verschiedene richterliche Ämter, ward 1839 Direktor
des Stadt- und Landgerichts zu Berlin, 1844 nach Tilsit versetzt
und wurde 1848 Oberlandesgerichtsdirektor zu Münster. Er
saß in der preußischen wie in der deutschen
Nationalversammlung auf der äußersten Linken und ward
1849 wegen selner Teilnahme an den Stuttgarter Beschlüssen in
einen Hochverratsprozeß verwickelt, zwar nach neunmonatlicher
Haft vom Schwurgericht freigesprochen, aber im Disziplinarweg 1851
aus dem Staatsdienst entlassen. Vgl. "Die Prozesse gegen J. T."
(Braunschw. 1851). Von 1851 bis 1852 redigierte er die "Neue
Oderzeitung" in Breslau, 1852 folgte er einem Ruf als Professor des
Kriminalrechts nach Zürich, wo er 14. Nov. 1881 starb. Von
seinen juristischen Werken sind hervorzuheben: "Lehrbuch des
preußischen Zivilrechts" (2. Aufl., Leipz. 1846, 2 Bde.);
"Lehrbuch des preußischen Strafrechts" (Beri. 1853); "Archiv
für die strafrechtlichen Entscheidungen der obersten
Gerichtshöfe Deutschlands" (Erlang. 1854-59, 6 Bde.);
"Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts" (Aarau 1855); "Lehrbuch
des gemeinen deutschen Strafrechts" (Stuttg. 1876). Daneben trat er
mit Glück als Novellist auf und entwickelte besonders im Fach
der Kriminalnovelle eine ungewöhnliche Produktivität.
Vgl. seine "Erinnerungen" (hrsg. von Born, Leipz. 1882).
Temne (Timmene), Negerstamm in Westafrika, am
Rokellefluß in Sierra Leone. Die Sprache der T., grammatisch
dargestellt von Schlenker (Lond. 1864), ist nahe verwandt mit der
des benachbarten kleinen Stammes der Bullom (grammatisch und
lexikalisch bearbeitet von Nyländer, das. 1814); nach Bleek
und Lepsius steht sie auch zu dem großen
südafrikanischen Bantusprachstamm (s. Bantu) in
Beziehungen.
Temnikow, Kreisstadt im russ. Gouvernement Tambow, an der
Mokscha, hat 8 griechisch-russ. Kirchen, Gußeisen- u.
Fayencefabriken u. (1885) 7107 Einw.
Tempe ("die Einschnitte"), von den alten Dichtern
vielfach gefeiertes, 100-2000 Schritt breites, etwa 10 km langes,
vom Peneios durchströmtes Felsenthal mit üppiger
Vegetation zwischen dem Ossa und dem Olympos in Thessalien. Wo der
Peneios das Gebirge durchbricht, rücken die Berge sehr nahe
zusammen; weiterhin öffnet sich stellenweise das Thal, so
daß der Fluß in Windungen sanft hindurchströmt;
aber in der Nähe des Meers bilden die Felsen eine enge, wilde
Schlucht, um dann ganz am Meer wieder auseinander zu treten. Die
Straße, zum Teil in den Felsen gehauen, liegt am rechten
Ufer. Das Thal war einer der wichtigsten Pässe
Nordgriechenlands. Philipp von Makedonien ließ am Eingang
Kastelle errichten, die nach ihm verfielen, von den Römern
aber wiederhergestellt wurden. Noch jetzt sind Trümmer eines
Kastells auf dem rechten Peneiosufer vorhanden. Im Passe selbst
stand ein hochheiliger Altar des Apollon, unweit des Meers ein
solcher des Poseidon Peträos, als dessen Werk die Thalspalte
an-
581
Tempel (kunstgeschichtlich).
gesehen wurde. Vgl. Kriegk, Das thessalische T. (Leipz.
1835).
Tempel (v. lat. templum), bei den Völkern des
Altertums ein der Gottheit geweihter Bezirk, dann das auf demselben
stehende Gebäude, zur Aufnahme der Götterbilder, des
Altars und der Priester, aber nur selten des Volkes bestimmt. Im
Innern des eigentlichen Tempelhauses oder der Zelle (cella) stand
die Bildsäule oder das Bild der Gottheit, welcher der T.
gewidmet war, auf einem Postament an der dem Eingang
gegenüberliegenden Mauer, vor ihm ein entweder runder oder
viereckiger Opfer- und Betaltar. Die Decke bestand aus Holz, selten
aus Stein und war gewöhnlich eben, später bisweilen auch
gewölbt. Der Fußboden war anfangs aus Steinplatten,
später aus Mosaik hergestellt. Die Säulen des Portikus
schmückte man oft mit erbeuteten feindlichen Schilden. Stufen
hatten die griechischen T. in der Regel, und zwar liefen sie stets
ringsherum. Der dadurch geschaffene Stufenunterbau hieß
Krepidoma. Der Platz um den T., soweit er der Gottheit geweiht war,
hieß Peribolus. Mit einer Mauer umgeben, enthielt er
Altäre, Statuen, Monumente aller Art. Über die T. der
alten Ägypter s.Baukunst, S. 482, und über die der Inder
s. Höhlentempel. Die Hebräer besaßen nur einen
einzigen T., den berühmten T. zu Jerusalem, ihr
Nationalheiligtum. Der erste T. (Salomonischer T.), von Salomo seit
990 v. Chr. auf dem Berg Moria mit Hilfe phönikischer Meister
errichtet, war ein steinernes Gebäude von 60 Ellen Länge,
20 Ellen Breite und 30 Ellen Höhe, an drei Seiten mit
Seitenzimmern umgeben, welche, in drei Stockwerken
übereinander, zur Bewahrung der Schätze und
Gerätschaften des Tempels dienten, an der vordern Seite aber
mit einer 10 Ellen breiten Vorhalle geziert, welche von zwei
ehernen Säulen, Jachin und Boas ("Festigkeit und
Stärke"), getragen wurde. Das Innere enthielt einen 40 Ellen
langen Vorderraum, das Heilige, worin die goldenen Leuchter, der
Schaubrottisch und der Räucheraltar standen, und einen durch
einen Vorhang davon geschiedenen Hinterraum von 20 Ellen
Länge, das Allerheiligste, mit der Bundeslade. Beide
Räume waren an den Wänden, das Allerheiligste (Adyton)
auch am Boden und an der Decke mit Holzwerk getäfelt.
Letzteres war nur dem Hohenpriester, das Heilige nur den Priestern
zugänglich. Das Tempelgebäude war von einem innern Vorhof
der Priester mit dem Brandopferaltar, dem Reinigungsbecken und
andern Gerätschaften umgeben und dieser durch
Säulengänge mit ehernen Thoren von dem für das Volk
bestimmten und von einer Mauer umschlossenen äußern
Vorhof geschieden. Nachdem er 586 durch Nebukadnezar zerstört
worden war, erhob sich an seiner Stelle nach der Rückkehr der
Juden aus der Babylonischen Gefangenschaft der zweite, nach
Serubabel gekannte T., der wahrscheinlich wie auf der Stätte,
so auch nach dem Plan des ersten errichtet und 516 vollendet wurde,
diesem aber an Größe und Pracht nachstand. Durch
Antiochos Epiphanes 169 entweiht, ward er von Judas Makkabäus
wiederhergestellt und befestigt. Unter Herodes d. Gr. begann seit
21 v. Chr. eine gänzliche Umgestaltung des Tempels in
großartigerm Maßstab im griechischen Stil (daher
Herodianischer T.). Dieser Tempelbau war nach Josephus eine Stadie
lang und eine Stadie breit. Im jüdisch-römischen Krieg,
70 n. Chr., war der T. die letzte Schutzwehr der Juden. Seit 644
steht auf der Tempelstätte eine Moschee. Die Aufzeichnungen
über den Salomonischen Tempelbau finden sich, außer
einzelnen Notizen bei Jeremias 52 und im 2. Buch der Könige
25, im 1. Buch der Könige, Kap. 5-7, und 2. Chron., Kap. 2-4.
Vgl. Vogué, Le temple de Jérusalem (Par. 1864,
Prachtwerk), außerdem die Schriften über den
Salomonischen T. von Keil (Dorp. 1839), Bähr (Karlsr. 1848),
Rosen (Gotha 1866), Fergusson (Lond. 1878), Spieß (Berl.
1881), Wolff (Graz 1887). - Die höchste künstlerische
Ausbildung erfuhr der Tempelbau durch die Griechen, welche, von der
einfachsten Form ausgehend, allmählich zu einer Anzahl von
Typen gelangten, die nicht nur für die Römer
maßgebend gewesen sind, sondern auch auf die Baukunst der
neuern Zeit Einfluß geübt haben. Man unterschied die
einzelnen Gattungen der T. entweder nach der Anordnung der
Säulenstellungen vor und hinter der Tempelfronte oder an den
Seiten des Tempels oder
[siehe Graphik] [siehe Graphik] [siehe Graphik]
1. Antentempel. 2. Prostylos. 3. Ampyiprostylos.
[siehe Graphik] [siehe Graphik] [siehe Graphik]
4. Peripteros. 5. Dipteros. 6. Pseudodipteros.
nach der Zahl der Säulen an der Tempelfronte (vgl. auch
Baukunst, S. 486). Die erstere Einteilung ist die geläufigere.
Man unterschied demnach: 1) T. in antis (Antentempel), bei welchen
zwischen den über den Haupteingang zur Cella vorgeschobenen
Seitenmauern (antae) des Tempels zwei Säulen standen. Die
dadurch gewonnene Vorhalle hieß Pronaos. Um die Cella auch
von hinten zugänglich zu machen, wurde die Rückseite des
Tempels später mit einer gleichen Anlage (Opisthodomos,
Hinterhaus) versehen (Fig. 1). 2) Prostylos hieß der T., wenn
die Stirnseiten der Seitenmauern bis zur Eingangsthür der
Cella zurücktraten und die Vorhalle des Tempels allein durch
Säulen getragen wurde (Fig. 2). 3) Der Amphiprostylos
entsteht, wenn diese Säulenstellung sich am Hinterhaus des
Tempels wiederholt (Fig. 3). 4) Der Peripteros ist die Erweiterung
des Amphiprostylos durch eine Säulenhalle, welche um alle vier
Seiten des Tempels als freier Umgang herumgeführt wird. Es ist
die edelste Form des griechischen Tempelbaues, dessen klassisches
Beispiel der Parthenon ist (Fig. 4). Eine römische Abart ist
der Pseudoperipteros, bei welchem die Säulen in Form von
Halbsäulen und Pilastern den Seitenwänden angefügt
waren und das Gebälk tru-
582
Tempel - Tempelherren
gen, im wesentlichen also nur einen dekorativen Zweck hatten. 5)
Der Dipteros entsteht, wenn um den T. eine doppelte
Säulenstellung herumgeführt wird, also an der Vorder- und
Rückseite vier Reihen von Säulen stehen (Fig. 5). Der
Pseudodipteros (Fig. 6) unterscheidet sich von dem Dipteros
dadurch, daß die innere Säulenstellung fehlt, aber der
Zwischenraum zwischen der äußern Säulenstellung und
der Cellawand der gleiche geblieben ist. Je nach der Zahl der
Säulen an der Vorderseite, welche immer eine gerade war,
unterscheidet man: Naos (T.) tetra-, hexa-, okta-, deka- und
dodekastylos (d. h. 4-, 6-, 8-, 10- und 12säulige T.). Eine
besondere Abart der T. waren die Rundtempel, welche bisweilen auch
von Säulen umgeben waren und dann Monopteros hießen.
Vgl. Nissen, Das Templum (Berl. 1869).
Tempel, 1) Abraham van den, holländ. Maler, geboren
um 1622 zu Leeuwarden, war ein Schüler von Joris van Schooten
in Leiden und daselbst bis 1660 thätig und starb 1672 in
Amsterdam. Er hat Bildnisse und Porträtgruppen von vornehmer
Aufsassung, aber konventioneller Detailbehandlung gemalt.
Gemälde von ihm befinden sich zu Amsterdam, im Haag, in
Berlin, Kassel u. a. O.
2) Ernst Wilhelm Leberecht, Astronom, geb. 4. Dez. 1821 zu
Niederkunnersdorf in der Oberlausitz, ließ sich als
Lithograph in Venedig nieder und begann 1859 sich mit
astronomischen Beobachtungen zu beschäftigen, wandte sich dann
1860 nach Marseiile, wo er kurze Zeit an der Sternwarte, dann aber
als Lithograph thätig war; 1870 als Deutscher vertrieben, ging
er nach Italien, wo er anfangs an der Sternwarte in Mailand
beschäftigt war, 1875 aber Observator an der Sternwarte zu
Arcetri bei Florenz wurde; hier starb er 16. März 1889. T. hat
sich namentlich durch zahlreiche Kometen- und
Planetoiden-Entdeckungen und Beobachtung der Nebelflecke bekannt
gemacht.
Tempelburg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Köslin, Kreis Neustettin, zwischen Zeppliner und Dratzigsee
und an der Linie Ruhnow-Konitz der Preußischen Staatsbahn,
hat eine evangelische und eine kath. Kirche, ein Amtsgericht,
Zündholz- und Dachpappenfabrikation, eine
Dampfsägemühle, Bierbrauerei und (1885) 4510 Einw. Die
Stadt ward um 1291 von den Tempelrittern gegründet und kam
1668 von Polen an Brandenburg.
Tempeldiener, s. Hierodusen.
Tempelgesellschaft, eine 1854 in Württemberg
entstandene, 1861 aus der Kirche ausgetretene religiöse Sekte,
welche sich seit 1868 in Palästina angesiedelt und die drei an
der syrischen Küste gelegenen "Tempelkolonien" Haifa, Jafa und
Sarona samt einer vierten in Jerusalem gegründet hat. Die Zahl
der dort lebenden deutschen Templer belief sich 1878 etwa auf 850,
1884 auf 1300; 1886 waren 362 Mitglieder in Haifa, 203 zu Jafa, 256
zu Sarona. Die Gemeinden sind gut organisiert und besitzen in
Jerusalem eine höhere Schule, in Jafa ein Töchterinstitut
und ein Krankenhaus; ihre Glieder haben sich in Bezug auf die
Bodenkultur als tüchtige Kolonisten bewährt und auch um
Weg- und Straßenbau verdient gemacht. Haupt der T. war bis zu
seinem Tod Christoph Hoffmann (s. d. 10), der 1878 den Zentralsitz
der T. nach Jerusalem verlegte. Vgl. dessen Schriften: "Occident
und Orient. Eine kulturgeschichtliche Betrachtung vom Standpunkt
der Tempelgemeinden in Palästina" (Stuttg. 1875) und "Mein Weg
nach Jerusalem" (das. 1881-85, 2 Bde.). Nachdem er in
christologische Ketzereien verfallen war, sagte sich 1876 der
Reichs-Bruderbund zu Haifa unter Hardegg von dem Haupttempel los.
Hardegg starb 1879, Hoffmann 8. Dez. 1885. Sein Nachfolger ist Chr.
Paulus geworden. Ein Mitglied der Gemeinde zu Haifa, G. Schumacher,
ist seit 1885 als türkischer Beamter für Straßen-
und Brückenbau thätig.
Tempelherren (Templer, Tempelbrüder, Milites templi,
Templarii), geistlicher Ritterorden, entstand zur Zeit der
Kreuzzüge in Palästina, indem 1119 neun französische
Ritter, an ihrer Spitze Hugo von Payens und Gottfried von St.-Omer,
zu einer Gesellschaft zusammentraten, um zur Ehre der
süßen Mutter Gottes Mönchtum und Rittertum
miteinander zu verbinden und am Grab des Heilands sich zugleich dem
keuschen und andächtigen Leben sowie der tapfern Beschirmung
des Heiligen Landes und der Geleitung der Waller durch die
gefährlichen und unsichern Gegenden zu widmen. Sie erhielten
vom König Balduin II. einen Teil seiner auf dem Platz des
ehemaligen Salomonischen Tempels erbauten Residenz und zur
Beherbergung armer Pilger von den Kanonikern des Heiligen Grabes
mehrere Gebäude in der Nähe und nannten sich daher T.
oder Templer. Ihre Kleidung bestand in einem weißen leinenen
Mantel mit einem achteckigen blutroten Kreuz und in einem
weißen leinenen Gürtel; ihr Ordenssiegel zeigte den
Tempel, später zwei Reiter (einen Templer und einen hilflosen
Pilger) auf Einem Pferd. Papst Honorius II. erteilte dem Orden 1127
die Bestätigung. Bernhard von Clairvaux entwarf 1128 in Troyes
die erste Ordensregel, welche den spätern Ordensstatuten (72
Artikel) zu Grunde lag, und schrieb eine Schrift zum Lob des Ordens
("Liber de lande[statt laude] novae militiae admilites templi").
Auf einer Reise in das Abendland bewirkte Hugo von Payens den
Eintritt vieler Ritter in den Orden und die Schenkung reicher
Besitzungen. Während sich der aristokratische Teil des Ordens
dem Kampf gegen die Ungläubigen widmete, beschäftigte
sich eine Anzahl von Brüdern mit dem religiösen Dienst,
andre mit dem Pilgerschutz und der Pilgerpflege; aber erst bei der
Revision der Statuten in der Mitte des 13. Jahrh. wurden die
Ordensmitglieder förmlich in Ritter, Priester und dienende
Brüder (Waffenknechte und Hausleute) eingeteilt. An der Spitze
des Ordens stand der Großmeister (magister Templariorum), der
fürstlichen Rang hatte, unter ihm die Großprioren,
welche den Provinzen vorstanden, dann die Baillifs, Prioren und
Komture. Der Großmeister hatte zur Seite das Generalkapitel
oder an dessen Stelle den Konvent zu Jerusalem und durfte nur mit
dessen Zustimmung über Krieg und Frieden, Käufe und
Veräußerungen etc. beschließen. In den Provinzen
des Ordens hatten die Vorsteher der einzelnen Landschaften
ähnliche Kapitel zur Seite. Der Orden der T. entsprach am
meisten dem Ideal des Rittertums und genoß deswegen besonders
die Gunst der Großen, weshalb er sich rasch vermehrte und
durch Schenkungen großen Besitz und Vorrechte erwarb. Um 1260
zählte er an 20,000 Ritter und besaß 9000 Komtureien,
Balleien, Tempelhöfe etc. mit liegendem Besitz, der zehntfrei
war. Unter den Nachfolgern Hugos von Payens (gest. 1136) in der
Großmeisterwürde sind hervorzuheben: Bernhard von
Tremelay, der 1153 bei einem Angriff auf Askalon fiel; Odo de
Saint-Amand (gest. 1179), der viel für die Erweiterung der
Macht des Ordens that; Wilhelm von Beaujeu, unter dem Akka, das
letzte Bollwerk der Christen in Palästina, im Mai 1291 in die
Hände der Sarazenen fiel, und Gaudini, unter dem sich der
Orden nach Cypern zurückzog. Schon im 12. Jahrh. waren Klagen
über Anmaßlichkeit, Treulosigkeit und
583
Tempellhof - Tempeltey.
Ausschweifungen der T. laut geworden. Bibere templariter (saufen
wie ein Templer) wurde fast sprichwörtlich gebraucht. Ohne
Rücksicht auf die allgemeinen Interessen verfolgten sie aus
Habgier und Herrschsucht eine nicht selten verderbliche
Sonderpolitik. Oft standen sie mit den Sarazenen im geheimen Bunde,
den Kaiser Friedrich II. wollten sie auf seinem Kreuzzug an
dieselben verraten; mit den Johannitern lebten sie in
beständigem, oft blutigem Streit, und von den Bischöfen
wurden sie, weil deren Aufsicht seit 1162 vom Papst entzogen, ohne
dies gehaßt. Dazu waren die Fürsten schon lange auf dle
Macht des Ordens eifersüchtig. Der Orden gab auch dem Neid und
der Mißgunst aufs neue Nahrung, als er den Kampf gegen die
Ungläubigen aufgab und 1306 unter dem Großmeister Jakob
von Molay nach Paris übersiedelte, um sich anscheinend
müßigem Wohlleben zu ergeben. Hiermit gab er sich in die
Gewalt Philipps IV. von Frankreich, der nach den Schätzen des
Ordens lüstern und wegen der Haltung desselben in seinem
Streit mit Bonifacius VIII. und wegen seiner Unabhängigkeit
gegen ihn erbittert war. Auf Grund der Aussagen zweier
verdächtiger Männer erhob er gegen die T. die Anklage
wegen Verleugnung Christi, Verehrung des Götzenbildes Baphomet
(s. d.), Verspottung des Abendmahls, unnatürlicher Wollust
etc., - Beschuldigungen, welche durch manche Umstände, durch
frivole Äußerungen mancher Templer, durch frühere
Anklagen seitens der Päpste, so 1208 Innocenz' III. u. a.,
unterstützt werden, aber durch unwiderlegliche Zeugnisse noch
nicht bewiesen sind. Namentlich ist die Behauptung von einer
förmlichen ketzerischen Geheimlehre der T. (vgl. Prutz,
Geheimlehre und Geheimstatuten des Tempelherrenordens, Berl. 1879),
wonach sie an einen Doppelgott, den wahren himmlischen und den
andern, der die Freuden der Welt erteile, geglaubt und letztern im
Bild eines aus edlem Metall geformten Menschenkopfs verehrt
hätten, keineswegs unbestritten. Am 13. Okt. 1307 wurden die
T. in Frankreich mit ihrem Großmeister verhaftet.
Gleichzeitig begann die Einziehung ihrer Güter. Man
erpreßte von den Rittern durch die Folter Geständnisse,
die dann als unverwerfliche Beweise der Strafbarkeit aller
Mitglieder angesehen wurden. Nicht bloß die Reichsversammlung
in Tours, auch Papst Clemens V. erklärte die Anklage gegen die
T. für begründet und befahl 12. Aug. 1308 überall
das gerichtliche Einschreiten gegen sie. Der Prozeß dauerte
bis 5. Juni 1311, worauf dann das Konzil von Vienne das Urteil
fällen sollte, aber zu fällen sich weigerte. Noch vor dem
Schluß der Akten ließ Philipp 54 Ritter verbrennen (12.
Mai 1310), denen die Folter kein Geständnis abgezwungen hatte.
Papst Clemens V. hob den Orden durch eine Bulle vom 22. März
1312 auf, ohne jedoch ein Verdammungsurteil zu wagen. Der
Großmeister wurde mit dem 80jährigen Großprior
Guido von der Normandie und mehreren andern Rittern auf einer Insel
der Seine zu Paris 18. März 1313 auf des Königs Befehl,
weil er die auf der Folter erzwungenen Geständnisse
öffentlich zurückgenommen, bei langsamem Feuer verbrannt.
Die Güter der T. wurden in Frankreich, in Kastilien und einem
Teil von England von der Krone eingezogen, in Aragonien und
Portugal aber dem Orden von Calatrava, in Deutschland den
Johannitern und Deutschen Rittern überwiesen. In Portugal
bestand der Orden unter dem Namen Christusorden, in Schottland
unter dem Namen Ritter von der Distel fort. In der Mitte des 18.
Jahrh. bemühten sich die Jesniten, das auftauchende
Freimaurerwesen mit dem alten Templerorden in Verbindung zu
bringen, um den Bund in katholisch-hierarchischem Sinn zu lenken.
So entstand der neue Templerorden in Frankreich, dessen
Haupttendenzen die Bewahrung des ritterlichen Geistes und das
Bekenntnis eines aufgeklärten, in der Zeitphilosophie
wurzelnden Deismus waren, und dem die ersten Personen des Hofs und
der Pariser Gesellschaft beitraten. Nachdem derselbe während
der Revolution sich aufgelöst hatte, sammelte in den letzten
Jahren das Direktorium seine Trümmer wieder, und man suchte
nun dem Bund eine politische Richtung zu geben. Napoleon I.
begünstigte ihn als ein Adelsinstitut. Die Restauration sah
den aufgeklärte Tendenzen verfolgenden Bund zwar mit
argwöhnischen Augen an, doch bestand derselbe fort. Die
Philhellenenvereine fanden in ihm eifrige Teilnehmer. Nach der
Julirevolution trat der Bund sogar in Paris wieder öffentlich
hervor und zwar mit kommunistischen Tendenzen, und seine Mitglieder
nannten sich Chrétiens catholiques primitifs. Seine
Geheimlehre war in einem "Johannisevangelium" zusammengefaßt.
Der Orden erlosch 1837. Vgl. Wilcke, Geschichte des Ordens der T.
(2. Ausg., Halle 1860, 2 Bde.); Michelet, Procès des
Templiers (Par. 1841-51, 2 Bde.); Havemann, Geschichte des Ausgangs
des Tempelherrenordens (Stuttg. 1846); Merzdorf, Geheimstatuten des
Ordens der T. (Halle 1877); Schottmüller, Der Untergang des
Templerordens (Berl. 1887, 2 Bde.); Prutz, Entwickelung und
Untergang des Tempelherrenordens (das. 1888).
Tempelhof, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Potsdam,
Kreis Teltow, südlich bei Berlin, an der Berliner Ringbahn und
mit Berlin durch eine Pferdebahn verbunden, hat eine evang. Kirche,
ein Garnisonlazarett, das Elisabeth-Kinderhospital, eine
Gardetrainkaserne, ein Proviantamt, Elfenbeinbleicherei und (1885)
3522 Einw. Nördlich dabei das Tempelhofer Feld,
Übungsplatz der Berliner Garnison. T. kam 1318 aus dem Besitz
des Templerordens in den der Johanniter; seit 1435 gehörte es
längere Zeit den Städten Berlin-Kölln.
Tempelkolonien, s. Tempelgesellschaft.
Tempeln, sehr einfaches Hasardspiel mit Karte, vom Pharo
im Grund nur durch Weglassung der Lappe, Paroli etc. unterschieden.
13 durch Kreidestriche bezeichnete Felder (für Zwei bis As)
nehmen die Einsätze auf, und der Bankier zieht die Karte ab
wie beim Pharo. Links gewinnt die Bank, rechts verliert sie.
Tempeltey, Eduard, Dichter, geb. 13. Okt. 1832 zu Berlin,
studierte daselbst Philologie und Geschichte, war dann längere
Zeit bei der "Nationalzeitung" beschäftigt und lebt seit 1861
am Hof des Herzogs Ernst von Koburg-Gotha, der ihn zunächst
provisorisch mit der Leitung des Theaters betraute und 1871
definitiv zum Hoftheater-Intendanten ernannte. Seine beiden Dramen:
"Klytämnestra" (Berl. 1857) und "Hie Welf - hie Waiblingen"
(Leipz. 1859), erregten ihrer Zeit großes Aufsehen wegen der
klassischen Formvollendung und verrieten ein bedeutendes
dramatisches Talent; 1882 folgte ein Drama: "Cromwell", das
ebenfalls seinen Weg über die großen deutschen
Bühnen nahm. Außerdem veröffentlichte er einen
Liederkranz: "Mariengarn" (5. Aufl., Leipz. 1866), worin das
Liebesleben in seinen verschiedenen Phasen mit tiefer Empfindung
und in makelloser Form geschildert wird, und eine kleine Schrift:
"Th. Storms Dichtungen" (Kiel 1867). T. war inzwischen zum Geheimen
Kabinettsrat ernannt worden und erhielt 1887 das Prädikat
"Präsident".
584
Tempera - Temple.
Tempera (ital.), eigentlich jede Flüssigkeit, mit
welcher der Maler die trocknen Farben vermischt, um sie mittels des
Pinsels auftragen zu können; dann insbesondere eine im
Mittelalter gebräuchliche Art der Malerei (Temperamalerei),
wobei die Farben mit verdünntem Eigelb und Leim von gekochten
Pergamentschnitzeln vermischt wurden (peinture en détrempe).
Seit Cimabue verdrängte die T. in Italien die altbyzantinische
Manier. In Deutschland malte man mit einer verwandten Technik, bis
die von den van Eycks verbesserte Ölmalerei dieselbe im Lauf
des 15. Jahrh. verdrängte. In Italien hielt sich die T.
teilweise bis um 1500, wo die Ölmalerei auch hier vollkommen
durchdrang.
Temperament (lat.), ursprünglich ein gewisser
spezifischer Wärmegrad (Temperatur) des Körpers. Man
glaubte früher, daß dieser spezifische Wärmegrad
abhängig sei von der Mischung der Säfte, und stellte
daher so viel Temperamente auf, als man Kardinalsäfte des
Körpers (rotes Arterienblut, schwarze Galle, gelbe Galle oder
der Schleim und Lymphe) annahm. Je nach dem Vorherrschen des einen
oder andern Safts im Körper hat der Mensch ein sanguinisches,
melancholisches, cholerisches oder lymphatisches (phlegmatisches)
T. Das sanguinische T. hieß auch das warme, das
melancholische das kalte, das cholerische das trockne, das
phlegmatische auch das feuchte T. Obgleich sich dieser Ideengang
keineswegs auf positive Thatsachen gründen läßt und
als eine zusammenhängende Reihe von Irrtümern erscheint,
so hat sich doch das Wort T. in der Umgangssprache erhalten, weil
man das Bedürfnis fühlte, für gewisse Zustände
und Erscheinungen am Körper, deren Wesen und innere
Bedingungen nicht klar vor uns liegen (wie für andre
unbestimmte Begriffe), ein einfaches Wort zur Hand zu haben. Die
wissenschaftliche Medizin macht in Deutschland wenigstens keinen
Gebrauch mehr von dem Wort und dem Begriff T., wohl aber geschieht
dies noch in Frankreich. Um so mehr findet das Wort T. von seiten
der Laien Verwendung, und man versteht darunter einen gewissen Teil
der Konstitution, nämlich die Stimmung und die Weise der
Thätigkeitsäußerung des Gehirns. Man hat die
Temperamente folgendermaßen charakterisiert. Das
sanguinische, warme T. ist mit Körperfülle, weicher,
zarter Haut, angenehmer frischer Gesichtsfarbe, starker
Füllung der Blutgefäße verbunden. Die
körperlichen wie geistigen Funktionen sind leicht anzuregen;
die Individuen von sanguinischem T. sind reizbar und empfindlich,
meist heiter und fröhlich, aber veränderlich in ihrer
Stimmung. Das melancholische oder sentimentale T. ist
gekennzeichnet durch festen, straffen Körperbau,
größere oder geringere Magerkeit, durch dicke, trockne,
kühle Haut, die mit dunkeln Haaren besetzt ist. In allen
Bewegungen und Handlungen zeigt sich eine gewisse Langsamkeit, die
aber von großer Ausdauer begleitet ist. Die melancholischen
Individuen sind ernst, mehr zu trüber Stimmung geneigt,
verfallen verhältnismäßig oft in
Geisteskrankheiten. Das cholerische oder trockne T. steht zwischen
dem sanguinischen und melancholischen gleichsam in der Mitte. Es
zeichnet sich durch einen leichtern und beweglichern
Körperbau, durch weniger braune und behaarte Haut und eine
lebhaftere Gesichtsfarbe aus, als diese dem melancholischen T.
zukommen. Die cholerischen Individuen sind beweglich, erhalten
leicht ein wildes Aussehen, sind zum Zorn geneigt, zeigen dabei
Stärke und Nachhaltigkeit der Erregungen,
Leidenschaftlichkeit. Die Kennzeichen des phlegmatischen, feuchten
Temperaments sind: ein schlaffer, weicher Körperbau, weiche,
weiße Haut, die wenig Haare zeigt, blondes Kopfhaar,
hervorstehende Augen, gleichgültige Gesichtszüge; die
geistigen und körperlichen Funktionen gehen träge von
statten, geringe und langsame Reaktion gegen geistige Erregungen,
geringe Empfindlichkeit gegen eigne und fremde Leiden; die
phlegmatischen Individuen neigen zu Fettbildung. Man hat diese
Temperamente auch untereinander kombiniert zu einem
melancholisch-phlegmatischen etc. T., womit der Willkür in der
Anwendung dieses ohnehin unbestimmten Begriffs vollkommene Freiheit
gegeben wurde. Auch ein nervöses T. hat man aufgestellt,
welches sich durch Muskelschwäche und große
Nervenreizbarkeit kennzeichnen soll. Man hat auch versucht, den
verschiedenen Temperamenten einen Einfluß auf die Entstehung
gewisser Krankheiten zuzuschreiben.
Temperantia (sc. remedia, lat.), mildernde Arzneimittel,
s. Einhüllende Mittel.
Temperánzgesellschaften (engl. temperance
societies), s. Mäßigkeitsvereine.
Temperatur (lat.), der dem Gesühl und durch das
Thermometer (s. d.) sich kundgebende Erwärmungszustand eines
Körpers; kritische T., s. Gase, S. 930; mittlere T., s.
Lufttemperatur. - In der Musik heißt T. die von der absoluten
akustischen Reinheit abweichende Stimmung der zwölf
Halbtöne einer Oktave, welche es ermöglicht, von jedem
beliebigen Ton als Grundton auszugehen. Es wird dies erreicht,
indem man unter Beibehaltung der Reinheit der Oktave die
übrigen Töne etwas oberhalb oder unterhalb der von der
reinen Stimmung geforderten Höhe "schweben" läßt.
Die T. heißt gleichschwebend, wenn alle Intervalle durch die
ganze Tonleiter einander gleich, ungleichschwebend, wenn sie
voneinander verschieden angenommen werden.
Temperatursinn, s. Tastsinn.
Temperguß, s. v. w. hämmerbares
Gußeisen.
Temperieren (lat.), mäßigen, mildern.
Tempern, s. v. w. Adoucieren.
Tempésta (ital.), Sturm, Seesturm (auch als
Gemälde); tempestoso, stürmisch, ungestüm.
Tempesta, Maler, s. Molyn 2).
Tempête (franz., spr. tangpäht, "Sturm"),
gesellschaftlicher Tanz, an dem viele Paare teilnehmen. Die
Aufstellung geschieht in Reihen zu je zwei Paaren, die sich an die
mittlern wie an die gegenüberstehenden Paare nach beiden
Seiten anschließen. Die mittlern vier Paare beginnen den Tanz
mit Rond, Chassé, Croisé, Balancé und
ähnlichen Touren, die dann nach beiden Seiten der Reihe nach
wiederholt werden. Die ziemlich lebhafte Melodie steht im
Zweivierteltakt und besteht aus mehreren Reprisen von acht
Takten.
Tempieren, den Zünder für Hohlgeschosse auf
eine bestimmte Brennzeit stellen; s. Zündung.
Tempio Pausania, Kreishauptstadt in der ital. Provinz
Sassari (Sardinien), am Nordabhang des Limbaragebirges, bildet mit
Ampurias ein Bistum, hat ein Gymnasium, eine technische Schule, ein
Seminar und (1881) 5452 Einw.
Tempi passati! (ital.), vergangene Zeiten!
Temple, 1) (le Temple, spr. tangpl) ehemals Ordenshaus
der Tempelherren in Paris, in der Revolutionszeit
Staatsgefängnis, in welchem auch Ludwig XVI. und seine Familie
im Winter 1792/93 bis zur Hinrichtung (21. Jan.) gefangen gehalten
wurde. Unter Napoleon III. ward der T. abgebrochen und an dessen
Stelle ein 7500 qm großes Square mit Trödlerhallen
anlegt. Vgl. Curzon, La maison du T. (Par. 1888). - 2) (spr.
tempel) ehemaliges Ordens-
585
Temple - Tenasserim.
haus der Tempelherren in London, welches 1346 den
Rechtsgelehrten überlassen wurde, seither die wichtigste der
sogen. Inns of Court; s. London, S. 900.
Temple (spt. tempel), 1) Sir William, engl. Staatsmann
und Schriftsteller, geb. 1628 zu London, studierte in Cambridge,
ward nach der Restauration 1660 Mitglied der irischen Konvention,
1661 des irischen Parlaments und 1662 zu einem der königlichen
Kommissare desselben ernannt. Seit 1665 englischer Resident in
Brüssel, schloß er 1668 im Haag mit Holland und Schweden
die Trivelallianz und vermittelte dann den Aachener Frieden (2. Mai
1668) zwischen Frankreich und Spanien, worauf er zum ordentlichen
Gesandten im Haag ernannt wurde. 1671 entlassen, lebte er mehrere
Jahre zurückgezogen auf seinem Gut Sheen bei Richmond in
Surrey, ging 1673 abermals als Gesandter nach dem Haag und vertrat
England auf dem Friedenskongreß von Nimwegen. 1679 kehrte er
nach England zurück und trat in den von Karl II. nach Temples
Entwurf organisierten Geheimen Rat sowie für die
Universität Cambridge ins Parlament, zog sich aber, mit der
königlichen Politik unzufrieden, 1682 nach Sheen zurück
und starb 27. Jan. 1699. Seine durch Form und Inhalt
ausgezeichneten "Works" erschienen London 1814 in 4 Bänden.
Swift gab seine "Memoirs" (Lond. 1709, 2 Bde.) und "Letters" (das.
1702, 2 Bde.) heraus. Sein Leben beschrieben Luden (in "Kleine
Aufsätze", Bd. 2, Götting. 1808) und Courtenay (Lond.
1836, 2 Bde.). Vgl. Emerton, Sir W. T. und die Tripelallianz (Berl.
1877).
2) Launcelot, Pseudonym, s. Armstrong 1).
Templeisen, die Ritter des Grals (s. d.).
Templemore (spr. templmóhr), Stadt in der irischen
Grafschaft Tipperary, am Suir lieblich gelegen, mit (l881) 2800
Einw.
Templer, s. v. w. Tempelherren; auch die Mitglieder der
Tempelgesellschaft (s. d.).
Templin, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk
Potsdam, zwischen mehreren Seen, die durch den 13,5 km langen
Templiner Kanal mit der Havel in schiffbarer Verbindung stehen, und
an der Linie Löwenberg-T. der Preußischen Staatsbahn, 67
m ü. M., hat 2 evang. Kirchen, eine Stadtmauer aus Feldsteinen
und 3 Stadtthore aus dem Mittelalter, ein Amtsgericht, ein
Dampfhammerwerk mit Fabrik für landwirtschaftliche Maschinen,
Schiffahrt und (1885) 4028 meist evang. Einwohner.
Tempo (ital., "Zeit"), Zeitmaß, die Bestimmung,
welche im einzelnen Fall die absolute Geltung der Notenwerte
regelt. Vor dem 17. Jahrh. waren die Mittel, ein verschiedenes T.
zu fordern, sehr beschränkt; die Noten hatten aber damals eine
ziemlich bestimmte mittlere Geltung, den "integer valor" (s. d.),
der sich aber doch im Lauf der Jahrhunderte sehr verschob, so
daß man heute bei Übertragungen von Musikwerken des 16.
Jahrh. die Werte wenigstens auf die Hälfte, bei denen des
14.-15. Jahrh. auf den vierten Teil und bei noch ältern auf
den achten Teil reduzieren muß, wenn man ein ungefähr
richtiges Bild gewinnen will. Um 1600 kamen die noch heute
üblichen Bestimmungen Allegro, Adagio, Andante auf, denen sich
bald Presto und die Unterarten: Allegretto, Andantino, Prestissimo
zugesellten. Da sich im Gebrauch dieser Bezeichnungen vielfach
Willkür einschlich, so sann man gegen das Ende des 18. Jahrh.
auf feste, unwandelbare Bestimmungen und gelangte zur Erfindung des
Taktmessers (s. d.). Vielfach sind heute auch Tempobezeichnungen
beliebt, die auf Tonstücke von bestimmtem Charakter der
Bewegungsart hinweisen, so T. di marcia (Marschtempo = Andante), T.
di minuetto (Menuetttempo, etwa = Allegretto), T. di valsa
(Walzertempo = Allegro moderato) u. s. f. Über die kleinen
Modifikationen des T., welche der musikalische Ausdruck bedingt
(agogische Schattierungen), s. Agoge.
Temporal (lat.), zeitlich; weltlich; auf die Schläfe
bezüglich, z. B. arteria temporales, Schläfenschlagader,
muscullis temporalis, Schläfenmuskel, etc.
Temporalien (Bona temporalia, "weltliche Vorteile"), alle
mit der Verwaltung eines bestimmten kirchlichen Amtes verbundenen
Einkünfte an Geld, Naturalien und sonstigen Gefällen, die
materiellen Rechte im Gegensatz zu den mit dem Kirchenamt
verbundenen geistlichen Befugnissen (Spiritualien). Die
Beschlagnahme dieser Einkünfte seitens der Staatsgewalt
heißt Temporaliensperre.
Tempora mutantur et nos mutamur in illis (lat.), die
Zeiten ändern sich, und wir verändern uns in oder mit
ihnen.
Temporär (lat.), zeitweilig, vorübergehend.
Temporäre Sterne, s. Fixsterne, S. 324.
Temporal (franz.), zeitlich, weltlich.
Temporisieren (lat.), sich nach den Zeitumständen
richten; in Erwerbung eines günstigen Zeitpunktes etwas
hinhalten.
Temps, le (spr. tang, "die Zeit"), eine der angesehensten
Pariser Zeitungen, 1861 begründet, hielt sich unter Napoleon
III. zur gemäßigten Opposition und vertritt jetzt den
gemäßigten Republikanismus.
Tempus (lat., Plur. tempora), Zeit; in der Grammatik der
Ausdruck der Zeitbeziehung am Verbum oder in konkreter Bedeutung
eine Gruppe von Verbalformen, die je ein bestimmtes
Zeitverhältnis ausdrücken. S. Verbum.
Temrjuk, Kreisstadt im kubanischen Gebiet in Kaukasien,
am Nordufer der Halbinsel Taman und an dem den Liman Achtanisow mit
der Bucht von T. verbindenden Kanal, mit (1883) 10,496 Einw. 6 km
von der Stadt wird der temrjuksche Mineralschlamm aus fünf
Gruppen kleiner Krater in Zwischenräumen von ½-¼
Minute in großen Massen ausgeworfen, dessen Gebrauch in
Bädern bei Rheumatismen, Skrofeln u. a. sich sehr heilsam
erwiesen hat.
Temuco, Departement der chilen. Provinz Cantion, 4600 qkm
groß mit (1885) l6,111 Einw. Die gleichnamige Hauptstadt hat
3000 Einw.
Temulénz (lat.), Trunkenheit.
Temurdschi, s. Dschengis-Chan.
Tenaille (franz., spr. -náj, "Zange"), ein
Festungswerk, dessen Linien abwechselnd ein- und ausspringende
Winkel bilden. Über die Tenaillensysteme von Landsberg und
Montalembert s. Festung, S. 182. T. ist auch s. v. w. Grabenschere
(s. d.).
Tenakel (lat.), "Halter", Blatthalter der Schriftsetzer;
auch Vorrichtung zur Befestigung von Seihtüchern,
Filtrierbeuteln etc.
Tenancingo, Stadt im mexikan. Staat Mexiko, südlich
von Toiuca, 1840 m ü. M., in reizender, fruchtbarer Gegend, wo
Weizen neben Zuckerrohr gedeiht, hat Weberei von wollenen
Tüchern (Panos) und (1880) 15,906 Einw. (im Munizivium).
Tenant (engl., spr. ténnänt), Pachter oder
Mieter; T.-at-will ("aus freiem Willen"), Mieter, dem nach Belieben
des Eigentümers geendigt werden kann (wogegen der lease-holder
auf die abgemachte Reihe von Jahren im Besitz nicht zu stören
ist, solange er die bedungene Pacht oder Miete zahlt).
Tenasserim (Tanengthari), Regierungsbezirk der
britisch-ind. Provinz Birma, im südlichstem Teil
586
Tenazität - Teneramente.
derselben an der Küste gelegen, 121,026 qkm (1280 QM.)
groß mit (1881) 825,741 Einw. (meist Buddhisten). Das Land
wird durch 1500 m hohe Gebirge von Siam geschieden, ist sonst
fruchtbar, wohlbewässert und zum Reisbau trefflich geeignet.
Der Hauptfluß T. ist für große Boote 53 km
aufwärts bis zu der früher bedeutenden, jetzt zu einem
elenden Dorf herabgesunkenen Stadt T. schiffbar.
Tenazität (lat.), Zähigkeit (vgl. Dehnbarkeit),
hartnäckiges Festhalten an etwas.
Tenbrink-Feuerung, s. Dampfkessel, S. 451, und
Lokomotive, S. 885.
Tenby (spr. tennbi), beliebtes Seebad in Pembrokeshire
(Südwales), mit Ruinen eines normännischen Schlosses,
Ausfuhr von Fischen, Austern und Geflügel und (1881) 4750
Einw.
Tence (spr. tangs), Stadt im franz. Departement
Oberloire, Arrondissement Yssingeaux, am Lignon, mit Hengstedepot,
Fabrikation von Papier, Hüten, Seide, Blonden und Spitzen und
(1881) 1520 Einw.
Tencin (spr. tangssang), Claudine Alexandrine
Guérin, Marquise de, franz. Schriftstellerin, geb. 1681 zu
Grenoble, entfloh 1714 aus dem Kloster nach Paris, gewann dort
durch ihre Schönheit und ihren Geist mächtige Freunde,
mischte sich in Staats-und Liebesintrigen, ging nacheinander mit
d'Argenson, Bolingbroke, dem Regenten, dem Kardinal Dubois u. a.
intime Verbindungen ein und wußte dieselben geschickt zu
ihrem und ihres Bruders (des Kardinals Pierre Guérin de T.,
gest. 1758; vgl. über ihn die biographische Schrift von
Audouy, Lyon 1881) Vorteil zu benutzen. Eins ihrer illegitimen
Kinder, das sie aussetzen ließ, war der berühmte
d'Alembert. Eine bedeutende Rolle spielte sie in den Streitigkeiten
der Jansenisten, deren heftige Gegnerin sie war. Später (1726)
mußte sie auf einige Zeit in die Bastille wandern, als sich
einer ihrer Liebhaber in ihrer Wohnung erschossen hatte. Seitdem
führte sie ein unanstößiges Leben und machte ihren
Salon zum Mittelpunkt der eleganten und gebildeten Gesellschaft.
Sie starb 4. Dez. 1749. Ihre Romane, besonders "Mémoires du
comte de Comminges" (1735, 1885) und "Le siége de Calais"
(1739), tragen ganz das Gepräge des 18. Jahrh. und gleichen
auffallend denen der Mad. de Lafayette, mit deren Schriften die
ihrigen auch zusammen herausgegeben wurden (Par. 1786, 8 Bde.;
1825, 5 Bde.; 1864). Die "Correspondance" mit ihrem Bruder erschien
Paris 1790, 2 Bde.; die "Lettres au duc de Richelieu" daselbst
1806. Vgl. Barthélemy, Mémoires secrets de Madame de
T. (Grenoble 1790).
Tendelti, Name eines Teichs, an welchem Fascher, die
Hauptstadt von Dar Fur, liegt, und nach welchem diese Stadt selbst
bisher auf den Karten bezeichnet wurde. Der Ort liegt 2000 In
ü. M., am Wadi el Ko, war früher Sitz des
ägyptischen Gouverneurs und hat 8000 Einw., welche lebhaften
Handel mit Wadai und Kordofan treiben. Bis 1874 war T. Hauptstadt
des selbständigen Reichs Dar Fur, wurde damals von den
Ägyptern erobert, die in neuester Zeit aber den Anhängern
des Mahdi weichen mußten. Die letztern sollen Dar Fur wieder
an die Anhänger der Snussisekte von Kufra verloren haben.
Tendénz (lat.), Streben in bestimmter Absicht oder
Richtung, auf einen bestimmten Zweck hin; daher Tendenzdichtungen,
solche, die nicht bloß auf die eigentlich poetische Wirkung
berechnet sind, sondern noch andre (politische, religiöse
etc.) Interessen verfolgen; tendenziös, bestimmten Zwecken
gemäß.
Tender (engl.), das einem größern Schiff oder
Geschwader zur Überbringung von Befehlen etc. beigegebene
Begleitschiff; dann der der Lokomotive angehängte Vorratswagen
für Kohlen und Wasser.
Tendo (lat.), Sehne, z. B. T. Achillis.
Achillessehne.
Tendovaginitis (lat.-griech.),
Sehnenscheidenentzündung.
Tendre (franz., spr. tangdr), zart, empfindlich; als
Substantiv s. v. w. Vorliebe, zärtliche Schwäche für
etwas; Tendresse, Zärtlichkeit, zärtliche Zuneigung.
Tendrons (franz., spr. tangdróng), in der
Kochkunst die Brustknorpel vom Kalb und Lamm.
Tenê (Tenneh), Fluß, s. Faleme.
Tenebrae (lat., "Finsternis"), s. Finstermetten.
Tenebrio, Mehlkäfer.
Tenebrionen (Schwarzkäfer, Melasoma Latr.,
Tenebrionidae Leach), Käferfamilie aus der Gruppe der
Heteromeren, düster, gewöhnlich ganz schwarz
gefärbte Käfer mit fünfgliederigen Tarsen an den
Vorder- und Mittel- und viergliederigen an den Hinterbeinen,
kurzem, kräftigem Oberkiefer, quer gestellten, vorn
ausgebuchteten Augen, elf-, selten zehngliederigen Fühlern,
sehr häufig verkümmerten Hinterflügeln und dann
verwachsenen Flügeldecken. Die sehr übereinstimmend
geformten Larven sind langgestreckt, schmal, etwas
niedergedrückt, ganz hornig, mit sechs fünfgliederigen
Beinen, viergliederigen Fühlern, einer Lade am Unterkiefer und
am letzten Hinterleibssegment meist mit zwei Hornfortsätzen
versehen. Viele T. sondern aus ihren Körperbedeckungen ein
Sekret ab, welches sie wie bereift oder behaucht erscheinen
läßt; auch entwickeln die meisten einen starken
widerlichen Geruch. Die metallisch oder lichter gefärbten
Arten sind am Tag an Pflanzen zu treffen; die dunkeln sind meist
lichtscheu, träge und halten sich am Tag an dunkeln Orten auf.
Man unterscheidet gegen 400 Gattungen, deren Artenzahl derjenigen
der Laufkäfer fast gleichkommt. Die sehr artenreiche Gattung
Blaps Fab. umfaßt zahlreiche, besonders in Südeuropa und
Nordasien heimische, große Käfer mit länglichem
Körper, ohne Flügel, die Männchen mit
zapfenförmig ausgezogenen Flügeldecken. Der gemeine
Trauerkäfer (Totenkäfer, Blaps mortisaga L., s. Tafel
"Käfer"), 20-25 mm lang, mattschwarz, fein und zerstreut
punktiert, mit fast quadratischem Halsschild, hinter der Mitte
schwach erweiterten, lang geschwänzten und undeutlich
gestreiften Flügeldecken, ist häufig in Häusern,
besonders in Kellern, und nährt sich von allerlei Unrat. Zu
derselben Familie gehört der Mehlkäfer (s. d.).
Tenedos, griech. Insel im Ägeischen Meer, an der
Küste der alten Landschaft Troas, war berühmt im Altertum
wegen der Rolle, welche sie im Trojanischen Krieg spielte, sowie
durch ihre Töpferwaren und ihren Wein. Sie stand abwechselnd
unter der Herrschaft der Perser, Athener und Römer. Jetzt
Tenedo oder Bosdscha Ada genannt, gehört sie zum
türkischen Wilajet Dschesair und bildet den Schlüssel zu
der Dardanellenstraße. Die Insel ist 13 km lang, 3-6 km breit
und ziemlich gebirgig, liefert trefflichen Muskatwein und
rötlichen Marmor und hat gegen 7000 Einw. Die Stadt Tenedo,
auf der Nordostküste, ist Sitz eines Kaimakams und eines
griechischen Bischofs, hat einen Hafen, eine Citadelle und 2000
Einw. (drei Viertel Griechen). Am 21. März 1807 erfochten hier
die Russen unter Siniavin über Seid Ali Pascha und 10. Nov.
1822 die Ipsarioten Kanaris und Kyriakos einen Seesieg über
den Kapudan-Pascha.
Teneramente (ital.), zart.
587
Tenerani - Teniers.
Tenerani, Pietro, ital. Bildhauer, geb. 11. Nov. 1789 zu
Torano bei Carrara, bildete sich in Rom bei Canova und später
bei Thorwaldsen, der ihm die Hauptfiguren des Grabmals des Prinzen
Eugen zur Ausführung übertrug. Schon Teneranis erste
Werke: Psyche mit der Büchse der Pandora, dann Amor, der Venus
einen Dorn ausziehend, erwarben ihm zahlreiche Aufträge. Er
ward zum Professor der Akademie von San Luca ernannt, an welcher
Anstalt er bis zu seinem Tod mit größtem Erfolg wirkte.
1860 wurde er Generaldirektor der römischen Museen und
Galerien. Er starb 14. Dez. 1869. T. schuf eine große Zahl
von Gruppen, Einzelstatuen und Porträtbüsten, Werke, die
sich alle durch Schönheit und Weichheit der Form und
vortreffliche, gewöhnlich nur allzu glatte Ausführung
auszeichnen. Ein von ihm modellierter Christus am Kreuz ward 1823
für die Kirche San Stefano zu Pisa in Silber getrieben. Seine
vorzüglichsten Werke sind das 1842 vollendete Marmorrelief der
Kreuzabnahme in der Kapelle Torlonia im Lateran, das Relief
für das Grabmal der Herzogin von Lante und das christliche
Liebespaar, den Märtyrertod erleidend.
Teneriffa (Tenerife), die größte, reichste und
bevölkertste der Kanarischen Inseln, an der Nordküste
Afrikas zwischen Canaria, Gomera und Palma gelegen, 2026 qkm (41,4
QM.) groß mit (1877) 105,052 Einw. Die Küsten, fast ohne
Buchten, fallen steil zum Meer ab und bilden viele Vorgebirge. Der
Boden ist, außer im NO., trefflich bewässert und
äußerst fruchtbar. Den Strand schmücken Dattel- u.
Kokospalmen, höher hinauf wachsen Bananen, Drachenbäume
und Pisang; die Abhänge der Höhen sind mit Reben
bepflanzt, welche den vorzüglichen Kanariensekt liefern. Im
südlichen Teil der Insel erhebt sich in gewaltiger
Großartigkeit der berühmte Pik von T. (Pico de Teyde) zu
3715 m Höhe, so daß er zuzeiten auf 300 km Entfernung
gesehen wird. Ein Ausbruch dieses Vulkans von der Spitze aus ist
nicht bekannt, wiewohl ein Krater vorhanden ist; dagegen haben seit
1385 wiederholte Ausbrüche an den Seiten stattgefunden, von
welchen der vom 5. Mai 1706 die Stadt Guarachico zerstörte.
Der letzte Ausbruch ereignete sich 1798. Am Fuß zeigt der
Berg eine reiche Vegetation, höher hinauf nur Gestrüppe
und Pfriemkräuter und ganz oben nur Lava, Bimsstein und
vulkanische Asche. In seinem obern Teil enthält er die sogen.
Eishöhle (Cueva del yelo) und Spalten (narizes), aus denen
heiße Dämpfe hervordringen. Die Spitze bildet der auf
einem Felsenwall sich ungefähr noch um 300 m erhebende Piton
(Pan de azucar, "Zuckerhut"), der vom November bis April eine
Schneedecke trägt. Die Besteigung des Bergs geschieht
gewöhnlich von Orotava (s. d.) aus, tn dessen Nähe auch
der berühmte ungeheure Drachenbaum stand, dessen Alter von A.
v. Humboldt auf 6000 Jahre geschätzt ward. Das Klima von T.
ist mild und gesund. Hauptstadt ist Santa Cruz. Vgl. Schacht,
Madeira und Tenerife mit ihrer Vegetation (Berl. 1859); Fritsch und
Reiß, Geologische Beschreibung der Insel Tenerife (Winterthur
1868); Stone, Tenerife and its six satellites (Lond. 1887, 2 Bde.),
und die Litteratur bei Art. Kanarische Inseln.
Tenes (Tennes), Sohn des Kyknos (s. d.).
Tenésmus (griech.), s. Stuhlzwang.
Teng ("Korb"), in Birma Getreidemaß, enthält
von geschältem Reis 26,49 kg; als Raummaß ungefähr
8 alte englische Weingallons.
Tenga, Münze in Mittelasien, à 40-44 Pul =
0,567-0,60 Mk. Vgl. Tilla.
Teniers (spr. tenjeh), 1) David, der ältere,
niederländ. Maler, geb. 1582 zu Antwerpen, war Schüler
seines ältern Bruders, Julian, bildete sich dann in Rom bei A.
Elsheimer weiter und wurde 1606 als Freimeister in die Lukasgilde
zu Antwerpen aufgenommen, wo er 29. Juli 1649 starb. Nachdem er
anfangs große Kirchenbilder von trockner Färbung gemalt,
wandte er sich später der Landschaft, dem phantastischen und
bäuerlichen Genre zu, demselben Gebiet, welches sein
berühmterer Sohn behandelte. Die Bilder des Vaters
unterscheiden sich von denen des Sohns durch eine härtere und
trocknere Behandlung und spitzigere Pinselführung bei minder
geistvoller Charakteristik. Hervorzuheben sind: der Auszug der
Hexen (im Museum zu Douai), die zechenden Bauern vor der
Dorfschenke (in der Galerie zu Darmstadt), die Versuchung des heil.
Antonius (in den Galerien zu Berlin und Schwerin), acht
Landschaften mit biblischer und mythologischer Staffage (in der
kaiserlichen Galerie zu Wien) und eine Berglandschaft mit einem
Schloß (im Museum zu Braunschweig).
2) David, der jüngere, Sohn des vorigen, Maler, geboren im
Dezember 1610 zu Antwerpen, war anfangs Schüler seines Vaters
und bildete sich dann unter den Einflüssen von Rubens und
Brouwer weiter. 1633 wurde er in die Lukasgilde zu Antwerpen
aufgenommen und um 1650 als Hofmaler nach Brüssel berufen, wo
er 25. April 1690 starb. T. ist der fruchtbarste der
vlämischen Bauernmaler, der sich jedoch von seinen
Kunstgenossen durch eine maßvollere, minder derbe und
ausgelassene Auffassung der bäuerlichen Vergnügungen
unterschied. Seine Bilder sind durch gemütlichen Humor, eine
reiche, wohldurchdachte Komposition, eine leuchtende, frische,
bisweilen an das Bunte streifende Färbung, durch geistreiche
Charakteristik und frische Lebendigkeit der Darstellung
ausgezeichnet. Außer Bauerntänzen, Dorfkirmessen,
Schlägereien und Wirtshausszenen malte er genrehaft
aufgefaßte Szenen aus der Bibel, phantastische Szenen, wie
die Versuchung des heil. Antonius, Alchimisten in ihren
Laboratorien, Wachtstuben mit Soldaten, das Thun und Treiben der
Menschen parodierende Tierstücke (Affen, Katzen etc.),
Landschaften mit Figuren u. dgl. m. Anfangs in einem
kräftigen, bräunlichen Ton malend, eignete er sich in
seiner besten Zeit einen warmen Goldton an, an dessen Stelle seit
etwa 1650 ein feiner Silberton trat. Er hat etwa 800 Bilder
hinterlassen, von denen wir zur Charakteristik seines Stoffsgebiets
die folgenden hervorheben: ein Alchimist, die Puffspieler, der
Künstler mit seiner Familie, Versuchung des heil. Antonius,
vlämische Kirmes und die Marter der Reichen im Fegefeuer (im
Berliner Museum), die Kirmes im Halbmond, die Rauchgesellschaft,
die Würfler, die Befreiung Petri aus dem Gefängnis und
der Zahnarzt (in der Galerie zu Dresden), die Bauernküche (in
den Uffizien zu Florenz), eine Wachtstube, eine
Schützengesellschaft vor dem Rathaus zu Antwerpen, das
Wirtshaus zum Engel, ein Raucher und ein Hochzeitsmahl (in der
Eremitage zu St. Petersburg), die Tricktrackspieler, die
Belustigung im Wirtshanshof, zwölf Bilder aus Tassos
"Befreitem Jerusalem" und Affen- und Katzenszenen (im Museum zu
Madrid), der verlorne Sohn unter den Dirnen, die Verleugnung Petri,
die Reiherjagd des Erzherzogs Leopold Wilhelm und der Raucher (im
Louvre zu Paris), der Tanz in der Wirtsstube und eine
Bauernhochzeit (in der Münchener Pinakothek), eine
Räuberszene, das Brüsseler Vogelschießen und
Abrahams Dankopfer (in der kaiserlichen Galerie zu Wien), dle
Ausstellung Christi
588
Teniet - Tenngler.
und zwei feierliche Einzüge der Erzherzogin Isabella (in
der Kasseler Galerie). T. war Direktor der Gemäldegalerie des
Erzherzogs Leopold Wilhelm, die 1657 nach Wien kam, und hat
mehrfach das Innere derselben mit getreuer Nachbildung des Stils
der einzelnen Bilder gemalt (Darstellungen dieser Art in
Brüssel, München und Wien). Er hat auch radiert. - Sein
Bruder Abraham T. (1629-70) hat Bauern-und Tierszenen in
ähnlicher Art gemalt.
Teniet (arab.), s. v. w. Übergang, Paß.
Tenimberinseln, zur niederländ. Residentschaft
Amboina gehörende Inselgruppe des Indischen Archipels,
zwischen den Kleinen Sundainseln und Neuguinea, enthält als
Hauptbestandteil die große bergige und waldige Insel
Timorlaut ("Nordost"), die durch die Egeronstraße in eine
Nord- und eine Südhälfte getrennt wird und von
zahlreichen kleinen Inseln (Larat, Vordate, Malu etc.) umgeben ist.
Das Areal beträgt 5782 qkm (105 QM.) mit 25,000 Einw.
Tenkitten, Dorf im preuß. Regierungsbezirk
Königsberg, Kreis Fischhausen, an der Ostsee, hat (1885) 78
Einw. und ist bekannt durch den Märtyrertod des Bischofs
Adalbert von Prag 997. Zum Gedächtnis ist daselbst ein 8 m
hohes Kreuz errichtet.
Tenkterer (Tenchterer), german. Völkerschaft, die
auf dem rechten Rheinufer zwischen Lahn und Wipper wohnte. Sie
waren berühmt als ausgezeichnete Reiter. Sie vereinigten sich
59 v. Chr. mit den Usipetern, gewannen Sitze am Niederrhein im
Gebiet der Menapier, überschritten im Winter 56-55 den Rhein,
wurden aber 55 in der Nähe von Nimwegen von Cäsar fast
vernichtet. 69-70 n. Chr. nahmen die T. am Aufstand des Claudius
Civilis teil.
Tenn., Abkürzung für Tennessee (Staat).
Tennantit, s. v. w. Arsenfahlerz, s. Fahlerz.
Tenne, s. Scheune.
Tenneberg, Amtsgericht, s. Waltershausen.
Tennemann, Wilhelm Gottlieb, Geschichtschreiber der
Philosophie, geb. 7. Dez. 1761 zu Kleinbrembach bei Weimar,
studierte in Erfurt und Jena Kantsche Philosophie, habilitierte
sich 1788 an letzterer Universität, folgte 1804 einem Ruf nach
Marburg, wo er 30. Sept. 1819 starb. Sein Hauptwerk ist die nicht
ganz vollendete (in Kants Geist abgefaßte, bis auf Thomasius
reichende) "Geschichte der Philosophie" (Leipz. 1798-1819, 11
Bde.), woraus der "Grundriß der Geschichte der Philosophie"
(das. 1812; 5. Aufl. von Wendt, 1828) ein Auszug ist.
Tennessee (spr. -ssih), Fluß in den Vereinigten
Staaten von Nordamerika, entspringt als Holston in den Iron
Mountains von Westvirginia, nimmt den von den Black Mountains in
Nordcarolina kommenden Frenchroad River auf, tritt unterhalb
Chattanooga vom Staate Tennessee nach Alabama über und
mündet schließlich, einen weiten Bogen durch Tennessee
nach N. beschreibend, bei Paducah (in Kentucky) in den Ohio.
Dampfer befahren ihn 440 km aufwärts bis Florence in Alabama,
wo er die Stromschnelle der Muscle Shells bildet. Oberhalb ist er
noch 500 km weit schiffbar. Sein gesamter Lauf ist 1600 km
lang.
Tennessee (spr. -ssih, abgekürzt Tenn.), einer der
Vereinigten Staaten von Nordamerika, grenzt gegen N. an Kentucky
und Virginia, gegen O. an Nordcarolina, gegen S. an Georgia,
Alabama und Mississippi, gegen W. an Arkansas und Missouri. Der
Osten von T. ist ein Gebirgsland, gebildet von Parallelzügen
der Appalachischen Gebirge, die im Clingman's Dome (2080 m)
kulminieren, und zwischen welchen sich die teilweise sehr
fruchtbaren Thäler des obern Tennessee und seiner
Nebenflüsse ausdehnen. Das mittlere T. ist wellenförmig
und vorzüglich zum Ackerbau geeignet, der westliche Teil fast
durchgehend eben, mit ausgedehnten Strecken Alluviallandes, auf
welchem Baumwolle und Tabak gut gedeihen. Der Mississippi bildet
die Westgrenze, und der bedeutendste Fluß des Staats ist der
ihm indes nur teilweise angehörende Tennessee; er sowie der
Cumberland münden in den Ohio. Das Klima ist
verhältnismäßig sehr mild und angenehm. T. hat ein
Areal von 108,905 qkm (1977,8 QM.) mit (1880) 1,542,329 Einw.,
worunter 103,151 Farbige. Die öffentlichen Schulen wurden 1886
von 383,507 Kindern besucht; 27 Proz. der über zehn Jahre
alten Weißen und 71 Proz. der Neger können nicht lesen.
An höhern Bildungsanstalten bestehen 18 Universitäten und
Colleges. Die Landwirtschaft beschäftigt 66, die Industrie nur
8 Proz. der Bevölkerung. 3,440,000 Hektar waren 1880
landwirtschaftlich verwertet. Neben Mais, Weizen, Hafer, Bataten
und Kartoffeln baut man namentlich Tabak (1880: 29 Mill. Pfd.) und
Baumwolle (33,621 Ballen). An Vieh zählte man 1880: 266,000
Pferde, 173,000 Maultiere, 783,000 Rinder, 673,000 Schafe und
2,160,000 Schweine. Der Bergbau befaßt sich mit
Förderung von Steinkohlen (1886: 1,700,000 Ton.), Eisenerz
(199,166 T. Roheisen), Zinkerz (1880: 3699 T.), Bleierz (60 T.),
Kupfer (1370 Ztr.) und Gold (1998 Doll.). Die 4326 gewerblichen
Anstalten beschäftigten 1880: 22,446 Arbeiter. Am wichtigsten
sind die Getreidemühlen, Sägemühlen, Eisen- und
Stahlwerke (3077 Arbeiter), Wagenbauwerkstätten,
Gießereien u. Lederfabriken. Auch die Baumrvoll- und
Wollefabrikation (zusammen 1480 Arbeiter) fängt an von
Bedeutung zu werden. An Eisenbahnen hat der Staat 1887: 4520 km.
Die gegenwärtige Verfassung ist die 26. März 1870
angenommene, nach welcher alle männlichen, über 21 Jahre
alten Einwohner, ohne Unterschied der Farbe, das Stimmrecht haben.
Die General Assembly besteht aus einem Senat von 33 und einem
Repräsentantenhaus von 66 Mitgliedern, welche alle zwei Jahre
neu gewählt werden. Die fünf Richter des Obergerichts
sowohl als die Richter der Kreisgerichte werden vom Volk auf acht
Jahre gewählt. Die Finanzen waren bis zum Ausbruch des
Bürgerkriegs in gutem Zustand, aber infolge desselben und der
darauf eingetretenen Anarchie war die Staatsschuld 1874 auf 24
Mill. Doll. angewachsen. Man fundierte dieselbe 1883 auf die
Hälfte, so daß dieselbe 1888 nur 18 Mill. Doll. betrug,
und hat überhaupt erfolgreiche Anstrengungen gemacht,
geordnete Zustände herbeizuführen. Die politische
Hauptstadt ist Nashville. - Das Gebiet des Staats T. war
ursprünglich in den 1664 von Karl II. für Nordcarolina
erteilten Freibrief mit eingeschlossen, doch fanden bis 1757 keine
Ansiedelungen jenseit der Alleghanies statt. 1790 trat Nordcarolina
das Gebiet an die Bundesregierung ab, welche eine
Territorialregierung daselbst errichtete. 1796 wurde T. als Staat
in die Union aufgenommen. Nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs
1862 erklärte sich T. nur vorübergehend und teilweise
für die konföderierten Staaten, war aber 1862 und 1863
mehrfach der Schauplatz blutiger Kämpfe. Vgl. Phelan, History
of T. (Boston 1888).
Tenngler, Ulrich, deutscher Jurist, geboren um die Mitte
des 15. Jahrh. zu Haidenheim bei Nördlingen, bekleidete
1479-83 das Amt eines Stadtschreibers zu Nördlingen und war
dann bis zu seinem 1510 oder 1511 erfolgten Tod Landvogt in
Höchstädt. Er versaßte den sogen. "Layenspiegel"
(Augsb. 1509 u. öfter, seit 1516 häufig mit dem von
Seba-
589
Tennis - Tenorino.
stian Brant herausgegebenen "Klagspiegel" gedruckt), eine
systematische Realencyklopädie der populären Jurisprudenz
für die Praxis, welche länger als ein halbes Jahrhundert
die deutsche Rechtsprechung beherrschte und am nachhaltigsten
für die Einbürgerung der fremden Rechte gewirkt hat.
Tennis, Ballspiel, s. Lawn Tennis.
Tennstedt, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Erfurt,
Kreis Langensalza, hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, ein
Schwefelbad, eine Papierfabrik, eine Dampfbierbrauerei und (1885)
2952 evang. Einwohner. Vgl. Roßbach, Das Schwefelbad T. (Erf.
1880).
Tennyson (spr. tennis'n), Alfred, engl. Dichter, geb. 6.
Aug. 1809 zu Somerby in Lincolnshire als der Sohn eines
Geistlichen, studierte zu Cambridge und gab bereits 1827 anonym mit
seinem Bruder Charles die "Poems of two brothers", dann 1830 die
Sammlung "Poems, chiefly lyrical" heraus, die aber wenig Beifall
fand, obschon in Einzelheiten, wie in "Mariana, recollections of
the Arabian nights" und "Claribel", poetischer Genius nicht zu
verkennen war. Auch ein zweiter Band Gedichte (1833) erfuhr von der
Kritik ziemlich unfreundliche Behandlung. Erst mit den zwei
Bänden "Poems", die 1842 erschienen, viele Auflagen erlebten
und zum Teil Überarbeirungen früherer Poesien, zum Teil
Neues enthielten, hatte T. Erfolg, und verschiedene darunter, wie
"Morte d'Arthur", "Godiva" (deutsch von Feldmann, 2. Aufl., Hamb.
1872), "The May Queen", "The gardener's daughter", gehören zu
den schönsten Schöpfungen Tennysons. Insbesondere ist
"Locksley Hall" (deutsch von Freiligrath) durch Tiefe und
Großartigkeit ausgezeichnet. Tennysons nächstes Werk:
"The princess, a medley" (1847), das reizende lyrische Bestandteile
hat, erzählt von einem Prinzen und einer Prinzessin, die nach
dem Willen der Eltern einander heiraten sollen, ohne sich gesehen
zu haben, und ist halb realistisch, halb phantastisch gehalten.
1850 gab er einen Band Gedichte unter dem Titel: "In memoriam"
(deutsch von Waldmüller, 4. Aufl. 1879) heraus, welche, dem
Andenken an einen verstorbenen Freund (Arthur Hallam, den Sohn des
Historikers) gewidmet, das Seelenleben des Dichters und die
Weichheit seines Gemüts entfalten. Neuen Beifall erwarb der
inzwischen (1851) zum Poet laureate ernannte Dichter mit der "Ode
on the death of the duke of Wellington" (1852), der Dichtung
"Maude" (1855, darin die gewaltige "Charge of the light brigade"),
namentlich aber mit den "Idylls of the king" (1858; deutsch von
Feldmann, 2. Aufl., Hamb. 1872), einem auf den sagenhaften
Britenkönig Arthur bezüglichen Romanzencyklus, der eine
Ergänzung fand durch die Bände: "The Holy Grail" (1869),
"Tristam and Iseult" (1871), "Gareth and Lynette" und "The last
tournament" (1872), welch letztere aber in der Lesewelt nicht mehr
den Anteil erweckten, dessen die frühern Stücke sich
erfreuten. Diese in fünffüßigen Jamben
geschriebenen Idylle bilden ein großes Ganze. Zwischen das
Erscheinen der Arthur-Idyllen fallen die Dichtungen: "Enoch Arden"
(1864) und "The Window, or the songs of the Wren" (1870).
Später versuchte er sich auch im Drama mit "Queen Mary" (1875)
und "Harold" (1876; deutsch vom Grafen Wickenburg, Hamb. 1880),
"The Falcon" (1879), "The Cup" (1881), "The promise of May" (1882)
und "Beckett" (1884). Weitere Veröffentlichungen Tennysons
sind: "The lover's tale" (1879), worin er auf Jugenderzeugnisse
zurückgreift, um sich unberechtigter Publikation durch Dritte
zu erwehren; "Ballads and other poems" (1880); die poetische
Erzählung "Tiresias" (1885) und "Locksley Hall, sixty years
after" (1886; deutsch, Gotha 1888). Tennysons poetische Richtung
ist vorwiegend kontemplativ, weniger aufs Erhabene gerichtet;
meisterhaft sind seine Schilderungen des Natur- und Seelenlebens.
Die Universität Cambridge hat T., der seit 1869 auf einem
Landsitz in der Nähe von Petersfield in Hampshire lebt, durch
Aufstellung seiner Büste in der Bibliothek der Trinity Hall
geehrt, Oxford durch Verleihung des Doktorgrades; 1884 wurde er von
der Königin als Baron T. von Altworth zum Peer ernannt. Seine
gesammelten Werke: "Poetical works", erschienen zuletzt 1886 in 10
Bänden, die "Dramatic works" 1887 in 4 Bänden.
Ausgewählte Dichtungen von T. in deutscher Übersetzung
gaben Freiligrath (in "Englische Gedichte aus neuerer Zeit",
Stuttg. 1846), Hertzberg (Dess. 1854) und Strodtmann (Hildburgh.
1867) heraus. Letztere Ausgabe enthält auch das ungemein
beliebte Gedicht "Enoch Arden", welches außerdem noch von R.
Waldmüller (30. Aufl., Hamb. 1888) u. a. übersetzt ward.
Vgl. Wace, Alfred T. (Lond. 1881).
Tenor (lat.), der ununterbrochene Lauf einer Sache;
Haltung, Inhalt (eines Aktenstücks, eines Gesetzes etc.). Uno
tenore, in einem fort.
Tenor (ital. Tenore, franz. Taille), die hohe
Mannerstimme, die sich jedoch von der tiefern (dem Baß) nicht
wie der Sopran vom Alt durch das Überwiegen eines hohen
Registers über ein tiefes unterscheidet; die sogen. Kopfstimme
kommt bei Männerstimmen nur ausnahmsweise und als Surrogat zur
Verwendung, die eigentlichen vollen Töne des
Männergesangs vom tiefsten Baß bis zum höchsten T.
werden durch dieselbe Funktion der Stimmbänder erzeugt wie die
sogen. Brusttöne der Frauenstimmen (vgl. Register). Man
unterscheidet zwei Hauptgattuugen von Tenorstimmen, sogen. lyrische
und Heldentenöre. Der Heldentenor entspricht etwa dem
Mezzosopran, d. h. er hat nur einen mäßigen Umfang (vom
klein c-b'), zeichnet sich durch eine kräftige Mittellage und
ein baritonartiges Timbre aus; der lyrische T. hat ein viel
helleres, fast an den Sopran gemahnendes Timbre und in der Regel
eine kraftlosere Tiefe, dafür aber nach der Höhe einen
ausgiebigern Umfang (c'', cis''). - T. heißt auch der Part in
Vokal-und Instrumentalkompositionen, welcher für die
Tenorstimme bestimmt ist, resp. ihr der Höhenlage nach
entspricht; auch Instrumente, welche diesen Umfang haben,
heißen Tenorinstrumente, so die Tenorposaune, das Tenorhorn,
früher die Tenorviola etc. - Der Name T. (eigentlich s. v. w.
fortlaufender Faden) wurde zuerst im 12. Jahrh., als der Diskantus
aufkam, der dem Gregorianischen Gesang entnommenen Hauptmelodie
beigelegt, gegen welche eine höhere diskantierte (abweichend
sang); so wurde T. der Name der normalen Mittelstimme und Diskantus
der der hohen Gegenstimme. Später gesellte sich als
Stütze (basis) der Baß und als weitere Füllstimme
der contratenor (Gegentenor), welcher auch alta vox, altus (hohe
Stimme) genannt wurde, während der Diskant dann zum supremus,
soprano (der "höchste") wurde.
Tenorhorn (ital. Corno cromatico), tubaartiges
Messinginstrument mit dem Umfang vom großen As bis zum
zweigestrichenen c, hauptsächlich bei Militärmusik
gebräuchlich.
Tenorino (ital., "kleiner Tenor"), Bezeichnung der
facettierenden Tenore (spanischen Falsettisten), welche vor
Zulassung der Kastraten (s. d.) die Knabenftimmen in der
Sixtinischen Kapelle und anderweit vertraten. Später nannte
man sie im Gegenssatz
590
Tenorist - Teplitz.
zu den auf widernatürliche Weise konservierten Sopranisten
und Altisten Alti naturali (vgl. Alt).
Tenorist, Tenorsänger (s. Tenor).
Tenorit, s. v. w. Schwarzkupfererz, s.
Kupferschwärze.
Tenorschlüssel, der c'-Schlüssel auf der
vierten Linie, welche dadurch Sitz des c' wird:
[Siehe Graphik]
gleich:
[Siehe Graphik]
Tenos, Insel, s. Tinos.
Tenotomie (griech.), Sehnendurchschneidung (s. d.).
Tension (lat.), Spannung der Gase und Dämpfe.
Tentacuiites, s. Schnecken, S. 573.
Tentakeln (Fühlfäden), s. Fühler.
Tentakulitenschiefer, s. Silurische Formation.
Tentamen (lat.), s. v. w. Examen, jedoch gewöhnlich
eine nur vorläufige, minder eingehende Prüfung, die als
solche hier und da dem eigentlichen Examen vorausgeschickt zu
werden pflegt.
Tente d'abri (franz., spr. tangt dabrih, "Schutzzelt"),
das im franz. Heer bisher gebräuchliche Lagerzelt für 2
Mann, 1878 für Europa abgeschafft.
Tenthredinidae, Familie aus der Ordnung der
Hautflügler, s. Blattwespen.
Tentyris, alte ägypt. Stadt, s. Dendrah.
Tenue (franz., spr. t'nüh), Haltung, Führung;
Kleidung; en (grande) t., im Paradeanzug, in Gala; petite t.,
Dienst-, Interimsuniform.
Tenuirostres, s. Dünnschnäbler.
Tenuis (lat.), alte Bezeichnung der tonlosen Konsonanten
p, t, k. Vgl. Media.
Tennität (lat.), Dünnheit;
Geringfügigkeit.
Tenuta (ital.), Landgut, Gehöft.
Tenuto (ital., abgek. ten., "ausgehalten"), musikalische
Vortragsbezeichnung besonders in Verbindung mit einem dynamischen
Zeichen, z. B. f ten., in gleicher Stärke ausgehalten (nicht
diminuendo), gilt stets nur für einen Ton oder Akkord.
Tenzone (ital.), Wett- oder Streitgesang; bei den
Provençalen eine Art poetischer Witzspiele (s.
Provençalische Sprache und Litteratur, S. 425). Vgl. Zenker,
Die provenzalische T. (Leipz. 1888).
Teokalli, die Tempelbauten der alten Mexikaner, s.
Amerikanische Altertümer, S. 482.
Teong, Längenmaß in Birma, = 0,485 m.
Teos, im Altertum ionische Stadt an der Küste von
Lydien in Kleinasien, nordwestlich von Ephesos, mit berühmtem
Dionysostempel, war Geburtsort des Anakreon (des "teischen
Sängers") und trieb bedeutenden Handel bis nach Ägypten.
Ruinen beim heutigen Sighadschik.
Teotihuacan (San Juan de T.), Indianerortschaft, 50 km
nordöstlich von Mexiko, mit zwei 55 m hohen und zahlreichen
kleinern Opferpyramiden und (1880) 4028 Einw. (im Munizipium).
Tepe (türk.), Spitze, Anhöhe.
Tepejilote, s. Chamaedorea.
Tepekermen, Berg auf der Halbinsel Krim, unweit
Baktschisarai, erhebt sich in Gestalt eines einzeln stehenden
Kegels, auf dessen kahlem Gipfel Überreste alter Bauwerte
sichtbar und etwas niedriger auf einer nach N. gerichteten
Böschung einige Reihen Höhlen sind, zu denen der Zugang
sehr schwierig ist. In einer derselben hat man viele Knochen, in
einer andern Spuren einer Kirche entdeckt.
Tepeleni, heruntergekommenes Städtchen im türk.
Wilajet Janina, links an der Viosa unterhalb Argyrokastrons,
bekannt als Geburtsort und Lieblingsaufenthalt Ali Paschas von
Janina, dessen dortiger prächtiger Palast heute in Ruinen
liegt, mit 600 Einw.
Tephrite, Eruptivgesteine, in welchen die eisenfreien
thonerdereichen Mineralien aus Plagioktas und Leucit oder Nephelin
bestehen, welchen sich vorwiegend Augit zugesellt.
Tepic, Stadt im mexikan. Staat Jalisco, 50 km von San
Blas, 880 m ü. M., in fruchtbarem Thal, wo Kaffee, Zuckerrohr
und Baumwolle gedeihen, hat (1880) 24,788 Einw. (im Munizipium),
die von den 56 in der Nähe liegenden Bergwerken abhängen.
T. ist Sitz eines deutschen Konsuls.
Tepidarium (lat.), in den altrömischen Bädern
das Zimmer für lauwarme Bäder (s. Bad, S. 222); auch
Räumlichkeit mit lauer Temperatur (5-9° R.), besonders
für Gewächse (s. Gewächshäuser).
Tepl, Stadt in Böhmen, am gleichnamigen Fluß,
welcher unweit südlich entspringt und unterhalb Karlsbad in
die Eger mündet, ist Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und
eines Bezirksgerichts, hat eine Dechanteikirche, Bierbrauerei und
(1880) 2733 Einw. Dabei das 1l93 gegründete reiche
Prämonstratenserstift T. mit Kirche, Bibliothek (60,000
Bände), Archiv und theologischer Lehranstalt.
Teplitz (Töplitz), 1) Stadt und berühmter
Kurort im nördlichen Böhmen, in dem reizenden, zwischen
dem Erzgebirge und dem böhmischen Mittelgebirge sich
ausbreitenden Bielathal 230 m ü. M. gelegen, Station der
Eisenbahnen Aussig-T.-Komotau und Dux-Bodenbach, ist Sitz einer
Bezirkshauptmannschaft, eines Bezirksgerichts, Hauptzoll- und
Revierbergamtes, hat ein Schloß des Fürsten Clary mit
schönem Park, eine Dechanteikirche, eine evang. Kirche (1862
erbaut), einen israelitischen Tempel (1882), ein Realgymnasium,
eine Handelsschule, eine Fachzeichenschule für Keramik, ein
schönes Stadttheater (seit 1874), einen Gewerbeverein, eine
Sparkasse (Einlagen 5 Mill. Gulden), eine Filiale der
Öfterreichisch-Ungarischen Bank, ein österreichisches,
ein sächsisches und preußisches
Militärbadeinstitut, 3 Spitäler und (1880) 14,841, mit
dem angrenzenden Badeort Schönau 16,750 Einw. In neuerer Zeit
hat sich die Stadt, begünstigt durch die in der Umgegend
befindlichen reichen Braunkohlenlager (1887 wurden im
Revierbergamtsbezirk T. 23,9 Mill. metr. Ztr. Kohlen
gefördert), zu einem bedeutenden Industrie- und Handelsplatz
emporgeschwungen. Es bestehen hier insbesondere Fabriken für
Wirkwaren, Knöpfe, Baumwoll- und Gummiwaren, chemische
Produkte, Glas, Siderolith, Töpferwaren, Spiritus, Mehl,
Bretter, Möbel, ein Walzwerk mit Bessemerhütte, eine
Maschinenbauwerkstätte und eine Gasanstalt. Die
gegenwärtig benutzten Heilquellen von T.-Schönau (die
Stadtbadquellen, nämlich die Urquelle und die Frauenbadquelle,
48° C., die Steinbadquelle 34,6°, die Stephansquelle 36,75,
die Sandbadquelle 32,5° und die Wiesenquelle 32,7° in T.,
die Schlangenbadquelle 39° und die Neubadquelle 44,75° C.
in Schönau) führen meist alkalisch-salinisches Wasser,
mit nur geringen festen Bestandteilen, vorzugsweise kohlensaurem
Natron, vermischt. 10,000 Volumteile der Urquelle enthalten 1110
Teile halb gebundene, 34 wirklich freie Kohlensäure, 51
Stickstoff, 18 Sauerstoff, 4,144 kohlensaures Natron, 0,630
Chlornatrium, 0,018 phosphorsaures Natron, 0,228 schwefelsaures
Kali, 0,175 Teile Kieselsäure etc. Das Wasser ist farblos und
hat einen matten Geschmack. Die Quellen werden fast
ausschließlich zum Baden gebraucht und zwar vorzugsweise
gegen chronischen Rheumatismus, Gicht, Lähmungen, bei
skrofulösen Anschwellungen und Geschwüren, Neuralgien,
beginnenden Rückenmarksleiden, namentlich aber bei den
Nachkrankheiten aus Schuß- und Hiebwunden, nach
Knochenbrüchen ("Bad der Krieger").
591
Teppichbeete - Teppiche.
Die Urquelle dient auch zur Trinkkur. Von den Quellen werden 10
Badehäuser gespeist. Die Frequenz von T.-Schönau belief
sich 1887 auf 7351 Kurgäste nebst 19,224 Passanten. Der
Badegesellschaft dienen als Versammlungs- und Vergnügungsorte:
der in der Mitte der Stadt gelegene Kurgarten, in welchem sich das
neue Stadttheater, die Trinkhallen, der Kursalon und das
palastartige Kaiserbad befinden; der Garten und Park des
fürstlich Claryschen Schlosses; die 264 m hohe
Königshöhe mit dem Schießhaus, der Schlackenburg
und dem Denkmal König Friedrich Wilhelms III.; das Belvedere;
der Seumepark mit dem Grabmal Joh. Gottfr. Seumes (gest. 1810); der
Kaiserpark; die Payer-und Humboldtanlagen; der 392 m hohe
Schloßberg mit Schloßruinen; der Turner und Propstauer
Park etc. In der Nähe Eichwald, inmitten prächtiger
Waldungen, in neuerer Zeit als Sommeraufenthalt und klimatischer
Kurort vielbesucht, mit Kaltwasserheilanstalt, Porzellan- und
Siderolithfabrik. - Die Quellen von T. sollen der Sage nach 762
entdeckt worden sein, waren aber zweifellos viel früher
bekannt. Urkundlich wird der Stadt erst im 12., der Bäder im
16. Jahrh. gedacht. Um 1630 gehörten Stadt und Schloß
dem Herrn v. Kinsky, der in Wallensteins Sturz verwickelt ward.
Darauf belieh der Kaiser Ferdinand II. den Generalfeldmarschall
Grafen von Aldringer damit, und als 1634 der Mannesstamm dieses
Geschlechts erlosch, kamen Stadt und Schloß an die Clarys. Im
September und Oktober 1813 war T. das Hauptquartier der drei
alliierten Monarchen. Im September 1835 hatten die Monarchen von
Österreich, Rußland und Preußen, im Herbst 1849
der Kaiser von Österreich, die Könige von Preußen
und Sachsen und 25. Juli 1860 der Kaiser von Österreich und
der Prinz-Regent von Preußen eine Zusammenkunft in T. 1862
wurde das 1100jährige Jubelfest der Thermen gefeiert und dabei
ein Denkmal enthüllt. Durch eine Katastrophe in den
benachbarten Kohlenwerken von Ossegg (10. Febr. 1879), welche das
Thermalwasser dorthin abführte, war die Fortexistenz von T.
als Badeort in Frage gestellt. Doch wurde das Verhängnis
glücklich abgewendet und die Quellen in kurzer Zeit (3.
März) an ihren alten Austrittsöffnungen wieder zu Tage
gefördert. Vgl. Friedenthal, Der Kurort T.-Schönau,
topographisch und medizinisch dargestellt (Wien 1877); Herold,
Studien über die Bäder zu T. (das. 1886); Delhaes, Der
Badeort T.-Schönau (3. Aufl., Prag 1886); Lustig, Karlsbad und
T., balneo-therapeutisch (2. Aufl., Wien 1886); Hallwich, T., eine
deutschböhmische Stadtgeschichte (Leipz. 1886).
2) Ungar. Badeort, s. Trentschin.
Teppichbeete, s. Blumenbeete.
Teppiche, meist gemusterte Gewebe, welche seit dem
Altertum zum Bekleiden der Wände (die spätern Tapeten),
zum Bedecken der Fußböden, Polster etc. dienen. Diese
vielseitige Verwendung finden die T. gegenwärtig nur noch im
Orient, während sie in Europa fast ausschließlich zum
Bedecken der Fußböden benutzt werden. Man unterscheidet
orientalische T., welche auf rahmenartigen Vorrichtungen durch
Handarbeit, und europäische, welche auf Webstühlen
angefertigt werden. Orientalische T. liefern Indien, Persien, die
Türkei, aber auch der Kaukasus, Siebenbürgen, Kroatien,
Slawonien und Rumänien. Sie zeichnen sich durch vortreffliche
Arbeit und besonders durch das Muster aus, welches auf dem Prinzip
der Flächendekoration beruht, die Perspektive und die
naturalistische Nachahmung vegetabilischer und animalischer
Körper beiseite läßt und aus zierlichen Ornamenten
in harmonischer Färbung besteht. Die orientalischen T. sind
geflochten oder geknüpft. Erstere, nach einer
französischen Nachahmung gobelinartige genannt, bilden ein
glattes Gewebe, dessen Kette aus Leinen- oder Baumwollgarn durch
einen dicht angeschlagenen wollenen Schuß vollständig
bedeckt wird, so daß ein ripsartiger Stoff entsteht. Der
Schuß wird indes nicht auf die ganze Breite des Stoffes
eingetragen, sondern nur an den Stellen, wo er wirken soll, mit der
Kette verbunden. Die geknüpften, plüschartigen T. werden
auf baumwollener, leinener oder wollener Kette durch das
Einknüpfen von Flormaschen hergestellt, die man jede einzeln
durch die Breite des Teppichs einlegt. Nach Vollendung des Teppichs
wird der Flor desselben mit einfachen Handscheren egalisiert. Das
Material des Flors ist Schafwolle, für feinere T. auch
Ziegenhaare und Seide. Die schönsten orientalischen T. sind
die persischen (s. Tafel "Ornamente IV", Fig. 11, und Tafel
"Weberei", Fig. 16) und von diesen wieder die von Farahan in der
Provinz Arak; sie enthalten auf 1 m Breite 400-500 Flormaschen. Die
indischen (s. Tafel "Weberei", Fig. 22) haben einen ansehnlich
höhern Flor und 300-350 Maschen auf 1 m, für den
europäischen Handel sind aber bei weitem wichtiger die
ungleich billigern türkischen T., von denen die Smyrnaer mit
120-200 Maschen am geschätztesten sind; sie besitzen stets
eine wollene Kette, während die der persischen und indischen
aus Baumwolle besteht. Die orientalischen T., und namentlich die
geknüpften Smyrnateppiche, werden mit gutem Erfolg in Europa,
speziell in Deutschland (Schmiedeberg seit 1856, Kottbus, Wurzen,
Springe, Linden etc.) und Wien, nachgeahmt und zwar unter Anwendung
derselben Methode. Man arbeitet aber mit Kette aus Leinengarn und
Grundschuß aus Jute, erreicht eine große technische
Vollkommenheit und versteht auch die Muster und Farben so getreu
nachzubilden, daß ein großer Unterschied zwischen
echten und nachgeahmten Smyrnateppichen nicht mehr besteht.
Nachahmungen der orientalischen geflochtenen T. sind die Gobelins
(s. Tapeten). Die eigentlichen europäischen T. werden auf
mechanischen Webstühlen, die bessern auf der Jacquardmaschine
hergestellt. Die glatten T. bilden in Europa wie im Orient
gewöhnlich die geringere Sorte; man verfertigt sie aus Kuh-
oder Ziegenhaar, ordinärem Streichgarn oder Jute und benutzt
sie als Laufteppiche zum Bedecken von Treppen, Fluren etc. Hierher
gehören auch die Kidderminsterteppiche aus Doppelgewebe,
wollener oder baumwollener Kette und viel stärkerm wollenen
Schuß; das Muster erzeugt sich rechts und links in gleicher
Weise. Die Plüschteppiche haben entweder einen ungeschnittenen
Flor, welcher kleine, geschlossene Noppen bildet (Brüsseler
T.), oder einen aufgeschnittenen Flor, der eine samtartige
Oberfläche bildet (Velours-, Tournai-, Wilton-,
Axminsterteppiche). Die Herstellung ist im wesentlichen die der
Plüsche und Samte. Das Muster wird meist mit der
Jacquardmaschine hervorgebracht, und je nachdem es mehr oder
weniger Farben enthält, zieht man zwischen je zwei leinenen
Grundfäden mehr oder weniger Polfäden in jedes Riet ein
und unterscheidet nach der Zahl derselben die T. als drei-, vier-,
fünf- etc. chörige oder teilige. Billigere T. erzielt man
durch Aufdrucken des Musters, indem man entweder das gewebte Stuck
bedruckt, oder das Muster der Polkette vor der Verarbeitung
appliziert. Das letztere Verfahren liefert eine sehr gute Ware,
welche die im Stück bedruckten
592
Teptjären - Terceira.
T. weit übertrifft. Die Ornamentation der T. ahmt entweder
die orientalische Sitte nach (besonders die Jacquardteppiche), oder
sie bedeckt die ganze Fläche mit Blumen, Tieren, Architektur
etc. (besonders bedruckte T.). Das erste Prinzip hat sich als das
für T. ästhetisch angemessenste immer mehr Bahn
gebrochen, so daß der Naturalismus in Deutschland, England
und Österreich nur noch die billige Ware beherrscht. In
Frankreich ist dagegen das naturalistische Dessin in den
extravagantesten Formen noch vorherrschend. Gegenwärtig werden
in England, Österreich und Deutschland orientalische T. aller
Art nachgebildet. In Deutschland, welches früher
größtenteils Kettendruckteppiche lieferte, werden auch
T. in Brüsseler und Axminsterart fabriziert (Berlin). Vgl.
Lessing, Alt-orientalische Teppichmuster (Berl. 1877).
Teptjären, eine aus flüchtigen Wolgasinnen und
Tschuwaschen hervorgegangene, jetzt ganz tatarisierte
Völkerschaft im europäischen Rußland, unter den
Baschkiren in den Gouvernements Orenburg und Ufa lebend, 126,000
Köpfe stark.
Ter, Fluß in der span. Provinz Gerona, entspringt
auf den Ostpyrenäen und mündet unterhalb Torroella in das
Mittelländische Meer; 155 km lang.
Teramo, ital. Provinz in der Landschaft der Abruzzen,
grenzt im N. an die Provinz Ascoli-Piceno, im W. an Aquila, im S.
an Chieti und im O. an das Adriatische Meer und hat einen
Flächenraum von 3325, nach Strelbitsky nur 2875 qkm (52,22
QM.) mit (1881) 254,806 Einw. Die Provinz enthält an der
westlichen Grenze den Hauptzug der Abruzzen mit dem Gran Sasso
d'Italia und wird vom Tronto, Tordino, Vomano, Piomba und Pescara
bewässert. Erwerbszweige sind Getreide- (1887: 545,028 hl
Mais, 522,751 hl Weizen), Wein- (483,891 l.l) und Ölbau
(34,852 hl Öl), Seidenzucht, Seefischerei und etwas Industrie.
Längs der Küste zieht die Eisenbahn Ancona-Brindisi hin.
Die Provinz zerfällt in die zwei Kreise Penne und T. - Die
Hauptstadt T., am Tordino und an der Eisenbahn Giulanova-T., hat
eine Kathedrale aus dem 14. Jahrh., ein bischöfliches
Kollegium, Seidenspinnerei, Fabriken für Strohhüte,
Leder, Thonwaren, Möbel etc. und (1881) 8634 Einw., ist Sitz
der Präfektur, eines Zivil- und Korrektionstribunals, einer
Finanzintendanz, eines Bistums und einer Handelskammer. T. gilt
für das alte Interamna (Reste von Thermen, eines Theaters
etc.).
Teras, s. Gallwespen.
Teratolith (Eisensteinmark, sächsische Wundererde),
Mineral, kommt in derben, bläulichen und grauen, matten und
undurchsichtigen Massen vor, Härte 2,5-3, spez. Gew. 2,5,
besteht im wesentlichen aus wasserhaltigem Eisenaluminiumsilikat
und stellt ein Zersetzungsprodukt des sogen. Porzellanjaspis, eines
durch Kohlenbrände umgewandelten Schieferthons, dar, dessen
Pflanzenabdrücke bisweilen noch erkennbar sind. T. findet sich
in der Steinkohle von Zwickau und in der Braunkohle von Zittau und
wurde früher medizinisch benutzt.
Teratologie (griech.), die Lehre von den
Mißbildungen der Pflanzen und Tiere; s. Mißbildung.
Teratom (griech.), eine Balggeschwulst, welche durch
abnorme fötale Entwickelung entsteht und ganze Organe oder
Organteile, Haare, Knorpel, Muskelfasern, Epithelien etc.
einschließt.
Teratoskopie (griech.), s. Zeichendeuter.
Terbene, s. Kamphene und Ätherische Öle.
Terborch (früher Terburg genannt), Gerard,
niederländ. Maler, geboren um 1617 zu Zwolle, war Schüler
seines Vaters Gerard (1584-1662), von dem sich nur Handzeichnungen
erhalten haben, ging 1632 nach Amsterdam und von da nach Haarlem,
wo er zu P. Molyn dem ältern in die Lehre trat, aber mehr von
Frans und Dirk Hals beeinflußt wurde, was sich sowohl in
seinen Bildnissen als in seinen eleganten Sittenbildern zeigt. 1635
trat er in die Lukasgilde zu Haarlem ein, ging aber noch in
demselben Jahr nach England und von da nach Italien.
Zurückgekehrt, hielt er sich eine Zeitlang in Amsterdam auf,
wo er von Rembrandt Einflüsse erhielt, und 1646 ging er nach
Münster, wo er als Porträtmaler während der
Friedensverhandlungen thätig war und unter anderm das
berühmte Bild des Friedenskongresses mit 60 Bildnissen (jetzt
in der Nationalgalerie zu London) malte. Von da ging er nach
Madrid, wo er sich ein Jahr aufhielt und seinen Stil durch das
Studium des Velazquez vervollkommte. 1650 war er wieder in Holland
und ließ sich 1654 in Deventer nieder, wo er später
Bürgermeister wurde und 8. Dez. 1681 starb. T. ist der
geistvollste holländische Sittenmaler, welcher psychologische
Feinheit der Charakteristik mit vornehmer, anmutiger Darstellung
und glänzender koloristischer Behandlung der Stoffe verband
und seinen Genrebildern aus den Kreisen des höhern
Bürgerstandes gern einen novellistischen Inhalt gab. Seine
Hauptwerke dieser Gattung sind: die väterliche Ermahnung (im
Reichsmuseum zu Amsterdam, ein zweites Exemplar in Berlin), die
Konsultation (im Museum zu Berlin), die Lautenspielerin und der
brieflesende Offizier mit dem Trompeter (in der Dresdener Galerie),
die Depesche (im Museum des Haag), die Lautenspielerin und das
musizierende Paar (in der Galerie zu Kassel), die Musikstunde (in
der Nationalgalerie zu London), der Leseunterricht, die Musikstunde
und der Offizier und das Mädchen (im Louvre zu Paris), der
Bote vom Lande, der Liebesantrag, das Glas Limonade und das Konzert
(in der Eremitage zu St. Petersburg) und die
Äpfelschälerin (in der kaiserlichen Galerle zu Wien).
Ausgezeichnete Bildnisse von T. besitzen die Galerien in Amsterdam,
Berlin und im Haag. T. hat auch zahlreiche Handzeichnungen
hinterlassen. Vgl. Bode, Studien zur Geschichte der
holländischen Malerei (Braunschw. 1883); Mons, G. T. en zijne
familie (in der Zeitschrift "Oud Holland" 1886); Lemcke in Dohmes
"Kunst und Künstler", Bd. 2; Michel, G. Terburg et sa famille
(Par. 1888).
Terburg, Maler, s. Terborch.
Terceira (spr. tersse-ira), Insel, s. Azoren.
Terceira (spr. tersse-ira), Antonio José de Souza,
Herzog von, Graf von Villaflor, portug. Marschall, geb. 10.
März 1792 zu Lissabon, stieg im Kriege gegen Napoleon I. bis
zum Stabsoffizier, ging 1817 nach Brasilien, wo er Gouverneur der
Provinz Pará, dann der von Bahia ward, kehrte 1821 mit
König Johann VI. nach Europa zurück und ward 1826 von der
Regentin Isabella zum Marescal de Campo ernannt und gegen den
Parteigänger Dom Miguels, Marquis de Chaves, gesendet. Er
schlug denselben und ward hierauf zum Obergeneral der Nordarmee und
Gouverneur der Provinz Alemtejo erhoben. Als 1828 Dom Miguel die
Regentschaft übernahm, mußte sich T. als eifriger
Chartist vor dem Pöbel auf ein englisches Kriegsschiff
flüchten und ging nach London. Dort bereitete er die
Expedition nach Terceira vor, bemächtigte sich im Juni 1829
dieser Insel, 1830 auch der übrigen Azoren, ward von Dom Pedro
mit dem Oberbefehl der dort gesammelten Truppen betraut und landete
im Juli 1832 in Porto. Am 20. Juni 1833 erhielt er den Oberbefehl
über die Expedition
593
Tercerones - Terentius.
nach Algarve und ward zum Herzog von T. ernannt. Er schlug im
Juli das miguelistische Heer bei Almada und besetzte 24. d. M.
Lissabon. Im März 1834 von Dom Pedro mit dem Oberbefehl in
Porto betraut, reinigte er die nördlichen Provinzen
völlig von den Miguelisten und wurde im April 1836 an die
Spitze des Ministeriums berufen, mußte aber bald den
Absolutisten weichen. Erst 1842 und 1843 nach Herstellung der
Charte trat er wieder ans Ruder, ohne sich indes lange behaupten zu
können. Mit Saldanha leitete er im Oktober 1846 die
Konterrevolution im monarchischen Sinn, ward aber bei dem Versuch,
Porto zu beruhigen, von den Insurgenten gefangen genommen und erst
im Juni 1847 wieder freigegeben. Im März 1850 ward er zum
Kommandanten der 1. Armeedivision in Lissabon und im März 1859
wieder zum Präsidenten des Kabinetts ernannt, starb aber schon
26. April 1860.
Tercerones (span.), Ankömmlinge von einem
Europäer und einer Mulattin.
Terdschuman (Terguman, daraus entstanden Dragoman),
Dolmetsch, Übersetzer; Diwanterdschumani, der offizielle
Übersetzer der Hohen Pforte, ehedem ein ausschließlich
christliches Amt und zugleich Titel der Hospodare der Moldau und
Walachei; T.-efendi, der Dolmetsch des Sultans während des
Empfangs europäischer Gesandten; T.-odasi,
Übersetzungsbüreau der Hohen Pforte. Vgl. Dolmetsch.
Tereben, chem. Verbindung, entsteht bei Vermischung von
Terpentinöl mit konzentrierter Schwefelsäure und
wiederholter Destillation, bildet ein schwach gelbliches Öl,
siedet bei 156°, riecht thymianähnlich und dient als
desinsizierendes und antiseptisches Mittel.
Terebinthe, s. v. w. Terpentinpistacie, s. Pistacia.
Terebinthineen (Terebinthaceen, Anakardiaceen,
Balsamgewächse), dikotyle, etwa 450 Arten umfassende,
hauptsächlich in der Tropenzone einheimische, aber auch in
Südeuropa vertretene Pflanzenfamilie aus der Ordnung der
Terebinthinen, Milchsaft führende Bäume und
Sträucher mit wechselständigen, ungeteilten oder
handförmig dreizähligen oder unpaarig gefiederten,
nebenblattlosen Blättern und meist durch Fehlschlagen
eingeschlechtigen, ein- oder zweihäusigen, seltener
zwitterigen, regelmäßigen, meist kleinen und
unansehnlichen Blüten, welche end- oder achselständige
Rispen oder Ähren bilden und einen variabeln Bau besitzen. Als
Grundtypus ist eine fünf- oder vierzählige Blüte mit
doppeltem Staubblattkreis und reduzierter Zahl der
Fruchtblätter (meist drei) anzusehen, von denen
gewöhnlich nur eins den Ovarteil ausbildet. Zwischen
Staubblättern und Karpiden befindet sich ein ring- oder
becherförmiger Diskus; letztere sind stets eineiig. Vgl.
Marchand, Révision du groupe des Anacardiacées (Par.
1869). - Eine Reihe von Arten aus den Gattungen Pistacia L., Rhus
L., Anacardites Sap. u. a. kommen fossil in Tertiärschichten
vor. Offizielle Anwendung finden die Blätter des Giftsumachs
(Rhus Toxicodendron) aus Nordamerika, das Harz (Mastix) der auf den
griechischen Inseln einheimischen Pistacia Lentiscus und die durch
ihre eigentümliche Gestalt bekannten Früchte der
tropischen Anacardium occidentale und orientale, die sogen.
Elefantenläuse. Gegessen werden die Früchte der
südeuropäischen und im Orient wachsenden Pistacia vera.
Die Rinde der südeuropäischen Rhus coriaria findet in der
Gerberei Anwendung. Die nahe verwandten Burseraceen unterscheiden
sich von den T. hauptsächlich durch zwei hängende,
anatrope Eichen in jedem Fach und durch die meist gefalteten und
gerollten Kotyledonen. Die ungefähr 150 Arten sind ebenfalls
in den Tropen einheimisch und zeichnen sich durch ein balsamisches
Harz aus.
Terebinthinen, Ordnung im natürlichen Pflanzensystem
unter den Dikotyledonen, Choripetalen, charakterisiert durch meist
zwei Staubgefäßkreise und einen zwischen Fruchtknoten
und Staubgefäßen stehenden Blütendiskus,
umfaßt die Familien der Terebinthaceen, Burseraceen,
Rutaceen, Diosmeen, Zygophyllaceen und Simarubaceen.
Terebrateln (Terebratula Cuv.), Brachiopodengattung,
welche schon in der devonischen Formation vorkommt, dann aber ganze
Schichten des Muschelkalks bildet, am zahlreichsten in der
Juragruppe erscheint und auch jetzt noch in den Meeren vertreten
ist (s. Tafeln "Triasformation I" und "Juraformation I"). Vgl.
Krötensteine und Brachiopoden.
Teredo. Bohrwurm, s. Bohrmuscheln.
Terek, Fluß in der russ. Statthalterschaft
Kaukasien, bildet sich unweit des Kasbek aus den Gletschern der
Berge Sûrchu-Barsom, Siwera-uta und Silpa-Choch,
durchströmt in nordwestlicher Richtung die Kabarda und wendet
sich bei Jekaterinograd, wo er die Ebene erreicht, plötzlich
ostwärts, später nordostwärts, spaltet sich bei
Kisljar, ein großes, bis 110 km breites sumpfiges Delta
bildend, in drei Hauptarme und mündet nach 480 km langem Lauf
in das Kaspische Meer. Der südlichste dieser Arme, Neuer T.
genannt, fällt in die Agranbucht. Schiffbar ist der T.
nirgends. An seinen Ufern, von Mosdok an aufwärts, haben die
Russen eine Reihe kleiner Festungen angelegt, die sogen. Tereksche
Linie, deren Hauptpunkt Wladikawkas bildet, und die bis Dariel
reichen, dem Hauptpaß über den mittlern Kaukasus nach
Tiflis.
Terekgebiet (Terscher Landstrich), Gebiet in der russ.
Statthalterschaft Kaukasien, am Nordabhang des Kaukasus und
durchflossen vom Ter, nach welchem es den Namen führt, 60,988
qkm (1108 QM.) groß mit (1883) 678,110 Einw., von denen die
eingebornen Tschetschenzen, Kabardiner, Ossetinen, Kumüken den
südlichen gebirgigen, die Russen (meist Kosaken) aber den
nördlichen flachen Teil bewohnen. Hauptort ist Wladikawkas,
wohin von Rostow die Eisenbahn führt.
Terentianus Maurus, lat. Grammatiker, aus Afrika
gebürtig, lebte wahrscheinlich zu Ende des 3. Jahrh. n. Chr.
und ist Verfasser eines in vielfachen Versmaßen
abgefaßten Lehrgedichts: "De literis, syllabis, metris", das
bei den Alten in hohem Ansehen stand. Ausgaben von Lachmann (Berl.
1836) und Keil ("Grammatici latini", Bd. 6, Leipz. 1874).
Terentius, Publius, mit dem Beinamen Afer ("Afrikaner"),
röm. Lustspieldichter, geb. 185 v. Chr. angeblich zu Karthago,
kam in früher Jugend als Sklave in das Haus des römischen
Senators Terentius Lucanus, welcher ihm eine sorgfältige
Erziehung geben ließ und später die Freiheit schenkte.
T. ward der Lieblingsdichter der höhern Stände und Freund
der bedeutendsten Männer seiner Zeit, namentlich des
jüngern Scipio Africanus. Auf einer Reise nach Griechenland
starb er 159. Wir besitzen von T. sechs Lustspiele, von denen vier
nach Menander, zwei nach Apollodor gearbeitet sind: "Andria" (hrsg.
von Klotz, Leipz. 1865; von Spengel, 2. Ausg., Berl. 1889),
"Eunuchus", "Heautontimorumenos" (hrsg. von Wagner, das. 1872),
"Phormio" (hrsg. von Dziatzko, 2. Aufl., Leipz. 1885), "Hecyra",
"Adelphi" (hrsg. von Spengel, Berl. 1879, und Dziatzko, Leipz.
1881). Vor Plautus zeichnet sich T. durch kunstgerechtere Anlage,
feinere Charakteristik und Eleganz der Form
594
Terentius Barro - Terminrechnung.
aus, steht ihm aber an Kraft und Witz nach, wie er auch hinter
der Lebensfrische seines Vorbildes Menander zurückblieb. In
der Sprache wußte er, der geborne Afrikaner, so den seinen
Umgangston zu treffen, daß seine Neider behaupteten, seine
hohen Gönner wären ihm bei der Arbeit behilflich gewesen.
Seine bis ins Mittelalter vielgelesenen Stücke wurden von den
Grammatikern mehrfach kommentiert (s. Donatus 1) und neben Vergil
am häufigsten als Fundgrube für grammatische Beispiele
benutzt. Gesamtausgaben besorgten Bentley (Cambr. 1726, Amsterdam
1727; zuletzt wiederholt von Vollbehr, Kiel 1846), Westerhov (Haag
1726, 2 Bde.), Fleckeisen (Leipz. 1857), Umpfenbach (kritische
Hauptausgabe, Berl. 1870), Dziatzko (Leipz. 1884). Die älteste
Übersetzung erschien 1499 zu Straßburg: "T. der
hochgelahrte Poet. Zu tütsch transferiert nach dem Text und
nach der Gloss" (mit Holzschnitten). Neuere Übertragungen
lieferten: Benfey (Stuttg. 1837 u. 1854), Jakob (Berl. 1845),
Herbst (2. Aufl., das. 1888) und Donner (Stuttg. 1864, 2 Bde.).
Vgl. Francke, T. und die lateinische Schulkomödie in
Deutschland (Weim. 1877); Conradt, Die metrische Komposition der
Komödien des T. (Berl. 1876).
Terentius Varro, s. Varro.
Tereus, nach griech. Mythus König von Daulis, Gemahl
der Prokne und Schwager der Philomela, die von ihm geschändet
ward (s. Philomela), wurde schließlich in einen Wiedehopf
(oder Habicht) verwandelt.
Tergeste, Stadt, s. Trieft.
Tergiversieren (lat.), Ausflüchte, Winkelzüge
machen; eine Sache hinausziehen.
Terglou (Triglaw), Gebirgsstock im nördlichen Teil
der Julischen Alpen (s. d.), mit der höchsten der drei
zuckerhutartigen Spitzen bis zu 2865 m emporsteigend. Von ihm
fließen die Gewässer drei Flüssen zu: der Drau
(Gailitz), Isonzo und Save; er teilt auch drei Sprach- und
Völkergebiete: Deutsche, Slawen, Italiener. Erstiegen wurde er
zuerst 1778 vom Arzt Willonitzer, seitdem insbesondere 1822 von
Hauptmann Bosio behufs Vermessungsarbeiten. Gegenwärtig ist
die Besteigung durch einen verbesserten Weg und eine
Unterkunftshütte erleichtert.
Tergnier (spr. ternjeh), Dorf imfranz. Departement Aisne,
Arrondissement Laon, wichtiger Knotenpunkt der Nordbahn (Linie
Paris-Jeumont mit Abzweigungen nach Amiens und Laon), mit
Eisenbahnwerkstätten, Zuckerfabrik und (1881) 3536 Einw.
Terlan, Dorf in Südtirol, Bezirkshauptmannschaft
Bozen, an der Etsch und der Bozen-Meraner Bahn, mit gotischer
restaurierter Kirche, berühmtem Weinbau und (1880) 1315 Einw.
In der Nähe die Ruinen der Burg Maultasch.
Terlizzi, Stadt in der ital. Provinz. Bari, Kreis
Barletta, 12 km vom Adriatischen Meer, mit Ringmauern und Kastell,
Wein- und starkem Mandelbau und (1881) 20,442 Einw.
Terme (franz.), Grenzstein; viereckiger schlanker
Pfeiler, der oben oft in eine Büste ausläuft; auch s. v.
w. Ausdruck, Kunstwort (terminus). Hermes, Termite.
Termin (v. lat. terminus "Grenze", Tagfahrt), Zeitpunkt,
zu welchem eine bestimmte Handlung, namentlich eine Rechtshandlung,
vorgenommen werden muß, im Gegensatz zur Frist, binnen
welcher dies zu geschehen hat. Die Folgen der Versäumnis eines
Termins, welche den Ungehorsamen (contumax) treffen, richten sich
nach dem in der Ladung angedrohten Rechtsnachteil.
Terminaliia L., Gattung aus der Familie der Kombretaceen,
Bäume und Sträucher mit wechsel-, selten fast
gegenständigen Blättern, kleinen, meist grünen oder
weißen Blüten in lockern Ähren, selten in
Köpfchen, und eiförmiger, kantig zusammengedrückter
oder zwei- bis fünfflügeliger Steinfrucht. 80-90 Arten.
T. Catappa L., in Ostindien, dort und in Westindien kultiviert,
liefert Samen, die wie Mandeln benutzt werden. T. Chebula Retz
(Myrobalanus Chebula Gärtn., s. Tafel "Gerbmaterialien
liefernde Pflanzen"), in Ostindien, liefert die
gerbsäurehaltigen Myrobalanen (s. d.). Auch die Früchte
von T. citrina Roxb., T. belerica Roxb. und andern Arten kommen als
Myrobalanen in den Handel.
Terminalien (lat.), s. Terminus.
Terminei (lat.), abgegrenzter Bezirk.
Termingeschäft, Terminkauf, s. v. w.
Lieferungsgeschäft und Lieferungskauf (s. diese Artikel).
Terminieren (lat.), begrenzen, festsetzen; als
Bettelmönch Gaben sammelnd umherziehen. Terminismus, s. v. w.
Determinismus.
Termini Imerese, Kreishauptstadt in der ital. Provinz
Palermo (Sizilien), in herrlicher Lage an der Mündung des San
Lionardo (auch Fiume T.) ins Tyrrhenische Meer und an der Eisenbahn
Palermo-Girgenti, hat eine Hauptkirche im Renaissancestil, ein
Tribunal, Hauptzollamt, Gymnasium, Lyceum, eine technische Schule,
Bibliothek und (1881) 22,733 Einw.. die sich besonders mit
Thunfisch- und Sardellenfang, Handel (Ausfuhr von Schwefel,
Fischen, Gemüsen, getrockneten Früchten) und Schiffahrt
beschäftigen. Vom Hafen von T. liefen 1886: 552 Schiffe mit
21,805 Ton. aus. An Stelle des 1860 geschleiften Kastells wurde ein
Garten angelegt. Ostwärts im untern Stadtgebiet liegen stark
besuchte Bäder (die antiken Thermae Himerenses), welche reiche
Mengen an kohlensaurem und schwefelsaurem Kalk, Chlormagnesium und
Kochsalz nebst freiem Schwefelwasserstosfgas bei einer Temperatur
von 44° C. enthalten und gegen Rheumatismus, Hautkrankheiten
und Nervenleiden benutzt werden. Von der alten Stadt sind noch
Reste eines Amphitheaters, eines Aquädukts u. a.
vorhanden.
Terministischer Streit, Streit über die Ausdehnung
der von Gott dem Sünder gestatteten Gnadenzeit, hervorgerufen
1698 durch die vom Diakonus Böse in Sorau aufgestellte und von
Leipziger Professoren unterstützte Behauptung, daß die
göttliche Gnade jedem Menschen zu seiner Bekehrung nur bis zu
einem gewissen Termin offen stehe, während die Wittenberger
und Rostocker Theologen eine Bekehrung auch noch im Todeskampf
für möglich hielten. Vgl. Hesse, Der terministische
Streit (Gießen 1877).
Terminologie (lat. -griech.), Inbegriff der
sämtlichen in einer Wissenschaft, einer Kunst, einem Handwerk
etc. gebrauchten Fach- oder Kunstausdrücke (termini technici);
auch die Lehre von solchen Kunstausdrücken und ihre
Erklärung.
Terminrechnung (Termin-Reduktionsrechnung), die
Berechnung eines gemeinschaftlichen mittlern Zahlungstermins
für mehrere zu verschiedenen Zeiten fällige
unverzinsliche Kapitalien. Die gewöhnliche Regel, nach der man
im kaufmännischen Verkehr, wo es sich um kurze Termine
handelt, stets rechnet, besteht darin, daß man jedes Kapital
mit seiner Verfallzeit multipliziert, die Summe aller Produkte
bildet und sie mit der Summe der Kapitalien dividiert. Sind also
1200 Mk. in einem Jahr, 800 Mk. in 2 Jahren, 1500 Mk. in 4 Jahren
und 2500 Mk. in 5 Jahren zahlbar, so hat man 1200.1 + 800.2 +
1500.4
595
Terminus - Termiten.
+ 2500.5 = 21,300, und der mittlere Zahlungstermin für die
Gesamtsumme von 6000 Mk. ist daher x = 21300/6000 = 3 11/20 Jahre
oder 3 Jahre 6 Monate 18 Tage. Dieses durch Einfachheit sich
auszeichnende Verfahren wird oft mit Unrecht für falsch
erklärt; es findet seine vollständige Rechtfertigung
darin, daß bei Anwendung desselben der Gläubiger, wenn
er jedes Kapital am Tag des Empfangs verzinslich anlegt, zuletzt an
Kapital und Zinsen dieselbe Summe in der Hand hat, wobei es
gleichgültig ist, ob die ursprünglichen Termine
innegehalten werden, oder ob die ganze Summe auf einmal gezahlt
wird.
Terminns (lat.), Grenz- oder Markstein; sodann der Gott,
unter dessen Obhut die Grenze gestellt war, daher Beschützer
des Eigentums, dem alle Grenzsteine heilig waren, weshalb das
Setzen derselben stets unter religiösen Zeremonien geschah.
König Numa stiftete ihm zu Ehren ein besonderes Fest, die
Terminalien, welche 23. Febr., als dem Ende des altrömischen
Jahrs, gefeiert wurden. In dem Jupitertempel auf dem römischen
Kapitol befand sich ein ihm geweihter Grenzstein, der beim Bau des
Tempels nicht hatte weichen wollen. Später ist T. auch Beiwort
des Jupiter. Die Darstellungen des T. auf römischen Denaren
sind stets in Form von Hermen gehalten. In der Sprache der Logiker
ist T. s. v. w. Begriff (s. Schluß); in England Bezeichnung
der großen Zentralbahnhöfe (s. v. w. Endstation).
Terminus technicus (lat.), s. v. w. Kunstausdruck.
Termiten (Unglückshafte, weiße Ameisen,
Termitina Burm.), Insektenfamilie aus der Ordnung der
Falschnetzflügler, gesellig lebende Insekten mit
länglichem, oberseits mehr abgeflachtem, unterseits
gewölbtem Körper, freiem, nach unten gerichtetem Kopf,
runden Augen, keinen oder zwei Nebenaugen, kurzen,
perlschnurartigen Fühlern, aufgetriebenem Kopfschild,
kräftigen Mundteilen, schlanken, kräftigen Beinen mit
viergliederigen Tarsen und, sofern sie geflügelt sind, mit
vier gleich großen, langen und hinfälligen Flügeln.
Neben den fortpflanzungsfähigen, geflügelten Individuen
existieren zwei Formen geschlechtsloser, ungeflügelter, mit
verkümmerten männlichen oder weiblichen
Geschlechtsorganen, nämlich Soldaten, mit großem,
quadratischem Kopf und langen, kräftigen Mandibeln, und
Arbeiter, mit kleinem, rundlichem Kopf, verborgenen Mandibeln und
wenig entwickeltem Mittelleib. Die Arbeiter besorgen den Aufbau der
gemeinsamen Behausung und die Pflege der Brut, den Soldaten liegt
die Verteidigung der Kolonie ob, den an Individuenzahl weit
zurückstehenden geflügelten T. aber die Erhaltung der
Art. Die Termitenkönigin ist ein seiner Flügel
entledigtes, befruchtetes Weibchen, dessen Hinterleib durch die
Anschwellung der eine ungemein große Anzahl von Eiern
enthaltenden Eierstöcke eine enorme Ausdehnung erhalten hat.
Ob sich in jeder Kolonie nur eine solche Königin nebst
zugehörigem Männchen (König) in einer besonders
geräumigen Zelle tief im Mittelpunkt des Baues vorfindet, oder
ob deren mehrere zugleich vorhanden sind, ist noch nicht sicher
ermittelt. Jedenfalls hat das sparsame Vorkommen befruchteter
Individuen nur in äußern Umständen seinen Grund,
indem die große Mehrzahl nach vollzogener Begattung den
Vögeln etc. zum Opfer fällt. Die Eier sind walzig,
bisweilen gekrümmt, an den Enden abgerundet und von ungleicher
Größe. Die Larven sind anfangs stark behaart, haben
undeutliche Augen, kürzere Fühler und verwandeln sich
durch mehrere Häutungen in die vollkommenen Insekten. Zu der
Zeit, wo sich die geschlechtlichen Individuen in einer Kolonie
entwickelt haben, gerät die ganze Bevölkerung in
große Unruhe, und die geflügelten Männchen und
Weibchen verlassen den Haufen, um sich in der Luft zu begatten und
gleich darauf ihre Flügel nahe der Wurzel abzubrechen. Die
Bauten der T. sind sehr verschieden; sie werden entweder in
Baumstämmen oder am Erdboden selbst angelegt, im letztern Fall
häufig in Form von Hügeln, die in Afrika eine Höhe
von 5 m und am Fuß einen Umfang von 19 m erreichen. Diese
großen Bauten bestehen hauptsächlich aus Thon und
besitzen große Festigkeit; sie enthalten zahlreiche Zellen
und Gänge, von denen erstere als Wiegen für die Brut,
letztere zur Kommunikation zwischen allen Teilen des Baues dienen.
Oft stehen viele Hügel durch ein System überwölbter
Straßen miteinander in Verbindung und bilden
gewissermaßen eine einzige Kolonie. Andre Arten leben im Sand
unter der Erdoberfläche und bauender röhrenartige
Gänge, umgeben Wurzeln oder Äste im Boden mit
erhärtendem Material und weilen in diesen Röhren, bis das
Holz aufgezehrt ist. Wieder andre Arten nagen Gänge in das
Holz der Bäume, kleiden die Wandungen mit Kot aus, und so
entstehen, indem die Gänge immer näher aneinander
rücken und das Holz zuletzt völlig aufgezehrt wird,
Bauten, die in ihrem Gefüge an einen Schwamm erinnern und
zuletzt auch außerhalb des Baumes fortgeführt werden.
Viele Arten sind ein Schrecknis der heißen Länder; sie
dringen scharenweise in die menschlichen Wohnungen und
zerstören namentlich Holzwerk, indem sie dasselbe im Innern
völlig zerfressen, die äußere Oberfläche aber
verschonen, so daß scheinbar unversehrte Gegenstände bei
geringer Erschütterung zusammenbrechen. Die T. führen
ihre Arbeiten nur nachts aus und unternehmen auch weite
Wanderungen; ihre ärgsten Feinde sind die Ameisen, die
förmlich gegen sie zu Felde ziehen. Man kennt etwa 80 lebende
Arten in allen heißern Ländern, bis 40° nördl.
und südl. Br., in Frankreich bis Rochelle (s. unten),
besonders zahlreich vertreten in Afrika und Amerika. Fossile Arten
finden sich schon in der Kohlenformation, am häufigsten aber
im Bernstein und im Tertiär. Die kriegerische Termite (Termes
bellicosus Smeathm., T. fatale L.), 1,8 cm lang, 6,5-8,0 cm breit,
ist dunkelbraun, mit heller geringelten Fühlern, am Mund, an
den Beinen und am Bauch rostgelb, mit gelblichen, undurchsichtigen
Flügeln, im größten Teil des tropischen Afrika
heimisch, baut hohe, unebene, mit vielen Hervorragungen versehene
Erdhügel, die sich allmählich abrunden und mit dichter
Vegetation bedecken. Die Umgebung der Hügel besteht in einem
Thonwall von 15-47 cm Stärke und enthält Zellen,
Höhlungen und Wege. Die schreckliche Termite (T. dirus Klug.,
s. Tafel "Falschnetzflügler") lebt in Brasilien in
Erdlöchern und unter Steinen von den Wurzeln verfaulender
Bäume. Die lichtscheue Termite (T. lucifugus Rossi), 9 mm
lang, 20 mm breit, ist schwarz, am Mund, an der Schienenspitze und
den Tarsen gelblich, mit gerunzelten, rauchigen, schwärzlich
gerandeten Flügeln, findet sich überall in
Südeuropa, ist in Frankreich bis Rochefort und Rochelle
vorgedrungen und hat in letzterer Stadt an den Holzpfählen,
auf welchen diese erbaut ist, arge Verwüstungen angerichtet.
Manche T. werden in den heißen Ländern von den
Eingebornen gegessen. Vgl. Hagen, Monographie der T. ("Linnaea
entomologica". Bd. 10, 12, 14); Lespés, Recherches sur
l'organisation et les moeurs du Termite lucifuge ("Annales des
sciences naturelles", Serie 4, Bd. 5).
596
Termoli - Terpentin.
Termoli, Flecken in der ital. Provinz Campobasso, Kreis
Larino, am Adriatischen Meer und an der Eisenbahn Ancona-Foggia,
von welcher hier die Linie über Campobasso nach Benevent
abzweigt, ist Bischofsitz, hat ein Kastell (von 1247), eine im 16.
Jahrh. gebaute Kathedrale, einen Hafen und (1881) 3963 Einw.
Termonde, Stadt, s. Dendermonde.
Ternate, eine Insel der Molukken, an der Westküste
von Dschilolo, hat einen 1675 m hohen Vulkan, reiche Vegetation und
9000 Einw. und bildet mit Teilen von Celebes, den Suluinseln, dem
Nordteil der Molukken (Dschilolo) u. a. die niederländische
Residentschaft T. mit einem Areal von 238,956 qkm (4339,7 QM.) mit
(1885) 109,947 Einw., worunter 308 Europäer und 465 Chinesen.
Zur Residentschaft gehören außer dem eigentlichen
Regierungsgebiet die abhängigen Reiche T., Tidore (wozu auch
die Westhälfte von Neuguinea) und Batjan. Die Stadt T., mit
6000 Einw., ist Sitz des niederländischen Residenten, hat
einen prächtigen Dalem oder Palast des Sultans und daneben das
Fort Oranien.
Ternaux (spr. -noh), Guillaume Louis, Baron,
Industrieller, geb. 8. Okt. 1763 zu Sedan, erlernte bei seinem
Vater die Handlung und übernahm 1778 dessen Geschäft.
Nach dem Ausbruch der Revolution mußte er 1793 fliehen; doch
kehrte er schon unter dem Direktorium zurück, ging nach Paris
und begründete nach und nach über das ganze Land, ja
selbst im Ausland, Fabriken, machte mehrere wichtige Erfindungen in
der Mechanik und führte die Spinnmaschinen und zur Erzeugung
bessern Rohstoffs sächsische Widder und Kaschmirziegen in
Frankreich ein. Auch die Weberei suchte er zu heben und
begründete die Fertigung der feinern Shawls. Nach der ersten
Restauration wandte er sich den Bourbonen zu und ging daher 1815
während der Hundert Tage mit Ludwig XVIII. nach Gent. Nach der
zweiten Restauration ward er mehrfach von der Regierung
ausgezeichnet und zu Rate gezogen, doch schloß er sich 1827
in der Kammer völlig der Opposition an und beteiligte sich
auch an der Julirevolution. Er starb 2. April 1833 in St.-Ouen.
Terne (Ternion, lat.), Zusammenstellung je dreier Dinge
aus einer größern Anzahl, insbesondere beim Lottospiel
jede Zusammenstellung von drei bestimmten Nummern unter den
vorhandenen 90.
Terneuzen, Stadt, s. Neuzen.
Terni, Kreishauptstadt in der ital. Provinz Perugia
(Umbrien), zwischen zwei Armen der Nera, an der Eisenbahn
Rom-Foligno, in welche hier die Bahn Castellammare
Adriatico-Aquila-T. einmündet, ist Sitz eines Bischofs und
eines Handelsgerichts, hat eine Kathedrale (1653 von Bernini
erbaut), eine Kirche, San Francesco, mit schönem gotischen
Glockenturm, ein Theater, ein Lyceum, Gymnasium, Institut für
Mechanik und Konstruktionslehre, Orangen-, Oliven-und
Maulbeerkultur, Tuch- und Lederindustrie, große,
neueingerichtete Eisenwerke (vorwiegend für maritime und
Eisenbahnzwecke) und (1881) 9415 Einw. - T. ist das alte Interamna
Umbrica, angeblich die Vaterstadt des Geschichtschreibers Tacitus,
und enthält von der antiken Stadt noch Ruinen eines
Amphitheaters, eines Sonnentempels etc. In der Nähe der
berühmte Wasserfall des Velino (s. d.). Bei T. wurden 27. Nov.
1798 die Neapolitaner von den Franzosen geschlagen.
Ternströmiaceen, dikotyle, etwa 260 Arten
umfassende, im tropischen Amerika und dem südlichen Asien
einheimische Pflanzenfamilie ausder Ordnung der Cistifloren,
Bäume und Sträucher mit wecselständigen, oft an den
Zweigspitzen in Büscheln stehenden, einfachen, gewöhnlich
lederartigen, immergrünen, meist durchscheinend punktierten,
fiedernervigen Blättern mit am Grund artikuliertem Blattstiel
und meist fehlenden Nebenblättern und mit zwitterigen,
bisweilen durch Fehlschlagen eingeschlechtigen,
regelmäßigen Blüten. Der bisweilen spiralig
geordnete und unbestimmtzählige Kelch ist in andern
Fällen fünfzählig, die freien Blumenblätter
wechseln meist mit den Kelchblättern ab, die zahlreichen
Staubgesäße stehen in mehreren Kreisen oder in fünf
aus einer gemeinsamen Anlage hervorgehenden Bündeln beisammen.
Die 2-5 Fruchtblätter verwachsen stets und tragen im
Innenwinkel zwei Samenknospen. Die Frucht bildet sich zu einer
wand- oder fachspaltigen Kapsel oder beerenartigen Steinfrucht aus.
Vgl. Choisy, Mémoire sur les Ternstroemiacées
("Mémoires de la Société physique", Bd. 14,
Genf). Mehrere Arten der Gattungen Ternstroemia Mut.. Freziera Sw.
u. a. kommen fossil in Tertiärschichten vor. Manche T. werden
als Heilmittel angewendet; die Gattung Thea L. zeichnet sich durch
den Gehalt an Kaffein aus. Beliebte Schmuckpflanzen sind die
japanischen Kamelien (Camellia-Arten).
Terpándros (Terpander), griech. Musiker und
Lyriker aus Antissa auf Lesbos, ist der Schöpfer der
klassischen Musik der Griechen und damit Begründer der
griechischen Lyrik, indem er zuerst den alten choralartigen
Gesängen zu Ehren des Apollon, den sogen. Nomen, durch
regelmäßige Gliederung eine künstlerische
Ausbildung gab und statt der bisherigen viersaitigen Kithara die
siebensaitige erfand. Nach Sparta zur Schlichtung innerer
Zwistigkeiten auf Geheiß des delphischen Orakels berufen,
ordnete er das dorische Musikwesen und siegte 676 v. Chr. in dem
ersten musischen Wettkampf am Feste der Karneen, ebenso zwischen
672 und 648 viermal hintereinander bei den Pythischen Spielen. Von
seinen Dichtungen sind nur wenige Verse erhalten (bei Bergk,
"Poetae lyrici graecl", abgedruckt).
Terpentin (Terebinthina), balsamartige Masse, welche
durch Einschnitte aus den Stämmen von Nadelhölzern
gewonnen wird (s. Fichtenharz). Der gemeine T. wird aus Pinus
maritima Lamb., P. laricio Poir., P. silvestris L., Abies excelsa
Lam. und A. pectinata Dec. sowie aus mehreren amerikanischen Arten
gewonnen. Die Ausbeute ist sehr verschieden. Man rechnet z. B. in
Österreich auf den Stamm jährlich 2 kg T., während
man in Westfrankreich etwa 3,6 kg erhält und starken Fichten,
besonders alleinstehenden, auf deren Erhaltung es nicht weiter
abgesehen ist, in einem Jahr bis 40 kg T. abgewinnen kann. Der
gemeine T. bildet eine mehr oder weniger klare,
gelblichweiße, honigdicke, stark klebende Masse, reagiert
sauer, riecht nach Terpentinöl, ist löslich in Alkohol,
Äther, ätherischen Ölen und in nicht
überschüssiger Kalilauge, enthält 15-30 Proz.
Terpentinöl, Harz, Harzsäuren (Pinarsäure,
Pininsäure, Sylvinsäure, Abietinsäure), wenig
Ameisensäure und Bernsteinsäure. Im frischen T. findet
sich Abietinsäureanhydrid; dies nimmt aber Wasser auf, und es
scheiden sich wetzsteinähnliche Kristalle von
Abietinsäure aus, durch welche der T. trübe und
krümelig wird. Im Handel unterscheidet man: deutschen T. von
kaum bitterm Geschmack; ihm ähnlichen französischen T.,
welcher weniger Terpentinöl enthält; Straßburger T.
von der Weißtanne, welcher bald hell und klar wird,
zitronenartig riecht, sehr bitter schmeckt und 35 Proz.
Terpentinöl enthält; amerikanischen T.,
weißlichgelb, zäh, von kräftigem Geruch, sehr
scharf bitterm Geschmack und geringem Terpen-
597
Terpentinbaum - Terrain.
tinölgehalt. Der venezianische T. von der Lärche
(Larixeuropaea Dec.) wird in Südtirol aus dem Kernholz durch
Bohrlöcher gewonnen, welche man zu Ende des Winters anlegt,
verstopft und erst im Herbst wieder öffnet, um den
angesammelten T. abzuzapfen. Dieser T. ist gelblich bis
bräunlich, fast klar, zähflüssig und scheidet nicht
Kristalle aus. Kanadabalsam von Abies balsamaea Marsh, A. Fraseri
Pursh und A. canadensis Mich., in Nordamerika aus Blasen in der
Rinde dieser Bäume gewonnen, ist vollkommen klar, hellgelb,
riecht angenehm aromatisch, schmeckt bitter, mischt sich mit
absolutem Alkohol, enthält 24 Proz. ätherisches Öl,
scheidet keine Kristalle aus und wird hauptsächlich zur
Darstellung mikroskopischer Präparate benutzt. Unter T.
verstand man im Altertum den Harzsaft der Pistacia Terebinthus, und
erst später wurde der Name auf den Saft der Koniferen
übertragen, den man auch schon im Altertum benutzte. T. gibt
beim Kochen mit Wasser Terpentinöl und hinterläßt
ein Harz (gekochten T., Glaspech), bei Destillation ohne Wasser
Kolophonium. Man benutzt ihn zur Darstellung von Terpentinöl,
Salben, Pflastern, Firnissen, Lacken, Siegellack, Kitt. Vgl.
Winkelmann, Die Terpentin- und Fichtenharzindustrie (Berl.
1880).
Terpentinbaum, s. v. w. Pistacia.
Terpentingallen (Carobbe), s. Pistacia.
Terpentinhydrat, s. Terpentinöl.
Terpentinkiefer, s. Kiefer, S. 714.
Terpentinöl (Terpentinspiritus), ätherisches
Öl, findet sich in allen Teilen der Nadelhölzer aus den
Gattungen Pinus, Picea, Abies, Larix, wird durch Destillation aus
dem Terpentin dieser Bäume gewonnen und zeigt je nach der
Abstammung gewisse Abweichungen in den Eigenschaften, besonders das
direkt durch Destillation der Pflanzenteile mit Wasser gewonnene
Öl (Fichtennadelöl, Templinöl etc.), unterscheidet
sich nicht unwesentlich von dem aus Terpentin gewonnenen. Das rohe
Öl ist dünnflüssig, farblos oder gelblich, klar,
löst sich in 8-10 Teilen Alkohol, verharzt leicht an der Luft
unter Bildung von Ameisensäure und Essigsäure und wird
dickflüssig. Zur Reinigung wird es am besten mit Dampf unter
Zusatz von etwas Ätzkalk rektifiziert (Terpentinspiritus). Es
ist dann farblos, dünnflüssig, riecht stark, schmeckt
brennend, spez. Gew. 0,86-0,89, löst sich in 10-12 Teilen
90proz. Alkohol, mischt sich mit Äther, siedet bei
152-160°; es löst Schwefel, Phosphor, Harz, Kautschuk und
manche andre Körper, absorbiert Sauerstoff, verwandelt ihn
teilweise in Ozon und verharzt allmählich (unter Bildung von
Ameisensäure). T. besteht aus einem Kohlenwasserstoff C10H16.
Bei längerm Stehen mit Wasser bildet es den Terpentinkampfer
(Terpinhydrat, Terpentinhydrat) C10H16. 2H2O+H2O, welcher sich in
farb- und geruchlosen, leicht löslichen Kristallen
ausscheidet. Dieser schmeckt aromatisch, löst sich in 200
Teilen Wasser, in 6 Teilen Alkohol und wird als harntreibendes,
expektorierendes Mittel und gegen Neuralgien benutzt. Mit trocknem
Chlorwasserstoff bildet T. salzsaures T. (künstlichen Kampfer)
C10H17Cl in farblosen Kristallen, welche kampferartig riechen und
schmecken, in Alkohol und Äther löslich sind und bei
115° schmelzen. Öxydierende Substanzen verwandeln T. in
Ameisensäure, Essigsäure, Oxalsäure etc. T. erzeugt
auf der Haut bei längerer Einwirkung Schmerz, Rötung,
Geschwulst und Bläschen; innerlich wirkt es in
größern Gaben giftig, auch beim Einatmen der
Dämpfe; man benutzt es bei Neuralgien, Diphtheritis,
Lungengangräne, Gallensteinkolik, gegen Würmer, bei
Gonorrhöe, Blasenkatarrh, Typhus etc., äußerlich
als reizendes, kräftigendes Mittel, in der Technik zu Lacken,
Firnissen, Anstrichfarben, zum Bleichen des Elfenbeins, früher
auch als Leuchtmaterial. - Künstliches T., s. Erdöl, S.
767.
Terpentinspiritus s. Terpentinöl. Terpentinhydrat [s.
Terpentinöl.]
Terpsichore (die "Tanzfrohe"), eine der neun Musen, später
besonders die Muse der Tanzkunst und des Chorgesanges; führte
in Bildwerken eine große Leier und in der Rechten das
Plektron. Vgl. Musen (mit Abbildung).
Terra (lat.), Erde, Land; T. incognita. unbekanntes Land;
T. firma, Festland; T. di Siena, Sienaerde (s. Bolus); T. foliata
tartari, essigsaures Kali; T. foliata tartari crystallisata,
essigsaures Natron; T.inebriata, glasierte Thonwaren in der Art der
Robbia-Arbeiten; T. japonica, s. Katechu; T. lemnia, Siegelerde (s.
Bolus); T. ponderosa, Schwererde, Baryt; T. sigillata, s. Bolus; T.
tripolitana Tripel; T. umbria, schwarze Kreide.
Terracina (spr. -tschina), Stadt in der ital. Provinz
Rom, Kreis Velletri, am gleichnamigen Golf des Tyrrhenischen Meers,
früher wichtiger Punkt an der Straße von Rom nach
Neapel, ist Sitz eines Bischofs, hat eine Kathedrale (an der Stelle
eines antiken Tempels), Ruinen eines Palastes des Gotenkönigs
Theoderich, einen Hafen, von welchem 1886: 446 beladene Schiffe mit
15,509 Ton. ausliefen, Fischerei, Handel (Ausfuhr von Holzkohle)
und (1881) 6294 Einw. T. ist das alte volskische Anxur an der Via
Appia und hat noch mehrere römische Altertümer. Die
Umgegend ist wegen ungesunder Luft berüchtigt.
Terra cotta (ital.), s. Terrakotten.
Terra di Lavoro, ital. Provinz, s. Caserta.
Terra di Siena, hellbraune Farbe, in der Malerei
vorzugsweise zu Lasuren verwendet.
Terra d'Otranto, ital. Provinz, s. Lecce.
Terra firma (lat.), festes Land, im Gegensatz zu den
Inseln; insbesondere Bezeichnung aller aus dem Festland Italiens
der Herrschaft der Venezianer unterworfenen Landschaften,
nämlich: das Herzogtum Venedig, die venezianische Lombardei,
die Treviser Mark, das Herzogtum Friaul und Istrien. Auch
hieß so (span. Tierra firma) das nördliche
Küstenland Südamerikas (das spätere Kolumbien) und
im engern Sinn die Landenge von Panama.
Terrafirmaholz, s. Rotholz.
Terrain (franz., spr. -ráng, Gelände), eine
Strecke Land von bestimmter Bodenbeschaffenheit, Gestaltung,
Bebauung und Bewachsung, besonders als Schauplatz kriegerischer
Thätigkeit. Einzelne im T. vorhandene, in sich abgegrenzte und
hervorragende Teile, wie Dörfer, Gärten, Waldungen etc.,
nennt man Terraingegenstände. Längere Strecken, deren
Beschaffenheit die Gangbarkeit unterbricht, wie Wasserläufe,
Einsenkungen, Höhenzüge etc., bilden Abschnitte im T. Wo
größere Flüsse oder Ströme, Gebirgsketten,
Sumpf- und Moorgebiete u. dgl. solche Abschnitte trennen, nennt man
letztere auch besondere Kriegstheater. Offen heißt ein T.
ohne die Übersicht hindernde Terraingegenstände im
Gegensatz zum bedeckten T., in welchem Bewachsung und Anbau die
Übersicht hindern. Durchschnitten oder koupiert heißt
das T. im Gegensatz zum reinen, wenn Wasserläufe, Gärten,
Hecken, Mauere etc. die Bewegung hemmen. Über die Darstellung
des Terrains auf Karten etc. s. Planzeichnen. Die Terrainlehre, d.
h. die wissenschaftliche Beurteilung des Terrains nach seiner
Benutzbarkeit für die Verwendung der
598
Terra incognita - Terrakotten.
Truppen im Krieg, bearbeiteten theoretisch: Pönitz (2.
Aufl., Adorf 1855), O'Etzel (4. Aufl., Berl. 1862), Koeler (das.
1865), v. Böhn (Potsd. 1868), v. Waldstätten (3. Aufl.,
Wien 1872), Frobenius (Berl. 1876, 2 Bde.), v. Rüdgisch (Metz
1874), Streffleur (Wien 1876), Ulrich (Münch. 1888) u. a. In
der Geologie ist T. meist gleichbedeutend mit "Formation", z. B. T.
houiller, f. v. w. Steinkohlenformation; T. salifere, s. v. w.
Salzgebirge (Trias formation).
Terra incognita (lat.), unbekanntes Land.
Terrainkurorte, s. Klimatische Kurorte, S. 846.
Terrainwinkel, der Winkel zwischen einer wagerechten und
einer vom Geschützstand nach dem Fußpunkt des Ziels
gedachten Linie. Liegt das Ziel höher als der
Geschützstand, so ist der T. positiv, andernfalls negativ.
Beim Richten mit dem Quadranten muß der erstere vom
Erhöhungswinkel abgezogen, der negative diesem zugerechnet
werden; s. Elevation.
Terrakotten (v. ital. terra cotta. "gebrannte Erde",
hierzu Tafel "Antike Terrakotten"), jetzt allgemeiner Name für
alle künstlerisch ausgestatteten Produkte der Töpfer und
Thonbildner wie der Bildhauer überhaupt, die sich mit
Kleinplastik beschäftigen. Die Technik des Formens in Thon aus
freier Hand, vermittelst der Hohlform oder auf der Drehscheibe ist
uralt und war schon bei den Ägyptern, dann auch bei den
Babyloniern und Assyrern hoch entwickelt. Mit bemalten und
glasierten Thonfliesen sind am Nil ebenso wie am Tigris und Euphrat
Wände und Fußboden der Wohnungen belegt worden. Aber
erst in Griechenland wird die Technik aufs höchste verfeinert,
die Form geadelt und mit jener Farbenpracht geschmückt, welche
der klassischen Kunst in allen ihren Äußerungen eigen
war. Die Aufgaben der Keramik in dieser Zeit sind doppelter Art,
sie arbeitet teils im Dienste der Architektur und Tischlerei, teils
schafft sie selbständige Gebilde: Gefäße oder
Figuren der verschiedensten Größe, Gestalt und
Bestimmung. Der erstgenannten Gattung gehören die
kastenartigen, bunt bemalten und hart gebrannten Thonplatten an,
welche in ältester Zeit (7. u. 6. Jahrh. v. Chr.) in
Griechenland zur Verkleidung der Gesimsbalken an Tempeln,
Schatzhäusern etc. verwendet worden sind, und deren sich eine
große Anzahl in Olympia, in Sizilien und an der von Griechen
bewohnten unteritalischen Küste vorgefunden haben. Sie waren
in Olympia mit Nägeln auf die steinernen (ursprünglich
aus Holz gefertigten) Geisonblöcke befestigt und dienten dem
geringern Material (poros), das sie bedeckten, als Schutz und
Schmuck zugleich (vgl. Fig. 1 u. 3, T. von Olympia und Selinus, und
die Schrift von Dörpfeld u. a.: "Über die Verwendung von
T. am Geison und Dach griechischer Bauwerke", Berl. 1881). Auch
späterhin, als dieser Gebrauch abgekommen, erhielt sich die
Anwendung von T. als Dachstirnziegel (Fig. 10) und Wasserspeier
(Fig. 2), und beliebt wurde zumal in römischer Zeit die
Verzierung von Wandflächen mit thönernen, bunt bemalten
Relieffriesen, deren viele in kampanischen Gräbern zum
Vorschein gekommen sind. Hauptsammlungen der letztern im Britischen
Museum (London), im Louvre (Paris) und im vatikanischen Museum
(Rom). Vgl. Combe, Description of the collection of ancient
terracottas in the British Museum (Lond. 1810; Campana, Opere in
plastica (Rom 1842). Auch zur Verkleidung hölzerner
Geräte benutzte man frühzeitig Thonreliefs, an denen der
Hintergrund ausgeschnitten wurde, und deren Befestigung mit
Nägeln die im Thon ausgesparten Löcher bezeugen. Eine aus
zahlreichen Beispielen bekannte Klasse derselben bilden die nach
dem Hauptfundort (Insel Melos) so genannten melischen Reliefs (Fig.
11). Auch Vasen pflegte man etwa seit dem 4. Jahrh. v. Chr. mit
bemalten Reliefs an Stelle der einfachern Gemälde zu
schmücken. Besondere Formen und Dekorationsweisen bilden sich
in Athen, Etrurien (schwarze Reliefvasen, vasi di Bucchero) und
Unteritalien (Fig. 4 u. 5) aus, während in der Kaiserzeit
zumeist nur einfarbig rote, mit aus Hohlformen eingepreßten
Reliefs verzierte Thonvasen (Fabriken von Cales etc.) gefertigt
werden (ein Beispiel gibt Fig. 6). Die höchsten Leistungen
dieser Technik erreichte man in der Koroplastik, in der Herstellung
kleiner Rundfiguren, die in der Form gepreßt, gebrannt, dann
mit Pfeifenthon überzogen, aus freier Hand nachmodelliert und
in zarten Farbentönen bemalt wurden. Manche scheinen als
Spielzeug, als Zimmerschmuck gedient zu haben. Die Mehrzahl wurde
für Zwecke des Kultus und des Totendienstes geschaffen. Es
waren Weihgeschenke an die Götter und Toten, daher sie
vorzugsweise in Gräbern gefunden werden. Ein
altertümliches Sitzbild der Athene aus einem attischen Grab
zeigt Fig. 9. Der Blütezeit griechischer Kunst aber
gehören die anmutigen Terrakottafiguren an, die in
erstaunlichen Mengen neuerdings bei Tanagra in Böotien, in
Myrrhina, Ephesos und andern Orten Kleinasiens, auch in Tarent
(Unteritalien) ausgegraben worden sind. Der Farbenschmuck ist meist
bei der Auffindung bereits zerstört, recht gut aber z. B. an
einer Figur der früher dem Grafen Pourtalès-Gorgier
angehörenden Sammlung (Fig. 7) erhalten. Die Gegenstände
sind meist dem Alltagsleben entlehnt, schöne Mädchen zum
Ausgehen angekleidet, mit dem Hut auf dem Kopf, allerlei
Handwerker, spielende Knaben, seltener Darstellungen aus dem Kreis
der Aphrodite und des Eros. Rundfiguren dieser Art wurden dann auch
gern an Vasen angebracht (Fig. 8). In römischer Zeit fertigte
man sogar lebensgroße Figuren aus Thon, für
Giebelkompositionen oder als Grabdenkmäler. Die Renaissance
brachte diese Technik wieder zu neuer Blüte und stellte selbst
Porträtbüsten gern in Terrakotta her (Beispiele im
Berliner Museum); vor allem aber erlangte die Schule der Robbia
durch ihre in heitern Farben prangenden, glasierten Einzelreliefs
(meist Madonnenbilder) hohen Ruf (vgl. Keramik und Thonwaren). Auch
in der Architektur der Renaissance, besonders in der
norditalienischen (lombardischen), gelangte die Terrakotta zum
Schmuck der äußern und Hoffassaden in reich
ornamentierten Gesimsen und Kranzgesimsen, Archivolten,
Fensterumrahmungen, Pilasterfüllungen, Friesen, Medaillons und
sonstigen Zieraten zur Verwendung. Zu unsrer Zeit hat die Baukunst
zum Schmuck der Fassaden von Backsteinrohbauten noch ausgedehntern
Gebrauch von der Terrakotta gemacht, indem auch einzelne
architektonische Glieder, wie Kapitäler, Konsolen u. dgl., nur
aus Terrakotta hergestellt werden, ferner ganze Friese,
Eckakroterien, Figuren und Gruppen zur Bekrönung von
Gebäuden, für Fontänen etc., wobei die Färbung
des Thons meist in Übereinstimmung mit der Farbe der für
die Fassade gewählten Backsteine (gelb oder rot in
verschiedenen Nuancen) gehalten wird. Bei rein ornamentalen T.
kommt auch ein- und mehrfarbige Glasur, selbst Vergoldung zur
Anwendung. Der Backsteinbau mit Terrakottenverzierung blüht am
meisten in den an Werksteinen armen Gegenden, besonders in
Norddeutschland. Fabriken, welche sich mit Anfertigung von
Ornamenten und Kunstgegenständen in Terrakotta
beschäftigen, gibt es in Charlottenburg
ANTIKE TERRAKOTTEN.
Zum Artikel »Terracotta«
1. Sima und Geisonverkleidung vom Schatzhaus der Geloer in
Olympia.
2. Wasserspeier aus Pompeji.
3. Sima vom Tempel C in Selinus.
7. Griechische Thonfigur der Sammlung Pourtales.
5. Unteritalische Vase.
4. Kampanische Reliefvase.
6. Römische gepreßte Terrakotte (Hermes).
11. Tänzerin mit Klappern (melische Relieffigur).
10. Etruskische Stirnziegel (Juno Caprotina).
8. Weinkrug aus Athen (geflügelter dionysischer Eros)
9. Thronende Athene (archaisch).
599
Terralithwaren - Terrasse.
bei Berlin (March), Greppin bei Bitterfeld, Lauban, Ullersdorf,
Tschauschwitz, Siegersdorf und Hansdorf, sämtlich in
Schlesien. Vgl. d'Agincourt, Recueil de fragments de sculpture
antique en terre cotte (Par. 1814); Panofka, T. des
königlichen Museums in Berlin (Berl. 1842); Gruner, The
terra-cotta architecture of North-Italy (Lond. 1867); Birch,
History of ancient pottery (2. Aufl., das. 1873); Kekulé,
Griechische Thonfiguren aus Tanagra (Stuttg. 1878); Derselbe, Die
antiken T. (mit v. Rohden, das. 1880-84, 2 Bde.); "Griechische T.
aus Tanagra und Ephesos im Berliner Museum" (Berl. 1878);
Fröhner, Terres cuites d'Asie Mineure (Par. 1879).
Terralithwaren, s. Siderolithwaren.
Terramaren (v. ital. terra di mare. "Meereserde,
angeschwemmtes Land"), in Parma, Modena und Reggio, vorwiegend in
der Ebene zwischen Po und Apennin, hügelartige Erhebungen von
5 m und mehr Höhe und 60-70 m Durchmesser, hervorgegangen aus
pfahlbauähnlichen Konstruktionen, die man in sumpfigem Terrain
oder inmitten eines künstlich gegrabenen Bassins
aufführte. Der Unrat und die Küchenabfälle wuchsen
unter der Balkendecke allmählich an und bildeten den Kern des
Hügels, auf dem die Menschen wohnen blieben, indem sie nur von
Zeit zu Zeit ihre Wohnungen in ein etwas höheres Niveau
verlegten. Bisweilen liegen die T. auf natürlichen
Hügeln; auch fehlt bisweilen das Pfahlwerk. Einige T. sind
wohl schon in der "neolithischen Zeit" bewohnt gewesen; die
Mehrzahl derselben enthält jedoch primitive
Bronzegegenstände, namentlich Haus- und Ackergeräte und
Schmuckgegenstände, seltener Waffen. Die bemerkenswerte
Übereinstimmung zwischen den Fundgegenständen und der
Konstruktion der schweizerischen Pfahlbauten und der T. hat zu der
Annahme geführt, daß die Besiedler der T. sowie die
Bewohner der Pfahlbauten Piemonts, der Lombardei und Venetiens von
Norden her über die Alpen gekommen seien. Helbig ("Die
Italiker in der Poebene", Leipz. 1879) glaubt, daß die T. wie
die Pfahlbauten an den oberitalienischen Seen von den Italikern
herrühren und die ersten Niederlassungen dieses Volkes
bilden.
Terranova, 1) (T. di Sicilia) Kreishauptstadt in der
ital. Provinz Caltanissetta (Sizilien), am Mittelländischen
Meer, in welches nahe östlich der Fluß T. mündet,
mit Gymnasium, mehreren Kirchen, Resten von Befestigungen, einem
Hafen, in welchem 1886: 752 Schiffe mit 50,259 Ton. einliefen,
Handel (Einfuhr von Steinkohlen und Getreide, Ausfuhr von Getreide,
Bohnen, Baumwolle, Baumwollsamen, Schwefel, Wein, Orangen),
Thunfisch- und Sardellenfang und (1881) 16,440 Einw. T. ist Sitz
eines deutschen Konsuls. Es wurde von Kaiser Friedrich II. nahe an
der Stelle des alten Gela erbaut, von welchem in letzterer Zeit
einige Ausgrabungen gemacht wurden. - 2) (T. Pausania) Stadt in der
ital. Provinz Sassari (Insel Sardinien), Kreis Tempio, am
gleichnamigen Golf und der Eisenbahn Chilivani-Golfo degli Aranci
gelegen, einst eine bedeutende Römerstadt, hat einen Hafen,
aus welchem 1886: 421 Schiffe mit 105,355 Ton. ausliefen (Ausfuhr
von Holzkohle, Kork, Käse), und (1881) 2671 Einw.
Terrarium (lat.), Vorrichtung zur Pflege und Zucht von
Landtieren, entsprechend den für Wassertiere bestimmten
Aquarien. Je nach dem speziellen Zweck, der mit den Terrarien
verfolgt wird, erhalten dieselben sehr verschiedene Einrichtung.
Die einfachsten Terrarien sind größere Kisten, die mit
einem mit Drahtgaze bespannten Rahmen verschlossen werden. Zur
bessern Beobachtung der Tiere ersetzt man eine oder mehrere
Wände der Kiste durch Glasscheiben, auch wird der Boden
vorteilhaft mit Zinkblech benagelt, auf welches man nach dem
Anstreichen handhoch Erde schüttet. Aus dieser einfachsten
Vorrichtung sind sehr luxuriöse Apparate hervorgegangen,
welche namentlich dann am Platz sind, wenn man zur Pflege
tropischer Tiere einer Heizeinrichtung bedarf. Man heizt mit
Petroleum- oder Gasflamme oder sehr vorteilhaft mit Grude, die
langsam und gleichmäßig verbrennt und ungemein billig
ist. Die Heizung geschieht vom Boden aus, erfordert
sorgfältige Regulierung, Überwachung der Luftfeuchtigkeit
im T. und gute Ventilation. Je nach den zu pflegenden Tieren ist
das T. verschieden einzurichten. Eidechsen und viele Schlangen
brauchen trocknen Sand und trockne Schlupfwinkel, die Amphibien
dagegen feuchtes Moos und größere Wasserbecken; fast
immer erweist es sich vorteilhaft, im T. Pflanzen zu kultivieren,
deren Auswahl sich nach der Temperatur und Feuchtigkeit, welche die
Tiere fordern, richten muß. Für kleinere Tiere und zur
Aufzucht der Jungen benutzt man Glasglocken, die, wenn es
erforderlich ist, durch Einstellen in ein Wasserbad geheizt werden.
In solchen oder ähnlichen kleinen Behältern kann man auch
Reptilieneier ausbrüten. Zur Aufzucht von Amphibien dienen
Aquarien, bis die Tiere das Wasser verlassen. In Häusern mit
starken Mauern kann man Fensternischen mit Doppelfenstern als
Terrarien einrichten und hier wie überhaupt Pflanzenkultur mit
Tierpflege erfolgreich verbinden. Der Raum zwischen Doppelfenstern
ist auch leicht zu heizen, wenn man über dem Fensterbrett
einen zweiten Boden (am besten starkes, mehrfach gestütztes
Blech) und in dem abgegrenzten Raum die Flamme anbringt. Will man
sich auf die Zucht heimischer Reptilien und Amphibien
beschränken, dann thut man gut, die Tiere in Winterschlaf
fallen zu lassen, da die Fütterung im Winter umständlich
und teuer ist. Die Einrichtung größerer Terrarien ist
durchaus von den Verhältnissen abhängig. Im Freien hat
man den für das T. bestimmten Raum mit einer etwa 1 m hohen
Mauer umgeben und diese mit einem breiten, etwas abwärts
geneigten Zinkblech bedeckt, um das Entschlüpfen der Tiere
sicher zu vermeiden. In der Mitte des Raums wird aus Steinen ein
Felsen errichtet, welcher hinlänglich Schlupfwinkel darbietet,
auch passend bepflanzt und mit Geäst für die kletternden
Tiere versehen wird. Der Boden muß ausreichende Abwechselung
bieten, mit Sand, Moos, Steinen, Rasen bedeckt sein, auch ist
für Wasserbehälter zu sorgen und, falls Gelegenheit
vorhanden ist, kann man fließendes Wasser, auch wohl einen
Springbrunnen, anbringen. Unter Umständen ist ein solches T.
auch durch radiale Wände zu teilen, selbstverständlich
aber eignet es sich nur für Tiere, welche gegen die Witterung
keines andern Schutzes bedürfen, als wie sie der Felsen, das
Moos oder der Erdboden darbieten. Für Säugetiere
müssen ausreichende Vorkehrungen gegen das Entweichen
getroffen werden, meist wird man das T. mit einem Oberbau aus
Drahtgeflecht versehen müssen, und für grabende Tiere ist
der Boden 1,5 m tief auszuheben, die Grube vollständig mit
Mauerwerk auszukleiden und dann wieder mit Erde zu füllen.
Vgl. Fischer, Das T. (Frankf. a. M. 1884); Dammer, Der Naturfreund,
Bd. 1 (Stuttg. 1885); Lachmann, Das T. (Magdeb. 1888).
Terrasse (franz.), wagerecht abgeplattete
Erderhöhung oder Erdstufe; insbesondere im Land- und Gartenbau
Bezeichnung für die treppenförmigen Absätze zur
Kultivierung von Bergabhängen. Jede T. bil-
600
Terrassierte Werke - Tersteegen.
det eine breite und hohe Stufe, welche sich in horizontaler
Richtung über den ganzen Abhang ausdehnt. Die obere Seite der
Stufe ist eine nur wenig nach vorn geneigte Fläche, die
vordere Seite (Dossierung) eine nicht ganz senkrecht absteigende
Wand, welche, wenn sie nicht aus natürlichem Fels besteht,
durch eine Vormauer oder Rasenverkleidung verwahrt werden
muß. Auch ein plattes Dach an einem Haus oder Turm
(Plattform) wird oft als T. bezeichnet. Über den
geographischen Begriff T. vgl. Thäler u. Hochgestade.
Terrassierte Werke, terrassenförmig angelegte
Befestigungen, wie sie hauptsächlich bei Bergbefestigungen
vorkommen.
Terrasson (spr. -ssóng), Stadt im franz.
Departement Dordogne, Arrondissement Sarlat, an der
Vézère und der Eisenbahn
Périgueux-Figeac-Toulouse, mit Lehrerinnenbildungsanstalt,
Kohlengruben, Stahlwarenfabrikation, Wollspinnerei und (1881) 2711
Einw.
Terrazzo (ital.), Söller, Terrasse; auch Estrich, in
welchen kleine bunte Steine eingewalzt sind, so daß eine
mosaikartige Wirkung entsteht.
Terre Haute (spr. tär oht), Stadt nahe der
Westgrenze des nordamerikan. Staats Indiana, Grafschaft Vigo, am
schiffbaren Wabash und am Wabash- und Eriekanal gelegen, hat breite
und gerade, von Bäumen beschattete Straßen, einen
Gerichtshof, ein Stadthaus, ein Lehrerseminar, eine kath.
Töchterschule, lebhaften Handel (mit Schweinefleisch,
Steinkohlen etc.) und (1880) 26,042 Einw.
Terremoto (span.), Erdbeben.
Terre-Noire (spr. tär-noáhr), Dorf im franz.
Departement Loire, Arrondissement St.-Etienne, an der Eisenbahn
Lyon-St. Etienne, zum Teil auf einem Hügel erbaut, welchen ein
1200 m langer Tunnel durchzieht, hat reiche Kohlengruben (Becken
von St.-Etienne), großartige Eisenwerke (das
Bessemerverfahren wurde hier in Frankreich zuerst angewendet) und
(1886) 2792 (Gemeinde 6489) Einw.
Terres fortes (spr. tär fórt), s.
Bordeauxweine.
Terresin, Mischung von Kohlenteer, Kalk und Schwefel,
dient als Asphaltsurrogat.
Terréstrisch (lat.), auf die Erde bezüglich,
irdisch.
Terreur (franz., spr. -ör, "Schrecken"), s.
Terrorismus; la T. blanche, "der weiße Schrecken", die
Reaktion nach 1815 (Anspielung auf die weiße Fahne der
Bourbonen).
Terribel (lat.), schrecklich.
Terrine (franz.), "irdene" Suppenschüssel, welche im
vorigen Jahrhundert dem Tafelgeschirr zugefügt wurde,
später meist aus Porzellan, bisweilen auch aus Silber
gefertigt; auch thönerne Deckelbüchsen für
Gänseleber- und Geflügelpasteten. Hauptfabrikationsort
für letztere ist Saargemünd.
Territion (lat.), früher die Bedrohung eines
Angeschuldigten mit der Tortur (s. d.) durch Vorzeigen der
Folterwerkzeuge, wodurch der Inquirent das Geständnis zu
erzwingen suchte.
Territorial (lat.), ein Territorium (s. d.) betreffend,
damit verbunden.
Territorialarmee, in Frankreich s. v. w. Landwehr.
Territorialdivisionen, in Belgien bis 1875 die drei
großen Bezirke für die militärische Verwaltung.
Territorialhoheit, die Gesamtheit der Befugnisse, welche der
Staatsgewalt in Bezug auf das Staatsgebiet zukommen; im
frühern Deutschen Reich s. v. w. Landeshoheit im Gegensatz zu
der Reichshoheit.
Territorialprinzip (lat.), Rechtsgrundsatz, wonach der
Erwerb eines Territoriums den Erwerb der Souveränität in
sich schließt; auch der Grundsatz, wonach die in einem
bestimmten Land Wohnenden unter der Gesetzgebung dieses Landes
stehen und die dort vorgenommenen Rechtshandlungen, ebenso wie die
dort begangenen Verbrechen, nach den Landesgesetzen beurteilt
werden.
Territorialretrakt, s. Landlosung.
Territorialsytem, diejenige kirchenrechtliche Theorie,
nach welcher der höchste Episkopat des Landesherrn ein
Ausfluß der Landeshoheit sein soll. Das T. beruht auf dem
Grundsatz: Cujus regio, ejus religio, d. h. wem im Lande die
höchste Gewalt zusteht, dem gebührt auch die Regierung
des Kirchenwesens. Es entstand als Übertreibung des
Episkopalsystems (s. d.) und fand infolge des Westfälischen
Friedens oft eine drückende Anwendung. Konsequent verfolgt,
führt es zum Cäsareopapat (Cäsareopapie) oder
weltlichen Papsttum und ward in dieser Weise besonders von Hobbes
in den Schriften: "De cive" und "Leviathan" entwickelt. Eine
wissenschaftliche Begründung erhielt das T. in Deutschland
durch Pufendorf in der Schrift "De habitu religionis ad vitam
civilem" (Brem. 1687). Im Gegensatz dazu stellte Chr. Matth. Pfaff
das Kollegialsystem (s. d.) auf. Vgl. Kirchenpolitik, S. 765. - T.
heißt auch ein Wehrsystem, nach welchem sich die
Heeresorganisation an die Landeseinteilung anschließt, wo
also die einzelnen Truppenteile sich aus den Wehrpflichtigen
bestimmter Landesbezirke ergänzen, gewisse Landwehr- oder
Landsturmformationen aufstellen. Die Anfänge eines solchen
Systems bildet die Kantonverfassung (s. d.) Preußens. In den
heutigen Heeresverfassungen der meisten Länder kommt das T. in
einer oder der andern Form zum Ausdruck.
Territorium (lat.), Gebiet, im Mittelalter Amtsbezirk
eines mit Verwaltung der kaiserlichen Hoheitsrechte betrauten
Vasallen; dann, nachdem dergleichen Beamte zu Landesherren
geworden, s. v. w. Landesgebiet im Gegensatz zum Reichsgebiet. In
der nordamerikanischen Union versteht man unter T. (engl.
territory) ein durch den Kongreß abgegrenztes Gebiet, welches
durch einen vom Präsidenten ernannten Gouverneur verwaltet
wird. Die gegenwärtig vorhandenen zehn Territorien (Alaska,
Arizona, Dakota, Idaho, Indianerterritorium, Montana, Neumexiko,
Utah, Washington und Wyoming) gehören nicht zu den
selbständigen Staaten der Union. Sie entsenden zu dem
Kongreß einen Abgeordneten, der jedoch nicht stimmberechtigt
ist.
Terrorismus (lat.), Schreckenssystem,
Schreckensherrschaft. Berüchtigt ist besonders der
französische T. (la Terreur) zur Zeit der ersten Revolution
(vom Mai 1793 bis 27. Juli 1794); die damaligen Gewalthaber
hießen Terroristen, Schreckensmänner. Vgl. Ternaux,
Histoire de la Terreur (Par. 1862 bis 1867, 8 Bde.). Terrorisieren,
in Schrecken setzen, eine Schreckensherrschaft ausüben.
Tersane-Nasir (türk.), Arsenaldirektor.
Ter-Schelling, niederländ. Insel in der Nordsee, vor
dem Eingang des Zuidersees, etwa 100 qkm groß mit drei
Dörfern und (1887) 3685 Einw. T. ist Sitz eines deutschen
Konsuls.
Tersteegen, Gerhard, Liederdichter und asketischer
Schriststeller, geb. 25. Nov. 1697 zu Mörs, lebte als
Bandmacher in Mülheim a. d. R., bis er sich seit 1728
ausschließlich der religiösen Schriftstellerei und dem
Predigeramt in frommen Konventikeln widmete, und starb 3. April
1769 daselbst. Von seinen Schriften sind hervorzuheben:
"Geistliches Blumengärtlein" (neueste Ausg., Stuttg. 1884);
"Brosamen" (Soling. 1773); "Gebete" (neue Aufl., Mülheim 1853)
und seine "Briefe" (Soling. 1773-75, 2 Bde.).
Tertiärformation I.
Crassatella ponderosa (Art. Muscheln), äußere
Seite.
Cancer macrocheilus. (Art. Krallen.)
Crassatella ponderosa, innere Seite.
Nummulites, Horizontaldurchschnitt der Schale. (Art.
Nummuliten.)
von oben
von unten
Sciltella striata. (Art. Echinoideen.)
Nummulites nummularia, von oben.
Nummulites, von der Seite.
Limnaeus pyramidalis. (Art. Schlammschnecke.)
Rhombus minimus. (Art. Fische.)
Cerithium hexagonum. (Art. Schnecken.)
von der Seite
von vorn
Planorbis discus. (Art. Lungenschnecken.)
Zähne von Notidanus primigenius. (Art. Selachier.)
Turbinolia sulcata. (Art. Korallen.)
Kauplatte von Myliobatus punctatus. (Art. Selachier.)
Zahn von Carcharodon heterodon. (Art. Selachier.)
Tertiärformation II.
Schädel von Rhinoceros incisivus. (Art. Huftiere.)
Zeuglodon macrospondylus, restauriert. Verkleinerung 1/100.
(Art. Wale.)
Anoplotherium commune, restauriert. (Art. Huftiere.)
Backenzahn von Mastodon australis. (Art. Mastodon und
Rüsseltiere.)
Unterkiefer von Dryopithecus Fontani; natürliche
Größe, a zerbrochener Eckzahn. (Art. Affen.)
Skelett des Megatherium Cuvieri. (Art. Megatherium und
Zahnlücker.)
Platte mit einem Abdruck von Andrias Scheuchzeri. Kopf,
Vorderfüße und Rückenwirbelsäule sind
erhalten. (Art. Andrias.)
Mylodon robustus, restauriert. (Art. Megatherium und
Zahnlücker.)
Kopf des Dinotherium giganteum, sehr stark verkleinert. (Art.
Dinotherium und Rüsseltiere.)
Backenzahn von Dinotherium giganteum, von der Krone aus gesehen,
sehr stark verkleinert.
Glyptodon clavipes. (Art. Zahnlücker.)
601
Tersus - Tertiärformation.
Am bekanntesten wurde er als Dichter pietistisch gefärbter,
aber gemütvoller und durch wahre Frömmigkeit
ausgezeichneter Kirchenlieder ("Jauchzet ihr Himmel, frohlocket ihr
englischen Chöre", "Siegesfürst und Ehrenkönig",
"Nun sich der Tag geendet " etc.). Eine Sammlung seiner Schriften
erschien Stuttgart 1844-45, 8 Bde. Sein Leben beschrieben Kerlen
(2. Aufl., Mülh. 1853) und Stursberg (das. 1869).
Tersûs, Stadt, s. Tarsos.
Terteln, Kartenspiel, s. Tatteln.
Tertia (lat.), die dritte Schulklasse; Tertianer,
Schüler derselben. In der Buchdruckerkunst heißt T. eine
Schriftgattung von 16 typographischen Punkten Kegelstärke (s.
Schriftarten).
Tertian (lat.), dreitägig; Tertianfieber, Fieber,
das jeden dritten Tag eintritt (s. Wechselfieber).
Tertiär (lat.), die dritte Stelle in einer
Reihenfolge einnehmend; so heißt in der Heilkunde die dritte
Periode der Syphilis mit schweren Erkrankungen der Haut, Knochen
und Eingeweide tertiäre Syphilis; als Substantivum (das T.)
auch s.v. w. Tertiärformation (s. d.).
Tertiärbahnen, Eisenbahnen dritter Ordnung zum
Transport von Kohlen, Erzen etc. in Bergwerken, Fabrikanlagen etc.,
welche auf geneigten Strecken meist mittels Seil oder Kette
betrieben werden.
Tertiärformation (hierzu Tafeln
"Tertiärformation I u. II"), in der Geologie Schichtenfolge,
jünger als die Kreidebildungen und älter als das
Diluvium. Der Name ist im Gegensatz zu "primär" und
"sekundär" als Bezeichnungen der ältern Formationen
gewählt, Ausdrücke, welche jetzt fast ganz außer
Gebrauch gekommen sind, während speziell tertiär
allgemein üblich geblieben ist. Zusammen mit dem jüngern
Diluvium (Quartär) und dem noch jüngern Alluvium
(Rezent), die wohl auch als Posttertiär zusammengefaßt
werden, bildet das Tertiär die känozoische
Formationsgruppe im Gegensatz zu der mesozoischen und
paläozoischen. Charakteristisch für die
Tertiärbildungen ist der große Einfluß, den die
Herausbildung der Klimazonenunterschiede auf die Beschaffenheit der
damaligen Tier- und Pflanzenwelt ausgeübt hat, während
solche klimatische Sonderungen in den ihr an Alter vorausgehenden
Formationen nur eben nachweisbar sind. Eigentümlich ist ferner
das Zurücktreten oder vollkommene Verschwinden vieler
tierischer und pflanzlicher Formen, welche noch dem mesozoischen
Zeitalter einen fremdartigen, von unsrer heutigen Schöpfung
wesentlich verschiedenen Charakter aufprägten, während im
Tertiär Pflanzen und Tiere teils neu auftreten, teils zu
dominieren beginnen, welche den uns umgebenden näherstehen.
Weiter bietet das Tertiär vorzüglich in seinen
jüngern Abteilungen besondere Lagerungsverhältnisse dar:
die meisten Vorkommnisse sind auf einzelne, voneinander isolierte
Becken beschränkt, und nur von älterm
Tertiärmaterial finden sich zusammenhängende, über
weite Strecken ununterbrochen verbreitete Ablagerungen. In den
isolierten Becken wechseln Schichten, in denen Meeresformen
aufgehäuft sind, mit solchen, die brackische Formen oder
Süßwasser- und Landorganismen führen, oft in
mehrfacher Folge. Einige dieser Eigentümlichkeiten der T.,
namentlich die zuletzt erwähnten, erschweren die
Parallelisierung und Etagierung der Schichten sehr bedeutend. Eine
noch jetzt in ihren Grundzügen beibehaltene Einteilung der
Tertiärschichten rührt von Lyell (1832) her und beruht
auf Verhältniszahlen zwischen ausgestorbenen und noch lebenden
Mollusken, welche zuerst von Deshayes berechnet worden waren.
Derselbe hatte gefunden, daß in den ältesten Schichten
der T. etwa 97 Proz. aller Mollusken Arten angehören, welche
sich in unsrer heutigen Schöpfung nicht mehr vorfinden,
daß dieser Prozentsatz für die mittlere T. auf etwa 81
sinkt und in den jüngsten Schichten nur noch 48 beträgt,
so daß in diesen die Mehrzahl der Versteinerungen sich den
Arten der Jetztwelt unterordnen läßt. Lyell fixierte
diese drei Stufen als Eocän, Miocän und Pliocän.
Neuere Untersuchungen haben zwar diese Zahlen wesentlich
korrigiert, im allgemeinen aber doch die Zunahme noch lebender
Formen in den jüngern Schichten bestätigt; ja, bei der
Vereinzelung vieler tertiärer Ablagerungen bildet dieses
prozentige Verhältnis zwischen noch lebenden und schon
ausgestorbenen Arten oft die einzige Unterlage für die
relative Altersbestimmung. Dagegen hat sich der Sprung vom
Eocän zum Miocän als zu groß, dem Intervall
zwischen Miocän und Pliocän nicht gleichwertig
herausgestellt, weshalb Beyrich (1854) zwischen Eocän und
Miocän noch Oligocän einschob. Eine ursprünglich von
Mayer herrührende, von andern mannigfaltig geänderte
Einteilung der Tertiärschichten unterscheidet zwölf
Stufen, die nach hervorragenden Lokalitäten ihres Vorkommens
benannt werden, und von denen die Soissonische, Londoner, Pariser
und Bartonische dem Eocän, die Ligurische, Tongrische und
Aquitanische dem Oligocän, die Mainzer (auch Langhische Stufe
genannt), Helvetische und Tortonische dem Miocän und endlich
die Piacentische (Messinische) und Astische Stufe dem Pliocän
zuzurechnen sein würden. Mayers Originalbezeichnungen sind
französisch, z. B. Tongrien, Mayencien, Helvetien etc. Mayer
selbst aber trennt die T. in nur zwei Abteilungen: das
Alttertiär (Paläogen) und das Neutertiär (Neogen),
von denen das erstere Eocän und Oligocän, das letztere
Miocän und Pliocän umfaßt. Die "Übersicht der
geologischen Formationen" (s. Geologische Formation) gibt einen
Katalog aller wichtigen Tertiärablagerungen, während im
folgenden nur einige in geographischer Anordnung besprochen werden
sollen.
Zu den ältesten Bildungen der T. gehören die untersten
Schichten des Paris-Londoner Beckens, welches schon während
der Eocänperiode einer wiederholten Aussüßung
unterlag, was sich in dem Wechsel der Versteinerungen deutlich
ausspricht. Oft genannt werden die Pariser Grobkalke (Calcaire
grossier), reich an Tierresten, von denen die Tafel I Korallen
(Turbinolia sulcata), Fischzähne (Carcharodon heterodon),
Schnecken (Cerithium hexagonum) und Zweischaler (Crassatella
ponderosa) darstellt. Etwas älter ist der Londonthon (London
clay), welchem die abgebildete Kauplatte eines Rochens (Myliobatus
punctatus, s. Tafel I) entstammt, noch älter die Tanetthone
und -Sande, jünger die plastischen Thone von Barton und
Bembridge, aus denen als Repräsentanten von
Süßwasserschnecken Lymnaeus pyramidalis und Planorbis
discus abgebildet sind (s. Tafel I). Die jüngern Schichten des
Beckens fallen dem Oligocän zu, so namentlich die Gipse des
Montmartre (Paläotherienschichten), an dessen reiche Reste
(Palaeotherium, Anoplotherium commune, s. Tafel II) sich die
berühmten Untersuchungen Cuviers anknüpften, sowie der
Sandstein von Fontainebleau. An der Grenze zwischen Oligocän
und Miocän stehen die Süßwasserkalke von La Beauce,
und ungefähr gleichalterig sind die Indusienkalke der
Auvergne, mit Phryganeenhülsen (Indusien), die aus kleinen
zusammengekitteten Konchylien bestehen, durchspickte
602
Tertiärformation (die wichtigsten
Tertiärablagerungen).
Kalke. Noch jünger sind die Faluns der Touraine und der
Bretagne, muschelreiche Sande und Mergel, aus denen Tafel I einen
Seestern (Scutella striata) abbildet. In England sind
außerdem pliocäne Schichten vertreten, der sogen. Crag,
der sich in mehrere Etagen gliedern läßt. Eine rein
marine Facies des Untertertiärs ist die Nummulitenformation.
Wenn auch für diese die früher vorausgesetzte
Gleichartigkeit nicht besteht, die betreffenden Gesteine vielmehr
verschiedenen Altersstufen untergeordnet werden müssen, so
sind doch die Altersunterschiede dieser aus Kalksteinen,
Sandsteinen und Schiefern bestehenden überaus mächtigen
Ablagerungen gering: es entsprechen die ältesten etwa dem
Pariser Grobkalk, die jüngsten der untern Abteilung des
Öligocäns. Kalksteine und Sandsteine sind mitunter
überreich an großen Foraminiferen (Nummuliten, s. Tafel
I u. beistehende Textfigur);
[siehe Graphik]
Nummulitenkalk.
die Schiefer (Flysch, s. übrigens auch Kreideformation)
führen Fucus-Arten. Wesentlich unterscheidet sich die Bildung
von dem in abgeschlossenen Becken auftretenden Tertiär durch
die an ältere Formationen erinnernde Mannhaftigkeit der
Entwickelung nach vertikaler Mächtigkeit und horizontaler
Erstreckung. In den Ländern am Mittelmeer beginnend,
beteiligen sich Nummulitengesteine an der Zusammensetzung der
Pyrenäen, Alpen, Apenninen und Karpathen, durchziehen
Kleinasien, sind im Himalaja vertreten und von den Sundainseln,
China und Japan bekannt. In verschiedenen Niveaus führen sie
fischreiche Schichten, so in einem tiefern, am Monte Bolca in
Norditalien (s. Rhombus minimus, Tafel I), mit denen auch die
Basalttuffe von Ronca fast gleichalterig sind, in einem höhern
ein schwarzes, den alten Thonschiefer vollkommen gleichendes
Gestein, den Fischschiefer von Glarus (Glarner Schiefer), in noch
höherm Niveau (Ungarn) solche mit Meletta crenata. In mehreren
der genannten Gebirge, den Pyrenäen, Alpen und dem Himalaja,
steigen die Nummulitengesteine bis zu sehr bedeutenden
Meereshöhen (im Himalaja bis über 5000 m) hinauf, ein
Beweis, daß die Hebung dieser Gebirge erst in einer
spätern Periode als in der des Alttertiärs erfolgt sein
muß. Daß die mit den Sammelnamen "Wiener Sandstein" (in
den Südalpen Macigno) und "Karpathensandstein" bezeichneten
Schichten ebenso wie der Flysch nur teilweise hierher gehören,
teilweise aber zur Kreideformation, wurde dort erwähnt. An
einzelnen Stellen, namentlich in Bayern, werden die
Nummulitengesteine glaukonitisch und eisenführend, so
daß sie als Eisenerze gefördert werden (Sonthofen,
Kressenberg); an andern Orten in den Alpen (Häring, Reit im
Winkel) finden sich kohleführende Schichten. Ungefähr
gleichalterig, teils oligocän, teils miocän, sind die
besonders für Württemberg und die Schweiz wichtigen
Bohnerze, welche kleine Becken oder Ausfüllungen von
schlotähnlichen Vertiefungen in Jurakalken bilden, denen sie
wegen dieser lokalen Verknüpfung lange beigezählt wurden,
während ihre Reste (Säugetierknochen und Zähne) sie
der T. zuweisen. Molasse ist kein streng geologischer Begriff,
sondern eher ein petrographischer und bezeichnet meist feinere,
lockere Sandsteine, besonders typisch in der Schweiz, aber auch in
Oberschwaben entwickelt. Die Annahme einer Molassenformation hat
nach genauern paläontologischen Untersuchungen weichen
müssen; es gehören diese Bildungen verschiedenen Stufen
des obern Oligocäns und des Miocäns an und bergen teils
meerische, teils Süßwasserformen. Aus der Meeresmolasse
bildet die Tafel I den Haifischzahn, Notidanus primigenius, ab. Der
obern Süßwassermolasse, dem mittlern Miocän, werden
auch die Kalke von Öningen in Oberbaden zugerechnet, welche
einen ganz außerordentlichen Reichtum an pflanzlichen und
tierischen Formen enthalten, unter den letztern jenen
Riesensalamander (Andrias Scheuchzeri, s. Tafel II), den Scheuchzer
1732 als Homo diluvii testis beschrieb. Auch Nagelfluh ist ein
petrographischer Begriff: die mit diesem Namen belegten polygenen
Konglomerate gehören teils zum obern Oligocän, teils zum
Miocän. Die Schichten, welche im W. Deutschlands das Mainzer
Becken auf beiden Seiten des Rheins, mainaufwärts bis
Aschaffenburg, nördlich zwischen Taunus und Vogelsberg bis
gegen Gießen, bilden, sind teils Oligocän, teils
Miocän. Zu ersterm zählen unter anderm die Meeressande,
unter deren Resten namentlich die einer Seekuh (Halianassa)
bemerkenswert sind, die Septarien- oder Rupelthone, die
Landschneckenkalke, die Cerithienschichten und Cyrenenmergel. Dem
Miocän werden Kalke, oft ganz erfüllt mit einer kleinen
Schnecke (Litorinella), und Sandsteine mit Pflanzenabdrücken,
sogen. Blättersandsteine (z. B. von Münzenberg in
Hessen), beigerechnet und als jüngste Etage die Eppelsheimer
Sande (Dinotheriensande), welche viele Säugetierreste, unter
ihnen Rhinoceros (s. Tafel II) und Dinotherium (s. Tafel II),
enthalten. Von dem großen Wiener Becken sind höchstens
die ältesten Schichten dem Oligocän beizuzählen; das
Gros der Bildung gehört dem Miocän, bis zu der
jüngsten Stufe hinauf, an. Lokale Benennungen sind, von unten
nach oben geordnet: der Leithakalk (Nulliporenkalk), ein fast nur
aus Versteinerungen bestehender Kalk, der Tegel, ein kalkhaltiger
Thon, beide wohl parallele Facies einer und derselben
Bildungsperiode, Cerithienschichten, Kongerienschichten, oberer
Tegel, Belvedereschichten. Gleichalterig sind die wichtigen
Steinsalzablagerungen in Galizien (Wieliczka, Bochnia) und in
Siebenbürgen (Kalusz), von denen Wieliczka jährlich gegen
1½ Mill. Ztr. Steinsalz liefert. In Norddeutschland sind
zahlreiche Tertiärbildungen bekannt, durch Bedeckung seitens
jüngerer Schichten in eine große Anzahl kleiner Becken
geteilt und meist dem Oligocän angehörig. Als technisch
wichtiges Produkt führen diese Schichten Braunkohlen, unter
denen die der Rhön, der Wetterau und des Niederrheins
jünger als die Ostdeutschlands und als die Bernstein
führenden Schichten des Samlandes sind. Zwischen diesen
kohleführenden Schichten sind marine Niveaus entwickelt, wie
die Sande von Egeln, die Sande der Kasseler Gegend, die Kiese von
Meck-
603
Tertiärformation (Pflanzen- u. Tierformen, vulkanische
Thätigkeit der Tertiärzeit).
lenburg mit den Sternberger Kuchen (versteinerungsreiche
Konkretionen). Italien besitzt außer den oben erwähnten
alttertiären Gesteinen auch weit jüngere, die als
Subapenninenformation zusammengefaßt werden. Sie sind bis zu
mehreren Hunderten von Metern mächtig und reich an Arten,
welche fast ausnahmslos mit noch lebenden mittelmeerischen oder
tropischen identisch sind. Tafel I gibt einen Taschenkrebs (Cancer
macrocheilus) aus diesen Schichten. Auch jenseit des Ozeans, in
Nordamerika, sind zahlreiche Tertiärbildungen bekannt, welche
reiche Funde, namentlich an höhern Tieren, geliefert haben. In
Grönland treten Braunkohlen auf, welche einen
Rückschluß auf das damals herrschende Klima gestatten.
Die Kalktuff- und Lehmschichten aber, welche in riesigen
Ablagerungen die Pampas am La Plata-Strom in Südamerika
bilden, und von deren Riesenformen Tafel II einige Abbildungen
(Glyptodon, Megatherium, Mylodon) gibt, werden jetzt nicht mehr wie
früher dem Jungtertiär, sondern dem Diluvium (s. d.)
zugerechnet.
Unter den Pflanzenformen, zunächst des Alttertiärs,
spielen besonders die Koniferen (Taxites, Taxoxylon,
Cupressinoxylon, Sequoia) eine hervorragende Rolle als
kohlebildende Pflanzen, von denen auch der Bernstein geliefert
wurde, der sich aber meist fern von den erzeugenden Pinus-Arten auf
sekundärer Lagerstätte in glaukonitischen Sanden
vorfindet. Die Thone, Sandsteine und Schiefer führen Reste von
Chondrites-Arten (in meerischen Schichten), Palmen, Pandanen,
Seerosen, Feigen, immergrünen Eichen, Lorbeer,
Sandelbäumen, Myrten und Proteaceen, während die
Sagobäume ganz zurücktreten. Die sämtlichen Pflanzen
des Alttertiärs tragen einen tropischen Charakter an sich, wie
denn auch die Land- und Süßwasserkonchylien ihre
nächsten Verwandten unter den heutigen Arten von Ostasien,
Polynesien und Indien haben. Auch nach den Pflanzenformen des
Neogens, unter welchen 119 Arten Monokotyledonen und gegen 500
Arten Dikotyledonen gezählt werden, berechnet O. Heer für
die verschiedenen Fundorte eine gegen 9° C. höhere
Mitteltemperatur während der Neogenzeit, als heute an
denselben Orten herrscht. Er nimmt an:
Mitteltemperatur zur
frühern Miocänzeit spätern Miocänzeit
in Oberitalien .... 22° 20°
in der Schweiz .... 20½° 18½°
bei Danzig .... 16° -
in Schlesien .... - 15°
in Nordisland .... 9° -
Unter den Tierformen der T. sind die Molluskenordnungen schon
ganz in dem für die Jetztwelt bestehenden Verhältnis
vertreten. Zweischaler und Schnecken überwiegen; Brachiopoden
und namentlich Cephalopoden, noch in der Kreide in
großartigem Formenreichtum entwickelt, treten vollkommen
zurück. Gleiches Schicksal teilen die Krinoideen, die
Meeressaurier und Flugsaurier. Weitaus das meiste Interesse unter
den tertiären Tierformen erregen die Säugetiere, teils
weil sie im Gegensatz zu der in ältern Formationen allein
vertretenen Ordnung der Beuteltiere viel mannigfaltigere Typen
aufweisen, teils weil sie gewisse in der heutigen Schöpfung
nur lückenhaft entwickelte Ordnungen ergänzen. Schon im
Alttertiär treten Wale auf, so das aus Alabama stammende, 15 m
lange Zeuglodon (Tafel II), besonders aber Mischlingstypen zwischen
den Wiederkäuern und Dickhäutern, wie Palaeotherium und
Anoplotherium (Tafel II). Daneben kommen vereinzelt
Fledermäuse, Raubtiere, Nager, Insektenfresser und Affen vor,
während Funde in Nordamerika die abenteuerlichen Gestalten des
Loxolophodon und Dinoceras geliefert haben, sechsfach gehörnte
Tierkolosse, welche gewisse Merkmale des Tapirs, des Rhinozeros und
des Elefanten in sich vereinigen. Für das Neogen sind vor
allen die Mastodonten (Tafel II), Elefanten mit vier
Stoßzähnen und eigentümlichen, nicht
blätterig, sondern zitzenförmig gebauten Zähnen,
charakteristisch, daneben Dinotherium (Tafel II), ein riesiges
Rüsseltier mit abwärts laufenden Stoßzähnen,
in der übrigen Bezahnung an den Tapir erinnernd. Ferner treten
gehörnte und ungehörnte Rhinozerosarten, Giraffen,
Antilopen, Hunde, Raubtiere sowie einige Affen auf, von denen
Dryopithecus (Tafel II) ein besonderes Interesse erregt, weil seine
Bezahnung der des Menschen so nahe steht, daß einzelne
aufgefundene Zähne lange Zeit für menschliche gehalten
wurden. Endlich birgt das Jungtertiär in Anchitherium und
Hipparion Stammformen unsers Pferdes.
Die Produkte der vulkanischen Thätigkeit während der
Tertiärperiode sind Basalte, Andesite, Trachyte und
Phonolithe, meist mit Laven historischen Ursprungs petrographisch
vollkommen übereinstimmend. Ihre als Tuffe ausgebreiteten
Zertrümmerungsprodukte sind durch Wechsellagerung mannigfaltig
mit rein sedimentärem Material verknüpft und führen
oft als einen greifbaren Beweis gleichzeitiger Bildung
tertiäre Petrefakten. Im schroffen Gegensatz zu der Seltenheit
vulkanischen Materials, welches gleichaltrig mit Kreide-, Jura- und
Triasgesteinen ist, sind die Eruptivgesteine tertiären Alters
äußerst zahlreich. In Deutschland gehören hierher
die isolierten Basalt- und Phonolithkuppen des Hegaues, die Basalte
der Alb, die Tuffe und Bomben im Ries, die vulkanischen Gesteine
des Kaiserstuhlgebirges, die Umgebungen des Laacher Sees, die der
Eifel, des Siebengebirges, Westerwaldes, Vogelgebirges,
Habichtwaldes und Meißners, der Rhön, die isolierten
Partien im Thüringer Wald, Fichtelgebirge, Erzgebirge und
Riesengebirge. Gleichalterig sind ferner die nordböhmischen,
ungarischen und siebenbürgischen Territorien vulkanischen
Materials. Hierzu gesellen sich weiter die Gebiete in
Zentralfrankreich, in Norditalien, in Schottland, Irland, auf den
Shetlandinseln, den Färöern und Island. Auch im
Süden Europas begann die heute noch andauernde vulkanische
Thätigkeit schon während der Tertiärzeit. Gleich
zahlreiche Belege für die großartige Entwickelung der
Vulkane in der T. wären auch aus außereuropäischen
Ländern beizubringen.
Vgl. Beyrich, Über den Zusammenhang der norddeutschen
Tertiärbildungen (Berl. 1856); v. Ettingshausen, Die
Tertiärflora der österreichischen Monarchie (Wien 1851);
die Schriften von Heer: "Flora tertiaria Helvetiae" (Zürich
1854-58), "Urwelt der Schweiz" (2. Aufl., das. 1878), "Über
das Klima und die Vegetationsverhältnisse des
Tertiärlands" (Winterthur 1860) und "Flora fossilis arctica"
(Zürich u. Winterthur 1868-75, 3 Bde.); Hörnes u.
Reuß, Die fossilen Mollusken des Tertiärbeckens von Wien
(Wien 1851-71, 2 Bde.); v. Könen, Über die
Parallelisierung des norddeutschen, englischen und
französischen Oligocäns (Berl. 1876); Sandberger,
Untersuchungen über das Mainzer Tertiärbecken (Wiesbad.
1853); Derselbe, Die Konchylien des Mainzer Tertiärbeckens
(das. 1863); Lepsius, Das Mainzer Becken (Darmst. 1883);
Sueß, Der Boden der Stadt Wien (Wien 1862); Fuchs,
Erläuterungen zur geologischen Karte der Umgebung Wiens (das.
1873); Derselbe, Übersicht der jüngern Ter-
604
Tertiarier - Terz.
tiärbildungen des Wiener Beckens etc. (Berl. 1877); Karrer,
Geologie der Franz Joseph-Hochquellenwasserleitung (Wien 1877).
Tertiarier und Tertiarierinnen (lat. Tertius ordo de
poenitentia), Laien, die an dem Verdienst eines Ordens Anteil
haben, aber in der Welt bleiben. Dergleichen Orden (Bußorden,
dritte Orden) führen sich zurück auf den heil.
Franziskus, welcher, als 1221 ganze Scharen von Männern und
Frauen Aufnahme in Klöster verlangten, einen Orden von
Halbmönchen und Halbnonnen schuf und demselben eine Regel in
20 Kapiteln gab, nach welcher sie durch Vermeidung von
leichtsinnigen Eiden, Zänkerei, des Besuchs von Schauspielen,
üppigen Lebens etc. den Klosterleuten im Leben ähnlich
werden könnten, ohne ihre Verbindungen mit der Welt zu
verlassen. Ihre Kleidung war meist ein aschgrauer Rock, mit einem
Strick umgürtet, die der Schwestern ein weißer Schleier.
Selbst Kaiser Karl IV. und König Ludwig IX. von Frankreich
sowie viele andre fürstliche Personen gehörten dem Orden
an. Zu Ende des 13. Jahrh. legten eine Anzahl von Tertiariern die
Ordensgelübde ab und wurden Religiosen, wodurch die
regulierten T. (regulierter Bußorden) entstanden. Dieselben
teilten sich mit der Zeit in eine Menge von Korporationen. Auch
verschiedene Orden der regulierten Klosterfrauen vom Bußorden
tauchten auf, in Deutschland Elisabetherinnen genannt. Von ihnen zu
unterscheiden sind die Hospitalbrüder und Hospitalschwestern
vom dritten Orden des heil. Franziskus.
Tertiärsystem, s. v. w. Tertiärformation.
Tertiawechsel, s. Wechsel.
Tertie (lat.), der jetzt nur noch selten
gebräuchliche 60. Teil einer Sekunde bei der Winkel- und
Zeiteinteilung, im ersten Fall durch drei der Zahl oben beigesetzte
Striche bezeichnet, z. B. 4° 9' 25'' 10''' = 4 Grad 9 Minuten
25 Sekunden 10 Tertien.
Tertiogenitur (lat.), Abfindung, welche dem Drittgebornen
oder dessen Linie nach der Bestimmung mancher fürstlichen
Hausgesetze gewährt wird, meist ein Vermögenskomplex,
früher auch zuweilen eine Entschädigung an Land und
Leuten, wie dies z. B. in dem habsburgischen Haus der Fall gewesen
ist, dessen Primogenitur die österreichische Monarchie,
während die Sekundogenitur Toscana, die T. Modena war.
Tertium comparationis (lat., "das Dritte der
Vergleichung"), der Vergleichungspunkt, das, worin zwei verglichene
Dinge übereinstimmen.
Tertium non datur (lat., "ein Drittes gibt es nicht"),
Formel zur Bezeichnung, daß zwei Urteile einander
kontradiktorisch entgegenstehen, ein dritter Fall also außer
den beiden angegebenen nicht möglich ist.
Tertius gaudet (lat.), "der Dritte freut sich"
(nämlich wenn zwei sich streiten); vollständiger: Duobus
litigantibus tertius gaudet.
Tertulia (span.), gesellige Zusammenkunft, besonders
Abendgesellschaft, in welcher man sich durch Konversation,
Gesellschaftsspiele, bisweilen wohl auch mit Tanzen
unterhält.
Tertullianus, Quintus Septimius Florens, lat.
Kirchenvater, geboren um 160 zu Karthago, war daselbst als
Rechtsgelehrter und Rhetor thätig und trat erst um 185 zum
Christentum über. Er war ein Mann von strenger Denkungsart,
heftigem Charakter und reicher, oft wilder Phantasie und ward durch
seine ganze Gemütsrichtung der Richtung der Montanisten (s.
d.) zugeführt. Er starb um 230. Seine Schriften,
apologetischen ("Apologeticum, Ad gentes" u. a.), moralischen und
disziplinarischen Inhalts, reich an Gedanken, aber vielfach dunkel
und in dem rauhen afrikanischen Stil abgefaßt, wurden
neuerdings von Leopold (Leipz. 1839-41, 4 Bde.) und Öhler
(das. 1853, 3 Bde.) herausgegeben und von Kellner (Köln 1882,
2 Bde.) übersetzt. Vgl. Böhringer, Tertullianus (Stuttg.
1873); Hauck, Tertullians Leben und Schriften (Erlang. 1877);
Bonwetsch, Die Schriften Tertullians nach der Zeit ihrer Abfassung
untersucht (Bonn 1878); Ludwig, Tertullians Ethik (Leipz.
1885).
Teruel, span. Provinz, den südlichen Teil der
Landschaft Aragonien umfassend, grenzt im N. an die Provinz
Saragossa, im O. an Tarragona und Castellon, im S. an Valencia und
Cuenca, im W. an Guadalajara und hat einen Flächenraum von
14,818 qkm (269,1 QM.). Das Land ist meist gebirgig und wird von
zahlreichen zum iberischen Gebirgssystem gehörigen
Berggruppen, wie Sierra de Cucalon, Sierra de San Just (1513 m),
Sierra de Gudar (1770 m), Sierra de Albarracin (mit Cerro San
Felipe, 1800 m, und Muela de San Juan, 1610 m), Sierra de
Javalambre (2002 m), durchzogen. Die Flußthäler bilden
fruchtbare Ebenen, der Nordosten gehört dagegen zur iberischen
Steppe. Die Gewässer der Provinz fließen zum
größern Teil dem Ebro zu, darunter Jiloca
(Nebenfluß des Jalon), Martin, Guadalope. Außerdem
entspringen hier der Tajo und die Küstenflüsse
Guadalaviar mit Alfambra und der Mijares. Die Bevölkerung ist
spärlich, (1878) 242,165 Seelen (nur 16 pro QKilometer, 1886
auf 250,000 Seelen geschätzt). Der Boden ist wenig kultiviert
und großenteils Weideland, liefert aber immerhin viel
Getreide, dann Öl, Hanf, Flachs, etwas Obst und Wein.
Abgesehen vom Westen, wo sich Wald vorfindet, ist das Land baumarm.
Andre Produkte sind: Seide, Wolle (als Ergebnis der stark
betriebenen Schafzucht), dann, als Ertrag des bis jetzt sehr
schwach betriebenen Bergbaues: Braunkohlen, Blei- und Eisenerz,
Schwefel und Salz. Auch Mineralquellen sind vorhanden. Industrie,
Handel und Verkehr sind unbedeutend. Die Provinz umfaßt zehn
Gerichtsbezirke (darunter Albarracin, Alcañiz, Hijar und
Montalban). - Die gleichnamige Hauptstadt, auf steilem Hügel
am Guadalaviar gelegen, altertümlich und wirr gebaut, hat 7
Kirchen (darunter die schöne gotische Kathedrale), einen im
17. Jahrh. erbauten, aus zwei übereinander stehenden
Bogenreihen bestehenden Aquädukt (Los Arcos), ein
Priesterseminar, Speditionshandel und (1886) 8861 Einw. Es ist Sitz
des Gouverneurs und eines Bischofs. T. hieß im Altertum
Turdeto und ist keltiberischen Ursprungs.
Ter-Vere, Stadt, s. Vere.
Tervueren (spr -vuh-er'n), Marktflecken in der belg.
Provinz. Brabant, Arrondissement Löwen, an der Eisenbahn
Brüssel- T., mit (1888) 2674 Einw., war früher
Sommerresidenz der Herzöge von Brabant, hat ein schönes,
dem König zur Verfügung gestelltes Schloß mit Park,
welches unter der holländischen Regierung dem Prinzen von
Oranien gehörte und seit 1867 zeitweilig von der Kaiserin
Charlotte, Witwe des Kaisers Maximilian von Mexiko (Schwester des
Königs der Belgier), bewohnt wurde.
Terz (lat. Tertia), in der Musik die dritte Stufe in
diatonischer Folge. Dieselbe kann sein: groß (a), klein (b),
vermindert (c) oder übermäßig (d). [Siehe Graphik]
Von hervorragender Bedeutung für das elementare Studium der
Harmonielehre ist die große T., denn sie ist wie die Quinte
(s. d.) eins der den Dur- und Mollakkord konstituierenden
Grundinter-
605
Terzerol - Tessin.
valle. Wie schon Zarlino, Tartini und in neuerer Zeit besonders
M. Hauptmann betonten, hat der Mollakkord nicht eine kleine T.
(diese hat er nur im Generalbaß), sondern wie der Durakkord
eine große T., aber von oben, da der ganze Mollakkord von
oben herunter zu denken ist: e
c
a.
T. ist auch Name einer Hilfsstimme in der Orgel. Auch einer der
Grundhiebe der Fechtkunst (s. d.) heißt T.
Terzerol (ital.), kleine Pistole (s. d.), Taschenpistole
mit Perkussionsschloß.
Terzeronen (span.), s. Farbige.
Terzett (ital.), ein Tonstück für drei
konzertierende Stimmen, insbesondere Singstimmen, während ein
solches für Instrumente Trio genannt wird.
Terzine (ital.), ursprünglich ital. Strophe, aus
drei Versen von fünf- oder sechsfüßigen Jamben
bestehend, mit gekreuzten Reimen, so daß stets der erste und
dritte Vers jeder folgenden Strophe mit dem zweiten der
vorhergehenden reimen, während der letzte Vers des Gedichtes
als überschüssiger Vers mit dem zweiten Vers der letzten
Strophe reimt und so einen metrischen Abschluß
herbeiführt (Schema: aba, bcb, cdc, dec[?], efe etc.).
Angeblich von Dante erfunden, dessen "Divina Commedia" in dieser
Strophenform abgefaßt ist, wurde die T. seit Ende des 18.
Jahrh. auch von deutschen Dichtern, z. B. von A. W. Schlegel,
Rückert, Chamisso, Heyse u. a., mit Meisterschaft behandelt.
Vgl. Schuchardt, Ritornell und T. (Halle 1875).
Terzka (Terzky, eigentlich Treka), Adam Erdmann, Graf,
kaiserl. General, ein böhmischer Edelmann, diente im Heer
Wallensteins, dessen Schwager er durch die Heirat mit der
Gräfin Maximiliane Harrach (also nicht der Schwester
Wallensteins wie in Schillers "Wallenstein") war, genoß als
unbedingt ergebener Anhänger Wallensteins dessen Vertrauen und
zeichnete sich mit seinem Regiment in der Schlacht bei Lützen
aus. Er und Ilow beredeten hauptsächlich im Januar 1634 die
Wallensteinschen Obersten zum Revers von Pilsen und zu der zweiten
Verbriefung ihrer Treue den 20. Febr. Er ward deshalb von dem
kaiserlichen Pardon ausgenommen und 25. Febr. 1634 in Eger, wohin
er Wallenstein begleitet hatte, nebst Ilow und Kinsky beim
Abendessen nach verzweifeltem Widerstand ermordet.
Terzquartakkord (Terzquartsextakkord), Umkehrung des
Septimenakkords mit in den Baß gelegter Quinte (ghdf:dfgh).
Vgl. Septimenakkord.
Terztöne, s. Quinttöne.
Tesanj (spr. -schanj), Bezirksstadt in Bosnien, Kreis
Banjaluka, liegt malerisch in einer Schlucht an beiden Ufern der
Raduska, hat 5 Moscheen, auf steilem Kegel eine Ruine der
ehemaligen Residenz der Bane der Landschaft Usora, deren Hauptstadt
T. war, (1885) 5807 Einw. (meist Mohammedaner), lebhaften Obst- und
Getreidehandel und ein Bezirksgericht.
Teschen, Fürstentum im österreich. Herzogtum
Schlesien, besteht aus dem größten Teil des frühern
Teschener Kreises, welcher im J. 1849 in die jetzigen
Bezirkshauptmannschaften T., Bielitz und Friedeck aufgelöst
ward (s. Karte "Böhmen, Mähren und Schlesien"),
gehörte ursprünglich den oberschlesischen Herzögen
von Oppeln, wurde zufolge der Teilung dieses Herzogtums 1282
selbständig als piastisches Fürstentum und stand seit
1298 unter böhmischer Oberhoheit. Als 1625 der Mannesstamm der
Herzöge von T. erlosch, verblieb das Fürstentum bei der
Krone Böhmen, bis Kaiser Karl VI. dasselbe 1722 dem Herzog
Leopold Joseph Karl von Lothringen übergab, dem sein Sohn
Franz Stephan, nachmaliger Kaiser Franz I., 1729 im Besitz folgte.
Nach diesem besaß dasselbe seit 1766 unter dem Titel eines
Herzogs von Sachsen-T. der mit der Tochter Maria Theresias, Maria
Christina, vermählte Prinz Albert von Sachsen, der es bei
seinem Tod 1822 an den Erzherzog Karl vererbte, von dem es an
dessen ältesten Sohn, Albrecht, überging. - Die
gleichnamige Stadt (poln. Cieszyn), an der Olsa und am
Kreuzungspunkt der Kaschau-Oderberger Eisenbahn und der
Nordbahnlinie Kojetein-Bielitz, hat eine Dechanteikirche, ein
verfallenes Bergschloß und (1880) mit den sechs
Vorstädten 13,004 Einw., welche Fabrikation von Möbeln,
Wagen, Bautischlerei, Flachsspinnerei und -Weberei, Bierbrauerei,
Branntweinbrennerei und lebhaften Handel betreiben. T. ist Sitz
einer Bezirkshauptmannschaft, eines Kreisgerichts, eines Zollamtes
und eines katholischen Generalvikariats mit bischöflicher
Jurisdiktion, hat ein Obergymnasium, eine Oberrealschule, eine
Lehrerbildungsanstalt, ein adliges Konvikt, evangelisches Alumneum,
ein Museum, eine Sparkasse und ein Theater. Historisch
merkwürdig ist die Stadt durch den hier 13. Mai 1779 zwischen
Maria Theresia und Friedrich II. abgeschlossenen Frieden, welcher
dem bayrischen Erbfolgekrieg ein Ende machte. Vgl. Biermann,
Geschichte des Herzogtums T. (Tesch. 1863); Peter, T.,
historisch-topographisches Bild (das. 1878); Derselbe, Geschichte
der Stadt T. (das. 1888).
Tesching, Zimmergewehr von so kleinem Kaliber, daß
die Gase eines stark geladenen Zündhütchens genügen,
das erbsengroße Geschoß auf 10-20 m durch ein
mäßig starkes Brett zu treiben; angeblich nach der Stadt
Teschen benannt.
Teskere (arab.), Billet, Note, Paß,
Schuldverschreibung und andre ähnliche Schriftstücke;
auch Sammlung von Biographien von Heiligen und Dichtern. T.-dschi,
Notar des Großwesirs und des Hohen Rats.
Tessellarisch (lat.), würfelig, gewürfelt.
Tessera (lat.), Tafel, Stein zum Stimmen in den
Versammlungen; Parole; auch Würfel zum Spielen.
Tesserales Kristallsystem, s. Kristall, S. 230.
Tesseralkies, s. v. w. Arsenikkobaltkies.
Tessin (ital. Ticino, lat. Ticinus), ein Alpenfluß,
der in Oberitalien den Po erreicht, auf Schweizerboden 70 km lang,
hat seine größere Quelle an der Nufenen, die kleinere
auf dem St. Gotthardpaß, die sich beide (die erstere das Val
Bedretto, die andre das Val Tremola durchrauschend) bei Airolo
(1170 m) vereinigen, strömt dann als kräftiger Bergstrom
durch Livinen (Valle Leventina), durchbricht die wilde Felsschlucht
des Dazio Grande (763 m), eine der wildschönsten Partien im
Alpenrevier, und betritt bei Biasca, wo ihm der Brenno
zufließt (287 m), das offenere und flachere Thalgelände
der Riviera. Von nun an langsamer fließend, zerspaltet er
sich in viele Arme und legt Massen von Geschiebe ab. Nach Aufnahme
der Moësa (232 m) neigt sich das Thal noch weniger, ist sehr
breit und wenig höher als das Flußbett, so daß
Überschwemmungen und Versumpfungen eintreten. Bei Magadino
mündet der T. in den Lago Maggiore (197 m), den er bei Sesto
Calende, schon auf italienischem Gebiet, als schiffbarer Fluß
wieder verläßt. In südöstlicher Richtung
fließt der T. weiter an Pavia vorüber und mündet
unterhalb dieser Stadt in den Po. Der T. richtet im Frühjahr,
besonders in seinem obern Lauf, durch sein Austreten oft bedeutende
Verheerungen an. Bei Sesto Calende zweigt ein Kanal nach Mailand
ab.
606
Tessin (Kanton).
Tessin (Ticino), der südlichste Kanton der Schweiz,
im N. von Wallis, Uri und Graubünden, im O. von
Graubünden und Italien, im S. und W. von Italien begrenzt, hat
eine Fläche von 2818 qkm (51,2 QM.). Er umfaßt die
große Masse des obern Tessingebiets, d. h. einen
förmlichen Fächer alpiner und voralpiner Thäler,
welche sich gegen den Lago Maggiore, meist in südlicher
Richtung, dem Fluß T. zu, öffnen. Soweit das Hochgebirge
reicht, pflegt man die Tessiner Alpen als Ausstrahlungen des St.
Gotthard (s. d.) zu betrachten und der Gotthardgruppe beizuordnen.
Es ist dies zunächst ein Zug, der von dem Knotenpunkt
einerseits zum Ofenhorn (3270 m), anderseits zum Vorderrhein zieht
und hier in die Graubündner Alpen übergeht. Da erheben
sich unter andern die zentralen Massen des Scopi (3201 m), des
Camotsch (Cima Camadra 3203 m) und insbesondere die Adulagruppe mit
dem 3398 m hohen Rheinwaldhorn, der höchsten Erhebung des
Kantons, von wo ein langer Kamm nach S., bis zur Mündung der
Moësa, zieht. Dieser großartigen äußern
Umwallung in Halbkreisform entspricht, durch das Thal des Tessin
davon getrennt, eine innere, von den Schneehäuptern des
Basodine (3276 m) und Pizzo Forno (2909 m) flankierte. Jenseit der
tiefen Furche des Tessinthals und des Lago Maggiore erreicht das
Gebirge nur noch voralpinen Charakter in den Zentralmassen des
Monte Tamaro (1961 m), des Camoghe (2226 m) und des Monte Generoso
(1695 m); die Thäler nehmen mildere Formen an und leiten
allmählich in die lombardischen Ebenen über. Eine
Straße, welche den Monte Ceneri (553 m) überschreitet,
jetzt eine zum Netz des Gotthardunternehmens gehörige Bahn,
mit 1,673 km langem Tunnel (1880/81 gebohrt), verbindet die
hochalpinen Landschaften (Sopraceneri) mit dem voralpinen Gebiet
(Sottoceneri). Der Hauptfluß des Landes ist der Tessin (s.
d.), dessen Thal sich in die drei Stufen: Val Bedretto, Valle
Leventina und Riviera gliedert. Ihm geht links das von Lukmanier
und Greina herabsteigende, vom Brenno durchflossene Valle Blegno
zu; zwei andre hochalpine, dem Tessinthal parallele Thäler
münden rechts zum Lago Maggiore: das Val Verzasca und bei
Locarno Valle Maggia, zu oberst Val Lavizzara genannt. Im Gegensatz
zu diesen ernst und eng umrahmten Alpenthälern steht der
voralpine Sottoceneri. Hier lagert der Luganer See, dem der Agno
zufließt und die klare Tresa entströmt, um in den Lago
Maggiore zu münden. Dieser orographischen Gestaltung
entspricht die klimatische Mannigfaltigkeit, so daß
Bellinzona eine durchschnittliche Jahrestemperatur von 12,6° C.
hat, während im St. Gotthard-Hospiz (2100 m) das Jahresmittel
-0,6° beträgt. Der Kanton zählt (1888) 127,274 (1880:
130,777) Einw., durchweg italienischer Nationalität.
Entsprechend ihrer Bodenbeschaffenheit bringen die alpinen
Thäler des Sopraceneri wenig Getreide hervor, während der
Sottoceneri und die untere Stufe des Sopraceneri sehr ergiebig
sind. Hier gibt es meist zwei Ernten, und neben allerlei Obst
gedeihen Feigen, Pfirsiche und Walnüsse, Kastanien und Oliven
sowie Wein und Tabak. Die Waldungen sind meist in der
schonungslosesten Weise ausgeholzt worden; die früher sehr
starke Holzausfuhr hat daher beinahe ganz aufgehört. Auch in
der Rinderzucht findet sich nichts Bedeutendes; die Tiere sind
klein und von geringer Rasse. Ein großes Heer von Ziegen und
kleinen, unansehnlichen Schafen zeugt kaum für eine
wirtschaftliche Entwickelung. Im Sottoceneri hält man viele
Esel. Auch Seiden- und Schneckenzucht wird betrieben. Um Locarno
findet sich Gneis, um Mendrisio Kalkstein und Marmor, und im Val
Lavizzara wird Lavezstein (zu Geschirren) vielfach angewendet. Die
einheimischen Gewerbszweige, etwa die Geschirrdrechselei von Val
Lavizzara und die Strohflechterei von Val Onsernone abgerechnet,
häufen sich im Sottoceneri, namentlich um Lugano, wo
Leinweberei, Gerberei, Ziegelei, Töpferei, Papierfabrikation
u. a. blühen. Den meisten Gewerbfleiß aber zeigen die
Tessiner in der Fremde, wo sie in den mannigfachsten Handwerken und
Arbeiten thätig sind. In neuerer Zeit wendet sich die
Auswanderung auch überseeischen Ländern,
hauptsächlich den La Plata-Staaten, zu. Von seinen
schweizerischen Nachbarn, den Kantonen Wallis, Uri und
Graubünden, durch wilde Gebirge geschieden, ist das Land von
N. her schwer zugänglich; hohe und beschwerliche Bergpfade,
wie die Nufenen (2441 m) und Greina (2360 m) sowie der zum Comersee
hinüberleitende Paß von Sant Jorio (1956 m), haben keine
Bedeutung als Verkehrsrouten erlangt, und erst seit kurzem ist der
1917 m hohe Lukmanier gebahnt, dessen neue Straße 1877 dem
Verkehr übergeben wurde. Dagegen war der St. Gotthard (2114 m)
seit dem 12. Jahrh. mehr und mehr zu einem wichtigen Übergang
geworden und bekam 1820-24 eine großartige Kunststraße;
ziemlich zu derselben Zeit wurde auch der Bernhardin (2063 m)
gebahnt. Seit 15. Okt. 1869 kam das Unternehmen der Gotthardbahn
(s. d.) zur Ausführung. Die tessinischen Thalbahnen
Biasca-Bellinzona-Locarno sowie Lugano-Chiasso wurden bereits 1874
dem Betrieb übergeben; dann folgte die Linie
Bellinzona-Lugano-Chlasso (-Como), welche den Monte Ceneri
passiert. Einstweilen ist die Dampfschiffahrt auf dem Lago
Maggiore, in minderm Grade diejenige auf dem Luganer See von
Wichtigkeit; auf ersterm kursieren 11, auf letzterm 3 Dampfer. Die
inländische Handelstätigkeit ist nicht bedeutend; ein
vorübergehendes Leben bringen die herbstlichen Viehmärkte
von Airolo, Faido, Biasca und namentlich von Lugano, dem
industriellsten Ort und ersten Handelsplatz des T. In Bellinzona
und Lugano arbeiten die zwei tessinischen Zettelbanken; Locarno hat
eine Hypothekenbank. Zur Hebung der sehr vernachlässigten
Volksbildung ist in neuerer Zeit manches geschehen. Auch im T. ist
der Primarunterricht jetzt obligatorisch. Ein Lehrerseminar
für beide Geschlechter besteht erst seit 1874 (in Pollegio).
Neben einigen Progymnasien ist das Lyceum in Lugano die
höchste Lehranstalt des Kantons. Die öffentlichen
Bibliotheken enthalten nur 30,000 Bände. Seit längerer
Zeit sind die kirchlichen Verhältnisse in einer Umbildung
begriffen. Der Kanton T. gehörte früher teils zum Bistum
Como, teils zum Erzbistum Mailand; am 22. Juli 1859 hat die
Bundesversammlung die Abtrennung vom auswärtigen Verband
ausgesprochen, und durch Staatsvertrag ist diese Ablösung
ökonomisch geregelt. Die kirchliche Seite jedoch blieb lange
streitig, da der Papst die Errichtung eines besondern Bistums T.
wünschte, die Eidgenossenschaft dagegen den Anschluß an
eins der schon bestehenden schweizerischen Bistümer verlangte.
Erst 1888 wurde der Streit durch einen Vergleich mit der Kurie
beigelegt (s. unten, Geschichte). Die Verfassung datiert vom 4.
Juli 1830 und erfuhr wiederholt partielle Revisionen (die letzte
10. Febr. 1883). T. stand bis dahin noch durchaus auf dem Boden der
Repräsentativdemokratie; dann aber wurde das fakultative
Referendum eingeführt, nämlich sofern 5000 Bürger
die Abstimmung verlangen, und zwar
607
Tessin - Testakte.
unterliegen dieser Abstimmung Gesetze und allgemein verbindliche
Beschlüsse nicht dringlicher Natur. Die gesetzgebende
Behörde ist der Große Rat, der auf je vier Jahre durch
das Volk erwählt wird. Die Exekutive übt ein Staatsrat
von fünf Mitgliedern, die der Große Rat auf je vier
Jahre erwählt. Die höchste richterliche Gewalt ist einem
Obergericht übergeben, das ebenfalls durch den Großen
Rat auf vier Jahre ernannt wird. In den acht Bezirken des Kantons
ist die Exekutive durch einen Commissario der Regierung vertreten;
jeder Bezirk hat sein Bezirksgericht, die Gemeinden je eine
Municipalität mit einem Sindaco an der Spitze. Die
Staatsrechnung für 1886 zeigt an Einnahmen 2,368,121, an
Ausgaben 1,974,388 Frank. Die verzinsliche Staatsschuld belief sich
am 1. Jan. 1887 auf 8,584,957 Fr., die unverzinsliche auf 767,003
Fr. Der Sitz der Regierung wechselte bisher von sechs zu sechs
Jahren zwischen den Städten Lugano, Locarno und Bellinzona;
seit 1881 ist infolge eines Volksbeschlusses Bellinzona die
ständige Hauptstadt des Kantons geworden.
[Geschichte.] Das Gebiet des Kantons T., ursprünglich
größtenteils zum Herzogtum Mailand gehörig, wurde
von den Eidgenossen im 15. und 16. Jahrh. teils durch Eroberung,
teils durch Schenkung erworben. Das Thal Leventina (Livinen)
gehörte den Urnern (seit 1440) und erfreute sich ausgedehnter
Freiheiten, die ihm erst 1755 infolge eines Aufstandes entrissen
wurden. Bellenz, Riviera und Bollenz (Blegnothal), von Ludwig XII.
für die Hilfeleistung bei der Eroberung Mailands 1503
abgetreten, waren "gemeine" Vogteien von Uri, Schwyz und Nidwalden,
Lugano, Locarno, Mendrisio und Maggiathal, ein Geschenk Maximilian
Sforzas für Mailands Befreiung (1512), dagegen solche
sämtlicher eidgenössischer Orte ohne Appenzell. Die
Verwaltung dieser italienischen Vogteien war ein Schandfleck der
alten Eidgenossenschaft, und das Land fiel einer trostlosen
Verwilderung anheim; dennoch zog es 1798 vor, bei der Helvetischen
Republik zu verbleiben, die ihm Gleichberechtigung mit den
ehemaligen Herren brachte, statt sich dem Wunsch Bonapartes
gemäß der Cisalpinischen Republik anzuschließen.
Die Mediationsakte schuf daraus 1803 den heutigen Kanton T. mit
einer Repräsentativverfassung, die 1814 in aristokratischem
Sinn modifiziert wurde. Im T. begann noch vor der Julirevolution in
Frankreich mit einer unter der Führung des nachmaligen
Bundesrats Franscini ins Werk gesetzten Verfassungsrevision vom 30.
Juni 1830 die liberale Bewegung in der Schweiz. Die innere
Geschichte des Kantons blieb jedoch immer eine leidenschaftlich
bewegte infolge des Gegensatzes zwischen den Klerikalen, welche in
den nördlich vom Monte Ceneri gelegenen Alpenthälern
(Sopraceneri), und den Liberalen, die im südlichen Landesteil
(Sottoceneri) die entschiedene Mehrheit besaßen. Am 6. Dez.
1839 stürzten die Liberalen eine sie mit Verfolgungen
bedrohende ultramontane Regierung mit Gewalt, während ein
ähnlicher Versuch der Ultramontanen 1841 mit der Hinrichtung
ihres Führers Nessi endete. Nachdem die Liberalen ihr
Übergewicht im Großen Rat und im Staatsrat dazu benutzt
hatten, die Klöster aufzuheben oder doch in der
Novizenaufnahme zu beschränken, die Geistlichen von der Schule
auszuschließen und den kirchlichen Verband mit den
Bistümern Como und Mailand seitens des Staats zu lösen
(1858), entbrannte 1870 über der Frage, ob Bellinzona oder
Lugano alleinige Hauptstadt des Kantons sein sollte, aufs neue ein
leidenschaftlicher Parteikampf zwischen den Sopra- u.
Sottocenerinern. Der Gegensatz verschärfte sich, als 1875 die
Ultramontanen die Mehrheit im Großen Rat erhielten. Dieser
geriet nunmehr in Konflikt mit dem liberalen Staatsrat über
ein neues Wahlgesetz. Die Aufregung stieg darüber so hoch,
daß es 22. Okt. 1876 in Stabio zu einem blutigen
Zusammenstoß zwischen Klerikalen und Liberalen kam. Doch ward
unter Vermittelung eines eidgenössischen Kommissars ein
Vergleich geschlossen und Neuwahlen für den Großen Rat
au 21. Jan. 1877 anberaumt, bei denen die Klerikalen definitiv den
Sieg errangen. Durch ein Verfassungsgesetz vom 10. März 1878
wurde der bisherige Wechsel des Regierungssitzes zwischen Locarno,
Lugano und Bellinzona aufgehoben und letzteres zur alleinigen
Hauptstadt erklärt. Neuen Stoff zur Entflammung der
Parteileidenschaften gab die nunmehr ausschließlich aus
Klerikalen bestellte Regierung durch die rücksichtslose
Entfernung aller liberalen Lehrer und Beamten,
Wiederbevölkerung der Klöster etc.; durch den Versuch
aber, den Prozeß wegen der Vorgänge in Stabio zur
Vernichtung des Obersten Mola, eines Führers der Liberalen, zu
benutzen, obschon dessen Unschuld klar zu Tage lag, brachte sie die
ganze Schweiz in Aufregung, die sich erst wieder legte, als die in
ihrer Mehrheit klerikale Jury den Prozeß durch eine
allgemeine Freisprechung endigte (14. Mai 1880). Im J. 1883 wurde
durch eine Verfassungsrevision das Referendum eingeführt und
1886 das Kirchengesetz in ultramontanem Sinn umgeändert,
wogegen der Papst durch Verträge mit der Eidgenossenschaft
(1884 und 1888) in den formellen Anschluß des T. an das
Bistum Basel willigte, unter der Bedingung, daß ein von der
Kurie im Einverständnis mit dem Bischof aus der tessinischen
Geistlichkeit zu ernennender apostolischer Administrator in Lugano
die bischöfliche Gewalt im Kanton ausübe. Aus Anlaß
der Neuwahlen für den Großen Rat (3. März 1889) kam
es zu einem so heftigen Streit zwischen den Konservativen und den
Liberalen, welche die erstern gesetzwidriger Streichungen von
Liberalen in den Wahllisten beschuldigten, daß die
Bundesbehörde einschreiten mußte. Gewählt wurden 75
Konservative und 37 Liberale. Vgl. Franscini, Der Kanton T.
historisch, geographisch und statistisch (deutsch, St. Gallen
1835); Osenbrüggen, Der Gotthard und das T. (Basel 1877);
"Bolletino storico della Svizzera italiana" (Bellinz. 1879ff.);
Motta, Bibliografia storica ticinese (Zür.).
Tessin, Stadt im Großherzogtum
Mecklenburg-Schwerin, Herzogtum Güstrow, an der Recknitz, hat
ein Amtsgericht und (1885) 2462 Einw.
Test, eine mit Äscher, Mergel oder Knochenmehl
(Testasche) ausgeschlagene kleine eiserne Schale, in welcher das
Blicksilber fein gebrannt wird, wobei die Testasche die gebildeten
geschmolzenen Metalloxyde einsaugt. Das Erhitzen der Schale
geschieht vor dem Gebläse, in einem Muffel- oder einem
Flammofen.
Testa (lat.), in der Botanik s. v. w. Samenschale (s.
Same, S. 253).
Testaccio (spr. -áttscho), Hügel am
Südwestende Roms, nahe dem Tiber, s. Rom, S. 905.
Testakte (v. engl. test. Probe), ein Gesetz, welches das
englische Parlament 1673 von Karl II. erzwang, und nach welchem
jeder öffentliche Beamte außer dem Supremateid,
betreffend die oberste Kirchengewalt der Krone, noch einen
besondern Schwur (Testeid) leisten mußte, daß er nicht
an die Transsubstantiation, d. h. an die Umwandlung von Brot und
Wein in den wahrhaftigen Leib und in das Blut Christi nach
katholischer Lehre, glaube. Dadurch wurden die Katholiken nicht nur
von allen Staatsämtern,
608
Testament (juristisch).
sondern auch vom Sitz im Parlament ausgeschlossen, bis die
Parlamentsakte vom 13. April 1829 T. und Testeid aufhob.
Testament (lat.), im weitern Sinn s. v. w. letzter Wille,
letztwillige Verfügung (Disposition), Verfügung von Todes
wegen überhaupt, d. h. die einseitige Verfügung, welche
jemand von Todes wegen über sein Vermögen trifft, im
Gegensatz zur zweiseitigen oder vertragsmäßigen; im
engern und eigentlichen Sinn und im Gegensatz zur Schenkung auf den
Todesfall und zum Kodizill (s. d.) eine letztwillige Disposition,
welche eine eigentliche Erbeinsetzung enthält. Derjenige,
welcher ein T. errichtet, wird Testierer (testator, testatrix), der
im T. Bedachte Honorierter genannt. Jedes T. setzt zur
Gültigkeit die Fähigkeit des Erblassers, ein T. zu
errichten (Testierfähigkeit, testamenti factio activa), ferner
die Fähigkeit des eingesetzten Erben, aus einem letzten Willen
etwas zu erwerben (Bedenkfähigkeit), und endlich
regelmäßig die Beobachtung der gesetzlich
vorgeschriebenen Form der Testamentserrichtung voraus. Die
Testierfähigkeit ist ein Ausfluß der persönlichen
Handlungsfähigkeit überhaupt; sie steht also jedem
Geschäftsfähigen zu und ist ebendeshalb nur Kindern und
den wegen Geisteskrankheit entmündigten Personen
vollständig entzogen. Die in ihrer
Geschäftsfähigkeit nur beschränkten Personen, wie
Minderjährige, können nach dem Entwurf eines deutschen
bürgerlichen Gesetzbuchs (§ 1912), solange sie das 16.
Lebensjahr nicht zurückgelegt haben, kein T. errichten, auch
nicht mit Einwilligung ihres gesetzlichen Vertreters. Nach diesem
Zeitpunkt können sie aber auch ohne diese Einwilligung
testieren. Was die Bedenkfähigkeit anbetrifft, so sind
verschiedene Unfähigkeitsgründe des römischen Rechts
heutzutage unpraktisch; nur in Ansehung juristischer Personen ist
die Erbfähigkeit auf den Fiskus, die Gemeinden, Kirchen und
milden Stiftungen und auf diejenigen juristischen Personen
beschränkt, welchen dieselbe ausdrücklich beigelegt
worden ist. Nach dem Entwurf eines deutschen bürgerlichen
Gesetzbuchs (§ 1759) kann jede juristische Person als Erbe
eingesetzt oder mit einem Vermächtnis bedacht werden. Der Form
nach werden die Testamente in Privattestamente und öffentliche
Testamente eingeteilt. Die Form des römisch-rechtlichen
Privattestaments war die Errichtung desselben unter Zuziehung von
sieben Solennitätszeugen, in deren gleichzeitigem Beisein die
Testamentserrichtung ohne erhebliche Unterbrechung zu vollenden war
(unitas actus, loci et temporis). Die Errichtung des Testaments
konnte auf diese Weise mündlich oder schriftlich geschehen.
War der Testator des Schreibens unkundig, so bedurfte es zur
Unterschrift an seiner Statt der Zuziehung eines achten Zeugen.
Unter Umständen kann jedoch nach gemeinem Recht von diesen
Formen ganz oder teilweise abgesehen werden (privilegiertes T.). So
kann es zur Zeit einer ansteckenden Krankheit nachgelassen werden,
daß die Zeugen nicht gleichzeitig versammelt, sondern einzeln
und getrennt das Erforderliche vornehmen (testamentum pestis
tempore conditum); bei einem auf dem Land errichteten T.
genügt im Notfall die Zuziehung von nur fünf Zeugen
(testamentum ruri conditum); Verfügungen zu gunsten der Kirche
oder milder Stiftungen können ganz formlos errichtet werden
(testamentum ad pias causas), wofern sie nur durch zwei Zeugen
bewiesen werden können. Trifft der Testator im T. nur für
seine Kinder und Kindeskinder Verfügungen, so genügt ein
schriftlicher, datierter Aufsatz, in welchem die Namen der
Deszendenten und ihre Erbteile mit Worten, nicht mit Zahlen,
angegeben sind (testamentum parentis inter liberos). Besonders
privilegiert ist endlich das Soldatentestament, welches nach
römischem Recht, wenn es im Feld errichtet wird, keiner
Förmlichkeit bedarf, wofern nur der Wille des Testators
gewiß ist. Gegenwärtig sind in Deutschland nach dem
Reichsmilitärgesetz vom 2. Mai 1874 (§ 44)
militärische letztwillige Verfügungen gültig, wenn
sie in Kriegszeiten oder während eines Belagerungszustandes
errichtet, vom Testator eigenhändig geschrieben und
unterschrieben oder von demselben wenigstens eigenhändig
unterschrieben und von zwei Zeugen, einem Auditeur oder Offizier,
mit unterzeichnet sind, oder wenn von einem Auditeur oder Offizier
unter Zuziehung zweier Zeugen oder noch eines Auditeurs oder
Offiziers über die mündliche Erklärung des Testators
eine schriftliche Verhandlung aufgenommen und diese dem Testator
vorgelesen sowie von dem Auditeur oder Offizier und den Zeugen oder
von den zugezogenen Auditeuren oder Offizieren unterschrieben
worden ist. Solche privilegierte militärische Verfügungen
verlieren aber ihre Gültigkeit mit dem Ablauf eines Jahrs von
dem Tag ab, an welchem der Truppenteil, zu dem der Testator
gehört, demobil gemacht ist oder der Testator aufgehört
hat, zu dem mobilen Truppenteil zu gehören, oder als
Kriegsgefangener oder als Geisel aus der Gewalt des Feindes
entlassen ist. Dem Privattestament steht das heutzutage die Regel
bildende ösfentliche T. gegenüber, welches nach
römischem Rechte durch die Mitwirkung des Regenten, welcher
das ihm vom Testator überreichte schriftliche T. entgegennahm
(testamentum principi oblatum), errichtet wurde. Inzwischen ist an
dessen Stelle das gerichtliche oder notarielle T. (testamentum
publicum) getreten, sei es, daß der Testator seinen Willen zu
gerichtlichem oder notariellem Protokoll erklärt (testamentum
apud acta conditum), sei es, daß er das schriftlich
abgefaßte T. dem Gericht, Notar und im Ausland auch einem
Konsul zur Verwahrung und zur Eröffnung (Apertur) nach des
Testators Tod übergibt (testamentum judici oblatum). Das
versiegelt übergebene T. wird auch mystisches T. genannt.
Wesentlich ist nach gemeinem Recht bei jedem T. die Einsetzung
eines oder mehrerer Erben; auch kann eine eventuelle Erbeinsetzung
(Einsetzung eines Nacherben) für den Fall ausgesprochen
werden, daß der in erster Linie Eingesetzte (Vorerbe) nicht
Erbe werden würde (s. Substitution). Nach dem Entwurf eines
deutschen bürgerlichen Gesetzbuchs soll jedoch eine
eigentliche Erbeinsetzung zur Gültigkeit des Testaments
künftighin nicht mehr erforderlich sein. Es kann vielmehr auch
nur ein Vermächtnis in dem T. enthalten sein. Der Entwurf
(§ 1911 ff.) kennt ferner außer dem gerichtlichen oder
notariellen (konsularischen) T. das Soldatentestament sowie das in
besonders eiligen Fällen vor dem Vorsteher der Gemeinde unter
Zuziehung von zwei Zeugen errichtete T. Befindet sich ferner der
Testator in einer Ortschaft, einer Straße oder einem
Gebäude, welche infolge einer Krankheit oder sonstiger
außerordentlicher Umstände abgesperrt sind, so kann,
abgesehen von der Errichtung des Testaments vor dem
Gemeindevorstand, dieselbe auch durch mündliche Erklärung
vor drei Zeugen oder durch eine von dem Erblasser unter Angabe des
Ortes und des Tages der Errichtung eigenhändig geschriebene
und unterschriebene Erklärung erfolgen. Auf die letztere Weise
oder vor drei Zeugen kann man auch auf hoher See testieren. Das
bisherige gemeine Recht kennt ferner
609
Testament - Tête-à-tête.
ein gemeinschaftliches T. (testamentum simultaneum). Bei diesem
gemeinschaftlichen T., welches namentlich bei Ehegatten vorkommt,
sind zwei oder mehrere Testamente formell miteinander verbunden.
Gewöhnlich setzen hier die gemeinschaftlichen Testierenden
(Kontestatoren) sich oder Dritte gegenseitig zu Erben ein
(wechselseitiges, reziprokes T.), und ein solches T. wird dann im
Zweifel als ein korrespektives angesehen, d. h. der Bestand der
einen letztwilligen Disposition erscheint als abhängig von dem
der andern; namentlich gilt hier der Widerruf des einen zugleich
auch als solcher des andern Testators. Der Entwurf des deutschen
bürgerlichen Gesetzbuchs (§ 1913) erklärt jedoch
gemeinschaftliche Testamente für unzulässig. Dem Prinzip
nach besteht völlige Testierfreiheit, d. h. der Testator kann
über seinen Nachlaß frei verfügen; ein Satz,
welcher nur zu gunsten der sogen. Noterben, d. h. der nächsten
Blutsverwandten und des Ehegatten, eine Ausnahme erleidet, welchen
wenigstens der sogen. Pflichtteil zukommen muß. Nur wenn ein
gesetzlicher Enterbungsgrund vorliegt, kann ein solcher Noterbe von
der Erbfolge gänzlich und zwar durch ausdrückliche
Enterbung ausgeschlossen werden (s. Pflichtteil). Endlich kann auch
nach deutschem Recht über Stamm-, Lehns- und
Fideikommißgüter sowie über das Vermögen,
welches nach dem ehelichen Güterrecht dem überlebenden
Ehegatten oder den Kindern verbleiben muß, nicht oder doch
nur in beschränkter Weise letztwillig verfügt werden.
Vgl. Eichhorn, Das T. Musterbuch für letztwillige
Verfügungen nach dem allgemeinen Landrecht etc. (Berl.
1885).
Testament, Altes und Neues, s. Bibel.
Testamentarisch (lat.), letztwillig, ein Testament (s.
d.) betreffend, einem solchen gemäß.
Testamentsvollstrecker (Testamentsexekutoren,
Treuhänder, Salmannen, Testamentarier, Manufideles), die von
dem Erblasser bei Errichtung des letzten Willens mit der
Vollstreckung des letztern und mit der Regulierung des Nachlasses
betrauten Personen. Je nachdem ihnen diese im ganzen oder nur in
Ansehung einzelner Rechtsgeschäfte übertragen ist, wird
zwischen Universal- und Spezialexekutoren unterschieden. Auch ist
es dem Erblasser nach dem Entwurf eines deutschen Zivilgesetzbuchs
unbenommen, für den Fall der Behinderung oder des Hinwegfalls
eines Testamentsvollstreckers eventuell einen anderweiten T. zu
erenennen[sic!].
Testat (lat.), Zeugnis. Testato, mit Hinterlassung eines
Testaments (sterben.)
Testator (Testierer, lat.), derjenige, welcher ein
Testament errichtet; s. Testament.
Teste de Buch, La (spr. test d'bük), Stadt im franz.
Departement Gironde, Arrondisfement Bordeaux, an der
Südküste des Bassins von Arcachon des Atlantischen
Ozeans, durch eine Zweigbahn mit der Bahnlinie Bordeaux-Bayonne
verbunden, hat Seebäder, welche von den Bordelesen stark
besucht werden, bedeutende Austernparke, Seefischerei und (1886)
5235 Einw. Das umliegende Dünenland (Le Buch genannt) ist mit
ausgedehnten Beständen von Kiefern (welche Harz in den Handel
liefern) und Eichen bedeckt.
Testeid, s. Testakte.
Testes (Testiculi, lat.), Hoden.
Testieren (lat.), bezeugen; ein Testament errichten.
Testierfreiheit, s. Erbrecht und Pflichtteil.
Testifikation (lat.), Beweis durch Zeugen; testifizieren,
durch Zeugen nachweisen.
Testikel (lat.), Hode (s. d.).
Testimoninm (lat.), Zeugnis. T. integritatis.
Ledigkeitszeugnis; T. maturitatis, Zeugnis der Reife, welches nach
bestandenem Abiturientenexamen ausgestellt wird; T. morum,
Sittenzeugnis; T. paupertatis, Armutszeugnis (s. d.).
Teston (spr. testóng oder tätóng),
altfranz. Silbermünze im Wert von 10-15 Sous.
Testudo (lat.), Schildkröte; im altrömischen
Heer eine taktische Stellung der Soldaten zum Schutz gegen
Wurfgeschosse und besonders zum Angriff gegen eine befestigte
Stadt, wobei die ganze Heeresabteilung die Schilde über die
Köpfe hielt (vgl. Abbild.);
[siehe Grafik]
Schilddach (Testudo). Relief der Antoninssäule in Rom.
s. auch Aries. Bei den Römern auch s. v. w. Lyra (s. d.),
im 15.-17. Jahrh. s. v. w. Laute (s. d.).
Têt (spr. tä oder tät. Teta),
Küstenfluß im franz. Departement Ostpyrenäen,
entspringt hoch in den Pyrenäen, fließt in vorherrschend
nordöstlicher Richtung und fällt nach 125 km langem Lauf
bei Ste.-Marie de la Salenque in das Mittelländische Meer.
Tetanie (Tetanus intermittens, Tetanille), eine
Krankheit, welche vorzugsweise bei Kindern und jugendlichen
Individuen nach Erkältungen und akuten Krankheiten vorkommt.
Dieselbe äußert sich in anfallsweise auftretenden
tonischen Krämpfen, welche meist in den Fingern beginnen und
sich sodann auf den Arm und die untern Extremitäten, meist
symmetrisch forterstrecken. In der Regel werden vornehmlich die
Beugemuskeln befallen, wodurch die Extremitäten während
des Anfalls in starrer Beugung der verschiedenen Gelenke fixiert
werden. Die Anfälle dauern in manchen Fällen nur
minuten-, in andern stunden- und sogar tagelang. Das
Bewußtsein ist während des Anfalls völlig intakt,
die Schmerzen mäßig. In den freien Zwischenräumen
sind die Nerven abnorm leicht erregbar und die Krämpfe
jederzeit durch Druck auf die größern Arterien und
Nerven der Extremitäten künstlich hervorzurufen. Die
Krankheit dauert meist einige Wochen und endet fast stets in
Genesung. Die Behandlung besteht in elektrischen und
nervenberuhigenden Kuren.
Tetanus (griech.), s. Starrkrampf.
Tetaratasprudel, in Neuseeland, s. Geiser, S. 26, und
Band 7, S. 1025.
Tetartin, s. Albit.
Tetartoëdrie (griech.), s. Kristall, S. 232.
Tête (franz.), Kopf; im Militärwesen die
Spitze, der vorderste Teil eines Truppenkörpers.
Tête-à-tête (franz., "Kopf an Kopf"),
vertrauliche Zusammenkunft, Gespräch unter vier Augen.
610
Tetens - Tetrarch.
Tetens, Johann Nikolaus, Philosoph, geb. 1736 zu
Tetenbühl im Holsteinischen, von 1776 bis 1789 Professor der
Philosophie zu Kiel, hat sich durch seine in Geist und Sprache der
vorkritischen Popularphilosophie verfaßten "Philosophischen
Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwickelung"
(Leipz. 1776, 2 Bde.) verdient gemacht. Er starb 1807 in
Kopenhagen. Vgl. Harms, Die Psychologie des Joh. Nik. T. (Berl.
1878).
Teterow, Stadt im Großherzogtum
Mecklenburg-Schwerin, Herzogtum Güstrow, am gleichnamigen See,
Knotenpunkt der Linie Lübeck-Mecklenburgisch-Preußische
Grenze der Mecklenburgischen Friedrich Franz-Bahn und der Eisenbahn
Gnoien-T., hat eine alte, renovierte gotische Kirche, ein neues
Krankenhaus, 2 gotische Stadtthore, ein Amtsgericht,
Eisengießerei und Maschinenfabrikation, eine Dampfmolkerei,
eine Zuckerfabrik, 2 Sägemühlen und (1885) 5991 fast nur
evang. Einwohner.
Tethys, in der griech. Mythologie Tochter des Uranos und
der Gäa, eine Titanide, Gemahlin des Okeanos, Mutter der
Okeaniden und der Stromgötter (nicht zu verwechseln mit
Thetis).
Tetjuschi, Kreisstadt im russ. Gouvernement Kasan, an der
Wolga, mit (1885) 3934 Einw., die sich hauptsächlich mit
Fischerei beschäftigen.
Tetrachloräthylen etc., s. Kohlenstoffchloride.
Tetrachord (griech.), eine Skala oder Folge von vier
Tönen, s. Griechische Musik, S. 729.
Tetradymit, Mineral aus der Ordnung der Metalle,
kristallisiert rhomboedrisch, häufig in Zwillingen und
Vierlingen (woher der Name), kommt aber auch derb vor, ist
zinnweiß bis stahlgrau, nur auf frischer Spaltungsfläche
stark glänzend, Härte 1-2, spez. Gew. 7,4-7,5, besteht
aus Tellur, Schwefel und Wismut Bi2Te2S, scheint aber mit andern
Tellurwismuten nur Eine Spezies zu bilden, deren Tellur- und
Wismutgehalt schwankt, während Schwefel (und Selen)
unwesentlich sind. T. findet sich bei Schemnitz in Ungarn, in
Virginia, Nordcarolina, Montana, etwas abweichend zusammengesetzte
Tellurwismute bei Deutsch-Pilsen in Ungarn, San José in
Brasilien, Cumberland in England.
Tetradynama stamina (griech.-lat.), viermächtige
Staubgefäße, in Zwitterblüten mit 6
Staubgefäßen, von denen 4 länger als die beiden
übrigen sind; Pflanzen mit solchen Blüten bilden die 15.
Klasse des Linneschen Systems, Tetradynamia.
Tetraëder (griech., "Vierflächner"), im weitern
Sinn jede dreiseitige Pyramide; im engern Sinn eine von vier
kongruenten gleichseitigen Dreiecken begrenzte Pyramide mit vier
gleichen dreiseitigen Ecken und vier gleichlangen Kanten, einer der
fünf regulären Körper (s. Körper); in letzterm
Sinn tritt das T. in der Kristallographie als hemiedrische Form des
(regulären) Oktaeders auf.
Tetraëdrit, s. Fahlerz.
Tetraëdrometrie (griech.), eigentlich die
Ermittelung der fehlenden Stücke einer dreiseitigen Pyramide
(eines Tetraeders im weitern Sinn) aus sechs gegebenen
Stücken; neuerdings die Lehre von den Eckenfunktionen, durch
welche dreiseitige Ecken für die Rechnung in ähnlicher
Weise repräsentiert werden wie Winkel durch ihre
trigonometrischen Funktionen. Vgl. Junghann, Tetraedrometrie (Gotha
1863, 2 Tle.).
Tetragon (griech.), s. Viereck.
Tetragonales Kristallsystem, s. v. w. quadratisches
Kristallsystem, s. Kristall, S. 230.
Tetragonia L., Gattung aus der Familie der Aizoaceen,
Kräuter oder Halbsträucher, welche meist an den
Küsten auf der südlichen Halbkugel wachsen, mit
wechselständigen, gestielten, fleischigen Blättern und
achselständigen, gestielten Blüten. T. expansa Murr.
(neuseeländischer Spinat), ein einjähriges, 1 m hohes,
ästiges Kraut mit eirund-rautenförmigen Blättern,
gelblichgrünen Blüten und vierhörnigen, fast[sic!]
sitzenden Früchten, wächst auf Neuseeland, Australien,
den Norfolkinseln, Südamerika und Japan und wird allgemein als
Gemüse benutzt. Es wird seit 1772 auch in Europa
kultiviert.
Tetragonolobus Rivin. (Spargelerbse, Flügelerbse),
Gattung aus der Familie der Papilionaceen, einjährige und
ausdauernde Kräuter mit einzeln oder zu zweien in den
Blattwinkeln stehenden Blüten und vierkantigen,
geflügelten Hülsen. Nur vier Arten. T. purpureus
Mönch. (Spargelklee, englische Erbse), Sommergewächs mit
Kleeblättern, fast rhombischen Blättchen, ähnlichen
Nebenblättern, dunkel blutroten oder dunkelgelben Blüten
und 5 cm langen, mehrsamigen Hülsen; wächst in
Südeuropa und wird seit dem 18. Jahrh. der Hülsen und
Samen halber kultiviert, die ein feines Gemüse liefern.
Tetragynus (griech.), vierweibige Blüten mit vier
Griffeln; daher Tetragynia, im Linnéschen System die
Pflanzengattungen mit vierweibigen Blüten.
Tetrakishexaëder (Pyramidenwürfel),
24-flächige Kristallgestalt des tesseralen Systems, s.
Kristall, S. 230.
Tetraktys (griech.), in der Zahlenlehre der Pythagoreer
die Zahl 10, insofern dieselbe die Summe der vier ersten
natürlichen Zahlen (1+2+3+4) und als Zahl der Weltkörper
sowie der Paare ursprünglicher Gegensätze an sich und in
kosmologischer wie logischer Beziehung der Ausdruck der
Vollkommenhelt ist.
Tetralogie (griech.), s. Trilogie.
Tetrameter (griech., lat. Octonarius), ein aus vier
Doppelfüßen (Dipodien) bestehender Vers, kommt in
trochäischem, iambischem und anapästischem Rhythmus vor
und zwar sowohl katalektisch als akatalektisch, je nachdem der
letzte Fuß um eine Silbe verkürzt oder vollständig
ist. Der iambische katalektische T. findet sich besonders bei den
griechischen Lyrikern und Komikern, der trochäische T. bei den
griechischen Dramatikern, den lateinischen Komikern, um eine
feierliche Bewegung hervorzubringen, in der altspanischen Romanze,
auch in Gedichten Platens (z. B. "Das Grab im Busento"). Der
anapästische (mit einzelnen Spondeen vermischte) T. wurde von
Platen und Prutz, nach dem Vorbild des Aristophanes, für die
Chorstrophen ihrer satirischen Komödien angewendet (s.
Anapäst). - T. heißt auch ein Feldmeßinstrument,
s. Meßkette.
Tetrandrus (griech.), viermännige Blüten mit
vier gleichlangen Staubgefäßen; davon Tetrandria, vierte
Klasse des Linnéschen Systems, Gewächse mit vier
gleichlangen Staubfäden enthaltend.
Tetranychus, s. Milben, S. 607.
Tetrao, Auerhuhn; Tetraonidae (Waldhühner), Familie
aus der Ordnung der Hühnervögel (s. d.); Tetraoninae,
Unterfamilie, die eigentlichen Waldhühner umfassend.
Tetrapolitanische Konfession (Confessio tetrapolitatia),
s. Augsburgische Konfession.
Tetrarch (griech.), in asiat. Staaten, z. B. Galatien,
ein Vierfürst, d. h. einer der vier Beherrscher des Landes;
auch in Judäa kamen dergleichen vor, wenn auch nicht im
striktesten Sinn, z. B. Herodes. Tetrarchie, Herrschaft,
Würde, Bezirk eines Vierfürsten; s. auch Phalanx.
6l1
Tetrasporen - Teucrium.
Tetrasporen, eine Art Sporen bei den Florideen (s. Algen,
S. 346).
Tetrax, Zwergtrappe.
Tetrodon, Kugelfisch.
Tetronerythrin, roter Farbstoff, welcher im Tierreich
weit verbreitet ist, findet sich in den roten Flecken am Kopf
mancher Vögel und kann daraus mit Chloroform ausgezogen
werden. Er löst sich auch in Alkohol, Äther und
Schwefelkohlenstoff, wird durch Chlorwasser und Licht entfärbt
und durch Vitriolöl indigoblau, dann schwarz gefärbt. T.
ist einer der wichtigsten Farbstoffe der Schwämme, findet sich
in fast allen Klassen der wirbellosen Tiere und auch in den
Fischen. Er entspricht dem Blutrot der höhern Tiere und dient
kraft seiner großen Affinität zum Sauerstoff der
Hautatmung. Er tritt daher überall dort in großer Menge
auf, wo bedeutende Mengen Sauerstoff durch die Gewebe aufgenommen
werden sollen, und man trifft ihn an Hautteilen, die in
unmittelbarer Berührung mit Wasser stehen, an den
Atmungsorganen wie in den Kiemen der sitzenden Anneliden, in
Muskeln und ähnlichen Organen wie in dem muskelartigen
Fuß der Muscheltiere. Sitzende Tiere sind reicher an T. als
frei sich bewegende, weil letztere ohnehin genügend mit
sauerstoffhaltigem Wasser in Berührung kommen.
Tetschen, Stadt im nördlichen Böhmen, an der
Mündung der Pulsnitz (Polzen) in die Elbe, Station der
Österreichischen Nordwestbahn und der Böhmischen
Nordbahn, durch Ketten- und Eisenbahnbrücke mit Bodenbach (s.
d.) am andern Elbufer verbunden, ist Sitz einer
Bezirkshauptmannschaft und eines Bezirksgerichts, hat ein 1668 vom
Grafen Maximilian Thun erbautes Schloß (auf 45 m hohem
Felsen), mit schönem Park und Gewächshäusern, 2
Kirchen, eine Handelsschule, Fachschule für Thonindustrie,
eine Schifferschule, eine bedeutende Sparkasse (Einlagen 6 Mill.
Guld.), Baumwollspinnerei, Fabriken für ätherische
Öle, Papier und Knöpfe, Bierbrauerei, Kunstmühle,
Gasanstalt, bedeutenden Handel und (1880) 5330 Einw. T. ist
zugleich Station der Elbdampfschiffahrt und besuchter klimatischer
Kurort. Schöne Partien in der reizenden Umgebung sind der
nordwestlich liegende Schneeberg (694 m), die höchste Erhebung
des nordböhmischen Sandsteingebirges, mit prachtvoller
Aussicht, und Tyssaer Wände, wild zerklüftete
Sandsteinbildungen, dann die nördlich an der Elbe beginnende
Sächsische Schweiz (s. d.). Im Pulsnitzthal zwischen T. und
Bensen ist ein Hauptsitz der böhmischen Baumwollindustrie.
Tettenborn, Friedrich Karl, Freiherr von, berühmter
Reitergeneral im Freiheitskrieg, geb. 19. Febr. 1778 zu Tettenborn
in der damals badischen Grafschaft Sponheim, trat 1794 in
österreichische Militärdienste und stieg schnell zum
Rittmeister auf. In der Schlacht bei Wagram erwarb er sich den
Majorsrang. Nach dem Wiener Frieden begleitete er den Fürsten
Schwarzenberg nach Paris. Bei dem Ausbruch des russischen Kriegs
1812 trat er als Oberstleutnant in russische Dienste. An der Spitze
des Kutusowschen Vortrabs rückte er zuerst wieder in Moskau
ein, verfolgte an der Spitze der leichten Reiterei die Franzosen
bis an die Beresina, nahm dann Wilna, überschritt den Niemen,
drängte Macdonald durch Ostpreußen zurück und
besetzte Königsberg. Zum Obersten ernannt, ging er darauf
über die Weichsel und Oder und rückte, nachdem er sich in
Landsberg mit dem General Tschernischew vereinigt hatte, in Berlin
ein. Von da ward er nach Hamburg entsendet, das er 18. März
1813 besetzte, nachdem er Morand bei Bergedorf auf das linke
Elbufer zurückgeworfen hatte; doch mußte er die Stadt
30. Mai dem anrückenden Davout überlassen. Darauf focht
er unter Wallmoden gegen Davout und gegen Pecheux, nach dessen
Niederlage er 15. Okt. Bremen nahm. Im Januar 1814 ward er
beauftragt, mit einem Korps leichter Reiterei in Frankreich die
Verbindung zwischen den einzelnen Heeren der Alliierten
herzustellen. Nach dem Frieden zog er sich auf seine Güter
zurück, und 1818 trat er aus den russischen Diensten in
badische über. Er brachte hier die Territorialdifferenzen
zwischen Baden und Bayern in Ordnung, war bei Gründung der
Verfassung thätig und ging 1819 als Gesandter nach Wien, wo er
9. Dez. 1845 starb. Vgl. Varnhagen von Ense, Geschichte der
Kriegszüge des Generals T. (Stuttg. 1814).
Tettnang, Oberamtsstadt im württemb. Donaukreis, 7
km vom Bodensee, an der Linie Bretten-Friedrichshafen der
Württembergischen Staatsbahn, 465 m ü. M., hat eine
evangelische und eine kath. Kirche, ein Schloß, ein
Amtsgericht, Hopfen- und Obstbau, Käse- und Malzfabrikation,
Dampfsägemühlen u. (1885) 2267 Einw. T. war ehemals
Hauptort der Grafschaft Montfort-T., kam 1783 an Österreich,
1803 an Bayern und 1810 an Württemberg.
Tetnan (Tetawîn), Stadt auf der Nordküste von
Marokko, links am Martil, 6 km vom Meer, hat eine Citadelle, ist
von hohen Bastionen umgeben und schließt mit besonderer Mauer
das weit sauberere Viertel der Juden ein, welche den
größten Teil des Handels in Händen haben und ein
Drittel der Bevölkerung (ca. 22,000) ausmachen. Die Einfuhr
betrug 1887: 1,232,875, die Ausfuhr 324,950 Frank. Die Einfahrt in
den Fluß verteidigt ein Fort; 1887 liefen 143 Schiffe von
2716 Ton. ein. Die Stadt wurde mehrmals von den Spaniern genommen;
4. Febr. 1860 siegten dieselben unter O'Donnell, der den Titel
Herzog von T. erhielt, hier über die Marokkaner.
Tetzel, s. Tezel.
Teu, chines. Getreidemaß, s. Hwo.
Teubner, Benedictus Gotthelf, Buchhändler, geb. 16.
Juni 1784 zu Großkraußnigk in der Niederlausitz, ward
Buchdrucker, erwarb 1811 die Weinedelsche Buchdruckerei zu Leipzig,
welche er schon seit 1806 geleitet hatte, und die er durch Energie
und Geschick zu einer der bedeutendsten Deutschlands erweiterte.
Daneben gründete er 1832 auch in Dresden eine noch jetzt
bestehende Druckerei. Zu dem Ruf der Firma hat namentlich auch die
Entwickelung beigetragen, welche das 1824 in Verbindung mit der
Druckerei gegründete Verlagsgeschäft genommen, das seit
Jahren auf dem Gebiet der Philologie und des höhern
Unterrichtswesens in Deutschland die erste Stelle behauptet, und
von dessen Unternehmungen die "Bibliotheca scriptorum graecorum et
romanorum Teubneriana" die bekannteste ist. T. starb 21. Jan. 1856
in Leipzig und hinterließ das Geschäft seinen
Schwiegersöhnen Adolf Roßbach u. Albin Ackermann.
Teucer, griech. Heros, s. Teukros.
Teuchern, Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Merseburg, Kreis Weißenfels, an der Rippach und der Linie
Weißenfels-Gera der Preußischen Staatsbahn, hat eine
evang. Kirche, ein Amtsgericht, Braunkohlengruben, Solaröl-,
Maschinenöl- und Paraffinfabrikation, Brennerei,
Dampfdrechslerei, 9 Ziegeleien und (1885) 4644 fast nur evang.
Einwohner.
Teucrium L. (Gamander), Gattung aus der Familie der
Labiaten, Kräuter, Halbsträucher oder Sträucher von
sehr verschiedenem Habitus, mit meist einzelnen, selten zu mehreren
achselständigen Blüten. Etwa 100 Arten, weit zerstreut,
viele in den Mittel-
612
Teuerdank - Teufel.
meerländern. T. marum L. (Marum verum L., Katzen-, Marum-
oder Mastixkraut), 30-60 cm hoch, strauchartig, in Südeuropa
und Vorderasien, hat kleine, eirunde, ganzrandige, am Rand etwas
zurückgerollte, unterseits weißlich-filzige Blätter
und rosenrote, an den Enden der Äste lockere Trauben bildende
Blüten. Der Strauch riecht aromatisch kampferartig und
schmeckt bitter und scharf gewürzhaft. Das Kraut lockt die
Katzen an; es wurde früher arzneilich benutzt. T. Scordium L.
(Knoblauchgamander, Skordienkraut), ausdauernd, mit sitzenden,
länglich lanzettlichen, grob gesägten Blättern und
purpurnen Blüten, wächst im gemäßigten Europa
und Asien auf Sumpfwiesen, riecht stark nach Knoblauch und wurde
schon von Hippokrates arzneilich benutzt. T. Chamaedrys L.,
ausdauernd, buschig, immergrün, mit kleinen, gestielten,
länglichen, eingeschnitten gekerbten Blättern und
purpurnen Blüten in beblätterter Traube, wächst in
Mitteldeutschland auf Kalkhügeln und wird wie die erstere Art
als Zierpflanze kultiviert.
Teuerdank (Theuerdank), s. Pfinzing.
Teuerung, s. Teurung.
Teufe, im Bergbau s. v. w. Tiefe; daher Seigerteufe,
senkrechte Tiefe; flache T., Abstand zwischen zwei untereinander
liegenden Punkten auf einer flachen schiefen Ebene; Teufkarte, s.
v. w. Profil; ewige T., die unbeschränkte Ausdehnung einer
Bergbauberechtigung in die Tiefe.
Teufel (griech. Diabolos, "Verleumder"; hebr. Satan, s.
v. w. Widersacher), das personifizierte Prinzip des Bösen. Der
stete Wechsel von schaffenden und zerstörenden
Naturkräften spiegelt sich in den meisten Religionen als
Gegensatz göttlich-wohlthätiger zu finster-unheilvollen
Wesen, und in demselben Maß, als die Furcht vorherrschender
Faktor in einer Religion ist, wendet sich sogar gerade den letztern
ein gewisser Kult zu. Am ausgebildetsten tritt ein solcher
Dualismus bei den Parsen (s. d.) auf. Von da drang die Lehre von
einem persönlichen Haupte des Reichs des Bösen in das
Judentum ein, und erst jetzt wurde der Satan, welcher im Buch Hiob
noch als ein übelwollender, aber Gott untergeordneter und in
seinem Dienst handelnder Unglücksengel erscheint, zum
eigentlichen T., neben welchem in den palästinischen
Apokryphen, z. B. im Buch Tobias, noch andre Dämonen
erscheinen als Plagegeister der Menschen. Dieselbe
dämonologische Vorstellungswelt ist in voller Stärke dann
auch in die neutestamentlichen Schriften übergegangen, wie
schon die große Rolle beweist, welche die "Besessenen" (s.
d.) in den Evangelien spielen. Wenn dann auch noch in den
spätern Lehrschriften des Neuen Testaments Christus als Sieger
erscheint über den "Fürsten dieser Welt", d. h. den mit
landesüblichen Ausdrücken auch Beelzebub (s. d.) oder
Beelzebul, eine Form des Baal, und Belial oder Beliar
("Nichtsnutzigkeit") genannten Satan, so steht hier die mit
Hölle und T. sich befassende Vorstellung allerdings
zunächst im Dienste der Vertiefung der religiösen Ideen
und Motive. Der Glaube an die Überwindung des Teufels durch
Christus trug dazu bei, der Lehre vom Messias einen sittlichen
Gehalt zu geben und alle Energie der sittlichen Kräfte in den
Gläubigen zum Kampf wider die Gewalt des Argen ins Feld zu
rufen. Aber auch, als die sittliche Begeisterung abgekühlt
war, erhielt sich die Vorstellung vom T., welcher seither in der
christlichen Dogmatik den persönlichen Repräsentanten der
Sünde bildet, den schlauen und gewaltigen Feind des
göttlichen Reichs, den allezeit geschäftigen Veranlasser
böser Lüste und unfrommer Gedanken in den Gläubigen.
Im Gegensatz zu den Schutzengeln und guten Geistern galten in der
alten Kirche die Dämonen als geschaffene, aber freiwillig
abgefallene Geister, welche die Heidenwelt beherrschen, Objekte des
heidnischen Kultus sind, Christenverfolgungen veranlassen und die
Ausbreitung der Kirche hindern. Ihr Haupt Lucifer (s. d.) hat sich
gleich nach der Schöpfung von Gott losgesagt, sei es aus Neid,
sei es aus Hochmut; seine endliche Bekehrung, welche einzelne
Lehrer in Aussicht stellten (s. Apokatastase), wurde schon von
Irenäus und seit Augustin von der ganzen Rechtgläubigkeit
geleugnet. Dagegen war man der Ansicht, daß infolge des Siegs
Christi über Tod und Hölle Gebet, Taufwasser,
Kreuzeszeichen u. dgl. hinreichen, den T. zu bändigen, und
schon Gregor I. meinte, er sei eigentlich ein dummes Tier, welches
sich in seinen eignen Schlingen fange. Eine schreckhaftere Gestalt
gewann er wieder im Mittelalter. Besonders im germanischen
Volksglauben spielte er von jeher eine große Rolle, teils
allerdings auch humoristisch im Märchen, meistens aber
schauerlich im Glauben an Hexerei und Zauberei. Die Theologen und
Juristen, welche seit dem 15. Jahrh. die Theorie und Praxis der
Hexenprozesse (s. d.) kultivierten, haben auch die genauere
Naturgeschichte des Teufels festgestellt. Selbst die Reformation
hat den ganzen Teufelsglauben als unentbehrlichen Artikel mit in
den Kauf genommen, Luther voran, welcher sein Leben lang wider den
"altbösen Feind" zu Felde lag. Erschüttert wurde diese
Lehre erst im Zusammenhang mit den Hexenprozessen, und infolge der
kritischen Richtung, welche in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrh. die protestantische Theologie erfaßte, fingen selbst
die offenbarungsgläubigen Theologen an, die Lehre vom Satan zu
mildern, während die Rationalisten ihn ganz aus dem
christlichen Glauben verwiesen, indem sie die biblischen
Äußerungen auf Akkommodation zurückführten.
Die neuere Orthodoxie dagegen hat sich des Teufels wieder mit
Vorliebe angenommen, Vilmar ihn sogar gesehen, und im Volksglauben
spielt derselbe noch immer eine große Rolle; selbst die
Meinung, daß man durch Zaubersprüche den T. und seine
Geister herbeirufen und unter gewissen Bedingungen sich dienstbar
machen könne (Teufelsbeschwörung), steht noch vielfach in
Blüte. Vorgestellt wird er nach altväterlicher Weise
schwarz und behaart, mit Bocks- oder Pferdefüßen,
Krallen, Hörnern, einem Kuhschwanz, häßlichem
Gesicht und langer Habichtsnase und bei seinem Verschwinden einen
argen Gestank hinterlassend. Überdies hat er im Volksglauben
noch viel von dem Wesen, den Gestalten und den Namen der alten
Gottheiten beibehalten, und die meisten Sagen, welche vom T.
handeln, sind auf die ehemaligen Götter zu beziehen. Daher
spukt der T. hauptsächlich an Stätten, die im Heidentum
heilig waren, heischt dieselben Opfer, welche einst die Götter
empfingen, erscheint häufig als grüner Jäger oder in
Tiergestalt. Mitunter sind auch Züge von den Riesen auf ihn
übergegangen, und deshalb werden nicht nur uralte Bauten,
Fußspuren in Felsen und Pflanzen nach ihm benannt, sondern
auch viele Sagen von ihm erzählt, in denen er, wie einst die
Riesen von Helden, von Menschen überlistet wird. Die Kunst
pflegt den T. allegorisch, namentlich unter den biblischen Bildern
einer Schlange oder eines Drachen, darzustellen. Vgl. Roskoff,
Geschichte des Teufels (Leipz. 1869, 2 Bde.); Albers, Die Lehre vom
T. (Straßb. 1878); Conway, Demonology and devillore (Lond.
1878, 2 Bde.); Brown, Personality and
613
Teufelsabbiß - Teutoburger Wald.
history of Satan (das. 1887); Wessely, Die Gestalten des Todes
und des Teufels in der darstellenden Kunst (Leipz. 1875).
Teufelsabbiß, s. Scabiosa.
Teufelsaltäre, s. Gräber,
prähistorische.
Teufelsauge, Pflanze, s. v. w. Adonis autumnalis.
Teufelsblatt, s. Urtica.
Teufelsbolzen, s. v. w. Schwanzmeise, s. Meisen.
Teufelsbrücke, die berühmte über die
Reuß führende Brücke der St. Gotthardstraße
im schweizer. Kanton Uri, 30 m über dem Fluß, welcher,
das Ursernthal verlassend, tosend in die Tiefe stürzt, wurde
1830 etwa 6 m über der im Mittelalter erbauten alten T., deren
Überreste 1888 eingestürzt sind, neu erbaut und hat einen
Bogen von 8 m Weite. Etwas höher hinauf ist das Urner Loch (s.
Reuß). Eine zweite T. führt hoch über die wilde
Sihlschlucht bei Einsiedeln (s. Etzel).
Teufelsdreck, s. Asa foetida.
Teufelsei, s. Phallus.
Teufelsfinger, s. Belemniten.
Teufelsfluch, s. Hypericum.
Teufelsgraben, s. Befestigung, prähistorische.
Teufelskammern, s. Gräber, prähistorische.
Teufelskanzeln, Felspartien oder sonstige Punkte im
Gebirge, welche vermutlich in vorgeschichtlicher Zeit heidnische
Kultusstätten waren. Als nach Einführung des Christentums
der heidnische Kultus an solchen Stätten noch heimlich
fortgesetzt wurde, brachte der Volksaberglaube dieselben mit dem
Teufel in Verbindung.
Teufelskirsche, s. Atropa.
Teufelskirschenwurzel, s. Bryonia.
Teufelsklaue, volkstümliche Bezeichnung des
unterirdischen Stockes mancher Farne.
Teufelsküchen, s. Gräber,
prähistorische.
Teufelsmauer, s. Blankenburg 1).
Teufelsmühlen, s. Granit.
Teufelsschloß, s. Kaiser Franz Joseph-Fjord.
Teufelszwirn, s. Cuscuta und Lycium.
Teuffel, Wilhelm, namhafter Philolog, geb. 27. Sept. 1820
zu Ludwigsburg, studierte 1838-42 im evangelisch-theologischen
Seminar zu Tübingen, wurde 1844 Privatdozent daselbst, 1847
Hilfslehrer am Obergymnasium zu Stuttgart, 1849
außerordentlicher, 1857 ordentlicher Professor der
klassischen Philologie in Tübingen und starb daselbst 8.
März 1878. T. hat sich vornehmlich als Literarhistoriker einen
Namen gemacht. Seine "Geschichte der römischen Litteratur"
(Leipz. 1870; 4. Aufl. von Schwabe, 1881) ist für den
Philologen unentbehrlich. Seine litterarhistorischen Monographien
sind zum größten Teil gesammelt in "Studien und
Charakteristiken zur griechischen und römischen sowie zur
deutschen Litteraturgeschichte" (Leipz. 1871, Nachträge 1877;
2. Aufl., das. 1889). Auch hat er für die von Pauly
begründete "Realencyklopädie der klassischen
Altertumswissenschaft", die er seit 1846 vom 4. Band an mit seinem
Kollegen Walz redigierte, zahlreiche Artikel geliefert. Eine
vollständige Geschichte der griechischen Litteratur im Verein
mit mehreren Gelehrten zu bearbeiten, wurde er durch den Tod
verhindert. Außerdem sind zu nennen seine Ausgaben von
Äschylos' "Persern" (2. Aufl., Leipz. 1875) und Aristophanes'
"Wolken" (mit lat. Anmerkungen, das. 1856, 2. Bearb. 1863; mit
deutschen Anmerkungen, das. 1867) und ein Kommentar zum zweiten
Buch der Satiren des Horaz in der Kirchnerschen Ausgabe (Bd. 2,
das. 1857). Aus seinem Nachlaß erschienen "Lateinische
Stilübungen" (Freiburg 1887). Vgl. S. Teuffel, W. T.
(Tüb. 1889).
Teukros (Teucer), im griech. Mythus: 1) Sohn des
Flußgottes Skamandros und der Nymphe Idäa, erster
König von Troas, daher der Name Teukrer für Trojaner; -
2) Sohn des Telamon und der Hesione, aus Salamis, Halbbruder des
Aias, war der beste Bogenschütze unter den Griechen vor Troja,
erhielt später die Herrschaft von Cypern.
Teupitz, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Potsdam,
Kreis Teltow, an einem See, hat eine evang. Kirche, Überreste
eines alten Schlosses (auf einer Insel im See) und (1885) 593 Einw.
T. war bis 1718 im Besitz der Familie Schenk von Landsberg.
Teurung, der Zustand ungewöhnlicher Preishöhe,
namentlich wichtiger Lebensmittel. Bei mangelhaft entwickeltem
Verkehrswesen bildet die T. einen wichtigen Gegenstand der
Staatsfürsorge oder der Teurungspolitik, deren Aufgabe dahin
ging, die Entstehung von Teurungen zu verhüten oder die
Wirkung von solchen zu mildern, so durch Ausfuhrerschwerungen,
durch Förderung der Einfuhr, Verbot des Verkaufs auf dem Halm,
Enteignung von privaten Vorräten, Zwang, Vorräte zu
halten (z. B. der Bäcker in Paris bis 1863) etc. Bei der
heutigen Ausbildung des Verkehrswesens, welches eine rasche und
vollständigere örtliche Ausgleichung von Mangel und
Überfluß erleichtert, hat die Teurungspolitik mehr den
Charakter einer außerordentlichen Fürsorge in
Notfällen angenommen. Weiteres in den Artikeln Getreidehandel,
S. 266, und Hungersnot. Vgl. Roscher, über Kornteurungen (3.
Aufl., Stuttg. 1852).
Teurungszulagen wurden früher in mehreren Ländern
Beamten in Fällen der Teurung (s. d.) gewährt, heute
bei richtiger Bemessung der Besoldung (s. d.) nicht mehr am
Platz.
Teuschnitz, Bezirksamtsstadt im bayr. Regierungsbezirk
Oberfranken, im Frankenwald, hat ein Schloß mit schönem
Garten, Flachsbau und (1885) 969 Einw.
Teut, s. v. w. Tuisco, s. Mannus.
Teutoburg, die von den Cheruskern auf dem Teutberg (der
heutzutage mit dem Arminiusdenkmal geschmückten Grotenburg)
angelegte nationale Feste, welcher wahrscheinlich der von Tacitus
("Annales" I, 60) erwähnte Saltus Teutoburgiensis und somit
vermutlich auch der Teutoburger Wald seinen Namen verdankt.
Dieselbe bot gegenüber dem von den Römern an der
Mündung der Alme in die Lippe angelegten Waffenplatz Aliso
für die kriegerischen Operationen der Germanen einen
Stützpunkt und gestattete, die durch das Gebirge
führenden Pässe zu überwachen. Die Befestigungen
bestanden aus einem vom Fuß des Bergs auf dessen sanfter
Abdachung aufsteigenden geradlinigen Steinwall und zwei ebenfalls
durch Steinwälle gebildeten Schanzen, welche in späterer
Zeit als großer und kleiner Hünenring bezeichnet wurden.
Die jetzt zum großen Teil zerstörte große
Walllinie, welche einen Verteidigungsabschnitt zwischen dem
Fuß des Bergs und der untern Schanze bildete, besteht aus
senkrecht oder der Länge nach dicht nebeneinander
eingetriebenen, zum Teil mannshohen Steinblöcken mit
darüber gelegten kleinern, doch immer ansehnlichen
Steinstücken. Von dem vor der Walllinie befindlichen Graben
sowie von der obern und untern Schanze sind deutliche Spuren
erhalten. Vgl. Peucker, Das deutsche Kriegswesen der Urzeiten, 2.
Teil, S. 376 ff. (Berl. 1860).
Teutoburger Wald, Waldgebirge in Nordwestdeutschland,
schließt sich in der Gegend seines höchsten Punktes, des
Völmerstod (468 m), an die Egge (s. d.) und erstreckt sich in
einer Länge von 115 km bei der geringen Breite von 2-5 km von
SO. nach
614
Teutona - Texas.
NW., durchzieht unter dem Namen Lippescher Wald den
südwestlichen Teil des Fürstentums Lippe, unter dem Namen
Osning die Kreise Bielefeld und Halle des preußischen
Regierungsbezirks Minden, ferner die Kreise Melle und Iburg des
Regierungsbezirks Osnabrück und den Kreis Tecklenburg des
Regierungsbezirks Münster und endigt in geringer Höhe im
Huxberg bei Bevergern an der Eisenbahnlinie Osnabrück- Rheine
und an den großen Mooren der nordwestdeutschen Tiefebene.
Meist besteht das Gebirge aus einem einzigen Kamm, doch erscheinen
auch mehrere Nebenzüge, besonders in dem mittlern Teil. Tiefe
Einschnitte, vom Volk Dören (Thüren) genannt,
unterbrechen den Hauptkamm an vielen Stellen, z. B. die
Dörenschlucht in Lippe, die Thäler von Bielefeld, Halle,
Borgholzhausen, Iburg, Tecklenburg etc. In solchen Thälern
wird das Gebirge mehrfach von Eisenbahnen durchschnitten, so von
den Linien Hannover-Hamm und Wanne-Bremen. Die wichtigsten
Höhen sind außer dem Völmerstod (s. oben): der
Barnacken (451 m), die Externsteine (s. d.), die Grotenburg (s. d.)
mit dem Hermannsdenkmal und der Hermannsberg (366 m) in Lippe, die
Hünenburg (334 m) bei Bielefeld, der Knüllberg bei
Borgholzhausen (311 m) und der Dörenberg bei Iburg (363 m).
Das Gebirge ist meist mit schönen Laubwaldungen bedeckt und
besteht vorzüglich aus den Gesteinen der Kreideformation,
denen nördlich und östlich auch die Gesteine der Jura-
(Schieferthon der Wälderformation bei Iburg) und
Triasformation (Muschelkalk in Lippe) vorgelagert sind. Auf der
östlichen und nördlichen Seite des Gebirges breitet sich
ein meist recht fruchtbares Hügelland aus, während die
entgegengesetzte Seite von den Sand- und Sumpfstrichen der Senne,
besonders im Quellgebiet der Lippe und Ems, begleitet wird. Vgl.
Löbker, Wanderungen durch den T. (Münst. 1878);
Reisehandbücher von Thorbecke (6. Aufl., Detm. 1889) und
Fricke (Bielef. 1884).
Der Name T. wird zuerst bei Tacitus genannt u. in die Nähe
von Ems und Lippe verlegt; welches Gebirge aber Tacitus gemeint
hat, und wo daher der Schauplatz der Schlacht im T., in welcher
Arminius an der Spitze der Germanen 9.-11. Sept. im Jahr 9 n. Chr.
die drei Legionen des Varus vernichtete, zu suchen ist, bildet eine
viel umstrittene und noch heute nicht entschiedene Frage.
Gewöhnlich wird als Ort des Kampfes der Teil des Osning
angenommen, welcher von den beiden Pässen eingeschlossen ist,
die von der Lippe bei Neuhaus und Lippspringe durch die
Dörenschlucht und unter dem Falkenberg hin durch das Gebirge
führen. Mommsen (s. unten) verlegt ihn nach der Venne an der
Huntequelle nördlich von Osnabrück. Vgl. Clostermeier, Wo
Hermann den Varus schlug (Lemgo 1822); Giefers, De Alisone deque
cladis Varianae loco (Kref. 1844); Middendorf, Über die Gegend
der Varusschlacht (Münst. 1868); Dederich, Kritik der
Quellenberichte über die Varianische Niederlage im T. (Paderb.
1868); Esselen, Das römische Kastell Aliso und Ort der
Niederlage des römischen Heers unter Q. Varus (Hamm 1878);
Hülsenbeck, Die Gegend der Varusschlacht (Paderb. 1878);
Mommsen, Die Örtlichkeit der Varusschlacht (Berl. 1885);
Veltman, Funde von Römermünzen im freien Germanien und
die Örtlichkeit der Varusschlacht (Osnabr. 1886); Neubourg,
Die Örtlichkeit der Varusschlacht (Detm. 1887); Höfer,
Die Varusschlacht, ihr Verlauf und ihr Schauplatz (Leipz. 1888);
Knoke, Die Kriegszüge des Germanicus in Deutschland (Berl.
1887, Nachtrag 1888).
Teutona, Waffe, s. Keule.
Teutonen (Teutoni, Teutones), ein durch seine Teilnahme
am Zug der Cimbern berühmt gewordenes Volk in Germanien,
dessen Wohnsitze an der Küste der Ostsee in Jütland und
den dänischen Inseln zu suchen sind. Sie wurden 102 v. Chr.
bei Aquä Sextiä vernichtet. Ein Teil des Volkes blieb im
Norden zurück; ihr Name Teutonovarier hat sich im Namen der
Landschaft Ditmarschen erhalten. S. Cimbern und Teutonen.
Teutsch, Georg Daniel, Bischof der Siebenbürger
Sachsen, geb. 12. Dez. 1817 zu Schäßburg, studierte in
Wien und Berlin Theologie und Geschichte ward 1842 Lehrer und 1850
Rektor des Gymnasiums in Schäßburg, 1863 Pfarrer zu
Agnethlen und 1867 Superintendent oder Bischof der evangelischen
Landeskirche Augsburger Bekenntnisses in Siebenbürgen und
wohnt in Hermannstadt. 1848 und 1863-64 war er Mitglied des
Siebenbürger Landtags, 1864 bis 1865 des österreichischen
Reichsrats und 1867 des ungarischen Reichstags; seit 1885 ist er
Mitglied des ungarischen Oberhauses. Er förderte das
kirchliche und geistige Leben der Siebenbürger Sachsen mit
Eifer und Erfolg, ist Präses des Vereins für
siebenbürgische Landeskunde und schrieb eine "Geschichte der
Siebenbürger Sachsen" (2. Aufl., Leipz. 1874; 2 Bde.). Auch
ist er Mitherausgeber des "Urkundenbuchs der evangel. Landeskirche
in Siebenbürgen".
Tevere, ital. Name des Tiber.
Teverone, Fluß, s. Anio.
Tewfik (eigentlich Taufik) Pascha, Mehemed, Chedive von
Ägypten, geb. 1852, ältester Sohn Ismail Paschas, erhielt
eine ziemlich gute Erziehung und ward 1866 vom Sultan als
Thronfolger anerkannt. Seit 1873 mit der Prinzessin Emineh
vermählt (einen Harem hielt sich T. nie), lebte er meist in
Zurückgezogenheit auf seinem Landgut bei Heliopolis. Erst 1879
trat er in die Öffentlichkeit, als ihn Ismail im März d.
J. nach der Entlassung Nubars an die Spitze des Ministeriums
stellte. Da er sich aber den Wünschen seines Vaters nicht
willfährig genug erwies, mußte er nach vier Wochen
wieder von seinem Posten zurücktreten. Am 8. Aug. d. J.
ernannte ihn der Sultan an Stelle seines abgesetzten Vaters zum
Chedive; er entzog ihm anfangs durch Aufhebung des Fermans von 1873
wesentliche Regierungsrechte, gab sie ihm aber auf Verlangen der
Westmächte später wieder zurück. T. hatte die ernste
Absicht, die Mißbräuche und Schäden in der
Verwaltung des Landes zu beseitigen, gab aber, um die finanziellen
Verpflichtungen Ägyptens zu regeln, den von England und
Frankreich gesandten Kontrolleuren zu viel Macht, so daß die
rücksichtslose Ausbeutung des Volkes zu gunsten der fremden
Gläubiger 1881 Militäraufstände verursachte. T.
zeigte sich dem Haupte der Nationalpartei, Arabi Pascha,
gegenüber schwach und energielos, so daß er 1882 alle
Macht an diesen verlor und erst durch die englische Intervention in
seine Herrschaft wieder eingesetzt werden mußte. Er ist
seitdem ganz von England abhängig.
Tewkesbury (spr. tjuhksberi). Stadt in Gloucestershire
(England), am Zusammenfluß des Avon und des Severn, hat eine
normännische Abteikirche, Fabrikation von Stiefeln,
Strumpfwaren, Nägeln, Leder etc., eine schöne Markthalle
und (1881) 5100 Einw. 1 km südlich davon die "blutige Wiese",
wo 1471 die letzte Schlacht im Krieg der Rosen stattfand.
Texas (abgekürzt Tex.), der südwestlichste und
größte Staat der nordamerikan. Union, grenzt im O. an
Louisiana und Arkansas, im N. an das Indianerterritorium und
Neumexiko, im W. und S. an Me-
615
Texas (geographisch-statistisch, Geschichte).
xiko und den Golf von Mexiko. Das Land zerfällt seiner
Oberflächenbeschaffenheit nach in drei verschiedene
Abteilungen. Von der Küste aus, die fast ihrer ganzen
Länge nach von Haffen eingefaßt ist, erstreckt sich
50-100 km landeinwärts ein Flachland, das zum Teil sehr
fruchtbar und für den Anbau von Baumwolle, Zuckerrohr und
stellenweise auch Reis vorzüglich geeignet ist. Hinter
demselben erhebt sich ein wellenförmiges hügeliges Land,
welches, bis 320 km breit, den ganzen Nordosten des Staats
umfaßt, großenteils von Prärien bedeckt und zum
Anbau sehr geeignet und in seinen Thälern dicht bewaldet ist.
Der ganze nordwestliche Teil des Staatsgebiets endlich ist Berg-
und Hochland und besteht zum Teil aus einem 1300 m hohen
wüsten Sandsteinplateau (Llano estacado oder Staked Plain). An
Flüssen ist T. reich, wenn auch die meisten nur während
eines Teils des Jahrs schiffbar sind. Der Red River scheidet es von
dem Indianergebiet, der Sabine von Louisiana und der Rio Grande von
Mexiko. Ganz innerhalb des Staatsgebiets liegen Trinity, Brazos,
Colorado, Guadalupe, San Antonio und Nueces. Das Klima gilt im
Vergleich zu den übrigen südlichen Staaten der Union
für gesund. Nur in der Küstenniederung fordern
intermittierende Fieber neben dem gelben Fieber fast jährlich
zahlreiche Opfer. Am untern Rio Grande ist die Jahrestemperatur
23,2°, im Norden, bei Fort Worth nur 17,5° C.; dort betrug
der Unterschied zwischen dem kältesten und dem wärmsten
Monat nur 13,2, hier aber 21,9°. Kalte Nordwinde (Northers)
wehen manchmal zwischen November und Januar, während die
Küste im September von Orkanen heimgesucht wird. Mit dem
Süden der Union und deren mittlern Staaten unter einer Breite
liegend, bietet das Land in seiner Vegetation alle Produkte dar,
welche jene Staaten auszeichnen, und ist auch hinreichend mit den
verschiedensten Holzarten zu allen Zwecken der Landwirtschaft
sowohl als der Industrie versehen. Die Tierwelt von T. gleicht der
des benachbarten Louisiana und Arkansas. Büffel, verwilderte
Pferde (Mustangs) durchziehen noch herdenweise die Steppen. In
Bezug auf Mineralien ist T. eins der reichsten Länder der
Welt. Nicht nur Steinkohlen und Eisen kommen in ungeheuern Mengen
vor, sondern auch Kupfer, Silber, Gold, Blei etc., dazu Edelsteine,
Töpfererde, Salz u.a. Diese Bodenschätze liegen jedoch
fast noch unberührt. T. hat ein Areal von 681,842 qkm
(12,843,3 QM.) mit (1880) 1,591,749 Einw., einschließlich von
393,384 Farbigen und 35,347 Deutschen, aber ohne einige tausend
herumstreifende Indianer (1870 erst 818,899 Einw.). Die
öffentlichen Schulen wurden 1886 von 261,021 Kindern besucht,
doch sind noch immer 15 Proz. der über 10 Jahre alten
Weißen und 75 Proz. der Schwarzen des Schreibens unkundig. An
höhern Bildungsanstalten besitzt der Staat 6 Colleges. Von der
Bevölkerung beschäftigen sich 69 Proz. mit Landwirtschaft
und 6 Proz. mit Industrie. Angebaut werden neben Mais, Hafer,
Gerste und Bataten namentlich Baumwolle (1880: 805,284 Ballen),
Zucker und Tabak. Alle unsre Obstsorten gedeihen, und im Süden
auch Feigen. Für die Viehzucht bietet das Innere des Staats
große Vorteile. 1889 zählte man 940,000 Pferde und
Maultiere, 4,084,000 Rinder, 2,413,000 Schafe und 1,950,000
Schweine. Die Fischereien hingegen (1880 von 600 Personen
betrieben) sind unbedeutend. Der Bergbau fördert Gold (1886:
147,000 Dollar), Silber (80,000 Doll.), Steinkohlen (125,000 Ton.)
und Eisen. Die Industrie (1880: 2996 Anstalten mit 12,159
Arbeitern) beschränkt sich fast nur auf Mahlen von Korn und
die Zurichtung von Bauholz. T. hat (1887) 9810 km Eisenbahnen und
besitzt 252 eigne Schiffe von 8621 Ton. Gehalt. Unter den
Häfen ist Galveston der bedeutendste. Die jetzige Verfassung
wurde im November 1869 angenommen. Die gesetzgebende Gewalt liegt
in den Händen eines Senats von 31 und eines
Repräsentantenhauses von 109 Mitgliedern, welche auf zwei
Jahre gewählt werden. Die obersten Staatsbeamten werden
gleichfalls vom Volk gewählt, und der Gouverneur bleibt zwei
Jahre im Amte. Die richterliche Gewalt ist einem Obergericht und 34
Kreisgerichten übertragen; sämtliche Richter erwählt
das Volk. Die Finanzen sind in gutem Zustand. Die Staatsschuld
betrug 1887: 4,237,730 Doll. Eingeteilt wird T. in 78 Counties.
Politische Hauptstadt ist Austin. S. Karte "Vereinigte Staaten,
westliche Hälfte".
Geschichte. T. gehörte früher zu Mexiko und zwar zur
Provinz Tamaulipas. Schon während des mexikanischen
Unabhängigkeitskampfes sammelten sich hier viele Abenteurer
aus den Vereinigten Staaten an. Nachdem der nordamerikanische
Oberst Austin 1823 die Stadt San Felipe de Austin gegründet
hatte, fanden sich immer mehr Ansiedler aus dem Norden ein, die
ihre Absicht, das Land für die Union zu gewinnen, nicht
verhehlten. 1835 erklärten sich die Texaner im Vertrauen auf
den Beistand der herrschenden Partei in den Vereinigten Staaten,
welche eine Vermehrung der Sklavenstaaten wünschte, für
unabhängig und ernannten den General Houston zum
Generalissimus. Ein mexikanisches Heer unter Santa Anna drang zwar
im Januar 1836 in T. ein und besetzte die Hauptstadt San Felipe de
Austin, ward aber 21. April unweit des Jacintoflusses von den
Texanern unter Houston geschlagen. Mehrere andre Expeditionen der
Mexikaner in den folgenden Jahren scheiterten ebenfalls, und um
1840 stand T. als völlig konsolidierte Republik da. Frankreich
und England erkannten dieselbe 23. Nov. 1839 und 14. Nov. 1841 an;
in T. selbst aber verlangte die Mehrzahl Anschluß an die
Vereinigten Staaten, welcher vom Kongreß 1. März 1845
angenommen wurde. Die förmliche Aufnahme in den Staatenbund
erfolgte 29. Dez. 1845. Hierüber entbrannte 1846 ein Krieg
zwischen Nordamerika und Mexiko, der am 2. Febr. 1848 mit dem
Friedensvertrag von Guadalupe Hidalgo endete; in diesem entsagte
Mexiko allen seinen Ansprüchen auf T. und das Gebiet zwischen
Rio Grande und Nueces, doch schlug die Unionsregierung durch
Beschluß vom 7. Sept. 1850 einen Teil dieser Länder zu
Neumexiko, welches inzwischen als eignes Territorium in die Union
getreten war, und T. erhielt hierfür eine Entschädigung
von 10 Mill. Doll. 1844 hatte sich zu Mainz ein deutscher
Adelsverein zu dem Zweck gebildet, den nach T. auswandernden
Deutschen Hilfe und Schutz zu gewähren. Noch in demselben Jahr
wurden 150 Familien nach T. befördert und in einer Kolonie,
Neubraunfels, vereinigt. Infolge örtlicher Schwierigkeiten und
Geldmangels geriet aber die Sache bald ins Stocken. Der Prinz von
Solms-Braunfels, der Leiter der Angelegenheit, verließ das
Land, und an seine Stelle trat ein Preuße, v. Meuselbach,
welcher im Herbst 1845 den Indianern einen nördlich von jener
Kolonie gelegenen bedeutenden Landstrich abkaufte, wo später
Friedrichsburg angelegt ward. Zwar kam jetzt ein neuer Zug von
mehreren tausend Auswanderern an; doch gerieten dieselben aus
Mangel an Mitteln sowie durch die ungeeignete Lokalität, den
mexikanischen Krieg und Krankheiten bald in eine sehr
mißliche Lage. Nur Neubraunfels und Friedrichsburg kamen
etwas empor.
616
Texcoco - Thaarup.
1847 verabschiedete der Mainzer Verein alle seine Beamten und
Agenten in T. und überließ seinen dortigen Grundbesitz
dem Advokaten Martin aus Freiberg, womit die ganze Sache ihr Ende
erreichte. Kein besseres Schicksal als die deutschen Einwanderer
hatten die 1848 unter Führung des französischen
Kommunisten Cabet (s. d.) hier angelangten Ikarier. T. stand
während des amerikanischen Bürgerkriegs sehr entschieden
zur Sezession, kam indes in seinen mittlern und westlichen Teilen
infolge der Wegnahme des Forts Esperanza am Eingang der
Matagordabai durch den Unionsgeneral Banks in die Gewalt des
Nordens. T. widerstrebte nebst Mississippi und Virginia am
längsten der Annahme des sogen. konstitutionellen Amendements
und ward daher erst später rekonstituiert. Vgl. Römer,
Texas (Bonn 1849); Olmstedt, Wanderungen durch T. (deutsch, 3.
Aufl., Leipz. 1872); Eickhoff, In der neuen Heimat (Geschichtliches
über die deutsche Einwanderung, New York 1884); Burkes,
Texas-Almanack; Baker, History of T. (New York 1873); H. Bancroft,
History of the Pacific States. Bd. 10 (San Francisco 1884).
Texcoco (Tezcuco, spr. techkoko), Stadt im mexikan. Staat
Mexiko, am gleichnamigen, 240 qkm großen Salzsee, hat eine
Glashütte, Trümmer alter Paläste sowie eines
großartigen Aquädukts und (1880) 15,626 Einw. T. war
unter dem Namen Acolhuacan Hauptsitz der Kultur der Azteken. Der
See (2275 m ü. M.) wird immer seichter. Vgl. Mexiko, S.
568.
Texel, niederländ. Insel in der Nordsee, vor dem
Eingang des Zuidersees gelegen, durch das Marsdiep vom Festland
getrennt, 187 qkm (3,4 QM.) groß, an der Ost- und
Südseite durch Deiche, im übrigen durch Dünen gegen
das Meer geschützt, hat schönes Weideland, zwei
Häfen, ein Fort (Oude Schans) zur Verteidigung des Marsdiep
und 6342 Einw. Haupterwerbszweig ist Schafzucht (etwa 34,000
Stück), welche außer feiner Wolle (70-100,000 kg) den
berühmten grünen Texeler Schafkäse liefert, daneben
Ackerbau, Fischfang und Schiffahrt. T. ist Sitz eines deutschen
Konsulats.
Texier (spr. tekssieh), 1) Charles Felix Marie,
Architekt, Archäolog und Geolog, geb. 29. Aug. 1802 zu
Versailles, bereiste im Auftrag der französischen Regierung
seit 1834 mehrere Jahre lang Kleinasien und zwar in einzelnen
Teilen als erster Europäer, war 1834 in Phrygien, Kappadokien
und Lykaonien, 1835 an der West- und Südküste und zog
1836 von Tarsos mitten durch die Halbinsel nach Trapezunt. 1838-40
forschte er sodann mit La Guiche und Labourdonnaye in Armenien,
Kurdistan und Persien und 1842 wieder an der Westküste
Kleinasiens. Zeitweise Sekretär der Geographischen
Gesellschaft in Paris, wurde er 1855 Mitglied der Akademie und
starb 1871. Er schrieb: "Description de l'Asie Mineure" (Paris
1839-49, 3 Bde.); "L'Arménie, la Perse et la
Mésopotamie" (das. 1840-52, 2 Bde.) u. a.
2) Edmond, franz. Publizist, geb. 1816 zu Rambouillet
(Seine-et-Oise), studierte in Paris und veröffentlichte
bereits in seinem 19. Jahr in Gemeinschaft mit Ménard eine
Sammlung von Gedichten unter dem Titel: "En avant" (1835). Dann mit
Leidenschaft sich auf die Journalistik werfend, lieferte er
Beiträge in die beliebtesten Tagesblätter, hatte
später hervorragenden Anteil am "Siècle" und
übernahm 1860 die Redaktion der "Illustration". Eine seiner
gelungensten und ergötzlichsten Schriften ist die Humoreske
"La physiologié du poète" (1841), welche unter dem
Pseudonym Sylvius erschien. Bemerkenswert sind ferner: "Biographie
des journalistes" (1850); "Lettres sur l'Angleterre" (1851);
"Critiques et récits littéraires" (1852); "Tableau de
Paris" (1853, 2 Bde.); "Les hommes de la guerre d'Orient" (1854);
"Paris, capitale du monde" (1867); "Le journal et les journalistes"
(1867); die im Verein mit Le Senne geschriebenen Romane: "Madame
Frusquin" (1878), "Mémoires de la Cendrillon"
(preisgekrönt, 1879), "La dame du lac" (1880) u. a. T. starb
20. Okt. 1887 in Paris.
Text (lat. textus), eigentlich Gewebe, Geflecht; in der
Litteratur der eigentliche Inhalt eines Buches, im Gegensatz zu dem
in den Noten (Anmerkungen) enthaltenen; manchmal auch s. v. w.
Schriftwerk überhaupt, wenn dasselbe in einer fremden Sprache
abgefaßt ist; in der Homiletik Stelle der Heiligen Schrift,
welche der Predigt (s. d.) zu Grunde gelegt zu werden pflegt; in
der Musik die einem Gesangstück zu Grunde liegenden Worte; in
der Buchdruckerkunst Name einer größern Schriftgattung
von 20 typographischen Punkten Kegelstärke (s.
Schriftarten).
Textil (lat.), auf Weberei bezüglich; daher
Textilindustrie, Gesamtbezeichnung der Arbeiten, welche zur
Erzeugung der Stoffe dienen, wie sie als Handelsware üblich
sind und Spinnerei, Weberei, Näherei und Stickerei mit
Einschluß der Appretur, Bleicherei etc. umfassen.
Textilpflanzen, Spinnfasern (s. d.) liefernde Pflanzen.
Textor, Vogel, s. v. w. Viehweber, s.
Webervögel.
Textularia, s. Rhizopoden.
Textur (lat.), Gewebe, Gefüge, Anordnung.
Textus receptus (lat.), s. Bibel, S. 882.
Tezcuco, Stadt und See, s. Texcoco.
Tezel, Johann, berüchtigter Ablaßkrämer,
geboren um 1455 zu Leipzig, trat 1489 in den Dominikanerorden und
trieb sodann 15 Jahre lang den Ablaßhandel auf die
unverschämteste Weise. Zu Innsbruck wegen Ehebruch zum Tod
mittels Ersäufens verurteilt, ward er auf Verwenden des
Erzbischofs Albrecht von Mainz wieder auf freien Fuß gesetzt.
Er holte sich in Rom Ablaß und ward sogar zum apostolischen
Kommissar ernannt. Jetzt nahm er als Unterkommissar des Erzbischofs
Albrecht von Mainz seinen Ablaßhandel besonders in Sachsen
wieder auf und hielt eine reiche Ernte, bis Luther 31. Okt. 1517 in
seinen Thesen gegen dies Unwesen auftrat. T. wurde hierauf 1518 zu
Frankfurt a. O. Doktor der Theologie und starb im August 1519 in
Leipzig an der Pest. Sein Leben beschrieben Hofmann (Leipz. 1844),
Körner (Frankenb. 1880); katholischerseits: Gröne ("T.
und Luther", 2. Aufl., Soest 1860) und Hermann (2. Aufl., Frankf.
1883). Vgl. Kayser, Geschichtsquellen über T. (Annab.
1877).
Th, th, in sprachwissenschaftlicher Hinsicht, s. "T".
Th, in der Chemie Zeichen für Thorium.
Thaarup, Thomas, dän. Dichter, geb. 21. Aug. 1749 zu
Kopenhagen, war von 1794 an eine Zeitlang Mitglied der
Theaterdirektion und starb als Privatgelehrter 11. Juli 1821 auf
dem Gut Smidstrup unfern Hirschholm. T. ist namentlich als
Verfasser der kleinen dramatischen Idylle: "Høstgildet"
("Das Erntefest") und "Peders Bryllup" ("Peters Hochzeit") bekannt,
die durch ihren einfachen heimischen Ton und ihre anmutigen,
stimmungsvollen Gesänge ungemein ansprachen; besonders diese
letztern erfreuten sich der weitesten Verbreitung und sind zum Teil
Volkslieder geworden. Seine Schriften gab Rahbek ("Efterladte
poetiske Skrifter", Kopenh. 1822), eine Auswahl seiner Gedichte mit
Biographie Nygaard (das. 1878) heraus.
617
Thabur - Thaleia.
Thabur (türk.), s. Tabor.
Thackeray (spr. thäckere), 1) William Makepeace,
berühmter engl. Romandichter, geb. 12. Aug. 1811 zu Kalkutta
als Sohn eines Beamten der Ostindischen Kompanie, ward im Charter
House zu London erzogen, studierte in Cambridge, bereiste den
Kontinent, wo er sich unter anderm in Weimar aufhielt (1830-31),
und widmete sich nach pekuniären Verlusten der
Schriftstellerei. Unter dem Namen Michael Angelo Titmarsh und
George Fitzboodle, Esq., lieferte er zunächst Beiträge zu
"Fraser's Magazine", unter denen besonders die Erzählungen:
"Barry Lyndon" und "The adventures of an Irish fortune-hunter"
Beachtung verdienen. Als Titmarsh veröffentlichte er ferner
die von ihm selbst illustrierten Werke: "The Paris sketch-book"
(1840), "The chronicle of the Drum "(1841), "The Irish sketch-book"
(1843) sowie die Reisebeschreibung "Notes of a journey from
Cornhill to Grand Cairo" (1846). Doch erst "Vanity Fair" (1847),
seine originellste Schöpfung, machte ihn berühmt: hier
zeigt er sich als vollendeten Satiriker und bedeutenden
Novellisten. Es folgten: "Our street" (1848); "Dr. Birch and his
young friends" (1849); "Pendennis" (1849-1850), im Plan "Vanity
Fair" nicht ebenbürtig, doch gleich ausgezeichnet durch Humor
und Charakterzeichnung, und "The Kickleburys on the Rhine" (1851).
Um diese Zeit begann er, erst in England, dann in Schottland und
Amerika, öffentliche Vorlesungen zu halten, zunächst
über "The English humourists of the eighteenth century",
sodann über "The four Georges". Seinem Studium der Humoristen
entsproß der Roman "Esmond" (1852), eine der besten
Schilderungen der Zeit der Königin Anna; besonders wertvoll
sind: "The Newcomes" (1855), worin der Ernst und die Herzlichkeit
Thackerays ganz besonders hervortreten, und "The Virginians"
(1857), ein Seitenstück zu "Esmond". 1860 übernahm er die
Herausgabe des "Cornhill Magazine", zu dem er die Erzählungen:
"The adventures of Philip", "Lovell the widower" und eine kleine
monatliche Skizze, die "Round-about papers", lieferte. T. starb 24.
Dez. 1863. Gesammelt erschienen seine Werke zuletzt 1887 in 24
Bänden, in illustrierter Prachtausgabe London 1879 ff., sein
Briefwechsel 1887. Vgl. Hannay, Memoir of T. (Edinb. 1864);
Trollope, T. (Lond. 1879; deutsch von Katscher, Leipz. 1880);
Conrad, W. M. Thackeray (Berl. 1887).
2) Anna Isabella, Tochter des vorigen, ebenfalls
Schriftstellerin, s. Ritchie.
Thaddädl, stehende komische Figur in alten Wiener
Volksdramen, Seitenstück zum Kasperle u. dgl. Hauptvertreter
derselben war der Komiker Anton Hasenhut (gest. 1841).
Thaddäus, s. Judas 2).
Thag (Thug), in Ostindien Hindubanden, die es sich zum
Geschäft machen, als Pilger u. dgl. Vertrauen bei Reisenden
oder in Gehöften zu erwecken und die Leute dann durch Gift zu
betäuben, ja selbst zu ermorden, um sich ihrer Habe zu
bemächtigen. Seit 1831 ergriff die britische Regierung von
Indien ernste Maßregeln gegen das Unwesen, so daß es
nur noch in vereinzelten Fällen auftritt.
Thai, die Bewohner von Siam, s. Schan.
Thaïs, berühmte griech. Hetäre, aus Athen
gebürtig, folgte Alexander d. Gr. auf seinem Zuge gegen
Persien und soll bei einem Gastmahl den berauschten Geliebten zur
Verbrennung der Stadt Persepolis veranlaßt haben. Später
wurde sie eine der Frauen des Ptolemäos Lagi.
Thal, s. Thäler.
Thal, Dorf in Sachsen-Gotha, im Thüringer Wald,
unweit des Erbstroms und an der Eisenbahn Wutha-Ruhla, hat eine
evang. Kirche, ein Amtsgericht, eine Burgruine (Scharfenberg) und
430 Einw.; T. ist eine beliebte Sommerfrische. Vgl. Lion, Bad T.
(Eisenach 1887).
Thalamifloren ("Bodenblütige"), eine
größere Abteilung im Pflanzensystem De Candolles,
begreift alle diejenigen Polypetalen, deren Kron- und
Staubblätter dem Blütenboden (thalamus) eingefügt
sind.
Thalamos, im altgriech. Haus das eheliche Schlafgemach;
auch s. v. w. Braut- oder Ehebett; in der Botanik s. v. w.
Fruchtboden.
Thalassa (Thalatta, griech.), das Meer.
Thalassidroma, s. Sturmvogel.
Thalberg, Sigismund, Klavierspieler und Komponist, geb.
7. Jan. 1812 zu Genf als natürlicher Sohn des 1854
verstorbenen Fürsten Dietrichstein-Proskau-Leslie, bildete
sich in Wien unter Sechter und Hummel in der Komposition und im
Klavierspiel aus, begab sich 1830 auf Konzertreisen, ward 1834 zum
österreichischen Kammervirtuosen ernannt, bereiste seit 1855
als Konzertspieler wiederholt England und Amerika und zog sich 1858
auf eine Villa bei Neapel zurück, wo er, mit Unterbrechung
einer 1862-63 unternommenen Kunstreise nach Paris, London und
Brasilien, bis zu seinem Tod 27. April 1871 der Ruhe genoß.
T. verdankt seine außerordeutlichen Erfolge als Virtuose
vornehmlich der von ihm eingeführten Behandlungsweise des
Klaviers, welche sich von der seiner Vorgänger im wesentlichen
dadurch unterscheidet, daß hier die frühere Trennung von
Melodie und Passagenwerk aufgehoben ist und das letztere als
Begleitung der Melodie auftritt, meist in Form von Arpeggien, die
in ihren mannigfaltigen Umstellungen das melodische Motiv umranken,
ohne es zu ersticken; vielmehr bestand Thalbergs Hauptstärke
gerade darin, daß er durch gesangreichen Vortrag und
geschickte Benutzung des Pedals die Melodie in einer Weise belebte,
wie es außer Liszt noch keinem Klavierspieler gelungen war.
Dieser ihm eigentümliche Stil gelangt auch in seinen
zahlreichen Klavierkompositionen zur Geltung, weshalb dieselben
einen höhern Kunstwert nicht beanspruchen können. Auch
als Opernkomponist hat sich T. noch in den 50er Jahren zweimal in
die Öffentlichkeit gewagt, beide Male jedoch ohne
nennenswerten Erfolg.
Thälchen, in der Botanik, s. Umbelliferen.
Thale, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Magdeburg,
Kreis Aschersleben, an der Bode und der Linie Magdeburg-T. der
Preußischen Staatsbahn, 175 m ü. M., hat eine evang.
Kirche, eine Oberförsterei, ein großes
Eisenhüttenwerk (Blechhütte) mit Maschinenfabrik,
Fabrikation emaillierter Kochgeschirre, eine Zementfabrik, eine
Dampfziegelei, Bierhrauerei und (1885) 4498 Einw. Dabei das
Hubertusbad mit jod- und bromhaltigen Kochsalzquellen und das
Bodethal, die großartigste Partie des Harzes, mit dem
Hexentanzplatz und der Roßtrappe (s. d.) sowie eine
Blödsinnigenanstalt (Kreuzhülfe) und ein Asyl für
Epileptische (Gnadenthal).
Thale, Adalbert vom, Pseudonym, s. Decker 3).
Thaleia (Thalia, die "Blühende"), 1) eine der neun
Musen, später besonders als Muse des Lustspiels betrachtet;
wird auf antiken Denkmälern dargestellt mit kürzerm
Untergewand und Mantel, in der erhobenen Linken die komische Maske,
in der gesenkten Rechten ein pedum (Krummstab) haltend. Vgl. Musen
(mit Abbildung). Jetzt wird T. gewöhnlich als
618
Thaler - Thäler.
Beschützerin des Theaters im allgemeinen genannt. - 2) Eine
der drei Grazien oder Chariten (s. d.).
Thaler, eine größere Silbermünze, wie sie
zuerst in Joachimsthal in Böhmen (Joachimsthaler) von den
Herren v. Schlik seit 1518 mit ihrem Wappen, dem böhmischen
Löwen, und dem Bilde des heil. Joachim geschlagen wurde.
Später verstand man unter T. alle groben Silbermünzen,
welche mehr als 1 Lot wogen. Dieselben kamen unter verschiedenen
Nebenbezeichnungen vor, als Kronenthaler, Laubthaler, Speziesthaler
etc. (s. d.). Der auch nach der Einführung der
Reichswährung in Deutschland noch umlaufende T., welcher bis
Ende 1871 die Geldeinheit von beinahe ganz Norddeutschland bildete,
in 30 Groschen geteilt und auch in Süddeutschland geprägt
wurde, wo er den Wert von 1¾ Gulden hatte (im allgemeinen
Reichsthaler genannt, abgekürzt Rthlr.), enthält nach dem
Münzgesetz von 1857: 16,666 g fein Silber und wird 3 Mark Gold
gleich gerechnet. Auch in Dänemark und Schweden wurde bis Ende
1874 nach Reichsthalern gerechnet (s. Rigsdaler und Riksdaler).
Thäler, verschieden gestaltete Einsenkungen der
Gebirge und Durchfurchungen der Plateaus. Ist die Entfernung der
begrenzenden Gesteinswände, der Gehänge (welche als
rechtes und linkes im Sinn eines mit dem Gesicht dem Thalausgang
zugekehrten Beobachters unterschieden werden), eine geringe, und
ist der Winkel, unter welchem die Gehänge ansteigen, ein
großer, dem rechten sich nähernder, so entstehen
Schluchten, Gründe, Klammen, Canons (s. d.). Die beiden
Gehänge laufen häufig selbst bei gewundenen Thälern
einander parallel, so daß ein ausspringender Teil des einen
Gehänges (Thalsporn) einem einspringenden des andern
(Thalwinkel) entspricht. Nähern sich die beiden Gehänge,
so entstehen Thalengen; verlaufen sie annähernd in einer
Kreislinie, so entstehen Thalweitungen (Bassins, Becken, Zirkus
und, wenn die Gehänge steil abfallen, Thalkessel). Der
allgemeine Lauf der Gebirgsthäler steht entweder ungefähr
senkrecht zur allgemeinen Erstreckung des Gebirgskammes
(Querthäler, T. erster Ordnung), oder es laufen die T. etwa
parallel zu dem Hauptkamm des Gebirges (Längsthäler, T.
zweiter Ordnung). T., deren allgemeine Erstreckung eine zwischen
diesen beiden vermittelnde Richtung einhält, hat man
Diagonalthäler genannt. - Ein bei der Bildung der T. nie ganz
fehlendes, mitunter allein wirkendes Agens ist der erodierende
Einfluß des strömenden Wassers. Denkt man sich einen
zunächst vollkommen unverritzten Bergabhang, an welchem Wasser
herabströmt, so wird im Anfang dort das Wasser am energischten
angreifen, wo die einzelnen dünnen Wasserstränge zu einem
mächtigern Bergstrom zusammentreten. Bei fortgesetzter
Thätigkeit wird sich bald ein oberer und unterer Teil des
Wasserlaufs unterscheiden lassen. Im obern, dem Berggebiet,
schäumt der Bergstrom auf stark geneigter Thalsohle dahin,
zertrümmert das ihm entgegenstehende Gesteinsmaterial und
führt es hinweg. In dem untern Teil, dem Thalgebiet, wird der
in weniger geneigtem Terrain zum Fluß verlangsamte Bergstrom
einen Teil des im Oberlauf aufgewühlten Materials wieder
absetzen, seine erodierende Thätigkeit im wesentlichen nur bei
Hochwasser und nur im Sinn der Erweiterung, nicht der Vertiefung
des Thals äußern. In solchen breiten Thälern
läßt sich neben dem im eignen Material eingewühlten
Flußbett ein Inundationsgebiet, von Terrassen (Hochufern)
begrenzt, unterscheiden, das Produkt gelegentlicher Hochwasser. Je
länger die erodierende Thätigkeit anhält, desto
größere Strecken wird die Ausbildung des Thalgebiets
annehmen, desto weiter nach rückwärts, dem Kamm des
Gebirges näher, wird der Oberlauf mit seiner starken Neigung
der Thalsohle sich eingraben. Im obersten Wasserlauf, nahe dem Kamm
des Gebirges, ist ein weiter Thalkessel, oft mit steilen, fast
senkrechten Felswänden, vorhanden (in den Pyrenäen Oules
geheißen), über welche sich bei zur Bildung
günstiger Gesteinsbeschaffenheit Wasserfälle in die Tiefe
stürzen. Der Ausgang aus dem Kessel ist gewöhnlich stark
verengert, schluchtartig, und erst nach abwärts erweitert sich
dann die Thalbildung in der Region des nicht mehr stürmischen,
sondern ruhigen Wasserlaufs. Werden in der gechilderten Weise auf
den zwei einander entgegengesetzten Abhängen eines Gebirges T.
ausgewaschen, so wird das letzte Stadium in einer teilweisen
Abtragung des Gebirgskammes bestehen. Statt eines steilen Randes,
der die beiden auseinander strahlenden T. trennt, wird ein kleines
Plateau, tiefer gelegen als der Kamm des Gebirges (Paß),
dieselben vielmehr verbinden. Ganz ähnlich wie die
geschilderte Bildung der Gebirgsthäler verläuft der
Prozeß bei dem Einsenken der T. in die Plateaus. Abweichungen
können zunächst durch Verschiedenheiten in den zu
durchbrechenden Gesteinen begründet sein. Wälle
härtern Materials werden hemmend einwirken, das Thal sperren
und zu Thalerweiterungen dadurch Veranlassung geben, daß sich
das Wasser hinter ihnen seeartig ausbreitet, bis der Wall durchnagt
ist und der Fluß in Stromschnellen den vorher sperrenden Wall
durcheilt. Werden ferner weiche, der Erosion leicht
zugängliche Gesteine durch eine härtere Bank bedeckt, so
wird dort eine Thalschwelle mit Wasserfällen entstehen, wo die
weichern Gesteine zuerst verritzt werden. Durch Unterwaschung wird
das härtere Material stückweise abbrechen und nachsinken,
die Thalschwelle ruckweise nach dem Oberlauf zu weiter und weiter
zurückreichen. Ein oft citiertes Beispiel für solche
Verhältnisse bietet der Niagara dar. Der Erosion kann aber
auch der Weg durch Dislozierung der Gesteinsschichten
vorgeschrieben sein, so daß am fertigen Gebirgsthal zwar die
Erweiterung und endgültige Gestaltung auf Rechnung der Erosion
fallen, die erste Anlage und Richtung aber in dem allgemeinen Bau
des Gebirges begründet sind. Querthäler sind häufig
erweiterte Querspalten des Gebirges (Klusen, Klausen);
Längsthäler laufen mitunter die Grenze zwischen zweierlei
Schichten entlang, die gegen den Kamm des Gebirges zu ansteigen. Es
zeigen diese letztern (Scheidethäler, isoklinale T., Komben)
an den beiden Gehängen verschiedenes Gestein und nur auf dem
einen Abhang einen steilen Absturz, während der Sinn des
Einfallens der Schichten rechts und links der gleiche ist.
Längsthäler können ferner in der Richtung der
Sattellinie des Sattels eines Schichtensystems (s. Schichtung)
verlaufen, dessen oberste Schichten bei der Dislozierung zerrissen
wurden. Solche Gewölbthäler (Hebungsthäler,
antiklinale T.) werden an beiden Gehängen einerlei Folge der
Gesteine erkennen lassen, deren Schichten von der Thallinie aus
nach beiden Seiten einfallen. Muldenthäler
(Senkungsthäler, synklinale T.) verlaufen der Muldenlinie
einer Mulde (s. Schichtung) entlang; hier werden die
Gesteinsschichten der Gehänge nach der Thallinie zu
einschießen. Ferner kann die zwischen zwei ungefähr
parallel verlaufenden Lavaströmen entstehende Einsenkung
(interkolliner Raum) eine Thalbildung
619
Thalerhumpen - Thallochlor.
veranlassen. Besondere Thalformen zeigen auch einzeln stehende
Berge vulkanischen Ursprungs. Nach Erlöschen der vulkanischen
Thätigkeit senkt sich häufig an der Stelle des zentralen
Kegels ein tiefes Kesselthal (Caldera, Caldeira) ein, von welchem
aus mitunter ein den Ringwall durchbrechendes Hauptthal nach
außen führt, und gleichzeitig wird auch der
äußere Mantel von radial ausstrahlenden Rillen
(Barrancos) durchfurcht werden (vgl. Vulkane). Der Form nach stehen
der Calderabildung nahe die hinsichtlich der Entstehungsweise noch
streitigen Maare (s. Vulkane) als Einsenkungen in vulkanische
Plateaus oder doch in der Nähe vulkanisch gebildeter
Lokalitäten, und ganz ähnliche T., in Plateaus rein
sedimentärer Gesteine eingesenkt, liefern Unterwaschungen und
die von ihnen veranlaßten Erdfälle.
Thalerhumpen, s. Münzbecher.
Thales, griech. Philosoph und Stifter der ionischen
Schule, geboren um 640 v. Chr. zu Milet in Kleinasien, Zeitgenosse
des Solon, Sprößling einer phönikischen Familie,
unternahm in seinen reifern Jahren Reisen nach Kreta,
Phönikien, Ägypten und lebte auch eine Zeitlang an dem
Hof des Königs Krösos. In Ägypten soll er die
Höhe der Pyramiden berechnet und den Unterricht der Priester
des Landes genossen haben. Sein Tod wird in das erste Jahr der 58.
Olympiade (543) gesetzt. Indem er das Seiende auf ein
möglichst einfaches Prinzip zurückzuführen und aus
diesem die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen abzuleiten suchte,
stellte er das Wasser als Grundprinzip aller Dinge auf, aus welchem
alles entstanden sei und fortwährend entstehe, sowie alles
auch wieder in dasselbe zurückkehre. Aus der Verdichtung und
Verdünnung jenes Grundstoffes leitete er, wie es scheint, die
Veränderung der Dinge ab. Seine Lehren wurden erst von
spätern Philosophen, namentlich von Aristoteles,
aufgezeichnet, desgleichen eine Menge Gnomen oder Sentenzen, die
man ihm zuschrieb, wie das berühmte "Erkenne dich selbst", und
die ihm eine Stelle unter den sogen. sieben Weisen Griechenlands
erwarben. Er soll auch dem Krösos mechanische Hilfsmittel zur
Abdämmung des Halys an die Hand gegeben und das Jahr auf 365
Tage bestimmt haben. Die ihm beigelegte Vorausbestimmung der
Sonnenfinsternis vom Jahr 585 wurde von Martin ("Revue
archéologique" 1864) als unhistorisch dargethan. Als seine
vorzüglichsten Schüler werden Anaximander, Anaximenes und
Pherekydes genannt.
Thalfahrt, Fahrt zu Thal, die Fahrt der Schiffe
stromabwärts, im Gegensatz zur Bergfahrt (s. d.).
Thalheim, Dorf in der sächs. Kreishauptmannschaft
Zwickau, Amtshauptmannschaft Chemnitz, an der Zwönitz und der
Linie Chemnitz-Adorf der Sächfischen Staatsbahn, hat eine
evang. Kirche, ein Rittergut mit Schloß, eine
Oberförsterei, Baumwoll-, Flachs- und Streichgarnspinnerei und
(1885) 4428 Einw.
Thalia, Muse, s. Thaleia.
Thalia dealbata, s. Wasserpflanzen.
Thalleiochin, s. Chinin.
Thallin (Tetrahydroparachinanisol) C10H13NO3 entsteht bei
Behandlung des Methyläthers des Paraoxybenzchinolins mit Zinn
und Salzsäure, bildet dicke rhombische Prismen, schmilzt bei
42-43° und siedet bei 283°. Schwefelsaures T., ein
gelblichweißes kristallinisches Pulver, welches in Wasser
löslich ist und bitter schmeckt, wird als antipyretisches
Mittel benutzt. Auch das weinsaure Salz findet Anwendung.
Thallium Tl, Metall, findet sich mit Kupfer, Silber und
Selen im Crookesit (16-18,5 Proz.) und Berzelianit, in geringer
Menge in manchen Schwefel- und Kupferkiesen, Zinkblende, im
Lepidolith und im Glimmer von Zinnwald, im Badesalz von Nauheim,
Orb, Dürrenberg, im Braunstein etc. Es geht beim Rösten
der Kiese in den Flugstaub und in den Bleikammerschlamm (welcher z.
B. bei Verarbeitung von Meggener Kiesen 3,5 Proz. T. enthält),
auch in die Schwefelsäure und aus dieser bei der Darstellung
von Salzsäure in letztere über; ebenso findet es sich im
Schwefel aus Meggener und spanischen Kiesen, im Schwefel von
Lipari, im käuflichen Wismut etc. Aus Rammelsberger Kiesen
gewonnene Lauge, welche auf der Juliushütte bei Goslar
versiedet wird, ist reich an T. Zur Gewinnung von T. kocht man
Bleikammerschlamm wiederholt unter Zusatz von etwas
Schwefelsäure mit Dampf aus, koliert, setzt Salzsäure zu,
wäscht das abgeschiedene Thalliumchlorür aus, verdampft
es mit konzentrierter Schwefelsäure zur Trockne, löst das
schwefelsaure Thalliumoxydul in Wasser und fällt abermals
Thalliumchlorür, verwandelt dies wieder in Sulfat, behandelt
die Lösung desselben mit Schwefelwasserstoff, um Arsen zu
fällen, digeriert sie dann mit Zink, wäscht das
ausgeschiedene T. mit Wasser, preßt und schmelzt es in einem
Tiegel, in welchen Leuchtgas geleitet wird. T. ist kristallinisch,
fast zinnweiß, stark glänzend, viel weicher und weniger
fest als Blei, gibt auf Papier einen bläulichen Strich, der
durch Oxydation bald verschwindet, ist dehnbar, spez. Gew. 11,8,
Atomgewicht 203,6, schmilzt bei 290°, destilliert im
Wasserstoffstrom, oxydiert sich schnell an der Luft, wird daher am
besten in aufgekochter Zinkvitriollösung aufbewahrt, und
entwickelt beim Erhitzen violetten Dampf und eigentümlichen
Geruch. Das verrostete Metall wird im Wasser durch Lösung des
Oxyds wieder blank, und fein verteiltes T. löst sich
allmählich in Wasser beim Zutritt der Luft. T. löst sich
leicht in verdünnter Schwefelsäure und
Salpetersäure, schwer in Salzsäure, verbindet sich direkt
mit Chlor, Brom, Jod und Schwefel, fällt viele Metalle aus
ihren Lösungen und färbt die Flamme schön grün.
In vieler Hinsicht gleicht es dem Kalium, in andrer dem Blei; seine
Verbindungen sind giftig. Mit Sauerstoff bildet es schwarzbraunes
Thalliumoxydul Tl2O, welches sich in Wasser zu Thalliumhydroxydul
TlOH löst. Dies bildet gelbe Kristalle, ist leicht
löslich in Wasser und Alkohol; die farblose Lösung
reagiert alkalisch, schmeckt laugenartig, wirkt ätzend,
absorbiert begierig Kohlensäure. Es bildet mit Säuren
meist lösliche Salze, aus denen Salzsäure sehr schwer
lösliches weißes Thalliumchlorür TlCl fällt,
welches am Licht violett wird, leicht schmilzt und zu einer
hornartigen Masse erstarrt. Mit kohlensaurem Thalliumoxydul
bereitetes Glas ist härter und schwerer als Kaliflintglas und
bricht das Licht stärker als alle andern Glassorten.
Thalliumoxyd Tl2O3 ist braun, unlöslich in Wasser und
Alkalien, gibt leicht Sauerstoff ab. Das Thalliumhydroxyd TlO2H
entsteht bei Einwirkung von Ozon auf Thalliumhydroxydul, ist braun,
unlöslich in Wasser, gibt mit Säuren die wenig
beständigen, meist kristallisierbaren farblosen Oxydsalze. Man
benutzt T. zur Darstellung optischer Gläser und mit
Thalliumhydroxydul imprägniertes Papier (Thalliumpapier) als
Reagens auf Ozon. T. wurde 1861 von Crookes entdeckt.
Thallo, Göttin, s. Horen.
Thallochlor (Flechtengrün), der grüne Farbstoff
der Flechten.
620
Thallophyten - Thapsia.
Thallophyten (griech.), s. Thallus und Kryptogamen.
Thallus (griech., Thallom, Laub, Lager), alle
Pflanzenkörper, an denen diejenigen Gliederungen,
Wachstumsgesetze und innerer Bau, welche die Begriffe Stengel,
Wurzel und Blatt bedingen, nicht wahrzunehmen sind; gilt daher
für alle Pilze, Flechten und Algen, welche darum Thallophyten
genannt werden (vgl. Kryptogamen).
Thalsperre, ein Damm von sehr widerstandsfähiger
Bauart, quer über den Lauf eines Wildbachs angelegt, zur
Zurückhaltung des Geschiebes und Ausfüllung tief
eingeschnittener Rinnen (Runsen). Zur Verbauung der Wildbäche
dient zumeist eine größere Anzahl von Thalsperren in
angemessenem Abstand voneinander. Dieselben verhindern das
Verwildern des Gebirgsbaches in der Thalebene durch
Zurückhalten der Geschiebsmassen, müssen aber, wenn sie
diese Aufgabe sicher erfüllen sollen, bei allen in den
Fluß einmündenden Wildbächen angelegt werden. Hand
in Hand damit ist häufig eine Aufforstung kahler Hänge zu
bewerkstelligen. Vgl. v. Seckendorff, Verbauung der Wildbäche
etc. (Wien 1884).
Thalstern, s. Astrantia.
Thalysia (griech.), Erstlingsopfer von Feldfrüchten,
Erntefeier (vgl. Demeter, S. 660); Thalysianismus nennt Baltzer die
"natürliche Lebensweise" der Vegetarier (s. d.).
Thame (spr. thehm), Marktstadt in Oxfordshire (England),
18 km westlich von Oxford, am schiffbaren Fluß T., der bei
Dorchester in die Themse mündet, hat (1881) 3267 Einw.
Thames (spr. temms'), 1) Fluß, s. Themse. - 2)
Fluß im nordamerikan. Staat Connecticut, entsteht durch
Vereinigung von Quinnebaug und Yadkin und ergießt sich nach
einem Laufe von 110 km bei New London in den Long Island Sound.
Für Seeschiffe ist er 22 km aufwärts bis Norwich
schiffbar.
Thamiatis, altägypt. Stadt, s. Damiette.
Thamsbrück, Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Erfurt, Kreis Langensalza, an der Unstrut, hat eine evang. Kirche,
eine Handelsmühle und (1885) 999 Einw.
Thamyris (Thamyras), im griech. Mythus ein thrakischer
Sänger, Sohn des Philammon und der Nymphe Argiope, wurde, weil
er sich vermaß, die Musen im Gesang zu überwinden, von
diesen des Augenlichts und der Gabe des Gesanges beraubt. Vgl. A.
Michaelis, T. und Sappho (Leipz. 1865).
Than (angelsächs. thên, althochd. degan,
schott. than, thayne), bei den Angelsachsen Titel der die
Gefolgschaft eines Fürsten bildenden Dienstmannen, später
s. v. w. Baron; im alten Schottland Titel der vornehmsten
Häuptlinge, die mit den Clans oder Unterhäuptlingen den
hohen Adel bildeten. Die Thans waren Stammesälteste und die
Gewaltträger des Königs. Nachmals trat der englische
Titel Earl (s. d.) an die Stelle des schottischen Thans.
Than, Moritz, ungar. Maler, geb. 1828 zu Alt-Becse im
Bacser Komitat (Südungarn), studierte zuerst die Rechte,
wandte sich dann der Malerei zu, nahm an den Kämpfen des Jahrs
1849 teil und setzte seine Studien an der Wiener Akademie,
später bei Rahl fort. Nach einer Reise durch Deutschland und
Belgien malte er 1856 zu Paris die Schlacht bei Mohacs. Er lebte
hierauf, mit der Ausführung mehrerer Bilder für den Baron
Sina (Odysseus und Nausikaa, Odysseus und Penthesilea)
beschäftigt, drei Jahre in Rom und erhielt 1859 den Auftrag
zur Ausführung eines die Wiedervereinigung des
Königssohns mit der Zauberhelene darstellenden Wandbildes im
Redoutensaal zu Pest, wo er sich dauernd niederließ. Er schuf
seitdem eine größere Reihe von Altargemälden,
Bildnissen (darunter das des Kaisers von Österreich für
den großen Saal des neuen Bibliothekgebäudes) und
Historienbildern (Angelika und Medor, Liebe der Fata Morgana) sowie
mit Lotz Wandgemälde und einen Fries (aus der Geschichte
Ungarns) im Treppenhaus des Nationalmuseums zu Pest.
Thanatos (griech., bei den Römern Mors),
Personifikation des Todes, Bruder des Hypnos (s. d.), Sohn der
Nacht. Vgl. Robert, Thanatos (Berl. 1879).
Thane, ind. Stadt, s. Tanna 1).
Thanet, Isle of (spr. eil of thännet), Name des
nordöstlichsten Teils der engl. Grafschaft Kent, welcher bis
etwa 1500 durch einen Meeresarm, den Wantsome, vom Festland
getrennt war. Er ist 106 qkm groß, und in ihm liegen die
Seebadeorte Margate und Ramsgate; auf der Nordostspitze steht ein
Leuchtturm.
Thang (Tsang), siames. Getreidemaß, = 20 Kanang (s.
d.).
Thank God Harbonr (spr. harber), s. Polarisbai.
Thankmar (Dankmar), Sohn des deutschen Königs
Heinrich I. aus seiner ersten, von der Kirche für
ungültig erklärten Ehe mit Hatheburg, verband sich, als
sein Halbbruder, König Otto d. Gr., die Nordmark, welche T.
beanspruchte, dem Markgrafen Gero gegeben hatte, mit dem Herzog der
Franken, Eberhard, eroberte die Burg Belcke (Badliki) an der Ruhr
und die Feste Eresburg, wurde in letzterer von Otto belagert und
bei der Erstürmung im Juli 938 in der Kirche, wohin er sich
geflüchtet, erschlagen.
Thanksgiving-day (engl., spr. thänksgiwwing-de,
"Danksagungstag"), der Nationalfeiertag in den Vereinigten
Staatenvon Nordamerika, durch Gottesdienst in allen Kirchen
gesetzlich gefeiert. Das Datum wird alljährlich vom
Präsidenten besonders festgesetzt (gewöhnlich Ende
November).
Thann, Kreisstadt im deutschen Bezirk Oberelsaß, am
Austritt der Thur aus den Vogesen und an der Eisenbahn
Mülhausen-Wesserling, 350 m ü. M., hat die katholische
prächtige gotische St. Theobaldkirche mit durchbrochenem Turm
und eine evang. Kirche, ein Progymnasium, 2 Waisenhäuser, ein
Amtsgericht, eine Oberförsterei, Baumwoll- und
Florettspinnerei, Fabrikation von Baumwollwaren, Kattun,
Seidenzeug, Chemikalien, Maschinen, Dampfkesseln, Feilen,
Bürsten etc., Bleicherei, Färberei, Bierbrauerei,
vortrefflichen Weinbau (am Rangen), Weinhandel und (1885) 7462
meist kath. Einwohner. Über der Stadt die Ruinen der
Engelburg. T. war schon 995 vorhanden und kam 1324 an das Haus
Habsburg. 1632 eroberten es die Schweden; 15. Okt. 1638 gewann
daselbst Herzog Bernhard von Weimar einen Sieg über den Herzog
von Lothringen; 1674 nahmen es die Kaiserlichen, 1675 die Franzosen
unter Turenne, welche die Engelburg sprengten.
Thannhausen, Flecken im bayr. Regierungsbezirk Schwaben,
Bezirksamt Krumbach, an der Großen Mindel, hat eine kath.
Kirche, ein Schloß, ein neues Rathaus und (1885) 1624 Einw.;
T. bildet eine Standesherrschaft des Grafen Stadion.
Thapsakos (später Amphipolis), im Altertum
berühmte Handelsstadt in Syrien, an der untersten Furt des
Euphrat gelegen, angeblich nördlichste Grenze des Reichs
Salomos. Hier gingen der jüngere Kyros, Alexander d. Gr. u. a.
über den Strom. Jetzt Ruinen El Hammâm.
Thapsia L. (Böskraut), Gattung aus der Familie der
Umbelliferen, perennierende Kräuter mit fiederig
zusammengesetzten untern und auf den schei-
621
Thapsus - Thatbestand.
denförmigen Blattstiel reduzierten obern Blättern,
großer, zusammengesetzter Blütendolde mit wenigen oder
keinen Hüllblättchen und vom Rücken her
zusammengedrückten Früchten. Die vier Arten wachsen in
den Mittelmeerländern und gelten meist als heilkräftig,
so besonders T. garganica L., in Südeuropa und Algerien,
dessen purgierend wirkende Wurzel früher offizinell war, und
T. Silphium Viv. in Nordafrika, welches als die Stammpflanze des
Silphium (s. d.) betrachtet worden ist.
Thápsus, im Altertum feste Stadt auf der
Küste des karthagischen Afrika (Byzakion), berühmt durch
den Sieg, den hier Cäsar 6. April 46 v. Chr. über die
Pompejaner gewann. Ruinen bei Ed Dimas.
Thaer, 1) Albrecht, Landwirt, geb. 14. Mai 1752 zu Celle,
studierte seit 1771 in Göttingen Medizin und Philosophie, war
dann in seiner Vaterstadt als Arzt thätig, bebaute daneben
einen kleinen Grundbesitz und widmete sich bald
ausschließlich der Landwirtschaft. Durch die von ihm
gegründete landwirtschaftliche Lehranstalt in Celle sowie
durch die "Einleitung zur Kenntnis der englischen Landwirtschaft"
(Hannov. 1795-1806, 3 Bde.; 3. Aufl. 1816) und die "Annalen der
niedersächsischen Landwirtschaft" (Gött. 1799-1804, 3
Bde.) erlangte er großen Ruf; auf Reisen in Norddeutschland
studierte er die deutsche Landwirtschaft, und die Ausgabe von
Bergens Werk über Viehzucht (1800), die Abbildungen und
Beschreibungen nützlicher Ackergerätschaften (1803-1806),
die Übersetzung von Bells "Versuch über den Ackerbau"
(1804) bereiteten sodann seine Übersiedelung nach
Preußen vor, wohin ihn der König berufen hatte. Er
kaufte das Gut Möglin und errichtete hier 1806 die erste
höhere landwirtschaftliche Lehranstalt, welche als solche
epochemachend war. Sein Werk "Grundsätze der rationellen
Landwirtschaft" (Berl. 1809-10, 4 Bde.; 6. Aufl. 1868; neue Ausg.
von Krafft, Thiel u. a., das. 1880) ward in fast alle
europäischen Sprachen übersetzt. 1807 zum Staatsrat
ernannt, hatte er an den agrarischen Gesetzen zur Regulierung der
bäuerlichen Verhältnisse bedeutenden Anteil. 1810 wurde
er Professor der Landwirtschaft an der Universität zu Berlin
und vortragender Rat im Ministerium des Innern. Nachdem er im
folgenden Jahr die berühmt gewordene Mögliner
Schäferei gegründet, erhielt er 1815 die Stelle eines
Generalintendanten der königlichen Stammschäfereien. 1818
legte er seine Profefsur nieder und widmete sich nun wieder seinem
Institut in Möglin, welches 1824 zu einer königlichen
Akademie des Landbaues erhoben ward. Er starb 26. Okt. 1828 in
Möglin. T. hat zuerst in Deutschland die Resultate der
Naturwissenschaften auf die Agrikultur angewandt und gilt als
Begründer der rationellen Landwirtschaft in Deutschland; er
entwickelte die Begriffe von Roh- und Reinertrag, begründete
die Landwirtschaftslehre, förderte die Wechselwirtschaft und
den Kartoffelbau und bemühte sich erfolgreich um die Freiheit
des landwirtschaftlichen Gewerbslebens. In den letzten Dezennien
seines Lebens war er vor allem Tierzüchter, dann speziell
Schafzüchter. Seine Werke über die Erzeugung und Zucht
hochfeiner Wolle und hochedler Schafe, sein Leipziger Wollkonvent
waren für die deutsche Nationalwirtschaft von
größter Bedeutung. 1850 wurde ihm ein Denkmal von
Rietschel in Leipzig, 1860 ein solches von Rauch in Berlin und 1873
ein drittes in Celle errichtet. Vgl. Körte, Albr. T. (Leipz.
1839).
2) Konrad Wilhelm Albrecht, Enkel des vorigen, Landwirt, geb. 6.
Aug. 1828 auf Lüdersdorf bei Wriezen a. O., studierte 1846 in
Heidelberg Staatswissenschaft, dann in Möglin und Berlin,
erlernte die Landwirtschaft in England und Schottland und
übernahm in der Heimat die Verwaltung zweier Güter.
1859-61 lehrte er an der Akademie zu Möglin, habilitierte sich
darauf zu Berlin und erhielt daselbst 1866 eine
außerordentliche, 1871 in Gießen eine ordentliche
Professur. Er schrieb: "System der Landwirtschaft" (Berl. 1877);
"Die Wirtschafsdirektion des Landguts" (2. Aufl., das. 1879); "Die
altägyptische Landwirtschaft" (das. 1881); "Die
landwirtschaftlichen Unkräuter" (das. 1881, mit 24
Tafeln).
Tharant (Tharandt), Stadt in der sächs. Kreis-und
Amtshauptmannschaft Dresden, an der Wilden Weißeritz und der
Linie Dresden-Chemnitz der Sächsischen Staatsbahn, 212 m
ü. M., hat eine evang. Kirche, eine berühmte
Forstakademie (1811 von Cotta gegründet, seit 1816
königliche Anstalt, 1887: 136 Studierende) mit reichen
Sammlungen, ein Amtsgericht, ein salinisch-eisenhaltiges Mineralbad
und (1885) 2511 Einw. Dabei die Ruine des Schlosses T. und am
Bergabhang das neue Schloß des Grafen Suminski. Vgl.
Fritzsche, Tharant (Dresd. 1867).
Thargelien, das Hauptfest des Apollon in Athen, am
siebenten Tag des danach benannten Monats Thargelion (Mai-Juni),
dem Tag der Geburt des Gottes, begangen. Nach seiner
ursprünglichen Bedeutung bezog es sich auf das Reifen der
Feldfrüchte, deren Erstlinge dem Apollon nebst der Artemis und
den Horen in Prozession dargebracht wurden. Zugleich war es ein
Sühnfest, an dem man durch ein eigentümliches
Bußopfer die Stadt von aller Schuld reinigte, damit nicht der
erzürnte Gott durch ausdörrende Hitze die Ernte vernichte
und die Menschen mit Seuchen heimsuche. Ursprünglich bestand
das Opfer in zwei des Todes schuldigen Menschen, Mann und Weib, die
unter seltsamen Zeremonien am Ufer geopfert wurden; später
scheint man sich damit begnügt zu haben, die Opfer von einer
Höhe ins Meer zu stürzen, unten aber aufzufangen und
wieder ans Land zu schaffen. Auch festliche Aufzüge und
Wettrennen von Männern und Knaben fanden statt.
Tharrhaleus, s. Flüevogel.
Thasos, nördlichste Insel des griech. Archipelagus,
hat 435 qkm (7,9 QM.) mit 5200 Einw., fast ausschließlich
Griechen. Die Insel ist vulkanischen Ursprungs, hat meist steile
Küsten und hohe, bewaldete Berge (Hypsaria 1045 m) sowie viele
Überreste des griechischen Altertums. Hauptort ist Panagia
(Kastro), auf der Nordküste. Hauptprodukte sind Honig und
Öl. - Ionische Griechen besetzten die von Thrakern und
Phönikern bewohnte, damals durch ihren Goldreichtum
berühmte Insel von Paros aus vor 700 v. Chr.; in den
Perserkriegen litt dieselbe schwer, ebenso 463, als die Athener
unter Kimon die Stadt T. (auf der Nordküste) nach langer
Belagerung eroberten. Später wechselte ihr Besitz zwischen
Athen und Sparta; unter den Römern war sie frei, wurde 1462
türkisch, kam später in den Privatbesitz des
Vizekönigs Mehemed Ali von Ägypten und wird seitdem von
einem ägyptischen Gouverneur verwaltet.
Thassilo, s. Tassilo.
Thatbericht, s. Species facti.
Thatbestand (Corpus oder Materiale delicti), im
Strafrecht der Inbegriff derjenigen Merkmale, welche den Begriff
einer strafbaren Handlung ausmachen. Der Begriff eines Verbrechens
faßt die Merkmale desselben zusammen, während der T. die
Merkmale, aus denen die "That besteht", einzeln aufführt.
Subjektiver T., die innere That, das Willensmoment, objektiver T.,
die äußern tatsächlichen Merkmale,
622
Thaeter - Thäyingen.
welche zu dem Begriff des Verbrechens gehören; allgemeiner
T., die Merkmale eines Verbrechens überhaupt, besonderer T.,
die Merkmale einer einzelnen Verbrechensart. Vgl. Cohn, Die
Grundsätze über den T. der Verbrechen (Bresl. 1889).
Thaeter, Julius, Kupferstecher, geb. 7. Jan. 1804 zu
Dresden, kam 1818 auf die Akademie daselbst, war dann unter harten
Entbehrungen in Nürnberg, Berlin und München thätig,
wo er bei Amsler arbeitete, wurde 1841 Lehrer an der Kunstschule in
Weimar, 1846 Lehrer an der Akademie zu Dresden und 1849 als
Professor der Kupferstecherkunst nach München berufen, wo er
14. Nov. 1870 starb. Er hat besonders den sogen. Kartonstich
geübt und mit Vorliebe nach Meistern der neuklassischen
deutschen Kunst gestochen. Seine Hauptblätter sind: der
Spaziergang nach Cornelius (1823); die Umrisse zu Faust nach
Schwind (1830); die Hunnenschlacht nach Kaulbach (1837); die Parzen
und die Überfahrt Charons nach Carstens; Barbarossa in Mailand
und Venedig und Rudolf von Habsburg, den Landfrieden wahrend, nach
Schnorr; die Entwürfe zum Campo santo in Berlin und die
apokalyptischen Reiter nach Cornelius (1849); der babylonische
Turmbau nach Kaulbach; Elisabeths Werke der Barmherzigkeit und
Aschenbrödel nach Schwind (1858). Vgl. A. Thaeter, Julius T.,
Lebensbild (Frankf. a. M. 1887).
Thatfrage (Schuldfrage), bei einem Verbrechen die Frage,
ob der Angeschuldigte der ihm zur Last gelegten Handlung schuldig
sei oder nicht; im Gegensatz zur sogen. Rechtsfrage, d. h. der
Frage, unter welche Bestimmung des Strafgesetzbuchs die That zu
subsumieren und wie sie zu bestrafen sei. Zur Beantwortung der T.
werden bei schwereren Verbrechen Geschworne zugezogen.
Übrigens spricht man auch bei Privatrechtsstreitigkeiten von
der T. (Quaestio facti) im Gegensatz zur Rechtsfrage (Quaestio
juris), indem man unter der erstern die tatsächliche
Feststellung eines Rechtsverhältnisses, unter der letztern
aber die Frage versteht, welche Rechtsgrundsätze auf jenes
Verhältnis Anwendung finden.
Thatsache, im allgemeinen das Resultat jedes Geschehens,
also jede Begebenheit, sei sie bloß in den Naturgesetzen
begründet oder durch die Willensbestimmung des Menschen
herbeigeführt. Im Rechtswesen versteht man unter T. alles
Geschehene als Grundlage juristischer Wirksamkeit, sei es,
daß es sich um den Erwerb oder um den Verlust oder um die
Veränderung eines Rechts handelt.
Thatteilung, s. Grundteilung.
Thau, s. Tau.
Thau (spr. toh., Etang de T., Stagnum Tauri), die
größte der Küstenlagunen von Languedoc, im franz.
Departement Herault, hat eine Länge von 20, eine Breite von
5-8 km und eine Oberfläche von ca. 8000 Hektar und ist vom
Mittelländischen Meer nur durch eine schmale Landzunge
getrennt, auf welcher die Eisenbahn von Bordeaux über Cette
nach Marseille hinzieht, und an deren breitester Stelle, am
Fuß eines 180 m hohen Bergrückens, Cette liegt. Das
Wasser ist von geringer Tiefe, salzig, tiefblau und sehr
fischreich. Der Kanal von Cette setzt den T. mit dem Meer in
Verbindung, während ihn der im SW. einmündende Canal du
Midi und der von NO. her zugeleitete Canal des Etangs mit dem
südfranzösischen Kanalnetz in Zusammenhang bringen.
Thaumalea, s. Fasan, S. 61.
Thaumas, nach griech. Mythus Sohn des Pontos und der
Gäa, Gemahl der Okeanide Elektra, Vater der Harpyien und der
Iris.
Thaumatologie (griech.), Lehre von den Wundern.
Thaumatrop (griech.), von Paris 1827 erfundener Apparat,
welcher gleich dem Phänakistoskop auf der Nachdauer der die
Netzhaut treffenden Lichteindrücke beruht. Wird eine
kreisförmige Pappscheibe um ihren Durchmesser gedreht, so
daß man schnell hintereinander beide Seiten erblickt, so
verschmelzen die auf letztern vorhandenen Zeichnungen zu einem
einzigen Bild. Zeigt z. B. die eine Seite einen Vogel, die zweite
einen Käfig, so erblickt man beim Rotieren der Scheibe den
Vogel im Käfig.
Thaumatúrg (griech.), Wunderthäter (daher
Beiname mehrerer Heiligen, namentlich der griechischen Kirche),
auch s. v. w. Gaukler.
Thausing, Moritz, Kunstschriftsteller, geb. 3. Juni 1838
auf Schloß Tschischkowitz bei Leitmeritz in Böhmen,
studierte an den Universitäten Prag, Wien und München
Geschichte und germanische Philologie und war anfangs auf diesen
Gebieten schriftstellerisch thätig, bis er sich, nachdem er
1868 Vorsteher der Kupferstich- und Handzeichnungensammlung des
Erzherzogs Albrecht (Albertina) in Wien geworden, der
Kunstwissenschaft zuwendete. 1873 wurde er Professor der
Kunstgeschichte an der Wiener Universität. Er starb durch
eigne Hand 14. Aug. 1884 in Leitmeritz. T. gab heraus: "Dürers
Briefe, Tagebücher und Reime" (Wien 1872); "Dürer,
Geschichte seines Lebens und seiner Kunst" (2. Aufl., Leipz. 1884,
2 Bde.); "Le livre d'esquisses de J. J. Callot" (Wien 1881);
"Wiener Kunstbriefe" (Leipz. 1884).
Thaya, Fluß in Österreich, entsteht aus zwei
Flüssen, der Mährischen und der Deutschen T., von denen
erstere nordöstlich von Teltsch in Mähren, letztere bei
Schweiggers in Niederösterreich entspringt und sich mit jener
bei Raabs vereinigt, nimmt die Jaispitz, Pulkau und Iglawa auf und
fällt bei Hohenau in die March; 282 km lang und sehr
fischreich.
Thayer (spr. theh'r), Alexander Wheelock, amerikan.
Schriftsteller, insbesondere als Biograph Beethovens hochverdient,
geb. 22. Okt. 1817 zu South Natick (Massachusetts), studierte
Rechtswissenschaft an der Harvard University zu Cambridge, trat,
nachdem er daselbst promoviert hatte, in den Staatsdienst, war
1860-64 bei der amerikanischen Gesandtschaft in Wien angestellt und
lebte seitdem als Konsul der Vereinigten Staaten in Triest. Seit
1882 widmet er sich ausschließlich litterarischen Studien.
Schon frühzeitig hatte er den Plan einer erschöpfenden
Biographie Beethovens gefaßt und zur Ausführung
desselben wiederholt (1849-51, 1854-56, 1858 ff.) Studienreisen
nach Deutschland unternommen, wo er durch seine Nachforschungen ein
überaus reiches Material zusammenbrachte. Das Werk erschien
zunächst in deutscher Übersetzung (von H. Deiters): "L.
van Beethovens Leben" (Berl. 1876-79, 3 Bde.), und entwirft unter
Beiseitelassung aller musikalischen Analyse und Charakteristik von
dem Lebensgang und menschlichen Charakter des Meisters ein Bild,
das an Vollständigkeit, Treue und psychologischem
Verständnis jeden frühern Versuch auf diesem Gebiet weit
hinter sich läßt. T. veröffentlichte
außerdem: "Signor Masoni and other papers of the late J.
Brown", eine Sammlung musikalischer Novellen (Berl. 1862);
"Chronologisches Verzeichnis der Werke L. van Beethovens" (das.
1865); "Ein kritischer Beitrag zur Beethoven-Litteratur" (das.
1877) u. a.
Thäyingen (Thayngen), Dorf im schweizer. Kanton
Schaffhausen, an der Bahnlinie Konstanz-Schaffhausen, mit Weinbau
und (1888) 1185 Einw. über die dort gemachten Höhlenfunde
s. Randen.
623
Thb. - Theater.
Thb., auch Thgb., Thnb., bei botan. Namen Abkürzung
für K. P. Thunberg (s. d.).
Theagenes, Tyrann von Megaris, stürzte um 625 v.
Chr. mit Hilfe des Volkes die dorische Oligarchie und machte sich
zum Alleinherrscher, unterstützte 612 den Versuch des Atheners
Kylon, seines Schwiegersohns, in Athen die Tyrannis zu errichten,
versah Megara mit einer Wasserleitung, beförderte Handel und
Gewerbe, ward indes um 580 vertrieben.
Theano, von Kreta gebürtig, Tochter der Pythonax,
erst Schülerin, dann Gattin des Pythagoras, gilt für die
Verfasserin mehrerer Briefe (über Kindererziehung, Hauswesen
etc.) und Sittensprüche, die aber wahrscheinlich einer
spätern Zeit angehören.
Theanthropophilen, s. Theophilanthropen.
Theanthropos (griech., "Gottmensch"), dogmatische
Bezeichnung Christi, s. Christologie.
Theater (griech., hierzu Tafel "Theaterbau"),
Schaubühne, Schauspielhaus. Das eigentliche Vaterland des
Theaters ist das alte Hellas mit seinen Kolonien. Das
altgriechische T. (s. den Grundriß und Tafel "Baukunst IV",
Fig. 11) war nicht allein für dramatische Aufführungen
bestimmt, sondern auch Schauplatz für alle zum Kultus des
Dionysos gehörigen Feierlichkeiten und bestand aus drei
Hauptabteilungen: 1) aus dem Zuschauerraum (Theatron im engern
Sinn), welcher die in immer weitern Halbkreisen nach hinten
übereinander sich erhebenden Sitzreihen enthielt, durch einen
oder zwei breite, ebenfalls konzentrische Gänge (Diazoma) in
Stockwerke sowie durch Treppengänge in einzelne
keilförmige Abschnitte (Kerkis) abgeteilt war; 2) aus der
Orchestra, dem mittlern, für den Chor bestimmten Raum mit der
erhöhten Thymele, dem Standort des Chorführers, und 3)
aus dem mit Statuen geschmückten Bühnengebäude
(Skene), das mit seinen zwei nach dem Zuschauerraum hervortretenden
Flügeln (Paraskenion) den eigentlichen Spiel- und Sprechraum
(Proskenion) umschloß und die zur Aufbewahrung des ganzen
Theaterapparats nötigen Räume sowie die Ankleidezimmer
der Schauspieler enthielt. Der unter dem Proskenion gelegene Raum,
welcher dem Zuschauerraum gegenüber die tiefer liegende
Orchestra und die höher liegende Bühne abschloß,
hieß das Hyposkenion. Das ganze Gebäude war ohne
Bedachung, höchstens bedachte man den obersten, den
Zuschauerraum umgebenden Gang, welcher dann eine Säulenhalle
bildete, und die von zwei nach der Orchestra hin vorspringenden, im
Grundriß rechteckigen Flügeln flankierte Bühne, und
mit dem Zuschauerraum gewöhnlich an einen Hügel
angelehnt, aus dessen Gestein die Sitzreihen der Zuschauer
herausgearbeitet waren. Das T. in Athen (340-328 v. Chr. erbaut)
faßte gegen 30,000, das zu Megalopolis 40,000 Personen.
Daß bei den Griechen auch Szenerie, Maschinerie und
Dekoration schon eine gewisse Ausbildung erlangt hatten, steht
außer Zweifel; das Kostüm war zum Teil durch feste
Regeln bestimmt. Äschylos führte in die Tragödie den
hohen Kothurn und die Maske (s. d.) ein, welch letztere auch
ermöglichte, daß Frauenrollen ohne Störung der
Illusion von Männern gegeben werden konnten. Der Kampfpreis
für den tragischen Dichter bestand in einem Epheukranz,
für den komischen in einem Schlauch mit süßem Wein.
Das Eintrittsgeld betrug in Athen für die drei Spieltage eine
Drachme. Vgl. Chor und Schauspielkunst.
In Rom entstanden feststehende Theatergebäude erst gegen
das Ende der Republik. Wie das griechische, bestand auch das
römische aus drei Teilen: dem Zuschauerraum, der Orchestra und
der Bühne, nur daß die Orchestra (weil der Chor mit auf
der Bühne auftrat) zu bevorzugten Sitzplätzen verwendet
wurde; man nannte den Raum das Podium, den Sprechplatz der
Schauspieler Pulpitum. Eigentümlich war der römischen
Bühne ein Vorhang (aulaeum), womit sie vor Beginn des Spiels
geschlossen war. Der Zutritt zu den Theatern in Rom war
unentgeltlich; doch mußte jeder beim Eintritt eine Marke
(tessera) aufweisen, auf welcher sein Sitz
[siehe Graphik]
Grundriß eines griechischen Theaters.
bezeichnet war. Die Ausrichtung der Theaterspiele war
Staatssache; auch hier wurden weibliche Rollen bis in die
Kaiserzeit von Knaben und Männern gespielt. Außer dem T.
des Pompejus waren das T. des Corn. Balbus und das des Marcellus,
welches 22,000 Menschen faßte, die vorzüglichsten. Vgl.
Strack, Das altgriechische Theatergebäude (Potsd. 1843, 9
Tafeln); Wieseler, Theatergebäude und Denkmäler des
Bühnenwesens bei den Griechen und Römern (Götting.
1851, mit 14 Tafeln); Schönborn, Die Skene der Hellenen
(Leipz. 1858); Arnold, Das altrömische Theatergebäude
(das. 1873); A. Müller, Griechische Bühnenaltertümer
(Freiburg 1886); Öhmichen, Griechischer Theaterbau (Berl.
1886); Opitz, Das Theaterwesen der Griechen und Römer (Leipz.
1889).
Dem Mittelalter waren eigentliche Theatergebäude ganz
fremd. Die dramatischen Aufführungen standen im Dienste der
Kirche, welche die bauliche Anlage ihrer Gotteshäuser nach dem
Beispiel der antiken T. dem Zweck der heiligen Festspiele
anbequemte. Charakteristisch ist hierbei die dreiteilige,
über- und
624
Theater (moderner Theaterbau).
hintereinander sich erhebende Emporbühne, deren Anordnung
auch beibehalten wurde, als mit der zunehmenden Verweltlichung die
überdies allzu personenreichen Kirchenspiele ins Freie, auf
Kirchhöfe, Märkte etc., verwiesen wurden (s. Mysterien,
S. 956 f.), wo besondere Gerüste hierfür erbaut wurden.
Die weltlichen Spiele waren auf Schulsäle, Scheunen
("Stadeln"), unbedeckte Hofräume mit Gerüsten und Emporen
("Brücken", "Zinnen"), mit Teppichen umhangene Räume,
später auf schlichte "Spielhäuser" angewiesen, deren
erstes 1550 in Nürnberg durch die Meistersingerzunft errichtet
wurde. Letztere vervollkommten sich erst mit dem
Überhandnehmen des Luxus bei den Hofhaltungen in der zweiten
Hälfte des 17. Jahrh., besonders nach dem Vorbild der
italienischen Operntheater, deren Grundformen noch heute gelten.
Die ersten Opernhäuser in Deutschland erhielten, abgesehen von
den Residenzen, Nürnberg, Augsburg, Hamburg und Leipzig
(1667-93).
Der moderne Theaterbau.
Auch im modernen T. wird der Zuschauerraum wie im antiken
halbrund oder hufeisenförmig, nach hinten zu etwas aufsteigend
erbaut. Den Boden desselben nimmt das Parterre (in seinem mit
reservierten Plätzen versehenen vordern Teil Parkett genannt)
ein; an der tiefsten Stelle des Zuschauerraums, zwischen Parkett
und der Bühne, hat sich die antike Orchestra in den schmalen,
lang gedehnten Raum für das Musikchor verwandelt, auf welches
auch der alte Name (eigentlich "Tanzplatt") übergegangen ist
(s. Orchester). Bei den neuesten Theaterbauten wird, nach der Idee
Richard Wagners und Sempers (Wagnertheater in Baireuth mit
amphitheatralisch aufsteigenden Sitzreihen), das Orchester, um die
Illusion weniger zu stören, versenkt und so angeordnet,
daß mindestens das in dem Parkett und Parterre befindliche
Publikum die ausführenden Musiker nicht sieht. Durch die
Herstellung eines vertieften Orchesters wird nicht nur der Eindruck
der von unsichtbaren Musikern herrührenden Musik, sondern auch
die perspektivische Wirkung der scheinbar näher gerückten
und deshalb größer erscheinenden Darsteller und
Darstellungsgegenstände wesentlich erhöht. Der Umfang des
Parterre wird von übereinander errichteten Logenreihen oder
von Balkonen, welche alsdann für die Logen nur den Raum am
Orchester übriglassen, umschlossen; der oberste Balkon
heißt Galerie. Die erhöhte Bühne, d. h. der Ort, wo
die Schauspieler agieren, wird von dem Orchester- und Zuschauerraum
durch mehrere Vorhänge geschieden, welche bei
größern Theatern, z. B. in Dresden, in einem Haupt- und
einem Zwischenaktsvorhang, einem Vorhang für Szenenwechsel und
einem zur Lokalisierung der Feuersgefahr bestimmten eisernen
Vorhang bestehen. Letzterer ist aus Trägerwellenblech
konstruiert, durch Gegengewichte ausbalanciert und mittels
Kurbelwinden beweglich. Vor dem Vorhang befindet sich die Rampe
oder das Gestell, an welchem die vordere Beleuchtung der Bühne
angebracht ist; in der Mitte der Rampe befindet sich der
Souffleurkasten. Vom Proszenium, dem vordersten Teil der
Bühne, aus steigt der Boden der Bühne (Podium) nach
hinten zu ein wenig aufwärts. Die Szene oder der Ort, wo die
Handlung spielt, wird durch die Dekorationen, nämlich eine
Hinterwand und Seitenwände, begrenzt. Die Hinterwand
(Hintergardine) muß an verschiedenen Stellen herabgelassen
werden können, da es nötig ist, die Bühne bald
kürzer, bald länger (tiefer) zu machen. Die
Seitenwände der Bühne werden durch Kulissen dargestellt.
Sie bestehen aus Leinwand, auf Rahmen gespannt, gehen durch das
Podium hindurch und ruhen unterhalb desselben auf einem kleinen
Wagen oder einer Walze, so daß leicht mit demselben Zug die
neuen Kulissen vor, die nicht mehr nötigen zurückgezogen
werden können. In neuester Zeit hat man, besonders für
das Konversationsstück, vielfach versucht, "geschlossene"
Dekorationen, sogen. Panoramatheater, einzuführen, d. h.
Kulissen, welche mittels Klappen sich aneinander anschließen
(Klappkulissen) und wirkliche Seitenwände bilden, sowie auch
die Deckendekoration aus dem Ganzen zu arbeiten. Die zur
nähern Bestimmung der Szene nötigen Stücke, wie
Häuser, Mauern, Bäume, Felsen u. dgl., heißen
Versetzstücke und werden vermittelst sogen. Freiwagen, deren
Maschinerie unter dem Podium hingeht, von den Seiten
hervorgeschoben. Den Luftraum oder die obere Decke der Bühne
bilden die Soffiten, d. h. quer über die Bühne gehende
Leinwandstreifen, die das Bühnenbild nach oben begrenzen. Je
nachdem die Soffiten bemalt sind, heißen sie Luft-, Wald-,
Zimmersoffiten etc. Die gesamte Maschinerie des modernen Theaters
wird in die obere und die untere geteilt. Die obere umfaßt
alle Zug- und Hängewerke nebst den dazu gehörigen Leinen,
Zügen, Walzen, Schnürböden, Galerien etc. sowie den
ganzen Apparat, mittels dessen auf der Bühne Personen und
Gegenstände durch die Luft bewegt werden, d. h. das Flugwerk.
Die untere Maschinerie besteht aus den Versenkungen
(geräuschlos auf- und niedergehenden Bodenausschnitten),
Kanälen, Freifahrten, Wagen u. dgl. und dient teils zur
Bewegung der Kulissen, teils zum Emporheben aus der Erde
aufsteigender Erscheinungen. Die notwendigen Vorrichtungen zum
Flugwerk, zu dem Aufziehen des Vorhangs, zum Dekorationswechsel,
zur Herablassung der Soffiten befinden sich auf einem besondern
Boden über der Bühne, dem Schnürboden, dessen
Fußboden durchbrochen ist. Auf einem andern obern Boden, dem
Feuerboden, sind für Feuersgefahr die zur Löschung
nötigen Reservoirs befindlich. Die Bühne wird meist in
5-8 perspektivisch geordnete Abteilungen zerlegt, deren jede eine
große Versenkung, drei durchgehende Freifahrten und eine
durchgehende Klappe hat. Die Beleuchtung wird meist in jeder Bahn
mittels zwei Ober- und zwei Seitenlichter sowie durch Versetz-,
Transparent- und Extralampen bewirkt. Hierzu kommt die vordere,
durch die Proszeniumslampen bewirkte, regulierbare Beleuchtung der
Bühne. Zu beiden Seiten der Hauptbühne befinden sich
Probesäle, Garderoben und Ankleidezimmer. Die den
Zuschauerraum enthaltende Abteilung des Hauses versieht man
außer mit den Treppenanlagen mit Restaurationsräumen,
Büffetten u. Foyers. Hierzu kommen die Vestibüle,
Korridore und Unterfahrten sowie bei Hof- und Residenztheatern in
dem Zuschauerraum die Anordnung der Hoflogen und die damit in
Verbindung zu bringenden Salons und sonstigen Appartements. Nicht
selten wird die Anlage besonderer Konzertsäle und Säle zu
kleinern theatralischen Aufführungen gefordert.
Die Anordnung des Äußern bestand früher in der
Herstellung eines mehr oder minder regelmäßigen
rechteckigen Gebäudes, in welches man den
hufeisenförmigen Zuschauerraum einschaltete, erfolgt aber bei
neuern Ausführungen häufig im engen Abschluß an die
Form des Innenbaues und stellt alsdann von der Seite des
Zuschauerraums einen mehr oder minder vollständigen Rundbau
dar. Anordnungen dieser Art zeigen unter andern das Mainzer, das
Dresdener
Theaterbau.
1 Auffahrt
2 Terasse
3 Magazine
4 Rundgang um das Vestibül (5)
6 Rundgang um das Foyer (7)
8 Große Garderobe
9 Terrasse
10 Haupttreppe
11 Foyer für III. Rang
12 Ventilationskanäle u. Heizraum
13 Garderobe für Parterre
14 Saal zur Königsloge
15 Vorsaal für III. Rang
16 Königsloge
17 Parterreloge
18 Mischraum
19 Zuschauerräume: Parkett, Parterre, Loge im I. und II.
Stock, III. Rang, Amphitheater
20 Ventilationsschacht
21 Bühne mit Asphaleia-Einrichtung
22 Versenkung
23 Schnürboden
24 Ventilationsschacht für die Bühne
25 Akkumulatoren 26 Hinterbühne
27 Ballett-Probesaal
28 Malersaal
Längenschnitt des königl. ungarischen Opernhauses in
Budapest. (Maßstab 1:500).
Grundriß des Parterregeschosses. (Maßstab
1:1040.)
Grundriß des Hochparterres (Bühnenhöhe).
(Maßstab 1:1040.)
[Artikel Theater.]
Zur Tafel 'Theaterbau': Das neue königliche Opernhaus in
Budapest.
Zu den Eigentümlichkeiten des beim Opernhaus zu Budapest
(Architekt Nik. v. Ybl) teilweise in Anwendung gekommenen sogen.
Asphaleia-Systems gehört der um den hufeisenförmigen
Zuschauerraum geführte, zu Lüftungszwecken dienende sog.
Ventilationsring, an welchen sich in den einzelnen Stockwerken das
Vestibül, die Foyers, Treppenhäuser, Garderoben u.
Büffette nebst den beiden seitwärts angebrachten,
gedeckten Unterfahrten u. zwar durchweg in einer Weise
anschließen, welche die Sicherheit und Bequemlichkeit der
Theaterbesucher vollkommen wahrt. Zur Verbesserung der Akustik,
Lüftung und freien Aussicht der Galeriebesucher ist der
eiserne Plafond muschelartig gewölbt, aus zwei Böden,
wovon der untere zwecks Aufsaugung schlechter oder Zuführung
frischer Luft siebförmig durchlöchert ist,
zusammengesetzt und ruht nicht auf der Galeriebrüstung,
sondern auf dem Ventilationsring, wodurch auch die Galeriebesucher
einen freien Ausblick auf die Bühne genießen. Mit den
Hauptneuerungen ist die Bühne ausgestattet, welche (das Podium
ausgenommen) mit Ausschluß von Holz konstruiert ist. Das
Podium ist seiner Breite nach in mehrere Podienstreifen, sogen.
Gassen (s. den Grundriß der Bühne auf der folgenden
Seite), zerlegt, wovon jeder für sich oder mit den andern um
je 2,5 m gesenkt oder um je 4,5 m gehoben werden kann. Diese
Bewegung wird, wie der nebenstehende Querschnitt zeigt, durch
hydraulische Pressen bewirkt, deren Stempel zugleich die
Träger jener Gassen unterstützen, und durch das
Öffnen und Schließen eines Hahns erzielt, welcher den
Zufluß des unter einem bestimmten Druck stehenden Wassers zum
Preßcylinder regelt. Jede Gasse enthält wieder drei
nebeneinander befindliche Versenkungen, welche ebenfalls auf
hydraulischen Pressen ruhen und in ähnlicher Weise um 5 m
gesenkt oder um 6,5 m gehoben werden können. Mit Hilfe dieser
hydraulisch zu bewegenden Versenkungen lassen sich Terrassen,
Serpentinen, Brücken, Balkone, ja bei abwechselndem
Öffnen und Schließen der Wasserhähne selbst
Schaukelbewegungen des Podiums oder seiner Teile hervorbringen.
Zwischen den einzelnen Gassen sowie an beiden Seiten der Bühne
sind Klappen angebracht, durch welche man nicht nur ganze
Dekorationen, sondern auch ganze Zimmer bis zu einer Höhe von
8 m heben kann. Bei dem Schnürboden werden die
Soffitenzüge durch lange Züge ersetzt und hierbei nur
Drahtseile verwandt. Alle Züge können ebenso wie die
Versenkungen
Querschnitt durch die Bühne in der Richtung einer
Kulissengasse, 1:285.
*
Zur Tafel 'Theaterbau': Das neue königliche Opernhaus in
Budapest.
hydraulisch von unten bewegt werden, wodurch das
gefährliche Betreten des Schnürbodens und der
Soffitenbrücken wegfällt. Dafür ist in jeder Gasse
ein Flugapparat eingeschaltet, welcher nicht bloß an jeden
Punkt derselben gelenkt, sondern auch in beliebigen Lagen bewegt
werden kann. Der Abschluß des Zuschauer- und Bühnenraums
wird durch einen ebenfalls hydraulisch bewegten Blechvorhang
geschlossen. Die vielfach störende Rampenbeleuchtung ist durch
eine seitliche Beleuchtung durch elektrisches Licht ersetzt, zu
welchem Zweck in der Mauer der Proszeniumsöffnung eine nur
gegen die Bühne hin offene Hohlkehle angebracht ist, welche
die Lampen aufnimmt. Die schwierig zu handhabenden, oft durch ihre
ungleiche Beleuchtung störenden Luftsoffiten sind durch einen
sogen. Horizont, ein mit Wolken bemaltes, senkrecht
herabhängendes Dekorationsstück, welches die ganze
Bühne umgibt und sich hinreichend hoch, im Budapester Theater
19 m, über das Podium erhebt, ersetzt. Der auf der Tafel
dargestellte Längenschnitt des königlich ungarischen
Opernhauses in Budapest gibt ein anschauliches Bild dieser ganzen
Einrichtung, deren einzelne Teile mit fortlaufenden Zahlen
bezeichnet und demgemäß mit den ihrem Zweck
entsprechenden Benennungen versehen sind. Zu erwähnen ist
noch, daß der Zuschauerraum, wie die beiden Grundrisse
zeigen, hufeisenförmig angelegt, und daß das Proszenium
in Gestalt eines Triumphbogens zwischen Bühne und
Zuschauerraum eingeschaltet ist. Der Orchesterraum ist vertieft und
mit einer zierlichen Eisenguirlande eingefaßt. In den mit 18
bezeichneten Mischraum treiben zwei große, von einem Gasmotor
bewegte Ventilatoren die frische Luft ein, von wo dieselbe,
entsprechend vorgewärmt, durch gemauerte Kanäle in den
Zuschauerraum gelangt. Die schlechte Luft wird durch den
Kronleuchterschacht (20) und zahlreiche andre
Luftabzugsschlöte entfernt. Die Effektbeleuchtung der
Bühne wird durch elektrisches Licht bewirkt, wobei vier durch
zwei zwölfpferdige Gasmaschinen bewegte Dynamomaschinen zur
Verfügung stehen. Die Beleuchtung des Hauses wird aus
ökonomischen Gründen durch Gas bewirkt. Zwischen
Zuschauerraum und Bühne befindet sich der eiserne Vorhang,
während die letztere mit einem eisernen Dachstuhl
überdeckt ist. Die Bewegung des ganzen Bühnenapparats,
welchen der Längenschnitt unter 21, 22 u. 23 sowie der
Querschnitt durch die Bühne deutlich darstellt, geht von einer
zwölfpferdigen Gasmaschine aus, welche die von einem unter dem
Zuschauerraum befindlichen Brunnen gespeiste Wasserpumpe in
Thätigkeit setzt. Der Urheber der Maschineneinrichtung des
Asphaleia-Systems ist der Wiener Ingenieur Robert Gwinner, nach
dessen Plänen seitdem diese Bühneneinrichtung unter
andern beim Landestheater zu Prag, den neuerbauten Theatern in
Halle a. S., Göggingen bei Augsburg, dem Drurylane-Theater in
London, dem großen Theater zu Chicago etc. Anwendung gefunden
hat.
Grundriß der Bühne mit Asphaleia-Einrichtung (Nr. 21,
22 des Längenschnitts).
625
Theaterbilletsteuer - Theatre-Francais.
und das Berliner Viktoria-T. Sowohl der die Vorder- und
Hinterbühne einschließende Gebäudeteil als auch die
für die verschiedenen Säle, Foyers, Treppen und
Korridoranlagen erforderlichen Anbauten erhalten dann aus dem
gleichen Grund rechteckige Begrenzung, wodurch die Form der neuern
T. eine mit mehr oder minder großem Geschick ausgebildete
kombinierte, aus Rechteck- und Rundbau bestehende wird. Die
merkwürdigste, zwar sehr reiche, aber etwas gezwungene
Kombination dieser Art zeigt die von Garnier erbaute Große
Oper in Paris, während diejenige des Dresdener Theaters dem
Innern genau angepaßt und natürlich ist. Die
Bekrönung der einzelnen Teile und ihre äußere
Verzierung wird meist durch Figuren oder Figurengruppen
unterstützt.
Die Stilformen des Hauptinnenraums bewegen sich bei den neuern
Theatern fast durchweg, je nach dem Grad ihres Reichtums, in einer
frühern oder spätern Epoche des Renaissancestils, wobei
die figürliche Skulptur eine mehr oder minder hervorragende
Rolle spielt. Karyatiden, Atlanten an den Proszeniumslogen,
schwebende Figuren in den Gewölbzwickeln der Decke (wie an der
Pariser Oper), Statuen und Medaillons von Musen und Musengruppen,
bedeutenden Ton- und Dramendichtern etc. bilden die Motive. Die
Dekorationsmalereien entfalten sich vorwiegend an dem Plafond. Als
ein Hauptschmuck des Zuschauerraums tritt endlich außer den
übrigen Arm- und Wandlampen der Kronleuchter hervor, dessen
Lampen sich in zwei und mehr (an der Pariser Oper in vier) Etagen
von ungleichen Durchmessern aufbauen und sowohl durch Ausziehen und
Niederlassen als auch durch die Regulierung der Gasflammen einen
mehr oder minder hellen Lichteffekt erzeugen können. Die in
der Nähe des Plafonds aufgehängten sogen. Sonnenbrenner
dienen zugleich zur Beförderung der Ventilation des
Innenraums, welche bisweilen, z. B. beim Dresdener Theater, noch
durch einen besondern, auf dem Dachstuhl ruhenden Ventilator
unterstützt wird. Zu den schon in der Bauanlage getroffenen
Vorsichtsmaßregeln zur Abwendung der Feuersgefahr
(Löschanstalten, ausreichende Ausgänge, zahlreiche
feuersichere Treppen, nach außen sich öffnende Zwischen-
und Außenthüren, Vorplätze, zur Abführung des
Rauches dienende Ventilationseinrichtungen etc.) kamen in neuerer
Zeit als bedeutungsvoll hinzu: die Aufführung einer soliden
Brandmauer zwischen Bühne und Zuschauerraum in Verbindung mit
dem in der Proszeniumsöffnung angebrachten hydraulisch
bewegbaren Metallvorhang (s. oben) zur raschen Isolierung beider
Räume bei Ausbruch eines Brandes; Ersatz der Gasbeleuchtung
durch elektrische Beleuchtung in allen Teilen des Theaters; Schutz
aller Theaterrequisiten und des Holzwerks auf der Bühne gegen
rasche Entzündbarkeit mittels chemischer Imprägnierung
mit unbrennbaren Stoffen. Der am 8. Dez. 1881 ausgebrochene
verhängnisvolle Brand des Wiener Ringtheaters führte
indessen zu der Einsicht, daß der technische Teil des
Theaterwesens den Anforderungen, welche die Richtung der heutigen
Kunst an denselben stellt, überhaupt nicht mehr gewachsen sei
und einer durchgreifenden Umgestaltung bedürfe. Dieser
Einsicht verdankt ein Entwurf nach dem System "Asphaleia" zu einem
nicht nur feuersichern, sondern auch technisch zeitgemäß
umgestalteten T. seine Entstehung, welcher bei dem 1885
eröffneten königlichen Opernhaus in Budapest seine erste,
bereits bewährte Anwendung gefunden hat und seitdem auch
anderwärts nachgeahmt worden ist. Weiteres darüber s. in
der Textbeilage zur beifolgenden Tafel.
Die schönsten Theatergebäude in Deutschland finden
sich zu München, Berlin (Schauspielhaus, Opernhaus, Viktoria-
und Wallnertheater), Wien (Opernhaus, Hofburgtheater, s. Tafel
"Wiener Bauwerke", und das T. an der Wien), Hannover, Dresden,
Leipzig, Magdeburg, Köln, Bremen, Karlsruhe, Braunschweig,
Halle, Darmstadt, Frankfurt a. M., Prag, Budapest. Das
Wagnertheater in Baireuth wurde bereits oben erwähnt. In
Frankreich zeichnen sich aus das
Théâtre-Français, die neue Große Oper und
das Châtelettheater in Paris, die T. von Lyon, Marseille und
Bordeaux; in Italien die T. San Carlo in Neapel, della Scala in
Mailand und Fenice in Venedig. Das größte T. in
Rußland ist das zu Petersburg (durchaus von Stein und Eisen
bis auf das Podium und den Maschinenboden). Londons
größte T. sind das Drurylane- und das
Coventgardentheater. Die größten der modernen T. fassen
3-7000 Zuschauer (della Scala 7000, San Carlo 7500, das T. in
Chicago, gegenwärtig das größte der Welt, hat 8000
Sitzplätze). Vgl. aus der neuern Litteratur Gosset,
Traité de la construction des théâtres (Par.
1885); Garnier, Le nouvel Opera de Paris (das. 1876-81); "Das neue
Opernhaus in Wien" (Wien 1879); Gwinner, Das neue königliche
Opernhaus in Budapest (das. 1885); Staude, Das Stadttheater zu
Halle (Halle 1886); Fölsch, Theaterbrände und die zu der
Verhütung derselben erforderlichen Schutzmaßregeln
(Hamb. 1878); Gilardone, Handbuch des Theaterlösch- und
Rettungswesens (Straßb. 1882-84, 3 Bde.). über die
Geschichte des Theaters im weitern Sinn vgl. Schauspielkunst. -
Anatomisches T. (Anatomie), das Gebäude, in welchem Anatomie
gelehrt und ausgeübt wird, besonders der Hörsaal mit
amphitheatralisch erhöhten Plätzen.
Theaterbilletsteuer, eine Aufwandsteuer auf den
Theaterbesuch, in Frankreich als Zwecksteuer für
Wohlthätigkeitsanstalten von größern Städten
im Betrag von 10 Proz. des Eintrittsgeldes erhoben.
Theatiner, Orden regulierter Chorherren, gestiftet 1524
in Rom von Joh. Pet. Caraffa, nachmaligem Papst Paul IV., damals
Bischof von Theate oder Chieti (daher auch Chietiner, Quietiner,
Pauliner), in Verbindung mit Cajetan da Thiene (daher Kajetaner),
bestätigt von Paul III. 1540 und Pius V. 1568, vornehmlich aus
Adligen bestehend, eine Pflanzschule des höhern Klerus. Die
noch jetzt verfolgte Tendenz des Ordens geht auf Erweckung eines
reinen apostolischen Geistes mittels Predigt und Gottesdienstes.
Die T. legen die drei Mönchsgelübde auf Augustins Regel
ab und verpflichten sich außerdem zum Predigen gegen Heiden
und Ketzer, zur Seelsorge, zur Pflege der Kranken. Später
verbreitete sich der Orden auch über Frankreich, Spanien,
Polen und hatte Missionen in Asien. Spätere Päpste, Urban
VIII. und Clemens IX., vereinigten mit ihm zwei von Ursula
Benincasa 1583 und 1610 gestiftete Kongregationen von
Theatinerinnen.
Theatralisch (griech.), das Theater betreffend;
bühnenmäßig; affektiert.
Théâtre-Français (auch
Comedie-Française genannt), das erste Pariser Theater in
litterarischer Beziehung, ist eine Schöpfung Ludwigs XIV.
Durch Kabinettsbefehl von 21. Okt. 1680 vereinigte er die Truppe
des Hôtel de Bourgogne und die Molièresche, welche
nach dem Tod ihres Meisters (1673) aus ihrem Saal im Palais-Royal
hatte weichen müssen, zu einer Truppe, um, wie es in dem
Befehl hieß, den Schauspielern die Möglichkeit zu
gewähren, sich
626
Theatrum europaeum - Theben.
immer mehr zu vervollkommnen. Er gab ihr das Privilegium,
Tragödien und Komödien aufzuführen, und bewilligte
eine jährliche Unterstützung von 12,000 Frank; die Anzahl
der Schauspieler wurde fest bestimmt, die Verwaltung geregelt. So
war durch die Vereinigung des Repertoires von Corneille und Racine
mit dem Molières die klassische Bühne Frankreichs
geschaffen; die Schauspieler nannten sich Comédiens
ordinaires du roi. 1689 baute sich die Truppe einen eignen Saal in
der Straße Fosses Saint-Germain (nachmals Straße de
l'Ancienne Comédie) und nannte sich von der Zeit an
Théâtre de la Comédie-Française; in
demselben blieb das Theater bis zum Jahr 1770. In der ersten
Hälfte dieser Periode machte es nur schlechte Geschäfte
und vermochte die Konkurrenz der Markttheater (Marionetten,
Akrobaten, Bänkelsänger etc.) nur mit polizeilicher Hilfe
zu überwinden; die Zeit von 1740 aber, wo Voltaires Dramen die
Bühne beherrschten, bis 1780 ist die glänzendste Epoche
seiner Geschichte. Eine große Anzahl ausgezeichneter
Schauspieler fand sich damals zusammen, von denen wir hier nennen:
Grandval, Lekain, Bellecourt, Préville, Molé, Monvel,
Brizard, Dugazon, die Damen Dumesnil, Clairon, Dangeville und
Contat. Im J. 1770 siedelte das Theater in die Tuilerien über,
zwölf Jahre später in einen neuerbauten Saal, wo sich
jetzt das Odéon befindet. Hier fand auch 1784 die
berühmte erste Vorstellung von "Figaros Hochzeit" statt. Die
Revolution spielte dem T. übel mit; den Versuch, die
antirepublikanischen Stücke Layas aufzuführen,
mußten Schauspieler und Dichter mit Gefängnis
büßen; erst nach und nach wurden sie befreit. Zur Ruhe
aber kam das T. erst 1803, als es wieder in den Saal des
Palais-Royal einziehen durfte, in dem schon Molière gewirkt
hatte. Hier ist es seit der Zeit geblieben; der jährliche
Zuschuß wurde auf 100,000 Frank erhöht. Eine feste
Organisation erhielt es durch Napoleons pomphaftes Dekret vom 15.
Okt. 1812 aus Moskau, das ergänzt und im einzelnen modifiziert
wurde durch die Dekrete vom April 1850 und November 1859. Hiernach
untersteht die Verwaltung einem Komitee von sechs Mitgliedern,
unter der Direktion eines vom Staat bestellten Beamten (seit 1833;
seit 1885 J. Claretie); dieses hat nicht nur die finanziellen
Angelegenheiten zu besorgen und die Sociétaires (fest
angestellten Mitglieder im Gegensatz zu den Pensionnaires) zu
ernennen, sondern wirkt auch als Lesekomitee und hat über
Annahme und Zurückweisung der eingereichten Stücke zu
entscheiden. Der Zuschuß ist auf 240,000 Frank erhöht
worden. - In dieser ganzen Zeit war die
Comédie-Française arm an hervorragenden Talenten;
abgesehen von Talma, der 1784 zuerst auftrat, und Rachel
Félix, die ihr von 1838 bis 1855 angehörte, sind Sterne
erster Größe auf der klassischen Bühne nicht zu
verzeichnen. Dafür aber ist sie, besonders seit der Mitte
dieses Jahrhunderts, durch ein mustergültiges Zusammenspiel
ausgezeichnet, durch das in Verbindung mit der sorgfältigen
Ausstattung, einem unermüdlichen Studium und liebevoller
Achtung vor der Überlieferung die glänzendsten Erfolge
erzielt wurden. Diese Vorzüge kommen besonders der
Wiederaufführung der Werke der großen französischen
Klassiker zu gute; eine würdige und künstlerisch
schöne Darstellung derselben zu bieten, hat das T. immer als
wichtigste Aufgabe betrachtet, eine Aufgabe, der die romantische
Periode, welche mit der berühmten Theaterschlacht vom 25.
Febr. 1830 zum Siege gelangte, es nur vorübergehend zu
entfremden vermochte. Dafür hat auch die 200jährige
Jubelfeier der Gründung des T. im J. 1880 einen
vollgültigen Beweis geliefert. Vgl. Lucas, Histoire du T. (2.
Aufl. 1863, 3 Bde.); Despois, Le T. sous Louis XIV (Par. 1886);
Chabrol, Histoire et description du Palais-Royal et du T. (das.
1884).
Theatrum europaeum, eine Chronik der Zeitereignisse,
welche seit etwa 1616 zu Frankfurt a. M. in Bänden erschien
und Vorläuferin der später entstandenen Zeitungen war.
Sie ging später in den Besitz der Kupferstecher- und
Kunsthändlerfamilie Merian (s. d.) über, deren Mitglieder
sie mit Kupferstichen versahen. Seit 1700 führte die Redaktion
der Laubacher Pastor Schneider, welcher dem T. einen neuen
Aufschwung gab. Doch ging es 1718 zum Teil durch die
Verschwendungssucht des Generals und Architekten Eosander v. Goethe
ein, welcher die Erbin des Merianschen Verlags geheiratet hatte. Es
umfaßt 21 Bände.
Theba (hebr.), s. Arche.
Thebain C12H21NO3, Alkaloid des Opiums, bildet farb- und
geruchlose Kristalle, schmeckt scharf, metallisch zusammenziehend,
ist leicht löslich in Alkohol und Äther, kaum in Wasser,
reagiert stark alkalisch, bildet mit Säuren kristallisierbare
Salze, ist sehr giftig und erregt Starrkrampf.
Thebaïs, im Altertum Name von Oberägypten, nach
der Hauptstadt Theben (s. d. 1).
Thebaïsche Region, nach der Legende eine vom Kaiser
Maximianus 300 n. Chr. aus der ägyptischen Landschaft Thebais
gegen die Christen in Gallien gesandte Legion, welche wegen
Dienstverweigerung erst zweimal dezimiert, dann mit ihrem
Führer Mauritius zu St.-Maurice in Wallis niedergemetzelt und
unter dem Namen der 10,000 Ritter (22. Juni) in das Martyrologium
aufgenommen ward.
Theben, 1) die alte Hauptstadt Oberägyptens, am Nil,
die "hundertthorige Stadt", der einstige Mittelpunkt des
Pharaonenreichs, heute nur ein ausgedehntes Ruinenfeld zu beiden
Seiten des Nils. Der hieroglyphische Name der Stadt war Ape (mit
dem Artikel T'Ape), woraus das griechische Thebae entstanden ist.
Die unter den Ptolemäern eingeführte Benennung Diospolis
ist eine Übersetzung des altägyptischen Pe-Amun ("Haus
des Ammon"). Die Gründung Thebens ist in Dunkel gehüllt.
In die Geschichte tritt die Stadt erst mit der 11. Dynastie (2850
v. Chr.) ein, welche von Manetho eine thebaische genannt wird, und
deren Gräber dort entdeckt wurden. Nach der Vertreibung der
Hyksos und mit der Herstellung der unter ihnen zerstörten
Tempel, also unter der 18. Dynastie (1706), begannen die herrlichen
Bauten zu entstehen, welche, im Lauf der folgenden elf Jahrhunderte
verschönert, vergrößert und vermehrt, die Stadt zum
Wunder der Alten Welt erhoben haben. 527 wurde ihr durch Kambyses
der erste Stoß versetzt; die Verwüstung und
Plünderung durch die Perser war derart, daß T. nie
wieder sich zu altem Glanz erheben konnte. Die Verlegung der
Residenz unter den letzten Dynastien nach den Städten des
Deltas und der Aufschwung Alexandrias unter den Ptolemäern
entzogen ihr die Lebenskraft. 84 endlich brachte ihr die
Empörung gegen Ptolemäos Soter II. Lathyros den
Untergang. Erbittert durch ihren dreijährigen Widerstand,
verheerte sie der siegreiche König mit Feuer und Schwert, so
daß Strabon hier nur einige ärmliche Ortschaften um die
vier Haupttempel gruppiert fand. Das Gebiet von T. nehmen
gegenwärtig vier Dörfer: Luksor, Medinet Habu, Karnak und
Kurnah, ein, mit den noch erhaltenen großartigen Ruinen der
alten Stadt
627
Theben - Thecosmilia.
2) (Thebae) die größte Stadt in der griech.
Landschaft Böotien, auf den Vorhöhen des Teumessos, wird
schon von Homer als die Stadt der sieben Thore (Thebe Heptapylos)
genannt und war in der historischen Zeit der wichtigste Ort des
Böotischen Bundes. T. lag in quellenreicher, hügeliger
Gegend über dem südlichen Rande der aonischen Ebene und
hatte eine etwa 15 km lange Ringmauer. Die Stadt oder zunächst
die Burg Kadmeia wurde der Sage nach von Kadmos gegründet,
nachdem er den Drachen getötet, der das Land verödete.
Jedenfalls ließen sich bei T. phönikische Einwanderer
nieder, welchen dann griechische aus Kleinasien folgten, was die
Sage von Amphion beweist, der durch seine Leier die Steine
herbeilockte. Zu dem Geschlecht der Kadmeionen gehörte auch
der Sohn des Laios, Ödipus (s. d.), der die Regierung seinen
Söhnen Eteokles und Polyneikes mit der Bestimmung
übergab, daß jeder allemal ein Jahr regieren sollte.
Eteokles brach den Vertrag und veranlaßte dadurch den
berühmten Zug der Sieben gegen T. (s. Sieben gegen Theben),
dem 20 Jahre später der Zug der Epigonen, d. h. der Söhne
jener Sieben, folgte, welcher mit der Niederlage der Thebaner bei
Glisas und der Zerstörung des alten T. endete. T. gehörte
zum Böotischen Bund (s. Böotien) und ward bald Sitz der
Böotarchen und somit Hauptstadt des Bundes. 728 v. Chr.
erhielt die Stadt von dem Bakchiaden Philolaos aus Korinth neue
Gesetze. Auf Athens wachsende Macht eifersüchtig und über
den Abfall Platääs vom Böotischen Bund erbittert,
begann es 507 einen Krieg gegen Athen, wurde aber besiegt. In den
Perserkriegen stand T. mit Orchomenos auf der Seite der Perser und
erlitt mit diesen die Niederlage bei Platää 479, worauf
die Häupter der persischen Partei hingerichtet wurden. Thebens
Ansehen hatte infolgedessen so gelitten, daß Athen durch
Errichtung demokratischer Verfassungen in den böotischen
Städten Thebens Einfluß wiederholt zu brechen und
Böotien seiner eignen Hegemonie zu unterwerfen suchte. Nachdem
durch den Sieg bei Önophyta 456 Böotien (außer T.)
für den Athenischen Bund gewonnen worden war, schlugen die aus
Böotien Verbannten im Verein mit den Orchomeniern ein
athenisches Heer unter Tolmides 447 bei Koroneia, wodurch
Böotien sich vom Athenischen Bund wieder losriß.
Zugleich wurde die aristokratische Verfassung in T.
wiederhergestellt. Im Peloponnesischen Kriege gehörte T. zu
den erbittertsten Feinden Athens und versuchte 431 vergeblich,
Platää zu erobern; erst 427 gelang ihm die
Zerstörung dieser Stadt. 410 schloß es einen neuen Bund
mit Sparta. Als nach dem Sturz der Demokratie in Athen die 30
Tyrannen eine Schreckensherrschaft daselbst führten, sammelten
sich besonders in T. die athenischen Flüchtlinge und besetzten
von hier aus 403 unter Thrasybulos die kleine Grenzfeste Phyle und
später den Piräeus. Infolge dieses Umstandes und zugleich
aus Eifersucht auf die wachsende Macht Spartas nahm T. wieder eine
demokratische Verfassung an. Auch begann es 395 in Verbindung mit
Korinth und Argos offenen Krieg, den Korinthischen (s. d.), gegen
Sparta, ward aber 394 bei Koroneia geschlagen. Beim Ausbruch des
olynthischen Kriegs (382) besetzte der spartanische Feldherr
Phöbidas durch einen Handstreich die Burg von T., stellte die
Herrschaft der Aristokratie wieder her und schickte die
Häupter der demokratischen Partei in die Verbannung. Aber
schon 379 kehrte Pelopidas (s. d.) mit den übrigen
Flüchtlingen nach T. zurück, stürzte die
Aristokraten und erzwang mit Hilfe eines athenischen Heers die
Räumung der Burg. T. schloß hierauf ein Bündnis mit
Athen, Pelopidas u. Epameinondas (s. d.) aber traten an die Spitze
des Staats. Zwei Einfälle der Lakedämonier wies T. mit
Hilfe der Athener ab, ja es unterwarf sich auch die übrigen
böotischen Städte. Als die Thebaner 371 den allgemeinen
Frieden nicht annahmen, weil die Spartaner die Auflösung des
Böotischen Bundes forderten, begann der thebanische Krieg, in
welchem T. durch des Epameinondas Sieg bei Leuktra (371) die
Hegemonie errang. Es stürzte auch Spartas Macht auf dem
Peloponnes, indem Epameinondas den Arkadischen Bund stiftete und
die Unabhängigkeit Messeniens wiederherstellte; ja, es strebte
sogar nach einer Seeherrschaft. Jetzt glaubte selbst Athen, Thebens
Übermacht fürchten zu müssen, und trat auf Spartas
Seite über, und nach des Epameinondas Sieg und Tod bei
Mantineia (362) sank Thebens Macht wiederum, welche nur durch das
Genie seiner beiden größten Staatsmänner so hoch
gestiegen war. Neid und Haß trieben T. an, Phokis, das sich
ihm nicht unterwerfen wollte, durch das Amphiktyonengericht wegen
Verletzung des delphischen Tempelgebiets zu einer hohen Geldstrafe
verurteilen und sich zum Vollstrecker bestellen zu lassen.
Hierdurch erregte es den zweiten Heiligen Krieg (355-346), in dem
es jedoch unterlag, worauf es Philipp von Makedonien zu Hilfe rief
und ihm Gelegenheit gab, sich in Hellas festzusetzen. Erst nachdem
die Amphiktyonen 339 den Lokrern von Amphissa den zweiten Heiligen
Krieg erklärt und Philipp herbeigerufen hatten, ihr Urteil
gegen die Lokrer zu vollstrecken, und dieser Elateia besetzte,
griffen die Athener und Thebaner zu den Waffen gegen jenen, erlagen
aber in der Schlacht bei Chäroneia 338. T. mußte darauf
makedonische Besatzung in die Kadmeia aufnehmen. Nach Philipps Tod
(336) empörte sich T. gegen Alexander (335) auf die falsche
Nachricht von dessen Tod. Schon nach zwölf Tagen stand dieser
vor der Stadt und zerstörte sie nach dem Beschluß des
korinthischen Synedrions; 6000 Thebaner fielen, 30,000 wurden als
Sklaven verkauft. Erst 315 wurde T. von Kassandros mit Hilfe der
Athener wieder aufgebaut und stand nun unter makedonischer
Herrschaft. Im achäischen Krieg 146 schloß es sich der
Kriegserklärung der Achäer an die Römer an; nach
Verlust der Schlachten bei Skarpheia und Leukopetra flohen aber die
Einwohner Thebens nach dem Peloponnes, und T. verödete
seitdem. Pausanias fand nur noch die Burg und einige Tempel vor. Im
2. Jahrh. n. Chr. war die untere Stadt schon gänzlich
verschwunden. In neuerer Zeit hat man den Kabirentempel
ausgegraben. Aus Thebens Gebiet stammte Pindar. An Stelle der
phönikischen Burg Kadmeia erhob sich Thivä (s. d.).
Theben (ungar. Dévény), Markt und
Dampfschiffstation im ungar. Komitat Preßburg, an der
Mündung der March in die Donau und am Fuß des 513 m
hohen Thebner Kogels, mit dem die Kleinen Karpathen am
Donaudurchbruch (der Porta Hungarica) dem Leithagebirge
gegenüber beginnen, hat (1881) 1655 meist deutsche Einwohner,
die bedeutenden Handel mit Gemüse treiben. In der Nabe
T.-Neudorf, Station der Wien-Preßburger Bahnlinie, an der
March, über welche eine Brücke nach dem kaiserlichen
Jagdschloß Schloßhof führt, mit 1711 meist slowak.
Einwohnern.
Theca (lat., "Büchse"), die Frucht der Moose (s. d.,
S. 790); das Antherenfach der Staubgefäße (s. d.): bei
Pilzen der Sporenschlauch (s. d.).
Thecosmilia, s. Korallen.
628
Thé dansant - Thee.
Thé dansant (franz., spr. dangssang), ein
Tanzfest, wobei Thee gereicht wird; ein kleiner Ball.
Thedinghausen, Flecken im Herzogtum Braunschweig, Kreis
Braunschweig, Exklave in der preuß. Provinz Hannover,
südöstlich von Bremen, aus den Orten Bürgerei, Hagen
u. Westerwisch bestehend, hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht,
Vieh- und Pferdehandel und (1885) 1697 Einw.
Thee (Theestrauch, Thea L.), Gattung aus der Familie der
Ternströmiaceen, immergrüne Sträucher oder kleine
Bäume mit abwechselnden, lederigen oder krautigen,
glänzenden, meist gesägten, einfachen Blättern,
achselständigen, einzeln oder in Büscheln stehenden,
weißen oder rosenroten Blüten und holzigen,
dreifächerigen, dreisamigen Kapseln. Die wenigen Arten dieser
Gattung sind im obern Indien, in China und Japan heimisch. Die
wichtigste Art der auf Ostasien beschränkten Gattung (mit
welcher oft die Gattung Camellia vereinigt wird), T. chinensis
Sims., ein 1-3, selbst 10 m hoher Strauch mit kahlen oder
seidighaarigen Zweigen und Blattstielen, lanzettlichen, verkehrt
eilanzettlichen oder länglich-eiförmigen, spitzen, selten
stumpfen, gesägten, kahlen und glänzenden Blättern,
ziemlich großen, weißen, rosa angehauchten,
wohlriechenden Blüten, braunen, dreikantigen Kapseln und
kirschkerngroßen, glänzend braunen Samen mit gelbem
Nabel, variiert ungemein und hat im Lauf einer mehr als
tausendjährigen Kultur zahlreiche Spielarten ergeben, welche
ziemlich konstant sind (man unterscheidet T. viridis L. [s. Tafel
"Genußmittelpflanzen"], mit langen, breit lanzettlichen, T.
Bohea L., mit kürzern, mehr verkehrt eirunden, und T. stricta
Hayne, mit schmälern Blättern als die vorige und straff
aufrechten Ästen), und von denen die breitblätterige T.
assamica Lindl., welche in Assam einen hohen Baum bildet,
vielleicht die Stammpflanze ist. Genau kennt man das Vaterland des
Thees nicht, doch ist dasselbe wahrscheinlich in Oberassam zu
suchen. Durch die Kultur ist der Theestrauch bis 40°
nördl. Br. verbreitet, namentlich in China und Japan, auch in
Kotschinchina, Korea, Indien, Java, Sumatra und in Amerika. Der
Theestrauch wird in China vorwiegend zwischen dem 25. und 31.°
nördl. Br., besonders in den Provinzen Kuangtung, Fukian,
Kiangsi, Tschikiang und Nganhui, gewöhnlich auf den
südlichen Abhängen der Hügel kultiviert, wohl
niemals aber in eignen, ihm allein gewidmeten Anlagen, sondern
entweder in zerstreuten Büschen oder in Reihen zwischen den
Feldern, nicht selten zwischen den Reisfeldern auf den mehr oder
weniger hohen Dämmen. Man pflanzt den T. durch Samen fort,
versetzt die etwa einjährigen Sämlinge in Reihen, 1,25 m
voneinander entfernt, stutzt die Pflanze im dritten Jahr auf etwa
60 cm und sammelt die neuentwickelten Blätter vom April bis
September. Die kaum aus den Knospen sich entwickelnden, seidenartig
glänzenden, weißlichen Blättchen heißen nach
der Zubereitung Theeblüten. Im siebenten Jahr schneidet man
den Strauch nahe am Boden ab, damit die Stümpfe neue
Schößlinge und zarte Blätter treiben. Die
geernteten Blätter läßt man an der Luft auf Matten
welken, knetet sie dann mit nackten Füßen in Kübeln
zu einer Kugel und erhitzt sie unter beständigem Mischen auf
einem seichten Bambusgeflecht über Kohlenfeuer, rollt sie,
indem man die flach aufgelegten Hände im Kreis
herumführt, und trocknet sie an der Luft. Dann folgt das
Sieben, Sichten, Mischen und Auslesen, worauf man die Blätter
noch einmal erhitzt, um alle während der Bearbeitung
aufgenommene Feuchtigkeit zu beseitigen. Das Verfahren weicht
übrigens in verschiedenen Gegenden sehr voneinander ab, und
die auf eine oder die andre Weise provisorisch zubereiteten
Blätter werden von den Agenten der Theehändler angekauft
und in den größern Handelsplätzen weiter
bearbeitet. Man erhitzt sie unter beständigem Mischen auf
eisernen Pfannen über Aschenglut viermal abwechselnd mit
Auslegen des erhitzten Thees an die Sonne oder in einen luftigen
Raum, rollt dabei die Blätter noch besser ein, röstet sie
und parfümiert sie für den europäischen Geschmack
mit den Blüten von Camellia sasaqua, Aglaia odorata, Gardenia
florida, Olea fragrans, Jasminium Sambac und paniculatum,
Orangenblüten etc. Abgesehen von dem Einfluß der
Beschaffenheit der ältern oder jüngern Blätter auf
die Qualität des Thees verdanken die verschiedenen
Handelssorten ihren Ursprung ausschließlich einer
verschiedenen Zubereitungsweise, und der schwarze und grüne T.
können von derselben Pflanze gewonnen werden, wenn man die
Blätter so schnell trocknet, daß sie ihre Farbe
behalten, oder so langsam, daß der Blattsaft einer
Gärung unterliegt. Den grünen T. bereitet man in der
Provinz Hupei aus den im Anfang der Saison gewonnenen feinhaarigen
Kuppen der jüngsten Zweige. Der beste schwarze T., welcher
vier Fünftel der Gesamtausfuhr nach England ausmacht, kommt
aus dem Distrikt Kienningfu in der Provinz Fukian, von den
berühmten Boheahügeln, und führt im Handel
unzählige Namen, welche hauptsächlich auf die
Lokalitäten, wo derselbe wächst, oder auf die
Eigentümer des Grundstücks sich beziehen. Der beste
grüne T. kommt aus Huangho und Santotschu und soll um so mehr
an Güte abnehmen, aus je weiter nördlich von Kanton
gelegenen Distrikten er auf den Markt gebracht wird. In Japan baut
man den T. von 33-36° nördl. Br., und die bedeutendsten
Theedistrikte befinden sich nordöstlich und östlich von
Oasaka in den Provinzen Yamasiro und Ise sowie südlich vom
Fusijama. Man pflanzt die Sträucher um die Felder meist
zwischen Maulbeerbäumen; doch soll es auch eigne, vom
Theestrauch allein eingenommene Pflanzungen geben. Die Kultur ist
ähnlich der chinesischen. Die Blätter werden sofort in
eisernen Pfannen über Kohlenfeuer unter fortwährendem
Mischen mit den Händen etwa 40 Minuten gewärmt, dann auf
Matten ausgebreitet, mit den Händen gerollt und getrocknet.
Alle diese Operationen werden mehrmals wiederholt. Man behandelt
die Blätter aber auch auf Sieben zunächst mit Wasserdampf
und trocknet sie, nachdem sie braun geworden, auf einer Matte. Die
getrockneten Blätter werden auf einem Rahmen mit Papierboden
oder in eisernen Pfannen über Kohlenfeuer erhitzt und
schließlich gerollt. Das Produkt ist ein grüner,
starker, im ganzen aber geringerer T. als der chinesische. Man
unterscheidet die Sorten hauptsächlich nach ihrer
Qualität und nicht, wie in China, nach der Provenienz. Der
japanische T. geht meist nach Nordamerika. Die Theegärten
Indiens befinden sich in den Distrikten Assam, Dakka (Kachar,
Silhet) und Dardschiling der Provinz Bengalen und in dem
Kangradistrikt des Pandschab. Die Pflanzungen auf den Nilgiri
(Präsidentschaft Madras) sowie jene in den Nordwestprovinzen
und in Britisch-Birma sind von geringerer Bedeutung. Die Kultur ist
im wesentlichen dieselbe wie in China, und man produziert auch hier
zum weitaus größten Teil schwarze Thees, indem man die
Blätter eine Woche welken läßt, zu
faustgroßen Kugeln zusammenknetet und rollt und dann zwei
Stunden unter feuchten Tüchern einer
629
Thee (Physiologisches, Bereitung, Handelssorten).
Gärung überläßt, wobei sich die
Blätter braun färben. Nun erhitzt man die wieder
isolierten Blätter unter fleißigem Umrühren etwa
drei Minuten in eisernen Pfannen, rollt sie von neuem, setzt sie in
dünner Schicht einige Stunden der Luft aus und erhitzt sie
dann, mit Matten bedeckt, etwa 24 Stunden, wobei sich das herrliche
Aroma entwickelt. Zuletzt folgt das Auslesen und Sortieren. Nach
der Qualität unterscheidet man Orange-Flowery-Pekoe,
Flowery-Pekoe, Pekoe, Broken-Pekoe, Pekoe-Dust, Pekoe-Souchong,
Souchong, Broken-Tea, Kongoe, Dust. Der indische T. zeichnet sich
durch Stärke und durchdringendes Aroma aus und eignet sich
deshalb vortrefflich zur Mischung mit schwächeren chinesischen
T. Die Sorten führen dieselben Bezeichnungen wie die
chinesischen. Der größte Teil geht nach England. Der
anfangs sehr schlechte Javathee hat sich durch Verbesserungen in
Kultur und Zubereitung sehr gehoben; er ist herber und stärker
als Chinathee, ohne den Assamthee an Wohlgeschmack zu erreichen.
Die in Amerika unternommenen Versuche der Theekultur in Brasilien
und den Südstaaten der Union haben bis jetzt wenig
Bedeutung.
[Physiologisches. Bereitung.] Die Theeblätter enthalten
Kaffein (Thein), Gerbsäure, Boheasäure, Gallussäure,
Oxalsäure, Quercitrin, ätherisches Öl,
Eiweißstoff (wahrscheinlich Legumin) etc. Der Kaffeingehalt
schwankt zwischen 0,8 und 5 oder 6,2 Proz., beträgt im
Durchschnitt 2 Proz., kann aber durchaus nicht als Wertmesser des
Thees gelten, da bei den grünen Sorten die wohlfeilern an
Kaffein reicher sind als die im Handel höher geschätzten,
während beim schwarzen T. das Umgekehrte stattfindet. Der
grüne T. ist reicher an Gerbsäure als der schwarze, bei
dessen Bereitung ein Teil derselben, wie es scheint durch den
Gärungsprozeß, zerstört wird. Schwarzer T.
enthält durchschnittlich 10 Proz. Gerbsäure, und die
Abweichungen nach oben und unten überschreiten nicht 1,5 Proz.
In den Aufguß gehen etwa 29-45 Proz. löslicher Stoffe
über. Unter den mineralischen Bestandteilen des Thees ist Kali
vorherrschend, welches auch größtenteils in den Auszug
übergeht, während Kalk, Magnesia, Phosphorsäure in
den extrahierten Blättern bleiben. Auffallend ist, daß
der Auszug trotz der Gerbsäure Eisen enthält. Die
wirksamen Bestandteile des Thees sind das Kaffein und das
ätherische Öl, während die Gerbsäure,
wenigstens bei nicht übermäßigem Genuß, kaum
in Frage kommt; einen Nahrungswert besitzt der T. nicht. Er
äußert seinen erregenden Einfluß auf das
Nervensystem, zumal auf das Gehirn, indem er wach erhält. Die
Kraft, erhaltene Eindrücke zu verarbeiten, wird durch den
Genuß von T. gesteigert; man wird zu sinnigem Nachdenken
gestimmt, und trotz einer gröern Lebhaftigkeit der
Denkbewegungen läßt sich die Ausmerksamkeit von einem
bestimmten Gegenstand fesseln. Es findet sich ein Gefühl von
Wohlbehagen und Munterkeit ein, und die produktive Thätigkeit
des Gehirns gewinnt einen Schwung, der bei der größern
Sammlung und der bestimmter begrenzten Aufmerksamkeit nicht leicht
in Gedankenjagd ausartet. Wird der T. im Übermaß
getrunken, so stellt sich erhöhte Reizung des Nervensystems
ein, die sich durch Schlaflosigkeit, allgemeines Gefühl der
Unruhe und Zittern der Glieder auszeichnet. Es können selbst
krampfhafte Zufälle, erschwertes Atmen, ein Gefühl von
Angst in der Präkordialgegend entstehen. Da das
ätherische Öl des Thees, in größerer Menge
genossen, narkotisch wirkt, so erklärt sich daraus die
Eingenommenheit des Kopfes, die sich nach
übermäßigem Theetrinken anfangs als Schwindel, dann
als Betäubung zu erkennen gibt. Diese nachteiligen Wirkungen
hat der grüne T. in viel stärkerm Maß als der
schwarze. Der Chinese und Japaner trinkt den Aufguß des
Theeblattes ohne jede Beimengung; in Europa setzt man dem T. wohl
allgemein Zucker zu, häufig genießt man ihn auch mit
Milch und verdeckt das Aroma oft vollständig durch Vanille,
Rum etc. Asiatische Völker bereiten den T. auch mit Salz,
Milch, Butter, Mehl sowie mit Betel, Soda, Gewürzen, und hier
und da werden auch die erschöpften Blätter gegessen. Zur
Bereitung des Thees (einen Theelöffel voll T. auf die Person
und einen auf die Kanne) spült man die (metallene) Kanne mit
heißem Wasser aus, schüttet den T. hinein, gießt
wenig kochendes Wasser hinzu, füllt nach 3 Minuten die Kanne
mit siedendem Wasser und läßt noch 5 Minuten ziehen.
Nach einer andern beliebten Methode übergießt man den T.
nur mit 1/5-¼ des erforderlichen siedenden Wassers,
läßt 5 Minuten ziehen, gießt dann ab und
füllt nun die Tasse, indem man etwa ¼ Extrakt und
¾ heißes Wasser hineingießt. Die Hauptsache
bleibt immer, daß man gutes reines Wasser in einem
Gefäß erhitzt, welches niemals zu andern Zwecken benutzt
wird.
[Handelssorten.] Die bei uns gebräuchlichsten Handelssorten
des chinesischen schwarzen Thees sind: Pekoe ("Milchhaar"), die
feinste Sorte, besteht aus zarten, jungen, schwarzbraunen
Blättern, die besonders gegen die Spitze zu mit weißem,
seidenartigem Filz (Blüte) bedeckt sind. Der Aufguß ist
hell, goldgelb. Kongoe (d. h. T., auf welchen Arbeit verwendet
wurde), auch Kamp-hu genannt, kurze, dünne,
schwärzlichgraue Blätter, liefert einen hellen
Aufguß von angenehmem Geruch; diese Sorte bildet zwei Drittel
der gesamten englischen Einfuhr. Souchong (kleine Sorte),
bräunliche, etwas ins Violette spielende, große
Blätter von Melonengeruch, gibt einen klaren, duftenden
Aufguß von süßlichem Geschmack. Diese Sorte bildet
namentlich den Karawanenthee, welcher auf dem Landweg nach
Rußland importiert ward und bei diesem Transport viel weniger
leidet als der T., welcher den Seeweg nimmt. Gegenwärtig hat
die Absendung von Theekarawanen fast ganz aufgehört, und was
von Nishnij Nowgorod unter dem Namen Karawanenthee versandt wird,
hat meist vorher den Weg über London und Königsberg
dorthin genommen. Pouchong, breite, lange, stark gedrehte
Blätter mit vielen Blattstielen, gibt einen
grüngelblichen Aufguß von ambraartigem Geruch.
Kaperthee, Kaper-Kongoe, die geringste schwarze Theesorte, wegen
ihrer Ähnlichkeit mit Kapern so genannt, bildet einen sehr
bedeutenden Teil der europäischen Einfuhr. Von grünem T.
unterscheidet man: Imperial- oder Kaiserthee (Kugelthee),
kugelförmig zusammengerollte Blätter,
großkörnig, bläulichgrün; Gunpowder
(Schießpulver, Perlthee), kleinkugelig, dunkler; Haysan,
seitlich zusammengerollte Blätter, grün, ins
Bläuliche fallend; Younghaysan, Tonkay und Haysanchin. Eine
eigentümliche Ware ist der Ziegelthee (Backsteinthee), welcher
aus Theeblättern und -Stengeln, Abfällen aller Art von
der Bereitung des Thees dargestellt wird, indem man dieselben
dämpft, zusammenpreßt, dabei in Form von Ziegeln bringt
und trocknet. Dieser nur in China bereitete T. dient den
Nomadenvölkern Rußlands, den Kalmücken, Kirgisen,
Baschkiren etc., als gewöhnliches und sehr beliebtes
Nahrungsmittel, welches mit Milch und Hammelfett gekocht wird. In
Nordasien gelten diese Ziegel auch als Handelsmünze.
630
Thee, mongolischer - Thefillin.
Der T. unterliegt manchen Verfälschungen, besonders in
Kanton (daher die Handelsbezeichnung Canton made im Gegensatz zu
Country), aber auch in Europa. Sehr gebräuchlich ist die
Färbung des grünen Thees mit Berliner Blau, Indigo,
Kurkuma und das Bestäuben (Glasieren) mit Gips; in England
verfälscht man den T. mit Blättern von Schlehdorn, Ulme,
Esche, Weidenröschen etc.; auch wird sehr häufig schon
einmal benutzter T. mit Katechu etc. wieder aufgefrischt. Bis zu
Beginn der 70er Jahre lieferte China fast ausschließlich T.
für den Weltmarkt, dann begann Japan sich zu beteiligen, und
bald nachher trat Ostindien mit so bedeutenden Quantitäten
auf, daß die monopolistische Stellung Chinas wesentlich
geschwächt ist. China exportierte 1885: 1,618,404 Pikuls
schwarzen, 214,693 grünen T., 280,112 Ziegelthee und 15,505
Staubthee, im ganzen 2,128,714 Pikuls = 128,7 Mill. kg im Wert von
173 Mill. Mk. Dazu kommt die chinesische Theeausfuhr nach Sibirien
und nach der Mongolei, so daß sich die Gesamtausfuhr für
1885 auf 138,7 Mill. kg berechnet. Man nimmt an, daß die
Ausfuhr etwa ein Drittel der Produktion beträgt.
Außerdem lieferten für den Weltmarkt: Britisch-Ostindien
31,2, Japan 16 (?), Java und Madura 2,4 (?), Ceylon und andre
Gebiete 1,8 Mill. kg. Der Gesamtexport beträgt 190,1 Mill. kg
gegen 120 im J. 1872. Der Theeverbrauch beträgt in einem Jahr
pro Kopf der Bevölkerung in:
Austral. Kolonien 3,47 kg Portugal . . 0,05 kg
Großbritannien 2,16 - Schweiz . . . 0,05 -
Kanada . . . 1,67 - Norwegen . . 0,o4 -
Vereinigte Staate. 0,59 - Deutschland . 0,03 -
Niederlande 0,48 - Schweden . . 0,01 -
Dänemark . . 0,17 - Österreich . . 0,01 -
Europ. Rußland 0,17 - Belgien . . . 0,01 -
[Kulturgeschichtliches.] Der Gebrauch des Thees ist in China
sehr alt. Ein buddhistischer Heiliger soll im frommen Eifer das
Gelübde gethan haben, sich des Schlafs zu enthalten. Da ihn
derselbe endlich doch überwältigte, so schnitt er zur
Sühne seine Augenlider ab und warf sie auf die Erde; aus ihnen
erwuchs die schlasverscheuchende Theestaude. Dieser Heilige lebte
angeblich im 6. Jahrh. Doch ist bekannt, daß der T. schon
früher medizinisch benutzt wurde. Am Ende des 8. Jahrh. war
derselbe in China schon besteuert, und um diese Zeit haben
chinesische Bonzen den Strauch nach Japan verpflanzt, wo er bald
ebenso wie in China verbreitet wurde. Hier trinkt man ihn
allgemein, wenn auch der Ärmere sich mit Surrogaten behilft,
die auf dem Feld wild wachsen. Wie es scheint, hat der Mangel an
gutem Trinkwasser die Sitte des Theetrinkens sehr befördert;
doch hat der T. jedenfalls auch in seiner Eigenschaft als
narkotisches Genußmittel sich zahlreiche Freunde erworben. In
Asien verbreitete sich die Sitte des Theetrinkens im 15. Jahrh.;
die Araber, welche seit dem 9. Jahrh. mit China Handel trieben,
beschrieben den T. unter dem Namen Scha, entsprechend dem
chinesischen Namen Tscha, welcher in Fukian Tiä (daher T.)
lautet. Europa erhielt die erste Nachricht vom T. 1559 durch die
Portugiesen und Holländer, Maffei erwähnt ihn 1588 in
seiner "Historia indica", und 1610 brachten die Holländer in
Bantam von chinesischen Kaufleuten erstandenen T. auf den Markt.
1635 soll T. zuerst nach Paris gekommen sein; drei Jahre
später erhielt ihn Rußland auf dem Landweg, indem
russische Gesandte ihn als Geschenk für den Zaren mitbrachten.
1650 wurde der T. in England bekannt, und zehn Jahre später
trank man ihn als kostbares Getränk in Londoner
Kaffeehäusern. 1665 brachte Lord Arlington den ersten T.
direkt aus Ostindien, während die frühern Sendungen durch
Holländer und andre Vermittler geschehen waren. Die Sitte des
Theetrinkens machte indes zunächst langsame Fortschritte,
zumal bald viele Feinde derselben auftraten, welche den Genuß
des Thees wie den des Kaffee bekämpften. Dagegen rühmten
wieder andre (Molinari 1672, Albinus 1684, Pechlin 1684, Blankaart
1686, Blegna 1697) den T. auf das lebhafteste, und besonders
Bontekoe, welcher Leibarzt des Kurfürsten von Brandenburg war,
veröffentlichte 1667 eine Lobrede auf den T. voll arger
Übertreibungen. Er machte den T. zuerst in Deutschland
bekannt. Solange der T. Monopol einzelner Kompanien war und hoch
besteuert wurde, blieb der Verbrauch beschränkt. Noch 1820
erhielten Europa und Nordamerika nur 32 Mill. Pfd., wovon drei
Viertel auf England entfielen. Seitdem hat sich durch Verminderung
der Zölle und Aufhebung des Monopols der Ostindischen Kompanie
der Verbrauch ungemein vergrößert. Wirklich zur
Volkssitte ist das Theetrinken aber nur bei Holländern und
Engländern geworden, durch welche es auch nach den Kolonien
verpflanzt wurde. Sonst ist der Theekonsum nur noch in
Rußland, Skandinavien und den Küstengegenden des
mittlern Europa von Bedeutung, in den übrigen Ländern hat
die Sitte nur in den Städten und den höhern Schichten der
Bevölkerung Eingang gefunden. 1825 entdeckte Bruce die
Theepflanze in Assam, und zehn Jahre später wurden die ersten
Regierungspflanzungen gegründet und diese 1839 an die Assam
Tea Company abgetreten. 1851 betrug der indische Export nur 262,839
Pfd., seit 1861 aber nahm derselbe einen rapiden Aufschwung. Auf
Java datiert die Theekultur seit 1825, und elf Jahre später
kam der erste Javathee nach Amsterdam. In Brasilien begann man 1812
mit dem Theebau, ohne indes besonders gute Resultate zu erzielen;
die Versuche in Nordamerika begannen etwa 1848 in Südcarolina
und Tennessee. In Europa wurde die erste Theestaude 1658 von
Jonquet in Paris gepflanzt, in Südeuropa hält sie im
Freien aus, und in Hohenheim bei Stuttgart überstand sie sogar
den harten Winter von 1784. In Frankreich, Portugal, Kleinasien,
auf St. Helena, Bourton und am Kap ist der Theebau ohne
wesentlichen Erfolg versucht worden. Vgl. Jacobson, Handbuch der
Theekultur (in holländ. Sprache, Batav. 1844); Bruce, Report
on the manufacture of teas (Lond. 1849); Ball, Cultivation and
manufacture of tea in China (das. 1848); Fries, Darstellung der
Theekultur und des Theehandels in China (Wien 1878); Money,
Cultivation and manufacture of tea (4. Aufl., Lond. 1888);
Schwarzkopf, Der T., Bestandteile etc. (Halle 1881); Feistmantel,
Die Theekultur in Britisch-Ostindien (Prag 1888).
Thee, mongolischer, s. Saxifraga.
Thee von New Jersey, Ceanothus.
Theebaum, weißer, s. Melaleuca.
Theeheide, s. Gaultheria.
Theekraut, mexikanisches, s. Chenopodium.
Theemaschine, s. Samowar.
Theer, s. Teer.
Thefillin (hebr., Gebetriemen, griech. Phylakterien, nach
Luthers Übersetzung, Matth. 23,5, "Denkzettel"), bei den Juden
Pergamentstreifen, mit Bibelsprüchen (5. Mos. 6,4-9; 11,13-21;
2. Mos. 13,1-16) beschrieben, die, in zwei würfelförmige
Kapseln gelegt, beim werktägigen Morgengebet an die Stirn und
an den linken Arm dem Herzen gegenüber mit ledernen Riemen
gebunden werden, um anzudeuten, daß man Gedanken und Herz auf
Gott
631
Theïn - Thekla.
richten müsse. Eine Mißdeutung des
ursprünglichen Sinnes war es, wenn man sie für Amulette
hielt (daher griechisch Phylakterien).
Theïn, s. v. w. Kaffein.
Theiner, Augustin, gelehrter kathol. Kanonist, geb. 11.
April 1804 zu Breslau, studierte daselbst Theologie, dann
Philosophie und die Rechte, gab mit seinem Bruder Anton (s. unten)
eine oppositionelle Schrift: "Die Einführung der erzwungenen
Ehelosigkeit bei den christlichen Geistlichen" (Altenb. 1828, 2
Bde.; 2. Ausg. 1845), heraus, unternahm seit 1830 eine
wissenschaftliche Reise nach Wien, London und Paris und ging 1833
nach Rom, wo er für den Ultramontanismus gewonnen ward. Seit
1855 war er Präfekt des vatikanischen Archivs. Nicht
bloß hat er des Baronius "Annales ecclesiastici" neu
herausgegeben (Bar le Duc 1864 ff.) und fortgesetzt (Rom 1856-57, 3
Bde.), sondern daneben auch eine große Anzahl
selbständiger Schriften verfaßt, namentlich
kirchenrechtlichen und kirchengeschichtlichen Inhalts, z. B.: "Die
neuesten Zustände der katholischen Kirche in Polen und
Rußland" (Augsb. 1841); "Geschichte der Zurückkehr der
regierenden Häuser von Braunschweig und Sachsen in den
Schoß der katholischen Kirche" (Einsiedeln 1843); "Die
Staatskirche Rußlands im Jahr 1839" (anonym, Schaffh. 1844);
"Zustände der katholischen Kirche in Schlesien von 1740 bis
1758" (Regensb. 1852, 2 Bde.); "Über Ivos vermeintiiches
Dekret" (Mainz 1852); "Geschichte des Pontifikats Clemens' XIV."
(Leipz. u. Par. 1853, 2 Bde.); "Documents inédits relatifs
aux affaires religieuses de la France" (Par. 1858, 2 Bde.);
"Monumenta vetera historica Hungariam sacram illustrantia" (Rom
1859-60, 2 Bde.; "Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae
gentiumque finitimarum historiam illustrantia" (das. 1860-64, 4
Bde.); "Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis" (das.
1861-62, 3 Bde.); "Vetera monumenta Slavorum meridionalium
historiam illustrantia" (Bd. 1, das. 1863); "Vetera monumenta
Hibernorum et Scotorum historiam illustrantia" (das. 1864); "La
souveraineté temporelle du Saint-Siège, jugée
par les conciles généraux de Lyon, en 1245, de
Constance, en 1414" (Bar le Duc 1867). Diese Urkundenwerke wurden
in einer von ihm eigens eingerichteten Offizin im Vatikan gedruckt.
Während des vatikanischen Konzils wurde T. gemaßregelt
und ihm das Archivariat abgenommen, weil er beschuldigt war,
verschiedene Aktenstücke den deutsch-österreichischen
Oppositionsbischöfen in die Hand gespielt zu haben. Der
eigentliche Thäter war Friedrich in München. Während
letzterer in Theiners Auftrag anfing, die von diesem in der
vatikanischen Bibliothek vorbereiteten "Acta genuina concilii
Tridentini" (Agram u. Leipz. 1874, 2 Bde.) herauszugeben, starb T.
10. Aug. 1874. Vgl. Gisiger, Vater T. und die Jesuiten (Mannh.
1875). - Sein älterer Bruder, Joh. Anton, geb. 1799 zu
Breslau, war seit 1824 außerordentlicher Professor des
Kirchenrechts daselbst; die in dem mit seinem Bruder
gemeinschaftlich herausgegebenen Buch über den Cölibat
hervortretende liberale Tendenz sowie seine Teilnahme an den
damaligen Reformbestrebungen des Klerus bewogen die Regierung, ihm
die Vorlesungen über Kirchenrecht zu untersagen; er wurde
daher 1830 Pfarrer, trat 1845 zum Deutschkatholizismus über
und starb 1860 als Sekretär der Universitätsbibliothek in
Breslau. Er schrieb unter anderm: "Das Seligkeitsdogma der
katholischen Kirche" (Bresl. 1847).
Theiothermin, s. Baregin.
Theïsmus (griech.), im Gegensatz zum Atheismus
allgemeine Bezeichnung für jegliche Art von Gottesglauben;
insbesondere in neuerer Zeit die Lehre von einem persönlichen,
über die Welt ebenso erhabenen wie lebendig ihr nahen und sie
durchweg bedingenden Gott, im Gegensatz nicht bloß zum
Pantheismus (s. d.), sondern auch zum Deismus (s. d.).
Theiß (ungar. Tisza, lat. als Grenzfluß
Daciens Tissus, Tisia oder Pathissus), der größte
Nebenfluß der Donau, der zweitgrößte Fluß
Ungarns und der fischreichste Europas, entsteht im Komitat Marmaros
auf den Waldkarpathen aus der Vereinigung der Schwarzen und
Weißen T., fließt anfangs südlich durch enge
Gebirgspässe und wendet sich nach Aufnahme des Vissó,
der Iza, des Taraczko, Talabor und Nagyág west- und
nordwestwärts über Sziget nach Huszt. Bis hierher ist die
T. rein und schnell fließend, in der Ebene aber schleichend
und schlammig. Nachdem sie sodann rechts die Borsova, links die
Thur und die Szamos aufgenommen, fließt sie von Csap
über Tokay bis Szolnok gegen SW., dort wendet sie sich
südwärts, welche Richtung sie, Csongrád und
Szegedin berührend, bis zur Mündung in die Donau
(unterhalb Neusatz), mit der sie in einer durchschnittlichen
Entfernung von 90 km parallel läuft, beibehält. Die Ufer
sind meist flach und infolge der häufigen
Überschwemmungen sumpfig. Ihre Breite beträgt 160-320 m.
Schiffbar wird sie bei Sziget, für größere
Fahrzeuge an der Hernádmündung, für Dampfboote,
welche früher bis Tokay verkehrten, erst bei Szolnok, von wo
an sie ebenso große Lasten wie die Donau trägt. Der
Bácser oder Franzenskanal verbindet sie mit der Donau, der
Begakanal mit der Temes. Seit längerer Zeit hat man neben der
Theißregulierung auch die Trockenlegung der Ufermoräste
und die Sicherung des Ufergebiets vor Überschwemmung begonnen,
durch die unvollständige Durchführung aber anderseits die
tiefern Gegenden geschädigt. Der Lauf der T. beträgt mit
den Krümmungen 1308 km, der direkte Abstand von der Quelle nur
467 km; ihr Gebiet umfaßt 146,500 qkm (2660 QM.). Der Lauf
ist des sehr geringen Gefälles halber ziemlich träge; von
Namény bis zur Mündung sinkt der Wasserspiegel nur um
40 m. Überschwemmungen der doppelt schnellern Donau stauen die
T. weit aufwärts. Nebenflüsse derselben sind rechts:
Taraczko, Talabor, Nagyág, Borsova, Bodrog, Sajó
(Hernád), Eger, Zagyva; links: Vissó, Iza, Szamos,
Körös, Maros, Bega. Vgl. Hieronymi, Die
Theißregulierung (Budapest 1888).
Theißblüte, s. Eintagsfliegen.
Theißholz (ungar. Tiszolcz), Markt im ungar.
Komitat Gömör und Station der Ungarischen Staatsbahn, mit
(1881) 3511 slowakischen und ungar. Einwohnern, Schafzucht,
Käsebereitung, Eisensteinbergbau, bedeutendem Eisenwerk
(Produktion 130,000 metr. Ztr.), Papierfabrik und einem
Sauerbrunnen.
Thekaspore (griech.), s. Sporen und Pilze, S. 66.
Thekla, die heilige, nach der Legende eine vornehme
Jungfrau aus Ikonion, die vom Apostel Paulus zum Christentum
bekehrt ward und ihm nach Antiochia folgte. Da sie das Gelübde
eines ehelosen Lebens gethan, hatte sie von seiten ihrer Familie
und ihres Bräutigams heftige Verfolgungen zu erdulden und
wurde endlich, von letzterm als Christin denunziert, im Zirkus den
winden Tieren vorgeworfen, von diesen aber, wie ein späteres
Mal von den Flammen, denen man sie preisgab, verschont. Nach
Paulus' Tod lebte sie bis ins hohe Alter in einer Höhle bei
Seleukia. Ihr Tag ist der 23. September. T. ist die
632
Thekodonten - Themistokles.
Heldin eines christlichen Romans aus dem 2. Jahrh., betitelt:
"Die Akten des Paulus und der T.", der im wesentlichen noch
erhalten ist und von Tischendors in den "Acta apostolorum
apocrypha" (Leipz. 1851) herausgegeben wurde. Eine poetische
Nachbildung der Legende verdankt man P. Heyse. Vgl. Schlau, Die
Akten des Paulus und der T., und die ältere Theklalegende
(Leipz. 1877); Lipsius, Die apokryphen Apostelgeschichten, Bd. 2
(Braunschw. 1884-86).
Thekodonten, s. Reptilien, S. 738.
Thelemarken, Landschaft im norweg. Stift Christianssand
(Amt Bratsberg), wird von einer Gebirgsmasse ausgefüllt, die
im Gausta (1884 m) ihren höchsten Gipfel hat. Die Gegend ist
reich an großen Seen, die ihr Wasser größtenteils
dem Norsjö abgeben, der wieder durch die 10 km lange Skienselv
seinen Abfluß zum Meer hat. Am Gausta ist das
großartige Westfjorddal mit dem Wasserfall Rjukan
bemerkenswert. Vornehmlich das nördliche T. wird seiner
Naturschönheiten halber viel von Touristen besucht. Die
Bewohner sind ein kräftiger Schlag, rauh und keck, aber
gutmütig und höflich; sie haben in ihren Sitten noch viel
Originelles. Ihre Tracht besteht aus einer kurzen, grauen,
grün besetzten Jacke, einem grauen, kurzen Beinkleid und
Schuhschnallen; dazu tragen sie langes Haar und stets ein Messer an
der Hüfte. In den hohen Teilen des Landes herrscht Armut, aber
überall findet sich eine gewisse Bildung. Zu den
größern Gehöften gehört ein sogen. Staatshaus
(Stue), das für die Gäste bestimmt tst, während der
Besitzer in seinem Vorratshaus (Stolpebod, Stabur) wohnt, das auf
schlanken geschnitzten Säulen ruht und ungeheure Eß- und
Kleiderschränke enthält. Der Wohlstand wird durch die
Zahl der Pelz- und Wolldecken bestimmt. Ein andres Haus ist Schlaf-
und Wohnstätte der Familie, und darüber sind die Kammern
für das Gesinde. Abgesondert steht auch das Feuerhaus oder die
Küche.
Thema (griech.), das Gesetzte, Aufgestellte; daher in der
Rhetorik der einer jeden stilistischen Darstellung zu Grunde
liegende Hauptgedanke; in der Musik derjenige Gedanke (Satz) in
einem Tonstück, der dem ganzen Stück oder doch einer
größern Abteilung desselben zu Grunde gelegt ist, daher
als Hauptgedanke am meisten wiederholt und in der Art weiter
ausgeführt ist, daß er in den verschiedensten Wendungen
und Veränderungen und in verschiedenen Tonarten wiederkehrt.
Bei den kontrapunktischen Formen (Fuge etc.) wird das T. auch
Subjekt genannt. Vgl. Kompositionslehre und Fuge.
Themar, Stadt im sachsenmeining. Kreis Hildburghausen, an
der Werra, Knotenpunkt der Linien Eisenach-Lichtenfels und
T.-Schleusingen der Werraeisenbahn, hat eine evang. Kirche, eine
Ringmauer mit Türmen, ein Amtsgericht, Holzhandel, 2
Dampfziegeleien, eine Dampfmahlmühle, Korbwarenfabrikation und
(1885) 1694 Einw. Dabei die Ruine Osterburg und das Nadelöhr,
ein Felsenriff, welches die Werra durchbrochen hat.
Themis, in der griech. Mythologie eine der Titaniden,
Tochter des Uranos und der Gäa, war eine Zeitlang Inhaberin
des delphischen Orakels, überließ dasselbe aber dem
Apollon, als Zeus sie zu seiner zweiten Gemahlin erhob. Sie gebar
demselben die Horen und die Mören (Parzen). In weiterer
Ausbildung erscheint sie als Personifikation der gesetzlichen
Ordnung. Dargestellt wird sie auf Münzen mit Füllhorn und
Wage, auch als Göttin der Gerechtigkeit, entsprechend der
Justitia. Vgl. Ahrens, Über die Göttin T. (Hannov. 1862
u. 1864).
Themistios, mit dem Beinamen Euphrades ("Wohlredner"),
peripatetischer Philosoph und Rhetor aus Paphlagonien, lehrte in
Nikomedia, späterhin in Konstantinopel, wo er 355 Senator, 362
Stadtpräfekt und, obgleich Heide, von Kaiser Theodosius zum
Erzieher seines Sohns Arcadius bestellt wurde; starb zwischen 387
und 390. Außer einem Kommentar zu einigen Schriften des
Aristoteles (hrsg. von Spengel, Leipz. 1866; von Wallies in den
"Commentaria in Aristotelem graeca" der Berliner Akademie, Bd. 23,
Berl. 1884) besitzen wir von ihm 33 Reden, die unter andern Dindorf
(das. 1874) herausgab.
Themisto, nach griech. Mythus Tochter des
Lapithenkönigs Hypseus und dritte Gemahlin des Athamas (s.
d.), tötete aus Versehen ihre eignen Kinder und dann, nachdem
sie ihren Irrtum erkannt, sich selbst.
Themistokles, berühmter athenischer Feldherr und
Staatsmann, geboren um 527 v. Chr. zu Athen, Sohn des Neokles aus
dem altattischen Stamm der Lykomiden, aber einer fremden
(thrakischen oder karischen) Mutter, weswegen er nicht
vollbürtig war, zeigte schon als Knabe hellen Verstand,
treffende Urteilskraft, großes Selbstbewußtsein und
hochstrebenden Geist, aber auch ein leidenschaftliches, trotziges
Gemüt. Er erlangte durch seine geistige überlegenheit und
Kühnheit bald Einfluß bei der Bürgerschaft und war
bemüht, sie für die Schaffung einer herrschenden Seemacht
zu gewinnen. 493 zum Archonten erwählt, bewirkte er die Anlage
des neuen Hafens im Piräeus, ermutigte 490 die Athener zum
Widerstand gegen die persische Übermacht und kämpfte als
einer der zehn Strategen in der Schlacht bei Marathon. Da er aber
die Rückkehr der Perser mit verstärkter Macht voraussah,
welcher die Athener nur mit einer Flotte erfolgreich entgegentreten
könnten, so bewirkte er den Beschluß, die Einkünfte
der Silberbergwerke von Laurion zur Erbauung von 100 neuen Schiffen
zu verwenden, und setzte das Gesetz durch, daß die Flotte
einen jährlichen Zuwachs von 20 neuen Trieren erhalten sollte.
Da Aristeides diese Beschlüsse für verderblich ansah und
ihrer Ausführung entgegenwirkte, wurde er 483 auf T.' Betrieb
durch den Ostrakismos verbannt, und nun hatte T. allein die
Herrschaft in Athen und benutzte sie zur Vermehrung der
Seerüstungen, so daß bald 200 Trieren fertig waren. An
der Spitze derselben nahm er an den Kämpfen von 480 (s.
Perserkriege) teil, und ihm war es zu danken, daß die
griechische Flotte bei Artemision aushielt und die ersten
Kämpfe wagte; er bewog die Athener, ihre ganze Existenz der
neuen Flotte anzuvertrauen, und führte endlich durch Ausdauer
und List den Kampf bei Salamis herbei, der mit dem glänzenden
Sieg der Griechen endete. Hierauf zwang er die Kykladen zur
Unterwerfung und zur Zahlung ansehnlicher Bußgelder.
Mißgunst und Eifersucht bewirkten, daß T. nicht nur den
gebührenden ersten Siegespreis nicht erhielt, sondern auch
für 479 nicht zum Feldherrn ernannt wurde. Athen wurde hierauf
478 unter seiner Leitung wieder aufgebaut und befestigt. Den
Einspruch Spartas gegen den Bau von Mauern beseitigte er durch
List, zog sich aber dadurch dessen Haß zu. Auch der
Piräeus wurde von neuem in großem Maßstab
befestigt, der Hafenbau vollendet und durch Beförderung der
Einwanderung die junge Stadt bevölkert. Trotzdem verlor T.
bald sein Ansehen und seinen Einfluß, weil er nicht frei von
Eitelkeit, willkürlicher Gewalttätigkeit und
Bestechlichkeit war und deshalb von Aristeides verdunkelt wurde; da
er diesem entgegenwirkte und das gute
633
Themse - Thenenet.
Einvernehmen mit Sparta störte, wurde er 471 durch das
Scherbengericht verbannt. Er begab sich nach Argos, mußte
aber, als seine Feinde, die Spartaner, ihn der Teilnahme am
Hochverrat des Pausanias beschuldigten und in Athen seine
Verurteilung und Verfolgung durchsetzten, 466 von da flüchten.
Er ging nun über Kerkyra zu dem Molosserkönig Admetos
und, als die Spartaner auch von diesem seine Auslieferung
verlangten, 465 über Ephesos nach Susa zu dem Perserkönig
Artaxerxes, der ihm die Einkünfte dreier Städie
überwies: Magnesia zum Brot, Lampsakos zum Wein, Myus für
die Zukost. In Magnesia lebte T. längere Zeit als persischer
Satrap in fürstlichem Prunk. Als er gerade nach Ausbruch des
ägyptischen Aufstandes eine persische Flotte gegen seine
Heimat führen sollte, starb er plötzlich (um 460),
vielleicht freiwillig durch Gift. Seine Freunde brachten seine
Gebeine heimlich nach Attika und setzten sie beim Vorgebirge
Alkimos bei. Zu Magnesia zeigte man nachmals sein Grabmal und auf
dem Markte daselbst seine Bildsäule. Die Briefe, welche wir
unter seinem Namen besitzen, sind unecht, wie Bentley
("Abhandlungen", deutsch von Ribbeck, Leipz. 1867) nachgewiesen
hat. Sein Leben beschrieben Cornelius Nepos und Plutarch. Vgl.
Finck, De Themistoclis Neoclis etc. aetate (Götting. 1849);
Bauer, Themistokles (Merseb. 1881).
Themse (engl. Thames, franz. Tamise, im Altertum Tamesis
oder Tamesa), der wichtigste Fluß Englands, entspringt als
Churn in den Cotswoldhügeln im S. von Cheltenham, wird durch
den der Quelle Thames Head (115 m ü. M.) entströmenden
Bach verstärkt und vereinigt sich nach einem Laufe von 32 km
oberhalb Cricklade mit dem aus W. kommenden kleinern
Quellfluß, der eigentlichen T. oder Isis. Der Fluß
stießt nun östlich an Lechdale vorbei, wo er für
Boote schiffbar wird, nimmt bei Oxford den von N. kommenden
Cherwell auf, verstärkt sich weiter unterhalb durch Thame (bei
Dorchester), Kennet (bei Reading), Loddon, Colne, Wey, Mole und
Brent sowie unterhalb London durch Lea (s. d.), Ravensbourne,
Darent und Medway (s. d.), berührt außer den oben
genannten Orten noch Maidenhead (am malerischten Teil des Flusses),
Windsor, Kingston und unterhalb London Greenwich, Woolwich,
Gravesend und Sheerneß und fällt unterhalb letzterer
Stadt in die Nordsee. Mitten in ihrer 7 km breiten Mündung,
bei der "Nore" genannten Sandbank, liegt ein weltberühmtes
Leuchtschiff. Das Flußgebiet der T. umfaßt 15,371 qkm
(279 QM.) und gehört 14 Grafschaften an. Die direkte
Entfernung der Mündung des Flusses von der Quelle beträgt
201 km, der Stromlauf 346 km. Der unterhalb der Londonbrücke
gelegene Teil des Flusses, der eigentliche Hafen Londons,
heißt Pool, aber gesetzlich erstreckt sich der Hafen bis zu
einer Linie, welche man sich vom Nord Foreland bis zum Harwich Naze
gezogen denkt. Die Breite des Flusses beträgt bei Gravesend
noch 731 m, bei der Londonbrücke 244 m. Die Tiefe bis dahin
ist nirgends unter 3,6 m. Die Flut steigt alle 12 Stunden 4-6 m
senkrechter Höhe mit einer Schnelligkeit von 3-5 km auf die
Stunde, so daß Schiffe bis zu 800 Ton. in die Catherinedocks
dicht bei der Londonbrücke einlaufen können. Die Flut
macht sich bis Teddington, 29 km oberhalb der Londonbrücke,
bemerkbar, wo die erste Schleuse ihrem weitern Fortschreiten ein
Ziel setzt. Nur selten bildet sich Eis im Fluß; wohl aber
überschwemmt derselbe häufig seine Ufer, die unterhalb
London meilenweit durch Deiche geschützt sind, da die dortigen
Marschen bei hoher Flut 1 m unter dem Wasserspiegel liegen. In
Beziehung auf den Handel ist die T. einer der wichtigsten
Flüsse der Welt, indem an ihren Ufern London, die
größte Handelsstadt der Welt, liegt. Ihre Wichtigkeit
wird erhöht durch zahlreiche Kanäle, welche die T. mit
fast allen Teilen Englands verbinden. Die wichtigsten unter ihnen
sind: der Thames- und Severnkanal, welcher Lechdale an der obern T.
mit dem Severn und der englischen Westküste verbindet; der
Oxfordkanal, der von Oxford ins mittlere England führt; der
Wilts- und Berkskanal; der Grand Junctionkanal (s. d.), mit
mehreren Zweigen, welcher London mit dem innern England verbindet.
Gegen feindliche Angriffe ist die übrigens wegen der
Sandbänke sehr schwierige Themseeinfahrt durch in neuester
Zeit sehr verstärkte Befestigungen geschützt. An der
Mündung des Medway in die T. liegt Sheerneß, den Zugang
zum Kriegshafen Chatham versperrend. Weiter oberhalb verteidigen
vier große Forts (bei Cliffe Creek, Coalhouse Point, Shorne
Creek und Tilburn) den Zugang zu Gravesend. Vgl. "The royal river
T." (Lond. 1886).
Themsetunnel, ein Tunnel, welcher 2,1 km unterhalb der
Londonbrücke unter der Themse weg führt und die
Verbindung zwischen den beiden Ufern herzustellen bezweckt, ohne
doch dem Schiffsverkehr auf dem Fluß hinderlich zu sein. Die
1798 (von R. Dodd) und 1805-1808 gemachten Versuche schlugen fehl,
und erst Marc Isambard Brunel (s. d.) gelang es, durch Erfindung
des Teredobohrers das Werk 1825 mit Aussicht auf Erfolg wieder in
Angriff zu nehmen. Durch mehrere Unglücksfälle
unterbrochen, wurde dasselbe 25. März 1843 von Page vollendet.
Der Tunnel ist 361,8 m lang, 4,27 m breit, 5,18 m hoch, und sein
Boden liegt 24,34 m unter dem Straßenniveau. Der Bau kostete
über 9 Mill. Mk. 1869 ging derselbe in den Besitz einer
Eisenbahngesellschaft über, welche eine Verbindungsbahn
durchgeführt hat. Weiter oberhalb liegt ein 1869-70 erbauter
zweiter T. (Tower subway), 405 m lang und nur für den
Personenverkehr bestimmt. Ein dritter Tunnel soll jetzt weiter
unterhalb gebaut werden.
Thenar, Daumenballen.
Thénard (spr. -ár), Louis Jacques,
Chemiker, geb. 4. Mai 1774 zu Louptière im Departement Aube,
studierte zu Paris, ward Professor der Chemie am Collège de
France, später an der polytechnischen Schule und an der
Universität und 1833 Pair von Frankreich. 1840 legte er seine
Professur nieder und starb 20. Juni 1857 in Paris. Thénards
Untersuchungen, welche sich über fast alle Teile der Chemie
erstreckten, waren zum Teil epochemachend für seine Zeit.
Namentlich lieferte er in Gemeinschaft mit Gay-Lussac eine Reihe
der wichtigsten Arbeiten. So entdeckten sie das Bor, die
Alkalisuperoxyde und das Baryumsuperoxyd, stellten zuerst die
Alkalimetalle ohne Anwendung einer galvanischen Batterie dar und
bildeten die Elementaranalyse aus. T. entdeckte auch das
Wasserstoffsuperoxyd und das Kobaltblau sowie eine neue Methode der
Bleiweißfabrikation, vervollkommte die Ölraffinerie etc.
Seine Hauptschriften sind: "Traité de chimie
élémentaire théorique et pratique" (6. Aufl.,
Par. 1836, 5 Bde.; deutsch, Leipz. 1825-30, 7 Bde.) und "Recherches
physico-chimiques" (mit Gay-Lussac, Par. 1811, 2 Bde.).
Thenardit, natürlich vorkommendes Glaubersalz
(schwefelsaures Natron).
Thénardsblau, s. Kobaltblau.
Thenenet, ägypt. Göttin, Begleiterin des Gottes
Month, eine Form der Hathor.
634
Theobroma - Theodolit
Theobroma, s. Kakaobaum.
Theobromin C7H8N4O2, Alkaloid, findet sich zu 1,5 Proz.
in den Kakaobohnen und wird dargestellt, indem man entölten
Kakao anhaltend mit Wasser und wenig Schwefelsäure kocht, die
klare Abkochung mit Bleioxyd neutralisiert, filtriert, das Filtrat
gären läßt, kocht, mit Soda neutralisiert und das
sich ausscheidende T. durch wiederholtes Lösen in
Salpetersäure und Fällen mit Ammoniak reinigt. T. bildet
ein farb- und geruchloses, kristallinisches Pulver, schmeckt
bitter, ist wenig löslich in Wasser, kaum in Alkohol und
Ather, leicht in Ammoniak, sublimiert bei 290°, reagiert
neutral, bildet leicht kristallisierbare, unbeständige Salze
und gibt in ammoniakalischer Lösung mit salpetersaurem
Silberoxyd einen Niederschlag von Theobrominsilber, welches mit
Jodmethyl Jodsilber und Kaffein (Methyltheobromin) bildet. T. wirkt
wie Kaffein, aber viel schwächer.
Theodat (Deodat), König der Ostgoten, letzter
männlicher Sprößling des Königsgeschlechts der
Amaler, Graf von Tuscien, ward von Amalasuntha nach ihres Sohns
Athalarich Tod (534) zum Mitherrscher erkoren, obwohl er wegen
seiner Habsucht und Gewaltthätigkeit allgemein verhaßt
war und schon in verräterischer Verbindung mit dem Hofe von
Konstantinopel stand, ließ, gereizt durch Amalasunthas
Verachtung, diese 535 im Bad ermorden, benahm sich, unkriegerisch
und zu gelehrter Spielerei neigend, als Belisar das Ostgotenreich
angriff, feig und kriechend demütig, erbot sich sogar, sein
Reich an Justinian abzutreten, und ward 536 von einem über
seine Feigheit ergrimmten Goten ermordet. Vgl. O. Abel, T.,
König der Ostgoten (Stuttg. 1855).
Theodéktes, griech. Redner und tragischer Dichter,
aus Phaselis in Lykien, trug achtmal den Sieg davon, so 351 v. Chr.
mit seiner Tragödie "Mausolos" in dem tragischen Wettstreit,
welchen die Königin Artemisia zu Ehren ihres verstorbenen
Gemahls Mausolos veranstaltet hatte. Von seinen Tragödien sind
nur unbedeutende Bruchstücke übrig (abgedruckt bei Nauck,
"Tragicorum graecorum fragmenta", Leipz. 1856). Vgl. Märcker,
De Theodectis vita et scriptis (Bresl. 1835).
Theodelinde, Königin der Langobarden, Tochter des
Bayernherzogs Garibald, ward 589 mit dem langobardischen König
Authari, der unerkannt um sie warb, vermählt, reichte nach
dessen Tod (590) dem Herzog Agilulf von Turin die Hand und
verschaffte ihm dadurch die Krone, übte unter ihm und ihrem
Sohn Adelwald (615-624) großen Einfluß auf die
Regierung aus und vermittelte namentlich den Frieden zwischen den
arianischen Langobarden und der römisch-katholischen Kirche.
Sie erbaute die Kathedrale in Monza, wo fortan die Eiserne Krone
aufbewahrt wurde.
Theoderich (got. Thiudareiks, "Volksherrscher",
Theodorich, Theuderich, später Dietrich), Name zweier
westgotischer Könige: 1) T. I., 419-451, Nachfolger Wallias,
wählte Tolosa zum Herrschersitz, besiegte 439 den
römischen Feldherrn Litorius, verband sich 451 mit Aetius
gegen die Hunnen und fiel, tapfer kämpfend, in der Schlacht
bei Catalaunum.
2) T. II., 453-466, Sohn des vorigen, ermordete seinen
ältern Bruder, König Thorismund, regierte kräftig
und focht siegreich, ward 466 von Eurich ermordet.
3) T. der Große, König der Ostgoten, geb. 454, Sohn
des Amalers Theodemir, kam 462 als Geisel an den byzantinischen
Hof, an dem er zehn Jahre verweilte, nahm dann an seines Vaters
Kämpfen teil, ward nach dessen Tod 475 König der Ostgoten
und stand im Bund mit dem oströmischen Kaiser Zenon, der ihn
mit Ehren und Würden Überhäufte und ihm die
Erlaubnis erteilte, Italien für den Kaiser wiederzuerobern.
488 zog er über die Ostalpen, schlug Odoaker 489 am Isonzo und
bei Verona, 490 an der Adda, zwang ihn 493 in Ravenna zur
Übergabe und tötete ihn mit eigner Hand. Er nannte sich
nun, obwohl er die Oberhoheit des byzantinischen Kaisers
anerkannte, König von Italien und begründete das
ostgotische Reich. Er erweiterte und sicherte dessen Grenzen nach
außen, erwarb Sizilien, die Alpenlande und die Provence,
suchte den Frieden unter den germanischen Reichen aufrecht zu
erhalten und ward von denselben als mächtiger Schiedsrichter
hoch geachtet. Im Innern stellte er ebenfalls eine vortreffliche
Staatsordnung her. Seinen Goten wies er ein Dritteil des
Grundbesitzes an und übertrug ihnen den bewaffneten Schutz des
Reichs; für die Italiker ließ er die römische
Verfassung, Gerichtsordnung und Gesetzgebung bestehen und suchte
dieselben überhaupt durch Milde und Gerechtigkeit für
sich zu gewinnen, begünstigte den Ackerbau, errichtete
Getreidemagazine, um der Teurung vorzubeugen, und schmückte
die größern Städie des Landes mit Kirchen,
Palästen, Bädern, Wasserleitungen etc., wovon noch jetzt
Überbleibsel vorhanden sind. Kurz, Italien begann unter seiner
Regierung nach jahrhundertelanger innerer Zerrüttung und
Anfeindung von außen sich aller Segnungen des Friedens wieder
zu erfreuen. Dennoch gelang es ihm nicht, die Goten mit den
Römern zu verschmelzen und die Abneigung des orthodoxen Klerus
gegen die Herrschaft der arianischen Ketzer zu überwinden. Die
Ränke desselben verleiteten ihn 524 zur Hinrichtung der
hochgeachteten Senatoren Boethius und Symmachus. Er starb 26. Aug.
526, ohne einen Sohn zu hinterlassen, daher das Reich auf seinen
zehnjährigen Enkel Athalarich, den Sohn seiner Tochter
Amalasuntha, überging. Auch in der Sage und im Lied lebte T.
als Dietrich von Bern (s. d.) fort, und im deutschen Heldenbuch wie
im Nibelungenlied wird er als einer der hervorragendsten Helden
gefeiert. Vgl. Dahn, Könige der Germanen, Bd. 3 (Würzb.
1866); Deltuf, Théodoric, roi des Ostrogothes (Par. 1869);
Martin, T. der Große bis zur Eroberung Italiens (Freiburg
1889).
Auch Name zweier fränkischer Könige aus dem Geschlecht
der Merowinger: 4) T. I., außerehelicher Sohn Chlodwigs,
folgte diesem 511 im Osten des Frankenreichs (Austrasien) mit der
Hauptstadt Reims, eroberte 530 das Thüringer Reich, dessen
letzten König, Hermanfried, er hinterlistig tötete; starb
534. - 5) T. II., Sohn Childeberts, erbte von diesem 596
Burgundien, entriß seinem Bruder Theodebert 612 Austrasien,
starb aber 613 in Metz.
Theodicee (griech., "Gottesrechtfertigung"), der
religionsphilosophische Versuch des Erweises, daß das
Vorhandensein des Übels und des Bösen vereinbar sei mit
einer weisen, gütigen und gerechten Vorsehung. Für die
älteste T. gilt gewöhnlich das Buch Hiob; aber Begriff
und Aufgabe derselben stehen erst fest seit Leibniz' Schrift "Essai
de théodicée sur la bonté de Dieu, la
liberté de l'homme et l'origine du mal" (Amsterd. 1712).
Vgl. Optimismus.
Theodolít (griech.), ein hauptsächlich zu
geodätischen Zwecken, aber auch in der Astronomie benutztes
Winkelmeßinstrument, besteht aus zwei geteilten Kreisen, von
denen der eine horizontal, der andre vertikal steht. Der
Horizontalkreis ist in fester Verbindung mit dem massiven
dreifüßigen Gestell und kann
635
Theodor - Theodora
mit Hilfe von Stellschrauben und einer Libelle genau horizontal
eingestellt werden. In dem Kreis liegt ein zweiter, um eine
vertikale Achse drehbarer Kreis (Alhidadenkreis), welcher mit
seinem Rand genau an den Horizontalkreis anschließt und an
den Enden eines Durchmessers zwei Nonien zur Zählung der Grade
trägt. Senkrecht darauf steht ein fester Träger für
ein Fernrohr mit Fadenkreuz, welches um eine mit dem
Horizontalkreis parallele Achse drehbar ist, und dessen Visierlinie
von der Alhidadenachse geschnitten wird und auf der Drehachse des
Fernrohrs senkrecht steht. Fest verbunden mit der Drehachse des
Fernrohrs steht der Vertikalkreis, welcher alle Bewegungen des
Fernrohrs mitmacht. Zur Messung derselben dienen zwei feststehende
Nonien, welche an dem Ende eines mit dem Horizontalkreis parallelen
Durchmessers liegen. Nebenbestandteile sind die Klemm- und
Mikrometerschrauben für die grobe und feine Drehung des
Vertikal- und Alhidadenkreises und die Lupen zum Ablesen. Von
diesem einfachen T. unterscheidet sich der Repetitionstheodolit
(MultipliKations-, Repetitionskreis) dadurch, daß er bei
einmaliger Aufstellung und zweimaliger Ablesung ein beliebig
großes Vielfache eines gegebenen Winkels zu messen gestattet,
aus dem man durch Division leicht den einfachen Winkel finden kann.
Man vermindert in dieser Weise den Einfluß der
Beobachtungsfehler auf den gemessenen Winkel. Statt des
Hängekompasses, welcher nur eine geringe Genauigkeit der damit
aufgenommenen Winkel gewährt, wendet man die Grubentheodolite
an, welche sich von den andern nur dadurch unterscheiden, daß
sie in der Regel mit einer Bussole umgeben sind. Über den
magnetischen T. s. Magnetometer. Kleine Theodolite mit
distanzmessendem Fernrohr, mit Bussole und Vertikalkreis werden als
Tachymeter (Schnellmesser, daher Tachymetrie), Tacheometer,
Tachygraphometer in der praktischen Geometrie zum Feldmessen und
Abstecken heutzutage vielfach gebraucht. Vgl. Jordan, Handbuch der
Vermessungskunde (2. Aufl., Stuttg. 1878). Ein ähnliches
Instrument ist der Katersche Kreis. Große Theodolite mit
Vertikalkreisen genauester Konstruktion werden allgemein
Universalinstrumente genannt. Offizinen zu deren Verfertigung:
Breithaupt in Kassel, Ertel in München, Repsold in Hamburg,
Kern in Aarau, Starke in Wien. Das Urbild des Theodolits ist das
von Regiomontan im 15. Jahrh. erfundene Astrolabium, ein
Kreisbogen, in dessen Zentrum behufs Horizontalwinkelmessung eine
Alhidade (Zeiger, Radrus) sich drehte, über deren Endpunkte
man mittels Diopter visierte, dann an der feststehenden
Gradeinteilung den Winkel ablas. Die Alhidade wurde später zum
Alhidadenkreis erweitert, auf welchem sich ein Kippfernrohr mittels
Bocks oder Säule erhob; dieses erhielt dann noch zur
Vertikalmessung den Vertikal- oder Höhenkreis. Das Ganze auf
Stativ befestigt, bildete nun den T.
Theodor (griech., "Gottesgabe" oder "Gottgeweihter"), 1)
König von Corsica, s. Neuhof.
2) (Theodoros) König von Abessinien, eigentlich Kasa,
geboren um 1820 im Land Quara als Sohn des dortigen Statthalters
Hailu Marjam und einer Mutter niederer Abkunft, führte den
Titel Ledsch (Prinz), ward in einem Kloster erzogen, widmete sich
aber dem Kriegerstand, suchte sich an der Spitze einer
Räuberbande im Kampf gegen Moslims und Heiden Ruhm und Macht
zu erwerben, erhielt 1847 vom König von Gondar, Ras Ali, die
Herrschaft über ein großes Gebiet, stürzte darauf
Ras Ali durch den Sieg bei Aischal (1853) und ließ sich,
nachdem er auch den König Ubieh von Tigré seiner
Herrschaft beraubt hatte, 11. Febr. 1855 von dem Abuna Selama in
der Kirche von Deresgeh Marjam unter dem Namen T. zum König
der Könige (Negus Negesti) von Äthiopien salben und
krönen. Er eroberte darauf auch noch das Land der Wollo Galla
und Schoa, mußte aber unaufhörlich gegen Aufstände
in diesen Ländern kampfen, welche seine Kraft aufrieben und
die Durchführung seiner Reformabsichten vereitelten. Dazu
kamen Streitigkeiten mit der mächtigen Geistlichkeit und mit
England, das T. durch Nichtachtung beleidigte. Obwohl T. eigentlich
danach strebte, die europäische Zivilisation in seinem Land
einzuführen, wurde sein Zorn durch Anmaßung und
Taktlosigkeiten der europäischen Konsuln und Missionäre
so gereizt, daß er 1864 alle Europäer ins Gefängnis
warf. Im unaufhörlichen Kampf mit Rebellen und der Ungunst des
Auslandes waren seine Willkür und Grausamkeiten gewachsen. Als
er 1866 den englischen Gesandten Rossam, der eine
Verständigung versuchte, gefangen nahm und seine Auslieferung
verweigerte, landeten die Engländer Ende 1867 bei Massaua und
drangen, von den Rebellen unterstützt, bis zur Bergfeste
Magdala vor, wo T. sie erwartete. Nach einer Niederlage seines
Heers bot er Frieden an, als aber die Engländer forderten, er
solle sich als Gefangener stellen, erschoß er sich selbst
(14. April 1868). Sein Sohn Alemajehu wurde nach England gebracht,
starb hier aber bald. Vgl. Acton, The Abyssinian expedition and the
life and reign of king T. (Lond. 1868).
Theodor Laskaris, Name zweier griech. Kaiser von
Nikäa. 1) T. I., Schwiegersohn des oströmischen Kaisers
Alexios III., flüchtete 1204 nach der Einnahme Konstantinopels
durch die Kreuzfahrer nach Kleinasien und gründete hier das
griechische Kaiserreich von Nikäa, welches er in tapfern
Kämpfen gegen Lateiner und Seldschukken glücklich
behauptete. Er starb 1222.
2) T. II., Enkel des vorigen, Sohn des Kaisers Johann Vatatzes,
folgte demselben 1254 auf dem Thron, kämpfte glücklich
gegen die Bulgaren und den abtrünnigen Despoten von Epirus,
starb aber schon 1258.
Theodora, 1) Gemahlin des oströmischen Kaisers
Justinian I., Tochter eines Zirkusbeamten, Acacius von Cypern, war
früher Schauspielerin, Tänzerin und Hetäre, dann die
Geliebte und endlich die Gemahlin des Justinianus. Als derselbe 527
den byzantinischen Thron bestieg, erhielt auch sie die Krönung
vom Patriarchen und die Würde als Mitherrscherin. Sie
übte eine bedeutende Gewalt über den Kaiser und gab
vielfache Beweise von Klugheit und Mut, aber auch von Hochmut,
Herrschsucht und rachsüchtiger Grausamkeit. Bei dem 532 in
Konstantinopel ausgebrochenen Nika-Aufstand rettete sie ihren
Gemahl, welcher den Mut verloren hatte und fliehen wollte, durch
unerschrockenes Auftreten. Ihre vertraute Freundin war die
sittenlose Gemahlin Belisars, Antonina, weswegen sie Belisar
begünstigte. Durch äußere Frömmigkeit und
kirchliche Rechtgläubigkeit, durch Spenden und Stiftungen an
Kirchen, Klöster und Spitäler suchte sie ihren
frühern Lebenswandel zu sühnen. Sie starb, 40 Jahre alt,
548 an einer schrecklichen Krankheit. Prokopios hat in der
"Geheimgeschichte" ("Anecdota") ein abschreckendes Bild ihrer
Sittenlosigkeit gegeben, welches die neuere Kritik aber als ein
sehr übertriebenes erkannt hat. Vgl. Debidour,
L'impératrice T. (Par. 1885).
2) Gemahlin des oströmischen Kaisers Theophilos, nach
dessen Tod 842 Regentin für ihren unmündigen Sohn Michael
III. Schon bei Lebzeiten ihres bilder-
636
Theodoretus - Theodotion.
feindlichen Gemahls heimlich dem Bilderdienst zugewandt, stellte
sie nach ihrer Thronbesteigung denselben wieder her, entsetzte den
widerstrebenden Patriarchen Johannes und erhob Methodios an seine
Stelle. Sie wurde 856 auf Veranstalten ihres Bruders Bardas von
ihrem Sohn in ein Kloster geschickt, später aber aus demselben
wieder entlassen und überlebte noch den Tod Michaels
(867).
3) Tochter des oströmischen Kaisers Konstantin VIII., wurde
1042 nach dem Sturz Michaels V. mit ihrer Schwester Zoe auf den
Kaiserthron erhoben, führte dann nach dem Tode der letztern
und des dritten Gemahls derselben, Konstantin VII. Monomachos, 1054
bis 1056 allein die Regierung. Mit ihr erlosch die von Basilius I.
begründete makedonische Dynastie.
4) Römerin, Gemahlin des Konsuls Theophylactus, schön,
klug und ehrgeizig, aber sittenlos, Mutter der Marozia und der
jüngern Theodora, stand mit diesen an der Spitze der
patrizischen Partei und beherrschte mehrere Jahre Rom und den
päpstlichen Stuhl, auf den sie 914 Johann X., ihren
frühern Geliebten, erhob.
Theodoretus, Kirchenhistoriker, geboren zu Antiochia,
ward 420 Bischof in Cyrus am Euphrat, als Vertreter der
antiochenischen Schule in den nestorianischen und eutychianischen
Streitigkeiten zwar auf der sogen. Räubersynode in ein Kloster
verbannt, vom Konzil zu Chalcedon aber als rechtgläubig
anerkannt und starb 457. Seine Schriften wurden von Schulze und
Nösselt (Halle 1769, 5 Bde.) herausgegeben, die wichtigste
darunter, die "Historia ecclesiastica", welche die Zeit von 322 bis
428 umfaßt, von Gaisford (Oxf. 1854). Vgl. Binder,
Études sur Théodorète (Genf 1844); Bertram,
Theodoreti doctrina christologica (Hildesh. 1883).
Theodorus von Mopsuëstia, griech. Kirchenvater, aus
Antiochia gebürtlg, war anfänglich Mönch, seit 393
Bischof von Mopsuestia in Kilikien, wo er 428 starb. Er war der
erste Exeget seiner Zeit, zugleich der unbefangenste im ganzen
kirchlichen Altertum. In der morgenländischen Kirche ward er
als Anhänger des Pelagianismus sowie des Nestorianismus auf
dem fünften ökumenischen Konzil als Ketzer verdammt. Die
syrischen Fragmente seiner Schriften gab Sachau (Leipz. 1869)
heraus, die exegetischen Schriften Fritzsche (Zürich 1847) und
Swete (Cambridge 1880 bis 1882, 2 Bde.). Vgl. Kihn, T. und Junilius
(Freiburg 1880).
Theodosia, Stadt, s. Feodosia.
Theodosianus Codex (lat.), vom Kaiser Theodosius
veranstaltete und 438 als Gesetzbuch in 16 Büchern publizierte
Sammlung von Gesetzen, welche die Verordnungen von Konstantins d.
Gr. Zeit bis auf die seinige umfassen. Gute ältere Ausgaben
sind die von Gothofredus (Leid. 1665) und Ritter (Leipz. 1736-45),
die besten neuern lieferten Hänel (Bonn 1837-42) und
Krüger (Berl. 1880).
Theodosius, 1) T. I., der Große, röm. Kaiser,
geb. 346 n. Chr., war der Sohn des aus Spanien stammenden Flavius
T., der unter Valentinian I. in Britannien und Afrika dem Reich als
Feldherr bedeutende Dienste geleistet hatte, aber 376 in Ungnade
fiel und hingerichtet wurde. Der Sohn hatte sich schon bei
Lebzeiten seines Vaters ebenfalls als Feldherr ausgezeichnet, zog
sich aber nach dessen Hinrichtung auf sein Landgut in Spanien
zurück, wo er in völliger Verborgenheit sich ganz den
Geschäften der Landwirtschaft widmete. Als aber die Goten die
Donau überschritten und 378 in der Schlacht bei Adrianopel den
Kaiser des Ostens, Valens, geschlagen und getötet und fast das
ganze Heer desselben vernichtet hatten, wurde er 379 von Gratianus
(s. d.), dem Kaiser des Westens, berufen, um als Kaiser des Ostens
das Reich gegen die eindringenden Feinde zu verteidigen. Er brachte
die Goten teils durch glückliche Unternehmungen, teils durch
Unterhandlungen dahin, daß sie sich 382 unterwarfen, worauf
er ihnen feste Wohnsitze in Thrakien und Dacien anwies und einen
Teil derselben in sein Heer ausnahm. Außer gegen
auswärtige Feinde hatte er aber auch gegen innere Krieg zu
führen. Als Maximus (s. d. 3), welcher bereits Gratian
gestürzt hatte, auch Valentinian H. bedrohte, zog er 388 gegen
Maximus und brachte ihm bei Siscia eine völlige Niederlage
bei, und 394 unternahm er den Krieg gegen Arbogastes (s. d.),
welcher, nachdem wahrscheinlich auf sein Anstiften Valentinian II.
ermordet worden, Eugenius als Kaiser des Westens eingesetzt hatte;
auch dieser wurde bei Aquileja völlig geschlagen und fand bald
darauf den Tod. Auf diese Art wurde das ganze Reich zum letztenmal
unter der Herrschaft Eines Kaisers vereinigt. Im Innern war T.
besonders bemüht, die Arianer zu unterdrücken und dem
Heidentum ein Ende zu machen, weshalb er 381 auf dem Konzil zu
Konstantinopel das Nicäische Glaubensbekenntnis für
allein gültig erklären ließ und 392 durch ein Edikt
den heidnischen Kultus völlig verbot. Als er 390 die Stadt
Thessalonich wegen eines Aufstandes durch ein grauenhaftes Blutbad
züchtigte, mußte er sich vor Bischof Ambrosius von
Mailand einer Kirchenbuße unterwerfen. Er starb 17. Jan. 395
in Mailand. Nach seinem Tod wurde das Reich unter seine beiden
Söhne Arcadius und Honorius geteilt, die er schon bei seinen
Lebzeiten zu Mitkaisern ernannt hatte. Vgl. Güldenpenning und
Ifland, Kaiser T. d. Gr. (Halle 1878).
2) T. II., der jüngere, Sohn des Arcadius und der Eudoxia,
Kaiser des oströmischen Reichs, geb. 401, folgte seinem Vater
408 und stand bis 414 unter Vormundschaft des Präfekten
Anthemius, worauf seine Schwester Pulcheria für ihn bis an
seinen Tod die Herrschaft führte; er selbst verbrachte seine
Zeit mit Jagen und andern nutzlosen Beschäftigungen.
Während seiner Herrschaft wurde ein Krieg mit Persien
geführt, welcher 422 durch einen nicht unrühmlichen
Frieden beendigt ward; dagegen wurde das Reich seit 441 durch die
Einfälle der Hunnen unter Attila schwer heimgesucht, denen 447
ein großer Strich Landes südlich der Donau abgetreten
und, außer einer Summe von 6000 Pfd. Goldes, ein
jährlicher Tribut bewilligt werden mußte. An den
theologischen Streitigketten nahm T. eifrig teil. In dem Streit
über die natürliche Geburt Christi erklärte er sich
unter Pulcherias Einfluß für die Lehre Cyrillus' und
schickte den Patriarchen Nestorius in die Verbannung; später
wurde er für die Lehre des Entyches gewonnen und geriet
darüber in ein Zerwürfnis mit Pulcheria, welche 449 auf
kurze Zeit vom Hof entfernt wurde. Noch ist zu bemerken, daß
unter ihm 438 der Codex Theodosianus (s. d.), eine Sammlung der
kaiserlichen Edikte von Konstantin d. Gr. bis auf die Gegenwart,
veröffentlicht wurde. T. verheiratete sich 421 mit Athenais
(s. d.), die nach der Taufe den Namen Eudotia erhielt, sich aber
441 von ihm trennte. Er starb 450. Vgl. Güldenpenning,
Geschichte des oströmischen Reichs unter den Kaisern Arcadius
und T. (Halle 1885).
Theodotion, Kirchenschriftsteller des 2. Jahrh.,
über dessen Person und Heimat Widersprechendes berichtet wird,
lieferte gleich seinem Zeitgenossen Aquila (s. d. 1) eine
griechische Übersetzung des Al-
637
Theodulie - Theologie.
ten Testaments, welche von Origenes in die "Hexapla" (s. d.)
aufgenommen wurde.
Theodulie (griech.), Gottesdienst.
Theognis, griech. Elegiker, zwischen 540 und 470 v. Chr.,
wurde als Anhänger der Aristokratie aus seiner Vaterstadt
Megara vertrieben und kehrte erst in spätern Jahren in die
Heimat zurück. Aus den Überresten seiner Elegien ersieht
man, daß dieselben mit seinen politischen Erlebnissen in
innigstem Zusammenhang standen. Den Untergang derselben hat ihr
außerordentlicher Reichtum an Sentenzen herbeigeführt,
die man schon frühzeitig auszog und zusammenstellte, um sie
für den Jugendunterricht zu verwerten, wie dies namentlich in
Athen geschah. Wir besitzen unter dem Namen des T. eine planlose,
oft nach bloßen Stichwortern geordnete Sammlung von allerlei
distichischen Sprüchen und Ermahnungen in 1389 Versen, unter
denen sich auch manches dem Dichter nicht Gehörige findet.
Ausgaben besorgten Bekker (Berl. 1827), Welcker (Frankf. 1826),
Orelli (Zürich 1840), Bergk (in "Poetae lyrici graeci"),
Ziegler (2. Ausg., Tübing. 1880) und Sitzler (Heidelb. 1880);
Übersetzungen liegen vor von Weber (Bonn 1834) und Binder
(Stuttg. 1860).
Theognosie (griech.), Gotteserkenntnis.
Theogonie (griech.), die Lehre von der Abstammung der
Götter, wie sie in mehreren alten Dichtungen der Griechen
niedergelegt war. Erhalten hat sich davon nur die T. des
Hesiod.
Theok, Längenmaß, s. Thuok.
Theokratie (griech.), "Gottesherrschaft", Staatswesen,
bei welchem die Gottheit selbst als oberster Regent gedacht ist;
zunächst eine dem Josephus (gegen Apion, 2,16) entlehnte
Bezeichnung des Mosaismus, sofern hier der im Gesetz und durch den
Mund der Richter, Priester und Propheten sich kundgebende Wille
Gottes die oberste Norm für das Gemeinwesen war. Ähnliche
Vorstellungen sind übrigens dem antiken Staatswesen
überhaupt eigentümlich, und ihre großartigste
Verwirklichung fand die Idee eines "Gottesstaats" in der
mittelalterlichen Kirche.
Theokritos, der Schöpfer und Hauptvertreter der
bukolischen Poesie der Griechen, aus Syrakus oder Kos
gebürtig, blühte um 270 v. Chr. und lebte teils in
Alexandria, teils zu Syrakus. Unter seinem Namen besitzen wir
außer einer Anzahl von Epigrammen 32 größere
Gedichte, sogen. Idylle. Die meisten derselben haben eine
dramatische Form und sind teils künstlerische Nachahmungen des
Wechselgesangs der sizilischen Hirten, teils stellen sie Szenen des
gemeinen Lebens dar, während andre mythologische
Erzählungen enthalten, noch andre rein lyrischer Natur sind.
Schon bei den Alten standen sie wegen des echten Dichtergeistes,
der lebendigen und doch prunklosen Darstellung der Natur in hohem
Ansehen. Wie die Form, ist auch die Sprache meist die epische,
letztere jedoch zur Erhöhung des volkstümlichen Eindrucks
in höchst kunstvoller Weise mit Formen des auf Sizilien
heimischen dorischen Dialekts gemischt. Ausgaben von Valckenaer
(mit Bion und Moschos, Leid. 1779, 1810), Meineke (ebenso, zuletzt
Berl. 1856), Ahrens (ebenso, Leipz. 1855-59, 2 Bde.; Textausg.,
das. 1856), Ziegler (2. Aufl., Tübing. 1867), Fritzsche
(3.Aufl., Leipz. 1881); Übersetzungen von Voß (2.Aufl.,
Tübing. 1815), Eberz (Frankf. 1858), F. Rückert (im
"Nachlaß", Leipz. 1867), Mörike und Notter (2. Aufl.,
Berl. 1882). Ein "Lexicon Theocriteum" bearbeitete Rumpel (Leipz.
1879).
Theolatrie (griech.), Gottesdienst.
Theologia deutsch, s. Deutsche Theologia.
Theologie (griech.), bei den Griechen die Lehre von den
Göttern und göttlichen Dingen. Daher nannten die Griechen
denjenigen einen Theologos, welcher über das Wesen und die
Geschichte der Götter Auskunft zu erteilen vermochte. So
führen diesen Namen der Syrer Pherekydes und der Kreter
Epimenides. Die alte Kirche nannte Theologen die Verteidiger der
Gottheit des Logos, wie den vierten Evangelisten und Gregor von
Nazianz. Erst die Scholastik versteht unter T. den Komplex der
christlichen Lehre, und so spricht man noch heute im Unterschied
von der gesamten Religionswissenschaft von T. im Sinn einer
positiven Wissenschaft, welche einer bestimmten geschichtlichen
Religion gilt. Insonderheit ist die christliche T. die
Fakultätswissenschaft der Diener der Kirche, wie die
Jurisprudenz diejenige der Staatsdiener. Daraus ergibt sich teils
der wesentliche Unterschied der T. von dem Begriff der Religion (s.
d.), teils ihr nahes Verhältnis zur Philosophie (s.
Religionsphilosophie). Fast jedes philosophische System ist auf die
T. angewendet worden, und in langen Perioden der Geschichte bildete
die T. den alles bedingenden Hintergrund für die Geschichte
der Philosophie. Formell ist man seit Schleiermacher ziemlich
allgemein darin einverstanden, daß in der T. eine Reihe von
Disziplinen, welche der Sache nach in die Gebiete der Geschichte,
der Philosophie und der Philologie gehören, im Interesse der
Kirchenleitung in eine, jeder dieser Disziplinen an sich fremde,
Association versetzt wurde. Da es sonach bloß ein praktischer
Gesichtspunkt ist, welcher als zusammenhaltende Klammer für
die sonst mannigfach divergierenden Beschäftigungen der
"theologischen Fakultät" dient, würde an sich nichts im
Weg stehen, ihre einzelnen Elemente in die ihnen natürliche
Verbindung zurücktreten zu lassen, wofern nicht ein leider oft
allzu wenig erkanntes Interesse des Staats selbst es erheischte,
die Kirche durch eine von ihm, nicht von ihr zu besetzende
theologische Fakultät in dem lebendigen und befruchtenden
Zusammenhang mit dem sich entwickelnden wissenschaftlichen,
künstlerischen und politischen Bewußtsein der Zeit zu
erhalten oder, wo dieser Zusammenhang verloren gegangen ist, ihn
wiederherzustellen. Im übrigen unterscheidet man
herkömmlicherweise innerhalb der T. als christlicher (bez.
auch jüdischer) Religionswissenschaft die Hauptgebiete der
historischen, systematischen und praktischen T. Die historische T.
hat zum Gegenstand den Ursprung, den weitern Fortgang und die
gegenwärtige Lage der Kirche und zerfällt daher wieder in
die exegetische, kirchenhistorische und statistische T. Unter der
erstern begreift man alles das, was auf das Bibelstudium oder auf
die Erklärung der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments
Bezug hat. Sie umfaßt außer der eigentlichen Exegese
auch die dazu nötigen Hilfswissenschaften. Diese sind: die
biblische Philologie, die Einleitungswissenschaft oder Isagogik und
die Hermeneutik. An die Quellen der Offenbarung reiht sich der
Inhalt derselben als eigentliche biblische Geschichte und
Archäologie und als biblische Glaubens- und Sittenlehre
(biblische T.) und wieder an die biblische Geschichte speziell die
historische T. an, welche die Geschichte der Kirche seit ihrer
Entstehung im nachapostolischen Zeitalter bis auf die neueste Zeit
fortsetzt. Einige Zweige der Kirchengeschichte sind besonders
bearbeitet worden, so: die Dogmengeschichte, die Symbolik, die
Patristik, die kirchliche Archäologie, die Geschichte des
Kultus und der Kirchenverfassung, oft auch der christ-
638
Theomantie - Theophano.
lichen Kunst und Sitte in den ersten Jahrhunderten, die
Darstellung des christlichen Lebens in den verschiedenen
Zeitaltern, die Missionsgeschichte und die Ketzergeschichte. Die
kirchliche Statistik endlich ist die Darstellung des
gegenwärtigen Zustandes der äußern und innern Lage
der Kirche in den verschiedenen christlichen Ländern. Unter
der systematischen T. begreift man die wissenschaftliche
Darstellung der christlichen Lehre, sowohl nach dem Glauben als
nach dem ihm entsprechenden sittlichen Leben. Die Dogmatik (s. d.)
oder Glaubenslehre bildet eigentlich den Mittelpunkt der T., indem
in ihr die Resultate der exegetischen und historischen T. zu einem
geordneten Ganzen verbunden werden. Als besondere Bestandteile
gehören ihr an: die Apologetik, die Polemik und deren
Gegensatz, die Irenik. Die christliche Moral oder Sittenlehre hatte
früher als besondere Disziplinen neben sich die Kasuistik und
die Asketik. Die praktische T. würde, falls sich die oben
angeregte Auseinandersetzung der theologischen mit der
philosophischen Fakultät vollziehen ließe, ganz
außerhalb der Universitätsstudien fallen und Sache
kirchlicher Seminare werden, sofern sie die Theorie von
Kirchenleitung und Kirchendienst darstellt. Auch sie umfaßt
mehrere besondere Disziplinen, namentlich die Katechetik, Liturgik,
Homiletik, Pastoraltheorie und unter Umständen das
Kirchenrecht; wir verweisen auf die betreffenden Artikel.
Theologische Encyklopädie heißt diejenige Disziplin,
welche den gesamten Organismus der theologischen Wissenschaften
darzustellen und in denselben einzuführen hat. Die neuesten
Werke sind: Hofmann, Encyklopädie der T. (hrsg. von Bestmann,
Nördling. 1879; Hagenbach, Encyklopädie und Methodologie
der theologischen Wissenschaften (11. Aufl., hrsg. von Kautzsch,
Leipz. 1884); Rothe, Theologische Encyklopädie (hrsg. von
Ruppelius, Wittenb. 1880); Räbiger, Theologik oder
Encyklopädie der T. (Leipz. 1880); Zöckler u. a.,
Handbuch der theologischen Wissenschaften (3. Aufl., Nördling.
1889 ff., 4 Bde.). Lexikalische Hilfsmittel: Herzogs
"Realencyklopädie für protestantische T. und Kirche" (2.
Aufl., Leipz. 1876-88, 18 Bde.); Holtzmann und Zöpffel,
Lexikon für T. und Kirchenwesen (2. Aufl., Braunschw. 1888);
Meusels "Kirchliches Handlexikon" (Lpz. 1885 ff.); Zellers
"Theologisches Handwörterbuch" (Kalw 1889 ff.);
katholischerseits: Wetzer und Weltes umfangreiches "Kirchenlexikon"
(2. Aufl. von Hergenröther und Kaulen, Freiburg 1880 ff.) und
Schäflers "Handlexikon der katholischen T." (Regensb. 1880-88,
3 Bde.).
In den ersten Jahrhunderten war die T. wesentlich Exegese,
zuerst des Alten, dann auch des Neuen Testaments; in dieser
Beziehung unterschieden sich namentlich die Alexandrinische (s. d.)
und die Antiochenische Schule (s. d.). Seit dem 3. und noch mehr
seit dem 4. Jahrh. trat die Dogmatik in den Mittelpunkt der T.,
während zugleich durch den herrschenden Gebrauch, auf Konzilen
Glaubensgesetze aufzustellen, die Freiheit der theologischen
Forschung gehemmt wurde. Später trat die Macht der Päpste
an die Stelle der Konzile. Nachdem so das Dogma durch die
Hierarchie festgestellt war, fand die scholastische T. (s.
Scholastiker) ihre Aufgabe in der Durchbildung des Lehrbegriffs im
einzelnen, namentlich aber in dem Nachweis seines innern
Zusammenhanges und in der philosophischen Begründung der
Kirchenlehre. Erst gegen Ende des 14. Jahrh. beginnt eine
durchgreifende, auf das Wesen des Christentums zurückgehende
Reformation der T. mit Wiclef, die durch Huß, aber auch durch
seine Gegner, die nominalistischen Theologen Frankreichs,
fortgesetzt, durch die Reformatoren vollendet und praktisch ins
Werk gesetzt wurde. Von diesem Zeitpunkt an durchläuft die
theologische Wissenschaft, als die Schöpferin einer neuen
Kirche, neue Phasen. Die Reformation brachte der evangelischen T.
zunächst Freiheit der Forschung dadurch, daß sie die
Herrschaft und die Macht der bloßen Autorität über
die Geister brach und die Heilige Schrift als alleinige
Erkenntnisquelle hinstellte. Im Gegensatz gegen die neue Fessel,
als welche nun der Schriftbuchstabe in der zu einer zweiten
Scholastik erstarrten protestantischen T. des 17. Jahrh. auftrat,
regte sich mit Erfolg das teils philosophisch fortgeschrittenere,
teils historisch geschultere Bewußtsein des 18. Jahrh.,
während das 19., besonders in Schleiermacher, mit der
philosophischen und historischen Unbefangenheit auch wieder eine
tiefere Würdigung des Wesens der Religion und der Interessen
der Kirche zu verbinden wußte. Gleichwohl ließen die
restaurativen Tendenzen, welche zeitweilig im Staate, dauernd in
der Kirche die Herrschaft gewannen, es kaum zur Bildung einer
eigentlich freien, die Grundlage und Methode der übrigen
Wissenschaften teilenden T. kommen. Vgl. Holtzmann, Über
Fortschritte und Rückschritte der T. unsers Jahrhunderts
(Straßb. 1878); Dorner, Geschichte der protestantischen T.
(Münch. 1867); Werner, Geschichte der katholischen T. (2.
Aufl., das. 1889).
Theomantie (griech.), im Altertum die Wahrsagung
zukünftiger Dinge durch göttliche Eingebung, die weder an
einen bestimmten Ort noch an eine bestimmte Zeit geknüpft war,
meist bei Privatangelegenheiten stattfand und sich vom Orakel (s.
d.) ebenso wie von der Weissagung aus Opfern unterschied.
Theon, 1) T. von Smyrna, griech. Philosoph um die Mitte
des 2. Jahrh. n. Chr., verfaßte ein für die Kenntnis der
altgriechischen Arithmetik wichtiges Werk über die zum
Verständnis des Platon nötigen mathematischen,
musikalischen und astronomischen Sätze (hrsg. von Hiller,
Leipz. 1878).
2) T. von Alexandria, griech. Mathematiker und Astronom, gegen
Ende des 4. Jahrh. n. Chr. in Alexandria lebend, Vater der Hypatia
(s. d.), schrieb unter anderm Kommentare zu Eukleides und
Ptolemäos. Seine Schriften gab Halma (Par. 1821-23, 2 Bde.)
mit französischer Übersetzung heraus.
3) Älios, aus Alexandria, griech. Rhetor des 5. Jahrh. n.
Chr., ist Verfasser einer trefflichen Anleitung, sogenannter
"Progymnasmata" (hrsg. von Finckh, Stuttg. 1834, und in den
"Rhetores graeci" von Walz und von Spengel).
Theophanes, mit dem Beinamen Isauricus oder Confessor,
byzantin. Geschichtschreiber, geb. 758 zu Konstantinopel,
bekleidete daselbst mehrere Hofämter, ward dann Vorsteher
eines Klosters in Bithynien, aber als Bilderverehrer von Kaiser Leo
III. verbannt und starb 817 in Samothrake. Er verfaßte eine
"Chronographia" (hrsg. von Classen und Becker, Bonn 1839-41, 2
Bde.; von Boor, Leipz. 1883-85, 2 Bde.).
Theophanie (griech., "Gotteserscheinung"), in der
christlichen Kirche s. v. w. Epiphania (s. d.).
Theophano (Theophania), Kaiserin, Tochter des
oström. Kaisers Romanos II. und der berüchtigten
Theophano, welche 963 Romanos und 969 ihren zweiten Gemahl,
Nikephoros Phokas, ermorden ließ, geb. 960, ward 972 mit dem
jungen Kaiser Otto II. in Rom vermählt. Sie war eine Frau von
hoher Schönheit, starkem Geist und feiner Bildung,
erlangte
639
Theophilanthropen - Theorie.
bald nach der Thronbesteigung ihres Gemahls (973) großen
Einfluß auf denselben, dem sie 980 den spätern Kaiser
Otto III. gebar, begleitete ihn 981 nach Italien und kehrte nach
Ottos II. Tod 984 nach Deutschland zurück. Als
Vormünderin ihres jungen Sohns und Reichsregentin anerkannt,
führte sie die Regierung mit Kraft und Umsicht und erzog ihren
Sohn in griechischer Bildung, starb aber schon 15. Juni 991 in
Nimwegen. Vgl. Moltmann, Theophano (Schwerin 1878).
Theophilanthropen (Theanthropophilen, griech., "Gottes-
und Menschenfreunde"), deistische Religionsgesellschaft in
Frankreich, welche sich 1796 in Paris zur Erhaltung der Religion
bildete und vom Direktorium zehn Pfarrkirchen in Paris
eingeräumt erhielt, aber schon 1802 erlosch. Vgl.
Grégoire, Geschichte des Theophilanthropismus (deutsch,
Hannov. 1806).
Theophilos, 1) oström. Kaiser, Sohn Michaels II.,
schon von diesem zum Mitkaiser erhoben, bestieg nach dem Tode
desselben im Oktober 829 den Thron. Er war ein talentvoller,
hochgebildeter Fürst, welcher strenge Gerechtigkeit übte,
die Wissenschaften und Künste förderte, die Hauptstadt
mit prächtigen Bauten schmückte und ihre Festungswerke
verstärkte. Er war ein eifriger Bilderfeind und verfolgte die
Verehrer derselben, namentlich die halsstarrigen Mönche. Er
kämpfte tapfer gegen die Araber, erlitt aber mehrere
Niederlagen und konnte nicht verhindern, daß 838 der Kalif
Mutassim auf einem großen Heereszug seine Heimatstadt Amorion
in Phrygien eroberte und zerstörte. Er starb 20. Jan. 842 und
hinterließ die Regierung seinem unmündigen Sohn Michael
III. unter der Vormundschaft seiner Gemahlin Theodora.
2) Ein Heidenchrist, seit 168 Bischof von Antiochia, wo er 180
und 181 die drei Bücher an den Autolykos schrieb, eine
Apologie des Christentums (hrsg. von Otto im "Corpus apologetarum",
Bd. 8, Jena 1861).
3) Nach der Legende Bistumsverweser zu Adana in Kilikien,
verschrieb sich, infolge von Verleumdungen seines Amtes entsetzt,
dem Teufel und ward hieraus restituiert. Von Gewissensbissen
gefoltert, wandte er sich später an die heilige Jungfrau,
erhielt von dieser die verhängnisvolle Handschrift zurück
und starb drei Tage darauf. Diese schon im 10. Jahrh. vorhandene
Legende, eine Vorläuferin der Faustsage, ward bis in das 16.
Jahrh. herab dichterisch behandelt. Bearbeitungen wurden
herausgegeben unter andern von Blommaert (eine niederländische
metrische des 14. Jahrh., Gent 1836); von Pfeiffer (Stuttg. 1846)
aus den Marienlegenden des Verfassers des alten Passionals; von
Ettmüller (Quedlinb. 1849); von Hoffmann von Fallersleben
(Hannov. 1853) nach dramatischer Bearbeitung in niederdeutscher
Sprache aus dem 14. und 15. Jahrh.; von W. Meyer ("Radewins Gedicht
über T.", Münch. 1873). Vgl. Sommer, De Theophili cum
diabolo foedere (Berl. 1844); Wedde, T., das Faustdrama des
deutschen Mittelalters (Hamb. 1888).
Theophrastos, griech. Philosoph, geb. 390 v. Chr. zu
Eresos auf der Insel Lesbos, war in Athen erst Schüler des
Platon, dann des Aristoteles und ward von diesem zum Erben seiner
Bibliothek und zu seinem Nachfolger in der Leitung der
peripatetischen Schule ernannt. Er starb in Athen, 85, nach andern
106 Jahre alt. In seinen Reden zeigte T. so viel Würde und
Anmut, daß Aristoteles seinen eigentlichen Namen Tyrtamos in
T., d. h. göttlicher Redner, umgewandelt haben soll. T. ist
der Verfasser von etwa 200 Schriften dialektischen, metaphysischen,
moralischen und physikalischen Inhalts, von denen einige
naturhistorische und philosophische, zum Teil Fragmente aus
größern Werken, erhalten sind. Die bekanntesten sind:
"Ethici characteres" (hrsg. von Foß, Leipz. 1858, und
Petersen, das. 1859; deutsch von Schnitzer, Stuttg. 1858; von
Binder, das. 1864; vgl. La Bruyère) und die "Naturgeschichte
der Gewächse" (hrsg. von Schneider, Leipz. 1818-21, 5 Bde.;
deutsch von Sprengel, Altona 1822, 2 Bde.). Eine Gesamtausgabe des
noch Vorhandenen von seinen Schriften besorgte Wimmer (Leipz.
1854-62, 3 Bde., und Par. 1866, 1 Bd.). Zur Entwickelung der
Philosophie scheint T. nicht viel beigetragen, sondern die
Aristotelische Philosophie nur fortgepflanzt und erläutert
sowie durch Zusätze zur Logik und Politik erweitert zu haben.
Vgl. Kirchner, Die botanischen Schriften des T. (Leipz. 1874).
Theophylaktos, Erzbischof von Achrida in der Bulgarei,
gest. 1107, hat katenenartige Kommentare zum größten
Teil des Neuen Testaments verfaßt; im Streit mit der
abendländischen Kirche nahm er eine versöhnliche Stellung
ein. Auch hinterließ er eine Schrift über
Prinzenerziehung und 130 Briefe. Seine Werke erschienen Venedig
1754-63, 4 Bde.
Theopneustie (griech.), s. v. w. Inspiration (s. d.).
Theopompos, 1) griech. Historiker, von Chios,
Schüler des Isokrates, lebte im 4. Jahrh. v. Chr. und starb,
aus Chios verbannt, in Ägypten. Er schrieb eine "Hellenika"
betitelte Fortsetzung von des Thukydides Geschichtswerk bis zur
Seeschlacht bei Knidos (394 v. Chr.) und "Philippika", eine
allgemeine Geschichte seiner Zeit von Ol. 105, 1 (360 v. Chr.) an.
Herausgegeben sind die Fragmente derselben von Wichers (Leid.
1829), Theiß (Nordh. 1837) und Müller in den
"Historicorum graecorum fragmenta" (Bd. 1, Par. 1841). Vgl. Pflugk,
De Theopompi vita et scriptis (Berl. 1827).
2) Griech. Komödiendichter, ein jüngerer Zeitgenosse
des Aristophanes, dichtete noch um 370 v. Chr. Von seinen 24
Dramen, von denen die spätern den Übergang von der alten
zur mittlern Komödie anbahnten, sind nur geringe
Bruchstücke erhalten (gesammelt in Meinekes "Fragmenta
comicorum graecorum", Bd. 2, Berl. 1840). Vgl. Bünger,
Theopompea (Straßb. 1874).
Theorbe (ital. Tiorba, Tuorba), ein veraltetes, im
16.-18. Jahrh. sehr angesehenes, zur Familie der Laute
gehöriges Saiteninstrument. Vgl. Laute.
Theorem (griech.), s. v. w. Lehrsatz (s. d.).
Theorie (griech.), eigentlich das Betrachten, Beschauen,
vorzugsweise aber das geistige Anschauen und Untersuchen, die
daraus hervorgehende wissenschaftliche Erkenntnis und Entwickelung
der einzelnen Erscheinungen einer Wissenschaft in ihrem innern
Zusammenhang. Jeder Kreis von Gedankenobjekten hat demnach seine
besondere T., welche darauf hinausläuft, aus allgemeinen
Gesetzen, welche nicht erfahren, sondern denkend gefunden werden,
die Mannigfaltigkeit der auf irgend eine Weise erkannten
Einzelheiten in ihrem Kausalnexus zu begreifen. Jede auf Erfahrung
gegründete Wissenschaft kommt von selbst, je mehr der innere
Zusammenhang klarer vor die Augen tritt, zu Theorien, welche umso
vollkommener aufgestellt werden können, je mehr die Masse der
Erscheinungen Anhaltspunkte für die wissenschaftliche
Untersuchung darbietet. Bei der Endlichkeit des menschlichen
Geistes behalten alle Theorien ihre Mängel; die beste wird die
sein, welche am einfachsten und ungezwungensten die Ergebnisse der
Erfahrung aus einem oder einigen Grundprinzipien herzuleiten im
640
Theorikon - Therapie.
stande ist. Im gemeinen Leben pflegt man unter T. im Gegensatz
zur Praxis die bloße Erkenntnis einer Wissenschaft ohne
Rücksicht auf Anwendung derselben zu besondern Zwecken zu
verstehen (danach theoretisch, s. v. w. der T. angehörig,
wissenschaftlich). In dieser Beziehung behauptet man oft, daß
etwas in der T. wahr, für die Praxis aber unbrauchbar sei,
welche Behauptung insofern gegründet sein kann, als die
Gedanken nach des Dichters Wort "leicht bei einander wohnen", die
Sachen aber, deren die That zur Verkörperung des Gedankens
bedarf, "sich hart im Raume stoßen". - Bei den Griechen
hießen Theorien insbesondere auch die Festgesandtschaften,
welche von den einzelnen Staaten zu den großen Nationalfesten
sowie zu den Festen befreundeter Staaten geschickt wurden, um sich
offiziell an der Feier zu beteiligen. Diese Festgesandtschaften
waren Ehrengäste des betreffenden Staats.
Theorikon (griech.), bei den alten Athenern das
Theatergeld, eine seit Perikles aus der Staatskasse an die
ärmern Bürger gezahlte Spende von zwei Obolen (25
Pfennig), um ihnen den Theaterbesuch zu ermöglichen; 338 v.
Chr., kurz vor der Schlacht bei Chäroneia, abgeschafft.
Theosophie (griech.), die tiefere Erkenntnis Gottes und
göttlicher Dinge; dann im Unterschied von der Theologie und
Philosophie das angeblich höhere Wissen von Gott und Welt,
welches der Mystik (s. d.) infolge unmittelbarer Anschauung und
göttlicher Erleuchtung zu teil werden soll. T. ist daher ein
Gesamtname für alle mystischen Systeme, insonderheit auch der
auf den Neuplatonismus zurückgehenden pantheistischen. Der
neuern Zeit gehören an: Jakob Böhme, V. Weigel,
Swedenborg, Ötinger, Saint-Martin, F. v. Baader.
Theotókos (griech., russ. Bogoroditza),
"Gottgebärerin", d. h. Maria, die Mutter Jesu, eine
Bezeichnung, welche die Griechisch-Gläubigen sehr lieben.
Theoxenien (griech.), Götterbewirtung, ein im alten
Griechenland in manchen Gegenden gefeiertes Fest, an welchem neben
der Hauptgottheit des Lokalkultus auch alle übrigen
Götter gleichsam als Gäste derselben gefeiert wurden.
Eine solche Feier fand namentlich zu Delphi in dem danach benannten
Monat Theoxenios (August) im Namen des Apollon statt. Über die
Art derselben ist näheres nicht bekannt.
Thera, Insel, s. Santorin.
Theramenes, Athener, Adoptivsohn Hagnons, fein gebildet,
klug und beredt, aber charakterlos, gehörte anfangs zur
gemäßigten Partei der Oligarchen und nahm 411 v. Chr. am
Umsturz der Solonischen Verfassung, dann aber, zur Volkspartei
übergehend, an ihrer Herstellung teil. Er kämpfte daraus
bei Kyzikos, vor Byzanz und bei den Arginusen mit; da er sich aber
zurückgesetzt und seinen Ehrgeiz nicht befriedigt fand, so
ging er wieder zur volksfeindlichen Partei über und betrieb
die Verurteilung der sechs Feldherren, welche bei den Arginusen
gesiegt, wegen der Versäumnis der Aufsammlung der Leichen,
welche eigentlich ihm selbst zur Last fiel. Nachdem er 405 bis 404
durch seine langwierigen Verhandlungen mit Lysandros die Athener an
einer mutigen Verteidigung ihrer Stadt gehindert und sie zum
schimpflichen Frieden gezwungen hatte, erreichte er das Ziel seiner
Herrschsucht, indem er zu einem der 30 Tyrannen ernannt wurde. Da
er die Grausamkeiten seiner Genossen nicht billigte und dem
gewalttätigen Kritias sich widersetzte, ward er 403 von diesem
zum Tod verurteilt und mußte den Giftbecher leeren. Vgl.
Pöhlig, Der Athener T. (Leipz. 1877).
Therapeuten (griech., "Diener", nämlich Gottes), ein
Orden von Asketen, welche, den Essäern ähnlich, am See
Möris bei Alexandria lebten. Übrigens kennen wir sie
bloß aus einer etwas zweifelhaften Schrift: "De vita
contemplativa", welche bislang Philo zugeschrieben wurde, jetzt
aber als Machwerk christlich-asketischen Ursprungs erkannt ist, und
ihre historische Existenz steht keineswegs ganz fest. Vgl. Lucius,
Die T. (Straßb. 1879).
Therapie (griech., "Dienst, Pflege", Heilkunst),
derjenige Teil der Medizin, welcher den eigentlichen Endzweck des
medizinischen Wissens bildet, die Lehre von der Behandlung der
Krankheiten. Die Mutter der T. ist die Erfahrung, und so findet
sich in den Uranfängen der medizinischen Kunst noch vor
Hippokrates oder irgend einer ausgebildeten Lehre die empirische
Behandlung vor, welche bis auf unsre Tage ihr gutes Recht geltend
macht und nicht selten Aufgaben löst, die für die exakte
Forschung noch auf lange Zeit ein Buch mit sieben Siegeln sind. So
hat vor mehreren Jahrhunderten die Erfahrung gelehrt, daß das
Einimpfen von Kuhpockenlymphe einen Schutz gegen die wahren Pocken
gewährt; seitdem sind dank der durchgreifenden Einführung
der Impfung die Blatterepidemien aus den Kulturländern fast
verschwunden, und noch immer sucht man nach der Ursache, auf
welcher dieser geheimnisvolle Schutz beruht. Seit langem ist die
geradezu spezifische Wirkung des Quecksilbers gegen die Syphilis
oder des Chinins gegen das Wechselfieber bekannt, jeder Arzt wendet
diese Mittel empirisch an, aber niemand kann Auskunft geben, auf
welche Weise diese Wirkung zu stande kommt. Neben der
Erfahrungstherapie hat es zu allen Zeiten eine rationelle
Behandlung gegeben. Diese Ratio nun ist so wechselvoll gewesen wie
die vielfachen Systeme und Schulen der Medizin (s. d.) selbst,
welche im Lauf der Jahrtausende aufeinander gefolgt sind, und
rationelle T. bedeutet darum nichts allgemein Feststehendes,
sondern nur ein auf dem Grund irgend welcher gerade herrschenden
Lehre aufgebautes Heilverfahren. Es ist z. B. rationell, wenn man
einen Nierenkranken, dessen Harnabsonderung stockt, in heiße
Decken hüllt, damit die im Blut sich anhäufenden
schädlichen Stoffe auf einem andern Weg durch den
Schweiß, aus dem Körper entfernt werden. Diese T. beruht
auf einer Reihe von wissenschaftlich begründeten
Vorstellungen, bei denen der Arzt zielbewußt handelt,
während er beim Wechselfieber vorläufig das "Warum"
seiner T. noch nicht kennt. - Radikalkur ist eine solche T., bei
welcher das Übel gleichsam mit der Wurzel (radix) ausgerissen
werden kann, z. B. eine erfolgreiche Bandwurmkur, die
Durchschneidung verkürzter Sehnen, das Ausziehen eines
schmerzenden Zahns etc. Ist eine solche gründliche T. nicht
möglich, etwa weil das Organ nicht zugänglich ist, so
muß sich die T. beschränken, die drohendsten oder
lästigsten Symptome, z. B. den Schmerz durch
Betäubungsmittel, zu bekämpfen (symptomatische T.). Liegt
eine Krankheit vor, bei welcher erfahrungsgemäß ein
günstiger Ausgang zu erwarten ist, wie bei Masern, leichten
Fällen von Lungenentzündung bei kräftigen Personen,
so muß sich der Arzt abwartend verhalten und nur jederzeit
aufmerksam sein, daß nicht etwanige neue Übel
hinzutreten; man spricht dann wohl von exspektativer T., die aber
eben nur eine Beobachtung ist. Dies sind dann die Fälle, bei
denen die Homöopathie, die Naturheilung und andre Systeme ihre
Triumphe feiern, da sich eben die Prozesse durch kein Mittel in
ihrem Ablauf beschleunigen lassen. Das Vorbeugen
641
Theremin - Thermen.
durch Schutzmaßregeln, welche die Entstehung oder
Verbreitung einer Krankheit hemmen, heißt Prophylaxis. Eine
T. ohne eine gründliche Kenntnis der Pathologie ist weder
wissenschaftlich denkbar noch vor dem Gewissen eines ehrlichen
Menschen zu verantworten. Es gibt deswegen kein Lehrbuch der T.,
das nicht gleichzeitig ein solches der Pathologie wäre, wohl
aber Lehrbücher der Pathologie, welche nicht von T. handeln.
Vgl. Billroth, Allgemeine chirurgische Pathologie und T. (14.
Aufl., Berl. 1889); die Handbücher der allgemeinen Pathologie
und T. von Lebert (2. Aufl., Tübing. 1875) und F. v. Niemeyer
(11. Aufl., das. 1881, 2 Bde.); Petersen, Hauptmomente in der
geschichtlichen Entwickelung der medizinischen T. (Kopenh.
1877).
Theremin, Ludwig Friedrich Franz, protest. Kanzelredner,
geb. 19. März 1780 zu Gramzow in der Ukermark, wurde 1810 zum
Prediger der französischen Gemeinde in Berlin, 1814 zum Hof-
und Domprediger und 1824 zum Oberkonsistorialrat und vortragenden
Rat im Ministerium des Kultus, 1834 zum Wirklichen
Oberkonsistorialrat ernannt und bekleidete seit 1839 zugleich eine
Professur an der Berliner Universität. Er starb 26. Sept.
1846. Außer "Predigten" (Berl. 1829-41, 9 Bde.) u.
Erbauungsschriften, wie die "Abendstunden" (6. Aufl., Frankf.
1869), die sich besonders durch klassische Form auszeichnen,
veröffentlichte er: "Die Beredsamkeit, eine Tugend" (Berl.
1814; neue Ausg., Gotha 1889) und "Demosthenes und Massillon, ein
Beitrag zur Geschichte der Beredsamkeit" (Berl. 1845). Vgl. Nebe,
Zur Geschichte der Predigt, Bd. 3 (Wiesb. 1878).
Therese, Schriftstellername, s. Bacheracht.
Therese von Jesu, Heilige, geb. 1515 zu Avila in
Altkastilien, wo sie 1535 in ein Karmeliterkloster trat. Sie
stellte in den von ihr reformierten Klöstern der unbeschuhten
Karmeliterinnen den Orden in seiner ursprünglichen Reinheit
wieder her und hatte schwere Verfolgungen von seiten der Karmeliter
der laxen Observanz auszustehen, die selbst gegen sie einen
Ketzerprozeß anstrengten. Sie starb 1582 im Kloster zu Alba
de Liste in Altkastilien und ward 1622 kanonisiert. Ihre bei den
katholischen Mystikern in hohem Ansehen stehenden
Erbauungsbücher (die berühmtesten: "Selbstbiographie",
"Seelenburg" u. a.), in denen sie in Visionen und ekstatischen
Zuständen schwelgt, wurden in fast alle europäischen
Sprachen übersetzt, ins Deutsche von Schwab (3. Aufl.,
Regensb. 1870, 5 Bde.) und L. Clarus (2. Aufl., das. 1866-1868, 5
Bde.). Ihre Briefe ("Cartas de Santa Teresa de Jesus") erschienen
in 4 Bänden (Madr. 1793; deutsch in den genannten Ausgaben).
Vgl. Pösl, Das Leben der heil. T. (2. Aufl., Regensb. 1856);
Hofele, Die heilige T. (das. 1882); Pingsmann, Santa Teresa de
Jesus (Köln 1886).
Theresienorden, bayr. Damenorden, gestiftet 12. Dez. 1827
von der Königin Therese von Bayern als Auszeichnung und
Unterstützung für zwölf unvermögende adlige
unverheiratete Damen, die jährlich 516 Mk. beziehen. Auch
andre adlige Damen können ihn erhalten, heißen aber
Ehrendamen und genießen keine Einkünfte. Die Dekoration
ist ein hellblau emailliertes, mit der Krone gedecktes Kreuz, in
dessen Mittelschild auf dem Avers ein T, vom Rautenkranz, auf dem
Revers 1827, von der Devise: "Unser Erdenleben sei Glaube an das
Ewige" umgeben, sich befinden. Das Band ist weiß mit
himmelblauen Rändern.
Theresienstadt, Stadt und Festung in der böhm.
Bezirkshauptmannschaft Lettmeritz, an der Eger, unweit ihrer
Mündung in die Elbe, Station der Österreichischen
Staatseisenbahn, mit Lederfabrik, Bierbrauerei, Mühlen und
(1880) mit Einschluß ron 4325 Mann Militär 7014 Einw.
Der Fluß kann durch Schleusen, die durch eine Citadelle
gedeckt sind, zu Inundationen benutzt werden. T. wurde 1780 von
Joseph II. angelegt und zu Ehren seiner Mutter benannt.
Theresiopel, ungar. Stadt, s. Maria-Theresiopel.
Therezina, Hauptstadt der brasil. Provinz Piauhy, am
Parnahyba, 250 km oberhalb dessen Mündung,
regelmäßig angelegt, aber ohne hervorragende
öffentliche Gebäude, mit Gewerbeschule, Lyceum und 6000
Einw., die lebhaften Handel treiben, den die kleinen, den
Fluß befahrenden Dampfschiffe vermitteln.
Theriak (griech.), altes Universalarzneimittel in Form
einer Latwerge, angeblich vom Leibarzt Kaiser Neros, Andromachus,
erfunden, ist aus 70 Stoffen zusammengesetzt und wurde bis in die
neuere Zeit in den Apotheken Venedigs, Hollands, Frankreichs mit
gewissen Feierlichkeiten und unter Aufsicht von Magistratspersonen
gefertigt. Jetzt wird es nur noch bei Tierkrankheiten benutzt. Nach
der "Pharmacopoea germanica Ed. I." bereitet man T. aus 1 Teil
Opium, 3 Teilen spanischem Wein, 6 Teilen Angelikawurzel, 4 Teilen
Rad. Serpentariae, 2 Teilen Baldrianwurzel, 2 Teilen Meerzwiebel, 2
Teilen Zitwerwurzel, 2 Teilen Zimt, 1 Teil Kardamom, 1 Teil Myrrhe,
1 Teil Eisenvitriol und 72 Teilen gereinigtem Honig.
Theriakwurz, s. Valeriana.
Theriodónten, s. Reptilien, S. 738.
Thermä, Name mehrerer alter Orte mit warmen Quellen.
Am bekanntesten sind: Thermae Himerenses, an der Nordküste von
Sizilien, westlich von Himera, dessen Einwohner es nach der
Zerstörung ihrer Stadt gründeten, seit Ende des ersten
Punischen Kriegs im Besitz der Römer; heute Termini. Ein
zweites T. (Thermae Selinuntinae) lag an der Südwestküste
von Sizilien bei Selinus; heute Sciacca.
Thermäischer Meerbusen, im Altertum Name des Golfs
von Saloniki (in ältester Zeit Thermä).
Thermästhesiometer (griech.), Vorrichtung zur
Prüfung des Temperatursinns, beruht im wesentlichen auf der
Applizierung eines erwärmten, resp. abgekühlten
Thermometers.
Thermen (griech.), "warme Quellen", d. h. solche, welche
eine höhere Temperatur besitzen als die mittlere
Jahrestemperatur der Orte, an denen sie auftreten. Sie sind eine
besondere Art der Mineralquellen (s. d.), eben durch diese
erhöhte Temperatur charakterisiert, wogegen ihr Gehalt an
gelösten Mineralbestandteilen oft ein auffallend geringer ist.
Nach der am meisten verbreiteten Ansicht verdanken sie ihre hohe
Temperierung der Erdwärme, indem sie aus bedeutenden Tiefen,
in denen die Gesteine eine hohe, sich den Wässern mitteilende
Temperatur besitzen, emporsteigen (vgl. Erde, S. 746). - Bei den
Römern führten diesen Namen (thermae) zum Unterschied von
den gewöhnlichen Bädern (balnea) die unter Augustus von
Agrippa eingeführten öffentlichen Anstalten, welche die
Einrichtung der griechischen Gymnasien (Ringplatz, offene und
bedeckte Säulenhallen, Konversatsonszimmer, Räume
für den Unterricht und die verschiedenen Übungen,
namentlich auch für das Ballspiel, allgemeines Badebassin u.
a.) mit warmen Bädern verbanden. Die umfangreichsten und
prächtigsten Anlagen dieser Art befanden sich in Rom und sind
zum Teil noch in Trümmern vorhanden, insbesondere die des
Caracalla (Rekonstruktion s. Tafel "Baukunst VI", Fig. 11); der
Erhaltung nach nehmen die wichtigste Stelle ein die beiden T. von
Pompeji (den Plan der einen s. Bad, S. 222, Fig. 2).
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl., XV. Bd.
41
642
Thermia - Thermochemie.
Vgl. "Le terme dei Romani" (Zeichnungen von Palladio, hrsg. von
Scamozzi, Vicenza 1785); Canina, L'architettura romana, Bd. 1;
Overbeck, Pompeji (4. Aufl., Leipz. 1884); Marquardt, Privatleben
oer Römer, Bd. 1 (2. Aufl., das. 1886).
Thermia (das alte Kythnos), griech. Insel im
Ägelschen Meer, zu den Kykladen gehörig, 76 qkm (1,38
QM.) groß, gebirgig, aber wohl angebaut, mit (1879) 2923
Einw., die vorliegend Seeleute oder Weinbauer sind. Die Hauptstadt
Kythnos, im Zentrum der Insel, ist Sitz eines griechischen
Bischofs, hat einen Hafen und (1879) 1523 Einw. An der
Nordostküste befinden sich mehrere hauptsächlich
salzsaure Soda und Magnesia enthaltende Quellen von 40-55° C.,
von denen die Insel ihren modernen Namen hat.
Thermidor (auch Fervidor, franz., "Hitzemonat"), der
elfte Monat im franz. Revolutionskalender, vom 19. Juli bis 17.
Aug. Merkwürdig ist der 9. T. des Jahrs II (27. Juli 1794), an
welchem Robespierre gestürzt ward, dessen Gegner sich deshalb
Thermidoristen nannten.
Thermik (griech.), Lehre von der Wärme (s. d.).
Thermische Anomalie, s. Isanomalen.
Thermobarograph, s. Meteorograph.
Thermobarometer, s. Barothermometer.
Thermo-cautère (griech.-franz., spr.
-kotähr), s. v. w. Paquelinscher Brennapparat.
Thermochemie (griech.), die Lehre von den durch chemische
Prozesse bedingten Wärmeerscheinungen. Die neuere Physik lehrt
bekanntlich, daß der Wärmezustand eines Körpers
bedingt werde durch die Art der Bewegung der kleinsten
Massenteilchen, der Moleküle. Je schneller sich diese Teilchen
bewegen, je größer ihre lebendige Kraft ist, um so
wärmer erscheint uns der Körper, dem sie angehören;
je geringer dagegen die Geschwindigkeit der Moleküle ist, um
so weniger Wärme wird der Körper zu enthalten scheinen.
Mithin muß, wenn durch irgendwelche äußere
Einwirkung oder innere Veränderung die Bewegung der
Moleküle in einem beliebigen Massensystem geändert wird,
auch der Wärmezustand dieses Systems eine Veränderung
erleiden. Wenn sich zwei isolierte Gasatome, die sich vollkommen
unabhängig voneinander bewegen, zu einem Molekül
vereinen, so werden bedeutende Bewegungsgrößen
zerstört, da die früher frei beweglichen Atome durch die
chemische Verbindung gezwungen sind, sich innerhalb bestimmter
Grenzen zu bewegen. Der scheinbare Wärmeinhalt des Systems
wird also nach der Vereinigung der beiden Atome ein geringerer
sein, es wird während der Vereinigung Wärme nach
außen abgegeben. Mithin wird bei der chemischen Vereinigung
zweier Atome stets Wärme frei. Zur Trennung der chemisch
vereinten Atome ist die Anziehungskraft zu überwinden, welche
die Atome zwingt, sich innerhalb bestimmter Grenzen zu bewegen; den
Atomen ist eine so lebhafte Bewegung mitzuteilen, daß sie
sich voneinander losreißen, sich unabhängig voneinander
bewegen können. Es wird also bei der Zersetzung einer
chemischen Verbindung Wärme von außen zugeführt
werden müssen, es wird Wärme gebunden werden und zwar
genau so viel, wie bei der Entstehung der betreffenden Verbindung
frei geworden war. Da nun aber bei der Entstehung einer chemischen
Verbindung um so mehr Wärme frei wird, je größer
die durch die Affinität zerstörten oder richtiger in
Wärme verwandelten Bewegungsgrößen der
Elementaratome oder nähern Bestandteile der fraglichen
Verbindung waren, so gibt die frei werdende Wärmemenge ein
relatives Maß der bei der Entstehung der fraglichen
Verbindung sich betätigenden Verwandtschaftskräfte ab,
vorausgesetzt, daß nicht anderweitige physikalische oder
chemische Vorgänge, welche sich neben der eigentlichen
Reaktion abspielen, von Wärmeerscheinungen begleitet sind. Das
letztere ist nun gewöhnlich der Fall, so daß die
thermochemischen Daten nur mit Vorsicht als Maß für die
chemischen Verwandtschaftskräfte zu benutzen sind. Wenn bei
der Vereinigung von Wasserstoff und Chlor zu gasförmiger
Chlorwasserstoffsäure 22 Kal. entwickelt werden, so ist diese
Wärmeentwickelung nicht durch die bei der Vereinigung der
beiden Gase in Frage kommende Affinität allein bedingt,
sondern es kommen noch andre Faktoren in Betracht. Der Prozeß
ist nicht: H+Cl==HCl, sondern: H2+Cl==2HCl, d. h. es müssen
erst die Wasserstoff- und die Chlormoleküle in die diskreten
Atome zerlegt werden, ehe die letztern sich zu Chlorwasserstoff
vereinigen können. Die oben angeführte
Wärmetönung gibt also die Bildungswärme des
Chlorwasserstoffs, vermindert um die Zersetzungswärme der
Wasserstoff- und der Chlormoleküle. Aus dem Umstand, daß
jede Wärmetönung, wie sie durch die direkte Beobachtung
gegeben wird, als eine Differenz angesehen werden muß, ergibt
sich auch die Erklärung für die sonst
schwerverständliche Thatsache, daß viele Verbindungen
unter Wärmeabsorption entstehen. Nichtsdestoweniger haben die
thermochemischen Daten als relatives Maß der bei einem
chemischen Prozeß zum Ausgleich kommenden Affinitäten
ihren hohen Wert. Man darf eben nur auf solche Prozesse
bezügliche Zahlen direkt miteinander vergleichen, welche
analog verlaufen und Produkte von analoger Konstitution liefern, so
daß man eine annähernde Gleichheit der sekundären
Wärmeerscheinungen annehmen kann. Die letztern werden sich
dann bei der Differenzierung aufheben.
Es gibt eine Reihe wichtiger chemischer Prozesse, deren Verlauf
teils wegen der Langsamkeit der Reaktion, teils wegen der geringen
Beständigkeit der dabei entstehenden Produkte und aus
ähnlichen Gründen keiner genauen thermischen Untersuchung
unterzogen werden kann. Will man nun dennoch einen Aufschluß
über die durch derartige Prozesse bedingten
Wärmeerscheinungen erhalten, so muß man mittels
Rechnungsoperationen aus anderweitigen Versuchsdaten
erschließen, was die direkte Beobachtung nicht ergeben kann.
Die Handhabe für diese Rechnungen bietet der sogen. zweite
Hauptsatz der T., welcher aussagt, daß, wenn ein System
einfacher oder zusammengesetzter Körper unter bestimmten
äußern Umständen und Bedingungen chemische und, wie
wir gleich hinzusetzen können, physikalische
Veränderungen erleidet, die dabei auftretende
Wärmeabsorption oder Emission allein von dem Anfangszustand
und dem Endzustand des Systems abhängig ist und dieselbe
bleibt, welches immer die Beschaffenheit und die Aufeinanderfolge
der Zwischenzustände sei. Es geht daraus hervor, daß,
wenn ein System von zwei verschiedenen Anfangszuständen zu
demselben Endzustand oder von einem und demselben Anfangszustand zu
zwei verschiedenen Endzuständen übergeführt wird,
die Differenz der diesen beiden Prozessen entsprechenden
Wärmetönungen diejenige Wärmetönung ergibt,
welche dem übergang des Systems aus dem einen Anfangs-, bez.
Endzustand in den andern entspricht. Die Affinitätskräfte
beruhen auf der Zerstörung von Bewegungsgrößen oder
richtiger auf ihrer Verwandlung in Wärme. Jedes bewegte
Massensystem strebt aber dem Zustand des stabilen Gleichgewichts
zu, und das Gleichgewicht ist am stabilsten, wenn das System den
größtmöglichen Verlust an lebendiger Kraft er-
643
Thermochrose - Thermoelektrizität.
litten hat. Mithin ist stets die wahrscheinlichste Reaktion,
vorausgesetzt, daß nur die Affinitätskräfte den
Verlauf derselben bedingen, diejenige, bei welcher die Atome den
größten Verlust an lebendiger Kraft erleiden, bei
welcher also die größte Wärmemenge entwickelt wird.
Dies Prinzip der größten Arbeit, das am meisten
bestreitbare und auch bestrittene Prinzip der T., ist nur eine
erste Annäherung, welche man unter Vernachlässigung aller
sekundären Kräfte erhält, und welche ihren Wert nur
so lange bewahren kann, als diese Vernachlässigung statthaft
ist. Unter dieser Voraussetzung hat das Prinzip für die
Beurteilung der Wahrscheinlichkeit einer Reaktion seinen
großen Wert. Ein Problem, an dessen Lösung man oft
gezweifelt hat, ist das, was eintritt, wenn man eine Säure auf
das Salz einer andern Säure einwirken läßt. Bringt
man z. B. Natriumsulfat und Salpetersäure zusammen, so
könnten folgende Reaktionen eintreten: die Salpetersäure
könnte die Schwefelsäure vollkommen verdrängen, so
daß in der Lösung schließlich nur Natriumnitrat
und freie Schwefelsäure vorhanden wären. Es könnte
aber auch eine nur teilweise Verdrängung der
Schwefelsäure eintreten, so daß wir eine Mischung von
Natriumnitrat und Natriumsulfat, von freier Salpetersäure und
freier Schwefelsäure in der Endlösung anzunehmen
hätten. Die Schwefelsäure würde sich dann aller
Wahrscheinlichkeit nach mit dem Natriumsulfat zu Natriumbisulfat
vereinigen. Die T. hat die vollkommene Sicherheit dafür
verschafft, daß die zuletzt erwähnte Teilung im
Schoß der Lösung vor sich geht. Die T. liefert also
nicht allein die Mittel, um die Affinitätskräfte einer
genauen relativen Messung zu unterziehen, sie gibt zugleich
Aufschluß über die Wirkungen dieser Kräfte in
Fällen, wo alle rein chemischen Methoden bisher versagt haben.
Sie gibt die Handhabe, um über die Möglichkeit, in vielen
Fällen sogar über die Wahrscheinlichkeit des Verlaufs
eines chemischen Prozesses von vornherein zu entscheiden, und
eröffnet der theoretischen chemischen Forschung dadurch ganz
neue Bahnen. Vgl. Berthelot, Méchanique chimique (Par. 1879,
2 Bde.); Thomsen, Thermochemische Untersuchungen (Leipz. 1882-1886,
4 Bde.); Naumann, Lehr- und Handbuch der T. (Braunschw. 1882);
Jahn, Grundsätze der T. (Wien 1882); Horstmann, Theoretische
Chemie einschließlich der T. (Braunschw. 1885); Ditte,
Anorganische Chemie, gegründet auf die T. (deutsch von
Böttger, Berl. 1886).
Thermochrose (griech., Wärmefärbung), s.
Wärmestrahlung.
Thermoelektrizität (griech.), durch Wärme
hervorgerufene Elektrizität. Lötet man einen Bügel m
n (Fig. 1) von Kupfer an einen Wismutstab o p und erwärmt die
eine Lötstelle, so zeigt eine innerhalb des Bügels auf
einer Spitze schwebende Magnetnadel a durch ihre Ablenkung,
daß ein elektrischer Strom entstanden ist, welcher an der
erwärmten Lötstelle vom Wismut zum Kupfer übergeht.
Wird die Lötstelle unter die Temperatur der umgebenden Luft
abgekühlt, so entsteht ein thermoelektrischer Strom von
entgegengesetzter Richtung. Verbindet man einen Antimonstab mit dem
Kupferbügel, so geht der Strom an der erwärmten
Lötstelle vom Kupfer zum Antimon. Einen solchen aus zwei
Metallen, welche an zwei Stellen miteinander verlötet sind,
gebildeten Bogen nennt man ein geschlossenes thermoelektrisches
Element (Thermoelement). Zwei Metallstäbchen, welche
bloß am einen Ende zusammengelötet sind, während
die freien Enden Leitungsdrähte tragen, bilden ein offenes
thermoelektrisches Element (Fig. 2), das zu einem geschlossenen
wird, wenn man die Drahtenden miteinander in leitende Verbindung
bringt. Die verschiedenen Metalle lassen sich in eine Reihe
(thermoelektrische Spannungsreihe) derart ordnen, daß, wenn
man aus zwei derselben ein Element bildet und die Lötstelle
erwärmt, der positive Strom von dem in der Reihe höher
stehenden Metall zu dem tiefer stehenden übergeht; diese Reihe
ist: Wismut, Quecksilber, Platin, Gold, Kupfer, Zinn, Blei, Zink,
Silber, Eisen, Antimon. Einige Schwefel- und Arsenmetalle sowie
einige Oxyde, z. B. Kupferkies, Arsenikkies, Bleiglanz, Pyrolusit
etc., stehen noch über dem Wismut, eine Legierung aus 2 Teilen
Antimon mit 1 Teil Zinn noch unter dem Antimon. Zur Konstruktion
möglichst wirksamer Thermoelemente wählt man zwei
Metalle, welche in der Spannungsreihe weit voneinander entfernt
stehen, z. B. Wismut und Antimon. Die Wirkung wird verstärkt,
wenn man mehrere Elemente nach Art der Voltaschen Säule zu
einer thermoelektrischen Säule (Thermosäule, Fig. 3)
verbindet; mehrere Stäbchenschichten, deren Zwischenräume
mit einer isolierenden Substanz ausgegossen sind, werden, zu einem
Bündel vereinigt, in eine Fassung p (Fig. 4) gebracht, so
daß ihre Endstäbchen mit den Stiften x und y in
leitender Berührung stehen. Eine solche Thermosäule in
Verbindung mit einem Galvanometer (Multiplikator) wird
Thermomultiplikator genannt und bildet ein sehr empfindliches
Mittel zum Nachweis und zur Messung der strahlenden Wärme.
Marcus hat eine größere Thermosäule konstruiert,
worin einerseits eine Legierung aus 10 Teilen Kupfer, 6 Teilen Zink
und 6 Teilen Nickel, an-
41*
644
Thermograph - Thermometer.
derseits eine solche aus 12 Teilen Antimon, 5 Teilen Zinn und 1
Teil Wismut angewandt wird. Die eine Reihe der Lötstellen wird
durch Flammen erwärmt, die andre durch Wasser oder Eis
gekühlt. 30 Elemente dieser Art erzeugen einen Elektromagnet
von 75 kg Tragkraft. Weit günstigere Resultate gibt die
Thermosäule von Noë, deren 20 Elemente sternförmig
angeordnet sind, von der Mitte aus durch einen Bunsenschen Brenner
erwärmt werden und durch Vermittelung kupferner Blechspiralen
die Wärme an die Luft abgeben. Ebenfalls auf Luftkühlung
eingerichtet ist die Clamondsche Thermosäule; auch sie wird
von einem cylindrischen Hohlraum aus geheizt, um welchen die
Elemente in übereinander geschichteten Kränzen aufgebaut
sind. Vier solche Säulen zu je 400 Elementen, welche zusammen
pro Stunde 3,2 cbm Gas verzehren, ersetzen 50 Bunsenelemente und
können demnach elektrisches Kohlenlicht erzeugen. Leitet man
durch ein Thermoelement einen galvanischen Strom, so bringt
derselbe an der Lötstelle eine Temperaturveränderung
hervor, welche derjenigen entgegengesetzt ist, die einen
Thermostrom von gleicher Richtung erzeugen würde. Geht z. B.
der galvanische Strom vom Antimon zum Wismut, so erwärmt sich
die Lötstelle; sie kühlt sich dagegen ab, wenn der Strom
vom Wismut zum Antimon übergeht (Peltiers Phänomen).
Thermograph (griech.), s. Registrierapparate.
Thermographie (griech.), graphische Darstellung der
Schwankungen der Körpertemperatur bei fieberhaften
Krankheiten; auch ein dem Naturselbstdruck (s. d.) ähnliches
Verfahren mechanischer Vervielfältigung, von Abate in Neapel
erfunden, das aber nur geringe Verbreitung gefunden hat.
Thermohypsometer (griech.), s. Barothermometer.
Thermolyse (griech.), s. v. w. Dissociation.
Thermometer (griech., Wärmemesser), Instrument zur
Bestimmung der Temperatur. Bei den gewöhnlichen Thermometern
mißt man die durch das Fallen und Steigen der Temperatur
veranlaßten Volumveränderungen einer in einem
Gefäß mit Kapillarrohr eingeschlossenen
Flüssigkeit, besonders des Quecksilbers. Das Gefäß
ist am besten cylindrisch, weil es bei dieser Form im
Verhältnis zu der von ihm aufgenommenen Quecksilbermenge der
Umgebung eine größere Oberfläche darbietet. Je
größer die Kapazität des Gefäßes im
Verhältnis zum Querschnitt des Kapillarrohrs ist, desto
merklicher wird das Steigen oder Sinken des Quecksilbers bei
gleicher Änderung der Temperatur sein. Das Rohr des
Thermometers muß überall gleiche innere Weite haben, so
daß ein Quecksilberfaden an allen Stellen desselben gleiche
Länge behält. Bei der Anfertigung des Thermometers wird
die Luft vollständig aus dem Instrument entfernt. Der Raum
über dem Quecksilber muß absolut luftleer sein, so
daß letzteres das Rohr beim Umkehren des Instruments bis in
die äußerste Kuppe füllt. Das fertige T. wird in
schmelzendes Eis getaucht und der Stand des Quecksilbers bestimmt.
So erhält man den Gefrierpunkt. Zur Bestimmung des
Siedepunktes hängt man das T. in einer Röhre auf, durch
welche der Dampf von kochendem destillierten Wasser strömt,
und markiert den Stand des Quecksilbers. Durch den Druck der
äußern Luft auf das luftleere Instrument wird das
Gefäß des letztern etwas zufammengepreßt und
dadurch die Skala etwas verrückt. Es ist deshalb der
Gefrierpunkt nach längerer Zeit wiederholt zu bestimmen. Den
Raum zwischen Gefrier- und Siedepunkt teilt Reaumur in 80, Celsius
in 100 Teile oder Grade. Auf den Fahrenheitschen Thermometern ist
der Eispunkt mit 32, der Siedepunkt mit 212 bezeichnet, der 0-Punkt
liegt also 3.2° F. unter dem Eispunkt. Die Grade über dem
Gefrierpunkt werden durch das Zeichen +, die unter dem Gefrierpunkt
durch - bezeichnet. Um die Angaben einer der verschiedenen Skalen
in eine andre zu übertragen, dienen folgende Formeln:
t° C. = 8/10 t° R. oder 9/5 t + 32° F.,
t° R. = 10/8 t° C. oder 9/4 t + 32° F.,
t° F. = 5/9 (t -32)° C. oder 4/9 (t - 32)° R.
Vergleichnng der Thermometerskalen.
C. R. F. C. R. F.
-40 -32 -40 35 28 95
-35 -28 -31 40 32 104
-30 -24 -22 45 36 113
-25 -20 -13 50 40 122
-20 -16 - 4 55 44 131
-15 -12 5 60 48 140
-10 - 8 14 65 52 149
- 5 - 4 23 70 56 158
0 0 32 75 60 167
5 4 41 80 64 176
10 8 50 85 68 185
15 12 59 90 72 194
20 16 68 95 76 203
25 20 77 100 80 212
30 24 86
Bei Siedepunktbestimmungen ist immer der Barometerstand zu
berücksichtigen, weil das Sieden einer Flüssigkeit von
dem auf ihr lastenden Druck abhängig ist. Die
Thermometerskalen beziehen sich stets auf normalen Barometerstand
von 760 mm. Über den Siedepunkt des Wassers hinaus trägt
man die Skala empirisch auf und kann sie bis fast zum Siedepunkt
des Quecksilbers ausdehnen. Bei -40° gefriert das Quecksilber,
und man bedient sich daher zur Messung
Fig. 1. Rutherfords Maximum- und Minimumthermometer.
niedriger Temperaturen des Alkoholthermometers, welches ebenso
wie das Quecksilberthermometer angefertigt und nach einem solchen
graduiert wird. Rutherfords Maximum- und Minimumthermometer
(Thermometrograph, Fig. 1) gibt die höchste und die niedrigste
Temperatur an, welche in einer gewissen Zeit geherrscht hat. Es
besteht aus einem Weingeist- und einem Quecksilberthermometer,
deren Röhren horizontal liegen. In der Röhre des
Quecksilberthermometers schiebt das Quecksilber einen feinen
Stahlcylinder vor sich her, läßt ihn aber liegen, wenn
es sich bei fallender Temperatur zusammenzieht. Im
Weingeistthermometer befindet sich ein feines Glasstäbchen,
welches aus
645
Thermometer (zu verschiedenen Zwecken).
dem Weingeist nicht herauszufallen vermag; es folgt dem beim
Sinken der Temperatur sich zusammenziehenden Weingeist, bleibt aber
liegen, wenn der Weingeist sich wieder ausdehnt. Das Sixsche
Maximum- und Minimumthermometer (Fig. 2) besteht aus einer
heberförmig gebogenen Röhre n o p, deren unterer Teil
Quecksilber enthält. Das Gefäß d und der linke
Schenkel sind bis auf das Quecksilber mit Weingeist gefüllt;
im rechten Schenkel, der mit dem Gefäß q endigt,
befindet sich über dem Quecksilber ebenfalls Weingeist. Jeder
Schenkel der Röhre enthält in seinem mit Weingeist
gefüllten Teil einen Stahlstift a und b, von denen der
letztere bei steigender Temperatur, der erstere bei fallender
Temperatur durch das Quecksilber hinaufgeschoben und beim
Rückgang des Quecksilbers stehen gelassen wird. Der Stift a
gibt also das Minimum, der Stift b das Maximum der Temperatur seit
der letzten Einstellung an. Die Einstellung wird durch einen
kleinen von außen an die Röhre gehaltenen Magnet
bewirkt, durch welchen man die beiden Stifte wieder bis zu den
Quecksilberkuppen herabzieht. Das Six-T. ist namentlich zum Messen
der Temperatur der Meerestiefen sehr geeignet. Zur Messung der
menschlichen Blutwärme gebrauchen die Ärzte ein kleines
Maximumthermometer, das sogen. Fieberthermometer (Fig. 3,
natürliche Größe), von dessen Quecksilbersäule
das obere Stück durch eine ganz kleine Luftblase von dem
übrigen Queck-Silber abgetrennt ist. Beim Steigen wird der
abgetrennte Faden vorgeschoben und bleibt bei der Abkühlung an
der erreichten Stelle stehen. Durch Schwingen des Thermometers
muß vor jeder neuen Beobachtung der abgetrennte Faden wieder
bis zum übrigen Quecksilber zurückgeführt werden,
wobei eine doppelte Umbiegung der Röhre eine völlige
Vereinigung mit diesem verhindert. Beim Gebrauch steckt man das
Gefäß des Thermometers in die Achselhöhle oder in
den After des Kranken und wartet 10 Minuten bis zur Ablesung. Die
Einteilung gestattet, Zehntelgrade abzulesen, und braucht nur im
Bereich der vorkommenden Bluttemperaturen ausgeführt zu sein.
Das Geothermometer zum Messen der Temperatur in Bohrlöchern
ist ein Ausflußthermometer, es besitzt ein großes
cylindrisches Gefäß, welches mittels Korks zwischen zwei
durch Schrauben verbundene Metallplatten eingeklemmt ist; die
Röhre ist oben offen u. so kurz, daß der Endpunkt der
Skala noch unter der zu messenden Temperatur liegt. Füllt man
nun das Rohr vollständig mit Quecksilber u.
überläßt das Instrument einige Zeit neben einem
gewöhnlichen T. sich selbst, so kann man die Temperatur,
welche es anzeigt, als T notieren; senkt man es dann ins Bohrloch,
so dehnt sich das Quecksilber aus, und ein Teil desselben
fließt aus. Nach dem Versuch zeigt das Geothermometer t1°
und ein gewöhnliches T. daneben t°, wobei t1 kleiner ist
als t. Die Temperatur im Bohrloch ist dann x=t-t1+T. Für
wissenschaftliche Zwecke wendet man das Luftthermometer (s.
Ausdehnung, S. 110) an, bei welchem die Ausdehnung oder
Druckzunahme eines bestimmten Volumens Luft gemessen wird. Dieses
Instrument gibt zwischen 0 und 100° dieselben Grade an wie das
Quecksilberthermometer, über 100° hinaus gibt dagegen
letzteres stets höhere Temperaturen an. Das Quecksilber dehnt
sich nämlich von 0-100° gleichförmig, von 100° an
aber in einem stärkern Verhältnis aus. Nur die Ausdehnung
der Luft ist der absorbierten Wärmemenge stets proportional,
und deshalb muß man auch, wenn es sich um genaue Bestimmung
höherer Temperaturen handelt, stets das Luftthermometer
anwenden. Die Benutzung desselben ist aber umständlich, da man
die Temperatur nicht direkt ablesen, sondern jedesmal durch einen
mehr oder minder umständlichen Versuch ermitteln muß.
Das Metallthermometer von Breguet (Fig. 4) ist ein
spiralförmig gewundenes, 1-2 mm breites Band, das aus Silber,
Gold u. Platin besteht. Drei Streifchen dieser Metalle sind so
aufeinander gelötet, daß sich das Gold in der Mitte
zwischen dem stärker ausdehnbaren Silber u. dem weniger
ausdehnbaren Platin befindet, und dann zu einem sehr dünnen
Band ausgewalzt. Das eine Ende der Spirale A ist an einem Stativ
befestigt, das andre B trägt einen Zeiger cd, der über
einer Kreisteilung schwebt. Beim Wechsel der Temperatur windet sich
die Spirale auf oder zu und bewegt so den Zeiger, dessen Angaben
nach einem guten Quecksilberthermometer reguliert werden. Das
Instrument ist äußerst empfindlich. Bei dem abgebildeten
Metallthermometer hängt ein an der Nadel cd befestigtes
Stäbchen in das Quecksilbergefäß H H herab, welches
mit dem Messingbügel N N A nur durch das Spiralband in
leitender Verbindung steht. Wird nun das
Quecksilbergefäß mit dem einen, der Messingbügel
mit dem andern Pol eines galvanischen Stromerzeugers verbunden, so
geht der Strom durch das Spiralband, welches sich infolgedessen
erwärmt, und die Nadel dreht sich um eine der Stärke des
Stroms entsprechende Anzahl von Graden. Das Quadrantenthermometer
(Fig. 5) enthält ein innen aus
646
Thermometer (Tiefsee -T.).
Kupfer, außen aus Platin bestehendes, kreisförmig
gebogenes Band fgh, dessen eines Ende f befestigt ist, während
das andre t t mittels eines Hebelwerks boa durch den gezahnten
Bogen cd einen Zeiger z z in Bewegung setzt, sobald sich das Band
mehr streckt oder biegt. Bei abnehmender Temperatur bewirkt die
Spiralfeder s s eine Drehung in entgegengesetzter Richtung. Auf
demselben Prinzip beruht das Metall-Maximum- und Minimumthermometer
von Herrmann und Pfister (Fig. 6). Das eine Ende der Spirale s s,
welche aus zwei Metallstreifen, außen Stahl, innen Messing,
zusammengelötet ist, ist an einen festen Metallzapfen a
angeschraubt, das andere Ende b ist frei. Steigt die Temperatur, so
dehnt sich das Messing stärker aus als der Stahl, die Spirale
öffnet sich etwas, ihr freies Ende geht nach links u. schiebt
den leicht beweglichen Zeiger cd mittels des Stifts p vor sich her;
beim Erkalten schließt sich die Spirale wieder mehr, ihr
freies Ende bewegt sich nach rechts, läßt den Zeiger cd
auf der erreichten Maximaltemperatur stehen und schiebt nun den
Zeiger fg mittels des Stifts q nach rechts, wo derselbe bei
erneuter Erwärmung stehen bleibt und das Temperaturminimum
anzeigt. Die bogenförmige Skala wird durch Vergleichung mit
einem Quecksilberthermometer graduiert. Solche Spiralen eignen sich
sehr gut zur Konstruktion selbstregistrierender T. (s.
Registrierapparate, S. 664).
Das Tiefseethermometer von Negretti und Zambra ist ein
gewöhnliches Quecksilberthermometer mit cylindrischem
Gefäß, dessen Hals verengert und auf besondere Weise
zusammengezogen ist (Fig. 7 u. 8). Jenseit dieser Verengerung ist
das Thermometerrohr mehr ausgebogen und bildet eine kleine Bucht
zur Aufnahme von Quecksilber. Das Ende der alsdann gerade
verlaufenden Röhre bildet ein Reservoir für das aus dem
cylindrischen Gefäß abfließende Quecksilber. Wird
der Apparat zunächst so gehalten, daß dies
Gefäß sich unten befindet, so füllt das Quecksilber
die ganze Röhre bis zu einem Raum in dem Reservoir am Ende
derselben, welcher für die Ausdehnung des Quecksilbers
genügt, sobald die Temperatur steigt. Kommt nun aber durch
eine plötzliche Umkehrung des Apparats das cylindrische
Gefäß nach oben, so zerreißt das Quecksilber bei
der Verengerung des Halses, u. der abgerissene Teil des
Quecksilbers fließt die Röhre hinab und füllt das
Reservoir u. einen Teil der Röhre oberhalb desselben,
entsprechend der jedesmaligen Temperatur zur Zeit der Umkehrung;
die Röhre ist deshalb von dem Reservoir aus nach oben in Grade
eingeteilt und bildet die Thermometerskala. Um das Instrument zur
Beobachtung vorzubereiten, muß das cylindrische
Gefäß nach unten gebracht werden und so lange in dieser
Lage verharren, bis es bei seinem Herablassen in das Wasser die
Temperatur seiner Umgebung angenommen hat (Fig. 7). Will man nun
für irgend eine Tiefe des Meers, eines Sees oder eines Flusses
die Temperatur bestimmen, so muß man das T. umkehren, so
daß das cylindrische Gefäß nach oben kommt (Fig.
8), und es in dieser Lage halten, bis die Ablesung nach dem
Heraufholen des Thermometers gemacht ist. Die Menge des
Quecksilbers in dem untern graduierten Teil der Röhre ist
nämlich so gering, daß sie von einer Änderung der
Temperatur während des Heraufholens nicht oder nur sehr
unbedeutend beeinflußt wird (ausgenommen, wenn diese sehr
beträchtlich sein sollte). Dagegen wird sich das Quecksilber
in dem cylindrischen Gefäß mit der Ab- und Zunahme der
Wärme zusammenziehen oder ausdehnen. In dem letztern Fall wird
etwas Quecksilber die Verengerung am Hals des Gefäßes
passieren, in die oben erwähnte seitliche Ausbuchtung gelangen
und dort verbleiben, solange das Gefäß aufwärts
gerichtet ist; somit bleibt die Quecksilbermenge bei dieser Lage
des Thermometers in dem untern Teil der Röhre
unverändert. Die nach dem Heraufholen des Thermometers mittels
der eingeteilten Lotleine an der Oberfläche erfolgende
Ablesung desselben gibt also in der That die wirkliche Temperatur
der betreffenden, durch die Lotleine bestimmten Tiefenschicht
647
Thermomètre automoteur - Theromorphie.
des Wassers an, und das Instrument selbst ist ein genauer
Registrierapparat. Bei der Umkehrung des Thermometers in die Lage
(Gefäß nach oben) in irgend einer Tiefe muß
große Vorsicht angewendet werden. Zu diesem Zweck ist das
Instrument in ein hölzernes Gehäuse (s. Figur)
eingefügt, welches zum Teil mit Schrotkugeln angefüllt
ist, die sich frei von einem Ende zum andern bewegen können,
und deren Gewicht so reguliert ist, daß sie den ganzen
Apparat gerade schwimmend im Wasser erhalten; dieser selbst ist
mittels eines Taues, welches durch eine Öffnung des
hölzernen Gehäuses so nahe wie möglich bei dem
cylindrischen Gefäß geht, mit der Lotleine befestigt.
Bei dem Herablassen wird das T. mit dem Gefäß in der
Lage nach unten herabgezogen; bei dem Heraufziehen aber wird der
Apparat, infolge des Widerstandes des Wassers, sich umkehren, und
das Gefäß kommt in die Lage nach oben (s. Figur). Die
Vorrichtung zum Schutz gegen den Wasserdruck besteht in einer das
T. umgebenden starkwandigen, hermetisch verschlossenen
Glashülle, welche zum größten Teil mit Quecksilber
angefüllt ist. Vgl. Gerland, Das T. (Berl. 1885).
Thermomètre automoteur (franz., spr.
otomotör), s. Nachtfrost.
Thermomultiplikator, s. Wärmestrahlung.
Thermon, im Altertum Hauptort des erweiterten
Ätolien in Griechenland, wozu seit ca. 300 v. Chr. auch
Westlokris, Doris, Ötäa und Äniania gehörten,
lag am Ostufer der Trichonis (See von Vrachori) und war weniger
eine Stadt als ein Komplex von Tempeln, Versammlungsräumen
etc. und Sitz des Ätolischen Bundes. T. wurde 218 v. Chr. von
Philipp V. von Makedonien geplündert und zerstört, wobei
allein 2000 Statuen weggeführt wurden, und blieb seitdem
unbedeutend. Seine Ruinen sind wahrscheinlich in Paläo-Bazaro
bei Petrochori zu suchen.
Thermopathogenie (griech.), Lehre von der Entstehung des
Fiebers.
Thermophore (griech.), s. Radiophonie.
Thermopylen ("Thor der warmen Quellen"), Engpaß an
der Grenze der griechischen Landschaften Lokris und Malis (im
jetzigen Nomos Phthiotis und Phokis), zwischen dem von Sümpfen
umränderten Malischen Meerbusen und einem Ausläufer des
Bergs Öta, so benannt nach den daselbst befindlichen warmen
Schwefelquellen, war bei einer Länge von mehr als einer Stunde
nur 50-60 Schritt breit, an vielen Stellen aber noch weit enger und
war als Haupteingang von Thessalien nach Hellas von alters her ein
wichtiger strategischer Punkt. Das vom Spercheios
herabgeführte Alluvium hat die Küste hier bedeutend
verändert und vorgeschoben; kleine Bäche bilden jetzt
neben dem Weg einen bodenlosen Sumpf, durch welchen ein Steindamm
mit mehreren Brücken führt. - Berühmt ist der
Paß besonders durch die heldenmütige Ausopferung des
Leonidas und seiner Spartiaten im Juli 480 v. Chr. Während
sich die hellenische Bundesflotte an der Nordspitze von Euböa,
am Vorgebirge Artemision, aufstellte, übernahmen die Spartaner
die Verteidigung der T. gegen das unermeßliche persische
Heer. Die dort aufgestellte griechische Schar bestand aus nicht
ganz 6000 Mann, darunter bloß 300 Spartiaten unter dem
Oberbefehl des Königs Leonidas, welcher die alte Vermauerung
des Passes erneuern und den Paß über den Öta am
Kallidromos durch 1000 Phoker besetzen ließ. Als Xerxes zum
Angriff schritt, schlugen die Griechen die Perser zwei Tage lang,
zuletzt selbst die persische Leibwache zurück. Da führte
der Malier Ephialtes 20,000 Perser unter Hydarnes auf dem
Fußpfad, den die Phoker zu bewachen versäumten,
über das Gebirge den streitenden Griechen in den Rücken.
Als diese die Kunde von ihrer Umgehung erhielten, beschloß
Leonidas, dem Befehl, den Paß zu hüten, gehorsam, mit
den Spartiaten zu bleiben und bis auf den letzten Mann zu
kämpfen. Die übrigen ließ er zur Verteidigung ihrer
Heimat abziehen, mit Ausnahme von 400 Thebanern, die er als Geiseln
für die Treue dieser Stadt mitgenommen hatte. Aber auch die
700 Thespier blieben freiwillig bei ihm. Um 10 Uhr vormittags des
dritten Tags, als von beiden Seiten die persische Übermacht
zum Angriff schritt, führte Leonidas seine Schar mitten unter
die Feinde, um ihr Leben so teuer wie möglich zu verkaufen;
als die Lanzen zersplittert und die Kräfte erschöpft
waren, zogen sich die Hellenen auf einen kleinen Hügel
südlich von den Quellen zurück, wo sie einer nach dem
andern den Pfeilen der Perser erlagen. Von den Thebanern dagegen
retteten sich viele dadurch, daß sie nach Leonidas' Tode die
Waffen streckten und den Persern beteuerten, daß sie nur
gezwungen gegen sie gekämpft hätten. Das Haupt des
Leonidas ließ Xerxes auf einen Pfahl stecken, und den Rumpf
soll er an das Kreuz haben schlagen lassen. Die Griechen aber
widmeten dem Andenken der Helden ein Denkmal mit der Inschrift des
Simonides:
Wanderer, meld es daheim Lakedämons Bürgern:
erschlagen
Liegen wir hier, noch im Tod ihrem Gebote getreu.
Im J. 191 siegte der römische Konsul Manius Acilius Glabrio
über Antiochos d. Gr. und die Ätolier, indem der Legat M.
Porcius Cato die Umgehung über das Gebirge ausführte.
Auch im griechischen Freiheitskampf wurde hier mehrere Male (6.
Sept. 1821, dann 8. und 14. Juli 1822) gekämpft.
Thermosäule, s. Thermoelektrizität.
Thermostat (griech.), Gestell zum bequemen Erhitzen eines
Körpers über der Lampe, speziell eine Vorrichtung zur
selbsttätigen Regulierung der Temperatur beim Erhitzen.
Erreicht die Quecksilbersäule eine bestimmte Höhe, die
nicht überschritten werden soll, so schließt sie durch
einen in das Thermometer eingeschmolzenen Platindraht einen
elektrischen Strom, der nun entweder nur den Wächter durch
eine elektrische Klingel herbeiruft, oder auch direkt auf die
Flamme wirkt, indem er den Zufluß von Leuchtgas
verringert.
Thermotherapie (griech.), Behandlung der Krankheiten
mittels heißer Bäder, heißer Bähungen
etc.
Thermotonus (griech.), bei Pflanzen mit reizbaren und
periodisch beweglichen Organen der durch die Wärme bedingte
bewegliche Zustand derselben; vgl. Pflanzenbewegungen.
Théroigne de Méricourt (spr. teroannj d'
merikuhr), "die Amazone der franz. Revolution", geb. 13. Aug. 1762
zu Luxemburg, hieß eigentlich Anna Josephe Terwagne, ward in
Paris Kurtisane, that sich beim Zug der Pariser nach Versailles
(Oktober 1789) hervor, trat in den Dienst der Jakobiner und
agitierte für sie in Belgien, wo sie 1790 der kaiserlichen
Polizei in die Hände fiel. Nach einjähriger Haft in Wien
kehrte sie Anfang 1792 nach Paris zurück, wurde als
Verräterin vom Pöbel 10. Aug. beim Sturm auf die
Tuilerien ausgepeitscht und starb 9. Juni 1797 im Irrenhaus. Vgl.
Fuß, Théroigne de Méricourt (Lüttich
1854).
Theromorphie (griech.), tierähnliche Bildung, sowohl
eine Mißbildung als eine atavistische Form, welche auf die
Abstammung des Menschen vom Tier hindeutet.
648
Theron - Thespis.
Theron, Sohn des Änesidemos aus Gela, Tyrann von
Akragas (Agrigent) seit 489 v. Chr., zeichnete sich durch
Gerechtigkeit und Milde aus, eroberte Himera, kämpfte 480 in
der Schlacht daselbst gegen die Karthager und starb 472. Pindar
feiert ihn als Sieger in den Olympischen Spielen. Sein Grabmal zu
Akragas galt für ein berühmtes Kunstwerk.
Thersandros, einer der Epigonen, Sohn des Polyneikes und
der Argeia, zog mit gegen Theben und ward nach des Eteokles und
seines Vaters Tod König von Theben. Später zog er mit
gegen Troja und kam in Mysien im Kampf mit Telephos um.
Thersítes, nach griech. Mythus der
häßlichste Mann in dem vor Troja lagernden Heer der
Griechen, Sohn des Agrios und Verwandter des Diomedes, ein
boshafter und schmähsüchtiger Schreier, ward von Odysseus
wegen Verleumdung des Agamemnon öffentlich gezüchtigt und
nach späterer Sage von Achilleus getötet, weil er dem
Leichnam der Amazonenkönigin Penthesileia die Augen
ausgerissen hatte. Vgl. Jacobs, Die Episode des T. (in den
"Vermischten Schriften", Bd. 6, Leipz. 1844).
Thesa (Tasa, Teja), Stadt in Marokko, östlich von
Fes, am Ued el Assar, ein strategisch sehr wichtiger Punkt, hat
3500 Einw., welche mit einer kleinen Garnison des Sultans in der
von einer doppelten Mauer umgebenen Stadt leben, aber dieselbe kaum
verlassen können, da der die Umgegend bewohnende Stamm der
Riata in Wahrheit Herr des ganzen Gebiets ist.
Thesaurus (griech., "Schatz"), bei den alten Griechen s.
v. w. Schatzkammer, Schatzhaus. Die in der Regel unterirdischen
Schatzhäuser (Thesauren) der alten Herrschergeschlechter
gehörten zu den bedeutendsten Anlagen der griechischen
Vorzeit; die übliche Grundform derselben war die eines
kreisrunden, durch Überkragung horizontaler Schichten
kuppelartig geschlossenen Gemachs (am bekanntesten das sogen.
Schatzhaus des Atreus zu Mykenä). In der historischen Zeit
errichteten die einzelnen Staaten innerhalb des Bezirks allgemein
angesehener Heiligtümer (z. B. der zu Olympia und Delphi)
eigne Thesauren zur Aufnahme der von ihnen dargebrachten
Weihgeschenke. - T. ist außerdem ein in früherer Zeit
sehr beliebter und auch jetzt noch vorkommender Titel für
Sammlungen von Monographien, zerstreuten Bemerkungen etc., welche,
in einem größern Werk vereinigt, ein ganzes
wissenschaftliches, besonders sprachliches, Gebiet umfassen, ebenso
für umfangreichere, zum Gebrauch für Fachgelehrte
bestimmte Wörterbücher. Bekannt sind namentlich: der "T.
linguae graecae" von Henricus Stephanus und "T. linguae latinae"
von Rob. Stephanus, der "T. antiquitatum graecarum" von Gronovius
und "T. antiquitatum romanarum" von Grävius.
Theseus, einer der berühmtesten Heroen des
Altertums, Sohn des Königs Ägeus von Athen und der
Äthra, ward bei seinem Großvater Pittheus in Trözen
erzogen. Herangewachsen, nahm er das Schwert seines Vaters, welches
dieser selbst für ihn unter einem Felsblock verborgen hatte,
als Erkennungszeichen und ging damit nach Athen. Unterwegs erschlug
er die Räuber Periphetes, Sinis, Skiron, Kerkyon, Prokrustes
u. a. In Athen angekommen, sollte er auf Anstiften seiner
Stiefmutter Medeia (s. d.) vergiftet werden; Ägeus erkannte
den Sohn aber am Schwert, und Medeia mußte fliehen. T. machte
sich zunächst um das Land verdient, indem er den
marathonischen Stier erlegte. Als darauf die Gesandten des Minos
nach Athen kamen, um den jährlichen Tribut von sieben
Jünglingen und sieben Jungfrauen für den Minotauros zu
holen, ließ sich T. unter die Zahl der ausersehenen Opfer
aufnehmen, und es gelang ihm, mit Hilfe der Ariadne (s. d.) den
Minotauros zu töten (s. Mtnotauros, mit Abbildung). Nach dem
Tode des Ägeus trat er die Herrschaft über Attika an und
zeichnete sich durch weise Herrschermaßregeln sowie durch
kühne Heldenthaten aus. Er stiftete die Panathenäischen
und Isthmischen Spiele, zog mit Herakles gegen die Amazonen und
erhielt als Siegespreis die Königin Antiope oder Hippolyte,
die ihm den Hippolytos gebar, half dem Peirithoos die Kentauren
vertreiben und stieg mit demselben in die Unterwelt, um die
Persephone zu entführen; hier aber wurden beide gefesselt
zurückgehalten, bis sie Herakles befreite. Später nahm T.
an dem Argonautenzug und an der kanonischen Jagd teil. Bei seiner
Zurückkunft nach Athen den Menestheus, Sohn des Peteos, auf
dem Thron findend, ging er nach Skyros, wo er seinen Tod durch
einen Sturz von einem Felsen oder durch Verrat des Königs
Lykomedes fand. T. war der ionische (speziell athenische)
Hauptheros, den seine Verehrer zu gleichem Glanz wie die Dorier
ihren Herakles zu erheben suchten, insbesondere Repräsentant
des volkstümlichen Königtums. Er erhielt bald
Heroendienst in Athen, und es wurde ihm ein prachtvoller Tempel
errichtet. Noch jetzt führt ein im Mittelalter als christliche
Kirche, dann als Museum benutzter, kunstgeschichtlich höchst
bedeutsamer Tempel in Athen den Namen Theseion, wiewohl
wahrscheinlich mit Unrecht (s. Athen, S. 997). Die Darstellung des
T. auf Kunstwerken ähnelt sehr der des Herakles, nur ist er
stets jugendlich aufgefaßt und in seiner ganzen Erscheinung
schlanker, die Keule weniger schwer, als die Herakleische.
Besonders auf attischen Monumenten (Metopen und Fries des sogen.
Theseions in Athen) sind seine Thaten gern dargestellt worden. Vgl.
Stephani, Der Kamps zwischen T. und Minotauros (Leipz. 1842);
Roßbach, T. und Peirithoos (Tübing. 1852).
Thesiger, Frederick, s. Chelmsford.
Thesis (griech.), ein Satz, namentlich ein zum Beweis
aufgestellter (These); in der Metrik der Gegensatz von Arsis (s.
d.), ebenso in der Musik.
Thesmophorien (griech.), altes mysteriöses Fest,
welches in Athen und vielen andern Orten Griechenlands Anfang
November nach Bestellung der Wintersaat gefeiert wurde, und zwar zu
Ehren der Demeter Thesmophoros, d. h. der gesetzgebenden Demeter,
der Gründerin des Ackerbaues, der bürgerlichen
Gesellschaft sowie der rechtmäßigen Eheverbindung. Von
der Festfeier, die der Hauptsache nach in einer Prozession der
Frauen nahe dem Demetertempel am Vorgebirge Kolias bestand und mit
einem Festschmaus unter mimischen Tänzen und Spielen endete,
waren die Männer streng ausgeschlossen. Vgl. Mommsen,
Heortologie. Antiquarische Untersuchungen über die
städtischen Feste der Athener (Leipz. 1864).
Thesmotheten (griech.), s. Archonten.
Thespiä, Stadt im alten Böotien, westlich von
Theben, von deren Einwohnern 700 in den Thermopylen kämpften
und fielen, wurde von Xerxes zerstört, dann wieder aufgebaut,
um später (372 v. Chr.) von den ihr stets feindlichen
Thebanern aufs neue zerstört zu werden. T. war Geburtsort des
Praxiteles und der Phryne und blühte noch in römischer
Zeit. Ruinen bei Erimokastro.
Thespis, nach der griech. Sage der Erfinder des Dramas,
speziell der Tragödie, indem er den dithyrambischen
Chören bei den Dionysien (Bakchosfesten)
649
Thesprotia - Theuriet.
einen Monolog (und also einen Schauspieler) hinzufügte, der
in der Regel eine auf Bakchos bezügliche mythische Geschichte
enthielt, war aus Ikaria in Attika gebürtig und lebte um 540
v. Chr. Falsch ist die Nachricht, daß T. mit einer wandelnden
Bühne aus einem Karren herumgezogen sei; doch ist der
Thespiskarren für wandelnde Bühnen seit Horaz
sprichwörtlich geworden. Vgl. Schauspielkunst, S. 414.
Thesprotia, Landschaft im alten Epirus, reichte vom
Ambrakischen Meerbusen (Golf von Arta) bis an den Thyamis (Kalamas)
und ward vom Acheron (heute Phanariotiko) durchströmt. Die
Thesproter, die schon in der "Odyssee" als ein seefahrendes, von
Königen beherrschtes Volk genannt werden, waren ein
illyrischer Stamm, welcher erst allmählich sich hellenisierte;
zur Zeit des Peloponnesischen Kriegs war ihr Staat der
mächtigste in Epirus.
Thessalien, alte Landschaft im nördlichen
Griechenland, grenzt gegen W. an Epirus, von dem es der Pindos
trennt, gegen N. an Makedonien, gegen O. an das Ägeische Meer,
gegen S. an den Pagasäischen und Malischen Meerbusen und an
das Gebiet der Doloper und Änianen. Die Hauptgebirge sind: der
Olympos (2985 m), Ossa (1953 m), Pelion (Plessidi, 1620 m) im N.,
der Othrys (1728 m) im S., der Pindos (2168 m) im O. Die Gebirge im
N. und S. sind leicht zu überschreiten, so daß T.
wiederholt Völkerwanderungen und Eroberern zum Durchzugsland
diente. Ein nur 800 m hoher Gebirgszug, die berühmten
Kynoskephalä, teilt die von jenen Bergen umringte thessalische
Ebene, die einst ein Binnensee gewesen ist, in zwei
wohlbewässerte Hälften. Hauptfluß ist der Peneios.
Der Boden war fruchtbar; besonders gab es gute Weiden, weshalb die
Pferdezucht in T. zu Hause war. Die Thessalier waren als
Pferdebändiger ebenso berühmt wie als Zauberer. Die
einzelnen Stadtgebiete waren (vom Beginn der Olympiaden bis ins 3.
Jahrh. v. Chr.) in vier Bezirke (sogen. Tetraden) verteilt. Diese
waren: Hestiäotis, nebst dem Gebiet der Perrhäber, der
westliche und nördliche Teil des Landes mit den Städten
Trikka, Gomphi, Ithome; Pelasgiotis, im O. längs der Halbinsel
Magnesia mit Larissa, der größten Stadt des Landes,
Krannon, Pherä, Skotussa; Thessaliotis, der südwestliche
Teil der thessalischen Ebene, mit Kierion und Pharsalos, und
Phthiotis oder Achaia Phthiotis, der Süden u. Südosten
des Landes mit Halos und Thebä Phthiotides, wozu als
fünfte Landschaft noch der Küstenstrich Magnesia mit der
Stadt Demetrias kam, der ein selbständiges Gemeinwesen
bildete. S. Karte "Altgriechenland". - Als älteste Bewohner
des Landes werden Pelasger genannt, welche die Ureinwohner
unterjochten und zu Leibeignen machten, die unter dem Namen
Penesten einen ähnlichen unterdrückten Stand bildeten wie
die Heloten in Sparta. Die "Ilias" kennt den Namen T. noch nicht.
Der Tradition nach fielen 60 Jahre nach Trojas Fall die
wahrscheinlich illyrischen Thessalier, ein Teil der Thesproter, aus
Epirus in T. ein und veranlaßten dadurch die Dorische
Wanderung. Sie wurden später hellenisiert, blieben aber
geistig unbedeutend. Um so mehr leisteten sie in athletischen
Künsten. Unter den edlen Geschlechtern waren schon zur Zeit
der Perserkriege die Aleuaden in Larissa und die Tyrannen zu
Pherä, die ihren Ursprung auf Jason zurückführten,
berühmt. Unter dem spätern Tyrannen Alexander war T. der
Schauplatz eines Kriegs mit den Thebanern unter Pelopidas. Dann
stand T. im Bund mit Theben gegen Sparta. Nach Alexanders Ermordung
(359) riefen die Aleuaden gegen dessen Nachfolger Tisiphonos und
Lykophron den König Philipp von Makedonien zu Hilfe, der sich
aber bald selbst zum Herrn des Landes machte. Von da an blieb T. in
makedonischer Abhängigkeit, und wenn auch für Augenblicke
der Ätolische Bund im Besitz des Landes war, so war es doch
schon so weit makedonisiert, daß es keinen weitern Versuch
machte, die frühere Selbständigkeit wiederzuerlangen. Als
Philipp III. mit den Römern Krieg führte, standen die
Thessalier auf seiner Seite. Nach der Schlacht bei
Kynoskephalä, in der ersterer besiegt wurde, ward T. mit den
andern griechischen Staaten bei den Isthmischen Spielen für
frei erklärt (196) und bildete bis 146 einen Bund, um dann
unter römischen Einfluß zu gelangen. Es behielt zwar
seine Verfassung, wurde aber als Provinz behandelt. Unter den
Kaisern wurde es förmlich zu einer solchen gemacht und, da es
nicht groß genug war, zu Makedonien geschlagen. Konstantin d.
Gr. machte es dagegen zu einer eignen Provinz und stellte es unter
die Präfektur Illyrien. Hierauf kam es zum byzantinischen und
zu Anfang des 13. Jahrh. zum lateinischen Kaisertum, obwohl sich
während dieser Zeit manchmal eigne Dynasten in Besitz des
Landes setzten und darin zu behaupten wußten. 1460-1881 war
T. in der Gewalt der Türken. Jetzt bildet es die griechischen
Nomarchien Larissa und Trikkala. S. Karte "Griechenland".
Thessalonicher, Briefe an die, zwei Schriften des
neutestamentlichen Kanons, welche vom Apostel Paulus wahrscheinlich
zu Korinth abgefaßt worden sind, ihre Veranlassung in seinem
Interesse für die erst kürzlich von ihm gestiftete
Gemeinde zu Thessalonich haben und insbesondere ihre Erwartungen
von der Zukunft Christi berichtigen sollen. Neuerdings ist die
Authentie wenigstens des zweiten dieser Briefe fast gänzlich
zweifelhaft geworden. Vgl. P. Schmidt, Der erste
Thessalonicherbrief (Berl. 1885).
Thessalonike, Stadt, s. Saloniki.
Thetford, Stadt in der engl. Grafschaft Norfolk, an der
Kleinen Ouse, hat Malzdarren, Handel und (1881) 4032 Einw. T. war
früher Hauptstadt Ostanglias; die Ruinen eines Palastes und
mehrerer kirchlicher Gebäude zeugen noch von seiner ehemaligen
Bedeutung.
Thetis (nicht zu verwechseln mit Tethys), in der griech.
Mythologie Tochter des Nereus und der Doris, wider ihren Willen
Gemahlin des Peleus (s. d.), Mutter des Achilleus. Als Peleus sie
wegen des gefährlichen Mittels, durch das sie ihren Sohn
unsterblich machen wollte (s. Achilleus), tadelte, stieg sie zu
ihrem Vater in die Tiefen des Meers zurück, und nur bisweilen
begab sie sich auf die Erde, um ihrem Sohn Achilleus dle
zärtlichste Muttersorge zuwidmen.
Theuerdank, s. Pfinzing.
Thëurgie (griech.), die vorgebliche Kunst, sich
durch gewisse Zeremonien und Handlungen mit den Göttern und
Geistern in nähere Verbindung zu setzen und sie zu
Hervorbringung übernatürlicher Wirkungen für sich zu
gewinnen. Die T. hat ihren Ursprung bei den Magiern der
Chaldäer und Perser. Auch die Ägypter rühmten sich,
große Geheimnisse darin zu besitzen. Unter den Philosophen
spielte sie bei den Neuplatonikern eine große Rolle,
namentlich bei Jamblichos und Proklos. Auch im Mittelalter kommen
häufig Spuren von ihr vor. Vgl. Lobeck, Aglaophamus
(Königsb. 1829, 2 Bde.), und Litteratur bei Magie.
Theuriet (spr. töria), André, franz. Dichter
und Romanschreiber, geb. 1833 zu Marly le Roi bei Paris, studierte
die Rechte in Paris und erhielt 1857 eine Anstellung im
Finanzministerium. In demselben
650
Theux de Meylandt - Thibaudin.
Jahr veröffentlichte die "Revrte des Deux Mondes" ein
Gedicht von T.: "In memoriam", das sehr bemerkt wurde, dann aber
schwieg er lange. Erst 1867 erschien "Le chemin des bois", ein Band
Gedichte, in welchen er den Wald besang, und die ihn zum Liebling
der Frauenwelt machten (in 2. Aufl. 1877 von der Akademie
gekrönt). Weitere Werke von T. sind : "Les paysans de
l'Argonne, 1792", episches Gedicht (1871), "Le Bleu et le Noir,
poème de la vie réelle" (1872); dann die Romane:
"Mademoiselle Guignon" (1874), "Le mariage de Gérard", "Une
Ondine" (1875), "La fortune d'Angèle" (1876), "Raymonde"
(1877); ferner: "Le filleul d'un Marquis" (1878), "Le fils Maugars"
(1879), "Le sang des Finoël" (1879), "Tante Aurélie",
"Mariage de Gérard" (1884), der Novellenband "L'amoureux de
la préfète" (1888), "Deux soeurs", Roman (1889), u.
a. Die französische Akademie erkannte T. auch als
Romanschriftsteller 1878 einen ihrer ersten Preise zu. Als solcher
zeichnet er sich ebenfalls durch einen tiefen Sinn für die
Natur und ein seltenes, an George Sand erinnerndes Talent aus,
landschaftliche Stimmungsbilder zu entwerfen, und entschädigt
dadurch für eine manchmal etwas lockere Erzählung oder
ungenügende Charakterzeichnung. T. ist seit geraumer Zeit eine
der Stützen der "Revue des Deux Mondes".
Theux de Meylandt (spr. thö), Barthélemy
Theodore, Graf de, belg. Staatsmann, geb. 25. Febr. 1794 auf
Schabroek im Limburgischen, studierte zu Lüttich die Rechte,
ward Advokat daselbst, im November 1830 Mitglied des Kongresses,
1831 Mitglied der Deputiertenkammer und im Dezember d. J. Minister
des Innern. Nachdem er 1832 mit seinen Kollegen
zurückgetreten, ward er im August 1834 mit der Bildung eines
neuen klerikalen Ministeriums beauftragt, worin er nebst der
Präsidentschaft das Portefeuille des Innern und später
das des Auswärtigen übernahm. Nach dem Sturz dieser
Verwaltung 1840 ward T. in den Grafenstand erhoben und war noch
eine Zeitlang als Minister ohne Portefeuille thätig. 1846 trat
er abermals an die Spitze eines klerikalen Kabinetts, mußte
aber schon 13. Aug. 1847 infolge des Siegs der liberalen Linken bei
den Wahlen zurücktreten und war bis 1870 eins der Häupter
der klerikalen Partei in der Kammer. Ende 1871 wurde er in einem
neuen klerikalen Ministerium Präsident und Minister ohne
Portefeuille. Er starb 21. Aug. 1874 auf seinem Gut Meylandt bei
Hasselt.
Thiaki, jetziger Name von Ithaka.
Thianschan (Tienschan, "Himmelsgebirge"), mächtiges
Gebirge in Zentralasien (s. Karte "Zentralasien"), das vom 96.°
östl. L. v. Gr. in der Wüste Gobi bis zum 65.° in die
Ebenen der Bucharei unweit der Stadt Bochara reicht, und etwa 2600
km lang ist. Im O. schmal, wächst das Gebirge nach W. zu an
Breite und zerteilt sich hier in spitze, winkelig auseinander
gehende Höhenzüge (Terek-Tagh, Alexanderkette,
Transilenischer Alata u. a.), so daß die Breite schon am
Westrand des Sees Issikul 1500 km beträgt. Die einzelnen
Hauptketten erscheinen kulissenartig übereinander geschoben,
so daß die nördlichste im W. schon unter dem 77.
Meridian endigt, wo die südlichste im O. kaum begonnen. Die
Längsthäler herrschen vor, die größern
öffnen sich nach W., so das Thal des Ili im N., welches sich
zu einem breiten Steppengebiet erweitert, oder das des Tschu. Mit
Zunahme der Breite nimmt die Starrheit und Unzugänglichkeit
ab, doch ist unsre Kenntnis der Hauptzüge noch sehr
lückenhaft, viele Gipfel sind nur aus großer Ferne
visiert worden; auch tragen die einzelnen Ketten nicht immer
einheitliche Namen. Die äußerste Kette im NO., welche
die Dsungarei vom Tarimbecken trennt, reicht im Massiv des
Bogdo-ola in die Schneeregion (hier 4000 m), auch das Quelle gebiet
des Ili ist von Gletschern umstarrt, und den Issikul umgeben Gipfel
von 4500 m; die höchsten Erhebungen scheinen aber dem mittlern
Teil anzugehören, wo der Chan-Tengri 6500 m, nach einigen
sogar 7500 m erreichen soll. Die meisten Paßeinsenkungen sind
hier vergletschert, am Ostfuß des Chan-Tengri führt der
Musartpaß (3900 m) als einziger gangbarer aus dem Tekesthal
in das Tarimbecken und verbindet so Kuldscha mit Aksu. Die
westlichen Pässe sind aber für den Verkehr wichtiger,
insbesondere ist der Terek Dawan (3727 m) von alters her
Hauptstraße zwischen Ost- und Westturkistan gewesen.
Erloschene Vulkane finden sich in beträchtlicher Menge am
Westrand des Tarimbeckens, dagegen ist das Vorhandensein
thätiger Vulkane bisher nicht festgestellt worden. Das Rauchen
des früher als Vulkan bezeichneten Beschan, südlich vom
Juldusplateau, ist brennenden Kohlenlagern zuzuschreiben. Vgl.
Sewerzow, Erforschung des Thianschangebirgssystems 1867
(Ergänzungsheft zu "Petermanns Mitteilungen", Gotha 1875).
Thianschan-Nanlu, das westliche Becken des Han-hai,
besser Tarimbecken genannt ; s. Han-hai.
Thianschan-Pelu, chines. Name der Dsungarei.
Thibaudeau (spr. tibodoh), Antoine Claire, Graf, franz.
Staatsmann und Historiker, geb. 23. März 1765 zu Poitiers,
ward Advokat daselbst, 1792 Konventsdeputierter, schloß sich
der Bergpartei an und stimmte für den Tod des Königs.
Nach dem Sturz Robespierres trat er auf die Seite der
Gemäßigten, ward im März 1795 Präsident des
Konvents, dann Mitglied des Wohlfahrtsausschusses und 1796
Präsident des Rats der Fünfhundert, nach der Revolution
vom 18. Brumaire Präfekt von Bordeaux, dann Staatsrat und 1803
unter Erhebung in den Grafenstand Präfekt der Gironde,
später der Rhonemündungen. Nach der zweiten Restauration
1815 verbannt, ging er zunächst nach der Schweiz, dann nach
Prag, wo er ein Handelshaus errichtete. Nach der Julirevolution von
1830 kehrte er nach Frankreich zurück, beteiligte sich hier
aber nicht an den öffentlichen Angelegenheiten. 1852 von
Napoleon III. zum Senator ernannt, starb er 8. März 1854. Er
schrieb unter anderm: "Mémoires sur la Convention et le
Directoire" (Par. 1824, 2 Bde.); "Mémoires sur le Consulat
et l'Empire" (das. 1835, 10 Bde.); "Histoire générale
de Napoléon Bonaparte" (das. 1827 bis 1828, 5 Bde.; deutsch,
Stuttg. 1827-30); "Histoire des États généraux
et des institutions représentatives en France" (Par. 1843, 2
Bde.). Nach seinem Tod erschien: "Ma biographie; mes
mémoires 1765-92" (Par. 1875).
Thibaudin (spr. tibodäng), Jean, franz. General,
geb. 13. Nov. 1822 zu Moulins-Engilbert (Nièvre), trat 1841
in die Schule von St.-Cyr, ward 1843 Infanterieleutnant, diente
anfangs in Algier, kämpfte 1859 als Hauptmann in Italien,
befehligte 1870 als Oberst das 67. Linienregiment in der
Rheinarmee, fiel nach der Kapitulation von Metz in deutsche
Gefangenschaft und wurde in Mainz interniert. Von hier entwich er
im Dezember unter Bruch seines Ehrenworts nach Frankreich und
stellte sich hier dem Kriegsminister wieder zur Verfügung.
Nachdem er den Namen seiner Mutter, Comagny, angenommen, wurde ihm
das Kommando der 2. Division des 24. Armeekorps bei der Armee
Bourbakis und nach der
651
Thibaut IV. - Thienemann.
Absetzung des Generals Bressolles das des Korps selbst
übertragen, mit welchem T. 1. Febr. 1871 nach der Schweiz
übertrat. Nach dem Krieg wurde er zwar von der
Untersuchungskommission nicht verurteilt, aber mit Rücksicht
auf eine Reklamation der deutschen Regierung in Inaktivität
versetzt. Jedoch schon 1872 wurde er rehabilitiert, zum Obersten
des 32. Linienregiments ernannt und, da er sich als eifriger
Republikaner zeigte, bald zum Brigadegeneral und, nachdem er unter
Farre Direktor des Infanteriewesens im Kriegsministerium gewesen
war, 1882 zum Divisionsgeneral befördert. Da er bei der
Ministerkrisis Ende Januar 1883 sich bereit erklärte, die
Ausführung des Prätendentengesetzes gegen die in der
Armee dienenden Prinzen von Orléans zu übernehmen, ward
er 30. Jan. 1883 zum Kriegsminister ernannt, nahm aber schon im
Oktober d. J. auf Verlangen der übrigen Minister seine
Entlassung, da er sich weigerte, dem König von Spanien einen
Besuch zu machen. 1885 wurde er zum Kommandanten von Paris ernannt,
aber wegen seiner Beziehungen zu der durch den Ordensschacher
belasteten Frau Limouzin im November 1887 abgesetzt.
Thibaut IV. (spr. tiboh), Graf von der Champagne und
Brie, seit 1234 König von Navarra, geb. 1201, war ein eifriges
Mitglied der Adelskoalition, die sich die Minderjährigkeit
Ludwigs IX. zu nutze machen wollte. Aber der schönen Mutter
Ludwigs, Blanche von Kastilien, gelang es, den Grafen auf ihre
Seite zu ziehen und ihn später gegen die Rache seiner
frühern Freunde zu schützen. Dafür
überließ er ihr, als er den Thron von Navarra erbte, die
Grafschaften Blois, Chartres und Sancerre. T. starb 1253 in der
Champagne nach der Rückkehr aus dem Heiligen Land.
Großen Ruhm erwarb sich T. als Trouvère besonders
durch seine Liebeslieder; Dante und Petrarca zählen zu seinen
aufrichtigsten Bewunderern. Seine Gedichte, welche sich trotz ihres
kunstvollen Baues durch den leichten und graziösen Fluß
der Verse, Innigkeit und Wahrheit der Gefühle und durch reine
und klare Sprache auszeichnen, nehmen eine Art Mittelstellung ein
zwischen der nordfranzösischen Lyrik und der Poesie der
Troubadoure, und man wird kaum fehl gehen, wenn man annimmt,
daß die zartesten und duftigsten Blüten seiner Dichtung
unter dem Einfluß des liederreichen Hofs von Navarra
erblüht sind. Von den 66 überlieferten Liedern sind 39
Liebeslieder, die andern Kampflieder, fromme Rügelieder etc.;
sie sind herausgegeben von Lévesque de la Ravallière
(Par. 1742, 2 Bde.) und von Tarbé (Reims 1851). Vgl.
Delbarre, Vie de T. (Laon 1850).
Thibaut (spr. tiboh), Anton Friedrich Justus,
ausgezeichneter Lehrer des röm. Rechts, geb. 4. Jan. 1772 zu
Hameln, studierte in Göttingen, Königsberg und Kiel, ward
1798 Professor in Kiel, 1802 nach Jena und 1806 nach Heidelberg
berufen, wo er 28. März 1840 starb. Sein Hauptwerk ist das
"System des Pandektenrechts" (Jena 1803, 2 Bde.; 9. Aufl. von
Buchholtz, das. 1846). Gemeinschaftlich mit Löhr und
Mittermaier gab er Bd. 6-23 des "Archivs für die zivilistische
Praxis" (Heidelb. 1823-40) heraus. Seinen "Juristischen
Nachlaß" veröffentlichte Guyet (Berl. 1841-42, 2 Bde.).
Als Kenner der klassischen Musik bewies er sich in der Schrift
"Über Reinheit der Tonkunst" (Heidelb. 1825, 6. Aufl. 1884).
Vgl. E. Baumstark, A. F. J. T. (Leipz. 1841).
Thibet, Land, s. Tibet.
Thièle (spr. tjähl, Zihl), linksseitiger
Nebenfluß der Aare, 134 km lang, entsteht als Orbe in dem
französischen Jurasee Lac des Rousses (1075 m ü. M.),
durchfließt, im Val de Joux auf Schweizergebiet
übergetreten, den Lac de Joux (1009 m ü. M.) und den Lac
Brenet, verschwindet von hier an durch einen Trichter, in welchem
die Werke einer Mühle sich befinden, unter den Kalkfelsen und
kommt erst 4 km weiter als "Source de l'Orbe" aus einer hohen
Felswand wieder hervor (783 m). Bald wieder einen ansehnlichen
Bergstrom bildend, zieht die T. durch das enge Thal von Valorbe,
betritt unterhalb des Städtchens Orbe ein weites Sumpfland und
mündet, schon unter dem Namen Toile oder (Obere) T., in den
Neuenburger See (435 m). Als Mittlere Zihl verläßt der
Fluß sein großes Läuterungsbassin und erreicht
jetzt in geradem, kanalisiertem Lauf den Bieler See. Die Untere T.,
vom Austritt aus diesem Seebecken bis zur Aare, ist jetzt, nach
Ausführung großer hydrotechnischer Arbeiten, mit der
Aare selbst vereinigt und erreicht deren altes Bett bei
Meienried-Buren (430 m). S. Juragewässerkorrektion.
Thielmann, Johann Adolf, Freiherr von, preuß.
General, geb. 27. April 1765 zu Dresden, trat 1782 in ein
sächsisches Chevaulegers-Regiment, ward 1784 Leutnant, 1790 zu
einem Husarenregiment versetzt, machte die Feldzüge am Rhein
mit, ward 1798 Stabsrittmeister und focht 1806 bei Jena. Am 15.
Okt. d. J. an Napoleon I. gesandt, ward er ganz von Bewunderung
für diesen erfüllt und betrieb die Allianz Sachsens mit
Frankreich. Er diente als Major und Flügeladjutant im
polnischen Feldzug, ward 1809 Oberst und Generaladjutant sowie kurz
darauf Generalmajor, deckte im Kriege gegen Österreich
Sachsen, ward 1810 Generalleutnant, kommandierte 1812 in
Rußland eine Kavalleriebrigade und zeichnete sich besonders
in der Schlacht an der Moßkwa aus, wofür er in den
Freiherrenstand erhoben wurde. 1813 war er dafür, daß
Sachsen sich von Napoleon lossage, und suchte als Kommandant von
Torgau die dort versammelten Truppen zur Vereinigung mit den
Alliierten zu bewegen. Als ihm dies nicht gelang, ging er im Mai
allein zu denselben über, ward erst Befehlshaber eines
Streifkorps, dann des sächsischen Korps, das er 1814 in
Frankreich befehligte, trat 9. April 1815 in preußische
Dienste über, führte 1815 bei Ligny und besonders bei
Wavre das 3. Armeekorps, ward 1816 kommandierender General des 7.,
1819 des 8. Korps und starb als General der Kavallerie 10. Okt.
1824 in Koblenz. Vgl. v Minckwitz, Die Brigade T. in dem Feldzug
von 1812 in Rußland (Dresd. 1879).
Thielt, Arrondissementshauptstadt in der belg. Provinz
Westflandern, Knotenpunkt der Eisenbahnen Lichtervelde-T. und
Deynze-Ingelmünster, hat ein Kommunalcollège,
Spitzenklöppelei, Leinweberei, Ölfabrikation, Handel und
(1888) 9850 Einw.
Thiene (spr. ti-ene), Distriktshauptstadt in der ital.
Provinz Vicenza, an der Eisenbahn Vicenza-Schio gelegen, hat einen
Palast mit Fresken von Veronese, bedeutende Tuchfabrikation und
(1881) 5217 Einw.
Thienemann, Friedrich August Ludwig, Ornitholog, geb. 25.
Dez. 1793 zu Gleina an der Unstrut, studierte seit 1813 in Leipzig
Medizin und Naturwissenschaften, bereiste seit 1820 den Norden
Europas, namentlich Island, ward 1825 als Inspektor des
königlichen Naturalienkabinetts nach Dresden berufen und 1839
zum königlichen Bibliothekar ernannt, legte aber schon 1842
aus Gesundheitsrücksichten diese Stelle wieder nieder und
starb 24. Juni 1858 in Trachenberg bei Dresden. Seine Hauptwerke
sind
652
Thienen - Thiers
die "Systematische Darstellung der Fortpflanzungsgeschichte der
Vögel Europas" (mit seinem Bruder G. A. W. Thienemann und Chr.
L. Brehm, Leipz. 1825 bis 1838, 5 Abtlgn.) und
"Fortpflanzungsgeschichte der gesamten Vögel" (das. 1845-56,
10 Hefte mit 100 Tafeln); "Reise im Norden Europas" (das. 1824 bis
1827, 2 Bde.).
Thienen, Stadt, s. Tirlemont.
Thiengen, Stadt im bad. Kreis Waldshut, an der Wutach und
der Linie Mannheim-Konstanz der Badischen Staatsbahn, 350 m ü.
M., hat eine kath. Kirche, ein Schloß, 2 Bezirksforsteien,
Baumwollspinnerei und -Weberei, Verbandstofffabrikation, Viehhandel
und (1885) 2231 meist kath. Einwohner.
Thierfelder, Albert, Komponist, geb. 30. April 1846 zu
Mühlhausen i. Th., einer der letzten Schüler von Moritz
Hauptmann, wirkte als Dirigent zuerst in Elbing, dann in
Brandenburg und wurde 1886 als Universitätsmusikdirektor nach
Rostock berufen. Er schrieb eine Symphonie in C moll, Sonaten, ein
Klavierquartett, das Chorwerk "Zlatorog" (Text von Rud. Baumbach)
für Chor, Solo und Orchester, mit verbindender Deklamation, u.
a.
Thierry (spr. tjerri), 1) Augustin, hervorragender franz.
Geschichtschreiber, geb. 10. Mai 1795 zu Blois, besuchte die
Normalschule in Paris, widmete sich dem Studium der Geschichte,
namentlich der französischen und englischen, ward 1830
Mitglied der Akademie und starb erblindet 22. Mai 1856 in Paris. Er
schrieb: "Histoire de la conquête de l'Angleterre par les
Normands" (Par. 1825, 4 Bde.; deutsch, Berl. 1830-1831, 2 Bde.),
"Lettres sur l'histoire de France" (Par. 1827, 13. Aufl. 1868),
"Dix ans d'études historiques" (1834, 11. Aufl. 1868),
"Récits des temps mérovingiens" (1840, 2 Bde., in
vielen Ausgaben; deutsch, Elberf. 1855), die von der Akademie mit
einem Hauptpreis gekrönt wurden, "Essai sur l'histoire de la
formation et des progrès du tiers-état" (1853, neue
Ausg. 1868), welche Werke zuletzt in 9 Bänden (Par. 1883)
gesammelt erschienen, und gab den "Recueil des monuments
inédits de l'histoire du tiers-état" (das. 1843-70, 4
Bde.) heraus. Vgl. Aubineau, M. Aug. T., son système
historique et ses erreurs (2. Aufl., Par. 1879).
2) Amédée, namhafter franz. Geschichtschreiber,
Bruder des vorigen, geb. 2. Aug. 1797 zu Blois, erhielt eine
Professur in Besançon, ward nach der Julirevolution zum
Präfekten des Departemnts Obersaône ernannt, 1831 in die
Akademie aufgenommen, 1838 Requetenmeister im Staatsrat und 1860
Senator; starb 27. März 1873. Er schrieb: "Histoire des
Gaulois jusqu'à la domination romaine" (Par. 1828, 3 Bde.;
6. Aufl. 1877, 2 Bde.); "Histoire de la Gaule sous la domination
romaine" (1840-47, 3 Bde.; 4. Aufl., 2 Bde.); "Récits (und
"Nouveaux récits") de l'histoire romaine au V.
siècle" (1860-1878, 6 Bde.: "Alaric", "Placidie", "Derniers
temps de l'Empire d'Occident", "Saint Jérôme, la
société chrétienne à Rome et
l'emigration romaine en Terre Sainte", "Saint Jean Chrysostome et
l'impératrice Eudoxie", "Nestorius et Eutychès");
"Tableau de l'Empire romain" (das. 1862 u. öfter); "Histoire
d'Attila et de ses successeurs" (das. 1864; 6. Aufl. 1876, 2 Bde.;
deutsch, Leipz. 1874).
Thiers (spr. tjähr), Arrondissementshauptstadt im
franz. Departement Puy de Dôme, malerisch am steilen Abhang
des Besset (623 m) über der Durolle gelegen, Station der
Eisenbahn von St.-Etienne nach Clermont-Ferrand (Abzweigung nach
St.-Germain des Fossés), hat 2 Kirchen aus dem 11. Jahrh.,
viele mittelalterliche Häuser, ein Handelsgericht,
Collège, Gewerbeschule, Handelskammer u. (1886) 11,753 Einw.
T. ist der Mittelpunkt einer ausgedehnten Messerindustrie, welche
über 400 Werkstätten mit gegen 12,000 Arbeitern
beschäftigt, und betreibt außerdem Fabrikation von
Papier, Quincaillerien, Kerzen, Decken, Asphalt und Leder sowie
lebhaften Handel.
Thiers (spr. tjähr), Louis Adolphe, franz.
Staatsmann und Geschichtschreiber, geb. 15. April 1797 zu Marseille
als Sohn eines Advokaten, studierte in Aix die Rechte, ließ
sich 1820 daselbst als Advokat nieder, begab sich aber schon im
September 1821 mit seinem Freund Mignet nach Paris, um dort als
Journalist seine Talente geltend zu machen. Er schrieb zuerst
für den "Constitutionnel", das vornehmste Organ der liberalen
Partei, und veröffentlichte außer einer mehrfach
aufgelegten Schrift über Jean Law (1826, neue Ausg. 1878)
1823-27 seine "Histoire de la Révolution française"
in 6 Bänden (15. Aufl. 1881, 10 Bde.; deutsch von Jordan,
Leipz. 1854), welche seinen Ruhm als Historiker begründete.
Als Karl X. durch die Ernennung des Ministeriums Polignac der
liberalen Partei den Krieg erklärte, gründete diese unter
der Leitung von T., Armand Carrel und Barrot im Januar 1830 den
"National", der durch die Kraft und Kühnheit seiner Polemik
gegen die bestehende Dynastie bald großen Einfluß
gewann. Besonders elektrisierte die Massen das von T. erfundene
Schlagwort: "Le roi règne, mais ne gouverne pas". Als 26.
Juli 1830 die berüchtigten Ordonnanzen erschienen,
versammelten sich die Redakteure aller liberalen Journale im
Büreau des "National" und erließen unter T.' Leitung
einen Protest gegen diese Regierungsmaßregel. Nachdem Sieg
der Revolution führte T. die Unterhandlungen mit dem Herzog
von Orléans, der auch 31. Juli auf dem Stadthaus den von T.
an der Spitze einer Deputation wiederholten Antrag, den Thron zu
besteigen, annahm. Als die Ordnung wiederhergestellt war, wurde T.
11. Aug. zum Staatsrat und Generalsekretär, sodann Anfang
November von Laffitte zum Unterstaatssekretär der Finanzen
ernannt. Zu derselben Zeit von der Stadt Aix in die
Deputiertenkammer gewählt, bildete er sich rasch zu einem
Redner aus, dessen Präzision und Gewandtheit bald Anerkennung
fanden. Hierdurch und durch seine administrativen Gaben den
regierenden Kreisen empfohlen, ward er nach Périers Tod 11.
Okt. 1832 Minister des Innern, 25. Dez. 1832 des Handels und der
öffentlichen Arbeiten. Bei der Umgestaltung des Kabinetts 4.
April 1834 übernahm er wieder das Departement des Innern.
Während ihn die Strenge, die er bei der Unterdrückung der
demokratischen Unruhen in Paris und Lyon zeigte, auf immer mit
seinen alten republikanischen Freunden entzweite, ward er dem Hof
noch unentbehrlicher und behauptete sich 1834-36 trotz mehrfacher
Ministertwechsel im Kabinett, die "Politik des Widerstandes" mit
Erfolg verfechtend. Im Februar 1836 erhielt er den Vorsitz im neuen
Kabinett zugleich mit dem Portefeuille des Auswärtigen,
mußte aber schon 26. Aug. 1836 zurücktreten, da der
König dem schon beschlossenen Einschreiten in Spanien zu
gunsten des Liberalismus seine Zustimmung versagte, und stand nun
zwei Jahre lang an der Spitze der dynastischen Opposition. Seit 13.
Dez. 1834 war er auch Mitglied der Akademie. Am 1. März 1840
als Minister des Auswärtigen wieder an die Spitze des
Kabinetts gestellt, bewirkte er die Zurückführung der
Leiche Napoleons I. von St. Helena und die Befestigung von Paris.
Sein Plan, der Quadrupelal-
653
Thiers (Louis Adolphe).
lianz vom 15. Juli entgegen den Vizekönig von Ägypten
zu unterstützen und in dem allgemeinen Krieg die Rheingrenze
wiederzugewinnen, scheiterte an der Weigerung des friedfertigen
Königs. T. reichte daher 21. Okt. seine Entlassung ein und
griff den schon früher gefaßten Plan wieder auf, die
Geschichte Napoleons I. zu schreiben, zu welchem Behuf er 1841 bis
1845 dessen Schlachtfelder in Deutschland und Italien bereiste. In
der Kammer gesellte er sich wieder zur Opposition, deren
Führung er jedoch nicht erlangte, obwohl er bei den
Verhandlungen über die Regentschaft (1842), die Jesuiten
(1845) und die Rechte der Universität (1846) heftig gegen die
Regierung auftrat. Als die Februarrevolution von 1848 den
König zwang, das Ministerium Guizot zu entlassen, sollte T.
mit Barrot ein neues bilden, durch welches Ludwig Philipp den Sturm
besänftigen wollte. Dasselbe kam aber nicht mehr zu stande,
und T. hielt es für geraten, nach Proklamierung der Republik
Paris zu verlassen. Er blieb Orléanist und nahm in der
Nationalversammlung eine Mittelstellung ein. Den Plänen
Napoleons wirkte er eifrig entgegen und ward daher beim
Staatsstreich 2. Dez. 1851 verhaftet und dann in das Ausland
entlassen. 1852 ward ihm die Rückkehr nach Frankreich
gestattet, wo er sich elf Jahre lang vom öffentlichen
politischen Leben fern hielt und sich ganz der schriftstellerischen
Thätigkeit widmete. Die Frucht derselben war die "Histoire du
Consulat et de l'Empire" (Par. 1845 bis 1862, 20 Bde.; Register
1869; deutsch von Bülau, Leipz. 1845-62, 20 Bde.; von
Burckhardt und Steger, das. 1845-60, 4 Bde.). 1863 wurde T. in
Paris in den Gesetzgebenden Körper gewählt und ward hier
der Führer der kleinen, aber mächtigen Opposition. Er
bekämpfte in glänzenden Reden ("Discours prononcés
au Corps législatif", Par. 1867) besonders den falschen
Konstitutionalismus und die auswärtige Politik des
Kaiserreichs, sowohl in Zollfragen als namentlich die Intervention
in Italien, welche die Gründung der italienischen Einheit, und
sein Verhalten 1864-66 in der deutschen Frage, welches Sadowa zur
Folge gehabt habe. Um das legitime Übergewicht Frankreichs zu
behaupten, drang er auch auf Aufrechthaltung eines tüchtigen
stehenden Heers nach altem System, da er von allgemeiner
Wehrpflicht und Volksbewaffnung nichts wissen wollte. Mit um so
größerer Energie widersetzte er sich 15. Juli 1870 der
übereilten Kriegserklärung und erklärte mit
später bestätigter Einsicht Frankreich für nicht
gerüstet. Nach dem Sturz des Kaiserreichs übernahm er im
September eine Rundreise an die Höfe der
Großmächte, um sie zu einer Intervention für
Frankreich zu veranlassen, kehrte aber Ende Oktober unverrichteter
Sache zurück und begann nun im Auftrag der Regierung
Unterhandlungen mit dem deutschen Hauptquartier über einen
Waffenstillstand, die ebenso erfolglos endeten. Bei den Wahlen
für die Nationalversammlung ward er in 20 Departements zum
Deputierten und, da alle Parteien ihr Vertrauen auf ihn setzten,
schon 17. Febr. 1871 von der Versammlung zum Chef der
Exekutivgewalt gewählt. Seine erste Aufgabe war, den Frieden
mit Deutschland zu stande zu bringen; er führte selbst die
Verhandlungen mit Bismarck und rettete wenigstens Belfort. Am 1.
März setzte er die Annahme des Friedens in der
Nationalversammlung durch und bewog 10. März diese, ihren Sitz
nach Versailles zu verlegen. Der Kommuneaufstand in Paris 18.
März brachte T. in die höchste Bedrängnis, und nur
seinem Mut und Selbstvertrauen sowie seiner unermüdlichen
Thätigkeit war es zu danken, daß derselbe
überwunden und gleichzeitig 10. Mai der definitive Friede mit
Deutschland abgeschlossen wurde. Daran schlossen sich die
erfolgreichen Maßregeln zur Beschassung der nötigen
Geldmittel. Am 31. Aug. 1871 ward er auf drei Jahre zum
Präsidenten der Republik ernannt. Nun begannen aber die
Schwierigkeiten des Parteigetriebes in der Nationalversammlung. Die
monarchistischen Parteien sahen sich in ihren Hoffnungen auf T.'
energische Unterstützung getäuscht und rächten sich
durch gehässige Angriffe und Ränke, obwohl T. den
klerikalen Ansprüchen möglichst nachgab. Als daher T.,
überzeugt, daß die Herstellung des Königtums in
Frankreich, besonders des orléanistischen, eine
Unmöglichkeit und die Republik die einzig mögliche
Regierungssorm sei, 11. Nov. 1872 die definitive Konstituierung der
Republik von der Nationalversammlung verlangte, beschloß die
klerikal-monarchistische Majorität derselben, da die Zahlung
der Kriegsentschädigung an Deutschland und die Räumung
des Gebiets durch den Vertrag vom 15. März 1873 gesichert
waren, T. zu stürzen. Am 19. Mai brachte die Rechte eine
Interpellation ein über das neue Ministerium, welches T.
berufen hatte, um seine Verfassungsvorschläge für die
Republik durchzuführen; nach heftiger Debatte ward 23. Mai ein
Tadelsvotum gegen dies Ministerium mit 360 gegen 344 Stimmen
angenommen und, als T. darauf seine Entlassung gab, diese mit 368
gegen 338 Stimmen genehmigt. T. zog sich darauf wieder vom
öffentlichen Leben zurück und nahm nur an wichtigen
Abstimmungen in der Deputiertenkammer teil. Nach dem Staatsstreich
vom 16. Mai 1877 richteten sich die Hoffnungen aller Republikaner
wieder auf T. als das Haupt einer gemäßigten Republik,
aber er starb plötzlich 3. Sept. 1877 zu St.-Germain en Laye
infolge. eines Schlaganfalls und wurde am 8. in Paris feierlich
bestattet. 1879 wurde ihm ein Standbild in Nancy, 1880 ein solches
in St.-Germain errichtet. T., von kleiner Gestalt, aber scharf
geschnittenen, lebendigen Zügen, war einer der bedeutendsten
Staatsmänner Frankreichs im 19. Jahrh. und jedenfalls der
populärste. Seine Doktrin war die des konstitutionellen
Systems, in welchem der aufgeklärte, wohlhabende
Bürgerstand die beste Sicherung seiner geistigen und
materiellen Güter erblickte, und welches T. unter der
Julimonarchie verwirklicht zu sehen gehofft hatte. Deshalb war ihm
die militärische Demokratie eines Napoleon III. verhaßt.
Aber über allen Doktrinen stand bei T. seine Nation,
Frankreich. Dessen Ruhm und Größe zu vermehren, war sein
höchstes Ziel, wie er denn auch ein echter Franzose mit allen
Vorzügen und Schwächen dieses Volkes war; er besaß
eine unermüdliche Arbeitskraft, feine, edle Bildung,
Scharfblick, eine sanguinische Elastizität des Geistes und
echten Patriotismus, dabei aber eine naive Selbstsucht und
Eitelkeit. Als Geschichtschreiber verherrlichte er die
Freiheitsideen der französischen Revolution und den Kriegsruhm
Napoleons I. in schwungvoller Sprache und glänzender
Darstellung, jedoch keineswegs stets wahrheitsgetreu und
unparteiisch. Ganz erfüllt von der Idee, daß Frankreichs
berechtigte Suprematie das politische Gleichgewicht Europas bedinge
und die kleinen deutschen und italienischen Staaten für diese
Suprematie notwendig seien, war er ein heftiger Gegner der
italienischen und deutschen Einheitsbestrebungen und, obwohl
Voltairianer, ein Beschützer des Kirchenstaats. T.' "Discours
parlementaires" wurden von Calmon (1879 bis 1883, 15 Bde.)
herausgegeben. Vgl. Laya, Étu-
654
Thiersch.
des historiques sur la vie privée, politique et
littéraire de M. T. 1830-46 (Par. 1846 2 Bde.); Derselbe,
Histoire populaire de M. T. (das. 1872); Richardet, Histoire de la
présidence de M. T. (das. 1875); Eggenschwyler,T.' Leben und
Werke (Bern 1877); Jules Simon, Le gouvernement de M. T. (Par.
1878, 2 Bde.); Derselbe, T., Guizot, Remnsat (das. 1885); Mazade,
M. T. (das. 1884); P. de Remusat,A. T. (das. 1889).
Thiersch, 1) Friedrich, namhafter Philolog, geb. 17. Juni
1784 zu Kirchscheidungen bei Freiburg a. d. Unstrut, vorgebildet in
Naumburg und Schulpforta, studierte seit 1804 in Leipzig und
Göttingen Theologie und Philologie, ward 1808 Kollaborator am
Gymnasium zu Göttingen und Privatdozent an der
Universität, 1809 Professor an dem neuerrichteten Lyceum zu
München, begründete hier das 1812 mit der Akademie
verbundene philologische Institut und zur Vereinigung der
jüngern Gelehrten die "Acta philologorum Monacensium"
(Münch. 1811-29, 4 Bde.) und ward 1826 nach der Verlegung der
Universität Landshut nach München ordentlicher Professor
der Philologie und Direktor des philologischen Seminars daselbst.
1831-32 war er in Griechenland, wo er nach dem Tod Kapo d'Istrias'
an der Regierung teilnahm und namentlich für Erwählung
des Prinzen Otto von Bayern zum König wirkte; 1848 wurde er
zum Präsidenten der Akademie der Wissenschaften erwählt.
Er starb 25. Febr. 1860. T. ist die Wiederbelebung der
philologischen Studien in Bayern zu danken. Von seinen Schriften
gehören hierher: "Griechische Grammatik, vorzüglich des
Homerischen Dialekts" (Leipz. 1812, 3. Aufl. 1826); "Griechische
Grammatik für Schulen" (das. 1812, 4. Aufl. 1855); "Über
die Epochen der bildenden Kunst unter den Griechen" (Münch.
1816-19, 2 Bde.; 2. Aufl. 1829); die Bearbeitung des Pindar (Leipz.
1820, 2 Bde.); "Allgemeine Ästhetik in akademischen
Lehrvorträgen" (Berl. 1846). Er hat aber auch sehr segensreich
auf die Gestaltung des höhern Schulwesens überhaupt
eingewirkt; er veröffentlichte hierüber: "Über
gelehrte Schulen, mit besonderer Rücksicht auf Bayern"
(Stuttg. 1826-37, 3 Bde. in 12 Abtlgn.); "Über den Zustand der
Universität Tübingen" (Münch. 1830; "Über die
neuesten Angriffe auf die Universitäten" (Stuttg. 1837) und
"über den gegenwärtigen Zustand des öffentlichen
Unterrichts in den westlichen Staaten von Deutschland, in Holland,
Frankreich und Belgien" (das. 1838, 3 Bde.). Auch sonst vertrat er
die Grundsätze freierer Lebensgestaltung. In der Schrift
"Über den angenommenen Unterschied zwischen Nord- und
Süddeutschland" (Münch. 1810) trat er für die
angefeindeten Norddeutschen auf, in "Über Protestantismus und
Kniebeugung in Bayern" (drei Sendschreiben an Döllinger, Marb.
1844) für seine protestantischen Glaubensgenossen. Noch
schrieb er: "De l'état actuel de la Grèce et des
moyens d'arriver à sa restauration" (Leipz. 1833, 2 Bde.).
Sein Leben beschrieb sein Sohn Heinrich T. (Leipz. 1866-67, 2
Bde.). - Sein Bruder Bernhard, geb. 26. April 1794 zu
Kirchscheidungen, 1817 Lehrer in Gumbinnen, 1818 in Lyck, 1823 in
Halberstadt, 1832 Direktor des Gymnasiums in Dortmund, gest. 1.
Sept. 1855 als Emeritus in Bonn, veröffentlichte: "Über
das Zeitalter und Vaterland des Homer" (Halberst. 1824, 2. Aufl.
1832), eine Ausgabe des Aristophanes (nur Bd. 1 und 6, Leipz. 1830)
und der "Thesmophoriazusen" von Aristophanes (Halberst. 1832),
Forschungen über die westfälischen Femgerichte u. a. T.
ist der Dichter des Preußenliedes.
2) Heinrich Wilhelm Josias, Sohn von T. 1), der
wissenschaftliche Vertreter des Irvingianismus in Deutschland, geb.
5. Nov. 1817 zu München, studierte daselbst Philologie, in
Erlangen Theologie, ward 1839 Privatdozent der theologischen
Fakultät zu Erlangen und 1843 Professor in Marburg, legte aber
1850 diese Stelle nieder, um als Pastor an der sich damals in
Norddeutschland bildenden irvingianischen Gemeinde zu wirken, lebte
seit 1864 ohne Amt in München, Augsburg und Basel, wo er 3.
Dez. 1885 starb. Unter seinen Schriften sind zu nennen: "Versuch
zur Herstellung des historischen Standpunktes für die Kritik
der neutestamentlichen Schriften" (Erlang. 1845); "Vorlesungen
über Katholizismus und Protestantismus" (2. Aufl., das. 1848,
2 Bde.); "Über christliches Familienleben" (8. Aufl., Augsb.
1888); "Die Kirche im apostolischen Zeitalter" (3. Aufl., das.
1879); "Döllingers Auffassung des Urchristentums" (Erlang.
1862); "Die Strafgesetze in Bayern zum Schutz der Sittlichkeit"
(Münch. 1868); "Die Gleichnisse Christi" (2. Aufl., Frankf.
1875); "Die Bergpredigt Christi" (2. Aufl., Augsb. 1878);
"Über den christlichen Staat" (Frankf. 1875); "Christian
Heinr. Zellers Leben" (Basel 1876, 2 Bde.); "Die Anfänge der
heiligen Geschichte" (das. 1877); "Über die Gefahren und
Hoffnungen der christlichen Kirche" (2. Aufl., das. 1878);
"Inbegriff der christlichen Lehre" (das. 1886); ferner außer
der Biographie seines Vaters (s. oben): "Griechenlands Schicksale
vom Anfang des Befreiungskriegs bis auf die gegenwärtige
Krisis" (Frankf. 1863). Vgl. Wigand, H. W. T.' Leben, zum Teil von
ihm selbst erzählt (Basel 1887).
3) Karl, Mediziner, Bruder des vorigen, geb. 20. April 1822 zu
München, studierte daselbst, in Berlin, Wien u. Paris, ward
1848 Prosektor für pathologische Anatomie in München,
machte den zweiten schleswig-holsteinischen Krieg unter Stromeyer
als freiwilliger Arzt mit und stellte 1854 bei einer
Choleraepidemie in München experimentelle Untersuchungen
über die Ansteckungsfähigkeit der Cholera an. 1854 wurde
er als Professor der Chirurgie nach Erlangen, 1867 nach Leipzig
berufen. 1870 machte er als konsultierender Generalarzt im 12.
Armeekorps den Krieg gegen Frankreich mit. T. zählt zu den
ersten Chirurgen der Gegenwart. Nach einem von ihm in Gemeinschaft
mit Wunderlich entworfenen Plan wurde das neue Stadtkrankenhaus zu
Leipzig, ein Musterinstitut ersten Ranges, erbaut. Seine
hervorragendsten Untersuchungen beziehen sich auf die Wundheilung,
deren feinere Vorgänge er mikroskopisch zu erforschen suchte.
Die gewonnenen Resultate wurden im "Handbuch der Chirurgie" von
Billroth und Pitha veröffentlicht. Auch die praktische Seite
der Wundheilung förderte T. als einer der ersten durch
Einführung der Salicylsäure als Verbandmittels. über
den Epithelialkrebs lieferte er eine bahnbrechende Arbeit (Leipz.
1865).
4) Ludwig, Maler, geb. 12. April 1825 zu München als Sohn
von T. 1), besuchte die dortige Akademie, um sich unter
Schwanthaler der Bildhauerkunst zu widmen, ging aber nach einigen
Jahren zur Malerei über, worin er Schüler von Heinrich
Heß, Schnorr und insbesondere von Schorn wurde. Nachdem er
eine Sakuntala (1848) und eine Kamisardenszene gemalt, begab er
sich nach Rom und malte Szenen aus dem italienischen Volksleben
sowie einen Hiob unter seinen Freunden. 1852 reiste er mit seinem
Vater nach Athen, schmückte die dortige byzantinische Kirche
des heil. Nikodemus mit Fresken und wurde 1856 nach Wien berufen,
wo er in der griechischen Kirche ebenfalls Fresken ausführte.
Nachdem
655
Thiersheim - Thiviers.
er für den Baron Sina die in Rom entworfenen Kartons:
Charon als Seelenführer, Bakchos' Einzug in den Hain von
Kolonos und Thetis' Klage um Achilleus ausgeführt hatte,
folgte er 1860 einem Ruf nach Petersburg, wo er zahlreiche Bilder
in den Kapellen der Großfürsten Nikolaus und Michael und
in der protestantischen Katharinenkirche malte. Nach seiner
Rückkehr entstanden für die Stiftskirche in Kempten die
Auferweckung der Tochter des Jairus und Christus in Gethsemane,
1866 die Predigt des Paulus auf dem Areopag und in den folgenden
Jahren Christus am Teich Bethesda, eine Ceres, die ihre Tochter
sucht, ein Christus in der Wüste, Alarich in Athen als Sieger
gefeiert und eine Kreuztragung Christi.
5) Friedrich, Architekt, Sohn von T. 2), geb. 18. April 1852 zu
Marburg, besuchte 1868-73 das Polytechnikum in Stuttgart und
bildete sich dann im Atelier von Mylius und Bluntschli für den
praktischen Beruf aus. 1877 und 1878 bereiste er Italien und
Griechenland und entwarf dann mit dem Maler Keuffel die Kartons
für die dekorativen Malereien im Haupttreppenhaus des neuen
Stadttheaters in Frankfurt a. M. Auf Grund dieser Arbeiten wurde er
1879 als Professor der Architektur an die Kunstakademie und die
technische Hochschule in München berufen. Er beteiligte sich
an der Konkurrenz um den Zentralbahnhof in Frankfurt a. M., wobei
sein Entwurf angekauft wurde, und 1881 an der Konkurrenz um die
Rheinbrücke in Mainz. Hier erhielt sein mit den Ingenieuren
Lauten und Bilfinger entworfenes Projekten ersten Preis. In weitern
Kreisen wurde sein Name durch die Konkurrenz um das deutsche
Reichstagsgebäude bekannt, bei welcher ihm ebenfalls der erste
Preis zuerkannt wurde. Jedoch ward nicht er, sondern Wallot mit der
Ausführung des Gebäudes betraut. T. veröffentlichte:
"Die Königsburg von Pergamon" (Stuttg. 1882).
Thiersheim, Flecken im bayr. Regierungsbezirk
Oberfranken, Bezirksamt Wunsiedel, hat eine evang. Kirche, ein
Amtsgericht und (1885) 1178 Einw.
Thiessow, Dorf und Seebad im preuß.
Regierungsbezirk Stralsund, Kreis Rügen, auf der
Südspitze der Halbinsel Mönchgut, hat eine Lotsenstation
und 189 Einwohner.
Thietmar (Dietmar), Bischof von Merseburg,
Geschichtschreiber der Zeit der sächsischen Kaiser, geb. 976
als Sohn des Grafen Siegfried von Walbek, mit dem sächsischen
Kaiserhaus verwandt, im kaiserlichen Stift zu Quedlinburg, im
Klosterberge und in Magdeburg gebildet, wurde 1002 Propst des von
seinem Großvater gestifteten Klosters Walbek, 1009 Bischof
von Merseburg und starb 1. Dez. 1019. Er schrieb eine Chronik in
acht Büchern, welche die Geschichte von 908 bis 1018
umfaßt und an die Geschichte Merseburgs, Sachsens und der
Wendenkriege wertvolle Mitteilungen zur Reichsgeschichte
anschließt. T. ist in der Geschichte seiner Zeit gut
unterrichtet, wahrheitsliebend und anschaulich in der Darstellung;
namentlich sind die drei letzten Bücher (1014-18) fast wie ein
Tagebuch. Weniger gut ist sein lateinischer Stil und die
Komposition, da er immer neue Zusätze und Nachträge
hinzufügte, die sich, da die eigne Handschrift Thietmars
erhalten ist, leicht erkennen lassen. Die einzige zuverlässige
Ausgabe ist die von Lappenberg in den "Monumenta Germaniae
historica", Script. III (besonders, Hannov. 1889), die beste
Übersetzung die von Laurent (2. Aufl., Berl. 1879).
Thimothygras, s. Phleum.
Thing, s. Ding.
Thinis, die älteste Stadt Ägyptens und Heimat
des ersten Pharao, Mena oder Menes, des Begründers des
ägyptischen Reichs und der Stadt Memphis, lag in
Oberägypten westlich vom Nil, wo sich ca. 18 km südlich
von Girge bei El Cherbe und Kôm es Sultân seine Reste
erhalten haben, unweit der mit ihm in engen Beziehungen stehenden
Totenstadt Abydos (s. d. 2).
Thiocyanverbindungen, s. Rhodanverbindungen.
Thionville (spr. tiongwil), Stadt, s. Diedenhofen.
Thioschwefelsäure, s. Unterschweflige
Säure.
Thiosulfate, Unterschwefligsäuresalze, z. B.
Natriumthiosulfat, unterschwefligsaures Natron.
Thirlmere (spr. thirlmihr), kleiner See in der engl.
Grafschaft Cumberland, 1877 von der Stadt Manchester angekauft, die
ihn in ein großes Reservoir für neu zu erbauende
Wasserwerke verwandelt hat.
Thirsk, Stadt in Yorkshire (England), malerisch am
Ostrand der Ebene von York und am Fuß der Hambletonhügel
gelegen, mit (1881) 3337 Einw.
Thirst-quenchers (engl., spr. thörst-kwenntschers,
"Durstlöscher"), moussierende Pastillen gegen Durst.
Thisted, dän. Amt, den nordwestlichsten Teil von
Jütland umfassend, 1688 qkm (30,6 QM.) mit (1880) 64,007 Einw.
Die gleichnamige Hauptstadt im sogen. Thyeland, am nördlichen
Ufer des Limfjords, Endpunkt der Bahnlinie Struer-T, hat eine
ansehnliche Kirche und (1880) 4184 Einw., die recht lebhaften
Handel, Fischerei und Industrie treiben. T. ist Sitz eines
deutschen Konsuls.
Thisted, Valdemar Adolf, dän. Dichter, bekannt unter
dem Pseudonym Em. Saint-Hermidad, geb. 28. Febr. 1815 zu Aarhus,
studierte Theologie in Kopenhagen, ward 1845 Adjunkt an der
Realschule seiner Vaterstadt, 1855 Pfarrer im nördlichen
Schleswig und 1862 nach größern Reisen im Süden zu
Tömmerup auf Seeland, von welcher Stelle er sich 1870
entbinden ließ. Er starb 1889. Von seinen meist auch ins
Deutsche übersetzten Werken sind hervorzuheben die Romane und
Schilderungen: "Vandring i Syden" (1843); "Havfruen" (1846); "Tabt
og funden" (1849, 2 Bde.); ferner: "Episoder fra et Reiseliv"
(1850) und "Romerske Mosaiker" 1851), die Früchte einer Reise
nach Italien; der Roman "Sirenernes Ö" (1853); das romantische
Drama "Hittebarnet" (1854; "Neapolitaniske Aquareller" (1853) und
"Hjemme og paa Vandring" (1854), novellistische Reisestudien; dann
die Dichtungen: "Örkenens Hjerte" (1849) und "Bruden" (1851),
nebst "Digte" (1861); endlich der Roman "Familieskatten" (1856).
Großes Aufsehen erregten seine "Breve fra Helvede" ("Briefe
aus der Hölle", 4. Aufl. 1871, unter dem Pseudonym M. Rowan).
Thisteds Schriften zeichnen sich durch glänzende Darstellung
und reiche Phantasie aus, leiden aber unter großer
Weitschweifigkeit.
Thivä (Thebai), Hauptstadt einer Eparchie des
griech. Nomos Attika und Böotien, an der Stelle der Kadmeia,
der Burg des alten Theben (s. d. 2), gelegen, Sitz eines Bischofs,
mit (1879) 3509 Einw. Aus dem Altertum hat sich nur wenig erhalten,
abgesehen von den zahlreichen Quellen, die in den thebanischen
Mythen eine Rolle spielen. In der Nähe wurden jüngst von
der Deutschen Archäologischen Schule die Reste des von
Pausanias geschilderten, berühmten Kabirentempels
ausgegraben.
Thiviers (spr. tiwjeh), Stadt im franz. Departement
Dordogne, Arrondissement Nontron, an der Eisenbahn
Limoges-Périgueux, hat eine romanische Kirche, ein
Schloß, Fabrikation von Fayence, Handel mit Vieh,
Trüffeln und Käse und (1881) 2127 Einw.
656
Thizy - Thomas.
Thizy (spr. tisi), Stadt im franz. Departement
Rhône, Arrondissement Villefranche, an der Eisenbahn
St.-Victor-Cours, mit bedeutender Fabrikation von Leinwand und
Kattun, Färberei und Appretur und (1881) 3759 Einw.
Thlinkit, Indianerstamm, s. Koloschen.
Thoas, nach griech. Mythus König von Lemnos, wurde,
als die Frauen von Lemnos alle Männer aus der Insel
töteten, von seiner Tochter Hypsipyle (s. d.) gerettet,
später aber von den Lemnierinnen entdeckt und ins Meer
versenkt. Nach andrer Überlieferung entfloh er nach der Insel
Sikinos bei Euböa oder nach Chios oder nach Taurien, dessen
aus der Geschichte der Iphigenie (s. d.) bekannter König T.
nun mit dem lemnischen identifiziert wurde.
Thöl, Johann Heinrich, Autorität auf dem Gebiet
des Handels- und Wechselrechts, geb. 6. Juni 1807 zu Lübeck,
ward 1830 Privatdozent und 1837 Professor der Rechte in
Göttingen, 1842 zu Rostock, kehrte aber 1849 an erstere
Universität zurück und starb 16. Mai 1884 in
Göttingen. Er hat sich namentlich durch "Das Handelsrecht"
(Bd. 1 u. 2, Götting. 1841-48; Bd. 3, Leipz. 1880; Bd. 1, 6.
Aufl., Leipz. 1879; Bd. 2: Wechselrecht, 4. Aufl. 1878) bekannt
gemacht. Außerdem erwähnen wir von ihm: "Volksrecht,
Juristenrecht" (Rost. 1846); "Einleitung in das deutsche
Privatrecht" (Götting. 1851); "Ausgewählte
Entscheidungsgründe des Oberappellationsgerichts der vier
Freien Städte Deutschlands" (das. 1857); "Zur Geschichte des
Entwurfs eines allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuchs" (das.
1861); "Protokolle der Leipziger Wechselkonferenz" (das. 1866);
"Theaterprozesse" (das. 1880); "Handelsrechtliche
Erörterungen" (das. 1882). Vgl. die Gedächtnisschriften
von Frensdorff (Freiburg 1885) und Ehrenberg (Stuttg. 1885).
Tholen, Insel der niederländ. Provinz Zeeland, durch
die Osterschelde und Mündungsarme der Maas gebildet, 24 km
lang, 11 km breit. Auf der Ostküste die Stadt T., mit 2
Kirchen und (1887) 2758 Einw.
Tholey, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Trier,
Kreis Ottweiler, hat eine kath. Kirche, ein Amtsgericht,
Eisenerzgruben und (1885) 1155 Einw.; die ehemalige
Benediktinerabtei ward 1793 aufgehoben.
Tholos (griech.), ein aus übereinander nach innen
vortretenden Steinschichten gebildeter Kuppelbau. Solche den
ältesten Zeiten Griechenlands angehörende Kuppelbauten
sind bei Mykenä, Orchomenos u. a. O. entdeckt worden.
Früher für Schatzhäuser gehalten, gelten sie jetzt
als Gräber von Fürsten.
Tholuck, Friedrich August Gotttreu, protest. Theolog,
geb. 30. März 1799 zu Breslau, studierte daselbst und in
Berlin erst orientalische Sprachen, dann Theologie und ward durch
den Verkehr mit den damaligen frommen Kreisen in Berlin für
die pietistische Richtung gewonnen, von welcher sogleich sein
Erstlingswerk: "Die wahre Weihe des Zweiflers" (1823; 9. Aufl. u.
d. T.: "Die Lehre von der Sünde und dem Versöhner", Gotha
1870), zeugte. Seit 1824 außerordentlicher Professor der
Theologie in Berlin, folgte er, von einer wissenschaftlichen Reise
nach England und Holland zurückgekehrt, 1826 einem Ruf als
ordentlicher Professor nach Halle, wo er namentlich auch durch
einen ausgebreiteten Privatverkehr mit den Studierenden sowie als
Prediger und (seit 1867) Oberkonsistorialrat erfolgreich bis zu
seinem 10. Juni 1877 eingetretenen Tod wirkte. Vorübergehend
war er 1828 und 1829 preußischer Gesandtschaftsprediger zu
Rom. Außer der genannten Schrift und Kommentaren zur
Bergpredigt (5. Aufl., Gotha 1872), zu den Psalmen (2. Aufl., das.
1873), zum Römerbrief (5. Aufl., Halle 1856),
Johannesevangelium (7. Aufl., Gotha 1857) und Hebräerbrief (3.
Aufl., Hamb. 1850) sowie zahlreichen Predigten ("Predigten
über die Hauptstücke des christlichen Glaubens und
Lebens", 4 Bde.; 6. Aufl., Gotha 1877) veröffentlichte er:
"Die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte" (Hamb.
1837, 2. Aufl. 1838); "Das Alte Testament im Neuen" (das. 1836, 7.
Aufl. 1877); "Der Geist der lutherischen Theologen Wittenbergs im
17. Jahrhundert" (das. 1852); "Das akademische Leben des 17.
Jahrhunderts" (Halle 1853-54, 2 Bde.); "Das kirchliche Leben des
17. Jahrhunderts" (Berl. 1861-62, 2 Abtlgn.); "Lebenszeugen der
lutherischen Kirche vor und während der Zeit des
Dreißigjährigen Kriegs" (Halle 1861); "Geschichte des
Rationalismus" (Bd. 1, Berl. 1865) u. "Stunden christlicher
Andacht" (Hamb. 1840; 8. Aufl., Gotha 1870). Eine Gesamtausgabe
seiner Werke erschien Gotha 1863-67, 11 Bde. Vgl. Kähler, A.
T., ein Lebensabriß (Halle 1877); L. Witte, Tholucks Leben
(Bielef. 1885-86, 2 Bde.).
Thomar, Stadt in der portug. Provinz Estremadura,
Distrikt Santarem, am Nabào und der Eisenbahn
Lissabon-Oporto, hat ein altes Schloß, 2 Kirchen, ein
großes Kloster des Christusordens (dessen Hauptsitz ehemals
die Stadt war), Baumwollindustrie und (1878) 5105 Einw. Unfern die
Ruinen des alten Nabantia.
Thomas, einer der zwölf Jünger Jesu, im vierten
Evangelium nach griechischer Übersetzung des aramäischen
Namens Didymus, d. h. Zwilling, genannt und als Typus der
Schwergläubigkeit behandelt, daher das sprichwörtliche
ungläubiger T. Der ältesten Tradition zufolge predigte er
das Christentum in Parthien oder in Indien. Ebendeshalb betrachten
auch die seit etwa 600 in Malabar wohnenden syrischen Christen
(Thomaschristen) den T. als Stifter ihrer Kirche; vgl. Germann, Die
Kirche der Thomaschristen (Gütersl. 1877). Der geschichtliche
Kern dieser Traditionen dürfte sich auf eine gewisse
Verbindung oder doch wenigstens Bekanntschaft alter christlicher
Missionäre mit den parthisch-indischen Grenzländern
reduzieren. Die Legenden nennen als vom Apostel T. getauft mit
großer Bestimmtheit einen uns durch viele Münzen und
Inschriften bekannten König parthischer Abkunft, welcher in
Peschawar am Indus geherrscht: Gundaphoras oder Gondophares; vgl.
Gutschmid, Rheinisches Museum für Philologie (1864). Dem T.
zugeschrieben werden unter den Apokryphen die "Acta Thomae" und das
"Evangelium secundum Thomam" (vgl. Lipsius, Apokryphe
Apostelgeschichten, Bd. 1, Braunschw. 1883; Bonnet, Acta Thomae,
Leipz. 1883). In der römisch-katholischen Kirche ist dem T.
der 21. Dezember, in der griechisch-katholischen der 6. Oktober
sowie der erste Sonntag nach Ostern (Thomassonntag) geweiht.
Thomas, 1) Charles Louis Ambroise, Komponist, geb. 5.
Aug. 1811 zu Metz, war 1828-32 Schüler des Pariser
Konservatoriums und errang im letztgenannten Jahr mit der Kantate
"Herman et Ketty" den römischen Preis. Nach dreijährigem
Aufenthalt in Italien nach Paris zurückgekehrt,
debütierte er 1837 als dramatischer Komponist mit der
komischen Oper "La double échelle", welche jedoch so wenig
wie sieben weitere Arbeiten dieser Gattung einen nennenswerten
Erfolg hatte. Erst mit den komischen Opern: "Le Caïd" (1849)
und "Le songe d'une nuit d'été" (1850), gelang es
ihm, die Teilnahme des Publikums in vollem Maß zu
gewinnen
657
Thomas a Kempis - Thomas von Celano.
und in die Reihe der ersten dramatischen Komponisten Frankreichs
zu treten. Von seinen während der folgenden Jahre
aufgeführten sechs Opern fand nur "Psyche" (1857) einigen
Beifall, wogegen "Mignon" (1866) vollständig durchschlug und
nicht nur in Paris, sondern auch im Ausland glänzenden Erfolg
hatte. Eine günstige Aufnahme fand auch "Hamlet" (1868),
während sein letztes Werk, "Françoise de Rimini"
(1882), nur einen mäßigen Erfolg hatte. T.' Musik
zeichnet sich durch angenehme, wenn auch bisweilen an
Trivialität streifende Melodik, geistvolle Orchestration und
namentlich durch effektvolle Behandlung der Singstimmen aus, steht
jedoch an Originalität hinter der seiner Vorgänger auf
dem Gebiet der großen wie der komischen Oper weit
zurück. Unter seinen sonstigen Werken befinden sich ein
Requiem, eine solenne Messe, ein Streichquintett und -Quartett,
eine Phantasie für Klavier und Orchester, Klavier- und
Gesangstücke u. a. Auch als Musikpädagog hat sich T.
ausgezeichnet, nachdem er 1871 als Nachfolger Aubers zum Direktor
des Konservatoriums erwählt war, welcher Anstalt er schon
Jahre zuvor als Komposttionslehrer angehört hatte. Seit 1868
ist er auch Kommandeur der Ehrenlegion.
2) George H., amerikan. General, geb. 1816 in Southampton County
(Virginia), ward in West Point erzogen, 1840 Leutnant der
Artillerie, diente in Florida u. Texas und machte auch den
mexikanischen Krieg mit. Beim Ausbruch des Bürgerkriegs 1861
Kavallerieoberst in der Unionsarmee, erhielt er den Oberbefehl
über die Reiterei auf dem westlichen Kriegsschauplatz, siegte
19. März 1862 bei Mill Spring, zeichnete sich in der Schlacht
am Chickamanga (19. und 20. Sept. 1863) durch seine Standhaftigkeit
und Umsicht aus, befehligte 1864 ein Korps unter Sherman auf dem
Marsch nach Atlanta, dann in Tennessee, siegte 15.-16. Dez. 1864
bei Nashville, erhielt nach dem Krieg ein Militärkommando im
Süden, dann das in San Francisco und starb daselbst 28.
März 1870. Bescheidenheit und Uneigennützigkeit
zeichneten ihn als Menschen, Tapferkeit, Ausdauer und methodische
Bildung als Soldaten aus. Sein Leben beschrieben R. W. Johnson
(Philad. 1881) und van Horne (New York 1882).
3) Theodor, Violinspieler und Dirigent, geb. 11. Okt. 1835 zu
Esens in Ostfriesland, kam als Kind nach New York, wo er sich,
nachdem er durch Schüllinger und Mayrhoffer eine
gründliche musikalische Erziehung erhalten hatte,
zunächst als Quartettspieler eine geachtete Stellung errang.
Einen ungleich größern Wirkungskreis aber fand er von
1869 an, als er sich an die Spitze eines eignen Orchesters stellte
und eine wahrhaft geniale Kraft als Dirigent entfaltete. Seitdem
haben die außerordentlichen Leistungen seiner Kapelle sowie
die vielseitigen, alle Richtungen der klassischen Musik umfassenden
Programme der von ihm in New York und in den größern
Städten der Union veranstalteten Konzerte seinen Namen zu
einem der populärsten des Landes gemacht. 1877 folgte er einem
überaus vorteilhaften Engagement als Direktor des
neuerrichteten Konservatoriums in Cincinnati, kehrte jedoch schon
nach zwei Jahren nach New York und zu seiner frühern
Dirigentenwirksamkeit zurück.
4) Sydney Gilchrist, Techniker, geb. 1850 in oder bei London,
besuchte die Royal School of mines, bemühte sich seit 1870 um
die Entphosphorung des Roheisens im Bessemerkonverter und verband
sich 1876 mit seinem Vetter Percy Gilchrist, der als Chemiker auf
den Bleanaoneisenwerken beschäftigt war, zur Vornahme
größerer Verfuche. 1877 nahm er sein erstes Patent auf
ein Verfahren, welches für die Eisenindustrie kaum minder
bedeutungsvoll wurde als der Bessemerprozeß. Seiner
Gesundheit halber ging er 1882 nach Australien, 1883 nach Algier
und starb 1. Febr. 1885 in Paris.
5) Karl, Pseudonym, s. Richter 10).
Thomas a Kempis, s. Thomas von Kempen.
Thomas von Aquino (T. Aquinas), berühmter
Scholastiker, geb. 1225 auf dem Schloß Roccasecca im
Neapolitanischen aus einem alten Adelsgeschlecht, ward im Kloster
Monte Cassino erzogen und trat gegen den Willen seiner Eltern 1243
zu Neapel in den Dominikanerorden ein, studierte in Köln und
Paris und trat hier 1248 als Lehrer der scholastischen Philosophie
mit solchem Beifall auf, daß er den Beinamen eines Doctor
universalis und angelicus erhielt. Papst Urban IV. berief ihn 1261
nach Italien zurück, worauf T. zu Bologna, Pisa und Rom
lehrte. Seit 1272 zog er sich in dasselbe Kloster zu Neapel
zurück, in das er zuerst eingetreten war, und starb 6.
März 1274 im Kloster Fossanuova bei Terracina auf der Reise
zum Konzil von Lyon. T. ward 15. Juli 1323 kanonisiert und galt
für den größten Kenner der Aristotelischen
Philosophie. Als einer der Hauptverfechter des Realismus übte
er einen großen Einfluß in den scholastischen
Streitigkeiten seiner Zeit aus. Seine in vielen Einzelausgaben
gedruckten Hauptwerke sind: der Kommentar über des Petrus
Lombardus vier Bücher Sentenzen; ferner "Summa theologiae"
(hrsg. von Nicolai u. a., 13. Aufl., Regensburg 1884, 8 Bde.;
deutsch von Schneider, das. 1886 ff.), der erste vollständige
Versuch eines theologischen Systems; "Summa fidei catholicae contra
gentiles"; "Quaestiones disputatae et quodlibetales" und "Opuscula
theologica". Er begründete besonders die Lehren vom Schatz der
Kirche an überflüssigen Werken, von der
Transsubstantiation und von der Infallibilität des Papstes.
Seine Schriften (Gesamtausgabe, Parma 1852-72, 25 Bde., und auf
Veranlassung des Papstes Leo XIII., Rom 1882 ff.; Auswahl, Turin
1886, 3 Bde.) genossen lange in der katholischen Kirche eine Art
von kanonischem Ansehen, und namentlich war er stets die
Hauptautorität der Dominikaner. Doch trat schon um 1300 der
Franziskaner Duns Scotus gegen ihn auf und gründete die
philosophisch-theologische Schule der Skotisten, mit welcher die
Thomisten auf den Universitäten in Fehde lebten. Letztere
verteidigten namentlich im Anschluß an T. die strenge Lehre
Augustins von der Gnade und bestritten die unbefleckte
Empfängnis der Jungfrau Maria. In beiderlei Beziehung ist die
spätere Kirche von der Lehrautorität des heil. T.
abgewichen. Vgl. Werner, Der heil. T. (Regensb. 1858-59, 3 Bde.);
Jourdain, La philosophie de saint Thomas d'Aquin (Par. 1858, 2
Bde.); Baumann, Die Staatslehre des heil. T. (Leipz. 1873);
Holtzmann, T. und die Scholastik (Karlsr. 1874); Eucken, Die
Philosophie des T. und die Kultur der Neuzeit (Halle 1886);
Frohschammer, Die Philosophie des T. (Münch. 1889); ferner
Thömes, Divi Thomae Aquinatis opera et praecepta (Berl. 1875,
Bd. 1); Schütz, Thomas-Lexikon (Paderb. 1881).
Thomas von Celano, geistlicher Dichter des 13. Jahrh.,
Verfasser des berühmten Liedes "Dies irae, dies illa" war zu
Celano in den Abruzzen geboren und einer der ersten Jünger des
heil. Franziskus von Assisi. Als sich 1221 der Bettelorden der
Minoriten am Rhein niedergelassen hatte, wurde er von Cäsarius
von Speier, dem ersten Minister der deutschen
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl., XV. Bd.
42
658
Thomas von Kempen - Thomasschlacke.
Ordensprovinz, zum Kustos der Konvente zu Worms, Mainz und
Köln und 1222 zu seinem Stellvertreter und zum alleinigen
Kustos der Rheingegenden ernannt. Nach achtjähriger Verwaltung
dieses Amtes begab er sich wieder nach Assisi und schrieb hier im
Auftrag des Papstes Gregor IX. das Leben des heil. Franziskus, das
nie im Druck erschien. Weiter ist von seinem Leben nichts bekannt.
Einige schreiben T. noch zwei Sequenzen zu: "Fregit victor
virtualis" und "Sanctitatis nova signa"; doch bleibt das "Dies irae
etc." das Werk, dem er allein seinen Ruhm verdankt. Man hat von
diesem in der römisch-katholischen Kirche zu einem stehenden
Gesang am Fest Allerseelen und beim Totenamt erhobenen Liede drei
bedeutend voneinander abweichende Texte: den wahrscheinlichen
Urtext, wie er von einer Marmorplatte in der Kirche des heil.
Franziskus zu Mantua kopiert worden sein soll; den sogen.
Hämmerlinschen, wie ihn Felix Hämmerlin (Malleolus)
herstellte, und den kirchlichen, der durch die Autorität des
tridentinischen Konzils festgestellt und 1576 in einem
römischen Missale bekannt gemacht worden ist.
Übersetzungen dieses Liedes sind in vielen Sprachen
erschienen; unter den deutschen sind besonders die von Clodius,
Herder, A. W. Schlegel, Fichte, A. L. Follen und H. A. Daniel
hervorzuheben. Noch öfter wurde das Gedicht komponiert, so von
Palestrina, Pergolese, Astorga, Durante, Joseph und Michael Haydn,
Jomelli, Mozart (im "Requlem"), Cherubini, Neukomm, Abt Vogler, G.
Weber, Winter u. a. Vgl. Lisco, Dies irae, Hymnus auf das
Weltgericht (Berl. 1840); Daniel im "Thesaurus hymnologicus" (Halle
1844).
Thomas von Kempen (T. a Kempis), berühmter
asketisch-mystischer Theolog des Mittelalters, eigentlich Thomas
Hamerken oder Hämmerlein (Malleolus), geb. 1380 zu Kempen
(Kampen) im Kölnischen, besuchte die Schule der Brüder
des gemeinsamen Lebens in Deventer, trat 1407 in das
Augustinerkloster zu Agnetenberg bei Zwolle, ward 1423 Priester und
Subprior und starb als Superior desselben 1471. Unter seinen
Schriften (zuletzt hrsg. von F. X. Kraus, Trier 1868;
übersetzt von Silbert, 2. Ausg., Wien 1840, 4 Bde.) sind am
verbreitesten geworden die "Vier Bücher von der Nachfolge
Christi" ("De imitatione Christi", etwa 5000 mal aufgelegt; nach
dem 1441 geschriebenen, in Brüssel befindlichen Autograph
hrsg. von Hirsche, Berl. 1874; im Faksimile von Ruelens, Lond.
1879). Nachdem früh seine Autorschaft desselben bestritten
war, wurde dieselbe 1652 vom Pariser Parlament und auch durch die
neuere Kritik, allerdings gegen vielfachen Widerspruch, behauptet.
Vgl. Malou, Recherches sur le véritable anteur du livre de
l'Imitation de Jésus-Christ (3. Aufl., Tournai 1858);
Kettlewell, The authorship of the De imitatione Christi (Lond.
1877); Derselbe, Thomas a Kempis and the brothers of common life
(2. Aufl. 1884); Hirsche, Prolegomena zu einer neuen Ausgabe der
Imitatio Christi (Berl. 1873-83, 2 Bde.; Keppler in der
Tübinger "Theologischen Quartalschrift" (1880). Verfehlt ist
der noch von Wolfsgruber ("Van der navolginge cristi ses boeke",
Wien 1879; "Giovanni Gersen", Augsb. 1880) vertretene Versuch der
Benediktiner, das Buch für einen Benediktinerabt von Vercelli
mit Namen Gersen, von dem man nichts näheres weiß, in
Anspruch zu nehmen. Doch ist anzuerkennen, daß die
Unterschrift in dem sogen. Autographum (Finitus et completus ...
per manus fratris Thomae Kempensis) den Thomas ebensogut als
Abschreiber (und T. hat in der That viele Bücher
abgeschrieben) wie als Verfasser bezeichnen kann. Auch kann man
sich nach dem augenblicklichen Stande der Dinge dem Eindruck nicht
verschließen, daß es nach aller Wahrscheinlichkeit
Handschriften gibt, die über die Zeit des T. hinausgehen,
womit freilich nicht gesagt ist, daß gerade Gersen der
Verfasser wäre.
Thomaschristen, s. Thomas (Apostel) und Nestorianer.
Thomasin von Zirkläre, mittelhochdeutscher Dichter,
aus Friaul, verfaßte 1215-16 ein Lehrgedicht in zehn
Büchern. "Der welsche Gast", d. h. der Fremdling aus
Welschland (hrsg. von Rückert, Quedlinb. 1852), eine
umfassende, auf die höfischen Kreise berechnete
Tugendlehre.
Thomasius, 1) (Thomas) Christian, deutscher Rechtslehrer,
geb. 1. Jan. 1655 zu Leipzig, studierte daselbst die Rechte und
Philosophie, trat dann als akademischer Lehrer auf und hielt (1688)
die ersten Vorlesungen in deutscher Sprache. Seine
Freimütigkeit zog ihm viele Feinde unter den Theologen zu, und
schon war in Dresden ein Verhaftsbefehl gegen ihn ausgewirkt, als
er über Berlin 1690 nach Halle entfloh, wo er an der
Ritterakademie Vorlesungen begann. Später (1694) wurde er an
der zum Teil durch seine Mitwirkung neugegründeten
Universität zu Halle Professor der Rechte, Geheimrat und
Rektor. Er starb daselbst 23. Sept. 1728. T. hat viel zur
Einführung einer bessern Methode in der Behandlung aller
Wissenschaften und namentlich der Philosophie durch Verwerfung der
hergebrachten philosophischen Terminologie beigetragen. Auch hat er
zuerst die Hexenprozesse und die Tortur mit den Waffen des Geistes
bekämpft. Seine Denkart charakterisieren besonders seine
"Vernünftigen und christlichen, aber nicht scheinheiligen
Gedanken und Erinnerungen über allerhand gemischte
philosophische und juristische Händel" (Halle 1723-25, 3 Bde.;
Anhang 1726) sowie seine "Historie der Weisheit und Thorheit" (das.
1693, 3 Tle.). Seine systematischen Schriften betreffen meist das
Naturrecht und die Sittenlehre. Vgl. H. Luden, T. nach seinen
Schicksalen und Schriften (Berl. 1805); Dernburg, T. und die
Stiftung der Universität Halle (Halle 1865); B. A. Wagner,
Christ. T. (Berl. 1872); Nicoladini, Christ. T. (das. 1887).
2) Gottfried, luther. Theolog, geb. 26. Juli 1802 zu Egenhausen
in Franken, studierte in Erlangen, Halle und Berlin, wurde 1829
Pfarrer zu Nürnberg, 1842 ordentlicher Professor der Dogmatik
und Universitätsprediger in Erlangen und starb daselbst 24.
Jan. 1875. Seine bedeutendsten Schriften sind außer mehreren
Predigtsammlungen, Religionslehrbüchern und kirchlichen
Zwecken dienenden Arbeiten: "Origenes" (Nürnb. 1837);
"Beiträge zur kirchlichen Christologie" (das. 1845); "Das
Bekenntnis der lutherischen Kirche in der Konsequenz seines
Prinzips" (das. 1848); "Christi Person und Werk" (2. Aufl., Erlang.
1856-64, 3 Bde.); "Das Bekenntnis der lutherischen Kirche von der
Versöhnung" (das. 1857); "Das Wiedererwachen des evangelischen
Lebens in der lutherischen Kirche Bayerns" (das. 1867); "Die
christliche Dogmengeschichte" (das. 1874-76, 2 Bde.; 2. Aufl.
1886-89). Vgl. v. Stählin, Lohe, T., Harleß (Leipz.
1886).
Thomasschlacke, die nach dem Thomasschen Verfahren der
Verhüttung phosphorhaltiger Erze mit basischen Zuschlägen
erhaltene Schlacke, ist porös oder dicht, schwarz,
zerfällt beim Liegen an der Luft zu einem groben Pulver,
welches schwer zersetzbare, bis kopfgroße Beimengungen
enthält. Die gemahlene Schlacke zeigt wenig konstante
Zusammensetzung, da diese durch die verwendeten Erxe und
Zuschläge wie auch durch die
659
Thomisten - Thomson.
Führung des Prozesses beeinflußt wird. Im Mittel
enthält T. 17 (14-24) Proz. Phosphorsäure, 50 Kalk, 4
Magnesia, 14 Eisenoxyd, je 4 Manganoxydul und Thonerde, 7,5
Kieselsäure, 0,5 Schwefel und 0,2 Proz. Schwefelsäure.
Sie dient im fein gemahlenen Zustand als billiges Dungmittel, doch
wird sie auch auf Thomaspräzipitat (präzipitierten
phosphorsauren Kalk) verarbeitet, welcher als Dungmittel ungleich
größern Wert besitzt.
Thomisten, s. Thomas von Aquino.
Thommen, Achilles, Architekt, geb. 25. Mai 1832 zu Basel,
studierte daselbst Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaft,
seit 1850 auf dem Polytechnikum in Karlsruhe, arbeitete seit 1852
unter Etzel an der Schweizer Zentralbahn und 1857 an der Franz
Joseph-Orientbahn in Ungarn. Als Oberingenieur tracierte,
projektierte und baute er 1861-67 die Brennerbahn, wurde dann als
Staatseisenbahnbaudirektor und Leiter des gesamten Eisenbahnwesens
nach Ungarn berufen. Hier projektierte, leitete und überwachte
er den Bau eines Bahnnetzes von über 2400 km Länge, nahm
aber 1870 seinen Abschied und lebt seitdem in Wien. Seine
Thätigkeit für den Bau von Gebirgsbahnen war
epochemachend, und die Brennerbahn ist das Vorbild für
ähnliche Unternehmungen geworden. Er bearbeitete schon 1869
"Grundzüge für Lokalbahnen" und veröffentlichte in
der Folge "Normalien für Unter-, Ober- und Hochbau",
außerdem die Schrift "Die Gotthardbahn" (Wien 1877).
Thomsen, Christ. Jürgensen, dän.
Archäolog, geb. 29. Dez. 1788 zu Kopenhagen als Sohn eines
Kaufmanns, dessen Handelsgeschäft er nach dem Tode des Vaters
fortführen mußte, beschäftigte sich nebenbei eifrig
mit Numismatik, Altertümern und Kunstgeschichte und legte eine
Münz- und Antiquitätensammlung an. 1816 wurde er
Sekretär der Kommission zur Aufbewahrung der Altertümer
und übernahm dann die Verwaltung des neuerrichteten
altnordischen Museums. In dieser Stellung war er der erste, welcher
zwischen einem Steinzeitalter, Bronzezeitalter und Eisenzeitalter
unterschied. Später erhielt er die Direktion der Münz-
und Medaillensammlung, die Inspektion der Gemäldesammlung und
die des ethnographischen Museums; 1861 wurde er Direktor
sämtlicher Sammlungen, deren eigentlicher Schöpfer und
Ordner er war. T. starb 21. Mai 1865.
Thomson, 1) James, engl. didaktischer Dichter, geb. 11.
Sept 1700 zu Ednam in Schottland, studierte zu Edinburg Theologie,
widmete sich aber bald ganz der Poesie und dichtete als Hofmeister
zu London die beschreibenden, im Blankvers abgefaßten
Gedichte: "Winter" (1726), "Summer" (1728), "Spring" (1729) und
"Autumn" (1730), die dann vereinigt unter dem Namen: "Seasons"
(deutsch von Soltau, Braunschw. 1823; von Bruckbräu,
Münch. 1836) erschienen. In diesen Gedichten gibt T. eine
originelle Beschreibung der Naturerscheinungen, die er mit
aufmerksamem und liebevollem Auge begleitet; besonders
glücklich ist er in Beobachtung des Tierlebens. Die
Eintönigkeit aber, die ein bloß beschreibendes Gedicht
kaum würde vermeiden können, weiß T. zu umgehen,
indem er in lieblichen und ergreifenden Episoden den Menschen in
seinem Verhältnis zu den Mächten der Natur und im Kampf
mit denselben vorführt. Haydn hat das Gedicht im Auszug
komponiert. 1731 begleitete T. einen Sohn des nachmaligen
Lord-Kanzlers Sir Charles Talbot auf seinen Reisen durch den
Kontinent. Nachdem er bis Talbots Tod im Genuß einer
einträglichen Sinekure gestanden, erhielt er vom Prinzen von
Wales einen Jahrgehalt von 100 Pfd. Sterl. und die Stelle eines
Oberaufsehers über die Antillen. Er starb 27. Aug. 1748. Fast
noch höher als die "Seasons" steht "The castle of indolence",
ein allegorisches Gedicht in der Spenserstrophe und eine der besten
Nachahmungen des Spenserschen Stils. Andre Produktionen von T. sind
die trefflichen patriotischen Gedichte: "Liberty" und "Britannia".
Am schwächsten ist er in seinen fünf Tragödien
(darunter "Sophonisbe" und "Tancred and Sigismunda"). Noch ein
kleines von ihm mit einem Schulfreund, Mallet, gemeinschaftlich
geschriebenes Stück: "Alfred", verdient Erwähnung, weil
in ihm zuerst das berühmte englische Volkslied "Rule
Britannia" vorkommt. Eine Gesamtausgabe von Thomsons Werken
erschien zu Edinburg 1768, 4 Bde. (in neuer Ausgabe 1874). Des
Dichters Leben beschrieb Murdoch (Lond. 1803, 3 Bde.).
2) Thomas, Chemiker, geb. 12. April 1773 zu Crieff in
Schottland, studierte zu Glasgow und Edinburg und lieferte seit
1796 für die Supplemente zur "Encyclopaedia britannica"
gediegene Artikel über Physik, Chemie, Mineralogie und
Metallurgie. 1801 bis 1811 las er in Edinburg über Chemie,
lebte dann in London, war 1817-41 Professor der Chemie in Glasgow
und starb 2. Juli 1852 zu Kilmun in Argyllshire. Seine Arbeiten
bewegen sich auf dem Gebiet der allgemeinen und organischen Chemie,
der Mineralogie und Geologie. Er entdeckte mehrere Verbindungen,
erfand ein Saccharometer, verbesserte das Lötrohr und
führte 1798 den Gebrauch der Symbole in der Chemie ein. Von
seinen selbständigen Werken sind hervorzuheben: "System of
chemistry" (7. Aufl., Edinb. 1831, 4 Bde.); "Elements of chemistry"
(das. 1810); "Attempt to establish the first principles of
chemistry by experiments" (Lond. 1825, 2 Bde.); "History of
chemistry" (das. 1830-1831, 2 Bde.); "Outlines of mineralogy and
geology" (das. 1836); "Chemistry of organic bodies" (das. 1838, 2
Bde.) und "Outlines of heat and electricity" (das. 1839). Seit 1813
gab er zu London die "Annals of Philosophy" heraus, welche 1822 mit
dem "Philosophical Magazine" vereinigt wurden.
3) Thomas, engl. Reisender, geb. 4. Dez. 1817 zu Glasgow,
studierte dort Medizin, trieb daneben aber auch Chemie,
Mineralogie, Konchologie und Botanik, trat 1840 als Arzt in die
Dienste der Ostindischen Kompanie und machte den afghanischen
Feldzug mit. 1847 wurde er zu einem der drei Kommissare ernannt,
welche die Grenze zwischen Kaschmir und Tibet festlegen sollten.
1848 erforschte er den Schajokfluß bis zu seiner Quelle am
Karakorumpaß in 5550 m Höhe. Über diese Reisen
schrieb er: "Western Himalayas and Tibet" (Lond. 1852), welches ihm
die goldene Medaille der Londoner Geographischen Gesellschaft
eintrug. 1850 und 1851 bereiste er Sikkim, die Khassiaberge,
Katschar, Tschittagong und die Sunderbands. 1851 kehrte er mit
kolossalen botanischen und geologischen Sammlungen und
Beobachtungen, aber mit gebrochener Gesundheit nach Europa
zurück. Alle Bemühungen, von der Ostindischen Kompanie
eine Unterstützung zur Herausgabe und Verwertung seiner
Schätze zu erlangen, waren vergeblich, und so mußte er
die auf eigne Kosten begonnene Herausgabe seiner "Flora of British
India" einstellen. Von 1854 bis 1861 lebte er wieder in Indien als
Direktor des botanischen Gartens und Professor der Botanik in
Kalkutta; er starb 18. April 1878 in London.
4) Sir William, Physiker, geboren im Juni 1824 zu Belfast,
studierte in Glasgow, Cambridge und Paris und wurde 1846 Professor
der Physik in Glas-
660
Thomson - Thon.
gow. Seine erste Arbeit (1841) behandelte die Wärmeleitung
in homogenen festen Körpern und deren Beziehung zur
mathematischen Theorie der Elektrizität. Sie erschien mit
vielen andern Arbeiten aus dem Gebiet der Elektrizität und des
Magnetismus in dem Werk "Reprint of papers on electricity and
magnetism" (Lond. 1872, 2. Aufl. 1884). T. lieferte auch
verschiedene Elektrometer, von denen das Quadrantelektrometer
für die feinsten elektrischen Messungen große
Verbreitung, namentlich zu Untersuchungen über die
atmosphärische Elektrizität, gefunden hat, während
sein Spiegelgalvanometer in der Geschichte der unterseeischen
Telegraphie Epoche machte. Auf dem Gebiet der mechanischen
Wärmetheorie haben seine Arbeiten neben denen von Clausius am
meisten zur Entwickelung der Theorie beigetragen. In England hat
man versucht, T. überhaupt als den Begründer der neuen
Wärmetheorie hinzustellen; indes hat Clausius zuerst 1850 die
aus dem von Mayer 1842 ausgesprochenen Prinzip von der Erhaltung
der Kraft sich ergebenden Folgerungen in der mathematischen
Behandlung der Wärmeerscheinungen verwertet. Dann aber gehen
die Arbeiten von T. und Clausius einander so nahe parallel,
daß es manchmal schwer fällt, zu unterscheiden, welcher
von beiden Forschern gewisse Sätze zuerst entwickelt hat.
Ebenso wie Clausius hat auch T. die Prinzipien der mechanischen
Wärmetheorie auf andern Gebieten der Physik verwertet; so
entwickelte er sofort eine mechanische Theorie der chemischen
Zersetzung durch den elektrischen Strom und eine Theorie der
Thermoströme. Letztere führte ihn zu der Entdeckung der
positiven oder negativen Fortführung der Wärme durch den
galvanischen Strom, wie er die Erscheinung bezeichnete.
Hervorragendes leistete T. auf dem Gebiet der unterseeischen
Telegraphie. Seine theoretischen und experimentellen Arbeiten, ganz
besonders seit 1858, als das erste gelegte Kabel zwischen England
und Amerika seine Dienste so bald versagte, haben zu den
später erreichten Erfolgen auf das erheblichste beigetragen.
In Anerkennung dieser Leistungen wurde er bei der Rückkehr von
der Legung des Kabels 1866, an der er sich selbst beteiligt hatte,
zum Ritter ernannt. Ein Beweis von der Vielseitigkeit des Mannes
sind seine Untersuchungen über Ebbe und Flut, über die
Gestalt der Erde, über die Frage, ob das Innere der Erde fest
oder flüssig ist, und über manche Frage der theoretischen
Mechanik. T. schrieb: "On the electrodynamic properties of metals"
(1855); "Navigation, a lecture" (1876); "Reprint of papers on
electrostatics and magnetism" (2. Aufl. 1884); "Mathematical and
physical papers" (1882-84, 2 Bde.); "Treatise on natural
philosophy" (2. Aufl. 1879-83, Bd. 1 in 2 Tln.; deutsch von
Wertheim: "Handbuch der theoretischen Physik", Braunschw. 1874,
unvollendet); er redigiert seit 1846 das "Cambridge and Dublin
Mathematical Journal".
5) Sir Charles Wyville, Naturforscher, geb. 5. März 1830 zu
Bonsyde in Linlithgowshire, studierte seit 1845 zu Edinburg
Naturwissenschaft und begann 1850 Vorlesungen über Botanik in
Aberdeen. Gleichzeitig beschäftigte er sich eifrig mit der
Erforschung der niedern Tiere. 1853 ward er Professor für
Naturwissenschaft in Cork, ging aber schon 1854 in gleicher
Eigenschaft nach Belfast und las hier über Mineralogie und
Geologie, wobei er indes seine geologischen Arbeiten fortsetzte und
auch den Bau des Museums des Queen's College leitete. Er begann um
diese Zeit die Studien über die fossilen und die lebenden
Liliensterne, welche erst 1862 zum Abschluß kamen. Die
Entdeckung einer sehr alten Form von Liliensternen in den Tiefen
des Atlantischen Ozeans brachte T. zu der Überzeugung,
daß in diesen Regionen die größten Schätze
für die weitere Erforschung dieser Tiere zu finden seien, und
auf seine Anregung veranlaßte Carpenter die Regierung,
wissenschaftliche maritime Expeditionen auszurüsten. So kamen
seit 1868 die Lightning-, Porcupine- und Challenger-Expedition zu
stande, welche namentlich für die Zoologie und die
physikalische Geographie die bedeutendsten Resultate geliefert
haben. 1870 wurde T. Professor der Naturwissenschaft in Edinburg.
Von hier aus unternahm er die Challenger-Expedition, auf welcher er
3½ Jahre von England abwesend war. Erst 1876 kehrte er nach
England zurück. Die Resultate dieser Expeditionen legte er
nieder in den Werken: "The depths of the sea" (2. Aufl., Lond.
1873) und "The voyage of the Challenger, the Atlantic" (das. 1877,
2 Bde.). Er starb 10. März 1882 in Edinburg.
Thon (Pelit), in seinen reinsten Varietäten (Kaolin,
Porzellanerde, s. d.) ein wasserhaltiges Aluminiumsilikat von
bestimmter Zusammensetzung, die lokal aufgehäuften
Zersetzungsprodukte feldspathaltiger oder glimmerreicher Gesteine
darstellend. In trocknem Zustand sind die Thone fein- oder
groberdig, zerreiblich, an der Zunge klebend und beim Anhauchen von
eigentümlichem Geruch (Thongeruch). Nach dem Gefühl beim
Angreifen spricht man von fetten und magern Thonen, die letztern
sind die unreinern. Haben die Thone Wasser eingesogen (und sie
können bis 70 Proz. aufnehmen), so werden sie in verschiedenem
Grad geschmeidig und plastisch. Auch Fetten, Ölen und
Salzlösungen gegenüber besitzen die Thone eine starke
Absorptionskraft. Das aufgenommene Wasser entweicht beim
Erwärmen, wobei die Thone stark schwinden und bersten (die
magern Thone weniger als die fetten); beim Glühen werden sie
hart, klingend, verlieren ihre Plastizität und verglasen und
schmelzen je nach der Natur der Beimengungen bei verschieden hoher
Temperatur. Reiner Kaolin ist nicht schmelzbar, sondern sintert nur
bei sehr hoher Temperatur zusammen; von den Verunreinigungen des
Kaolins scheint besonders Magnesia die Feuerbeständigkeit
abzuschwächen, weniger Kalk, noch weniger Eisenoxyd und Kali.
Selten sind die Thone rein weiß, gewöhnlich grau,
bräunlich, rötlich, grünlich, bläulich, bunt
gestreift, geädert oder geflammt. Spezifisches Gewicht des bei
100° getrockneten Thons 2,44-2,47. Chemisch sind die Thone als
unreine Kaoline (vgl. Porzellanerde) aufzufassen, als vermittelnde
Verwitterungsstadien zwischen den Feldspaten (sowie einigen andern
Silikaten) und diesen, gewöhnlich gemengt mit den sonstigen
Zersetzungsprodukten der betreffenden Gesteine. Sie enthalten
außer reinem Aluminiumsilikat am häufigsten kohlensauren
Kalk, Magnesia, Eisenoxydul, Quarzsand, Glimmerschüppchen,
Eisenoxyd, Eisenhydroxyd, kohlige Substanzen, seltener Eisenkies,
Gips, Schwefel, Knollen von thonigem Sphärosiderit, kalkigen
Mergeln etc. Als Beispiel der chemischen Zusammenhang mögen
folgende Analysen dienen:
1. 2. 3. 4. 5.
Kieselsäureanhydrid 46,50 62,54 68,28 75,44 52,87
Thonerde 39,56 14,62 20,00 17,09 15,65
Eisenoxyd und -Oxydul - 7,65 1,78 1,13 12,81
Kalk - - 0,61 0,48 -
Magnesia - - 0,52 0,31 2,65
Kali - - 2,35 0,52 1,33
Wasser 13,94 14,75 6,39 4,71 14,73
Zusammen: 100,00 99,56 99,93 99,68 100,04
661
Thonberg - Thonissen.
Zum Vergleich sind unter 1) die berechneten Werte der
Kaolinformel vorausgeschickt; 2) T. von Pöchlarn in
Österreich; 3) T. von Grenzhausen in Nassau; 4) T. von Bendorf
bei Koblenz; 5) roter T. von Norfolk in England.
An Varietäten unterscheidet man: eisenschüssigen T.,
gelb oder rotbraun, je nachdem Eisenhydroxyd oder Eisenoxyd das
färbende Prinzip ist; glimmerigen T., mit zahlreichen, oft
lagenweise angeordneten Glimmerblättchen gemengt;
Töpferthon, zäh und sehr plastisch, feinen Quarzsand
führend; Pfeifenthon, sehr reiner, kaolinartiger T.;
bituminösen T. mit hohem Gehalt an organischen Stoffen, welche
beim Glühen unter Bleichung des Thons zerstört werden;
Salzthon (Hallerde), mit Steinsalz und Calciumsulfat (Anhydrit oder
Gips) innig gemengt; Alaunthon (Vitriolthon, Alaunerde), Gemenge
von T. mit Eisenkies, gewöhnlich in mikroskopischen Teilchen,
welche bei der natürlichen oder künstlich
unterstützten Verwitterung Schwefelsäure bilden und auf
die im T. enthaltenen Kalium- und Aluminiumsilikate zersetzend
einwirken (vgl. Alaunerde, Schwefelkies); Septarienthon s.
Septarien), ein an mergeligen Nieren reifer T. Feuerfeste Thone
schmelzen erst bei sehr hoher Temperatur, eine Eigenschaft, die auf
der Abwesenheit oder dem geringen Gehalt an Kalium-, Magnesium-,
Eisen- und Manganverbindungen beruht. Einen durch Quarz, Kalk und
Eisen stark verunreinigten T. stellt der Lehm (s. d.) dar. T. mit
der Neigung zu Schieferung nennt man Letten, bei stärkerm
Hervortreten der Parallelstruktur Lettenschiefer. Ebenfalls den
Thonen beizuzählen ist die Walkerde (Walkererde), die eine
grünlichgraue bis olivengrüne Masse bildet, nur wenig an
der Zunge haftet, im Wasser zerfällt, aber sehr begierig
Öle und Fette einsaugt; chemisch scheint sie durch einen
konstanten Gehalt an Magnesia charakterisiert zu sein.
Porzellanjaspis (Porzellanit) und Basaltjaspis sind durch
natürliche Prozesse (Kohlenbrände, vulkanische
Eruptionen) gebrannte Thone. Sonstige Unterscheidungen beziehen
sich auf die geologische Formation, in welcher sie vorkommen, so z.
B. Tegel (ein Tertiärthon), Wälderthon (aus dem Weald),
Oxfordthon (zum Jurasystem gehörig) u. a. Im allgemeinen sind
die Thone in den mittlern und jüngern Formationen entwickelt
und werden in den ältern durch Schieferthone und Thonschiefer
vertreten. Ganz fremd sind sie aber selbst den ältesten
Gesteinsschichten nicht, wie z. B. in Rußland sowohl im Silur
als in der Steinkohlenformation Thone vorkommen. Die Thone bilden
bald mächtigere Schichten, bald dünne Lagen oder
Spaltenausfüllungen (Lettenklüfte) zwischen andern
Gesteinen, namentlich Kalken und Sandsteinen. Bisweilen findet man
sie auf primärer Lagerstätte als Hülle um diejenigen
Silikatgesteine, aus denen sie entstanden sind. Sie führen
häufig Versteinerungen, und dann gewöhnlich in besonders
schönem Erhaltungszustand. Bekanntere Thonlager sind die von
Großalmerode in Kurhessen, Passau, Stourbridge in England,
Hoganäs in Schweden für feuerfeste Thone; Köln,
Lüttich, Namur für Pfeifenthone; Bunzlau, Hildburghausen,
Klingenberg am Main, Koblenz u. v. a. O. für Töpferthone.
Thone dienen zu Fayence, Steingut, Topfwaren, Thonpfeifen,
Schmelztiegeln, Gußformen, zum Modellieren, zum Walken des
Tuchs, als Dungmaterial (namentlich Salzthon); unreinere
Varietäten und Lehm zu Backsteinen und Ziegeln, als
Baumaterial, zum Ausschlagen (Dichten) von Wasserkanälen etc.
Über die wichtige Rolle, welche der T. im Boden spielt, s.
Boden. Endlich sind thonige Schichten im Innern der Erde die
wichtigsten Wassersammler, welche als sperrende Schichten die
versinkenden Wasser der durchlassenden Gesteine auf ihrer
Grenzfläche auffangen und bei entsprechender Lagerung der
Schichten Quellenbildung veranlassen. Durch diese wassersperrende
Kraft schützen umgebende Thonschichten die Steinsalzlager vor
der Auslaugung.
Thonberg, Dorf im SO. von Leipzig, jetzt mit diesem
zusammenhängend, mit Irrenanstalt (der Stadt Leipzig
gehörig) und (1885) 3740 Einw. Unfern bezeichnet der
Napoleonstein Napoleons Standort in der Leipziger Schlacht (18.
Okt. 1813).
Thoneisenstein, brauner und roter, s. Brauneisenerz und
Roteisenstein.
Thonerde, s. Aluminiumoxyd.
Thonerdealaun, s. Alaun, konzentrierter.
Thonerdehydrat, s. Aluminiumhydroxyd.
Thonerdenatron, s. Aluminiumhydroxyd.
Thonerdesalze, s. Aluminiumsalze.
Thônes (spr. tohn), Stadt im franz. Departement
Obersavoyen, Arrondissement Annecy, am Fier, mit Collège,
kleinem Seminar, Uhrmacherschule, Fabrikation von Seilerwaren,
Kirschgeist, Pelzwerk und Baumwollwaren und (1881) 1694 Einw.
Thonet, Michael, Industrieller, geb. 1796 zu Boppard,
begründete eine Möbelfabrik in Wien, wo er die Möbel
aus gebogenem Holz erfand, und starb daselbst 1870. Die Fabrik wird
unter der Firma "Gebrüder T." von seinen Söhnen
weitergeführt. Die Rundstäbe werden durch Wasserdampf
oder durch Kochen in dünnem Leim erweicht und in eiserne
Formen gepreßt, deren Krümmungen sie nach dem Trocknen
behalten. Der Vorzug der gebogenen Möbel (Stühle,
Fauteuils, Schaukelstühle, Sofas, Klaviersessel u. dgl.)
besteht in großer Festigkeit.
Thongallen, regellos gestaltete Konkretionen von Thon in
andern Gesteinen, besonders in thonigen Sandsteinen. Sie
können, da sie sich nach dem Verritzen durch Wasseraufnahme
aufblähen u. abblättern, beim Abbau, namentlich beim
Tunnelbohren, große Schwierigkeiten bereiten und
Einstürze veranlassen.
Thonglimmerschiefer, s. Phyllitschiefer.
Thonissen, Jean Joseph, belg. Nationalökonom und
Rechtslehrer, geb. 21. Jan. 1817 zu Hasselt, studierte
Rechtswissenschaft, widmete sich hierauf der Advokatur und wurde,
nachdem er verschiedene Ämter im Gebiet der Verwaltung und der
Rechtspflege bekleidet hatte, 1847 Professor des Kriminalrechts an
der katholischen Universität zu Löwen und später
auch in das Abgeordnetenhaus gewählt. 1855 wurde er zum
Mitglied der Akademie in Brüssel ernannt und 1869 zum
korrespondierenden Mitglied der französischen Akademie. Seit
1863 der Abgeordnetenkammer angehörend, wurde er 26. Okt. 1884
Minister des Innern und des öffentlichen Unterrichts, trat
jedoch Oktober 1887 zurück. Er schrieb: "La constitution belge
annotée" (1844, 3. Aufl. 1879); "Le socialisme et ses
promesses" (1850); "Le socialisme dans le passé" (1851); "Le
socialisme depuis l'antiquité jusqu'à la constitution
française du 14 janvier 1852" (1852); "La Belgique sous le
règne de Leopold I" (1855-56, 4 Bde.; 2. Aufl. 1861, 3
Bde.); "Vie du comte Félix de Merode" (1861); "De la
prétendue nécessité de la peine de mort"
(1864); "Études sur l'histoire du droit criminel des peuples
anciens" (1869); "Mélanges d'histoire, de droit et
d'économie politique" (1873); "Le droit pénal de la
république athénienne" (1876); "L'organisation
judiciaire, le
662
Thonmergel - Thonwaren.
droit pénal et la procédure pénal de la loi
salique" (2. Aufl. 1882); "Travaux préparatoires du code de
procédure pénale" (1885).
Thonmergel, s. Mergel.
Thonon (spr. -óng), Arrondissementshauptstadt im
franz. Departement Obersavoyen, ehemalige Hauptstadt des Chablais,
am Genfer See und der Eisenbahn Collonges-St. Gingolph, mit Resten
des 1536 zerstörten Residenzschlosses, Collège,
Gipsbrüchen, Baumwollspinnerei, Handel mit Käse, einem
Hafen und (1886) 3216 Einw. Unfern das Schloß Ripaille.
Thonpfeifen, s. Thonwaren, S. 667.
Thonröhren, s. Mauersteine, S. 353.
Thonsandstein, s. v. w. thoniger Quarzsandstein, s.
Sandsteine.
Thonschiefer (Argilit), dichte schieferige Gesteine, die
gewöhnlich vorwiegend aus klastischem Material (einem
kaolinartigen Silikat, Quarz- und Feldspatbruchstücken,
Glimmer- und Talkblättchen) bestehen, daneben aber auch
kristallinische, meist nur unter dem Mikroskop erkennbare
Bestandteile enthalten. Die letztern, gewöhnlich als schwer
bestimmbare Mikrolithe entwickelt, scheinen Hornblende, Turmalin,
Glimmer und glimmerähnliche Mineralien zu sein. Außerdem
kommen Eisenkies, Kohleteilchen, Eisenoxydblättchen und
Kalkspat vor, in größern, makroskopischen Partien
Eisenkiesknollen (auch als Vererzungsmittel eingeschlossener
Petrefakten), Quarz und Kalkspat in Linsen, Nestern und Adern.
Gefärbt ist der T. meist grau oder schwarz, seltener rot,
grün und gelb. Das spezifische Gewicht schwankt um 2,8. Die
chemische Zusammensetzung ist infolge der schwankenden
mineralischen sehr unbestimmt. Geschiefert sind die T. meist sehr
deutlich und zeigen oft gleichzeitig die transversale Schieferung
(s. d.). An Varietäten sind zu unterscheiden: Dachschiefer
(Lehesten, Sonneberg u. a. O. im Thüringer Wald, Kaub etc. am
Rhein, Harz, Erzgebirge, England), sehr vollkommen und eben
schieferig; Tafelschiefer (Grapholith), durch beigemengte Kohle
intensiv schwarz gefärbt; Zeichenschiefer (schwarze Kreide,
Schieferschwarz; Thüringen, Oberfranken, Andalusien),
ebenfalls kohlereich, daneben weich und erdig; Griffelschiefer
(besonders Thüringen), zu Stengeln spaltbar infolge des
gleichzeitigen Auftretens der wahren und der falschen Schieferung
(s. d.); Alaunschiefer (Skandinavien, Vogtland, Harz, Böhmen),
reich an Eisenkies neben Kohle; Kalkthonschiefer (Alpen), in
welchem die Thonschiefermasse Kalklinsen umhüllt; Wetzschiefer
(Thüringen, Sachsen, Ardennen), kieselsäurereiche, harte
Varietäten von gewöhnlich hellerer Farbe. Im
Ottrelithschiefer (Ottrez in den Ardennen, Oberpfalz,
Pyrenäen, Nordamerika) sind Ottrelithblättchen
eingewachsen, im Chiastolithschiefer (Fichtelgebirge, Vogesen,
Bretagne, Pyrenäen) weiße Chiastolithe von verschiedener
Größe. Die zuletzt genannte Varietät ebenso wie
gewisse andre, in denen unbestimmt konturierte und mineralogisch
von der übrigen Gesteinsmasse nur wenig verschiedene
Konkretionen auftreten, welche nach ihrer Form die Namen
Knotenschiefer, Fruchtschiefer, Garbenschiefer und Fleckschiefer
veranlaßt haben, sind mit typischen Thonschiefern an einigen
Orten so verknüpft, daß sie sich allmählich aus
letztern heraus entwickeln und sich proportional zu einer
größern Annäherung an Eruptivgesteine, namentlich
Granit, mehr und mehr von dem normalen T. unterscheiden. Die
Bauschanalysen solcher Gesteine bewegen sich, namentlich wenn man
vom Gehalt an Wasser und organischen Substanzen absieht, innerhalb
enger Grenzen, so daß im wesentlichen nur eine Änderung
der Struktur, ein Kristallinischwerden der Bestandteile vorliegt
(vgl. Metamorphismus der Gesteine). Thonschiefergebiete, welche
eine Verknüpfung solcher "metamorphischer" Varietäten
aufweisen, sind aus Sachsen, dem Harz, den Vogesen, Pyrenäen,
aus Cornwall und von andern, auch transatlantischen Orten bekannt.
Es bilden diese Varietäten zugleich petrographische
Übergänge zu den Phylliten (s. Phyllit), welche im
allgemeinen reicher an kristallinischen Bestandteilen als die T.
sind. Die T. gehören den ältern Formationen an und kommen
nur selten (z. B. die tertiären Glarusschiefer, s.
Tertiärformation) in jüngern Schichten vor, werden aber
meist ihrerseits von den Phylliten an Alter noch übertroffen.
Eine Reihe von Bezeichnungen, Ortsnamen entnommen oder nach
Versteinerungen gewählt, dienen zur Charakterisierung des
Alters der T., so beispielsweise: Graptolithenschiefer im Silur,
Wissenbacher oder Orthocerasschiefer im Devon, Posidonienschiefer
des Kulms etc. Wo der T. in großer, Berge bildender
Mächtigkeit auftritt, setzt er meist abgerundete Höhen
und wellige Plateaus zusammen; seine Thäler sind oft schroff
eingerissen, am Fuß der klippenartig emporsteigenden
Thalwände mit großen Schutthalden bedeckt, welche die
starke Zerklüftung des Gesteins geliefert hat. Das letzte
Residuum der Verwitterung ist meist ein mit Gesteinsbrocken
gemengter, fruchtbarer Lehm- und Thonboden. T. dient zu
Dachplatten, Schreibtafeln, Griffeln, Tischplatten, die erdigen
Varietäten als schwarze Kreide, die harten als Wetzsteine, die
eisenkieshaltigen zur Alaun- und Vitriolbereitung.
Thonschneidemaschinen, s. Mauersteine, S. 351.
Thonstein, s. v. w. Porphyr- und Felsittuff (s.
Porphyrbreccie), früher für verhärteten Thon, in
einigen Varietäten für Bandjaspis gehalten.
Thonwaren, aus Thon geformte und gebrannte, oft glasierte
Gegenstände. Die ungemein zahlreichen Gattungen der T. werden
nach der innern Beschaffenheit der gebrannten Masse (des Scherbens)
eingeteilt. Die sehr stark erhitzten oder aus leicht schmelzbarer
Masse bestehenden sind auf dem Bruch dicht, glasartig, scheinbar
geflossen, kleben nicht an der Zunge, sind undurchdringlich
für Wasser und geben am Stahl Funken. Die weniger stark
erhitzten sind im Bruch erdig, porös, kleben an der Zunge und
lassen Wasser durchsickern. Knapp hat folgende Übersicht
gegeben:
A. Dichte T. 1) Echtes oder hartes Porzellan
(Feldspatporzellan), massiv, gleichsam geflossen, durchscheinend,
hell klingend, weiß, strengflüssig, mit dem Messer nicht
ritzbar, stark glänzende Glasur. Rohmaterial: Kaolin mit einem
Zusatz, dem sogen. Fluß, welcher, für sich unbildsam,
mit der Thonmasse zu einem Glas zusammenschmilzt. Der Fluß
besteht aus Feldspat mit Zusatz von Kreide, Gips, Quarz.
Ähnliche Zusammensetzung hat die Glasur. Die Masse wird in
Einer Operation gar gebrannt. Unglasiert zeigt die gebrannte Masse
ein mattes Aussehen und heißt Statuenporzellan oder
Biskuit.
2) Frittenporzellan, weiches Porzellan, Glasporzellan, aus
leichtflüssigerer Masse als englisches und französisches
fabriziert. Jenes besteht aus Kaolin und sich weiß brennendem
Thon mit Flußmitteln (Feuerstein, Cornish stone, Gips oder
Knochenasche). Masse und Glasur werden in zwei Operationen
gebrannt, zuerst die Masse, dann die Glasur. Das französische
Porzellan ist ein glasartiges, unvollständig geschmolzenes
Alkali-Erdsilikat ohne Thonzusatz mit bleihaltiger Glasur. Aus
einer Masse, ähnlich der
662a
Thonwarenfabrikation.
Fig. 1. Töpferscheibe, durch Maschinenkraft gedreht.
Fig. 2. Doppelofen für Holzkohlenfeuerung.
Fig. 3. Thomas Steinkohlenofen.
Fig. 4. Grundriß von Mendheims Gasofen.
Fig. 5. Querschnitt von Mendheims Gasofen.
Fig. 6. Längsschnitt von Mendheims Gasofen.
Zum Artikel »Thonwaren«.
663
Thonwaren (Porzellanfabrikation).
für das englische Porzellan, nur daß sie
strengflüssiger ist, besteht das parische Porzellan oder
Parian. Eine andre Masse steht in ihren Eigenschaften in der Mitte
zwischen Parian und Steinzeug und wird Carrara genannt. Aus feinem,
mit Salzsäure gereinigtem Feldspatpulver (Zusatz von
Knochenasche) stellt man die Porzellanknöpfe her. 3) Steingut,
wovon zu unterscheiden: feines Steingut oder Wedgwood aus
feuerfestem, sich weiß brennendem Thon, mit Flußmitteln
(Feldspat, Feuerstein), glasiert mit Blei- und Boraxglasur oder
unglasiert und gefärbt; ordinäres Steingut oder Steinzeug
aus einem farbigen, feuerfesten Thon, der mit dünner
Kochsalzglasur versehen wird: Material für
Mineralwasserkrüge, Töpfe, Schüsseln, Näpfe
etc. 4) Klinker, verglaste Ziegel, aus schmelzbarem Thon erzeugt,
als Pflasterziegel benutzt.
B. Poröse Thonwaren. Dieselben zeigen geringere Härte,
sind meist nicht gesintert, daher im Scherben porös, an der
Zunge klebend. 1) Feine Fayence, englisches Steingut, aus
weißem, feuerfestem Thon bestehend, mit durchsichtiger
bleiischer Glasur, häufig mit Malerei und
Kupferstichabdrücken geziert. 2) Ordinäre Fayence,
weißes Steingut, Majolika, aus sich gelblich brennendem Thon
oder Thonmergel mit undurchsichtiger, weißer oder
gefärbter Zinnglasur; zu gewöhnlichem Geschirr. 3)
Gemeine Töpferware, irdene Ware, Töpferzeug, alle aus
Töpferthon und Thonmergel dargestellten weichen und
porösen Gefäße, mit undurchsichtiger Zinn- oder
Bleiglasur überzogen und durch Metalloxyde gefärbt:
weiße und braune Töpferware. 4) Tabakspfeifen oder
kölnische Pfeifen aus weißem, feuerfestem Pfeifenthon
(Pfeifenerde). 5) Terrakotta, gebrannte, antike Formen nachahmende
Waren zu Bauornamenten, Fußbodenplatten, Mosaiksteinen. 6)
Schmelztiegel aus feuerfestem Thon, mit grobem Sand, auch wohl
Graphit vermischt (hessische, Passauer, Ipser, Graphittiegel
für Metallreduktionen). 7) Feuerfeste Steine, Schamottesteine
aus feuerfestem Thon zum Bau von Schmelzöfen. 8) Mauerziegel,
Backsteine, Dachsteine aus Lehm, magerm Töpferthon oder
Kalkmergel nebst Sandzusatz, durch Eisen gelb bis rot und braun
gefärbt; bisweilen glasiert.
Porzellanfabrikation.
(Hierzu Tafel "Thonwarenfabrikation".)
Hartes, echtes Porzellan. Die Grundmasse ist ein Gemisch von
reiner Porzellanerde mit Feldspat als hauptsächlichem
Flußmittel, zuweilen auch mit Quarz, Kreide, Gips. Der Quarz
mindert das Schwinden des Thons, nimmt ihm aber auch einen Teil
seiner Plastizität. Die Flußmittel machen die Masse
kompakt, klingend, glasartig, transparent, indem sie die
Thonteilchen beim Schmelzen umhüllen und miteinander
verbinden. Die natürlichen Rohstoffe bedürfen
sorgfältiger Zubereitung. Sie werden auf Stampfwerken oder im
Desintegrator zerkleinert, unter Wasserzufluß gemahlen,
gesiebt und geschlämmt. Beim Schlämmen bedient man sich
großer, terrassiert übereinander stehender
Schlammbottiche, die je in verschiedenen Abständen Löcher
haben, welche für gewöhnlich mit Holzpfropfen verstopft
sind. Das gepulverte Material kommt in die obersten Bottiche, wird
mit Hilfe zufließenden Wassers aufgeweicht und ausgewaschen;
die Milch fließt in die folgenden Bottiche, in welchen sich
das Pulver nach dem Grade der Feinheit als zarter Schlamm absetzt.
Die entwässerten, aber noch feuchten Materialien werden in
geeignetem Verhältnis gemischt, worauf man die Masse durch
Verdunstung im Freien oder durch künstliche Wärme, durch
Auflegen auf poröse Platten aus gebranntem Thon oder Gips,
unter welchen ein luftleerer Raum erzeugt wird, auf Filterpressen
oder endlich durch Pressen in Drilchsäcken noch weiter
entwässert, durch Kneten homogener macht und längere Zeit
in einem kühlen, feuchten Raum liegen läßt, damit
sie "faule". Sie färbt sich hierbei anfangs dunkel, dann unter
Gasentwickelung wieder weiß und erlangt eine günstigere
Beschaffenheit, ohne daß man mit Sicherheit angeben kann,
worauf dies beruht. Nach dem Faulen wird die Masse zerschnitten und
wieder zu Ballen geknetet, aus welchen nunmehr die verschiedenen
Gegenstände auf der Dreh- oder Töpferscheibe oder mit
Hilfe besonderer Formen hergestellt werden. Die Töpferscheibe
(Textfig.) besteht aus einer vertikalen eisernen Welle, deren
unteres Ende ein horizontales Schwungrad c, das obere eine Platte d
trägt. Gegenüber der Scheibe sitzt der Arbeiter und dreht
das Schwungrad und somit die Platte zuerst mit einer Stange, dann
mit dem Fuß oder durch maschinelle Vorrichtungen. Der Former
setzt die Masse auf die Mitte der Tischplatte, benetzt sie mit
Wasser, bringt die Scheibe in Drehung, bildet zuerst einen stumpfen
Kegel, drückt, während sich die Platte fortwährend
dreht, mit dem Daumen beider Hände in den obern Teil des
Kegels, gleichzeitig mit den Fingern auf die Seitenfläche und
hat es so in der Gewalt, der Masse eine bestimmte Höhlung und
äußere Form zu erteilen. Damit seine Hände glatt
und schlüpfrig bleiben, taucht er sie in fein zerteilte
Porzellanmasse, sogen. Schlicker. Anstatt mit dem Fuß des
Arbeiters, kann die Scheibe auch mit Maschinenkraft gedreht werden.
Eine derartige Scheibe ist in Fig. 1 der Tafel dargestellt; a ist
eine konische Trommel, die durch Treibriemen d gedreht wird, b eine
zweite in entgegengesetzter Lage stehende Trommel; ein Riemen c,
der durch eine Kurbel auf s verschiebbar ist, dient zur
Änderung der Umdrehungsgeschwindigkeit der Scheibe m, die ihre
Bewegung mittels des Riemens f erhält. Zur Herstellung genauer
Muster benutzt der Dreher Schablonen, die aus Blech geschnitten
sind und mit der Kante, welche die Kontur des Gegenstandes angibt,
gegen die beständig rotierende Thonmasse gehalten werden. Das
geformte Stück wird mit einem dünnen Messingdraht von der
Scheibe abgeschnitten, vorsichtig auf ein
664
Thonwaren (Porzellanfabrikation).
Brett gestellt und bei gewöhnlicher Temperatur im Schatten
getrocknet. Gegenstände von nicht kreisförmigem
Querschnitt oder von komplizierter Gestalt werden in Formen
hergestellt. Diese bestehen meist aus Gips, welcher der Masse so
viel Wasser entzieht, daß sie sich nach Entfernung der Form
nicht mehr verbiegt. Das Formen wird verschieden ausgeführt.
Bei der Ballenformerei drückt man die Masse in Stücken
von geeigneter Größe mit den Fingern oder mit Hilfe
eines Holzes so in die Form, daß das Stück
gleichmäßige Scherbenstärke erhält. Ist die
Form zweiteilig, so werden beide Hälften schließlich
aufeinander gelegt und die beiden Thonmassen miteinander vereinigt.
Teller, Tassen etc. formt man mit Hilfe von dünnen
Blättern aus weicher Porzellanmasse, die häufig mit
Maschinen erzeugt werden. Man gießt auch die Porzellanmasse
in Form eines gleichmäßig flüssigen Breies in die
porösen Formen, welche Wasser absorbieren und sich dadurch mit
einer Schicht von kompakterer Masse auskleiden. Sobald dies
geschehen ist, gießt man das flüssig Gebliebene ab und
füllt neue Masse ein, was so oft wiederholt wird, bis
hinreichende Wandstärke erreicht ist. Viele Figuren, Blumen,
Ornamente etc. werden aus freier Hand mit dem Bossiergriffel
gebildet. Die geformten Gegenstände bedürfen häufig
noch einer nachträglichen Bearbeitung durch Abdrehen,
Ausbessern, Guillochieren etc.; auch werden Henkel und andre
ähnliche Teile angesetzt, worauf man sie trocknen
läßt. Unglasiertes Porzellan kommt als Biskuit in den
Handel, besonders in Form von Kunstgegenständen, alle
Gebrauchsgegenstände aber werden glasiert.
Die Porzellanglasur ist sehr hart, glatt, glänzend, bekommt
nicht leicht Risse und haftet sehr fest auf dem Porzellan. Diese
Eigenschaften verdankt sie ihrer Zusammensetzung, die mit der des
Porzellans selbst wesentlich übereinstimmt. Man bereitet sie
aus einem Gemenge von fein gepulvertem und geschlämmtem
Kaolin, Quarzsand, Gips und Porzellanscherben, die mit Wasser etwa
zur Konsistenz der Kalkmilch angerührt werden. Die zu
glasierenden Stücke müssen neben gewisser Festigkeit
insbesondere Porosität besitzen, welche sie befähigt,
Feuchtigkeit schnell und leicht zu absorbieren. Damit sie diese
Eigenschaft erhalten, müssen sie einem schwachen Brande, dem
Verglühen, unterworfen werden. Zieht man sie dann durch eine
Flüssigkeit, in welcher feine Körper suspendiert sind,
wie in der Glasurflüssigkeit, so halten sie letztere wie ein
Filter in ihren Poren zurück, absorbieren die Feuchtigkeit,
bedecken sich mit Glasurschicht und erscheinen nach dem
Herausziehen trocken. Um von den glasierten Stücken alle
Verunreinigungen fern zu halten, werden sie nicht der direkten
Einwirkung des Feuers ausgesetzt, sondern in eigens für diesen
Zweck angefertigten Thongefäßen, Kassetten oder Kapseln,
die aus feuerfester Masse bestehen, gebrannt. In diese Kapseln
werden die Objekte eingesetzt; dieselben kommen dann in den
Porzellanbrennofen und zwar Kapsel auf Kapsel, so daß
möglichst an Raum erspart wird. Das Brennen des Porzellans,
wie der keramischen Objekte überhaupt, hat in der Neuzeit
erhebliche Fortschritte gemacht in Ausnutzung der Wärme,
Ersparung von Brennstoff, Verwertung auch schlechter
Brennmaterialien. Bis vor etwa zehn Jahren diente für den
Porzellanbrand der Holzetagenofen mit periodischem Brande. Die
Verbesserungen der Heizungsanlagen im Hüttenwesen, die
Anwendung des Ringofens in der Ziegelfabrikation wirkten
regenerierend auf diesem Gebiet. Kontinuierlicher Brand, Benutzung
von Gas als Brennstoff, Vorwärmung der Verbrennungsluft,
Ausnutzung der Verbrennungsgase charakterisieren die Gegenwart;
damit sucht sie bedeutende Leistungsfähigkeit und
Bequemlichkeit des Betriebs zu verbinden. Bereits im vorigen und
Anfang der 40er Jahre dieses Jahrhunderts versuchte man in
Frankreich, Porzellan mit Steinkohle zu brennen, jedoch ohne
Erfolg; erst in den 60er Jahren bürgerten sich solche
Öfen neben den ältern Etagenöfen in England,
Frankreich und Mitteldeutschland ein. In den 50er Jahren machte
Salvetat auf den hohen Wert der Gasfeuerung für die
keramischen Industrien aufmerksam, und es konstruierte dann Venier
den ersten brauchbaren Gasofen für die Thunsche
Porzellanfabrik zu Klösterle in Böhmen.
Fig. 2 zeigt den ältern Doppelofen für
Holzkohlenfeuerung, wie er zu Sèvres Anwendung fand, Fig. 3
den Steinkohlenofen von Thoma, Fig. 4-6 den Gasofen von G.
Mendheim. Der Holzetagenofen bestand aus drei durch flache
Gewölbe getrennten Etagen; die beiden untern L L' dienen zum
Glattbrennen, die obere L'' zum Verglühen des Porzellans; alle
drei Etagen kommunizieren durch die Öffnungen c c c in den
Gewölben. Die seitlichen Thüren P gestatten den Zugang in
die verschiedenen Räume; dieselben sind übrigens
während des Brandes vermauert. f f sind die seitlich
angebrachten Feuerkasten, die mittels eines eisernen Schiebers
verschlossen werden können. In dieselben wird durch o etwas
Holz gebracht und, sobald dieses brennt, o verschlossen und von
oben neues Brennmaterial zugebracht. Die Luft tritt nun von oben zu
dem Brennstoff, und die Flamme gelangt, durch die Kanäle
gehörig verteilt, in den Ofen. Die Feuergase ziehen
aufwärts, umspülen die eingesetzten
Kapselstöße und entweichen durch den essenartigen
Aufsatz H, welcher übrigens zur Regelung des Zugs durch Klappe
I nach Wunsch geöffnet oder geschlossen werden kann. In Fig. 3
bei dem Thomaschen Ofen ist A der Glattbrennofen mit
Einsetzthür a, C der Verglühofen, D die Esse, welche auf
Kappe b des Verglühofens ruht. Der Ofen hat fünf
Feuerkasten, in denen die Roststäbe der Roste g schräg
hängen; l ist der Fülltrichter, durch p
verschließbar. Durch seitliche Kanäle wird der Feuerung
Luft zugeführt. Die Einrichtung ist derart, daß die
Flamme an der Sohle r des Glattofens nach der Mitte getrieben wird,
um eine gleichmäßige Verteilung der Hitze zu bewirken;
durch w wird der Trockenraum S erwärmt, v ist die Klappe zur
Zugregulierung. Bei dem Gasofen von Mendheim erfolgt die Befeuerung
der einzelnen Kammern durch Gas, welches in besondern,
außerhalb des Ofens liegenden Generatoren erzeugt wird. Fig.
4 stellt den Grundriß des Ofens, Fig. 5 den Querschnitt, Fig.
6 den Längsschnitt der Kammer dar. Der Ofen besteht aus zwei
parallelen Kammerreihen von 18 Kammern, welche in der Weise
angeordnet sind, daß in jeder Reihe 9 Kammern liegen, die in
der Mitte durch Rauchsammler getrennt (1-9, 10-18), an beiden Enden
durch die Kanäle h1h2 verbunden sind. Das aus den beiden
Schachtgeneratoren a aus Steinkohle erzeugte Gas tritt durch die
eisernen Ventile b b in den Kanal c c ein, gelangt je nach Bedarf
durch Ventile d1d2 in die Kanäle e1e2, um hier zum Heizen der
bei f schließbaren Kammer zu dienen. Soll z. B. Kammer 8
befeuert werden, so öffnet man das zugehörige Ventil f;
das Gas strömt hinter einer Feuerbrücke in dieselbe ein
und kommt hier mit einem Luftstrom in Berührung, der bereits
die fertig gebrannten Kammern 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 11, 18, 17
passiert hat. Der Luftstrom
665
Thonwaren (Porzellanfabrikation).
ist bei 17 eingetreten und hat sich auf dem Weg bis 8
allmählich an den kühlenden Objekten erhitzt; hier herein
tritt er durch die in der Kammerwand befindlichen Löcher g g
und bewirkt die Verbrennung des Gases unter bedeutender
Wärmeentwicklung. Die Flamme streicht nun durch die
Löcher g g nach Kammer 9, von hier durch den Kanal h2 nach 10,
dann nach 11, 12, 13, 14. Letztere Kammer kann man von 15 durch
einen Blechschieber trennen; die Feuergase werden dadurch
gezwungen, durch das geöffnete Ventil i in den Rauchkanal zu
treten, um von diesem dem Schornstein l zugeführt zu werden.
Der Betrieb des Ofens ist demnach derselbe wie derjenige des
für den Ziegelbrand benutzten Ringofens. Während Kammer 8
im Garbrand, werden die Kammern 9-14 durch die abziehenden
Feuergase vorgewärmt; die Kammern 15, 16 sind ausgeschlossen,
15 wird neu beschickt, 16 entleert. Die Zirkulation der Luft
beginnt mit ihrem Eintritt bei 17 und endet mit dem Austritt der
Verbrennungsprodukte bei 14. Ist Kammer 8 gar gebrannt, so
schreitet man zu 9. Kammer 18 bildet dann die Eintrittsstelle
für Luft, Kammer 15 die Austrittsstelle; 16 wird neu
beschickt, 17 entleert u. s. f.
Das Einsetzen der zu brennenden Porzellangeschirre erfordert
große Aufmerksamkeit, da der Arbeiter die Kassetten nach den
Objekten zu wählen und die Kapselstöße in die
verschiedenen Stellen des Ofens unter möglichster
Raumausnutzung und Ausnutzung der Hitze zu verteilen hat. In den
Etagenöfen stellt er die Stöße in der Regel in drei
konzentrischen Ringen um eine Kernsäule; die Stöße
werden durch dazwischen gelegte Thonmassen gegeneinander verstrebt.
Ist die Einsetzarbeit vollendet, so werden die
Einsatzöffnungen vermauert, mit Aussparung von
Probelöchern, um den Gang durch eingelegte Probescherben
beobachten zu können. Anfangs gibt man in Öfen mit
direkter Feuerung ein schwaches Feuer. Man nennt dies Vorfeuer,
Lavier- oder Flatterfeuer; dieses wird in 12-15 Stunden zum
Scharffeuer (Weißglut) gesteigert, welches man 17-18 Stunden
unterhält. Hierauf verschließt man den Ofen und
läßt 3-4 Tage erkalten, um ihn zu entleeren. Das dem
Ofen entnommene Geschirr wird sortiert, wobei sich
verhältnismäßig wenig vollkommen fehlerfreie Ware
ergibt. Ein großer Teil des Porzellans wird mit Malerei
dekoriert, und hierbei kann mancher Fehler verdeckt werden. Die
Porzellanfarben sind gefärbte Gläser, welche durch
Einschmelzen oder Einbrennen befestigt werden. Manche Farben
ertragen die Hitze des Garbrandes, ohne zerstört zu werden
(Scharffeuerfarben); sie können unter Glasur aufgetragen und
mit ihr im Garofen eingeschmolzen werden. Bei andern ist dies nicht
der Fall (weiche oder Muffelfarben); sie werden stets auf der
Glasur des bereits gar gebrannten Porzellans aufgetragen und apart
in Muffeln eingebrannt. Die Zahl dieser letztern Farben ist sehr
viel größer, weil die meisten Metalloxyde im Scharffeuer
sich verflüchtigen oder einen unreinen Ton geben. Alle
Muffelfarben liegen auf dem Porzellan fühlbar erhaben und sind
als weiche Bleigläser der Abnutzung stark unterworfen. Als
Farbstoffe benutzt man Eisenoxyd für Rot, Braun, Gelb,
Violett, Chromoxyd für Grün, Chromoxyd und
salpetrigsaures Kobaltoxydkali für Blau und Schwarz, Uranoxyd
für Orange und Schwarz, Manganoxyd für Violett, Braun und
Schwarz, Iridiumoxyd für Schwarz, Titanoxyd und Antimonoxyd
für Gelb, Kupferoxyd und Kupferoxydul für Grün und
Rot, Goldpurpur für Purpur und Rosenrot etc. Bei Vergoldung
wird fein verteiltes Gold mit basisch salpetersaurem Wismutoxyd und
mit Quecksilberoxyd gemischt aufgetragen. Auch benutzt man Muschel-
oder Malergold und brennt in der Muffel ein. Die Vergoldung
erscheint matt und erhält erst durch Polieren mit Achat und
Blutstein Glanz. Zur Meißener oder Glanzvergoldung benutzt
man ein Präparat, welches Goldchlorid, Schwefelgold oder
Knallgold in Schwefelbalsam enthält. Man erhält hier
direkt glänzende Vergoldung, die aber sehr vergänglich
ist. Will man die Glasur des Hartporzellans färben, so
muß man, wenn die normale Zusammensetzung derselben nicht zu
sehr verändert und Haarrissigkeit herbeigeführt werden
soll, die farblosen Flußmittel (Kali und Kalk) in
äquivalenten Mengen durch färbende Metalloxyde ersetzen.
Da die Menge der farblosen Flußmittel bei der
Hartporzellanglasur aber nur 8-10 Proz. beträgt, so ist in
Bezug auf die Einführung der färbenden Metalloxyde nur
ein geringer Spielraum gelassen. Dazu kommt, daß
Hartporzellan ohne Anwendung einer reduzierenden Flamme kaum gar
gebrannt werden kann, und daß demnach solche Metalloxyde,
welche der Reduktion leicht unterworfen sind, für die Glasur
nicht angewendet werden dürfen. Aus diesen Gründen ist
die Palette für die Scharffeuerglasuren des Porzellans nur
schwach besetzt und beschränkt sich auf Kobalt-, Chrom-,
Eisen- und Manganoxyd nebst den edlen Metallen Gold, Platin und
Iridium. Seger hat deshalb eine neue Masse für Porzellan
zusammengesetzt, für welche die Garbrandtemperatur bedeutend
niedriger ist, so daß eine wesentlich leichtflüssigere
Glasur verwendet werden kann, ohne daß dieselbe Haarrisse
zeigt. Um diese Glasur zu färben, kann man weit
größere Mengen färbender Metalloxyde an Stelle der
farblosen Flußmittel einführen, auch sind die leichter
reduzierbaren Metalloxyde (Kupfer-, Nickel- und Uranoxyd) zu
verwenden, weil das Seger-Porzellan noch in oxydierendem Feuer gar
gebrannt werden kann. Dadurch ist die Palette für die farbigen
Glasuren, welche im Vollfeuer aufgebrannt werden können, eine
wesentlich ausgedehntere geworden als früher. Auch die
fabrikmäßige Herstellung des so sehr geschätzten
Chinesischrots, bisher das Geheimnis einiger Fabriken in Nanking,
wurde von Seger aufgefunden; nunmehr liefert die Berliner
Porzellanmanufaktur derartige Gegenstände in vorzüglicher
Qualität. Nach einer neuen Dekorationsweise für Porzellan
wird das Biskuit spitzenartig durchstochen und eine
zähflüssige Emailglasur aufgebracht. Dieselbe
überzieht das ganze Stück, so daß auch die
kleinsten durchstochenen Öffnungen erfüllt werden und
nach dem Brennen durchsichtig erscheinen (émail
ajouré). Beim Porzellandruck wird die gravierte Kupfer- oder
Stahlplatte mit Emailfarbe eingerieben, die Zeichnung auf Papier
gedruckt, dieser Druck auf Porzellan abgezogen und entweder im
Garfeuer oder in der Muffel eingebrannt. Lichtbilder oder
Lithophanien sind in flachen Gipsformen mit Reliefzeichnungen
gepreßte und unglasierte Porzellanplatten. Über
Porzellanmalerei als Kunstbeschäftigung s. den besondern
Artikel.
Frittenporzellan war in seiner Darstellung in Europa lange Zeit
vor dem echten bekannt und wurde als Surrogat desselben, als
weiches Porzellan, benutzt. Das englische Frittenporzellan (zum
Teil auch das nordamerikanische Iron-Stone) besteht aus
kalkhaltigem Porzellanthon von Cornwall (Cornish clay genannt),
einem feldspatartigen Mineral (Cornish stone, verwitterter
Pegmatit), plastischem Thon, Feuerstein und phosphorsaurem Kalk
(Kno-
666
Thonwaren (Steingut, Fayence etc.).
chenasche oder Phosphorit). Letzterer macht die Masse
leichtflüssig. Dies Porzellan wird im ersten Feuer nahezu gar
gebrannt und erhält im zweiten schwächern Feuer eine
leichtflüssige Glasur aus Cornish stone, Kreide, Feuerstein,
Borax und Bleioxyd. Hiernach ist das englische Porzellan weniger
haltbar und bekommt leichter Risse als das harte, die Masse aber
ist plastischer, verzieht sich weniger, weil sie nicht so scharf
gebrannt wird, erträgt geringere Scherbenstärke, und auf
der leichtflüssigen Glasur sind die schönsten
Farbennüancen anwendbar. Man brennt dies Porzellan in Kapseln
und in Etagenöfen mit Steinkohlen- oder Gasfeuerung. Parisches
Porzellan (Parian), von verschiedener Zusammensetzung, ist
strengflüssiger als das vorige, wachsartig schimmernd, von
mildem, gelbem Ton und wird unglasiert zu Statuen benutzt.
Ähnlich ist der Carrara. Das französische
Frittenporzellan ist ein Erdalkaliglas ohne Kaolinzusatz mit
bleihaltiger Glasur. Es wurde in Sèvres vor der Fabrikation
des echten Porzellans bis 1769 ausschließlich dargestellt.
Man bereitet es aus 75 Teilen Glas (aus Sand, Kalk, Pottasche und
Soda hergestellt), 17 Teilen Mergel und 8 Teilen Kreide. Diese
Materialien werden naß gemahlen und der Brei monatelang
aufbewahrt. Die Masse wird durch Seifen-, Leim- oder Gummiwasser
plastisch gemacht, kann aber nur in Gipsformen geformt und
muß, da sie sich beim Brand leicht verzieht, auf Formen von
feuerfestem Thon in Kapseln gebrannt werden. Hierzu genügt das
Verglühfeuer des Porzellanofens. Die Glasur ist ein
bleihaltiges Glas. In Sèvres wird dies Porzellan kunstvoll
durch die sogen. pastose polychrome Malerei dekoriert. Ähnlich
ist das Heißgußporzellan oder Kryolithglas, welches in
Philadelphia und Pittsburg in großem Maßstab fabriziert
wird.
Steingut, Fayence, Halbporzellan etc.
Steingut (Steinzeug) hat, ähnlich dem Porzellan, einen
dichten, halb verglasten, gleichartigen, klingenden, an der Zunge
nicht klebenden Scherben, unterscheidet sich aber vom Porzellan
dadurch, daß es auch in seinen weißen Varietäten
an den Kanten nicht durchscheinend ist. Gegen Temperaturwechsel
zeigt es sich sehr empfindlich, dagegen ist es sehr fest und von
beträchtlicher chemischer Widerstandsfähigkeit. Es ist
farblos oder farbig und kommt glasiert und unglasiert vor. Die
größere Plastizität gestattet die Herstellung sehr
großer Gefäße. Das feine weiße Steinzeug
wird aus sich weiß brennendem, weniger feuerfestem
plastischen Thon hergestellt, mit Zusatz von Kaolin und Feuerstein
und mit Cornish stone als Flußmittel, von welchem mehr als
bei der Porzellanfabrikation genommen wird, so daß das
Steinzeug bei niederer Temperatur zu brennen ist. Statt des Kaolins
benutzt man oft auch Feldspat und bedarf demnach geringerer Hitze.
Die Waren kommen unglasiert in die Kapseln, oder man kleidet die
Kapseln, in denen sie gebrannt werden, mit Kochsalz, Pottasche und
Bleioxyd aus oder gibt eine Glasur aus blei- und
borsäurehaltigem Glas. Das feine Steinzeug ist besonders in
England gebräuchlich, ebenso das ähnliche Wedgwood,
welches oft durch Metalloxyde in der Masse gefärbt oder nur
mit einer Schicht farbigen Thons überzogen und in der
mannigfaltigsten Weise, z. B. mit farbigen oder farblosen
Ornamenten auf andersfarbigem Grund, dekoriert wird. Basaltgut ist
schwarzes, sehr hartes und dauerhaftes Steingut, aus eisenhaltigem
Thon, Kiesel, Gips und Braunstein ohne Glasur gebrannt. Zu
Medaillons und feinen Kunstwerken dient das feine weiße
Jaspisgut.
Das gemeine Steingut bildet die Masse der
Mineralwasserkrüge, Krüge, Näpfe, Einmachkruken,
pharmazeutischen Geräte etc. Es wird aus einem plastischen,
mehr oder weniger gefärbten, ohne Zusatz von Flußmitteln
stark frittenden Thon, bisweilen unter Zusatz von Sand oder
gemahlenen Steingutfarben hergestellt und ist meist grau, gelblich,
rötlich oder bläulich. Der Thon wird nur eingesumpft, auf
der Thonknetmühle bearbeitet, auf Haufen gebracht, in
dünnen Spänen abgestochen und wieder geknetet. Das
Brennen geschieht in liegenden gewölbten Öfen mit meist
ansteigender Sohle oder in Kasseler Flammöfen. Befindet sich
die eingesetzte Ware in höchster Glut, so wird durch die
Öffnungen des Gewölbes Kochsalz eingeworfen. Die
Kieselsäure der Ware zersetzt bei Gegenwart von
Wasserdämpfen das Kochsalz unter Bildung von Salzsäure
und Natron, mit welch letzterm sie kieselsaures Natron bildet, das
mit der Thonerde auf der Oberfläche der Geschirre zu einer
Glasur von kieselsaurem Thonerde-Natron zusammenschmilzt.
Die Fayence hat ihren Namen von der Stadt Faenza in Italien, sie
ist in der Masse dicht, erdig, nicht durchscheinend, klebt an der
Zunge und wird wesentlich aus plastischem Thon, oft unter Zusatz
von gemeinem Töpferthon, bisweilen auch Kreide, Sand,
Glasfritte, Gips, Knochenasche etc. dargestellt. Sie ist deshalb
zum Teil feuerbeständig oder sehr schwer schmelzbar,
während andre Sorten nur bei niederer Temperatur gebrannt
werden dürfen. Die Glasur ist ein durchsichtiges oder
undurchsichtiges Bleiglas, wird leicht rissig und blättert
bisweilen ab. Durch die Risse dringen farbige Flüssigkeiten
und Fett in die Masse ein und lassen die Geschirre unrein
erscheinen. Von gewöhnlicher Töpferware unterscheidet
sich Fayence wesentlich nur durch feineres Material und
sorgfältigere Bearbeitung. Man unterscheidet feine und
ordinäre Fayence. Erstere besteht aus einer weißen,
dichten, harten, etwas klingenden Masse und erhält stets
durchsichtige bleiische Glasur. Hierher gehört das feine
Steingut von Mettlach, Belgien und dem nordöstlichen
Frankreich, welches aus weißem plastischen Thon mit Zusatz
von Sand und Kreide oder alkalireicher Glasfritte dargestellt wird,
ferner das englische Steingut (Staffordshire) aus sich weiß
brennendem, feuerfestem Thon mit Zusatz von Feuersteinpulver und
das Hartsteingut (feines englisches Steingut, Gesundheitsgeschirr,
Halbporzellan) aus weißem plastischen Thon mit Zusatz von
Kaolin. Der Thon wird auf einem Thonschneider mit Wasser gemischt,
auf einer Siebmaschine gereinigt, mit den übrigen Materialien
gemischt und die Masse auf der Filterpresse entwässert. Die
geformten und getrockneten Gegenstände werden in Kapseln bei
hoher Temperatur gebrannt, dann bemalt, bedruckt etc. und zuletzt
glasiert. Die Glasur bereitet man aus Bleioxyd, Feuerstein,
Feldspat, Cornish stone, Kaolin, oft unter Zusatz von Borax, Soda,
Salpeter, Kreide. Das Einbrennen geschieht in Kapseln bei sehr viel
niederer Temperatur. Da sich nun hierbei nicht wie beim Porzellan
das Geschirr verzieht, so braucht man nicht jedes Stück in
eine besondere Kapsel zu stellen, sondern kann mehrere Stücke
übereinander schichten, wobei nur die gegenseitige
Berührung durch feinspitzige Pinnen von Thonmasse verhindert
wird. Ein Teller z. B. ruht dann auf drei Pinnen, deren Marken man
auf der Unterseite des breiten Randes als kleine Glasurfehler
leicht auffindet. Hierdurch unterscheidet sich ein Fayenceteller
von einem Porzellanteller, welch letzterer beim Brand
667
Thor (Archit.) - Thor (nord. Myth.).
mit seinem untern Rand auf dem Boden der Kapsel steht und hier
zur Verhinderung des Anschmelzens von Glasur befreit wird. Der
feinen Fayence schließen sich auch die kölnischen oder
holländischen Thonpfeifen aus reinem weißen Thon ohne
Zusatz und die lackierten T., wie Terralith, Hydrolith, Siderolith,
an. Die ordinäre Fayence wird aus mehr oder weniger
eisenhaltigem plastischen oder Töpferthon mit Mergel- und
Sandzusatz dargestellt und bei so niedriger Temperatur gebrannt,
daß der kohlensaure Kalk des Mergels nicht zersetzt wird und
der Scherben mithin beim Übergießen mit Säure
braust. Die Glasur wird aus Blei- und Zinnoxyd, Sand und Kochsalz
oder Soda dargestellt und ist weiß, undurchsichtig, um die
Farbe des Scherbens zu verdecken, oft aber auch durch Metalloxyde
gefärbt. Die Fayence wird in Kapseln zweimal gebrannt und zwar
erst bei Kirsch- oder Hellrotglut, dann nach dem Auftragen der
Glasur (durch Eintauchen) bei kaum höherer Temperatur. Die
gemeine Fayence zeigt meist geringe Festigkeit und springt leicht
beim Erhitzen, so daß sie als Kochgeschirr nicht benutzt
werden kann. Eine besondere Gattung derselben bilden die
Ofenkacheln. Die Fayence wird unter oder auf der Glasur bemalt,
auch durch Angießen mit farbigem Thonbrei gefärbt und
bedruckt. Man benutzt fein pulverisierte Metalloxyde, mit gekochtem
Leinöl angerieben, als Druckerfarbe, druckt das Bild auf
feinem, weichem, mit Leinsamenschleim getränktem Papier,
bringt dieses sogleich auf die einmal gebrannte, also poröse
Fayence und drückt es mit Filz vorsichtig an. Löst man
nun das Papier vorsichtig mit Wasser ab, so bleibt der Druck auf
der Fayence und kann eingebrannt werden. Auch Flowing-colours und
Lüster werden häufig auf Fayence angewandt.
Mit dem Namen Majolika bezeichnet man die verschiedensten
Gattungen ordinärer Fayence und zwar solche mit auf der rohen
Glasur angebrachten, eingebrannten Malereien aus
feuerbeständigen Starkfeuerfarben, solche mit farbigen
Glasuren oder mit Malerei auf Steingutglasur, ferner Fayence mit
opaker Glasur, meist Imitationen italienischer Meister, desgleichen
Imitationen mit transparenter weißer Glasur auf einer den
rötlichen Scherben bedeckenden Lage farbigen Thons, ferner
Gegenstände, mit verschiedenfarbigen Thonlagen und darauf mit
durchsichtiger Glasur versehen (Schweizer Majolika). Während
letztere und die sogen. französischen Majoliken,
Steingutgegenstände mit farbigen Glasuren,
Gebrauchgegenstände geworden sind, liefert die italienische
Imitationsmajolika nur Luxus- und Schaustücke. Weiteres s.
Keramik.
Töpfergeschirr (Weiß- und Brauntöpferei).
Ordinäres Töpfergeschirr wird aus den verschiedensten
Thonen, wenn sie nur billig sind, namentlich aus Töpferthon
und Thonmergel, dargestellt und kann nur bei Dunkel- bis
Hellrotglut gebrannt werden. Infolgedessen bleibt die Masse sehr
porös und wird nur durch die Glasur gebrauchsfähig.
Letztere muß daher auch sehr haltbar sein und darf nicht
rissig werden oder abblättern. Die Geschirre ertragen starken
Temperaturwechsel und sind daher auch als Kochgeschirr verwendbar.
Für die sogen. Weißtöpferei, welche gemeines
Küchengeschirr herstellt, benutzt man den gemeinen
Töpferthon, für die Brauntöpferei, zu welcher das
Bunzlauer und Waldenburger Geschirr gehört, einen ziemlich
feuerbeständigen Thon. Zu fetter Thon wird mit magerm Thon
oder Sand, auch wohl mit Feuerstein, Kreide, Schamotte,
Steinkohlenasche gemischt und, nachdem er monatelang gelegen hat,
getreten, auf dem Thonschneider bearbeitet, geknetet, einem
Fäulnisprozeß unterworfen und abermals getreten,
geknetet etc., bis er hinreichend homogen geworden ist. Das
Schlämmen ist in der Regel zu teuer. Die auf der Drehscheibe
geformten und getrockneten Gegenstände werden häufig mit
einem Schlamm aus weißem oder farbigem Thon, auch wohl unter
Zusatz färbender Metalloxyde begossen (engobiert), um ihnen
eine bestimmte Farbe zu erteilen, und, nachdem der Beguß
getrocknet ist, durch Eintauchen, Begießen oder
Bestäuben mit Glasur versehen. Letztere ist eine leicht
schmelzbare Bleiglasur aus Bleiglätte oder Bleiglanz und Lehm,
welcher häufig färbende Metallpräparate beigemengt
werden. Bei richtiger Zusammensetzung der Glasur, wenn das Bleioxyd
vollständig an die Kieselsäure gebunden ist, entziehen
die in der Haushaltung vorkommenden Säuren (Essig,
Fruchtsäfte) der Glasur kein Blei, während saure Speisen
aus schlechter, namentlich ungenügend gebrannter Glasur Blei
aufnehmen können. Die ordinäre Töpferware wird in
der Regel nur einmal (mit der Glasur) und ohne Kapseln gebrannt.
Der Boden der Gefäße darf keine Glasur erhalten, damit
er nicht anschmilzt, auch muß die gegenseitige Berührung
der Geschirre thunlichst vermieden werden. Die Töpferöfen
sind meist liegende Flammöfen mit nur einer Feuerung an der
einen und der Esse an der andern Seite. Der Feuerraum ist vom
Brennraum in der Regel durch eine durchbrochene Mauer geschieden,
welche die Feuerungsgase möglichst gleichmäßig
verteilen, Flugasche zurückhalten und, wenn glühend, zur
Rauchverbrennung beitragen soll. Sehr gebräuchlich ist der
Kasseler Ofen (s. Mauersteine, S. 352). Auch Gasfeuerung ist auf
Töpferöfen mit Vorteil angewandt worden, und bei
großem Betrieb benutzt man die kontinuierlichen
Ringöfen, welche zuerst für Ziegeleien konstruiert
wurden. Über Mauersteine und Terrakotten s. diese Artikel;
über die Geschichte der Thonbildnerei s. Keramik. Vgl. Kerl,
Handbuch der gesamten Thonwarenindustrie (2. Aufl., Braunschw.
1878); Gentele, Vollständiges Lehrbuch im Poteriefach (2.
Aufl., Leipz. 1859); Schumacher, Die keramischen Thonfabrikate
(Weim. 1884); Möller, Die neue Bauanlage der königlichen
Porzellanmanufaktur zu Charlottenburg (Berl. 1873); Mendheim,
Brennöfen mit Gasfeuerung (das. 1876); Liebold, Die neuen
kontinuierlichen Brennöfen (Halle 1876); Stegmann, Gasfeuerung
und Gasöfen (2. Aufl., Berl. 1881); Challeton, L'art du
briquetier (Par. 1861), und die kunstgeschichtliche Litteratur bei
Keramik.
Thor, in der Architektur, s. Portal.
Thor (Thunar), in der nord. Mythologie Gott des Donners,
dem deutschen Donar (s. d.) entsprechend, war der erste Sohn des
Odin und der Jörd (Erde) und genoß unter allen Asen das
höchste Ansehen. Er wird geschildert als ein Wesen von
jugendlicher Frische, mit rotem Bart und von ungeheurer
Stärke, furchtbar besonders durch drei Kleinode: den
Donnerhammer Miölnir, der geschleudert sein Ziel nie verfehlte
und von selbst zurückkehrte, den Machtgürtel Megingiard
und die Eisenhandschuhe. Er lag in steter Fehde mit dem
Riesengeschlecht der Joten und Thursen, auch mit der Jormungandr
(Midgardschlange). Später erlegte er diese bei der
Götterdämmerung, doch wurde er hierbei selbst durch ihren
Gifthauch getötet. Seine Gattin, die Erdgöttin Sif (s.
d.), brachte ihm aus früherer Ehe den schnellen
Bogenschützen Uller zu und gebar ihm eine Tochter, Thrud
("Kraft"), während er von der Jotin Jarnsaxa zwei Söhne,
Magin ("Stärke")
668
Thor, Le - Thoren.
und Modi ("Mut"), besaß. Sein gewöhnlicher Wohnsitz
war Thrudheim ("Land der Stärke"); doch hatte er auch eine
Wohnung in Asgard, Namens Thrudwangr. Von ihm hat der Donnerstag
(Thorstag) den Namen. Vgl. Uhland, Der Mythus vom T. (Stuttg. 1836,
und im 6. Bd. der "Schriften").
Thor, Le, Flecken im franz. Departement Vaucluse,
Arrondissement Avignon, an einem Arm der Sorgues und an der
Eisenbahn Avignon-Cavaillon, hat eine gut erhaltene Kirche (im
Übergangsstil), Seidenspinnerei, Papierfabrikation,
Gipserzeugung und (1881) 1462 Einw.
Thora (Thorah, hebr.), bei den Juden vorzugsweise
Benennung des mosaischen Gesetzes und des dasselbe enthaltenden
Pentateuchs (vgl. Bibel, S. 879). Sefer-T., Buch des Gesetzes, die
von besondern Schreibern mit größter Genauigkeit
geschriebene Pergamentrolle, aus welcher in den Synagogen die
Abschnitte der Bücher Mosis vorgelesen werden.
Thorakocentesis (griech), s. Paracentese.
Thorakometer (griech., Brustmesser), Instrument zum
Messen des Brustumfanges und der Erweiterung des Brustkorbes beim
Atmen, wird vollkommen ersetzt durch ein gewöhnliches
Bandmaß.
Thorax (griech.), Brustharnisch (s. Rüstung); in der
Anatomie die Brust (s. d.) sowohl der Wirbeltiere als auch der
Gliederfüßer. Bei den letztern ist der T. zuweilen mit
dem Kopf zum sogen. Kopfbruststück (Cephalothorax, s.d.)
verwachsen. Bei den Insekten trägt er die drei Bein- und
gewöhnlich auch zwei Flügelpaare.
Thorbecke, Johann Rudolf, niederländ. Staatsmann,
geb. 15. Jan. 1798 zu Zwolle, studierte in Leiden die Rechte, dann
in Deutschland Philosophie, habilitierte sich 1822 als Dozent in
Gießen, dann in Göttingen und ward 1825 Professor der
politischen Wissenschaften zu Gent, 1830 Professor der Rechte zu
Leiden. 1840 in die Erste Kammer berufen, stimmte er für
durchgreifende Verfassungsreform, welche er bereits durch seine
Schriften: "Aanteekening op de grondwet" und "Proeve van herziene
grondwet" verteidigt hatte, und legte 1844 einen vollständig
ausgearbeiteten Entwurf einer Verfassungsreform vor, der aber erst
im Oktober 1848 von einer mit Revision des Grundgesetzes unter
Thorbeckes Leitung beauftragten Kommission angenommen wurde. Im
Oktober 1849 mit Bildung eines neuen Ministeriums beauftragt,
übernahm er in diesem das Portefeuille des Innern und wirkte
in dieser Stellung mit Eifer für Durchführung der
Verfassung. Da er indes den König durch schroffes Auftreten,
das protestantisch gesinnte Volk durch die Zulassung katholischer
Bistümer verletzte, ward er von seinen Gegnern 1853
gestürzt. T. war nicht bloß dem König, sondern auch
vielen sogen. Liberalen seines ernsten, rücksichtslosen Wesens
und seiner strengen politischen Doktrin wegen verhaßt, und
erst 30. Jan. 1862 trat er endlich wieder an die Spitze des
Ministeriums. Da indes seine Reformpläne im Kolonialwesen die
Interessen zu vieler, auch Liberaler, verletzten, ward er im
März 1866 wieder gestürzt, obwohl er der einzige
Staatsmann in den Niederlanden war, welcher wußte, was er
wollte, und die liberale Partei einigermaßen zusammenzuhalten
verstand. Das Verhalten des Ministeriums van Zuylen in der
Luxemburger Frage tadelte er aufs schärfste und führte
1868 dessen Sturz herbei, worauf er zwar 22. Mai den Auftrag
übernahm, ein neues Ministerium zu bilden, aber nicht selbst
eintrat, sondern dasselbe Fock übertrug und bloß in der
Kammer unterstützte. Nach dessen Abdankung, Anfang 1871, trat
er indes selbst wieder als Minister des Innern an die Spitze des
Kabinetts und bemühte sich, die Reform des Heerwesens zur
Sicherung der niederländischen Unabhängigkeit, die T.
durch Preußen bedroht glaubte, und die Einführung einer
Einkommensteuer durchzusetzen. Mit beiden Vorschlägen drang er
indes nicht durch und nahm im Mai 1872 deshalb seine Entlassung.
Noch ehe das neue Ministerium gebildet war, für welches T. die
Geschäfte noch fortführte, starb er 4. Juni 1872. Nach
seinem Tod erst würdigte man den Verlust des
überzeugungstreuen, energischen und praktisch befähigten
Staatsmanns und ehrte ihn 1876 durch ein Denkmal zu Amsterdam.
Gesammelt erschienen Thorbeckes kleinere Schriften ("Historische
schetsen", 2. Aufl., Haag 1872), seine Briefe aus den Jahren
1830-32 (Amsterd. 1873) und seine Reden (Deventer 1856-70, 6 Bde.).
Vgl. Olivier, Herinneringen aan T. (Haag 1872).
Thordsen, Kap, s. Eisfjord und Polarforschung, S.
160.
Thoreau (spr. thóro). Henry, nordamerikan.
Schriftsteller, geb. 1817 zu Concord bei Boston als der Sohn eines
Bleistiftmachers, besuchte das Harvard College in Cambridge,
welches er 1837 nach erlangtem Grad verließ, um als Lehrer
sein Brot zu verdienen. Sein unsteter, Selbständigkeit
liebender Geist ließ ihm aber keine Ruhe bei einer festen
Berufsstellung; er verschmähte die Handwerksthätigkeit
nicht und verstand sich aufs Zimmern, Malen, Bleistiftmachen und
Gartenarbeit. Die Schriftstellerei trieb er ebenso regellos
nebenher. T. ist eins der hervorragendsten Mitglieder jener durch
Emerson, Alcott, Margareta Fuller u. a. vertretenen Schule des
Idealismus, welche sich von der puritanischen
Strenggläubigkeit befreit hatte und einem freiern Leben im
Geist und in der Wahrheit zustrebte. In diesem Kreis war T. eine
der originellsten Erscheinungen, in der sich der Dichter und Denker
vereinigte. Der Gegenstand seiner Schriften ist fast
ausschließlich die Natur, deren Erscheinungen aus allen
Gebieten er in tief empfundenen Bildern und Betrachtungen zu
beschreiben verstand. Während zweier Jahre lebte T. in einer
von ihm selbst gezimmerten Hütte, eine Meile von Concord im
Wald; dort sammelte er seine zerstreuten Aufsätze zu dem Buch
"A week on the Concord and Merrimac rivers" (Bost. 1849) und
entstand die Schrift "Walden; or life in the woods" (das. 1855).
Seine andern Schriften wurden erst nach seinem 1862 erfolgten Tod
gesammelt herausgegeben. Es sind die mit einer kleinen
Lebensbeschreibung Thoreaus von seinem Freund Emerson eingeleiteten
"Excursions in field and forest" (Bost. 1863); ferner: "The Main
woods" (1864); "Cape Cod" (1865); "Early spring in Massachusetts";
"A Yankee in Canada" (1866); endlich: "Letters to various persons"
(1865). Ein hervorstechender Zug bei T. war seine leidenschaftliche
und frühzeitige Parteinahme für die Abschaffung der
Sklaverei. Sein Leben schrieben Page (1879) und Sanborn (Bost.
1882).
Thoren, Otto von, Maler, geb. 1828 zu Wien wurde 1846
Offizier, machte 1848 den ungarischen Feldzug mit und verweilte
dann längere Zeit in Venedig; 1857 wandte er sich ganz der
Malerei zu und studierte mehrere Jahre in Brüssel und Paris.
Gegen Mitte der 60er Jahre wurde er nach Wien berufen, um ein
Reiterbildnis des Kaisers von Österreich auszuführen.
Nachdem er noch einen Tod Gustav Adolfs gemalt hatte, wandte er
sich der Tiermalerei, insbesondere der Darstellung des Weideviehs,
zu, worin er sich durch energische Charakteristik und feine
Naturbeob-
669
Thorenburg - Thorn.
achtung bei breiter malerischer Darstellung auszeichnet. Seine
Hauptwerke sind: ungarische Ochsen, gegen den Wind nach Hause
getrieben, ackernde Ochsen, Pflüger aus der Normandie, der
herannahende Wolf, Ochsengruppe bei Sonnenuntergang. T. lebt in
Paris.
Thorenburg, Stadt, s. Torda.
Thoresen, Anna Magdalena, geborne Kragh, norweg.
Romanschriftstellerin, geb. 3. Juni 1819 zu Fridericia in
Jütland als die Tochter eines Schiffszimmermanns, kam mit 20
Jahren nach Kopenhagen, um sich zur Lehrerin auszubilden, ward nach
einigen Jahren Erzieherin im Haus des norwegischen Pfarrers
Thoresen und zwei Jahre später (1844) dessen Frau. Ihr neuer
Wohnort bot ihr in Fülle Gelegenheit, das Volk und die
nordische Natur zu studieren, und beide, Land und Leute Norwegens,
haben in ihr später die verständnisvollste Darstellerin
gefunden. Als nach 18jähriger Ehe der Pfarrer starb, wandte
sich die Witwe wieder nach Kopenhagen, um es nun mit der
Schriftstellerei zu versuchen. Sie brachte zuerst kleinere Arbeiten
("Fortällinger" u. a.), sodann die ebenso eigentümliche
wie schöne Erzählung "Signes Historie" (1864), die
durchschlagenden Erfolg hatte. Es war damals die Blütezeit der
Bauerngeschichten und die Strömung ihr sonach förderlich;
gleichwohl verdankt sie vorzugsweise ihrem eignen Talent die
Erfolge dieser und ihrer folgenden Erzählungen, die sich
ebensosehr durch Originalität der Erfindung und Tiefe der
Charakteristik wie durch Pracht der Schilderungen auszeichnen. Es
sind: "Solen i Siljedalen" (1868); "Billeder fra Vestkysten af
Norge" (1872); "Nyere Fortällinger" (1873); "Livsbilleder"
(1877); "Herluf Nordal" (1879); "Billeder fra Midnatsolens Land"
(1884-86, 2 Bde.). In ihren Bühnendichtungen ("Et rigt parti".
1870; "Inden Döre", 1877; "Kristoffer Valkendorf og
Hanseaterne", 1878; "En opgaaende sol", 1882) zeigt sie sich
weniger beanlagt. Der größte Teil ihrer Dorfgeschichten
wurde von Reinmar ins Deutsche übersetzt (2. Aufl., Berl.
1884, 5 Bde.). Ihre neueste Veröffentlichung ist ein Band
Gedichte (1887).
Thorheit unterscheidet sich von der Tugend, welche nur
gute, wie von dem Laster, welches nur schlechte Zwecke verfolgt,
durch moralische Gleichgültigkeit gegen die Beschaffenheit des
Zwecks, von der Weisheit, welche zur Erreichung guter, wie von der
Klugheit, welche zu solcher beliebiger Zwecke taugliche Mittel
wählt, durch die gedankenlose Sorglosigkeit oder (logische)
Verkehrtheit in der Wahl der Mittel.
Thorild, Thomas, schwed. Dichter und Denker, geb. 1759 zu
Kongelf in Bohuslän, trat als leidenschaftlicher Gegner des
herrschenden französischen Geschmacks auf und verschaffte, ein
Verehrer Klopstocks und Ossians, der Romantik in Schweden Eingang,
verweilte dann 1788-90 zur Ausführung seiner weltverbessernden
Ideen in England, ohne Erfolg zu haben, wurde nach seiner
Rückkehr wegen der freisinnigen politischen Schrift
"Ärligheten" ("Die Ehrlichkeit") auf mehrere Jahre des Landes
verwiesen, erhielt 1795 eine Anstellung als Professor der
schwedischen Litteratur und Bibliothekar zu Greifswald und starb
daselbst 1808. Weniger durch seine Poesien, von denen das
didaktische Gedicht "Passionerna" ("Die Leidenschaften^, Stockh.
1785) genannt sei, hat T. durch seine Streitschriften, die er zum
Teil unter dem Titel: "Kritik öfver kritiker med utkast til en
lagstiftning i snillets verld" ("Kritik über Kritiken nebst
Entwurf zu einer Gesetzgebung im Reich des Genies", 1791)
herausgab, Einfluß auf die Entwickelung der schwedischen
Dichtkunst ausgeübt. Als origineller und paradoxer Denker aber
erscheint er besonders in seinem Hauptwerk: "Maximum sive
archimetria" (Berl. 1799), das eine Fundamentalphilosophie oder
urwissenschaftliche Grundlehre, allgemeine Kritik "Tanti et Totius"
sein sollte. Grundlage alles Wissens ist danach das Gefühl der
Notwendigkeit, so zu denken, wie man denkt, und da bei einem echten
Denker vorausgesetzt werden müsse, daß er überhaupt
nichts, was ihm nicht denknotwendig scheine, denke, so sei
überhaupt jedes Denken Erkenntnis, weil und insoweit es
notwendiges Denken ist, und der Unterschied zwischen Wahrheit und
Irrtum besteht in dem Wieviel (Tantum quantum), d. h. in dem Grade
der Notwendigkeit, welche dasselbe besitzt. Ein philosophisches
Glaubensbekenntnis, das T. drucken ließ, soll
unterdrückt worden sein. Eine neue Ausgabe seiner "Samlade
skrifter" besorgte Hanselli (Stockh. 1873-1874, 2 Bde.). Vgl.
Geijer, Thorild (Upsala 1820).
Thorium (Donarium) Th, chem. Element, welches sich im
Thorit, Orangit, Pyrochlor, Monazit und andern seltenen Mineralien
findet und aus dem Chlorthorium gewonnen wird. Es bildet ein graues
Pulver vom spez. Gew. 7,73, Atomgewicht 231,96, zersetzt nicht
Wasser, ist leicht löslich in Salpetersäure, schwer in
Salzsäure, verbrennt beim Erhitzen an der Luft zu farbloser
Thorerde (Thoroxyd, Thorsäure) ThO2. Diese bildet mit
farblosen Säuren farblose Salze, die etwas zusammenziehend
schmecken und beim Erhitzen zersetzt werden.
Thorn (poln. Torun), Kreisstadt und seit dem Eingehen der
Festung Graudenz durch Anlage zahlreicher detachierter Forts auf
beiden Seiten der Weichsel Festung ersten Ranges, an der Weichsel,
über die hier eine 1000 m lange Eisenbahnbrücke
führt, Knotenpunkt der Linien Schneidemühl-T.,
T.-Allenstein, T.-Alexandrowo, T. Marienburg und Posen-T. der
Preußischen Staatsbahn, 34 m ü. M., hat alte, vom
Deutschen Orden erbaute Ringmauern, 2 evangelische und 3 kath.
Kirchen (unter letztern die Johanniskirche mit dem Epitaphium des
Kopernikus), eine Synagoge, ein altes Schloß (von 1260), ein
schönes Rathaus (mit wichtigem Archiv und Museum), 2
Bahnhöfe, ein Schlachthaus, einen Marktplatz (in der Altstadt)
mit der kolossalen Bronzestatue des Kopernikus, welche dem 1473 in
T. gebornen großen Astronomen 1853 hier errichtet wurde, und
(1885) mit der Garnison (2 Infanteriereg. Nr. 21 und 61, ein
Pionierbat. Nr. 2, ein Ulanenreg. Nr. 4 und ein
Fußartilleriereg. Nr. 11) 23,906 meist evang. Einwohner. Die
Industrie besteht in Eisengießerei, Maschinen-, Dampfkessel-,
Spiritus-, Seifen-, Tabaks- und berühmter
Pfefferkuchenfabrikation, Tischlerei und Schlosserei, Bierbrauerei
etc. Der lebhafte Handel, unterstützt durch eine
Handelskammer, eine Reichsbankstelle und andre Bankinstitute sowie
durch die Stromschiffahrt, ist besonders bedeutend in Getreide und
Holz, ferner in Wein, Kolonial-, Eisen- und Schnittwaren, Vieh,
Steinkohlen etc. Besucht sind auch die dortigen alljährlichen
Woll-, die allmonatlichen Pferde- und allwöchentlichen
Viehmärkte. T. ist Sitz eines Landgerichts, eines
Hauptzollamtes, des Stabes der 8. Infanteriebrigade und hat ein
Gymnasium mit Realgymnasium u. ein Lehrerinnenseminar. Unmittelbar
bei T. liegt das Dorf Mocker mit Eisengießerei, Ma-
Wappen von Thorn.
670
Thornbury - Thorwaldsen.
schinen- und Nudelfabrikation und (1885) 6826 Einw. sowie der
Flecken Podgorz mit 1972 Einw. Zum Landgerichtsbezirk T.
gehören die neun Amtsgerichte zu Briesen, Gollub, Kulm,
Kulmsee, Lautenburg, Löbau, Neumark, Strasburg und T. - Den
ersten Grund zu der Stadt legte der Hochmeister Hermann Balk 1231.
Deutsche Einwanderer aus Westfalen bevölkerten die Stadt, die
28. Dez. 1232 das unter dem Namen der Kulmischen Handfeste bekannte
Privilegium erhielt. T. trat später dem Hansabund bei. Hier
wurde 1411 zwischen dem König Wladislaw II. von Polen und dem
Deutschen Orden Friede geschlossen. 1454 ward das Schloß zu
T. vom Preußischen Bund erobert und von den Bürgern
zerstört. Am 19. Okt. 1466 ward hier ein zweiter Friede
zwischen Polen und dem Deutschen Orden geschlossen. Der
Waffenstillstand mit Polen zu T. 5. April 1521 gewährte dem
Hochmeister Albrecht von Brandenburg vier Jahre Ruhe bis zum
berühmten Krakauer Frieden. 1557 nahmen Rat und
Bürgerschaft die Reformation an, und 1558 ward die
Marienschule zu einem Gymnasium erhoben. Auf Veranlassung des
polnischen Königs Wladislaw IV. ward hier 1645 unter
Ossolinskis Vorsitz das sogen. Colloquium charitativum zur
Versöhnung der Katholiken und Dissidenten, woran auch G.
Calixt teilnahm, veranstaltet. Streitigkeiten, welche 16. Juli 1724
zwischen den Jesuitenzöglingen und den Schülern des
protestantischen Gymnasiums bei Gelegenheit der
Fronleichnamsprozession entstanden, hatten einen Tumult zur Folge,
wobei das Jesuitenkloster gestürmt und verwüstet wurde.
Die polnische Regierung ließ darauf auf Grund eines ganz
ungesetzlichen Verfahrens 7. Dez. 1724 den Stadtpräsidenten
Rößner nebst neun Bürgern enthaupten (Thorner
Blutbad) und bestimmte, daß der Magistrat künftig zur
Hälfte aus Katholiken bestehen und die Marienkirche den
Katholiken übergeben werden sollte. Bei der zweiten Teilung
Polens fiel T. zugleich mit Danzig 1793 an Preußen. Durch den
Frieden von Tilsit 1807 kam es an das Großherzogtum Warschau,
und 16. April 1813 mußte es, nachdem es von den Russen und
Preußen eingeschlossen worden war, nach achttägiger
Beschießung kapitulieren. Durch die Wiener Kongreßakte
von 1815 kam es von Polen an Preußen zurück und ward
seit 1818 mit Festungswerken versehen. Vgl. Wernicke, Geschichte
Thorns (Thorn 1839-42, 2 Bde.); Hoburg, Die Belagerungen der Stadt
und Festung T. (das. 1850); Steinbrecht, Die Baukunst des Deutschen
Ritterordens, Bd. 1: T. im Mittelalter (Berl. 1884); Kestner,
Beiträge zur Geschichte der Stadt T. (Thorn 1883); Steinmann,
Der Kreis T. (das. 1866).
Thornbury (spr. thórnböri), George Walter,
engl. Dichter und Schriftsteller, geb. 1828 zu London, gest.
daselbst 11. Juni 1876, begann seine Laufbahn 1845 mit
Beiträgen zum "Bristol Journal" und schrieb später
hauptsächlich für das "Athenaeum". Sein erstes
größeres Werk war: "Lays and legends of the New World"
(1851). Es folgten eine Geschichte der Bukanier ("Monarchs of the
Main", 1855, neue Aufl. 1873), "Shakspere's England during the
reign of Elisabeth" (1856, 2 Bde.) und "Art and nature at home and
abroad" (1856, 2 Bde.). Als Dichter zeigte er sich in "Songs of
Cavaliers and Roundheads" (1857), "Two centuries of song" (1867)
und "Historical and legendary ballads and songs" (1875) sowie in
seinen Romanen, von denen zu nennen: "Every man his own trumpeter"
(1858); "Icebound" (1861); "True as steel" (1863, 3 Bde.);
"Wildfire" (1864); "Tales for the marines" (1865); "Haunted London"
(1865); "Greatheart" (1866); "The vicar's courtship" (1869) und
"Old stories retold" (1869). Als Kunstschriftsteller hat sich T.
hervorgethan in den Werken: "British artists from Hogarth to
Turner" (1861, 2 Bde.) und "Life of J. M. W. Turner" (1861). Von
seinen Reiseschilderungen sind anzuführen: "Life in Spain"
(1859); "Turkish life and character" (1860); "Tour round England"
(1870, 2 Bde.); "Criss crossjourneys" (1873, 2 Bde.); "Old and new
London" (1873-74, 2 Bde.).
Thornhill, Stadt im südwestlichen Yorkshire
(England), am Calder, dicht bei Dewsbury, hat chemische Fabriken,
Eisenhütten und (1881) 8843 Einw.
Thornhill, James, engl. Maler, geb. 1676 zu Melcombe
Regis in Dorset, bildete sich bei Th. Highmore und war dann
besonders auf dem Gebiet der dekorarativen Malerei unter dem
Einfluß der französischen Schule thätig. Er
schmückte unter anderm die Kuppel der Paulskirche, die
große Halle zu Blenheim, die Kapelle zu Wimpole, die
große Halle zu Greenwich, ferner Hamptoncourt und Easton
Neston mit Gemälden und malte auch Porträte und
Landschaften. Er starb 13. Mai 1734 bei Weymouth.
Thornton, Stadt in Yorkshire (England), westlich von
Bradford, hat Worstedweberei, Fabrikation von Weberschiffen und
Holzschuhen und (1881) 6084 Einw.
Thorpe (spr. thorp), Benjamin, engl. Forscher auf dem
Gebiet der angelsächsischen Sprache und Litteratur, geb. 1782,
folgte in seinen Studien den Grundsätzen des Dänen Rask
(s. d.), dessen angelsächsische Grammatik er ins Englische
übertrug (Kopenh. 1830, 3. Aufl. 1879); starb 23. Juli 1870 in
Chiswick. T. lieferte viele schätzbare Ausgaben und
Übersetzungen angelsächsischer Sprachdenkmäler,
unter denen hauptsächlich die folgenden hervorzuheben sind:
"Anglo-Saxon version of the story of Apollonius" (Lond. 1836);
"Codex Vercellensis"(1837); "Ancient laws and institutes of the
Anglo-Saxon kings" (1840, 2 Bde.); "Codex Exoniensis, a collection
of Anglo-Saxon poetry" (1842); "Analecta anglo-saxonica" (1846,
neue Ausg. 1868); "Anglo-Saxon version of the four gospels" (1848);
"Beowulf" (1855, 2. Aufl. 1875); "Libri psalmorum versio, latina et
anglo-saxonica" (1857); "Anglo-Saxon chronicle" (1861, 2 Bde.) und
"Diplomatarium anglicanum aevi saxonici" (1865). Außerdem
schrieb er: "Northern mythology" (1852, 3 Bde.), eine kritische
Übersicht der Volkssagen Skandinaviens, Norddeutschlands und
der Niederlande, der sich "Yule tide tales" (1852) und eine
Übersetzung der Edda (1866) anschlossen; auch übertrug er
Lappenbergs "Geschichte Englands" sowie Paulis "Alfred d. Gr." u.
a. ins Englische.
Thorshavn, Stadt auf Strömö, s.
Färöer, S. 58.
Thorstein, Berg, s. Dachstein.
Thorsteuer (Thoraccise), eine Form der Aufwandsteuer,
erhoben beim Eingang von Waren in bewohnte (geschlossene) Orte,
kommt unter der Benennung Ottroi meist nur als Gemeindesteuer
vor.
Thorwaldsen, Bertel (in Rom Alberto genannt), Bildhauer,
geb. 19. Nov. 1770 auf der See zwischen Island und Kopenhagen,
wohin sich sein Vater, ein Isländer, begab, um sich seinen
Lebensunterhalt durch Schnitzen von Figuren für
Schiffsvorderteile zu erwerben. T. war schon als Knabe in demselben
Beruf thätig. Vom elften Jahr an besuchte er die
Kunstakademie, wo er mit Erfolg studierte und mehrere Preise
gewann. Unter anderm hatte T. damals die Büste des
Staatsministers Peter Andreas v. Bernstorff modelliert, welche er
später (1798) zu Rom in Marmor ausführte. Dadurch wurde
der Staatsmi-
671
Thorwaldsen.
nister Graf Reventlow auf ihn aufmerksam und verschaffte ihm ein
dreijähriges Reisestipendium. Im Mai 1796 verließ T.
Kopenhagen zu Schiff, kam aber erst im Februar des folgenden Jahrs
in Neapel und 8. März in Rom an. Hier ging ihm unter dem
Anschauen der antiken Götter- und Heroenbilder das
Verständnis für die klassische Kunstrichtung auf.
Insbesondere gaben auch die Zeichnungen von Carstens und Zoega
seinem Geiste die Richtung auf die ideale Schönheit der
antiken Kunst. Im Sommer 1798 übersandte er von Rom aus der
Kopenhagener Akademie sein erstes selbständiges Werk: Bakchos
und Ariadne. Gegen das Ende seines auf drei Jahre bestimmten
Aufenthalts in Rom führte er noch einen das Goldene Vlies
erobernden Jason aus, fand aber damit keinen Beifall und zerschlug
ihn. Ein neuer Jason, in kolossaler Größe, fand zwar bei
Zoega und Canova Anerkennung, hätte jedoch fast das Schicksal
seines Vorgängers geteilt. T. wollte seine Rückreise nach
Kopenhagen mit dem Bildhauer Hagemann aus Berlin antreten, ward
jedoch durch eine Paßangelegenheit des letztern um einen Tag
aufgehalten. Gerade an demselben Tag besuchte der reiche Brite Sir
Th. Hope Thorwaldsens Atelier und bestellte die Ausführung des
Modells vom Jason, wodurch über Thorwaldsens fernern
Aufenthalt in Rom und damit über seine Zukunft entschieden
wurde. Verschiedene Umstände verzögerten die Vollendung
der Arbeit bis 1828, wo T. das Werk zugleich mit mehreren Reliefs
und Büsten als Geschenken des Künstlers an Hope nach
England absendete. In das Frühjahr 1805 fällt die
Ausführung von vier Statuen: Bakchos mit Thyrsos und Patera,
Ganymed mit Jupiters Adler zu seinen Füßen, Apollon, mit
Leier und Plektron an den Baumstamm gelehnt, und die berühmte
Venus mit dem Apfel, nackt, mit dem Kleid über dem Baumstamm.
Letztere hat der Künstler später (1813-16) auch in
Lebensgröße ausgeführt. Im Mai 1805 wurde T. zum
Mitglied der Akademie in Kopenhagen und zum Ehrenmitglied der
Akademie in Bologna ernannt. Von den Werken der
nächstfolgenden Jahre sind die hervorragendsten: der Adonis
(1810) in der Münchener Glyptothek; das Relief: A genio lumen,
die Kunst als sitzende weibliche Gestalt darstellend; Hektor den
Paris auffordernd, die Waffen zu ergreifen, und vier Reliefs: Amor
als Löwenbändiger, Venus, aus der Muschel ins Licht der
Welt tretend, Amor, von der Biene verwundet und vor seiner Mutter
klagend, und Bacchus, welchen Merkur der Ino übergibt,
sämtlich für den Fürsten Malte von Putbus. Von
Napoleon I. erhielt T. den Auftrag, für den Sommerpalast auf
Monte Cavallo (Palazzo Quirinale) einen großen Fries
auszuarbeiten. T. wählte den Triumphzug Alexanders d. Gr. in
Babylon und vollendete das Werk im Juni 1812. Eine Ausführung
in Marmor, die Napoleon I. für Paris bestellt hatte, wurde
nach dem inzwischen erfolgten Sturz des Kaisers für die Villa
des Grafen Sommariva (jetzt Villa Carlotta) am Comersee 1828
vollendet. Später hat T. den Triumphzug noch mehrere Male
ausgeführt, unter anderm 1829 für das Schloß
Christiansborg in Kopenhagen (s. Tafel "Bildhauerkunst VII", Fig. 1
u. 2). Gestochen ist er am besten von Amsler (mit Beschreibung von
L. Schorn, Münch. 1835, und mit Text von Lücke, Leipz.
1870). In Montenero, wohin sich T. wegen Unwohlseins begeben,
führte er 1815 nach drei Monate langem schwermütigen
Hinbrüten die beiden schönen Reliefs: Nacht und Morgen an
Einem Tag aus. In den Jahren 1817 und 1818 modellierte er unter
anderm eine Statue des Ganymed, die Büste Lord Byrons, den
berühmten Hirtenknaben mit dem Hunde, die Statue der Hoffnung
(im Schloß Tegel bei Berlin), Merkur als Argustöter und
ein Relief für die Kapelle im Palast Pitti: Christus mit
seinen Jüngern am Meer bei Tiberias, dem Christus in Emmaus
folgte. Seine damals ausgeführte Gruppe der Grazien zeigt im
Gegensatz zu der berühmten des Canova die keusche Strenge der
Antike. 1819 kehrte T. nach Kopenhagen zurück. Seine ersten
dortigen Arbeiten waren die Büsten des Königs und der
Königin sowie mehrerer Prinzen und Prinzessinnen.
Bedeutungsvoller sind die Werke für die Frauenkirche in
Kopenhagen, welche er teils damals, teils später
ausführte. Im August 1820 verließ er, zum Etatsrat
ernannt, die dänische Hauptstadt und ging über
Deutschland, Polen und Österreich nach Italien zurück. In
Rom modellierte er zunächst die treffliche Porträtstatue
des Fürsten Potocki (jetzt in der Kathedrale zu Warschau) und
vollendete dann (1821) die Skizzen zu dem großen Bildercyklus
der Frauenkirche. Unter seiner Aufsicht führten seine
Schüler die Statuen der Apostel und den aus 14 Statuen
bestehenden Schmuck des Giebelfeldes: die Predigt des Johannes in
der Wüste aus. Das nächste größere Werk, das
Monument des Kopernikus, in Bronze gegossen, ward 1830 auf dem
Universitätsplatz zu Warschau aufgestellt. Zu Thorwaldsens
Hauptarbeiten der folgenden Jahre gehören: das Modell zur
Reiterstatue des Fürsten Poniatowski, welche, in Bronze
gegossen, 1830 zu Warschau enthüllt wurde, und die Büste
und ein Relief für den Sarkophag des Kardinals Consalvi.
Obwohl T. Protestant war, wurde er ausersehen, dem Papst Pius VII.
ein Denkmal zu setzen; dasselbe ward 1830 in Marmor vollendet und
in der Kapelle Clementina der Peterskirche aufgestellt. Weitere
Werke Thorwaldsens aus dieser Zeit sind: das Monument des Herzogs
Eugen von Leuchtenberg in der St. Michaelskirche zu München
und die Reiterstatue des Kurfürsten Maximilian I. von Bayern
auf dem Wittelsbacher Platz daselbst, die Statue Gutenbergs
für Mainz, welche 1837, und die Schillers für Stuttgart,
die 1839 enthüllt ward. 1838 unternahm T. eine zweite Reise
nach Dänemark und wurde mit großer Begeisterung
empfangen. Hier beschäftigte er sich vorzugsweise mit Werken,
deren Motive der christlichen Religion entnommen sind. Meisterwerke
dieser Richtung sind zwei große Reliefs, der Einzug Christi
in Jerusalem und der Zug des Heilands nach Golgatha, beide in der
Frauenkirche zu Kopenhagen. Damals modellierte er auch die Statue
König Christians IV., die, in Erz gegossen, im Dom zu
Roeskilde aufgestellt wurde, dann die Büsten Holbergs,
Öhlenschlägers, Steffens' und sein eignes Bild in
Lebensgröße. Im Mai 1841 kehrte er nach Rom zurück.
Dort vollendete er die Allegorien der sieben Wochentage in
Genienfiguren, für den König von Württemberg die
Reliefs der vier Jahreszeiten, der Hirtin mit den
Liebesgöttern im Nest und Amors, wie er sich bei Venus
über den Stich der Rose beklagt. Nachdem T. noch einen Cyklus
von Bildern aus dem Leben des Heilands, als Fortsetzung der im
Auftrag des Königs von Bayern begonnenen gleichartigen Arbeit,
entworfen, kehrte er im Oktober 1842 nach Kopenhagen zurück.
Hier beschäftigte ihn neben der Umarbeitung einiger
früher gefertigter Modelle zur Ausschmückung des
Schlosses Christiansborg vornehmlich der Plan zu einem Standbild
Luthers, welches aber nicht zu stande kam. Aus seinem Atelier zu
Rom ging in dieser Zeit die schon 1833 begonnene Statue Konradins
von Schwaben in Marmor hervor, welche in der Kirche Santa Maria
del
672
Thos - Thouars.
Carmine zu Neapel, wo Konradins Gebeine ruhen, aufgestellt ward.
T. starb plötzlich 24. März 1844 in Kopenhagen
während einer Vorstellung im Theater; sein
Leichenbegängnis trug das Gepräge nationaler Trauer.
Thorwaldsens Hauptgebiet war die Darstellung idealer,
mythologischer Gestalten; er schuf die Antike gleichsam neu in sich
in ihrer Wahrheit und Einfachheit, in ihrer Naivität und ihrem
Humor. In dieser Beziehung hat er eine Zeitlang auf die Richtung
der Kunst des 19. Jahrh. Einfluß geübt, besonders aber
auf die Kunst und Kunstindustrie seines Vaterlandes, die noch heute
seiner Richtung folgt. Die Darstellung des Individuellen,
Charakteristischen war ihm dagegen versagt, ebenso wie das
Dramatische außerhalb seiner Begabung lag. Seine Bedeutung
liegt in der Wiederbelebung der idyllischen Richtung der antiken
Kunst. T. war nie verheiratet und hatte außer einer
natürlichen Tochter keine Angehörigen. Zum Erben seines
künstlerischen Nachlasses nebst einem Kapital von 75,000
Thaler hatte er seine Vaterstadt eingesetzt mit der Bedingung,
daß ein eignes Gebäude zur Aufbewahrung desselben
errichtet werde. Dieses Thorwaldsen-Museum, nach Plänen des
Architekten Bindesböll im italienischen Stil aufgeführt,
wurde 1846 eröffnet und enthält (teils in Originalen,
teils in Abgüssen) die sämtlichen Kunstwerke sowie die
Kunstsammlungen des Meisters (darunter von seiner Hand 80 Statuen,
drei lange Bilderreihen in erhabener Arbeit sowie zahlreiche andere
Reliefs und 130 Büsten). In dem von den vier Flügeln des
Gebäudes umschlossenen Mittelraum befindet sich sein
schmuckloses Grab. Einen Katalog des Museums veröffentlichte
Müller (Kopenh. 1849-1851, 8 Tle.); eine Sammlung von
Lithographien (120) sämtlicher Werke Thorwaldsens gab Holst im
"Musée T." (das. 1851). Denkmäler des Künstlers
befinden sich im Garten des Palazzo Barberini zu Rom (nach Emil
Wolff) und zu Reikjavik auf Island (seit 1875). Zu den
bedeutendsten seiner Schüler gehören die Dänen
Freund und Bissen, die Deutschen Emil Wolff, Schwanthaler, von der
Launitz, die Italiener Tenerani, Bienaimé u. a. Vgl. Thiele,
Leben und Werke des dänischen Bildhauers B. T. (Leipz.
1832-34, 4 Bde. mit 160 Kupfertafeln); Derselbe, Thorwaldsens
Leben, nach eigenhändigen Aufzeichnungen (deutsch, das.
1852-56, 3 Bde.); E. Plon, T., sein Leben und seine Werke (a. d.
Franz, Wien 1875); Hammerich, T. u. seine Kunst (Gotha 1876).
Thos, s. Schakal.
Thoth (Tehut), ägypt. Gott, mit dem die Griechen den
Hermes identifizierten, ist ursprünglich Lunus, ein Mondgott,
gewöhnlicher aber der Gott der Schrift und Wissenschaft. Sein
heiliges Tier ist der Ibis, er selbst wird beständig mit einem
Ibiskopf dargestellt (s. Abbildung); außerdem war ihm der
Hundskopfaffe heilig, unter dessen Form er gleichfalls mitunter
erscheint. Seine gewöhnlichsten Attribute sind Schreibtafel
und Griffel. Er gilt als der Urheber aller Intelligenz und als der
Verfasser der heiligsten Bücher. Weiteres s. Hermes
Trismegistos.
Thou (spr. tu), 1) Jacques Auguste de, latinisiert
Thuanus, franz. Geschichtschreiber und Staatsmann, geb. 8. Okt.
1553 zu Paris, wo sein Vater Christoph de T. erster
Parlamentspräsident war, studierte in Orléans und
Valence die Rechte, ward von Heinrich III. mit mehreren wichtigen
Missionen, unter andern 1576 mit den Unterhandlungen mit den
protestantischen Führern in Guienne, betraut und zum
geistlichen Rat beim Pariser Parlament ernannt. Nach dem Tod seiner
beiden Brüder gab er den beabsichtigten Eintritt in den
geistlichen Stand auf, ward 1584 Requetenmeister, folgte 1586
Heinrich III. nach Chartres, veranlaßte ihn 1588 zu dem
Bündnis mit Heinrich von Navarra und reiste, um Geld zur
Fortsetzung des Kampfes gegen die Liga zu schaffen, nach
Deutschland und Italien. Nach Heinrichs IIl. Ermordung trat er in
die Dienste Heinrichs IV. 1594 ward er Vizepräsident des
Parlaments und Großmeister der königlichen Bibliothek.
Als toleranter, freisinniger Katholik hatte er wesentlichen Anteil
an der Ausarbeitung des Edikts von Nantes. Nach Heinrichs IV.
Ermordung (1610) verlieh ihm die Regentin Maria von Medici nicht
die ihm versprochene Stelle des ersten Präsidenten des
Parlaments, sondern ernannte ihn zu einem der drei
Generaldirektoren der Finanzen; daher zog er sich bald aus dem
öffentlichen Leben zurück. Er starb 7. Mai 1617. Sein
Hauptwerk ist die "Historia mei temporis", 1543-1607, die er 1591,
vom Tod Franz' I. ausgehend, begann. Die ersten 18 Bücher
wurden 1604 veröffentlicht. 1606 erschien eine neue Ausgabe
bis zum 49. Buch, 1614 eine dritte, 80 Bücher umfassend, bis
1584. Das Werk sollte nach seinem Plan 138 Bücher umfassen und
bis zum Tod Heinrichs IV. reichen; allein bei Veranstaltung der
nächsten Ausgabe überraschte ihn der Tod, und dieselbe
erschien daher erst 1620, von seinem Verwandten Dupuy und seinem
Freund Nic. Rigault besorgt. Vollständig erschien das Werk in
dem ursprünglichen Text und von Rigault aus Thous Materialien
bis zu dem bestimmten Ziel fortgesetzt zu London 1733 in 7
Bänden. Nach dieser Ausaabe ist die 1734 zu Paris (mit dem
Druckort London) erschienene französische Übersetzung (16
Bde.) abgefaßt. Das in trefflichem lateinischen Stil
geschriebene Werk ist für die Geschichte jener Zeit, besonders
die französische, und für die Würdigung der
damaligen religiösen Händel äußerst wichtig,
da T. Augenzeuge vieler Ereignisse war und nach unparteiischer
Wahrheit strebte. Dennoch wurde er als kirchenfeindlich und
parteiisch für die Hugenotten angegriffen. Zu seiner
Rechtfertigung schrieb T. seit 1616: "Thuani commentarius de vita
sua", libri IV" (Orl. 1620, deutsch in Seybolds "Selbstbiographien
berühmter Männer"). Eine Sammlung trefflicher Poesien in
lateinischer Sprache erschien unter dem Titel: "Posteritati;
poematum opus notis perpetuis illustratum a J. Melanchthone"
(Amsterd. 1678). Vgl. Phil. Chasles, Discours sur la vie et les
oeuvres de J. A. de T. (Par. 1824); Düntzer, de Thous Leben,
Schriften und historische Kunst (Darmst. 1837).
2) François Auguste de, franz. Staatsrat, Sohn des
vorigen, geb. 1607 zu Paris, glich seinem Vater an Talenten und
Kenntnissen sowie an Edelmut des Charakters, wurde sehr jung
Parlamentsrat, Requetenmeister, auch Großmeister der
königlichen Bibliothek und später Staatsrat, aber als
Mitwisser der Verschwörung des Cinq-Mars (s. d.) 12. Sept.
1642 in Lyon enthauptet.
Thouars (spr. tuár), Stadt im franz. Departement
Deux-Sèvres, Arrondissement Bressuire, rechts am Thouet,
über den drei Brücken führen, Knotenpunkt
[Thoth.]
673
Thouars - Thrakische Chersones.
der Eisenbahnen Tours-Bressuire und Saumur-Niort, hat ein
Felsenschloß mit schöner Kapelle, Reste von
Befestigungswerken, Weberei, Gerberei, Handel mit Getreide, Pferden
etc. und (1881) 3535 Einw.
Thouars, auch P. Th., bei botan. Namen für L. M. A.
du Petit-Thouars, geb. 1756 auf Schloß Boumois in Anjou,
bereiste die Maskarenen und Madagaskar, gest. 1831 in Paris. Flora
der südafrikanischen Inseln; Obstbäume.
Thourout (spr. turuh), Stadt in der belg. Provinz
Westflandern, Arrondissement Brügge, Knotenpunkt der
Staatsbahnlinie Ostende-Ypern und der Linie Brügge-Courtrai,
hat Leinweberei, Gerberei, Hutfabrikation und (1888) 8972 Einw.
Thouvenel (spr. tuhw'nell), Edouard Antoine, franz.
Staatsmann, geb. 11. Nov. 1818 zu Verdun, bereiste nach
Absolvierung seiner Rechtsstudien den Orient (vgl. sein Werk "La
Hongrie et la Valachie", 1840), ging 1844 als Attaché nach
Brüssel und 1845 als Gesandtschaftssekretär nach Athen,
wo er 1848 Gesandter wurde; 1850 ward er nach München
versetzt. Als entschiedener Anhänger des
Prinz-Präsidenten erhielt er nach dem Staatsstreich vom 2.
Dez. 1851 die Leitung der politischen Angelegenheiten im
Departement des Auswärtigen übertragen. Dem Kaiser machte
er sich unentbehrlich durch die Gewandtheit, womit er dessen Ideen
aufzunehmen und in vollendeter Form diplomatisch zu gestalten
verstand. 1855 für den Gesandtschaftsposten in Konstantinopel
ausersehen, sollte er vornehmlich den englischen Einfluß im
Diwan brechen; doch gelang es ihm nicht, den französischen
Einfluß zu größerer Geltung zu bringen. Seit 8.
Mai 1859 Senator, war er vom 24. Jan. 1860 bis 15. Okt. 1862
Minister des Auswärtigen. Er starb 19. Okt. 1866 in Paris.
Vgl. "Le secret de l'empereur. Correspondance confidentielle et
inédite entre M. T., le duc de Grammont et le
général Flahault 1860-63", veröffentlicht von M.
Thouvenel (Par. 1888).
Thouvenin (spr. tuhw'náng), Louis Etienne de, geb.
1791 zu Moyenvic (Meurthe), wurde 1811 Artillerieleutnant im
französischen Heer, focht mit Auszeichnung in den
Feldzügen 1813-15, dann 1823 in Spanien, 1828 in Griechenland,
trat 1853 als Brigadegeneral in den Ruhestand und starb 1882. Er
schlug 1840 eine Verbesserung des gezogenen Gewehrs vor, indem er
einen Dorn in der Schwanzschraube des gezogenen Gewehrs anbrachte,
und konstruierte 1844 eine Dornbüchse mit Langgeschoß,
welche 1846 angenommen, fast in allen Heeren als Jägerwaffe,
auch als Birsch- und Scheibenbüchse benutzt und erst durch das
Minie- und Zündnadelgewehr verdrängt wurde.
Thrakien (Thrake, lat. Thracia), in den ältesten
Zeiten Bezeichnung der nördlich von Griechenland sich
ausdehnenden Landstriche, dann das Land östlich und
nördlich von Makedonien; zur Zeit der Römerherrschaft das
im W. vom Gebirge Rhodope, im N. vom Hämos, im O. vom Pontos
Euxeinos und dem Thrakischen Bosporus und im S. von der Propontis,
dem Hellespont und dem Ägeischen Meer begrenzte Land.
Hauptgebirge desselben ist der Hämos im N., an den sich im SW.
der Skomios anschließt. Die bedeutendsten Flüsse sind
die an der Südküste mündenden: Nestos und Hebros
(jetzt Maritza) mit dem Ergines (jetzt Ergene) und dem Artiskos
(Arda). Von Meerbusen ist nur der Melasbusen zwischen T. und der
Thrakischen Chersones ermähnt. Das Land lieferte Getreide in
Menge und selbst Wein. Auch an edlen Metallen war es reich, und bei
Philippi wurden Goldminen bearbeitet. Die unter dem allgemeinen
Namen Thraker (Thrakes) begriffenen Einwohner arischen Stammes
standen frühzeitig auf einer ziemlich hohen Stufe der Kultur,
sanken aber später in derselben und zerfielen in eine Menge
Völkerschaften, z. B. die Odrysen am Hebros, die Besser
längs der Rhodope und die Kikonen und Bistonen am
Ägeischen Meer. Die Sitten und Gebräuche der Thraker
hatten viel Übereinstimmendes mit denen der germanischen
Völker. Jagd und Krieg bildeten die Hauptbeschäftigung
der Männer. Eine den Thrakern eigentümliche Sitte war das
Tättowieren. Manche Stämme hatten Könige, denen ein
Rat zur Seite stand. Die Religion war die polytheistische der
Griechen. Menschenopfer wurden nur bei Nationalfeiern dargebracht.
Die wichtigern Städte, fast durchweg griechische Siedelungen,
waren, zwischen Nestos und Hebros an der Küste: Abdera,
Maroneia, Änos; auf der Thrakischen Chersones: Sestos,
Kallipolis, Lysimachia; an der Propontis: Perinthos, Selymbria; am
Thrakischen Bosporus: Byzantion; am Pontos: Apollonia, Mesembria;
im Innern: Philippopolis, Hadrianopolis.
Dareios Hystaspis hatte auf seinem Feldzug gegen die Skythen 515
v. Chr. die um den Pontos Euxeinos wohnenden thrakischen
Stämme unterjocht; doch hörte die persische Herrschaft
wieder ganz auf, als der Zug des Königs Xerxes gegen
Griechenland 480 unglücklich ablief. Nach den Perserkriegen
bemächtigten sich die Griechen der thrakischen Küsten,
und namentlich war es Athen, welches mehrere Seestädte und die
Striche in T. mit den Goldbergwerken an sich riß. Im Innern
gelangten besonders die Odrysen zur Herrschaft, namentlich unter
ihren Fürsten Teres und Sitalkes, der sein Reich bis zum
Istros, Nestos und Pontos Euxeinos ausdehnte. Mit den Athenern
befreundet, unternahm er auf ihre Veranlassung gegen Perdikkas von
Makedonien 430 einen Feldzug, blieb aber 425 gegen die Triballer.
Sein achfolger Seuthes L unterwarf sich mehrere Nachbarvölker.
Seuthes I. (400) war der Schwiegersohn des Atheners Xenophon. Sein
Nachfolger Kotys (380) eroberte fast ganz T., wodurch er in
Zwiespalt mit Athen geriet. Sein Sohn Chersobleptes wurde von
Philipp von Makedonien 343 seines Landes beraubt und T. dem
makedonischen Reich einverleibt. Nach Alexanders d. Gr. Tod wurde
T. Lysimachos 311 zugesprochen, doch behaupteten mehrere
Stämme unter Seuthes III. ihre Unabhängigkeit. Nach
Lysimachos' Tod eroberten 280 keltische Völkerschaften das
Land, wurden aber um 220 wieder vertrieben, worauf wieder jeder
Volksstamm seinen besondern Heerführer hatte. Besonders
mächtig wurden die Besser sowie die odrysischen Fürsten.
M. Crassus unterwarf einen großen Teil des Landes, welcher
unter dem Namen Mösia zur römischen Provinz gemacht ward.
Das übrige T. stand zwar in Abhängigkeit von den
Römern, hatte aber eigne Könige. Nach dem Tode des
Rhömetalkes, 7 n. Chr., verteilte Kaiser Augustus dessen Reich
zwischen dessen Bruder und Sohn Rheskuporis und Kotys V. Ihnen
folgte durch die Gunst des Tiberius des erstern Sohn
Rhömetalkes II., und Caligula überließ ihm 38 die
Herrschaft über ganz T. Nach seinem Tod (47) wurde ganz T.
römische Provinz, erhielt aber erst von Vespasianus die
Einrichtung einer solchen. Unter den byzantinischen Kaisern wurden
viele fremde Völker nach T. verpflanzt, so die Bastarner von
Probus, die Goten von Valens und Theodosius. Vgl. Cary, Histoire
des rois de Thrace (Par. 1825).
Thrakische Chersones, s. Chersonesus.
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl., XV. Bd.
43
674
Thrakischer Bosporus - Thrasybulos.
Thrakischer Bosporus, im Altertum Name der Straße
von Konstantinopel.
Thran (Fischthran, Fischöl), fettes Öl aus
Seesäugetieren und Fischen. Die Waltiere und Robben, welche
hauptsächlich des Thrans halber gejagt werden, besitzen unter
der Haut eine sehr starke Specklage, aus welcher man durch
Auskochen den T. gewinnt. Früher geschah dies meist auf den
Schiffen selbst, während man jetzt den in Fässern
verpackten Speck nach den Seestädten bringt und mit Dampf
ausschmelzt. Frischer Speck liefert einen hellen T. von mildem
Geschmack und Geruch; aus dem auf der Reise angefaulten Speck
erhält man dagegen bei größerer Ausbeute einen
dunkelbraunen T. von widerlich scharfem Geruch und Geschmack,
nachdem eine etwas bessere Sorte vorher freiwillig abgeflossen ist.
Der braune T. wird durch Schütteln mit Ätzkali oder
Metallsalzlösungen, Lohbrühe oder Chlorkalk gereinigt und
zum Teil auch gebleicht. Heller T. harzt stärker auf dem Leder
als dunkler, bei höherer Temperatur durch Ausbraten gewonnener
und erhält die guten Eigenschaften des letztern, wenn man ihn
auf 290° erhitzt. Der gewöhnliche Walfischthran,
zunächst vom Grönlandswal (Balaena Mysticetus) gewonnen,
ist meist als weißer T. im Handel, obwohl davon auch eine
gelbe und braune Sorte existiert. Der T. vom Pottfisch oder
Kachelot (Catodon macrocephalus) ist hell orangegelb, in
dünnen Schichten lichtgelb, durchsichtig klar, vom spez. Gew.
0,884, setzt bei 8° nadelförmige Fettkristalle ab. Er
dringt leicht in das Leder ein, schlägt aber gern durch.
Delphinthran, hauptsächlich aus dem Speck des Grindwals
(Globiceps macrocephalus), im Norden Europas in großen Mengen
erzeugt, ist leichtflüssig, zitronengelb, von sehr starkem
Geruch, scheidet bei 3° Fettkristalle ab und erstarrt erst bei
niedriger Temperatur. Er eignet sich bestens für die
Sämischgerberei. Der Döglingthran, aus dem Zwergwal
(Balaenoptera rostrata) gewonnen, ist farblos bis braun, riecht
sehr intensiv, gehört zu den schlechten Thransorten und wird
meist mit andern Thranen gemischt. Die Robbenthrane, zu denen der
beliebte Dreikronenthran gehört, werden aus dem Speck der
Ohrenrobben (Otaria), Seehunde (Phoca) und Walrosse (Trichechus)
auf verschiedenen Meeren gewon^ nen. Diese Thrane sind viel
geschätzter als die Walsischthrane. Da sie spezisisch schwerer
sind, liefern sie im Leder bessere Gewichtsergebnisse, wegen ihrer
Dickfiüssigkeit schlagen sie nicht leicht durch und mischen
sich auch gleichmäßiger mit dem Talg zu einer
gleichförmigen Schmiere. Dazu kommt, daß die Walthrane
mit der Zeit an der Luft zu einer starren Masse eintrocknen, wobei
das Leder steif, hart und brüchig wird. Durch den
Sämischprozeß wird der Walfischthran in ein braunes,
dickes Öl (Moellon, Dégras) umgewandelt, welches nicht
mehr an der Luft trocknet und als vorzügliches
Lederschmiermittel bekannt ist. Die Umwandlung, welche der
Walfischthran hier erfahren hat, muß auch auf andre Weise
herbeigeführt werden können, wenigstens kommt als
Baläneïn ein T. im Handel vor, welcher viele wertvolle
Eigenschaften des Dégras besitzt und dem Leder helle Farbe
und große Milde verleiht. Für die Sämischgerberei
sind die Walfischthrane vorzuziehen, weil sie vermöge ihrer
Dünnflüssigkeit leichter als die Seehundsthrane in die
Blöße eindringen. Von den Fischthranen ist der T. vom
Stockfisch oder Dorsch (Gadus Morrhua) am wichtigsten. Er wird aus
der Leber dieser beiden Fische, aber auch aus der Leber andrer
Schellfische gewonnen, der helle und braunblanke durch Behandeln
der Leber mit Dampf, der dickflüssigere, dunklere durch
Ausbraten der gedämpften Lebern über freiem Feuer. Der
Dampfthran bildet beim Lagern einen bedeutenden Bodensatz und
braucht lange Zeit zum Abklären. Für die Benutzung als
Lederschmiere ist das Auskochen ebenso notwendig wie beim Wal- und
Robbenthran. Heringsthran kommt weiß, blond und braun vor,
ist sehr dickflüssig, vom spez. Gew. 0,927, riecht und
schmeckt intensiv nach Seefischen. Der Gerberthran dieser Sorte ist
bräunlich orangegelb, bleibt bei 0° noch flüssig und
setzt nur nach einiger Zeit festes Fett ab. Beim Lagern wird er
bald ranzig und ziemlich sauer, was übrigens seiner guten
Verwendbarkeit als Schmiermittel nur wenig schadet. Rochenthran,
aus den Lebern von Trygon Pastinaca, Raja Giorna und Raja clavata,
dem Dorschthran ähnlich, wird in italienischen und
südfranzösischen Gerbereien benutzt. Eine ergiebige
Quelle ist durch den Haifischfang erschlossen; manche Leber soll
800 kg T. liefern. Über die Eigenschaften desselben als
Lederschmiermittel ist noch nichts bekannt. An der Ostküste
Nordamerikas liefert die Meerbricke (Petromyzon maximus) einen T.,
der weniger als Dorschthran geschätzt wird. Die Leber des
Thunfisches (Thynnus vulgaris) wird jetzt ebenfalls auf T.
versotten. Guter Thunfischthran ist gelbbraun, dickflüssig,
vom spez. Gew. 0,9275, riecht mild nach Sardinen, erstarrt erst
unter 0° und stellt sich den besten bisher im Handel
vorkommenden Thranen zur Seite.
Thränen (Lacrimae), die wässerige und klare
Flüssigkeit, welche von den acinösen
Thränendrüsen abgesondert wird und auf 99 Proz. Wasser
kleine Mengen von Mucin und Eiweiß sowie ca. 0,8 Proz. Salze
enthält. Die T. werden beständig in geringer Menge
abgesondert, ergießen sich über die vordere Fläche
des Augapfels, um diesen vor Wasserverlust zu schützen,
sammeln sich im Thränensee in den innern Augenwinkeln und
gelangen durch die Thränenpunkte in die
Thränenkanälchen, von hier in den Thränengang und
dann in die Nasenhöhle, wo sie sich dem Nasenschleim
beimengen. Wird die Sekretion der T. so stark vermehrt, daß
die Thränenkanälchen das Sekret nicht mehr
fortzuführen im stande sind, so stürzen die T. aus dem
Auge hervor (Weinen). Die Thränenabsonderung wird
vergrößert durch Reizung des Nervus lacrimalis, durch
gewisse psychische Affekte und reflektorisch bei Reizung der
Nasenschleimhaut oder der Konjunktiva. Beiden Tieren wird ein
Abfließen der T. über die Wangen nur unter
pathologischen Verhältnissen wahrgenommen.
Thränenbeine, s. Schädel, S. 374.
Thränenfistel, eine krankhafte, geschwürige
Öffnung, durch welche der Thränensack und
Thränenkanal nach außen münden. Meist liegt eine
Erkrankung der den Thränenkanal begrenzenden Knochen zu
Grunde; die Behandlung beginnt mit einer Entfernung etwa
abgebröckelter Knochenstückchen, später wird der
Defekt durch plastische Operation geschlossen.
Thränenflaschen, fälschliche Bezeichnung
für schlauchförmige, in antiken Gräbern gefundene
Salbgefäße aus Glas oder Thon.
Thränengras, s. Coix.
Thränenschwamm, s. Hausschwamm.
Thränensteine, s. Augenstein.
Thraso, Name des prahlerischen Soldaten (miles gloriosus)
in dem Lustspiel "Der Eunuch" von Terenz; daher thrasonisch,
prahlerisch, großsprecherisch.
Thrasybulos, athen. Feldherr, Sohn des Lykos, stand 411
v. Chr. als einer der Strategen an der
675
Thrasyllos - Thrombosis.
Spitze der athenischen Flotte bei Samos, setzte, um die
oligarchische Herrschaft der Vierhundert zu stürzen, die
Zurückberufung des Alkibiades durch und focht erst unter
Alkibiades am Hellespont, dann 406 als Trierarch bei den Arginusen.
Nachdem auf das Gebot Spartas in Athen die Herrschaft der
Dreißig Tyrannen errichtet worden war, ging T. in die
Verbannung nach Theben, fiel von da aus 403 mit 70 seiner Freunde
in Attika ein, eroberte das Kastell Phyle, bemächtigte sich
des Piräeus und besiegte die Tyrannen. Er betrieb darauf die
Wiederherstellung der Solonischen Verfassung und den Erlaß
einer allgemeinen Amnestie. Unmäßige Ausbrüche
leidenschaftlicher Demokraten wider die Gegenpartei wußte er
zu unterdrücken. Er begnügte sich mit einem Olivenkranz
als Anerkennung seines Verdienstes. Als Feldherr befehligte er 394
die athenischen Truppen in Böotien und vor Korinth, stellte
391 den Einfluß Athens in Byzantion und auf den Inseln wieder
her, namentlich durch die Eroberung von Lesbos und die Verteidigung
von Rhodos, und wurde 389, als er in Pamphylien bei der Stadt
Aspendos gelandet war, durch einen Ausfall der Aspender im
Feldherrenzelt getötet; er entging so der gegen ihn erhobenen
Anklage wegen Veruntreuung und Plünderung.
Thrasyllos, athen. Feldherr, Anhänger der
Demokratie, rief 411 als Strateg der athenischen Flotte bei Samos
im Verein mit Thrasybulos Alkibiades zurück, kämpfte
unter diesem tapfer in Kleinasien, war wieder Strateg 406 in der
siegreichen Schlacht bei den Arginusen, ward aber nebst fünf
andern Strategen wegen der Nichtbestattung der Gefallenen zum Tod
verurteilt und hingerichtet.
Three rivers (spr. thri riwwers), s. Trois
Rivières.
Threnodie (griech.), bei den Griechen Bezeichnung der
Trauer- oder Klagelieder auf den Tod geliebter Wesen, dergleichen
bei der Ausstellung der Leichen gesungen wurden. Sie bildeten sich
mit der Zeit zu einer eignen Gattung der Poesie aus, in der
namentlich Pindar und Simonides Vorzügliches leisteten. Vgl.
Elegie.
Threskiornis, s. Ibisse.
Thrinakía, mythische Insel bei Homer, auf welcher
die Herden des Sonnengottes weideten (s. Helios), wohl identisch
mit Trinakria (s. d.).
Thrips, Blasenfuß, s. Blasenfüßer.
Thrombosis (griech.), Verstopfung von
Blutgefäßen durch ein Blutgerinnsel (Thrombus,
Pfropfen), kommt im Herzen, in den Arterien und besonders
häufig in den Venen, namentlich nahe ihren Klappen, vor.
Dagegen ist sie in den Kapillaren und Lymphgefäßen
seltener. Jeder Pfropfen ist von Anfang an ein wandständiger,
welcher das Gefäßlumen nur teilweise verstopft;
späterhin füllt der Pfropfen das Gefäßlumen
vollständig aus. Von der Stelle der ursprünglichen
Verstopfung kann sich der Thrombus sowohl nach rückwärts
als auch zentralwärts, d. h. nach dem Herzen hin, in
verschiedener Ausdehnung fortsetzen. Derselbe ist anfangs weich,
feucht, blutig gefärbt; später wird er trockner, derber,
gelblich und bröckelig. Weiterhin kann derselbe, und zwar
zunächst in seinem Zentrum, zu einer breiigen, oft
eiterartigen Masse erweichen (puriforme Schmelzung) und endlich
seiner ganzen Ausdehnung nach in eine solche Masse zerfallen. Das
Gerinnsel kann aber unter andern Umständen auch durch
Einwanderung von Rundzellen aus der Nachbarschaft zu festem
Bindegewebe organisiert werden. Hierdurch wird stets eine bleibende
Verstopfung des Gefäßes bedingt, und dieser Vorgang ist
erwünscht, wenn er in einem zerschnittenen oder anderweitig
verletzten Gefäß vor sich geht, weil er das einzige
sichere Mittel gegen die Blutung abgibt. Selten kommt es zur
teilweisen Resorption, zur einfachen Schrumpfung und Vermeidung des
Thrombus (Venensteine, Phlebolithen). An der Stelle, wo sich in
einem Gefäß ein Thrombus gebildet hat, zeigt sich die
Gefäßwand infolge der T. meist im Zustand einer
chronischen, seltener einer akuten Entzündung; umgekehrt hat
auch eine Entzündung der Gefäßwand nicht selten T.
zur Folge. Die Ursachen der T. bestehen entweder in einer Stockung
des Bluts (bei normaler Gefäßwand) oder in krankhafter
Veränderung der Gefäßwand. Stockungen des Bluts
treten aber unter den verschiedensten Verhältnissen ein, so z.
B. bei jeder Verengerung des Gefäßlumens
(Kompressionsthrombose), wie sie durch die Unterbindung des
Gefäßes oder durch den Druck, welchen Geschwülste
etc. auf das Gefäß ausüben, bedingt wird. Auch bei
der Durchschneidung und Zerreißung der Gefäße
kommt es fast immer zur T. (traumatische T.), und in diesem Fall
ist die Pfropfenbildung ein erwünschter, zur Heilung
notwendiger Vorgang, da auf ihm z. B. die Heilung von Wunden zum
Teil beruht. Eine fernere Veranlassung zur T. ist die Erweiterung
der Gefäße (Dilatationsthrombose), denn je weiter der
Kanal ist, desto langsamer ist der Fluß in demselben bei
gleicher Flüssigkeitsmenge. Hierher gehören die
Fälle von Gerinnung in den Krampfaderknoten und
Pulsadergeschwülsten, wodurch eine Heilung der letztern
bewerkstelligt werden kann. Endlich bilden sich Gerinnungen in den
Venen bei stark abgemagerten Kranken, wenn dieselben ruhig
daliegen, und wenn gleichzeitig die Herzkraft abgenommen hat, das
Blut also nicht schnell genug zirkuliert (marantische T.). Diese
Art der T. ist eine häufige Nachkrankheit schwerer
fieberhafter Krankheiten, namentlich des Typhus und
Puerperalfiebers; sie ist auch eine sehr gewöhnliche
Komplikation der Tuberkulose, Krebskrankheit, der chronischen
Gelenk- und Knochenkrankheiten. In andern Fällen ist die T.
abhängig von krankhaften Veränderungen der
Gefäßwand. Dies geschieht beim Brand eines Gliedes, bei
der Entzündung der äußern Venenhaut, bei Krebs,
welcher die Venenwand durchbricht, und am häufigsten bei der
chronischen Entzündung der innern Arterien und Herzhaut. In
allen diesen Fällen werden die Gefäßwände
rauh, und der Faserstoff des Bluts lagert sich auf den Rauhigkeiten
als Thrombus ab. In ähnlicher Weise tritt Blutgerinnung ein,
wenn man durch das lebende Gefäß eine Nadel sticht oder
einen Faden durchzieht, wie dies z. B. die Chirurgen bei der sogen.
Elektropunktur der Aneurysmen thun, um auf dem Weg einer
künstlich herbeigeführten Gerinnung oder T. die Heilung
derselben herbeizuführen. Die Verstopfung der Venen gibt sich
zu erkennen durch Anstauung des venösen Bluts hinter dem
Thrombus und vorzugsweise durch wassersüchtige Anschwellung
des betreffenden Körperteils. Die Wassersucht fehlt jedoch,
wenn sich ein genügender Kollateralkreislauf herstellt. Die
Folgen der T. einer Arterie bestehen in mangelhafter oder
unterbrochener Blutzufuhr, also in Blutarmut des betreffenden
Teils, welche so hochgradig werden kann, daß derselbe brandig
abstirbt, wie beim sogen. Altersbrand. Es kommt nicht selten vor,
daß ein Stück von einem Thrombus, namentlich wenn
derselbe in der Erweichung begriffen ist und der Kranke eine
schnelle Bewegung ausführt, abbricht und mit dem Blutstrom
nach andern Körperteilen hingeführt wird (s. Embolie).
War der Thrombus aus der
43*
676
Thrombus - Thugut.
Gegend einer verjauchenden Wunde und selbst mit Jauche
getränkt, so ruft der von ihm abgebrochene Embolus an der
Stelle, wohin er mit dem Blutstrom gelangt, wiederum eine jauchige
Entzündung hervor, es entstehen die sogen. metastatischen
Abszesse. Vgl. Virchow, Gesammelte Abhandlungen (Berl. 1862);
Baumgarten, Die sogen. Organisation des Thrombus (Leipz. 1877).
Thrombus (griech.), s. Thrombosis.
Thron (griech.), der für besonders feierliche
Gelegenheiten bestimmte, ausgezeichnete Sitz für
fürstliche Personen, ein Attribut der Herrschergewalt, bei den
Griechen ursprünglich Ehrensitz, der Stuhl der sitzenden
Götterbilder (s. Abbildung). Der T. ist in einem besondern
Saal (Thronsaal) aufgestellt und ruht gewöhnlich auf einem
Gestell, zu dem mehrere Stufen führen. Über dem Sessel
ist in der Regel ein Thronhimmel angebracht, d. h. eine an der Wand
befestigte, verzierte, zeltartige Decke mit prächtigen, meist
aus Seide u. Goldstoff bestehenden Behängen. Der T. wird von
den Fürsten nur bei feierlichen Gelegenheiten benutzt, wenn
der Fürst als Träger der Herrscherwürde auftreten
muß. Symbolisch bezeichnet T. die Herrscherwürde oder
Herrschergewalt selbst, daher die Ausdrücke: den T. besteigen,
jemand vom T. stoßen etc., Thronerbe, Thronlehen,
Thronräuber (Usurpator).
Thronentsagung, s. Abdankung.
Thronfolge (Succession, Thronerbfolge), der Eintritt des
Regierungsnachfolgers (Thronfolgers) in die Hoheitsrechte des
bisherigen Monarchen. Je nachdem sich die T., wie dies in den
Erbmonarchien der Fall ist, auf Verwandtschaft oder je nachdem sie
sich auf einen andern Titel, z. B. auf eine Erbverbrüderung,
gründet, wird zwischen ordentlicher und
außerordentlicher T. unterschieden. Das Recht zur
ordentlichen T. (Thronfolgerecht) wird durch leibliche und eheliche
Abstammung vom ersten Erwerber der Krone aus ebenbürtiger Ehe
begründet (s. Ebenbürtigkeit), und zwar sind nach den
meisten fürstlichen Hausgesetzen männliches Geschlecht
des Thronfolgers und Abstammung desselben vom ersten Erwerber durch
Männer (agnatische oder männliche Deszendentenfolge)
erforderlich. Außerdem muß der Thronfolger nach den
meisten Verfassungen die zur Führung der Regierung nötige
geistige und körperliche Tüchtigkeit besitzen. Weibliche
(kognatische) T. ist nach manchen Hausgesetzen und Verfassungen
überhaupt ausgeschlossen. Dies ist das sogen. Salische Gesetz
(s. d.). In andern Staaten, z. B. in Holland, Bayern, Sachsen und
Württemberg, ist die weibliche T. subsidiär, d. h. nach
gänzlichem Aussterben des Mannesstamms, statuiert, und in
England und Spanien ist sogar eine mit der agnatischen vermischte
weibliche T. (Successio promiscua) insofern eingeführt, als
nur die Söhne des Regenten und ihre männliche Deszendenz
vor den Töchtern den Vorzug haben, während die letztern
und ihre Nachkommen die Brüder des Regenten und dessen
sonstige Agnaten in den Seitenlinien ausschließen. Die
Thronfolgeordnung ist regelmäßig so bestimmt, daß
stets der Erstgeborne und, wenn er vor der Thronerledigung
verstarb, sein erstgeborner Deszendent und dessen Nachkommenschaft
succedieren (Lineal-Primogeniturordnung). Fehlt es überhaupt
an Deszendenten, so kommt der Erstgeborne der dem letzten Regenten
nächsten Linie zur T. Vgl. Schulze, Das Recht der Erstgeburt
in den deutschen Fürstenhäusern (Leipz. 1851); Derselbe,
Die Hausgesetze der regierenden deutschen Fürstenhäuser
(Jena 1862-83, 3 Bde.); Heffter, Die Sonderrechte der
souveränen und der mediatisierten, vormals
reichsständigen Häuser (Berl. 1871).
Thronrede, die Rede, mit welcher der Monarch oder an
dessen Stelle ein verantwortlicher Minister die Sitzungen der
Volksvertreter eines konstitutionellen Staats eröffnet. Sie
bezeichnet die von der Volksvertretung zu behandelnden
Gegenstände und gibt zugleich in der Regel eine Darlegung der
äußern und innern Verhältnisse des Staats. Die T.
wird daher zugleich als Programm des Ministeriums, welches ihren
Inhalt zu vertreten hat, angesehen und bei besonderer Veranlassung
von der Kammer in einer Adresse beantwortet.
Thuanus, s. Thou 1).
Thudichum, Friedrich Wolfgang Karl von, angesehener
Rechtslehrer, geb. 18. Nov. 1831 zu Büdingen, studierte
1849-52 in Gießen, war dann vier Jahre im Justiz- und
Verwaltungsdienst thätig und habilitierte sich 1858 in
Gießen als Privatdozent. 1862 folgte er einem Ruf als
außerordentlicher Professor der Rechte nach Tübingen, wo
er 1870 zum ordentlichen Professor ernannt ward. Er schrieb. "Die
Gau- und Markverfassung in Deutschland" (Gieß. 1860); "Der
altdeutsche Staat" (das. 1862); "Rechtsgeschichte der Wetterau"
(Tübing. 1867-85, 2 Bde.); "Das Verfassungsrecht des
Norddeutschen Bundes und des Deutschen Zollvereins" (das. 1869f., 2
Abtlgn.); "Deutsches Kirchenrecht des 19. Jahrhunderts" (Leipz.
1877-78, 2 Bde.); "Bismarcks parlamentarische Kämpfe und
Siege" (Stuttg. 1887).
Thueyts (spr. tüä), Stadt im franz. Departement
Ardèche, Arrondissement Largentière, auf einem von
riesigen Basaltsäulen gestützten Lavaplateau nahe am
Zusammensluß der Ardèche und des
Médéric, welcher unter dem Pont du Diable einen 100 m
hohen Wasserfall bildet, hat Mineralquellen, Seidenindustrie, ein
altes Schloß und (1881) 720 Einw.
Thug, s. Thag.
Thugut, Franz Maria, Freiherr von, österreich.
Staatsmann, geb. 8. März 1739 zu Linz, fand 1752 Aufnahme in
die orientalische Akademie zu Wien, ward 1754 als Sprachknabe
(Dolmetschgehilfe) mit einer Gesandtschaft nach Konstantinopel
geschickt, hierauf 1757 zum Dolmetsch, 1769 zum
Geschäftsträger bei der Pforte, 1770 zum Residenten und
1771 zum Wirklichen Internunzius daselbst ernannt. Auf dem
Friedenskongreß von Fokschani 1772 bewies er als
österreichischer Botschafter große diplomatische
Gewandtheit und ward von Maria Theresia dafür in den
Freiherrenstand erhoben. Durch eine Konvention mit der Pforte
bewirkte er 1776 die Abtretung der Bukowina an Österreich.
Nachdem er an den Höfen von Neapel, Versailles und Berlin
diplomatisch thätig gewesen, ging er 1780 als Gesandter nach
Warschau, 1787 nach Neapel und 1788 als Hofkommissar in die Moldau
und Walachei, deren Verwaltung er bis 1790 leitete. Er beteiligte
sich hierauf an den Friedensunterhandlungen mit der Pforte zu
Sistova und leitete in Paris die Unterhandlungen zwischen der
Königin Maria Antoinette und dem Grafen Mirabeau. Nach seiner
Rückkehr im J. 1792 wurde er zum Armeeminister bei dem Heer
des Prinzen von
[Zeus auf dem Thron os sitzend (Münze von
Elis).]
677
Thuin - Thulden.
Koburg, welches die verlornen Niederlande wiedererobern sollte,
ernannt und 27. Mai 1793 Generaldirektor der Staatskanzlei unter
Kaunitz und damit tatsächlich, nach Kaunitz' Tod 1794 auch
formell, Minister der auswärtigen Angelegenheiten. Ein Mann
von Geist und Talent, aber ränkevoll und gewissenlos,
schärfte er durch seine unruhige, neidische Eroberungspolitik
den Gegensatz zwischen Österreich und Preußen, dessen
Plänen er in Polen auf alle Weise hindernd in den Weg trat,
ohne für Österreich Wesentliches zu erreichen,
während er die energische Kriegführung der Koalition
gegen Frankreich empfindlich schädigte. Nachdem er auf diese
Weise Österreich in Deutschland isoliert hatte, verschuldete
er den unglücklichen Ausgang des Kriegs und mußte auf
Napoleons I. ausdrückliches Verlangen bei dem Abschluß
des Friedens von Campo Formio 1797 aus dem Ministerium scheiden. Er
ging darauf als bevollmächtigter Minister in die neuerworbenen
italienischen und Küstenprovinzen, übernahm 1799 beim
Wiederausbruch des Kriegs aufs neue das Portefeuille des
Auswärtigen, trat aber schon im Dezember 1800 wieder
zurück und lebte fortan zu Preßburg und Wien, wo er 29.
Mai 1818 starb. Vgl. Vivenot, T., Clerfayt und Wurmser 1794-97
(Wien 1869); Derselbe, T. und sein System (das. 1870, 2 Tle.);
Derselbe, Vertrauliche Briefe des Freiherrn v. T. (das. 1871, 2
Bde.).
Thuin (spr. tuäng), Hauptstadt eines Arrondissements
in der belg. Provinz Hennegau, an der Sambre und der Eisenbahn
Charleroi-Erquelines, mit schöner Kirche, höherer
Knabenschule, Tuchfabrikation, Eisenwerken und (1888) 5361 Einw. T.
gehörte früher zum Bistum Lüttich und war stark
befestigt.
Thuja Tourn. (Lebensbaum), Gattung aus der Familie der
Kupressineen, Bäume von in der Regel mehr oder weniger
pyramidenförmigem Wuchs, mit blattartig flachen letzten
Verästelungen, vierreihig dachziegeligen,
schuppenförmigen, nur an der Spitze freien Blättern,
monözischen Blüten auf verschiedenen Ästen und
kleinen, im zweiten Jahre reifenden Zapfen. T. occidentalis L.
(abendländischer Lebensbaum), ein 20-22 m hoher Baum von
pyramidenförmigem Wuchs mit abstehenden bis horizontalen
Ästen, in horizontaler Ebene dicht und fiederig zweizeilig
verzweigten jüngern Zweigen, kurzen, fast stachlig gespitzten
Blättern, von denen die auf den flachen Seiten der Zweige
stehenden eine rundliche, stark riechende Drüse auf dem
Rücken besitzen, und länglichen, überhängenden,
braunen Beerenzapfen, wächst in Nordamerika und wird seit dem
16. Jahrh. bei uns kultiviert. In den Gärten benutzt man
mehrere Varietäten als Ziersträucher, auch ist der Baum
an vielen Orten beliebte Gräberpflanze. Das Holz dient zu
Wasserbauten und feinen Tischlerarbeiten; die Blätter und das
daraus bereitete ätherische Öl wurden früher
medizinisch benutzt (daher der Name, den zuerst Dodoens brauchte).
T. (Biota) orientalis L. (morgenländischer Lebensbaum), ein
niedriger, bleibender, pyramidenförmiger Baum mit in
senkrechter Ebene fiederig verzweigten Ästchen, einer
Mittelfurche auf dem Rücken der Blätter und fleischigen,
hellgrünen, bläulich bereiften, später fast der
ganzen Länge nach sich öffnenden Beerenzapfen,
wächst in China und Japan, auch in Mittelasien und Gilan und
wird wie die vorige in mehreren Abarten bei uns kultiviert, ist
aber viel empfindlicher. - T. articulata, s. Callitris.
Thukydides, 1) athen. Staatsmann, Sohn des Melesias,
übernahm nach Kimons, seines Verwandten, Tod (449 v. Chr.) die
Leitung der konservativen Partei in Athen, wußte durch seinen
uneigennützigen Charakter und seine Rednergabe viele
Anhänger zu gewinnen, ward, als er Perikles zu stürzen
versuchte, 444 durch den Ostrakismos verbannt, setzte aber nach
seiner Rückkehr die Opposition gegen Perikles fort.
2) Ausgezeichneter griech. Geschichtschreiber, geb. 471 v. Chr.
(so eine Angabe aus dem Altertum, wahrscheinlich jedoch einige
Jahre später) im attischen Gau Halimus, stammte durch seinen
Vater Oloros von einem thrakischen Fürstengeschlecht ab,
während er durch seine Mutter mit Miltiades verwandt war,
hatte den Philosophen Anaxagoras und angeblich auch den Redner
Antiphon zu Lehrern. Er führte 424 den Oberbefehl über
eine Flottenabteilung in den thrakischen Gewässern, ward aber,
weil er die Eroberung der Stadt Amphipolis durch die Spartaner
nicht verhindern konnte, 423 verbannt, kehrte 403 infolge der
veränderten Verhältnisse nach Athen zurück, aber nur
auf kurze Zeit, und starb wenige Jahre nachher; über Ort, Zeit
und Art seines Todes besitzen wir nur unzuverlässige, sich
untereinander widersprechende Nachrichten. Er war der erste, der
eine strenge historische Kritik anwandte; sein Werk stellt den
Peloponnesischen Krieg dar, jedoch nur bis 411, wo es unvollendet
abbricht, und zeichnet sich ebensosehr durch Wahrheitsliebe und
politische Einsicht wie durch die kräftige, gedrängte
Sprache aus; die gedankenreichen Betrachtungen über die
Gründe der Vorgänge sind meist in die Form von Reden
gekleidet, die den handelnden Personen in den Mund gelegt werden
und die einen besonders wertvollen Bestandteil des Werkes bilden.
Unter den Ausgaben sind außer der ersten (Vened. 1502) die
von Poppo (Leipz. 1821-40, 11 Bde.; Handausgabe, 2. Aufl., das.
1875, 2 Bde.), Bekker (Berl. 1821, 3 Bde.; in 1 Bd. 1868), Dindorf
(Leipz. 1824), Göller (2. Aufl., das. 1836, 2 Bde.), Arnold
(neue Ausg., Oxf. 1854, 3 Bde.), Bloomfield (Lond. 1842, 2 Bde.),
Krüger (3. Aufl., Berl. 1860, 2 Bde.), Schöne (das.
1874), Classen (2. Aufl., das. 1870-78, 8 Bde.) und Böhme (2.
Aufl., Leipz. 1862 ff.) hervorzuheben. Neuere Übersetzungen
lieferten Osiander (Stuttg. 1826 bis 1829 u. öfter, 8 Bdchn.),
Campe (das. 1856-1857, 2 Bde.) und Wahrmund (2. Aufl., das. 1867, 2
Bde.). Eine Biographie des T. in griechischer Sprache besitzen wir
von Marcellinus (hrsg. von Westermann in den "Biographi graeci
minores". Braunschw. 1845). Antike Büsten des T. befinden sich
in Neapel (Doppelherme, mit Herodot) und zu Holkham Hall in
England. Vgl. Krüger, Untersuchungen über das Leben des
T. (Berl. 1832); Roscher, Leben, Werk und Zeitalter des T.
(Götting. 1842); Welzhofer, T. und sein Geschichtswerk
(Münch. 1877); Michaelis, Die Bildnisse des T. (Straßb.
1877); Girard, Essai sur T. (2. Aufl., Par. 1884).
Thulden, Theodor van, niederländ. Maler und
Radierer, geb. 1606 zu Herzogenbusch, bildete sich in der Werkstatt
von Rubens und wurde 1627 Freimeister der Lukasgilde in Antwerpen.
Er war 1632 und 1647 in Paris thätig, wo er eine Anzahl von
Kirchenbildern, unter andern die heilige Dreifaltigkeit (jetzt im
Museum zu Grenoble), die Himmelfahrt Mariä (jetzt im Museum zu
Angers) und die Äusgießung des Heiligen Geistes (jetzt
im Museum zu Le Mans), malte, und 1648 wurde er nach dem Haag
berufen, wo er an der Ausmalung des Oraniensaals im Huis ten Bosch
teilnahm (Hauptbild: die waffen-
678
Thule - Thun.
schmiedenden Kyklopen). Von seinen übrigen Werken sind zu
nennen: Martyrium des heil. Hadrian (in der Michaeliskirche zu
Gent), der auferstandene Christus vor Maria (im Louvre zu Paris),
die Entdeckung der Purpurschnecke (im Museum zu Madrid) und die
Rückkehr des Friedens (in der kaiserlichen Galerie zu Wien).
Er hat auch zahlreiche Blätter radiert, unter andern die
Amazonenschlacht nach Rubens, 49 Blätter nach den
Darstellungen auf dem Triumphbogen beim Einzug des
Kardinal-Infanten Ferdinand in Antwerpen (1635) und 58 Blätter
Odysseebilder nach Primaticcio und N. dell' Abbate. Er starb um
1676 in Herzogenbusch.
Thule, eine von Pytheas (s. d.) um 330 v. Chr. entdeckte
und fälschlich von ihm unter den Polarkreis verlegte Insel des
Atlantischen Meers, die für den nördlichsten Punkt der
bekannten Erde galt. Ptolemäos setzt dieselbe so an, daß
sie den heutigen Shetlandinseln entspricht (so H. Kiepert und
Müllenhoff).
Thum, Stadt in der sächs. Kreishauptmannschaft
Zwickau, Amtshauptmannschaft Annaberg, an der Linie
Willischthal-Ehrenfriedersdorf der Sächsischen Staatsbahn, 513
m ü. M., hat eine evang. Kirche, eine Oberförsterei,
Strumpfwirkerei, Spinnerei, Färberei, Bandfabrikation und
(1885) 4213 Einw.
Thumann, Paul, Maler, geb. 5. Okt. 1834 zu Tschacksdorf
(Niederlausitz), war von 1855 bis 1856 Schüler der Akademie in
Berlin und arbeitete dann bis 1860 im Atelier von Julius
Hübner in Dresden. Nach zweijährigem Aufenthalt in
Leipzig ging er nach Weimar zu Ferdinand Pauwels und wurde 1866
Professor an der Kunstschule daselbst. Nachdem er seit 1872 als
Lehrer in Dresden thätig gewesen, wurde er 1875 als Professor
an die Kunstakademiein Berlin berufen, welche Stellung er 1887
niederlegte. Er bereiste 1862 Ungarn und Siebenbürgen, 1865
Italien, später Frankreich, Belgien, England. Seine
Hauptthätigkeit fand T. in der Illustration (z. B. Auerbachs
Kalender, Goethes "Wahrheit und Dichtung", Tennysons "Enoch Arden".
Chamissos "Frauenliebe und Leben", desselben "Lebenslieder und
-Bilder", Hamerlings "Amor und Psyche", Heines "Buch der Lieder").
Die Eleganz der Formengebung, der sinnvolle Ernst und die Anmut der
Figuren gewannen diesen Illustrationen großen Beifall. Doch
verlor sich T. schließlich in ein süßliches und
oberflächliches Formenspiel, welches den Eindruck seiner
ersten Schöpfungen abschwächte. Von seinen Gemälden
sind neben der Erstlingsarbeit: St. Hedwigis, Altarbild für
Liegnitz (1857), fünf Bilder aus dem Leben Luthers für
die Wartburg, Luthers Trauung (1871), die Taufe Wittekinds und die
Rückkehr Hermanns des Cheruskers aus der Schlacht am
Teutoburger Wald für das Gymnasium zu Minden und die drei
Parzen zu erwähnen. Er hat auch Studienköpfe gemalt,
deren Vorzug in der süßlichen Eleganz der Auffassung
beruht.
Thumerstein (Thumit), s. Axinit.
Thümmel, Moritz August von, Schriftsteller, geb. 27.
Mai 1738 zu Schönefeld bei Leipzig, studierte in Leipzig, ward
1761 Kammerjunker bei dem Erbprinzen von Sachsen-Koburg und 1768
Wirklicher Geheimer Rat und koburgischer Minister, zog sich 1782
von den öffentlichen Geschäften zurück und starb 26.
Okt. 1817 in Koburg. Unter seinen Schriften (neue Ausg. 1856, 8
Bde.) erlangten "Wilhelmine, oder der vermählte Pedant", ein
prosaisch-komisches Gedicht (Leipz. 1764; 6. Aufl. 1812; neue Ausg.
von Ad. Stern, das. 1879), und die "Reise in die mittägigen
Provinzen von Frankreich" (das. 1791-1805, 10 Bde.) einen
außerordentlichen Ruf. T. erwies sich in diesen Produktionen
als echten Geistesverwandten und Schüler Wielands. Eine
gewisse Anmut, feine Beobachtung und Schilderungsgabe, daneben
freilich auch Frivolität und lüsterne Leichtfertigkeit
sicherten ihnen die nachhaltigste Wirkung. Vgl. v. Gruner, Leben M.
A. v. Thümmels (Bd. 8 der "Werke", Leipz. 1819). -
Sein Bruder Hans Wilhelm, Freiherr von, geb. 17. Febr. 1744 zu
Schönefeld, gest. 1. März 1834 als herzoglich
sachsen-gothaischer Wirklicher Geheimer Rat, Kammerpräsident
u. Obersteuerdirektor in Altenburg, machte sich besonders um das
Herzogtum Sachsen-Altenburg durch Erleichterung der
bäuerlichen Lasten, Verbesserung des Armenwesens, Errichtung
von Armen- und Krankenhäusern etc. verdient. Zugleich war er
ein Freund und Förderer der Wissenschaften und Künste
(namentlich der Baukunst). Seiner Anordnung gemäß wurde
er auf seinem Landgut Nöbdenitz unfern Altenburg unter dem
Stamm einer alten Eiche, ohne Sarg, auf einer Moosbank sitzend,
eingesenkt.
Thummim, s. Urim und Thummim.
Thun, Landstädtchen im schweizer. Kanton Bern, an
der Eisenbahn Bern-Scherzligen, mit (1888) 5507 Einw., ist Sitz der
eidgenössischen Militärschule und der größte
Waffenplatz der Schweiz (mit Reitschule, Zeughäusern,
Munitionsfabrik etc.), außerdem für die Mehrzahl der
Touristen die Pforte zum Berner Oberland. An die Dampfschiffkurse
des Thuner Sees (s. d.), an dessen Ausfluß T. liegt,
schließt sich die Bödelibahn Därligen-Interlaken.
Vgl. Roth, T. und seine Umgebungen (Bern 1873); "T. und Thuner See"
(Zürich 1878).
Thun (T. und Hohenstein), 1) Friedrich, Graf von,
österreich. Staatsmann, geb. 8. Mai 1810 aus einem seit 1629
reichsgräflichen, in Tirol und Böhmen begüterten
Geschlecht, betrat die diplomatische Laufbahn, ward bei dem am 9.
Mai 1850 eröffneten Kongreß zu Frankfurt a. M.
österreichischer Gesandter und nach Reaktivierung des
Bundestags Präsident desselben, welche Stelle er im November
1852 mit der eines außerordentlichen Gesandten und
bevollmächtigten Ministers am preußischen Hofe
vertauschte. Von 1854 bis 1863 war er österreichischer
Gesandter in Petersburg und starb als k. k. Kämmerer und
Mitglied des Herrenhauses 24. Sept. 1881 in Tetschen.
2) Leo, Graf von, österreich. Staatsmann, Bruder des
vorigen, geb. 7. April 1811, war vor der Märzbewegung von 1848
als Sekretär in der Hofkanzlei angestellt und machte sich
damals auch durch einige Schriften, wie: "über den
gegenwärtigen Stand der böhmischen Litteratur" (Prag
1842), "Die Stellung der Slowaken in Ungarn beleuchtet" (das.
1843), bekannt. 1848 war er eine Zeitlang Landeschef von
Böhmen. Vom 28. Juli 1849 bis Oktober 1860 mit dem
Portefeuille des Kultus und öffentlichen Unterrichts betraut,
machte er sich in dieser Stellung namentlich um Durchführung
der Unterrichtsreform verdient, errichtete die kaiserliche Akademie
der Wissenschaften, deren Ehrenmitglied er wurde, wirkte aber
anderseits wesentlich zum Abschluß des Konkordats mit. Am 18.
April 1861 wurde er lebenslängliches Mitglied des
Herrenhauses, in welchem er Huuptvertreter der klerikalen und
feudalen Interessen war. 1861 als Vertreter des
fideikommissarischen Besitzes in den Landtag Böhmens gesendet,
schloß er sich der mit den tschechischen Föderalisten
verbündeten Feudalpartei an. Bei den staatsrechtlichen
Verhandlungen des böhmischen Landtags 1865 bis 1866 war T.
Berichterstatter der Majorität. Der
679
Thunar - Thur.
Ausgleich mit Ungarn fand in T. einen schroffen Gegner, wie er
auch gegen das Ehe- und Schulgesetz von 1868 war. Er starb 17. Dez.
1888 in Wien.
3) Guido, Graf von, österreich. Staatsmann, geb. 19. Sept.
1823, trat in den diplomatischen Dienst, ward 1859
Geschäftsträger im Haag, 1863 in Petersburg, 1865-66
Gesandter am kaiserlichen Hof in Mexiko, 1866-67 bei den
Hansestädten, 1867-1870 Vertreter der verfassungstreuen
böhmischen Großgrundbesitzer im böhmischen Landtag
und im Abgeordnetenhaus, ist seit Dezember 1872 Mitglied des
Herrenhauses.
Thunar, Gott des Donners, s. Thor.
Thunb., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung
für K. P. Thunberg (s. d.).
Thunberg, Karl Peter, Botaniker und Zoolog, einer der
berühmtesten Schüler Linnés, geb. 11. Nov. 1743 zu
Jönköping, studierte in Wexiö, dann seit 1761
Medizin und Naturgeschichte zu Upsala, bereiste Europa, lebte von
1772 bis 1775 als Arzt der Holländisch-Ostindischen Kompanie
am Kap, ging 1775 nach Batavia und Japan, kehrte 1778 nach Schweden
zurück, ward 1781 Professor der Botanik zu Upsala und starb 8.
Aug. 1828 auf Tunaberg bei Upsala. Er schrieb: "Flora japonica"
(Leipz. 1784); "Icones plantarum japonicarum" (Ups. 1794-1805);
"Prodromus plantarum capensium" (das. 1794-1800); "Flora capensis"
(das. 1807-13); "Resa uti Europa, Africa, Asia" (das. 1788-93, 4
Bde.; deutsch, Berl. 1792-94). Von seinen botanischen und
zoologischen Abhandlungen in den akademischen Dissertationen der
Universität Upsala wurden die bis 1801 reichenden von Persoon
herausgegeben: "Dissertationes academicae Upsaliae hahitae sub
praesidio C. P. Thunbergi" (Götting. 1799-1801, 3 Bde.).
Thunder Bay, Bai am westlichen Ende des Obern Sees in
Kanada (Britisch-Amerika), an welchem die Hafenorte Port Arthur und
Fort William liegen.
Thünen, Johann Heinrich von, hervorragender
Nationalökonom, geb. 24. Juli 1783 auf dem väterlichen
Gut Kanarienhausen bei Jever, studierte Landwirtschaft und kaufte
1810 das durch ihn berühmt gewordene Gut Tellow in
Mecklenburg, welches er bis zu seinem 22. Sept. 1850 erfolgten Tod
bewirtschaftete. Er führte mit großer Genauigkeit Buch
und Rechnung über seine Wirtschaft und gewann auf diesem Weg
fruchtbare Schlußfolgerungen über den Einfluß,
welchen die Entfernung vom Absatzort auf Intensität der
Bewirtschaftung, Wahl der Fruchtart, überhaupt auf die Art
ausüben muß, wie ein Landgut rationell zu behandeln ist.
In lichtvoller Weise hat er das unter dem Namen Thünensches
Gesetz bekannt gewordene Ergebnis derselben in seinem in 3 Teilen
(Hamb. 1826, Rost. 1850 u. 1863) erschienenen Werk "Der isolierte
Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie"
(3. Aufl., Berl. 1875) dargelegt. Im 2. Bande dieses Werkes,
welcher kurz vor seinem Tod erschien, untersucht er die
naturgemäße Höhe des Arbeitslohns und kommt zu dem
Resultat: "Der naturgemäße Arbeitslohn = ^ap; diese
Formel schmückt auch seinen Leichenstein. 1847 führte T.
auf seinem Gute das System der Gewinnbeteiligung der Arbeiter ein,
mit welchem gute Erfolge erzielt wurden. Vgl. (Schumacher) "J. H.
v. T., ein Forscherleben" (2. Aufl., Rost. 1883); Hermann, Das
Thünensche Gesetz (Halle 1876).
Thuner See, See im schweizer. Kanton Bern, 560 m ü.
M., 216 m tief, 48 qkm groß, nimmt viele Gebirgswasser auf,
darunter bei Thun die Kander, und wird von der Aare durchflossen,
die ihn mit dem Brienzer See verbindet. Im Gegensatz zu diesem ist
er mehr von voralpinem Wesen, mehr lieblich als ernst und
großartig, von sanftern Bergformen umrahmt, mehr mit
Dörfern und Landhäusern bekränzt und in der Saison
mehr vom Fremdenzug belebt, wie die größere Zahl seiner
Dampfer verrät. Das Bahnnetz der flachern Schweiz erreicht ihn
in Thun (-Scherzligen), und die Bödelibahn verknüpft ihn
mit dem Brienzer See: von Därligen über Interlaken nach
Bönigen. Der See ist reich an Fischen, vorzüglich
Forellen, Aalen, Karpfen und Hechten.
Thunfisch (Thynnus C. V.), Gattung aus der Ordnung der
Stachelflosser und der Familie der Makrelen (Scomberoidei),
große Fische mit gestrecktem, spindelförmigem, gegen den
Schwanz hin stark verdünntem Körper, nahe aneinander
stehenden Rückenfloffen, 6-9 falschen Flossen, hinten
Rücken- und Afterflosse, einem aus großen Schuppen
gebildeten Brustpanzer und einem Kiel neben beiden Kanten des
Schwanzes. Der gemeine T. (T. vulgaris C. V., s. Tafel "Fische
II"), 2-3 m, angeblich bis 4 m lang und 3-12 Ztr. schwer, ist
oberseits schwarzbläulich, am Brustpanzer weißblau, an
den Seiten und am Bauch grau mit weißen Flecken und
Bändern, an der ersten Rücken- und der Afterflosse
fleischfarben, die falschen Flossen schwefelgelb, schwarz
gesäumt, bewohnt das Mittelmeer, auch den Atlantischen Ozean
und das Schwarze Meer, geht nördlich bis England, selten bis
Rügen, lebt in der Tiefe, nähert sich, um zu laichen, den
Küsten und hält dabei, bisweilen in Herden von Tausenden,
bestimmte Straßen ein. Er erscheint im April, laicht im Juni
im Tang, und die Jungen erreichen noch im Oktober ein Gewicht von 1
kg. Der T. nährt sich von Fischen und Weichtieren,
hauptsächlich von Sprotten und Sardellen, und wird von
Haifischen und Delphinen verfolgt, lebt dagegen mit dem
Schwertfisch in gutem Einvernehmen und zieht öfters in dessen
Gesellschaft. Die Thunfischerei wurde im Altertum
hauptsächlich an der Straße von Gibraltar und im
Hellespont, gegenwärtig besonders großartig an den
italienischen Küsten betrieben. Man sperrt den Tieren die
gewohnten Straßen mit sehr großen Netzen ab und
erbeutet Tausende mit einemmal, indem man sie aus einer Kammer des
Netzes in die andre treibt, bis sie sämtlich in der
Totenkammer versammelt sind. Diese wird dann heraufgezogen und der
Fisch mit Keulen erschlagen. Das Fleisch ist sehr verschiedenartig,
wird daher gut sortiert und eingesalzen, bildet aber wesentlich nur
eine Speise der ärmern Klassen. Ein vielfach beliebtes hors
d'oeuvre ist T. à l'huile, gekochter T. in Öl
eingelegt, den man mit pikanter kalter Sauce genießt. Aus der
Leber gewinnt man Thran; aus Haut und Knochen kocht man Öl.
Der Bonite (T. Pelamis L.), 80 cm lang, ein sehr schöner
Fisch, auf dem Rücken und an den Seiten stahlblau, in
Grün und Rot schillernd, am Bauch silbern mit braunen
Streifen, lebt besonders im Atlantischen Ozean, folgt in
Gesellschaft der Thune oft lange den Schiffen, bildet dabei aber
regelmäßig geordnete Haufen. Er nährt sich
hauptsächlich von fliegenden Fischen, außerdem von
Tintenfischen, Schaltieren und selbst Pflanzenstoffen; sein Fleisch
ist nicht genießbar, soll sogar schädlich sein.
Thuok (Theok), Ellenmaß in Anam, = 10 Tahk à
10 Fahn = nahezu 64 cm; das T. der Feldmesser und Architekten ist
jedoch nur 0,485 m.
Thur, 1) Fluß im Oberelsaß, entspringt am
Rheinkopf in den Vogesen, durchströmt das anmutige,
industriereiche Thal von St.-Amarin in südöstlicher
680
Thür - Thurgau.
Richtung, tritt bei Thann aus dem Gebirge, fließt in der
Rheinebene nach NO. und mündet mit einem Arm bei Ensisheim,
mit dem andern bei Kolmar links in die Ill; die Länge ihres
Laufs beträgt 86 km. -
2) Linksseitiger Nebenfluß des Rheins in der Schweiz, 122
km lang, entspringt in zwei Quellflüssen im obersten Teil des
Toggenburg, bei Wildhaus (1104 m) und am Säntis,
durchfließt in nordwestlichem Lauf das Toggenburg, wendet
sich dann bei Wyl nach NO., bei Bischofzell, unter Aufnahme der
Sittern (457 m), wieder nach W., durchfließt den Thurgau und
das Züricher Weinland und mündet in korrigiertem Bett
unterhalb Andelfingen (348 m). Ihr größter linksseitiger
Zufluß ist die Murg.
Thür, im Hochbau verschließbare
Durchgangsöffnung in einer Umfangs- oder Zwischenwand, besteht
aus einer meist steinernen oder hölzernen, selten eisernen
Einfassung, aus ein- oder mehrteiligen, meist hölzernen,
seltener aus Metall bestehenden Flügeln und aus dem Beschlag.
Die Thüröffnung erhält je nach der Bestimmung der T.
eine Breite von 0,5-1,5 m und eine Höhe von 1,8-2,5 m,
während sie je nach Baumaterial und Stil des Gebäudes
oben wagerecht oder durch Bogen (s. d.) begrenzt ist. Die
Einfassung einer rechteckigen T. besteht aus dem Sturz, den beiden
Gewänden (Säulen, Pfosten) nebst der Schwelle (Sohle) und
ist mit Falz versehen, in welchen sich die Flügel legen,
welche bei untergeordneten Gebäuden oder Gebäudeteilen
aus Brettern mit zwei Querleisten und einer Strebe, für
Gebäude, welche höhern Anforderungen genügen
müssen, aus Rahmstücken und Füllungen
zusammengesetzt sind. Im romanischen Stil bildet der meist
gewölbte Bogen einen Halbkreis, im gotischen Stil einen
Spitzbogen. Die Thürflügel lehnen sich entweder direkt an
diese Bogen oder an den wagerechten Abschluß eines zwischen
dieselben eingeschalteten, mehr oder minder reich ornamentierten
Bogenfeldes an. Der Beschlag besteht aus den Thürbändern
und dem Thürschloß von verschiedener Konstruktion, wozu
in manchen Fällen noch besondere Verschlußvorrichtungen,
wie Riegel und Thürzuwerfer, hinzutreten. Je nach Lage und
Bewegungsweise hat man noch Schiebethüren, Fallthüren,
Klappthüren u. a. Die T. wird je nach dem Charakter des
Gebäudes mehr oder minder reich ausgebildet und erhält
besonders im Kirchenbau oft reichgegliederte und ornamentierte
Einfassungen, künstlerisch ausgestattete Thürflügel
und kunstvoll geschmiedete Beschläge (s. Tafel
"Schmiedekunst") . In diesem Fall, besonders bei den
Haupteingängen der Kirchen, wird die T. mit Portal
bezeichnet.
Thuret (spr. türä), Gustav, Botaniker, geb. 23.
Mai 1817 zu Paris, studierte Rechtswissenschaft, dann Botanik, ging
1840 als Attaché der französischen Gesandtschaft nach
Konstantinopel, kehrte aber schon im nächsten Iahr nach
Frankreich zurück, um sich ganz den Untersuchungen der
Meeresalgen widmen zu können. Hier lebte er bis 1851 auf
seinem Schloß Reutilly bei Lagny, siedelte dann mit Bornet
nach Cherbourg und später nach Antibes über, wo er einen
botanischen Garten anlegte. Er starb 10. Mai 1875. T. entdeckte die
Geschlechtlichkeit und die Befruchtung der Fukaceen (1853) und
Florideen (1867). Nach seinem Tod erschienen: "Études
phycologiques. Analyses d'algues marines" (Par. 1878, mit 50
Tafeln).
Thurgau, Kanton der nördlichen Schweiz, durch den
Bodensee und Rhein von Baden, Württemberg und Bayern getrennt,
umfaßt 988 qkm (17,9 QM.). In dem zum Thalsystem der Murg
gehörenden Hinter-T. steigt das Land fast zu voralpinen
Höhen an, so am Hörnli (1135 m), jedoch ohne dessen
Gipfel zu erreichen. Auch der größere Teil des an den
Kanton St. Gallen grenzenden Gebiets steigt erheblich an,
während die tiefsten Punkte an der Thur und am Rhein liegen.
Zwischen Thurthal und Bodensee zieht ein breites Plateau
(Seerücken) hin, zudem als einer der markantesten Punkte der
Ottenberg (671 m) gehört. Der Kanton zählt (1888) 105,091
Einw. deutscher Abstammung. Unter der Bevölkerung sind beide
Konfessionen sehr gemischt, doch ist der Protestantismus
vorherrschend. Die Katholiken (im ganzen 30,337) gehören der
Diözese Basel an; Klöster bestehen keine mehr. Der Kanton
baut zwar nicht ausreichend Getreide, nimmt aber in andern
Feldgewächsen und besonders in Obst und Wein (auf 1812 Hektar)
eine hervorragende Stelle ein. Auch die Rinder- u. Schweinezucht
ist bedeutend (1886 gab es 47,317 Rinder, 10,418 Schweine). Viele
Gesellschaftskäsereien sind vorhanden. In Ermatingen und
Gottlieben werden jährlich ca. 150,000 Gangfische gefangen.
Hauptindustrie ist gegenwärtig die Baumwollspinnerei an der
Thur und Murg; Islikon im Thurthal besitzt eine ausgedehnte
Färberei und Druckerei, Amriswyl eine Strumpffabrik.
Außerdem sind Gerbereien, Papiermühlen,
Spielkartenfabriken, Spiritus- und Leimfabriken, Ziegeleien etc. im
Betrieb. Großhandelsplätze hat der T. nicht, aber einen
bedeutenden Obstmarkt in Frauenfeld, große Viehmärkte in
Dießenhofen, Bischofzell, Amriswyl und Weinfelden. Romanshorn
ist als Bodenseehafen wichtig. Die Nordostbahn überschreitet
in Amriswyl den Seerücken, geht ins Thurthal hinüber nach
Weinfelden-Frauenfeld-Winterthur und kreuzt die Seethallinien in
Romanshorn. Den Hinter-T. kreuzt die Linie Winterthur-St. Gallen.
In Frauenfeld und Weinfelden arbeiten die zwei thurgauischen
Zettelbanken: die Thurgauische Hypothekenbank (1851 gegründet)
und die Thurgauische Kantonalbank (seit 1870). Das Schulwesen
gehört zu den regenerierten; in Kreuzlingen besteht das
kantonale Lehrerseminar, in Frauenfeld eine Kantonsschule. Der T.
hat auch eine Rettungs- und eine Zwangsarbeits-, aber keine
Blinden- und Taubstummenanstalt. Die öffentlichen Bibliotheken
enthalten 60,000 Bände, wovon über 30,000 auf die
Kantonsbibliothek in Frauenfeld entfallen. Nach der Verfassung vom
28. Febr. i869 gehört der T. zu den rein demokratischen
Kantonen. Sie gibt dem Volk das obligatorische Referendum, dem auch
die Beschlüsse der Legislative unterstellt werden können.
Die oberste Landesexekutive wird direkt vom Volk gewählt und
kann, wie die Legislative, abberufen werden, nämlich wenn 5000
Votanten sich für eine Abstimmung ausgesprochen haben. Die
Legislative übt der Große Rat, der auf je drei Jahre
durch das Volk gewählt wird. Die oberste vollziehende
Behörde ist der Regierungsrat, mit fünf Mitgliedern und
ebenfalls dreijähriger Amtsdauer. Die oberste Gerichtsinstanz
heißt Obergericht, dessen sieben Mitglieder ebenfalls auf
drei Jahre durch den Großen Rat gewählt werden. Der
Kanton ist in acht Bezirke eingeteilt; jeder derselben hat seinen
Bezirksstatthalter, dem ein Bezirksrat zur Seite steht, und ein
Bezirksgericht, jede Gemeinde ihren Gemeinderat, dessen Vorsitz der
Ammann führt; für größere Kreise besteht ein
Friedensrichter. Die Staatsrechnung für 1886 weist an
Einnahmen 1,224,476 Frank auf, darunter Ertrag des Staatsguts
449,516, Abgaben 625,207 Fr.; die Ausgaben belaufen sich auf
1,207,793 Fr., wovon 281,784 Fr. auf das Erziehungswesen fallen. Zu
Ende des Jahrs 1886 berechnete sich das unmittelbare Staatsgut auf
5,624,823 Fr.
681
Thurii - Thüringen.
die Summe des Spezialfonds auf 6,444,022, also das
Gesamtvermögen auf 12,068,845 Fr. Hauptstadt ist
Frauenfeld.
Geschichte. T. war der Name einer alten alemannischen
Grafschaft, welche ursprünglich außer dem Kanton T. auch
die heutigen Kantone Zürich, Uri, Schwyz, Zug, Appenzell sowie
Stücke von St. Gallen, Aargau und Luzern umfaßte, aber
durch die Lostrennung des westlichen Teils als eines besondern
Zürichgaues, durch die Immunitätsprivilegien des Klosters
St. Gallen etc. zusammenschmolz. Nach dem Aussterben der Grafen von
Kyburg, welche die Landgrafschaft T. besessen, kam dieselbe an
Rudolf von Habsburg (1264). 1415 wurde infolge der Ächtung
Herzog Friedrichs die hohe Gerichtsbarkeit über den T. an
Konstanz verliehen, 1460 entrissen die Eidgenossen das Land
Österreich gänzlich und machten daraus eine gemeine
Vogtei der sieben alten Orte (ohne Bern). Unter dem Schutze
Zürichs wandte sich der größte Teil des Landes der
Reformation zu. Der Umsturz der alten Eidgenossenschaft (1798)
befreite den T. aus seiner Unterthanenschaft, und die
Mediationsakte erhob ihn 1803 zum selbständigen Kanton mit
einer Repräsentativverfassung, die 1814 durch Zensus, lange
Amtsdauern, künstliche Wahlart etc. ein aristokratisches
Gepräge erhielt. Nach der Julirevolution machte T. unter der
Führung des Pfarrers Bornhauser den Anfang mit der
Demokratisierung der schweizerischen Kantone durch seine neue, 26.
April 1831 angenommene Verfassung. Seitdem gehörte der T.
beständig zu den liberalen Kantonen, nahm teil an den Badener
Konferenzbeschlüssen, hob 1848 seine Klöster auf bis auf
eins und erklärte sich für Annahme der neuen
Bundesverfassung wie auch für die Revisionen derselben 1872
und 1874. Nachdem schon 1837 und 1849 das Grundgesetz revidiert
worden war, begann 1868 eine neue Revisionsbewegung, welche
Einführung des Referendums und der Initiative, der direkten
Volkswahl der Regierung etc. anstrebte und in der Verfassung vom
28. Febr. 1869 ihren Abschluß fand. Vgl. Puppikofer,
Geschichte des Thurgaus (2. Aufl., Frauenfeld 1884); Häberlin,
Geschichte des Kantons T., 1798-1869 (das. 1872-76, 2 Bde.);
"Thurgauische Beiträge zur vaterländischen Geschichte"
(das. 1861 ff.).
Thurii, Stadt, s. Sybaris.
Thüringen, das Land zwischen Werra und Saale, dem
Südfuß des Harzes und dem des Thüringer Waldes,
umfaßt den Hauptteil des Großherzogtums Sachsen-Weimar,
das Herzogtum Sachsen-Gotha, die Ober-Herrschaft der
Fürstentümer Schwarzburg-Rudolstadt und
Schwarzburg-Sondershausen, einen Teil der Herzogtümer
Sachsen-Meiningen und Sachsen-Altenburg, den preußischen
Regierungsbezirk Erfurt fast ganz und vom Regierungsbezirk
Merseburg den westlichen Teil. Unter den Namen thüringische
Staaten versteht man alle Länder zwischen den
preußischen Provinzen Sachsen und Hessen-Nassau, Bayern und
dem Königreich Sachsen, nämlich: das Großherzogtum
Sachsen-Weimar, die Herzogtümer Sachsen-Meiningen,
Sachsen-Koburg-Gotha und Sachsen-Altenburg sowie die
Fürstentümer Schwarzburg und Reuß, mit einem
Gesamtflächeninhalt von 12,288 qkm (223,17 QM.) und (1885)
1,213,063 Einw. (darunter ca. 1,147,800 Evangelische, 17,000
Katholiken und 3800 Juden). S. Karte "Sächsische
Herzogtümer".
[Geschichte.] Zu Anfang des 5. Jahrh. n. Chr. tritt in dem
heutigen T. ein deutscher Volksstamm unter dem Namen Thüringer
(Düringe) in der Geschichte auf. Sie sind Abkömmlinge der
Hermunduren, mit deren Namen der ihrige nahe verwandt ist. Zu
Grenznachbarn und steten Gegnern hatten sie im Norden die Sachsen,
im Westen die Franken und im Süden die Alemannen. Sie werden
dann unter den deutschen Völkerschaften genannt, welche den
Hunnenkönig Attila 451 auf seinem Zug nach Gallien
begleiteten. Zu Anfang des 6. Jahrh. hat sich ein großes
thüringisches Reich gebildet, dessen Grenzen im Norden bis zur
Niederelbe, im Süden bis zur Donau reichten. Hermanfried,
durch seine Gattin Amalaberga der Eidam des großen
Theoderich, erwarb damals die Alleinherrschaft, nachdem er seine
Brüder Berthar und Baderich aus dem Wege geräumt hatte.
Als König Theoderich I. von Austrasien, der ihm dabei
geholfen, den versprochenen Lohn nicht erhielt, begann er in
Gemeinschaft mit seinem Bruder Chlotar I. 530 gegen Hermanfried den
Krieg. Bei Burgscheidungen wurden die Thüringer geschlagen,
und ihr König, der sich, um Frieden zu schließen, nach
Austrasien begab, fand auf der Mauer von Zülpich durch
Hinterlist seinen Tod. Das nordöstliche T. zwischen der
Unstrut und Elbe ward hierauf den Sachsen überlassen, der
südwestliche Teil fiel an Austrasien. Fortan bezieht sich der
Name T. vornehmlich auf das Gebiet zwischen Harz und Thüringer
Wald, Werra und Saale. Der südliche Teil um den Main bis zur
Donau wurde allmählich fränkisches Gebiet und verlor den
alten Namen. Dagobert I. von Austrasien gab 630 den Thüringern
einen Herzog in der Person Radolfs. Derselbe focht tapfer gegen die
Slawen, lehnte sich dann gegen den Frankenkönig Siegbert III.
auf und brachte 640 die Unabhängigkeit Thüringens zu
stande. Schon im 7. Jahrh. wurde die Bekehrung der Thüringer
durch britische Missionäre versucht. Die dauernde Bekehrung
gelang aber erst Bonifacius, welcher um 725 die Johanniskirche auf
dem Alten Berg bei Georgenthal, das Kloster Ohrdruf und die
Marienkirche in Erfurt stiftete. Inzwischen war T. wieder zur
Anerkennung der fränkischen Oberhoheit gebracht worden; von
Pippin wurde die herzogliche Würde beseitigt und die
Verwaltung der einzelnen Gaue (wie Helmengau, Altgau, Eichsfeld,
Westgau, Ostgau, Lancwiza und Arnstadt) Grafen überlassen.
Karl d. Gr. gründete um 804 gegen die Sorben die
thüringische Mark an der Saale, deren Inhaber unter Ludwig dem
Deutschen den Titel Markherzöge (duces Sorabici limitis)
führten, wie Thakulf um 849 und Radulf um 875. Diese
Würde wechselte dann mehrfach, so daß es zur Ausbildung
einer einheimischen herzoglichen Gewalt nicht kam; vielmehr dehnte
der sächsische Herzog Otto der Erlauchte 908 nach dem Tode des
Markgrafen Burchard seine Gewalt eigenmächtig auch über
T. aus. Nach dessen Tod (912) behauptete sie sein Sohn, der
nachmalige deutsche König Heinrich I., gegen den König
Konrad I. Von den fünf Marken, in welche Kaiser Otto I. nach
Markgraf Geros Tode dessen große Sorbenmark zerteilte,
verschwanden die nordthüringische und die
südthüringische frühzeitig wieder, weil
überflüssig geworden durch die östlichern Marken.
Ihnen entsprechen die Bistümer Merseburg und Zeitz
(später Naumburg), wogegen das eigentliche T. kirchlich von
Mainz abhängig blieb. Markgraf Ekkehard I. von Meißen
(985-1002) besaß auch über T. eine Art herzoglicher
Gewalt. Noch einmal, unter den Markgrafen Wilhelm und Otto (von
Weimar, 1046-1067), war T. mit Meißen vereinigt; doch erhob
sich um diese Zeit ein neues Geschlecht in T., das die übrigen
Grafen, die sich nach Käfernburg, Schwarzburg, Gleichen,
Gleisberg, Weimar nannten, an Macht bald übertraf. Ludwig der
Bärtige kaufte zwischen 1031
682
Thüringen (Geschichte).
und 1039 von den Grafen von Käfernburg, Gleichen u. a.
Güter am Thüringer Wald, namentlich in der Gegend von
Altenberg und Reinhardsbrunn, erhielt hierzu vom Kaiser noch ein
großes unangebautes Gebiet um den Inselsberg und durch seine
Gemahlin Cäcilie Sangerhausen und Umgegend. Er ist der Ahnherr
der ältern thüringischen Landgrafen. Ihm folgte 1056
Ludwig II., der Salier (fälschlich der Springer, s. Ludwig
53), unter dem T. den Zehntenstreit mit dem Erzbischof Siegfried
von Mainz auszufechten hatte. Trotz der Entscheidung der Erfurter
Kirchenversammlung (1073) weigerten sich die Thüringer, neue
Zehnten zu zahlen, und stellten sich auf die Seite der Gegner
Heinrichs IV., der die Ursache ihrer Bedrückung gewesen war.
In dieser schweren Zeit der Gewaltthaten entstanden überall
auf Thüringens Bergen Burgen; auch Ludwig der Springer baute
1067 die Wartburg bei Eisenach und schlug da 1076 seinen Wohnsitz
auf. 1085 gründete er das Kloster Reinhardsbrunn. Nach seinem
Tod (1123) folgte sein Sohn Ludwig III. Ihm verlieh 1130 König
Lothar die bisher dem Grafen von Winzenburg zustehende Würde
eines Landgrafen von T. Auch erwarb er, als Landgraf Ludwig I.
genannt, durch Heirat bedeutende Besitzungen in Hessen. Sein Sohn
Ludwig II., der Eiserne (s. Ludwig 54), durch seine Gemahlin Jutta
mit dem Kaiser Friedrich Barbarossa verwandt, nahm an dessen
Heerfahrten nach Italien teil und starb 1172. Sein Sohn und
Nachfolger Ludwig III., der Milde (s. Ludwig 55), nahm an der
Bekämpfung Heinrichs des Löwen den thätigsten Anteil
und erhielt nach Heinrichs Sturz (1180) die Pfalzgrafschaft
Sachsen. 1189 machte er Kaiser Friedrichs I. Kreuzzug mit und starb
auf der Heimkehr im Mai 1190 auf Cypern kinderlos. Ihm folgte sein
Bruder Hermann I., dessen Schwanken zwischen den beiden
Gegenkönigen Philipp von Schwaben und Otto IV. sowie zwischen
Otto IV. und Friedrich II. große Kriegsdrangsale über T.
brachte. Die Wartburg ward unter ihm ein Asyl der Minnesänger
und der Schauplatz des sagenhaften Wartburgkriegs (s. d.). Hermann,
welcher 1216 starb, hatte seinen zweiten Sohn, Ludwig IV., den
Heiligen, zum Nachfolger. Dieser (s. Ludwig 56) und seine Gemahlin,
die heil. Elisabeth (s. Elisabeth 14), sind von Sage und Legende
vielfach verherrlicht worden. Bei Ludwigs Tod in Otranto 11. Sept.
1227 zählte sein einziger Sohn, Hermann II., erst vier Jahre,
weshalb sein Oheim Heinrich Raspe die stellvertretende Regierung in
T. erhielt. 1238 mündig geworden, übernahm Hermann II.
die Regierung selbst, starb aber schon 1242 kinderlos. Ihm folgte
der eben genannte Heinrich Raspe (s. Heinrich 49). Er starb als
Gegenkönig Kaiser Friedrichs II. 17. Febr. 1247, als der
letzte männliche Sproß seines Hauses. Schon 30. Juli
1242 hatte der Markgraf Heinrich der Erlauchte von Meißen (s.
Heinrich 39), Sohn von Jutta, der Stiefschwester des letzten
Landgrafen von T., vom Kaiser Friedrich II. die anwartschaftliche
Belehnung mit T. erhalten und schritt nun zur Besitzergreifung. Da
aber zu gleicher Zeit Sophie, die Tochter Ludwigs des Heiligen und
Gemahlin des Herzogs Heinrich I. von Brabant, und Graf Siegfried
von Anhalt, ein Neffe Heinrich Raspes, mit Erbansprüchen
hervortraten, so entstand der sogen. Thüringer Erbfolgekrieg,
welcher zwar durch das Treffen bei Mühlhausen (11. Febr. 1248)
und den Weißenfelser Vergleich vom 1. Juli 1249 zu gunsten
Heinrichs des Erlauchten endigte, allein, da Sophie von Brabant den
Kampf erneuerte, nach einem zweiten entscheidenden Sieg Heinrichs
bei Wettin (29. Okt. 1263) dadurch beigelegt wurde, daß
Sophie Hessen, Heinrich dem Erlauchten aber T. zugesprochen ward.
T. war seit 1256 von Heinrichs ältestem Sohn, Albrecht, und
dessen Oheim, dem Grafen Hermann von Henneberg, verwaltet worden.
1263 aber trat Heinrich der Erlauchte T. und die sächsische
Pfalz an jenen Sohn, Albrecht den Entarteten (s. Albrecht 14), ab.
Diesen verwickelte sein Versuch, die ihm von seiner ersten
Gemahlin, Margarete, gebornen Söhne, Heinrich, Friedrich den
Freidigen und Diezmann, zu gunsten des ihm von Kunigunde von
Eisenberg gebornen Apitz an ihrem Erbteil zu verkürzen, in
Krieg mit erstern; dabei verkaufte er 1294 T. für 12,000 Mark
Silber an den König Adolf von Nassau. Infolge davon ward das
Land von allen Greueln des Kriegs heimgesucht, indem sich
König Adolf 1294 und 1295 mit Heeresmacht in Besitz des
erkauften Landes zu setzen suchte, und diese Greuel wiederholten
sich, als nach Adolfs Sturz dessen Nachfolger Albrecht I. ebenfalls
Ansprüche auf T. erhob. Nachdem aber Friedrich der Freidige
(s. Friedrich 34) seinem Vater die Wartburg entrissen und mit
Diezmann die kaiserlichen Truppen bei Lucka 31. Mai 1307 geschlagen
hatte, gelangte er nach Diezmanns Ermordung zum alleinigen Besitz
von T. und erhielt dann von Kaiser Heinrich VII. auch die
förmliche Belehnung. Zwischen seinem Sohn und Nachfolger
Friedrich II,. dem Ernsthaften (s. Friedrich 35), einer- und den
Grafen von Orlamünde und Schwarzburg sowie andern
thüringischen Grafen anderseits entstand 1342 der sogen.
Thüringer Grafenkrieg. Zwar stiftete Kaiser Ludwig der Bayer
1343 Frieden, doch entbrannte der Kampf bald aufs neue und endete
erst 1345 und zwar zum Vorteil des Landgrafen. Er starb 18. Nov.
1349. Von seinen drei Söhnen vergrößerte Friedrich
III., der Strenge (1349-81, s. Friedrich 36), T. durch Erwerbung
der Pflege Koburg und Balthasar (1349-1406) durch Erwerbung der
Ämter Hildburghausen, Heldburg, Ummerstadt etc. infolge seiner
Vermählung mit Margarete, der Tochter des Burggrafen Albrecht
von Nürnberg. Auch entrissen sie im Verein mit ihrem dritten
Bruder, Wilhelm dem Einäugigen, 1369 den von ihnen besiegten
Vögten von Plauen Ziegenrück, Auma und Triptis und
kauften 1365 die Stadt Sangerhausen zurück. Nachdem 1373 mit
den Landgrafen von Hessen eine Erbverbrüderung geschlossen
worden war, fand 1379 und definitiv 1382 nach Friedrichs des
Strengen Tod eine Teilung statt, der zufolge T. an Balthasar fiel.
Balthasar hatte in T. 1406 seinen Sohn Friedrich IV., den
Friedfertigen oder den Einfältigen, zum Nachfolger. Dieser (s.
Friedrich 37) überließ aber die Regierung meist seinem
Schwiegervater, dem Grafen Günther von Schwarzburg, und
erhielt infolge des Absterbens seines Oheims Wilhelm einen
großen Teil von Meißen. Nach seinem Tod (1440) fiel T.
an den Kurfürsten Friedrich II., den Sanftmütigen, und
dessen Bruder, den Herzog Wilhelm III. Die Teilung zwischen beiden
Brüdern veranlaßte einen Bruderkrieg (s. Sachsen, S.
134). Als darauf Wilhelm 1482 ohne Leibeserben starb, fiel T. an
die Söhne Friedrichs des Sanftmütigen, Ernst und Albert,
welche 26. Aug. 1485 eine förmliche Länderverteilung
vornahmen (s. Sachsen, S. 134). Seitdem verschmilzt die Geschichte
von T. in die der sächsischen Herzogtümer Ernestinischer
Linie (s. d.), die Geschichte des thüringischen Kreises aber,
wie der Anteil der Albertinischen Linie hieß, in die
Geschichte Kursachsens und seit 1815 Preußens. Vgl.
"Thüringische Geschichts-
GEOLOGISCHE KARTE VON THÜRINGEN.
Maßstab 1:415000.
Farbenerklärung.
Formationen:
Tertiär
Lias
Trias:
Keuper
Muschelkalk
Buntsandstein
Perm:
Zechstein
Rotliegendes
Karbon:
prod. Steinkohle
Kulm
Devon
Silur
Cambrium.
Gneis und Glimmerschiefer
Eruptivgesteine:
Phonolith
Basalt
Palatinit
Melaphyr und Porphyrit
Quarzporphyr
Granitporphyr
Granit
Diabas
683
Thüringer Wald.
quellen" (hrsg. von Wegele und Liliencron, Jena 1854 bis 1886,
Bd. 1-5); "Zeitschrift des Vereins für thüringische
Geschichte" (das. 1854 ff.); Galletti, Geschichte Thüringens
(Gotha 1781-85, 6 Bde.); Wachter, Thüringische und
obersächsische Geschichte (Leipz. 1826-30, 3 Bde.);
Knochenhauer, Geschichte Thüringens in der karolingischen u.
sächsischen Zeit (Gotha 1863) und zur Zeit des ersten
Landgrafenhauses (das. 1871); Koch, Geschichte Thüringens
(das. 1886); Rothe, Chronik von T. (hrsg. von Fritzsche, Eisenach
1888); Gebhardt, Thüringische Kirchengeschichte (Gotha 1880);
Bechstein, Sagenschatz und die Sagenkreise des Thüringer
Landes (Hildburgh. 1838).
Thüringer Wald (hierzu "Geologische Karte des
Thüringer Waldes"), Kettengebirge in Mitteldeutschland,
erstreckt sich zwischen Thüringen im N. und Franken im S. in
südöstlicher Richtung von der Werra unweit Eisenach bis
zum Wetzstein bei Lehesten, nach andern nur bis zur Werra und
Schwarza, wo es, den Charakter des Plateaus annehmend, in den
Frankenwald übergeht (s. Karte "Sächsische
Herzogtümer"). Die Länge des Gebirges, über dessen
Kamm in seiner ganzen Ausdehnung ein uralter Grenzweg, der sogen.
Rennstieg (s. d.), führt, beträgt, die Linie der Werra-
und Schwarzaquelle als Grenze angenommen, 75, bis zum Wetzstein 110
km, während die Breite im äußersten Nordwesten kaum
10 km, im SO., zwischen Rudolstadt und Sonneberg, 35 km
beträgt. Das Profil des langgestreckten Gebirgszugs mit seinen
zahlreichen, schön gerundeten Gipfeln und muldenförmigen
Vertiefungen bildet eine fortlaufende, sanft gekrümmte
Wellenlinie, die namentlich von der Nordseite her einen ungemein
malerischen Anblick darbietet. Der Kamm selbst erhebt sich nur an
wenigen Stellen über 900 m, während die Höhe seiner
Ausläufer zwischen 200 m (bei Eisenach und Saalfeld) und 490 m
(bei Ilmenau) schwankt. Im allgemeinen kann man den T. W. nach
seiner Längenausdehnung in zwei Hälften teilen, die in
ihrer von der geognostischen Zusammensetzung abhängigen
Oberflächengestalt sich wesentlich voneinander unterscheiden.
Auf ihrer etwa durch die Linie Eisfeld-Amtgehren bezeichneten
Grenze haben die Gewässer, welche das Gebirge drei
Hauptströmen (Elbe, Weser und Rhein) zusendet, ihren
Quellknoten. Der nordwestliche Teil bildet eine schmale, gegen
Eisenach keilförmig zugespitzte, durch einen hohen Kamm
geschlossene Bergkette mit steilem Abfall nach N. und S. Da,
abgesehen von räumlich beschränkten Gebieten
kristallinischen Urgebirges (Granit-, Gneis- und
Glimmerschiefergebiet von Brotterode), die Ablagerungen der
Karbon-Rotliegend-Zeit und von diesen wiederum vorwaltend die
Lavaströme porphyr- und melaphyrartiger Gesteine die
Hauptmasse dieses etwa 75 km langen, 15 bis 22 km breiten
Gebirgsabschnitts zusammensetzen, so herrschen die den
Eruptivgebieten eignen steilen, zerrissenen, durch malerisch
geformte Thalgründe zerklüfteten Terrainformen vor. In
diesem vorzugsweise von Bade- und Kurorten belebten Teile liegen
zugleich die höchsten und besuchtesten Gipfel des Gebirges:
der Inselsberg (915 m), der Große Beerberg (983), der
Schneekopf (978), der Finsterberg (947), der Kickelhahn (861 m) u.
a. Der südöstliche Teil (den Wetzstein als Grenze
angenommen) stellt sich als ein fast ebenso langes, dagegen 40-50
km breites, wellenförmiges, hauptsächlich aus Phyllit,
Thonschiefer und Grauwacke bestehendes Hochland dar, mit steilem
Abfall nach S., breitfüßigen und flach geböschten
Bergen, welche sich nur wenig über das allgemeine Niveau
erheben, und langgestreckten, etwas einförmigen, aber von
gewerblichem und industriellem Verkehr vielfach belebten
Thälern. Als höchste Punkte sind hier zu nennen: das
Kieferle (877 m), die Kursdorfer Kuppe (805), der Wurzelberg (837)
und der Wetzstein (821 m). - Der Wald besteht vorherrschend aus
Tannen und Fichten, neben denen auch bedeutende
Laubwaldbestände vorkommen, gegenwärtig fast überall
Gegenstand einer sorgfältigen Kultur. Die am höchsten
gelegenen, stets bewohnten Orte sind: Neustadt a. R. (925 m),
Igelshieb (835), Steinheid (814), Neuhaus a. R. (812), Oberhof
(811), Oberweißbach (754), Schmiedefeld (728 m) etc., fast
alle im südöstlichen Teile des Thüringer Waldes
liegend.
In geognostischer Beziehung gehört der T. W. zu den
interessantesten und lehrreichsten Gebirgen Deutschlands. Das
nordwestliche Ende besteht aus Rotliegendem; weiterhin gegen SO.
wächst in der Nachbarschaft des inselartig hervortauchenden
Kernes kristallinischen Grundgebirges (Granit, Gneis,
Glimmerschiefer) die Zahl und Mannigfaltigkeit der
karbonisch-rotliegenden Sedimente und besonders der gleichaltrigen
Eruptivgesteine mit ihren Tuffbildungen. Porphyr, Porphyrit,
Melaphyr in den verschiedenartigsten Abänderungen durchsetzen
gangförmig und stockförmig oder überlagern
deckenförmig die bisweilen stark zurücktretenden und in
ihrem Lagerungsgefüge durch zahlreiche Verwerfungen
gestörten Schichtgesteine. Dabei walten in den gewaltigen,
Lavaströmen vergleichbaren Deckenergüssen der tiefern
(karbonischen) Stufe, wie sie den Granit von Suhl, Vesser,
Schmiedefeld und Stützerbach überlagern, die basischen
Eruptivgesteine (Melaphyr, Glimmerporphyrit), in der höhern,
dem Rotliegenden zugerechneten Stufe, insonderheit auf der Strecke
Tambach, Oberhof, Elgersburg, dagegen die sauren Glieder
(Quarzporphyr etc.) vor. Südöstlich der Linie Amtgehren,
Neustadt a. R., Unterneubrunn hören die zusammenhängenden
Eruptivgesteinsdecken ziemlich plötzlich auf, und die Glieder
des kambrisch-phyllitischen Schiefersystems (Thonschiefer,
Grauwacke, Quarzit) mit den bei Siegmundsburg aufgefundenen
Vertretern der ältesten Fauna treten in der ganzen Breite des
Waldgebirges hervor. Schon hart an der Grenze gegen den Frankenwald
lagern sich in schmalem, von SW. bis NO. laufendem Streifen von
Steinach über Spechtsbrunn, Gräfenthal nach Saalfeld die
Glieder des Silur- und Devonsystems auf, ihrerseits den weit in den
Frankenwald in großer Fläche verbreiteten Kulm
(Unterkarbon) tragend. Der ganze Gebirgskörper erscheint als
ein durch gewaltige Bruchlinien (Verwerfungen) von dem ihn
allseitig umgebenden, eingesunkenen, aus Buntsandstein, Muschelkalk
und Keuper gebildeten hügeligen Vorland losgetrennter und
stehen gebliebener horstförmiger Keil. Wo das Absinken des
Vorlandes von demselben weniger in Gestalt scharfer,
schnittförmiger Brüche als durch eine Schichtenverbiegung
und Niederziehung erfolgte, ist die Zechsteinformation als bald
breiterer, bald schmälerer Randsaum des Gebirges erhalten.
Die Gewässer des Thüringer Waldes, sämtlich zum
Gebiet der Nordsee gehörend, verzweigen sich zu einem
dreifachen Flußgebiet, dessen Scheitelpunkt der Saarberg
unfern Limbach ist. Zum Elbgebiet gehören die direkt oder
indirekt zur Saale gehenden: Selbitz, Loquitz, Schwarza, Ilm und
Gera mit Apfelstedt; zum Wesergebiet: die Werra mit Schleuse,
Hasel, Schmalkalde, Druse und Hörsel mit Leine; zum
Rheingebiet die zum Main gehenden: Rodach und Itz. An
größern stehenden Gewässern fehlt es dem Gebirge.
Von Mineralquellen
684
Thüringische Terrasse - Thurles.
sind außer den kalk- und kohlensäurehaltigen
Eisenquellen in Liebenstein die Solquellen von Salzungen und
Schmalkalden zu nennen, während andre Orte, besonders
Elgersburg, Ilmenau etc., sich eines fast chemisch reinen Wassers
erfreuen und den dortigen Kaltwasserheilanstalten ihren guten Ruf
verschafft haben. An nutzbaren Mineralien ist die Ausbeute von
Braunstein, welcher aus Gängen im Porphyr vorkommt
(Manganerz), bei Ilmenau, Elgersburg, Friedrichroda, Schmalkalden
etc. von einiger Bedeutung. Außerdem liefert die
Zechsteinformation Eisenerze (Stahlberg und Mommel bei
Schmalkalden, Kamsdorf bei Saalfeld), Schwerspat, Kupfererz
(Kupferschiefer bei Ilmenau, Schweina u. Fahlerz bei Kamsdorf),
Gips (Kittelsthal, Friedrichroda etc.), Kobalt- und Nickelerze bei
Saalfeld und Schweina. Alaun- und Vitriolschiefer sind bei
Schmiedefeld im Silur bekannt. Gold fand sich im kambrischen
Quarzit von Reichmannsdorf. Flußspat wird bei Steinbach und
Öhrenstock, Kaolin bei Limbach etc. gewonnen. Besondere
Erwähnung verdienen noch die Schieferbrüche im
südöstlichen Teil des Gebirges, besonders bei Lehesten.
Lebhaft ist die Industrie. Hervorragend sind besonders: die
Bearbeitung des Eisens in allen Formen bis hinab zu den Produkten
der Kleinschlosserei und den sogen. Schmalkaldener Waren, die
Porzellan- und Steingutmanufakturen, die Spielwaren- und
Papiermachéfabriken in Sonneberg und Waltershausen, die
Meerschaumindustrie in Ruhla, die Glashütten,
Glasinstrumenten- und Glasperlenfabrikation, die Farbenfabriken,
die Gewinnung von Pechharz und Kienruß etc. Bedeutend ist der
Fremdenverkehr während der Sommermonate, besonders in
Eisenach, Thal, Ruhla, Friedrichroda, Tabarz, Georgenthal, Tambach,
Elgersburg, Ilmenau. Zahlreiche, meist wohlgepflegte Straßen
überschreiten das Gebirge. Ein Gürtel von Eisenbahnen
umgibt den T. W., drei Linien durchschneiden denselben von N. nach
S. zum Teil in langen Tunnels. Für noch größere
Hebung des Fremdenverkehrs, namentlich auch für
Aufschließung noch weniger bekannter Thäler und
Aussichtspunkte, ist der Thüringerwaldverein sehr thätig.
In politischer Beziehung bietet der T. W. noch heute das bunteste
Bild dar: Preußen, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Weimar,
Sachsen-Koburg-Gotha, die beiden Schwarzburg, Reuß und Bayern
teilen sich in ihn. Vgl. Heim, Geologische Beschreibung des
Thüringer Waldgebirges (Meining. 1796, 6 Bde.); Credner,
Geognostische Verhältnisse Thüringens und des Harzes
(Gotha 1843); Derselbe, Versuch einer Bildungsgeschichte der
geognostischen Verhältnisse des Thüringer Waldes (das.
1855); Schwerdt und Ziegler, Thüringen (in "Meyers
Reisebüchern", 3. Aufl., Leipz. 1879), und ebenda: Anding und
Radefelds "Wegweiser" (9. Aufl., das. 1888); Trinius,
Thüringer Wanderbuch (Mind. 1886-89, 3 Bde.); Vogel,
Topographische Karte vom T. W., 1 : 150,000 (Gotha).
Thüringische Terrasse, die Berg- und
Hügellandschaft zwischen dem Thüringer Wald und dem Harz,
der Saale und der Werra, die vom Harz durch die Goldene Aue (das
Thal der Helme) geschieden wird, bildet im allgemeinen eine
allmählich gegen S. ansteigende Landschaft mit zahlreichen
Bergzügen und Platten unter besondern Namen. Dahin
gehören: das Plateau des Eichsfeldes (Goburg, am Westrand, 568
m) mit dem Ohmgebirge (522 m) und dem Dün (517 m), das
zwischen Wipper und Helbe sich als Hainleite (Wetternburg 465,
Possen 461 m) zur Unstrut zieht; das Kyffhäusergebirge (470 m)
am südlichen Rande der Goldenen Aue; die Schmücke,
Schrecke und Finne zwischen der Unstrut bei Sachsenburg und der
Saale bei Kösen; der Göttinger Wald (440 m) östlich
von der Leine und von Göttingen; der Hainich (473 m),
Verbindungsglied zwischen dem Eichsfelder Plateau und den Bergen
bei Eisenach; der Ettersberg (481 m) nördlich von Weimar und
der Steigerwald bei Erfurt. In unmittelbarer Nähe des
Thüringer Waldes bereits befinden sich Höhen zwischen der
Saale und Gera (Singerberg bei Stadtilm 582 m, Reinsberg bei Plaue
614 m), die Drei Gleichen bei Wandersleben und die Hörselberge
(485 m) bei Eisenach. Auch die ostwärts von der Saale sich
erstreckenden Berglandschaften gehören teilweise noch hierher,
so: der Kulm (482 m) bei Saalfeld, die Leuchtenburg (436 m), die
Kunitzburg (353 m) und die Rudelsburg, alle drei unmittelbar an der
Ostseite des Saalethals. Was den Bau der Terrasse betrifft, so
besteht dieselbe, abgesehen von den Alluvionen in den
Flußthälern, vorzugsweise aus Keuper, Muschelkalk und
Buntsandstein. Älteres Gestein, Zechstein und Rotliegendes,
Granit, Gneis und Hornblendefels bedeckend, findet sich im
Kyffhäusergebirge.
Thürklopfer, ursprünglich eiserne Hämmer,
dann Ringe aus Eisen oder Bronze, welche an den Hausthüren so
angebracht waren, daß man sie bewegen und mit ihnen gegen
einen eisernen Knopf schlagen konnte. Seit der gotischen Zeit
wurden die T. phantastisch gestaltet und künstlerisch verziert
(s. Tafel "Schmiedekunst", Fig. 3 u. 25), in der Renaissance zu
Kunstwerken mit figürlichem Zierat ausgebildet (s. Abbild.).
Bisweilen waren sie auch mit Fackelhaltern verbunden (s. Tafel
"Schmiedekunst", Fig. 19). Jetzt nur noch in England
gebräuchlich.
Thurles (spr. thörls), Stadt in der irischen
Grafschaft Tipperary, am Suir, sehr alt, Sitz des Erzbischofs von
Cashel und Emly, hat ein kath. Seminar, 2 Nonnenklöster, die
Ruinen eines Schlosses derTempelherren und (1881) 4850 Einw. 6 km
davon die Ruinen der 1182 gestifteten Holy Croß Abbey.
[Thürklopfer (Neptun am Palast Trevisan in
Venedig).]
685
Thurm - Thymele.
Thurm, s. Turm.
Thurmayr, Johannes, s. Aventinus.
Thurn, Heinrich Matthias, Graf von, einer der
Hauptführer des böhmischen Aufstandes unter Ferdinand
II., geb. 1580 von protestantischen Eltern, erhielt vom Kaiser
Rudolf II. wegen seiner Dienstleistungen in einem Feldzug gegen die
Türken die Stelle eines Burggrafen von Karlstein in
Böhmen. Er war einer der Haupturheber des Majestätsbriefs
und wurde von den Ständen zu einem der 30 Defensoren des
Glaubens ernannt. Er gab 23. Mai 1618 das Zeichen zum Aufstand der
protestantischen Bevölkerung in Böhmen und ward dann zum
Anführer des ständischen Heers ernannt, mit dem er im
Juni 1619 bis Wien vordrang. Nach der Schlacht am Weißen
Berg, in welcher er mitkämpfte, floh er nach Siebenbürgen
zu Bethlen Gabor. 1626 befehligte er ein kleines Korps in
Schlesien, begab sich dann zu dem König Gustav Adolf von
Schweden und focht bei Leipzig 1631 und bei Lützen 1632 mit.
Nach dem Tode des Königs ging er mit einem schwedischen Korps
nach Schlesien, knüpfte dort mit Wallenstein nutzlose
Unterhandlungen an und ward im Oktober 1633 mit seinen 2500
Schweden bei Steinau a. O. eingeschlossen und zur Kapitulation
gezwungen, aber bald wieder freigegeben. 1636 veröffentlichte
er in Stockholm eine "Defension-Schrifft". Er starb 28. Jan. 1640.
Vgl. Hallwich, Heinrich Matthias Graf T. (Leipz. 1883).
Thurn und Taxis, altes, weitverzweigtes Adelsgeschlecht,
stammt angeblich von den mailändischen della Torre, die
1237-77 und 1302-11 Mailand beherrschten. Von den Visconti
vertrieben, ließ sich nach der Überlieferung Lamoral I.
1313 im Gebiet von Bergamo nieder und nahm von dem Berg Tasso
(Dachsberg) den Namen del Tasso, später de Tassis (Taxis), an.
Thurn entstand durch die Übersetzung des italienischen Torre.
Franz von T. ward von Kaiser Maximilian 1512 der
rittermäßige Reichsadel bestätigt; er errichtete
1516 die erste wirkliche Post zwischen Wien und Brüssel. 1595
wurde Leonhard von Taxis Generalpostmeister des Reichs, und 1615
erwarb Lamoral von Taxis neben der Erblichkeit dieses Amtes die
gräfliche Würde für sein Haus. Eugen Alexander von
Taxis wurde 1686 von Leopold I. in den Reichsfürstenstand
erhoben, und der fürstliche Rang war seit 1695 in seinem
Geschlecht erblich. Die 1785 von Karl Anselm von Taxis erkauften
reichsunmittelbaren Herrschaften Friedberg, Scheer,
Dürmentingen und Bussen wurden 1786 zu einer gefürsteten
Reichsgrafschaft erhoben und verschafften ihrem neuen Herrn Sitz
und Stimme auf der Fürstenbank des schwäbischen Kreises.
Als Entschädigung für den Verlust der Posten in den
österreichischen Niederlanden und auf dem linken Rheinufer
erhielt das Thurn und Taxissche Haus im
Reichsdeputationshauptrezeß von 1803 das gefürstete
Damenstift Buchau nebst Stadt, die Abteien Marchthal und Neresheim,
das Amt Ostrach, die Herrschaften Schemmerberg und die Weiler
Tiefenthal, Frankenhofen und Stetten als Fürstentum; von
Preußen 1819 als Entschädigung für die hier
verlornen Posten drei in der Provinz Posen gelegene
Domänenämter, die zu einem Fürstentum Krotoschin
erhoben wurden. Außerdem besitzt das Haus zahlreiche
Herrschaften in Österreich, Bayern, Württemberg u.
Belgien. Seine gesamten Besitzungen umfassen etwa 1900 qkm
(34½ QM.) mit ca. 100,000 Einw. und 1,1 Mill. Mk.
Einkünften. Über die Thurn und Taxisschen Posten, welche
1867 Preußen übernahm, s. Post, S. 274.
Gegenwärtiger Standesherr ist Fürst Albert, geb. 8. Mai
1867, Sohn des Erbprinzen Maximilian und der Prinzessin Helene,
Herzogin in Bayern. Derselbe wohnt in Regensburg, ist erblicher
Reichsrat in Österreich u. Bayern und erbliches Mitglied des
preußischen Herrenhauses sowie der Ersten Kammer in
Württemberg. Eine Sekundogenitur des Hauses T. bildet die zu
Prag residierende fürstliche Seitenlinie, welche durch die
Nachkommen des Prinzen Maximilian Joseph (geb. 29. Mai 1769, gest.
15. Mai 1831) gebildet wird. An ihrer Spitze steht jetzt Fürst
Hugo, geb. 3. Juli 1817. Einer seiner Brüder, Prinz Emmerich,
geb. 12. April 1820, ist k. k. Geheimrat, Kämmerer und General
der Kavallerie in Österreich. Beider Oheim, Prinz Karl
Theodor, geb. 17. Juli 1797, wurde 1850 bayrischer General der
Kavallerie und im Feldzug von 1866 Befehlshaber des
Kavalleriereservekorps, ward bald nach wiederhergestelltem Frieden
zur Disposition gestellt und starb 21. Juni 1868 in
München.
Thurnau, Flecken im bayr. Regierungsbezirk Oberfranken,
Bezirksamt Kulmbach, am Rande des Jura, 350 m ü. M., Hauptort
eines 220 qkm (4 QM.) großen Mediatgerichts des Grafen von
Giech, hat eine evang. Kirche, ein Schloß mit Park, ein
Amtsgericht, Schleifsteinbrüche und (1885) 1269 Einw.
Thursday (spr. thörrsde), zur britisch-austral.
Kolonie Queensland gehörige Insel, in der Torresstraße
gelegen, nördlich vom Kap York, mit der seit einigen Jahren
hierher von Somerset verlegten Niederlassung der Regierung. T. ist
eine Zentralstation für die in diesen Gewässern
schwunghaft betriebene Perl- und Trepangfischerei (Ertrag 1886:
70,602, resp. 6800 Pfd. Sterl.) und Station für die von
Singapur nach Brisbane laufenden Postdampfer.
Thursen, Riesen, s. Joten.
Thúrso, Seestadt in der schott. Grafschaft
Caithneß, an der Mündung des Flusses T. in eine
geräumig Bai, hat ein altes Schloß, einen Hafen für
Schiffe von 3,6 m Tiefgang, Seilerei, Ausfuhr von Vieh und
Pflastersteinen und (1881) 4026 Einw.
Thürsteuer, f. Gebäudesteuer.
Thusis (roman. Tuseun), Marktflecken im schweizer. Kanton
Graubünden, Hauptort des Bezirks Heinzenberg, an der
Mündung der Nolla in den Hinterrhein (oberhalb beginnt die Via
mala), 746 m ü. M., mit Korn- und Viehhandel und (1880) 1126
Einw. T. ist wichtig als Kreuzungspunkt der Splügen- und der
Schynstraße. In der Nähe die Burgruine Hohen-Rätien
(Hohen-Realta, 950 m hoch) mit schöner Aussicht. Vgl. Lechner,
T. und die Hinterrheinthäler (Chur 1875); Rumpf, Thusis
(Zürich 1881).
Thusnélda, Tochter des Segestes, Gattin des
Arminius, der sie ihrem Vater entführt hatte, geriet
später wieder in die Gewalt ihres Vaters und wurde von diesem
15 n. Chr. an Germanicus ausgeliefert, der sie nebst ihrem Sohn
Thumelicus, den sie in der Gefangenschaft geboren, im J. 17 zu Rom
im Triumph aufführte.
Thyatira, antike Stadt, s. Akhissar 2).
Thyéstes, Bruder des Atreus (s. d.).
Thyiaden, s. v. w. Bacchantinnen, s. Dionysos, S.
997.
Thylacinus, Beutelwolf.
Thylacotherium, s. Beuteltiere, S. 848.
Thyllen (griech., Füllzellen), Zellen, welche
ältere oder verletzte Gefäße, z. B. im Holz der
Eiche, Robinien u. a., nachträglich ausfüllen.
Thymallus, Äsche.
Thymele, auf der altgriech. Bühne eine
altarförmige viereckige, sich auf Stufen erhebende
Erhöhung in der Mitte der Orchestra, auf welcher der
Chorführer
686
Thymeleen - Tiara.
stand und die Bewegung des Reigens beherrschte (s. Tafel
"Baukunst IV", Fig. 11, u. Theater, S. 623).
Thymeleen (Daphnoideen), dikotyle, etwa 300 Arten
umfassende, der gemäßigten und warmen Zone
ungehörige Pflanzenfamilie aus der Ordnung der
Thymeläinen, welche sich von den nächstverwandten
Eläagnaceen hauptsächlich durch die nahe dem Gipfel des
ein-, selten mehrfächerigen Ovariums entspringenden,
hängenden Samenknospen unterscheidet. Vgl. Meißners
Monographie in De Candolles "Prodromus", Bd. 14. Eine Anzahl von
Arten aus den Gattungen Daphne L. und Pimelea Banks kommen fossil
in Tertiärschichten vor.
Thymelinae, Ordnung im natürlichen Pflanzensystem
unter den Dikotyledonen, charakterisiert durch nebenblattlose
Blätter, viergliederige Blüten, ein
röhrenförmiges, blumenkronartig gefärbtes Perigon,
die fehlende Korolle, perigynische Staubgefäße, einen
oberständigen, einfächerigen und meist einsamigen
Fruchtknoten, umfaßt die Familien der Thymeleen,
Eläagneen, Proteaceen.
Thymian, Pflanzengattung, s. Thymus.
Thymianöl, ätherisches Öl, welches aus dem
blühenden Kraute des Thymians durch Destillation mit Wasser
gewonnen wird. Es ist farblos oder gelblich, vom Geruch und
Geschmack des Thymians, spez. Gew. 0,87-0,90, löst sich schwer
in Wasser, in gleichen Teilen Alkohol, leicht in Äther,
enthält Thymen C10H16, Cymol C10H14 und Thymol C10H14O. Es
wird in der Parfümerie häufig angewandt.
Thymol (Thymiankampfer) C10H14O findet sich im
ätherischen Thymianöl und in einigen andern
ätherischen Ölen und wird daraus gewonnen, indem man die
Öle mit Natronlauge schüttelt und die von dem Öl
getrennte wässerige Flüssigkeit mit Salzsäure
Übersättigt. Es bildet farblose Kristalle, riecht
thymianähnlich, schmeckt brennend gewürzhaft, ist leicht
löslich in Alkohol und Äther, schwer in Wasser, schmilzt
bei 44°, siedet bei 230° und wird aus seiner Lösung in
wässerigen Alkalien durch Kohlensäure abgeschieden. Das
T. wurde als Ersatz der Karbolsäure (Phenol) beim Wundverband,
als Arzneimittel, zu Mundwässern und zum Konservieren des
Fleisches etc. empfohlen. Es wirkt antiseptisch, aber nicht in der
Weise schädlich auf den Organismus wie Karbolsäure,
hinter welcher es freilich auch in seinen antiseptischen
Eigenschaften bedeutend zurücksteht. In der Wundbehandlung hat
es daher nur vorübergehend eine Rolle gespielt. Vgl. Ranke,
Über das T. (Leipz. 1878).
Thymus Tourn. (Thymian, Quendel), Gattung aus der Familie
der Labiaten, Halbsträucher oder kleine Sträucher mit
kleinen, ganzrandigen, gegenständigen Blättern, meist
wenigblütigen Scheinquirlen, die bald entfernt voneinander,
bald zu dichten oder lockern Ähren oder Köpfchen
zusammengedrängt sind, und meist rötlichen Blüten.
40 (80) Arten, besonders in den Mittelmeerländern. T.
Serpyllum L. (Feldthymian, Feld-, Hühnerpolei, Quendel), in
ganz Europa, im mittlern und südwestlichen Asien, in Afrika
und Nordamerika, kleiner Halbftrauch mit niederliegendem,
verästeltem Stengel, linealischen oder elliptischen, meist
drüsig punktierten und am Grund borstig gewimperten
Blättern und blaß purpurroten Blüten, variiert
stark in Behaarung und Blattform, riecht, besonders gerieben,
angenehm gewürzig und liefert ein ätherisches Öl
(bis 0,4 Proz.). Das Kraut ist offizinell. T. vulgaris L.
(Gartenthymian, römischer Quendel), ein niedriger Halbstrauch
in Südeuropa, in Deutschland und noch in Norwegen häufig
in den Gärten zum Küchengebrauch und der Bienen wegen
kultiviert, hat einen aufsteigenden, ästigen Stengel,
linealisch-lanzettliche bis länglich-eiförmige,
drüsig punktierte, sehr kurz behaarte oder kahle, am Rand
umgerollte Blätter und weißliche oder rötliche
Blüten in ährig bis kopfig zusammengerückten
Scheinquirlen. Das Kraut enthält ätherisches Öl (bis
0,6 Proz.) und ist offizinell.
Thymusdrüse (Milchfleisch, Brustdrüse, Briesel,
Glandula Thymus), bei den Wirbeltieren ein drüsiges Gebilde im
obern Teil der Brusthöhle und des Halses. Sie ist sehr
langgestreckt bei den Krokodilen und Vögeln, wo sie vom
Herzbeutel bis zum Unterkiefer reicht, kürzer bei den
Säugetieren. Fast immer ist sie in der Jugend stärker
entwickelt und erleidet im Alter Rückbildungen. Bei den
Fischen steht sie noch in naher Beziehung zu den Kiemen und scheint
auch aus ihnen hervorgegangen zu sein. Ihrem Bau nach ist sie eine
Lymphdrüse (s. d.) ohne Ausführungsgang. Beim Menschen
liegt sie hinter dem Handgriff des Brustbeins, wiegt 4-34 g, ist
graurötlich, platt, meist dreieckig und besteht aus zwei
seitlichen Lappen, welche durch einen schmälern mittlern Teil
untereinander verbunden sind. Ungefähr im zweiten Jahr nach
der Geburt hört sie auf, sich zu vergrößern. Von da
an bleibt sie, meist bis etwa zum 15. Jahr, stationär und
erleidet dann allmählich eine Umwandlung in Fettgewebe.
Thynnus, Thunfisch.
Thyone, Beiname der Semele (s. d.), daher auch Dionysos
hin u. wieder als Thyoneus verehrt wurde.
Thyreotomie (griech.), operative Spaltung des
Schildknorpels zur Entfernung unzugänglicher Neubildungen aus
dem Kehlkopf.
Thyrsos (griech.), der mit Epheu u. Weinranken umwundene,
oben mit einem Fichtenzapfen versehene Stab des Dionysos u. seiner
Begleiter (s. Abbild.); in der Botanik (Thyrsus) s. v. w. sehr
zusammengedrängte Rispe.
Thysanuren (Thysanura), Gruppe der Insekten, welche
früher zu den Geradflüglern gestellt wurde, jetzt aber
als selbständige Ordnung aufgefaßt wird; flügellose
Tiere mit behaarter oder beschuppter Körperbedeckung,
rudimentären kauenden Mundteilen und borstenförmigen
Fäden, bez. Springapparat am Ende des zehngliederigen
Hinterleibs. Die T. scheinen den ursprünglichen Charakter der
ältesten Insektenformen am meisten bewahrt zu haben u.
erinnern besonders in den langgestreckten Kampodiden an gewisse
Myriopoden, zumal sie auch am Hinterleib Fußstummel tragen
können. Die T. leben an feuchten, moderigen Orten und
ernähren sich von verwesenden organischen Substanzen. Man
teilt sie in drei Familien: Campodidae. Springschwänze
(Poduridae) und Borstenschwänze (Lepismidae), zu welchen der
Zuckergast (Lepisma saccharina) gehört. Vgl. Lubbock,
Monograph of the Collembola and Thysanura (Lond. 1873).
Ti, in der Chemie Zeichen für Titan.
Tiahuanaco, Dorf in der südamerikan. Republik
Bolivia, in der Nähe des Titicacasees, bekannt durch seine
Altertümer, die von den Vorfahren der Aymara herstammen
sollen.
Tiara (griech.), nach Herodot die bei feierlichen
Gelegenheiten getragene Kopfbedeckung der Orientalen, namentlich
der Perser, von aufrecht stehender Form mit darum geschlungenem
Diadem; dann die hohe päpstliche Kopfbedeckung, anfangs
weiß ohne Kronenrand, dann gestreift mit goldenem
Stirnreif.
[Thyrsos.]
687
Tibaldi - Tiber.
Bonifacius VIII. (gest. 1303) gab dem letztern die Gestalt einer
Krone (regnum) und setzte darüber noch einen zweiten goldenen
Kronenreif; Urban V. (gest. 1370) fügte dazu einen dritten
Kronenreif und machte sie so zur dreifachen Krone (triregnum), an
den Seiten mit zwei herabhängenden Bändern u. oben darauf
mit dem Reichsapfel, dem Symbol der vom Kreuz beherrschten Welt.
Seit Papst Paul II. (gest. 1471) besteht sie aus purpurnen, blauen
und grünen Streifen mit dreifachem Reif darum (s.
Abbild.).
Tibaldi, Pellegrino, ital. Maler und Architekt, geb. 1532
zu Bologna, begab sich 1547 nach Rom, wo er besonders die Werke
Michelangelos studierte, ging sodann zur Architektur über,
bethätigte sich aber auch wieder als Maler, als ihn der
Kardinal Gio. Poggi beauftragte, in seinem Palast zu Bologna die
Geschichte des Odysseus zu malen. Durch seine Ausschmückung
der Kapelle des heil. Jakob des Augustiners erwarb er sich den
Namen eines "Michelangelo riformato". Im Börsensaal zu Ancona
malte er den die Ungeheuer zähmenden Herakles, inzwischen aber
auch zarte und anmutige Bilder in Öl, meist figurenreich,
lebhaft koloriert und mit Architektur verziert. 1562 wurde T. vom
Kardinal Carlo Borromeo nach Pavia berufen, um den Plan zum Palast
della Sapienza zu entwerfen. In Mailand restaurierte er den
erzbischöflichen Palast, und nach Vollendung des Baues der
Kirche des heil. Fidelis daselbst wurde er 1570 erster Architekt
des Doms und modernisierte als solcher besonders das Innere
desselben. 1586 ward er von Philipp II. nach Madrid berufen, um den
Plan zum Escorial zu entwerfen, in welchem er auch das Deckenbild
der Bibliothek malte. Zum Marchese von Valsolda ernannt, kehrte der
Künstler nach neun Jahren nach Mailand zurück und starb
daselbst 1598. Vgl. Zanotti, Le pitture di Pellegrino T. (Vened.
1756). Sein Sohn Domenico, geb. 1532 zu Bologna, gest. 1583, erwarb
sich ebenfalls als Architekt und Maler einen Namen.
Tibbu (Tebu), das Volk der östlichen Sahara, hat
seine westliche Grenze, gegen die Tuareg hin, ungefähr an der
großen von Tripolis über Mursuk und Bilma nach Kuka
verlaufenden Karawanenstraße, wird im N. von Tripolitanien,
im S. von Kanem und Wadai, im O. von der Libyschen Wüste
begrenzt und zerfällt in zwei sprachlich getrennte Gruppen:
die Teda oder Tubu in Tibesti und Kauar und die Dasa oder Koran in
Borku, Kanem und dem Gebiet des Gazellenflusses in Wadai.
Während Rohlfs u. a. die T. zu den Negern stellten, weist
ihnen Nachtigal ihre ethnographische Stellung bei den Berbern zu;
doch ist eine Mischung mit Negern nicht ausgeschlossen. Die Sprache
der Teda ist nach den Untersuchungen von Barth, der die T. für
Nachkommen der alten Garamanten (s. d.) hält, und Fr.
Müller entschieden verwandt mit dem benachbarten Kanuri von
Bornu. Hautfarbe und Gesichtsbildung der T. schwanken zwischen hell
und "kaukasisch" und negerartig mit krausem Haar und gelber
Bindehaut der Augen; vorwiegend sind weißlichgelbe bis
rotbräunliche Individuen. Der Bartwuchs ist spärlich.
Alle T. sind jetzt zum Islam bekehrt, dem sie fanatisch
anhängen, wiewohl sie dessen Wesen kaum begriffen haben.
Gesellschaftlich sind die T. in drei Klassen geschieden: die Maina
(Edlen), aus welchen die Sultane hervorgehen, das übrige Volk
und die Schmiede, welche eine Pariastellung einnehmen. Die
Industrie ist sehr gering; die Frauen flechten Matten aus
Palmfasern, die Männer gerben Schläuche und verfertigen
Sättel. Die Behausungen, durch Reinlichkeit ausgezeichnet,
bestehen aus Höhlen in den Felsen, aus kreisrunden, von
Sandsteinen geschichteten Häusern und aus Stabhütten, die
mit Matten gedeckt sind. Die Kleidung ist das einfache
Baumwollgewand (Tobe) des Sudân; Knaben gehen bis zum zehnten
Jahr nackt. Waffen sind Schwert, Spieß, Bogen und das zackige
Wurfmesser (Schandermagor), wie es bei den Niam-Niam im Gebrauch
ist. Da geschriebene Gesetze fehlen, beruht die gesellschaftliche
Ordnung auf dem Herkommen, wozu seit Einführung des Islam der
Koran kommt. Die Sultane (Derde) werden auf Lebenszeit aus der
Klasse der Maina gewählt; ihre Einkünfte bestehen in
einem Teil der Raubzugsbeute; ihre Machtvollkommenheit ist eine
beschränkte. Eine Nation oder einen Staat bilden die T. nicht;
auch da, wo, wie in Kauar und Tibesti, mehrere Ortschaften unter
einem gemeinsamen Herrscher stehen, ist doch der Verband ein
lockerer. Vgl. Behm, Land und Volk der Tebu (im Ergänzungsheft
Nr. 8 zu "Petermanns Mitteilungen", 1862); Nachtigal, Die T. (in
der "Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin",
Berl. 1870); Derselbe, Sahara und Sudân, Bd. 1 (das. 1879);
Rohlss, Quer durch Afrika, Bd. 1 (Leipz. 1874).
Tiber (ital. Tevere, franz. Tibre, bei den Römern
Tiberis, in noch früherm Altertum Albula), der Hauptfluß
des mittlern Italien, an dessen Ufern die Stadt Rom liegt,
entspringt in der Provinz Arezzo, 18 km nördlich von Pieve
Santo Stefano, am Hochkamm des toscanischen Apennin, fließt
anfangs gegen S. und SW. durch die Provinz Perugia, wendet sich
dann bei der Einmündung der Paglia scharf gegen SO. und
läuft nun eine Strecke weit parallel mit der Küste des
Tyrrhenischen Meers, bis er sich wieder gegen SW. dem Meer
zuwendet, die Provinz Rom betritt und 38 km unterhalb Rom in zwei
Armen (wovon der nördliche, der von Fiumicino, ein
künstlich abgeleiteter Kanal ist) in das Tyrrhenische Meer
einmündet. Das Thal des T. ist bald schluchtenartig eng und
wild, bald weitet es sich zu einem lieblichen Gebirgskessel aus,
überall aber ist es reich an Naturschönheiten. Auch die
Thäler der Nebenflüsse haben einen wilden Charakter. Nur
die untern, erweiterten Thalgründe von Rieti u. Foligno,
trocken gelegte Seebecken, machen eine Ausnahme. Bei Nazzano
gelangt der Fluß in die wellenförmige Campagna di Roma.
Die beiden Mündungsarme, von welchen nur der nördliche
(Fiumicino) schiffbar, der südliche (Fiumara) aber versandet
ist, umschließen die Isola sacra ("heilige Insel"), ein mit
Wald und Sumpf bedecktes Delta. Von den mehr als 40
Nebenflüssen verdienen nur die Paglia mit der Chiana rechts,
der Chiascio mit Topino und Clitunno, die Nera mit dem Velino und
der Teverone links Erwähnung. Die direkte Entfernung von der
Quelle bis zur Mündung beträgt 233, der Stromlauf 418 km.
Beim Eintritt in die Stadt Rom, welche er auf eine Länge von
4450 m durchfließt, ist der Fluß 75, weiterhin nur 52,
unterhalb der Tiberinsel 103 m breit, bei einer Tiefe von 5-13 m.
Berüchtigt sind die vielen Überschwemmungen in Rom und
der Cam-
[Tiara.]
688
Tiberias - Tiberius Claudius Nero.
pagna, welche durch rasches Schneeschmelzen und langes
Regenwetter bei weitgehender Entwaldung des Flußgebiets
verursacht werden. Den Lauf des Flusses zu regeln und diese
Überschwemmungen zu verhüten, ist eine der schwierigsten
noch ungelösten Aufgaben der italienischen Wasserbaumeister.
Der T. ist von der Mündung der Nera an schiffbar, von Rom aus
auch für kleine Dampfer und Segelschiffe bis zu 180 Ton. Sein
Wasserstand ist auch im Sommer höher, als man erwarten sollte,
und es ist anzunehmen, daß er durch unterirdische
Zuflüsse aus dem Kalkgebirge genährt wird. Er ist
beständig trübe und von den Thonmassen gelblichweiß
gefärbt, welche er von den umbrischen Bergen und Ebenen
mitführt, um sie an seiner Mündung abzulagern. Er schiebt
deshalb sein Delta sehr rasch ins Tyrrhenische Meer vor und hat
alle Hafenanlagen ausgefüllt und unbrauchbar gemacht; die
älteste, Ostia, liegt jetzt 6½ km vom Meer. Vgl. Smith,
The T. and its tributaries (Lond. 1877); Nissen, Italische
Landeskunde, Bd. 1 (Berl. 1883).
Tiberias, Stadt in Palästina (Galiläa), am
westlichen Gestade des Sees Genezareth, der daher auch See von T.
heißt, Gründung und gewöhnliche Residenz des
Herodes Antipas, der ihr dem Kaiser Tiberius zu Ehren den Namen
gab, war durchaus im römisch-griechischen Geschmack erbaut,
mit Amphitheater, Rennbahn etc. und daher den strenggläubigen
Juden zuerst verhaßt. Nach dem Untergang des jüdischen
Staats war T. Jahrhunderte hindurch Sitz einer berühmten
jüdischen Akademie und Mittelpunkt der jüdischen Nation,
wo Mischna und Talmud entstanden. Das Christentum fand nur langsam
seit Konstantin Eingang. 637 fiel die Stadt den Arabern in die
Hände. Während der Kreuzzüge galt sie als eins der
wichtigsten Bollwerke der Kreuzfahrer; aber 4. Juli 1187 erlitten
die Christen bei Hattin unweit T. durch Saladin eine entscheidende
Niederlage, welche die Übergabe der Stadt zur Folge hatte.
Jetzt Tabarieh, ein ärmlicher, schmutziger Ort mit verfallenem
Kastell, dicker Stadtmauer und 3000 Einw., zur größern
Hälfte Juden, deren Begräbnisplatz, ½ Stunde
westlich der Stadt, die Gräber der berühmtesten
Talmudisten (Maimonides, Rabbi Akiba etc.) enthält.
Tiberinus (Paton T.), der Gott des Tiberflusses, nach der
römischen Sage ein alter König des Landes, der in dem
seither nach ihm Tiberis genannten Fluß Albula ertrank und
zum Gott wurde. Der Mythus ließ ihn die in den Tiber
gestürzte Mutter des Romulus und Remus, Rea Silvia, zu seiner
Gemahlin und zur Stromgöttin erheben. Sein Heiligtum war auf
der Tiberinsel, wo ihm 8. Dez. geopfert wurde; besondere Spiele
feierten ihm zu Ehren am 7. Juni die Fischer.
Tiberius, Name zweier oströmischer Kaiser: 1) T.
Constantinus, ein Thraker, Befehlshaber der Leibwache unter Justin
II., wurde von diesem 574 zum Mitkaiser erhoben und folgte ihm 578
in der Regierung. Er unterdrückte einen von Justins Gemahlin
Sophia angestifteten Aufstand und führte ein kräftiges
und gerechtes Regiment, er kämpfte mit Glück gegen den
Perserkönig Chosru, welcher 579 den Krieg erneuerte, aber von
T.' Feldherrn Justinian wiederholt besiegt und bis in die Nähe
seiner Hauptstadt verfolgt wurde. T. starb schon 582.
2) T. Apsimarus, von dem gegen den Kaiser Leontios
aufständischen Heer 698 zum Kaiser ausgerufen, stürzte
Leontios, wurde aber 705 von dem mit bulgarischer Hilfe aus dem
Exil heimkehrenden Justinian II. gestürzt und grausam
hingerichtet.
Tiberius Claudius Nero, röm. Kaiser, geb. 42 v.
Chr., Sohn eines gleichnamigen Vaters und der Livia Drusilla und
nach deren Verheiratung mit Augustus (38) Stiefsohn des Kaisers,
unterwarf mit seinem Bruder Drusus zusammen 16-15 die Rätier
und Vindelizier, unterdrückte in drei Feldzügen 12-10
einen Aufstand der Pannonier und Dalmatier und machte 8 einen
Einfall in das Gebiet der Sigambrer, die er schlug, und von denen
er 40,000 auf das linke Rheinufer verpflanzte. Er war 12 nach dem
Tode des Agrippa mit Julia, der Tochter des Augustus, verheiratet
worden, und 6 wurde ihm die tribunizische Gewalt auf fünf
Jahre verliehen. In demselben Jahr aber wurde er durch die
Ausschweifungen der Julia und durch Eifersucht auf die bevorzugten
Enkel des Augustus, Gajus und Lucius Cäsar, bewogen, sich
gegen den Willen des Kaisers nach Rhodos in ein freiwilliges Exil
zu begeben. Erst 2 n. Chr. kehrte er von da zurück, und nun
wurde er, nachdem Gajus und Lucius Cäsar gestorben waren, 4
von Augustus adoptiert und damit zum Nachfolger auf dem Kaiserthron
designiert; zugleich wurde ihm die tribunizische Gewalt auf weitere
fünf Jahre (sodann 9 auf Lebenszeit) übertragen. Sonach
fiel ihm, nachdem er 6-9 einen neuen, langen und schwierigen Krieg
in Pannonien und Dalmatien geführt und 11 die Rheingrenze
gegen die Deutschen geschützt hatte, 14 nach dem Tode des
Augustus die Herrschaft von selbst zu, welche er hierauf 23 Jahre
mit Klugheit und Energie und nicht ohne einen gewissen Gewinn
für die Provinzen, aber mit Härte und Mißgunst
gegen jedermann und mit Grausamkeit geführt hat. In den ersten
Jahren seiner Regierung wurde er zu einiger Zurückhaltung
durch die Rücksicht auf Germanicus, den Sohn seines Bruders
Drusus, bestimmt, den er auf Anordnung des Augustus adoptiert, und
der durch zwei glänzende, obwohl erfolglose Feldzüge
gegen die Deutschen (15 und 16) seinen Argwohn erregt hatte.
Nachdem aber Germanicus 19 gestorben und die Regierung immer mehr
in die Hand des Sejanus, des Präfekten der Prätorianer,
gelangt war, der diese in einem festen Lager in Rom selbst
vereinigte, um durch sie einen Druck auf die Hauptstadt
auszuüben, nahmen die Verfolgungen der angesehensten
Männer durch die Delatoren, d. h. die Angeber, welche im
Dienste des T. alle, die dessen Verdacht erweckten, anklagten und
ihre Verurteilung im knechtisch gesinnten Senat bewirkten, immer
mehr zu. Zwar wurde 31 Sejanus gestürzt, der, um sich selbst
den Weg zur Herrschaft zu bahnen, schon 23 Drusus, den Sohn des T.,
durch seine Gemahlin hatte vergiften lassen, der 26 den T. bewogen
hatte, sich nach Capreä (Capri) zurückzuziehen, und der
die Familie des Germanicus zum großen Teil zu beseitigen
gewußt hatte. Indessen diente dies nur dazu, die Zahl der
Hinrichtungen zu vermehren, indem alle diejenigen, welche der
Mitschuld an den Plänen des Sejanus geziehen wurden, der
Grausamkeit des T. zum Opfer fielen, bis endlich T. 16. März
37, als er schon im Todeskampf lag, von Macro, dem Nachfolger des
Sejanus in der Gunst des Kaisers, in den Kissen seines Lagers
erstickt wurde. Vgl. Stahr, Tiberius' Leben, Regierung, Charakter
(2. Aufl., Berl. 1873); L. Freytag, T. u. Tacitus (das. 1870),
welche beide den T. durch Herabsetzung des Tacitus zu rechtfertigen
gesucht haben; dagegen Pasch, Zur Kritik der Geschichte des Kaisers
T. (Altenb. 1866), und Beulé, T. und das Haus des Augustus
(deutsch von Döhler, Halle 1873); Deppe, Kriegszüge des
T. in Deutschland (Bielef. 1887).
689
Tibesti - Tibet.
Tibesti (auch Tu), das Land der Tibbu Reschade in der
östlichen Sahara, zwischen 14-19° östl. L. v. Gr. und
19-23° nördl. Br. gelegen, wurde zuerst 1868-69 von
Nachtigal erforscht. Der bewohnte Teil des Landes konzentriert sich
um das Zentralgebirge, eine von NW. nach SO. streichende Kette,
welche im Tarso, einem 1000 m hohen Dolomitrücken, ihren
Hauptstock hat. Die höchsten Kegel desselben sind: der Tusside
(2500 m), der Timi, Boto und Bodo. Am östlichen Fuß des
Tarso befindet sich eine heiße Quelle. An den Seiten dieses
Hauptgebirges, in den nach W. hinabgehenden Thälern sowie in
dem östlich gelegenen Thal Bardai, haust die elende und arme
Bevölkerung, deren Hauptsubsistenzmittel ihre Kamel-, Schaf-
und Ziegenherden sind. Datteln wachsen in einigen Schluchten, Durra
und Duchn wird an wenigen Orten gebaut. Auch die Jagd ist
dürftig. Hauptorte sind Tao und Bardai. Vgl. Nachtigal, Sahara
und Sudân, Bd. 1 (Berl. 1879).
Tibet, Zeug, s. Merino.
Tibet (Thibet, Tübet), Nebenland Chinas zwischen dem
Hauptkamm des Himalaja im S. und W., dem Kuenlün und seinen
östlichen Fortsetzungen im N. und den Provinzen Kansu und
Setschuan im O. (s. die Karten "Zentralasien" und "China"),
umfaßt 1,687,898 qkm (30,654 QM.), bildet ein großes
Plateau, das, im äußersten Westen schmal, nach Osten
ständig an Breite zunimmt, bis es im Meridian von Lhassa
zwölf Breitengrade bedeckt, worauf es mit schwach
konvergierendem Nord- und Südrand nach Osten geht. Den
Süden dieses ungeheuern Gebiets nimmt das Längsthal des
Indus und Sanpo ein als deutliche Grenzmark zwischen dem Himalaja
und der tibetischen Massenerhebung. Die nördlich davon sich
ausbreitende Hochfläche, welche sich allmählich von
Westen, wo die gewaltige Bergmasse des Karakorum aufgelagert ist,
nach O. senkt, hat eine mittlere Höhe von über 4000 m.
Zwischen 80 und 90° östl. L. v. Gr. scheint die wellige
Hochsteppe vorzuherrschen; hier führt die Straße von
Kiria über den Kuenlün und ein 5000 m hohes Plateau zu
den Goldfeldern von Thok Dschalung, dem höchsten (4977 m)
ständig bewohnten Orte der Erde. Hier dehnt sich nun die
zentrale Hochsteppe aus, ein mit zahlreichen Salzlachen und
Salzseen bedecktes, abflußloses Gebiet, das für
zahlreiche Scharen wilder Esel, Antilopen und Moschusschafe immer
noch genügende Weideplätze zu bieten scheint. Auf weite
Strecken ist das Hochland unbewohnt, nur einige tiefer gelegene
Gründe gestatten den Anbau von Gerste. Den Südostteil
dieser Hochsteppe erfüllt ein seenreiches Gebiet; einer der
größten Seen ist der Tengri-Nor (4600 m ü. M.),
einige buddhistische Klöster an seinen Ufern sind die einzigen
Wohnstätten. Osttibet, das Gebiet nordöstlich von Lhassa
bis zum Huangho, ist gleichfalls ein von beträchtlichen
Bergmassen erfülltes Hochland, doch unterscheidet sich
dasselbe von dem westlichen Plateau dadurch, daß zahlreiche
nach O. und SO. strebende Flüsse (Omtschu oder Dibong,
Tsatschu, Salwen, Mekhong, Murussu oder Britschu, Jatschu, die
beiden letztern Quellflüsse des Jantsekiang) dasselbe
durchziehen. Über die Hauptrichtung der Gebirgszüge
Osttibets herrscht noch keine Klarheit; auf weite Strecken
gänzlich unbewohnt, beherbergt dies Gebiet einzelne wilde
Stämme, die kaum als Unterthanen der Chinesen anzusehen sind
und das Eindringen von S. her ähnlich erschweren wie die
tibetischen Beamten an den Grenzorten der Karawanenstraßen.
Von der großen Hochebene führen 5000 m hohe Pässe
über den bis 7500 m hohen, mit Schneegipfeln gekrönten
Plateaurand in das Thal des Brahmaputra, das bis 88° östl.
L. v. Gr. noch immer über 4000 m hoch und daher nur von
Nomaden bewohnbar ist. Hier erst beginnt die Möglichkeit des
Anbaues der Gerste. Im NO. liegt das mit zahllosen Seen besetzte
Quellgebiet des Huangho, des Sternenmeers, westlich davon erhebt
sich das Plateau zu 5400 m, dagegen senkt sich das von einem
abflußlosen Salzmorast bedeckte Becken von Tschaidam bis zu
2600 m; am äußersten Nordrand des tibetischen Plateaus
liegt 3300 m hoch das Becken des Kuku-Nor. Das Klima hat einen
durchaus kontinentalen Charakter: die Sommer sind kurz und
heiß, die Winter lang und streng (bis -25° C.). Die
Trockenheit ist ungemein, der atmosphärische Niederschlag,
fast nur Schneefall während des 5-7 Monate dauernden Winters,
beträgt kaum 25 mm. Die beim Auftauen des Schnees mit
Feuchtigkeit sich vollsaugenden Moosarten ersetzen zum Teil den
Mangel an Waldungen, indem sie das gänzliche Ausdörren
des Bodens verhindern. Die Pflanzenwelt ist, da die Hochebenen
größtenteils höchst unfruchtbar sind, eine sehr
dürftige. In den wärmern Thälern des Südwestens
wird Reis gebaut, ebenso Obst und Wein; der Getreidebau deckt den
Bedarf nicht. Die Steppenregionen liefern den feinsten Rhabarber.
Mannigfaltig ist das Tierreich. Der Yak kommt auf den Hochsteppen
in großen Herden wild vor, ebenso eine wilde Art Pferde
(Equus hemionus) und ein wildes Schaf (Ovis Argali) mit
großen Hörnern. Antilopen, Moschustiere, Wölfe,
Schakale und Füchse bevölkern die Steppen. Vögel
sind selten, Singvögel fehlen ganz. Die wertvollsten Haustiere
sind: Yak, Pferd (klein), Ziege (deren Vlies die kurze, zu den
feinsten Geweben taugliche, Paschm genannte Wolle liefert) und
Schaf. Hunde sind bei jedem Haus, aber verwahrlost und darum eine
Plage. Das Mineralreich liefert Gold, Edelsteine, Bergkristalle,
Salz, Borax u. a.
Die Bevölkerung, deren Zahl auf 6 Mill. veranschlagt wird,
gehört der großen Mehrzahl nach zu den eigentlichen
Tibetern (Bod-dschi), einem mongolischen Volk; daneben gibt es
eigentliche Mongolen (Sokpa), Türken (Hor) und Kirgisen im N.,
Mohammedaner, Chinesen und einige Inder in Lhassa und in den
Städten. Die Tibeter bewohnen außer T. noch Bhutan,
Sifan, das Quellgebiet des Huangho und die obern Stufenländer
der hinterindischen Flüsse sowie im W. Ladak und Baltistan.
Den Charakter des Tibeters kennzeichnen kriechende
Unterwürfigkeit gegen Mächtige, Übermut gegen
Niedrige. Die Ehe wird wenig heilig gehalten; unter den Reichen
herrscht Polygamie, unter dem Volk Vielmännerei bei
Brüdern. Gesellschaftlich gliedert sich die Bevölkerung
in Geistliche und Laien; leider übt die Welt- und
Klostergeistlichkeit beider Geschlechter keinen guten Einfluß
auf die Sittlichkeit des Volkes aus. Doch findet wissenschaftliche
Bildung in den zahlreichen Klöstern eine anerkennenswerte
Pflege, so daß in dieser Hinsicht die Tibeter unter den
Völkern Hochasiens einen hervorragenden Rang einnehmen. Die
Hauptbeschäftigung ist Viehzucht, dann Ackerbau; die
gewerbliche Thätigkeit beschränkt sich auf Anfertigung
von groben Wollgeweben, Filzen und Metallarbeiten für den
Hausbedarf. Der Handel mit Hochasien, Indien und China ist nicht
unbedeutend; doch bereitet die chinesische Regierung dem Verkehr
mit Indien aus politischem Mißtrauen die größten
Schwierigkeiten. Den Verkehr mit China wie den Binnenhandel haben
die Klöster und die Großen des Landes in
Händen.
690
Tibet (Geschichte).
Waren werden auf den Rücken von Schafen und Ziegen oder
auch von Menschen verschickt, Kunststraßen fehlen, und selbst
auf den Hauptverkehrswegen müssen Seilbrücken solidere
Anlagen ersetzen. Der Handel ist vorwiegend Tauschhandel. Neben
Thee statt Geld kursieren chinesische Kupfermünzen und
indische Rupien, oft zu Klumpen zusammengeschmolzen. Religion ist
der Buddhismus in der tibetischen Form. Begründer der
tibetischen Lehre ist der Mönch Tsonkhapa (1358-1419), der die
Menge des zu Wissenden und zu Verrichtenden in acht Gebote
zusammenfaßte und unter der Geistlichkeit eine feste
Hierarchie begründete, welche der Kitt der bestehenden
politischen Verhältnisse wurde. Obenan steht der Dalai Lama,
eine Verkörperung des Tschenresi (Padmapani), des
göttlichen Stellvertreters des Buddha auf Erden; seine
Residenz ist Lhassa (s. d.). Nächst diesem kommt der Pantschen
Rinpotsche, der zu Taschi Lhunpo (s. d.) residiert und dort in
einem kleinen Bezirk auch Hoheitsrechte ausübt. Beide
Hohepriester gehen aus Wahl hervor unter Einwirkung der
chinesischen Regierung (s. Dalai Lama). Unter dem Dalai Lama stehen
die Klosteräbte, unter diesen die Priester (Lama), alle dem
Cölibat unterworfen und in verschiedene Klassen zerfallend.
Die Klöster (Gonpa) sind weitläufige Gebäude
(zuweilen eine ganze, von Ringmauern umgebene Stadt) und reich mit
liegenden Gründen bedacht. Durchschnittlich wird aus jeder
Familie ein Sohn Lama. Die Mönche sind sehr ungebildet, dabei
von lockern Sitten. Die religiösen Gebräuche
unterstützen den Aberglauben; weltbekannt ist die Anwendung
des Gebetrades (s. Gebetmaschine). Die Hauptfamilienakte vollziehen
sich ohne Segen des Lama; aber bei jedem sonstigen Anlaß
braucht man den Lama als Geisterbeschwörer, der dabei
große Fertigkeit in höherer Gaukelei bekundet. Der
eigentliche Gottesdienst ist durch Gepränge, Musik und
Weihrauch geistverwirrend (vgl. E. Schlagintweit, Buddhism in T.,
Leipz. 1863). Eine zwischen 1861 und 1870 durch französische
Missionäre in Bonga, südöstlich von Lhassa,
eingerichtete Missionsstation wurde unterdrückt. Die
Verwaltung wird im Namen des Kaisers von China von Tibetern
geführt, welche ihre Bestallung von Peking aus erhalten. Der
Dalai Lama widmet sich nur der Erfüllung seiner
religiösen Pflichten; die Besorgung der
Regierungsgeschäfte liegt einem Stellvertreter ob, der aus den
Mönchen eines der Hauptklöster von Lhassa genommen wird.
Oberster Rat sind 4 Minister und 16 Dezernenten für Zivil,
Militärverwaltung, Gerichtswesen und Finanzen mit dem Sitz in
Lhassa; unter ihnen wirken Lokalbeamte. Chinesische Beamte
überwachen in Lhassa, Mandarinen in den Provinzen die
Geschäfte; sie stehen unter dem Gouverneur von Setschuan, wie
T. auch als Teil dieser Provinz gilt. Verwaltung wie Gerichtswesen
bieten jedoch durch Bestechlichkeit ein Zerrbild gesunden
Staatslebens. Für den Bestand der chinesischen
Oberherrlichkeit sorgt eine Mandschutruppe von etwa 4000 Mann, die
in zahlreichen kleinen Garnisonen untergebracht ist. Außerdem
wird im Inland eine Miliz ausgehoben. Der jetzige Dalai Lama, der
13. dieses Titels, wurde 1879 noch im Kindesalter unter
Feierlichkeiten, die drei Tage andauerten, eingesetzt.
[Geschichte.] Die tibetischen Chroniken leiten das älteste
dort regierende Königsgeschlecht von jenem der Sakja ab, dem
im 7. Jahrh. v. Chr. der Stifter des Buddhismus entsproß. Ein
Inder, Namens Buddasri, soll ein halbes Jahrhundert v. Chr. die
"kleinen Könige" in T. sich unterthan gemacht und sich zum
ersten Großkönig aufgeschwungen haben. Das Reich
hieß damals Jarlung ("oberes Thal") und umfaßte die
Uferländer des Jarlungflusses und seiner Zuflüsse. Innere
Kämpfe füllten die Zeit bis 607, da trat als großer
Eroberer Namri Srongtsan auf; Begründer des Buddhismus, einer
Litteratur und eines tibetischen Alphabets wurde Srongtsan Gampo
(629-698), der dem Reich dabei viele neue Provinzen erwarb und zu
dem chinesischen Kaiserhaus durch eine Heirat in freundschaftliche
Beziehungen trat; er verlegte die Residenz nach Lhassa. Unter Kri
Srongdetsan (744-786) stand T. auf der Höhe der Macht; bis an
den Mustag hin, unter Türken und Mongolen, verschaffte es sich
Achtung; die Himalajaländer wurden abhängig, mit China
über die Grenze ein Vertrag geschlossen und dieser in eine
Denksäule zu Lhassa eingeschnitten. Mächtig war noch
Ralpatschan (806-842); er ließ die heiligen Schriften in zwei
Sammlungen bringen (vgl. Tibetische Sprache), demütigte die
äußern Feinde, darunter die Chinesen. Seine
Gunstbezeigungen an den Klerus hatten eine innere Revolution zur
Folge, der König wurde ermordet, dem fremden Kultus Abbruch
gethan und hierdurch Osttibet in kleinere Reiche zersplittert wie
auch den Chinesen geöffnet. In diesen Wirren wurde von
Mitgliedern der Königsfamilie eine Seitendynastie in Westtibet
gegründet, Ladak (s. d.) und die angrenzenden Provinzen zum
Buddhismus bekehrt. 1206 und 1227 erhob Dschengis-Chan Tribut von
T.; im 14. Jahrh. trat Tsonkhapa (s. oben) als Reformator der Lehre
auf und wurde Begründer der Allgewalt der Priester. 1566
fielen die Ostmongolen in das nördliche T. ein; 1624 drang der
Jesuitenpater A. Andrada als der erste christliche Missionär
in das südöstliche T. vor. Eine große
Umwälzung brachte dann der 1640 auf Anforderung des damaligen
Dalai Lama erfolgte Zug der am Kuku-Nor lagernden Choschotmongolen.
Die dem Dalai Lama ungünstigen Großen wurden vernichtet
und dieser von den gläubigen Mongolen als Landesherr
eingesetzt. Den Mandschu bezeigte bereits 1642 der Dalai Lama
Verehrung, 1651 begab sich dieser nach Peking zum Besuch des
Kaisers. Die in Kaschgar, Jarkand und Ili herrschenden Dsungaren
wollten nicht dulden, daß China über die Wahl des Dalai
Lama verfüge; um T. von sich abhängigen machen, zogen sie
vor Lhassa, stürmten dies vergeblich, bekamen es aber 30. Nov.
1717 durch Verrat in die Hand und wüteten schrecklich. Der
chinesische Kaiser Kanghi wurde nun von den Tibetern um Hilfe
angegangen, seine Armee rückte in vier Haufen ein, schlug die
Dsungaren in mehreren Treffen und begründete so 1720 die
Oberherrschaft der heute noch herrschenden Mandschudynastie
über T. Ein 1727 ausgebrochener Aufstand wurde blutig
unterdrückt, und T. behielt nun Ruhe bis 1791, während
welcher Zeit jedoch China manchen unbequemen Würdenträger
mittels Gifts beseitigt haben soll. Die Weigerung der Tibeter, mit
Nepal einen billigen Münzvertrag abzuschließen,
führte zum Krieg mit diesem; China schickte Truppen und schlug
1791 das nepalische Heer. Zwischen 1837 und 1844 ließ der
ehrgeizige Regent (der weltliche Stellvertreter des Dalai Lama)
drei Dalai Lamas ermorden, wurde schließlich der That
überführt, verbannt und die chinesische Verwaltung noch
straffer angezogen. Insbesondere wurden die Großen des Landes
dadurch mißgestimmt, daß der Regent nunmehr nur aus der
Reihe der Priester genommen ward; die Priester hinwieder wurden
darum unbotmäßig, weil seit einigen Jahrzehnten infolge
der Aufstände der Taiping und
691
Tibetische Sprache und Litteratur - Tic.
Dunganen (s. d.) die herkömmlichen Gaben des chinesischen
Schatzes an die tibetischen Klöster ausblieben. Die Chinesen
vermögen ihre Herrschaft in T. nur mit Schwierigkeiten zu
behaupten. Zwischen Ende des 13. Jahrh. und 1870 erreichten
Europäer 14mal T., darunter 7mal Lhassa; von Indien aus ist
der Eintritt Europäern nicht gestattet, eine 1876 geplante
englische Gesandtschaft mußte unterbleiben. Im Streit um
Sikkim (1887/88) nahm T. gegen Britisch-Indien Partei, wurde aber
von Peking aus zur Nachgiebigkeit gezwungen. Große Verdienste
um die Erforschung von T. hat der Russe Prschewalskij (s. d.) ;
kein andrer europäischer Reisender hat in T. so große
Strecken durchmessen wie dieser Forscher. Vgl. Klaproth,
Description du Thibet (Par. 1831); E. Schlagintweit, Die
Könige von T. (Münch. 1866); Desgodins, Le Thibet (2.
Aufl., Par. 1885); Ganzenmüller, Tibet (Stuttg. 1878);
Kreitner, Im fernen Osten (Wien 1881); Prschewalskij, Reisen in T.
(deutsch, Jena 1884); Feer, Le T. (Par. 1886).
Tibetische Sprache und Litteratur. Die tibetische Sprache ist
eine der einsilbigen Sprachen Ostasiens und bietet die seltene
Erscheinung dar, daß sie sich, obschon bereits vor mehr als
1200 Jahren zur Schrift- und Litteratursprache erhoben, infolge
einer fast abgöttischen Verehrung des geschriebenen Wortes bis
heute unverändert erhalten hat, während Stil und
Redeformen Umgestaltungen erfuhren. Daher zeigen sich bei
Vergleichung von Schrift und Laut Abweichungen in ähnlichem
Maß wie im Französischen. Alphabet und Schrift (von
links nach rechts) sind dem Altindischen nachgebildet; doch wird
eine Druckschrift, eine Kursiv und eine Schnellschrift
unterschieden. Man schneidet die Buchstaben sehr schön in
Holzblöcke und druckt damit; bewegliche Lettern kennt man
nicht. Der Schrift sind zusammengesetzte Konsonanten eigen, wie im
Sanskrit. Das Tibetische hat 30 Konsonanten; Diphthonge fehlen.
Beim Schreiben trennt man jede Silbe durch einen Punkt. Die Flexion
wird meist durch Anfügung von Stammbildungsendungen (Affixen
und Suffixen) ersetzt. Es gibt zwei Modi: Infinitiv und Imperativ,
und drei Tempora: Präsens, Perfektum und Futurum. Das Verbum
ist durchweg unpersönlich, Aktivum und Passivum werden nicht
unterschieden; das handelnde Subjekt eines transitiven Zeitworts
steht im Instrumental ("durch mich ist gethan"). Die Syntax kennt
nur wenige feste Regeln, worunter obenan steht, daß der
einfache Satz mit dem Zeitwort schließt. Grammatiken des
Tibetischen verfaßten der Missionär Schröter (mit
Wörterbuch, Serampur 1826), der Ungar Csoma (ebenfalls mit
Wörterbuch, Kalk. 1834), J. F. Schmidt (Petersb. 1839-41),
Foucaux (Par. 1858) und besonders Jäschke ("Tibetan grammar",
2. Aufl., Lond. 1883), der auch ein "Tihetan-English dictionary"
(das. 1882) und ein großes "Handwörterbuch der
Tibetsprache" (Gnadau 1871-75) herausgab. Die tibetische Litteratur
besteht ihrem geistlichen Teil nach zumeist aus Übertragungen
aus dem Sanskrit, die mit wenigen tibetischen Originalwerken zwei
Hunderte von Bänden starke Sammlungen füllen, den
Kandschur (s. d.) und den neuern Tandschur. Die Profanlitteratur an
Erzählungen, Gedichten, Geschichtswerken ist nicht
unbedeutend, aber noch wenig bekannt. An der Herausgabe und
Übersetzung tibetischer Texte beteiligten sich der Ungar
Csoma, die Deutschen J. F. Schmidt, A. Schiefner, H. A.
Jäschke, E. Schlagintweit, die Franzosen Foucaux und Feer.
Vgl. Hodgson, Essays on the languages, literature and religion of
Nepal and Tibet (Lond. 1874).
Tibia (lat.), Schienbein; bei den Römern auch ein
Blasinstrument mit Tonlöchern (Pfeife, Flöte).
Tibialis (lat.), das Schienbein betreffend, z. B. arteria
t., Schienbeinschlagader, vena t., Schienbeinblutader, etc.
Tibullus, Albius, röm. Elegiker, um 55 v. Chr.
geboren aus ursprünglich wohlhabendem Rittergeschlecht, das in
den Bürgerkriegen einen großen Teil seiner Güter
verloren hatte. Er begleitete 31 seinen Gönner Messala auf dem
aquitanischen Feldzug. Eine Aufforderung desselben, ihn nach Asien
zu begleiten, lehnte er anfangs ab, da ihn die Liebe zu Delia
(eigentlich Plania), einer Libertine in Rom, zurückhielt; zwar
entschloß er sich noch zur Mitreise, doch mußte er,
unterwegs erkrankt, in Kerkyra zurückbleiben. Nach Rom
zurückgekehrt, fand er seine Geliebte mit einem reichern
Bewerber verheiratet, ein Schlag, den er nicht wieder verwunden zu
haben scheint. Er starb bald nach Vergil, 19 oder 18 v. Chr. Seine
Gedichte zeichnen sich durch Einfachheit, Gefühl und Anmut
aus; besonders schön und innig sind die auf Delia
bezüglichen im ersten der unter seinem Namen
überlieferten vier Bücher. Von diesen gehören ihm
indessen nur die beiden ersten vollständig an. Das ganze
dritte rührt von einem wenig talentvollen Nachahmer her, der
sich selbst mit dem Namen Lygdamus und als 43 v. Chr. geboren
bezeichnet, und von den Gedichten des vierten Buches haben eine
Anzahl poetische Liebesbriefe ein junges Mädchen, Namens
Sulpicia, zur Verfasserin. Neuere Ausgaben von Voß (Heidelb.
1811), Lachmann (Berl. 1829), Dissen (Götting. 1835, 2 Bde.),
Haupt (5. Aufl., Leipz. 1885), L. Müller (das. 1870),
Bährens (das. 1878), Hiller (das. 1885). Übersetzungen
lieferten Voß (Tübing. 1810), Teuffel (Stuttg. 1853 u.
1855), Binder (2. Aufl., Berl. 1885) , Eberz (Frankf. 1865).
Tibur, Ort in Latium, auf einem 250 m hohen Hügel am
südlichen Ufer des hier prächtige Wasserfälle
bildenden Anio (s. d.), östlich von Rom, war eine der
ältesten und mächtigsten Städte des Latinischen
Bundes, welche sich erst 335 den Römern endgültig
unterwarf, aber nominell unabhängig blieb. Die Umgebung war
reich an Landhäusern, unter denen namentlich die prachtvolle
Villa Hadriani, südwestlich der Stadt in der Ebene,
berühmt war. Jetzt Tivoli (s. d.). Vgl. L. Meyer, T. (Berl.
1883).
Tic (franz.), s. v. w. Zucken, Verziehen des Gesichts.
Man unterscheidet zwei Krankheiten dieses Namens, nämlich den
T. douloureux oder Fothergilischen Gesichtsschmerz (s.
Gesichtsschmerz) und den T. convulsif, welcher ein Krampf im
Bereich des Nervus facialis, ein mimischer Gesichtskrampf ist.
Diese letztere Krankheit kommt häufig bei hysterischen und mit
Eingeweidewürmern behasteten Personen vor. Auch
Gemütsbewegungen und der Nachahmungstrieb werden unter den
veranlassenden Ursachen des T. convulsif angeführt; in vielen
Fällen ist der T. convulsif ein leichter Grad von Veitstanz.
Fast immer werden nur die Muskeln Einer Gesichtshälfte vom
Krampf befallen. Die Kranken machen schnell wechselnde oder
andauernde Grimassen, runzeln die Stirn und die Augenbrauen,
blinzeln mit den Augenlidern und schließen das Auge, zucken
und schnüffeln mit den Nasenflügeln, verziehen den
Mundwinkel nach oben und unten etc. Diese Grimassen treten
plötzlich auf, verschwinden ebenso schnell und kehren nach
kurzen Zwischenpausen wieder. Gewöhnlich ruft eine durch den
Willen eingeleitete isolierte Bewegung des Gesichts krampfhafte
Zusammenziehungen in andern Muskeln hervor. Anfangs ist die kranke
Gesichts-
692
Tichatschek - Tidemand.
hälfte oft schmerzhaft, später verlieren sich die
Schmerzen. Die Behandlung ist selten erfolgreich, man empfiehlt den
konstanten galvanischen Strom, Bromkalium, kräftige
Ernährung; beim Vorhandensein von Würmern abtreibende
Mittel. - Figürlich bedeutet T. (Tick) s. v. w. Grille,
wunderliche Eigenheit.
Tichatschek, Joseph Aloys, Opernsänger (Tenor), geb.
11. Juli 1807 zu Weckelsdorf in Böhmen, ging 1827 nach Wien,
um dort Medizin zu studieren, widmete sich jedoch bald darauf der
Musik und fand 1830 ein Engagement als Chorist am
Kärntnerthor-Theater. Infolge eifriger Kunstgesangstudien
unter Leitung Cicimaras konnte er 1833 in kleinern Partien mit
Erfolg auftreten und das Jahr darauf einen Ruf als erster Tenor
nach Graz annehmen, wo er bis 1837 der Liebling des Publikums war.
Im genannten Jahr gastierte er in Dresden und fand hier solchen
Beifall, daß er alsbald an der Oper und zugleich als
Sänger beim Chor der katholischen Hofkirche angestellt wurde.
Hier erreichte er, angeregt namentlich durch den
künstlerischen Verkehr mit der Sängerin
Schröder-Devrient und Richard Wagner, nachdem dieser 1842 als
Kapellmeister an die Dresdener Oper berufen war, die höchste
Stufe der Meisterschaft. Besonders gaben ihm die Musikdramen des
letztgenannten Meisters: "Rienzi", "Tannhäuser" und
"Lohengrin", Gelegenheit, seine Fähigkeiten nicht nur als
Sänger, sondern auch als geistvoll reproduzierender
Künstler im hellsten Licht zu zeigen. So wirkte er, zahlreiche
Gastspiele in ganz Europa abgerechnet, ununterbrochen in Dresden
bis 1870, wo er in den Ruhestand trat. Er starb 18. Jan. 1886
daselbst.
Tichborne (spr. tittschborn), Sir Roger, engl. Baronet,
geb. 5. Jan. 1829, wanderte 1853 auf einem französischen
Schiff aus und kam wahrscheinlich bei dem Schiffbruch der Bella im
April 1854 um. Seine reiche Erbschaft wurde den Verwandten, die sie
in Besitz genommen hatten, 1866 von einem Fleischergesellen Orton
aus Neusüdwales streitig gemacht, der sich für den
verschollenen Sir Roger T. ausgab. Anerkannt von der Mutter Sir
Roger Tichbornes und unterstützt von Advokaten und Agitatoren,
gelang es dem Prätendenten, die öffentliche Meinung
für sich zu interessieren und einen Prozeß gegen die
Erben einzuleiten, für dessen Kosten seine Anhänger
allmählich 60,000 Pfd. Sterl. aufbrachten. Dieser
Prozeß, der das größte Aufsehen machte, zog sich
infolge der zahlreichen weit hergeholten Schutz- und
Belastungszeugen und der Winkelzüge der Advokaten lange hin,
Orton wurde 1872 zunächst für einen Betrüger
erklärt und 1874 wegen doppelten Meineids zu 14 Jahren
Zuchthaus verurteilt. Obwohl bei den Gerichtsverhandlungen der
T.-Prätendent sich als dem Verschollenen ganz unähnlich,
überdies roh und ungebildet erwies, wurde die Agitation
für ihn auch nach seiner Verurteilung noch einige Zeit sowohl
in T.-Meetings und Zeitungsartikeln als auch im Parlament
fortgesetzt. Als Orton aber 1884 aus dem Zuchthaus entlassen wurde,
war das Interesse für ihn erloschen. Vgl. "Der neue Pitaval",
neue Serie, Bd. 10 (Leipz. 1875).
Tichwin, Kreisstadt im russ. Gouvernement Nowgorod, an
der Tichwinka (Nebenfluß des Sjas), hat 4 Kirchen, 2
Klöster, ein weibliches Gymnasium und (1886) 6526 Einw., deren
Hauptbeschäftigung im Bau von Flußbarken besteht.
Tichwinsches Kanalsystem, in Rußland, verbindet die
Wolga mit der Newa. Die Fahrt geht: Newa, Ladogakanal, Sjaskanal,
Sjasfluß, Tichwinka, Eglinosee, Tichwinscher Kanal,
Fluß Woltschina, See Somino, Fluß Somina, Woschsee,
Fluß Gorün, Tschagadoschtscha, Mologa, Wolga. Die
Länge des Verbindungssystems erstreckt sich vom Fluß
Gorün bis zum Sjaskanal 334 km weit, die Länge der
eigentlichen Kanäle ist 16 km. Das Tichwinsche Kanalsystem
durchzieht die Gouvernements St. Petersburg, Nowgorod, Jaroslaw auf
einer Strecke von 903 km. Da wegen der vielen kleinen Seen und
Flüsse größere Barken nicht passieren können,
so werden mehr die wertvollern, aber leichtern Waren transportiert,
wie Kolonialwaren, Getreide nur teilweise. Der erste Gedanke zu
diesem System gehörte Peter I., doch wurde es erst 1811
eröffnet.
Ticino (spr. titscht-), Fluß und Kanton, s.
Tessin.
Ticinum, antike Stadt, s. Pavia, S. 793.
Ticinus, linker Nebenfluß des Padus im
cisalpinischen Gallien, der jetzige Tessin (s. d.). Am T.
Niederlage der Römer unter dem Konsul P. Scipio durch die
Karthager unter Hannibal 218 v. Chr.
Tick, s. Tic.
Ticket (engl.), Zettel, Stimmzettel, Billet, z. B.
Railway-T., Eisenbahnfahrkarte.
Ticknor, George, Literarhistoriker, geb. 1. Aug. 1791 zu
Boston, wurde im Dartmouth College erzogen und zum Juristen
vorgebildet, gab aber diesen Beruf auf, ging 1815 nach Europa, wo
er fünf Jahre lang in London, Göttingen, Paris, Genf,
Rom, Madrid und Lissabon verweilte, und wurde nach seiner
Rückkehr zum Professor der französischen und spanischen
Sprache sowie der Belles-Lettres an der Harvard-Universität
ernannt. Berühmt machte sich T. besonders durch sein noch
heute unübertroffenes Werk "The history of Spanish literature"
(New York 1849, 3 Bde.; 4. Aufl. 1872; deutsch von Julius, mit
Zusätzen von Wolf, neue Ausg., Leipz. 1867, 2 Bde.), worin die
Resultate 30jähriger Studien in trefflichen, durch Genauigkeit
und Fülle ausgezeichneten Darstellungen verwertet sind.
Außerdem schrieb T. eine Biographie Lafayettes und des
Historikers Prescott (1863, neue Ausg. 1882). Er starb 26. Jan.
1871. Vgl. "The life, letters and journals of George T." (neue
Ausg., Boston 1876).
Ticul, Ruinenstätte im mexikan. Staat Yucatan, 50 km
südlich von Merida, beim Dorf Tekoh, mit merkwürdigen
Grabstätten. Der gleichnamige Distrikt hat (1880) 23,648
Einw.
Tidemand, Adolf, norweg. Maler, geb. 14. Aug. 1814 zu
Mandal in Norwegen, bildete sich zuerst auf der Kunstakademie zu
Kopenhagen und seit 1837 in Düsseldorf bei Th. Hildebrandt und
Schadow. Nach Vollendung des Bildes: Gustav Wasa redet in der
Kirche zu Mora zu den Dalekarliern (1841) wandte er sich nach
München, später nach Italien und kehrte dann nach
Norwegen zurück. Hier malte er einige Bildnisse für die
Universität in Christiania und machte Volksstudien in den
Gebirgsthälern. Von 1846 bis 1848 lebte er wieder zu
Düsseldorf, dann abermals in Norwegen und seit 1849 in der
Regel im Winter in Düsseldorf, im Sommer in Norwegen. Er starb
25. Aug. 1876 in Christiania. Um T. scharte sich ein zahlreicher
Kreis skandinavischer Künstler. Er wußte freundliche
Anmut, elegischen Ernst, große Naturwahrheit und meisterhafte
Individualisierung mit Großartigkeit der Auffassung zu
vereinigen. Seine Farbe ist kräftig, frisch und von
großem Schmelz, seine Pinselführung breit und markig.
Frei von gesuchten Gegensätzen, machen seine Bilder den
einfachen Eindruck der Natur. Er leistete im Volks- und Sittenbild
sein Bestes, weniger in Altargemälden. Von seinen Werken sind
hervorzuheben: Katechisation
693
Tiden - Tieck.
des Küsters in einer Landkirche (1847); Nachmittagsandacht
der Haugianer (1848, Kunsthalle in Düsseldorf, wiederholt);
norwegisches Bauernleben, ein Cyklus von zehn Gemälden auf
Zink für den Speisesaal des Schlosses Oskarshall bei
Christiania (1851, als Prachtalbum in Lithographien von J. B.
Sonderland mit norwegischem und deutschem Text in Düsseldorf
erschienen); der verwundete Bärenjäger (1856, kaiserliche
Galerie in Wien); die Austeilung des heiligen Abendmahls in einer
Hütte (1860); der Zweikampf beim Hochzeitsmahl (1864); die
Brautkrone der Großmutter (1865, Galerie zu Karlsruhe); die
Fanatiker (1866); vier cyklische Bilder aus dem Volksleben für
die Kronprinzessin von Dänemark (1870); Abschied eines
Sterbenden von seiner Familie (1872); der Hochzeitszug, der einen
Waldbach durchschreitet (1873), und die drei großen
Altargemälde für norwegische Kirchen: die Taufe Christi
(1869), die Auferstehung Christi (1871) und Christus als
Einzelfigur (1874). T. hat auch häufig die Figuren auf
Gemälden norwegischer Landschaftsmaler (Gude,
Morten-Müller u. a.) gemalt. Vgl. L. Dietrichson, A. T. hans
Liv og hans Vaerker (Christiania 1878-79, 2 Bde.), und "A. T.
utvalgte Vaerker" (das. 1878, 24 Radierungen von L. H.
Fischer).
Tiden, s. v. w. Gezeiten, s. Ebbe und Flut.
Tidikelt, Oase in Marokko, s. Tuat.
Tidor, eine zu den nördlichen Molukken gehörige
Insel an der Westküste von Dschilolo, hat etwa 150 qkm im
Umfang, mehrere Vulkane, ist fruchtbar und gut angebaut und bildet
mit 8000 mohammed. Bewohnern den Mittelpunkt eines von den
Niederländern abhängigen Sultanats. Die gleichnamige
Hauptstadt ist die Residenz des Sultans.
Tidscharet (arab.), Handel; T.-Naziri, Handelsminister;
T.-Mehkemesi, Handelstribunal zur Schlichtung der Handelsprozesse
zwischen osmanischen und fremden Unterthanen.
Tieck, 1) Johann Ludwig, Dichter der romantischen Schule,
geb. 31. Mai 1773 zu Berlin als der Sohn eines Sellermeisters,
besuchte seit 1782 das damals unter Gedikes Leitung stehende
Friedrichswerdersche Gymnasium, wo er sich eng an Wackenroder
anschloß, studierte darauf in Halle, Göttingen und kurze
Zeit in Erlangen Geschichte, Philologie, alte und neue Litteratur
und kehrte 1794 nach Berlin zurück, wo er sofort als
Schriftsteller auftrat. Es erschienen seine ersten Erzählungen
und Romane: "Peter Lebrecht, eine Geschichte ohne
Abenteuerlichkeiten" (Berl. 1795, 2 Bde.), "William Lovell" (das.
1795-96, 3 Bde.) und "Abdallah" (das. 1796), worauf er, seinen
Übergang zur eigentlichen Romantik vollziehend, die bald
dramatisch-satirische, bald schlicht erzählende Bearbeitung
alter Volkssagen und Märchen unternahm und unter dem Titel:
"Volksmärchen von Peter Lebrecht" (das. 1797, 3 Bde.)
veröffentlichte. Nachdem er sich 1798 in Hamburg mit einer
Tochter des Predigers Alberti verheiratet hatte, verweilte er
1799-1800 in Jena, wo er zu den beiden Schlegel, Hardenberg
(Novalis), Brentano, Fichte und Schelling in freundschaftliche
Beziehungen trat, auch Goethe und Schiller kennen lernte, nahm 1801
mit Fr. v. Schlegel seinen Wohnsitz in Dresden und lebte seit 1803
teils in Berlin, teils auf dem gräflich Finkensteinschen Gut
Ziebingen bei Frankfurt a. O., wohin er auch nach der Rückkehr
von einer Reise nach Italien, die er 1805 zum Behuf des Studiums
der im Vatikan aufbewahrten altdeutschen Handschriften unternommen
hatte, zurückkehrte. Während dieses Zeitraums waren
erschienen: "Prinz Zerbino, oder die Reise nach dem guten
Geschmack" (Jena 1799), "Franz Sternbalds Wanderungen" (Berl.
1798), ein die altdeutsche Kunst verherrlichender Roman, an welchem
auch sein Freund Wackenroder Anteil hatte, und "Romantische
Dichtungen" (Jena 1799-1800, 2 Bde.) mit dem Trauerspiel "Leben und
Tod der heil. Genoveva" (separat, Berl. 1820) sowie das nach einem
alten Volksbuch gearbeitete Lustspiel "Kaiser Octavianus" (Iena
1804), Werke, worin sich der Autor rückhaltlos der
romantischen Richtung hingegeben hatte. Daneben
veröffentlichte er eine übertragung des "Don Quichotte"
von Cervantes (Berl. 1799-1804, 4 Bde.), die Übersetzung einer
Anzahl dem Shakespeare zugeschriebener, aber zweifelhafter
Stücke unter dem Titel: "Altenglisches Theater" (das. 1811, 2
Bde.), eine Bearbeitung des "Frauendienstes" von Ulrich von
Lichtenstein (Tübing. 1812) sowie eine Auswahl dramatischer
Stücke von Rosenplüt, Hans Sachs, Ayrer, Gryphius und
Lohenstein ("Deutsches Theater", Berl. 1817, 2 Bde.) und gab unter
dem Titel: "Phantasus" (das. 1812-17, 3 Bde.; 2. Ausg., das.
1844-45, 3 Bde.) eine Sammlung früherer Märchen und
Schauspiele, vermehrt mit neuen Erzählungen und dem
Märchenschauspiel "Fortunat", heraus, welche die deutsche
Lesewelt wieder lebhafter für T. interessierte. In der That
werden Märchen und Erzählungen wie "Der getreue Eckart",
"Die Elfen", "Der Pokal", "Der blonde Eckbert" etc. schon ihrer
formellen Vorzüge wegen ihren dichterischen Wert lange Zeit
behaupten. Das Kriegsjahr 1813 sah den Dichter in Prag; nach dem
Frieden unternahm er größere Reisen nach London und
Paris, hauptsächlich im Interesse eines großen
Hauptwerks Über Shakespeare, das er leider nie vollendete.
1818 verließ er dauernd seine ländliche Einsamkeit und
nahm seinen Wohnsitz in Dresden, wo nun die produktivste und
wirkungsreichste Periode seines Dichterlebens begann. Trotz des
Gegensatzes, in welchem sich Tiecks geistige Vornehmheit zur
Trivialität der Dresdener Belletristik befand, gelang es ihm,
hauptsächlich durch seine fast allabendlich stattfindenden
dramatischen Vorlesungen, einen Kreis um sich zu sammeln, der seine
Anschauungen von der Kunst als maßgebend anerkannte. Als
Dramaturg des Hoftheaters gewann er namentlich in den 20er Jahren
eine bedeutende Wirksamkeit, die ihm freilich durch Kabalen und
Lügen der trivialen Gegenpartei mannigfach verleidet wurde.
Als Dichter bediente er sich seit der Niederlassung in Dresden
beinahe ausschließlich der Form der Novelle. Die Gesamtheit
seiner "Novellen" (vollständige Sammlung, Berl. 1852-54, 12
Bde.) erwies sein großes Erzählertalent. In den
vollendetsten gab er wahrhafte Kunstwerke, in denen eine wirklich
dichterische Aufgabe mit rein poetischen Mitteln gelöst ward;
mit zahlreichen andern bahnte er hingegen jener bedenklichen
Gesprächsnovellistik den Weg, in welcher das epische Element
ganz zurücktritt und die Erzählung nur das Vehikel
für die Darlegung gewisser Meinungen und Bildungsresultate
wird. Zu den bedeutendsten der erstern Gattung zählen: "Die
Gemälde", "Die Reisenden", "Der Alte vom Berge", "Die
Gesellschaft auf dem Lande", "Die Verlobung", "Musikalische Leiden
und Freuden", "Des Lebens Überfluß" u. a. Unter den
historischen haben "Der griechische Kaiser", "Der Tod des Dichters"
und vor allen der großartig angelegte, leider unvollendete
"Aufruhr in den Cevennen" Anspruch auf bleibende Bedeutung. In
allen diesen Novellen entzückt nicht nur die einfache Anmut
der Darstellungsweise, sondern auch die Man-
694
Tiedemann - Tiedge.
nigfaltigkeit lebendiger und typischer Charaktere und der
Tiefsinn der poetischen Idee. Auch in den prosaischern Novellen
zeigte T. seine Meisterschaft des Vortrags. Sein letztes
größeres Werk: "Vittoria Accorombona" (Bresl. 1840),
entstand unter den Einwirkungen der neufranzösischen Romantik
und hinterließ trotz der aufgewendeten Farbenpracht einen
überwiegend peinlichen Eindruck. Auch Tiecks sonstige
litterarische Thätigkeit war während der Dresdener
Periode eine sehr ausgebreitete. 1826 übernahm er die
Herausgabe und Vollendung der von A. W. v. Schlegel begonnenen
Shakespeare-Übertragung und gab die hinterlassenen Schriften
Heinrichs v. Kleist (Berl. 1821) heraus, denen die "Gesammelten
Werke" desselben Dichters (das. 1826, 3 Bde.) folgten. "Die Insel
Felsenburg" (Bresl. 1827), "Lenz' gesammelte Schriften" (Berl.
1828) sowie "Shakespeares Vorschule" (Leipz. 1823-29, 2 Bde.) etc.
wurden mit Vorreden und Abhandlungen von bleibendem Wert begleitet.
Aus seiner dramaturgisch-kritischen Thätigkeit erwuchsen die
"Dramaturgischen Blätter (Bresl. 1826, 2 Bde.; Bd. 3, Leipz.
1852; vollständige Ausg., Leipz. 1852, 2 Tle.). 1841 wurde T.
vom König Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin berufen, wo er,
durch Kränklichkeit zumeist an das Haus gefesselt und durch
den Tod fast aller nähern Angehörigen sehr vereinsamt,
ein zwar ehrenvolles und sorgenfreies, aber im ganzen sehr
resigniertes Alter verlebte und 28. April 1853 starb. Seine
"Kritischen Schriften" erschienen gesammelt in 2 Bänden
(Leipz. 1848), "Nachgelassene Schriften" in 2 Bänden (das.
1855). "Ausgewählte Werke" Tiecks gab Welti heraus (Stuttg.
1886-88, 8 Bde.). Tiecks vielfach widerspruchsvolle Natur kann
nicht bloß aus der Zwiespältigkeit seiner Bildung, in
welcher sich der Rationalismus des 18. Jahrh. und die mystische
Romantik fortwährend bekämpften, erklärt werden,
sondern ist zumeist auch noch auf das Improvisatorische, vom
zufälligen Augenblick Abhängende seiner Begabung
zurückzuführen, das ihn selten zu reiner Ausgestaltung
seiner geist- und lebensvollen Entwürfe gelangen ließ.
Vgl. R. Köpke, Ludwig T. Erinnerungen aus dem Leben etc.
(Leipz. 1855, 2 Bde.); H. v. Friesen, Ludwig T., Erinnerungen (Wien
1871, 2 Bde.); K. v. Holtei, Briefe an Ludwig T. (Bresl. 1864, 4
Bde.); Ad. Stern, Ludwig T. in Dresden (in "Zur Litteratur der
Gegenwart", Leipz. 1879). - Tiecks Schwester Sophie T., geb. 1775
zu Berlin, verheiratete sich 1799 mit Aug. Ferd. Bernhardi (s. d.),
von dem sie 1805 wieder geschieden wurde, lebte dann in
Süddeutschland und mit ihren Brüdern, dem Dichter und dem
Bildhauer, längere Zeit in Rom, später in Wien,
München und Dresden. Im J. 1810 schloß sie eine zweite
Ehe mit einem Esthländer, v. Knorring, dem sie in dessen
Heimat folgte, und starb dort 1836. Sie hat außer Gedichten,
z. B. dem Epos "Flore und Blanchefleur" (hrsg. von A. W. Schlegel,
Berl. 1822), auch Schauspiele und einige Romane, wie "Evremont"
(hrsg. von Ludw. T., das. 1836), geschrieben.
2) Christian Friedrich, Bildhauer, Bruder des vorigen, geb. 14.
Aug. 1776 zu Berlin, hatte hier Schadow, dann in Paris David zum
Lehrer und ward seit 1801 zu Weimar bei der Ausschmückung des
Neuen Schlosses beschäftigt. Unter anderm modellierte er
Goethes Büste, die er später auch in Marmor für die
Walhalla ausführte. 1805 ging er mit seinem Bruder Ludwig nach
Italien, wo er mehrere treffliche Büsten, wie die Alexanders
v. Humboldt, und ein Reliefporträt Neckers für dessen
Grabmal in Coppet ausführte. Von 1809 bis 1812 hielt er sich
in der Schweiz und in München auf, wo er die Büsten des
damaligen Kronprinzen Ludwig, Schellings, F. Jacobis und L. Tiecks
fertigte. In Carrara, wo er dann längere Zeit verweilte,
entstanden die Büsten Lessings, Erasmus' von Rotterdam, Hugo
Grotius', Herders, Bürgers, Wallensteins u. a. 1820 wurde er
Profefsor der Akademie zu Berlin, wo er die 1829 in Erz gegossenen
Gruppen von Rossebändigern für den Überbau des
königlichen Museums, Niobe und ihre Kinder, ein Relief lm
Giebelfeld des Schauspielhauses, Ifflands Statue im Schauspielhaus,
das Standbild König Friedrich Wilhelms II. für Neuruppin,
eine Statue Schinkels für die Vorhalle des Museums und
zahlreiche durch sorgfältige Durchführung ausgezeichnete
Büsten schuf (darunter eine dritte Goethebüste 1820
gleichzeitig mit Rauch). T. starb 14. Mai 1851 in Berlin.
Tiedemann, 1) Dietrich, philosoph. Schriftsteller, geb. 3. April
1748 zu Bremervörde bei Bremen, 1776 Lehrer am Carolinum zu
Kassel, 1786 Professor der Philosophie an der Universität
Marburg, wo er 24. Sept. 1803 starb. Er war ein Gegner der
Kantschen Philosophie und schrieb unter anderm ein "System der
stoischen Philosophie" (Leipz. 1776, 3 Bde.) und in skeptischer
Haltung eine Geschichte der Philosophie unter dem Titel: "Geist der
spekulativen Philosophie" (Marb. 1791-96, 6 Bde,).
2) Friedrich, Mediziner, geb. 23. Aug. 1781 zu Kassel, studierte
seit 1798 in Marburg, Würzburg und Paris und ward 1806
Professor der Anatomie und Zoologie zu Landshut. Seine "Anatomie
des Fischherzens" (Landsh. 1809) und seine Untersuchung des Baues
der Strahltiere gehörten wie die "Anatomie der kopflosen
Mißgeburten" (das. 1813) und die "Anatomie der
Bildungsgeschichte des Gehirns" (Nürnb. 1816) zu den
bedeutendsten Leistungen jener Zeit. 1816 ging T. als Professor der
Anatomie und Physiologie nach Heidelberg, wo er eine anatomische
und zoologische Sammlung anlegte. 1849 zog er sich vom Lehramt
zurück und lebte dann in Frankfurt und München, wo er 22.
Jan. 1861 starb. Er schrieb noch. "Zoologie" (Landsh. u. Heidelb.
1808-14, 3 Bde.); "Die Verdauung nach Versuchen" (gemeinschaftlich
mit Gmelin, Heidelb. 1826-27, 2 Bde.); "Physiologie des Menschen"
(Bd. 1 und 3, Darmst. 1830 und 1836); "Das Hirn des Negers, mit dem
des Europäers verglichen" (Heidelb. 1837); "Von den
Duverneyschen und Bartholinischen Drüsen des Weibes" (das.
1840) ; "Von der Verengung und Schließung der Pulsadern in
Krankheiten" (das. 1843); "Von lebenden Würmern und Insekten
in den Geruchsorganen des Menschen" (Mannh. 1844); "Geschichte des
Tabaks" (Frankf. 1854). Mit Reinhold und Treviranus gab er die
"Zeitschrift für Physiologie" heraus, von welcher 5 Bände
(Darmst. 1825-32) erschienen sind. Vgl. Bischoff,
Gedächtnisrede (Münch. 1861).
Tiedge, Christoph August, Dichter, geb. 14. Dez. 1752 zu
Gardelegen, übernahm 1776 eine Hauslehrerstelle zu Ellrich in
der Grafschaft Hohenstein, trat von dort aus in Verkehr mit
Göckingk, Gleim, der Gräfin Elisa von der Recke u. a.,
ging 1782, von Gleim aufgefordert, nach Halberstadt, wo er 1792
Sekretär des Domherrn v. Stedern wurde und dessen Töchter
unterrichtete, und zog nach Stederns Tod mit dessen Familie in die
Nähe von Quedlinburg. Nach dem Tode der Frau v. Stedern lebte
er abwechselnd auf Reisen, in Halle und Berlin, begleitete
1805-1808 Frau von der Recke durch Deutschland, die Schweiz und
Italien und blieb dann bei derselben als Gesellschafter und zwar
seit 1819 in Dresden.
695
Tiedm. - Tiefenmessung von Gewässern.
Hier starb er 8. März 1841. Tiedges Dichterruf wurde
begründet durch das Lehrgedicht "Urania" (Halle 1800, 18.
Aufl. 1862), welches auf Kantscher und rationalistischer Grundlage
den Unsterblichkeitsglauben mit allem Feuer und aller
Trivialität einer durchaus wohlmeinenden, aber
mittelmäßigen Natur in leichtflüssigen Versen
vortrug und daher von der Masse der Halbgebildeten mit Enthusiasmus
aufgenommen ward. Unter seinen sonstigen Poesien haben die "Elegien
und vermischten Gedichte" (Halle 1803) am meisten Erfolg gehabt.
Tiedges "Werke" gab A. G. Eberhardt heraus (4. Aufl., Leipz. 1841,
10 Bde.). Vgl. Falkenstein, Tiedges Leben und poetischer
Nachlaß (Leipz. 1841, 4 Bde.); Eberhardt, Blicke in Tiedges
und Elisas Leben (Berl. 1844). Zu Ehren Tiedges erhielt eine der
Unterstützung von Dichtern und Künstlern gewidmete
Stiftung in Dresden den Namen Tiedge-Stiftung (1842 gegründet,
Vermögen Ende 1888: 657,000 Mk.).
Tiedm., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung
für Friedr. Tiedemann (s. d. 2).
Tiefbau, Gesamtbezeichnung für die Anlage und
Unterhaltung der Schleusen, Wasser- und Gasleitungen, Straßen
etc. im Gegensatz zum Hochbau (s.d.); im Bergbau Abbau mit Hilfe
künstlicher Wasserhaltung; sonst jeder unter dem Stollen
getriebene oder ein in der größten Tiefe unter dem
Stollen stehender Bau.
Tiefbohrungen, von der preußischen Regierung seit
etwa 25 Jahren unternommene Erdbohrungen zu wissenschaftlichen und
technischen Zwecken. Die T. haben zur Kenntnis derjenigen
geologischen Bildungen geführt, welche die Grundlage der zu
Tage tretenden oder durch Straßen- und Bergbau erschlossenen
Formationen bilden, sie haben über das Vorkommen und die
Verbreitung abbauwürdiger Mineralien Aufschluß gegeben
und manche Thatsachen, welche für die Physik der Erde von
Wichtigkeit sind, geliefert. Während noch vor 30 Jahren das
548 m tiefe Bohrloch von Grenelle bei Paris und das 671 m tiefe bei
Luxemburg niedergebrachte als die tiefsten galten, wurden dieselben
bald übertroffen durch das Bohrloch von Neusalzwerk
(Öynhausen), welches 696 m in das Erdinnere drang. Die vom
preußischen Bergfiskus ausgeführten Bohrlöcher
erreichten aber doppelt so große Tiefen, und das tiefste
Bohrloch der Erde wurde bei Schladebach (Provinz Sachsen, unweit
Kötschau) niedergestoßen. Es erreichte in 6 Jahren eine
Tiefe von 1748,4 m, beginnt mit 280 mm Weite in Dammerde und endet
mit 31 mm Weite im Oberdevon. Die Kosten für diese Bohrarbeit
beziffern sich auf 210,000 Mk., wovon allein 100,000 Mk. auf
verbrauchte Diamanten zu rechnen sind.
Tiefenfurth, Dorf im preuß. Regierungsbezirk
Liegnitz, Kreis Bunzlau, hat eine evang. Kirche, Fabrikation von
Schlesischem Porzellan und Steingut und (1885) 882 Einw.
Tiefenhafen, Hafenort, s. Dagö.
Tiefenmessung von Gewässern (Bathometrie) wird bei
geringer Tiefe mit dem Peilstab, bei größerer mit dem
Tiefenlot ausgeführt. Während die Alten sich hinsichtlich
des Meers mit Schätzungen von dessen Tiefe begnügten und
annahmen, daß die größten Meerestiefen den
höchsten Erhebungen der Gebirge entsprechen, fing man im
Mittelalter an, geringere Tiefen mit der Sonde oder dem Senkblei zu
messen. Die Lotleinen der Entdecker sollen nur 400 m Länge
besessen haben, 1818 aber erreichte John Roß in der
Baffinsbai mit einer Tiefseezange von 6 Ztr. Gewicht den
Meeresboden bei 1970 m. In eine neue Phase trat die T. mit den
unterseeischen Telegraphenkabeln, für welche es von
großem praktischen Interesse war, die Tiefen der betreffenden
Meeresteile kennen zu lernen. Die großartigsten
Unternehmungen dieser Art wurden von der nordamerikanischen,
besonders aber von der englischen Marine (Lightning-, Porcupine-,
Challenger-Expedition) ins Werk gesetzt, denen sich die deutsche
Gazelle und die nordamerikanische Tuscarora anschlossen. Die
Messung größerer Tiefen erfordert besondere Apparate.
Für 200-300 m genügt ein gewöhnliches Handlot, bis
etwa 2000 m ein Lot von 70-80 kg, welches mittels eines 25 mm
dicken Taues herabgelassen u. wieder aufgewunden wird. Für
größere Tiefen versagen diese Apparate, es ist nicht
mehr möglich, den Moment zu bestimmen, in welchem das Lot den
Meeresboden erreicht, und indem das Tau noch beständig
abrollt, gelangt man zu ganz abenteuerlichen Resultaten.
Größere Sicherheit gewährte zuerst Brookes
Bathometer (Fig.1), dessen sich Maury bediente. Dasselbe besteht
aus einer durchbohrten Kanonenkugel A, durch welche ein Stab B mit
zwei beweglichen Armen C an seinem obern Ende gesteckt ist. Die
Arme sind, wenn das Instrument hängt, nach oben gerichtet und
so mit der Leine a verbunden. An zwei Haken dieser Arme hängt
ein Band b, welches um die Kugel herumgeht und sie trägt.
Stößt der Stab nun auf den Meeresboden, so klappen die
beweglichen Arme zurück, und infolgedessen gleitet das Band
von den Haken, und die Kugel löst sich los. Der Stab
enthält eine kleine mit Talg ausgeschmierte Höhlung und
bringt daher beim Heraufziehen Grundproben mit. Zur Erlangung
größerer Grundproben besitzt der Bulldogapparat ein aus
zwei klaffenden und beim Aufziehen zusammenklappenden Halbkugeln
gebildetes Maul; bei Fitzgeralds Apparat schaufelt ein durch eine
Klappe sich verschließendes Kästchen die Bodenprobe auf,
und bei dem Hydrobathometer besitzt der Stab, auf welchen das
durchbohrte und später sich ablösende Gewicht geschoben
wird, vier durch Ventile sich öffnende und schließende
Kammern. Es sind auch Bathometer konstruiert worden, welche die
erreichte Tiefe selbstthätig registrieren, das von Massey
angegebene enthält z. B. ein Schaufelrad, welches beim Sinken
des Instruments in Rotation gerät und dabei auf ein
gewöhnliches Zählwerk wirkt. Eine sehr wesentliche
Verbesserung der Bathometer rührt von Thomson her,
nämlich die Anwendung eines dünnen Stahldrahts an Stelle
der bisher gebräuchlichen dickern Leine, welcher im Wasser
eine geringere Reibung erleidet und deshalb schneller und sicherer
fungiert. In neuerer Zeit hat man sich aber bemüht, die
Lotleine ganz zu vermeiden, was auch in vielen Fällen
vortrefflich gelungen ist. Rousset hat ein Bathometer konstruiert
(Fig. 2, S. 696), welches aus einer weiten, starkwandigen
Röhre besteht, in der sich ein Uhrwerk befindet zur
Registrierung der Anzahl Um-
Fig. 1. Brookes Bathometer.
696
Tieffenbrucker - Tiefsinn.
drehungen einer unter dem Apparat befindlichen
mehrflügeligen Schraube. Ein großer Schwimmer am obern
Ende des Rohrs treibt den Apparat im Wasser aufwärts, nachdem
durch Aufstoßen auf dem Grund ein Ballastgewicht abgefallen
und damit zugleich die vorher arretierte Schraube ausgelöst
ist. Durch die angegebene Anzahl der Umdrehungen dieser Schraube
beim Aufwärtssteigen wird dann der zurückgelegte Weg
bestimmt. Auf ganz andern Prinzipien beruhen das Siemenssche
Bathometer u. die Lote von Hopfgartner-Arzberger und von William
Thomson. Siemens ging von dem Satz aus, daß die gesamte
Gravitation der Erde, wie sie auf ihrer normalen Oberfläche
gemessen wird, aus den einzelnen Anziehungen aller ihrer Teile sich
zusammensetzt, und daß die Anziehung eines jeden gleichen
Volumens sich direkt mit der Dichtigkeit und umgekehrt wie das
Quadrat seiner Entfernung vom gemessenen Punkt ändert. Da nun
die Dichtigkeit des Seewassers von der des Gesteins bedeutend
abweicht, so folgt, daß eine bestimmte Tiefe des Meerwassers
einen merklichen Einfluß auf die Gesamtgravitation haben
wird, die an der Oberfläche des Meers gemessen wird. Das
hierauf gegründete Bathometer besteht im wesentlichen aus
einer senkrechten Quecksilbersäule in einer Stahlröhre,
die an beiden Enden tellerartig erweitert ist. Die untere
Erweiterung schließt mit einem wellig gebogenen dünnen
Stahlblech, und das Gewicht des Quecksilbers wird balanciert durch
die Elastizität von zwei Spiralfedern, welche auf den
Mittelpunkt des Bleches aufsetzen und so lang sind wie die
Quecksilbersäule. Das Instrument ist so aufgehängt,
daß es stets in vertikaler Lage verharrt. Die Ablesung
erfolgt durch einen elektrischen Kontakt, der zwischen dem Ende
einer Mikrometerschraube und dem Mittelpunkt der elastischen
Scheibe angebracht ist. Mit der Anziehungskraft ändert sich
das Gewicht des Quecksilbers, und die Schwankungen des Instruments
sind so bemessen, daß die durch einen Faden Tiefe
hervorgebrachte Verminderung der Schwere je einem Grade der Skala
entspricht. Vgl. Siemens, Der Bathometer (Berl. 1877). Das
Bathometer von Hopfgartner (Fig. 3) lehrt die Meerestiefe finden
durch den Druck, den die ganze über ihm ruhende
Wassersäule auf Metalldosen ausübt, welcher durch
Verschiebung eines Index registriert wird. In dem untern Bügel
eines starken Messingrahmens R befindet sich ein Schrauben-
gewinde, in welches ein Zapfen Z paßt, der in beliebiger
Stellung durch eine Kontermutter M festgeklemmt werden kann. Auf
diesem Zapfen befinden sich übereinander drei luftdicht
verlötete Metalldosen D, welche unter sich durch massive
Verbindungsstücke V vereinigt sind. Die oberste dieser Dosen
trägt einen doppelten Arm A, welcher sich oben ringförmig
um einen graduierten Cylinder C schließt, der an dem obern
Bügel des Rahmens R festsitzt und zwar so, daß die
Umgreifung des Arms um den Cylinder C auf allen Seiten etwas
Spielraum hat. An demselben Cylinder ist innerhalb des
fensterförmigen Armes A ein Nonius mit großer Reibung
verschiebbar, der vor Benutzung des Apparats auf Null einzustellen
ist. Darauf muß man den obern Teil des Armes A mit der obern
Kante des Nonius genau in Kontakt bringen. Wird nun der Apparat in
das Wasser versenkt, so übt dasselbe einen mit zunehmender
Tiefe wachsenden Druck auf die Dosen aus, diese werden
zusammengepreßt und um so mehr, je tiefer der Apparat
eintaucht; dadurch aber bewegen sie den Arm A und mit ihm den
Nonius nach unten, der an seiner tiefsten Stelle stehen bleibt,
wenn der Druck wieder nachläßt. Man kann also aus dem
zurückgelegten Weg des Nonius den belastenden Wasserdruck und
aus diesem die Höhe der Wassersäule ermitteln.
Selbstredend ist dieser Mechanismus durch Umgebung mit einem
starken Metallcylinder vor dem leichten Zerbrechen geschützt.
Bei Thomsons Apparat hat die Lotleine (Stahldraht) nur den Zweck,
das Bathometer ins Meer herabzulassen und wieder heraufzuholen;
gemessen wird mit der Leine nicht. Der Lotkörper, nahezu 1 m
lang und 11 kg schwer, ist ein unten offenes Metallrohr, in welches
ein Glasrohr eingeschoben ist, dessen innere Wandung mit
chromsaurem Silber belegt ist. Mit zunehmender Tiefe wird das
Seewasser mehr und mehr im Innern des Rohrs aussteigen und dadurch
die rote Farbe in eine gelblichweiße verwandeln. Aus der
Höhe dieses andersfarbigen Streifens kann man empirisch die
gelotete Tiefe bestimmen. Ist indes das Seewasser wenig salzig, wie
z. B. das der Ostsee, so wird die Bestimmung der Höhe dieses
Streifens unsicher, und man läßt dann durch den
erhöhten Wasserdruck eine Lösung von Eisenvitriol in die
mit rotem Blutlaugensalz an den Innenwänden bestrichene
Glasröhre eintreten, welche durch Bildung von Berliner Blau
anzeigt, wie weit die Lösung in der Röhre gestiegen ist.
Bei Tiefen von mehr als 500 m werden die Angaben dieses Apparats
sehr unsicher.
Tieffenbrucker (Duiffopruggar), Kaspar, der älteste
bekannte Verfertiger von Violinen, der daher für den Erfinder
der Violine angesehen wird, stammte aus Tirol und ließ sich
1510 in Bologna nieder. Nach Wasielewski existieren einige
unzweifelhaft echte Violinen von T. aus den Jahren 1511-19. Auf
Einladung Franz' I. von Frankreich ging T. 1515 nach Paris,
später siedelte er nach Lyon über, wo er gestorben
ist.
Tiefländer, s. Niederungen.
Tieflot, s. Senkblei.
Tiefsinn, im Gegensatz zum Witz (s. d.) als der
Fähigkeit, verborgene Ähnlichkeiten zwischen
Verschiedenem, und dem Scharfsinn (s. d.) als der Fähigkeit,
verborgene Verschiedenheiten des Ähnlichen zu entdecken, die
Gabe, die tiefliegende innere Zusammengehörigkeit scheinbar
weit voneinander getrennter und einander fern stehender Gedanken zu
ergründen, daher er vor allem der Vernunft, wie der Witz der
Phantasie und der Scharfsinn dem Verstand beigelegt wird. - Auch s.
v. w. Melancholie (s. d.).
[Fig. 2. Roussets Bathometer.]
[Fig. 3 Hopfgartners Bathometer.]
697
Tiefstes - Tier.
Tiefstes, der tiefste Teil eines Grubenbaues.
Tiefurt, Dorf im Großherzogtum Sachsen-Weimar, an
der Ilm, 3 km östlich von Weimar, hat eine evang. Kirche, ein
Lustschloß (einst Landsitz der Herzogin Anna Amalia) und 400
Einw.
Tiege, Hauptabfluß des großen Marienburger
Werders (zwischen Weichsel und Nogat), entsteht aus zwei
Flüssen mit Namen Schwente, die unterhalb Neuteich
zusammenfließen und schiffbar werden. Unterhalb Tiegenhof
geht der 7 km lange Weichsel-Haffkanal in die T. und in ihrem Bett
bis zur Mündung ins Frische Haff; schiffbare Strecke der T. 22
km.
Tiegel, s. Schmelztiegel.
Tiegeldruckpresse findet in der Buchdruckerei in neuerer Zeit
viel Verwendung zum Drucken von Accidenzarbeiten. Die
Konstruktion derselben beruht im Prinzip auf der der
Flachdruckmaschinen (s. Schnellpresse, S. 582).
Tiegelofen, s. Gießerei.
Tiegenhof, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Danzig,
Kreis Marienburg, am Eintritt des Weichselhaffkanals in die
schiffbare Tiege und an der Linie Simonsdorf-T. der
Preußischen Staatsbahn, 2 m ü. M., hat eine evangelische
und eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, eine Zuckerfabrik,
Bierbrauerei, Gerberei, Dampfmahl- und Sägemühle,
Holzhandel, Schiffahrt und (1885) 2749 Einw.
Tiel, Stadt in der niederländ. Provinz Gelderland,
an der Waal, in der sogen. Betuwe, an der Eisenbahn
Elst-Geldermalsen, Sitz eines Bezirksgerichts, hat 2 reformierte,
eine lutherische und eine römisch-kath. Kirche, ein Gymnasium,
eine höhere Bürgerschule, Fabrikation von Garancin und
Krapp, Essig etc., Schiffahrt, noch immer beträchtlichen
Handel und (1887) 9341 Einw. T. ist Sitz eines deutschen
Konsuls.
Tienschan, Gebirge, s. Thianschan.
Tientje, s. Wilhelmdor.
Tiëntsin, Traktatshafen in der chines. Provinz
Petschili, am Ausfluß des Großen Kanals in den Peiho,
45 km vom Meer gelegen, mit 950,000 Einw., gilt als Eingangsthor
Pekings von der Seeseite, ist Sitz verschiedener Konsuln (darunter
auch eines deutschen Berufskonsuls), Standort eines von
Europäern geschulten chinesischen Armeekorps und nicht
bloß für den westeuropäischen Handel (der Wert der
Ein- und Ausfuhr betrug 1887: 7,652,000 Taels), sondern
insbesondere auch für den russisch-chinesischen Landhandel der
wichtigste Stapelplatz. Die Zahl der im Hafen von T. 1888 ein- und
ausgegangenen Schiffe belief sich auf 1140 mit 864,098 Ton. Die
Handelsniederlassung der Europäer liegt am Nordufer des Peiho,
3 km von der chinesischen Stadt, und enthält großartige
Warenmagazine und schöne Wohnhäuser. Die an der
Peihomündung liegenden Takuforts wurden 23. Mai 1858 und
wieder 21. Aug. 1860 von den Franzosen und Engländern erobert,
worauf die Einnahme von Peking und 24. und 25. Okt. die
Bestätigung der Verträge von T. vom 26. und 27. Juni 1858
(s. China, S. 20) erfolgte. Seither wurden neue Forts errichtet,
ältere umgebaut, ein ausgedehntes befestigtes Lager angelegt,
Kruppsche Riesenkanonen aufgestellt, zwei Minensperren vorbereitet
und bei T. eine Torpedoflottille stationiert, so daß die
französische Flotte 1885 einen Angriff auf T. nicht wagte,
sich vielmehr auf die Blockierung der Peihomündung
beschränkte. Hier wurde auch 9. Juni 1885 der Friede
unterzeichnet, wodurch China seine Rechte auf Tongking an
Frankreich abtrat.
Tiepolo, Giovanni Battista, italien. Maler, geb. 5.
März 1692 (oder 1693) zu Venedig, Schüler von Greg.
Lazzarini, bildete sich dann nach Piazzetta, zumeist aber nach P.
Veronese, welcher vornehmlich das Vorbild für seine
zahlreichen Wand- und Deckengemälde in Fresko wurde. Nachdem
er in der Ausschmückung von Kirchen und Palästen in
Venedig und auf dem benachbarten Festland eine umfangreiche
Thätigkeit entfaltet, wurde er 1750 nach Würzburg
berufen, wo er während dreier Jahre das erzbischöfliche
Schloß (im Treppenhaus der Olymp und die vier Weltteile und
im Kaisersaal das Leben Friedrich Barbarossas) mit großen
Fresken schmückte. 1760 oder 1761 begab er sich an den
königlichen Hof von Spanien, und auch hier entwickelte er eine
äußerst fruchtbare Thätigkeit. Er starb 27.
März 1769 (oder 1770) in Madrid. T. war der letzte
Großmeister der venezianischen Malerei; seine Gewandtheit im
Malen war erstaunlich, die Farbe hell und glänzend, die Form
mannigfaltig, aber inkorrekt. Sein Vorbild P. Veronese erreichte er
an Tiefe und Durchbildung nicht. Von monumentalen Malereien
Tiepolos sind außer den genannten das Deckenbild in der
Kirche der Scalzi (Überführung der Santa Casa nach
Loreto), die Geschichte des Antonius und der Kleopatra im Palast
Labia, seine glänzendste Schöpfung, die Darstellungen aus
dem Alten Testament im erzbischöflichen Palast zu Udine und
die Fresken im Madrider Schloß die bedeutendsten. Seine
Ölgemälde zeichnen sich durch geistvolle Charakteristik
und ein prächtiges, fein zusammengestimmtes Kolorit aus. Nicht
minder geistvoll sind seine Radierungen. Auch seine Söhne
Lorenzo und Domenico (letzterer der Gehilfe des Vaters bei dessen
dekorativen Malereien) sind zumeist als geschickte Radierer
bekannt. Vgl. Molmenti, Il Carpaccio e il T. (Turin 1885).
Tier, ein meist frei und willkürlich beweglicher,
mit Empfindung begabter Organismus, der organischer Nahrung bedarf,
Sauerstoff einatmet, unter dem Einfluß der
Oxydationsvorgänge im Stoffwechsel Spannkräfte in
lebendige Kräfte umsetzt und Kohlensäure nebst
stickstoffhaltigen Zersetzungsprodukten ausscheidet. Während
zwischen leblosen und belebten Körpern (Organismen) eine
scharfe Grenze leicht zu ziehen ist, während ferner
höhere Tiere und Pflanzen (z. B. Löwe und Eichbaum) als
solche sofort erkannt werden, zeigen die einfachsten Organismen
Eigenschaften, die eine sichere Entscheidung über die
Zugehörigkeit unmöglich machen und daher auch wohl zur
Aufstellung eines Zwischenreichs der Protozoen (s. d.) oder
Protisten geführt haben. Alle irgendwie zweifelhafte Formen
sind hiernach ausgeschlossen, und mit dieser Einschränkung ist
die oben gegebene Erklärung des Wortes T. haltbar. Sie trifft
auch auf den Menschen zu, den als echtes T. zu bezeichnen erst die
letzten Jahrzehnte angefangen haben. Jedes für sich eine
abgeschlossene Einheit darstellende T. bezeichnet man als
Individuum, hat aber deren von verschiedener Ordnung. So sind bei
manchen niedern Tieren, z. B. den Korallen, eine Anzahl von
Einzeltieren (Personen genannt) zu einem sogen. Stock (Kolonie)
vereinigt, ähnlich wie an einem Baum die Zweige. Ein solcher
Tierstock ist ein Individuum höherer Ordnung. Bei jeder
"Person" unterscheidet man als niedere Individuen die Organe, d. h.
Körperteile, die zwar bis zu einem gewissen Grad
selbständig sind, aber bestimmte Leistungen für den
Gesamtorganismus zu verrichten haben. Die Organe finden sich in
einfacher oder mehrfacher Anzahl vor (z. B. jede "Person" hat nur
einen Darm, kann aber viele Beine besitzen) und
698
Tier (Physiologisches).
zeigen im letztern Fall eine bestimmte Anordnung, je nachdem das
T. strahlig, zweiseitig oder gegliedert ist. Im Körper der
höhern Tiere liegen nämlich die mehrfach vorhandenen
Organe in der Regel so, daß man nur durch Einen
Längsschnitt zwei einander gleiche Hälften, die rechte
und linke, gewinnen kann, während jeder andre
Längsschnitt (also z. B. der, welcher Bauch- und
Rückenteil sondern würde) ungleiche Teile ergibt. Ein
solches zweiseitiges (bilateralsymmetrisches) T. besitzt also nur
zwei gleiche (genauer: spiegelbildlich gleiche) Teile
(Gegenstücke, Antimeren); ein strahlig gebautes, wie die
meisten Quallen etc., hat dagegen einen solchen Bau, daß man
durch mehrere Schnittebenen je zwei gleiche Teile gewinnen kann,
und zerfällt so in mehrere Antimeren. Ist ein T. gegliedert
(segmentiert), so wiederholen sich die Organe in der queren, d. h.
der auf die Längsachse senkrechten, Richtung derart, daß
man durch bestimmte Querschnitte eine Anzahl völlig oder
annähernd gleicher Stücke (Folgestücke, Metameren)
erhalten kann. So besteht z. B. ein Bandwurm oder ein Regenwurm
sowohl aus zwei Antimeren als aus vielen unter sich gleichen
(homonomen) Metameren, ein Insekt ebenfalls aus zwei Antimeren,
aber nur wenigen, noch dazu ungleichen (heteronomen) Metameren;
letztere sind entweder auch äußerlich als Segmente
(Ringe, Glieder) erkennbar oder treten nur im innern Bau hervor.
Man unterscheidet dann meist, aber durchaus nicht immer, einen aus
verschmolzenen Segmenten bestehenden Kopf, eine Brust (Thorax,
deutlich gegliedert bei Insekten, äußerlich nicht
gegliedert bei Wirbeltieren) und einen Hinterleib (Abdomen; bei den
Spinnen z. B. während des Eilebens noch deutlich gegliedert,
später scheinbar einfach), faßt jedoch die genannten
drei Teile als Stamm im Gegensatz zu den Gliedmaßen (s.
unten) zusammen.
Individuen von noch niederer Ordnung als die Organe sind die
Zellen, d. h. die einfachsten Einheiten, aus denen der
Körper der Tiere (und auch der Pflanzen; die Protisten sind
fast alle einzellig) sich aufbaut. Jedes T., auch das
größte und komplizierteste, geht aus Einer Zelle, dem
Ei, hervor; letzteres teilt sich im Lauf der Entwickelung in eine
Anzahl Zellen, die eine Zeitlang noch gleichartig sein können,
bald jedoch ungleich werden (sich differenzieren) und in der
verschiedensten Weise zu Geweben zusammentreten (vgl. Zelle,
Gewebe, Keimblätter), aus denen wiederum die Organe sich
gestalten. Bis zu einem gewissen Grad führen die Zellen noch
ein selbständiges Leben, sind jedoch, je höher ein T.
steht, um so abhängiger von ihren Nachbarn; für den
Gesamtorganismus haben sie, obwohl in andrer Weise als die Organe,
gewisse Leistungen (Funktionen) zu verrichten. Man vergleicht so in
passender Weise das T. mit einem Staat, in welchem die einzelnen
Bürger durch die Zellen dargestellt sind, während als
Organe bestimmte Gruppen von Bürgern (Handwerker, Soldaten
etc.) bestimmte Funktionen auszuüben haben und ihre
verschiedene Verteilung in den Städten und auf dem Land
einigermaßen die Gewebebildung veranschaulicht. Die einzelnen
Organe und Funktionen beim T. lassen sich in zwei Hauptgruppen
vereinigen: sogen. pflanzliche (vegetative) und tierische
(animale); erstere beziehen sich auf Ernährung und Erhaltung
des Körpers, letztere auf Empfindung und Bewegung.
Bei vielen niedern Tieren besteht der ganze Körper nur
aus zwei Zellschichten, einer äußern, der
Hautschicht (Ektoderm), und einer innern, der Darmwandung
(Entoderm). Von letzterer wird ein zur Nahrungsaufnahme und
Verdauung dienender Hohlraum, der Magen oder die Darmhöhle,
umschlossen, welche durch nur eine Öffnung, den Mund, mit der
Außenwelt in Verbindung zu stehen braucht. Auch bei sehr
vielen höhern Tieren tritt während der Entwickelung im Ei
ein Stadium auf, in welchem der ganze Embryo nur diese einfache
Form besitzt (sogen. Gastrula). Zwischen den beiden genannten
Schichten bildet sich jedoch bei weitaus den meisten Tieren eine
dritte Schicht, das Zwischengewebe (Mesoderm), aus und liefert
sowohl die verschiedenen Formen des Skeletts (Bindegewebe, Knorpel,
Knochen) als auch die Muskeln u. a. m. Ein innerhalb dieser Schicht
auftretender Hohlraum, die Leibeshöhle, veranlaßt,
daß ihr äußerer Teil als sogen. Hautfaserschicht
in nähere Beziehung zur Haut tritt, während der innere
als sogen. Darmfaserschicht sich dem Darm eng anlegt. Die
Leibeshöhle ist mit Flüssigkeit (Blut) gefüllt und
enthält meist besondere, darin schwimmende Zellen, die
Blutkörperchen, welche gleichfalls vom Mesoderm abstammen. Die
einzelnen Organe nun verteilen sich auf die genannten Schichten in
folgender Weise.
Die vegetativen Organe umfassen im weitesten Sinn die
Vorgänge der Ernährung; die durch den Mund
aufgenommenen Nahrungsstoffe werden verdaut, und die durch diesen
Prozeß gebildeten löslichen Stoffe werden zu einer
ernährenden, den Körper durchdringenden Flüssigkeit,
welche in mehr oder minder bestimmten Bahnen zu sämtlichen
Organen gelangt und an dieselben Bestandteile abgibt, aber auch von
ihnen die unbrauchbar gewordenen Zersetzungsstoffe aufnimmt und bis
zu ihrer Unschädlichmachung (s. unten) weiterführt. Die
ungelösten Nahrungsbestandteile werden durch den Mund oder
meist durch eine besondere Öffnung, den After,
ausgestoßen. Gewöhnlich zerfällt dann die
Verdauungshöhle, auch Darmkanal genannt, in drei Abschnitte:
Vorder- oder Munddarm (Speiseröhre), Mittel- oder Magendarm
(Magen) und Hinter- oder Afterdarm (Darm im engern Sinn). Von
diesen Abschnitten gehört nur der mittlere zum Entoderm,
während Vorder - und Hinterdarm Einstülpungen der
Hautschicht sind und bei manchen Tieren sich auch der
äußern Haut gleich verhalten. Bei einigen niedern Tieren
hat jedoch der Magen keine selbständige Wandung, vielmehr wird
die Nahrung aus der Speiseröhre in das weiche
Körperinnere gedrückt und dort verdaut; bei den
höhern Tieren gestaltet sich dagegen der Verdauungsapparat
sehr kompliziert, indem Kauorgane (Kiefer mit Zähnen oder als
Abschnitt der Speiseröhre ein besonderer Kaumagen) sowie
Drüsen zur Absonderung verdauender Säfte
(Speicheldrüsen, Leber) entstehen. Je nachdem übrigens
die Nahrung rein pflanzlicher oder rein tierischer oder gemischter
Natur ist, unterscheidet man Herbivoren (Phytophagen), Karnivoren
(Zoophagen) und Omnivoren (Pantophagen). Die von der Darmwandung
aus den Speisen aufgenommene Ernährungsflüssigkeit tritt
nur durch sie hindurch in die Leibeshöhle und erfüllt als
Blut (oft schon mit zelligen Elementen, den Blutkörperchen)
die Lücken und Gänge zwischen den verschiedenen Organen
und Geweben. Auf einer weitern Stufe umkleiden sich Abschnitte der
Blutbahn mit einer besondern Muskelwandung und unterhalten als
pulsierende Herzen eine rhythmische und regelmäßige
Strömung des Bluts. Von dem Herzen, als dem Zentralorgan des
Blutkreislaufs, aus entwickeln sich dann bestimmt umgrenzte
Kanäle zu Blutgefäßen, welche bei den Wirbellosen
meist noch mit wandungslosen Lücken wech-
699
Tier (Entwickelungsgeschichtliches, geographische
Verbreitung).
seln, bei den Wirbeltieren aber als abgeschlossenes
Gefäßsystem die Leibesräume durchsetzen. In diesem
System unterscheidet man vom Herzen abführende Arterien und
zum Herzen zurückführende Venen, zu welchen noch das
System von Chylus- oder Lymphgefäßen hinzutritt. Alle
genannten Organe gehören dem Mesoderm an. Die Atmung, welche
im wesentlichen in der Aufnahme von Sauerstoff und der Abgabe von
Kohlensäure durch das Blut besteht, wird im einfachsten Fall
durch die gesamte äußere Körperbedeckung
ausgeführt; auch können innere Flächen, besonders
diejenige des Darmkanals, bei diesem Gasaustausch beteiligt sein.
Weiterhin aber treten, und zwar als Teile der Haut- oder der
Darmschicht, besondere Atmungsorgane auf, bei der Wasseratmung
äußere, möglichst flächenhaft entwickelte
Anhänge (Kiemen), bei der Luftatmung Lungen oder
Luftröhren (Tracheen). Die Intensität der Atmung steht in
geradem Verhältnis zur Energie des Stoffwechsels. Tiere mit
geringer Sauerstoffaufnahme (Kiemenatmung) verbrennen nur geringe
Mengen organischer Substanz, setzen nur ein kleines Quantum von
Spannkräften in lebendige Kraft um und produzieren wenig
Wärme, so daß die Temperatur ihres Körpers von der
der Umgebung abhängig bleibt. Dies gilt auch für kleine
luftatmende Tiere, welche, wie Insekten, eine bedeutende
wärmeausstrahlende Oberfläche besitzen (Kaltblüter).
Die höhern Tiere mit energischem Stoffwechsel produzieren
dagegen viel Wärme, sind durch ihre Körperbedeckung vor
rascher Ausstrahlung derselben geschützt und erhalten sich
einen Teil der erzeugten Wärme unabhängig von der
Temperatur des umgebenden Mediums als konstante Eigenwärme
(Warmblüter). Die von den Atmungsorganen ausgestoßene
Kohlensäure zählt zu den Auswurfstoffen des Organismus;
andre derartige schädliche Stoffe werden durch besondere
Exkretionsorgane abgeschieden, von denen die Nieren u.
nierenähnlichen Bildungen die wichtigsten sind.
Unter den animalen Verrichtungen fällt zunächst am
meisten die Ortsbewegung in die Augen. Manche Protozoen gelangen
ohne besondere Organe lediglich durch Zusammenziehung und
Ausdehnung ihres ganzen Körpers von der Stelle, andre sind mit
Wimpern, d. h. feinen, hin und her schlagenden Härchen,
besetzt und bedienen sich nur dieser als Bewegungsorgane. Wo bei
den eigentlichen Tieren Muskeln, d. h. kontraktile Gewebsteile,
vorhanden sind, legen sich diese im einfachsten Fall dicht unter
die Haut und bilden mit ihr einen sogen. Hautmuskelschlauch, dessen
abwechselnde Verkürzung und Verlängerung den Körper
weiterschiebt. Wenn ferner vom Körper ungegliederte oder
gegliederte Anhänge (Gliedmaßen) ausgehen, so zweigen
sich besondere Muskeln zu diesen hin ab und befestigen sich
entweder an deren Haut oder an ein inneres, dem Mesoderm
angehöriges und mehr oder minder starres Skelett. Der
ursprünglich rings geschlossene Hautmuskelschlauch reduziert
sich alsdann zuweilen so sehr, daß er für die Bewegung
kaum noch in Betracht kommt. Die Gliedmaßen selber sind
zuweilen ungegliederte, meist jedoch gegliederte, d. h. in
bewegliche Abschnitte zerfallende, Anhänge des Kopfes oder
Rumpfes. Je nach Bau und Thätigkeit werden sie als Fühler
(Antennen), Kieser (Kauwerkzeuge), Geh- und Schwimmbeine sowie als
Flügel bezeichnet und sind in den einzelnen Tiergruppen
äußerst verschieden gebaut. Es kann zwar an jedem
Segment eines gegliederten Tiers auch ein Paar Gliedmaßen
vorhanden sein, doch ist das bei weitem nicht immer der Fall. Als
Empfindungsorgane sind Nervensystem und Sinneswerkzeuge anzusehen.
Ersteres ist entweder strahlig oder zweiseitig gebaut, geht aus der
Hautschicht hervor, liegt jedoch meist in seinem größern
Teil tiefer im Innern des Körpers an möglichst
geschützter Stelle und besteht aus einem oder mehreren
Zentralorganen (Ganglien, Nervenknoten) nebst den davon
ausstrahlenden Nerven. Gewöhnlich unterscheidet man ein im
Vorderende des Körpers befindliches, aus mehreren Ganglien
verschmolzenes sogen. Gehirn (wegen seiner Lage dicht über dem
Schlund auch Oberschlundganglion genannt) u. eine sich daran
knüpfende Ganglienkette, die je nach ihrem Verlauf als Bauch-
oder als Rückenmark bezeichnet wird. Die Eindrücke von
der Außenwelt werden von den Sinnesorganen (Auge, Ohr etc.)
aufgenommen und mittels der Nerven den Zentralorganen
zugeführt; andre Nerven stehen mit den Muskeln in Verbindung
und vermögen deren Zusammenziehung zu bewirken. Die
Fortpflanzung läßt sich überall auf die Absonderung
eines körperlichen Teils, welcher sich zu einem dem
elterlichen Körper ähnlichen Individuum umgestaltet,
zurückführen. Indessen ist die Art und Weise dieser
Neubildung ungemein verschieden (Teilung, Sprossung, Keimbildung
und geschlechtliche Fortpflanzung). Als Ausgangspunkt des sich
entwickelnden Organismus hat man die einfache Zelle zu betrachten;
der Inhalt derselben erleidet eine Reihe von Veränderungen,
deren Endresultat die Anlage und Ausbildung des Embryonalleibes
ist. Diese Vorgänge sind durch große Mannigfaltigkeit
ausgezeichnet und schließen nicht immer die Entwickelung des
Individuums ab, sondern liefern vielfach zunächst eine Larve,
welche erst durch Metamorphose dem geschlechtsreifen T.
ähnlich wird.
Die entwickelungsgeschichtlichen Arbeiten der neuern Zeit haben
die zuerst von Cuvier aufgestellte Lehre, nach der es im Tierreich
mehrere Hauptzweige oder Typen gebe, gewissermaßen allgemeine
"Baupläne", nach denen die zugehörigen Tiere modelliert
zu sein scheinen, im allgemeinen bestätigt. Während aber
Cuvier vier Typen (Wirbeltiere, Weichtiere, Gliedertiere,
Radiärtiere) annahm, ist die Zahl derselben jetzt auf sieben
oder noch mehr erhöht (s. Tierreich), auch hat man die
Vorstellung von der Isolierung eines jeden "Bauplans" aufgegeben,
da sich Verbindungsglieder und Verknüpfungen verschiedener
Typen nach mehrfachen Richtungen hin nachweisen ließen.
Überhaupt ist man auf Grund der darwinistischen Prinzipien
über die Inkonstanz der Art und ihre allmähliche
Abänderung zur Ansicht gekommen, daß die sämtlichen
Typen oder, wie sie jetzt richtiger heißen, Tierstämme
gemeinsamen Ursprungs sind.
[Geographische Verbreitung.] Wie hiernach das Tierreich als ein
sich allmählich entwickelndes erscheint, so liegt auch bei
einem überblick über die geographische Verbreitung der
Tiere auf der Erde derselbe Gedanke nahe. Danach ist die heutige
Verteilung der Tiere (auch des Menschen) auf der Oberfläche
unsers Planeten nicht von jeher dieselbe gewesen, sondern hat sich
durch das Zusammentreffen von vielen Umständen gerade so und
nicht anders gestaltet. Zu berücksichtigen sind, wenn man zu
einem Verständnis derselben gelangen will, die geologischen
Veränderungen (Senkungen und Hebungen von Land, so daß
Halbinseln zu Inseln werden oder Inseln mit dem Festland in
Verbindung treten etc.) und die paläontologischen Funde, um
aus der frühern Verteilung die jetzige erklären zu
können, und um in besonders klaren Fällen auch wohl
Rückschlüsse auf die
700
Tier - Tierdienst.
frühere Beschaffenheit der Erdrinde, auf die Anordnung von
Wasser und Land u. a. m. wagen zu dürfen. Die
gegenwärtige Verbreitung der Tiere bietet viele
Sonderbarkeiten dar, die nur durch Zurückführung auf
frühere Zustände erklärt werden; z. B.
läßt sich die Ähnlichkeit der Fauna (Tierwelt) auf
hohen Bergen mit derjenigen der nordischen Gegenden leicht durch
die auch sonst begründete Annahme der sogen. Eiszeit
begreiflich machen, deren über ganz Europa verbreitete
Vertreter in der wärmern Gegenwart nur noch an den genannten
kältern Orten zu finden, sonst aber ausgestorben sind. Im
übrigen sind noch folgende Thatsachen bemerkenswert. Von den
Wendekreisen zu den Polen hin nimmt im allgemeinen die Anzahl der
Arten ab, diejenige der Individuen zu. Die sämtlichen um den
Nordpol gelegenen Länder haben, was bei der
Gleichmäßigkeit der Lebensbedingungen nicht auffallen
kann, eine ziemlich eintönige Fauna , während weiter nach
dem Äquator zu die einzelnen Kontinente in Bezug hierauf meist
große Verschiedenheiten aufweisen. Doch gilt dies nur von
solchen Land- und Wassertieren, deren Mittel zur aktiven oder
passiven Wanderung in andere Gegenden gering sind; bei Seetieren
hingegen spielen meist Entfernungen keine Rolle, während
eingeschobene Länderstrecken leicht als Barrieren gegen die
Verbreitung wirken (vgl. Wanderung). Bei dem Versuch einer
Einteilung der Erdoberfläche nach dem allgemeinen Gepräge
ihrer Land- und Süßwasserbewohner gelangt man zu 6-8
Regionen, welche aber nur einen relativen Ausdruck für
natürliche große Verbreitungsbezirke geben, weil sie
sich nicht auf alle Tiergruppen in gleicherweise anwenden lassen.
Auch stößt man auf intermediäre Gebiete, welche
Eigenschaften der benachbarten Regionen mit einzelnen
Besonderheiten verbinden. Diese Regionen sind: 1) die
paläarktische Region: Europa, das gemäßigte Asien
und Nordafrika bis zum Atlas; 2) die nearktische Region:
Grönland und Nordamerika bis Nordmexiko; 3) die
äthiopische Region: Afrika südlich vom Atlas, Madagaskar
und die Maskarenen mit Südarabien; 4) die indische Region:
Indien südlich vom Himalaja bis Südchina und bis Borneo
und Java; 5) die australische Region: Celebes und Lombok, nach
Osten bis Australien, und die Südseeinseln; 6) die
neotropische Region: Südamerika, die Antillen und
Südmexiko. - Die vier ersten Regionen haben miteinander eine
weit größere Ähnlichkeit als irgend eine derselben
mit der von Australien oder Südamerika; auch hat man
Neuseeland als selbständige Region unterschieden und von der
palä- und nearktischen Region eine Zirkumpolarprovinz von
gleichem Rang abgegrenzt; einzelne Forscher unterscheiden auch noch
eine Mittelmeerprovinz. Bezüglich des relativen Reichtums der
einzelnen Regionen gab Wallace folgende Tabelle:
Region Wirbeltiere Säugetiere Vögel
Familie der Region eigentüml. Gattungen der Region
eigentüml. Prozentverhältnis Gattungen der Region
eigentüml. Prozentverhältnis
Familien Gattungen Gattungen
Paläarktische ... 136 3 100 35 35 174 57 33
Äthiopische ..... 174 22 140 90 64 294 179 60
Indische ........ 164 12 118 55 46 340 165 48
Australische .... 141 30 72 44 61 298 189 64
Neotropische .... 168 44 130 103 79 683 575 86
Nearktische .... 122 12 74 24 32 169 52 31
Jedoch sind wegen der Unsicherheit im Begriff der Gattung und
Familie die angegebenen Zahlen mit Vorsicht aufzunehmen. Die
Grenzen der einzelnen Regionen sind ausgedehnte Meere, hohe
Gebirgsketten oder große Sandwüsten; diese Grenzen haben
aber nicht tür alle Tiere gleichen Wert, denn für
einzelne Gruppen bilden sie absolute Hindernisse, während sie
andern immer noch Übergänge aus einem Gebiet in das andre
gestatten. Für ziemlich abgeschlossene Verbreitungsbezirke
braucht man den Ausdruck Verbreitungszentren
(Schöpfungszentren), indem man damit der Ansicht Raum gibt,
daß dort bestimmte Artengruppen sich ausgebildet und langsam
auch in andre Gebiete verbreitet haben. Vgl. Häckel, Generelle
Morphologie (Berl. 1866, 2 Bde.); Gegenbaur, Grundriß der
vergleichenden Anatomie (2. Aufl., Leipz. 1878); Rütimeyer,
Herkunft unsrer Tierwelt (Basel 1867); Schmarda, Geographische
Verbreitung der Tiere (Wien 1853); Wallace, The Geographical
distribution of animals (Lond. 1876, 2 Bde.; deutsch, Dresd. 1876);
Sclater, Über den gegenwärtigen Stand unsrer Kenntnisse
der geographischen Zoologie (deutsch, Erlang. 1876); Semper, Die
natürlichen Existenzbedingungen der Tiere (Leip. 1879, 2
Bde.); Marshall, Atlas der Tierverbreitung (Gotha 1888, 9
Karten).
Tier, in der Jägersprache der weibliche Hirsch.
Tierarzt, s. Veterinärwesen.
Tierbäder, animalische Bäder, s. Bad, S.
221.
Tierce (spr. tihrs oder ters), engl.
Flüssigkeitsmaß, = ½ Puncheon (s. d.).
Tierchemie, s. Chemie, S. 980.
Tierçon (franz., spr. tjerssóng),
Flüssigkeitsmaß auf Haïti, = 60 Gallons (s.
d.).
Tierdienst (Zoolatrie), die Verehrung bestimmter
nützlicher oder schädlicher Tiere bei niedriger und
höher stehenden Völkern. Man muß hierbei indessen
verschiedene Vorstellungskreise unterscheiden. Die niedersten
Naturvölker betrachten das Tier als ein mit ihnen auf gleicher
Stufe stehendes, ja oft als ein sie an Macht überragendes
Wesen, dem man Verehrung bezeigen müsse, wie denn von einigen
nordischen Völkern erzählt wird, daß sie den
Bären um Verzeihung gebeten hätten, wenn sie ihn
getötet hatten. In diesem Sinn konnten sie auch ein bestimmtes
Tier zu ihrem Schutzgeist erwählen (vgl. Fetischismus und
Totem), an ein Fortleben der Ahnen in Tierleibern und an eine
Verwandlung von Menschen in Tiere (Werwolfssage, s. d.) glauben. Im
besondern wurden wegen ihrer Kraft und Wildheit gefürchtete
Tiere, wie Löwe, Wolf und Bär, oder solche, die wegen
ihres unheimlichen Wesens gemieden werden, wie Molche, Eidechsen
(Drachen) und Schlangen (s. Schlangendienst), häufiger zum
Gegenstand einer abergläubischen Verehrung. Einem andern
Vorstellungskreis, obwohl er aus dem vorigen entstanden sein mag,
gehört der T. der alten Ägypter, Semiten und Inder an,
welche an göttliche Inkarnationen in Tiergestalt und an eine
Wanderung der menschlichen Seele durch Tierleiber glaubten (s.
Seelenwanderung). Diese Völker stellten ihre Gottheiten daher
in Tiergestalt oder wenigstens
701
Tiergarten - Tierische Wärme.
mit Tierköpfen versehen dar, pflegten die betreffenden
Tiere in Tempeln (z. B. die in den Küstenländern
wohnenden Semiten gewisse heilige Fische, die Ägypter Katzen,
Ibisse u. a., die Inder Schlangen, Krokodile und Affen),
erließen Gesetze zu ihrem Schutz, setzten sie nach ihrem Tod
feierlich einbalsamiert bei etc. Aus diesen
Inkarnationsvorstellungen gingen in den spätern
Religionssystemen die als Attribute der Gottheiten namentlich von
der bildenden Kunst verwerteten heiligen Tiere, wie der Adler des
Jupiter und Johannes, der Löwe der Rhea und des heil. Markus,
der Specht des Mars (Picus) etc., hervor, und ebenso
schließen sich daran gewisse Stammsagen (Drache der Chinesen,
Wölfin der Römer). Vgl. De Gubernatis, Die Tiere in der
indogermanischen Mythologie (deutsch, Leipz. 1874, 2 Bde.).
Tiergarten, s. Wildgärten und Zoologische
Gärten.
Tiergeographie, die Lehre von der geographischen
Verbreitung der Tiere, s. Tier, S. 699 f.
Tierheilkunde, s. Veterinärwesen.
Tierischer Magnetismus, s. Magnetische Kuren.
Tierische Wärme. Thermometrische Messungen haben
dargethan, daß zahlreiche Tiere eine ihnen eigne, nur
geringen Schwankungen ausgesetzte und von der Temperatur der
Außenwelt ganz unabhängige Körpertemperatur oder
Eigenwärme besitzen. Dieselbe ist im hohen Norden nicht
geringer als unter den Tropen, und man bezeichnet derartige Tiere
als warmblütige oder homöotherme (konstant temperierte)
Tiere. Andre Organismen besitzen eine schwankende, wesentlich von
der Temperatur des sie umgebenden Mediums abhängige
Temperatur, man nennt sie kaltblütige oder richtiger
poikilotherme (variabel temperierte) Organismen. Bei ihnen ist die
Energie der Oxydationsprozesse so gering, daß die
Eigenwärme nur wenige Grade höher als die Temperatur der
Umgebung ist. Ein ganz eigentümliches Verhalten bieten einige
Säugetiere (Fledermaus, Igel, Murmeltier, Hamster etc.),
welche man als Winterschläfer bezeichnet hat; diese sind
während der wärmern Jahreszeit homöotherm, verfallen
aber in der kältern Jahreszeit in einen eigentümlichen
Erstarrungszustand, in welchem der ganze Stoffwechsel auf ein
äußerst geringes Maß beschränkt ist, und in
welchem sie sich ganz wie die Kaltblüter verhalten. Die
Temperatur des Murmeltiers sinkt dann auf 1,6°. Beim Menschen
und den Warmblütern ist die Körperwärme eine der
unerläßlichsten Bedingungen für den geregelten
Ablauf der wichtigsten Lebensprozesse. Das Experiment hat gezeigt,
daß mit einem Absinken der Körperwärme die Energie
aller Lebensprozesse ganz wie bei den Winterschläfern erlahmt,
und daß auf der andern Seite schon geringe Erhöhungen
der Eigenwärme bedeutende Gefahren im Gefolge haben, daß
beim Menschen und den Säugetieren sogar der Tod eintritt,
sobald die Körperwärme 42-43° C. übersteigt. Die
t. W. wird nun in den Geweben des Organismus gebildet, und zwar
resultiert sie aus dem ganzen Cyklus von Veränderungen, den
man als Stoffwechsel bezeichnet. Ganz besonders müssen wir die
Drüsen und die Muskeln als Hauptquellen der Wärme
bezeichnen. Es ist möglich, die durch eine einzige
Muskelkontraktion bewirkte Temperatursteigerung nachzuweisen. Trotz
der sehr ungleichen Wärmemengen, welche in den verschiedenen
Organen gebildet werden, verteilt sich die gebildete Wärme
ziemlich gleichmäßig über den ganzen Organismus;
dieses wird bewirkt durch direkte Berührung der verschiedenen
Organe, weit mehr aber noch mittels einer durch den Blutstrom
hergestellten wärmeleitenden Verbindung. Auf diese Weise
erreichen die in den einzelnen Organen gebildeten Wärmemengen
selbst solche Körperteile, welche für sich gar keine
Wärme erzeugen. Das Resultat dieser Ausgleichung ist eine
annähernd konstante Temperatur des ganzen Organismus.
Oxydationen sind nun die verbreiterten, durchaus aber nicht die
ausschließlichen Erzeuger der Wärme; Wärme wird
vielmehr bei allen chemischen Prozessen frei, bei denen der Vorrat
an Spannkraft sich mindert. Dieser Punkt ist deshalb von Bedeutung,
weil im tierischen Körper neben Oxydationsprozessen
komplizierte Spaltungsvorgänge eine wichtige Rolle spielen.
Die eigne Natur der im Tierkörper verlaufenden Prozesse ist
daher von keinem Einfluß auf die Verbrennungswärme; die
gebildete Wärme ist vielmehr durch die Anfangs- und
Endzustände der Körper gegeben und hängt durchaus
nicht von den Zwischenstufen ab, welche die Körper
durchlaufen. Das Prinzip von der Erhaltung der Kraft fordert ja,
daß bei einem Prozeß, der aus mehreren getrennten Akten
zusammengesetzt ist, eine Wärmemenge entsteht, die derjenigen
völlig gleich ist, welche beim Ablaufen des Prozesses in einem
Akt gebildet wird. Folgende Tabelle enthält die
Verbrennungswärme einiger für den Organismus
bedeutungsvoller Substanzen:
Wärmeeinheiten
1 Gramm
bei vollständiger Verbrennung bei Verbrennung im
Organismus
Eiweiß ....... 4998 4263
Rindfleisch (frisch) . . . 1567 1427
Rinderfett ...... 9069 9069
Milch .......662 628
Traubenzucker. .... 3277 3277
Kartoffeln ......1013 997
Erbsenmehl .....3936 3941
Weizenmehl ..... 3541 3846
Reis ........ 3813 3761
Gegenüber den durch den Stoffwechsel bewirkten
Wärmeeinnahmen des Organismus der Warmblüter stehen die
Abgaben von Wärme an die kalte Umgebung. Letztere finden
statt: 1) durch Strahlung von der freien
Körperoberfläche. Das Quantum dieser Wärme wird
unter sonst gleichen Verhältnissen um so größer
sein, je erheblicher die Temperaturdifferenz zwischen dem
Körper und der umgebenden Luft sich gestaltet. 2) Durch
Leitung, und zwar leitet der Körper Wärme a) an
kältere Gegenstände, die seine Oberfläche
berühren, Luft, Kleidung etc.; b) an die in die Lungen
gelangende Luft; c) an die in den Verdauungsapparat gelangenden
Substanzen; d) an das in den Lungen und an der
Körperoberfläche verdunstende Wasser. Um zu einer
ungefähren Vorstellung von der Verteilung der Wärmeabgabe
auf die verschiedenen Posten zu gelangen, sei angegeben, daß
Helmholtz den durch Erwärmung der Nahrung entstandenen Verlust
auf 2,6 Proz., den Verlust durch Erwärmung der Atmungsluft auf
5,2, denjenigen durch Wasserverdunstung auf 14,7 Proz.
schätzt, während er den ganzen Rest durch die
Körperoberfläche zur Verausgabung gelangen
läßt.
Da sowohl Wärmebildung als Wärmeabgabe großen
Schwankungen ausgesetzt ist, die Eigenwärme aber stets
konstant bleibt, so muß der Organismus über
Vorrichtungen verfügen, welche seine Temperatur regulieren.
Bei der Betrachtung dieser regulatorischen Einrichtungen haben wir
zu unterscheiden zwischen solchen, welche auf die Wärme
erzeu-
702
Tierkämpfe - Tierkreis.
gung, und solchen, welche auf die Wärmeabgabe einwirken.
Von den Einflüssen der ersten Art ist in erster Linie die
Nahrungszufuhr zu nennen. In der Kälte ist das Bedürfnis
nach Nahrungsaufnahme größer als in der Wärme. Ein
zweites Mittel dieser Art ist die Muskelarbeit. In der Kälte
suchen die Organismen durch vermehrte Muskelkontraktionen
Wärme zu bilden, in der Wärme vermeiden sie Muskelarbeit
am liebsten ganz. Unter den regulatorischen Vorrichtungen, welche
auf die Wärmeausgabe einwirken, kommt in erster Linie der die
äußere Haut und die Lungen passierende Blutstrom in
Betracht. Diese Vorrichtung basiert auf der Veränderlichkeit
in der Weite der Arterien (s. Blutbewegung), und sie ist
entschieden der wichtigste Regulator der Eigenwärme. Durch
eine Erweiterung der Gefäße in der äußern
Haut und den Lungen wird der Wärmezufluß vom Innern des
Körpers her vermehrt, durch eine Verengerung verringert. Nun
sichert eine nervöse Verbindung einen ursachlichen
Zusammenhang in der Weite dieser Gefäße und der
Körpertemperatur und macht sich derartig geltend, daß
die Gefäße sich erweitern, sobald die
Körperwärme steigt, daß sie sich aber verengern,
sobald diese sinkt. Ein andres Prinzip, welches bei der
Wärmeregulation Anwendung findet, ist die Wärmeabgabe bei
der Veränderung des Aggregatzustandes von
Körperbestandteilen. Der Organismus macht hiervon beim
Übertritt von Flüssigkeiten in den gasförmigen
Zustand, also bei der Verdunstung, Gebrauch. Diese findet besonders
umfangreich in zwei Organen statt, nämlich in den Lungen und
in der äußern Haut. Wie bedeutend die Verdunstung durch
die Lungen ist, kann man schon aus der Beobachtung der ausgeatmeten
Luft bei kalter Witterung schließen. Was die Verdunstung
durch die äußere Hnut betrifft, so ist die dichte
Bekleidung derselben mit Epidermiszellen der Verdunstung nicht
günstig, und der Mechanismus ist hier der, daß bei
gesteigerter Körperwärme ein Reiz auf die
Schweiß-Zentren (s. Schweiß) ausgeübt wird,
daß infolgedessen die Schweißdrüsen durch ihre
Thätigkeit die Hautoberfläche mit einer
Flüssigkeitsschicht überziehen, zu deren Verdunstung
Wärme vom Körper abgegeben wird. Als dritte die
Wärmeabgabe betreffende Regulationsvorrichtung benutzt der
Organismus die Lungenatmung. Diese Vorrichtung basiert auf dem
Prinzip des Fächers, also darauf, daß ein bewegter
Luftstrom die Wärmeabgabe eines Körpers begünstigt,
indem er diesen fortwährend mit neuen kältern Luftmassen
in Berührung bringt. Steigt die Körperwärme, so
vermehren sich die Atemzüge, und die außerordentlich
große Oberfläche der Lungenbläschen wird jetzt mit
einem in beständiger Bewegung begriffenen großen Quantum
kühlerer Luft in Berührung gebracht. Es ist übrigens
ersichtlich, daß auf diese Weise nicht allein die direkte
Wärmeabgabe, sondern auch die Verdunstung
außerordentlich begünstigt wird. Die Regulierung der
Körperwärme mittels der beschriebenen
Kompensationsvorrichtungen vollzieht sich zum
allergrößten Teil, vielleicht ganz, durch Vermittelung
des Nervensystems. Wie die betreffenden Nervenmechanismen gestaltet
sind, kann einstweilen nur vermutet werden. Die Existenz eines die
Thätigkeit der verschiedenen Regulationsvorrichtungen
regelnden Wärmezentrums ist bis jetzt nicht genügend
bewiesen.
Die mittlere Körperwärme schwankt beim Menschen
zwischen 36,5 und 38° C. Ähnlichen Temperaturen begegnet
man bei den Säugetieren; beim Pferd beträgt sie
37,5-38,5°, beim Rind 37,5-39,5°, bei Schafen 38-41°,
bei Schweinen 38,5-40° und bei Hunden 37,5-39,5° C. Etwas
höher liegt die Eigenwärme der Vögel, sie
beträgt 39,4-43,9° C. Bei den übrigen Tieren ist die
Temperatur variabel und in der Regel um wenige Grade höher als
die des umgebenden Mediums. Bei den Warmblütern werden
regelmäßige, von der Lebensweise abhängige
Temperaturschwankungen um 1-1,5° C. wahrgenommen. So zeigen
sich von der Nahrungsaufnahme abhängige Schwankungen derart,
daß ein Minimum der Temperatur etwa gegen Mitternacht beginnt
und bis 7 Uhr morgens andauert, diesem folgt eine etwa bis 4 Uhr
nachmittags anhaltende Periode der steigenden Temperatur, dann
kommt ein bis etwa 9 Uhr abends dauerndes Maximum und endlich eine
Periode der absinkenden Temperatur. Diese Schwankungen kommen beim
Hunger in Fortfall. Weitere Schwankungen der Eigenwärme
innerhalb physiologischer Grenzen hängen von der
Muskelthätigkeit ab; durch energische Muskelarbeit wird die
Temperatur nicht selten bis um 1,5° C. vermehrt. Von
medikamentösen Mitteln bewirken Herabsetzung der tierischen
Wärmebildung: Chinin, Salicylsäure, Alkohol, Chloroform,
Chloral u. a., eine Erhöhung derselben Digitalin. Eine
erhöhte Körpertemperatur ist eins der wichtigsten Zeichen
des Fiebers (s. d.). Beim Menschen bedient man sich zu Bestimmungen
der Körperwärme gewöhnlich der Achselhöhle oder
auch, wie bei den Tieren, des Mastdarms. Ein Thermometer
läßt man hier so lange liegen, bis kein Steigen der
Quecksilbersäule mehr wahrgenommen wird, was in der Regel nach
zehn Minuten erreicht ist. Regelmäßige, zu bestimmten
Tageszeiten wiederholte Temperaturmessungen sind in der neuern
Medizin eins der wichtigsten diagnostischen Mittel.
Tierkämpfe (lat. Venationes), Kämpfe von Tieren
untereinander oder von Menschen mit Tieren, gehörten bei den
alten Römern zu den beliebtesten Volksbelustigungen. Sie
fanden zumeist im Zirkus statt und wurden zuerst bei den Spielen
des M. Fulvius Nobilior 186 v. Chr. erwähnt. Die
Tierkämpfer (bestiarii) waren teils Verurteilte und
Kriegsgefangene, die den durch Hunger, Feuerbrände und
Stacheln rasend gemachten Tieren schlecht bewaffnet oder ganz
waffenlos entgegengestellt wurden, teils Mietlinge, die wie die
Gladiatoren in besondern Schulen geübt und ausreichend
bewaffnet waren. Für die Herbeischaffung zahlreicher und
seltener Tiere, oft aus den entferntesten Weltgegenden, und die
sonstige Ausstattung der Tierhetzen wurde besonders in der
Kaiserzeit ein unglaublicher Aufwand gemacht. So veranstaltete
Pompejus einen Tierkampf von 500 Löwen, 18 Elefanten und 410
andern afrikanischen Bestien, und Caltgula ließ 400
Bären und ebensoviel reißende Tiere aus Afrika sich
gegenseitig zerfleischen. Bisweilen wurde dabei durch geeignete
Dekoration und Kostümierung ein historischer oder
mythologischer Vorfall (z. B. wie Orpheus von Bären zerrissen
wird) szenisch dargestellt. Erhalten haben sich die T. bis ins 6.
Jahrh. - Bei den Griechen waren besonders Wachtel- und
Hahnenkämpfe (s. Huhn, S. 779) beliebt, wobei von den
Zuschauern Wetten oft bis zu bedeutender Höhe angestellt
wurden. Als T. der neuern Zeit sind die Stiergefechte (s. d.) der
Spanier zu bezeichnen.
Tierkohle, durch Verkohlung tierischer Substanzen
erhaltene Kohle, besonders Knochenkohle.
Tierkreis (Zodiakus), s. Ekliptik. Über den T. in
Dendrah s. d. In der christlichen Symbolik ist der T. das Sinnbild
der Weisheit Gottes, so namentlich auf Bildern der
Weltschöpfung, z. B. im Campo santo
703
Tierkreislicht - Tierreich.
zu Pisa (um 1390) und nach Raffaels Zeichnungen in Santa Maria
del Popolo zu Rom, auch häufig an kirchlichen Fassaden des 12.
und 13. Jahrh.; in neuerer Zeit von A. v. Heyden dargestellt (in
der Kuppel der Nationalgalerie in Berlin).
Tierkreislicht, s. Zodiakallicht.
Tiermalerei, ein Zweig der Malerei, welcher sich mit der
Darstellung einzelner oder zu Gruppen vereinigter lebender Tiere in
der Freiheit und in Gefangenschaft, in Ruhe und Bewegung
beschäftigt. Isolierte Darstellungen einzelner Tiere und
Tierstücke kommen bereits auf Kupferstichen und Holzschnitten
von M. Schongauer und A. Dürer vor. Ihre Ausbildung als
selbständige Gattung der Malerei erhielt die T. aber erst
durch die niederländischen Künstler des 17. Jahrh. Jan
Brueghel der ältere malte Landschaften mit Tieren jeglicher
Art (sogen. Paradiese). Rubens, Snyders und Jan Wildens malten
Jagden und wilde Tiere im Kampf mit den Menschen oder unter sich.
Andre hervorragende Tiermaler des 17. Jahrh. sind M. Hondecoeter
(Geflügel), Wouwerman (Pferde), Berchem (Rindvieh und Schafe
in Landschaften), Paul Potter (Rindvieh und Pferde), A. Cuyp
(Pferde und Hunde), Rosa di Tivoli (Schafe, Rinder und Ziegen). Im
18. Jahrh. zeichnete sich vornehmlich J. E. Ridinger in der
Darstellung von Hirschen, Wildschweinen, Jagden etc. als Maler und
Radierer aus. Im 19. Jahrh. nahm die T. einen neuen Aufschwung
durch den Engländer E. Landseer (Pferde, Hunde u. a. m.), die
Franzosen Troyon, Rosa Bonheur und Jacque und die Belgier
Verboeckhoven und Verlat. Die bedeutendsten deutschen Tiermaler der
neuern Zeit sind die Berliner Steffeck (Pferde und Hunde), P.
Meyerheim (Raubtiere, Affen, exotische Vögel), Brendel
(Schafe), Friese (Raubtiere und jagdbares Wild), Hallatz (Pferde),
die Düsseldorfer Kröner (jagdbares Wild), Deiker und Jutz
(zahmes Geflügel), die Münchener Mali (Schafe und
Rindvieh), Voltz (Weidevieh), Gebler (Schafe und Hunde), Braith
(Rindvieh) und Zügel (Schafe) und der Schweizer Koller. Vgl.
auch Idyllenmalerei.
Tiermasken, s. Maske, S. 314.
Tieröl (Hirschhornöl, Knochenöl,
Franzosenöl) entsteht bei trockner Destillation
stickstoffhaltiger tierischer Substanzen, besonders der Knochen,
ist dunkelbraun bis schwarz, dicklich, riecht durchdringend
widerwärtig, empyreumatisch, ist leichter als Wasser,
löslich in Alkohol, reagiert alkalisch, gibt an Alkalien
Blausäure und Phenol, an Säuren organische Basen (die
Pyridinbasen, auch Äthylamin etc.) ab und liefert bei
wiederholter Rektifikation ein farbloses Öl (Dippels Öl),
welches bald wieder gelblich oder braun wird. Dies war als Oleum
animale aethereum offizinell; man benutzte es früher gegen
Typhus, als Wurmmittel und zu Einreibungen. Mit 3 Teilen
Terpentinöl bildet es das Oleum contra Taeniam Chaberti, ein
altes Bandwurmmittel.
Tierpflanzen, s. Zoophyten.
Tierpsychologie, s. Tierseelenkunde.
Tierquälerei, s. Tierschutz.
Tierreich, die Gesamtheit der Tiere. Es läßt
sich, weil eine scharfe Grenze zwischen diesen und den Pflanzen
nicht vorhanden ist, in seinen niedersten Formen von denen des
Pflanzenreichs nicht trennen, falls man nicht, wie es seitens
einiger Forscher geschieht, die zweifelhaften Wesen zu einem
besondern Reich, demjenigen der Protisten, vereinigt und so
für Tier- und Pflanzenreich eine bessere, allerdings rein
künstliche Abgrenzung ermöglicht (vgl. Protozoen und
Tier). Das T. selbst zerfällt in eine Anzahl großer
Abteilungen (Typen, Klassen, Stämme), über deren Anzahl
und Umfang man jedoch in Fachkreisen von jeher der verschiedensten
Ansicht gewesen ist. Die erste derartige Einteilung rührt von
Aristoteles her, welcher blutführende und blutlose Tiere
unterschied; diese beiden Gruppen entsprechen den heutigen
Wirbeltieren und Wirbellosen (Vertebraten und Evertebraten) und
zerfielen jede wieder in vier Klassen, die zum Teil auch jetzt noch
als gut begrenzt angesehen werden, nämlich: lebendig
gebärende Vierfüßer (mit Einschluß der Wale),
Vögel, Eier legende Vierfüßer, Fische; Weichtiere
(die heutigen Tintenschnecken), Weichschaltiere (Krebse),
Kerftiere, Schaltiere (Schnecken, Muscheln, Echinodermen). Erst
gegen Ende des vorigen Jahrhunderts wurde nach 2000jährigem
Bestehen diese Klassifikation durch Linné beseitigt und
durch sein System von sechs Klassen: Säugetiere, Vögel,
Amphibien, Fische, Insekten, Würmer, ersetzt. Natürlich
erfuhren hierbei die kleinern Formen der niedern Tiere, da man sie
nicht oder nicht genügend kannte, keine Berücksichtigung,
und so bildete namentlich die Wurmgruppe ein buntes Allerlei, eine
"Rumpelkammer" für alle Tiere, welche sonst nicht
unterzubringen waren. Bereits nach wenigen Jahrzehnten erlangte
daher die von Cuvier 1812 versuchte neue Einteilung der Tiere nach
ihrer Gesamtorganisation allgemeinen Beifall; sie schuf vier
große Typen oder Kreise, nämlich die Wirbel-, Weich-,
Glieder- und Strahltiere, die ganz unabhängig voneinander nach
vier verschiedenen "Bauplanen" gebildet sein sollten. Indessen auch
hier vereinigte der unterste Kreis ganz heterogene Elemente in sich
(Echinodermen, Cölenteraten, Eingeweidewürmer,
Rädertiere und Infusorien), die zum großen Teil sogar
nichts weniger denn strahlig gebaut waren. Es wurde daher nach u.
nach die Anzahl der "Kreise" von vier auf sieben erhöht, indem
man die Glieder- und Strahltiere besser sonderte. Nachdem sodann in
den 60er Jahren die darwinistischen Prinzipien allgemeinen Eingang
zu finden begonnen hatten, verließ man den Begriff, welcher
dem Typus zu Grunde liegt, und spricht in der modernen Zoologie nur
noch von "Tierstämmen", welche, aus gemeinsamer Wurzel
hervorgegangen, in ihrer Gesamtheit den Baum des Tierreichs
darstellen. Als solche Stämme faßt man in der Ordnung
von unten nach oben auf: die Protozoen (auch häufig als
besonderes Reich abgetrennt, s. Protozoen), die Cölenteraten
(Schwämme, Korallen, Polypen, Quallen etc.), die Würmer,
die Echinodermen (Seesterne, Seeigel etc.), die
Gliederfüßler oder Arthropoden (Krebse, Insekten etc.),
die Weichtiere (Muscheln, Schnecken etc.), die Wirbeltiere. Doch
verhehlt man sich dabei nicht, daß manche isoliert dastehende
Gruppen, welche man heute noch einem der genannten Stämme
zurechnet, bei genauerer Erforschung ihrer Organisation vielleicht
einen besondern Stamm bilden werden, wie man auf der andern Seite
eifrig nach den lebenden oder ausgestorbenen Bindegliedern zwischen
den Stämmen sucht. Dieser Auffassung zufolge lassen sich also
die Tiere in ihrer natürlichen (d. h. auf Blutsverwandtschaft
oder auf Abstammung voneinander beruhenden) Anordnung nicht in eine
einfache Reihe, die vom niedersten zum höchsten Tiere reichen
würde, bringen, sondern bilden die Äste, Zweige und
Zweiglein eines mächtigen Baums, dessen Krone die noch
lebenden Tiere ausmachen, während die näher der Wurzel
befindlichen Zweige von der Ausdehnung des Baums in frühern
Zeiträumen berichten. Wie sich die genannten Stämme im
einzelnen verhalten, ist in den betreffenden Artikeln
nachzulesen.
704
Tiersage - Tierschutz.
Tiersage, eine Gattung der Sage (s. d.), welche von dem
Leben und Treiben der Tiere und zwar vorzugsweise der
ungezählten Tiere des Waldes handelt, die man sich mit Sprache
und Vernunft ausgestattet denkt. Die Wurzeln der T. liegen in der
Natureinfalt der ältesten Geschlechter, die noch in
unbefangenem, sei's freundlichem oder feindlichem, immer nahem
Verkehr mit den Tieren standen: aus der harmlosen Freude des
Naturmenschen an dem Treiben der Tiere, seiner Beobachtung ihrer
besondern Art und "Heimlichkeit" entsprang die einfache
Erzählung dessen, was er an und mit den Tieren erfuhr und
erlebte, und sie eben bildet das charakteristische Merkmal dieser
Art Naturpoesie, die teils in einzelnen konkret gewordenen
Erscheinungen als Tiermärchen, teils in Verknüpfung und
Verschmelzung derselben zu einem dichterischen Ganzen als Tierepos
auftritt. Wohl zu unterscheiden ist dieses Tierepos von der
gewöhnlichen (Äsopischen oder Lessingschen) Tierfabel,
die rein didaktischer Natur ist, indem sie nach kurzer
Erzählung des Tatsächlichen eine nüchterne
Verstandeslehre mit epigrammatischer Schärfe ausspricht (s.
Fabel). Das Tierepos ist dagegen von aller lehrhaften und
satirischen Tendenz frei; sein Wesen beruht auf der poetischen
Auffassung und naturgetreuen Darstellung des Tierlebens als eines
in seiner geheimnisvollen Eigentümlichkeit abgeschlossenen,
aber zugleich in den Bereich des Menschlichen erhobenen Daseins.
Die Tiere, welche diese Dichtung vorführt, sind nicht nackte,
außer aller psychischen Gemeinschaft mit dem Menschen
stehende Tiere, noch weniger allegorische Figuren oder in
Tiergestalt verkleidete Menschen: es sind die Tiere in ihrem
wirklichen Leben, jedoch mit Gedanken und Sprache ausgestattet und
von Trieben geleitet, denen Absicht und Bedeutung geliehen sind. In
dieser Verschmelzung des menschlichen und tierischen Elements liegt
die Bedingung und zugleich der höchste Reiz der T. Daß
bei solcher Schilderung der Tierwelt zugleich das gewöhnliche
Treiben der Menschen abgespiegelt wird, ist unleugbar, aber
keineswegs die beabsichtigte Wirkung der Dichtung, die vielmehr,
wie das Heldenepos, in ruhiger Breite dahinfließt, ohne
weitere Tendenz, als in ungestörter Gemütlichkeit sich
auszusprechen. Gelegenheit freilich, satirische Nebenbeziehungen
auf bestimmte menschliche Zustände anzubringen, bietet die T.
nur allzu reichlich, und sie wurde auch schon frühzeitig von
den Bearbeitern benutzt. Spuren der T. sind schon bei den
ältesten Völkern nachzuweisen, aber diese ließen
sie frühzeitig wieder fallen oder wandten sich der
didaktischen Tierfabel (s. oben) zu; eine vollständige epische
Durchbildung erhielt die T. nur bei den mit hervorragendem
Natursinn ausgestatteten Deutschen und zwar vorzugsweise bei den
Franken. Mit diesen wanderte sie im 5. Jahrh. über den Rhein,
wo sie in Flandern und Nordfrankreich Wurzel faßte und
gepflegt wurde, bis sie später nach Deutschland
zurückkehrte, um hier im 15. Jahrh. in der niederdeutschen
Dichtung "Reineke Vos" ihre endgültige Gestalt zu erhalten (s.
Reineke Fuchs). Die älteste und echteste T. kennt nur
einheimische Tierhelden (mit treffenden, echt deutschen Namen), und
der Bär, der König der deutschen Wälder, war auch im
Gedicht der König der Tiere; erst später (im 12. Jahrh.)
trat statt seiner der orientalische Löwe an die Spitze des
Tierstaats, in den nun auch Affen und andre fremdländische
Geschöpfe eingeführt wurden. Die besten, vollkommen
befriedigenden Aufschlüsse über den Charakter der T. gab
J. Grimm in einer Einleitung zu "Reinhart Fuchs" (1843).
Tiers-argent (franz., spr. tjähr-sarschang), s.
Aluminiumlegierungen und Drittel-Silber.
Tiersch, Otto, Musiktheoretiker, geb. 1. Sept. 1838 zu
Kalbsrieth bei Artern in Thüringen, ward Schüler von J.
G. Töpfer in Weimar, später Heinrich Bellermanns, Marx'
und L. Erks in Berlin, war mehrere Jahre als Lehrer am Sternschen
Konservatorium daselbst thätig und ist jetzt städtischer
Lehrer (für Gesang) in Berlin. T. ist als Musiktheoretiker
eine interessante Erscheinung, da er den Versuch macht, die
neuesten Errungenschaften der Akustik und Physiologie des
Hörens für die Harmonielehre zu verwerten, und
demgemäß ein eignes Harmoniesystem aufstellt. Seine
Schriften sind: "System und Methode der Harmonielehre" (Leipz.
1868); "Elementarbuch der musikalischen Harmonie- und
Modulationslehre" (2. Aufl., Berl. 1888; "Praktische
Generalbaß-, Harmonie- und Modulationslehre" (Leipz. 1876);
"Praktisches Lehrbuch für Kontrapunkt und Nachahmung" (das.
1879); "Lehrbuch für Klaviersatz und Akkompugnement" (das.
1881); "Allgemeine Musiklehre" (mit Erk, das. 1885); "Rhythmik,
Dynamik und Phrasierungslehre der homophonen Musik" (das. 1886) u.
a.
Tierschutz, der Inbegriff aller Anordnungen und
Bestrebungen, welche zum Zweck haben, den Tieren unnötige
Quälereien zu ersparen. Das Strafgesetzbuch für das
Deutsche Reich bedroht (§ 360, Ziff. 13) "mit Geldstrafe bis
zu 150 Mk. oder mit Haft denjenigen, welcher öffentlich oder
in Ärgernis erregender Weise Tiere boshaft quält oder roh
mißhandelt". Zur Verhütung einzelner Arten von
Mißhandlungen der Tiere bestehen auch vielfach besondere
Polizeivorschriften, wie z. B. bezüglich des Transports
kleinerer Haustiere, des Bindens der Füße derselben,
bezüglich der Hundefuhrwerke etc. In vielen Fällen ist es
schwer zu erkennen, wann eine Handlung wirklich als eine strafbare
Tierquälerei zu erachten ist; denn der Charakter, das Benehmen
u. die Benutzungsweise der verschiedenen Tiere weichen wesentlich
voneinander ab u. machen deshalb eine verschiedene Art in der
Behandlung derselben, zumal bei Arbeitstieren, nötig. Um den
Tieren eine humane Behandlung zu sichern, haben sich allenthalben
Tierschutzvereine gebildet, wozu der verstorbene Hofrat Perner in
München zuerst die Anregung gegeben hatte. Diese Vereine
suchen Mitglieder in allen Schichten der Bevölkerung zu
gewinnen und verpflichten dieselben, nicht nur selbst keinerlei
Tierquälerei zu begehen und von ihren Angehörigen zu
dulden, sondern auch andre davon abzumahnen und nötigen Falls
polizeiliche Abhilfe zu veranlassen. Da in erster Linie schon bei
der Erziehung der Kinder darauf hingewirkt werden muß,
Mitgefühl für die Leiden der Tiere und Abscheu vor allen
Handlungen zu erwecken, welche Tieren jeder Art unnötige
Schmerzen verursachen, suchen diese Vereine durch Schriften und
bildliche Darstellung auf die Jugend einzuwirken. Durch diese
Tierschutzvereine sind schon manche tierquälerische
Mißbräuche bei der Benutzung und Behandlung von Tieren
abgestellt worden; ihren Bemühungen ist es unter anderm
zuzuschreiben, daß mit Fußleiden und andern Gebrechen
behaftete Pferde, anstatt noch länger herumgeplagt zu werden,
zum Zweck des Fleischgenusses in Pferdeschlächtereien eine
nutzbringende Verwendung finden, daß ferner
unzweckmäßige Zuggeräte, wie das Doppeljoch, immer
mehr außer Gebrauch kommen, bessere Schlachtmethoden
angewendet werden, nutzlose und unsinnige Operationen, wie Stechen
und Brennen des Gaumens sowie Nagelschneiden bei Pferden,
Ohrenschneiden bei Hunden etc., immer seltener werden. Es bleibt
für
705
Tiers-consolidé - Tierseelenkunde.
den T. übrigens noch ein großes Feld der
Thätigkeit, wenn er seine Aufmerksamkeit auch fernerhin auf
entsprechendere Einrichtungen bei dem Transport der Tiere auf den
Eisenbahnen, auf Verbesserungen der häufig noch
unbeschreiblich schlechten Ställe sowie des
unzweckmäßigen, zu schmerzhaften Fußleiden
führenden Hufbeschlags etc. richtet. In Deutschland richtete
sich die Agitation der Tierschutzvereine in letzter Zeit namentlich
gegen die Vivisektion (s. d.). Auch wird eine Abänderung des
deutschen Strafgesetzbuchs in dem Sinn angestrebt, daß zu dem
Begriff der Tierquälerei nicht mehr das Requisit der
Öffentlichkeit oder das Erregen von Ärgernis gehören
soll. Der T. darf jedoch nicht in übertriebene
Sentimentalität ausarten, die für zuweilen unvermeidliche
Leiden der Tiere Ausdrücke des tiefsten Bedauerns findet und
alles mögliche aufbietet, vermeintliche Tierquälereien
abzustellen, während sie für Leiden der Menschen weniger
empfindlich ist. Insbesondere kann der (bei Verleihung von
Medaillen etc.) übertriebene Diensteifer niederer
Polizeiorgane, in vielen an und für sich unschuldigen
Handlungen Tierquälereien zu erblicken, zuweilen unangenehm
werden und zu lästigen Plackereien führen. Im weitern
Sinn erstreckt sich der T. auch auf die Verhinderung der Ausrottung
oder der zu starken Verminderung gewisser Arten von Tieren,
besonders nützlicher Vogelarten, der Fische etc., zu welchem
Zweck besondere Polizeivorschriften zu erlassen sind. Dem T.
gewidmete Zeitschriften erscheinen gegenwärtig in Berlin
("Ibis", seit 1872), Darmstadt (seit 1874), Stuttgart (seit 1875),
Köln (seit 1877), Guben (seit 1881), Riga (seit 1885), Aarau
(seit 1887).
Tiers-consolidé (franz., spr.
tjähr-kongsso-), die 30. Sept. 1797 anerkannte 5proz.
französische Rente, welche 1802 als "Cinq pour Cent"
bezeichnet und 1862 auf Grund der Gesetze vom 1. Mai 1825 und 14.
März 1852 in 3, bez. 4½ pour cent de 1852 umgewandelt
wurde.
Tierseelenkunde (Tierpsychologie), die Wissenschast von
den geistigen Fähigkeiten der Tiere, welche eigentlich nur
einen Teil der allgemeinen Psychologie (s. d.) zu bilden
hätte. Die ältern heidnischen Philosophen, wie
Parmenides, Empedokles, Demokrit, Anaxagoras u. a., waren auch
vollkommen überzeugt, daß die Tiere in ganz
ähnlicher Weise wie der Mensch Schlüsse ziehen und
Erfahrungen einsammeln; Plutarch schrieb eine Abhandlung über
die Frage, ob die Land- oder Wassertiere klüger seien, und
Porphyrios betonte mit strenger Folgerichtigkeit, daß wie im
körperlichen Bau auch im geistigen Leben kein prinzipieller,
sondern nur gradweise Unterschiede zwischen Tier und Mensch
vorhanden seien. Einige alte Philosophen übertrieben diese
Erkenntnis sogar, indem Celsus z. B. den Tieren selbst Religion,
Sprache und Prophetengabe zuschrieb, worauf Origines sehr richtig
bemerkte, daß sich ihre scheinbare Voraussicht nur auf
Erhaltung ihrer eignen Brut erstrecke. Die unter den Einfluß
der Kirche geratene Philosophie gewöhnte sich sodann seit
Descartes, den Tieren Überlegung und geistiges Leben ganz
abzuerkennen und sie für eine Art von Automaten zu
erklären, deren Handlungen sich nur nach bestimmten, für
jede Art ein für allemal festgestellten Normen bewegen, die
den sogen. Instinkt (s. d.) der Art ausmachen. Bei dieser Annahme
war das Studium der geistigen Fähigkeiten der Tiere
überflüssig, und obwohl sie nicht unwidersprochen blieb
und Rorarius, der Nunzius Papst Clemens' VII., sogar 1654 ein Buch
unter dem Titel: "Die wilden Tiere brauchen ihren Verstand besser
als der Mensch" veröffentlichte, so bewegten sich doch die zum
Teil überaus genauen Beobachtungen der Kunsttriebe niederer
Tiere, welche Swammerdam, Réaumur, Rösel von Rosenhof,
Bonnet, Trembley u. a. im 17. und 18. Jahrh. anstellten, lediglich
in der Richtung, das von Gott geordnete wunderbare "Maschinenwerk"
darin zu bewundern. Es ist unerhört, was in dieser Richtung
beispielsweise über den mathematischen Instinkt der Bienen bei
ihrem Wabenbau oder über die angeborne Wissenschaft gewisser
Trichterwickler noch in neuerer Zeit zusammenphantasiert worden
ist, obwohl solche Kunstwerke, wie Müllenhof gezeigt hat, zum
Teil einfach genug entstehen. Eine Richtung zum Bessern zeigten
zuerst die "Allgemeinen Betrachtungen über die Triebe der
Tiere" (1760) des Hamburger Populärphilosophen Hermann
Reimarus, sofern hier die fest determinierten Triebe von den
freiern geistigen Handlungen unterschieden werden; aber erst die
eingehenden Beobachtungen des Tierlebens durch Forscher und
Liebhaber, wie sie Brehm Vater und Sohn, Scheitlin, die
Gebrüder Müller und zahlreiche andre Tierfreunde
angestellt haben, brachen das alte Vorurteil und bahnten der
Ausdehnung einer wissenschaftlichen Psychologie auf die Tierwelt,
wie sie in Deutschland namentlich Wundt anstrebte, Bahn. Doch
eröffnete erst das Auftreten Darwins diesen Bestrebungen die
rechten Gesichtspunkte, sofern er auf das Werden und Wachsen der
geistigen Fähigkeiten unter den Tieren so gut wie der
körperlichen Formen hinwies und auch hierbei die Wirksamkeit
der natürlichen Auslese betonte (s. Darwinismus, S. 570).
Seitdem haben sich viele Forscher mit dem größten Erfolg
der vergleichenden und experimentellen T. gewidmet, und es ist
unvergessen, was in dieser Richtung Lubbock, Hermann Müller,
Plateau, Forel, Preyer und viele andre Forscher über die
geistigen Fähigkeiten der Insekten und andrer niedern Tiere
ermittelt haben, indem sie sie teils in ihre gewohnten und teils in
neue Bedingungen versetzten. Es hat sich dabei ergeben, daß
man ihre geistigen Fähigkeiten zum Teil über- und zum
Teil unterschätzt hat. Das sogen. Totstellen der niedern Tiere
hat sich z. B. als eine nützliche Schrecklähmung (s.
Kataplexie), die Selbstamputation der Seesterne, Krebse, Spinnen
und Eidechsen, die man früher als Ausfluß eines starken
und heroischen Willens ansah, als bloßer unbewußter
Reflexakt erwiesen, anderseits haben aber viele Beobachtungen, z.
B. diejenigen Preyers an gefesselten Seesternen, gezeigt, daß
die Fähigkeit, sich in neuen und schwierigen Lagen
zweckmäßig zu benehmen, selbst bei niedern Tieren nicht
gering ist. Ebenso ist das Gedächtnis früh entwickelt,
und selbst kopflose Tiere, wie die Muscheln, lernen schnell
Gefahren vermeiden, wie die Messerscheide (Solen), die sich nach
Forbes nur einmal durch aufgestreutes Salz aus ihrer Sandröhre
hervorlocken läßt, nicht aber zum zweitenmal. Neuere im
Sinn der Entwicklungslehre angestellte Untersuchungen haben
wahrscheinlich gemacht, daß bei den niedern Tieren nur die
chemischen Sinne (Geruch und Geschmack) neben dem körperlichen
Gefühlssinn feiner entwickelt sind, und daß die
höhern Sinne (Gehör und Gesicht) erst auf viel
höhern Organisationsstufen ihre Ausbildung erfahren. Das
Vorwiegen der chemischen Sinne bis in die Kreise der niedern
Wirbeltiere hinauf lehrt auch die vergleichende Gehirnkunde, welche
die vorherrschende Entwickelung der sogen. Riechlappen bei allen
niedern Wirbeltieren, ja bis zu den untern Klassen der Säuger
hin zeigt. Hierzu hat die Paläontologie ferner den Beweis
erbracht, daß der vom Gehirn ausgefüllte Hohlraum
Meyers Konv. -Lexikon, 4. Aufl., XV. Bd.
45
706
Tiers-état - Tiflis.
des Schädels selbst in derselben Familie, z. B. bei dem bis
zum Eocän zurückverfolgbaren Geschlecht der pferdeartigen
Tiere (Equiden), ein beständiges Wachstum in der Zeit
aufweist, wie denn die Tiere mit sehr unausgebildetem Hirn, z. B.
die Faultiere, unter den Säugern auch ein sehr unentwickeltes
Seelenleben und große Stumpfheit zeigen. In den höhern
Abteilungen, z. B. bei den Affen, ist es namentlich das
Großhirn, dessen beide Hemisphären eine erhebliche
Zunahme zeigen, bis sie (beim Menschen) alle übrigen
Gehirnteile bedecken. Den einzigen wesentlichen Unterschied der
tierischen von der menschlichen Intelligenz sucht Vignoli in dem
Mangel des Selbstbewußtseins bei der erstern, doch ist eine
bestimmte Grenze auch hierin nicht zu ziehen, und man kann nur ein
stufenweises Wachstum der Fähigkeiten bei den höhern
Tieren nachweisen. Vgl. Wundt, Grundzüge der physiologischen
Psychologie (3. Aufl., Leipz. 1887); Romanes, Die geistige
Entwickelung im Tierreich (das. 1885); Vignolt, Über das
Fundamentalgesetz der Intelligenz im Tierreich (das. 1879);
Büchner, Aus dem Geistesleben der Tiere (3. Aufl., Berl.
1880); über die geistigen Fähigkeiten der Insekten:
Fabre, Souvenirs entomologiques (3 Tle., Par. 1879, 1882 u. 1886);
Lubbock, Ameisen, Bienen und Wespen (deutsch, Leipz. 1883);
Derselbe, Die Sinne und das geistige Leben der Tiere (das. 1889);
über höhere Tiere: Scheitlin, Versuch einer
vollständigen T. (Stuttg. 1840, 2 Bde.); Rennie,
Fähigkeiten und Kräfte der Vögel (Leipz. 1839);
Derselbe, Baukunst der Vögel (Stuttg. 1847).
Tiers-état (franz., spr. tjähr-setá,
der "dritte Stand"), in Frankreich in der Zeit vor 1789 die Masse
des Volkes im Gegensatz zum Adel und Klerus als den beiden
privilegierten Ständen.
Tiers-parti (franz., spr. tjähr-, die "dritte
Partei"), Fraktion in der franz. Deputiertenkammer, welche
während der Kammersitzung von 1832 bis 1833 entstand und die
Herrschaft des Mittelstandes bezweckte.
Tiersymbolik, s. Symbolik.
Tierwolf, s. Luchs.
Tierzucht, s. Viehzucht.
Tieté, Nebenfluß des Paraná, in der
brasil. Provinz São Paulo, bildet 56 Katarakte, von denen
der unterste 16 km oberhalb der Mündung liegt und 22 m tief
ist.
Tietjens, Therese, Opernsängerin, geb. 18. Juli 1831
zu Hamburg von ungarischen Eltern, betrat 1847 das St.
Pauli-Aktientheater und wurde im folgenden Jahr am Altonaer
Stadttheater engagiert, ging 1850 nach Frankfurt a. M., 1851 nach
Brünn und wurde 1853 Mitglied des Kärntnerthor-Theaters
in Wien. 1858 kam sie als Primadonna der Italienischen Oper nach
London, wo sie bis zum Frühjahr 1877 als Opern, Konzert- und
Kirchensängerin eine rege Thätigkeit entfaltete und doch
noch Zeit fand, in Italien, Spanien, Paris und Deutschland (Berlin,
Köln, Hamburg) zu singen. Sie starb 3. Okt. 1877 in London.
Eine Vertreterin des echt musikalisch-dramatischen Stils,
besaß sie ein Organ von wunderbarer Weichheit, andauernder
Frische und Mächtigkeit; sie schuf edle, große,
klassische Gestalten u. fesselte namentlich durch meisterhafte
Deklamation des Recitativs.
Tieuté (spr. tjö-), s. Pfeilgift.
Tiférnum, s. Cittá di Castello.
Tiffin, Stadt im nordamerikan. Staat Ohio, Grafschaft
Seneca, 64 km südöstlich von Toledo, in reicher
Weizengegend, mit (188^) 7879 Einw.
Tiflis, Gouvernement der russ. Statthalterschaft
Kaukasien, 40,417 qkm (734 QM.) groß mit (1885) 785,313 Einw.
(darunter 24 Proz. Mohammedaner, erstreckt sich zu beiden Seiten
des Kuraflusses, im N. bis an den Hauptkamm des Kaukasusgebirges,
im S. bis an das armenische Hochland reichend, hat nur in der Mitte
Ebenen, auch Steppen, ist aber im ganzen ein fruchtbares
Gebirgsland mit vielem Weinbau, zahlreichen ergiebigen
Naphthabrunnen und Mineralquellen. Die gewerbliche Thätigkeit
der Bewohner ist nicht unbedeutend, man fabriziert besonders
schöne Teppiche und Shawls. Der Handel wird besonders
gefördert durch die das Gouvernement mitten durchschneidende
Poti-Baku-Eisenbahn sowie durch die über den Kaukasus durch
den Engpaß Dariel nach Wladikawkas führende
Tiflisstraße. Deutsche Kolonien befinden sich in
Alexandershilf, Elisabeththal, Marienfeld, Katharinenfeld mit
zusammen 5000 Einw., zahlreiche Deutsche wohnen außerdem in
der Stadt T. und in Neutiflis.
Die gleichnamige Stadt, in einem engen, von kahlen Felsen
eingeschlossenen, durch Weinpflanzungen, Gebüsch und
Gartenanlagen verschönerten Kesselthal, zieht sich an beiden
Ufern der wilden Kura hin, 460 m ü. M., hat (1886) 104,024
Einw., meist Armenier, Georgier, Russen, über 2000 Deutsche,
ferner Tataren, Perser, Polen, Juden. u. a. Nach Brugsch werden
hier 70 Sprachen gesprochen. Die Stadt ist in Bauart und
Lebensweise eine interessante Mischung asiatischen und
europäischen Wesens. Sie zerfällt in vier Teile. Am
rechten Flußufer liegen die Altstadt und Seid Abbad mit ganz
asiatischem Charakter, Karawanseraien, Bazaren, vielen Kirchen,
warmen Quellen, und der nördlich davon außerhalb der
alten Stadtmauer von den Russen angelegte Teil, dann das an
schönen Plätzen, Kaufläden, Palästen reiche
Quartier Sololaki, am linken Ufer das aus einer schwäbischen
Ansiedelung entstandene Kuki, der Vergnügungsort der Tifliser
und Wohnsitz der meisten Europäer. Daran schließen sich
mehrere Vorstädie, worunter das nach den Naphthaquellen an der
Kura benannte Nawtlug. T. ist Sitz des Statthalters von Kaukasien,
des Zivilgouverneurs für das Gouvernement T., der obersten
Militär- und Regierungsbehörden, eines georgischen
Patriarchen und Metropoliten, eines armenischen Erzbischofs und
eines deutschen Berufskonsuls; es besitzt 76 Kirchen, darunter 36
griechisch-russische, 26 armenische, je 2 protestantische und
römisch-katholische, 2 Klöster, 2 Moscheen, verschiedene
höhere russische Schulen (Gymnasium nebst 2 Progymnasien,
Militärschule, Handelsschule, 2 Lehrerseminare u. a.), 2
deutsche Schulen, öffentliche Bibliothek, Naturalienkabinett,
botanischen Garten, astronomisches und magnetisches Observatorium,
Theater, Münze. Von den Industrien der Stadt sind
erwähnenswert die Fabrikation von Woll-, Baumwoll- und
Halbseidenstoffen, Tapeten, Leder, Salzraffinerie, die Arbeiten in
Silberfiligran, Büchsenmacherei und Schwertfegerei. Dem
Handelsverkehr dienen die Tiflisstraße und die
Poti-Baku-Eisenbahn (s. oben), doch hat der Transitverkehr nach
Persien durch die seit 1883 eingeführten Zollerhöhungen
aufgehört. Europäer und Armenier vertreiben als
Großkaufleute die europäischen Waren. - Die Stadt, 455
n. Chr. gegründet, geraume Zeit Residenz der Könige von
Georgien, erlitt öfters Verheerungen infolge der
vorderasiatischen Völkerbewegungen. Zu Anfang des 17. Jahrh.
fiel sie zwar unter türkische Herrschaft, ward aber von dem
georgischen König Rustum (1636-58) wiedererobert und
befestigt. Zu Anfang des 18. Jahrh. bemächtigten sich die
Türken abermals der Stadt, wurden aber 1735 von Schah
707
Tigellinus - Tigeraugenstein.
Nadir wieder vertrieben, der den georgischen König
Theimuras wiederum einsetzte. Dessen Sohn Irakli (Heraklius) hob
die Stadt zu hoher Blüte; aber 1795 vertrieb der Perser Aga
Mohammed Chan Irakli, legte die Stadt abermals in Asche und
schleppte 30,000 Menschen in die Sklaverei. Im November 1799 nahm
der russische Generalmajor Lasarus von der Stadt Besitz. 1801 wurde
Grusien zu einem russischen Gouvernement und T. zur
Gouvernementsstadt erhoben.
Tigellinus, Sophonius, aus Agrigent gebürtig,
niedern Standes, ward 39 n. Chr. von Caligula wegen unerlaubten
Umgangs mit Agrippina und Julia verbannt, von Claudius
zurückgerufen, erwarb sich durch die Zucht von Pferden
für Wettkämpfe das Wohlwollen Neros, an dessen Lastern
und Ausschweifungen er teilnahm, und den er zu den
größten Grausamkeiten antrieb, wurde nach Burrus' Tod 62
Praefectus praetorio, diente Nero namentlich bei seiner grausamen
Verfolgung der Teilnehmer an der Pisonischen Verschwörung,
verriet Nero, als Galba sich gegen denselben erhob, rettete unter
Galba sein Leben durch die Gunst des Vinius, ward aber von Otho zum
Tod verurteilt und tötete sich in Sinuessa.
Tiger (Königstiger, Felis Tigris L., s. Tafel
"Raubtiere III"), Raubtier aus der Gattung und der Familie der
Katzen, gewöhnlich 1,6 m lang mit 80 cm langem, quastenlosem
Schwanz und am Widerrist etwa ebenso hoch. Alte Männchen
erreichen eine Gesamtlänge von 2,9 m. Das Weibchen ist
kleiner. Der T. ist gestreckter, leichter und höher gebaut als
der Löwe, der Kopf ist runder. Die Behaarung ist kurz und
glatt und nur an den Wangen bartartig verlängert. Auf dem
Rücken ist die rostgelbe Grundfarbe dunkler, an den Seiten
lichter, auf der Unterseite, den Innenseiten der Gliedmaßen,
dem Hinterleib, den Lippen und dem untern Teil der Wangen
weiß. Vom Rücken aus ziehen sich
unregelmäßige, zum Teil doppelte, schwarze Querftreifen
in schiefer Richtung nach der Brust und dem Bauch herab. Der
Schwanz ist lichter als der Oberkörper, dunkel geringelt; die
Schnurren sind weiß, die rundsternigen Augen gelblichbraun.
Der T. findet sich in Asien vom 8.° südl. Br. bis zum
53.° nördl. Br., also bis in das südliche Sibirien
und vom Kaukasus bis zum untern Amur. Von seinem Hauptsitz, Vorder-
und Hinterindien, aus verbreitet er sich durch Tibet, Persien und
die weite Steppe zwischen Indien, China und Sibirien bis zum Ararat
im W. von Armenien, nach N. bis in die Bucharei und Dsungarei, nach
O. vom Baikalsee durch die Mandschurei bis nach Korea an die
Meeresküste. In China findet er sich fast überall, und
nur in den höhern Gegenden der Mongolei und in den waldlosen
Ebenen von Afghanistan trifft man ihn nicht. Ebenso scheint er auch
auf den Inseln des Indischen Archipels, mit Ausnahme Javas und
Sumatras, zu fehlen. Sein Aufenthalt sind ebensowohl Dschangeln
oder Rohrdickichte mit Gesträuch wie hochstämmige
Wälder, aber immer nur bis zu einer gewissen Höhe
über dem Meer. Auch kommt er dicht an Dörfer und
Städte heran. Er zeigt die Gewohnheiten der Katzen. Seine
Bewegungen sind ungemein rasch und ausdauernd; er schleicht
unhörbar dahin, macht gewaltige Sätze, klettert gewandt
an Bäumen empor und schwimmt über breite Ströme. Er
streift zu jeder Tageszeit umher, am liebsten in den Stunden vor
und nach Sonnenuntergang. Der T. ist ein weit gefährlicheres
Raubtier als der Löwe. Seine Beute schlangenartig
beschleichend, stürzt er sich pfeilschnell mit einigen
Sätzen auf dieselbe und schlägt mit seinen Krallen
furchtbare, fast immer tödliche Wunden. Eine verfehlte Beute
verfolgt er als echte Katze nicht weiter. Wild und verwegen, zeigt
er doch in der Gefahr wenig Mut, und wenn er sich verfolgt sieht,
ergreift er fast feig die Flucht. Beim Fortschaffen der Beute
bekundet er sehr viel Klugheit und List. Er besitzt
außerordentliche Kraft, trägt einen Menschen und selbst
ein Pferd oder einen Büffel im Rachen fort, und nur die
stärksten Säugetiere, wie Elefant, Nashorn,
Wildbüffel, sind vor ihm sicher. In Ostindien sind einzelne
Engpässe und Schluchten durch seine Räubereien
berüchtigt, und aus manchen Ortschaften hat er die Bewohner
völlig vertrieben. Durch große Treibjagden ist er in
einzelnen Gegenden, z. B. auf Ceylon, fast ganz ausgerottet worden;
in andern findet er sich aber noch sehr zahlreich vor, namentlich
würde in Gudscharat, wo man nur des Nachts reisen kann, ohne
Aufbieten von Lanzenträgern, Trommlern und Fackelträgern
kaum ein Verkehr möglich sein, und manche Lokalitäten
sind durch den T. völlig ungangbar geworden. Hat ein T. einmal
Menschenfleisch gekostet, so zieht er dasselbe jedem andern vor. Er
schwimmt dreist auf Kähne zu und dringt in Ortschaften und von
Wachtfeuern umgebene Lager ein, um Menschen zu rauben. Auf
Singapur, wohin der T. nur durch die Meerenge schwimmend gelangen
kann, werden jährlich an 400 Chinesen von Tigern zerrissen,
und auf Java beträgt die Zahl der Opfer etwa 300. Die Tigerin
trägt 105 Tage und wirft 2-3 Junge. In Indien betrachtet man
den T. mit abergläubischer Furcht und sieht in ihm eine Art
von strafendem Gott. Auch in Ostsibirien herrschen ähnliche
Vorstellungen, und auf Sumatra erblickt man im T. nur die
Hülle eines verstorbenen Menschen und wagt nicht, ihn zu
töten. In Indien verbieten einige Fürsten die Tigerjagd,
welche sie für sich selbst reservieren. Dagegen thut die
englische Regierung sehr viel, um den T. auszurotten. Den alten
Griechen war der T. wenig bekannt, selbst Aristoteles wußte
von ihm soviel wie nichts. Auch die Römer wurden erst seit
Varros Zeit mit dem T. bekannt, und Scaurus zeigte zuerst im J. 743
der Stadt einen gezähmten T. im Käfig; später kamen
T. häufig nach Rom. Der Kaiser Heliogabalus soll sogar
gezähmte T. vor seinen Wagen gespannt haben. Nach dem Bericht
von Marco Polo benutzte der Chan der Tatarei gezähmte T. zur
Jagd. Noch heute lassen indische Fürsten gefangene T. mit
andern starken Tieren kämpfen, auf Java auch mit
Lanzenträgern. Der T. ist zähmbar, bleibt aber stets
gefährlich. Er hält sich gut in der Gefangenschaft und
pflanzt sich auch fort. Man hat auch Bastarde von Löwen und
Tigern erhalten. Die Tigerfelle, welche über England und
Rußland häufig in den Handel kommen, werden
hauptsächlich zu Pferde- und Schlittendecken benutzt. Die
Kirgisen benutzen sie zur Verzierung der Köcher und
schätzen sie sehr hoch. Das Fleisch soll wohlschmeckend sein,
und die Tungusen glauben, daß es Mut und Kraft verleihe; in
China dient es als Arzneimittel. In andern Ländern
schätzt man mehr Zähne, Klauen, Fett und Leber. Vgl.
Brandt, Untersuchungen über die Verbreitung des Tigers
(Petersb. 1856); Fayrer, The royal t. of Bengal (Lond. 1875).
Tigeraugenstein, gelbbraunes, faseriges Mineral, ein
Umwandlungsprodukt des Krokydoliths, zwischen dessen Fasern Quarz
eingedrungen ist, während das Eisen des ursprünglichen
Minerals in Eisenhydroxyd verhandelt wurde. T. findet sich in den
Doorn- und Griquastadbergen in Südafrika und wird wegen seiner
Härte und seines schönen wogenden Lichtscheins zu
Schmucksachen mit ebenen Flächen verarbeitet.
45*
708
Tigerfink - Tigris.
Tigerfink, s. Astrilds.
Tigerkatze, s. v. w. Ozelot, s. Pantherkatzen, S.
659.
Tigerpferd, s. v. w. Zebra.
Tigerschlangen (Pythonidae Dum. et Bibr.), Familie aus
der Ordnung der Schlangen und der Unterordnung der nicht giftigen
Schlangen, große Tiere mit sehr gestrecktem Körper,
mäßig langem, rundem Schwanz, langschnauzigem Kopf,
weitem Rachen mit derben Zähnen und rudimentären
Hinterextremitäten neben dem After. Die Tigerschlange (Python
molurus (Gray. s. Tafel "Schlangen II"), 7-8 m lang, an der vordern
Hälfte des Oberkopfs mit regelmäßigen Schildern, an
der hintern mit Schuppen bedeckt, ist am Kopf grau fleischfarben,
auf Scheitel und Stirn hell olivenbraun, auf dem Kopf mit
ölbraunen Flecken und Streifen, auf dem Rücken hellbraun,
auf der Unterseite weißlich, außerdem auf dem
Rücken mit großen, vierseitigen, braunen, dunkler
gerandeten Flecken versehen. Sie bewohnt Asien von der Küste
des Arabischen Meers bis Südchina und nördlich bis zum
Himalaja, auch die Sundainseln. Ebenso groß ist die Gitter-
oder Netzschlange (P. reticulatus Gray), auf der Malaiischen
Halbinsel und allen Inseln des Indischen Meers. Beide sind so
ungefährlich wie die amerikanische Riesenschlange, leben
besonders in der Nähe des Wassers, nähren sich von
kleinen Säugetieren, und nur alte, große Exemplare wagen
sich an Ferkel und die Kälber der kleinen Hirscharten. Sie
legen eine größere Anzahl Eier und bebrüten
dieselben mehrere Monate. Auch in der Gefangenschaft hat sich die
Tigerschlange fortgepflanzt. Man hält sie hier und da gern als
Rattenfängerinnen; anderwärts werden sie sehr
gefürchtet.
Tigerwolf, s. Hyäne.
Tiglat Pilesar (Tuklat-habalasur), Name zweier
assyrischer Könige: 1) T. I., 1130-1100 v. Chr., unternahm
Eroberungszüge nach Armenien und Syrien. -
2) T. II., 745-727, Sohn Assurnirars II., der Begründer der
assyrischen Weltmacht, dehnte die Grenzen des Reichs über Iran
bis zum Persischen Golf und nach Arabien aus, unterjochte
Babylonien sowie den westlichen Teil des Hochlandes von Iran und
vollendete in zahlreichen Feldzügen die Unterwerfung Syriens,
setzte nach der Ermordung Pekahs Hosea als König von Israel
ein, führte viele angesehene Einwohner als Gefangene ab und
eroberte 732 Damaskus, dessen König Rezin er hinrichten
ließ. Die Thaten, welche die Bücher des Alten Testaments
einem König Phul (s. d.) zuschreiben, kommen thatsächlich
T. zu.
Tigranes, der Große, König von Armenien, geb.
121 v. Chr., aus dem Geschlecht der Arsakiden, bestieg 95 den
Thron, eroberte Atropatene, Mesopotamien, das nördliche Syrien
und Kappadokien, gründete die neue großartige
Königsresidenz Tigranokerta am Nikephorios und nannte sich
König der Könige. Als er den Römern die Auslieferung
seines zu ihm geflüchteten Schwiegervaters Mithridates
verweigerte, wurde er 69 von Lucullus bei Tigranokerta besiegt und
bis Artaxata verfolgt, wo 68 Lucullus durch eine Meuterei in seinem
Heer zur Umkehr gezwungen wurde. Nach der zweiten Niederlage des
Mithridates durch Pompejus unterwarf er sich 66 diesem und empfing
Armenien unter römischer Oberhoheit zurück, mußte
aber alle Eroberungen abtreten und 6000 Talente zahlen. Er starb
36.
Tigre (franz., spr. tihgr), kleiner Reitknecht,
Groom.
Tigré (Tigrié), der nördliche Teil
Abessiniens, welcher zeitweilig ein eignes Reich bildete und aus
den Landschaften Hamasên, Saraë, Adiabo, Schiré,
Agamé, Enderta und dem eigentlichen T. besteht. Die
hauptsächlichsten Flüsse des Landes sind der Mareb und
Takazzé; in Bezug auf seine Bodengestaltung und Produkte s.
Abessinien. Die Bewohner des Landes, dem äthiopischen Stamm
angehörig, unterscheiden sich von ihren südlichen
Nachbarn, den Amhara, in mancher Beziehung, namentlich auch durch
die Sprache. Dieselbe (Tigrinja; Grammati von. Prätorius,
Halle 1872, und von Schreiber, Wien 1886) ist eine Tochtersprache
des Altäthiopischen (Geez), wird aber nicht geschrieben;
dagegen wird das ebenfalls dem Geez verwandte Tigrié oder
Baose in der Samhara und von den Beni Amer an der Seeküste
unter 16-18° nördl. Br. gesprochen. Hauptstadt von T. ist
Adua. Das selbständige Reich T. ging 9. Febr. 1855 in der
Schlacht von Debela (in Semién) zu Grunde, wo sein letzter
Herrscher, Ubié, von Theodoros II. besiegt und um sein Land
gebracht wurde. Auch in der Folge blieb T. mit dem Zentralstaat
(Amhara) vereinigt. S. Karte "Ägypten etc."
Tigri, Giuseppe, ital. Schriftsteller, geb. 22. Nov. 1806
zu Pistoja, widmete sich aus äußern Anlaß dem
geistlichen Stand, lebte aber als Abbate ganz den Wissenschaften
und gründete in den 30er Jahren ein Lehrinstitut, welches bis
1850 bestand. 1861 machte er eine Reise durch die Schweiz,
Deutschland, Holland, Belgien, England und Frankreich, wirkte dann
als Inspektor der Schulen von Pistoja und San Miniato und als
Studienprovisor in Caltanissetta, endlich als Bibliothekar der
Biblioteca Forteguerri in Pistoja, wo er 9. März 1882 starb.
Er schrieb: "Le selve" (1844, 2. Aufl. 1868), ein ausgezeichnetes
Lehrgedicht über die Pflege des Kastanienbaums, in welchem
sich mit dem Lehrhaften fesselnde Naturschilderungen und
historische Exkurse verbinden, und veröffentlichte die "Canti
popolari toscani", sein Hauptwerk, das in mehreren Auflagen (am
besten, Flor. 1856) verbreitet ist. Nicht geringern Beifall fand
sein durch pittoreske Schilderungen ausgezeichneter Roman "La
selvaggia de' Vergiolesi" (1870, 2. Aufl. 1876). Sein
Lleblingsthema, das Leben der Gebirgsbewohner, behandelte er
teilweise auch in den Schriften: "Il montanino toscano volontario
alla guerra dell' indipendenza italiana 1859" (1860), "Volontario e
soldato" (1872), "Celestina, bozzetto montanino" (1880) u.
"Matilde", denen eine historische Novelle in Versen (1881) folgte.
Aus Tigris Feder stammt ferner die gekrönte Preisschrift
"Contro i pregiudizii popolari etc." (1870); die Reisebeschreibung
"Da Firenze a Costantinopoli e Mosca" (1877) u. a.
Tigris, Tiger.
Tigris (v. altpers. tigra, "Pfeil", assyr. Chiddekel,
armen. Deklath, arab. Didschle), einer der Hauptströme von
Vorderasien, nächst dem Euphrat, mit dem er das
altberühmte Kulturland Mesopotamien umschließt, der
größte Fluß in der asiatischen Türkei,
entspringt in mehreren Quellflüssen am Südrand der
armenischen Taurusketten in Kurdistan. Der westliche, vorzugsweise
Didschle oder Schatt genannt, entspringt südlich von Charput
unweit der großen Biegung des Euphrat, fließt bei
Diarbekr vorüber, wendet sich östlich und nimmt in enger
Gebirgsschlucht bei Til den östlichen Arm, Bohtântschai
genannt, auf, der südlich von Wan entspringt, und in den der
dritte Quellfluß, Bitlistschai, mündet. Von nun an
behält der T. im allgemeinen südöstliche Richtung
bei. Er fließt zunächst mit bedeutenden Windungen durch
die assyrische Ebene an Mosul und Bagdad vorüber, nähert
sich dort dem Euphrat, durch zahlreiche, zum großen Teil
trockne Kanäle mit ihm
709
Tiguriner - Tilgner.
verbunden, bis auf ca. 30 km, nimmt in seinem untern Lauf den
Namen Amara an und vereinigt sich nach einem Laufe von
ungefähr 1500 km bei Korna mit dem Euphrat zu einem einzigen
Strom, dem Schatt el Arab (s. d.). Bei der Vereinigung beider
Ströme ist der T. weit wasserreicher und reißender als
der Euphrat. Von den zahlreichen Nebenflüssen des T. sind die
bedeutendsten: Chabur, die beiden Zab und Diala. Der vereinigte
Strom nimmt noch die Kercha und den Kârûn auf. Der T.
ist von Mosul an schiffbar (für Kellek, d. h. Flöße
aus aufgeblasenen Tierhäuten, von Diarbekr an), hat eine
ansehnliche Breite und Tiefe, aber auch viele Felsenklippen; der
vereinigte Strom ist auch für große Schiffe fahrbar,
doch wird die Einfahrt an der Mündung durch Sandbänke
sehr erschwert. Die Ufer des T., einst Sitze hoher Kultur und
Zivilisation, sind jetzt verödet und, mit Ausnahme der Orte
Diarbekr, Mosul und Bagdad, fast nur von nomadischen Kurden- und
Araberstämmen bewohnt.
Tiguriner, kelt. Volk, welches den helvetischen Pagus
Tigurinus bewohnte. Die T. erscheinen zuerst in Verbindung mit den
Cimbern, mit denen sie das südliche Gallien verwüsteten;
107 v. Chr. schlugen sie am Lemanischen See den Konsul L. Cassius;
dann folgten sie 102 den Cimbern nach Osten, drangen aber nicht in
Italien ein, sondern kehrten in ihre Heimat zurück, nahmen 58
an dem Zug der Helvetier nach dem südlichen Gallien teil,
wurden von Cäsar an der Saône geschlagen und zur
Rückkehr nach der Schweiz gezwungen.
Tikal (Bat), 1) siames. Silbermünze, 15,228 g
schwer, 0,928 fein, im Wert von 2,544 Mk.;
2) Gewicht in Siam (= 4 Salung à 2 Fuang = 15,292 g) und
in Birma (= 1/100 Pehtha = 16,556 g).
Tikei, Insel, s. Romanzow.
Tiki-Tiki, Zwergvolk, s. Akka.
Tikmehl, s. Arrow-root.
Tikotschin (Tikoczyn), Stadt im russisch-poln.
Gouvernement Lomsha, am Narew, mit 3 Kirchen, lebhaftem
Grenzverkehr und (1882) 6008 Einw.
Tikuna, Indianerstamm im Innern von Brasilien, welcher
mit vielen andern größern und kleinern Völkern
(Miranha am obern Yapure, Catauaxi am Coury, Botokuden im O. des
São Francisco u. a.) innerhalb des Gebiets der Tupi-Guarani
und der Omagua wohnt. Wahrscheinlich hängen die T. nicht mit
jenen zusammen, bilden vielmehr die zersprengten Überreste
eines oder mehrerer größerer Stämme. S. Tafel
"Amerikanische Völker", Fig. 22 u. 23.
Tikunagift, s. Pfeilgift.
Tilborch, Gillis, niederländ. Maler, geboren um 1625
zu Brüssel, Schüler von D. Teniers, wurde 1654 Meister
daselbst und starb um 1678. Er hat in der Art seines Meisters und
Craesbeecks Genrebilder aus dem Bauernleben (Hochzeiten,
Wirtshausszenen, Schlägereien u. dgl. m.) gemalt. Hauptwerk:
Bauernhochzeit (in Dresden).
Tilburg, Stadt in der niederländ. Provinz
Nordbrabant, durch Eisenbahnen mit Breda, Nimwegen, Boxtel und
Turnhout verbunden, hat ein Kantonalgericht, eine höhere
Bürgerschule, einen erzbischöflichen Palast, 4
römisch-katholische und eine reform. Kirche, eine Synagoge,
starke Tuch- und Wollzeugfabrikation, Gerberei etc. (im ganzen
über 300 Fabriken) und (1887) 32,016 Einw.
Tilbury (engl., spr. tillberi), Art Kabriolett, ein
leichter zweiräderiger Gabelwagen.
Tilbury (spr. tillberi). Dorf in der engl. Grafschaft
Essex, an der Themse, Gravesend gegenüber; dabei das Fort T.,
ursprünglich von Heinrich VIII. erbaut. Hier hielt die
Königin Elisabeth Heerschau über die englische Armee, als
die spanische Armada England bedrohte. Oberhalb sind seit 1882
großartige Docks mit 168 Hektar Wasserfläche und 11 m
Tiefe gebaut worden.
Tilde (span.), "Strichlein", insbesondere das Zeichen auf
dem (spanischen) ñ, z. B. señor (spr.
ssénjor).
Tilden, Samuel Jones, amerikan. Staatsmann, geb. 9. Febr.
1814 zu New Lebanon im Staat New York, studierte Jura und ward 1841
Advokat in New York. Frühzeitig widmete er sich der Politik,
wurde bald ein hervorragender Führer der demokratischen Partei
und war viele Jahre Präsident des demokratischen Komitees,
eine Stellung, die ihm großen Einfluß gab. Er that sich
besonders 1871 durch Sprengung des "Tammany-Rings" (s. d.) hervor.
1874 ward er zum Gouverneur des Staats New York gewählt und
1876 von den Demokraten als Gegenkandidat für die
Präsidentschaft gegen den Republikaner Hayes aufgestellt. T.
siegte zwar, doch kassierte die republikanische Majorität des
zur Prüfung der Wahlstimmen berufenen Kongreßausschusses
mehrere für ihn abgegebene Stimmen und proklamierte Hayes als
Präsidenten. Auch zum Gouverneur von New York wurde T. 1880
nicht wieder gewählt, zog sich ganz vom politischen Leben
zurück und starb 4. Aug. 1886. Seine "Writings and speeches"
wurden von Bigelow herausgegeben (New York 1885, 2 Bde.).
Tile Kolup, s. Holzschuh.
Tilguer, Viktor, Bildhauer, geb. 25. Okt. 1844 zu
Preßburg, bildete sich auf der Akademie zu Wien und bei den
Professoren Bauer, Gasser und Schönthaler und erhielt noch
während seiner Studienzeit den Auftrag, die Büste des
Komponisten Bellini für das Opernhaus und die Statue des
Herzogs Leopold VI. für das Arsenal auszuführen. Durch
den Einfluß des französischen Bildhauers Deloye, welcher
1873 eine Zeitlang in Wien thätig war, und an den sich T.
anschloß, wurde dieser auf den naturalistischen Stil der
Barock- und Rokokoplastik geführt, in dessen Formensprache er
sich, ähnlich wie R. Begas in Berlin, fortan bewegte. Seine
ersten hervorragenden Schöpfungen waren
Porträtbüsten, unter denen die von Charlotte Wolter
(1873, s. Tafel "Bildhauerkunst X", Fig. 12) seinen Namen zuerst
bekannt machte. Nachdem er 1874 eine Reise nach Italien
unternommen, entfaltete er in Wien eine umfangreiche
Thätigkeit auf dem Gebiet der Porträt- und dekorativen
Plastik. Von seinen durch höchste Lebendigkeit, feinste
Individualisierung und originelle Komposition ausgezeichneten
Porträtstatuen und -Büsten sind die hervorragendsten:
Kaiser Franz Joseph, Kronprinz Rudolf, die Maler Führich,
Schönn und Leopold Müller, H. Laube, Bauernfeld, Rubens
(für das Künstlerhaus in Wien), von seinen dekorativen
Arbeiten: die Figuren der Phädra und des Falstaff für das
neue Opernhaus, Triton und Najade (Brunnengruppe in Erz im
Volksgarten zu Wien), Brunnen- und Bassinsgruppen für die
kaiserlichen Villen in Ischl und im Tiergarten bei Wien, für
den Hochstrahlbrunnen beim Palais Schwarzenberg in Wien (1887) und
für Preßburg (1888). In diesen Figuren, Gruppen und
Zieraten für Brunnen hat T. eine reiche Phantasie entfaltet,
welche auch dem Ausdruck des Monumentalen gerecht wird. Für
Preßburg hat T. ein Denkmal des Komponisten Hummel
geschaffen. In neuerer Zeit hat er an Porträtbüsten und
Genrestatuetten glückliche Versuche in der Polychromie
gemacht. Er ist Professor an der Wiener Kunstakademie, in welcher
Stellung er zahlreiche
710
Tilgungsfonds - Tilly.
Schüler gebildet hat, Mitglied der Berliner Kunstakademie
und besitzt die große goldene Medaille der Berliner
Kunstausstellung.
Tilgungsfonds (Tilgestamm, engl. Sinking fund), ein
Kapitalfonds, welcher früher in mehreren Staaten zu dem Zweck
gebildet worden war, die allmähliche Tilgung der
Staatsschulden zu erleichtern. Anfänglich durch eine
Ausstattung der Staatskasse gegründet und auch durch
Überweisung gewisser Überschüsse vermehrt, sollten
diesem Stock alljährlich die ersparten Zinsen abgetragener
Schuldposten so lange zufließen, bis er, um Zins und
Zinseszins anwachsend, die ganze Schuld in sich aufnehmen und so
die völlige Abtragung bewirken müßte. Ein solcher
T. (Sinking fund) wurde 1716 in England durch Rob. Walpole
eingerichtet. Alle getilgten Schuldbriefe sollten als ein
Vermögen der Anstalt betrachtet und derselben fortwährend
aus der Staatskasse verzinst werden. Doch wurde dieses Ziel nicht
erreicht und endlich nach mehreren Wandlungen 1828 der Grundsatz
angenommen, daß künftig nur so viel in jedem Jahr
getilgt werden solle, als von den Einkünften nach Bestreitung
des Staatsaufwandes wirklich übrigbleibe. Diesen Grundsatz der
freiern Tilgungsweise hat man heute fast in allen Staaten
aufgestellt, in welchen überhaupt Schulden abgetragen werden.
Insbesondere wurde man hierzu durch die Thatsache gezwungen,
daß häufig neue Anleihen unter ungünstigern
Bedingungen als denen aufgenommen werden mußten, unter
welchen man tilgte. So wurden in England 1793-1813 für 14
Mill. Pfd. Sterl. weniger Obligationen eingelöst, als man nach
dem Emissionskurs der kontrahierten Anleihen für den gleichen
Betrag zu vertreiben genötigt war. In Frankreich entstand ein
Verlust von 105 Mill. Fr. am Schuldstamm daraus, daß man im
Durchschnitt jeden Frank Rente für 18¾ Fr.
zurückkaufte und zugleich bei den neuen Rentenverkäufen
nur 15¾ Fr. dafür erhielt.
Tilgungsrenten, die zur Amortisation von
Hypothekenschulden an landwirtschaftliche Kreditkassen gezahlten
Beiträge.
Tilgungsschein, s. Modifikation.
Tilia, Pflanzengattung, s. Linde.
Tiliaceen (lindenartige Gewächse), dikotyle Familie
aus der Ordnung der Kolumniferen, Bäume und Sträucher,
wenige Kräuter, mit meist wechselständigen Blättern
mit freien, meist abfallenden Nebenblättern. Die Blüten
sind gewöhnlich zwitterig, achsel-, seltener endständig.
Die 4 oder 5 Kelchblätter haben klappige Knospenlage und sind
hinfällig. Die Blumenblätter stehen in derselben Anzahl
abwechselnd mit den Kelchblättern am Grunde des flachen oder
stielförmigen Blütenbodens, sind genagelt, ganz oder an
der Spitze zerschlitzt, in der Knospenlage dachig, ebenfalls
abfallend, bisweilen ganz fehlend. Die meist zahlreichen, durch
Spaltung aus 5 oder 10 Grundanlagen hervorgehenden
Staubgefäße stehen auf dem Blütenboden, sind alle
fruchtbar, bisweilen die äußern steril oder auch die
innern; in manchen Fällen sind sie gruppenweise miteinander
verwachsen. Der oberständige Fruchtknoten besteht aus 2-10
quirlständigen Fruchtblättern und hat demgemäß
2-10 Fächer, welche bisweilen durch eine sekundäre
Scheidewand zwei-, seltener durch Querscheidewände
mehrfächerig sind. Die Frucht ist entweder eine meist
fachspaltige Kapsel oder nicht aufspringend, leder- oder holzartig,
oder eine Steinbeere. Die Samen haben ein meist fleischiges
Endosperm und in der Achse desselben einen geraden Keimling mit
flachen, blattartigen Kotyledonen. Vgl. Bocquillon, Mémoire
sur le groupe des Tiliacées. Adansonia VII. Die Familie
zählt gegen 300 Arten, von denen die meisten in den Tropen,
wenige, wie die Gattung Tilia, in der nördlichen
gemäßigten Zone einheimisch sind. Von einigen sind die
saftigen Früchte und die ölreichen Samen genießbar.
Andre, wie die Linde und Corchorus olitorius, liefern Bastfasern
(Jute) und Nutzholz. Fossil sind Arten der Gattungen Tilia L.,
Grewia Juss., Apeibopsis Heer u. a. aus Tertiärschichten
bekannt.
Tilla, die in Mittelasien kursierende Goldmünze; die
kleine T., in Chiwa und Chokand, hat 12 Tenga, die große T.,
in Bochara, 20 Tenga.
Tillandsia L. (Haarananas), Gattung aus der Familie der
Bromeliaceen, meist kleine Kräuter im heißen Amerika,
mit dünnen Stengeln, als Schmarotzer auf Bäumen wachsend.
T. usneoides L., besonders in Guayana, hängt mit den
fadenförmigen ellenlangen und untereinander verschlungenen
Luftwurzeln von den Ästen der Bäume herunter, wie
Flechten. Die von der Rinde entblößten Luftwurzeln
kommen als braune oder schwarze, bis 22 cm lange Faser (Baumhaar,
Caragate, Crin végétal) in den Handel und bilden ein
treffliches Surrogat des Roßhaars für Polsterungen.
Tillemont (spr. tilmóng), Sébastien le Nain
de, Kirchenhistoriker, geb. 30. Nov. 1637 zu Paris, ward bei den
jansenistischen Theologen zu Port Royal gebildet, wo er auch bis zu
dessen Aufhebung 1679 lebte; dann zog er sich auf sein zwischen
Vincennes und Montreuil gelegenes Gut T. zurück, wo er 10.
Jan,. 1698 starb. Seine Hauptwerke sind die "Mémoiren pour
servir à l'histoire ecclésiastique des six primiers
siècles" (Par. 1693-1712, 16 Bde.) und "Histoire des
empereurs et des audres princes, qui ont regné durant les
six premiers siècles de l'église" (1691-1738, 6 Bde.,
unvollendet). Von seiner "Vie de saint Louis" erschien eine neue
Ausgabe 1846-51, 6 Bde.
Tilletía Tul., Pilzgattung, s. Brandpilze.
Tillicoultry (spr. tillikúhtri), Stadt in
Clackmannanshire (Schottland), im Thal des Devon, hat bedeutende
Wollwarenfabrik und (1881) 3732 Einw.
Tillodoutier, s. Zahnlücker.
Tilly, Johann Tserklaes, Graf von, berühmter
Feldherr des Dreißigjährigen Kriegs, geb. 1559 auf dem
Schloß Tilly in Brabant, ward in einem Jesuitenkloster
erzogen, trat zuerst in spanische Kriegsdienste, in denen er unter
Alexander von Parma seine militärische Schule durchmachte,
dann in lothringische, 1598 in kaiserliche Dienste, focht 1600 als
Oberstleutnant in Ungarn gegen die Insurgenten und Türken,
stieg 1601 zum Obersten eines Wallonenregiments und nach und nach
zum Artilleriegeneral auf und erhielt 1610 von Maximilian I. von
Bayern die Reorganisation des bayrischen Kriegswesens
übertragen. Beim Ausbruch des Dreißigjährigen
Kriegs zum Feldmarschall der katholischen Liga ernannt, gewann er
8. Nov. 1620 die Schlacht am Weißen Berg, brach 1621 gegen
den Grafen Ernst von Mansfeld auf und verfolgte ihn bis in die
Oberpfalz, dann in die Rheinpfalz, wurde 27. April 1622 von dem
Markgrafen Georg Friedrich von Baden-Durlach und Mansfeld bei
Wiesloch geschlagen, besiegte aber dann den erstern 6. Mai bei
Wimpfen am Neckar, hierauf den Herzog Christian von Braunschweig
20. Juni bei Höchst a. M. und eroberte Heidelberg, Mannheim
und Frankenthal. Infolge des entscheidenden Siegs 5. und 6. Aug.
1623 bei Stadtlohn im Münsterschen
711
Tilos - Timäos.
über den Herzog von Braunschweig ward T. vom Kaiser in den
Grafenstand erhoben. Er blieb zunächst in Niedersachsen
stehen, wo er die gewaltsame Restitution der protestantischen
Bistümer und Klöster an die katholische Kirche und die
Jesuiten ins Werk setzte und den niedersächsischen Kreis zum
Kampf zwang, schlug 27. Aug. 1626 den Dänenkönig
Christian IV. bei Lutter am Barenberg, eroberte mit den
Kaiserlichen unter Wallenstein Schleswig-Holstein und Jütland
und zwang den König 12. Mai 1629 zum Abschluß des
Friedens von Lübeck. 1630 an Wallensteins Stelle zum
Generalissimus der ligistischen und kaiserlichen Truppen ernannt,
übernahm er die Durchführung des Restitutionsedikts in
Norddeutschland und begann zu diesem Zweck die Belagerung von
Magdeburg. Zwar gelang es ihm nicht, Gustav Adolfs Vordringen in
Pommern zu hindern; aber Magdeburg eroberte er 20. Mai 1631. Doch
war die Eroberung für ihn nutzlos, da der Brand die Stadt in
einen Trümmerhaufen verwandelte. Er konnte sich daher an der
Niederelbe gegen den Schwedenkönig nicht behaupten und fiel in
Sachsen ein, das er plünderte und verwüstete. Hierdurch
trieb er den sächsischen Kurfürsten zum Bündnis mit
Gustav Adolf, deren vereinigtem Heer er 17. Sept. 1631 in der
Schlacht bei Breitenfeld, in welcher der König seine
überlegene Kriegskunst entwickelte, erlag; T. selbst wurde
verwundet, sein Heer löste sich auf. Er eilte hierauf nach
Halberstadt, wo er Verstärkungen an sich zog, und brach dann
nach dem von den Schweden bedrohten Bayern auf. Bei Verteidigung
des Lechübergangs bei Rain 5. April 1632 ward ihm durch eine
Falkonettkugel der rechte Schenkel zerschmettert, und er starb
infolge davon 20. April d. J. in Ingolstadt. T. war von mittlerer
Statur und hager. Scharfe Gesichtszüge und große, unter
buschigen grauen Wimpern hervorblickende, feurige Augen verrieten
die eiserne Härte seines Charakters. Er haßte Aufwand
und äußere Ehrenbezeigungen, verschmähte es, sich
an der Kriegsbeute zu bereichern, und hielt auch in seinem Heer
strenge Mannszucht. Vor allem war er von kirchlichem Eifer beseelt,
die Ausrottung der Ketzerei in Deutschland war ihm Gewissenssache,
und er hat dem Kampf den fanatisch-religiösen Charakter mit
aufdrücken helfen. Dagegen war er kein roher Wüterich,
wie ihn die protestantische Geschichtschreibung darzustellen
pflegte. Die neuern katholischen Schriftsteller (O. Klopp, T. im
Dreißigjährigen Krieg, Stuttg. 1861, 2 Bde., und
Villermont, T., Tournai 1859, 2 Bde.; deutsch, Schaffh. 1860) haben
T. mit Erfolg von diesem Vorwurf gereinigt, gehen aber in ihrer
sonstigen Rettung zu weit. Von dem Vorwurf, T. habe die
Zerstörung Magdeburgs gewollt, reinigten ihn die Protestanten
Heising ("Magdeburg nicht durch T. zerstört", 2. Aufl., Berl.
1855) und Wittich ("Magdeburg, Gustav Adolf und T.", das. 1874). Im
J. 1843 ward ihm in der Feldherrenhalle zu München eine Statue
(Modell von Schwanthaler) errichtet.
Tilos (Episkopi, Piskopi, das alte Telos), türk.
Felseninsel im Ägeischen Meer, nordwestlich von Rhodos, mit
gutem Hafen, Resten der alten Stadt Telos und 800-1000 griech.
Einwohnern.
Tilsit, Kreisstadtim preuß. Regierungsbezirk
Gumbinnen, am Einfluß der Tilse in die Memel und an der Linie
Insterburg-Memel der Preußischen Staatsbahn, 10 m ü. M.,
hat 4 evangelische (darunter eine runde litauische) und eine kath.
Kirche, eine Synagoge, 3 Bethäuser, ein schönes Rathaus,
2 neue große Kasernen und (1885) mit der Garnison (ein
Infanteriebataillon Nr. 41 und ein Dragonerregiment Nr. 1) 22,422
Einw. darunter 21,064 Evangelische, 557 Katholiken, 285 sonstige
Christen und 514 Juden. Die Industrie ist besonders wichtig in
Eisengießerei und Maschinenbau, Hefen- und Spiritus-, Gips-,
Kunstwolle-, Chemikalien-, Knochenkohlen-, Seifen-, Kunststein-,
Käse-, Schnupftabaks- und Möbelfabrikation, auch befinden
sich dort 4 Dampfmahl- und 8 Dampfschneidemühlen, 2
Ölmühlen, 4 Bierbrauereien, eine Schaumweinfabrik, eine
Holzimprägnieranstalt, eine Kalkbrennerei etc. Der Handel,
unterstützt durch eine Korporation der Kaufmannschaft, eine
Reichsbankstelle (Umsatz 1887: 45 1/3 Mill. Mk.) und neben der
Eisenbahn durch die Schiffahrt auf der Memel, ist besonders
bedeutend in Tabak, Holz, Getreide, Steinkohlen, Flachs, Öl,
in Schuhwaren etc., auch hat T. besuchte Pferdemärkte. Die
Stadt ist Sitz eines Landgerichts und eines Hauptzollamtes und hat
ein Gymnasium, ein Realgymnasium, einen Kunstverein, ein Waisenhaus
etc. Zum Landgerichtsbezirk T. gehören die neun Amtsgerichte
zu Heinrichswalde, Heydekrug, Kaukehmen, Memel, Prökuls,
Ragnit, Ruß, Skaisgirren und T. 4 km westwärts von T.
fängt die Tilsiter Niederung an, ein fruchtbarer Landstrich im
Bereich der Mündungsarme der Memel, der sich von N. nach S.
80, von O. nach W. 53 km weit ausdehnt und am Kurischen Haff auch
den Forst von Ibenhorst (mit Elentieren) umschließt.
Geschichtlich merkwürdig ist T. durch den am 7. und 9. Juli
1807 von Napoleon I. daselbst abgeschlossenen Frieden zwischen
Frankreich und Rußland, bez. Preußen, welch letzteres
die Hälfte seines Gebiets verlor. Vgl. "Aus Tilsits
Vergangenheit" (2. Aust., Tilsit 1888, 2 Tle.).
Tim, Kreisstadt im russ. Gouvernement Kursk, am
Fluß T. (Nebenfluß der Sosna), mit 2 Kirchen, Obst-und
Gartenbau und (1885) 4543 Einw.
Timan (Timansche Tundra), Landstrich im Mesenschen Kreis
des russ. Gouvernements Archangel, beginnt am linken Ufer der
Petschora, reicht im W. bis zur Halbinsel Kanin, im N. bis zum
Eismeer und wird im S. von der Zylma und Pesa begrenzt. In der
Mitte zieht sich der Timansche Höhenzug, eine bis zu 63 m
relativer Höhe sich erhebende Wasserscheide zwischen der
Petschora und Dwina, vom obern Lauf der Wytschegda im Gouvernement
Wologda bis zum Eismeer. Die Tundra ist Moosweide. von Flüssen
durchschnitten, voll fischreicher Seen und gehört den
Samojeden.
Timanthes, griech. Maler, gebürtig von der Insel
Kydnos, Zeitgenosse des Zeuxis und Parrhasios, berühmt durch
sein Gemälde der am Altar stehenden Iphigenia, mit welchem er
seinen Nebenbuhler Kolotes von Teos besiegte. Tiefe und
Bedeutsamkeit der geistigen Auffassung seiner Stoffe zeichneten ihn
aus.
Timäos, 1) Pythagoreischer Philosoph aus Lokri, von
welchem der die Naturphilosophie behandelnde Dialog Platons den
Namen führt, lebte gegen 400 v. Chr. und bekleidete in seiner
Vaterstadt die höchsten Ehrenstellen. Die ihm beigelegte, aber
unechte Schrift "Von der Weltseele" wurde (außer in den
Ausgaben des Platon von Bekker, Hermann etc.) von Gelder (Leid.
1836) herausgegeben, übersetzt von C. C. G. Schmidt (Leipz.
1835). Vgl. Anton, De origine libelli etc. (Erfurt 1883).
[Wappen von Tilsit.]
712
Timavo - Timoleon.
2) Griech. Geschichtschreiber aus Tauromenium, um 290 v. Chr.,
wurde vom Tyrannen Agathokles aus Syrakus verbannt. Die Fragmente
seiner Geschichte Siziliens sowie der Geschichte des Kriegs der
Römer mit Pyrrhos sammelte Müller in "Historicorum
graecorum fragmenta" (Bd. 1, Par. 1841).
3) Griech. Grammatiker und Sophist, lebte wahrscheinlich im 3.
Jahrh. n. Chr. und schrieb ein Platonisches Wörterbuch, wovon
noch ein Teil vorhanden ist (hrsg. von Ruhnken, Leid. 1754 u. 1789;
wiederholt von Koch, 2. Aufl., Leipz. 1833).
Timavo (der Timavus der Römer), Fluß im
öfterreich. Küstenland, verliert sich als Rekka bei St.
Kanzian in den Grotten des Karstes, kommt nach 37 km unterirdischen
Laufs bei San Giovanni unfern Duino wieder zu Tage und
ergießt sich 4 km tiefer in den Golf von Triest.
Timbalan, Inseln, s. Tambilan.
Timbale (franz., spr. tängbáll), Pauke; in
der Kochkunst eine runde, schlichte Form von Teig, welche mit
Ragout, Farce, Maccaroni etc. gefüllt wird.
Timbo, Hauptstadt von Futa Dschallon in Westafrika, in
der Nähe der Quellen des Bafing, 758 m ü. M., mit 2500
Einw. Nur die Nachkommen der ersten Gründer des Reichs
dürfen hier wohnen.
Timbre (spr. tängbr'), nach gewöhnlichem
Sprachgebrauch s. v. w. Klangfarbe; im engern Sinn die durch die
Verschiedenartigkeit des resonierenden Materials bedingte
Färbung des Klanges im Gegensatz zu der durch die
Zusammensetzung des Klanges aus Partialtönen bedingten; auch
s. v. w. Stempel, Stempelzeichen, daher T.-poste,
Postbriefmarke.
Timbuktu (Tumbutu), altberühmte Handelsstadt am
Südrand der Sahara, unter 3° 5' westl. Br. v. Gr., 245 m
ü. M., nominell zum Fulbestaat Massina gehörig, aber
unter dem Einfluß der Tuareg stehend, 15 km nördlich vom
Niger, hat über 1 Stunde im Umfang und gegen 1000
einstöckige, flach bedachte Thonwohnungen nebst einigen
hundert runden Mattenhütten. Die einzigen öffentlichen
Gebäude von T. sind die drei Moscheen, darunter die 1325 von
Manssa Musa angefangene Dschingereber ("große Moschee") im
SW. der Stadt, ein stattliches Gebäude von 80 m Länge und
59 m Breite mit 12 Schiffen und einem hohen viereckigen Turm. Die
ansässige Bevölkerung, die etwa 20,000 Seelen
(mohammedanische Neger und Araber) zählt, besteht aus Sonrhai,
Arabern, Tuareg, Fulbe, dann Bambarra- und Mandinkanegern.
Industrie ist in T. wenig; von einiger Bedeutung ist dagegen der
Handel, welcher infolge der großen nördlichen Biegung
des Niger sich hier konzentriert. Der Hafen der Stadt ist das von
2000 Sonrhai bewohnte Kabaraam Nordufer des Niger. Früher
erstreckte sich ein Arm des Flusses bis an T. heran.
Haupthandelsartikel sind: Gold (namentlich von Bambuk und Bure
gebracht), Kolanüsse, Salz, Elfenbein, Gummi,
Straußfedern, Sklaven, von europäischen Manufakturen
rotes Tuch, Matratzen, Leibbinden, Spiegel, Messer, Zucker, Mehl,
Thee, Korallen etc., von arabischen Waren besonders Tabak, aus Tuat
Datteln. Die Stadt T. war seit Jahrhunderten ein Rätsel, mit
dessen Lösung sich die europäischen Geographen und
Reisenden beschäftigten, ohne ihr Ziel zu erreichen. Der Brite
Mungo Park drang 1805 bloß bis zum Hafenort Kabara vor. Laing
gelangte zwar 1826 von Tripolis aus nach T., wurde jedoch wenige
Tage darauf ausgewiesen und auf der Rückkehr ermordet.
Glücklicher war der Franzose Caillié, welcher von
Sierra Leone aus das Innere von Afrika bereiste und 20. April bis
3. Mai 1828 in T. verweilte, aber, weil er sich seiner Sicherheit
wegen verborgen halten mußte, an umfassendern Beobachtungen
verhindert wurde. Der erste Europäer, welcher von O. aus bis
T. vordrang, war Heinrich Barth, welcher 7. Sept. 1853 daselbst
anlangte und, vom Scheich El Bakay freundlich aufgenommen, bis 9.
Juli 1854 in der Stadt und Umgegend verweilte. 1880 wurde T. von
Lenz, der nur noch einen Schatten von seiner einstmaligen
Größe und Bedeutung fand, 1886 dessen Hafenstadt Kabara
von einem französischen Kanonenboot besucht.
Die Stadt T. wurde um 1100 n. Chr. von den Tuareg
gegründet. Manssa Musa, König des islamitischen Reichs
Melli (1311-31), eroberte 1326 auch T., welches sich nun als Teil
eines mächtigen Reichs schnell vergrößerte und bald
ein Handelsplatz ersten Ranges wurde. Gegen Ende der Regierung
Manssa Musas (1329) ward es zwar von dem heidnischen König des
Negerstaats von Mossi großenteils zerstört, jedoch schon
von Manssa Sliman von 1335 an wiederhergestellt. Seit seiner
Wiederherstellung gelangte T., begünstigt durch seine Lage am
Nordpunkt des Hauptstroms vom Sudân, auf der Grenze zwischen
dem dicht bevölkerten Süden und dem Karawanenhandel
treibenden Norden, dazu als eine der heiligen Städte des Islam
rasch zu hoher Blüte. 1591 fiel es mit den Nigerlandschaften
in die Hände der Marokkaner, bis die Auelimmiden, ein
mächtiger Zweig der Tuareg, 1780 das große Reich Haussa
am Nordufer des Niger gründeten, welchem auch T. unterworfen
wurde. Zu Anfang des 19. Jahrh. wanderten die Fulbe in die
Nigerlandschaften ein und bemächtigten sich nach dem Zerfallen
der Reiche im Sudân 1810 auch der Stadt T., die, ohne einem
Herrscher zu unterstehen, von den Fulbe und Tuareg
unaufhörlich bedroht wird. Vgl. Barth, Reisen in
Zentralafrika, Bd. 4 (Gotha 1857); Lenz, Timbuktu (Leipz. 1884, 2
Bde.).
Timeo Danaos etc. (lat.), s. Danaer.
Times (engl., spr. teims, "die Zeiten"), die
größte engl. Zeitung, wurde 13. Jan. 1788 von John
Walter in London gegründet und nimmt seit geraumer Zeit die
Stellung des einflußreichsten Weltblattes ein. Sie erscheint
täglich am Morgen, seit 1877 auch auszugsweise in einer
Wochenausgabe.
Timid (lat.), schüchtern, zaghaft.
Timmene, Negerstamm in Afrika, s. Temne.
Timok, Fluß der Balkanhalbinsel, bildet sich aus
dem östlichen Trgovischki-T., der auf der Stara Planina, und
dem westlichen Svrlyitschki-T., der auf der Babina Glava
entspringt. Beide vereinigen sich bei Knjaschewatz in Serbien zum
T., der nördlich zur Donau fließt, bei Saitschar den
Mali-T. aufnimmt und in seinem Unterlauf die Grenze (auch die
sprachliche) zwischen Serbien und Bulgarien bildet.
Timokratie (griech.), Staatsverfassung, welche die
politischen Rechte und Pflichten der Bürger nach Maßgabe
des Vermögens festsetzt, wie z. B. die Solonische Verfassung
in Athen, die Servianische in Rom.
Timoleon, Korinther, geboren um 411 v. Chr., edel und
mild, aber von unauslöschlichem Haß gegen alle Tyrannei
beseelt, ließ sogar 366 seinen Bruder Timophanes, der sich an
der Spitze von 1100 Söldnern der Alleinherrschaft
bemächtigen wollte, töten und lebte dann 20 Jahre in
Zurückgezogenheit. Auf den Hilferuf der Syrakusier 347 mit
einem kleinen Heer geworbener Krieger nach Sizilien geschickt,
bemächtigte er sich erst der Stadt, 343 auch der Burg von
Syrakus, die er zerstören ließ, stellte dann die
demokratische Verfassung wieder her und leitete die
713
Timomachos - Timur.
Stadt mit Gerechtigkeit und Uneigennützigkeit. Er zwang
auch die Karthager durch die Schlacht am Krimissos (340) zur
Räumung Siziliens, stellte hierauf in den übrigen
griechischen Städten Siziliens die republikanische Verfassung
wieder her und vereinigte sie mit Syrakus zu einem Bund. Er starb
337. Seine Lebensbeschreibung gaben Plutarch u. Cornelius Nepos
heraus. Vgl. Arnoldt, Timoleon (Gumb. 1850).
Timomachos, griech. Maler, aus Byzanz gebürtig, der
Diadochenzeit angehörig, berühmt durch eine Reihe von
Bildern aus dem Heroenkreis, wie Medea, Ares, Iphigenia in Tauris,
Orestes. Cäsar als Diktator bezahlte für die ersten
beiden Gemälde den hohen Preis von 80 Talenten, um sie
für Rom zu erwerben.
Timon, 1) ein durch seinen Menschenhaß bekannt
gewordener Athener, war ein Zeitgenosse des Sokrates und
bekämpfte mit beißendem Spotte die damals in Athen
einreißende Sittenlosigkeit, allen Umgang mit den Menschen
vermeidend. Lukian machte ihn zum Gegenstand eines Dialogs, der
noch erhalten ist. Auch Shakespeare hat von ihm die Charakterperson
seines Stücks "T. von Athen" entlehnt. Vgl. Binder, Über
T., den Misanthropen (Ulm 1856).
2) Griech. Dichter, um 280 v. Chr. zu Phlius geboren, der sogen.
Sillograph (s. Sillen).
Timor, die östlichste und bedeutendste der Kleinen
Sundainseln im Indischen Ozean (s. Karte "Hinterindien"),
mißt mit den Nebeninseln (Rotti, Landu, Samao, Kambing)
32,586 qkm (592 QM.), ist von Korallenbänken umgeben und hat
meist steile und schwer zugängliche Küsten. Das Innere
ist der ganzen Länge nach von einer bewaldeten Bergkette (mit
Gipfeln bis 3604 m) durchzogen, von welcher zahlreiche Bäche
herabstürzen. Das Klima ist heiß und an der Küste
ungesund. Während des Ostmonsuns herrscht oft anhaltende
Dürre, die Regenzeit dauert von November bis April. Die
Tierwelt begreift Beuteltiere, fliegende Hunde, Papageien,
Krokodile, Schlangen u. a. Wichtigste Ausfuhrartikel sind Mais,
Sandelholz, Wachs, Schildkröten, Trepang; Gold, Kupfer und
Eisen werden gefunden. Die Einwohner, deren Zahl auf 600,000
geschätzt wird, sind Papua, zum Teil vermischt mit Malaien,
Chinesen, Portugiesen, Holländern. Der südwestliche
größere Teil der Insel gehört den Niederlanden und
bildet mit den Inseln Floris, Sumba, Savu, den Solor- und
Allorinseln und Rotti die Residentschaft T., 57,409 qkm (1042,6
QM.) groß mit 350,000 Einw., worunter 250 Europäer, 1112
Chinesen und 33,015 eingeborne Christen. Hauptort ist Kupang am
Südufer der Bai von Kupang mit einem durch das Fort Concordia
geschützten Hafen (Freihafen) und 7000 Einw. Der
portugiesische Teil umfaßt 16,300 qkm (296 QM.) mit 250,000
Einw. und der Hauptstadt Dili (Dehli) an der Nordküste, wo der
unter dem Generalgouverneur zu Goa stehende Statthalter residiert.
Die ersten portugiesischen Missionäre kamen 1610 nach T. und
sicherten Portugal den Besitz, doch setzten sich schon 1688 die
Holländer im südwestlichen Teil fest. Den
Bekehrungsversuchen der Missionäre tritt hier wie auch sonst
in diesen Meeren der sich immer mehr ausbreitende Islam entgegen.
Vgl. Bastian, Indonesien, Bd. 2 (Berl. 1885).
Timorlaut, Insel, s. Tenimberinseln.
Timotheos, 1) berühmter griech. Dithyrambendichter
aus Milet, jüngerer Zeitgenosse des Philoxenos, gest. 357 v.
Chr. Sammlung der Fragmente in Bergks "Poetae lyrici graeci" und
mit Übersetzung in Hartungs "Griechischen Lyrikern" (Bd. 6,
Leipz. 1857).
2) Athen. Feldherr, Sohn Konons, mit dem er 393 v. Chr. nach
Athen zurückkehrte, zeichnete sich im Kriege gegen Sparta, in
welchem er Korkyra eroberte und 375 bei Leukas die spartanische
Flotte vernichtete, aus, ging 364 nach Kleinasien, um den
aufständischen Satrapen Ariobarzanes zu unterstützen,
eroberte Samos, Sestos und andre Städte, befehligte mit
Iphikrates im Bundesgenossenkrieg und ward, als er nebst diesem des
Sturms wegen eine Schlacht vermieden hatte, 355 der Bestechung und
des Verrats angeklagt. Zu 100 Talenten Strafe verurteilt, ging er
freiwillig in die Verbannung nach Chalkis, wo er starb. Seine
Biographie hat Cornelius Nepos gegeben. Vgl. Rehdantz, Vitae
Iphicratis, Chabriae, Timothei (Berl. 1845).
3) Gehilfe und Begleiter des Paulus, aus Lykaonien
gebürtig, ward von seiner Mutter, einer Judenchristln, fromm
erzogen und von Paulus zum Christentum bekehrt, worauf er teils mit
diesem, teils in dessen Auftrag Makedonien und Griechenland
bereiste. Später erscheint er in Ephesos und dann in Rom
während des Paulus Gefangenschaft daselbst. Die Tradition
macht ihn zum ersten Bischof von Ephesos, wo er auch den
Märtyrertod erlitten haben soll. Über die beiden an T.
gerichteten Briefe des Apostels Paulus s. Pastoralbriefe.
Timothygras, s. Phleum.
Timpani (ital.), Pauken.
Timsahsee ("Krokodilsee"), ein vom Suezkanal (s. d.)
durchzogener See in Unterägypten, zwischen dem Ballahsee und
den Bitterseen, vor dem Bau des Kanals eine sumpfige Lagune mit
brackigem Wasser, jetzt von schön hellblauer Farbe. Am
Nordwestende liegt Ismailia (s. d.).
Timur ("Eisen"), auch Timur-Lenk, der "lahme T.", wegen
seines Hinkens infolge einer Verwundung genannt, auch mit dem aus
Timur-Lenk verstümmelten Namen Tamerlan benannt, geb. 1333 zu
Kesch unweit Samarkand, wurde von seinem Vater Turgai, Oberhaupt
des Stammes Berlas, 1356 zum Emir Kasgan geschickt; mit diesem
focht er gegen Husein Kert von Chorasan (1355). Nach der Ermordung
Kasgans und dem Tod seines Vaters begab sich T. an den Hof der
Tschagataiden und wurde von diesen als Lehnsherr der Provinz Kesch
bestätigt. Später lebte er am Hof Ilias Chodschas von
Samarkand, führte dann ein Abenteurerleben in der Wüste,
bis er endlich die zu seiner Verfolgung ausgeschickten Truppen
Ilias' mit seiner kleinen Schar schlug. Nach Ernennung eines
Schattenkönigs, den Kriegen gegen die Tscheten, der Besiegung
seines Rivalen und frühern Waffen genossen Husein ließ
er sich schließlich 8. April 1369 zum Emir Transoxaniens
ausrufen. Samarkand wurde seine Residenz. Seine Aufmerksamkeit
richtete sich zuerst auf Herstellung der Ruhe im Innern, auf die
politische Administration und militärische Organisation.
Erweiterung der Grenzen seines Landes war dann sein Hauptstreben.
Von 1380 an unternahm er 35 Feldzüge nach den verschiedensten
Richtungen. Zuerst unterwarf er ganz Persien, 1386 Georgien; 1394
drang er bis Moskau vor, warf nach und nach alle Reiche
Mittelasiens in Trümmer und eroberte 1398 Hindostan vom Indus
bis zur Mündung des Ganges. Vom griechischen Kaiser und
mehreren Fürsten Kleinasiens gegen den Sultan Bajesid I. zu
Hilfe gerufen, brach er 1400 in das türkische Gebiet ein,
eroberte Sebaste und schlug bei Cäsarea ein türkisches
Heer, wandte sich aber plötzlich gegen den Sultan von
Ägypten, eroberte 1401 Damaskus, zerstörte Bagdad und
unterjochte ganz Syrien. Endlich (20. Juli 1402) kam es zwischen
ihm und
714
Tinca - Tinktur.
Bajesid zu einer entscheidenden Schlacht auf der Ebene von
Angora in Natolien, in der 800,000 Mongolen den Sieg über
400,000 Türken davontrugen. T. starb, auf einem Zug nach China
begriffen, 17. Febr. 1405. Grausam und blutdürstig auf seinen
gewaltigen Kriegszügen, war er im Frieden ein frommer
Herrscher, weiser Gesetzgeber, gerechter Richter, Beschützer
der Künste und Wissenschaften. Obwohl er seinen ältesten
Enkel zu seinem Nachfolger bestimmt hatte, zerfiel sein Reich doch
bald nach seinem Tod. Einer seiner Nachkommen, Babur, eroberte von
1498 bis 1519 Hindostan und stiftete das Reich des
Großmoguls. Vgl. Langlès, Instituts politiques et
militaires de Tamerlan (Par. 1787); Sherif Edin, Histoire de
Timur-Bei (übersetzt von Petis de la Croix, das. 1722, 3
Bde.).
Tinca, Schleihe.
Tinchebrai (spr. tängschbrä), Stadt im franz.
Departement Orne, Arrondissement Domfront, an der Bahnlinie
Montsecret-Sourdeval, mit Handelsgericht, Fabrikation von Stahl-
und Schlosserwaren, Papier, Woll- und Baumwollstoffen etc. und
(1881) 2429 Einw.
Tindal, Matthew, engl. Freidenker (s. d.), geb. 1657 zu
Bear-Ferris in Devonshire, studierte zu Oxford die Rechte, trat zur
katholischen Religion über und erwarb sich dadurch König
Jakobs II. Gunst, kehrte aber unter Wilhelm III. zur
protestantischen Kirche zurück. Gleichzeitig begann er die
Grundsätze des Deismus (s. d.) zu verbreiten. Die Heilige
Schrift nannte er eine Urkunde der natürlichen Religion; das
Christentum, behauptete er, sei so alt wie die Schöpfung, die
Kirche eine Institution des Staats. Seine Hauptschrift:
"Christianity as old as the creation, or the Gospel a republication
of the religion of nature" (Lond. 1730; deutsch von Lorenz Schmidt,
Frankf. a. M. 1741), wurde sehr oft abgedruckt, das Erscheinen
eines zweiten Teils (der 1750 erschienene ist unecht) aber durch
den Bischof von London, Gibson, verhindert. T. starb 1733 in Oxford
als Senior von All Souls' College. Vgl. Lechler, Geschichte des
englischen Deismus (Stuttg. 1841).
Tinea, Motte; Tineïna (Motten), Familie aus der
Ordnung der Schmetterlinge, s. Motten. T. favosa, s. v. w.
Erbgrind.
Ting, chines. Lusthäuschen, Gartenhäuschen.
Tingel-Tangel, Berliner Ausdruck für Singhallen
niedrigster Art mit burlesken Gesangsvorträgen und
Vorstellungen. Sie erhielten ihren Namen nach dem Gesangskomiker
Tange, der im Triangelgebäude sein lange populär
gebliebenes Triangellied zum besten gab.
Tinghai, chines. Stadt, s. Tschouschan.
Tingieren (lat.), eintauchen, färben, mit einem
Anstrich von etwas versehen.
Tingis, röm. Kolonie, s. Tanger.
Tinkal, s. Borax.
Tinkana, s. Borax.
Tinktur (lat. Tinctura), weingeistiger oder
ätherischer Auszug von Pflanzenteilen oder tierischen Stoffen.
Man bereitet ihn, indem man die zerschnittenen oder
zerstoßenen Substanzen in einer Flasche mit Weingeist oder
ätherhaltigem Weingeist übergießt und unter
Umschütteln etwa 8 Tage, gewöhnlich bei 15°, in einer
mit durchstochener Blase verschlossenen Flasche stehen
läßt, dann auspreßt und filtriert. Tinkturen
dienen als Arzneimittel, zu Likören und Parfümen. Die
wichtigsten Tinkturen sind: Wermuttinktur (Tinctura Absinthii), aus
1 Teil Wermutkraut mit 5 Teilen verdünntem Spiritus;
Eisenhuttinktur (T. Aconiti), aus 1 Teil Aconitknollen mit 10
Teilen verdünntem Spiritus; Aloetinktur (T. Aloës), 1
Teil Aloe mit 5 Teilen Spiritus; zusammengesetzte Aloetinktur (T.
Aloës composita, Elixirium ad longam vitam), 6 Teile Aloe, je
1 Teil Enzian, Rhabarber, Zitwerwurzel, Safran mit 200 Teilen
verdünntem Spiritus; bittere T. (T. amara), 2 Teile unreife
Pomeranzen, je 3 Teile Tausendgüldenkraut und Enzian, je 1
Teil Zitwerwurzel und unreife Pomeranzenschalen mit 50 Teilen
verdünntem Spiritus; Arnikatinktur (T. Arnicae), aus
Arnikablüten wie T. Aconiti zu bereiten; aromatische T. (T.
aromatica), je 1 Teil Kardamom, Gewürznelken, Galgant, 2 Teile
Ingwer und 5 Teile Zimt mit 50 Teilen verdünntem Spiritus;
Stinkasanttinktur (T. Asae foetidae), aus Asa foetida wie T.
aloës zu bereiten; Pomeranzenschalentinktur (T. Aurantii), aus
Pomeranzenschalen wie T. Absinthii zu bereiten; Benzoetinktur (T.
Benzoes), aus Benzoe wie T. Aloës zu bereiten; Kalmustinktur
(T. Calami), aus Kalmus wie T. Absinthii zu bereiten;
Indischhanftinktur (T. Cannabis indicae), 1 Teil Extractum cannabis
indicae in 19 Teilen Spiritus gelöst; Spanischfliegentinktur
(T. Cantharidum), 1 Teil Spanische Fliegen mit 10 Teilen Spiritus
maceriert; Spanischpfeffertinktur (T. Capsici), aus Spanischem
Pfeffer wie die vorige zu bereiten; Bibergeiltinktur (T. Castorei
canadensis und sibirici), aus Bibergeil wie T. Cantharidum zu
bereiten; Katechutinktur (T. Catechu), aus Katechu wie T. Absinthii
zu bereiten; Chinatinktur (T. Chinae), aus brauner Chinarinde wie
T. Absinthii zu bereiten; zusammengesetzte Chinatinktur (T. Chinae
composita, Elixirium roborans Whyttii), 6 Teile braune Chinarinde,
je 2 Teile Pomeranzenschalen und Enzianwurzel, 1 Teil
Zimtkassienrinde mit 50 Teilen verdünntem Spiritus digeriert;
Chinoidintinktur (T. Chinoidini), Lösung von 10 Teilen
Chinoidin in 85 Teilen Spiritus und 5 Teilen Salzsäure;
Zimttinktur (T. Cinnamomi), aus Zimtkassie wie T. Absinthii zu
bereiten; Zeitlosentinktur (T. Colchici), aus Colchicumsamen;
Koloquintentinktur (T. Colocynthidis), aus Koloquinten wie T.
Cantharidum zu bereiten; Safrantinktur (T. Croci), aus Safran wie
T. Aconiti zu bereiten; Fingerhuttinktur (T. Digitalis), aus 1 Teil
Digitalisblättern wie T. Aconiti zu bereiten; T. Ferri ..., s.
Eisenpräparate; Galläpfeltinktur (T. Gallarum), 1 Teil
Galläpfel mit 5 Teilen verdünntem Spiritus; Enziantinktur
(T. Gentianae), aus Enzian wie T. Absinthii zu bereiten;
Jodtinktur, s. d.; Ipekakuanhatinktur (T. Ipecacuanhae), aus
Ipekakuanhawurzel wie T. Aconiti zu bereiten; Lobeliatinktur, aus
Lobeliakraut wie T. Aconiti zu bereiten; Moschustinktur (T.
Moschi), 1 Teil Moschus mit 25 Teilen Wasser und 25 Teilen
verdünntem Spiritus; Myrrhentinktur (T. Myrrhae), aus Myrrhe
wie Aloetinktur zu bereiten; Opiumtinktur, s. Opium, S. 407;
Pimpinelltinktur (T. Pimpinellae), aus Pimpinellwurzel wie T.
Absinthii zu bereiten; Ratanhatinktur (T. Ratanhae), aus
Ratanhawurzel wie T. Absinthii zu bereiten wässerige
Rhabarbertinktur (T. Rhei aquosa), 100 Teile Rhabarber, je 10 Teile
Borax und kohlensaures Kali mit 900 Teilen siedendem Wasser
übergossen, nach einer Viertelstunde 90 Teile Spiritus
hinzugefügt, nach fünf Viertelstunden koliert und mit 150
Teilen Zimtwasser gemischt; weinige Rhabarbertinktur (T. Rhei
vinosa), 8 Teile Rhabarber, 2 Teile Pomeranzenschalen, 1 Teil
Kardamom mit 100 Teilen Jereswein, dann hinzugefügt 12 Teile
Zucker; Meerzwiebel-
715
Tinkturen - Tinte.
tinktur (T. Scillae), aus Meerzwiebelwurzel wie T. Absinthii
bereitet; Paratinktur, s. Paraguay-Roux; Krähenaugentinktur
(Strychnostinktur, T. Strychni, T. Nucum vomicarum), aus
Krähenaugen wie T. Aconiti bereitet; Baldriantinktur (T.
Valerianae), aus Baldrianwurzeln wie T. Absinthii bereitet;
ätherische Baldriantinktur (T. Valerianae aetherea), 1 Teil
Baldrianwurzel mit 5 Teilen Spiritus aethereus bereitet;
Ingwertinktur (T. Zingiberis), aus Ingwer wie T. Absinthii
bereitet.
Tinkturen, s. Heraldische Farben.
Tinné, Alexine, Afrikareisende, geb. 17. Okt. 1839
im Haag, Tochter eines reichen, in England naturalisierten
Holländers, begleitete schon 1856 und 1858 ihre Mutter nach
Ägypten, die 1861 ganz dahin übersiedelte, unternahm mit
ihr und einer Tante 1862 ihre erste große Reise nach dem
obern Nil bis Gondokoro, wobei auch der Sobat verfolgt ward, im
Februar 1863 von Chartum aus ihre zweite, von Heuglin und Steudner
begleitet, nach dem Gazellenfluß und Dschur, auf der die
Mutter und bald auch die Tante dem Klima zum Opfer fielen, begab
sich im Juli 1864 von Chartum über Suakin nach Kairo, besuchte
1868 Algerien und Tunis, trat im Januar 1869 von Tripolis aus eine
neue Reise nach Innerafrika an, um über Bornu nach dem obern
Nil vorzudringen, wurde aber auf dem Weg von Mursuk nach Ghat im
Sommer 1869 von räuberischen Tuareg ermordet. Ihre zweite
größere Reise nach dem Gazellenfluß ist von
wissenschaftlicher Bedeutung gewesen und beschrieben in den
"Transactions of the Historical Society of Lancashire etc.". Bd. 16
(Liverp. 1864). Vgl. Heuglin, Die Tinnésche Expedition im
westlichen Nilgebiet 1863-64 (Gotha 1865); Derselbe, Reise in das
Gebiet des Weißen Nil etc. (Leipz. 1869).
Tinnevelli (Tirunelweli), Distrikt der britisch-ind.
Präsidentschaft Madras, 13,936 qkm (253 QM.) groß mit
(1881) 1,699,747 Einw., darunter 81,805 protestantische und 57,129
katholische Christen. Hauptort ist Palamkotta, wichtigster Hafen
Tutikorin. Die Stadt T. mit 23,221 Einw. ist Sitz der sehr
thätigen protestantischen Mission in Südindien.
Tinnum, Dorf in der preuß. Provinz
Schleswig-Holstein, Kreis Tondern, auf der Insel Sylt, hat ein
Amtsgericht und (1885) 320 Einw.
Tinnunculus, Rötelfalke, s. Falken, S. 10.
Tinogasta, Stadt in der Argentinischen Republik, Provinz
Catamarca, an der Straße von Catamarca nach Copiapo in Chile,
hat bedeutende Ausfuhr von lebendem Vieh und 6000 Einw.
Tinos (Tenos), Insel im Griech. Archipelagus, zum Nomos
der Kykladen gehörig, südöstlich von Andros, 204 qkm
(3,70 QM.) groß mit (1879) 12,565 Einw., ist ihrer ganzen
Länge nach von einer bis 713 m hohen Gebirgskette durchzogen
und zwar nicht besonders fruchtbar, aber sehr gut in Terrassen
angebaut. Sie enthält Lager von weißem und schwarz
geädertem Marmor, Serpentin, Verde antico, Asbest und
Chromeisenerz. Die Einwohner treiben Wein- und Seidenbau,
Seidenweberei, Steinmetzarbeit und Viehzucht. Sehr stark betrieben
wird die Taubenzucht, sowohl wegen des Fleisches als auch wegen des
Düngers. In dem fruchtbarsten Teil der Insel ist die
Frankochora, eine Anzahl römisch-katholischer Ortschaften, zu
bemerken. Die Hauptstadt T., auf der Südküste, ist Sitz
eines römisch-katholischen Bischofs, hat 2 kath. Kirchen,
einen kleinen Hafen und (1879) 2083 Einw. Nördlich davon liegt
die berühmte Kirche der Panagia Evangelistria, wohin drei
Wochen vor Ostern von weither gewallfahrt wird. - Die Insel T.
hieß früher Ophlussa, dann Tenos. Als Bundesgenossen der
Athener kämpften die Tenier bei Platää gegen die
Perser. 1207 kam T. unter die Herrschaft der Ghizi, dann 1390 der
Venezianer, denen es aber 1537 von dem türkischen Piraten
Chaireddin Barbarossa vorübergehend abgenommen wurde. 1718 kam
sie von neuem unter türkische Oberhoheit, durch den
griechischen Befreiungskampf aber an Hellas.
Tinte (Dinte), jede zum Schreiben mit der Feder bereitete
Mischung. Die gewöhnliche Schreibtinte muß
dünnflüssig sein, ohne jedoch zu leicht aus der Feder zu
fließen oder zu tropfen, sie darf bei längerm Stehen
keinen Bodensatz bilden und nicht dickflüssig, gallertartig
werden. Auf der Feder muß sie zu einem firnisartigen
Überzug, nicht zu einer bröckeligen Masse eintrocknen.
Sie darf das Papier nicht mürbe machen, mit dem Alter nicht
vergilben, auch die Feder nicht angreifen und daher weder sehr
sauer noch kupferhaltig sein. Das Schimmeln läßt sich
durch eine Spur von Karbolsäure leicht verhindern. Da T. nur
unter dem Einfluß der Luft verdirbt, so verdienen
Tintenfässer den Vorzug, welche die Berührung der T. mit
der Luft möglichst beschränken, wie die artesischen.
Diese enthalten einen eingesenkten Trichter, in den immer nur eine
sehr geringe Menge T. eintritt, während der Vorrat von der
Luft fast vollständig abgeschlossen ist. Auch die
Tintenfässer mit vom Boden seitlich emporsteigendem Halse sind
empfehlenswert.
Die alte schwarze Galläpfeltinte besteht aus einer mit
Eisenvitriol versetzten Abkochung von Galläpfeln und
enthält gerbsaures und gallussaures Eisenoxydul und Eisenoxyd.
Sie bildet keine vollkommne Lösung, vielmehr sind die
Eisenoxydsalze nur in der T. suspendiert, und wenn die
Eisenoxydulsalze an der Luft vollständig in Oxydsalze
verwandelt sind und sich zu Boden gesetzt haben, so ist die T.
unbrauchbar geworden. Das Nachdunkeln beruht auf der Umwandlung der
Eisenoxydulsalze in schwarze Eisenoxydsalze. Mit der Zeit aber wird
die Gerb- und Gallussäure der letztern durch den Sauerstoff
der Luft ebenfalls oxydiert, und die Schrift vergilbt, indem nur
Eisenoxyd zurückbleibt. Man bereitet die Galläpfeltinte
durch Ausziehen chinesischer Galläpfel und Versetzen des
Auszugs, welcher 5-6 Proz. Gerbsäure enthalten soll, mit so
viel Eisenvitriol, daß von letzterm 9 Teile auf 10 Teile
Gerbsäure kommen. Frische Galläpfeltinte, welche fast nur
gerb- und gallussaures Eisenoxydul enthält, ist sehr
blaß und wird vorteilhaft mit Blauholz gefärbt.
Alizarintinte (welche mit Alizarin nichts zu thun hat) ist eine mit
Indigo gefärbte Galläpfeltinte, zu deren Darstellung man
in einer klaren verdünnten Lösung von Indigo in
rauchender Schwefelsäure Eisen löst, um Eisenvitriol zu
bilden, worauf die noch vorhandene freie Säure mit
kohlensaurem Kalk fast vollständig neutralisiert wird. Die vom
ausgeschiedenen schwefelsauren Kalk abgegossene Flüssigkeit
wird schließlich mit Galläpfelabkochung versetzt. Diese
T. ist völlig klar, seegrün, liefert schön schwarze,
fest haftende Schrift, welche tief in das Papier eindringt, wird
aber allmählich auch im Tintenfaß schwarz und bildet
zuletzt auch einen Bodensatz. Ihre Säure greift die
Stahlfedern ziemlich stark an. Sehr gute Tinten werden mit Blauholz
dargestellt. Eine klare Abkochung des Holzes oder eine Lösung
von Blauholzextrakt mit wenig Soda, dann mit chromsaurem Kali
versetzt, gibt eine schön blauschwarze, gut fließende
T., welche schnell trocknet, die Federn nicht angreift und sich
tief
716
Tinten - Tintenschnecken.
ins Papier zieht. Eine sehr gute Blauholztinte, die unter vielen
Namen im Handel ist, erhält man durch Versetzen einer klaren
Lösung von Blauholzextrakt mit Ammoniakalaun, Kupfervitriol
und wenig Schwefelsäure. Diese T. schreibt anfangs gelbrot,
wird aber schnell schön samtschwarz und gibt sofort schwarze
Schriftzüge, wenn man sie mit Chromtinte mischt. Auch einfache
Lösungen von Nigrosin oder Indulin in Wasser geben gute
schwarze Tinten, die nach dem Eintrocknen durch Zusatz von Wasser
sofort wieder verwendbar gemacht werden können. Alle diese
Tinten, namentlich die Galläpfeltinten, versetzt man, um ihnen
mehr Konsistenz zu geben, mit etwas Gummi. Zu Kopiertinten eignen
sich am besten die Galläpfel-, Alizarin- und eigentlichen
Blauholztinten. Man macht sie aber konzentrierter und versetzt sie
mit mehr Gummi und etwas Glycerin.
Das Problem, völlig unauslöschliche Tinten zu
bereiten, ist noch nicht vollkommen gelöst; wenn man aber auf
einem mit Ultramarin gebläuten Papier schreibt, dessen Farbe
durch Betupfen mit Säure zerstört wird, so genügen
schon viele unsrer gewöhnlichen Tinten, und auf Papier,
welches mit Ultramarin und Chromgelb grün gefärbt ist,
genügt jede T., da man die Schriftzüge auf keine Weise
entfernen kann, ohne einen der Farbstoffe zu zerstören.
Ausgezeichnet ist die T., mit welcher die Nummern in die
preußischen Staatspapiere eingeschrieben werden. Dieselbe ist
schwach angesäuerte Galläpfeltinte und enthält noch
salpetersaures Silberoxyd und chinesische Tusche. Es ist
unmöglich, auf dem oben genannten grünen Papier mit
dieser T. Geschriebenes unbemerkbar zu vertilgen. Ist auf
weißem Papier Geschriebenes ausgelöscht worden, so
gelingt es oft, die Schriftzüge wieder hervorzurufen, wenn man
das Papier in ganz schwache Salzsäure taucht und dann in eine
konzentrierte Lösung von gelbem Blutlaugensalz legt. Enthielt
die T. auch nur wenig Eisen, so erscheinen die Schriftzüge
blau.
Als rote T. benutzt man Lösungen von Teerfarbstoffen, eine
mit Gummi versetzte Lösung von Karmin in Ammoniak oder einen
mit Sodalösung bereiteten, dann mit Weinstein und Alaun
versetzten Kochenilleauszug, welchem noch etwas Gummi und Alkohol
zugesetzt wird. Die rote T. der Alten bestand aus einer Mischung
von Zinnober mit Gummilösung. Als blaue T. dient eine mit
Gummi versetzte Lösung von Anilinblau oder Indigkarmin. Auch
eine Lösung von Berliner Blau hält sich sehr gut und
greift die Stahlfedern nicht an, was die durch Auflösen von
Berliner Blau in Oxalsäure bereitete T. in hohem Grade thut.
Violette T., unter verschiedenen Namen im Handel, ist eine
Lösung von Blauviolettanilin in Wasser; grüne T.
erhält man durch Lösen von Jodgrün in Wasser, sie
ist leuchtend blaugrün und kann durch Pikrinsäure
nüanciert werden. Gold- und Silbertinte ist eine Mischung von
Gummilösung (die etwas Wasserglas enthalten kann) mit
Blattgold oder Blattsilber, welches auf einer Porphyrplatte mit
Honig zerrieben, ausgewaschen und getrocknet wurde. Sympathetische
Tinten sind Spielereien, da alle mit denselben ausgeführten
Schriftzüge sichtbar werden, wenn man das Papier stark erhitzt
oder mit Kohlenpulver reibt oder mit verschiedenen Reagenzien
prüft. Verdünnte Kobaltchlorürlösung gibt
unsichtbare Schriftzüge, welche beim Erwärmen blau werden
und beim Erkalten wieder verschwinden. Enthält die Lösung
auch Nickelsalz, so werden die Schriftzüge grün.
Bleisalz- und Ouecksilbersalzlösungen geben unsichtbare
Schriftzüge, die durch Schwefelwasserstoff braun oder schwarz
werden. Kupfervitriolschriftzüge werden durch Ammoniak
schön blau. Verdünnte Blutlaugensalzlösung eignet
sich sehr gut als sympathetische T. auf eisenfreiem Papier. Die
Schriftzüge werden durch Eisenoxydsalze blau. Beachtung
verdienen solche Tinten für den brieflichen Verkehr mit
Postkarten. T. zum Zeichnen der Wäsche muß der
wiederholten Einwirkung von Seife, Alkalien, Chlor und Säuren
widerstehen. Am häufigsten wendet man Silbermischungen an, die
recht dauerhafte Schriftzüge liefern, zuletzt aber auch braun
werden und verblassen. Man mischt eine Lösung von
Höllenstein (salpetersaures Silberoxyd) in Ammoniak mit einer
Lösung von Soda und Gummi in destilliertem Wasser und
erwärmt die Schriftzüge mit einem Plätteisen, bis
sie vollständig schwarz geworden sind. Man extrahiert auch die
Schalen der Elefantenläuse (Anakardien) mit einem Gemisch von
Äther und Weingeist und läßt das Filtrat
verdunsten, bis es die zum Schreiben geeignete Konsistenz hat. Die
Schriftzüge werden nach dem Trocknen mit Kalkwasser befeuchtet
und erscheinen dann tief braunschwarz. Sehr praktisch ist
Anilinschwarz, zu dessen Herstellung man ein grünlichgraues
Pulver kauft, welches, feucht auf die Wäsche aufgetragen, beim
Erwärmen über kochendem Wasser den sehr echten Farbstoff
liefert. Rote Schriftzüge erhält man, wenn man die
Wäsche mit einer Lösung von kohlensaurem Natron und
Gummiarabikum in destilliertem Wasser befeuchtet, auf der
getrockneten und geplätteten Stelle mit einer Lösung von
Platinchlorid in destilliertem Wasser schreibt und die getrockneten
Schriftzüge mit einer Lösung von Zinnchlorür in
destilliertem Wasser sorgfältig nachzieht. Waren, welche der
chemischen Bleiche unterworfen werden sollen, stempelt man mit
einer innigen Mischung von Eisenvitriol, Zinnober und
Leinölfirnis. Auf Weißblech schreibt man mit einer
Lösung von Kupfer in Salpetersäure und Wasser.
Pflanzenetiketten schreibt man auf blank gescheuertes Zinkblech mit
einer Lösung von gleichen Teilen essigsaurem Kupferoxyd und
Salmiak in destilliertem Wasser. Die Schriftzüge werden bald
tiefschwarz und haften sehr fest. T. zur Bezeichnung kupferner und
silberner Geräte bereitet man durch Kochen von Schwefelantimon
(Spießglanz) mit starker Ätzkalilauge. Über
lithographische Zeichen- oder Schreibtinte s. Lithographie. Vgl.
Andreae, Vollständiges Tintenbuch (5. Aufl. v. Freyer, Weim.
1876); Lehner, Tintenfabrikation (3. Aufl., Wien 1885).
Tinten, in der Malerei die Abtönungen einer Farbe
nach der hellern oder dunklern Seite.
Tintenbaum, s. Semecarpus.
Tintenbeerstrauch, s. Ligustrum.
Tintenfisch, s. Tintenschnecken und Sepie.
Tintenschnecken (Kopffüßer, Cephalopoda Cuv.,
fälschlich Tintenfische, hierzu Tafel "Tintenschnecken"), die
am höchsten entwickelte Klasse der Mollusken (s. d.) oder
Weichtiere, verdanken ihren deutschen Namen der Eigenschaft, als
Verteidigungmittel eine tintenartige Flüssigkeit
auszuspritzen, welche das Wasser trübt und die Tiere den
Blicken ihrer Feinde entzieht; wissenschaftlich heißen sie
Kopffüßer, weil man die Arme, welche rund um den Kopf
angebracht sind, früher für den umgewandelten und
vierteiligen Fuß der Schnecken und Muscheln ansah. Zum
Verständnis des Baues der T. kann man sich das Tier als eine
Schnecke vorstellen, welche im Verhältnis zur Länge
außerordentlich hoch und in normaler Lage mit dem Kopf nach
unten gerichtet ist.
Tintenschnecken.
Gemeiner Vielfuß (Octopus vulgaris). 1/30.
Zum Artikel »Tintenschnecken«.
717
Tintenschnecken.
Infolge davon ist die Bauchseite sehr schmal, der Rücken
hingegen sehr umfangreich; von letzterm ist aber bei manchen Formen
der hintere Teil heller als der vordere und erscheint so, zumal
wenn das betreffende Tier auf ihm ruht, leicht als Bauchseite, was
er in Wirklichkeit nicht ist. Der Kopf mit den Armen ist vom Rumpf
mehr oder weniger deutlich abgesetzt; bei den Oktopoden ist er
wegen der mächtigen Arme so groß, daß der Rumpf,
welcher alle Eingeweide birgt, mehr als Anhängsel erscheint.
Die Arme stehen im Kranz um die Mundöffnung, sind
außerordentlich muskulös und mit zahlreichen
Saugnäpfen oder auch Haken versehen. Sie dienen zum Kriechen
und Schwimmen sowie zum Ergreifen der Beute. Bisweilen ist zwischen
ihrer Basis eine Haut ausgespannt, welche die Bewegungen
begünstigt; im übrigen sind zum Schwimmen vielfach noch
zwei Flossen an den Seiten des Körpers vorhanden. Auf der
hintern, in der natürlichen Lage des Tiers untern Fläche
befindet sich als eine Hautfalte der sogen. Mantel, welcher eine
geräumige Höhle abschließt; in diese münden
Darm, Niere und Genitalien aus, auch liegen in ihr die Kiemen. Das
für die letztern nötige Atemwasser wird in die
Mantelhöhle durch einen weiten Spalt aufgenommen, dagegen nach
dessen Verschluß durch eine enge Röhre wieder
ausgestoßen. Diese, der sogen. Trichter, entspricht dem
vordern Teil des Fußes der Schnecken und veranlaßt,
wenn das Wasser plötzlich durch sie entleert wird, mittels des
Rückstoßes die Bewegung des Tiers mit dem Rücken
voran durch das Wasser. Viele T. sind vollkommen nackt, andre
bergen in einer besondern Tasche des Mantels eine flache, feder-
oder lanzettförmige Platte ("Schale") aus Chitin, die bei der
Sepie ziemlich umfangreich und durch Kalkablagerungen hart ist
(daher im gewöhnlichen Leben "Sepienknochen", os sepiae); noch
andre haben eine äußere Schale, welche nur ausnahmsweise
dünn und einfach kahnförmig (Argonauta), in der Regel
spiralig gewunden und durch Querscheidewände in eine Anzahl
hintereinander liegender Kammern geteilt ist. Das Tier bewohnt nur
die vordere größte Kammer; die übrigen sind mit
Luft gefüllt, werden aber von einem Fortsatz des
Tierkörpers durchzogen (s. Ammoniten). In der glatten,
schlüpfrigen Haut liegen mit Pigment gefüllte kontraktile
Zellen (Chromatophoren, s. d.), welche, von dem Nervensystem und
dem Willen der Tiere abhängig, ein lebhaftes Farbenspiel
bedingen. Zur Stütze der Muskulatur und zum Schutz des
Nervenzentrums und der Sinnesorgane dient ein inneres
Knorpelskelett im Kopf (dieses besteht aus den für die
Mollusken typischen, hier aber häufig ganz miteinander
verschmolzenen drei Ganglienpaaren). An den Seiten des Kopfes
befinden sich zwei mächtige Augen, die fast so kompliziert
gebaut sind wie die der Wirbeltiere. Gehör- und Geruchorgane
sind gleichfalls vorhanden. Der Mund ist mit hornigem Ober- und
Unterkiefer in Gestalt eines Papageienschnabels und mit einer Zunge
(Radula), welche zahnartige Platten und Haken zum Einziehen der
Nahrung trägt, bewaffnet. Der Darm ist ziemlich kurz,
Speicheldrüsen und Leber sind sehr groß. Als
Atmungsorgane dienen ein oder zwei Paare federförmiger Kiemen.
Das Gefäßsystem ist sehr entwickelt und besteht aus
einem muskulösen Herzen nebst Arterien, Venen und Kapillaren.
Die Gefäße, welche das Blut zu den Kiemen führen,
sind gewöhnlich ebenfalls kontraktil (Kiemenherzen). Das Blut
enthält kristallisierbares Hämocyanin, welches gleich dem
Hämoglobin der Wirbeltiere die Aufnahme des Sauerstoffs
besorgt. Doch findet sich in ihm nicht wie bei dem letztgenannten
Eisen, sondern Kupfer vor, welches auch die bläuliche Farbe
des Bluts veranlaßt. Als Nieren fungieren traubige
Anhänge der Kiemenarterien. Ein andres Exkretionsorgan ist der
oben erwähnte Tintenbeutel, welcher in den Darm ganz dicht am
After ausmündet; sein Produkt bei der Sepie dient als
Malerfarbe. Die Geschlechter sind bei den T. getrennt.
Männchen und Weibchen unterscheiden sich zuweilen in ihrer
Gestalt wesentlich (Argonauta. s. Papiernautilus). Ersteres erzeugt
für feine Samenfäden in einem besondern Abschnitt der
Geschlechtswerkzeuge komplizierte, über 1 cm lange Patronen
(sogen. Needhamsche Maschinen), welche im Wasser platzen. Die Eier
werden in einem unpaaren Ovarium produziert und dann nach
Umhüllung mit Eiweiß und Kapseln entweder einzeln oder
in Trauben und Schläuchen an allerlei Gegenstände
angeheftet. Die Begattung erfolgt vielfach in der Art, daß
ein dazu besonders eingerichteter Arm des Männchens die
Samenpatronen in die weibliche Geschlechtsöffnung
überträgt. Bei einigen Arten löst sich dieser Arm
nach seiner Füllung mit Samen vom Körper los und schwimmt
einige Zeit im Meer umher, um schließlich auch in die
Mantelhöhle des Weibchens zu geraten. Bei seiner Entdeckung
wurde er für einen Eingeweidewurm (Hectocotylus octopodis
Cuv.), später sogar für das ganze Männchen der
Tintenschnecke gehalten; jetzt weiß man, daß es ein
abgelöster, sogen. hektokotylisierter Arm ist. Die
Entwickelung der T. erfolgt direkt, so daß das junge Tier,
wenn es das Ei verläßt, schon bis auf die
Größe den Alten gleich ist.
Die T. sind ohne Ausnahme Bewohner des Meers, und zwar leben sie
sowohl an den Küsten als in großen Tiefen und auf der
offenen See. Sie kriechen und schwimmen sehr behende und entfalten
namentlich in einigen Formen eine im Verhältnis zur
Größe ungeheure Körperkraft. Von den Wirbellosen
sind es wohl die gewaltigsten und klügsten Raubtiere. Im
allgemeinen bleiben sie ziemlich klein, jedoch erreichen die Formen
der Tiefsee, von denen sich freilich nur selten Exemplare an die
Oberfläche verirren und so gefangen werden, enorme Dimensionen
(s. Kraken). Viele T. werden gegessen, auch wird der Farbstoff des
Tintenbeutels sowie der "Sepienknochen" (s. oben) technisch
benutzt. Nach der Anzahl der Kiemen teilt man die T. in
Tetrabranchiata (Vierkiemer) und Dibranchiata (Zweikiemer),
letztere wieder in Octopoda (Achtarmer) und Decapoda (Zehnarmer)
ein. Die Oktopoden, mit acht Armen, die an ihrer Basis durch eine
Haut verbunden sind, mit kurzem, rundlichem Körper, ohne
innere Schale und meist auch ohne Flossenanhänge, zerfallen in
zwei Familien: Philonexidae d'Orb., mit dem Argonauten oder
Papiernautilus (s. d.) und Octopodidae d'Orb., zu welcher unter
andern der Pulpe oder Vielfuß (Octopus, s. Tafel) und die
Moschuseledone (Eledone Leach) gehören. Die Dekapoden besitzen
außer den 8 Armen noch 2 lange, tentakelnartlge Fangarme,
ferner 2 Flossen und eine innere Schale. Hierher gehören die
Gattungen Loligo (Kalmar), Sepia (Sepie), Spirula (Posthorn), die
fossilen Belemniten etc. Die Vierkiemer besitzen vier Kiemen in der
Mantelhöhle, zahlreiche zurückziehbare Tentakeln am Kopf
und eine vielkammerige Schale; sie sind in der Gegenwart durch die
einzige Gattung Nautilus L. vertreten. Zu derselben Familie
(Nautilidae Ow.) gehören auch die Gattungen O1thoceras Breyn.,
Lituites Breyn. (s. Tafel "Silurische Formation")
718
Tintenstifte - Tipperary.
und Clymenia Münst. (s. Tafel "Devonische Formation"),
während die Familie Ammonitidae Ow. die Gattungen Goniatites
de Haan (s. Tafeln "Devonische Formation" und "Steinkohlenformation
I"), Ceratites de Haan (s. Tafel "Triasformation I") und Ammonites
Breyn. (s. Tafel "Juraformation I") umfaßt (s. Ammoniten). -
Die T. sind sowohl wegen der großen Mannigfaltigkeit der
Formen als auch wegen der Häufigkeit des Vorkommens für
die Erkenntnis versteinerungsführender Schichten wesentlich.
Die Vierkiemer traten schon im Silur mit Nautilen und
Geradhörnern, im Devon auch mit Goniatiten auf; von allen
diesen Formen überlebten nur die echten Geradhörner,
Goniatiten und Nautilen das paläozoische Zeitalter, doch
starben Orthoceras und Goniatites in der Trias aus. Dafür aber
erscheinen nun außer den bereits in der Trias wieder
aussterbenden Ceratiten die Ammoniten, die sich schon in genannter
Formation, mehr noch im Jura und ebenso noch in hohem Grad in der
Kreide (hier außer durch normale Formen auch durch
Nebenformen: Baculites, Ancyloceras, Toxoceras, Crioceras, s. Tafel
"Kreideformation") entwickeln, aber mit dem Schluß der Kreide
(des mesozoischen Alters) ihr Ende erreichen; es bleibt also
für Tertiär- und Jetztzeit nur Nautilus. Die Zweikiemer
beginnen in der Trias mit belemnitenartigen Tieren, echte
Belemniten und ihre Nebengenera sind äußerst häufig
in Jura und Kreide (Bejemnites, Rhynchoteuthis, s. Tafeln
"Juraformation I" und "Kreideformation"); die ganze Familie aber
stirbt mit der Kreide aus, während die ebenfalls im Jura
auftretenden Kalmare und Sepien bis jetzt zugenommen haben.
Spirula, Octopus haben keine, Argonauta hat nur tertiäre
fossile Repräsentanten. Vgl. Ferussac und d'Orbigny, Histoire
naturelle des Céphalopodes (Par. 1835-45); Verany,
Mollusques méditerranéens. Bd. 1: Céphalopodes
(Genf 1847-51); Bronn-Keferstein, Klassen und Ordnungen des
Tierreichs; Bd. 3: Cephalopoden (Leipz. 1869).
Tintenstifte, s. Bleistifte, S. 24.
Tintern Abbey (spr. äbbi). Abteiruine in
Monmouthshire (England), im malerischen Thal des Wye, im 13. Jahrh.
erbaut.
Tintillo (spr. -tilljo), s. Spanische Weine.
Tinto, Küstenfluß in Spanien, s. Rio
Tinto.
Tinto (vino tinto), dunkler span. Wein, wie der T. von
Alicante, der T. di Rota, der Inselburgunder (s. Madeirawein)
etc.
Tintoretto, eigentlich Jacopo Robusti, genannt il T.
("das Färberlein", nach dem Handwerk seines Vaters), ital.
Maler, geb. 1519 zu Venedig, war anfangs Schüler Tizians,
schlug jedoch bald eine eigne Richtung ein, welche durch seinen
Wahlspruch: "Von Michelangelo die Zeichnung, von Tizian die Farbe"
deutlich bezeichnet ist, wie in der That auch eine Anzahl seiner
Werke das Streben zeigt, die Größe des florentinischen
Stils mit den Vorzügen seiner heimatlichen Schule zu
verbinden. T. ist der Chorführer der zweiten Generation der
venezianischen Malerschule, welche sich in äußerlicher
Bravourmalerei, in prunkhafter und massenhafter Komposition und
schwierigen Perspektiven gefiel. T. überlud seine
Kompositionen oft mit nicht zur Sache gehörigen, theatralisch
gespreizten Figuren und wandte gern glänzende
Beleuchtungsgegensätze an. Sein Kolorit ist wirkungsvoll, warm
und tief, wenn er sich die Zeit zu sorgsamer Arbeit ließ,
aber roh und grob, wo er durch schnelle Improvisationen und zum
Staunen redende Bewältigung großer Flächen wirken
wollte. Viele seiner Gemälde, insbesondere die Bildnisse, in
welchen er Tizian am nächsten kam, haben übrigens durch
Nachdunkeln viel von ihrer ursprünglichen Farbenpracht
eingebüßt. Er starb 31. Mai 1594 in Venedig. Von den
Werken seiner frühern Zeit, in welchen er Tizian nahestand,
sind der Sündenfall und der Tod Abels (in der Akademie zu
Venedig), Venus, Mars und Amor (im Palast Pitti zu Florenz), die
Anbetung des Kalbes und das Jüngste Gericht (in Santa Maria
dell' Orto in Venedig), das Wunder des heil. Markus (in der
Akademie daselbst, eins seiner vollendetsten Werke), die Hochzeit
zu Kana (in Santa Maria della Salute) und die große
Kreuzigung (in der Scuola di San Rocco daselbst) hervorzuheben,
welches Gebäude überhaupt 56 Gemälde von Tintorettos
Hand aufzuweisen hat. Seine sinkende Meisterschaft bezeugen die
Bilder im Dogenpalast, insbesondere das kolossale Paradies.
Zahlreiche Gemälde von ihm befinden sich in den Galerien zu
Paris, London, Dresden, Berlin, Wien, Madrid, Florenz und Venedig.
- Sein Sohn Domenico, ebenfalls il Tintoretto genannt (1562-1637),
leistete im Porträtfach Tüchtiges, malte aber auch
Mythologisches und Historisches, unter anderm das Seegefecht
zwischen den Venezianern und Kaiser Otto (im großen Ratssaal
zu Venedig). Vgl. Janitschek in Dohmes "Kunst und Künstler"
(Leipz. 1876).
Tione, Marktflecken in Südtirol, an der Sarca, im
Thal Giudicarien, Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines
Bezirksgerichts, mit (1880) 1876 Einw., welche Seidenzucht und
Gerberei betreiben.
Tippecanoe (spr. tippekanu), Fluß im nordamerikan.
Staat Indiana, ergießt sich oberhalb Lafayette in den Wabash.
An seinen Ufern schlug General Harrison 5. Nov. 1811 die von
Elskwatawa, dem "Propheten", geführten Indianer.
Tippen (Dreiblatt, Zwicken), ein in Deutschland sehr
verbreitetes Kartenglücksspiel. Man spielt es unter 3-6
Personen mit 32, bei noch mehr Teilnehmern mit 52 Blättern.
Der Kartengeber setzt 3 Marken Stamm, gibt jedem Spieler 3
Blätter zu 1 und wirft dann ein Trumpfblatt auf. Steht nur der
Stamm, so müssen alle Spieler "mitgehen", und wer keinen Stich
bekommt, zahlt Bête (was im Pot steht). Sobald Bête
steht, darf der Spieler, welcher auf einen Stich nicht rechnet,
passen; hat jemand aber gute Karten, so sagt er: "ich gehe mit"
oder "tippt" mit dem Finger auf den Tisch. Für jeden Stich
erhält man den dritten Teil des stehenden Satzes. Man
muß Farbe bedienen oder trumpfen.
Tippera, fruchtbarer und dicht bevölkerter Distrikt
in der britisch-ind. Provinz Bengalen, an der Mündung des
Megnaarmes des Brahmaputra, 6451 qkm (117 QM.) groß mit
(1881) 1,519,338 Einw. und dem Hauptort Comillah. Östlich
davon liegt das unter britischer Oberhoheit stehende
T.-Hügelland (Hill T.), welches auf 10,582 qkm (192 QM.) nur
95,637 Einw. (größtenteils halbe Wilde) zählt.
Tipperáry, 1) Binnengrafschaft in der irischen
Provinz Munster, umfaßt 4297 qkm (78 QM.) mit (1881) 199,612
Einw., von denen 95 Proz. römisch-katholisch sind. Der
Fluß Suir durchfließt den Hauptteil der Grafschaft, den
die Silvermine Mountains (694 m) von dem an den Shannon grenzenden
Teil trennen. Der Südwesten ist gebirgig (Galtymore 919 m,
Knockmealdown 795 m), aber das Innere nimmt eine Ebene ein, die
wegen ihrer Fruchtbarkeit als Goldene Aue (Golden Vale) bezeichnet
wird. Von der Oberfläche sind (1888) 16 Proz. Ackerland, 67
Wiesen und Weiden, 2,6 Proz. Wald. An Vieh zählte man
719
Tippu Sahib - Tirard.
1881: 28,987 Pferde, 244,029 Rinder, 205,850 Schafe und 74,540
Schweine. Steinkohlen werden gewonnen; Kupfer, Zink und Blei kommen
vor. Die Industrie ist ohne Bedeutung. Die Grafschaft zerfällt
in zwei Ridings mit den Hauptstädten Nenagh und Clonmel. -
2) Stadt in der Goldenen Aue der irischen Grafschaft gleiches
Namens, an einem Nebenfluß des Suir, hat eine Lateinschule
und (1881) 7274 Einw.
Tippu Sahib, Sultan von Maissur, geb. 1751, folgte seinem
Vater Haider Ali (s. d.) 10. Dez. 1782 in der Regierung, focht mit
Glück gegen die in Südindien sich befestigenden
Engländer und schloß mit ihnen im März 1784 einen
Vertrag, wonach sie sein Reich räumen mußten. Er legte
sich hierauf den Titel eines Padischahs bei, durch welchen er eine
Souveränität über alle Fürsten Hindostans
beanspruchte, und seine Hofhaltung wurde eine der glänzendsten
in Indien. Im Dezember 1789 verbündeten sich die
Engländer mit seinen Nachbarn, eroberten 1790 und 1791 mehrere
feste Plätze in Maissur, schlossen T. im Februar 1792 in
seiner Hauptstadt Seringapatam ein und zwangen ihn zu einem
für ihn höchst nachteiligen Friedensschluß. T.
schloß hierauf einen geheimen Bund mit Frankreich gegen
England. Dieses aber kam ihm im Februar 1799 mit der
Kriegserklärung zuvor, und T. fiel 4. Mai d. J. bei der
Erstürmung von Seringapatam durch die Engländer. Seiner
Familie ward die Festung Vellor, später Kalkutta zum Wohnort
und eine jährliche hohe Pension angewiesen, die 1860
abgelöst wurde; jetzt ist die Familie in der Bevölkerung
aufgegangen. Vgl. "The history of Tippoo Sultan, written by Mir
Hussain Ali Khan" (übersetzt von Miles, Lond. 1844).
Tippu-Tipp (Tippo-Tib), eigentlich Hamed bin Mohammed,
arab. Großkaufmann und Pflanzer, früher auch
Sklavenhändler am obern Congo, welcher an diesem Fluß
oberhalb der Stanleyfälle die Stationen Kibonge, Riba Riba und
Kasongo (die letzte, etwas abseits vom Congo oberhalb Njangwe
gelegen, ist die Hauptstation) nebst zahlreichen andern kleinen
Handelsposten besitzt, gegenwärtig auch als Gouverneur der
Station Stanley Falls im Dienste des Congostaats steht. T. wurde
uns zuerst durch Cameron bekannt, dem er 1874 bei seiner
Durchquerung Afrikas über den Lualaba bis nach Utotera (5°
südl. Br. und 25° 54' östl. L. v. Gr.) das Geleit
gab. Als Stanley 1876 seine denkwürdige Entdeckungsreise den
Congo abwärts machte, lieh ihm T. seinen wertvollen Beistand,
namentlich zur Überwindung der Stanleyfälle. Schon zu
jener Zeit war T. ein höchst einflußreicher Mann,
seitdem wuchs sein Einfluß noch mehr, wiewohl ihn seine
Handelsunternehmungen in große Abhängigkeit von den
indischen Händlern an der ostafrikanischen Küste
brachten, die ihn das Anerbieten Stanleys bei dessen Zug zu Emin
Pascha, in die Dienste des Congostaats zu treten und Stanley bei
seinem Unternehmen zu unterstützen, bereitwilligst annehmen
ließ. Nach einem Anfang 1887 abgeschlossenen Vertrag nahm T.
die Würde eines Gouverneurs des Congostaats am obern Congo
gegen einen Monatsgehalt von 30 Pfd. Sterl. an, mit der
Verpflichtung, das ihm unterstellte Gebiet gegen alle Angriffe von
Arabern und Eingebornen zu schützen, unterhalb Stanley Falls
selbst keinen Sklavenhandel zu betreiben, auch diesen Handel von
andrer Seite in aller Weise zu verhindern. Ein Beamter des
Congostaats wurde ihm als Resident beigegeben, um T. zu
überwachen. T. verpflichtete sich ferner, für Stanleys
Expedition zu Emin Pascha von den Stanleyfällen und
zurück 600 Träger gegen eine Zahlung von 6 Pfd. Sterl.
für den Mann zu beschaffen. Mit diesen Trägern
beabsichtigte Stanley, die von Emin Pascha aufgespeicherten 75 Ton.
Elfenbein im Wert von 60,000 Pfd. Sterl. zur Küste zu bringen
und damit die von der ägyptischen Regierung ihm für sein
Unternehmen vorgestreckte Summe zurückzuzahlen. Stanley
schloß diesen Vertrag mit T. in Sansibar ab und nahm diesen
mit 40 seiner Leute von dort zur Congomündung und dann mit der
Expedition den Congo aufwärts bis zur Aruwimimündung mit,
T. ging darauf zu den Stanley Falls, um diese 26. Aug. 1886 von den
Arabern zerstörte Station wieder einzurichten; indessen
erfüllte er sein Versprechen, Träger für Stanley zu
stellen, erst nach dessen Rückkehr von Emin Pascha zum Lager
Bunalya am Aruwimi, und auch da sandte er nur 100 Mann.
Tipton (spr. tippton), Stadt in Staffordshire (England),
bei Dudley, hat Kohlen- und Eisengruben, Gießereien,
Kettenschmieden, Maschinenbau und (1881) 30,013 Einw.
Tipuani, Bergdorf im Departement La Paz der Republik
Bolivia, am Ostabhang der Binnenkordillere, 580 m ü. M.,
bekannt durch seine Goldwäscherei.
Tipula, Schnake, Bachmücke; Tipulariae
(Mücken), Familie aus der Ordnung der Zweiflügler, s.
Mücken.
Tiraboschi (spr. -ski), Girolamo, ital.
Litterarhistoriker, geb. 28. Dez. 1731 zu Bergamo, bei den Jesuiten
in Monza gebildet, nahm die geistlichen Weihen und lehrte in
Mailand und Novara an niedern Schulen, bis er die Professur der
Rhetorik an der Brera zu Mailand erhielt; 1770 wurde er Abt und
Oberbibliothekar beim Herzog Franz II. von Modena. Hier benutzte er
die ansehnlichen litterarischen Hilfsmittel, die ihm zu Gebote
standen, zur Ausarbeitung seiner berühmten "Storia della
letteratura italiana" (Modena 1772-82, 14 Bde.; 2. Ausg. 1787-93,
16 Bde.; Flor. 1805-12, 20 Bde.; am besten Mail. 1822-26, 16 Bde.;
deutsch im Auszug von Jagemann, Leipz. 1777-81, 6 Bde.), eines
Werkes von erstaunlicher Gelehrsamkeit, Genauigkeit und
Vollständigkeit, das von den ersten Anfängen
wissenschaftlicher Bildung in Italien bis zum Beginn des 18. Jahrh.
reicht und den gesamten Schriftschatz in allen seinen Zweigen
behandelt. T. starb als Ritter (cavaliere) und herzoglicher Rat 3.
Juni 1794 auf seinem Landgut bei Modena. Von seinen übrigen
Schriften sind die "Biblioteca Modenese" (Modena 1781-1786, 5 Bde.)
und die "Memorie storiche Modenesi^ (das. 1793, 6 Bde.) namhaft zu
machen.
Tirade (franz.), ein längerer deklamationsartiger
Worterguß, weitschweifiger Wortschwall; in der Musik eine
Verzierungsmanier, bestehend aus einer Anzahl
stufenmäßig aufeinander folgender schneller Noten, die
ein größeres Intervall ausfüllen.
Tirailleure (franz., spr. -ra[l]jöhre), in
aufgelöster Ordnung kämpfende Mannschaften der Infanterie
(Plänkler, Schützen); vgl. Schwärmen.
Tirailleurfeuer, s. Schießen.
Tirana, 120 m hoch und sehr schön gelegene Stadt im
türk. Wilajet Skutari, westlich von Durazzo, um 1600 n. Chr.
gegründet, hat einen großen Bazar, viele Moscheen und
Gärten, eine kath. Kirche und 22,000 meist mohammedan.
Einwohner.
Tirano, Flecken in der ital. Provinz Sondrio, im Veltlin,
an der Adda, mit einigen Palästen aus dem 16. Jahrh.,
besuchten Märkten, Weinbau und (1881) 3036 Einw. Unweit am
Eingang in das Thal Poschiavo (Puschlav) die berühmte
Wallfahrtskirche Madonna di T. aus weißem Marmor.
Tirard (spr. -rár), Pierre Emmanuel, franz.
Mi-
720
Tiraspol - Tiro.
nister, geb. 27. Sept. 1827 zu Genf von französischen
Eltern, lernte die Goldarbeiterkunst, begab sich 1846 nach Paris
und erhielt hier eine Anstellung in der Verwaltung der
Straßen und Brücken. Doch nahm er 1851 wieder seine
Entlassung und begründete ein Exportgeschäft für
Bijouterie- und Goldschmiedewaren, das einen guten Fortgang hatte.
An der Politik nahm er regen Anteil und schloß sich der
radikalen Partei an. Nach dem Sturz des Kaiserreichs 4. Sept. 1870
ward er Maire des sechsten Arrondissement von Paris. Bei dem
Ausbruch des Aufstandes vom 18. März 1871 wurde er zum
Mitglied der Kommune erwählt, sagte sich aber bald von ihr los
und ging nach Versailles, um zwischen der Nationalversammlung und
der Kommune eine friedliche Vermittelung zu versuchen, was jedoch
erfolglos blieb. Seit 8. Febr. 1871 Mitglied der
Nationalversammlung und seit 1876 Deputierter, schloß er sich
den radikalen Republikanern an. Er war vom März 1879 bis
November 1881 und vom Januar bis August 1882 Minister für
Handel und Ackerbau, vom August 1882 bis März 1885
Finanzminister und vom Dezember 1887 bis April 1888 und wieder seit
21. Febr. 1889 Ministerpräsident. Auch ist er Senator.
Tiraspol, Kreisstadt im russ. Gouvernement Cherson, am
Dnjestr und an der Eisenbahn von Odessa nach Jassy, hat eine in der
Nähe befindliche Festung, 4 Kirchen (darunter eine der
Altgläubigen), 2 Synagogen und (1887) 24,898 Einw. Die
Industrie besteht in Getreidemüllerei (Dampfmühle),
Gartenbau, Talgsiederei, Lichte- und Tabaksfabrikation.
Tiraß, Decknetz zum Fang von Wildgeflügel.
Tiratelli, Aurelio, ital. Maler, geb. 1842 zu Rom, war
seit 1856 Schüler der St. Lukas-Akademie und widmete sich
anfangs der Plastik. Nachdem er unter andern das Denkmal des
mexikanischen Gesandten Baron Guerra auf dem Campo santo zu Rom
geschaffen, wandte er sich seit 1873 der Landschafts-, Genre- und
Tiermalerei zu. Von seinen durch sorgfältige Detailbehandlung
und Lebendigkeit der Darstellung ausgezeichneten Gemälden,
deren Motive er ausschließlich Rom und seiner Umgebung
entnimmt, sind hervorzuheben: Viehmarkt in der römischen
Campagna, ein Eisenbahnunglück, Landleute auf einem von
Büffeln gezogenen Wagen (Museum zu Triest), Ernte in der
Campagna, Erntewagen in der römischen Campagna, eine
Ochsenherde auf der Landstraße, Büffelkampf in der
Campagna und eine Büffelversammlung an einem Sumpf.
Tire, Stadt im asiatisch-türk. Wilajet Aidin, am
Kütschük Menderes, 55 km südöstlich von Smyrna,
mit welchem es durch Eisenbahn verbunden ist, mit etwa 13,000
Einw.
Tireboli, Stadt im asiatisch-türk. Wilajet Tarabozon
(Trapezunt), 82 km westlich von Trapezunt am Schwarzen Meer
gelegen, mit 2-3000 meist türk. Einwohnern, Post, Telegraph
und einer verfallenen Festung. T. ist das antike, von Griechen aus
Milet im 8. Jahrh. v. Chr. gegründete Tripolis.
Tiree (Tyree, spr. tirrih), Insel der innern Hebriden,
zur schott. Grafschaft Argyll gehörig, 70 qkm groß mit
2730 Einw. Ben Haynish (132 m) ist der höchste Punkt; etwa der
dritte Teil der Insel ist angebaut. Vorzüglicher Marmor wird
gebrochen.
Tire-haut! (franz., spr. tir-oh), Zuruf, um bei der Jagd
auf vorbeistreichendes Federwild aufmerksam zu machen.
Tires (engl., spr. teirs), eiserne oder stählerne
Radkränze für Lokomotiven- u. Eisenbahnwagenräder
etc.
Tiresias, s. Teiresias.
Tiret (franz., spr. tirä), Bindestrich,
Gedankenstrich.
Tirguschu (rumän. Tirgu-Jiu, Targulu-Jiuliu),
Hauptstadt des rumän. Kreises Gorschi, am Schiul (Jiu), Sitz
des Präfekten und eines Tribunals, hat 5 Kirchen, eine
Normalschule und 3712 Einw.
Tirhaka (ägypt. Talhaka), dritter äthiop.
König von Ägypten, schlug 701 v. Chr. den assyrischen
König Sanherib bei Altaku, wodurch er das Reich Juda von den
Assyrern befreite, wurde aber 672 von dem König von Assyrien,
Assarhaddon, vertrieben und versuchte vergeblich, Ägypten
wiederzuerobern.
Tirhala, Stadt, s. Trikkala.
Tirlemont (spr. tirl'mong, vläm. Thienen), Stadt in
der belg. Provinz Brabant, Arrondissement Löwen, an der
Großen Geete, Knotenpunkt an der Eisenbahn
Brüssel-Lüttich, früher befestigt, seit dem
Mittelalter sehr zurückgegangen, hat eine schöne gotische
Liebfrauenkirche (1298 gegründet), die Kirche St.-Germain (12.
Jahrh.), eine Bibliothek, ein Kommunalcollège, Fabrikation
von Dampfmaschinen, Flanell, wollenen Strümpfen, Leder,
Zucker, Öl etc., Getreide- und Wollhandel und (1888) 15,315
Einw. Hier 16. März 1793 Sieg der Franzosen unter Dumouriez
über die Österreicher.
Tirmentau, westlicher Gebirgszug des Urals im
Gouvernement Ufa, Kreis Sterlitamak; 3 km vom Dorf Chasina ist in
einem der Felsen eine große Höhle, welche Lepechin
beschrieben hat.
Tirnau (ungar. Nagyszombat), königliche Freistadt im
ungar. Komitat Preßburg, an der Waagthalbahn, mit 9
römisch-kath. Kirchen (darunter der 1389 erbaute Dom),
mehreren Klöstern, einer evang. Kirche und (1881) 10,830
deutschen, slowakischen und ungar. Einwohnern, die Gewerbe, Handel
und Weinbau treiben. T. hat eine Zuckerfabrik, eine kath.
Lehrerpräparandie, ein kath. Obergymnasium, ein kath. Seminar,
ein Bezirksgericht, ein großes Militärinvalidenhaus mit
Spital und Irrenanstalt, ein Komitatsspital, ein Theater und ein
Denkmal zur Erinnerung an die 14. Dez. 1848 gefallenen
Honvéds. Bis 1773 bestand hier eine Universität.
Tirnowa (d. h. Dornburg), Kreishauptstadt in Bulgarien,
an der Jantra, zwischen höchst abenteuerlich geformten
Kalkfelsen erbaut, ehemals die Hauptstadt des Landes, Ausgangspunkt
mehrerer Straßen über den Balkan, hat Moscheen, mehrere
byzantin. Kirchen, Bäder, bedeutenden Zwischenhandel und
(1887) 11,314 Einw. (meist Bulgaren). Von der früher lebhaften
Webindustrie hat sich nur die Fabrikation groben Tuches, ferner
Färberei sowie Seidenzucht erhalten.
Tiro (lat.), junger Soldat, Rekrut; überhaupt
Anfänger, Neuling; daher Tirocinium, der erste Feldzug eines
Soldaten; die erste Probe in einer Sache; auch Titel von
Lehrbüchern für Anfänger.
Tiro, Marcus Tullius, röm. Gelehrter, geboren um 94
v. Chr., anfänglich Sklave, seit 54 Freigelassener des Cicero,
dem er durch besondere Gelehrsamkeit und Geschicklichkeit ein
geschätzter Begleiter und Gehilfe wurde. Nach Ciceros Tod zog
er sich auf ein kleines Landgut bei Puteoli zurück, wo er,
fast hundertjährig, 5 n. Chr. starb. Von seinen Schriften sind
uns nur einzelne Bruchstücke erhalten. Er gab die Werke
Ciceros heraus, sammelte und veröffentlichte dessen Witzworte
und schrieb eine Biographie desselben, welche Plutarch im "Leben
Ciceros" benutzt hat. Außerdem verfaßte er eine Schrift
über den lateinischen Sprachgebrauch und eine große
Encyklopädie unter dem Titel: "De variis atque promiscuis
quaestionibus". Am bekanntesten aber ist T.
TIROL
Maßstab 1: 1.100,000
Die Sitze der Bezirkshauptmannschaften sind unterstrichen.
721
Tirol (Bodenbeschreibung, Bewässerung, Klima).
wegen der Erfindung der altrömischen Kurzschrift, die man
seitdem 16. Jahrh. als die Tironischen Noten bezeichnet. Das
Alphabet der Tironischen Stenographie ist gebildet durch
Verkürzung und Vereinfachung der römischen
Majuskelzeichen. In der Verbindung miteinander erfahren die
Tironischen Buchstaben mancherlei Modifikationen und
Verschmelzungen, für einige Vokale besteht eine einfache
symbolische Bezeichnung an dem vorangehenden Konsonantenzeichen.
Als Abkürzungen benutzt, stehen die Tironischen
Buchstabenzeichen für häufig vorkommende Wörter, und
zwar werden durch Benutzung kleiner diakritischer Merkmale, durch
Ansetzen von Endungszeichen u. dgl. aus einem einzigen
alphabetischen Zeichen oft viele Abkürzungen dieser Art
gebildet. Bei der Mehrzahl der nicht auf solche Weise
gekürzten Wörter geschieht die notwendige Vereinfachung
durch Buchstabenauslassen, in dessen Vornahme eine systematische
Regelmäßigkeit nicht erkannt werden kann. Das geschickte
Verwerten des Punktes und der verkleinerten Buchstaben als
Nebenzeichen liefert weitere Mittel zur Kürzung, die auch im
zusammenhängenden Satz ihre Anwendung findet (Schriftprobe s.
auf Tafel "Stenographie"). Aus zahlreichen Stellen der alten
Autoren wissen wir, daß Geschwindschreiber (notarii) mit den
Tironischen Noten öffentliche Reden und Verhandlungen
wörtlich aufnahmen. Unter den Kaisern ward das Tironische
Notensystem als Lehrgegenstand in den Schulen vorgetragen. Mit dem
Sinken des römischen Reichs schwand auch die Kenntnis der
Tironischen Noten, doch erlebten diese unter den Karolingern noch
eine Nachblüte, ehe sie ganz der Geschichte anheimfielen.
Unsre Kenntnis der Tironischen Noten beruht teils auf ganzen Werken
oder einzelnen Abschnitten in Tironischen Zügen, die sich
erhalten haben, teils auf lexikonähnlichen Lehrbüchern.
Die ältesten Handschriften dieser Art stammen aus dem 8.
Jahrh. n. Chr. Vgl. Engelbronner, De M. T. Tirone (Amsterd. 1804);
Mitzschke, M. T. Tiro (Berl. 1875); Egger, Latini sermonis
vetustioris reliquiae selectae (Par. 1843); Kopp, Palaeographia
critica (Mannh. 1817); Schmitz im "Panstenographikon" Leipz.
(1869-74); Lehmann, Quaestiones de notis Tironis et Senecae (das.
1869); Mitzschke, Quaestiones Tironianae (Berl. 1875); Rueß,
Über die Tachygraphie der Römer (Münch. 1879);
Zeibig, Geschichte und Litteratur der Geschwindschreibkunst (2.
Aufl., Dresd. 1878); Lehmann, Das Tironische Psalterium der
Wolfenbüttler Bibliothek (Leipz. 1885).
Tirol (hierzu Karte "Tirol"), österreich. Kronland,
gefürstete Grafschaft, grenzt mit Einschluß von
Vorarlberg (s. d.) westlich an die Schweiz und Liechtenstein,
nördlich an Bayern, östlich an die österreichischen
Kronländer Salzburg und Kärnten, südlich an Italien
und umfaßt ohne Vorarlberg 26,690 qkm (484,73 QM.), mit
Vorarlberg aber 29,293 qkm (531,99 QM.). T. ist das gebirgigste
Land Österreichs und hat Anteil an dem nördlichen,
mittlern und südlichen Zug der Alpen. Die nördliche
Gebirgsmasse beginnt mit den Vorarlberger (Algäuer) Alpen und
dem Bregenzer Wald, welche sich vom Bodensee bis zum Lech hinziehen
(Rote Wand 2705 m, Hochvogel 2589 m, Arlberg mit Paß 1797 m)
und in den Nordtiroler Alpen mit dem Wettersteingebirge (Zugspitze
2960 m), dem Karwändelgebirge (2736 m) und dem Solstein (2655
m) ihre Fortsetzung finden. Den nordöstlichsten Teil Tirols,
jenseit des Inn, erfüllen die Kitzbühler Alpen (Breithorn
2496 m) und das denselben nördlich vorlagernde Kaisergebirge
(2375 m). Die Zentralzone der Alpen beginnt in T. mit dem
Rätikon (Scesaplana 2963 m) und den nördlichen
Ausläufern der Rätischen Alpen (Albuinkopf 3313m), setzt
sich in dem gletscherreichen Massiv der Ötzthaler Alpen
(Wildspitze 3776 m), in der Stubaier Gruppe (Zuckerhütl 3508
m) und den Sarnthaler Alpen (Hirzer 2781 m) fort. Der
Brennerpaß scheidet diesen westlichen Teil von dem
östlichen Zug der Zentralalpen, dem Zillerthaler Gebirgsstock
(Hochseiler 3506 m) und den Hohen Tauern (s. d.), von welchen sich
an der Tiroler Grenze noch die Dreiherrnspitze und der
Großvenediger erheben. Dem südlichen Alpenzug
gehören in T. an die Gruppen des Ortler (s. d.), des
höchsten Bergs des Landes und der Monarchie (3905 m), des
Adamello und der Presanella (3547 m), die Brentagruppe (3179 m),
die westlichen Trientiner Alpen; dann östlich vom Etschthal
die Lessinischen Alpen (Cima Dodici 2331 m), die Südtiroler
Dolomitalpen (Vedretta Marmolata 3494 m), die Fassaner und
Ampezzaner Alpen, endlich an der Grenze gegen Kärnten die
Karnischen Alpen. Die wichtigsten Alpenpässe in T. sind: das
Reschenscheideck, der Brenner, der Arlberg, das Stilfser Joch,
Finstermünz, Tonale, die Ehrenberger Klause, der Scharnitz-
und Achenpaß (diese drei nach Bayern), der Strub-, Thurn- und
Gerlospaß (diese drei nach Salzburg). Die Hauptthäler
sind: das Ober- und Unterinnthal, das Etsch- und Eisack- und das
Pusterthal. Unter den Nebenthälern sind besonders das
Ötz-, Wipp- und Zillerthal, Fleimser, Fassa- und Grödner
Thal, Sulzberg und Nonsberg, Giudicarien und Valsugana
hervorzuheben. Das nördliche T. gehört zu dem
Flußgebiet des Rheins und der Donau, zu letzterm auch der
östliche Teil des Pusterthals, aus welchem die Drau nach
Kärnten übertritt. Alles übrige gehört zum
Gebiet des Adriatischen Meers. Der Rhein empfängt aus
Vorarlberg die Ill, während die Bregenzer Ache in den Bodensee
direkt mündet. Der Inn betritt das Land bei Finstermünz
und verläßt es unterhalb Kufstein, nachdem er die
Rosana, den Ötzbach, Sill und Ziller aufgenommen. Ganz im N.
Tirols entspringen der Lech und die Isar, die aber bald nach Bayern
übergehen. Der Hauptfluß des südlichen T. ist die
Etsch (Adige), die links die Passer, den Eisack und den Avisio,
rechts den Noce aufnimmt und bei Borghetto in das Venezianische
übertritt. Außerdem sind von Flüssen zu nennen: im
SW. die Sarca, im SO. die Brenta. Unter den Seen sind der Boden-
und der Gardasee, deren Spiegel nur zum Teil zu T. gehören,
die größten; außer diesen beiden gibt es nur
kleinere Seen, z. B. der Achensee, der Brennersee, der See von
Caldonazzo, der Loppiosee. Die berühmtesten der zahlreichen
(123) Mineralquellen sind die von Rabbi, Prags, Maistatt, Innichen,
das Brennerbad und das Mitterbad im Thal Ulten. Das Klima Tirols
ist sehr verschieden, indem die zentrale Gebirgskette eine
Klimascheide bildet. Nördlich von derselben ist die Temperatur
vorherrschend rauh und kalt; südlich von der Zentralkette,
namentlich im Etschthal, erreicht die Sommerwärme oft eine
unerträgliche Höhe. Die mittlere Jahrestemperatur
beträgt in Innsbruck +8° C., in Bludenz +8½°
C., in Lienz +7½° C., in Trient dagegen +12,6° C. Im
nördlichen T. beträgt der Regenniederschlag
gewöhnlich 88-122 cm im Jahr, in Südtirol etwa 94 cm. Die
niedrigern Striche des Innthals, wie das Zillerthal, haben
ergiebiges Ackerland; im Etschthal erinnert schon die ganze Natur
an Italien, und hier ist der Boden überaus fruchtbar.
Die Bevölkerung von T. betrug mit Einschluß
722
Tirol (Bevölkerung, Naturprodukte, Bergbau, Industrie).
von Vorarlberg 1869: 885,789, 1880: 912,549, ohne dasselbe 1869:
782,753, 1880: 805,176 Seelen und zeigt eine sehr geringe Zunahme
(jährlich etwas über ¼ Proz.); für Ende 1887
wird die Zivilbevölkerung von T. mit 805,728 (hierzu
Militär ca. 8140 Mann), für Vorarlberg mit 110,525
(Militär ca. 130 Mann), zusammen mit 916,253 Bewohnern (hierzu
Militär ca. 8270 Mann) berechnet. Auf 1 qkm kommen im
Durchschnitt 31 Einw. (in Vorarlberg 41). Von der Bevölkerung
gehören 60 Proz. der deutschen, 40 Proz. der italienischen
Nation an. Am weitesten zieht sich die deutsche Bevölkerung an
der Etsch hinab. Die herrschende Religion ist die katholische, die
Protestanten bilden bis jetzt nur wenige kleine Gemeinden; ihre
Zahl betrug 1880: 2190, die der Juden 542. Die geistige Bildung des
Tirolers ist infolge klerikaler Einflüsse weit hinter seiner
Bildungsfähigkeit zurückgeblieben. Ein gemeinsamer
Charakterzug des Volkes ist Anhänglichkeit an das Vaterland
und kirchlicher Sinn. Infolge der geringen Produktivität des
Bodens sucht eine bedeutende Anzahl der Bewohner (etwa 33,000) ihr
Fortkommen zeitweilig oder dauernd in der Fremde; in den letzten
Jahren hat die Auswanderung auch nach überseeischen
Ländern, namentlich in Welschtirol, größere
Ausdehnung gewonnen.
Die Bodenproduktion Tirols ist wegen der gebirgigen
Beschaffenheit vorwiegend auf Waldwirtschaft und Viehzucht
beschränkt; doch wird, wo nur möglich, auch
Körnerbau betrieben. Die produktive Bodenfläche
beträgt 81,69 Proz. des Gesamtareals. Nach Kulturgattungen
verteilt sich die produktive Bodenfläche folgendermaßen:
Ackerland 6,23 Proz., Weinland 0,54, Wiesenland 8,21, Gärten
0,21, Weiden 5,83, Alpen 32,51, Wald 46,18, Seen, Teiche 0,29 Proz.
Was zunächst das Grasland betrifft, so läßt die
Kultur der Wiesen an Düngung und Bewässerung zu
wünschen übrig, dagegen ist die Art der Heugewinnung und
Auftrocknung ausgezeichnet. Überwiegend sind die Alpenweiden,
auf welchen das Vieh den Sommer über gehalten wird. Der
gesamte Ertrag an Grasheu beläuft sich auf etwa 11 Mill. metr.
Ztr. In der Bewirtschaftung der Äcker herrschen große
Verschiedenheiten. In Nordtirol überwiegt die
Eggartenwirtschaft mit langjähriger Grasnutzung, in Vorarlberg
die freie Wirtschaft. Eigentümlich ist die Feldwirtschaft in
Südtirol, wo es für Feldprodukte nur schmale Ackerbeete
zwischen den Reben- oder auch Maulbeerbaumpflanzungen gibt, welche
meist einem sehr bunten Zwischenfruchtbau gewidmet sind. Die
Produkte des Ackerbaues in T. sind: Weizen (250,000 h.), Roggen
(435,000), Gerste (185,000), Hafer (140,000), Mais (420,000 hl),
letzterer in Südtirol Hauptfrucht, aber auch in Nordtirol, z.
B. im obern Inn- und Lechthal, vertreten; ferner
Hülsenfrüchte (37,000 hl), Buchweizen (125,000 hl),
Kartoffeln (1,120,000 hl), besonders in Vorarlberg,
Futterrüben (340,000 metr. Ztr.), Klee (180,000 metr. Ztr.
Heu), Flachs (10,000 metr. Ztr.), insbesondere im Ötzthal,
Hanf (2000 metr. Ztr.) in Vorarlberg, Tabak (8000) metr. Ztr.) um
Roveredo, Zichorie (2200 metr. Ztr.) in Vorarlberg, etwas Mohn,
Kürbisse etc. Die Obstkultur ist in Nordtirol meist auf die
nicht großen Gärten beschränkt; das Kernobst wird
zu Obstwein (Cider) und das Steinobst zur Branntweinerzeugung
verwendet. In Südtirol ermöglichen die Lage und
Temperatur die Kultivierung edler Obstsorten, von denen neben der
Traube auch Pfirsiche, Aprikosen, Mandeln, Zitronen (am Gardasee),
Orangen, edlere Apfelsorten, besonders bei Bozen (Hauptsorte der
weiße Rosmarinapfel), feine Birnen, Kirschen,
Granatäpfel etc. gezogen werden. Das Erträgnis an Obst
beläuft sich durchschnittlich in T. auf 90,000 metr. Ztr.
Kernobst, 40,000 metr. Ztr. Steinobst, 14,000 metr. Ztr. Nüsse
und Mandeln und 14,500 metr. Ztr. Kastanien. Der Ölbaum wird
in T. mit Erfolg nur in den südlichsten Teilen um Arco und
Riva gezogen; auch die Kultur der Maulbeerbäume ist auf
Südtirol beschränkt. Der Weinbau ist ebenfalls auf
Südtirol und kleine Teile des Pusterthals und Vorarlbergs
beschränkt. Die Weine sind in Deutschtirol vorwiegend
weiß und schiller, in Welschtirol rot, würzig und bei
guter Behandlung wertvoll. Als die vorzüglichsten Sorten
gelten die von Isera bei Roveredo und der Traminer.
Durchschnittlich beträgt die Weinernte 260,000 hl. Den
größten Teil der produktiven Bodenfläche Tirols
nehmen die Waldungen ein, von denen über 10 Proz. auf
Staatsforsten kommen. Eine der Haupterwerbsquellen ist für T.
ferner die Viehzucht. Nach der Zählung von 1880 gab es:
in Tirol in Vorarlberg
Pferde 14307 2680
Esel, Maulesel und Maultiere 4844 25
Rinder 420169 61115
Schafe 246436 12312
Ziegen 102017 12090
Schweine 45961 9684
Bienenstöcke 38962 5927
Der Stand der Pferde ist ein sehr geringer und nur im Pusterthal
von größerer Bedeutung; dagegen ist das Rindvieh sehr
reich und durch mehrere vorzügliche Rassen vertreten. Der
Ertrag an Milch beläuft sich auf 4,3 Mill. hl, jener an Butter
auf 85,000 metr. Ztr., an Käse auf 211,000 metr. Ztr. Zu
besserer Verwertung der Milchprodukte tragen
Molkereigenossenschaften bei. Die Seidenraupenzucht wird in
Südtirol stark betrieben, hat aber durch Raupenkrankheit und
durch den Druck der italienischen Konkurrenz sehr gelitten
(jährlicher Kokonsertrag ca. 14,000 metr. Ztr.). Die Jagd,
eine Lieblingsbeschäftigung der Tiroler, ist nicht mehr so
ergiebig wie früher. Steinböcke, Wildschweine und Hirsche
sind fast ausgerottet, Gemsen und Rehe selten, nur Hasen und
Geflügel noch in größerer Menge vorhanden.
Der Bergbau und Hüttenbetrieb, ehemals in Nordtirol von
hoher Bedeutung, hat fast seine ganze Wichtigkeit verloren.
Für Eisen bestehen 3 Bergwerke und 2 Hochöfen (zu Jenbach
und Pillersee), für Kupfer eine ärarische
Schmelzhütte zu Brixlegg und ein Privatwerk zu Prettau. Die
Hüttenproduktion belief sich 1887 auf 80 kg Silber, 2717 metr.
Ztr. Kupfer und 13,425 metr. Ztr. Roheisen. Außerdem wird
Bleierz (7881 metr. Ztr.), Zinkerz (22,152 metr. Ztr.),
Schwefelkies (18,000 metr. Ztr.) und Braunkohle (zu Häring,
dann zu Wirtatobel in Vorarlberg, zusammen 254,230 metr. Ztr.)
gefördert. Der Wert aller Verkaufsprodukte des Berg- und
Hüttenbetriebs war 592,500 Gulden. Hierzu kommt der Betrieb
der Saline zu Hall mit einer Produktion von 140,500 metr. Ztr. Salz
im Wert von 1,114,000 Guld. Sonstige Produkte des Bodens sind:
Asphalt, Farberde, Gips, Kreide, Quarz, Marmor (bei Laas und
Predazzo), Serpentin, Amethyste, Granate (Ötzthal und
Zillerthal) u. a. In industrieller Beziehung zeichnet sich vor
allem Vorarlberg (s. d.) durch regen Gewerbfleiß aus;
Südtirol hat mit vorwiegender Seidenindustrie auch in dieser
Richtung den Charakter einer italienischen Landschaft; im
übrigen Land bilden Innsbruck und Bozen hervorragende
Mittelpunkte industriellen Betriebs. Die Metallindustrie ist durch
die Werke zu Jenbach und Piller-
723
Tirol (Handel, Verkehrswesen etc.; Geschichte).
see vertreten, welche Gußwaren und Stahl erzeugen.
Außerdem werden Maschinen (Innsbruck und Jenbach),
Kleineisenwaren (im Stubaier Thal), Sensen und Sicheln, Nägel
und Drahtstifte, Nadeln (Fügen), Kupfertiefwaren und Bleche
(Brixlegg), Messing (Achenrain), leonische Waren (Stans) in
größerer Menge erzeugt. Ferner gibt es Fabriken für
Steingut (Schwaz), für Zement (Kirchbichel u. a.), für
Marmorarbeiten, dann Glashütten, Fabriken für
Schießpulver, Dynamit, Bleiweiß, Seife und Kerzen,
Bierbrauereien, Branntweinbrennereien, Fabriken für
konservierte Früchte u. Gemüse (Bozen), für
Kaffeesurrogate, Teigwaren, Tabaksfabriken (Sacco und Schwaz). Der
Textilindustrie dienen, abgesehen von der bedeutenden Vorarlberger
Baumwollindustrie, mehrere Baumwollspinnereien und -Webereien, dann
Fabriken für Schafwollwaren, Filz, Zwirn und Bänder in
Nordtirol. Hierzu kommt die Seidenindustrie von Südtirol mit
den zahlreichen Seidenfilanden und Spinnereien (50,000 Spindeln)
und mehreren Seidensamtfabriken (Ala). Andre in T. vertretene
Industriezweige sind: die Gerberei (namentlich in Roveredo), die
Sumachbereitung, die Fabrikation von Papier, Holzstoff und
Cellulose, die Holzschnitzerei als Hausindustrie (besonders im
Grödner Thal), die Glasmalerei (Innsbruck), die Stickerei,
Spitzenklöppelei, Handschuhfabrikation u. a. Die Lage Tirols
zwischen Deutschland und Italien und die Vorteile wohlerhaltener
Kunststraßen und Eisenbahnen begünstigen den Handel mit
dem In- und Ausland wie auch den Transithandel. Das Land wird von
der Linie Kufstein-Ala (Brennerbahn) mit der durch das Pusterthal
führenden Seitenlinie Franzensfeste-Lienz-Marburg, dann von
den Staatsbahnlinien Salzburg-Wörgl und Innsbruck-Lindau
(Arlbergbahn) durchzogen. Die Gesamtlänge der Eisenbahnen
beläuft sich in T. und Vorarlberg auf 745 km.
Wasserverkehrswege bilden: der Inn von Hall bis zur Grenze (86 km),
der Rhein von Geißau bis zur Einmündung in den Bodensee
(5 km), die Etsch von Branzoll bis zur Grenze (105 km).
Außerdem werden der Boden-, der Garda- und der Achensee mit
Dampfschiffen befahren.
Für den Unterricht sorgen: die Universität zu
Innsbruck, 16 theologische Lehranstalten, 9 Obergymnasien, ein
Realgymnasium, 2 Oberrealschulen, 2 Unterrealschulen, 4 Lehrer- und
3 Lehrerinnenbildungsanstalten; ferner 5 Handelslehranstalten, 31
Gewerbeschulen, 3 landwirtschaftliche Lehranstalten, eine
Hebammenlehranstalt, 16 weibliche Arbeitsschulen und 28 sonstige
Lehr- und Erziehungsanstalten (meist in geistlichen Händen);
endlich 3 Bürger-, 1705 öffentliche und 59 private
Volksschulen. Der für T. bestehende Landtag (Vorarlberg
besitzt seine eigne Landesvertretung) besteht aus dem
Fürsterzbischof von Salzburg, den Fürstbischöfen von
Trient und Brixen, 4 Abgeordneten der Äbte und Pröpste,
dem Rektor der Innsbrucker Universität, 10 Abgeordneten des
Großgrundbesitzes, 13 der Städte, Märkte und
Industrialorte, 3 der Handels- und Gewerbekammern (zu Innsbruck,
Bozen und Roveredo) und 34 Vertretern der Landgemeinden, zusammen
aus 68 Landtagsmitgliedern. In den Reichsrat entsendet T. 18
Abgeordnete. In kirchlicher Beziehung ist das Land unter das
Erzbistum Salzburg (bis zur Ziller) und die Bistümer Brixen
und Trient verteilt. Das Wappen von T. (s. Tafel
"Österreichisch-Ungarische Länderwappen") bildet im
silbernen Feld ein aufrechter roter Adler mit gekröntem, nach
rechts gewandtem Kopf, der von einem Lorbeerkranz umgeben ist, und
mit silbernen Kleestengeln auf den ausgebreiteten Flügeln
(vgl. Busson, Der Tiroler Adler, Innsbr. 1879). Administrativ ist
das Land in 4 Städte mit selbständigem Statut und 24
Bezirkshauptmannschaften eingeteilt, wovon ^3[?] auf Vorarlberg
entfallen. Sitz der Statthalterei ist Innsbruck. Für die
Rechtspflege bestehen: ein Oberlandesgericht zu Innsbruck, 5
Gerichtshöfe erster Instanz und 67 Bezirksgerichte. Die
politische Einteilung von T. (jene von Vorarlberg s. d.) zeigt
folgende Tabelle:
Bezirke
Areal Bevölkerung 1880
in QKil. in QM
Städte:
Innsbruck 0,3 - 20537
Bozen 0,7 - 10641
Roveredo 8 0,1 8864
Trient 18 0,3 19585
Bezirkshauptmannschaften:
Ampezzo 369 6,7 6340
Borgo 729 13,2 43139
Bozen 1734 31,5 65812
Brixen 1203 21,8 26547
Brunek 1835 33,3 35509
Cavalese 765 13,9 23297
Cles 1166 21,2 49594
Imst 1705 31,0 23334
Innsbruck 2101 38,1 54970
Kitzbühel 1164 21,1 23138
Kufstein 1042 18,9 29953
Landeck 1918 34,8 24772
Lienz 2150 39,5 30846
Meran 2398 43,5 58209
Primiero 415 7,5 10983
Reutte 1096 19,9 16137
Riva 350 6,2 24495
Roveredo 708 12,9 52007
Schwaz 1654 30,0 26742
Tione 1230 22,3 36368
Trient 931 16,9 83357
Zusammen: 26690 484,7 805176
Vgl. Beda Weber, Das Land T. (Innsbr. 1837-1838, 3 Bde.; 2.
Aufl. als "Handbuch für Reisende in T.", 1853); Staffler, T.
und Vorarlberg, statistisch und topographisch (das. 1839-46, 2
Bde.); Schneller, Landeskunde von T. (das. 1872); Schaubach, Die
deutschen Alpen, Bd. 2, 4 u. 5 (2. Aufl., Jena 1866-67); Zingerle,
Sitten, Bräuche etc. des Tiroler Volks (2. Aufl., Innsbr.
1871); Hörmann, Tiroler Volkstypen (Wien 1877); Jüttner,
Die gefürstete Grafschaft T. und Vorarlberg (das. 1880);
Egger, Die Tiroler und Vorarlberger (Teschen 1882); Bidermann, Die
Nationalitäten in T. (Stuttg. 1886); "Spezial-Ortsrepertorium
von T." (hrsg. von der statistischen Zentralkommission, Wien 1885);
Grohmann, Tyrol and the Tyrolese (2. Aufl., Lond. 1877);
Schilderungen von Steub, Noë u. a.; Reisehandbücher von
Meyer ("Deutsche Alpen"), Bädeker, Trautwein, Amthor, Meurer
etc.
Geschichte.
T. wurde ursprünglich von rätischen, den Etruskern
oder Rasenna verwandten Stämmen bewohnt, zu welchen auch
Kelten hinzutraten. Vom Bodensee und den Lechquellen nordwärts
hausten die keltischen Vindelizier. Unter Kaiser Augustus eroberten
es die Römer und öffneten es dem Verkehr. Mit dem 2.
Jahrh. begannen die Einfälle germanischer Stämme,
insbesondere der Alemannen. Schon im 4. Jahrh. fand hier das
Christentum Eingang, für welches das Bistum Trient und wenig
später das in Seben errichtet wurde; letzteres wurde im 11.
Jahrh. nach Brixen verlegt. Nach dem Sturz des
abendländischen
46*
724
Tirol (Geschichte).
Kaisertums kam T. unter die Herrschaft der Ostgoten, nach deren
Zertrümmerung der nördliche Teil des Landes von den
Bojoaren (Bayern), der südliche von den Langobarden besetzt
ward. Dann ward T. fränkische Provinz, in Gaue geteilt, deren
Namen sich erhalten haben, wie Vintschgau (Finsgowe), Thal Passeyer
(Passir), Zillerthal (Cillarestal), Pusterthal (Pustrissa),
Innthal, Norithal (das innere T. um den Brenner herum) mit der
Grafschaft Bozen, und von Grafen verwaltet. Nach dem Aussterben des
karolingischen Hauses nahmen es die wieder emporgekommenen
bayrischen Herzöge zum Teil in Besitz. Außer den
geistlichen Fürsten von Brixen und Trient bewahrten ihre
Unabhängigkeit die Grafen von T., welchen der Vintschgau und
ein Teil des Engadin gehörte. Ihre Stammburg war Schloß
T. oberhalb Meran (früher Maias). Schon seit 1001 werden
Grafen von T. erwähnt, doch beginnt eine
regelmäßige Succession erst seit Albrecht I. um 1110.
Einer seiner Nachfolger, Albrecht IV. (1202-53), erwarb 1248 die
Grafschaft Andechs im Oberinnthal bei dem Aussterben der
Herzöge von Meran, welche diesen Titel als Markgrafen des am
Meer liegenden Istrien führten und sich von Friedrich I. von
Dießen (gest. 1020) ableiteten. Die übrigen Besitzungen
dieses Geschlechts in Oberbayern, wo Andechs am Starnberger See
lag, im Norithal (um Brixen) und Pusterthal wurden von den
Herzögen von Bayern und den Bischöfen von Brixen
okkupiert. Das Gebiet einer dritten Familie, nämlich der
Herren von Eppan, welche angeblich zum Geschlecht der Welfen
gehörten, erwarben in 12. Jahrh. die Bischöfe von Trient,
wie z. B. die Grafschaft Bozen. Diesem Stift war auch die
Grafschaft Matrei zugefallen, während das Zillerthal schon
seit dem 11. Jahrh. zum Erzstift Salzburg gehörte. Ein viertes
Geschlecht, die Grafen von Heimföls-Lurenfeld, seit dem 12.
Jahrh. Grafen von Görz genannt, war im
tirolisch-kärntnischen Pusterthal reich begütert. Als
Albrecht IV. von T. 1253 starb, teilten seine Schwiegersöhne,
die Grafen Meinhard I. von Görz und Gebhard von Hirschberg,
die kaum vereinigte Erbschaft; jener erhielt die Besitzungen der
Grafen von T., dieser die der Grafen von Andechs. Doch fiel die
Erbschaft Gebhards durch Kauf wieder an Meinhard II., Enkel des
letzten Grafen von T., welcher 1282 von Kaiser Rudolf I. die
Reichsunmittelbarkeit des nun in seinen Besitzverhältnissen
geschlossenen Landes zuerkannt erhielt, das nunmehr den Namen T.
(Etschland und Innthal) zu führen begann. Meinhards II. Enkel
Heinrich, Herzog von Kärnten und Graf von T., hinterließ
eine Erbtochter, Margarete Maultasch, welche zuerst mit Johann von
Luxemburg und dann mit dem Markgrafen Ludwig von Brandenburg,
Kaiser Ludwigs ältestem Sohn, vermählt war und nach dem
Tod ihres Sohns Meinhard 1363 das Land an die Herzöge von
Österreich abtrat. 1364 bestätigte der Kaiser diese
Gebietsveränderung im Vertrag zu Brünn, und 1369
erkannten sie auch die bayrischen Herzöge im Schärdinger
Vergleich an. Bei der Teilung der habsburgischen Brüder
Albrecht III. u. Leopold III. (1379) fiel T. an Herzog Leopold, der
1386 bei Sempach fiel. Bei der Teilung von 1406 überkam sein
jüngster Sohn, Herzog Friedrich IV. (mit der leeren Tasche),
das Land samt den schwäbischen Vorlanden in ziemlicher
Verwirrung, die sich durch den Konflikt, in den Friedrich mit dem
Konstanzer Konzil und dem Kaiser Siegmund 1415 geriet, noch
steigerte. Während Friedrich im Gebirge umherirrte, suchte
sich sein Bruder Ernst von Steiermark des Landes zu
bemächtigen; doch kam 1416 eine Versöhnung zwischen den
Brüdern zu stande, und die Grafschaft T. erhielt der Herzog
Friedrich zurück, der nun mit Hilfe des Landvolks den
widerspenstigen Adel demütigte. Von nun an erhielten die
Städte und das Landvolk gleiche politische Rechte mit den zwei
vornehmen Ständen (Landtag zu Meran 1433). Unter seinem Sohn
Siegmund, dem "münzreichen", aber durch verschwenderische
Freigebigkeit stets geldbedürftigen Herrscher, blühte der
Bergbau in T. auf, zumal die Silbergruben von Schwaz ergaben
unermeßliche Ausbeute. Dieser Fürst ist besonders
bekannt durch den Kirchenstreit, der 1455 zwischen ihm und dem
Bischof von Brixen, Nikolaus von Cusa, wegen der Vogtei über
das Nonnenkloster Sonnenburg im Pusterthal sich entspann und 1464
resultatlos endete. Da Siegmund kinderlos war, übergab er die
Grafschaft 1490 seinem Neffen, dem König Maximilian I., der
sie 1504 durch das Zillerthal, Kufstein, Kitzbühel,
Rattenberg, das kärntnische Pusterthal zwischen Ober-Drauburg
und Lienz, ferner gegen Italien durch die Reichsvikariate Ala,
Avia, Mori, Brentonico, das Grenzgebiet von Covolo (Kofel) und
Pudestagno (Peutelstein), ferner Riva und Roveredo
vergrößerte und ihr den Titel gefürstete Grafschaft
beilegte. Ferdinand I. trat der Reformation entgegen, die seit 1522
im Land Eingang gefunden hatte, unterdrückte zwar 1525 den
Bauernaufstand, den in Brixen Michael Geißmayer angestiftet
hatte, mußte aber die freie Predigt nach dem Wort Gottes
gestatten. Erst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. ward
durch das Zusammenwirken des katholischen Adels und der Regierung
in Innsbruck bewirkt, daß T. von den Protestanten verlassen
wurde. Nach Ferdinands I. Tod (1564) übernahm sein zweiter
Sohn, Erzherzog Ferdinand, der Gemahl der schönen Philippine
Welser von Augsburg, die Regierung; da Ferdinand keine
erbberechtigten Söhne hinterließ, so fiel nach seinem
Tod (1594) das Land wieder an die kaiserliche Familie, bis 1602
Rudolf II. seinen Bruder Maximilian zum Regenten bestellte. Nach
dessen Tode trat (1618) Erzherzog Leopold aus der steirischen Linie
ein, der Gatte Claudias von Medici, welche nach seinem Ableben als
Vormund des Sohns die Grafschaft verwaltete (1632-46). Auf Claudia
folgten noch ihre beiden Söhne, zuerst Ferdinand Karl, dann
Franz Siegmund, der 1665 starb. Mit ihm erlosch die steirische
Nebenlinie in T., und dieses wurde jetzt wieder von Wien aus
regiert. Kaiser Leopold I. stiftete 1673 die Universität zu
Innsbruck. Im spanischen Erbfolgekrieg (1703) unternahm Max Emanuel
von Bayern eine Expedition nach T., die anfangs gelang, bald aber
durch die Tapferkeit des Landsturms den Bayern ebenso verderblich
ward wie den Franzosen, die unter Vendôme von Italien her bis
Trient vorgedrungen waren. Durch den
Reichsdeputationshauptschluß von 1803 erhielt Kaiser Franz
II. die geistlichen Fürstentümer Brixen und Trient. Im
Frieden zu Preßburg fiel T. an Bayern; 11. Febr. 1806
erfolgte die Übergabe. Die Einmischung der neuen Regierung in
viele Dinge, welche die Wiener Hofräte bisher klüglich
unberührt gelassen, die bedeutenden Geldverluste, welche die
Entwertung der das Land überschwemmenden Bankozettel
verursachte, die Störung des altgewohnten Absatzes in den
Erbländern, die Einführung neuer Steuern und die
Konskription, die Auflösung der Tiroler Landschaft, die
Beseitigung selbst des Namens "T.", namentlich aber die
Verminderung der Feiertage und Klöster: dies alles erzeugte im
Land eine
725
Tiroler Grün - Tisch.
den Bayern sehr feindliche Stimmung und bereitete den heimlichen
Aufforderungen Erzherzog Johanns und Hormayrs in Wien zum Aufstand
einen günstigen Boden. So entzündete sich im April 1809
jener Volkskrieg unter den Helden Andreas Hofer (s.d.), Speckbacher
u. a., nach dessen unglücklichem Ende im Wiener Frieden von
1809 T. in drei Teile zerrissen ward: Welschtirol mit Bozen fiel an
das Königreich Italien, Oberpusterthal an Illyrien, und das
übrige blieb bei Bayern. Nach dem Fall des französischen
Kaiserreichs 1814 wurde das ganze Land wieder mit Österreich
vereinigt. Durch das Patent vom 24. März 1816 stellte Kaiser
Franz die Verfassung in etwas veränderter Gestalt wieder her.
T. fügte sich weniger gern als die andern deutschen
Kronländer in den durch das Februarpatent von 1861 (s.
Österreich, S. 521) in Österreich geschaffenen Zustand;
eine Adresse der alttiroler Partei vom 15. Febr. 1861 hatte
geradezu die Aufrechterhaltung der alten ständischen
Gliederung verlangt. Dazu weigerte sich der italienische
Süden, den Landtag zu beschicken, und verlangte eine
Abtrennung der italienischen Bezirke von den deutschen. Die
Abneigung der Massen, namentlich auf dem Land, gegen die neue
Ordnung der Dinge wuchs noch, als das Patent vom 8. April im
Prinzip die Gleichstellung der Protestanten aussprach. Doch hatte
die Adresse des allein aus Vertretern von Deutschtirol
zusammengesetzten Landtags, welcher auf Antrag des
Fürstbischofs von Brixen an den Kaiser die Bitte richtete, die
Ausübung des öffentlichen Gottesdienstes, die Bildung
kirchlicher Gemeinden, den Erwerb von Realbesitz den Protestanten
in T. nicht zu gestatten, keinen Erfolg. Die Sistierung der
Verfassung nach Schmerlings Sturz 1865 rief in T. keine
oppositionelle Kundgebung hervor, weil die Regierung T. in Absicht
auf das Protestantenpatent bedeutende Zugeständnisse machte.
So wurde durch das Gesetz vom 7. April 1866 die Bildung
protestantischer Gemeinden von der Einwilligung des Landtags
abhängig gemacht. Daher gab sich für die
Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Zustände
1867 in dem Landtag Tirols geringe Sympathie zu erkennen; indessen
erfolgte doch der Beschluß, den Reichsrat zu beschicken. Die
liberalen österreichischen Gesetze über Kirche und Schule
stießen in T. natürlich auf große Abneigung und im
Landtag auf Opposition. Alle Versuche des verfassungstreuen
Ministeriums, eine liberale Mehrheit durch Neuwahlen zum Landtag zu
erreichen, waren vergeblich. Auch nach dem Eintritt der
Welschtiroler in den Landtag (1875) blieb die Mehrheit ultramontan
und protestierte ebenso wie die Bischöfe immer wieder gegen
die konfessionslose Schule und für die Glaubenseinheit. Vgl.
v. Hormayr, Geschichte der gefürsteten Grafschaft T.
(Tübing. 1806-1808, 2 Bde.); Egger, Geschichte Tirols (Innsbr.
1872-80, 3 Bde.); über einzelne Perioden: A. Huber, Geschichte
der Vereinigung Tirols mit Österreich (das. 1864); v. Hormayr,
T. und der Tiroler Krieg von 1809 (2. Aufl., Leipz. 1845); A.
Jäger, Zur Vorgeschichte des Jahrs 1809 in T. (Wien 1852); "T.
unter der bayrischen Regierung" (Aarau 1816); A. Jäger,
Geschichte der landständischen Verfassung Tirols (Innsbr.
1880-1885, 2 Bde.) und andre Werke des Verfassers; Streiter,
Studien eines Tirolers (für die neuere Zeit, Leipz. 1862);
"Archiv für Geschichte und Altertumskunde Tirols" (Innsbr.
1864-68); "Acta Tirolensia" (das. 1886 ff.); "Zeitschrift des
Ferdinandeums für T." (das., seit 1825).
Tiroler Grün, s. Berggrün.
Tiroler Weine, im allgemeinen eher leichte als geistige,
wenig saure Weine, denen es an Parfüm, häufig an
Körper, meist an Haltbarkeit fehlt. Man gewinnt Rot- und
Weißweine, erstere besonders im Etschthal, letztere in der
Umgegend von Trient und Roveredo, wo auch vorzügliche
Likörweine bereitet werden. Man unterscheidet Leiten- oder
Collinenweine von den Anhöhen und den Buchten der Berge, reich
an Alkohol und Körper, von angenehmem Geschmack und
stärkendem Weingeruch, und Bodenweine aus der Tiefebene, ohne
Boukett, dick und nicht haltbar. Die vorzüglichsten Weine
Tirols sind: der Isera, weiß und rot, voll Geist und Feuer,
der braune Vin santo oder Pasqualino, der köstliche
weiße Terlaner, voll Feuer und Süße, der
dunkelrote Natalino, ein Strohwein von Roveredo, der dunkelbraune,
lieblich süße Muscato bianco, der dunkel rubinrote
Traminer und der Marziminer von Ala und Tramin, letzterer
feingeistig und körperreich, dem Veltliner ähnlich, der
Seeburger von Brixen, die Weine von Glanig und Leitach, wo der von
Vergil besungene Lieblingswein des Kaisers Augustus wuchs, der
Kalterer Seewein, Maddalena etc.
Tironische Noten, s. Tiro.
Tirschenreuth, Bezirksamtsstadt im bayr. Regierungsbezirk
Oberpfalz, an der Waldnab und an der Linie Wiesau-T. der Bayrischen
Staatsbahn, 500 m ü. M., hat 4 Kirchen, ein Schloß, ein
Waisenhaus, ein Amtsgericht, ein Forstamt, Porzellan-, Tuch- und
Zementziegelfabrikation, eine Dampfschneidemühle und (1885)
2829 meist kath. Einwohner. T. ist Geburtsort des Germanisten
Schmeller.
Tirschtiegel, zwei Städte im preuß.
Regierungsbezirk Posen, Kreis Meseritz, durch die Obra getrennt:
Alt-T., mit kath. Kirche und (1885) 965 meist kath. Einwohnern;
Neu-T., mit evangelischer und altluther. Kirche und Synagoge und
(1885) 1502 meist evang. Einwohnern. T. hat ein Amtsgericht, ein
Johanniterkrankenhaus u. starken Hopfenbau. Nahebei das
Schloß T.
Tirso (im Altertum Torsus), der bedeutendste Fluß
der Insel Sardinien, entspringt im nordöstlichen Teil
derselben, fließt südwestlich und mündet in den
Golf von Oristano; 135 km lang.
Tirso de Molina, Dichter, s. Tellez.
Tiryns, sehr alte Stadt in Argolis, südöstlich
von Argos, der Sage nach Sitz des Perseus und Herakles und von
lykischen Kyklopen mit riesigen (Steine von 3 m Länge und 1 m
Dicke), zum Teil noch erhaltenen Mauern, in welchen Kammern und
überdeckte Gänge ausgespart sind, befestigt, was auf
orientalische Einflüsse deutet. In T. erhielt sich die alte
achäische Bevölkerung im Gegensatz zur dorischen in
Argos. Darum stete Feindschaft, welche 465 v. Chr. mit der
Zerstörung der Stadt durch die Argiver endete. Die Ruinen,
durch die Ausgrabungen Schliemanns 1884 bis 1885 bekannt, welche
die Fundamente einer Fürstenburg aus Homerischer Zeit
bloßgelegt haben, heißen heute Paläa Nauplia. Vgl.
Schliemann und Dörpfeld, Tiryns (Leipz. 1885).
Tisane (franz.), s. Ptisane.
Tisch, in der Turnkunst (s. d.) ein zu Übungen des
gemischten Sprunges verwendetes, nur auf wenigen Turnplätzen
eingeführtes, hier aber sehr beliebtes Turngerät, etwa 2
m lang, 1 m breit, die Platte mit dichter Polsterung versehen, die
Füße mit Ständern in Röhren zum Stellen in
verschiedene Höhe (zwischem 1¼ und 1¾ m). Wegen
seiner Größe springt man an ihm gern mit dem stark
federnden Schwungbrett (Tremplin). Vgl. J. K. Lion, Die
Turnübungen des
726
Tischbein - Tischreden.
gemischten Sprunges (2. Aufl., Leipz. 1876). Eine Abart des
Tisches ist der weit kleinere Kasten (Springkasten), den die
preußische Militärgymnastik zu den Übungen des
Voltigierens an Stelle des Pferdes (s. d.) eingeführt, aber
wieder abgeschafft hat.
Tischbein, deutsche Künstlerfamilie: Johann
Valentin, geb. 1715 zu Haina in Kurhessen, malte Landschaften und
Dekorationen und starb 1767 als Hofmaler in Hildburghausen. Johann
Heinrich, der ältere, Bruder des vorigen, geb. 3. Okt. 1722 zu
Haina, ging 1743 nach Paris, wo er sich bei Vanloo bildete, 1748
nach Venedig, dann nach Rom und ward 1752 Kabinettsmaler des
Landgrafen von Hessen-Kassel, später Professor an der
Kunstakademie zu Kassel, wo er 22. Aug. 1789 starb. Er entlehnte
seine Stoffe meist der Mythologie. Seine Zeichnung ist im ganzen
korrekt; das Nackte verrät das Studium der Antike, die
Gewänder sind im großen Stil behandelt. Viele seiner vom
Geiste des Rokokostils erfüllten Arbeiten finden sich im
Schloß Wilhelmshöhe bei Kassel. Auch seine Brüder
Johann Jakob, gest. 1791 in Lübeck, und Anton Wilhelm, gest.
1804 als Hofmaler in Hanau, erwarben sich einen Namen, jener durch
Tierstücke, dieser durch historische Darstellungen und
Genrebilder. Johann Heinrich, der jüngere, Neffe der vorigen,
geb. 1742 zu Haina, gest. 1808 als Inspektor der Galerie zu Kassel,
stach vieles nach Joh. Heinr. T., dem ältern, und schrieb eine
"Abhandlung über die Ätzkunst" (Kassel 1808).
Sein Bruder Johann Heinrich Wilhelm, der Neapolitaner genannt,
geb. 15. Febr. 1751 zu Haina, der bedeutendste der Familie, bildete
sich unter Leitung seiner Oheime Joh. Heinr. und Joh. Jakob T. und
war dann zu Hamburg, in den Niederlanden, in der Schweiz, seit 1782
zu Rom und seit 1787 in Neapel thätig, wo er 1790 als Direktor
der Malerakademie angestellt ward; doch kehrte er bald darauf nach
Deutschland zurück und lebte abwechselnd in Hamburg und Eutin,
wo er 26. Juli 1829 starb. Von seinen Arbeiten sind hervorzuheben:
Konradin von Schwaben und Friedrich von Österreich wird beim
Schachspiel das Todesurteil verkündigt; Christus und die
Kindlein, für die Ansgariikirche zu Bremen; der wütende
Ajax, die Kassandra von der Statue der Pallas wegreißend.
Unter den von ihm herausgegebenen und zum Teil mit Radierungen
ausgestatteten artistischen Werken sind zu erwähnen:
"Têtes de différents animaux, dessinées
d'après nature" (Neap. 1796, 2 Bde.), "Sir Will. Hamilton's
collection of engravings from antiques vases" (das. 1791-1809, 4
Bde.) und sein berühmtestes Werk: "Homer, nach Antiken
gezeichnet", mit Erläuterungen von Heyne (Heft 1-6,
Götting. 1801-1804) und Schorn (Heft 7-11, Stuttg. 1821-23).
Seine Selbstbiographie wurde von Schiller ("Aus meinem Leben",
Braunschw. 1861, 2 Bde.) herausgegeben. Vgl. Alten, Aus Tischbeins
Leben (Leipz. 1872).
Johann Friedrich August, Sohn Joh. Valentin Tischbeins, geb.
1750 zu Maastricht, als Familienporträtmaler ausgezeichnet,
bereiste Frankreich und Italien, ward dann Hofmaler in Arolsen und
lebte hierauf einige Zeit in Holland, seit 1795 aber zu Dessau und
ward 1800 Ösers Nachfolger als Direktor der Akademie zu
Leipzig. Er starb 1812 in Heidelberg. Sein Sohn Karl Ludwig, geb.
1797 zu Dessau, wurde in Dresden gebildet, ging 1819 nach Italien,
ward 1825 Professor der Zeichenkunst an der Universität Bonn
und 1828 Vorsteher einer Zeichenschule und Aufseher über die
fürstlichen Sammlungen zu Bückeburg, wo er 13. Febr. 1855
starb. Beifall fand sein Besuch Egmonts bei Klärchen sowie
seine Ansichten von Städten, z. B. Bonn, Frankfurt, Leipzig.
Vgl. Michel, Étude biographique sur les T. (Lyon 1881).
Tischendorf, Lobegott Friedrich Konstantin von, bekannt
durch seine Arbeiten für Kritik des Bibeltextes, geb. 18. Jan.
1815 zu Lengenfeld im Vogtland, studierte zu Leipzig Theologie und
Philologie und habilitierte sich 1839 daselbst, bereiste, um
Materialien zu einer Textreform des Neuen Testaments zu sammeln,
einen großen Teil Europas und den Orient. Nach seiner
Rückkehr erhielt er 1845 eine außerordentliche, 1859
eine ordentliche Professur der Theologie zu Leipzig. 1853 und 1859
unternahm er zwei neue Reisen nach dem Orient, besonders nach
Ägypten und dem Sinai, von welcher er viele wertvolle
Handschriften, insonderheit eine griechische Bibel aus dem 4.
Jahrh., mit zurückbrachte (vgl. seine beiden Reisewerke:
"Reise in den Orient", Leipz. 1845-1846, 2 Bde., und "Aus dem
Heiligen Lande", das. 1862). Er starb 7. Dez. 1874. Seine Arbeiten
betreffen hauptsächlich die neutestamentliche Textreform, so:
die Ausgabe des "Codex Ephraemi Syri" (Leipz. 1843 u. 1845) und des
"Codex Friderico-Augustanus" (das. 1846); die "Monumenta sacra
inedita" (das. 1846; nova collectio 1855-71, 6 Bde.); "Evangelium
Palatinum ineditum" (das. 1847); "Codex Amiatinus" (das. 1850 u.
1854); "Codex Claromontanus" (das. 1852); "Fragmenta sacra
palimpsesta" (das. 1854); "Codex Sinaïticus" (Petersb. 1862, 4
Bde.; Handausgabe, Leipz. 1863, faksimiliert); das "Novum
Testamentum Vaticanum" (das. 1867). Nach seinem Tod setzten O. v.
Gebhardt und R. Gregory seine neutestamentlichen Arbeiten fort.
Auch lieferte T. mit der Zeit 20 Ausgaben des neutestamentlichen
Textes (8. größere Ausg., Leipz. 1869-1872, 2 Bde.;
hiernach eine kleinere 1873), eine kritische Ausgabe der
Septuaginta (7. Aufl., das. 1887, 2 Bde.) sowie Ausgaben der "Acta
apostolorum apocrypha" (das. 1851), der "Evangelia apocrypha" (das.
1853, 2. Aufl. 1877) und der "Apocalypses apocryphae" (das. 1866).
Seine Lösung der Frage: "Wann wurden unsre Evangelien
verfaßt?" (Leipz. 1865, 4. Aufl. 1866) wurde von der Kritik
fast einstimmig für einen verunglückten Versuch
erklärt. Vgl. Volbeding, Konstantin T. (Leipz. 1862).
Tischgelder werden im deutschen Heer den am gemeinsamen
Mittagstisch teilnehmenden Leutnants gezahlt; auch
Portepeefähnriche, Offizieraspiranten im Besitz des
Reifezeugnisses zum Fähnrich können T. erhalten, jedoch
nicht im Feld.
Tischnowitz, Stadt in der mähr.
Bezirkshauptmannschaft Brünn, an der Schwarzawa und der
Eisenbahn Brünn-T., mit Bezirksgericht, Schloß,
Tuchweberei, Gerberei und (1880) 2589 Einw. Dabei T.-Vorkloster,
mit einer Basilika (von 1238), Zucker- und Papierfabrik und 1205
Einw.
Tischreden, Unterhaltungen oder Äußerungen
berühmter Männer bei Tisch über Gegenstände der
Kunst, der Wissenschaft, des Lebens etc. Schon aus dem Altertum
finden sich T. in Xenophons und Plutarchs Symposien; am
bekanntesten aber sind die Luthers: "Colloquia, so er in vielen
Jahren gegen gelahrten Leuten, auch fremden Gästen und seinen
Tischgesellen geführet" (zuerst hrsg. von Rebenstock, 1571; am
besten von Förstemann, Leipz. 1844-48, 4 Tle.; Auszug, das.
1876). Es finden sich in diesen T. neben sinnreichen Bemerkungen,
namentlich über einzelne Punkte der Glaubens- und Sittenlehre,
auch zahlreiche kernhafte Späße. Auch
727
Tischri - Tissiérographie.
die T. ("Table-talk") des englischen Dichters S. T. Coleridge
(s. d.) verdienen Erwähnung.
Tischri (Tisri, hebr.), der erste Monat des
bürgerlichen und der siebente des Festjahrs der Juden, hat 30
Tage und fällt meist in den September unsers Jahrs. Der 1. und
2. T. ist jüdisches Neujahr, der 10. Versöhnungstag, 15.
bis 22. Laubhüttenfest.
Tischrücken und Tischklopfen. Mit ersterm Wort
bezeichnet man die drehende und fortrückende Bewegung, in
welche ein Tisch versetzt wird, wenn mehrere um den Tisch herum
sitzende oder stehende Personen ihre Hände darauf legen, wobei
durch Berührung der kleinen Finger eine Art von Kette gebildet
wird. Versuche dieser Art wurden zuerst in den Vereinigten Staaten
von Nordamerika gemacht (s. Spiritismus); nachdem aber ein Aufsatz
in der "Allgemeinen Zeitung" vom 4. April 1853 davon Kunde gegeben,
wurde das Tischrücken auch diesseit des Atlantischen Ozeans
fast allerorten in Gesellschaften mit Erfolg versucht, erregte
großes Aufsehen und beschäftigte eine Zeit hindurch
Gelehrte und Ungelehrte. Damit verband sich bald das sogen.
Tischklopfen, ein Frag- und Antwortspiel, bei welchem der Tisch
durch Erheben und Aufstampfen eines Fußes je nach Abrede Ja
oder Nein, die Buchstaben des Alphabets oder die Zahlen bezeichnen
mußte. Ähnliche Künste waren schon bei Griechen und
Römern im Gebrauch, indem man zur Erforschung der Zukunft
geweihte Dreifüße in Bewegung brachte, und unter dem
Kaiser Valens gab ein derartiges Verfahren den Anlaß zu
großartigen Zaubereiprozessen. Auch im jetzigen China und
Indien sind entsprechende magische Operationen seit uralten Zeiten
im Gebrauch. Da nun die Antworten auf vorgelegte Fragen nur von
einer intelligenten Macht gegeben werden können, so schrieb
man sie und bald auch das gesamte Tischrücken der Einwirkung
von Geistern zu. Eine Reihe von Halbgelehrten suchte nach
greifbarern Kräften, und in einer unendlichen
Broschürenlitteratur wurden bald die Elektrizität, bald
der Magnetismus, bald das Nervenfluidum oder das "magische
Geisteswirken" für diese Erscheinungen verantwortlich gemacht,
während andre alles für plumpen Betrug ansahen. Faraday
zeigte, daß beide Annahmen falsch seien und beim
Tischrücken lediglich Selbsttäuschung im Spiel sei,
insofern, wie er durch zu diesem Zweck von ihm konstruierte
Dynamometer bewies, Personen, die ihre Hände auf den Tisch
legen, bald beginnen, im Sinn sogen. ideomotorischer Bewegungen (s.
d.) unbewußt einen beträchtlichen Druck auszuüben,
der nur in eine bestimmte Richtung gelenkt zu werden braucht, um
selbst schwere Tische in Gang zu bringen. Die Spiritisten halten
natürlich an ihrer Theorie fest, und ihre herumreisenden
Apostel lassen es auch nicht mehr bei dem Tischrücken
bewenden, sondern pflegen (wie z. B. Home und Slade) am
Schluß ihrer Sitzungen schwebende und fliegende Tische zu
zeigen (vgl. Spiritismus). Die schreibenden Tischchen (s.
Psychograph) werden durch die aufgelegte Hand einzelner Personen
(Medien) in Bewegung gebracht, und zu Guadalupe erschien 1853 die
in dieser Weise von einem Stuhl verfaßte Novelle "Juanita".
Noch in neuerer Zeit hat sich Crookes bemüht, experimentell zu
beweisen, daß die "Medien" tatsächlich im stande seien,
eine Verminderung, resp. Gegenwirkung der Schwerkraft zu leisten.
Vgl. Crookes, Der Spiritualismus und die Wissenschaft (Leipz.
1873); Wallace, Eine Verteidigung des modernen Spiritualismus (das.
1875).
Tisi, Benvenuto, Maler, s. Garofalo.
Tisiphone, eine der Erinnyen (s. d.).
Tisri, s. Tischri.
Tissandier (spr. -ssangdjeh), Gaston, Gelehrter, geb. 21.
Nov. 1843 zu Paris, widmete sich vorwiegend der Chemie und leitete
1864-74 das Versuchslaboratorium der Union nationale. In dieser
Zeit beschäftigte er sich auch mit meteorologischen Arbeiten,
und 1868 unternahm er von Calais aus mit Dufour seine erste
Luftballonfahrt. Seitdem stieg er mit seinem Bruder Albert mehr als
20mal auf, entwich auch 1870 mittels eines Ballons aus dem
belagerten Paris und machte 1875 mit Croce-Spinelli und Sivel zwei
Fahrten, von denen die eine 23 Stunden dauerte und die andre,
wesentlich zum Zweck spektroskopischer Untersuchungen unternommen,
in eine Höhe von 8600 m führte und den beiden Begleitern
Tissandiers das Leben kostete. T. ist Vizepräsident der
französischen Luftschiffergesellschaft und Professor des
Polytechnischen Vereins. Er schrieb außer vielen
Beiträgen für die 1873 von ihm gegründete
Zeitschrift "Nature": "L'eau" (1867, 4. Aufl. 1878); "La houille"
(1869); "Les fossiles" (1874); "Merveilles de la photographie"
(1874); "Voyages aériens" (1870; deutsch in Masius'
"Luftreisen", Leipz. 1872); "En ballon pendant le siége de
Paris" (1871); "Simples notions sur les ballons" (1876);
"L'héliogravure" (1875); "Histoire de la gravure
typographique" (1875); "Histoire de mes ascensions" (1878); "Le
grand ballon captif à vapeur de M. Giffard" (1879); "Les
martyrs de la science" (1879); "Observations
météorologiques en ballon. Resumé de 25
ascensions aérostatiques" (1879); "Histoire des ballons et
des aéronautes célèbres" (1887) etc.
Tissaphérnes, pers. Satrap in Lydien, schloß
413 v. Chr. mit den Spartanern ein Bündnis, stand im Streit
zwischen Artaxerxes Mnemon und seinem Bruder Kyros auf des
Königs Seite, ließ nach der Schlacht bei Kunaxa 401 die
Anführer des griechischen Hilfsheers hinterlistig ermorden und
erhielt deshalb eine Königstochter zur Ehe und die
Statthalterschaft des im Kampf gefallenen Kyros. Als er die
ionischen Städte in Kleinasien dem König zu unterwerfen
versuchte, riefen jene die Spartaner zu Hilfe, und er ward von
diesen unter Agesilaos 395 am Paktolos besiegt und infolgedessen
seiner Strategie entsetzt. Sein Nachfolger Tithraustes ließ
ihn später hinrichten.
Tisserand (spr. tiß'rang), Felix, Astronom, geb.
15. Jan. 1845, studierte seit 1863 an der Normalschule in Paris,
promovierte 1868, trat als Adjunkt in die Sternwarte ein und wurde
bei der Reorganisation des astronomischen Dienstes durch Leverrier
1873 zum Direktor des Observatoriums und zum Professor der
Astronomie in Toulouse ernannt. 1874 ging er mit Janssen nach Japan
zur Beobachtung des Durchganges der Venus durch die Sonne und 1882
zu demselben Zweck nach Martinique. Er schrieb: "Note sur
l'interpolation" (1869); "Détermination des orbites des
planètes 116 et 117" (1871); "Sur la recherche de la
planète perdue 99" (mit Loewy, 1872); "Sur le mouvement des
planètes autour du soleil d'après la loi
électrodynamique de Weber" (1872); "Sur les étoiles
filantes" (1873); "Observations des taches du soleil à
Toulouse en 1874 et 1875" (1876); "Traité de mecanique
céleste" (1888 ff.) etc.
Tissiérographie, ein von Tissier zu Paris zuerst
angewandtes Verfahren, Kupferstiche auf den lithographischen Stein
überzudrucken und die Zeichnung hoch zu ätzen, um
dieselbe in der Buchdruckpresse gleichzeitig mit Typensatz drucken
zu können. Der Stein wird auf die Höhe der
Buchdrucklettern zuge-
728
Tissot - Titan.
richtet, der Überdruck in gewöhnlicher Weise (s.
Typolithographie) gemacht und dieser mit einer Mischung von
rektifiziertem Holzessig, Salzsäure und Alkohol so lange
geätzt, bis die erforderliche Tiefe erlangt ist, wobei die
Zeichnung während des Tieferätzens an den Seiten durch
Firnislagen vor dem Unterfressen durch das Ätzwasser
geschützt werden muß.
Tissot (spr. -sso), 1) Simon (Samuel) André, Arzt,
geb. 20. März 1728 zu Grancy bei Lausanne, studierte in Genf
und Montpellier, ließ sich als Arzt in Lausanne nieder,
leitete 1780-83 die Klinik in Pavia und starb 15. Juni 1797 in
Lausanne. Von seinen Schriften (Laus. 1783-95, 15 Bde.; Par. 1809,
8 Bde.; deutsch, Leipz. 1784, 7 Bde.) sind besonders die
populären hervorzuheben: "L'onanisme" (Laus. 1760, fast in
alle europäischen Sprachen übersetzt) und "Avis au peuple
sur sa santé" (das. 1761). Vgl. Eynard, La Vie de S. A. T.
(Par. 1839).
2) Pierre François, franz. Schriftsteller, geb. 10.
März 1768 zu Versailles, ein eifriger Revolutionär und
später ein Parteigänger Napoleons, widmete sich seit 1799
ganz der Litteratur, hielt seit 1810 am Collège de France
vielbesuchte Vorlesungen über lateinische Poesie, welche 1821
verboten wurden, schrieb unter der Restauration für die
Tagesblätter: "Constitutionnel", "Minerve", "Pilote", "Gazette
de France", von denen er letzteres auch dirigierte, nahm 1830 seine
Vorlesungen wieder auf, erhielt 1833 einen Sitz in der Akademie und
starb 7. April 1854. Seinen zahlreichen Schriften fehlte es weder
an der eleganten Form noch an bedeutendem Inhalt; nur leiden sie
öfters an Oberflächlichkeit. Am meisten gerühmt
werden seine "Études sur Virgile, comparé avec tous
les poètes épiques et dramatiques des anciens et des
modernes" (Par. 1825-30, 4 Bde.; 2. Aufl. 1841, 2 Bde.).
Außerdem schrieb er: "Bucoliques de Virgile, traduites en
vers" (1800); "Trophées des armées françaises
depuis 1792 jusqu'en 1815" (1819, 6 Bde.); "De la poésie
latine" (1821); "Poésies érotiques" (1826, 2 Bde.);
"Souvenirs historiques sur Talma" (1826); "Histoire complète
de la Révolution française" (1833-36, 6 Bde.);
"Histoire de Napoléon" (1833, 2 Bde.) u. a. Die
"Mémoires de Carnot" gab er nach dessen Manuskripten heraus
(1824).
3) Victor, franz. Schriftsteller, geb. 1845 zu Freiburg in der
Schweiz, war längere Zeit Hauptredakteur der "Gazette de
Lausanne" und ließ sich 1874 in Paris nieder. Von hier aus
bereiste er Deutschland und Österreich und
veröffentlichte über diese Länder seine in
Frankreich von der Lesewelt verschlungenen Schmähschriften:
"Voyage au pays des milliards" (1875), "Les Prussiens en Allemagne"
(1876) und "Voyage aux pays annexées" (1876) sowie "Vienne
et la vie viennoise" (1878), denen sich später anschlossen:
"Les mystères de Berlin" (1879), "Voyage au pays des
Tziganes" (1880), "La Russie rouge" (Roman, 1880), "L'Allemagne
amoureuse" (1884), "La police secrète prussienne" (1884),
"De Paris à Berlin" (1886) u. a.
Tissotgummi (Dextringummi), s. Dextrin.
Tisza (spr. tissa), 1) Koloman T. von Borosjenö,
ungar. Staatsmann, geb. 16. Dez. 1830 zu Geszt im Biharer Komitat
aus einer reichbegüterten adligen calvinistischen Familie,
studierte die Rechte und ward 1855 zum Hilfskurator des Szalontaer
helvetischen Kirchendistrikts gewählt. Er trat bei der durch
das Protestantenpatent vom 1. Sept. 1859 hervorgerufenen Bewegung
zuerst als öffentlicher Redner auf, ward 1861 für
Debreczin Mitglied des Reichstags, schloß sich hier der
Beschlußpartei an und übernahm 1865 mit Ghyczy die
Führung des linken Zentrums, bildete jedoch 1875, als die
Deákpartei infolge persönlicher Zerwürfnisse und
der finanziellen Verwirrung zerfiel, eine neue "liberale Partei"
aus dem größten Teil der Deákpartei und dem
linken Zentrum, welche, da sie die Majorität besaß, die
Regierung übernahm. T. trat in das neue Ministerium Wenkheim
als Minister des Innern ein, übernahm aber 21. Okt. 1875 nach
dem glänzenden Sieg der neuen Partei bei den Reichstagswahlen
den Vorsitz im Kabinett, welches er mit staatsmännischem
Geschick leitete. Er verstand es mit großer Geschicklichkeit,
die Ungarn für den neuen Ausgleich mit Österreich
günstig zu stimmen, die Besorgnisse und Klagen über die
Orientpolitik Andrássys zu beschwichtigen, die Abneigung
gegen die Okkupation Bosniens zu vermindern und die Mehrheit des
Reichstags immer wieder um sich zu scharen. Hierdurch erlangte er
auf die Politik der Gesamtmonarchie großen Einfluß und
freie Hand für die rücksichtslosen Maßregeln zur
Magyarisierung Ungarns, welche zu den schreiendsten
Ungerechtigkeiten, so gegen die siebenbürgischen Sachsen,
führten. Bei allen Neuwahlen behauptete er die Mehrheit, und
selbst die Finanzschwierigkeiten erschütterten seine Stellung
nicht. Im Februar 1887 vertauschte er selbst das Innere mit dem
Finanzportefeuille. Vgl. Visi, Koloman T. (Budapest 1886).
2) Ludwig, Graf T. de Szeged, Bruder des vorigen, geb. 12. Sept.
1832 zu Geszt, ward 1861 Mitglied des Reichstags, 1867 Obergespan
des Biharer Komitats, 1871-73 Kommunikationsminister, nach der
Katastrophe von Szegedin (1879) zum königlichen Kommissar
für dessen Wiederaufbau ernannt und nach der Vollendung
desselben 1883 in den Grafenstand erhoben.
Tisza-Eszlár (spr. tissa-éßlar),
Großgemeinde im ungar. Komitat Szábolcs, an der
Theiß, mit (1881) 2175 meist ungar. Einwohnern, bekannt durch
den im Sommer 1883 geführten Prozeß gegen mehrere
jüdische Einwohner, die beschuldigt wurden, ein
Christenmädchen, Esther Solymossy, 1. April 1882 rituell
geschlachtet zu haben; die Angeklagten wurden 3. Aug. 1883 vom
Gericht in Nyiregyháza freigesprochen.
Tisza-Füred (spr. tissa-), Markt im ungar. Komitat
Heves, unweit der Theiß, mit reform. Pfarrei, (1881) 6846
ungar. Einwohnern und regem Gewerbfleiß, erlangte als
einziger Übergangspunkt an der obern Theiß im J. 1849
strategische Wichtigkeit.
Titan, Beiname des Helios (s. Titanen).
Titan Ti, Metall, findet sich mit Sauerstoff verbunden
(Titansäureanhydrid) als Rutil, Anatas und Brookit, welche
drei Mineralien aus Titansäureanhydrid bestehen, aber
ungleiche Kristallgestalt besitzen, ferner als titansaures
Eisenoxydul mit Eisenoxyd im Titaneisenerz, als titansaurer Kalk im
Perowskit, als titansaurer Kalk mit kieselsaurem Kalk im Titanit,
in geringer Menge in vielen Silikaten, in den meisten Eisenerzen,
im Basalt und andern Felsarten, in der Ackererde und in den
Meteorsteinen. Aus Fluortitankalium durch Kalium abgeschieden,
bildet T. ein dunkelgraues, schwer schmelzbares Pulver, welches
beim Erhitzen an der Luft mit großem Glanz verbrennt und sich
leicht in erwärmter Salzsäure löst; das Atomgewicht
ist 50,25. Von seinen Oxyden ist Titansäureanhydrid TiO2,
welches auch künstlich in den drei Formen, in denen es in der
Natur vorkommt, dargestellt werden kann, am wichtigsten. T. wurde
1789 von Gregor im Titaneisenerz entdeckt.
729
Titaneisenerz - Tities
Titaneisenerz (Ilmenit, Kibdelophan, Crichtonit,
Washingtonit), Mineral aus der Ordnung der Anhydride, findet sich
in rhomboedrischen Kristallen, auf- oder eingewachsen, in Drusen
und rosettenförmigen Gruppen (Eisenrosen), auch derb in
körnigen und schaligen Aggregaten, in einzelnen Körnern
(Iserin) oder als Sand (Menaccanit); es ist eisenschwarz,
undurchsichtig, mitunter magnetisch, von halb metallischem Glanz;
Härte 5-6, spez. Gew. 4,56-5,21. T. wird von einigen als
isomorphe Mischung von Titanoxyd mit Eisenoxyd, von andern als
titansaures Eisenoxydul mit Eisenoxyd FeTiO3 + nFe2O3 betrachtet.
Ein oft bedeutender Gehalt an Magnesium (bis 14 Proz. MgO)
erscheint dann als Vertreter des zweiwertigen Eisens. T. findet
sich besonders als mikroskopischer Gemengteil in vielen Gesteinen
(Melaphyr, Dolerit, Diabas, Gabbro), kommt auch in Hohlräumen
vieler Silikatgesteine und auf sekundärer Lagerstätte
vor. Grosse Kristalle (bis zu 8 kg schwer) liefern Norwegen und
Nordamerika, die Eisenrosen stammen vom Gotthard. Sande werden in
großer Menge (bis 30 m mächtig) in Kanada gefunden, in
geringerer auf der Iserwiese in Böhmen, in Cornwallis.
Sonstige Fundorte sind: Aschaffenburg, Frankfurt, Hanau, Chemnitz,
Gastein, Bourg d'Oisans, Mijask etc. Hin und wieder wird T. auf
Eisen verschmolzen.
Titanen, in der griech. Mythologie das dritte
Göttergeschlecht, die Söhne und Töchter des Uranos
und der Gäa: Okeanos, Köos, Kreios, Hyperion, Japetos und
Kronos, sodann Theia, Rhea, Themis, Mnemosyne, Phöbe und
Tethys. Als Uranos seine Söhne, die Hekatoncheiren (oder
Centimanen) und Kyklopen, in den Tartaros geworfen, erhoben sich,
von Gäa aufgereizt, die T. gegen den Vater, entmannten ihn und
übergaben dem Kronos die Herrschaft. Gegen diesen und die
herrschenden T. begann aber später Zeus (s. d.) im Verein mit
seinen Geschwistern den Kampf. Derselbe (Titanomachie) wurde in
Thessalien geführt, von den T. vom Othrys, von den Kroniden
vom Olympos herab. Erst nach zehn Jahren siegte Zeus dadurch,
daß er die Kyklopen und Hekatoncheiren aus dem Tartaros
befreite. Die T. wurden hierauf selbst in den Tartaros geworfen und
die Hekatoncheiren zu ihren Wächtern gesetzt. Dieser Kampf ist
zu unterscheiden von dem der olympischen Götter gegen die
himmelstürmenden Giganten (s. d.). In der spätern
Mythologie werden alle von den T. abstammenden Gottheiten, z. B.
Helios, Selene, Hekate, Prometheus etc., mit diesem Namen
bezeichnet, bis man zuletzt T. und Giganten identifizierte und der
Name Titan nur noch an dem Sonnengott haftete. Vgl. Schömann,
De Titanis Hesiodeis (Greifsw. 1846); Mayer, Die Giganten und T. in
der antiken Sage und Kunst (Berl. 1887).
Titania, die Elfenkönigin, Gemahlin des Oberon.
Titanit (Sphen, Ligurit, Braun- und Gelbmenakerz,
Greenovit), Mineral aus der Ordnung der Silikate mit Titanaten
etc., findet sich in monoklinen, säulenartigen und
tafelförmigen, oft zu Zwillingen verwachsenen Kristallen, auf-
oder eingewachsen, auch derb in schaligen Aggregaten. T. ist gelb,
braun, grün, am seltensten rot, meist undurchsichtig oder
durchscheinend, glasglänzend; Härte 5-5,5, spez. Gew. 3,4
-3,6. Er besteht aus kieselsaurem und titansaurem Kalk CaSiTiO5,
gewöhnlich mit einem geringen Eisen- und Mangangehalt und
findet sich auf Klüften hornblendehaltiger Silikatgesteine,
besonders verbreitet aber als accessorischer, bisweilen nur
mikroskopisch erkennbarer Bestandteil hornblendehaltiger Gesteine,
des Syenits, Phonoliths, Trachyts etc.; auch auf
Erzlagerstätten. Größere Kristalle kommen vom
Gotthard, aus Tirol, der Dauphine und dem Ural. Kleinere gelbe und
braune sind mit den genannten Gesteinen weitverbreitet; ferner
führen T. die Auswürflinge am Laacher See und an der
Somma. Die durchsichtigen grünen Varietäten (Sphen)
werden mitunter als Schmucksteine verschliffen.
Titcomb, Timothy, Pseudonym, s. Holland 2).
Titel (lat.), Bezeichnung des Amtes, der Würde und
des Ranges einer Person, daher Standes-, Ehren-, Amtstitel (s.
Titulatur); ferner bezeichnet T. Aufschrift eines Buches,
Kunstwerkes etc.; im juristischen Sinn einen gesetzlichen Grund,
aus dem jemand ein Recht zusteht (Rechtstitel), sowie die einzelnen
Kapitelüberschriften in den Gesetzsammlungen; im Budget die
mit fortlaufenden Nummern bezeichneten Einzelgruppen von Einnahmen
und Ausgaben.
Titel, Markt im ungar. Komitat Bács-Bodrog,
Dampfschiffstation am rechten Theißufer, gegenüber der
Begamündung, mit (1881) 3321 serbischen und deutschen
Einwohnern, Hafen und Schiffbau. T. war ehemals der Hauptort des
Tschaikistenbataillons.
Titer, s. Titre.
Tithon, s. Juraformation, S. 330.
Tithonos, im griech. Mythus Sohn des Laomedon, Bruder des
Priamos und Gemahl der Eos (s.d.). Diese raubte ihn wegen seiner
außerordentlichen Schönheit und erbat sich von Zeus
Unsterblichkeit für ihn. Da sie aber vergaß, zugleich um
ewige Jugend für ihn zu bitten, so schrumpfte T. nach und nach
ganz zusammen, so daß er sich nicht mehr rühren konnte
und nur seine Stimme noch fort und fort wisperte, wie eine Cikade,
in welche ihn die spätere Sage auch endlich noch verwandelt
werden läßt.
Titicacasee (Laguna de Chucuito), größter
Gebirgssee Südamerikas, im südöstlichen Teil von
Peru und im westlichen Teil von Bolivia, zwischen den
Küstenkordilleren und den bolivischen Andes, einer der
höchst gelegenen Landseen der Erde (3824 m ü. M.), ist
150 km lang, 60 km breit und 8300 qkm (151 QM.) groß, bis zu
218 m tief und sehr fischreich. Der Spiegel schwankt je nach den
jährlichen Regenmengen (1875-82 fiel er 2,67 m, seitdem ist er
abermals im Steigen). Seine Ufer sind holzlos, meist von
Schilfdickichten umgeben, aber reich an prächtigen
Grabmälern mit zum Teil vertrockneten Leichen einer
ausgestorbenen Menschenrasse. Im N. empfängt der See
zahlreiche Bergströme; sein einziger Abfluß und zwar zum
Aullagassee (3700 m) ist der schiffbar gemachte Rio Desaguadero an
der Südwestspitze. Große Landzungen zerschneiden den T.
in mehrere Teile, die nur durch schmale Kanäle miteinander in
Verbindung stehen. Er wird mit Dampfbooten befahren und
enthält zahlreiche kleine Inseln, von welchen die am
südlichen Ende gelegene, zu Bolivia gehörige Insel
Titicaca die merkwürdigste ist. Dieselbe hat eine Menge zum
Teil großartiger Überreste altperuanischer Baukunst und
trug ehedem einen prächtigen und berühmten Sonnentempel,
dessen reiche Schätze die Priester bei der Eroberung Perus
durch die Spanier in den See versenkt haben sollen. Von hohem
Interesse ist der von Alex. Agassiz geführte Nachweis einer
marinen Krustaceenfauna in diesem hoch gelegenen
Süßwassersee. Vgl. "Proceedings of the American Academy
of Arts and Sciences" (1876); Pentland, The laguna de Titicaca
(Lond. 1848).
Tities (lat.), eine der drei ältesten Tribus (s. d.)
in Rom, welche aus den unter Titus Tatius sich mit den Römern
vereinigenden Sabinern gebildet wurde.
730
Titio - Tivoli.
Titio ("Feuerbrand"), Gelehrter, s. Brant.
Titisee, See im Schwarzwald, östlich vom Feldberg,
849 m ü. M., 2 km lang und 15 m tief; dabei ein Gasthaus, das
als Sommerfrische besucht wird.
Titlis, das Haupt einer der drei Gebirgsgruppen im
östlichen Flügel der Berner Alpen (3239 m), nahezu der
Dreiländerstein der Kantone Unterwalden, Uri und Bern. Sein
Rücken, eine breite, mit ewigem Schnee bedeckte Kuppe,
heißt der Nollen. Er wurde schon 1739 von Engelberg aus
erstiegen und galt längere Zeit als höchste Alpenspitze.
Eine kühne Ausstrahlung, die Gadmerflühe (3044 m), wendet
sich nach der Aare hin; eine firnbelastete Felsmauer verbindet den
T. mit den wilden Zacken der Großen und Kleinen
Spannörter (3205, resp. 3149 m), die sich nach der Reuß
hin verzweigen. Diese ganze Bergwelt ist von der noch
großartigern Gruppe des Dammastocks (s. d.) durch den
Sustenpaß, von der dritten Gruppe durch die Surenen
geschieden. Als Haupt dieser Gruppe ist der Uri-Rothstock (2932 m)
von dem Blackenstock (2922 m), dem Engelberger Rothstock (2820 m),
den Wallenstöcken (2595 m) und andern Trabanten umstellt, und
weiter nach N. hin nehmen Brisen, Ober- und Nieder-Bauen und
besonders das Buochser Horn (1809 m) schon voralpines Gepräge
an. Dem Buochser Horn gegenüber erhebt sich das Stanser Horn
(1900 m), der Schlußpfeiler eines vom T. ausstrahlenden
Bergzugs, der am Engelberger Joch ansetzt und die Thäler der
Engelberger Aa und der Sarner Aa scheidet. Ein Panorama vom T.
zeichnete Imfeld (Zürich 1879).
Titre (franz., spr. tihtr), s. v. w. Titel (s. d.), dann
Urkunde, Schein; der Feingehalt der Münzen sowie der
Feinheitsgrad der Seide; auch bei der Maßanalyse (s. Analyse,
S. 527) gebraucht (Titer). Daher titrieren, den Feinheitsgrad der
Seide feststellen; eine Maßanalyse ausführen.
Titriermethode, s. Analyse, S. 527.
Tittmoning, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Oberbayern,
Bezirksamt Laufen, an der Salzach, hat 2 kath. Kirchen, ein
Kollegiatstift, ein Amtsgericht, 2 Eisenhämmer, Tuchmacherei,
Gerberei, 8 Mahl- und eine Sägemühle,
Landesproduktenhandel und (1885) l423 Einw.
Titular (lat.), jemand, der mit dem Titel eines Amtes
bekleidet ist, ohne die damit verbundenen Funktionen zu verrichten,
gewöhnlich nur in Zusammensetzungen vorkommend, wie Titularrat
etc.
Titulatur (lat.), die Beilegung des einer Person ihrem
Stand gemäß zukommenden Prädikats. Vgl. R. Stein,
Titulaturen und Kurialien bei Briefen, Eingaben etc. (Berl.
1883).
Titurel, Held aus der Sage vom heil. Gral (s. d.),
Parzivals Urgroßvater. In der Geschichte der deutschen Poesie
wird unterschieden: der "Ältere T.", Bruchstücke einer
Dichtung von Wolfram von Eschenbach (s. d.), welche die Geschichte
von Schionatulander und Sigune behandelt, und der "Jüngere
T.", die Fortsetzung von Wolframs Gedicht von Albrecht von
Scharfenberg (s. d.).
Titus, apostol. Gehilfe des Paulus, welchen er als einen
Heidenchristen, der unbeschnitten geblieben war, auf den
Apostelkonvent nach Jerusalem begleitete; später erscheint er
im Auftrag des Paulus in Korinth. Die Legende macht ihn zum ersten
Bischof in Kreta, wozu der neutestamentliche Brief an T., einer der
sogen. Pastoralbriefe (s. d.), Veranlassung gab.
Titusbogen, ein zu Ehren der Besiegung der Juden durch
Kaiser Titus vom römischen Senat errichteter, einthoriger
Triumphbogen an der Ostseite des Palatin, welcher im J. 81 geweiht
wurde. Der Bogen ist 15½ m, die Attika 4½ m hoch. Die
Innenwände des Durchganges und die Friese über der
Bogenwölbung auf beiden Seiten sind mit Reliefs
geschmückt, welche den Triumphzug des Kaisers und den Opferzug
darstellen (s. Tafel "Bildhauerkunst IV", Fig. 14).
Titus Flavius Vespasianus, röm. Kaiser, der
ältere Sohn des Kaisers Vespasianus, geb. 41 n. Chr., wurde am
Hof Neros mit Britannicus erzogen und widmete sich zunächst
der bürgerlichen Laufbahn, versäumte aber auch nicht, als
Tribun in Germanien und Britannien die üblichen Kriegsdienste
zu leisten. Als sein Vater 67 nach Palästina geschickt wurde,
um die Empörung der Juden zu unterdrücken, begleitete ihn
T. und wurde von jenem, als er 69 Palästina verließ, um
die Kaiserwürde anzutreten, mit der Fortführung des
Kriegs beauftragt. T. beendete denselben durch die Eroberung und
Zerstörung Jerusalems 70. Nachdem er mit seinem Vater einen
glänzenden Triumph gefeiert hatte, wurde er von Vespasian zum
Teilnehmer an der Regierung ernannt. Er hielt sich als solcher
nicht völlig frei von dem Vorwurf der Ausschweifung und sogar
der Grausamkeit; allein alle hierauf gegründeten Besorgnisse
wurden durch die Güte und Milde völlig widerlegt, welche
er sofort bewies, als er nach Vespasians Tod 79 den Thron bestiegen
hatte. Von da an war sein Bestreben fortwährend darauf
gerichtet, andern Freundlichkeiten und Wohlthaten zu erweisen, und
wenn ihm dies an einem Tag nicht gelungen war, so pflegte er am
Abend zu seinen Freunden zu sagen, daß er einen Tag verloren
habe. Indessen wurde das Glück seiner Regierung, das ihm den
Namen "Lust und Liebe des Menschengeschlechts" ("amor et deliciae
generis humani") erwarb, durch mehrere schwere
Unglücksfälle getrübt, die er indes auf alle Art zu
mildern suchte, nämlich durch den Ausbruch des Vesuvs 24. Aug.
79, durch welchen die Städte Herculaneum, Pompeji und
Stabiä verschüttet wurden, durch eine drei Tage und drei
Nächte wütende Feuersbrunst in Rom und durch eine Pest,
welche eine große Menge Menschen hinwegraffte. Außerdem
ist von seiner kurzen Regierung noch zu erwähnen, daß er
zum Besten des Volkes ein alle frühern an Bequemlichkeit und
Geräumigkeit übertreffendes Badehaus, die nach ihm
benannten, noch jetzt in Trümmern vorhandenen Thermen des T.,
bauen ließ. Er starb 13. Sept. 81. Eine vortreffliche
Marmorstatue des Kaisers befindet sich im Louvre zu Paris. Vgl.
Beulé, T. und seine Dynastie (deutsch, Halle 1875).
Tituskopf (Frisur à la Titus), die in Frankreich
zur Zeit des Konsulats aufgekommene Mode, die Haare gekürzt
und zu lauter Löckchen verwirrt zu tragen. Als die Locken
nachher schlichter getragen wurden, hieß die Frisur à
la Caracalla.
Titusville (spr. teitoswill), Stadt im NW. des
nordamerikan. Staats Pennsylvanien, am Oil Creek, mit 1859
erbohrten Petroleumquellen u. (1880) 9046 Einw.
Tityos, in der griech. Mythologie ein erdgeborner Riese
auf Euböa, Vater der Europa. Da er sich (auf Veranlassung der
Hera) an der Leto vergriffen hatte, ward er von Artemis und Apollon
mit Pfeilen oder von Zeus mit dem Blitzstrahl erlegt, und in der
Unterwelt, wo er über neun Hufen Landes ausgestreckt liegt,
hacken zwei Geier seine immer wieder wachsende Leber (den Sitz der
sinnlichen Begierde) aus.
Tiverton (spr. tiwwertön), Stadt in Devonshire
(England), am Ex, mit Schloßruine (14. Jahrh.), Lateinschule,
Armenhaus (1517 gestiftet), Fabrikation von Spitzen und Wollwaren
und (1881) 10,462 Einw.
Tivoli, Stadt in der ital. Provinz Rom, in schö-
731
Tixtla - Tizian.
ner Lage am Fuß der Sabinerberge und am Teverone (Anio),
welcher hier die berühmten, seit 1835 jedoch teilweise durch
einen Tunnel abgelenkten Wasserfälle bildet (s. Anio), mit Rom
durch Dampftramway verbunden, ist Sitz eines Bischofs, hat enge
Straßen, mehrere Kirchen und (1881) 9730 Einw. T. ist das
alte Tibur (s. d.), der Lieblingssommersitz der römischen
Patrizier, von dessen zahlreichen Überbleibseln vor allen die
2 km außerhalb des heutigen T. gelegenen großartigen
Trümmer der Villa des Kaisers Hadrian (mit Resten des
Palastes, eines Theaters, einer Palästra, einer Bibliothek,
eines Stadiums etc.) zu erwähnen sind. In der Stadt selbst
befindet sich auf der Felswand über dem Aniofall der sogen.
Sibyllentempel, eine runde Cella mit einem äußern Kreis
von kannelierten korinthischen Säulen; nahe dabei steht ein
zweiter, viereckiger Tempel (jetzt Kirche San Giorgio). Unterhalb
des Wasserfalls befinden sich Ruinen mehrerer antiker Villen (des
Quintus Varus u. a.). Von den neuern Bauten ist namentlich die
Villa d'Este, ein schöner Renaissancebau (von 1551) mit
malerischen Parkanlagen und Wasserwerken, bemerkenswert. Seit
neuester Zeit wird die reiche Wasserkraft des Teverone zu
elektrischer Beleuchtung der Stadt und zu industriellen Anlagen
ausgenutzt. 9 km westlich, am Dampftramway Rom-T., liegen stark
besuchte, schon in der römischen Kaiserzeit benutzte
Schwefelbäder (24° C.), Bagni delle Acque Albule, und 6 km
westlich die malerische alte Aniobrücke Ponte Lucano mit dem
Rundgrab der Familie Plautia. - T. ist auch beliebte Bezeichnung
von Vergnügungsorten mit Gartenanlagen, Schauspiel etc.
Tixtla (T. de Guerrero), Hauptstadt des mexikan. Staats
Guerrero, 1380 m ü. M., mit (1880) 6139 Einw., dient den
reichen Bewohnern von Acapulco als Aufenthaltsort während der
ungesunden Jahreszeit. In der Nähe Silbergruben.
Tiza, s. Boronatrocalcit.
Tizian, eigentlich Tiziano Vecellio, der Hauptmeister der
venezian. Malerschule und Vollender einer neuen koloristischen
Richtung, geb. 1477 zu Pieve di Cadore in Friaul, kam noch als
zehnjähriger Knabe nach Venedig, um sich daselbst der Malerei
zu widmen. Als seine Lehrer werden der Mosaikmaler Zuccato, dann
Gentile Bellini genannt; doch muß er später auch bei
Giovanni Bellini gelernt und sich nach Giorgione weitergebildet
haben. Man erfährt zuerst von seiner Thätigkeit um 1507,
wo er neben Giorgione die jetzt verschwundenen Fresken am Fondaco
dei Tedeschi in Venedig ausführte. 1511 malte er mit Dom.
Campagnola Fresken in der Scuola del Santo in Padua, dann in
Vicenza, kehrte aber 1512 nach Venedig zurück. Nachdem er
einen Antrag, in die Dienste Leos X. zu treten,
zurückgewiesen, nahm ihn der Rat gegen Verleihung eines
einträglichen Maklerpatents in seinen Dienst. In der Folge kam
T. in intime Beziehungen zu Alfons von Ferrara (1516 reiste er das
erste Mal dahin), für den er dessen Porträt, ferner das
Venusfest und das Bacchanal (alle drei in Madrid) und Ariadne auf
Naxos (in der Nationalgalerie zu London) malte. In Ferrara
schloß er auch Freundschaft mit Ariosto, den er zu
wiederholten Malen porträtierte. Auch zu Federigo von Mantua
trat er um 1523 in nahe Beziehungen; er malte für ihn die
Grablegung (Paris). 1518 entstand eins seiner Hauptwerke, die
Himmelfahrt Maria (sogen. Assunta) in der Akademie zu Venedig, 1523
das Altarbild für die Kirche San Niccolò (Madonna mit
sechs männlichen Heiligen, jetzt im Vatikan) und 1526 ein
andres Meisterwerk dieser Periode, die Madonna des Hauses Pesaro
(Santa Maria de' Frari in Venedig). In das Jahr 1527 fällt
seine Bekanntschaft mit Pietro Aretino, dessen Porträt er
für Federigo Gonzaga malte. 1530 schuf er den Märtyrertod
Petri für San Giovanni e Paolo (1867 durch Feuersbrunst
zerstört). 1532 begab er sich im Auftrag Federigo Gonzagas
nach Bologna, wo gerade Kaiser Karl V. verweilte; er malte damals
letztern zweimal. T. wurde hierauf 10. Mai 1533 zum Hofmaler Karls
und zum Grafen des lateranischen Palastes sowie zum Ritter vom
Goldenen Sporn ernannt. Der hierauf folgenden Zeit entstammen die
Bildnisse Franz' I. und Isabellas von Este; etwas später
fallen die der Geliebten Tizians (Wien, Belvedere), dann die von
Eleonore Gonzaga und ihrem Gatten Francesco Maria (Florenz,
Uffizien). Nachdem er 1537 seiner Fahrlässigkeit wegen in
betreff des versprochenen Bildes sein Maklerpatent zu gunsten
Pordenones verloren hatte, malte er in Fresko die dem Rat schon
lange versprochene, nur noch in Fontanas Stich erhaltene Schlacht
bei Cadore (im großen Ratssaal). 1539 nach Pordenones Tod
erhielt er sein Maklerpatent zurück, 1541 ward er nach Mailand
zu Karl V. berufen; 1545 ging er, nachdem schon früher, seit
1542, Paul III. den Plan gefaßt hatte, T. nach Rom zu ziehen,
dahin, wo er glänzend aufgenommen wurde. Er malte damals das
Porträt des Papstes, dann die berühmte Danae
(Nationalmuseum zu Neapel). Auf der Rückreise nach Venedig
besuchte er Florenz. 1548 ward er nach Augsburg zu Karl V. berufen
und malte daselbst Porträte (das Karls V. in Madrid, das zu
München etc.). Er kehrte bald wieder nach Venedig zurück,
ward aber 1550 abermals nach Augsburg berufen, um das Porträt
Philipps II. von Spanien zu malen. Für diesen war er auch nach
seiner Rückkehr nach Venedig 1551 außerordentlich viel
beschäftigt. 1566 ward er in die florentinische Akademie
aufgenommen. Er starb 27. Aug. 1576 in Venedig, fast 100 Jahre alt,
an der Pest und ward in der Kirche Santa Maria de' Frari
beigesetzt. Der durch die flandrische Schule beeinflußte
koloristische Realismus der Venezianer gelangte durch T. auf seine
Höhe; in seiner Auffassung nicht so durchgeistigt und ideal
wie Raffael und Michelangelo, hat er vor den Römern und
Toscanern die unvergleichliche malerische Kraft voraus und kommt
Raffael in der Schönheitsfülle gleich, Michelangelo in
der dramatischen Lebendigkeit der Komposition nahe. T. ist der
größte Kolorist der Italiener und versteht seinen
Figuren zugleich den vornehmen Charakter zu geben, der seine eignen
Lebensgewohnheiten und die seiner Stadtgenossen kennzeichnet.
Obwohl er sich nicht an die Antike anschloß, so ist er doch
zu einer verhältnismäßig ähnlichen Wirkung
gelangt, indem sich die Ruhe des Daseins, die edle, in sich
befriedigte Existenz in seinen Werken ebenso spiegelt. Ganz
vermochte er sich übrigens nicht den Einwirkungen der andern
italienischen Schulen zu entziehen, und zwischen seinen
spätesten Arbeiten, worunter die Dornenkrönung Christi in
München hervorragt, und seinen frühern, deren edelstes
Erzeugnis der Zinsgroschen in Dresden ist, besteht ein
beträchtlicher Unterschied. Er wurde später bewegter in
der Haltung der Figuren, leidenschaftlicher im Ausdruck der
Köpfe, energischer im Vortrag. Seine Historienbilder tragen
mehr oder weniger etwas Porträtmäßiges, freilich in
großartiger Auffassung, an sich; es gibt deren, welche zu den
edelsten und unvergänglichsten Erzeugnissen der Kunst
gehören, während andre sich mit einer mehr
äußerlichen Wirkung be-
732
Tjalk - Tlaxcala.
gnügen. Die höchste Befriedigung gewähren seine
Bildnisse, welche die vornehme Erscheinung der venezianischen Welt
mit vollster Treue widerspiegeln und den vollkommensten Ausdruck
des venezianischen, von höchster Prachtliebe und sinnlicher
Glut erfüllten Lebens darstellen. Zugleich war er als
Landschaftsmaler sehr bedeutend, die Landschaft spielt in vielen
seiner Gemälde in ihrer großartig-poetischen Auffassung
eine Hauptrolle; Poussin und Claude Lorrain haben sich nach seinem
Vorbild entwickelt. Die Zahl seiner Schöpfungen ist
außerordentlich groß, besonders aus den letzten 40
Jahren seines Lebens, wo er zahlreiche Schüler zu Hilfe nahm.
Aus der ersten Periode seines Schaffens, die etwa bis 1511 reicht
und seine Jugendentwickelung umfaßt, sind noch zu nennen: die
Kirschenmadonna, in der kaiserlichen Galerie zu Wien, nebst zwei
andern Madonnen daselbst, und die irdische und himmlische Liebe, in
der Galerie Borghese zu Rom, Tizians schönstes allegorisches
Bild, ausgezeichnet in der Behandlung des Nackten. Von
hervorragenden Schöpfungen der zweiten, etwa bis 1530
reichenden Periode erwähnen wir noch die Auferstehung, in der
Kirche San Nazaroe Celso in Brescia (1522); die Ruhe auf der Flucht
und die Madonna mit dem Kaninchen, im Louvre zu Paris; die nur mit
einem Pelz bekleidete Eleonora Gonzaga von Urbino, in der
kaiserlichen Galerie zu Wien; das Bildnis derselben im Palazzo
Pitti zu Florenz, weltberühmt unter dem Namen La Bella di
Tiziano, das herrlichste Frauenporträt des Meisters; die
sogen. Venus von Urbino, in den Uffizien zu Florenz, und die sogen.
Geliebte Tizians bei der Toilette, im Louvre zu Paris. Zu den
Hauptwerken der letzten Periode seines Schaffens zählen noch
das Martyrium des heil. Laurentius, in der Jesuitenkirche zu
Venedig; der Tempelgang Mariä, in der Akademie daselbst; die
Ausstellung Christi, in der kaiserlichen Galerie zu Wien; die
Dornenkrönung, im Louvre; das Abendmahl, im Escorial; Venus
mit Amor, in den Uffizien zu Florenz; die sogen. Madrider Venus
(eine ruhende Schöne mit ihrem Geliebten); die Danae, im
Museum zu Neapel; Jupiter und Antiope, im Louvre; das Reiterbildnis
Karls V., in der Galerie zu Madrid (1548 in Augsburg begonnen);
Papst Paul III. (1545, im Museum zu Neapel); der Admiral Giovanni
Moro, im Berliner Museum. Von Tizians Selbstbildnissen sind
diejenigen im Museum zu Berlin und in der kaiserlichen Galerie zu
Wien die schönsten, von den Bildnissen seiner Tochter Lavinia
sind dasjenige mit der über dem Haupt emporgehobenen
Fruchtschüssel (Museum zu Berlin) und die beiden in der
Dresdener Galerie (um 1555 und 1565) die vorzüglichsten. Die
ältere Litteratur über T. ist überholt durch Crowe
und Cavalcaselle, T., Leben und Werke (deutsch von Jordan, Leipz.
1877, 2 Bde.). Vgl. auch Lafenestre, La vie et l'oeuvre du Titien
(Par. 1886).
Tjalk, kuffartig gebautes, kleines Fahrzeug mit einem
Mast und besonders großem Gaffelsegel und Schwertern; an der
Nordseeküste im Gebrauch.
Tjeribon, Insel, s. Tscheribon.
Tjost,s. Turnier.
Tjukalinsk, südlicher Kreis des westsibir.
Gouvernements Tobolsk, in welchem viel Ackerbau getrieben wird, und
auf dessen zahlreichen und großen Seen sich unzählige
Wasservögel befinden, die einen großartigen Handel in
Taucher- und Schwanenbälgen hervorgerufen haben. Jährlich
kommen 10,000 Schwanenbälge und 100,000 Greben (die Brustfelle
der Steißfüße) in den Handel. Die Kreisstadt T.
hat (1885) 3907 Einw.
Tjumen, Bezirksstadt im sibir. Gouvernement Tobolsk,
rechts an der für Dampfer fahrbaren Tura, 275 km
westsüdwestlich von der Stadt Tobolsk, mit
regelmäßigen Straßen aus schönen, meist
hölzernen Häusern, 11 Kirchen aus Stein, 2 Klöstern,
einer Moschee, einer Kreisschule und 2 Pfarrschulen und (1885)
15,590 Einw., welche in mehr als 100 gewerblichen Etablissements
eine außerordentlich rege Thätigkeit entfalten.
Hauptprodukte sind namentlich: Leder (Juften),Talg, Seife, Glocken,
Eisengußwaren, Handschuhe, Gewebe, Netze, Matten,
Töpferwaren. Seit 1885 steht die Eisenbahn von Jekaterinenburg
bis hierher (350 km) in Betrieb und schließt sich hier an den
Sibirischen Trakt (s. d.) an, der über Omsk, Tomsk,
Krasnojarsk und Irkutsk nach Kiachta führt. Bei T. beginnt
auch der Wasserverkehr nach Tobolsk auf dem Irtisch, diesen
abwärts bis zur Mündung des Ob und von diesem auf dem Tom
bis Tomst. Die für Ostsibirien bestimmten Waren gehen auf dem
Landweg nach Krassnojarsk und von hier auf dem Jenissei hinunter
nach Jenisseisk und weiter nach Turuchansk. Eine andre
Wasserstraße ist die von T. vermittelst des Ob und Irtisch
nach Semipalatinsk. In T. wird jährlich im Januar seit 1845
eine große Messe (Basiliusmesse) abgehalten, deren Umsatz 1
Mill. Rubel beträgt, aber durch die Messe zu Irbit immer mehr
verliert.
Tjutschew, Fjodor Iwanowitsch, russ. Dichter, geb. 23.
Nov. (a. St.) 1803 im Kreis Brjansk des Gouvernements Grodno,
studierte in Moskau, erhielt 1822 eine Stelle im Ministerium des
Auswärtigen zu Petersburg, war dann längere Zeit bei der
russischen Gesandtschaft in München und (seit 1838) in Turin
thätig, wurde 1844 der Person des Reichskanzlers attachiert
und erhielt 1857 endlich das Präsidium des Komitees für
auswärtige Zensur in Petersburg übertragen; starb in
dieser Stellung 15. Juli (a. St.) 1873. Seine Gedichte, die
gesammelt in Petersburg 1868 erschienen, zeichnen sich durch
Gedankentiefe, Wärme des Gefühls und Formvollendung
vorteilhaft aus; eine Auswahl derselben wurde von H. Noé ins
Deutsche übertragen (Münch. 1861). T. hat sich auch als
Übersetzer, namentlich deutscher Dichter, wie Heine, Goethe,
Schiller u .a., verdient gemacht.
Tl, in der Chemie Zeichen für Thallium.
Tlacotálpam, Stadt im mexikan. Staat Veracruz, am
Ende einer Lagune, deren Zugang durch die 50 km
südöstlich von Veracruz gelegene Barre von Alvarado
gesperrt wird, mit lebhaftem Verkehr und (1882) 5939 Einw.
Tlálpam (San Agostino de las Cuévas),
hübsche Landstadt, 15 km südlich von Mexiko, am Fuß
des Gebirges, beliebter Sommeraufenthalt, mit zahlreichen Villen
und 6200 Einw. (mit Umgebung); wird zum Pfingstfest, besonders um
der Hasardspiel willen, von Tausenden besucht. Bis 1831 war T.
Hauptstadt des Staats.
Tlalpujáhua, Stadt im mexikan. Staat Michoacan, am
Fuß des Cerro de Gallo, 2435 m ü. M., mit (1880) 9823
Einw. im Munizipium; die Silberbergwerke waren einst berühmt.
Hier begann unter Pfarrer Morelos die erste Revolution gegen
Spanien; hier ließ Hidalgo die erste Kanone gießen, die
er gegen die Spanier gebrauchte.
Tlaxcala, Binnenstaat der Republik Mexiko, ist auf drei
Seiten von Puebla umgeben und hat ein Areal von 3902 qkm (70,9 QM.)
mit (1882) 138,988 Einw. T. bildet einen Teil der Hochebene von
Anahuac. Die wichtigsten Produkte des Landbaues sind: Mais, Weizen,
Gerste, Hafer, Hülsenfrüchte, Maguey,
733
Tlemsen - Tobler.
Piment und Früchte aller Klimate. Eisenstein, Silber, Blei,
Kupfer und Steinkohlen kommen vor, werden aber noch wenig
ausgebeutet. Die gleichnamige Hauptstadt, 2225 m Ü. M, 25 km
nördlich von Puebla, an der Eisenbahn, hat eine höhere
Schule, etwas Wollindustrie und (1880) 4300 Einw. (zur Zeit ihres
Glanzes zählte sie 100,000). - T. bildete in der
altmexikanischen Zeit eine oligarchische Republik mit ungefähr
500,000 Einw. Bei der Eroberung Mexikos durch die Spanier schlossen
sich die Tlaxcalaner, ein Aztekenstamm, nachdem sie vergeblich
Widerstand versucht, treu an Cortez an, welcher daher der Republik
eine gewisse Selbständigkeit unter spanischer Oberherrschaft
verschaffte.
Tlemsen (bei den Franzosen Telemcen), Stadt in Algerien,
Departement Oran, 44 km vom Mittelländischen Meer entfernt,
auf drei Seiten von tiefen Schluchten umgeben, hat (1881) 25,370
Einw., davon 10,033 Europäer und Juden. T. hat aus seiner
alten Blütezeit nur einige schöne Moscheen aufzuweisen,
es ist aber durch günstige klimatische Verhältnisse,
zahlreiche Neuschöpfungen der Franzosen (Museum, Bibliothek)
und namentlich durch seine großartigen Ölbaumpflanzungen
und Weinberge eine Perle Algeriens. Südwestlich von T. liegt
Mansura mit den 1318 erbauten großartigen, jetzt in Ruinen
liegenden Wasserwerken. - T. war im Mittelalter eine blühende
Stadt und die Residenz der auf die Almorawiden folgenden maurischen
Dynastie Beni Zian; aber es war schon verfallen, als die Franzosen
es 1836 besetzten. Im Frieden von Tafna (1837) wieder freigegeben,
wurde es 1841 aufs neue genommen; im März 1842 und im Oktober
1845 fanden hier nochmals harte Kämpfe zwischen den Franzosen
und Abd el Kader statt.
Tlepolemos, im griech. Mythus Sohn des Herakles und der
Astyoche, mußte als Mörder seines Oheims Likymnios aus
Argos fliehen und ließ sich in Rhodos nieder, wo er die
Städte Lindos, Jalysos und Kameiros baute. Er beteiligte sich
am Zug nach Troja, ward aber von Sarpedon getötet.
Tlinkit (Thlinkit), Indianerstamm, s. Koloschen.
Tlumacz (spr. -maz), Stadt in Ostgalizien, Station der
Staatsbahnlinie Stanislau-Husiatyn, Sitz einer
Bezirkshauptmannschaft und eines Bezirksgerichts, mit
Branntweinbrennerei und (1880) 5062 Einw.
Tmesis (griech.), Trennung eines zusammengesetzten Wortes
durch etwas dazwischen Geschobenes (z. B. wo gehst du hin?
für: wohin gehst du?).
Toast (engl., spr. tohst), geröstete Brot-,
namentlich Weißbrotschnitte zum Thee; dann fast in alle
neuern Sprachen übergegangene Bezeichnung für Trinkspruch
(s. Gesundheittrinken).
Tobágo (Tabago), britisch-westind. Insel,
nächst Trinidad die südlichste der Kleinen Antillen, ist
vulkanischen Ursprungs, bis 650 m hoch, teilweise bewaldet und
ungemein fruchtbar. T. hat ein Areal von 385 qkm (6,99 QM.) mit
(1887) 20,335 Einw. Zucker und Rum sind die wichtigsten Produkte,
und auch die Viehzucht ist ziemlich ansehnlich. Den Wert der
Ausfuhr schätzt man auf (1887) 32,907 Pfd. Sterl., die Einfuhr
auf 23,118 Pfd. Sterl. Die frühere
Repräsentativverfassung wurde 1877 aufgehoben. Scarborough,
auf der Südostküste, mit gutem Hafen ist Hauptstadt. - T.
wurde 1498 von Kolumbus entdeckt. In der Folge war es
vorübergehend (1632-l677) von Niederländern besetzt, dann
abwechselnd im Besitz der Franzosen und Engländer, bis es 1803
endgültig in den der Engländer kam.
Tobarra, Stadt und Badeort in der span. Provinz Albacete,
an der Eisenbahn Madrid-Cartagena, mit besuchten Schwefelquellen
und (1878) 7219 Einw.
Több, Hohlmaß, s. Kojang.
Tobe, Längenmaß, s. Taka.
Tobelbad, Badeort in Steiermark, 10 km südwestlich
von Graz, in einem von waldigen Bergen umgebenen Thal, mit zwei
Thermen von 25 und 30° C., die besonders bei Frauenkrankheiten,
Nervenleiden etc. gebraucht werden.
Toberentz, Robert, Bildhauer, geb. 4. Dez. 1849 zu
Berlin, besuchte die dortige Kunstakademie und arbeitete dann zwei
Jahre in Schillings Atelier zu Dresden. Damals entstanden ein
überlebensgroßer Perseus und mehrere Büsten.
Nachdem T. von 1872 bis 1857 in Italien studiert hatte, brach er,
nach Berlin zurückgekehrt, mit seiner ältern Richtung,
die sich im Rauchschen Idealstil bewegt hatte, und arbeitete in der
Weise von R. Begas im engen Anschluß an die Natur. Die ersten
dieser Arbeiten waren die Marmorfigur einer Elfe und ein Faun mit
Amor, denen 1878 die Bronzefigur eines ruhenden Hirten (in der
Berliner Nationalgalerie) folgte. 1879 wurde er als Leiter eines
der mit dem schlesischen Museum verbundenen Meisterateliers nach
Breslau berufen, wo er unter anderm einen monumentalen Brunnen
für Görlitz schuf.
Töderich, s. Lolium.
Tobias, ein apokryphisches Buch des Alten Testaments, im
Griechischen Tobit genannt. Letzteres ist der Name des Vaters,
ersteres derjenige des Sohns. Beide zusammen bilden die
Hauptpersonen in einem durchaus romanhaften Familiengemälde,
welches wahrscheinlich innerhalb des ersten vorchristlichen
Jahrhunderts entstanden ist. Übrigens ist das Buch verschieden
bearbeitet worden, und namentlich ist der Text in der Septuaginta
älter und besser als derjenige der Vulgata, dem Luther in
seiner Übersetzung folgte. Die neueste kritische Bearbeitung
lieferte Fritzsche (Leipz. 1853), Erklärungen außerdem
Reusch (Freiburg 1857), Sengelmann (Hamb. 1857) und Gutberlet
(Münster 1877).
Tobiasfisch, s. Sandaal.
Tobitschau, Städtchen in der mähr.
Bezirkshauptmannschaft Prerau, unweit der March, mit einem
Schloß, 2 Kirchen, einer Synagoge und (1880) 2479 slaw.
Einwohnern, war nebst dem benachbarten Dorf Roketnitz 15. Juli 1866
der Schauplatz eines Gefechts zwischen Österreichern (Brigade
Rothkirch) und Preußen unter General v. Hartmann, in welchem
das 5. preußische Kürassierregiment 18 Kanonen eroberte,
und infolge dessen Benedek auf seinem Rückzug nach Ungarn die
Marchlinie aufgeben mußte.
Toblach, Marktflecken in Tirol, Bezlrkshauptmannschaft
Bruneck, 1204 m ü. M. im sogen. Toblacher Feld, der
Wasserscheide zwischen Drau und Rienz, im Pusterthal an der
Südbahnlinie Marburg-Franzensfeste gelegen, Ausgangspunkt ins
Ampezzothal, mit großem Eisenbahnhotel, neuer Kirche und
(1880) 1064 Einw. Unfern der kleine Toblacher See. Vgl. Noë,
T.-Ampezzo (3. Aufl., Klagenf. 1883).
Tobler, 1) Titus, schweizer. Sprachforscher und
Palästinaforscher, geb. 25. Juni 1806 zu Stein im Kanton
Appenzell, studierte zu Wien, Würzburg und Paris und
ließ sich dann in seiner Heimat als Arzt nieder, widmete sich
aber nebenbei mundartlichen Studien und publizistischen Arbeiten.
Die Frucht der erstern war sein "Appenzellerischer Sprachschatz"
(Zürich 1837), dem sich später die "Alten Dialektproben
der deutschen Schweiz" (St. Gallen 1869) anschlossen. 1840 nahm er
seinen Wohnsitz zu Horn im Kanton Thurgau, wo er 1853 zum Mitglied
des eid-
734
Tobol - Toce.
genössischen Nationalrats gewählt ward. Als
Früchte seiner vier Reisen nach dem Orient (die erste 1835,
die letzte 1865 unternommen) erschienen: Lustreise ins Morgenland"
(Zürich 1839, 2 Bde.); "Golgatha, seine Kirchen und
Klöster" (St. Gallen 1851); "Topographie von Jerusalem und
seinen Umgebungen" (Berl. 1853-54, 2 Bde.); "Denkblätter aus
Jerusalem" (Konst. 1853); "Dritte Wanderung nach Palästina"
(Gotha 1858); "Nazareth in Palästina" (Berl. 1868) u. a.
Außerdem veröffentlichte er noch: "Bibliographia
geographica Palaestinae" (Leipz. 1867); "Itinera et descriptiones
terrae sanctae ex saeculo VIII., IX., XII. et XV." (das. 1874) u.
a. Seit 1871 in München wohnhaft, starb er daselbst 21. Jan.
1877. Vgl. Heim, Titus T. (Zürich 1879).
2) Adolf, roman. Philolog, geb. 24. Mai 1835 zu Hirzel im Kanton
Zürich, Sohn des dortigen Pfarrers Salomon T. (gest. 1875 in
Zürich), der sich durch die epischen Dichtungen: "Die Enkel
Winkelrieds" (Zürich 1837) und "Kolumbus" (das. 1846) einen
litterarischen Namen gemacht hat, studierte in Bonn, wo er 1857
promovierte, lebte dann in Rom, in Toscana und Paris, bis er 1861
eine Stelle an der Kantonschule zu Solothurn erhielt. Im J. 1867
habilitierte er sich an der Universität zu Bern, folgte aber
noch in demselben Jahr einem Ruf als Professor der romanischen
Sprachen nach Berlin, welche Stelle er, seit 1881 auch Mitglied der
dortigen Akademie der Wissenschaften, noch jetzt bekleidet. Er
veröffentlichte: "Bruchstücke aus dem Chevalier au Lyon"
(Soloth. 1862); "Italienisches Lesebuch" (2. Aufl., das. 1868);
eine Ausgabe des altfranzösischen Dichters Jehan de Condet
(Stuttg. 1860); "Mitteilungen aus altfranzösischen
Handschriften" (Leipz. 1870); "Die Parabel von dem echten Ring" (2.
Aufl., das. 1884); "Vom französischen Versbau alter und neuer
Zeit" (2. Aufl., das. 1883); "Vermischte Beiträge zur
französischen Grammatik" (das. 1886) und zahlreiche
Abhandlungen in Zeitschriften etc. - Sein Bruder Ludwig T., geb.
1827, seit 1872 Professor der germanischen Philologie an der
Universität zu Zürich, schrieb außer Abhandlungen
in Zeitschriften: "Über die Wortzusammensetzung" (Berl. 1868)
und gab "Schweizerische Volkslieder" (Frauenf. 1882-84, 2 Bde.)
sowie mit F. Staub das "Schweizerische Idiotikon" (das. 1885 ff.)
heraus.
Tobol (kirgis. Tabul), Fluß im westlichen Sibirien,
entspringt auf den südlichen Ausläufern des Ural und
fließt in nordöstlicher Richtung dem Irtisch zu, in den
er bei Tobolsk fällt. Mit dem Eintritt in das Gouvernement
Tobolsk wird er schiffbar, doch ist er von Ende Oktober bis Ende
April mit Eis bedeckt. Er ist ungemein fischreich.
Tobolsk, russ. Gouvernement in Westsibirien,
nördlich vom Eismeer, westlich vom europäischen
Rußland begrenzt, umfaßt 1,377,776 qkm (25,022 QM.) mit
(1885) 1,313,392 Einw. (neun Zehntel Russen und Nachkommen
derselben oder Sibiriaken, darunter an 60,000 Verbannte, und 75,000
Tataren, Bucharen, Ostjaken, Wogulen und Samojeden). Der Religion
nach unterschied man 1,134,149 griechische Katholiken, 53,804
Mohammedaner, 6427 römische Katholiken, 4850 Lutheraner etc.
Die Zahl der Eheschließungen war 1885: 10,114, der Gebornen
71,049, der Gestorbenen 51,053. Hauptfluß ist der Ob (s. d.)
mit seinen Nebenflüssen Tobol und Irtisch. Gemäßigt
ist das Klima nur im S., im N. friert es fast jede Nacht im Jahr.
Unter Anbau stehen 2,579,000 Hektar, hauptsächlich werden
Hafer und Weizen gebaut, dann Roggen, Gerste, Kartoffeln. Der
Viehstand wurde 1884 auf 2,647,594 Stück geschätzt.
Fabriken sind zahlreich in den Städten; in erster Linie
Gerbereien, Talgsiedereien, Branntweinbrennereien, Mahlmühlen,
Kartoffelsirupfabriken, Eisengießereien, Schiffswerften u.
a., 1880 im ganzen 1093 Betriebe mit 5066 Arbeitern und einem
Produktionswert von 5,958,164 Rubel. An Lehranstalten gab es 1885:
331 Elementarschulen, 12 Mittelschulen, 5 Spezialschulen mit
zusammen 11,343 Lernenden. Die Spezialschulen sind: ein geistliches
Seminar, eine Feldscher-, eine Hebammen-, eine Navigations-, eine
Handwerkerschule. Der Handel ist bedeutend, wird aber von einem
kleinen Kreis von Händlern als Monopol ausgebeutet. - Die
gleichnamige Hauptstadt, an der Mündung des Tobol in den
Irtisch, ziemlich gut und regelmäßig, meist aus Holz
erbaut, hat einen Umfang von 12 km und besteht aus der niedrig
gelegenen, periodisch vom Irtisch überschwemmten neuern untern
Stadt und der ältern, schon 1589 gegründeten obern Stadt
auf einem steilen Uferhügel, zu welchem 290 Stufen
hinaufführen. Die letztere gewährt mit ihren
Festungswerken und der Kathedrale einen imposanten Anblick. T. ist
Sitz des Gouverneurs und der obersten Behörden des
Gouvernements, hat viele Kirchen, ein theologisches und ein
Schullehrerseminar, ein Gymnasium, eine Militär- und andre
Schulen, ein Arsenal, Theater und Arbeitshaus und (1885) 20,175
Einw. (darunter viele Deutsche, die hier eine lutherische Kirche
haben). Europäische Waren werden von den Märkten von
Nishnij Nowgorod und Irbit hierhergebracht. T. ist Stapelplatz
für alles für Rechnung der Krone abgelieferte
Pelzwerk.
Toboso, El, kleine Stadt in der span. Provinz Toledo, in
der Mancha, mit (1878) 1798 Einw., berühmt durch Don
Quichottes "Dulcinea von T."
Tobsucht (Furor maniacus), einzelnes Symptom in der Kette
einer bestimmten Geisteskrankheit, z. B. dem Säuferwahnsinn
(s. Delirium tremens) oder der Melancholie, der Verrücktheit,
oder eine selbständige, in sich abgeschlossene
Seelenstörung von mehr oder weniger regelmäßigem
typischen Verlauf. Vgl. Manie.
Tocaima, Stadt im Staat Cundinamarca der
südamerikan. Republik Kolumbien, am Rio Bogotá, 408 m
ü. M., mit Salzquelle, Kupfer- und Goldgruben und (1870) 6021
Einw. Eine 29 km lange Eisenbahn verbindet T. mit Jirardot.
Tocantins, Fluß, s. Tokantins.
Toccata (ital.), einer der ältesten Namen für
Instrumentalstücke, speziell für Tasteninstrumente, und
ursprünglich von Sonata, Fantasia, Ricercar etc. nicht
verschieden. Die ältesten Tokkaten für Orgel sind die von
C. Merulo 1598 herausgegebenen, aber jedenfalls sehr viel
früher geschriebenen für die Orgel. Sie beginnen in der
Regel mit einigen vollen Harmonien, allmählich setzt sich mehr
und mehr Läuferpassagenwerk an, und kleine fugierte
Sätzchen werden eingestreut. Die moderne T. ist ebenfalls noch
durchaus ein Stück für Tasteninstrumente und hat kein
weiteres charakteristisches Merkmal, als daß sie durchgehends
sich in kurzen Notenwerten bewegt und ziemlich vollstimmig gesetzt
ist (vgl. die Bachschen Orgeltokkaten, die Schumannsche
Klaviertokkata etc.).
Toccato (ital., franz. toquet), bei Trompetenchören
die vierte Stimme, welche in Ermangelung der Pauken die beiden
Töne derselben gewissermaßen als Grundstimme anzugeben
hat.
Toce (spr. tohtsche, Tosa), Fluß in der ital.
Provinz Novara, entspringt in den Lepontinischen Alpen an der
Schweizer Grenze, bildet einen berühmten
735
Tockieren - Tod.
Wasserfall (100 m hoch, 24 m breit, mit drei Absätzen),
durchfließt das Thal von Ossola und mündet bei Pallanza
in den Lago Maggiore; 76 km lang.
Tockieren (v. ital. toccare, "berühren"),
Bezeichnung für eine Art der Malerei, wobei die Farbe nicht
verschmolzen, sondern in deutlich sichtbaren und kurz behandelten
Pinselstrichen aufgetragen wird; daher s. v. w. mit derben und
fetten Strichen skizzenähnlich malen.
Tocopilla (spr. -pillja), Hafenort im Territorium
Antofagásta des südamerikan. Staats Chile, 22° 10'
südl. Br. In der Nähe sind Kupfergruben.
Tocqueville (spr. tockwil), Charles Alexis Henri Maurice
Cérel de, franz. Publizist, geb. 29. Juli 1805 zu Verneuil
(Seine-et-Oise), studierte die Rechte, ward 1826 zum
Instruktionsrichter und 1830 zum Hilfsrichter ernannt und 1831 nach
den Vereinigten Staaten von Nordamerika gesandt, um das dortige
Gefängniswesen kennen zu lernen. Als Früchte dieser Reise
erschienen: "Système pénitentiaire aux
États-Unis et de son application en France" (Par. 1832, 2
Bde.; 3. Aufl. 1845) und später das gedankenreiche,
epochemachende Werk "De la démocratie n Amérique"
(das. 1835, 2 Bde.; 15. Aufl. 1868), für welches er den
Montyonpreis erhielt, 1836 Mitglied der Akademie der moralischen
und politischen Wissenschaften und 1841 der Académie
française ward. Nachdem er seit 1839 in der
Deputiertenkammer auf seiten der dynastischen Opposition und nach
der Februarrevolution von 1848 in der Konstituante und Legislative
gewirkt, trat er 2. Juni 1849 als Minister des Auswärtigen ins
Kabinett, zog sich aber nach dem Staatsstreich 1851 vom
öffentlichen Leben zurück und starb 16. April 1859 in
Cannes. Er schrieb noch: "Histoire philosophique du règne de
Louis XV" (Par. 1846, 2 Bde.) mit der Fortsetzung: "Coup d'oeil sur
le règne de Louis XVI" (2. Aufl. 1850); "L'ancien
régime et la révolution" (das. 1856, 7. Aufl. 1866;
deutsch, Leipz. 1857 u. 1867). Gesammelt erschienen seine Werke in
9 Bänden (Par. 1860-65). Vgl. Jaques, A. de T. (Wien
1876).
Tocuyo, 1)(Nuestra Señora de la Concepcion de T.)
Stadt in der Sektion Barquisimeto des Staats Lara der
Bundesrepublik Venezuela, in einem schönen Gebirgsthal am
Fluß T., 629 m ü. M., gelegen, hat eine höhere
Schule, Wollweberei, Schafzucht, Woll- und Salzhandel u. (1883)
15,383 Einw.; wurde 1545 erbaut. -
2) (San Miguel de T., spr. -kujo) Ort im venezuelan. Staat
Falcon, nahe der Mündung des schiffbaren T. in das Karibische
Meer, in fieberschwangerer Gegend. Bei der Mündung des Flusses
Steinkohlenlager.
Tod, das endgültige Aufhören des Stoffwechsels
und der sonstigen Lebensthätigkeiten in einem Individuum, zum
Unterschied von einem durch äußere Hindernisse, die sich
wegschaffen lassen, erzwungenen zeitweisen Stillstand (s.
Anabiotisch und Scheintod). Da die ununterbrochene Aufnahme von
Sauerstoff den hauptsächlichsten Lebensreiz darstellt, so
ergibt die Lähmung der Atmungs- und Blutumlaufszentren die
nächste Todesursache bei den zusammengesetzten und höhern
Tieren; man sagt, jemand hat ausgeatmet, oder sein Herz steht
still, um den Eintritt des Todes zu bezeichnen. Man muß dabei
den natürlichen T. von dem gewaltsam herbeigeführten
unterscheiden. Mit dem erstern Namen bezeichnet man auch den durch
Krankheiten und innere Ursachen herbeigeführten T., obwohl die
Krankheiten oft sehr gewaltsam wirkende Todesursachen liefern (z.
B. Erstickung bei Halskrankheiten, Vergiftung bei Cholera und
ähnlichen Infektionskrankheiten) und strenggenommen nur der
infolge von Altersschwäche eintretende T. als der
naturgemäße Abschluß des Lebens zu bezeichnen
wäre. Ein solcher T. tritt, wie Preyer bemerkt hat, niemals
bei denjenigen niedersten Wesen ein, die sich durch beständige
Zweiteilung vermehren; der T. wurde erst eine Notwendigkeit
für zusammengesetzte Wesen, deren Organe sich abnutzen, und
die Begrenzung der Lebensdauer (s. d.) ist, wie schon Goethe
ausdrückte, eine Zweckmäßigkeitseinrichtung: der
Kunstgriff der Natur, immer neues und frisches Leben zu haben. Man
kann den örtlichen T., d. h. das Absterben einzelner Organe
(s. Brand), unterscheiden vom allgemeinen T. Auch beim allgemeinen
T. erfolgt das Absterben der sämtlichen Körperteile nicht
mit Einem Schlag, sondern mehr oder weniger allmählich; es
gehen seinem Eintritt Zeichen voran, welche dessen Annäherung
verkünden. Das Stadium, in welches diese Zeichen fallen,
heißt Todeskampf oder Agonie. Man nannte es einen Kampf, weil
es manchmal mit Symptomen von Aufregung, Schmerzen und
Krämpfen verknüpft ist. Aber sehr häufig
verläuft es still und geräuschlos (Todesschlaf) auch bei
kräftigern Körpern. Die Erscheinungen der Agonie sind in
jedem Fall gemischt aus den Symptomen der Krankheit, welche dem
Leben ein Ende macht, und aus den Zeichen der fortschreitenden
Lähmung des Nervensystems. Aufregungssymptome, von welchen die
Krankheit begleitet war, verschwinden nach und nach, das
Denkvermögen ist meist vermindert oder aufgehoben. Gegen die
Umgebung zeigen sich Sterbende, selbst wenn sie noch bei
Bewußtsein sind, meist gleichgültig. Häufiger fehlt
das Bewußtsein, manchmal kehrt dasselbe in den letzten
Momenten wieder, und die relative Ruhe nach den vorausgegangenen
Schmerzen und Krämpfen wird vom Sterbenden als physisches
Behagen empfunden. Der erfahrene Beobachter erkennt in der Ruhe das
Fortschreiten der Lähmung. Die verschiedenen Organe sterben in
einer bestimmten, ziemlich regelmäßigen Reihenfolge ab.
War das Bewußtsein noch erhalten, so überlebt es die
Sinne. Der Geruchs- und Geschmackssinn scheinen zuerst zu
verschwinden. Darauf erlischt meist der Gesichtssinn; die
Sterbenden klagen nicht selten über einen Nebel vor den Augen
oder rufen nach Licht. Für Gehörseindrücke geben sie
noch Zeichen des Verständnisses, wenn das Auge schon von
Dunkel umhüllt ist. Der Gefühlssinn ist bald schon
frühzeitig sehr verringert, bald verschwindet er erst zuletzt.
Nicht selten fühlen Sterbende die Kälte, welche von unten
an aufwärts über den Körper fortschreitet.
Allmählich verlieren die Muskeln die Fähigkeit, dem
Willen zu gehorchen. Der Körper sinkt im Bett herab und
streckt sich lang aus; die vorher vielleicht im Krampf
zusammengezogenen Gliedmaßen lösen sich; die
Gesichtszüge werden hängend, der Unterkiefer fällt
herab, und dadurch öffnet sich der Mund; die Augenlider
sinken, ohne sich zu schließen. Die Hornhaut des Auges wird
glanzlos und matt (gebrochenes Auge); das Auge wird starr und
fixiert nicht mehr. Die Schläfe sinken ein, die Nase wird
spitz und scheint verlängert. Das ganze Gesicht erscheint
länger, das Kinn spitzer und hervorragender; das Gesicht ist
gelblich, mitunter bläulich gefärbt, kühl,
häufig mit kaltem Schweiß bedeckt (Hippokratisches
Gesicht). Das Atmen geschieht langsam, selten und mühevoll,
die Atemzüge werden ungleich, auf mehrere oberflächliche
folgt ein tiefer; kurz vor dem T. werden sie immer seltener und,
einzelne Schluchzer oder Seufzer ausgenommen, immer leiser. Da die
schwa-
736
Tod - Toda.
chen Muskeln nicht mehr durch Husten den Schleim aus den
Bronchien entfernen können, so tritt hörbares Rasseln des
Schleims in den Luftwegen ein, welches bei den
unregelmäßigen Atembewegungen als Todesröcheln
bezeichnet wird. Auch die Zusammenziehungen des Herzens werden
unzulänglich, die Arterien immer schwächer gefüllt,
die Pulsschläge häufiger, aber schwächer, zuletzt
unfühlbar. Die Haut verliert wegen mangelhafter Füllung
der Blutgefäße ihre Röte und Elastizität. Die
Wärme ist, wenn dem T. Fieber vorausging, im Innern
erhöht und steigt sogar über diejenige Höhe hinaus,
welche sie während des Lebens hatte. Dabei fühlen sich
jedoch das Gesicht, besonders Nasenspitze und Ohren, sowie
Hände und Füße meist kühl an. Waren die
Kranken während des Todeskampfes fieberlos, so sinkt die
Wärme auch objektiv während desselben. Es ist
unmöglich, auf Minuten genau den Moment des Todes anzugeben.
Gewöhnlich sieht man die letzte Atembewegung, welche
natürlich in einer Exspiration besteht, als Schluß des
Lebens an; doch ist es sicher, daß zahlreiche Organe des
Körpers noch über diesen Moment hinaus eine Fülle
von Lebenserscheinungen darbieten. Das Herz arbeitet z. B. manchmal
noch eine geraume Weile, die Muskeln kontrahieren sich noch auf
direkte Reizung, die Baucheingeweide bewegen sich noch längere
Zeit, die auf der Oberfläche gewisser Schleimhäute
sitzenden Flimmerzellen stellen ihre sehr lebhaften Bewegungen
oftmals erst 48 Stunden nach dem letzten Atemzug ein. Es handelt
sich daher beim T. um einen allmählichen Austritt der
einzelnen Gewebe aus dem Lebensverband, eine Erscheinung, die dem
Verständnis um vieles näher gerückt wird, wenn man
den Organismus als einen Zellenstaat auffaßt, in dem
sämtliche Glieder ein gleichberechtigtes Einzeldasein
führen und erst durch das Aufhören des Blutumlaufs
gewissermaßen einzeln verhungern, weshalb man sie auch durch
fernere Durchleitung sauerstoffhaltigen Bluts außerhalb des
Körperverbandes längere Zeit zum Fortarbeiten veranlagen
kann. Etwa 8-12 Stunden nach erfolgtem T. erscheinen an den
niedriger liegenden Körperteilen blaurote Flecke
(Totenflecke), welche von der mechanischen Senkung des Bluts
herrühren. Bei Rückenlage der Leiche erscheinen die
Totenflecke am Rücken, bei Gesichtslage im Gesicht, auf Brust
und Bauch. Häufig kommen jedoch auch an obern
Körperstellen Totenflecke vor, namentlich bei blutreichen
Leichen. Die Leichenkälte tritt zu verschiedener Zeit
(½-24 Stunden, durchschnittlich 6-12 Stunden) nach dem T.
ein, je nach der Temperatur des Sterbenden und des umgebenden
Mediums, namentlich auch je nachdem der Tote im Bett gelassen wird
oder nicht. Ein weiteres und sehr entscheidendes Zeichen des
absoluten Todes ist die Toten- oder Leichenstarre, welche durch das
Gerinnen eines Blutbestandteils verursacht wird. Während die
Leiche unmittelbar nach dem T. völlig weich zu sein pflegt,
macht diese Biegsamkeit der Gliedmaßen allmählich einer
von den obern nach den untern Teilen fortschreitenden Erstarrung
Platz. Sie beginnt immer an den Kinnladen und am Hals, geht dann am
Rumpf abwärts auf die Arme und endlich auf die Beine, zuletzt
auf die innern Teile über und verschwindet auch wieder in
derselben Reihenfolge. In der Regel stellt sich die Totenstarre
binnen 6-12, selten erst nach 24 Stunden, noch seltener bereits
wenige Minuten nach dem T. ein, doch will man bei gewaltsamem T.,
z. B. auf Schlachtfeldern, häufig eine augenblicklich
eintretende und den Körper in seiner letzten Gliederanspannung
festhaltende Totenstarre beobachtet haben. Nachdem dieselbe 24-48
Stunden angehalten hat, verschwindet sie wieder; selten vergeht sie
früher, bisweilen währt sie 5-6 Tage. Mit dem Ende der
Totenstarre fällt der Anfang der Fäulnis zusammen, welche
sich weiterhin durch den Leichengeruch, durch die grünliche
Färbung der Haut und durch die Gasentwickelung im Körper
verrät. Alle diese Erscheinungen treten je nach der Temperatur
und Feuchtigkeit des umgebenden Mediums, nach der
Körperkonstitution, nach der Art der vorausgegangenen
Krankheit wenige Stunden bis eine Woche und länger nach dem T.
ein. Über die Unterscheidung des Todes vom Scheintod s. d.
Vgl. Weismann, Die Dauer des Lebens (Jena 1882); Götte,
Über den Ursprung des Todes (Hamb. 1883). Der T. spielt im
Volksglauben eine eigentümlich bedeutsame Rolle (s.
Totensagen). Die Naturvölker glauben nicht an einen
natürlichen und wirklichen T., sondern halten das Sterben
für eine Wirkung böser Geister oder Hexen, was sich auch
bei den Kulturvölkern noch in der Personifikation des Todes
als Totengenius (Thanatos der Griechen), Sensenmann und Freund Hein
der Germanen ausspricht. Die griechischen Künstler stellten
den T. (Thanatos), den Sohn der Nacht, den Bruder des Schlafes,
zumeist auf Grund einer freundlichen Auffassung dar, als ernsten
Jüngling mit gesenkter Fackel, eine Vorstellung, welche der
Darstellung der griechischen Dichtkunst, die in dem "starrherzigen"
Gott des Todes einen dunkelgewandeten, schwertbewehrten
Opferpriester der Unterwelt erblickte, allerdings nicht entsprach.
Doch gehören jene Darstellungen der bildenden Kunst meist der
spätern griechischen Zeit an. Man findet sie vorwiegend auf
attischen Grabsteinen, Vasen u. dgl. Vgl. Lessings Abhandlung "Wie
die Alten den T. gebildet" und Robert, Thanatos
(Winckelmanns-Programm, Berl. 1879). Die spätern
römischen Dichter schilderten den T. als ein
zähnefletschendes Ungeheuer, das mit blutigen Nägeln
seine Opfer zerfleischt. In der ernsten, finstern Auffassung eines
unheilvollen Dämons findet sich auch die geflügelte
Gestalt des Todes auf etruskischen Vasen und Sarkophagen. Auch die
Kunst des Mittelalters gab dem T. die schreckhafte Gestalt eines
Ungeheuers mit Fledermausflügeln, besonders in Italien. In
Deutschland trat der T. in den ersten Darstellungen der
Totentänze (s. d.) in der Mehrzahl auf. Es waren anfangs
zusammengeschrumpfte Leichname, später erst entfleischte
Gerippe, aus denen dann der Knochenmann der neuern Kunst entstanden
ist. Sense und Sichel wurden nach Offenbar. Joh. 14,4 sein
Attribut, wozu sich später das Stundenglas gesellte. Vgl.
Wessely, Die Gestalten des Todes und des Teufels in der
darstellenden Kunst (Leipz. 1876); Schwebel, Der T. in deutscher
Sage und Dichtung (Berl. 1877).
Toda (Tuda, Tudavar), Drawidastamm in den Nilgiri um
Utakamand herum. Sie sind Hirten, deren einziger Reichtum in ihren
Herden besteht, und zerfallen in fünf Kasten, die nicht
untereinander heiraten, nämlich Peiky, Pekkan, Kuttam, Kuma
und Tody. Es herrscht Polyandrie. Die Frau wird gekauft und
gehört den Brüdern einer Familie gemeinschaftlich; die
Kinder werden nach der Reihenfolge ihrer Geburt den Brüdern
vom ältesten abwärts zugeschrieben. Man hat zwei
Leichenzeremonien, ein "grünes" und ein "dürres"
Begräbnis. Bei dem grünen Begräbnis wird der Tote
verbrannt und die Asche gesammelt, bei dem dürren, das
zwölf Monate später stattfindet, wurden früher so
viele Büffel
737
Todaustragen - Todesstrafe.
geschlachtet, daß die englische Regierung die sinnlose
Verschwendung durch Verbote beschränkte. Dem Priester des
Dorfs liegt die Pflege und das Melken der Kühe ob; außer
den Priestern gibt es noch drei heilige Einsiedler. Man glaubt an
böse Geister und verehrt eine heilige Büffelschale, unter
der man sich den
höchsten Gott Hiriadeva vorstellt. Vgl. Metz, Die
Volksstämme der Nilagiris (Basel 1857); Marshall,A
phrenologist amongst the Todas (Lond. 1873).
Todaustragen (Tod austreiben),uraltes Volksfest
heidnischen Ursprungs, dessen Feier am Sonntag Lätare
(Todsonntag) oder Iudika sich hier und da noch in der Lausitz, in
Schlesien und Böhmen erhalten hat, früher aber auch in
Meißen, Thüringen, Franken, in der Pfalz und im Odenwald
üblich war. Es bildet einen Teil des Maifestes (s.d.) und
besteht darin, daß eine den Tod vorstellende Strohfigur unter
Absingen von Liedern umhergetragen und dann ins Wasser geworfen
oder verbrannt wird. Der Tod ist hier eine christliche Einkleidung
des heidnischen
Winterriesen, der vor der Gottheit des Frühjahrs weichen
muß. Mitunter war mit dem T. auch ein kleiner dramatischer
Wettstreit zwischen Sommer und Winter verbunden. Vgl.
v.Reinsberg-Düringsfeld, Das festliche Jahr (Leipz. 1863).
Toddy, Getränk aus Branntwein, Zucker, Eis und
Wasser, ähnlich dem Grog, in Schottland, England, Schweden
etc. beliebt (Sling enthält dazu noch etwas geriebene
Muskatnuß); auch s.v.w. Palmwein.
Todea Willd., Farngattung aus der Familie der
Osmundaceen. Eine baumbildende Art dieser Gattung mit 3 m hohem und
60 cm dickem Stamm sowie schönen, ca.2 m breiten,
doppeltfiederteiligen Blättern ist T. barbara Moore, die in
Neuholland, Neuseeland und Südafrika wächst.
Todesengel, christliches Bild, durch welches der Tod als
ein Genius dargestellt wird, der die Seele
aus diesem zu einem bessern Leben hinüberführt, dem
griechischen Hermes, welcher als Psychopompos die Seelen der
Abgeschiedenen nach dem Hades geleitet, entsprechend.
Todeserklärung, die richterliche Erklärung,
daß eine verschollene Person als verstorben anzusehen sei (s.
Verschollenheit).
Todeslinderung , s. Euthanasie.
Todesstrafe, die Hinrichtung eines Verbrechers zur
Sühne begangenen Unrechts. Je nachdem diese Hinrichtung in
mehr oder weniger schmerzhafter Weise vollzogen wurde, unterschied
man im ältern Strafrecht zwischen geschärfter
(qualifizierter) und einfacher T. Nach dem Strafsystem der
peinlichen Gerichtsordnung Karls V. waren als geschärfte
Todesstrafen der Feuertod, das Pfählen, das Rad, das
Vierteilen und das Säcken oder Ertränken in Übung,
während die Strafen des Stranges und des Schwertes sowie die
militärische Strafe der Kugel oder des Arkebusierens als die
leichtern und einfachen Arten der T. galten. Die moderne
Strafgesetzgebung kennt nur die einfache T., welche in den meisten
Staaten, namentlich auch nach dem deutschen Strafgesetzbuch, durch
Enthauptung und zwar meistens mittels des Fallbeils, in England,
Österreich und Amerika durch Erwürgen am Galgen, in
Spanien durch Bruch der Halswirbel (Garrotte) und im Staat New York
seit 1889 durch die Anwendung von Elektrizität vollzogen wird.
Die Öffentlichkeit der T., welche früher allgemein
üblich war, besteht nur noch ausnahmsweise, z. B. in
Frankreich; sonst wird dieselbe regelmäßig in einem
umschlossenen Raum vollzogen (sogen. Intramuranhinrichtung), so
seit 1869 auch in England. Nach der deutschen
Strafprozeßordnung müssen dazu zwei Gerichtspersonen,
ein Beamter der Staatsanwaltschaft, ein Gerichtsschreiber und ein
Gefängnisbeamter zugezogen werden. Der Ortsvorstand hat
zwölf Personen aus den Vertretern oder aus andern achtbaren
Mitgliedern der Gemeinde abzuordnen, um der Hinrichtung
beizuwohnen. Außerdem ist einem Geistlichen von dem
Religionsbekenntnis des Verurteilten und dem Verteidiger sowie nach
Ermessen des die Vollstreckung leitenden Beamten auch andern
Personen der Zutritt zu gestatten. Der Leichnam des Hingerichteten
ist den Angehörigen desselben auf ihr Verlangen zur einfachen,
ohne Feierlichkeit vorzunehmenden Beerdigung zu verabfolgen. An
schwangern oder geisteskranken Personen darf die T. nicht
vollstreckt werden. Ihre Vollstreckung ist überhaupt nur
zulässig, nachdem die Entschließung des Staatsoberhaupts
ergangen ist, von dem Begnadigungsrecht keinen Gebrauch machen zu
wollen. Als militärische T., die in Fällen des
Kriegsrechts aber auch gegen Zivilisten zur Anwendung kommt, ist
dieStrafe des Erschießens gebräuchlich. Über die
Zulässigkeit der T. an und für sich ist, seitdem Beccaria
für ihre Abschaffung eingetreten, also seit mehr denn 100
Iahren, Streit. Wenn dabei vielfach Unklarheit herrscht, so kommt
dies besonders daher, weil man oft zwei Fragen nicht gehörig
auseinander hält: die rechtsphilosophische, ob dem Staate das
Recht zusteht, dem Staatsbürger zur Sühne begangenen
Unrechts das Recht auf die Existenz abzusprechen, und die
rechtspolitische, ob es, wofern man und zwar wohl mit Recht die
erste Frage bejaht, zweckmäßig sei, von ebendiesem Recht
noch Gebrauch zu machen. Auch die zweite Frage glaubt die
herrschende Ansicht bei dem dermaligen Stand unsrer Zivilisation
zur Zeit noch nicht verneinen zu können. Abgeschafft war die
T. vor der Herrschaft des norddeutschen Strafgesetzbuchs in Anhalt,
Bremen, Oldenburg und im Königreich Sachsen; sie ist es noch
in Rumänien, Holland, Portugal, in der Schweiz und in einigen
nordamerikanischen Staaten; vorübergehend war sie in
Österreich abgeschafft. Einzelne Schweizer Kantone haben
indessen die T. neuerdings wieder eingeführt. Im norddeutschen
Reichstag hatte sich 1870 die Mehrheit für die Abschaffung der
T. entschieden, und nur um das Zustandekommen des Strafgesetzbuchs
nicht zu gefährden, entschloß man sich bei dem
entschiedenen Widerstand der Regierungen endlich doch fur die
Beibehaltung der T. Das deutsche Reichsstrafgesetzbuch bedroht mit
der T. den vollendeten Mord, außerdem aber noch den als
Hochverrat strafbaren Mord und den Mordversuch, welche an dem
Kaiser, an dem eignen Landesherrn oder während des Aufenthalts
in einem Bundesstaat an dem Landesherrn dieses Staats verübt
worden sind. Auch ist in dem Reichsgesetz vom 9. Juni 1884
über den verbrecherischen und gemeingefährlichen Gebrauch
von Sprengstoffen bestimmt, daß derjenige, welcher
vorsätzlich durch Anwendung von Sprengstoffen Gefahr für
das Eigentum, die Gesundheit oder das Leben eines andern
herbeiführt, mit Zuchthaus, wenn aber durch solche
Handlungsweise der Tod eines Menschen herbeigeführt worden
ist, mit dem Tod bestraft werden soll, wofern der Thäter jenen
Erfolg voraussehen konnte.Das deutsche Militärstrafgesetzbuch
endlich bedroht
auch die schwersten Militärverbrechen, wie Kriegsverrat,
Fahnenflucht, Feigheit vor dem Feinde, Thätlichkeiten gegen
Vorgesetzte im Felde und militärischen Aufruhr vor dem Feind,
mit dem Tod. Vgl. Deutsches Strafgesetzbuch, § 13, 32, 80 und
211; Deutsche
738
Todfall - Toggenburg.
Strafprozeßordnung, § 485 f.; Deutsches
Militärstrafgesetzbuch, § 58, 63, 73, 84, 97, 107 f.,
133, 159; Mittermaier, Die T. (Heidelb. 1862); Hetzel, Die T. (das.
1870); v. Holtzendorff, Das Verbrechen des Mordes und die T. (das.
1875); Pfotenhauer, Aphorismen über die T. (Bern 1879);
Carfona, La pena di morte (Neap. 1884).
Todfall, s. Baulebung.
Todi, Stadt in der ital. Provinz Perugia (Umbrien), an
der Mündung der Naja in den Tiber, mit (teilweise noch
etruskischen) Mauern umgeben, Bischofsitz, hat eine gotische
Kathedrale, eine nach Bramantes Entwurf erbaute Renaissancekirche,
ein schönes Stadthaus und ein altes Regierungsgebäude,
Gymnasium, technische Schule, Seminar, reiche
Wohlthätigkeitsanstalten und (1881) 3306 Einw. T. ist das alte
umbrische Tuder, später römische Kolonie.
Tödi, das Haupt der Glarner Alpen (3623 m), auf der
Grenzscheide der Kantone Glarus, Uri und Graubünden, hat eine
nach O. flach abfallende Firndecke und zwei Spitzen, den vordern,
rundlichen Glarner T. und den südlichen, auf Graubündner
Gebiet liegenden Piz Rusein. Ihn umstehen in zwei
Parallelzügen, die durch ein Firnmeer verbunden sind, der
Bifertenstock (3426 m), der Düssistock (3262 m) und der Piz
Tgietschen (Oberalpstock, 3330 m), der Claridenstock (3264 m), das
Scheerhorn (3296 m), die Große Windgelle (3189 m) etc.
Zwischen Düssistock und Scheerhorn zieht sich der
Hüfigletscher, aus dem der Kärstelenbach entspringt, ins
Maderanerthal hinab. Einer kleinern Schneemulde, die zusammen mit
dem Abfluß des am Piz Tgietschen lagernden Brunifirns,
zwischen Tödi und Bifertenstock lagert, entspringt der
Bifertenfirn, der wie der Claridenfirn in den Hintergrund des
Linththals sich hinabsenkt. Die natürliche Abgrenzung dieser
ganzen Bergwelt bilden Klausen-, Kreuzli- und Kistenpaß. Den
Reigen der schwierigen Aszensionen im Tödigebiet
eröffnete Pater à Spescha, der 1788 den Stockgron, 1799
den Piz Tgietschen erstieg. Auch die übrigen Gipfel wurden
seitdem erobert; den höchsten (Piz Rusein) bestieg als erster
Reisender Dürler (August 1837). Die Besteigung des T. erfolgt
gewöhnlich von der Klubhütte am Grünhorn (2451
rn).
Todleben, s. Totleben.
Tödlichkeit von Körperverletzungen, s.
Tötung.
Todmorden, Stadt in Yorkshire (England), an der Grenze
von Lancashire, am Calder, hat Baumwollwarenfabriken,
Maschinenbauwerkstätten, Kohlengruben und (1881) 23,862
Einw.
Todos los Santos (Bahia de T.), 1) Bai an der
Westküste der Halbinsel Niederkalifornien in Mexiko, unter
30° 45' nördl. Br., mit Zollhaus. -
2) Hafen in Argentinien, s. San Blas 1).
Todos Santos, Hafenort an der Westküste der
Halbinsel Kalifornien in Mexiko, unter dem Wendekreis, mit Zollhaus
und (1880) 1209 Einw.
Todsünden, nach 1. Joh. 5, 16 und 17 solche
Sünden, welche den geistigen Tod, d. h. den Verlust des
Gnadenstandes, zur Folge haben, nach Petrus Lombardus: Hochmut,
Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Trägheit des
Herzens; einen anerkannten Katalog derselben gibt es nicht. S.
Sünde.
Todt..., s. Tot...
Todtnau, Stadt im bad. Kreis Lörrach, an der Wiese
und am Fuß des Feldbergs, seit dem Brand von 1876
größtenteils neuerbaut, 650 m ü. M., hat eine kath.
Kirche, eine Bezirksforstei, Baumwollspinnerei und -Weberei,
Bürsten-, Holzstoff-, Zunder- und Papierfabrikation und (1885)
1756 Einw.
Tostlund, Dorf in der preuß. Provinz
Schleswig-Holstein, Kreis Hadersleben, hat eine evang. Kirche, ein
Amtsgericht und (1885) 657 Einw.
Toga (lat.), das Nationalkleid der freien Römer im
Frieden, wodurch sie als Togati sich von allen Nichtrömern
unterschieden, bestand aus einem einzigen, 4 m langen und 2½
m breiten Stück Zeug, das so getragen ward, daß man den
einen Zipfel über die linke Schulter nach vorn warf, den obern
Rand über den Rücken zog, den andern Zipfel aber unter
dem rechten Arm durchzog (so daß derselbe frei blieb) und
dann über die linke Schulter warf (vgl. Abbildung). Unter dem
rechten Arm bis zur linken Schulter entstand dabei ein Bausch, den
man als Tasche (sinus) gebrauchte. Im Krieg knüpfte man, bevor
das Sagum (s. d.) die allgemeine militärische Kleidung wurde,
die T. unter der Brust gürtelähnlich fest (Cinctus
Gabinus). In der spätern Zeit trug man unter der T. die Tunika
(s. d.) unmittelbar auf dem Körper. Die T. war von Wolle und
weißer Farbe (t. alba), bei gemeinen Leuten und bei der
Trauer dunkel (pulla). Die höhern Magistratspersonen bis zu
den kurulischen Ädilen trugen eine mit einem Purpurstreifen
eingefaßte T. (t. praetexta, s. Tafel "Kostüme I", Fig.
6), ebenso die Knaben bis zum 17. Jahr, die Mädchen bis zu
ihrer Verheiratung. Vom vollendeten 17. Jahr an trugen die
Jünglinge die einfache, unverbrämte T., die T. virilis
oder T. pura. Besondere Staatskleider waren die T. picta. eine T.
von Purpur, mit goldenen Sternen verziert, die der Triumphator
anlegte, sowie die mit eingestickten Palmzweigen geschmückte
T. palmata (trabea). Die T. candida wurde von den Bewerbern um
Staatsämter getragen und war glänzend weiß (s.
Candidatus); die Angeklagten trugen eine dunkle T. (t. squalida).
Im Sommer trug man die T. rasa, eine abgeschorne T. von dünnem
Zeug; im Winter eine wollene (t. pinguis). Auch Fremden konnte das
Recht, die T. zu tragen, durch Senatsbeschluß als
Auszeichnung erteilt werden, wie es z. B. das gesamte römische
Gallien erhielt, das daher Gallia togata hieß. Unter den
Kaisern begann die T. die Tracht der geringern Leute und Sklaven zu
werden. Die Frauen nahmen die Palla (s. d.) an, und die T. wurde
das Kleid der wegen Ehebruchs geschiedenen Frauen und
Buhldirnen.
Toggenburg, ehemals eine Grafschaft der Schweiz, die
voralpine Thalstufe der Thur umfassend, deren Besitzer (Grafen von
T.) zu den reichsten und angesehensten Dynasten des Landes
gehörten. Nach dem Erlöschen des Geschlechts (1436) fiel
die Grafschaft an die Freiherren von Raron, die sie 1469 an den Abt
von St. Gallen verkauften. Infolge der Religionsspaltung entstand
eine Menge von Zerwürfnissen zwischen Stift und Landschaft, so
daß die Zuricher und Berner, von den Toggenburgern angerufen,
mit den katholischen Orten handgemein wurden
[Römer in der Toga.]
739
Togianinseln - Tokar.
(Toggenburger oder Zwölferkrieg von 1712). Neu
ausgebrochene Feindseligkeiten wurden 1755 und 1759 beigelegt. 1803
wurde das Ländchen dem Kanton St. Gallen zugeteilt. Es
zerfällt in die vier Bezirke Ober-, Neu-, Alt- und Unter-T.,
von denen Alt-T. (11,721 Einw.) vorherrschend katholisch, die drei
andern, mit 43,887 Einw., vorherrschend protestantisch sind. Die
Hauptindustrie ist Baumwollspinnerei (s. Sankt Gallen, S. 283). Die
oberste Thalgemeinde ist Wildhaus, der Geburtsort Zwinglis. Bei
Ebnat-Kappel (640 m) beginnt die "Toggenburger Eisenbahn" und
führt thalabwärts über Wattwyl, Lichtensteg und
andre Orte bis nach Wyl, wo sie in die Zürich-St. Galler Linie
einmündet (560 m). Vgl. Wegelin, Geschichte der Landschaft T.
(St. Gallen 1857); Hagmann, Das T. (Lichtensteg 1877).
Togianinseln (Tadjainseln, Schildpattinseln), Gruppe von
etwa 500 Eilanden in der Tominibai an der Ostküste von
Celebes, 677 qkm (12,2 QM.) groß, stark bewaldet, unbewohnt,
aber wegen des Schildkrötenfanges und der Fischerei
häufig besucht; gehört zur niederländischen
Residentschaft Menado.
Togo ("jenseit der Lagune"), deutsche Kolonie an der
Sklavenküste von Westafrika (s. Karte bei "Guinea"), zwischen
1° 10' (New Sierra Leone) und 1° 30' östl. L. v. Gr.
(Gum Koffi), doch zieht sich die östliche Grenzlinie
nordostwärts bis 1°40', ein Areal von 1300 qkm (23,6 QM.).
Am Meer liegen die Handelsplätze Lome, Bagida und Porto Seguro
auf einem schmalen, niedrigen und hafenlosen Küstenstreifen;
dahinter zieht sich eine Strandlagune hin, welche in der Lagune T.
sich nach N. erweitert, jedoch in weit geringerm Maß, als die
Engländer, welche sie Avonlagune nennen, früher angaben.
In die Lagune mündet von N. her der Hahofluß. Das
sogleich zu Hügeln von 40-60 m Hohe aufsteigende Land ist
außerordentlich reich an Ölpalmen und andern
Fruchtbäumen; nur der kleinste Teil des Landes ist angebaut
mit Kassawen, Mais, Bataten, Ananas u. a., das übrige ist mit
Rohr, hohem Gras und Buschdickicht, aus dem einzelne Bäume
hervorragen, bestanden. Vierfüßige Tiere sind
außer Affen selten; vereinzelt gibt es Leoparden, dagegen ist
die Vogelwelt überreich, und die Lagunen sind voll von
Fischen. Die Bevölkerung, etwa 40,000 Köpfe und durchweg
Neger, beschäftigt sich an der Küste fast
ausschließlich mit Handel; weiter nach dem Innern zu fertigt
man kunstreiche Gefäße, Leder und Zeuge. Die aus Binsen
geflochtenen Hütten sind rund oder viereckig, in jedem Ort
aber gleichförmig gebaut und, wie Straßen und
Plätze, sehr rein gehalten. Jedes Dorf enthält eine
Gerichtshalle, ein Palaver- und ein Fetischhaus. Der Hauptort T. am
östlichen Ufer der gleichnamigen Lagune hat 2000-3000 Einw.,
das heilige Be zählt 2000 Seelen, außerdem werden noch
10 Orte mit je 1000 Seelen genannt. Das Gebiet von T. wurde Ende
1884 unter deutschen Reichsschutz gestellt und für dasselbe
ein deutscher Reichskommissar mit dem Sitz in Klein-Popo ernannt.
Das Budget der Kolonie bezifferte sich 1888/89 auf 107,000 Mk.
Einnahme und 178,000 Mk. Ausgabe. T. wurde 1887 von Henrici
besucht, und 1888 ging Wolf ab, um das Hinterland zu erforschen.
Vgl. Zöller, Das Togoland und die Sklavenküste (Stuttg.
1885); Krümmel, Togoland (Weim. l887); Henrici, Das deutsche
Togogebiet (Leipz. 1888).
Tográi, Muajjad ed-din el Hosein ibn 'Ali, arab.
Dichter des 11. und 12. Jahrh., war Wesir des
Seldschukkenfürsten Mas' ud ibn Mohammed und wurde nach dessen
Beseitigung durch seinen Bruder Mahmud 1119 oder 1121 getötet.
Er ist einer der hervorragendsten Elegiker und kontemplativen
Lyriker; am berühmtesten ist seine "Lâmije" (auf l
reimendes Gedicht), welche wiederholt herausgegeben und
übersetzt ist (unter andern v. Rucocke, Oxford 1661; Reiske,
Dresd. 1756; Frähn, Kasan 1814).
Tohu wabohu (hebr., "wüst und leer"), nach 1. Mos.
1, 2 Bezeichnung eines wüsten Durcheinander.
Toilette (franz., spr. toa-), ursprünglich ein Tuch
(toile), das man über den Putztisch der Damen breitete; dann
das ganze zum Putz notwendige Gerät, insbesondere neben dem
Spiegel der Tisch (Putztisch, Nachttisch), auf welchem alle diese
Geräte sich befinden; endlich der weibliche Putz selbst in
allen seinen Details, daher T. machen, sich vollständig
ankleiden, putzen.
Toise (spr. toahs'), die franz. Klafter, Normaleinheit
des altfranzösischen Längenmaßes. Die alte T. hatte
6 alte Pariser Fuß = 1,949 m; die neue (metrische, t.
usuelle), zu 2 m, wurde als Übergang vom alten zum neuen
Maßsystem eingeführt. Der ihr zu Grunde liegende, noch
jetzt in Paris aufbewahrte Maßstab hieß T. du
Pérou (weiteres bei Gradmessungen). Vgl. Peters, Zur
Geschichte und Kritik der Toisenmaßstäbe (Berl.
1886).
Tokâd, Hauptstadt eines Sandschak im türk.
Wilajet Siwas in Kleinasien, unweit des Jeschil Irmak, 620 m hoch,
auf drei Seiten von Bergen umgeben, hat eine alte Citadelle, einen
verfallenen Palast sowie eine Brücke und eine Moschee aus der
Seldschukkenzeit, sonst meist unansehnliche Häuser, viele
Moscheen sowie mehrere christliche Kirchen und Klöster. T. ist
Sitz eines armenischen Erzbischofs und war früher als
Karawanenstation wie durch lebhaften Handel und Industrie von
Bedeutung. Bemerkenswert sind die dortigen Kupferschmelzen und
Kupferschmieden, welche ihr Erz von Maaden Kapur an der Quelle des
westlichen Tigris erhalten. Die Einwohnerzahl beträgt etwa
45,000 Seelen (26,000 Türken, 15,0000 Armenier, der Rest
Griechen und Juden). Im Altertum lag 6 km nordöstlich von T.
das pontische Komana; T. selbst ist das byzantinische Eudokia.
Tokadille, ein aus Italien stammendes, dem Puff
verwandtes Spiel, wird von zwei Personen mit je 15 (auch 16)
Steinen gespielt, nach Regeln, die auf denen des Puffs beruhen,
aber ungleich verwickelter sind und mehr Abwechselung bieten als
dieser.
Tokantins, großer Fluß in Brasilien,
entspringt als Rio das Almas auf den Hochgebirgen im S. der Provinz
Goyaz, durchströmt diese und die Provinz Pará in
nördlicher Richtung, hat mehrere Wasserfälle und
Stromschnellen, erweitert sich unterhalb Cameta zum Rio
Pará, empfängt hier einen Nebenarm des Amazonenstroms,
den Paranau, der die Insel Marajo vom Festland trennt, und
mündet unterhalb Pará oder Belem in den Atlantischen
Ozean. Er ist 2612 km lang, wovon 220 km auf den Rio Pará
kommen; die Schiffahrt auf dem T. ist seit 1867 allen Nationen
freigegeben. Regelmäßige Dampfschiffahrt ist 650 km
aufwärts im Gang; oberhalb der Wasserfälle sind weitere
650 km bis zu den Schnellen von Itaboca schiffbar. Sein
bedeutendster, ihn an Ausdehnung übertreffender Zufluß
ist der Araguaia, welcher an der Sierra de Santa Martha entspringt
und in einem breiten Parallelthal zu dem des T. nach N.
fließt, um sich nach 2600 km langem Lauf und nach Bildung der
großen Flußinsel Santa Anna oder Bannanal bei
São João das Duas Barras mit jenem zu vereinen.
Tokar, Stadt mit kleinem Fort in Nubien, südlich von
Suakin in einer Oase, in der sich der Fluß Barka
47*
740
Tokay - Tokio.
in unzählige Bewässerungskanäle verzweigt; in den
Feldern in der Umgebung sind zur Zeit der Aussaat und der der Ernte
mehr als 20,000 Arbeiter thätig. Nach der Niederlage von Hicks
Pascha sollte die Besatzung des Forts durch Baker Pascha entsetzt
werden, dieser wurde jedoch 4. Febr. 1884 geschlagen, und erst
General Graham konnte nach einer Niederlage der Mahdisten T., das
inzwischen kapituliert hatte, aber vom Feind wieder geräumt
war, 1. März erreichen. Das Fort wurde aufgegeben.
Tokay (Tokaj), Markt im ungar. Komitat Zemplin, am Bodrog
(unweit der Mündung in die Theiß), Station der
Ungarischen Staatsbahn, mit Viehzucht, Fischerei, berühmtem
Obst- und Weinbau und (1881) 4479 Einw. Die nord- und
nordostwärts liegenden Tokayer Berge, der südliche Teil
der Hegyalja (s. d.), liefern 34 Sorten trefflicher Weine. Die
edelsten (fünf Sorten) werden bei Tarczal, Talya, Mád,
Lißka, Kisfaludy, Zsadany gewonnen, und zwar: ordinärer
Tischwein, ohne Süße, aus den ihrer Trockenbeeren
beraubten Trauben; Szamorodner, aus Trauben ohne Auslese der
Trockenbeeren, wenig süßer, kräftiger, feuriger
Wein; Mászláser oder gezehrter Wein (ein-, zwei- und
dreibuttig), aus Trauben mit Zusatz von Trockenbeeren,
süß, mild, höchst geistig; Ausbruch oder
Muskateller, wie der vorige, aber mit fünf oder mehr Butten
Trockenbeeren auf ein Faß (zehn Butten Wein). Was aus diesem
Gemisch durch den eignen Druck von selbst abfließt, bildet
die Essenz, den süßesten, duftigsten, geistigsten und
wohlschmeckendsten aller Weine. Der Tokayer Weinbau hat sich seit
Gründung der T.-Hegyaljaer Weinbaugesellschaft ungemein
gehoben. Der Gesamtertrag beträgt jährlich ca. 97,500 hl.
Bei T. fanden 1848 mehrere Gefechte zwischen dem
österreichischen Armeekorps unter Schlik und den Ungarn
statt.
Tokelauinseln, s. Unioninseln.
Tokio (spr. tokjo; auch Tokei, spr. toke,
"Osthauptstadt"), Hauptstadt des japan. Reichs und seit 1868
dauernde Residenz des Mikado, vordem Jedo (Yeddo) genannt, liegt
unter 35° 40' uördl. Br. und 139° 47' östl. L. v.
Gr. am nordwestlichen Ende der seichten Jedobucht und am
Südrand einer fruchtbaren Ebene, welche der Tonegawa mit
verschiedenen seiner Nebenflüsse, der Sumidagawa sowie
zahlreiche Kanäle durchschneiden. Sie wurde von Iyeyasu (s.
Japan, S. 165) angelegt, 1598 zur Residenz gemacht und durch ihn
und seine Nachfolger, die Shogune aus dem Haus Tokugawa, zu einer
der umfang- und menschenreichsten Städte der Welt, welche zur
Zeit ihrer größten Blüte auf einem Areal von 75 qkm
gegen 2 Mill. Einw. hatte. Von Jedo aus regierten die Shogune das
Land. Um das Schloß (O-Shiro), welches sich in der Mitte der
Stadt auf niedrigem, künstlichem Hügel erhob, und seine
vielen Nebengebäude und Parkanlagen waren Festungswerke mit
Ringmauern und schweren Thoren sowie drei Systeme Wallgräben
angebracht, an deren Seiten sich die ausgedehnten Yashikis oder
Residenzen des Feudaladels (der Daimios oder Fürsten des
Landes, welche hier mit großem Gefolge jedes zweite Jahr
wohnen mußten) befanden; dann folgte die eigentliche Stadt
mit den Wohnungen der Gewerbtreibenden und Kaufleute. Die
Revolution von 1868, welche dem Shogunat mit seinem komplizierten
Feudalsystem ein Ende machte und die unbeschränkte Macht des
Mikado wiederherstellte, brachte der Stadt große Verluste.
Die Yashikis der Daimios verödeten, häufige Brände
kamen hinzu und zerstörten ganze Stadtteile mit ihren leicht
gebauten, dicht aneinander gereihten Holzhäusern.
Allmählich aber erholte sich T. wieder, neues Leben floß
ihr durch den Verkehr mit dem Ausland und als Regierungssitz zu, so
daß die Stadt Ende 1887 wieder 982,043 Einw. zählte. In
der Nähe des Sumidagawa, welcher den westlichen Stadtteil
durchfließt, liegt der erste Bahnhof. Seit 1872 erreicht man
von hier aus auf dem 30 km langen Schienenweg in einer Stunde den
Hafen Yokohama. Vom Bahnhof aus führt eine weite Straße,
Shimbashi-dori genannt, nordwärts nach dem schönen Park
Uyeno hin über Nihonbashi, die Sonnenaufgangsbrücke, von
der aus man die Entfernungen berechnet und den riesigen Kegel des
Fujiyama schaut. Shimbashidori, die wichtigste und schönste
Verkehrsstraße von T., wurde nebst vielen Seitenstraßen
in fremdem Stil mit zweistöckigen, feuersichern
Backsteinhäusern angelegt, nachdem eine große
Feuersbrunst den Stadtteil zerstört hatte. Am 5. Mai 1873
brannte auch das O-Shiro nieder. Der Mikado residierte seitdem im
Yashiki eines ehemaligen Daimio, so daß seine Wohnung viel
bescheidener war als die neuen großen Backsteinbauten der
englischen und deutschen Gesandtschaft. Inzwischen ist seine neue
Residenz an Stelle des alten Schlosses vollendet u. im Januar 1889
von ihm bezogen worden. In T. wohnen die fremden Gesandten u.
Konsuln, wo sie wollen, Ausländer in japanischem Dienst in den
ihnen überwiesenen ehemaligen Yashikis oder neuen Holzbauten
auf Yashikigrund, fremde Kaufleute aber und Gewerbtreibende nur in
einem bestimmten Stadtteil. Die Stadt hat Gasbeleuchtung und manche
andre europäischen Städten nachgebildete Einrichtung.
Für den Straßenverkehr ist an Stelle der Sänfte
seit 20 Jahren hier wie in ganz Japan die Shinrikisha getreten, ein
Karren, den ein oder zwei sich in, resp. vor die Schere spannende
Kulis ziehen, während der Passagier über der Achse auf
einem Rohrsitz mit kutschenartigen Rück- und Seitenlehnen
sitzt. In ihren ein- oder zweistöckigen, meist nur 7 m hohen
Holzhäusern, deren Gemächer möbellos mit
Binsenmatten bedeckt und durch leichte Schiebewände getrennt
sind, gleichen sich alle japanischen Städte. Das Licht dringt
von der Straße oder dem Hof her matt ein durch die
Papierscheiben, womit man die Quadrate der Schieberrahmen
überzogen hat. In diesen japanischen Häusern ist die
Petroleumlampe eingeführt, während für die
Bekleidung und
[ Situationsplan von Tokio.]
741
Tokkieren - Toledo.
Ausstattung des noch nicht ganz europäisierten Japaners von
fremden Artikeln zuerst Filzhut und Regenschirm Eingang fanden.
Seit der neuen politischen Einteilung Japans 1871 bildet die Stadt
mit ihrer nächsten Umgebung ein besonderes Territorium, das
Tokiotu, mit ca. 1½ Mill. Einw.
Tokkieren, s. Tockieren.
Toko, Pfefferfresser, s. Tukan.
Tököly (Tökely), Emmerich, Graf von,
ungar. Magnat, geb. 1656 auf dem Schloß Käsmark im
Zipser Komitat, Sohn des protestantischen Grafen Stephan von T.,
welcher, der Beteiligung an der Verschwörung der ungarischen
Mißvergnügten gegen den Kaiser Leopold I. beschuldigt,
1671 seiner Güter für verlustig erklärt, in seinem
Schloß Likawa belagert ward und während der Belagerung
starb. Emmerich T. floh nach Siebenbürgen, erhielt vom
Großfürsten Apafi den Oberbefehl über ein den
aufständischen Ungarn zu Hilfe gesandtes Truppenkorps, drang
bis Österreich und Schlesien vor, ließ sich von der
Pforte gegen das Versprechen eines jährlichen Tributs zum
Fürsten von Ungarn ernennen, auf dem Landtag zu Kaschau 1682
von den Ständen als König huldigen und zog 1683 mit dem
Großwesir Kara Mustafa vor Wien, ward von diesem 4. Okt. 1685
auf verräterische Weise zu Großwardein verhaftet und in
Ketten zu dem Sultan nach Adrianopel gebracht, jedoch Anfang 1686
in Freiheit gesetzt und für seine weitern Operationen mit 9000
Mann türkischer Truppen unterstützt. Aber in Ungarn
selbst fand er bei seiner Rückkehr nur wenig Anhänger, so
daß er 1688 bei Großwardein von dem
österreichischen General Heusler geschlagen wurde. Hierauf vom
Sultan zum Großfürsten von Siebenbürgen erhoben,
drang er mit 16,000 Mann hier ein und schlug Heusler im September
1689 bei Zernest, mußte sich aber vor dem Markgrafen von
Baden in die Walachei zurückziehen. Er wohnte auch später
allen Kämpfen der Pforte gegen Österreich bei und
übte bedeutenden Einfluß auf den Sultan aus. Nach dem
Abschluß des Friedens on Karlowitz (26. Jan. 1699) lebte er,
von der Amnestie ausgeschlossen, aber vom Sultan mit einer Pension
und Gütern reich ausgestattet und zum Fürsten von Widdin
ernannt, meist zu Konstantinopel. Er starb 13. Sept. 1705 auf
seinem Landgut bei Ismid.
Tola, 1) Gold- und Silbergewicht in Ostindien,
ursprünglich das Gewicht der Bombay-, resp. Siccarupie von
179-179½ englischen Troygrän = 11,599-1l,642 g; wird in
Bombay in 100 Goonze à 6 Chows, in Kalkutta in 12 Mascha
à 8 Röttihs (Ruttees) à 4 Dhan eingeteilt;
2) Normal- oder neues Bazargewicht in Kalkutta, à 16 Anna
= 180 englischen Troygrän = 11,664 g. Seine Oberstufen Sihr
und Maund bilden das Handelsgewicht.
Tolam, Gewicht, s. Maund.
Toland, John, engl. Freidenker, geboren um 1670 zu
Redcastle in Irland von katholischen Eltern, trat 1687 zu den
Presbyterianern über, studierte in Glasgow, Edinburg und
Leiden Theorie und Philosophie, veröffentlichte 1696 in London
eine Schrift: "Christianity not mysterious", in welcher er im
Anschluß an Locke darzuthun suchte, daß das Christentum
vernunftmäßig sei, und welche alsbald von Henkers Hand
verbrannt wurde. Darauf politischen Studien zugewandt,
veröffentlichte er 1699 die Gesamtausgabe der Werke Miltons
mit Biographie des Dichters, welche ihm abermals Angriffe zuzog,
gegen die er sich in der Schrift "Amyntor" verteidigte. 1701
bereiste er Deutschland, fand hier an der Kurfürstin Sophie
von Hannover und der philosophischen Königin Sophie Charlotte
von Preußen Gönnerinnen und richtete dann an letztere
seine "Letters to Serena" (1704), in denen er den Glauben an einen
außerweltlichen Gott und eine individuelle Unsterblichkeit
aufgibt. Er bereiste 1709 abermals Deutschland und Holland und
starb 1722 in Putney bei London. Von seinen Schriften sind noch zu
ermähnen: "Adeisidaemon" (1709); "Nazarenus, or jewish,
gentile and mohametan christianity" (1718); "Pantheisticon" (1720).
Vgl. Berthold, John T. und der Monismus der Gegenwart (Heidelb.
1876).
Toldy (ursprünglich Schedel), Franz, bedeutendster
ungar. Literarhistoriker, geb. 10. Aug. 1805 zu Ofen, studierte
Medizin, praktizierte dann einige Zeit als Bezirksarzt in Pest,
wandte sich aber bald ganz der Litteratur zu, in der er schon
früh (namentlich mit Übersetzungen) zu wirken begonnen
hatte. Von einer größern Reise, die ihn nach Berlin,
London und Paris führte, 1830 zurückgekehrt, wurde er
Mitglied der ungarischen Akademie und 1835 Sekretär derselben,
welches Amt er bis 1861 führte. Von 1833 bis 1844 lehrte er
als außerordentlicher Professor der Diätetik an der
Pester Universität; 1836 gründete er die
Kisfaludy-Gesellschaft; 1861 erhielt er die Professur der
ungarischen Litteratur an der Hochschule zu Pest. Er starb daselbst
10. Dez. 1875. Seine Hauptwerke sind: "Handbuch der ungarischen
Poesie" (Pest 1828, 2 Bde.), durch welches die ungarische Dichtung
zum erstenmal in umfassenderer Weise in die deutsche Litteratur
eingeführt wurde; dann in ungarischer Sprache die unvollendete
"Geschichte der ungarischen Nationallitteratur" (das. 1851-53, 3
Bde.) und "Geschichte der ungarischen Poesie" (das. 1854, 3. Aufl.
1875; deutsch von Steinacker, 1863). - Sein Sohn Stephan, Publizist
und dramatischer Dichter, geb. 4. Juni 1844 zu Pest, studierte
daselbst Jurisprudenz, wirkte einige Zeit als Ministerialbeamter
und schrieb politische Broschüren, einen Roman und mehrere
Bände Novellen in französischer Richtung, auch Dramen,
von denen die Lustspiele: "A jó hajafiak" ("Die guten
Patrioten") und "Az uj emberek" ("Neue Menschen") mit Erfolg
aufgeführt wurden. Seit 1875 Redakteur des Journals "Nemzeti
Hirlap", starb er 6. Dez. 1879 in Budapest.
Toledo, 1) span. Provinz in der Landschaft Neukastilien,
grenzt im N. an die Provinzen Avila und Madrid, im O. an Cuenca, im
S. an Ciudad-Real, im W. an Caceres und hat einen Flächenraum
von 15,257 qkm (277,1 QM.). Die Provinz wird im S. von den Montes
de T., im N. von der Sierra de San Vicente, einer Parallelkette der
Sierra de Gredos, durchzogen, im übrigen ist sie eben oder
hügelig und gehört zum Becken des Tajo, welcher die
Provinz quer durchschneidet und hier den Guadarrama und Alberche
von N., dann kleinere Zuflüsse von S. her aufnimmt. Der
Südosten der Provinz gehört mit dem Giguela zum
Flußgebiet des Guadiana. Die Bevölkerung betrug 1878:
335,038 Seelen (22 pro Quadratkilometer) und wurde 1886 auf 358,000
Seelen geschätzt. Der Boden ist sehr fruchtbar, aber wenig
angebaut und liefert hauptsächlich Getreide, Öl und Wein.
Die Viehzucht ist ansehnlich, Schafwolle und Wachs sind wichtige
Produkte. Auch Salinen, Eisengruben und Mineralquellen sind
vorhanden. Die Industrie ist von geringer Bedeutung, sie liefert
Leder, Töpferwaren u. a. Auch der Handel ist wenig entwickelt.
Die von Madrid nach S. und W. auslaufenden Eisenbahnen durchziehen
die Provinz. Dieselbe umfaßt zwölf Gerichtsbezirke
(darunter Madridejos, Ocana, Talavera de la Reina).
Tolentino - Tollens.
742
Die gleichnamige Hauptstadt liegt malerisch auf einem zum Tajo
schroff abfallenden Berg, von doppelten, getürmten Mauern
umgeben, ist durch eine Zweigbahn nach Castillejo mit der Bahn
Madrid-Alicante verbunden und gewährt mit ihren 26 Kirchen,
zahlreichen Klostergebäuden, ihren alten Thoren, Brücken
und einer Unzahl von Türmen einen imposanten Anblick. Das
Innere bildet ein Gewirr krummer und ungleich hoch liegender, aber
reinlicher Gassen. Das ansehnlichste Gebäude ist die
Kathedrale, eine der großartigsten gotischen Kirchen, 113 m
lang, 57 m breit, mit einem großen, 90 m hohen Turm,
fünf von 88 Pfeilern getragenen Schiffen, 40 Seitenkapellen,
prachtvollen Grabmälern, zahlreichen Kostbarkeiten und
Kunstschätzen. Die Bibliothek des Domkapitels besitzt viele
seltene Handschriften. Der im höchsten Teil der Stadt gelegene
Alkazar ist 1887 abgebrannt. Bemerkenswert sind noch: die
schöne gotische Kirche San Juan de los Reyes (von 1477) und
das anstoßende ehemalige Franziskanerkloster mit herrlichem
Kreuzgang, der ehemalige Inquisitionspalast (jetzt
Regierungsgebäude), der Palast der Vargas, das Stadthaus, das
Hospital mit dem Grabmal seines Gründers, Kardinals Tavera, 2
Thore von arabischer Bauart, 2 hoch gespannte Brücken. Im
Mittelalter hatte T. gegen 2000,000, jetzt hat die tote, verlassene
Stadt nur noch (1886) 19,775 Einw. Nahe am Tajo liegt die
große königliche Waffenfabrik, in welcher die
berühmten Toledoklingen, jetzt meist die Waffen für die
Armee, verfertigt werden. Außerdem liefert T. Seiden-, Gold-
und Silberstoffe (Kirchenparamente) und führt berühmten
Marzipan aus. T. hat eine Zentralschießschule und ist Sitz
des Gouverneurs und eines Erzbischofs, der den Titel eines Primas
von Spanien führt. Hier spricht man das reinste Spanisch
(Castellano). Die 1498 gestiftete Universität ist eingegangen.
T. hieß zur Römerzeit Toletum, war ein befestigter Ort
der Karpetaner im tarrakonensischen Spanien, wurde später
römische Kolonie, war schon frühzeitig durch seine
Stahlwarenfabrikation berühmt und zu der Zeit Cäsars ein
starker Waffenplatz. Unter den Westgoten war es eine Zeitlang
(576-711) Residenz der Könige und wurde bedeutend
vergrößert. Unter der Herrschaft der Mauren (seit 714)
bildete es längere Zeit ein eignes Reich. 1085 eroberte Alfons
VI. von Kastilien die Stadt und das Reich und machte erstere zu
seiner Residenz. In der Folge war T. der Hauptsitz der Inquisition.
Vgl. Gamero, Historia de la ciudad de T. (Tol. 1863).
2) Stadt im nordamerikan. Staat Ohio, am Maumee, 7 km oberhalb
dessen Mündung in den Eriesee, hat stattliche Kirchen und
Schulen, ein Irrenhaus, eine Besserungsanstalt, ein
städtisches Gefängnis, großartige Industrie (Bau
von Dampfmaschinen, Eisenbahnwagen, Maschinen und
landwirtschaftlichen Geräten, Sägemühlen,
Schreinerwerkstätten, Kornmühlen), lebhaften Handel,
namentlich mit Getreide, und (1880) 50,137 Einw.
Tolentino, Stadt in der ital. Provinz Macerata, am
Chienti und am östlichen Abhang des Apennin, von
altertümlicher Bauart, hat eine Brücke von 1268, ein
Seminar, eine technische Schule, Industrie in Leder,
Eisenguß- und Wollwirkwaren und (188l) 4114 Einw. - T. ist
das alte Tolentinum im Picenterland und merkwürdig durch den
hier 19. Febr. 1797 zwischen Frankreich und Papst Pius VI.
abgeschlossenen Frieden, in welchem letzterer Avignon und
Venaissin, Bologna, Ferrara und die Romagna an ersteres abtrat,
sowie durch den am 2. und 3. Mai 1815 erfochtenen Sieg der
Österreicher unter Bianchi über die Neapolitaner unter
Murat, infolge dessen letzterer den Thron von Neapel verlor.
Toleránz (lat.), Duldung, insbesondere
religiöse, welche den von der Staatskirche abweichenden
Glaubensgenossen ungehinderte Religionsübung sichert, wie sie
z. B. innerhalb des Christentums gegen die Wiedertäufer,
Unitarier, Deutschkatholiken, Freien Gemeinden, aber auch gegen die
Bekenner andrer Religionen, in den christlichen Ländern
namentlich gegen die Juden, geübt wird. Früher wurden die
staats-, privat- und kirchenrechtlichen Verhältnisse solcher
tolerierten Bekenntnisse in den einzelnen Staaten oft durch
besondere Toleranzedikte (Toleranzpatente) geordnet, wie z. B. in
Preußen in Ansehung der Freien Gemeinden durch das
Toleranzedikt Friedrich Wilhelms IV. vom 30. März 1847. In
Österreich wurde durch das Toleranzeditt Josephs II. von 1781
den Protestanten Religionsfreiheit gewährt. - Im
Münzwesen ist T. s. v. w. Remedium (s. d.).
Tolfa, Flecken in der ital. Provinz Rom, Kreis
Civitavecchia, hat Alaungruben (bei T. und bei dem nahegelegenen
Allumiere), die, im l5. Jahrh. entdeckt, früher noch reichern
Ertrag lieferten, und (1881) 3103 Einw.
Tolima, 1) Staat der südamerikan. Republik
Kolumbien, umfaßt 47,700 qkm (866,3 QM.) mit (1881) 230,891
Einw. Das Land, vom obern Magdalenenstrom durchflossen und von den
beiden Hauptketten der Kordilleren Kolumbiens eingefaßt,
gehört meist dem gemäßigten Klima an; das Thal ist
reich an Produkten (Tabak, Kakao, Zuckerrohr, Mais), die Viehzucht
bedeutend, der Bergbau aber trotz großen Reichtums an Gold,
Silber, Kupfer etc. vernachlässigt. Hauptstadt ist Neiva.
2) Pik von T., vulkanischer Gipfel der mittlern Kordillere von
Kolumbien, im NW. von Ibagué, 5584 m hoch, höchster
Gipfel der Andes nördlich vom Äquator.
Toli-Monastir, türk. Stadt, s. Monastir 1).
Tolkemit, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Danzig,
Landkreis Elbing, am Frischen Haff, hat eine kath. Kirche, einen
Hafen, Störfischerei, Kaviarbereitung, starken Drosselfang,
Böttcherei, Töpferei, Schiffahrt und (1885) 2847
Einw.
Toll, Karl, Graf von, russ. General, geb. 1778 zu Reval,
trat 1796 in die russische Armee ein, machte 1799 Suworows Feldzug
mit, kam 1805 in den Generalstab, focht bei Austerlitz, dann gegen
die Türken, war 1812 Generalquartiermeister Kutusows, 1813
Barclay de Tollys, ward auf dem Schlachtfeld von Leipzig
Generalleutnant, 1823 Generaladjutant des Kaisers und Chef des
Generalstabs der ersten Armee und 1825 General der Infanterie. An
dem Feldzug von 1829 gegen die Türken nahm er als Chef des
Generalstabs den ruhmvollsten Anteil. Durch den Sieg 11. Juni bei
Kulewtscha erwarb er sich die Grafenwürde. Im polnischen
Feldzug von 1831 stand er abermals als Stabschef dem General
Diebitsch zur Seite, übernahm nach dessen Tode das
interimistische Kommando und leitete beim Sturm auf Warschau 7.
Okt. nach Paskewitsch' Verwundung die Operationen des letzten
entscheidenden Schlachttags. Hierauf ward er in den russischen
Reichsrat berufen und 1833 zum Oberdirigenten der Wasser- und
Wegekommunikationen und der öffentlichen Bauten ernannt. Er
starb 5. Mai 1842 in Petersburg. Vgl. Bernhardi,
Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Grafen von T. (2. Aufl.,
Leipz. 1866, 4 Bde.).
Tollens, Henrik Caroluszoon, niederländ. Dichter,
geb. 24. Sept. 1780 zu Rotterdam, ward
743
Tollense - Tollwut.
Kaufmann, widmete sich daneben der Poesie, zog sich 1846 auf
sein Landgut zu Rijswijk zurück, wo er 21. Okt. 1856 starb.
Seine Erstlingsarbeiten waren mehrere Komödien und ein
bürgerliches Trauerspiel: "Konstanten", welche er jedoch
später nicht in seine Werke aufnehmen wollte. Darauf
veröffentlichte er: "Idyllen en minnezangen" (1801-1805);
"Gedichten" (1808-15, 3 Bde.); "Tafereel van de overwintering der
Nederlanders op Nova Zembla" (1816; deutsch, Amsterd. 1871);
"Romanzen, balladen en legenden" (1818); "Nieuwe gedichten" (1821)
und "Laatste gedichten" (1848-53). Eine Gesamtausgabe seiner Werke
erschien Leeuwarden 1876, 12. Bde. T. war eine Zeitlang der
beliebteste holländ. Dichter, vorzüglich des
Mittelstandes; 1860 ward ihm zu Rotterdam ein Standbild
errichtet.
Tollense, Nebenfluß der Peene, entspringt oberhalb
Prillwitz in Mecklenburg-Strelitz, durchfließt den
Tollensesee (11 km lang, 2 km breit), tritt nach Pommern über
und mündet bei Demmin; sie ist auf 45 km für kleine
Fahrzeuge schiffbar.
Tollgerste, s. v. w. Lolium temulentum.
Tollheit, s. v. w. Geisteskrankheit, besonders eine mit
Aufregungszuständen verbundene Form, daher Tollhaus, s. v. w.
Irrenhaus; im engern Sinn ist T. s. v. w. Tollwut.
Tollkerbel, f. Conium.
Tollkirsche, s. Atropa.
Tollkrankheit (Darmgicht), Bienenkrankheit, bei der junge
Bienen, welche eben erst die Zelle verlassen haben, von den Waben
auf das Bodenbrett des Stockes herabfallen, sich zum Flugloch
herauswälzen und dann auf der Erde wie rasend umherlaufen, bis
sie unter krampfhaften Zuckungen sterben. Verursacht wird die T.
durch schädliche Bestandteile der genossenen Nahrung. Bemerkt
man der T. ähnliche Erscheinungen an den Flugbienen, so liegt
offenbar Vergiftung durch gewissenlose Menschen vor; aus Vorsicht
esse man nicht Honig aus Stöcken, an denen man T. wahrnimmt.
Durch Füttern gesunden Honigs mildert und beseitigt man das
Übel. Der T. nicht unähnlich ist die Flugunfähigkeit
(Maikrankheit), bei welcher die Trachtbienen aus dem Flugloch
herauskommen, auf die Erde niederstürzen, wo sie wie irrsinnig
umherlaufen, bis sie ermattet liegen bleiben und verenden. Ursache
dieser Krankheit ist ein Schimmelpilz (Mucor Mucedo) in den
Eingeweiden der Bienen. Füttert man gesunden Honig, dem man
einige Tropfen Saticylspiritus beimischte, so beseitigt man die
Krankheit nach und nach.
Tollkraut, s. Datura und Alropa.
Tollkühnheit unterscheidet sich von Feigheit (s.
d.), welche die drohende Gefahr überschätzt, von
Tapferkeit (s. d.), welche dieselbe richtig, und von Verwegenheit
(s. d.), welche sie unterschätzt, dadurch, daß sie jene
gar nicht schätzt, sondern ihr blind entgegengeht.
Tollrübe, s. Bryonia.
Tollwurm (Lyssa), die vom Zungenbeinkörper in die
Zunge des Hundes sich fortsetzende Bandmasse, welche früher,
besonders von Jägern, als Ursache der Tollkrankheit angesehen
und deshalb jungen Hunden häufig ausgeschnitten wurde.
Tollwut (Wutkrankheit, Hundswut, Wasserscheu, Lyssa,
Rabies canina), eine Krankheit, welche vermutlich ursprünglich
bei Hunden, vielleicht auch bei Wölfen und Füchsen
entsteht, gewöhnlich aber infolge von Ansteckung zum Ausbruch
gelangt. Sie überträgt sich auf Menschen, alle
Säugetiere und Vögel, wird indes fast
ausschließlich durch Hunde, bisweilen auch durch Katzen und
zwar durch Biß verbreitet, während eine Ansteckung durch
andre Tiere weniger zu fürchten ist, da diese in der Krankheit
nicht beißen. Die T. der Hunde kommt in zwei Formen, als
rasende und stille Wut, vor; nicht selten geht die erste in die
zweite über, meist aber besteht die eine Form des Leidens
während der ganzen Dauer desselben. Beide Formen sind
gleichmäßig ansteckend, und die eine kann die andre
hervorrufen. Die T. beginnt mit verändertem Benehmen der
Hunde; die Tiere werden mürrisch, hastig, weniger folgsam und
verkriechen sich oft. Der Appetit ist vermindert, und bald wird die
Aufnahme von Nahrungsmitteln ganz verschmäht. Dagegen zeigt
sich gewöhnlich eine Neigung, ungenießbare
Gegenstände zu benagen und selbst herabzuschlucken. Auch
plätschern die wutkranken Hunde zuweilen mit der Zunge in
kaltem Wasser. Die Ansicht, daß die Hunde in der T. Scheu vor
dem Wasser hätten, ist unrichtig. Die Neigung, zu
beißen, ist zunächst am meisten gegen andre Hunde und
gegen Katzen gerichtet. Nicht selten werden aber auch
größere Haustiere und Menschen schon in der ersten Zeit
der Krankheit angegriffen. Im weitern Verlauf der T. streben die
Hunde, sich aus ihrem etwanigen Gewahrsam zu befreien und von der
Kette loszumachen. Sie laufen ohne erkennbare Veranlassung fort,
schweifen nicht selten in entfernte Gegenden, kehren aber zuweilen
noch an demselben oder am folgenden Tag wieder zurück. Sie
verkriechen sich dann an abgelegenen Orten, um nach kurzer Ruhe
abermals zu entlaufen. Gegen ihnen bekannte Personen benehmen sie
sich oft freundlich, während sie fremde Personen und Tiere
anfallen. Sie beißen gewöhnlich Menschen und Tiere nur
ein- oder einigemal, worauf sie weiterlaufen. Zuweilen ist aber die
Beißwut so groß, daß der Hund auf alles, was ihm
in den Weg kommt, losfährt und selbst in leblose
Gegenstände sich mit den Zähnen einige Zeit lang
festbeißt. Die meisten wutkranken Hunde sind schwer
abzuwehren, weil sie sich gegen die gewöhnlichen Abwehrmittel
unempfindlich zeigen. Die Stimme ändert sich zu einem
Mittelding zwischen Bellen und Heulen. Es tritt Schwäche und
Lähmung des Unterkiefers und des Hinterteils sowie
allmählich zunehmende Abmagerung des Körpers ein. Aus dem
offen stehenden Maul fließt zäher Schleim. Die Hunde
ziehen sich nach dunkeln Orten zurück oder verkriechen sich in
ihren Behältern. Die Lähmung des Körpers nimmt zu,
u. der Tod erfolgt in der Regel nach 5 -7 Tagen. Über elf Tage
sah man bis jetzt keinen Hund bei T. leben bleiben. Bei der
rasenden Wut tritt unter den vorstehenden Erscheinungen besonders
hervor: die große Unruhe, die Neigung zum öftern
Entlaufen, die große Beißsucht, das häufige
eigentümliche Bellen und die kürzere Dauer der Krankheit.
Bei der stillem Wut sind sehr bemerkenswert: die Lähmung
(Herabhängen) des Unterkiefers, Schwäche und Lähmung
des Hinterteils, mehr ruhiges Verhalten, geringere Beißsucht,
das Verkriechen an dunkeln Orten und im allgemeinen eine
längere Krankheitsdauer. Die Meinung, daß tolle Hunde
immer geradeaus laufen, den Schwanz hängen lassen oder ihn
zwischen die Beine ziehen, und daß bei ihnen Speichel aus dem
Maul abfließt, ist irrig. Erst später, wenn die
Kreuzlähmung sich einstellt, hängt der Schwanz schlaff
herab, das Maul aber ist bei tollen Hunden mehr trocken als feucht.
Das eigentümlichste und wichtigste Zeichen der T. ist die
Veränderung der Stimme und der Art des Bellens. Die Töne
sind bald höher, bald tiefer als im gesunden Zustand, immer
etwas rauh und heiser, und der erste Anschlag des Bellens geht
allemal in ein kurzes Geheul über.
744
Tollwut.
Die Ursachen der primären Erzeugung der T. sind nicht
bekannt; ist eine solche überhaupt möglich, so erfolgt
sie jedenfalls sehr selten, sekundär entsteht die Krankheit
durch Einimpfung des Speichels, an welchen das Kontagium
hauptsächlich gebunden ist, in die Bißwunde. Bei hoher
Entwickelung der Krankheit findet sich das Kontagium aber auch im
Blut, Harn und andern Säften des Hundes. Die Verdauungsorgane
und die unverletzte Haut scheinen keine besondere
Empfänglichkeit für dasselbe zu besitzen. Das Kontagium
ist fix, hängt sich auch an Instrumente, Kleidungsstücke
etc. an und behält einige Zeit seine Wirksamkeit. Bei
Wiederkäuern und Schweinen entsteht T. immer nur durch den
Biß eines tollen Hundes, Fuchses oder andern
fleischfressenden Tiers, das Kontagium kann aber auch von
Pflanzenfressern auf andre Tiere und auf den Menschen
übertragen werden. Der Ausbruch der Krankheit erfolgt nach dem
Biß bei Hunden zwischen der 4. und 6. Woche, selten nach 3-6
Tagen oder nach 8-16 Wochen, ganz ausnahmsweise noch später.
Nicht jeder Biß eines tollen Hundes erzeugt T., besonders
dann nicht, wenn die Zähne durch den Pelz des gebissenen Tiers
oder durch dicke Kleider des Menschen abgewischt, von Speichel
befreit werden. Zuweilen wird auch das Kontagium durch reichlich
fließendes Blut fortgespült, oder es fehlt bei dem
betreffenden Individuum die Disposition. Die Behandlung wutkranker
Hunde und Katzen ist wegen der damit verbundenen Gefahr in den
meisten Ländern gesetzlich verboten, übrigens auch
erfolglos. Es kommt hauptsächlich darauf an, die Krankheit und
ihre Folgen zu verhüten. Dies geschieht am wirksamsten durch
möglichst hohe Hundesteuer. Nach dem deutschen
Viehseuchengesetz ist von jedem Fall von T. der Polizei sofort
Anzeige zu machen. Hunde, welche der T. verdächtig sind, sind
sofort zu töten oder bis zu polizeilichem Einschreiten
abgesondert in einem sichern Behältnis einzusperren.
Letzteres, soweit es ohne Gefahr geschehen kann, besonders dann,
wenn der verdächtige oder an der T. erkrankte Hund einen
Menschen oder ein Tier gebissen hat. Ist die T. festgestellt, so
ist der Hund sofort zu töten, ebenso alle Hunde und Katzen,
welche von demselben gebissen worden sind. Ist ein erkrankter oder
verdächtiger Hund frei umhergelaufen, so ist die Festlegung
aller Hunde des gefährdeten Bezirks für drei Monate
anzuordnen. Dasselbe gilt für Katzen. Kadaver toller Hunde
sind vorsichtig an abgelegenem Ort mindestens 2 m tief zu
vergraben. Die Berührung mit der bloßen oder gar mit
verletzter Hand ist sorgfältig zu vermeiden. Alles, was mit
dem tollen Hund in Berührung gekommen war oder von ihm
besudelt wurde, ist zu verbrennen oder auszuglühen.
Größere Massen von Geifer, Blut etc.
übergießt man mit starker Seifensiederlauge,
Chlorkalklösung oder Schwefelsäure. Die Hundehütte
ist zu verbrennen, der Stall gründlich zu reinigen und zu
desinfizieren, und niemals darf vor Ablauf von zwölf Wochen
ein neuer Hund in denselben gebracht werden. Pferde, Rinder,
Schafe, Ziegen, Schweine, Vögel, die von einem wutkranken Tier
gebissen wurden, sind sobald wie möglich tierärztlicher
Behandlung und zugleich einer Beaufsichtigung zu unterwerfen. Kommt
die Krankheit zum Ausbruch, so ist der Polizei Anzeige zu
erstatten, welche das Tier töten läßt. Die Kadaver
sind wie die der Hunde zu behandeln, sie sind ohne Abhäutung
tief zu vergraben oder durch Chemikalien, resp. hohe Hitzegrade
unschädlich zu machen. Ein Ersatz des Wertes der auf
polizeiliche Anordnung getöteten Tiere findet nicht statt. Die
Gesetzgeber haben sich gegenüber dieser Frage von dem
Gesichtspunkt leiten lassen, daß die T. nach ihrem Ausbruch
nur wenige Tage besteht, stets zum Tod führt und deshalb nicht
wie Rotz und Lungenseuche längere Zeit verheimlicht werden
kann. In Preußen erkrankten und fielen an T. oder wurden
deshalb getötet 1884-85: 352, 1885-86: 326, 1886-87: 386
Hunde. Die steigende Zahl der getöteten Hunde, welche mit
tollkranken in nähere Beziehung gekommen oder von solchen
gebissen worden waren (759, 822, 1247), zeigt, daß diese
Maßregel eine ihrer Wichtigkeit entsprechende Beachtung
gesunden hat. Von den tollwutkranken ortsangehörigen Hunden
entfällt ein so großer und beständig steigender
Prozentsatz (bis 86,79 Proz.) auf die östlichen Provinzen, und
von diesen ist wieder ein so großer Teil von herrenlos
umherschweifenden tollwutkranken Hunden gebissen worden, daß
man wohl annehmen darf, die steigende Verbreitung der T. in den
östlichen preußischen Provinzen sei auf stets erneute
Einschleppung aus Rußland zurückzuführen.
Jedenfalls aber ist der Verbreitung der Seuche in diesen Provinzen
förderlich, daß hier häufiger als anderwärts
viele nutzlose, schlecht gepflegte und wenig beaufsichtigte Hunde
gehalten werden. Ferner sind von 1884 bis 1887 in Preußen an
T. erkrankt und gefallen, bez. getötet worden: 23 Pferde, 348
Rinder, 80 Schafe und 52 Schweine.
Beim Menschen entsteht die T. ebenfalls nur nach dem Biß
eines wutkranken Fleischfressers (Hund, Wolf, Fuchs, Katze) und
zwar nach 2-6 Wochen, auch wohl nach einigen Monaten, so daß
die Wunde längst geheilt sein kann, wenn die Krankheit
ausbricht. Im ersten Stadium derselben sind die Kranken sehr
unruhig, ängstlich und matt, sie verlieren den Appetit, klagen
über Übelkeit und Gliederschmerzen, und es stellt sich
leichtes Fieber mit Durst und Verstopfung ein. Eitert die Wunde
noch, so nimmt sie ein häßliches Ansehen an; war sie
bereits geheilt, so wird sie wieder schmerzhaft, und die
Schmerzenziehen sich nach dem Stamm hin. Bald entsteht Steifigkeit
in Hals und Nacken, namentlich beim Schlingen; der Kopf wird
eingenommen, das Gesicht blaß, der Blick matt, der Puls voll
und beschleunigt. Allmählich oder plötzlich entwickelt
sich nun das zweite Stadium mit immer heftigern und häufigern
Anfällen mit krampfhaften Bewegungen, großer Angst,
Verzweiflung, Wut und meist nur geringer Störung des
Bewußtseins. Die Kranken haben das Bedürfnis zu
beißen, und manche laufen unruhig hin und her. Sie haben
heftigen Durst, aber Widerwillen gegen jedes Getränk. Mitunter
tritt schon beim Anblick des Getränks oder doch nach
Genuß von wenig Wasser das Gefühl heftiger
Zusammenschnürung im Hals oder ein Wutanfall ein, während
feste Speisen noch geschlungen werden können. Im dritten
Stadium, etwa 1-2 Tage später, tritt Lähmung ein, der
Speichel läuft aus dem Mund oder in den Schlund und erregt
Erstickungsnot, der Atem wird schnell und röchelnd, der Puls
klein, die Stimme rauh und heiser, und der Tod erfolgt in einem
Anfall oder ruhig nach einem solchen. Dies Stadium dauert nur
wenige Stunden, und so verläuft die ganze Krankheit in 3
Tagen, oft in 24 Stunden. Die Sektion ergibt nichts Besonderes, nur
die Schwellung der Milz und der lymphatischen Gebilde ist
bemerkenswert. Die Prognose der ausgebrochenen T. ist ganz
ungünstig, dagegen sind überhaupt nur wenige Bisse eines
tollen Hundes ansteckend, die Mehrzahl der Gebissenen erkrankt
nicht. In Preußen starben 1884-87 an T.
745
Tolmezzo - Tolstoi.
sechs Personen. Die Behandlung muß mit energischem
Ausblutenlassen der Wunde durch tiefe Einschnitte und aufgesetzte
Schröpfköpfe, Ätzungen der Wunde mit Alkalien und
rauchender Salpetersäure beginnen. Kleinere, vielfach
zerfleischte Glieder sind zu amputieren. Außerdem ist eine
umsichtige, beruhigende psychische Behandlung unendlich wichtiger
als alle Arzneien. In der Diät ändere man wenig und lasse
nur die bei jeder Wunde schädlichen Dinge vermeiden. Gegen die
Krankheit selbst sind allerlei Mittel empfohlen worden, die sich
aber als nutzlos erwiesen haben. Man beschränkt sich daher auf
Morphiumeinspritzungen und Chloroformeinatmungen, sucht bei
Wutanfällen zu verhindern, daß der Kranke sich oder
andern schaden kann, und wendet dabei möglichst geringen Zwang
an. Alles, was den Kranken erregen könnte, namentlich auch das
Aufdringen von Flüssigkeiten, ist zu vermeiden. Als Ersatz des
Getränks sind nasse Brotkrume, Apfelsinenscheiben,
Eisstückchen, Klystiere zu empfehlen, doch nur dann, wenn sie
keine Krämpfe erregen. In neuerer Zeit hat Pasteur auf
theoretische Annahmen hin ein Impfverfahren ersonnen, welches die
Empfänglichkeit für das unbekannte Wutgift selbst bei
schon gebissenen Personen beseitigen soll und bei Tieren, auch in
mehreren Fällen bei Menschen erprobt wurde. Er arbeitet mit
dem getrockneten Rückenmark tollwutkranker Kaninchen und
benutzt dies zu präventiven Impfungen. Dabei erreichte er,
daß ein geschütztes Tier ohne Schaden mit solchem
frischen Rückenmark geimpft werden konnte, welches bei
ungeschützten Tieren in sieben Tagen T. erzeugte. Thatsache
ist, daß alle Personen, welche Pasteur geimpft hat, die
Impfung ohne Schaden ertrugen, und daß keine derselben,
obwohl sie von verdächtigen Hunden gebissen worden waren, an
T. erkrankte. Ein Urteil über den wahren Wert dieser Impfungen
läßt sich aber bis jetzt nicht fällen, denn erstens
ist die Methode nicht frei von erheblichen Einwänden, ferner
ist bei mehreren der geimpften Personen sehr zweifelhaft, ob der
Hund, welcher sie biß, wirklich an T. litt, endlich lehrt die
Erfahrung, daß viele Menschen, welche von unzweifelhaft
wutkranken Tieren gebissen wurden, niemals an T. ertranken. Vgl.
Johnen, Die Wutkrankheit (Düren 1874); Zürn, Die
Wutkrankheit der Hunde (Leipz. 1876); Rueff, Die Hundswut (Stuttg.
1876); Fleischer, Die Tollwutkrankheit (Elbing 1887); Reder, Die
Hundswut (in der "Deutschen Chirurgie", Stuttg. 1879); Billings,
Fourteen days with Pasteur (New York 1886).
Tolmezzo, Distriktshauptstadt in der ital. Provinz Udine,
im Gebirge nahe dem Tagliamento, mit Ringmauern, stattlicher
Kirche, altem Schloß und (1881) 1658 Einw.; einer der
regenreichsten Orte Europas (jährlich 2437 mm).
Tolna, ungar. Komitat, am rechten Donauufer, wird
südlich vom Komitat Baranya, westlich von Sümeg,
nördlich von Veszprim und Weißenburg und östlich
von der Donau begrenzt, ist 3643 qkm (66,17 QM.) groß, eben
und sehr fruchtbar, im W. bergig und hügelig, in den
östlichen Teilen dagegen morastig. Das Komitat, welches der
Sárviz (mit dem Sárviz- oder Palatinalkanal) und
seine Nebenslüsse Kapos und Sió durchströmen,
erzeugt viel Getreide, Wein, Obst, Tabak etc. Ausgedehnte Wiesen
und Hutweiden begünstigen die Viehzucht; in der Donau wird
beträchtlicher Hausenfang betrieben. Die Einwohner (1881:
234,643) sind meist Ungarn und katholisch. Sitz des Komitats ist
Szegszárd. Der Markt T., an der Donau, hat ein Kastell, eine
Dampfschiffstation und (1881) 7723 Einw. Vgl. "Beschreibung der
Herrschaft T." (Wien 1885).
Tolosa, 1) Bezirksstadt in der span. Provinz Guipuzcoa,
an der Bahnlinie Madrid-Irun, mit Papier-, Waffen- und
Wollzeugfabriken, Zink- und Bleigruben und (1878) 7488 Einw. -
2) Stadt, s. Toulouse.
Tölpel, Pflanze, s. v. w. Raps.
Tölpel (Sula Briss.), Gattung aus der Ordnung der
Schwimmvögel und der Familie der T. (Sulidae), schlank gebaute
Vögel mit langem, geradem, an den Seiten komprimiertem, sehr
starkem und in eine wenig herabgekrümmte Spitze ausgehendem
Schnabel, sehr langen Flügeln, langem, keilförmigem
Schwanz, niedrigen, stämmigen Füßen, nacktem
Gesicht und nackter Kehle. Der T. (weißer Seerabe,
Bassansgans, Sula bassana Gray), 98 cm lang, 190 cm breit, mit
Ausnahme der braunschwarzen Schwingen erster Ordnung weiß,
auf Oberkopf und Hinterhals gelblich überflogen, mit gelben
Augen, bläulichem Schnabel, grünen Füßen und
schwarzer, nackter Kehlhaut, bewohnt alle nördlichen Meere vom
Wendekreis bis zum 70.° nördl. Br., kommt vereinzelt in
die Nähe Norddeutschlands, Hollands und Frankreichs, ist aber
am häufigsten auf Island, den Färöern, Orkaden und
Hebriden, an der amerikanischen Küste und im nördlichen
Teil des Stillen Ozeans, fliegt vortrefflich, schwimmt wenig, ruht
nachts auf Felsen an der Küste, ist auf dem Land sehr
unbeholfen und fast hilflos. Andern Vögeln gegenüber ist
er zänkisch und bissig. Er erbeutet seine Nahrung, indem er
auf das Wasser herabstürzt und dabei taucht. Die T. sammeln
sich zur Brutzeit auf Inseln in unzähligen Scharen, nisten
dicht nebeneinander und legen nur je ein weißes Ei. Die
Jungen werden gegessen, nach Edinburg auf den Markt gebracht, auch
eingesalzen.
Tolstoi, 1) Peter Andrejewitsch, Graf, hervorragender
Diplomat in der Zeit Peters d. Gr., geb. 1645, hielt sich, um das
Seewesen zu studieren, 1698 in Italien auf, wirkte als Gesandter
längere Zeit in der Türkei, setzte 1717 die Auslieferung
des auf österreichisches Gebiet geflüchteten Zarewitsch
Alexei durch und nahm während der Regierung Katharinas I. die
erste Stelle neben Menschikow ein, dessen Opfer er wurde; 1727
geheimer Umtriebe angeklagt, wurde er in den äußersten
Norden des europäischen Roland verbannt, wo er 1729 starb.
2) Peter Alexandrowitsch, Graf, russ. Feldherr und Diplomat,
geb. 1761, focht unter Suworow gegen die Türken und Polen,
befehligte 1805 das russische Landungskorps in Norddeutschland,
führte 1813 ein Korps in Bennigsens Armee, nahm an der
Belagerung von Dresden teil und erzwang dann Hamburgs
Übergabe. Zum General der Infanterie ernannt, erhielt er nach
Nikolaus' Thronbesteigung die Leitung der Militärkolonien und
1831 den Oberbefehl über das Reserveheer, mit welchem er die
Polen schlug. Er starb 1844 in Moskau als Präsident des
Departements für die Militärangelegenheiten im
Reichsrat.
3) Alexei Konstantinowitsch, Graf, der bedeutendste russ.
Dramatiker der Neuzeit, zugleich ausgezeichneter Lyriker und
Epiker, geb. 24. Aug. 1818 zu St. Petersburg, verbrachte seine
Jugend meist in Kleinrußland, wo ihn die schöne Natur
sowie die eigentümlichen Sitten und die reiche historische
Vergangenheit des Volkes mächtig anregten. Schon als Kind
lernte er, von seinem Oheim A. Perowskij bei seinen Reisen ins
Ausland stets mitgenommen, Welt und Menschen kennen und hatte sich
unter anderm auch des Wohlgefallens Goethes zu erfreuen, der
dem
746
Tolteken - Tolubalsam.
phantasievollen Knaben eine große Zukunft prophezeite.
Nach Beendigung der häuslichen Erziehung studierte er in
Moskau und übernahm nach Vollendung seiner Studien einen
kleinen Posten bei einer russischen Gesandtschaft in Deutschland.
Die diplomatische Karriere sagte ihm jedoch nicht zu; schon nach
kurzer Zeit jenen Posten aufgebend, begab er sich auf Reisen nach
Deutschland, Frankreich und Italien und begann nach seiner
Rückkehr seine litterarische Thätigkeit. Seine ersten
Versuche bestanden in lyrischen Gedichten, die durch das in ihnen
ausgesprochene tiefe Gefühl, durch die originellen Wendungen,
die Frische und Schönheit der Naturschilderungen und die
innige Liebe zum Volk große Beachtung fanden. Dem allgemeinen
patriotischen Aufschwung folgend, trat T. während des
Krimkriegs 1853-56 in das aktive Heer, zog sich aber sofort nach
Beendigung des Feldzugs wieder ins Privatleben zurück, um auf
seinen Gütern in der Nähe von St. Petersburg und im
Gouvernement Tschernigow ganz der Dichtung zu leben. Er starb in
der Blüte seiner Kraft 28. Sept. 1875. "T. war ein
großer, originaler Dichter, eine tief humane Natur",
heißt es von ihm in einem von Turgenjew geschriebenen
Nekrolog. Neben vielen lyrischen Gedichten (in Auswahl mit denen
Nekrassows deutsch von Jessen, Petersb. 1881), von denen manche in
glücklichster Weise den Ton des Volksliedes treffen,
müssen in erster Reihe genannt werden die epischen
Erzählungen: "Die Sünderin" (1858) u. "Der Drache"
(1875); der vortreffliche historische Roman "Fürst
Serebrennyi" (deutsch, Berl. 1882), das Drama "Don Juan", eine
interessante, durchaus originale Variation des bekannten Stoffes,
und die dramatische Trilogie: "Der Tod Iwans des Schrecklichen",
"Zar Fjodor Joannowitsch" u. "Zar Boris" (1876). Eine
vollständige Sammlung seiner lyrischen und epischen Dichtungen
erschien 1878.
4) Leo Nikolajewitsch, Graf, russ. Romanschriftsteller, geb. 28.
Aug. (a. St.) 1828 im Gouvernement Tula auf der Besitzung seines
Vaters, Jasnaja Poljana, erhielt daselbst eine gute häusliche
Erziehung und bezog 1843 die Universität Kasan, um dort
orientalische Sprachen zu studieren. Es zog ihn jedoch wieder
zurück in die Einsamkeit und Stille des Dorfs, so daß er
die Universität, die Studien aufgebend, bald verließ;
dort bildete er sich als Autodidakt weiter aus. Bei einer Reise in
den Kaukasus fand er am militärischen Leben Gefallen und trat
plötzlich 1851 in das Heer ein. Man nahm ihn als Offizier in
die 4. Batterie der 20. Artilleriebrigade am Terek auf, wo er bis
zum Beginn des türkischen Kriegs (1853) blieb. Während
desselben befand er sich bei der Donauarmee des Fürsten
Gortschakow, beteiligte sich am Gefecht an der Tschernaja und
erhielt 1855 das Kommando über eine Gebirgsbatterie. Nach
Beendigung des Kriegs nahm er seinen Abschied, hielt sich mehrere
Jahre abwechselnd in St. Petersburg und Moskau auf und zog sich
endlich 1861 wieder auf sein väterliches Gut Jasnaja Poljana
zurück, wo er seitdem in größter
Zurückgezogenheit lebte. Durch seine beiden großartigen
Romane: "Krieg und Frieden" (1865-68, 4 Bde.) und "Anna Karenin"
(1875-78, 3 Bde.), von denen der erstere die Zeit der
Napoleonischen Kriege behandelt, der andre in der russischen
Gegenwart spielt, hat sich T. einen Ehrenplatz in der modernen
russischen Litteratur erworben. Er ist ein vortrefflicher
Erzähler, der die echte epische Ruhe besitzt und die Sprache
meisterhaft handhabt. Außer den genannten Romanen sind als
bedeutsame Werke noch zu verzeichnen (seit Anfang der 50er Jahre):
"Kindheit und Jugend", "Die Kosaken", "Kriegsgeschichten",
"Sebastopoler Erzählungen" (während des Kriegs
geschrieben), "Polikuschka", "Familienglück"; die Skizze "Der
Tod des Iwan Iljitsch" (deutsch in "Tolstois neue
Erzählungen", Leipz. 1887); das dramatische Sittengemälde
"Die Macht der Finsternis" (deutsch von Scholz, Berl. 1887) u. a.
In den letzten Jahren ist T. mehr und mehr einem religiösen
Mystizismus anheimgefallen, wie z. B. sein Aufsehen erregendes Buch
"Worin besteht mein Glaube" (deutsch von Sophie Behr, Leipz. 1885)
zeigt. Gesamtausgaben seiner meist auch ins Deutsche
übersetzten Werke erschienen 1880 und 1887. Sonst ist T. noch
auf dem Gebiet der Volkspädagogik, auch litterarisch,
thätig gewesen.
5) Dimitri Andrejewitsch, Graf, russ. Staatsmann, geb. 1823,
ward beim Marineministerium angestellt, 1865 Oberprokurator des
heiligen Synod und 1866 Minister der Volksaufklärung. Er
zeigte sich als ein fanatischer Vorkämpfer des orthodoxen
Russentums. Die mitunter gewaltsame Bekehrung der
Griechisch-Unierten zur russischen Staatskirche, die Unterordnung
der Katholiken Rußlands unter das römisch-katholische
Kollegium in Petersburg, die Russifizierung der polnischen Schulen
waren sein Werk. Im Unterrichtswesen begünstigte er den
Klassizismus, machte sich aber durch seine Feindschaft gegen die
Volksschule und seine kleinliche Bevormundung der
Universitäten verhaßt und erhielt daher 1880 unter
Loris-Melikow seine Entladung. Auf Betrieb Katkows ernannte ihn
Kaiser Alexander 1882 zum Präsidenten der Akademie der
Wissenschaften und 1883 zum Minister des Innern. Er leitete dies
Amt ganz im Geiste des Zaren streng reaktionär und starb 7.
Mai 1889 in Petersburg. Er schrieb eine Geschichte der Finanzen
Rußlands bis Katharina II. (1847) und "Le catholicisme romain
en Russie" (1863-64); von dem letztern Werk erschien 1877 eine
russische Bearbeitung.
Tolteken (Tolteca), amerikan. Volksstamm, wanderte im 4.
oder 5. Jahrh. von einem nördlichern Land, Huehuetlapallan,
aus in Anahuac ein und gründete hier um die Mitte des 7.
Jahrh. die Stadt Tollan (Tula). Durch Eroberung und friedliche
Übereinkunft erweiterten die T. bald ihr Gebiet und gelangten
auf eine ziemlich hohe Stufe der Kultur, welche im allgemeinen das
Gepräge der spätern aztekischen trägt, und von
welcher großartige Bauten in Anahuac noch Kunde geben. Im 4.
Jahrh. seines Bestehens stand ihr Reich auf der höchsten Stufe
seiner Macht, seitdem sing es infolge unglücklicher Kriege und
ungünstiger Naturereignisse an zu sinken. Unter dem König
Topiltzin (Mitte des 11. Jahrh.) wurde das Land durch Hungersnot
und Krankheit entvölkert, und die übriggebliebenen
siedelten sich teils in benachbarten Landschaften an, teils
verschmolzen sie mit den Chichimeken, die 100 Jahre später
hier einwanderten, bis die Azteken (s. d.) an ihre Stelle traten.
Vgl. Valentini, The Olmecas and the Tultecas (Worcester 1883).
Tolú, Stadt im Staat Bolivar der südamerikan.
Republik Kolumbien, am Golfo de Morrosquillo, mit verfallenen
Festungswerken, Aussuhr von Palmöl, Getreide, Holz, Tolubalsam
und (1870) 3013 Einw.
Tolubalsam (Opobalsam), harzig-balsamische Substanz,
welche von dem in Südamerika heimischen Baum Myroxylon
toluifera H. B. Kth. aus Einschnitten in den Stamm gewonnen wird,
ist srisch terpentinartig, braungelb, durchsichtig, erstarrt mit
der Zeit kristallinisch und gibt dann ein gelbliches Pulver. Er
riecht feiner als Perubalsam, schmeckt
747
Toluca - Tomek.
aromatisch, wenig kratzend, löst sich in Alkohol und
Äther und besteht aus einem Kohlenwasserstoff, Tolen, Harzen,
Benzoesäure und Zimtsäure. Man benutzt den T. als
Räuchermittel und zur Bereitung eines aromatischen Sirups. Der
T. wurde zuerst durch Monardes bekannt, scheint aber noch lange
eine Seltenheit geblieben zu sein und findet sich erst im 17.
Jahrh. in deutschen Apothekertaxen.
Tolúca (Toloccan), Hauptstadt des mexikan. Staats
Mexiko, 2680 m ü. M. gelegen, hat eine schöne Kathedrale,
Theater, höhere Schule, Seifen-, Schminke- und
Kerzenfabrikation, bedeutende Schweinezucht, Handel mit
Würsten und Schinken und (1880) 11,376 Einw. Südwestlich
davon liegt der 4570 m hohe Nevado de T. (Xinantecatl), ein
ausgebrannter Vulkan mit einem Kratersee in der Höhe von 4090
m.
Toluidin, s. Toluol.
Toluidinblau, s. Anilin.
Toluifera, s. Myroxylon.
Toluol (Methylbenzol, Benzylwasserstoff) C7H8 findet sich
im leichten Steinkohlenteeröl und wird daraus durch
fraktionierte Destillation gewonnen, entsteht auch bei trockner
Destillation des Kampfers, Tolubalsams, Drachenbluts etc., bei
Behandlung eines Gemisches von Monobrombenzol und Methylbromür
mit Natrium etc. Das aus Steinkohlenteer gewonnene T. des Handels
ist ein Gemisch von Benzol und T. in Verhältnissen, wie sie
den Zwecken der Industrie entsprechen. Reines T. bildet eine
farblose, dem Benzol sehr ähnliche Flüssigkeit vom spez.
Gew. 0,882, riecht angenehm aromatisch, löst sich nicht in
Wasser, wenig in Alkohol, leicht in Äther, erstarrt noch nicht
bei -20°, siedet bei 111° und brennt mit leuchtender
Flamme; mit Chromsäure liefert es Benzoesäure, mit
konzentrierter Salpetersäure zwei isomere Nitrotoluole
C7H7NO2, ein kristallisierbares (Paranitrotoluol), welches bei
54° schmilzt und bei 237° siedet, und ein flüssiges
(Orthonitrotoluol) vom spez. Gew. 1,163, welches bei 227°
siedet und nach Bittermandelöl riecht. Bei Behandlung mit
reduzierenden Substanzen liefert das Gemisch der Nitrotoluole zwei
Toluidine C7H7.NH2, von welchen das Paratoluidin farblose Kristalle
bildet, bei 45° schmilzt und bei 198° siedet, während
das flüssige Orthotoluidin (Pseudotoluidin) vom spez. Gew. 1,0
nicht bei -20° erstarrt und bei 199° siedet. Dies Toluidin
wird durch Chlorkalklösung violett gefärbt, ersteres
nicht. Die Toluidine entsprechen dem Anilin und verhalten sich
demselben sehr ähnlich, bilden namentlich auch mit Säuren
Salze. Aus salzsaurem Orthotoluidin scheidet Eisenchlorid einen
blauen Körper (Toluidinblau) ab. Die Toluidine spielen eine
wichtige Rolle bei der Darstellung der Anilinfarben (vgl. Anilin),
das T. ist der Ausgangspunkt für die Darstellung vieler
Verbindungen, z. B. der Benzoesäure, des künstlichen
Indigos etc.
Tölz, Flecken und Bezirksamtshauptort im bayr.
Regierungsbezirk Oberbayern, am Austritt der Isar aus den Alpen und
an der Linie Holzkirchen-T. der Bayrischen Staatsbahn, 671 m
ü. M., hat eine evangelische und 4 kath. Kirchen, ein
Franziskanerkloster, ein Kriegerdenkmal zur Erinnerung an den Sieg
der deutschen Landsknechte bei Pavia (1525), deren Führer
Georg Frundsberg und Kaspar Winzerer in T. geboren waren,
elektrische Beleuchtung, ein Amtsgericht, Holzhandel,
Flößerei, Kreidebrüche, Zementfabrikation,
Ziegelbrennerei und (1885) 3796 Einw. Dabei das Bad Krankenheil mit
mehreren jod- und schwefelhaltigen, doppeltkohlensauren
Natronquellen von 7,5-9° C., welche besonders gegen
skrofulöse Leiden, Anschwellungen der Leber und Milz,
chronische Gebärmutterentzündung, chronische Katarrhe der
Nase, des Rachens und des Kehlkopfes, Leiden der Harnwerkzeuge und
chronische Hautkrankheiten empfohlen werden. Vgl. Höfler, Bad
Krankenheil zu T. (2. Aufl., Freiburg 1889); Derselbe, Führer
von T. und Umgebung (5. Aufl., Münch. 1886); Letzel, Der
Kurgast von Krankenheil (Tölz 1888).
Tom., Abkürzung für Tomus (s. d.).
Tomahawk (spr. -hahk), die Streitaxt der nord-amerikan.
Indianer, gilt als Symbol des Kriegs; daher den T. begraben, s. v.
w. Frieden halten.
Toman (Tomaund, Tomond), pers. Goldmünze,
ursprünglich dem Dukaten gleich, wird in 10 Kran à 2
Panabat à 10 Schahi (4 Schahi = 1 Abassi) eingeteilt und
enthält gesetzmäßig 3,376 g fein Gold im Wert von
9,419 Mk.
Tomaschek, Johann Wenzel, Musiklehrer und Kompon ist,
geb. 17. April 1774 zu Skutsch in Böhmen, erhielt den ersten
Violin- und Gesangunterricht in Chrudim, besuchte dann die Schule
des Klosters Iglau und bezog die Universität Prag, um die
Rechte zu studieren, wandte sich aber bald ganz der Musik zu und
wurde, nachdem er sich durch eingehende theoretische Studien
weitergebildet, der angesehenste Musiklehrer Prags. Schüler
von ihm sind: Dreyschock, Kittel, Schulhoff u. a. T. war auch ein
fleißiger und gediegener Komponist; im Druck erschienen von
ihm eine Orchestermesse, Kantaten, Lieder, eine Symphonie, ein
Klavierkonzert, ein Streichquartett, ein Trio, fünf
Klaviersonaten und andre Klavierstücke. Er starb 3. April 1850
in Prag.
Tomaschow, 1) Stadt im russisch-poln. Gouvernement
Petrokow, an der Pilitza und der Bahnlinie Koluszki-Ostrowez, hat
eine protestantische und eine kath. Kirche, viele Tuchfabriken und
(1885) 16,349 Einw. -
2) Kreisstadt im russisch-poln. Gouvernement Lublin, mit
Porzellanfabrik, regem Grenzverkehr mit Österreich und (1885)
5784 Einw.
Tomate, s. Lycopersicum.
Tombak, s. Messing; weißer T., s. v. w.
Weißkupfer.
Tombara, s. Neubritannia-Archipel, S. 70.
Tombigbee River (spr. tombiggbi riwwer), Fluß im
nordamerikan. Staat Alabama, vereinigt sich nach einem Laufe von
730 km mit dem Alabama zum Mobile River (s. d.) und ist bis
Columbus (Mississippi) 670 km oberhalb Mobile schiffbar. Sein
Hauptzufluß ist der Black Warrior River, der bis Tuscaloosa
fahrbar ist.
Tombola (ital.), ein in Italien übliches Lottospiel,
bei welchem die Lose aus einer Trommel gezogen werden; wird
namentlich bei Volksfesten von der auf öffentlichen
Plätzen versammelten Volksmenge gespielt.
Tombuktu, Stadt, s. Timbuktu.
Tomé (El T.), Hafenstadt im südamerikan.
Staat Chile, Provinz Concepcion, an der Nordseite der
Talcahuanabai, hat eine Wolltuchfabrik, Schiffswerfte und (1875)
3529 Einw.
Tomek, Wáclaw Wladiwoj, böhm. Historiker,
geb. 31. Mai 1818 zu Königgrätz, seit 1850 Professor an
der Universität in Prag, ging 1882 an die neue tschechische
Universität daselbst über, war 1861-66 Mitglied des
böhmischen Landtags und des österreichischen Reichsrats
und ist seit 1885 Mitglied des Herrenhauses. Er schrieb auf
Palackys Betrieb eine vortreffliche Geschichte Prags (1855 ff., Bd.
1-7). Von seinen übrigen Büchern sind noch zu nennen:
"Deje zemr ceské" (1843); "Deje mocnáestvi
Rakouského" (1845); "Dejepis university Prazske" (1848);
"Zák-
748
Tomi - Ton.
lady starého mistopisu Prazského" (1865); dann
"Geschichte Böhmens in übersichtlicher Darstellung"
(deutsch vom Verfasser, Prag 1864-65); "Die Grünberger
Handschrift" (übersetzt von Maly, das. 1859); "Handbuch der
österreichischen Geschichte" (das. 1859, nur Band 1); "Johann
Zizka" (deutsch, das. 1881).
Tomi, im Altertum Stadt in Untermösien, am Pontus
Euxinus, bekannt als Verbannungsort des Dichters Ovid; das jetzige
Constanza (s. d.).
Tomleschg, Thal, s. Hinterrhein.
Tommaseo, Niccolò, ital. Schriftsteller, geb. 1802
zu Sebenico in Dalmatien, studierte zu Padua die Rechte, folgte
aber seiner Neigung für die Litteratur, war seit 1827 in
Florenz journalistisch thätig und ging 1833 nach Frankreich.
Im folgenden Jahr veröffentlichte er seine Schrift "Dell'
educazione" (1834), die binnen zwei Jahren drei Auflagen erlebte,
ferner die politische Schrift "L'Italia" (1835) und einen Roman:
"Il duca d'Atene" (1836). Von 1838 an lebte er in Venedig, wo ein
Jahr vorher sein trefflicher "Kommentar zu Dante" erschienen war,
und wo er weiterhin seine "Nuovi scritti" (1839-1840, 4 Bde.) und
"Studj critici" (1843, 2 Bde.) sowie seine große, mit Recht
berühmte Sammlung "Canti popolari toscani, corsici, illirici,
greci" (1843, 2 Bde.) veröffentlichte. Auch ließ er eine
Bearbeitung der auf die Geschichte Frankreichs im 16. Jahrh.
bezüglichen Gesandtschaftsberichte (1838, 2 Bde.) erscheinen
und gab die "Lettere di Pasquale de' Paoli" (1846) heraus. Seine
streng katholische Gesinnung hinderte ihn nicht, sich 1848 zur
liberalen und nationalen Partei zu bekennen. Infolge seines
freimütigen Auftretens mit Manin verhaftet, aber vom Volke
gewaltsam befreit und als Minister des Unterrichts mit Manin an die
Spitze der provisorischen Regierung gestellt, verließ er die
Stadt vor dem Einzug der Österreicher und begab sich nach
Korfu, wo eine Krankheit seine Erblindung zur Folge hatte. 1852
veröffentlichte er zu Mailand seinen sehr interessanten
psychologischen Roman "Fede e bellezza", der mehrmals neu aufgelegt
wurde. 1854-59 lebte er in Turin, von da an zu Florenz, wo er 1.
Mai 1874 starb. Von seinen weitern Publikationen sind
hervorzuheben: "Le lettere di Santa Caterina di Siena" (1860, 4
Bde.); eine Sammlung seiner politischen Schriften: "Il secondo
esiglio" (1862, 3 Bde.); "Sulla pena di morte" (1865) und "Nuovi
studj su Dante" (1865). Äußerst verdienstvoll ist sein
"Dizionario di sinonimi della lingua italiana" (7. Aufl. 1887, 2
Bde.), geschätzt auch sein "Leben Rosminis" und sein
"Dizionario estetico" (neue Aufl. 1872). T. war einer der
angesehensten Schriftsteller seiner Zeit, vielseitigen und lebhaft
beweglichen Geistes und von großem Einfluß als
Kritiker. Vgl. Bernardi, Vita e scritti di Niccolò T. (Turin
1874); K. Hillebrand in der "Allgemeinen Zeitung" (Mai 1874).
Tommaso, ital. Maler, aus Modena, daher T. da Modena
genannt, malte um 1352 in Treviso (im Dominikanerkloster) eine
Reihe von Wandbildern der berühmtesten Mitglieder des
Dominikanerordens, sodann im Dom des Lünettenfresko des
Gekreuzigten. Weitere Spuren von ihm finden sich in Prag, wohin er
1357 durch Karl IV. berufen worden sein soll. Eine Madonna und ein
Ecce homo befinden sich auf dem Karlstein bei Prag.
Tompa, Michael, ungar. Dichter, geb. 29. Sept. 1819 zu
Rimaszombat im Gömörer Komitat, studierte daselbst und in
Sáros-Patak und ward 1845 protestantischer Seelsorger zu
Beje im Gömörer Komitat, 1848 Feldgeistlicher in der
Honvédarmee und 1852 Pfarrer zu Yamva (Gömörer
Komitat), wo er bis an das Ende seines Lebens wirkte. Sein erstes
selbständiges Werk war: "Néprgék,
Népmondák" ("Volksmärchen, Volkssagen", Pest
1846). In demselben Jahr zeichnete die Kisfaludy-Gesellschaft seine
komische poetische Erzählung "Szuhay Mátyás" mit
einem Preis aus und wählte ihn zu ihrem Mitglied. 1847
erschien die erste Ausgabe seiner Gedichte. In den Jahren
unmittelbar nach der Revolution gab er der damaligen
gedrückten Stimmung und den von der politischen Gewalt noch
verpönten Hoffnungen in mit großem Beifall aufgenommenen
allegorischen Gedichten Ausdruck, wegen deren er sich 1852 vor dem
Kriegsgericht in Kaschau zu verantworten hatte. 1858 wurde er von
der Akademie zum Mitglied gewählt, 1868 erhielt er für
seine Dichtungen den großen akademischen Preis (200 Dukaten).
Kurz darauf starb er 30. Juli 1868. Eine Gesamtausgabe seiner
Dichtungen erschien in 5 Bänden (Pest 1881).
Tomsk, russ. Gouvernement in Westsibirien, zwischen den
Gouvernements Tobolsk, Semipalatinsk und Jenisseisk und der
Mongolei, 847,887 qkm (15,398 QM.) groß mit (1885) 1,960,064
Einw. (meist Russen und deren Nachkommen), darunter 994,246
Griechisch-Katholische, 64,545 Heiden (Tataren, Kalmücken,
Bucharen, Ostjaken u. a.), 29,179 Mohammedaner, 6659
Römisch-Katholische, 4501 Juden u. a. Die Zahl der Verbannten
beträgt 30,000. Das Gouvernement wird im SO. vom Altai
ausgefüllt, hat weiter nach N. große Steppen (vgl.
Baraba), Wälder und Moräste und wird seiner ganzen
Länge nach vom Ob durchflossen. Das Klima ist im S.
gemäßigt, im N. rauh. Gebaut werden: Hafer, Weizen,
Roggen, Gerste, Kartoffeln. Haupterwerb ist Viehzucht, man
zählte 1883: 982,115 Pferde, 821,027 Rinder, 930,915 meist
grobe Schafe, 216,032 Schweine. Leider treten zuweilen Viehseuchen
auf. Die Hüttenwerke im Altai lieferten früher
außerordentliche Mengen von Metall (1851: 655,240 kg
silberhaltige Golderze, 362,872 kg goldhaltige Silbererze und
4,096,478 kg Kupfer), die Produktion ist aber sehr bedeutend
heruntergegangen; es ist daher eine Anzahl von Werken bereits
aufgegeben, was zum großen Teil an der Mißwirtschaft
der Kronbeamten liegt; die Privatunternehmungen gedeihen weit
besser. Die Ausbeute betrug 1880: 2427 kg Gold, 10,135 kg Silber,
1,058,274 kg Blei, 470,516 kg Kupfer und 713,383 kg Gußeisen.
Zwei große Märkte werden jährlich zu Susunk (Kreis
Barnaul) und zu Wosnesensk (Kainsk) abgehalten. An Lehranstalten
sind vorhanden 1885: 9 Mittelschulen mit 1372 Schülern, 5
Fachschulen mit 403 Schülern, 254 Elementarschulen mit 8956
Schülern. Die Hauptstadt T., am Tom, ist Sitz des Gouverneurs,
eines griechischen Bischofs, einer Schuldirektion, hat viele zum
Teil recht stattliche Regierungsgebäude, einen russischen
Bazar, zahlreiche chinesische Kaufläden, 9 griechische
Kirchen, 2 Klöster, eine lutherische und eine
römisch-katholische Kirche, mehrere Moscheen, ein
großartiges (1887 eröffnetes)
Universitätsgebäude, Seminar, Gymnasium, höhere
Töchterschule, Bibliothek, naturwissenschaftliches Museum und
(1885) 36,742 Einw., welche Gerberei, Seifensiederei,
Talgschmelzerei u. a. sowie lebhaften Handel mit Getreide, Leder
und Pelzwaren betreiben, wozu die Lage am Sibirischen Trakt die
Stadt besonders befähigt.
Tomus (lat.), Band, Teil eines Buches.
Ton (spr. tönn), Handelsgewicht in England und den
Vereinigten Staaten Nordamerikas, à 20 Ztr. à 112
Pfd. = 1016,046 kg; in Nordamerika oft nur
749
Ton - Tonart.
zu 2000 Pfd. T. of shipping, Schiffslast, nach Gewicht 2000
Pfd., oft das gewöhnliche T.; nach Raum = 400 engl.
Kubikfuß = 1,132 cbm; in New York und New Orleans nach Waren
usanzmäßig, z. B. 20000 Pfd. schwere Güter, 1830
Pfd. Kaffee in Säcken etc.
Ton, in der Musik ein Klang von konstanter Tonhöhe
(s. Schall, S. 391); auch s. v. w. Ganzton (s. d.) oder Tonart
(besonders Kirchenton). In der Malerei versteht man unter T.
(Farbenton) die sämtlichen in einem Gemälde angewendeten
Farben in ihrem Verhältnis zu einander und nach ihrem
Gesamteindruck.
Tonalá, Hafenstadt im mexikan. Staat Chiapas, an
einem Haff des Stillen Ozeans, dessen Einfahrt nur Schiffen von 3 m
Tiefe zugänglich ist, mit (1880) 6702 Einw.
Touale, Berg und Paß an der Grenze Tirols
(Sulzberg-Thal) und der ital. Provinz Sondrio, ersterer 2690,
letzterer 1874 m hoch. Über den Paß, welcher befestigt
ist, führt eine der wichtigsten Militärstraßen aus
Tirol nach dem Veltlin. Hier 1799 und 1809 Treffen zwischen
Tirolern und Franzosen; auch in den Jahren 1848, 1859 und 1866 kam
es daselbst öfters zu Gefechten.
Tonalit, gemengtes kristallinisches Gestein, aus
Plagioklas, Quarz, Hornblende und Biotit bestehend, bildet den
Monte Adamello, südlich von Tonale (daher T.).
Tonalität (franz.), ein Begriff der modernen
Musiktheorie, der sich nicht völlig mit "Tonart" deckt,
sondern in seiner Bedeutung weit über die Grenzen der letztern
hinausreicht. T. ist die eigentümliche Bedeutung, welche die
Akkorde dadurch erhalten, daß sie auf einen Hauptklang, die
Tonika, bezogen werden. Während die ältere Harmonielehre,
welche im wesentlichen von der Tonleiter ausgeht, unter "Tonika"
den dieselbe beginnenden und schließenden Ton versteht,
muß die neuere Harmonielehre, welche nichts andres ist als
die Lehre von der Auffassung der Akkorde im Sinn von Klängen,
einen Klang (Dur- oder Mollakkord) als Tonika aufstellen. So ist
die C dur-T. herrschend, wenn die Harmonien in ihrer Beziehung zum
C dur-Akkord verstanden werden; z. B. die Folge:
[s. Graphik]
ist im Sinn einer Tonart der ältern Harmonielehre gar nicht
zu begreifen, obgleich niemand behaupten kann, daß sie
fürs Ohr unverständlich ist. Im Sinn der C dur-T. ist
sie: Tonika - Gegenterzklang - Tonika - schlichter Terzklang -
Tonika, d.h. es sind der Tonika nur nahe verwandte Klänge
gegenübergestellt (vgl. Klangfolge). Ein Klang wird als
Hauptklang aufgestellt: entweder durch direkte Setzung,
wiederholten Anschlag, breite Darlegung (z. B. der F moll-Akkord zu
Anfang der Sonata appassionata von Beethoven), oder auf indirektem
Weg, indem ein Schluß zu ihm gemacht wird; das letztere
geschieht, indem einem seiner verwandten Klänge der
Untertonseite einer der Obertonseite folgt oder umgekehrt (s.
Tonverwandtschaft). Bei derartigen Folgen, z. B. F dur-Akkord - G
dur-Akkord || oder As dur-Akkord - G dur-Akkord || oder G
dur-Akkord - F moll-Akkord ||, ist der übersprungene C dur-
oder C moll-Akkord das Verständnis der beiden Akkorde
vermittelnd und tritt deshalb gern danach als schließender
Akkord auf. Diese Ausprägung der T. durch eine Art
Schlußfolgerung kann ein Tonstück beginnen, wird aber
noch viel häufiger im weitern Verlauf zur Anwendung gebracht,
wenn die Tonikabedeutung auf einen andern Klang übergehen soll
(s. Modulation). Die eigentümliche Thatsache, daß
konsonante Akkorde unter Umständen ganz dieselbe Wirkung und
Bedeutung für die harmonische Satzbildung haben wie
dissonante, daß z. B. in C dur der Unterdominante (fac) meist
ohne Änderung des Effekts die Sexte (d) beigegeben werden kann
und der Oberdominante (ghd) ebenso die Septime (f), findet ihre
Erklärung nur im Prinzip der T. Denn im strengsten Sinn
konsonant, d. h. schlußfähig, keine Fortsetzung
(Auflösung) verlangend, ist eigentlich immer nur ein einziger
Klang, die Tonika; die Bedeutung der übrigen ist durch ihre
Verwandtschaft mit dieser bedingt.
Tonart, in der Mufik die Bestimmung des Tongeschlechts
(ob Dur oder Moll) und der Tonstufe, auf welcher ein Stück
seinen Sitz baben soll. Statt unsrer heutigen beiden
Tongeschlechter nahmen die Alten (Griechen, Römer, Araber,
Inder, das Abendland im Mittelalter) deren eine größere
Zahl an (vgl. Kirchentöne); über die Bedeutung dieser
verschiedenen Oktavengattungen wie der Tonleitern überhaupt
vgl. Tonleiter. Jede Oktavengattung kann beliebig transponiert
werden, d. h. dieselbe Intervallenfolge kann von jedem Ton aus
gebracht werden; schon die Griechen hatten 15 Transpositionsskalen,
die Kirchentöne wurden freilich lange Zeit nur in die Quarte
und erst später auch in die Quinte transponiert. Die
Einführung noch mehrerer Transpositionen im 16.-17. Jahrh. war
schon das Anzeichen des Unterganges der alten Lehre. Die heutigen
Transpositionen der beiden Grundskalen (C dur und A moll) sind
:
1) in die Oberquinte (G dur E moll) mit 1 # (vor F)
2) - - Unterquinte (F dur, D moll) mit 1 b (vor H)
3) - - 2. Oberquinte (D dur, H moll) mit 2 # (vor F, C)
4) - - 2. Unterquinte (B dur, G moll) mit 2 b (vor H, E)
5) - - Obersexte (A dur, Fis moll) mit 3 # (vor F, C, G)
6) - - Untersexte (Es dur, C moll) mit 3 b (vor H, E, A)
7) - - Oberterz (E dur, Cis moll) mit 4 # (vor F, C, G, D)
8) - - Unterterz (As dur, F moll) mit 4 b (vor H, E, A, D)
9) - - große Oberseptime (H dur, Gis moll) mit 5 # (vor F,
C, G, D, A)
10) - - große Unterseptime (Des dur, B moll) mit 5 b (vor
H, E, A, D, G)
11) - - übermäßige Oberquarte (Fis dur, Dis
moll) mit 6 # (vor F, C, G, D, A, E)
12) - - übermäßige Unterquarte (Ges dur, Es
moll) mit 6 b (vor H, E, A, D, G, C)
13) - - chromatische Obersekunde (Cis dur, Ais moll) mit 7 #
(vor F, C, G, D, A, E, H)
14) - - chromatische Untersekunde (Ces dur, As moll) mit 7 b
(vor H, E A, D, G, C, F)
Der verschiedene Charakter der Tonarten ist kein leerer Wahn,
hängt aber nicht, wie man hier und da lesen kann, von der
ungleichartigen Temperatur der Töne ab (nämlich C dur als
am reinsten gestimmt gedacht), sondern ist eine ästhetische
Wirkung, die in der Art des Aufbaues unsers Musiksystems ihre
Erklärung findet. Dasselbe basiert auf der Grundskala der
sieben Stammtöne A-G, und die beiden diese vorzugsweise
benutzenden Tonarten C dur und A moll erscheinen als schlichte,
einfache, weil sie am einfachsten vorzustellen sind. Die Ab-
750
Tonbestimmung - Tongaarchipel.
weichungen nach der Obertonseite (#-Tonarten) erscheinen als
eine Steigerung, als hellere, glänzendere, die nach der
Untertonseite (b-Tonarten) als Abspannung, als dunklere,
verschleierte; die erstere Wirkung ist eine dur-artige, die
letztere eine moll-artige. Dazu kommt die Verschiedenheit der
ästhetischen Wirkung der Dur-Tonarten und Moll-Tonarten
selbst, welche in der Verschiedenheit der Prinzipien ihrer
Konsonanz wurzelt; Dur klingt hell, Moll dunkel. Die Dur-Tonarten
mit Kreuzen haben daher einen potenzierten Glanz, wie die
Molltonarten mit Been potenziert dunkel sind; eigenartige
Mischungen beider Wirkungen sind das Helldunkel der Dur-Tonarten
mit Been und die fahle Beleuchtung der Molltonarten mit Kreuzen.
Die Wirkung wächst mit der Zahl der Vorzeichen. Geringe
Modifikationen erleidet der Charakter der Tonarten durch die
größere oder geringere Schwierigkeit, mit der die
einzelnen Tonarten von den Instrumenten hervorgebracht werden. Die
Tonarten mit viel Vorzeichen klingen am besten beim Klavier;
dagegen machen manche Tonarten den Instrumenten mit teilweise
gebundener Intonation besondere Schwierigkeiten. Die Posaunen
stehen in Es dur, haben daher eine natürliche Abneigung gegen
#-Tonarten; umgekehrt stehen Flöte und Oboe in D dur, d. h.
sie haben Abneigung gegen B-Tonarten. Auch die Streichinstrumente
sind zufolge der Stimmung der leeren Saiten als in G-, resp. D-
oder A dur stehend anzusehen, d. h. sie begegnen in den B-Tonarten
größern Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten der
Applikatur belasten in einer ganz ähnlichen Weise die
Vorstellung wie die des Systems der Notenschrift, und Es dur
erscheint daher den Posaunisten, D dur den Flötisten, Oboisten
und Violinisten als eine besonders einfache Tonart.
Tonbestimmung, die mathematische Bestimmung der
Tonhöhenverhältnisse, die Feststellung der relativen
Schwingungszahlen oder Saitenlängen, welche den einzelnen
musikalischen Intervallen zukommen. Der Schwingungsquotient ist der
genaue mathematische Ausdruck des Verwandtschaftsverhältnisses
zweier Töne, z. B. der Schwingungsquotient 9:8 für den
großen Ganzton c:d; 10:9 für den kleinen Ganzton d:e;
16:15 für den großen Halbton e:f; 25:24 für den
kleinen Halbton f:fis; 5:4 für die (reine) große Terz
c:e; 6:5 für die kleine Terz c:es; 256:225 für die
verminderte Terz dis:f; 64:81 für c:e als vierte Quinte
aufgefaßt c (g d a) e (mit Ignorierung der Oktavversetzungen)
etc. Eine Tabelle der wichtigsten denkbaren Tonwerte im Umfang
einer Oktave, von e ausgehend und nach diesem die akustischen Werte
der übrigen Töne bestimmend, findet sich in Riemanns
"Musiklexikon" (3. Aufl., Leipz. 1887).
Tonbridge (spr. tönnbriddsch), s. Tunbridge.
Tonbuchstaben, s. Buchstabentonschrift.
Tondern (Tönder), Kreisstadt in der preuß.
Provinz Schleswig-Holstein, an der Widaue, Knotenpunkt der Linien
Elmshorn-Heide-Ribe der Schleswig-Holsteinischen Marsch- und
Tingleff-T. der Preußischen Staatsbahn, hat eine schöne
evang. Kirche, ein Schullehrerseminar, ein Amtsgericht, ein
Hauptsteueramt, Bierbrauerei, Viehmärkte, Fettviehausfuhr und
(1885) 3516 fast nur evang. Einwohner. 1639 fand man bei dem
benachbarten Ort Galhus im Schlamm ein großes goldenes, mit
Figuren verziertes Horn und 1734 ein zweites. Diese sogen.
Tondernschen Hörner, welche 1802 aus der Kunstsammlung zu
Kopenhagen entwendet wurden, waren Schau- und Luxusstücke. Die
Runenschrift des einen Horns gehörte dem angelsächsischen
Alphabet an und war, aus dem 6. Jahrh. stammend, die älteste
bekannte.
Tondeur (spr. tongdör), Alexander, Bildhauer, geb.
1829 zu Berlin, besuchte seit 1848 die dortige Akademie und bildete
sich dann unter Bläsers Leitung weiter aus. Nachdem er sich
von 1852 bis 1854 in Wien aufgehalten, begab er sich auf ein Jahr
nach Paris und 1856 nach Rom, wo eine verwundete Venus entstand,
die von der Iris zum Olymp getragen wird, worauf eine Marmorgruppe
der Mutterliebe folgte. 1858 begann er in Berlin eine ausgedehnte
Thätigkeit namentlich in allegorischen und mythologischen
Gestalten. Dieser Art sind eine Borussia als Brunnenfigur mit den
vier Hauptflüssen Preußens, Frühling, Sommer und
Herbst als dekorative weibliche Gewandfiguren, ein Triton in der
Muschel und zwei der kolossalen Städtefiguren in der Berliner
Börse, die Vasen zum Andenken an den dänischen und an den
deutsch-österreichischen Krieg, eine Gruppe: Tag und Nacht,
Pan, der eine Wasser schöpfende Nymphe überrascht, von
feiner Empfindung und großer Sorgfalt der Ausführung
(1867), die beiden Bronzestatuen Bülows und Blüchers am
Postament der großen Kölner Reiterstatue Friedrich
Wilhelms III. von Bläser, mehrere Büsten und zwei
Restaurationen von Reliefs der pergamenischen Gigantomachie (s.
Tafel "Bildhauerkunst III", Fig. 8, 9).
Tondruck, s. Lithographie, S. 837.
Tonelada, Schiffslast, Tonne, Stückmaß in
Spanien und Spanisch-Amerika, à 20 Quintales = 920,186 kg;
die neue Tonelada metrica = 1000 kg; in Portugal und Brasilien
für trockne Waren à 54 Arroba, für
Flüssigkeiten à 60 Almud; in Brasilien bei
Schiffsfrachten s. v. w. englisch Ton; in Argentinien und Uruguay
Getreidemaß, = 10,29 hl.
Tonfall, s. Kadenz.
Tongaarchipel (Freundschaftsinseln), eine zum
südlichen Polynesien gehörige Inselgruppe im Stillen
Meer, unter 18-22° südl. Br., südöstlich von den
Fidschi- und südlich von den Samoainseln, umfaßt im
ganzen 32 größere Inseln und ungefähr 150 kleinere
Eilande mit einem Gesamtflächenraum von 997 qkm (18 QM.). Die
meisten der Inseln sind niedrig, haben Korallenfelsen zur Grundlage
und sind mit einer dicken, fruchtbaren Erdschicht bedeckt; nur
einzelne sind hoch, gebirgig und vulkanischen Ursprungs. Die
umgebenden Riffe erschweren den Zugang zu den meisten Inseln, doch
haben einige derselben schöne Häfen. Das Klima ist
angenehm und gesund, nur finden häufig Erderschütterungen
statt. Das Pflanzenreich liefert Pisange, Brotfruchtbäume,
Yams, Kokos- und andre Palmen, Zuckerrohr, Bambus, Baumwolle,
Feigen, Citrusarten, Papiermaulbeerbäume etc. Das Tierreich
ist vertreten durch Schweine, Hunde, Ratten, das gewöhnliche
Hausgeflügel, Papageien, Reiher, Tropikvögel und
Schildkröten. Der Archipel ist aus drei Gruppen
zusammengesetzt. In der nördlichen, 205 qkm (3,7 QM.)
großen Hafulu-Hu-Gruppe ist Vavau (145 qkm mit über 3000
Einw.) die größte Insel; auf Amarpurai (Fanulai) und
Lette(Bickerton) sind thätige Vulkane, letzteres hatte 1854
einen heftigen Ausbruch, das erstere ist seit der Eruption von 1846
nur noch eine Masse von Felsentrümmern. Die mittlere Gruppe
umfaßt die Namukagruppe (37 qkm), die Kotuinseln, Tofoa (55
qkm), 854 m hoch und mit einem thätigen Vulkan, das kleinere
(11 qkm), aber 1524 m hohe Kao und die aus sechs Inseln und 6-8
Inselchen bestehende Hapaigruppe, 68 qkm (1,2 QM.). Zur
südlichen Gruppe gehören Pylstaart, das 174 qkm
750a
Zum .Artikel »Tongking«.
TONGKING.
Maßstab 1:2.500 000.
ÖSTL. HINTERINDIEN
Maßstab 1:18.000 000.
HUÉ.
1:600000
HA-NOI.
1:300000
751
Tongern - Tongking.
(3,2 QM.) große Eua und die bedeutendste aller Inseln,
Tongatabu, 430 qkm (7,8 QM.) mit ca. 9000 Einw. Die Zahl der
Einwohner betrug 1884: 22,937, darunter 350 Engländer, 63
Deutsche, 13 Amerikaner, 11 Franzosen. Die Tonganer (22,000)
gehören zu den Polynesiern (s. Tafel "Ozeanische Völker",
Fig. 22) und übertreffen an Bildungsfähigkeit die meisten
Bewohner der benachbarten Inselgruppen. Sie treiben
sorgfältigen Landbau, sind geschickte und unternehmende
Seeleute und beweisen bei dem Bau ihrer Häuser und Boote wie
bei der Verfertigung ihrer Gerätschaften, Waffen (Keulen,
Bogen und Pfeile) und Kleider (Stoffe aus Papiermaulbeerbaum)
ziemliche Kunstfertigkeit. Sie sind jetzt zum Christentum bekehrt.
Schon 1797 kamen Missionäre aus London auf Tongatabu an, drei
wurden ermordet, die andern kehrten zurück; seit 1822
siedelten sich Methodisten an. Auf den südlichen Inseln haben
französische Missionäre dem Katholizismus Eingang
verschafft. Etwa 5500 Kinder besuchen Schulen; von höhern
Bildungsanstalten existieren eine Industrieschule und ein
Gymnasium. Die ganze Gruppe bildet seit Anfang dieses Jahrhunderts
ein einheitliches Reich unter einem König, dem eine
gesetzgebende Versammlung zur Seite steht. Residenz des Königs
und Sitz der Regierung ist Nukualofa auf Tongatabu. Am 1. Nov. 1876
schloß König Georg I. einen Freundschaftsvertrag mit dem
Deutschen Reich. Die Gruppe gehört zum Bezirk des deutschen
Konsuls in Apia. Der Handel befindet sich zum großen Teil in
den Händen der Deutschen Handels- und Plantagengesellschaft,
welche die meisten Waren von Apia einführt. Die Einfuhr
(Baumwoll- und Wollwaren, Eisenwaren, Getreide, Bauholz, Konserven
etc.) betrug 1887: 3,171,553 Mk., davon deutsch 1,181,300, englisch
1,691,864 Mk., die Ausfuhr (Kopra und etwas Kaffee, Schwämme,
Wolle) 3,148,933 Mk., davon deutsch 2,377,384, englisch 704,160 Mk.
Der englische Handel wächst auf Kosten des deutschen. Die
Inselgruppe wurde 1887 besucht von 74 Schiffen von 28,264 Ton.,
darunter 34 deutschen von 19,468 T. Die deutschen Postdampfer
laufen den T. auf der Fahrt von Sydney nach Apia
regelmäßig an. Die Inseln wurden 1643 von Tasman
entdeckt und von Cook, der sie 1773 und 1777 genauer erforschte,
wegen des sanften und gutwilligen Charakters der Eingebornen
Freundschaftsinseln (Friendly Islands) benannt. Die Flagge s. auf
Tafel "Flaggen I". Vgl. Mariner, Account of the Tonga Islands
(Lond. 1814, 2 Bde.; deutsch, Weim. 1819); Meinicke, Die Inseln des
Stillen Ozeans (Leipz. 1875); Jung, Der Weltteil Australien, Bd. 3
(Leipz. 1883).
Tongern, Hauptstadt eines Arrondissements in der belg.
Provinz Limburg, am Geer, Knotenpunkt an der Eisenbahn
Lüttich-Hasselt, hat eine alte Kathedrale (13. Jahrh.), ein
Athenäum, ein Tribunal, Strohhutfabriken und (1888) 8763 Einw.
T. ist die älteste Stadt Belgiens (das alte Aduatuca) und war
schon im 4. Jahrh. Sitz eines Bischofs, welcher im 6. Jahrh. nach
Maastricht und 720 nach Lüttich übersiedelte.
Tongeschlecht (Klanggeschlecht), die Unterscheidung eines
Akkords oder einer Tonart (Tonalität) als Dur oder Moll.
Während Tonarten mit verschiedenen Vorzeichen nur
verschiedenartige Transpositionen derselben Tonreihe sind, ist die
Auffassung von Klängen oder Tonarten verschiedenen
Tongeschlechts eine prinzipiell verschiedene. Man vergleicht Dur
dem männlichen, Moll dem weiblichen Geschlecht.
Tongking (hierzu Karte "Tongking"), französisches
Schutzgebiet in Hinterindien, grenzt im N. an China, im W. an die
Laosstaaten und Siam, im S. an Anam, im O. an den Golf von T.
benannten Teil des Südchinesischen Meers und hat ein Areal von
90,000 qkm (1635 QM.), nach andern aber 165,200 qkm (3000 QM.) mit
10-12 Mill. Einw., worunter 400,000 einheimische Christen. Das Land
ist zum Teil gebirgig, teils durchaus ebenes Alluvium und wird in
seiner ganzen Länge von dem aus Jünnan kommenden Songka
durchzogen, der mehrere größere Flüsse (Schwarzer
und Klarer Fluß) aufnimmt und, ein großes,
vielverzweigtes Delta bildend, in zahlreichen Armen in die Bai von
T. mündet und mit dem zweiten Fluß Tongkings, dem
Thai-binh oder Bak-ha, durch drei künstliche Kanäle und
andre Abzweigungen in Verbindung steht. Den Süden
durchfließt der gleichfalls aus Jünnan kommende Ka, den
Norden der noch sehr wenig bekannte Tam. Die Wälder der Berge
sind reich an allerhand Nutzholz; dort hausen Elefanten, Tiger,
Büffel, Rhinozerosse. Der Mineralreichtum ist ein sehr
großer; Gold- u. Silberbergwerke werden seit langer Zeit in
primitiver Weise ausgebeutet, Kohlen, Kupfer, Quecksilber, Eisen,
Zink, Blei aber gar nicht abgebaut. Im Tiefland wird viel Reis
gebaut (1½ Mill. Hektar sind damit bestellt); außerdem
werden gewonnen und in den Handel gebracht: Zimt, Tabak, Indigo,
Mais, Baumwolle, Zuckerrohr, Bohnen, Rizinus, Drachenblut,
Sternanis, Erdnüsse, wohlriechende Harze. Als Haustiere werden
gehalten: Schweine, Hühner, Büffel, Rinder, aber nur
wenige Pferde und Elefanten. Eine Hauptbeschäftigung bildet
der Fang von Fischen und Krokodilen; der Schwanz der letztern wird
sehr geschätzt. Schiffahrt wird eifrig betrieben und in dem
baumlosen Flachland Ziegelbrennerei. In den Städten Hanoi und
Namdinh werden geschnitzte Möbel, Lackarbeiten, eingelegte
Perlmutterarbeiten, Kleiderstoffe angefertigt. Der Buchdruck von
Hanoi, dem Sitz tongkingesischer Gelehrsamkeit, ist berühmt.
Der Handel auf dem Songkai mit Jünnan ist sehr bedeutend, er
wird auf 3½ Mill. Frank geschätzt. Für den
Außenhandel ist Haiphong, an einem Nordarm des Deltas,
Hauptplatz; 1880 schätzte man den dortigen Handel auf 20 Mill.
Fr., während der Kriegsjahre sank derselbe
naturgemäß, stieg darauf aber schnell und betrug 1886
bei der Einfuhr 28,8, bei der Ausfuhr 9,1 Mill. Fr. Der Handel,
vornehmlich der Geldhandel, ist zum großen Teil in den
Händen der Chinesen, von denen 10,000 in T. leben. In neuester
Zeit wurden Differentialzölle eingeführt, welche die
französischen Provenienzen sehr begünstigen. Um den
Binnenverkehr zu heben, sind Eisenbahnen von Hanoi nach Haiphong
und Quang-Yen, auch über Namdinh nach Anam und von Hanoi nach
Langson geplant. Eine Gesellschaft mit einem Kapital von 1½
Mill. Fr. hat sich in Frankreich gebildet, um die öffentlichen
Arbeiten zu übernehmen. Sie hat auch eine wöchentliche
Dampferlinie zwischen Haiphong und Hongkong eingerichtet. In
Haiphong bestehen ein englisches und ein französisches
Bankinstitut. Die wichtigsten Orte sind die Hauptstadt Hanoi und
die Hafenstadt Haiphong. Das erstere ist Sitz der
französischen Verwaltungsbehörden. T. hat von 1883 bis
1885 dem Mutterland an 327 Mill. Fr. gekostet, wozu noch 685,000
Fr. für ein submarines Kabel kommen. Jetzt gewährt
Frankreich einen jährlichen Zuschuß von 30 Mill. Fr.
Nach dem Budget von 1888 belaufen sich für Anam und T. die
Einnahmen auf nur 17,321,000, die Ausgaben auf 17,034,620 Fr., wozu
aber noch die Ausgaben für Krieg u. Marine mit zusammen
38,055,000 Fr. kommen.
752
Tongoi - Tonmalerei.
Geschichte. Ein französischer Waffenhändler, Dupuis,
machte 1870 den französischen Gouverneur von Kotschinchina
darauf aufmerksam, daß der Rote Fluß eine treffliche
Wasserstraße nach der chinesischen Provinz Jünnan bilde.
Daher wurde 1873 der Schiffsleutnant Garnier nach T. geschickt, der
Hanoi besetzte und die Eroberung von T. begann, aber 31. Dez. 1873
von den Piraten der Schwarzen Flagge überfallen und
getötet wurde. Gemäß einem Vertrag mit Anam
räumten die Franzosen 1874 die besetzten Plätze gegen die
Zusicherung freien Handels und des Schutzes der Missionen. Als
chinesische Piraten den Handel störten und eine friedliche
Verständigung zwischen Frankreich und China, das die
Oberhoheit über T. beanspruchte, daran scheiterte, daß
die französische Regierung 1883 den sogen. Bourréeschen
Vertrag nicht genehmigte, schickte letztere den Kommandanten
Rivière mit Truppen nach T., um es von neuem zu besetzen.
Auch dieser wurde 19. Mai bei einem Ausfall aus Hanoi von den
Schwarzen Flaggen getötet und nun die Absendung einer
größern französischen Streitmacht beschlossen, um
T. völlig in französische Gewalt zu bringen, wofür
der Vertrag mit Anam 25. Aug. 1883 Frankreich freie Hand gab. Nach
einigen mißglückten Vorstößen erstürmten
die Franzosen unter Courbet 16. Dez. Sontai und nahmen unter
General Millot 12. März 1884 Bacninh ein, womit sie das Delta
des Roten Flusses in Besitz hatten. China verzichtete im Vertrag
von Tientsin (11. Mai 1884) auf T., räumte es aber nicht
schnell genug, so daß die eilig vorrückenden Franzosen
von den chinesischen Truppen bei Bakle zurückgewiesen wurden,
worauf Frankreich mit China Krieg begann (s. China, S. 23). In T.
wurden die Chinesen aus dem Land selbst vertrieben, brachten den
Franzosen aber, als dieselben über die Grenze vordrangen, 24.
März 1885 bei Langson eine empfindliche Niederlage bei.
Dennoch trat China am 1. April 1885 T. ab und zog seine Truppen
zurück, worauf die französische Regierung die Schwarzen
Flaggen unterdrückte. Vgl. Thureau, Le Tonkin (Par. 1883);
Millot, Le Tonkin (das. 1888); Bouinais, Tonkin-Anam (2. Aufl.,
das. 1886); Deschanel, La question du Tonkin (das. 1883); Gautier,
Les Français au Tonkin (das. 1884); "L'affaire du Tonkin,
par un diplomat" (1888); Lehautcour, Les éxpeditions
françaises au Tonkin (1888, 2 Bde.); Scott, Frankreich und
T. 1884 (deutsch, Ilfeld 1885).
Tongoi, Hafenstadt im südamerikan. Staat Chile,
Provinz Coquimbo, Ausgangspunkt einer ins Minenrevier von Ovalle
führenden Eisenbahn, hat Kupferschmelzen und (1875) 1533
Einw.
Tongrische Stufe, s. Tertiärformation, S. 601.
Tonic Solfa Association, in England weitverbreitete
Gesellschaft zur Ausübung des a cappella-Gesangs in akustisch
reiner Stimmung, die sich einer besondern Notierungsart mit den
Silben Do Re Mi Fa So La Si bedient. Erfinder der Tonic
Solfa-Methode ist der anglikanische Geistliche John Curwen (gest.
1880), der auch eine "Grammar of vocal music founded on the Tonic
Solfa Method" herausgab und eine Zeitung: "The Tonic Solfa
Reporter" (seit 1851), redigierte. Die Tonic Solfa-Methode hat die
größte Ähnlichkeit mit dem in Deutschland für
Volksschulen zur Anwendung gekommenen Ziffernsystem (1 2 3 4 5 6 7
für die Dur-Tonleiter) und ist eine Wiederbelebung der
Guidonischen Solmisation, aber mit sieben Silben statt mit
sechs.
Tonika (ital.), nach gewöhnlichem Sprachgebrauch der
Ton, nach welchem die Tonart benannt wird, d. h. in C dur c, in G
dur g etc. Die neuere Harmonielehre versteht indes unter T. den
Dreiklang der T., d. h. in C dur den C dur-Akkord, in C moll den C
moll-Akkord etc. Vgl. Tonalität.
Tonisch (vom lat. Tonus, s. d.), stärkend, spannend;
tonische Mittel (Tonica), Arzneimittel, welche den Tonus, das
Spannungsvermögen der Muskeln und Nerven, vermehren sollen,
also stärkende Mittel, besonders China,
Eisenpräparate.
Tonkabohnen, s. Dipteryx.
Tonkakampfer, s. Kumarin.
Tonkunst, s. Musik.
Tonleiter, nach der ältern Musiklehre identisch mit
Tonart (s. d.). Seit aber die neuere Theorie die Terzverwandtschaft
der Töne und Klänge erkannt hat (s. Tonverwandtschaft),
erscheint es als Willkür, z. B. den E dur-Akkord und As
dur-Akkord als nicht zur C dur-Tonart gehörige Klänge zu
betrachten. Der Begriff der Tonart ist daher zu dem der
Tonalität (s. d.) erweitert worden, während die T. als
Akkord der Tonika mit Durchgangstönen erscheint:
Dur-Tonleiter ^[s. Bildansicht]
Moll-Tonleiter ^[s. Bildansicht]
Wie der tonische, kann aber auch jeder andre Akkord, der tonalen
Harmonik mit Durchgangstönen auftreten; soll die
Tonalität scharf ausgeprägt bleiben, so werden die
Durchgänge so gewählt werden müssen, daß die
der Tonika angehörigen Töne bevorzugt werden. Die dann
zum Vorschein kommenden Skalen sind die alten Kirchentöne
(oder griechischen Oktavengattungen); die Skala der Dominante:
mixolydisch ^[s. Bildansicht]
die Skala der Unterdominante:
lydisch: ^[s. Bildansicht]
und so fort. Vgl. Riemann, Neue Schule der Melodik (Hamb.
1883).
Tonmalerei, Gattung von Musik, deren
hauptsächlichster Zweck darin besteht, mittels der Tonsprache
Zustände und Begebnisse zu schildern, welche der Sinnen- und
Erscheinungswelt entnommen sind. Die Frage über Berechtigung
und Zulässigkeit der T. gehört zu den unentschiedensten
auf dem Gebiet der Ästhetik der Tonkunst. Unbedingt verworfen
wird die T. von den Vertretern der sogen. strengen
Klassizität, wiewohl nicht abzuleugnen ist, daß, wie die
Meister des 17. Jahrh., so auch alle klassischen Tondichter des 18.
und 19. Jahrh., z. B. Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven,
Weber, Schubert, Spohr u. a., die T. mit Vorliebe gepflegt haben.
Jenen gegenüber stehen diejenigen, welche der Tonkunst
geradezu einen begrifflich erklärbaren Inhalt zu vindizieren
und zu diesem Behuf die Ausdrucksfähigkeit derselben extensiv
und intensiv zu vervollkommnen streben, als die entschiedensten
Anhänger der T.; nur verfallen diese wieder in ein
gefährliches Extrem, indem sie in Komposition und Kritik einer
realistischen Richtung huldigen, die nur in Ausnahmefällen mit
der
753
Tonna - Tonsur.
Tonkunst ein ersprießliches Bündnis einzugehen
vermag. Die Musik kann allerdings der realen Außenwelt
angehörige Dinge nicht in jener konkreten Weise schildern wie
Dichtkunst und bildende Kunst. Dagegen vermag sie gerade nach jener
Seite hin, wo die beiden genannten Künste ihrer Natur nach
mehr oder minder lückenhaft bleiben, nicht nur ergänzend
aufzutreten, wie in der Vokalmusik und im Drama, sondern auch als
unabhängige Kunst in den Formen der reinen Instrumentalmusik
die Vorgänge des innersten Gefühlslebens wiederzugeben,
insofern erst durch sie die mit der poetischen Grundidee
verknüpften Seelenstimmungen zur vollkommenen und
künstlerisch-selbständigen Erscheinung gebracht werden
können. Die Musik kann und soll demnach nicht das wiedergeben,
was das Auge sieht und der Geist denkt, sondern nur die hieraus
erwachsenden Empfindungen, die Seelenbilder in ihrer zeitlichen
Form. So stellt die Tonkunst die im Innern fortlebende
Außenwelt dar, und die T. würde alsdann richtiger als
musikalische Stimmungsmalerei zu bezeichnen sein. Dies hat
Beethoven wohl erwogen, wenn er der Pastoralsymphonie die Worte
vorausschickte: "Mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei". Ja,
selbst da, wo Beethoven eine scheinbar ganz materielle T. gibt, wie
am Schluß des zweiten Satzes (Nachtigallengesang,
Wachtelschlag und Kuckuckruf) und im letzten Satz (Schilderung des
Gewitters), offenbart sich eine so schöne geistige
Bedeutsamkeit, daß darin nur eine symbolische Auffassung der
Natur und im letztern Fall nur der durch die Schilderung der
äußern Hergänge in der Natur hervorgerufene
Stimmungston zur Darstellung gelangt. Eine solche symbolische
Auffassung aber ist es überhaupt, die der T. ihren innern
künstlerischen Wert verleiht, indem sie die Vorstellung des
Gegebenen bei hörbaren Vorgängen durch ähnliche
Klangwirkung nachahmt (wie z. B. Marschner das Heulen des
Sturmwindes in "Hans Heiling"), bei sichtbaren auch analoge
Tonformen wiedergibt, wie sich z. B. in einigen Messen die Worte:
"et descendit de coelis" in absteigender und "ascendit de coelum"
in aufsteigender Tonfolge komponiert finden. Am leichtesten sind
solche Vorkommnisse zu schildern, welche einen gewissen Rhythmus in
sich tragen. Die T. fand in F. David und Berlioz und in neuester
Zeit namentlich in Liszt, Raff, zum Teil auch in R. Wagner, also
vorzugsweise in den Anhängern der sogen. Programmmusik (s.
d.), ihre hauptsächlichsten Vertreter.
Tonna, Amtsgericht, s. Gräfentonna.
Tonnage (franz., spr. -ahsch), Schiffsladung,
Tonnengeld.
Tonnay-Charente (spr. tonnä-scharangt), Stadt im
franz. Departement Niedercharente, Arrondissement Rochefort, an der
Charente, über welche eine Drahtbrücke führt, und an
der Eisenbahn Rochefort-Angoulême, hat einen Hafen, welcher
einen Annex des Hafens von Rochefort (s. d. 1) bildet und einen
Warenverkehr von 163,000 Ton. aufweist, Fabrikation von
Seilerwaren, Schiffbau, bedeutenden Handel mit Branntwein und
(1881) 2256 Einw.
Tonne, großes Faß; dann Maß und Gewicht
für trockne Dinge, als Handelsgewicht in Deutschland = 1000
kg. Schiffs- oder Seetonne, Schiffsfrachtgewicht, = 1000 kg;
über Registertonne s. Schiffsvermessung; in Schweden, Norwegen
und Dänemark ist T. Feldmaß: die schwedische T. Landes
(Tonnstelle) = 49,366, die norwegische = 39,379, die dänische
= 55,162 Ar. Eine T. Goldes bedeutet eine Summe von 100,000
Thlr.
Tonneau (spr. -noh, T. de mer, T. metrique), in
Frankreich Gewicht = 1000 kg, an Raum = 42 Pariser Kubikfuß =
1,440 cbm, als Getreidemaß = 15 Hektol.; in Marseille nach
der Ware verschieden, = 900 Liter Öl, 18 Kisten à 25
Flaschen Wein etc.
Tonneins (spr. tonnängs, Stadt im franz. Departement
Lot-et-Garonne, Arrondissement Marmande, an der Garonne und der
Südbahn (Bordeaux-Toulouse), hat eine reformierte
Konsistorialkirche, ein Hengstedepot, eine Tabaksfabrik, Handel mit
Hanf, Wein etc. und (1886) 5447 Einw.
Tonnengehalt eines Schiffs, s. Schiffsvermessung.
Tonnengeld, eine nach dem Tonnengehalt (Tragkraft)
bemessene, von Seeschiffen, insbesondere solchen fremder Flagge,
beim Einlaufen in die Häfen erhobene Abgabe (s.
Zuschlagszölle).
Tonnengewölbe, s. Gewölbe, S. 311.
Tonnenkilometer, s. Kilometer.
Tonnenmühle, s. Wasserschnecke.
Tonnensystem, s. Exkremente, S. 966 f.
Tonnerre (spr. tonnähr), Arrondissementshauptstadt
im franz. Departement Yonne, am Armançon und an der
Eisenbahn Paris-Dijon, hat eine schöne Kirche (St.-Pierre),
ein Coll`ege, ein Spital (mit dem Grabmal des Ministers Louvois),
Bibliothek, Fabrikation von Webwaren, Zement, Schokolade,
vorzüglichen Weinbau, Steinbrüche und (1886) 4774
Einw.
Tönning (Tönningen), Stadt in der preuß.
Provinz Schleswig-Holstein, Kreis Eiderstedt, Knotenpunkt der
Linien Jübek-T. der Preußischen Staats- und
Neumünster-T. der Westholsteinischen Eisenbahn, hat eine
evang. Kirche, ein Amtsgericht, ein Landratsamt, ein Hauptzollamt,
einen Hafen, eine Schiffswerfte, Eisengießerei und
Maschinenbau, ansehnliche Fettviehausfuhr nach und
Steinkohleneinfuhr aus England und (1885) 3248 evang. Einwohner. T.
wurde 1644 befestigt und in der Folge wiederholt von den Dänen
erobert, die 1714 die Festungswerke schleiften.
Tönnisstein, Kurort im preuß. Regierungsbezirk
Koblenz, Kreis Mayen, zur Gemeinde Kell gehörig, unweit der
Station Brohl der Linie Kalscheuren-Bingerbrück der
Preußischen Staatsbahn, mit Kurhaus und einem gegen
chronische Katarrhe wirksamen alkalischen Säuerling. In der
Nähe der schon den Römern bekannte Säuerling
Heilbrunnen.
Tönsberg, älteste Stadt Norwegens, schon ums
Jahr 871 gegründet, im Amt Jarlsberg und Laurvik belegen, an
der Eisenbahn Drammen-Skien, mit 4913 Einw., ist in der neuern Zeit
der Mittelpunkt einer bedeutenden Schiffahrt mit dem Ausland
geworden. Ihr gehört vornehmlich der größte Teil
der norwegischen Flotte, die jedes Jahr im Monat März nach dem
Eismeer auf Walfischfang ausgeht, an. T. selbst besaß 1885:
139 Fahrzeuge von 61,242 Ton., die angrenzenden Distrikte 344
Fahrzeuge von 89,496 T. Der Wert der Einfuhr betrug 1885: 882,500
und der der Ausfuhr 295,000 Kronen. T. ist Sitz eines deutschen
Konsuls. Unweit der Stadt liegen die dicht bevölkerten und
reichen Inseln Nöterö und Tjömö. In der
Umgegend finden sich mehrere in der Landesgeschichte berühmte
Orte, z. B. das Slotsfjeld mit den Überresten der
mittelalterlichen Burg Tönsberghus und der Edelhof Jarlsberg,
sonst Söheim genannt.
Tonschluß, s. v. w. Kadenz.
Tonschnitt, s. Holzschneidekunst, S. 682.
Tonsillae (lat.), in der Anatomie s. v. w. Mandeln (s.
d.); Tonsillotomie, Exstirpation derselben.
Tonsur (lat.), die geschorne Stelle auf dem Scheitel als
Ehrenzeichen des katholischen Priesterstandes.
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl., XV. Bd.
48
754
Tontinen - Topana.
Büßende ließen sich schon früh das Haupt
ganz kahl scheren; von ihnen nahmen die Mönche diese Sitte an,
und von diesen ging sie im 6. Jahrh. auf alle christlichen
Geistlichen über, denen sie 633 auf der vierten Synode zu
Toledo gesetzlich vorgeschrieben ward. Man unterschied aber ein
kahl geschornes Vorderhaupt als T. des Apostels Paulus von der
kreisförmigen Platte auf dem Scheitel, der T. des Apostels
Petrus. Jene war in der griechischen Kirche sowie in etwas andrer
Form, als T. des Jacobus, bei den Briten und Iren üblich,
diese in der abendländischen Kirche Priestern und Mönchen
gemein. Die eben erst in den geistlichen Stand Eingetretenen tragen
sie im Umfang einer kleinen Münze, die Priester im Umfang
einer Hostie, die Bischöfe noch größer, und bei dem
Papst bleibt nur ein schmaler Kreis von Haaren über der Stirn
stehen.
Tontinen, Anstalten, welche gegen Entgelt Einzahlungen
unter der Verpflichtung annehmen, dieselben mit Zinsen nach Ablauf
bestimmter Zeit denjenigen der Einleger, welche dann noch am Leben
sein werden, als Kapital oder Rente zurückzugewähren. Sie
erhielten ihren Namen nach ihrem Erfinder, dem italienischen Arzt
Lorenzo Tonti, welcher auf Veranlassung des Kardinals Mazarin 1653
die erste Tontine in Paris einrichtete. Sie hatten vornehmlich in
den romanischen Ländern großen Anklang gefunden. In
Frankreich wurde das Tontinengeschäft bald nach seiner
Erfindung vom Staat betrieben, verwickelte denselben aber in arge
Finanzschwierigkeiten und wurde deshalb wieder aufgegeben; die
letzte größere Tontine wurde 1759 eingerichtet. Die T.,
welche sehr verschieden gestaltet sein können, gehören
nicht zu den Versicherungsanstalten, wenn nicht der Unternehmer ein
Risiko dabei zu tragen hat (z. B. wenn die Auszahlungen in Form von
Leibrenten bis zum Tode des letzten Überlebenden erfolgen).
Die oft und noch neuerdings versuchte Verbindung der T. mit einer
Lotterie ist auch in romanischen Staaten meistens ausdrücklich
verboten, z. B. in Italien. Vgl. Versicherung. - Tontine
heißt auch ein französisches Kartenglücksspiel, das
mit der vollständigen Whistkarte von 12-15 Personen gespielt
werden kann.
Tonus (lat., "Spannung"), eine während des Lebens
bestehende schwache, unwillkürliche, aber vom Nervensystem
abhängige Kontraktion der Muskulatur Während man
früher den T. als eine automatische Funktion auffaßte,
haben neuere Beobachtungen ergeben, daß er reflektorischer
Natur sei, und daß die Muskeln erst infolge einer gewissen
Spannung in tonische Kontraktion geraten. Da der Muskel in letzterm
Zustand unzweifelhaft einen größern Stoffverbrauch
aufweist als im Zustand der Ruhe, so dürfte der T. für
die Erhaltung und Regulierung der Körperwärme eine hohe
Bedeutung besitzen. Von außerordentlichem Wert ist der T.
für die Mechanik der Ortsveränderung; durch den T. wird
es nämlich ermöglicht, daß bei der Arbeit der
Muskeln sofort eine Annäherung der Befestigungspunkte bewirkt
wird, ohne daß erst Zeit und Kraft zur Anspannung des
schlaffen Muskels erforderlich wären. Nach dem Tod erlischt
der T., und infolgedessen erscheinen die Gesichtszüge der
Leichen welk und schlaff.
Tonverwandtschaft, ein moderner musikalischer Begriff,
welcher sich auf die Zusammengehörigkeit der Töne zu
Klängen bezieht. Verwandt im ersten Grade, direkt verwandt
sind Töne, welche einem und demselben Klang angehören (s.
Klang). Mit c im ersten Grad verwandt sind g, f, e, as, a und es,
denn c:g gehört dem C dur-Akkord oder C moll-Akkord an, c:f
dem F dur-Akkord oder F moll-Akkord, c:e dem C dur-Akkord oder A
moll-Akkord, c:as dem As dur-Akkord oder F moll-Akkord, c:a dem F
dur-Akkord oder A moll-Akkord, c:es dem As dur-Akkord oder C
moll-Akkord. Im ersten Grad verwandte Töne sind konsonant
(vgl. Konsonanz). Verwandt im zweiten Grad sind Töne, welche
nicht demselben Klang angehören, daher nicht direkt
aufeinander bezogen werden, sondern durch Vermittelung von
Verwandten ersten Grades. Es ist müßig, Verwandte
dritten und vierten oder noch fernern Grades anzunehmen, da alle
Töne, welche nicht direkt verwandt sind, gegeneinander
dissonieren. Die verschiedene Qualität der Dissonanzen
hängt allerdings von der Art der Vermittelung ab, welche das
Verständnis des Intervalls ermöglicht; diese Vermittelung
geschieht aber nicht durch Töne, sondern durch Klänge, so
daß die Klangverwandtschaft in Frage kommt. Töne, die im
ersten Grad verwandten Klängen angehören, sind leichter
gegeneinander verständlich als solche, die auf im zweiten Grad
verwandte Klänge bezogen werden müssen. Im ersten Grad
verwandte Klänge sind: 1) solche gleichartige (beide Dur oder
Moll), von denen der Hauptton des einen im ersten Grad verwandt ist
mit dem Hauptton des andern; 2) solche ungleichartige, von denen
einer der Wechselklang eines Akkordtons des andern ist, d. h.
für den Durakkord der Mollklang (Unterklang) des Haupttons,
Quinttons und Terztons, für den Mollakkord der Durklang des
Haupttons, Quinttons und Terztons, also allgemein:
Hauptwechselklänge (Ober- und Unterklang desselben Tons),
Quintwechselklänge und Terzwechselklänge; dazu kommen
noch die Leittonwechselklänge. Mit dem C dur-Akkord sind also
im ersten Grad verwandt der G dur-, F dur-, E dur-, As dur-, A
dur-, Es dur-, F moll-, C moll-, A moll- und E moll-Akkord; mit dem
A moll-Akkord dagegen der D moll-, E moll-, E moll-, Cis moll-, C
moll-, Fis moll-, E dur-, A dur-, C dur- und F dur-Akkord. Alle
übrigen sind nicht direkt verständlich, sondern
bedürfen der Vermittelung oder nachträglichen
Erklärung. Da die Tonartenverwandtschaft abhängt von der
Verwandtschaft der Toniken (Hauptklänge), so sind alle die
Tonarten mit C dur, resp. A moll im ersten Grad verwandt, deren
Tonika einer der Klänge ist, welche hier als im ersten Grad
verwandt mit dem C dur-, resp. A moll-Akkord aufgeführt sind.
Im zweiten Grad verwandt mit der C dur-Tonart sind dagegen z. B. D
dur, B dur, H dur, Des dur, D moll, H moll und alle noch ferner
stehenden; mit der A moll-Tonart: G moll, H moll, B moll, Gis moll,
G dur, B dur etc.
Tonwechselmaschine, s. Pistons.
Tooke (spr. tuk), 1) Thomas, engl. Nationalökonom,
geb. 1774 zu St. Petersburg als der Sohn des Historikers William
T., erwarb sich als Teilnehmer eines großen Handelshauses
reiche Erfahrungen im Handels- und Finanzwesen. Von 1820, wo er die
berühmte Merchant's petition in favour of free trade
verfaßte, war er bis zu seinem Tod, 1858, an allen
kommerziellen Enqueten und an der Gesetzgebung auf allen Gebieten
wirtschaftlicher Natur beteiligt. Er veröffentlichte eine
sechsbändige "History of prices" (Lond. 1838-57, Bd. 5 u. 6
von Newmarch bearbeitet), welche den englischen Handel von 1793 bis
1856 schildert; "Inquiry into the currency principle" (1844); "On
the bank charter act of 1844" (1855).
2) J. Horne, Schriftsteller, s. Horne Tooke.
Toowoomba, s. Tuwumba.
Top (Topp), s. Takelung.
Topana, eine Wurzel, s. Bunium.
755
Topas - Topelius.
Topas, Mineral aus der Ordnung der Silikate
(Andalusitgruppe), kristallisiert in säulenförmigen,
rhombischen Kristallen, auch derb in mangelhaft ausgebildeten
Individuen (Pyrophysalit), in parallelstängeligen Aggregaten
(Pyknit, Stangenstein), losen Kristallen und abgerollten
Stücken auf sekundärer Lagerstätte. T. ist selten
farblos und wasserhell, gewöhnlich gelblichweiß bis
gelb, auch braun, rötlichweiß bis rot,
grünlichweiß bis grün, mitunter violblau (diese
Farben bleichen aber am Tageslicht aus), durchsichtig bis
kantendurchscheinend, glasglänzend. Er phosphoresziert beim
Erhitzen mit gelblichem oder bläulichem Schimmer und besitzt
besonders interessante thermoelektrische Eigenschaften. Härte
8, spez. Gew. 3,51-3,57. Er besteht aus Aluminiumsilikat mit einem
analog zusammengesetzten Kieselfluoraluminium 5 Al2SiO5 +
Al2SiFl10. Sehr reich sind die Kristalle an mikroskopischen
Flüssigkeitseinschlüssen, darunter flüssige
Kohlensäure. Durch Glanz und Durchsichtigkeit ausgezeichneter
edler T. findet sich in Sibirien (Kristalle von über 10 kg
Gewicht), am Schneckenstein in Sachsen, zu Rozna in Mähren mit
Bergkristall, Turmalin, Steinmark oder Lithionglimmer in
granitischen Gesteinen, in Brasilien (Brasilian) in
Chloritschiefer. Außerdem führen die Zinnerzlagerstatten
des Erzgebirges und Cornwalls T. ; auf sekundärer
Lagerstätte findet er sich oft mit andern Edelsteinen in
Brasilien, auf Ceylon, in Aberdeen. Der Pyrophysalit stammt aus
norwegischen Graniten und Gneisen, der Pyknit aus den
Zinnerzlagerstätten von Altenberg in Sachsen und aus einem
Magneteisenlager bei Durango in Mexiko (s. Tafel "Edelsteine", Fig.
1-3). Die schönen Varietäten des Topases, namentlich die
wasserhellen (Pingos d'agoa, Wassertropfen), die gelbroten und die
dunkel gelbbraunen, sind Edelsteine zweiten Ranges. In Brasilien
sollen jährlich gegen 900 kg gewonnen werden. Die gelbroten
glüht man vorsichtig in geschlossenen Gefäßen,
wodurch sie lichtrot (gebrannte Topase, brasilische Rubine) werden
und im Preis bedeutend steigen. Die lichtbläulichen und
grünlichen Varietäten gehen als Aquamarin. Sonstige
Handelsnamen sind den Fundorten entlehnt, da dieselben meist
charakteristische Farbenvarietäten liefern. So wird der
bläuliche sibirischer oder taurischer T., der goldgelbe
brasilischer T., der safrangelbe indischer T., der blaß
weingelbe sächsischer T. oder Schneckentopas (vom
Schneckenstein) und, wenn er eine grünliche Farbe hat, wohl
auch sächsischer Chrysolith genannt. Orientalischer T. ist
bräunlichgelber Korund, böhmischer T. Citrin, die gelb
gefärbte Varietät des Bergkristalls, zu welchem auch die
grauwolkigen Rauchtopase gehören. Gelblicher Flußspat
führt ebenfalls den Namen T. Mit dem T. der Alten ist unser
Mineral wahrscheinlich nicht identisch. Die schlechtern Sorten des
Topases dienen als Surrogat des Schmirgels.
Topasfels, auf wenige Lokalitäten beschränktes
Gestein von breccienartigem Aussehen, besteht aus Quarz und Topas,
in körnigem Gemenge wechselnd mit Lagen von Turmalin; in die
zahlreichen Drusenräume ragen Quarz- und Topaskristalle mit
frei ausgebildeten Enden hinein. Außerdem beteiligen sich
noch ein dem Steinmark ähnliches Mineral und Glimmer an der
Zusammensetzung. Das Gestein bildet z. B. den als Topasfundort
bekannten Schneckenstein bei Auerbach im sächsischen Vogtland,
wo es gangförmig im Glimmerschiefer auftritt. Verwandte
Gesteine werden von mehreren Zinnerzlagerstätten
beschrieben.
Topazolith, gelbe Varietät des Granats (s. d.).
Tope (aus sanskr. Stupa, "Tumulus"), die einfachste Form
der Kultusdenkmäler des Buddhismus,
grabhügelähnliche Gebäude, in denen, in kostbaren
Kapseln verschlossen, Reliquien Buddhas und seiner Schüler
aufbewahrt wurden. Sie sind in halbkugelförmiger Ausbauchung
aus Steinen errichtet und ruhen auf einem terrassenartigen, in
späterer Zeit bisweilen hoch emporgeführten Unterbau,
manchmal von einem Kreise schlanker Säulen umgeben und mit
besonderer Portalanlage versehen; die Krone bildet ein Schirm. Die
Halbkugel soll eine Wasserblase vorstellen, womit Buddha den
menschlichen Leib vergleicht. Dergleichen Denkmäler sind in
großer Anzahl über Indien bis Afghanistan hinein und
gegen Norden bis ins südliche Sibirien verbreitet. Auf Ceylon
und in Vorderindien heißen sie Dagopa (aus
Dhâtugôpa, "Reliquienbehälter"). Vgl. Ritter, Die
Stupas (Berl. 1838); Wilson, Ariana antiqua (2. Ausg., Lond. 1861);
Cunningham, The Bhilsa Topes (das. 1854); Köppen, Die Religion
des Buddha, Bd. 1, S. 535 ff. (Berl. 1859).
Topeka, Hauptstadt des nordamerikan. Staats Kansas, am
Kansasfluß, mit Gelehrtenschule (Lincoln College),
Töchterschule, Staatenhaus, Mühlen, Gießereien,
Eisenbahnwerkstätte und (1880) 15,452 Einw. In der Nähe
Kohlen- und Eisengruben. T. wurde 1854 gegründet.
Topelius, Zachris, finnisch-schwed. Dichter und
Schriftsteller, geb. 14. Jan. 1818 auf Kuddnäs Gaard bei
Nykarleby, wurde, nachdem er bei Runeberg Privatunterricht
genossen, Student in Helsingborg, promovierte 1840 und redigierte
von 1842 bis 1860 die "Helsingfors Tidningar". worin er seine
ersten Gedichte und Novellen brachte. 1852 wurde er Lektor der
Geschichte am Gymnasium in Wasa, 1854 außerordentlicher
Professor der finnischen Geschichte an der Universität
Helsingborg, 1863 Ordinarius, endlich 1876 Professor der
allgemeinen Geschichte daselbst, von welcher Stellung er 1878 mit
dem Titel Staatsrat zurücktrat. T. ist nächst Runeberg
der angesehenste Dichter Finnlands; er hat sich mit Glück in
allen Zweigen der Poesie bewegt, und überall begegnet man
einem milden, frommen Sinn in einer vollendeten Form. In der Lyrik
("Ljungblommor", Stockh. 1845-54; "Sånger", 1861; "Nya blad",
1870) ist er am glücklichsten, wenn er seinen patriotischen
und religiösen Stimmungen Worte leiht. Seine bekanntesten
Schauspiele sind: "Efter femtio år" ("Nach 50 Jahren",
Stockh. 1851), das reich an Effekt ist, aber Gustavs Zeit mit zu
schwarzen Farben malt, und "Regina af Emmerits" (1854). 1861 gab er
eine Sammlung seiner "Dramatiska dikter" heraus (neue Ausg. 1881).
Am populärsten wurde er durch seine Novellen und
Kinderbücher. Unter den erstern ragt besonders hervor:
"Fältskärns berättelser" ("Erzählungen eines
Feldschers", Stockh. 1858-67, 5 Bde.; deutsch, Leipz. 1880), ein
Cyklus romantischer Schilderungen aus Finnlands und Schwedens
Geschichte von Gustav II. Adolf bis Gustav III. Die spätern
"Sagor" (1847-52, 4 Sammlungen) und "Läsning för barn"
(1865-84, 6 Bücher; ins Finnische, Norwegische, Engl. u.
Deutsche übersetzt) machten ihn zum Liebling der Jugend. Sein
für die Volksschulen Finnlands geschriebenes "Naturens bok"
erlebte sieben schwedische und fünf finnische Auflagen. Auf
dem Boden strenger Wissenschaft stehen seine Vorlesungen etc. und
seine "Geschichte des Kriegs in Finnland" (1850). Als anziehender
Schilderer seiner Heimat endlich erscheint er in den Werken:
"Finland
756
Topete y Carballo - Topik.
framstäld i teckningar" (1845-52) und "En resa i Finland"
(1873; deutsch von Paul, Helsingf. 1885). T.' Popularität
beruht auf seinem reinen, für alles Gute und Edle warmen
Gefühl und den zu gleicher Zeit frischen und wehmütigen
Naturtönen, welche durch seine Dichtungen gehen. In deutscher
Übersetzung erschienen neuerdings von ihm sechs Novellen: "Aus
Finnland" (Gotha 1888, 2 Bde.).
Topete y Carballo (spr. i karwalljo), I. B., span.
Admiral, geb. 24. Mai 1821 zu Tlacotalpa in Yucatan, trat 1835 in
die Marine, befehligte 1860 im Kriege gegen Marokko die spanische
Flotte, zeichnete sich dann in dem Kriege gegen Peru aus, war 1867
Konteradmiral und Hafenkapitän von Cadiz und nahm
hervorragenden Anteil an der Revolution vom September 1868. Auf
seinem Schiff Saragossa ward die Flagge der Empörung zuerst
aufgepflanzt. Er ward als Marineminister Mitglied der
provisorischen Regierung vom 8. Okt. 1868, geriet jedoch als
Beförderer der Thronkandidatur des Herzogs von Montpensier
wiederholt mit Prim in Streit, nach dessen Tod er wenige Tage das
Präsidium des Kabinetts innehatte. 1871-72 war T. Minister der
Kolonien, im Juni 1872 wieder wenige Tage und vom 4. Jan. bis 13.
Mai 1874 Marineminister. Hierauf zog er sich in das Privatleben
zurück und starb 31. Okt. 1885 in Madrid.
Topfbaum, s. Lecythis.
Topfbraten, in Thüringen und Sachsen beliebtes
Gericht, zu dessen Herstellung Zunge, Niere, Herz, Rüssel,
Ohrwange und etwas Schwarte eines frisch geschlachteten Schweins
gekocht und mit einer braunen Zwiebelsauce gedämpft
werden.
Topfen, s. Quark.
Töpfer, 1) Johann Gottlob, Organist, geb. 4. Dez.
1791 zu Niederroßla in Thüringen, besuchte das
Gymnasium, dann das Lehrerseminar in Weimar, wo er zugleich unter
Destouches und A. E. Müller gründliche Musikstudien
machte, wurde 1817 Seminarmusiklehrer, 1830 Stadtorganist daselbst;
starb 8. Juni 1870. Seine Bedeutung beruht auf seinen Schriften
über die Orgel, durch welche er vielfach reformatorisch
gewirkt hat. Die hauptsächlichsten sind: "Die Orgel, Zweck und
Beschaffenheit ihrer Teile" (Erf. 1843); "Theoretisch-praktische
Organistenschule" (das. 1845); "Lehrbuch der Orgelbaukunst" (Weim.
1856, 4 Bde.; 2. Aufl. von Allihn, 1888) etc. Als Komponist trat er
mit einer großen Orgelsonate, einem Konzertstück
für Orgel, einer Kantate: "Die Orgelweihe", einem Choralbuch
(4. Aufl., Weim. 1878), kleinen Orgelstücken u. a. hervor.
2) Karl, Lustspieldichter, geb. 26. Dez. 1792 zu Berlin,
debütierte als Schauspieler in Strelitz, ging dann nach
Breslau, Brünn und 1815 an das Hofburgtheater zu Wien. Daneben
versuchte er sich auch in Lustspielen, von denen "Der beste Ton" u.
"Freien nach Vorschrift" von der Kritik günstig aufgenommen
wurden. 1820 ließ er sich als Schriftsteller in Hamburg
nieder, wo er 22. Aug. 1871 starb. Von seinen spätern
Stücken hat besonders "Rosenmüller und Finke" Glück
gemacht. Seine dramatischen Produkte, welche als "Lustspiele" (neue
Ausg., Leipz. 1873, 4 Bde.) erschienen, entbehren zwar jedes
poetischen Gehalts, zeichnen sich aber durch theatralische
Wirksamkeit und eine gewisse Sorgfalt in der Durchführung aus.
Auch "Erzählungen und Novellen" (Hamb. 1842-44, 2 Bde.)
veröffentlichte T.
Töpferei (Häfnerei), ehemals zünftiges
Handwerk, welches sich mit Verfertigung irdener Ware, seltener mit
der Fabrikation feinerer Arbeiten, zuweilen auch mit der
Herstellung irdener Öfen und in neuerer Zeit an manchen Orten
auch mit der Fabrikation architektonischer Verzierungen, Basreliefs
etc. beschäftigt. S. Thonwaren.
Töpfererz, s. Alquisoux.
Töpferscheibe, s. Thonwaren, S. 663.
Töpferthon, s. Thon.
Töpffer, Rudolf, Maler und Novellist, geb. 31. Jan.
1799 zu Genf, Sohn des Malers Wolfgang Adam T. (gest. 1847),
widmete sich der Kunst, ging aber wegen eines Augenleidens bald zum
Lehrfach über, gründete 1825 ein Pensionat, das er bis zu
seinem Tod leitete, wurde 1832 zum Professor an der Genfer Akademie
ernannt und starb 8. Juni 1846. Von seinen Novellen fanden den
meisten Beifall die "Nouvelles genevoises" (Par. 1845; deutsch
unter andern von Zschokke, Aarau 1839 u. Stuttg. 1885); ferner
"Voyages en zigzag" (1844); "Nouvelles voyages en zigzag" (1854);
"Nouvelles et mélanges" (1840); "La bibliothèque de
mon oncle" (1843; deutsch, Leipz. 1847) und "Rose et Gertrude"
(1845; deutsch, Hildburgh. 1865). Für seine
künstlerischen Arbeiten bediente er sich nur des Stifts; aber
die Genrezeichnungen und Karikaturen, womit er seine humoristischen
Reisebeschreibungen, wie die "Voyages en zigzag" , illustrierte,
sind voll Wahrheit, Reiz und Satire. Namentlich gehören
hierher seine sechs kleinen Romane in Bildern, die in der
"Collection des histoires en estampes" (mit französischem u.
deutschem Text, Genf 1846-47, 6 Bde.) gesammelt erschienen. Vgl.
Rambert. Écrivains nationaux suisses, Bd. 1 (Genf 1874);
Relave, La vie et les oeuvres de T. (Par. 1886); Blondel und
Mirabaud, Rodolphe T. (das. 1887).
Topfgießerei, die Herstellung gußeiserner
Kochgeschirre.
Topfhelm, s. Helm.
Topfpflanzen, die in Töpfen kultivierten Pflanzen im
Gegensatz zu den Freilandpflanzen, welche im freien Land
herangezogen werden.
Topfstein (Lavezstein, Giltstein, Lavezzi, Pierre
ollaire), meist graugrünes Gestein, aus einem Gemenge von
Chlorit, Talk, auch Serpentin und gelegentlich Quarz sowie
kohlensauren Verbindungen bestehend, ist lokal mit Serpentinen,
Talk- und Chloritschiefern eng verknüpft, kommt in den Alpen
(Chiavenna), in Norwegen und Nordamerika vor und eignet sich durch
seine Weichheit, welche Schneiden und Drehen gestattet, sowie durch
seine Feuerbeständigkeit zur Herstellung von Töpfen,
Ofenplatten etc.
Top-Hane (türk.), Zeughaus, Arsenal; Name einer
Vorstadt in Konstantinopel.
Topik (griech.), bei den Alten die Lehre von der
Auffindung des Stoffes zum Zweck der rhetorischen Behandlung irgend
eines Gegenstandes; insbesondere die systematische Zusammenstellung
allgemeiner Begriffe und Sätze (Topen, lat. loci communes),
die beim Ausarbeiten von Reden als Richtschnur oder Leitfaden
für die Auffindung und Wahl zweckmäßiger
Beweisgründe dienen sollten. Die T. wurde von den spätern
griechischen Rhetorikern und Grammatikern sowie von den Römern
mit Vorliebe behandelt, z. B. von Cicero in seinen Schriften: "De
inventione" und "Topica"; doch war sie im ganzen ein bloßer
Schematismus, insofern man derselben nicht die logischen Kategorien
zu Grunde legte, sondern gewisse allgemeine Dispositionen
aufstellte, um zur Auffindung des Stoffes zu gelangen. Im
Mittelalter verlor sie sich in leere Spielereien, und in neuerer
Zeit hat man eine besondere Behandlung der-
757
Topin - Torda-Aranyos.
selben als unersprießlich ganz aufgegeben. In der
Grammatik ist T. die Lehre von den Stellen, welche den einzelnen
Wörtern im Satz und den Sätzen in der Periode zukommen.
Biblische T. oder Topologie, eine Theorie der Grundsätze, nach
denen der Theolog bei der Wahl und Behandlung der biblischen
Beweisstellen zu verfahren hat.
Topin (spr. -päng). Marius, franz.
Geschichtschreiber, geb. 25. Dez. 1838 zu Aix, Neffe Mignets,
besuchte das dortige Lyceum und das in Gap und war 1856-70 in der
Verwaltung der Steuern thätig. Während der Belagerung von
Paris 1870-71 befehligte er ein Bataillon Nationalgarde und
gründete 1872 mit Mitchell den "Courrier de France". 1873
übernahm er die Redaktion der "Presse" und verteidigte das
Ministerium Broglie, da er bonapartistisch gesinnt ist. Er schrieb:
"Le cardinal de Retz, son génie, ses écrits" (1864,
3. Aufl. 1872); "Histoire d'Aigues-Mortes" (1865); "L'Europe et les
Bourbons sous Louis XIV" (1867, 3. Aust. 1879); "L'homme au masque
de fer" (1869, 3. Aufl. 1870), welche Werke von der Akademie mit
Preisen gekrönt wurden; "Louis XIII et Richelieu" (1876),
ebenfalls preisgekrönt, und "Romanciers contemporains"
(1876).
Topinambur, s. Helianthus.
Topisch (griech.), örtlich, im Gegensatz zu
allgemein, z. B. topische Schmerzen, topische Arzneien, topische
Recidive bösartiger Geschwulste.
Töpler, August, Physiker, geb. 7. Sept. 1836 zu
Brühl a. Rhein, studierte in Berlin Chemie und Physik, wurde
Chemiker, dann Dozent an der landwirtschaftlichen Akademie zu
Poppelsdorf bei Bonn, 1864 Professor an der polytechnischen Schule
zu Riga. Er widmete sich indes hauptsächlich der Physik und
wurde 1868 als Professor der Physik nach Graz berufen, von wo er
1876 in derselben Eigenschaft an das Polytechnikum zu Dresden
übertrat. T. zeigte sich besonders geschickt in Auffindung
neuer Beobachtungsmethoden und Konstruktion neuer Apparate. Seine
"Optischen Studien nach der Methode der Schlierenbeobachtung" (Bonn
1865) zeigten, wie man eine ganze Reihe von Erscheinungen, welche
sich sonst der Beobachtung entziehen, sichtbarmachen kann. Ebenso
machte er die stroboskopischen Scheiben zur Beobachtung
schwingender Körper nutzbar. Er konstruierte eine
Quecksilberluftpumpe, welche gar keine Hähne verlangt und
dadurch einen großen Vorzug vor der Geißlerschen hat,
gegen welche sie allerdings den Nachteil erheblich
größerer Dimensionen besitzt. Gleichzeitig mit Holtz
konstruierte T. eine wesentlich auf denselben Prinzipien beruhende
Elektrisiermaschine, welche sich durch die Anwendung von
Metallbelegungen von derjenigen von Holtz unterscheidet und von
dieser zurückgedrängt wurde, in der letzten Zeit aber
sich allgemeinere Anerkennung verschaffte, seit T. ihr durch
Anwendung einer großen Anzahl von Scheiben eine früher
nicht geahnte Stärke gab. Durch eine Anzahl
mathematisch-physikalischer Arbeiten, so über die
Fundamentalpunkte eines optischen Systems, über die Zerlegung
zusammengesetzter Schwingungen u. a. m., hat sich T. ebenso als
gediegener Theoretiker bewiesen.
Töpliz, 1) Badeort in Böhmen, s. Teplitz. -
2) Badeort in Krain, unfern Rudolfswerth, mit warmen Quellen
(34-38° C.) und (1880) 363 Einw. Vgl. Radics, Das Mineralbad T.
(Wien 1878).
Topo, Feldmaß in Peru, = 5000 QVaras = 35,9128
Ar.
Topographenkorps, eine in Rußland zum Zweck der
Landesvermessung 1822 errichtete und 1877 reorganisierte Truppe mit
einem Etat von 9 Generalen, 75 Stabs- und 370 Oberoffizieren,
welche sich aus den Topographenunteroffizieren der
Topographenabteilung ergänzen, nachdem dieselben einen
dreijährigen Kursus auf der Topographenschule in St.
Petersburg mit Erfolg durchgemacht haben.
Topographie (griech.), Ortsbeschreibung mit
möglichst genauem Eingehen auf alle Einzelheiten, welche das
Gelände bietet, seien sie von der Natur oder durch Kunst
geschaffen. Die Gewinnung eines möglichst genauen Kartenbildes
eines Landes ist der Zweck der topographischen Aufnahme desselben,
die in den europäischen Staaten durch die topographische
Abteilung der Generalstäbe in Maßstäben von
1:20,000 bis 1:25,000 erfolgt, während die topographischen
Karten teils in denselben, teils in kleinern Maßstäben
herausgegeben werden (s. Landesaufnahme).
Topologie (griech.), Ortslehre, Ortskunde.
Topolya (spr. topolja), Markt im ungar. Komitat
Bács-Bodrog, an der Bahnlinie Budapest-Semlin, mit (1881)
9500 ungar. Einwohnern, Weinbau, Schloß und
Bezirksgericht.
Toponomastik (griech., topographische Onomastik),
geographische Namenkunde, s. Onomatologie.
Topp, Toppnant, s. Takelung
Topuszko (spr. topúss-), Kurort im
kroatisch-slawon. Komitat Agram, an der Glina, mit
Schlammbädern und zahlreichen gegen Gicht und Rheuma wirksamen
indifferenten Thermen (60° C.), deshalb das kroatische
"Gastein" genannt. Vgl. Hinterberger, Die Thermal- und
Schlammbäder zu T. (Wien 1864).
Torcello (spr. -tschello), Insel in den Lagunen von
Venedig, 9 km nordöstlich von der Stadt gelegen, mit wenigen
von der ehemaligen bedeutenden Stadt T. erhaltenen Gebäuden,
unter denen besonders der Dom im Basilikensystem aus dem 7. Jahrh.
und die Kirche Santa Fosca, ein Zentralbau aus dem 9. Jahrh.,
Erwähnung verdienen. Das gegenwärtige Dorf T. hat nur 128
Einw.
Torda (Thorenburg), Stadt im ungar. Komitat Torda-Aranyos
und Station der Ungarischen Staatsbahn, am linken Ufer des Aranyos,
mit Franziskanerkloster, 9 Kirchen (2 römisch-katholische,
eine lutherische, eine reformierte, eine unitarische, eine
griechisch-unierte und 3 griechisch-nichtunierte), schönem
neuen Komitatshaus und (1881) 9434 ungarischen und rumän.
Einwohnern, die Getreide- und Weinbau und Viehzucht betreiben. T.,
Sitz des Komitats und eines Gerichtshofs, hat ein unitar.
Untergymnasium, bedeutende Viehmärkte, ein großes, schon
seit Römerzeiten bekanntes Salzbergwerk, mehrere Salzteiche
mit einem Solbad und mitten in der Stadt Reste der ehemaligen
Thorenburg. In der Nähe von T., wo sich viele römische
Altertümer finden und einst die römische Kolonie Pataissa
(Salinä) stand, ist die wild romantische Tordaer Schlucht (320
m tief und 25 km lang), die einen 30 km langen Kalkzug von oben bis
unten quer durchschneidet, und durch deren Mitte, fast die ganze
6-20 m breite Sohle einnehmend, der Bach Kerekes fließt. Im
S. die pittoresken Toroczkóer Kalkfelsen und der malerisch
gelegene, einst von Deutschen gegründete, jetzt von
unitarischen Ungarn bewohnte Ort Toroczkó (Eisenmarkt).
Torda-Aranyos (spr. -áranjosch), ungar. Komitat in
Siebenbürgen, grenzt an die Komitate Arad, Bihar, Klausenburg,
Maros-Torda, Kis-Küküllö, Unterweißenburg u.
Hunyad, umfaßt 3370 qkm (61,2 QM.), wird vom Aranyos und
seinen Nebenflüssen bewäs-
758
Tordalk - Torf.
sert, ist besonders im W. durch Ausläufer des Bihargebirges
sehr gebirgig (Muntje le mare 1828 m) und hat (1881) 137,031
ungarische und rumän. Einwohner, die meist Berg- und Ackerbau,
Viehzucht und Holzhandel betreiben. T. ist reich an Edelmetallen
und Mineralschätzen und wird von der Ungarischen Staatsbahn
(Klausenburg-Kronstadt) durchzogen. Sitz des Komitats ist Tord
a.
Tordalk, s. Alk.
Torell, Otto Martin, Naturforscher, geb. 5. Juni 1828 zu
Warberg, studierte in Lund Medizin und Naturwissenschaften, machte
größere wissenschaftliche Reisen in Europa, unternahm
1858 mit Nordenskjöld eine Reise nach Spitzbergen und besuchte
1859 Grönland und 1861 abermals mit Nordenskjöld
Spitzbergen. Inzwischen war er in Lund zum Adjunkten der Zoologie
und zum Intendanten des zoologischen Museums ernannt worden, 1866
erhielt er die Professur der Zoologie und Geologie in Lund, und
1871 wurde er Chef der geologischen Untersuchung Schwedens in
Stockholm. Die wissenschaftlichen Ergebnisse seiner Reisen, seine
Studien über die Eiszeit und die Tiefseefauna publizierte er
in den Schriften der Universität Lund und der Akademie der
Wissenschaften zu Stockholm.
Torelli, 1) Giuseppe, Violinspieler, geboren um 1650 zu
Verona, gest. 1708 als Konzertmeister in Ansbach, war mit Corelli
(s. d.) der bedeutendste Vertreter der Instrumentalmusik des 17.
Jahrh. und gilt als der Schöpfer des noch bis zu Händels
Zeit in Gebrauch gebliebenen Concerto grosso, derjenigen Form, aus
welcher die moderne Orchestersymphonie hervorgegangen ist.
2) Achille, ital. Lustspieldichter, geb. 5. Mai 1844 zu Neapel,
erhielt seine Ausbildung in einem Privatinstitut und schrieb mit 16
Jahren seine erste Komödie: "Chi muore, giace". womit er einen
Turiner Staatspreis gewann. Weniger glücklich waren ein paar
weitere Versuche: "Il buon vecchio tempo", "Cuore e corona", "Prima
di nascere"; besser gefiel das Lustspiel "Il precettore del
rè" (später betitelt: "Una corte nel secolo XVII"),
dessen Aufführung der ältere Dumas beiwohnte, der dem
jungen Dichter eine glänzende Laufbahn verkündigte. Mit
"La missione della donna" und "La verita" (1875) errang T. wieder
Preise; auch "Gli onesti" fand Anerkennung. 1866 kämpfte T.
als Freiwilliger im italienischen Heer und erlitt in der Schlacht
bei Custozza einen Sturz vom Pferd. Einen außerordentlichen
Triumph feierte er darauf (1867) mit seinem Lustspiel "I mariti".
Den Erwartungen, welche dies Stück für Torellis Begabung
erweckte, vermochte er mit den spätern Leistungen nicht
völlig zu entsprechen; doch errang er noch manchen Erfolg, so
mit "La fragilità" (1868), "La moglie" (1870), "Nonna
scelerata" (für die Ristori geschrieben, 1870); ganz besonders
aber erfreuten sich "Triste realtà" (1871) und "Il colore
del tempo" (1875) ehrenvoller Aufnahme. Dagegen blieben "Consalvo"
(1872), "La fanciulla" (1873), "La contessa di Berga" (1874),
"Mercede" (1878), "Scrollina" (1880) u. a. ohne Wirkung. Der grelle
Wechsel von Erfolgen und Mißerfolgen wirkte
einigermaßen verdüsternd auf das Gemüt des Dichters
und nährte eine Empfindlichkeit, die auch in seiner lyrischen
Sammlung "Schegge" zum Ausdruck kommt.
Toreno, Don José Maria Queypo de Llana Ruiz de
Saravia, Conde de, span. Staatsbeamter und Geschichtschreiber, geb.
1786 zu Oviedo, nahm Anteil an der Erhebung der spanischen Nation
gegen die Franzosen 1808 und erwarb sich schon damals als
Unterhändler des Bündnisses zwischen Spanien und England
sowie als Deputierter bei den Cortes 1810 und 1812 den Ruf eines
gewandten Diplomaten und Staatsmannes. Nach der Rückkehr
Ferdinands VII. 1814 flüchtete er nach Frankreich und kehrte
erst 1820 in sein Vaterland zurück. Infolge der
Wiederherstellung der absolutistischen Regierungsgewalt 1823
abermals verbannt, lebte er in Paris, kehrte 1832 nach Spanien
zurück, gewann bald bedeutenden politischen Einfluß und
trat 1834 als Finanzminister in das Kabinett. Im April 1835
übernahm er das Portefeuille des Auswärtigen und die
Präsidentschaft des Kabinetts. Doch führten
Aufstände, die seine reaktionären Maßregeln
hervorriefen, schon im September seinen Sturz herbei. In den
Cortes, die 18. Febr. 1840 zusammentraten, und in die er als
Mitglied der Prokuratorenkammer gewählt worden war, zeigte er
sich wieder als entschiedener Moderado. Nach dem bald darauf
erfolgenden Sturz der Moderadospartei begab er sich wieder nach
Paris, wo er 16. Sept. 1843 starb. Als Schriftsteller gewann er
vornehmlich durch seine "Historia del levantamiento, guerra y
revolucion de España" (Madr. 1835-37, 5 Bde.; Par. 1838, 3
Bde.; deutsch, Leipz. 1836-38, 5 Bde.) Ruf.
Toreros (fälschlich Toreadores, span.), alle am
Stiergefecht Beteiligten.
Toreutik (griech., lat. Caelatura), die Bildnerei in
Metallen, zur Unterscheidung von Skulptur (sculptura), der Arbeit
in Stein, Thon und Holz. Man denkt bei T. vorzugsweise an die
Bearbeitung des Metalls mit scharfen Instrumenten, an das
Ziselieren, das Herausschlagen oder Treiben der Formen mittels
Bunzen, doch unter Umständen auch an ein teilweises
Gießen in Formen. Die Künstler in dieser Arbeit
heißen Toreuten.
Torf, Aggregat pflanzlicher Substanzen in verschiedenem
Grade der Zersetzung, mit erdigen Materialien gemischt. In den
ersten Stadien der Bildung läßt der T. die Struktur der
Pflanzen noch deutlich erkennen; bei tiefer greifender Zersetzung
entsteht ein homogener, wenigstens bei Betrachtung mit
unbewaffnetem Auge strukturloser Körper. Nicht selten sind in
einem und demselben Torflager die untern Schichten, als die
ältern und die dem größern Druck ausgesetzten, in
der Zersetzung weiter vorgeschritten (reifer) als die obern
(unreifen). Wo die Bodenbeschaffenheit die Ansammlung
stagnierender, seichter Wasser gestattet, werden dieselben durch
gesellig auftretende Pflanzen überwuchert, die dann ihrerseits
wiederum die Wasser vor schneller Verdunstung schützen. So
entsteht ein Mittelzustand zwischen Land und Wasser: die Moore
(Lohden der Oberpfälzer, Ried in Schwaben und Thüringen,
Moos in Bayern). Es setzt demnach die Torfmoorbildung zunächst
beckenartige Einsenkungen des Bodens oder Kommunikationen mit
benachbarten Flüssen und Seen sowie einen undurchlässigen
Untergrund voraus. Dieser wird entweder von fettem, schlammigem
Thon (dem Knick der Norddeutschen) oder von einem
eigentümlichen Mergel (Wiesenmergel, Alm in Südbayern)
gebildet. Auch auf spaltenfreien Gesteinen, die ein Versinken des
Wassers nicht gestatten, und namentlich auf solchen, welche bei
ihrer Verwitterung einen undurchlassenden Thon liefern, können
Moore entstehen. Ferner müssen die klimatischen Bedingungen
einer schnellen Verdunstung des Wassers entgegenarbeiten, wie in
regen- und nebelreichen Gegenden, weshalb namentlich die
gemäßigten Zonen die eigentliche Hei-
759
Torf (Entstehung der Torfmoore).
mat der Moore bilden, während sie sich in der heißen
Zone auf hoch gelegene Plateaus und auf undurchdringliche
Wälder beschränken. Außer durch die
atmosphärischen Niederschläge, beziehen die Moore das
Wasser aus Seen, Schnee- und Eisfeldern, aus Flüssen, welch
letztere sie oft saumartig umziehen. Ferner können Landseen
mit flachen Ufern der Vermoorung unterliegen. Von den
Uferrändern aus zieht sich eine das Wasser überwuchernde
Vegetation immer tiefer in den See hinein; schwimmende Vorposten
werden abgerissen, bilden bewegliche Inseln, auf denen sich eine
reiche Sumpfflora ansiedelt, bis die Masse zu schwer wird und zu
Boden sinkt, um durch Wiederholung des Spiels eine immer
mächtigere, das Wasser allmählich verdrängende
Schicht zu bilden, die sich endlich mit der vom Ufer her
fortschreitenden Moorbildung vereinigt. So besitzt der Federsee in
Oberschwaben heute nur noch eine Wasseroberfläche von 256
Hektar, während er noch gegen das Ende des vorigen
Jahrhunderts 1100 Hektar groß war. Das Steinhuder Meer in
Schaumburg-Lippe ist von 5400 auf 3600 Hektar reduziert. Auch der
Kochelsee, der Chiemsee u. a. sind in einem solchen
Vertorfungsprozeß begriffen. Die Pflanzen, die zur Vermoorung
führen, sind solche, welche in großer Anzahl der
Individuen vorkommen und stark wuchern, besonders aber verfilzte
Wurzeln treiben: die Heiden (Calluna vulgaris und Erica tetralix),
Riedgräser (Carex-Arten), Wollgräser (Eriophorum),
Scirpus, Juncus, ganz besonders Nardus stricta, von Moosen Hypnum-
und Sphagnum-Arten, endlich in hoch gelegenen Lokalitäten die
Zwergkiefer (Pinus Pumilio). Je nach der hervorragenden Beteiligung
einzelner der genannten Pflanzen an der Moorbildung unterscheidet
man Wiesen- (Grünlands-) Moore und Heide- (Moos- oder Hoch-)
Moore. In erstern dominieren die Carex- und Eriophorum-Arten;
bisweilen tritt auch Hypnum in großer Menge auf, während
Sphagnum fehlt. Ihr Hauptsitz sind die Ufer der Flüsse und
Seen und zwar namentlich (den Bedürfnissen der aufbauenden
Pflanzen entsprechend) derer mit kalkhaltigem Wasser. Sie
umsäumen die Wasserbehälter, vom Trocknen aus zum Nassen
hin immer weiter wachsend. Dieser Richtung des Wachsens
entsprechend, besitzen sie eine flache, mitunter selbst nach dem
Innern zu eingesenkte Oberfläche. Ihre Torflager sind
gewöhnlich nur 1-2 m mächtig, selten bis 3 m, ganz selten
6 m und mehr. Hierher zählen viele norddeutsche Torflager, die
Donau- und Isarmoore, die vertorfenden Seen etc. Die zweite Art der
Moore bildet sich in Mulden und Becken, in denen sich etwas Wasser
ansammelt, das zunächst Kolonien von Sphagnum entstehen
läßt, auf denen sich dann besonders Erica und Calluna
ansiedeln. Bei günstigen Wässerungsverhältnissen
immer größere und größere Kreise schlagend,
gibt sich hier die Richtung der Ausbreitung durch eine Wölbung
zu erkennen, deren Gipfelpunkt im Innern bis zu 10 m höher
liegen kann als der Rand, eine Eigenheit der Erscheinung, auf
welche der Name Hochmoor hinweist. Die solchergestalt gebildeten
und zusammengesetzten Moore, die sich in Norddeutschland, dann
namentlich auch in den mittel- und süddeutschen Gebirgen
finden, besitzen meist stärkere Torflager als die Wiesenmoore,
und es werden aus der Emsgegend Mächtigkeiten bis zu 11 m, aus
Südbayern solche von 7,5 m und darüber, aus dem Jura bis
12 m angegeben. Endlich kommen Moore von gemischtem Charakter vor,
indem bald Inseln mit Wiesenmooren in Hochmooren, bald mit
Hochmooren in Wiesenmooren auftreten. - In schon abgebauten
Torflagern pflegt der T. nachzuwachsen, wenn mit der Entfernung der
Torfmasse nicht zugleich auch die Ursachen zur Moorbildung
hinweggenommen wurden. Nur wo (natürliche oder
künstliche) Entwässerung und (natürliche oder
künstliche) Änderung des wasserundurchlassenden
Untergrundes in einen durchlassenden vorliegt, unterbleibt das
Nachwachsen, wie denn die sogen. Fehnkolonien (s. d.) nur dort
durchführbar sind, wo eine gründliche Entwässerung
und eine sorgfältige Entfernung der torfbildenden Masse
stattfinden. - Bei der Umwandlung der abgestorbenen
Pflanzensubstanz in T. liefern zunächst die
Proteinkörper, Dextrin und Stärke unter Einfluß von
Sauerstoff Kohlensäure, Schwefelwasserstoff,
Phosphorwasserstoff, Ammoniak und Humussäuren. Langsamer
zersetzt sich die Holzfaser zu einer erst gelben (Ulmin),
später braunen Masse (Humin), während der Gehalt der
Pflanzen an Kieselsäure und unlöslichen Mineralsalzen
unverändert in das Zersetzungsprodukt übergeht. Durch
eigne Schwere und durch den Druck nachwachsender Generationen
sinken die Massen zusammen, verdichten sich und unterliegen einer
stetig fortschreitenden Umsetzung, als deren gasige Hauptprodukte
sich Kohlensäure und Kohlenwasserstoffe bilden, während
die Masse selbst schwärzer, homogener und reicher an
Kohlenstoff wird. Die Gasexhalationen rufen mitunter in der
zähflüssigen Masse Aufblähungen hervor, welche, wenn
das Magma den Rand übersteigt, zu Moorausbrüchen
führen können. Übrigens ist die große
wasseraufsaugende Kraft des Torfs ebenfalls oft die Ursache solcher
Aufblähungen und Ausbrüche. Das Produkt des
Vertorfungsprozesses, der T., besitzt keine bestimmte chemische
Zusammensetzung und ist auch in seinen physikalischen Eigenschaften
je nach dem Grad, bis zu welchem die Umsetzung sich bereits
vollzogen hat, bedeutend verschieden. So ist der T. bald
schlammartig, bald dicht, hellgelb, dunkelbraun oder pechschwarz.
Oberflächlich getrocknet, kann er 50-90 Proz. Wasser aufnehmen
und gibt dasselbe in trockner Luft nur sehr allmählich ab,
verliert aber diese Eigenschaft, sobald er vollkommen ausgetrocknet
ist. Bei Abschluß der Luft erhitzt, gibt der T.
Kohlensäure, Kohlenoxyd, Kohlenwasserstoffe, Ammoniak, Teer
und Wasser; beim Verbrennen liefert er eine Asche, die arm an
Alkalien ist, thonigen Sand, Magnesium- und Calciumsulfat sowie
Eisenoxid neben wenig Phosphorsäure und Chlor enthält.
Für die quantitative Zusammensetzung ergeben sich folgende
ungefähre Grenzwerte: Kohlenstoff 40-60 Proz., Wasserstoff
4-6,5, Sauerstoff 25-35, Stickstoff 1-6, Asche 1-15 Proz.
Benennungen einzelner Varietäten des Torfs sind, solange sich
die komponierenden Pflanzen erkennen lassen, diesen entnommen, so:
Konferventorf (wesentlich aus Konferven gebildet), Moostorf
(Sphagnum), Wiesentorf (Ried- und Wollgräser, Binsen),
Heidetorf (Erica tetralix), Holztorf (Wurzel- und Stammteile von
Weiden, Erlen etc.). Auch die Aufhäufung von Tangen soll zur
Bildung von T. (Meertorf) führen; doch ist für mehrere
sogen. Meertorfe die Zusammensetzung aus
Süßwasserpflanzen nachgewiesen und ihr heutiges
Vorkommen am Meeresgrund oder am Ufer in einem tiefern Niveau als
die Meeresoberfläche als Folge von Senkungserscheinungen
erkannt worden. Andre Benennungen bezeichnen den Zustand, in
welchem sich die in Zersetzung begriffenen Substanzen befinden. So
läßt der Rasentorf, gewöhnlich die oberste Decke
der Moore bildend, die Reste noch deutlich ernennen, die nur eine
gelbe bis braune Farbe
Torf (Gewinnung).
760
angenommen haben. Ihn unterteufend und die untersten Lagen
einnehmend, tritt häufig Pechtorf auf, schwärzlichbraun
bis dunkelschwarz, strukturlos, auf der Schnittfläche
wachsglänzend. Die ungefähre Mitte zwischen beiden,
zugleich aber auch stark mit Erdteilen gemengt, hält die
Torferde. Der Fasertorf ist eine dem Pechtorf ähnliche Masse,
von Pflanzenteilen, die einen geringen Grad der Zersetzung zeigen,
durchzogen. Im Papiertorf ist unvollkommen zersetzte Pflanzenmasse
in dünne, leicht voneinander abzuhebende Lagen geteilt. Der
Baggeroder Schlammtorf endlich stellt frisch einen Brei dar,
welcher mit Netzen gebaggert oder geschöpft wird, getrocknet
aber fest und kompakt ist. Als gelegentliche Bestandteile finden
sich im T., außer Fragmenten noch nicht vollkommen zersetzter
Vegetabilien, menschliche und tierische Reste. Erstere befinden
sich meist in einem sehr vollkommnen Erhaltungszustand. Besonders
hervorzuheben sind außer den vertorften Pfahlbauten Knochen
vom Riesenhirsch, vom Bos primigenius und Elephas primigenius, weil
dieselben für ein sehr hohes, bis in die Diluvialperiode
zurückreichendes Alter der betreffenden Moore zeugen,
während die meisten Torfbildungen jüngern Datums sind und
dem Alluvium angehören. Unter den mineralischen
Einschlüssen sind Eisenkies und Strahlkies sowie als seltenere
Kupferkies, Zinkblende und sonstige Reduktionsprodukte aus Sulfaten
zu nennen. Die erstgenannten geben durch gelegentliche Oxydation
die Veranlassung zur Bildung von Gips, Bittersalz, Alaun,
Glaubersalz und besonders Eisenvitriol, welcher bisweilen in
solchen Mengen dem T. beigemengt ist, daß er aus demselben
gewonnen wird (Vitrioltorf). Ferner ist Blaueisenerde ziemlich
häufig, seltener Kochsalz, letzteres nur in tief gelegenen,
dem Meer benachbarten Mooren. Die Verbreitung der Torfmoore ist
zunächst in Deutschland eine sehr bedeutende. Altpreußen
besitzt 260 QM. Moorland, die drei 1866 erworbenen Provinzen 132,
Mecklenburg 10, Oldenburg 20, Bayern 12, die Reichslande und das
übrige Süddeutschland etwa 25 QM., so daß gegen 4,6
Proz. der gesamten Oberfläche Deutschlands vom Moor bedeckt
sind. Besonders tragen dazu bei das norddeutsche Tiefland, die
Hochplateaus Bayerns und Oberschwabens und die Rücken der
Gebirge Süd- und Mitteldeutschlands (Schwarzwald, rheinische
Gebirge, Rhön, Harz, Thüringer Wald, Fichtelgebirge,
Erzgebirge, Riesengebirge). Auch in der nördlichen Schweiz, am
Südabhang der Alpen, in den Tiroler, Salzburger und
Kärntner Alpen bis nahe zur Schneegrenze kommen Moore vor; 10
Proz. des irischen Landes sind von ihnen bedeckt. Ebenso zahlreich
sind sie in Schottland, Skandinavien, Rußland. Asien ist arm
an T.; aus Afrika ist keine echte Torfbildung bekannt. Dagegen sind
die Moore in Nordamerika stark verbreitet, und auch in
Südamerika werden viele aus den Anden beschrieben.
Gewinnung des Torfs.
(Hierzu Tafel "Torfbereitung".)
Die Gewinnungsweise des Torfs richtet sich nach der
physikalischen Beschaffenheit desselben. Der Stechtorf wird mittels
Handspaten oder besonderer Maschinen in Stücke von
regelmäßiger Ziegelform gestochen, an der Luft
getrocknet und als Loden von 314-525 mm Länge, 52-78 mm Dicke
und 105-157 mm Breite in den Handel gebracht. Das Abstechen des
Torfs geschieht entweder horizontal oder vertikal. Beim
horizontalen Torfstich arbeitet man in der Weise, daß ein
Brett neben den Rand der Torfgrube gelegt wird, welches vom Rand so
weit absteht, als die Lange der Loden beträgt; hierauf werden
mit einem scharfen herzförmigen Spaten der Länge und
Breite nach vor dem Brette die Loden abgestochen; nach
entsprechendem Weiterrücken des Bretts wird dann das eben
beschriebene Verfahren wiederholt. Ein zweiter, niedriger stehender
Arbeiter hebt die Torfstücke in 78-105 mm Dicke ab, legt sie
in einen bereit stehenden Schubkarren und fährt sie nach den
Trockenplätzen. Beim vertikalen Torfstich sticht der Arbeiter
am Rande der Grube mit einem scharfen, mit zwei rechtwinkeligen
Seitenkanten versehenen Spaten (s. Textfig. 1) im Torfboden auf die
Länge eines Ziegels nieder, schneidet dann mittels eines
Stecheisens das Torfstück an der untern Seite ab und bringt es
später mittels des Schubkarrens zum Trockenplatz. Bei dieser
Handarbeit müssen die Moore vorher genügend
entwässert werden; geschieht letzteres nicht, und muß
der T. unter Wasser gestochen werden, so benutzt man besondere
Stechmaschinen. Der auf vorstehend beschriebene Art gewonnene T.
enthält oft noch 80-90 Proz. Wasser und wird in Haufen, auf
Hiefeln oder auf Stellagen getrocknet, wobei der T. mindestens zwei
Monate im Freien bleibt und bei andauerndem Regenwetter sehr
große Verluste erleidet. Bei dem Trocknen auf Hiefeln werden
die Torfloden, nachdem sie einige Tage auf dem Boden gelegen haben,
auf kleine, zugespitzte Holzstäbe aufgesteckt, welch letztere
an etwa 2 m hohen Pfählen angebracht sind. Beim Trocknen auf
Stellagen werden die Loden auf einem mit Dach versehenen
Lattengerüst ausgebreitet und getrocknet. Dies letztere
Verfahren wird bei weniger konsistentem T. angewendet. Erdiger,
schlammiger T., welcher wegen mangelnden Zusammenhangs kein Stechen
zuläßt, wird gewöhnlich durch Schöpfen mit
eisernen Eimern, deren Ränder geschärft sind, und deren
Böden aus einem Stück groben Zeugs bestehen, gewonnen
(Baggertorf). Die Masse wird auf den geebneten Erdboden gegossen,
wo sich noch Wasser abscheidet, und dann in breiförmigem
Zustand in einen flachen Raum, der durch ausrecht stehende Bretter
abgegrenzt ist, gebracht. Wenn der T. hier eine genügende
Konsistenz erreicht hat, wird er in Formen gebracht, resp.
zerschnitten. Das Austrocknen wird wohl hierbei noch dadurch
befördert, daß man die Masse durch Schlagen mit
Knütteln oder Dreschflegeln bearbeitet, oder daß
Arbeiter mit Brettern, welche sie sich an die Füße
geschnallt haben, darauf herumtreten. Modell- oder Streichtorf und
Backtorf werden gewonnen, indem man die Torfmasse in
unregelmäßigen Stücken aus der Torfgrube nimmt,
durch Schlagen mit Hölzern oder Treten mit den
Füßen oder mit Zusatz von Wasser durcheinander mengt und
dann in entsprechende Formen bringt. Besser als dieser Handtorf mit
seinem geringen spezifischen Gewicht, wodurch große
Feuerungsanlagen bedingt werden, und seiner Neigung, beim Transport
zu zerbröckeln, ist der Maschinentorf, dessen Substanz auf
irgend eine Weise verdichtet wird. Man preßt die Torfmasse
entweder, nachdem sie zerkleinert und in Öfen getrocknet ist
(Trockenpreßmethode, System Exter-Gwynne), oder, sobald die
Masse aus
[Fig. 1. Spaten zum Torfstechen.]
Torfgewinnung.
Fig. 1. Torfmaschine für Pferdebetrieb von Schlickeysen;
Fig. 2 u. 3 die beiden obern Messer derselben.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 7. Zweiwellige Torfmaschine von Grotjahn und Picau.
Fig. 4. Torfmaschine für Dampfbetrieb von Schlickeysen.
Längendurchschnitt.
Fig. 5. Torfmaschine für Dampfbetrieb von Schlickeysen.
Querschnitt.
Fig. 6. Torfmaschine von Clayton, Son and Howlett.
Fig. 8 u. 9. Wander-Torf-Aufbereitungsmaschine von Cohen und
Moritz. Seiten- und Stirnansicht.
Zum Artikel »Torf«.
761
Torf (Gewinnung).
dem Moor kommt, in geeignete Formen (Naßpreßmethode,
System Koch und Mannhardt) und erhält auf diese Weise den
Preßtorf. Bei Gewinnung von Schlämmtorf nach dem System
Challeton wird die rohe Torfmasse zwischen Messerwalzen
zerkleinert, mittels eines Bürstenapparats und unter
Zufluß von Wasser durch ein Sieb getrieben und in andern
Apparaten noch weiter zerkleinert. Der Schlamm gelangt dann in
Gefäße, in denen sich die schweren mineralischen
Beimengungen absetzen, und hierauf in Bassins, durch welche das
Wasser absickern kann. Wenn die Torfmasse dann genügend
kompakt geworden ist, wird dieselbe in Ziegel geformt. Siebtorf
nach System Versmann wird gewonnen, indem man die rohe Torfmasse in
einen Trichter von Blech bringt, welcher am Umfang mit kleinen
Löchern versehen ist. In dem Trichter bewegt sich ein eiserner
Konus, welcher um seine Peripherie herum ein schneckenartig
gewundenes Messer trägt. Dieses Messer schneidet den T. fein
und drückt ihn in feinen Strähnen durch die seitlichen
Löcher des Trichters, während die gröbern Teile die
untere Trichteröffnung passieren. Unter Maschinentorf im
engern Sinn (kondensierter oder verdichteter T.) begreift man alle
diejenigen Torfsorten, bei denen die Torffasern durch maschinelle
Vorrichtungen zerrissen und wieder miteinander vermengt werden, so
daß ein möglichst homogenes Produkt entsteht, und wobei
das Verdichten des Torfbreies ohne Anwendung von Torfpressen vor
sich geht. Man unterscheidet hierbei noch, ob die Herstellung des
Torfs mit oder ohne Wasserzufluß erfolgt. Das Formen des
Torfs geschieht von Hand, oder es werden durch die Maschine
prismatische Stränge gebildet, welche nach den üblichen
Dimensionen zerschnitten werden. Eine besondere Art des
Maschinentorfs ist der Kugeltorf, bei welchem der durch die
Maschine hergestellte Torfbrei in besondern Vorrichtungen zu
faustgroßen Kugeln geformt wird. Die Herstellung von
kondensiertem oder verdichtetem Maschinentorf ist wohl als die
bisher rationellste und jetzt am meisten verbreitete Methode zu
bezeichnen. Nach einer andern Methode der Torfzubereitung wird der
T. auf einer Zentrifugalmaschine entwässert, in Brei
verwandelt, getrocknet, gemahlen und in heißen Pressen
komprimiert. Im bayrischen Kolbermoor und Haspelmoor wird die zu
bearbeitende Parzelle von der Vegetation befreit, geebnet,
gepflügt und geeggt und der abgelöste T. lufttrocken
gemacht. Dann sammelt man ihn mit einem Schneepflug, bringt ihn in
eine Zerkleinerungsmaschine, aus dieser in den Trockenofen und mit
einer Temperatur von 50-60° in die Presse, welche ihn in
dunkelbraune, glänzende Ziegel verwandelt. Fig. 1 der Tafel
zeigt eine Torfmaschine für Pferdebetrieb von Schlickeysen.
Die an der stehenden Welle W befestigten Schneckenflügel S, S
sind schraubenförmig gestaltet und umfassen nicht den ganzen
Kreisumfang, wie sich aus Fig. 2 und 3, welche die beiden obern
Messer, resp. Flügel darstellen, ergibt. Das obere Messer ist
mit einem Schaber B versehen, welcher die am innern Umfang des
Bottichs hängen gebliebenen Torffasern abschabt und den
Messern zuführt. Damit sich die Torfmasse nicht festsetzt,
sind mehrere Eisenstäbe E, E quer durch den Bottich
hindurchgezogen. Der den untern Teil des Bottichs
abschließende Boden O ist mit der Welle W fest verbunden.
Wenn nun die Torfmasse oben in den Bottich eingeschüttet wird,
so muß bei entsprechender Drehung der Welle W die Masse
zerrissen, durcheinander gemengt, durch das untere Messer der
Ausgangsöffnung, vor welcher sich die Form F befindet,
zugedrängt werden und aus dem Mundstück in einem
fortlaufenden Strang austreten. Um das unbequeme Aufgeben des rohen
Torfmaterials in die hohen Bottiche zu vermeiden, konstruierte man
Torfmaschinen mit liegender Schneckenwelle, wobei aber das
Eigengewicht des Torfs beim Nachschieben der Torfmasse nicht mehr
behilflich ist. Fig. 4 und 5 zeigen eine solche Maschine für
Dampfbetrieb von Schlickeysen. Die Konstruktion der Messer ist aus
der Zeichnung ersichtlich. Zu erwähnen ist die unterhalb des
Trichters T liegende Speisewalze W, welche durch Zahnräder im
entgegengesetzten Sinn mit der Messerwelle S bewegt wird, so
daß hierdurch Messer und Speisewalze das Material aus dem
Trichter nach unten ziehen. Derartige Maschinen liefern bei
geeignetem Rohmaterial in 10 Arbeitsstunden 10-15,000 Loden. Die in
Fig. 6 dargestellte Maschine ist von Henry Clayton Son and Howlett
in London, Atlas Works. Bei dieser wird die Torfmasse in den
vertikal stehenden Trichter T gegeben und durch Bewegung der
Flügel an der im Trichter befindlichen vertikalen Welle nach
unten gedrückt, wo sie in den horizontal liegenden Cylinder
eintritt. Aus letzterm wird die Masse durch die Formen
gepreßt und tritt daselbst in mehreren glatten Strängen
aus. Diese Stränge werden dann von Brettern aufgenommen und
durch das mit sechs eingespannten Drähten versehene
Schneidegatter G in Stücke zerschnitten. Die Torfmasse wird
durch eine besondere Aufzugsvorrichtung vermittelst der Trommel K
nach oben geschafft. Diese Maschine hat etwa 5-6 Pferdekräfte
für ihre Bewegung nötig und liefert pro Tag 60-100,000
Loden frischen T. Da der T. häufig mit wenig oder gar nicht
vermoderten Pflanzenteilen durchsetzt ist, welche sich an die
Messer ansetzen und dadurch Verstopfungen und
Betriebsstörungen herbeiführen, konstruierte man
Torfmaschinen mit zwei nebeneinander liegenden Wellen, deren
Schraubenflächen aneinander vorbeigleiten und sich gegenseitig
reinigen. In Fig. 7 ist eine derartige Maschine von Grotjahn und
Picau dargestellt. Die bis jetzt beschriebenen Maschinen zur
Herstellung von Maschinentorf stellen den T. ohne besondere
vorherige Beimengung von Wasser her. Von Cohen und Moritz ist eine
Wandertorfaufbereitungsmaschine (Fig. 8 und 9) konstruiert, bei
welcher der T. durch Zusatz von Wasser zu einer breiartigen Masse
verarbeitet wird. Dieselbe enthält mehrere nebeneinander
liegende horizontale Cylinder, in welchen sich je eine
Schneckenwelle bewegt. Diese Schneckenwellen werden durch
Zahnräder vermittelst der Riemenscheibe K durch eine
Lokomobile getrieben. In dem zur Aufnahme des Rohmaterials
dienenden Trichter T befindet sich ein Rührwerk, durch welches
die Torfmasse mit dem zugepumpten Wasser gemischt wird. Diese
Maschinen sind mit Rädern versehen und auf Schienen so
aufgestellt, daß ihre Fortbewegung zu gewissen Zeiten auf den
Schienen neben dem Arbeitskanal her erfolgen kann. Bei geringer
Tiefe der Torfgrube wird der ausgestochene T. direkt in den
Trichter geworfen, dagegen wird bei tiefer liegenden Torflagern die
Torfmasse durch einen Elevator E noch dem Trichter geführt.
Der auf diese Weise gewonnene Torfbrei wird dann durch Karren dem
Trockenterrain zugeführt. Bei der Kugeltorffabrikation wird
der T. zu einer breiartigen Masse verarbeitet und dann durch eine
Hebevorrichtung nach der Formmaschine gehoben. Diese Form besteht
aus einer oder mehreren Trommeln von Holz oder Metallblech (s.
Textfig. 2), welche um Achsen rotieren und an der innern Seite mit
Schraubengängen ver-
762
Torfbeere - Torgau.
sehen sind. In eine solche Trommel wird nun mittels einer im
Trichter T rotierenden Schraube der Torfbrei geschoben. Jeder auf
diese Weise während einer Umdrehung vorgeschobene Teil wird
bei der Drehung in den Schraubengängen zu einer Kugel geformt,
verläßt am Ende der Trommel dieselbe und rollt auf einer
schiefen Ebene nach dem Trockenraum.
Der fertige T. enthält im lufttrocknen Zustand oft noch bis
30 Proz. Wasser, das bei der Verbrennung verdampft werden muß
und den Heizeffekt des Torfs herabzieht. Um letztern zu
erhöhen, wird der T. in verschieden konstruierten
Darröfen getrocknet. Nach Karsten sind bei Siedeprozessen
2½ Gewichtsteile T. = 1 Gewichtsteil Steinkohle. Nach Vogel
ist die Verdampfungskraft von lufttrocknem Fasertorf mit 10 Proz.
Wasser 5,5 kg, von Maschinentorf mit 12-15 Proz. Wasser 5-5,5 kg
und von Preßtorf mit 10-15 Proz. Wasser 5,8-6,0 kg. Um den T.
besser verwerten zu können, verkohlt man ihn und zwar
namentlich, seitdem er durch die neuen Gewinnungsmethoden in eine
homogenere, dichtere Masse verwandelt werden kann. Die Verkohlung
in Meilern oder Haufen geschieht in ganz ähnlicher Weise wie
bei Holz, man hat aber auch besondere Verkohlungsöfen
konstruiert. Der T. findet in seiner durch die neuen Gewinnungs-
und Bearbeitungsmethoden wesentlich verbesserten Gestalt auch
ausgedehnte technische Verwendung. Die Torfkohle kommt in ihrem
spezisischen Wärmeeffekt der Holzkohle sehr nahe, doch steht
sie in ihrer Brauchbarkeit hinter derselben zurück. Sie gibt
wegen ihrer geringen Dichtigkeit und des großen Aschengehalts
kein intensives Feuer, ist leichter zerdrückbar und daher in
Schachtöfen nicht gut verwendbar, während sie in Herd-,
Pfannen- und Kesselfeuerungen mit vielem Erfolg benutzt werden
kann. Aus verdichtetem T. dargestellte Kohle dürfte für
Hüttenwerke sehr wichtig werden, wenn es gelingt, sie billig
genug herzustellen. Torfgasfeuerungen sind in verschiedenen
Industriezweigen für Puddel- und Schweißöfen,
für Glashüttenbetrieb, zum Brennen von honwaren, Ziegeln
etc. angewendet worden. Ferner unterwirft man T. der trocknen
Destillation, um Leuchtgas, Paraffin, Photogen etc. zu gewinnen.
Auch hat man versucht, den im T. enthaltenen Stickstoff (bis 3,8
Proz.) in die Form von Ammoniak überzuführen. Weitere
Anwendung findet der T. bei der Papierfabrikation und zwar
versuchsweise als Surrogat zur Pappenfabrikation, ferner als
Dungmittel, als Streumaterial in Viehställen etc. Vgl.
Torfstreu. Vgl. Wiegmann, Über die Entstehung, Bildung und das
Wesen des Torfs (Braunschw. 1837); Grisebach, Über die Bildung
des Torfs in den Emsmooren (Götting. 1846); Senft, Die Humus-,
Marsch-, Torf- und Limonit-Bildungen (Leipz. 1862); Sendtner, Die
Vegetationsverhältnisse Südbayerns (Münch. 1854);
Vogel, Der T., seine Natur und Bedeutung (Braunschw. 1859);
Derselbe, Praktische Anleitung zur Wertbestimmung von
Torfgründen etc. (Münch. 1861): Dullo, Torfverwertung in
Europa (Berl. 1861); Schenck, Rationelle Torfverwertung (Braunschw.
1862); Schlickeysen, Mitteilungen über die Fabrikation von
Preßtorf (Berl. 1864); Wentz, Lintner und Eichhorn, Der
Kugeltorf (Freising 1867); Breitenlohner, Maschinenbacktorf
(Lobositz 1873); Hausding, Industrielle Torfgewinnung und
Torfverwertung (Berl. 1876); Derselbe, Die Torfwirtschaft
Süddeutschlands und Österreichs (das. 1878); Birnbaum,
Die Torfindustrie etc. (Braunschw. 1880); Stiemer, Der T. (Halle
1883).
Torfbeere, s. v. w. Vaccinium Oxycoccus.
Torfmoor, s. Torf.
Torfmoos, s. Sphagnum.
Torfstreu und Torfmull, aus der Faserschicht, welche in
einer Stärke von 0,5 m den Brenntorf in den Heidemooren
bedeckt, auf besondern Maschinen dargestellte Fabrikate. Der Moos-
oder Fasertorf wird getrocknet und auf dem Reißwolf, einer
rotierenden, mit Spitzen besetzten Trommel, welcher ein ebenfalls
mit Spitzen besetztes Brett gegenübersteht, oder auf der
Torfmühle, die einer Kaffeemühle ähnlich ist,
zerkleinert und dann durch Siebe in die faserige Torfstreu und den
pulverigen Torfmull getrennt. Erstere dient in der Landwirtschaft
als Ersatz der Strohstreu, ist billiger als diese, saugt die
Flüssigkeit kräftiger auf und liefert vortrefflichen
Dünger. Man macht daraus für die Tiere ein Lager von
12-15 cm Höhe und ersetzt täglich die feucht gewordenen
Teile durch neues Material. Der Torfmull eignet sich vortrefflich
zum Desinfizieren von menschlichen Exkrementen und wird vielfach in
Streuklosetten angewandt. Er bindet etwa das Zwölffache seines
Gewichts an Fäkalstoffen und liefert dabei eine trockne,
geruchlose Masse, die sich vortrefflich als Dünger eignet.
Schmutzwasser, durch Torfftreu filtriert, liefern ein klares
Filtrat, welches bei reichlichem Luftzutritt nicht mehr
fäulnisfähig ist. Torfstreu wird auch mit
Karbolsäure, Jodoform, Sublimat imprägniert und als
Verbandmittel benutzt. Mit Kalkmilch imprägniert, dient
Torfstreu als Füllmaterial für Zwischendecken,
außerdem dient sie zu Isolierzwecken für Eishäuser,
zu Umhüllungen von Dampfleitungen, zur Konservierung von
Fleisch und Fischen, in der Gärtnerei zu verschiedenen Zwecken
etc. Das Aufsaugungsvermögen des reinen Fasertorfs ist so
groß, daß er das neunfache Gewicht an Wasser
absorbiert, einzelne Proben mit 20 Proz. Feuchtigkeit absorbierten
sogar bis 19,7 Teile Wasser. Torfstreu enthält im lufttrocknen
Zustand 88 Proz. organische Substanz (mit 0,6- 3,2 Proz.
Stickstoff), 2 Proz. Asche (mit 0,08 Proz. Kali, 0,09 Proz.
Phosphorsäure) und 10 Proz. Wasser. Vgl. Mendel, Die Torfstreu
(Brem. 1882); Haupt, Torfstreu als Desinfektions- und
Düngemittel (Halle 1884); Fürst, Die Torfstreu (Berl.
1888).
Torgau, Kreisstadt und Festung im preuß.
Regierungsbezirk Merseburg, liegt an der Elbe, über welche
zwei Brücken (darunter eine Eisenbahnbrücke) führen,
und an den Linien Halle-Guben und T.-Pratau der Preußischen
Staatsbahn. Die Festung (seit 1811) besteht aus acht Bastionen,
zwei Lünetten, dem Brückenkopf, dem Fort Zinna und dem
sogen. Neuen Werk (seit 1866). Das auf einem Felsen an der Elbe
lie-
[Fig. 2. Formmaschine für Kugeltorf.]
763
Torgel - Tornados.
gende Schloß Hartenfels (von Johann Friedrich dem
Großmütigen erbaut) dient jetzt als Kaserne. Von den 3
Kirchen (2 evangelische und eine katholische) ist die Stadtkirche
mit Gemälden von Lukas Cranach und dem Grabstein der Katharina
von Bora, von sonstigen Gebäuden das altertümliche
Rathaus und das Zeughaus bemerkenswert. Die Bevölkerung
beträgt (1885) mit der Garnison (ein Infanterieregiment Nr.
72, ein Pionierbataillon Nr. 3 und eine Abteilung Feldartillerie
Nr. 19) 10,988 Seelen, meist Evangelische, welche Wagen-,
Handschuh-, Thonwaren-, Zündschnur-, Dungmittel-, Zigarren-,
Mostrich-, Biskuit- und Mineralwasserfabrikation, Bierbrauerei,
Dampfschneidemüllerei, Kalk- und Ziegelbrennerei, Schiffahrt
und Getreidehandel betreiben. T. hat ein Landgericht, ein Gymnasium
und eine Sammlung sächsischer Altertümer. In der
Nähe das königliche Hauptgestüt Graditz (s. d.). Zum
Landgerichtsbezirk T. gehören die 16 Amtsgerichte zu Belgern,
Dommitzsch, Düben, Eilenburg, Elsterwerda, Herzberg, Jessen,
Kemberg, Liebenwerda, Mühlberg, Prettin, Schlieben,
Schmiedeberg, Schweinitz, T. und Wittenberg. - T. war häufig
Sitz der sächsischen Kurfürsten. Hier wurde im März
1526 das Torgauer Bündnis zwischen Sachsen und Hessen gegen
die katholischen Reichsstände geschlossen. Auch
verfaßten hier Luther und seine Freunde 1530 die Torgauer
Artikel, die Grundlage der Augsburgischen Konfession, und 1576 ward
zur Beilegung der kryptocalvinistischen Streitigkeiten hier das
Torgauische Buch (s. Konkordienformel) veröffentlicht. In der
Nähe von T., bei Süptitz, wurden 3. Nov. 1760 die
Österreicher unter Daun von Friedrich d. Gr. geschlagen
(Denkmal daselbst). 1811 ward T. auf Napoleons I. Befehl befestigt,
hielt Ende 1813 eine dreimonatliche Belagerung durch Tauenzien aus
und kapitulierte erst 10. Jan. 1814. T. fiel 1815 an Preußen.
1889 wurden die Rayongesetze aufgehoben. Vgl. Grulich,
Denkwürdigkeiten der altsächsischen Residenz T. aus der
Zeit der Reformation (2. Aufl., Torg. 1855); Knabe, Geschichte der
Stadt T. bis zur Reformation (das. 1880).
Torgel, Fluß in Esthland, entspringt als
Weißensteinscher Bach auf dem Südabhang des esthnischen
Landrückens, empfängt einen Abfluß des Fellinschen
Sees und fließt in südwestlicher Richtung, an der Stadt
Pernau vorbei, dem Rigaer Meerbusen zu.
Torgoten, s. Kalmücken.
Tories (spr. tóris), Mehrzahl von Tory (s.
d.).
Torino, ital. Name von Turin.
Torjaer Stinkberg (auch Berg Büdös), im ungar.
Komitat Háromszék (Siebenbürgen), nordwestlich
von Kézdi-Vásárhely, 1071 m ü. M., eine
der hervorragendsten Naturmerkwürdigkeiten Ungarns. Aus den
Spalten und Höhlen des vielfach zerrissenen und oben
verwitterten Trachyts entströmen ununterbrochen Gase,
namentlich Schwefelwasserstoffes, dessen Geruch schon von weitem
wahrnehmbar ist. Von den drei Höhlen (Stink-, Alaun- und
Mörderhöhle) wird nur die erstere vom Volk zu Kurzwecken
(bei Rheuma, Gicht und Augenleiden) benutzt. In diese kann man nur
dann ohne Gefahr eintreten, wenn der Kopf sich über der
Gasschicht befindet, tiefer verliert man sofort die Besinnung. Am
Fuß des Bergs sind acht Mineralquellen, die als Heilquellen
dienen.
Torlonia, röm. Fürstenfamilie, deren Reichtum
der Bankier Giovanni T. (geb. 1754 zu Siena, gest. 25. Febr. 1829
in Rom) begründete; er kaufte das Herzogtum Bracciano und
erlangte 1809 die Herzogswürde. Diese ging auf seinen
ältesten Sohn, Marino T. (1796-1865), über, jetziger
Inhaber ist sein Enkel Herzog Leopold T., geb. 25. Juli 1853, bis
1888 Bürgermeister (sindaco) von Rom. Der dritte Sohn, Don
Alessandro, Fürst von Civitella-Cesi, Musignano, Canino,
Farnese und Fucino, Marchese di Roma Vecchia und Torrita, geb. 1.
Juni 1800, erwarb durch die Pacht der Salz- und Tabaksregie in Rom
und Neapel und günstige Anleihen ein ungeheures Vermögen,
das er zur Errichtung von wohlthätigen Anstalten, zum Bau von
Theatern, zur Trockenlegung des Fuciner Sees (1852-75) und der
Anlegung des wertvollen Museo T. in Trastevere verwendete; er starb
7. Febr. 1886 in Rom. Seine Titel und Besitzungen gingen auf seine
einzige Tochter, Anna Maria (geb. 8. März 1855), und deren
Gemahl, den Fürsten Giulio Borghese (geb. 19. Dez. 1847),
über.
Tormentilla L. (Tormentill), Gattung aus der Familie der
Rosaceen, nur durch die Vierzahl der Teile der Blumenkrone und des
Kelchs von Potentilla verschieden, kleine, ausdauernde Kräuter
in Mitteleuropa, mit fiederigen Blättern und einzelnen
Blüten in Zweiggabeln. T. erecta L. (Potentilla T. Schrank,
Ruhr-, Blut- und Rotwurz), mit cylindrischem bis knolligem,
knotigem, hinten wie abgebissenem, dunkel rotbraunem Rhizom, bis 30
cm langem, fast niederliegendem, oberwärts sparrig verzweigtem
Stengel, meist dreizähligen Blättern, großen
Nebenblättern, einzeln stehenden, langgestielten, gelben
Blüten und kahlen, fast glatten Früchtchen, wächst
besonders auf feuchtem Boden in Nord- und Mitteleuropa. Das Rhizom
enthält Chinovasäure, Tormentillgerbsäure,
Tormentillrot, ist als Rhizoma Tormentillae offizinell und
gehört zu den kräftigsten einheimischen adstringierenden
Mitteln.
Tormes, Fluß in der span. Provinz Salamanca,
entspringt am nördlichen Abhang der Sierra de Gredos,
fließt vorherrschend nordwestlich, durchströmt das
reizende Thal von Bohoyo und El Barco und fällt unterhalb
Fermoselle an der portugiesischen Grenze links in den Duero; 230 km
lang.
Torna, ehemaliges ungar. Komitat am rechten
Theißufer, zwischen dem Hernád und Sajó,
umfaßte 619 qkm (11,22 QM.) und (1869) 26,176 Einw. Seit 1881
bildet es, mit Ausnahme von sieben zu Gömör
gehörigen Gemeinden, mit Abauj das neue Komitat Abauj-T. (s.
d.). Hauptort war der Markt T. (Turnau), jetzt im Komitat Abauj-T.,
mit (1881) 1470 ungar. Einwohnern und Ruinen des historisch
merkwürdigen Schlosses T. (Bebek).
Tornados (span.), Name von Wirbelstürmen, welche
zwar an Stärke den gewaltigsten Orkanen Westindiens, des
Indischen und Chinesischen Meers oft gleichkommen, aber einen
verhältnismäßig kleinern Raum umfassen und auch von
geringerer Dauer sind. Ihr Durchmesser sinkt von einigen Meilen oft
bis auf einige tausend Fuß herab. Sie kommen am
häufigsten in den östlichen Staaten Nordamerikas und an
der Westküste von Afrika als sogen. Landtornados vor, bewegen
sich in der Regel von SW. nach NO. über die Erdoberfläche
fort und richten oft ungeheure Verheerungen an. Seetornados trifft
man am häufigsten in dem Bereich und der Nachbarschaft der
Region der Kalmen (s. d.); sie sind hier außerordentlich
heftig und sehr gefährlich für die
[Wappen von Torgau.]
764
Tornberg - Torpedo.
Schiffe. Die T. werden von einem sehr kräftigen
aufsteigenden Luftstrom gebildet, welcher in der Höhe seine
Wasserdämpfe verdichtet. Auf diese Weise entsteht über
den T. regelmäßig die Sturmwolke, eine kleine schwarze
Wolke, das sogen. Ochsenauge, welche rasch zunimmt und sich nach
oben hin trichterförmig erweitert. Sie bilden einerseits den
Übergang zu den Tromben oder Windhosen (s. Trombe), anderseits
zu den Cyklonen oder eigentlichen Wirbelstürmen (s. Wind).
Vgl. Reye, Die Wirbelstürme, T. und Wettersäulen (Hamb.
1872).
Tornberg, Karl Johan, schwed. Orientalist, geb. 23. Okt.
1807 zu Linköping in Ostgotland, studierte von 1826 an zu
Upsala Theologie und orientalische Sprachen, habilitierte sich 1835
daselbst als Dozent des Arabischen, setzte 1836-38 seine
Sprachstudien noch in Paris unter Sacy, Jaubert und
Quatremère fort und wurde 1844 außerordentlicher, 1850
ordentlicher Professor der morgenländischen Sprachen an der
Universität zu Lund, wo er 6. Sept. 1877 starb. Er gab heraus:
Ibn el Vardis "Fragmenta libri Margarita mirabilium" (mit lat.
Übersetzung, Ups. 1835-45, 2 Bde.); "Primordia dominationis
Murabitorum" (aus dem "Kartas" genannten Buch, das. 1839); Ibn
Chaldunis "Narratio de expeditionibus Francorum in terras Islamismo
subjectas" (das. 1840); Ibn abi Zer' Fesanos "Annales regum
Mauritaniae" (im Arabischen "Roudh el Kartas", mit lateinischer
Übersetzung und Noten, das. 1843-1846, 2 Bde.) und Ibn al
Athirs umfangreiches "Chronicon, quod perfectissimum dicitur" (im
Arabischen: "Kamil Ette warikh", Leid. 1851-74, 13 Bde.). T.
schrieb außerdem: "De linguae Aramaeae dialectis" (Ups.
1842), beschrieb die "Codices arabici, persici et turcici
bibliothecae Upsaliensis" (das. 1849) und die "Codices orientales
bibliothecae Lundensis" (Lund 1850) und lieferte wichtige
Beiträge zur arabischen Münzenkunde in "Symbolae ad rem
numariam Muhammedanorum" (Ups. 1846-1856, 3 Tle.) und "Numi cufici"
(das. 1848).
Torneà (spr. tórneo), Stadt im finn.
Gouvernement Uleaborg, am linken Ufer des hier in den Bottnischen
Meerbusen mündenden Torne-Elf, der schwedischen Stadt
Haparanda gegenüber, mit (1885) 1015 Einw. 75 km
nördlicher liegt der Berg Awasaksa (s. d.). T. ist Sitz eines
deutschen Konsuls.
Torneutik (griech.), Dreher-, Drechslerkunst.
Tornister (im mittelalterlichen Latein turnicella),
Hauptbestandteil des Gepäcks der Fußsoldaten, meist
viereckiger Behälter, aus einem Holzgestell mit wasserdichtem
Überzug von Fellen oder präpariertem Segeltuch bestehend,
wird an zwei Riemen oben auf dem Rücken getragen, dient nebst
dem Brotbeutel zum Fortschaffen der nicht am Körper
befindlichen Ausrüstungsstücke des Soldaten.
Toro (Bocas del T.), Bezirk des Staats Panama, s.
Chiriqui.
Toro, Bezirksstadt in der span. Provinz Zamora, rechts am
Duero (mit schöner Brücke) und an der Eisenbahn
Medina-Zamora, mit (1878) 7754 Einw.
Torontál, ungar. Komitat, längs der Maros und
Theiß, wird von diesen Flüssen, der Donau und vom
Komitat Temes begrenzt, umfaßt 949 qkm (172,4 QM.), ist eben,
sehr fruchtbar, hat viele Sümpfe und Moräste und (1881)
530,988 Einw. (Deutsche, Serben, Ungarn und Rumänen), welche
Ackerbau und Viehzucht, lebhaften Handel und Schiffahrt treiben,
und wird von der Szegedin-Temesvárer Bahnlinie sowie vom
Begakanal durchschnitten. Komitatssitz ist die Stadt
Groß-Becskerek.
Torónto, Hauptstadt der britisch-amerikan. Provinz
Ontario, an der westlichen Nordküste des Ontariosees und an
einem vortrefflichen, durch ein Fort beschützten Hafen
gelegen, ward 1794 (unter dem Namen York) angelegt und nahm 1834
den jetzigen indianischen Namen an, der "Versammlungsort" bedeutet.
T. ist jetzt eine der blühendsten Städte Nordamerikas,
mit stattlichen öffentlichen Gebäuden und
Privathäusern, aber flacher, reizloser Umgebung. Es ist
Hauptsitz der höhern Bildungsanstalten Kanadas. Es hat eine
1827 gegründete Universität mit Sternwarte und Museum, 3
theologische Colleges, 2 Arznei- und eine Tierarzneischule, eine
Lehrerbildungsanstalt, ein Gymnasium und 2 Museen. Unter den
zahlreichen Kirchen zeichnen sich die anglikanische und katholische
Kathedralen aus. Andre öffentliche Gebäude sind: der
oberste Gerichtshof Kanadas (Osgoode hall), das Stadthaus, Zollamt,
die Börse, eine große Markthalle, ein Kristallpalast
für landwirtschaftliche Ausstellungen, ein Krankenhaus und
eine Irrenanstalt. Der Handel blüht ungemein, indem Torontos
günstige Lage es zum Haupthafen der westlichen Distrikte
Kanadas gemacht hat (Wert der Einfuhr 1887: 21 Mill., der Ausfuhr
3,2 Mill. Doll.). Die Stadt hat Möbelfabriken,
Gießereien, Brennereien, Brauereien, Korn- und
Papiermühlen. Die Bevölkerung wuchs 1817-81 von 1200 auf
86,415 Seelen. T. ist Sitz eines deutschen Konsuls.
Toropez, Kreisstadt im russ. Gouvernement Pskow, an der
Toropa, mit vielen griechisch-russ. Kirchen, 2 Klöstern,
zahlreichen Gerbereien u. (1887) 6811 Einw.
Torossen, s. Eis, S. 399.
Torpeder, der Mann, welcher den Torpedo handhabt; s.
Torpedo, S. 768.
Torpedo, Zitterroche, s. Rochen.
Torpedo (hierzu Tafel "Torpedos"), ein mit Explosivstoff
gefüllter, namentlich zum Zerstören feindlicher Schiffe
dienender Apparat, nach dem Zitterrochen benannt. David Bushnell
(geb. 1742 zu Connecticut, gest. 1826 in Georgia) baute 1776 ein
steuerbares submarines Boot, mit dessen Hilfe man eine Holzschraube
in den Rumpf des feindlichen Schiffs schrauben und an diese ein mit
Pulver gefülltes Gefaß hängen konnte, das in
bestimmter Zeit durch ein Uhrwerk zur Explosion gebracht wurde.
Diese Erfindung hatte aber so wenig Erfolg wie die Bushnellschen
Treibtorpedos, welche, mit dem Strom gegen die feindlichen Schiffe
treibend, durch den Anstoß an dieselben explodieren sollten.
Robert Fulton konstruierte 1797 ebenfalls ein unterseeisches Boot,
machte mit demselben 1801 im Hafen von Brest gelungene
Sprengungsversuche, wandte sich aber, da er keine Anerkennung fand,
1804 nach England und begleitete eine Expedition nach Boulogne, um
die dort liegende französische Flotte durch Seeminen, die man
Catamaran ("Floß", daher "Catamaran-expedition") nannte, zu
zerstören. Die mit 40 Fässern Pulver gefüllten
Catamarans sollten durch ein Uhrwerk zu bestimmter Zeit
entzündet und durch den Strom gegen die feindlichen Schiffe
geführt werden, hatten aber nur einen sehr geringen Erfolg.
1806 nach Amerika zurückgekehrt, veröffentlichte Fulton
in seinem Buch "T. war, or submarine explosions" (1807) noch viele
Projekte, welche zum Teil erst in neuerer Zeit verwirklicht wurden.
Samuel Colt (Erfinder des Revolvers) sprengte 1842 mehrere
verankerte Schiffe und 1843 ein solches, das mit 5 Seemeilen Fahrt
lief, mittels elektrischer Zündung aus einer Entfernung von 5
Seemeilen in die Luft. In dem T. wurde durch eine Vorrichtung bei
der Berüh-
Torpedos.
Fig. 4. Torpedoboot mit Stangen-Torpedo.
Fig. 1. Kontakt-Torpedo.
Fig. 8. Auslegen von Kontakt-Torpedos.
Fig. 5. Elektrisch steuerbarer Fisch-Torpedo.
Fig. 2. Chemisch wirkender Zünder des Kontakt-Torpedos.
Fig. 3. Treib-Torpedo.
Fig. 6. Durchschnitt. a Lancierrohr b Torpedolager c Kessel d
Maschine e Raum für Offiziere f Raum für Mannschaft g
Schraube h Revolverkanonen i Kommandotürme k Reserveschraube l
Beiboot m Masten mit Segeln, nur zur Überführung nach
China n Podest für Schnellfeuerkanonen o Schnellfeuerkanonen p
Luke oberhalb der Maschine q Ventilator r Luken zum Maschinen- und
Kesselraum s Bugruder
Fig. 7. Grundriß
Fig. 6 u. 7. Hochsee-Torpedoboot, für die chinesische
Regierung erbaut.
Zum Artikel »Torpedo«.
765
Torpedo (Defensiv- und Offensivtorpedos).
rung mit dem Schiffsboden ein metallischer Kontakt
hervorgebracht, der den richtigen Augenblick für die
Zündung am Land signalisierte. Die hierbei benutzten
Leitungsdrähte (so viel bekannt, die ersten submarinen Kabel)
waren durch eine Mischung von Asphalt und Wachs isoliert. 1848
führten Himly und Werner Siemens zum Schutz gegen die
dänische Flotte eine Hafensperre in Kiel aus. Es wurden
ausgepichte, mit 20 Ztr. Pulver gefüllte Fässer, in
welche zwei Leitdrähte geführt waren, deren
Verbindungsdraht in Schießbaumwolle lag, 6 m tief verankert.
Am Strand waren zwei Beobachtungsstellen angelegt, von denen aus
das Passieren einer Mine beobachtet wurde. Im Krimkrieg verwendete
man elektrische, vom Land aus zu zündende Grundminen (auf dem
Grund liegend) und Stoß- oder Kontaktminen, die durch den
Anstoß des Schiffs zur Explosion gebracht werden sollten. Der
Zünder der letztern bestand aus einer mit Schwefelsäure
gefüllten Glasröhre, bei deren Zerbrechen sich die
Säure über ein Gemisch von chlorsaurem Kali und Zucker
ergoß, wodurch dieses und somit die Mine zur Explosion
gebracht wurde. Über den Zünder war eine Schutzkappe aus
Blei geschraubt (s. Tafel, Fig. 1 u. 2, Kontakttorpedo und
Zünder desselben). Ihre allgemeine Einführung als
Kriegsmittel und ihre heutige Bedeutung verdanken die Torpedos dem
amerikanischen Bürgerkrieg. Im Februar 1862 fanden die
Nordstaaten die erste Torpedosperre im Savannahfluß; im
Oktober d. J. organisierten die Südstaaten das erste
Torpedokorps, anfänglich unter Leitung von F. M. Maury, dann
unter dem General Rains. Von den sich jetzt andrängenden
zahllosen Torpedoerfindungen fanden folgende vorzugsweise
Verwendung: Die Pfahl-, Rahmen- oder Gerüstminen zur Sperrung
von Hafeneinfahrten waren auf eingerammtem Pfahlwerk befestigte
Sprengkörper mit 12½ kg Pulver, deren Zünder durch
Anstoß funktionierte. Die Treib- oder Faßtorpedos waren
verpichte, mit 40 bis 60 kg Pulver gefüllte Fässer, meist
mit mehreren Kontaktzündern, zuweilen auch mit Uhrwerk
versehen, die mit angehängtem Ballast unter der
Oberfläche schwammen und durch den Strom gegen die
Blockadeschiffe getrieben wurden. Der auf beifolgender Tafel
dargestellte Treibtorpedo (Fig. 3) hat einen
Perkussionszünder, welcher erst funktioniert, wenn die Mine
zum Stillstand kommt; dann wird durch den Strom die Schraube mit
Flügeln in Drehung versetzt, wodurch das aus der Drehachse
verschiebbare Gewinde so weit fortgleitet, bis die Hahnsicherung
frei wird; sofort schlägt der Hahn herunter auf ein
Zündhütchen und bringt dieses und die Mine zur Explosion.
Da die Treibminen nicht selten den eignen Schiffen gefährlich
wurden, wenn sie der Gegenstrom bei eintretender Flut
zurückführte, so wendete man zur Sperrung der Häfen
vielfach schwimmende Torpedos an, die, am Grund verankert, durch
einen Schwimmer von Korkholz getragen wurden. Nach der Konstruktion
von Singer war das mit der Basis nach oben gekehrte
Minengefäß von der Form eines abgestumpften Kegels durch
einen lose aufliegenden Deckel geschlossen, welcher herunterfiel,
sobald die Mine beim Anstoß eines Schiffs sich nach einer
Seite neigte; im Herunterfallen löste er die Hemmung eines
Schlaghahns aus, der nun eine Zündpille durch Schlag
entzündete, worauf die Mine explodierte. Durch das Bewachsen
mit Muscheln wurde aber der Mechanismus aller komplizierten
Zündvorrichtungen häufig sehr bald in seiner Gangbarkeit
gestört, die Schwimmkraft der Minen vermindert und dadurch
ihre zeitgerechte Explosion fraglich. Eine furchtbare Waffe waren
die Uhrwerktorpedos oder Höllenmaschinen, gewöhnliche
Warenkisten, mit Pulver gefüllt und mit einem Uhrwerk
versehen, das zu bestimmter Zeit die Explosion bewirkte. Die
Kohlentorpedos waren gußeiserne Gefäße, durch
Bestreichen mit Teer und Bekleben mit Kohlengruß den
großen Kohlenstücken täuschend ähnlich
gemacht. Sie wurden, mit Pulver gefüllt, unter Kohlen gemischt
und explodierten in der Kesselfeuerung der Dampfschiffe, die dann
sofort versanken. Durch solche Kisten- und Kohlentorpedos ist
wahrscheinlich eine große Anzahl Schiffe der Nordstaaten
zerstört worden, deren spurloses Verschwinden nur so
erklärt werden kann. Außer den genannten kamen noch
elektrische Minen mit 20-30 Ztr. Pulver erfolgreich zur Verwendung.
Bei diesen wurden die mit Guttapercha und geteertem Hanf isolierten
Leitungsdrähte durch einen dünnen Platindraht
(Glühdraht) verbunden, welcher in einem mit Knallquecksilber
oder Mehlpulver gefüllten Zünder steckte.
Hatten die bisherigen Torpedos mit Erfolg ausschließlich
der Verteidigung gedient, so lag es nahe, dieselbe Waffe auch beim
Angriff zu verwenden, und man löste die Aufgabe nach Fultons
Vorschlag, indem man an der Spitze langer Stangen einen T. mit
Kontaktzünder befestigte und denselben unter den Boden des
feindlichen Schiffs schob (s. Tafel, Fig. 4). Hierzu bediente man
sich der Ruderboote oder kleiner Dampfbarkassen und besonders
für diesen Zweck erbauter eiserner Dampfboote in Zigarrenform,
die ihrer Kleinheit wegen Davids genannt wurden. Auch Bushnells
Idee der unterseeischen Boote trat wieder ins Leben; 17. Febr. 1864
wurde im Hafen von Charleston der Hausatonic durch ein solches
gänzlich zerstört, mit ihm aber auch das Boot. Nach
solchen Erfolgen traten alle Staaten dem Torpedowesen näher.
Überall wurden Kommissionen zur Prüfung des Vorhandenen,
Ausführung von Versuchen und entsprechenden Neukonstruktionen
eingesetzt. Man teilte die Torpedos in Defensiv- und
Offensivtorpedos und nannte erstere Seeminen, letztere kurzweg
Torpedos. Die im amerikanischen Krieg so viel verwendeten
Treibtorpedos verwarf man in Rücksicht auf die Gefahr, die sie
bei eintretendem Rückstrom oder bei Offensivbewegungen den
eignen Schiffen bringen, gänzlich. Alle Seeminen wurden
verankert und mit Auftrieb versehen, so daß sie in bestimmter
Wassertiefe schwimmend erhalten wurden. Die Zündung der Minen
erfolgte durch Kontakt- oder durch elektrische Zünder. Jene,
die Stoßminen, haben den Vorzug großer Einfachheit;
aber ihr gefahrvolles Auslegen und Wiederaufnehmen sowie die
Sperrung der Ausfahrt auch für die eignen Schiffe mußten
ihre Verwendung auf den zu beiden Seiten für den eignen
Verkehr freizulassenden Teil des Fahrwassers beschränken,
während in dem durch sie nicht gesperrten Wasser
Beobachtungsminen so tief versenkt wurden, daß die Fahrt auch
bei Ebbe für die größten Schiffe frei blieb. Die
alleinige Verwendung von elektrischen Beobachtungsminen ist bei
größerer Zahl durch die Kabelleitung (zwei Drähte
für jede Mine) nicht nur sehr kostspielig, sondern auch in
Bezug auf sichere Beobachtung kaum durchführbar. Alle bis
jetzt bekannt gewordenen Vorrichtungen zur Bestimmung des
Augenblicks, wann sich ein Schiff über einer der Minen
befindet, sind kompliziert und bei Nacht, Nebel und Pulverdampf
nicht zu gebrauchen. Den Apparaten liegt die Idee zu Grunde, durch
den Schnittpunkt zweier Visierlinien den Moment zu bestimmen, wann
sich ein
766
Torpedo (ältere und neuere Konstruktionen).
Schiff über der Mine befindet. Bei den meisten Apparaten
sind zwei Meßtische aufgestellt, deren Abstand als Basis
für das Beobachtungsdreieck genügend groß sein
muß. Auf jeder der beiden Meßtischplatten, auf denen
die ausgelegten Minen durch Punkte bezeichnet sind, steht ein
Fernrohr, und es handelt sich nun darum, dem Fernrohr an der
Zündstation die Bewegungen des andern synchronistisch
mitzuteilen, zu welchem Zweck beide Meßtische durch eine
elektrische Leitung verbunden sind. Durch dieselbe wird mit Hilfe
mechanischer Einrichtungen auf der Zündstation ein Zeiger oder
Lineal parallel der Fernrohrachse der andern Station bewegt. Bilden
nun die Verbindungslinie der beiden senkrechten Fernrohrachsen und
die Visierlinien der beiden Fernrohre das wirkliche
Beobachtungsdreieck, so wird durch das synchronistisch bewegte
Lineal auf der Zündstation stets ein jenem ähnliches
Dreieck dargestellt, und wenn die in die See fallende Spitze des
Dreiecks auf einen Minenpunkt fällt, so ist der Moment
für die Stromschließung der Zündbatterie und die
Explosion der Mine gekommen. In Deutschland ist ein derartiger
Apparat von Siemens und Halske im Gebrauch. Aus allem diesen geht
hervor, daß nur eine solche Zündeinrichtung der Minen
befriedigen konnte, welche die Vorteile des Kontakt- und
elektrischen Zünders ohne deren Nachteile vereinigt. Dies war
bereits 1866 vom österreichischen Obersten v. Ebener erkannt
worden, und es gelang ihm, eine solche Vorrichtung herzustellen,
bei welcher durch den Stoß des Schiffs die
Stromschließung der Leitung selbstthätig in der Weise
erfolgte, daß eine federnde Pufferstange beim Anstoß
ein Rad in Bewegung setzte, wodurch zunächst die
Stromschließung, sodann aber die Einschaltung der
Zündpatrone in den Stromkreis stattfand. War nun die
Zündbatterie am Land eingestellt, so erfolgte die Explosion;
andernfalls ging der Puffer nach Einwirkung des Schiffs auf
denselben wieder zurück, ohne daß eine Entzündung
eintrat. Diese Minen gestatteten also die freie Durchfahrt, solange
die Zündbatterie am Land nicht eingeschaltet war, ganz wie die
Beoachtungsminen und verhielten sich nach deren Einschaltung wie
Stoßminen. Wegen der Kompliziertheit der mechanischen
Einrichtung sind diese Minen indes nicht mehr in Verwendung.
Vorteilhafter erwies sich der Hertzsche elektrische Zünder,
der beliebig lange in Wirksamkeit bleibt, aber erst dann in
Thätigkeit tritt, wenn durch den Anstoß eines Schiffs
seine Kohlenzinkelemente mit einer erregenden Flüssigkeit in
Verbindung gebracht werden; die Entzündung erfolgt aber auch
dann nur, wenn noch ein Leitungsdraht zum Meeresboden führt.
Das gefahrlose Auslegen dieser Minen ist dadurch gesichert,
daß erst nach einstündigem Liegen im Wasser die
elektrische Batterie des Zünders wirkungsfähig wird;
inzwischen bleibt jedes Berühren des Torpedos ohne Erfolg. Die
Gefahr des Aufnehmens ist vollständig beseitigt, sobald der
Draht vom Meeresboden gehoben oder durchschnitten ist. Zu diesem
Zweck vereinigt man die Drähte einer größern Anzahl
von Minen an einem außerhalb ihrer Wirkungssphäre
liegenden und nur dem Eingereihten bekannten Punkte. Diese Minen,
deren spezielle Einrichtung geheimgehalten wird, bilden in
Deutschland den Schwerpunkt der Küstenverteidigung durch
Torpedos. Seitdem man die Seeminen, statt mit Ketten und Steinen
oder gewöhnlichen Ankern, mit Drahttauen und Pilz- oder
Saugankern, die sich im Grund festsaugen, verankert, werden
dieselben weniger leicht durch Strömungen fortgerissen. Man
legt die Stoßminen in zwei oder mehr Reihen (Treffen)
schachbrettförmig hintereinander an, so daß ein Schiff
die Sperre nicht passieren kann, ohne auf eine Mine zu
stoßen.
Der Spierentorpedo besitzt noch die alte Konstruktion, nur
wendet man häufig auch bei ihm die elektrische Zündung
an. Ende der 60er Jahre wurde von den Gebrüdern Harvey ein
Offensivtorpedo konstruiert, der aus einem kupfernen, mit Holz
bekleideten trapezoidischen Kasten besteht; an demselben sind
mehrere in einen Ring zusammenlaufende Leinen so befestigt,
daß der T. beim Schleppen um 45-60°, je nach der
schnellern Fahrt, querab vom Schiff ausschert. Man manövriert
so, daß das feindliche Schiff über die Schleppleine
laufen muß, bei deren Anziehen der T. gegen den Schiffsboden
stößt, in welchem Augenblick die Explosion bei
Kontaktzündern von selbst erfolgt, oder man zündet durch
Elektrizität. Zur Verhütung vorzeitiger Explosionen ist
der Zündmechanismus durch einen Vorstecker arretiert, den man
mittels einer Leine herauszieht, wenn der T. weit genug vom Schiff
abgetrieben ist. Der Harvey-T. kann nur bei Tage gebraucht werden,
und im Geschwaderkampf können Feind wie Freund auf den T.
auflaufen, zumal wenn im Melée und Pulverdampf die Schiffe
schwer zu unterscheiden sind. Aus diesen Gründen ist der
Harvey-T. in den meisten Marinen wieder außer Gebrauch
gekommen oder höchstens auf die Fälle beschränkt,
wenn einzelne Schiffe auf Kreuzungen ausgehen.
Fulton stellte 1814 Versuche an, mit Geschützen unter
Wasser zu schießen, um Schiffen unter der Wasserlinie einen
Leck beizubringen, und hat bis in die neueste Zeit Nachahmer
gefunden, von denen aber keiner Erfolg erreichte; der Widerstand
des Wassers ist so bedeutend, daß die Geschwindigkeit der
Geschosse in rapider Weise abnimmt. Man kann von einem
Geschoß unter Wasser nur dann befriedigende Wirkung erwarten,
wenn die dasselbe bewegende Kraft nicht bloß einmal, wie beim
Geschütz, sondern auf eine gewisse Zeit dauernd wirkt. 1730
soll Desaguliers Boote unter Wasser mit Raketen zerstört
haben; 1862 schoß Hunt aus 30,5 cm Geschützen Raketen;
1874 machte Weir in New York unter Wasser Versuche mit einer Rakete
von 2,31 m Länge, 30,5 cm Durchmesser und 111 kg Gewicht,
wovon auf den Treibsatz 35 kg und die Sprengladung 34 kg kamen; sie
ging mit etwa 4,5 m Geschwindigkeit, hatte aber infolge ihres
Leichterwerdens durch Verbrennen des Satzes eine
unregelmäßige Flugbahn. 1872 wurde von Lay ein
elektrisch steuerbarer Fischtorpedo in Zigarrenform (s. Tafel, Fig.
5) konstruiert, dessen treibende Kraft durch das Verdunsten
flüssiger Kohlensäure erzeugt wird, wovon der T. 200-250
kg enthält. Das Ausströmen der Kohlensäure ist auf 6
Atmosphären Druck geregelt, so daß der
Schraubenpropeller die gleiche Geschwindigkeit behält. Durch
ein sich aus dem T. abwickelndes Kabel mit zwei
Leitungsdrähten bleibt derselbe mit dem Land in Verbindung.
Der galvanische Strom setzt einen komplizierten Mechanismus in
Bewegung, durch den das Öffnen und Schließen eines
Dreiwegehahns für das Ausströmen der Kohlensäure und
durch Anziehen von zwei Elektromagneten das Steuern bewirkt wird.
Durch die Elektromagnete werden zwei Kolben bewegt, von denen jeder
mit einer Seite der Ruderpinne verbunden ist. Der Gang des Torpedos
im Wasser ist durch zwei auf seinem Rücken stehende Stäbe
sichtbar gemacht. Außer sehr großer Kompliziertheit hat
dieser T., der von der ägyptischen Regierung angenommen ist,
unter vielen andern noch den Nachteil, daß die
Herstellungskosten eines Exemplars
767
Torpedo (Fischtorpedo, Torpedoboote).
30,000 Mk. betragen. Der Smithsche T. (1872) ist dem vorigen
ähnlich; er wird durch den Druck flüssigen Ammoniaks
bewegt und mittels galvanischen Stroms gesteuert. Alle diese und
andre Offensivtorpedos werden von dem 1867 vom
österreichischen Kapitän Lupis und dem Ingenieur
Whitehead in Fiume erfundenen Fischtorpedo übertroffen,
welcher wegen seiner vorzüglichen Leistungen von fast allen
Kriegsmarinen eingeführt worden ist. Ein Whiteheadscher
Fischtorpedo ist ca. 4,5 m lang, bei einem größten
Durchmesser von 0,5 m; er besitzt kreisrunde Querschnitte und ist
an beiden Enden scharf zugespitzt. Sein Gewicht beträgt ca.
300 kg. Als treibende Kraft dient in eine besondere Abteilung des
Torpedos bis zu 100 Atmosphären Spannung eingepumpte Luft, die
bei ihrem Ausströmen eine Maschine treibt, durch welche zwei
vierflügelige Schrauben gedreht werden, die hintereinander
sitzen und sich gegeneinander bewegen, um das Drehen des Torpedos
zu verhüten. Um das Schiff in bestimmter Tiefe unter der
Wasserlinie zu treffen, hat der Fischtorpedo eine Einrichtung,
durch welche er auf eine bestimmte Wassertiefe gestellt werden
kann, und die, auf ein horizontales Ruder wirkend, die Wassertiefe
während der ganzen Dauer der Bewegung reguliert; ein zweites,
senkrecht stehendes Ruder dient zur Innehaltung der Richtung in
vertikaler Ebene. Der vorderste Teil des Torpedos enthält die
Sprengladung, die durch einen beim Anstoß funktionierenden
Zünder entzündet wird. Vier radial am Kopf sitzende
scharfe Messer verhindern bei schiefem Auftreffen an der
Schiffswand das Abgleiten. Die Geschwindigkeit des Torpedos wird
vor seinem Ablassen durch Stellung der Ventile bestimmt: werden
diese ganz geöffnet, so erreicht er in der ersten Sekunde eine
Geschwindigkeit von etwa 13 m und läuft fast 2 Seemeilen; bei
einer Anfangsgeschwindigkeit von 6,5 m erreicht er 2 Seemeilen
(3710 m). Mit der Geschwindigkeitsabnahme wachsen die Schwankungen
und nimmt die Treffsicherheit ab. Die Fischtorpedos wurden
früher aus Stahl, jetzt der bessern Konservierung halber aus
Phosphorbronze hergestellt. Ein T. kostet ca. 7500 Mk. Die
Fischtorpedos wurden zuerst aus unter Wasser, im Bug und Heck in
der Symmetrieebene des Schiffs fest eingebauten Lancierrohren
abgelassen, derart, daß die durchlaufene Bahn in der
verlängerten Mittellinie des Schiffs lag. Auch die
Einführung von über Wasser befindlichen Lancierrohren
änderte an letzterm Umstand nichts, so daß die dem T. zu
gebende Richtung demselben lediglich mit dem Schiff selbst erteilt
werden konnte, was bei bewegtem Wasser und sich schnell bewegendem
Zielobjekt mit geringen Treffchancen verknüpft ist.
Infolgedessen hat man zur Zeit zum Abschießen von
Fischtorpedos geschützartige Apparate, sogen. Torpedokanonen,
in Anwendung gebracht, welche, auf Deck stehend und um ein Pivot
drehbar, in ähnlicher Weise das Ziel zu nehmen gestatten wie
gewöhnliche Geschütze. Das Abschießen des Torpedos
aus dem Lancierrohr, resp. der Kanone geschah zuerst und geschieht
bei den ältern Apparaten auch jetzt noch mittels komprimierter
Luft; in neuester Zeit bringt man zu dem Zweck auch
Schießpulver zur Anwendung, welches man in der Torpedokanone
hinter dem als Geschoß fungierenden Torpedo zur Verbrennung
bringt. Wenn der T. das Lancierrohr oder die Torpedokanone
verläßt, stößt ein äußerlich
vorstehender Daumen gegen eine Knagge, hierdurch wird ein
entsprechender Hahn geöffnet, und nun beginnt die durch
komprimierte Luft betriebene Maschine ihre Thätigkeit. Die in
der vordern Spitze des Torpedos untergebrachte Sprengladung besteht
aus feuchter Schießbaumwolle. Obgleich der Fischtorpedo zur
Zeit an Bord von fast allen größern Kriegsschiffen
geführt wird, so findet derselbe seine Hauptanwendung doch auf
den sogen. Torpedobooten (Fig. 6 u. 7), deren fast
ausschließliche Bewaffnung derselbe bildet. Fast alle
Kriegsmarinen besitzen größere oder kleinere
Torpedobootflottillen, darunter Deutschland die mit am besten
organisierten. Die Boote sind aus Stahl gebaut und haben eine
Länge von ca. 40 m, die jedoch in neuester Zeit im Interesse
einer größern Ladefähigkeit (entweder um mehr
Torpedos nebst Munition, ein größeres Kohlenquantum oder
eine anderweitig vollkommnere Armierung, bestehend in
Schnellfeuerkanonen oder Revolvergeschützen, mitführen zu
können) keineswegs die Maximallänge repräsentiert.
Ihre scharfe Form und die bedeutende Kraft ihrer Maschinen
gestatten denselben, Geschwindigkeiten von 20 Knoten und
darüber zu erreichen. Derartig hohe Geschwindigkeiten
befähigen die Torpedoboote bei besondern Gelegenheiten,
speziell wenn es nicht darauf ankommt, ihren immerhin nur geringen
Kohlenvorrat vorzeitig zu erschöpfen, unter andern auch zu
Ekläreurdiensten und sind bei der Ausübung ihres Angriffs
auf feindliche Schiffe unerläßlich. Letztern hat man
sich in der Weise vorzustellen, daß eine größere
Anzahl von Booten entweder unter dem Schutz eines Geschwaders von
größern Schlachtschiffen oder von geeigneten Punkten der
Küste aus, vorzugsweise des Nachts, dem feindlichen Schiff so
schnell als möglich auf Schußweite nahe zu kommen sucht.
Dieses Manöver hat deswegen die Chance des Gelingens für
sich, weil das feindliche Schiff seine Aufmerksamkeit nicht auf
sämtliche angreifenden Boote gleich wirksam ausüben kann;
während es sich gegen einige derselben verteidigt, wird das
eine oder andre Boot Gelegenheit finden, seinen T. zu lancieren.
Die Verteidigungsmittel größerer Kriegsschiffe gegen
einen Angriff von Torpedobooten bestehen in schnell feuernden und
Revolverkanonen, deren Aufstellung an Bord so beschaffen ist,
daß das Schiff nach allen Richtungen hin feuern kann. Bei
einem nächtlichen Angriff wird dabei auch die weitere Umgebung
des Schiffs mittels elektrischen Bogenlichts erleuchtet, dessen
Reflektoren so eingerichtet sind, daß sie, um eine vertikale
Achse drehbar, den ganzen Horizont abzusuchen gestatten. Um nun
ihrerseits in dem Leuchtkegel des elektrischen Strahls nicht zu
früh als Torpedoboote erkannt zu werden, sind diese über
Wasser in allen ihren Teilen mit einer nicht reflektierenden
schwarzen Farbe gestrichen. Gelingt es einem Torpedoboot, innerhalb
der Schußweite der schnell feuernden Kanonen im elektrischen
Lichtkegel unbemerkt zu bleiben, so ist die Chance gegeben, bis zum
nächsten Beleuchtetwerden bis auf Torpedoschußweite
heranzukommen. Hieraus ergibt sich, wie große Anforderungen
an die Aufmerksamkeit eines einen Torpedobootsangriff erwartenden
Schiffs gestellt werden, und daß anderseits die von
Torpedobooten verzeichneten günstigen Erfolge zum Teil der
Unaufmerksamkeit des angegriffenen Schiffs zuzuschreiben sind. Bei
der Blockade von feindlichen Häfen, deren Verteidigung
Torpedobooten obliegt, tritt häufig der Fall ein, daß
die blockierenden Schiffe ankern müssen. Diese umgeben sich
alsdann mit sogen. Torpedoschutznetzen aus starkem Stahldraht,
welche an Spieren in einer gewissen Entfernung vom Schiff in
solcher Weise ausgebracht werden, daß der unter Wasser
befindliche Teil des Schiffs vollkommen durch die Netze
768
Torpedobatterie - Torre Annunziata.
maskiert wird. Ein auf das Schiff lancierter T. wird durch das
Netz aufgefangen und kommt nicht in unmittelbarer Nähe der
leicht verletzbaren Teile des Schiffsbodens zur Explosion, so
daß die Möglichkeit, durch dieselbe zum Sinken gebracht
zu werden, nur gering ist. Zum Sperren der Häfen und Reeden
mit Minen bedient man sich besonderer Boote, Minenleger und
Minenprahme; letztere dienen nur zum Transport, erstere zum
Auslegen der Minen, zu welchem Zweck sie Kräne zum
Aufhängen der Minen und Anker haben müssen, die in
neuerer Zeit meist korrespondierend an beiden Bordwänden
stehen, oder man benutzt hierzu das Bugspriet oder auch einen
Kranbalken am Heck (Fig. 8). - Über die gegen die Minen
anzuwendenden Schutzmittel hat man noch wenig Erfahrungen. Die
Leitungsdrähte von elektrischen Minen wird man durch
Schleppanker und Dreggen aufzufischen suchen und zerschneiden; man
wird Ketten und Taue über den Grund ziehen, um die Minen
selbst aufzufischen oder zur Explosion zu bringen, zu welchem Zweck
man kleine Boote vorschickt. Der Verteidiger aber wird sich
hiergegen dadurch sichern, daß er die Minensperre in den
Bereich des wirksamen Geschützfeuers legt und vor dieselbe
eine Kettensperre zieht. Hat man von der Lage der Minen Kenntnis,
so wird man zwischen dieselben Minen (Gegen- oder Quetschminen) zu
legen suchen oder hineintreiben, um durch deren Explosion die
Explosion der Sperrminen zu veranlassen. Man glaubt sogar, sich mit
schweren Geschossen einen Weg durch die Minensperre
erschießen zu können. Auch will man, wie im
Rettungswesen, mit einem Geschoß eine Leine über die
Sperre schießen und beim Zurückziehen derselben Minen
zerstören. Gegen Angriffe mit Spierentorpedos ist die
Wachsamkeit der beste Schutz. In den meisten Marinen hat man
für den Dienst mit Torpedos besondere Torpedokorps errichtet;
in denselben ist der Torpederleutnant ein Verwaltungsoffizier,
Obertorpeder und Torpeder sind Deckoffiziere erster und zweiter
Klasse, der Obertorpedersmaat ist Sergeant und der Torpedersmaat
Unteroffizier. Vgl. "Die Torpedos und Seeminen in ihrer
historischen Entwickelung" (Berl. 1878); "Submarine warfare
offensive and defensive" (New York 1869); "Des explosions au sein
de l'eau" und "Études sur les effets des explosions
sous-marines" in der "Revue maritime" (Par. 1877); Ehrenkrook, Die
Fischtorpedos (Berl. 1878); Derselbe, Geschichte der Seeminen und
Torpedos (das. 1878); Sleeman, Torpedos and Torpedo warfare (2.
Aufl., Lond. 1889); "Das Torpedowesen in der deutschen Marine"
(Berl. 1884).
Als Landtorpedos hat man Sprengkörper bezeichnet, wie sie
zuerst im nordamerikanischen Bürgerkrieg bei der Verteidigung
von Charleston, dann auch 1870 bei der Verteidigung von Paris
benutzt wurden, hölzerne oder eiserne, mit Sprengladung
versehene und auf Wegen, Defileen etc. oberflächlich in die
Erde vergrabene Gefäße, deren Zünder durch den
Fuß der darüber hinschreitenden Truppen in
Thätigkeit trat. Weitere Ausbildung erhielten die Landtorpedos
durch Zubovits. Er konstruierte fliegende Torpedos mit 2 kg
Sprenggelatine, die von den Feldtruppen mitgeführt werden,
Torpedos für feldmäßige Befestigung mit 10 kg und
solche für beständige Befestigungen mit 15-50 kg
Sprenggelatine. Seine Tritttorpedos explodieren beim Betreten der
Stelle, wo sie vergraben sind, die Berührungstorpedos beim
Wegräumen gewisser Hinderungsmittel (zurückgelassene
Wagen etc.), Beobachtungstorpedos bringt ein Beobachter mit Hilfe
von Abzugsdrähten im geeigneten Moment zum Spielen,
während die selbsttätigen Torpedos durch einen uhrartigen
Regulator zur bestimmten Zeit zur Explosion gebracht werden. Dies
System ist von mehreren Staaten angenommen worden. Lufttorpedos
(Aerobomben) sind Luftballons, welche mit Sprengstoffen geladene
Gefäße oder Geschosse über eine feindliche Festung
tragen und in dieselbe niederfallen lassen sollen.
Torpedobatterie, Kombination mehrerer
Unterwasserlancierrohre für Fischtorpedos, welche von zwei
fest miteinander verbundenen Pontons aus gleichzeitig gehoben,
geladen und unter Wasser gesenkt werden können. Dieselben sind
zur Verteidigung von Hafeneinfahrten bestimmt, bis jetzt jedoch
noch im Stadium des Versuchs.
Torpedoboot, s. Torpedo, S. 767.
Torpedogranaten, von Krupp für den 21 cm Mörser
hergestellte 6 Kaliber lange Gußstahlgranaten, welche eine
Sprengladung von 48 kg prismatischen Pulvers aufnehmen; aus ihnen
sind die jetzt in allen Artillerien gebräuchlichen Granaten
mit brisanter Sprengladung aus Schießwolle, Dynamit, Melinit
etc. hervorgegangen, welche aus 15 und 21 cm Mörsern
verschossen werden.
Torpid (lat.), schwer erregbar, empsindungslos.
Tórpor (lat., Torpidität), krankhaft
verminderte Erregbarkeit und Beweglichkeit, Stumpfsinn.
Torquatus, s. Manlius 2) und 3).
Torquay (spr. torkih), Stadt in Devonshire (England),
steigt terrassenförmig vom Meer an und wird von belaubten
Höhen mit zahlreichen Villen eingefaßt. Es ist eine alte
Stadt, wie die Ruine der Torabtei und die Tor Moham-Kirche, beide
aus dem 14. Jahrh., beweisen, ist aber erst seit Anfang des 19.
Jahrh. als beliebter Badeort wichtig geworden. T. hat einen
Kursaal, ein Museum, einen Zufluchtshafen für Jachten und
(1881) 24,767 Einw. Dabei Kent's Hole, eine Höhle, in der
zahlreiche Werkzeuge aus der Steinzeit und die Knochen
vorweltlicher Tiere gefunden wurden.
Torquemada (spr. -ke-), 1) Johannes de (Turrecremata),
Vertreter des Papalsystems, geb. 1388 zu Valladolid und schon als
Knabe dem Dominikanerorden übergeben. Seit 1431 magister sacri
palatii in Rom, nahm er an dem Baseler Konzil teil, erklärte
sich hier gegen die immaculata conceptio, aber auch gegen den von
der Majorität verfochtenen Satz von der Überordnung des
Konzils über den Papst. Ihm verlieh für seine dem Stuhl
Petri erwiesenen Dienste Eugen IV. den Titel eines "defensor fidei"
sowie den Kardinalshut. Er starb 1468 in Rom. Unter seinen
Schriften sind zu nennen: "Quaestiones Evangeliorum de tempore et
sanctis", ein Kommentar zum Dekret Gratians etc. Vgl. Lederer, Der
spanische Kardinal Joh. v. T. (Freiburg 1879).
2) Thomas de, span. Generalinquisitor; s. Inquisition, S.
971.
Torquieren (lat.), krümmend drehen (z. B. Tabak);
martern, peinigen, plagen.
Torr. et Gray, bei botan. Namen Abkürzung für
J. Torrey, Arzt in New York. Gray, s. Gray 6). Flora
Nordamerikas.
Torre Annunziata, Stadt in der ital. Provinz Neapel,
Kreis Castellammare, am Golf von Neapel, Knotenpunkt der
Eisenbahnen Neapel-Salerno und Cancello-Gragnano, hat bedeutende
Fabrikation von Maccaroni, Fischerei, einen Hafen, in welchem 1886:
2566 Schiffe mit 127,904 Ton. einliefen, Ausfuhr von Teigwaren,
Mehl und Steinen, Einfuhr von Getreide und Wein und (1881) 20,060
Einw.
769
Torre del Greco - Torstensson.
Torre del Greco, Stadt in der ital. Provinz Neapel, am
Golf von Neapel und an der Eisenbahn Neapel-Salerno, hat mehrere
Kirchen, zahlreiche Landhäuser, ansehnlichen Schiffbau,
Fischerei und Korallenfang, Fabrikation von Korallenwaren, Weinbau,
Schiffahrt und (1881) 21,588 Einw. T. ist der Hauptsitz der
Korallenfischer des Mittelmeers. Es wurde vom Kaiser Friedrich II.
auf den Ruinen römischer Bauten gegründet, litt sehr oft
durch Erdbeben und Ausbrüche des Vesuvs, so insbesondere 1631,
1794 und 1872. Unweit östlich das Kloster Camaldoli (della
Torre) am Hang des Vesuvs.
Torre de Moncórvo, Stadt in der portug. Provinz
Traz os Montes, Distrikt Braganza, unweit der Mündung des
Sabor in den Douro gelegen, mit Kastell, Seidenweberei und (1878)
2040 Einw.
Torrefaktion (lat.), Dörrung, Röstung (der
Erze).
Torre Maggiore (spr. maddschore), Stadt in der ital.
Provinz Foggia, Kreis San Severo, hat einen ehemals herzoglichen
Palast, ein berühmtes ehemaliges Cassinenserkloster und (1881)
8234 Einw.
Torrenssee (Lake Torrens), großer Salzsumpf in
Südaustralien, westlich von und zum Teil parallel mit der
Flinderskette und durch einen nur 31 km breiten Isthmus von dem
nördlichsten Ausläufer des Spencergolfs getrennt. Ein
Projekt, den See mit diesem zu verbinden, kam nicht zur
Ausführung, da der T., wie nachgewiesen wurde, zu hoch liegt,
um vom Meer aus hinlänglich mit Wasser gefüllt zu werden.
Die höchst öden Ufer sind nur an der Ostseite von
Viehzüchtern besetzt.
Torre Pellice (spr. pellihtsche. La Tour), Flecken in der
ital. Provinz Turin, Kreis Pinerolo, am Pellice und der Eisenbahn
Turin-T., Hauptort der Waldensergemeinden, hat ein Lycealgymnasium,
Tuch- und Baumwollmanufaktur, Seidenspinnerei und (1881) 2840
Einw.
Torres Novas, Stadt in der portug. Provinz Estremadura,
Distrikt Santarem, am Almondo und der Eisenbahn Lissabon-Oporto,
hat Leinenindustrie und (1878) 8065 Einw.
Torresstraße, Meerenge zwischen der Yorkhalbinsel
des Australkontinents und Neuguinea, welche das Arasurameer mit dem
Korallenmeer verbindet. Sie ist durch zahlreiche Inseln: Prince of
Wales, Horn, Thursday (s. d.), Booby, Banks, Mulgrave u. a., sowie
durch unzählige Korallenriffe, welche sich weit nach O. hin
erstrecken, fast verschlossen. Zwischen den Riffen führen
schmale Kanäle hindurch, der bedeutendste der Prince of
Wales-Kanal, welcher von den Postdampfern zwischen Batavia und
Brisbane benutzt wird. Der südlichere Teil heißt
Endeavourstraße (s. d.). Der erste, welcher die Straße
befuhr, war Torres (1606); Cook besuchte sie 1770, aber erst 1802
fand Flinders einen sichern Weg durch dieselbe.
Torres Vedras, Stadt in der portug. Provinz Estremadura,
Distrikt Lissabon, am Sigandro und der Bahnlinie Lissabon-T., mit
altem Schloß, 4 Kirchen. Weinbau und (1878) 4926 Einw. In den
Linien von T. auf einem Höhenrücken behauptete sich
Wellington im Winter 1810 auf 1811 gegen die Franzosen unter
Masséna.
Torrevieja, Stadt in der span. Provinz Alicante, am
Mittelländischen Meer, durch Zweigbahn mit der Linie
Alicante-Murcia verbunden, mit Hafen, starkem Export des in den
Salinen der Provinz gewonnenen Salzes (jährlich aegen 800,000
metr. Ztr.) und (1878) 8165 Einw. T. ist Sitz eines deutschen
Konsuls.
Torricelli (spr. -tschelli), Evangelista, Mathematiker
und Physiker, geb. 15. Okt. 1608 zu Piancaldoli, studierte etwa
seit 1628 in Rom unter Castelli, ging 1641 zu Galilei nach Florenz,
um diesem bei der Ausarbeitung seiner "Discorsi" zu helfen, und
ward 1642 Professor der Mathematik und Physik in Florenz, wo er 25.
Okt. 1647 starb. Er schrieb: "Trattato del moto" (vor 1641) und gab
in seinen "Opera geometrica" (Flor. 1644) die Gesetze vom
Ausfluß der Flüssigkeiten aus Gefäßen
(Torricellis Lehrsatz, s. Ausflußgeschwindigkeit). Er erfand
1643 das Barometer und erkannte die unregelmäßigen
Schwankungen desselben, verfertigte zuerst einfache Mikroskope und
verbesserte die Fernrohre. Vgl. J. R. v. Mayer, Die Torricellische
Leere (Stuttg. 1876).
Torricellische Leere und Röhre, s. Barometer.
Tórrington, alte Stadt in Devonshire (England), am
Torridge, südöstlich von Bideford, hat Fabrikation von
Handschuhen und (1881) 3445 Einw.
Torsellino (lat. Tursellinus), Orazio, Gelehrter, geb.
1545 zu Rom, trat 1562 in den Jesuitenorden, ward Rektor der
Kollegien in Florenz und Loreto; starb 6. April 1609 in Rom. Sein
Werk "De usu particularum latini sermonis" (Rom 1598) ward zuletzt
von Hand (Leipz. 1829-45, 4 Bde.) bearbeitet.
Torshok, Kreisstadt im russ. Gouvernement Twer, an der
Twerza und der Eisenbahn Ostaschkow-Rshew, eine der ältesten
Städte Rußlands und früher Festung, hat 30 Kirchen
(darunter eine schöne Kathedrale), ein festungsartig gebautes
Mönchskloster zum heil. Jephrem, ein geistliches Seminar, ein
Lehrerseminar, berühmte Fabrikation von Lederwaren,
Wachsbleichen, lebhaften Handel u. (1885) 14,574 Einw.
Torsion (lat., Drillung, Verdrehung), die
Veränderung, welche ein Stab oder Faden erleidet, wenn beide
Enden desselben in entgegengesetzter Richtung gedreht werden.
Während die Längenachse hierbei unverändert bleibt,
werden alle Längsfasern in eine schraubenförmige Lage
gebracht und dabei gedehnt. Dadurch entsteht eine Spannung in dem
tordierten Körper, die Torsionselastizität, welche
denselben in seine ursprüngliche Beschaffenheit
zurückzuführen sucht. Die zurückdrehende Komponente
dieser Spannung ist nach Coulomb und Wertheim proportional dem
Dreh- oder Torsionswinkel, ferner der vierten Potenz des Radius vom
Draht und umgekehrt proportional der Länge des
Torsionskörpers. - T. in der Botanik, s.
Drehwüchsigkeit.
Torsionsfestigkeit, s. Festigkeit, S. 177.
Torsionswage, s. Drehwage.
Torso (ital., "Strunk"), in der Kunstsprache der Rumpf
einer Bildsäule, welcher Kopf, Arme und Beine fehlen.
Berühmt ist der im Vatikan und zwar in der Belvedere genannten
Abteilung der Museen aufgestellte T. des Herakles ("T. vom
Belvedere"), welcher unter Papst Julius II. beim Campo di Fiore
gefunden worden ist, ein Werk des Bildhauers Apollonios (s. d. 4).
Von hervorragender Bedeutung ist auch der T. des sogen. Ilioneus in
der Münchener Glyptothek.
Torstensson, Linnard, Graf zu Ortala, schwed. Feldherr im
Dreißigjährigen Kriege, geb. 17. Aug. 1603 zu Torstena
in Schweden, ward in seinem 15. Lebensjahr Page Gustav Adolfs, kam
1630 als Kapitän der Leibkompanie mit dem König nach
Deutschland, ward bei dem Sturm auf Wallensteins Lager bei
Nürnberg 3. Sept. 1632 gefangen, im Februar 1633
ausgewechselt, stand dann beim schwedischen Heer in Livland, kehrte
1635 nach Deutschland zurück, machte bis 1639 unter dem Herzog
Bernhard von Weimar und Banér alle Feldzüge mit und
blieb dann als Reichsrat in Schweden bis 1641. Nach Banérs
Tod mit dem Oberbefehl über die Armee
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl., XV. Bd.
49
770
Torsus - Tory und Whig.
in Deutschland betraut, drang er, wiewohl durch Gichtleiden
stets an die Sänfte gefesselt, im Mai 1642 durch Sachsen in
Schlesien ein, nahm Glogau und Schweidnitz, rückte in
Mähren ein und eroberte Olmütz. Erzherzog Leopold und
Piccolomini zwangen ihn jedoch zum Rückzug nach Sachsen, wo er
2. Nov. d. J. auf der Ebene bei Breitenfeld einen blutigen, aber
glänzenden Sieg erfocht und dann Leipzig nahm. Um sein Heer
durch die Besatzungen Schlesiens und Pommerns zu verstärken,
ging er mit demselben im Frühjahr bis nach Frankfurt a. O.
zurück, eilte dann wieder über die böhmische Grenze,
bedrohte Prag und entsetzte das bedrängte Olmütz. Infolge
von Dänemarks Kriegserklärung an Schweden im Dezember
1643 nach Holstein berufen, eroberte er, mit Ausnahme der Festungen
Rendsburg und Glückstadt, die ganze Halbinsel. Darauf nach
Deutschland zurückgekehrt, schlug er 6. März 1645 den
kaiserlichen General Hatzfeld bei Jankau, vereinigte sich sodann
mit dem Fürsten Rakoczy von Siebenbürgen, eroberte im
Fluge ganz Mähren, drang bis an die Donau vor und nahm die
Schanzen an der Wolfsbrücke vor Wien. Um in Mähren festen
Fuß zu fassen, begann er alsdann die Belagerung von
Brünn; allein der hartnäckige Widerstand dieses Platzes,
die Verheerungen, welche eine pestartige Seuche unter seinen
Truppen anrichtete, und der Friede Rakoczys mit dem Kaiser
nötigten ihn im August zum Rückzug nach Böhmen. Von
Krankheit erschöpft, legte er den Oberbefehl in die Hände
des Generals Wrangel nieder und begab sich zurück nach
Schweden. Von der Königin Christine 1647 zum Grafen zu Ortala
ernannt, starb er 7. April 1651 in Stockholm. Vgl. Watts de
Peyster, Eulogy of T. (New York 1872).
Torsus, Fluß, s. Tirso.
Tort (lat. tortum), eine jemand absichtlich
zugefügte Beleidigung; Unrecht, Verdruß, Unbilde.
Törteln, Kartenspiel, s. Tatteln.
Torticollis (lat.), s. v. w. Schiefhals (s. d.).
Tórtola, britisch-westind. Insel, zu den
Jungferninseln (s. d.) gehörig, 64 qkm (1,67 QM.) groß
mit 4000 Einw., erzeugt Zucker, Baumwolle und Kaffee. Hauptort ist
Roadtown.
Tortona, Kreishauptstadt in der ital. Provinz
Alessandria, unfern der Scrivia, an der Eisenbahn
Mailand-Novi-Genua, mit welcher sich hier die Linie
Turin-Alessandria-Piacenza kreuzt, ist Sitz eines Bischofs und
eines Handelsgerichts, hat eine sehenswerte Kathedrale (mit
interessantem antiken Sarkophag), ein Theater, Reste alter
Festungswerke (1799 von den Franzosen geschleift), ein Gymnasium,
eine Notariatsschule, ein Seminar, eine technische Schule,
Seidenspinnerei, Fabrikation von Baumwollwaren, Hüten, Leder
und Ackerbauwerkzeugen und (1881) 7147 Einw. - T. ist das antike
Dertona. Von Kaiser Friedrich Barbarossa 1155 erobert und
zerstört, ward es von den Mailändern wieder aufgebaut.
1796 den Franzosen übergeben, wurde es 1799 von den
Österreichern zwar wiedererobert, aber infolge der Schlacht
von Marengo aufs neue geräumt.
Tortonische Stufe, s. Tertiärformation, S. 601.
Tortosa, befestigte Bezirksstadt in der span. Provinz
Tarragona, am Ebro (mit Schiffbrücke) und an der Bahnlinie
Valencia-Tarragona, hat eine Kathedrale, 3 Forts, Fabrikation von
Porzellan, Steingut, Seife, Papier, Leder etc., Seesalzgewinnung,
lebhaften Handel (mit Öl, Salz etc.) und (1878) 24,057 Einw.
T. ist Bischofsitz.
Tortrix, Wickler; Tortricina, Familie aus der Ordnung der
Schmetterlinge, s. Wickler.
Tortúga (Tortue, "Schildkröte"), 1) westind.,
zur Republik Haïti gehörige Insel an der Nordküste
Haïtis, 35 km lang, bewaldet und fruchtbar, aber unbewohnt.
-
2) Eine der Inseln unter dem Wind, in Westindien, 90 km von der
Küste von Venezuela, 60 qkm groß und unbewohnt.
Tortúgas ("Schildkröten"), Gruppe von
Koralleninselchen im Golf von Mexiko, am westlichen Ende des Riffs
von Florida, zwei mit Leuchttürmen und einem Fort (Jefferson)
der Vereinigten Staaten.
Tortur (lat., Marter, Folter, harte oder peinliche
Frage), im frühern Strafverfahren Erregung körperlicher
Schmerzen, um vom Angeschuldigten Geständnisse zu erpressen.
Im römischen Reich wurde die T. anfangs nur gegen Sklaven,
später auch gegen Freie und zwar zuerst bei
Majestätsverbrechen angewendet. In Deutschland fand die T.
durch das römische Recht und durch das Beispiel der
italienischen Praxis Eingang, gelangte aber bei dem Aberglauben und
der religiösen Intoleranz des 16. und 17. Jahrh. zur
ausgedehntesten Anwendung, indem sie zu einem furchtbaren Mittel
ward, Schuldige und Unschuldige zum Geständnis zu bringen. Man
verfolgte im blinden Eifer, die göttliche Vorsehung
nachzuahmen, die Verbrecher als Sünder, und der grausame Sinn
der Zeit mit dem Aberglauben im Bund und mit der T. in der Hand
belegte eine unglaubliche Menge Unschuldiger als Zauberer und Hexen
mit den ungerechtesten Strafen. Mittel der T., welche mehrere Grade
hatte, waren z. B. Peitschenhiebe bei ausgespanntem Körper,
Zusammenpressen der Daumen oder der Beine mittels
Schraubstöcke mit abgestumpften Spitzen (spanische Stiefel,
spanischer Bock), Ausrecken des Körpers auf einer Bank oder
Leiter, Brennen in der Seite oder an den Nägeln. Bevor man zur
T. selbst schritt, wurde häufig mit derselben unter Vorzeigung
oder Anlegung der Folterwerkzeuge gedroht (sogen. Territion). Die
peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. von 1532 suchte zwar die
T. zu beschränken, indem niemand ohne hinreichende
Verdachtsgründe gefoltert werden sollte; auch sollte das
Geständnis nur dann gültig sein, wenn es nicht
während der Marter, sondern erst, wenn der Scharfrichter mit
derselben nachgelassen, zu Protokoll erklärt und zwei oder
drei Tage nachher vor gehörig besetztem Gericht wiederholt
(Urgicht) worden sei. Indessen war damit doch nur wenig Sicherheit
gegen die Erpressung unwahrer Aussagen und Geständnisse
geboten, zumal die T. fortgesetzt, gesteigert und wiederholt werden
durfte, wenn der Gepeinigte das Geständnis, zu dem er
während der T. sich bereit gezeigt, nachmals verweigerte oder
zurücknahm. Wie in Deutschland, fand die T. auch in Frankreich
und in andern europäischen Ländern, am wenigsten in den
nördlichen, Eingang. Schon im 16. Jahrh. erhoben sich Stimmen
gegen die T.; aber erst Thomasius, Beccaria, Voltaire, Sonnenfels,
J. Möser vermochten der Überzeugung von ihrer
Unmenschlichkeit allgemeine Geltung zu verschaffen. Zuerst (1740
und 1754) wurde die T. in Preußen abgeschafft, dann in Baden
1767, Mecklenburg 1769, Sachsen und Dänemark 1770,
Österreich 1776, Frankreich 1789, Rußland 1801, Bayern,
Württemberg 1809, in Gotha ausdrücklich erst 1828 und in
Hannover 1840. Vgl. Wächter, Beiträge zur deutschen
Geschichte (Tübing. 1845).
Torus (lat.), Pfühl, Polster; Ehebett; der Wulst an
der Basis der ionischen Säule (s. Säule, S. 350); in der
Botanik der Blütenboden (s. Blüte, S. 70).
Tory und Whig (engl., im Plural Tories und Whigs), alte
Parteinamen der engl. Aristokratie,
771
Törzburg - Toscana.
welche bis zur neuesten Zeit die beiden Hauptgegensätze in
den politischen Ansichten derselben repräsentierten. Der
Ursprung der beiden Namen geht in die ersten Zeiten der Stuarts
zurück. Mit dem Namen Tories bezeichnete man ursprünglich
katholische Räuberbanden, welche zur Zeit des Kampfes Karls I.
gegen das Parlament unter dem Vorwand royalistischer Gesinnung
Irland plündernd durchzogen, und diese Bezeichnung wurde etwa
seit 1680 auf die Anhänger des Herzogs von York, der als der
geheime Beschützer der irischen Rebellen galt, dann auf die
Hofpartei überhaupt übertragen. Die Ableitung des Wortes
ist nicht sicher. Der Name Whig (abgeleitet von whigamore, einer
Bezeichnung der westschottischen Bauern wegen eines Instruments u.
Rufs [whigam], mit dem sie ihre Pferde antrieben) galt seit dem
Edinburger Aufstand von 1648, dem sogen. Whigamoreraid, für
die schottischen Covenanters; dann wurden die Anhänger
republikanischer Tendenzen in Schottland die "wilden Whigs"
genannt, und seit 1680 begann die Partei des Hofs ihre für die
Freiheiten der Nation kämpfenden Gegner als Whigs zu
bezeichnen. Seit der Berufung Wilhelms III. von Oranien 1688,
namentlich aber seit der Thronbesteigung des Hauses Hannover 1714
erlangten die Whigs das Übergewicht u. behaupteten es
während der Regierungen Georgs I. und Georgs II. im Kabinett
wie im Parlament. In dieser Zeit veränderte sich aber
allmählich die Stellung der beiden Parteien. Die Tories hatten
bisher noch immer an die Wiederherstellung der königlichen
Rechte in dem von den Stuarts beanspruchten Umfang, viele von ihnen
wohl auch an die Restauration der vertriebenen Dynastie gedacht.
Als aber diese unmöglich geworden war, fügten sie sich in
die Umstände und wurden die Vertreter des einmal Bestehenden,
also der bischöflichen Kirche und der neuen Dynastie, der
Sinekuren, der bisherigen parlamentarischen Formen und der
Schutzzölle. Die eifrigsten Gegner aller Neuerungen nennt man
Hochtories (high-tories). Die Whigs dagegen, dem Fortschritt
huldigend, wirkten für Emanzipation der Dissenters, Katholiken
und Juden und in staatlicher Hinsicht für freisinnigere
Entwickelung der politischen Institutionen gegenüber der
Unduldsamkeit des starren Aristokratismus. Seit 1782 wechselten
fast stets Tory- und Whigministerien miteinander ab; zu erstern
gehörten die Ministerien: Pitt, Portland, Castlereagh,
Goderich, Wellington, Peel, Aberdeen, Derby, zu letztern: Fox,
Canning, Grev, Melbourne, Russell und Palmerston. Infolge der
neuern großen Reformen haben jedoch, zumal durch das
Auftreten von neuen Parteibildungen, der Radikalen, Adullamiten,
Homerulers etc., die Namen T. und W. ihre aktuelle Bedeutung
eingebüßt. Als Liberale und Konservative werden auch in
England jetzt die sich hauptsächlich bekämpfenden
Parteien bezeichnet, so daß die Namen T. und W. nur noch
historische Bedeutung haben. Vgl. Kebbel, History of torysm from
the accession of Mr. Pitt to Beaconsfield (Lond. 1885).
Törzburg, Karpathenpaß im ungar. Komitat
Fogaras, südwestlich von Kronstadt, an der Grenze von
Siebenbürgen und Rumänien, der eine tiefe, breite
Einsattelung zwischen den Felswänden des Königssteins und
Bucsecs bildet; mit Grenzzollamt und Kontumazanstalt in Ober-T.
Nordwestlich hiervon Dorf Unter-T. mit dem Felsenschloß T.
(Dietrichsburg), das 1377 an Stelle der hölzernen Burg der
Deutschen Ordensritter erbaut wurde.
Tosa, Fluß, s. Toce.
Tosca, trachytischer Tuff, s. Trachyte.
Toscana, vormaliges ital. Großherzogtum, fast in
der Mitte Italiens, jetzt Landschaft (comuartimento) des
Königreichs Italien, grenzt an die Landschaften Rom, Umbrien,
die Marken, Emilia und Ligurien und umfaßt die Provinzen:
Arezzo, Florenz, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa und
Siena mit 24,053, nach Strelbitsky 24,062 qkm (437,01 QM.) Areal
und (1881) 2,208,869 Einw. (näheres s. unter den einzelnen
Provinzen und Italien). - T. ist das alte Tuscien oder Etrurien (s.
d.). Nach dem Untergang des weströmischen Reichs (476 n. Chr.)
herrschten in dem Land zwischen dem Macrafluß und dem Tiber
Ostgoten, dann Griechen, endlich Langobarden. Während der
Herrschaft der letztern stand es unter Lehnsherzögen, die zu
Lucca residierten; Karl d. Gr. machte T. 774 zu einer
fränkischen Provinz und setzte Markgrafen ein. Markgraf
Bonifacius II., zugleich Graf von Modena, Reggio, Mantua und
Ferrara, der reichste und mächtigste Fürst in Italien,
hinterließ 1052 einen minderjährigen Sohn, Friedrich,
für den seine Mutter Beatrix die Regierung führte, und
als er 1055 starb, folgte ihm sein Stiefvater Georg der
Bärtige von Niederlothringen. Beatrix und noch mehr ihre
Tochter Mathilde, Markgräfin von Tuscien, waren eifrige
Anhängerinnen des Papstes, und letztere vermachte nebst ihren
übrigen Besitzungen 1115 auch T. dem römischen Stuhl. In
dem hierauf entbrennenden Streit zwischen Kaiser und Papst um die
Mathildische Erbschaft ging die politische Einheit und die
fürstliche Macht unter, und die städtischen Gemeinwesen
Florenz, Siena, Pisa, Lucca, Arezzo u. a. rissen alle Gewalt in T.
an sich. Unter diesen erlangte Florenz die größte Macht
und vereinigte im 14. und 15. Jahrh. den größten Teil
von T. mit seinem Gebiet. Und als in Florenz die Familie Medici zur
Herrschaft kam, gewann sie damit auch die Herrschaft von T. Am 1.
Mai 1532 erhob der Kaiser Karl V. seinen spätern Eidam,
Alexander von Medici, zum erblichen Herzog von Florenz. Dessen
Nachfolger Cosimo I. (1537-74) vergrößerte sein Gebiet
1555 durch die Erwerbung Sienas und wurde 1569 von Papst Paul V.
zum Großherzog von T. ernannt und in dieser Würde sein
Nachfolger Franz (1574-87) vom Kaiser (1576) bestätigt.
Derselbe hatte dann seinen Bruder Ferdinand, bisher Kardinal, zum
Nachfolger. Unter den folgenden Herzögen, Cosimo II. (gest.
1621), Ferdinand II. (gest. 1670) und Cosimo III. (gest. 1723),
sank der Staat schon sichtlich. Gemäß dem Wiener Frieden
von 1735 fiel T. nach dem Tode des letzten Medici, Giovanni Gasto
(1737), an den Herzog Franz Stephan von Lothringen, Gemahl Maria
Theresias von Österreich und nachmaligen Kaiser Franz I. Ihm
folgte 1765 sein zweiter Sohn, Großherzog Leopold, unter
dessen aufgeklärter Regierung das zu einer
österreichischen Sekundogenitur erklärte Land durch weise
Reformen und vorzügliche Sorge um geistige und materielle
Entwickelung zu hoher Blüte gelangte. Als Leopold 1790 Kaiser
ward, folgte ihm in T. sein zweiter Sohn, Ferdinand III., der im
Sinn seines Vaters regierte. 1793 trat er der Koalition gegen
Frankreich bei, schon 1795 aber schloß er einen
Neutralitätsvertrag mit letzterm. Dessenungeachtet besetzte
Bonaparte 1796 Livorno. 1797 ward der Abzug der Franzosen mit 1
Mill. Frank erkauft; aber schon im März 1799 rückten
dieselben, nachdem sie nochmals 2 Mill. Fr. erpreßt hatten,
wieder in T. ein und nötigten den Großherzog, das Land
zu verlassen. Im Frieden von Lüneville 1801 mußte
derselbe T. gegen Salzburg abtreten; T. aber, das zu
49*
772
Toscana - Toschi.
einem Königreich Etrurien umgeschaffen ward, erhielt 21.
März der Infant Ludwig von Parma. Durch den Vertrag von
Fontainebleau vom 27. Okt. 1807 zwischen Frankreich und Spanien
ward Etrurien von letzterm gegen das nördliche Portugal an
Frankreich abgetreten und durch Dekret vom 24. März 1808 mit
demselben vereinigt. Am 2. März 1809 erhielt Napoleons
Schwester Elisa Bacciocchi den Titel einer Großherzogin von
T. Nach dem Sturz Napoleons I. erhielt Ferdinand 1814 T.
zurück, dazu den ehedem zu Neapel gehörigen Stato degli
Presidj, die Ensel Elba und die Anwartschaft auf die Erbfolge in
Lucca. Ferdinand III. starb 18. Juni 1824; ihm folgte sein Sohn
Leopold II., welcher, von seinem Minister, dem Grafen Fossombroni,
unterstützt, im Sinn seines Großvaters und Vaters zu
regieren sich bemühte. Straßenbauten, großartige
Arbeiten zur Entwässerung der Maremmen, Erweiterung des Hafens
von Livorno, Industrieausstellungen, Reorganisation des
Studienwesens zeugten von dem Eifer und der Einsicht der Regierung,
durch die T. sich in geistiger und materieller Kultur
außerordentlich hob. Seit dem Tod Fossombronis (1844) aber
machte sich bald der reaktionäre Einfluß
Österreichs fühlbar. Infolge der Abdikation des Herzogs
Karl von Lucca ergriff der Großherzog von T.,
gemäß der Wiener Kongreßakte vom 9. Juli 1815, am
11. Okt. 1847 von Lucca Besitz und trat Fivizzano an Modena,
Pontremoli an Parma ab. Die Nachwirkungen der Pariser
Februarrevolution rissen auch T. von dem Weg der Reform auf den der
Revolution. Schon vorher, unterm 17. Febr., hatte der
Großherzog eine liberale Konstitution proklamiert. Es folgten
der Erlaß eines neuen Preßgesetzes (21. Mai), die
Kreierung von Ministerien des Kultus und Unterrichts (5. Juni) und
die Eröffnung der Kammern (26. Juni), ohne daß die
revolutionäre Partei befriedigt worden wäre. Das neue
Ministerium Capponi ergriff im Auftrag der Kammern strengere
Maßregeln; als aber bei einem am 25. Aug. ausbrechenden
Aufstand zu Livorno, wo Guerrazzi (s. d.) der Hauptführer der
Bewegung war, das Militär gemeinschaftliche Sache mit den
Aufständischen machte und in Florenz selbst das Volk sich
erhob, warf sich der Großherzog eingeschüchtert der
demokratischen Partei in die Arme und berief ein Ministerium
Montanelli-Guerrazzi, flüchtete aber 23. Jan. 1849 nach Gaeta.
Schon 8. Febr. setzte die Deputiertenkammer eine provisorische
Regierung ein, welche eine Konstituierende Versammlung von 120
Mitgliedern einberief, und proklamierte 15. Febr. die Republik. Die
25. März eröffnete Nationalversammlung übertrug am
27. Guerrazzi die exekutive Gewalt in Form der Diktatur.
Gleichzeitig aber begann zu Florenz die Gegenrevolution, und
dieselbe siegte mit Hilfe der herbeigezogenen Truppen und der
Nationalgarden so schnell, daß bereits 11. und 12. April die
Republik beseitigt war. Von Florenz aus verbreitete sich die
Gegenrevolution schnell über das Land. Eine Deputation begab
sich nach Gaeta, um Leopold zur Rückkehr einzuladen; dieser
ernannte 1. Mai von Gaeta aus den Generalmajor Serristori zu seinem
außerordentlichen Kommissar und berief am 24. ein neues
Ministerium unter der Präsidentschaft Baldasseronis. Schon 11.
Mai ward nach zweitägigem Widerstand Livorno, das bisher noch
Widerstand geleistet hatte, von den Österreichern unter
d'Aspre besetzt, und am 25. rückten dieselben in Florenz ein.
Der Großherzog proklamierte bei seiner Rückkehr 28. Juli
zwar eine umfassende Amnestie, schloß aber 27. April 1850 mit
Österreich eine Militärkonvention, der zufolge 10,000
Mann Österreicher bis auf weiteres in T. bleiben sollten. 1851
wurde mit Rom ein Konkordat über Modifikation der
Leopoldinischen Gesetze abgeschlossen, welches der Kirche
unumschränkte Freiheit gewährte und den Staat in ihren
Dienst stellte; durch Dekret vom 8. Mai 1852 wurde die Konstitution
vom 17. Febr. 1848 außer Geltung gesetzt und die Herstellung
der unumschränkten Souveränität verkündigt. Die
österreichischen Truppen räumten T. erst im Frühjahr
1855. Der Ausbruch des Kriegs zwischen Österreich und
Frankreich im Frühjahr 1859 riß auch T. in den Strudel
der Begebenheiten hinein. Nachdem Leopold 24. April eine
Aufforderung zum Anschluß an Sardinien abgelehnt, brach am
27. ein Aufstand in Florenz aus, welcher den Großherzog
veranlaßte, das Land zu verlassen. Es ward sofort eine
provisorische Regierung eingesetzt und der König von Sardinien
zum Diktator ausgerufen. Derselbe lehnte zwar die Diktatur ab,
übernahm dagegen am 30. das Protektorat über T. und
ernannte seinen Gesandten in Florenz, Boncompagni, zum
außerordentlichen Generalkommissar während der Dauer des
Unabhängigkeitskriegs. Der Großherzog Leopold II.
entsagte durch Abdikationsurkunde vom 21. Juli dem Thron zu gunsten
seines ältesten Sohns, Ferdinands IV., und dieser erließ
sofort eine Proklamation an die Toscaner, welche Aufrechthaltung
der Verfassung und Anerkennung der Rechte der Nation verhieß.
Sie verhallte aber wirkungslos. Die Landesversammlung, die 11. Aug.
zusammentrat, beschloß am 16. die Thronentsetzung des Hauses
Lothringen und den Anschluß Toscanas an das Königreich
Sardinien. Letzterer erfolgte hierauf auf Grund der allgemeinen
Abstimmung vom 11. und 12. März 1860 am 22. März. Am 16.
April hielt Viktor Emanuel in Florenz seinen Einzug. Ein 17. Febr.
1861 erschienenes Dekret Viktor Emanuels hob auch den letzten Rest
der Autonomie Toscanas auf und machte dasselbe vollständig zu
einem Teil des neuen Königreichs Italien. Die entthronte
großherzogliche Familie lebt in Österreich. Vgl.
Galluzzi, Istoria del granducato di T. sotto il governo della casa
Medici (Flor. 1787, 5 Bde., u. öfter); Ricasoli und Ridolfi,
T. ed Austria (das. 1859); A. Zobi, Storia civile della T. dal 1737
al 1848 (das. 1850-52, 5 Bde.); Napier, Florentine history (Lond.
1847, 6 Bde.); v. Reumont, Geschichte Toscanas seit dem Ende des
florentinischen Freistaats (Gotha 1876-77, 2 Bde.); v. Wurzbach,
Die Großherzoge von T. (Wien 1883).
Toscana, Ludwig Salvator von, s. Ludwig 47).
Toscanella, Stadt in der ital. Provinz Rom, Kreis
Viterbo, an der Marta, mit etruskischen Gräbern,
mittelalterlichen Mauern und Türmen, zwei kunstgeschichtlich
bedeutenden Kirchen (San Pietro und Santa Maria, letztere von 1206)
und (1881) 3573 Einw.
Toscanisches Meer, s. Tyrrhenisches Meer.
Toschi (spr. tóski), Paolo, ital. Kupferstecher,
geb. 7. Juni 1788 zu Parma, machte seine Studien unter Bervic in
Paris und gewann hier besonders Ruf durch eine Radierung des
Einzugs Heinrichs IV. nach Gerard. 1815 fertigte er die Zeichnung
zu dem Stich nach der Kreuztragung von Raffael, welchem der Stich
nach der Kreuzabnahme von Daniel da Volterra folgte. Beide
Blätter gelten als Hauptwerke der neuern Kupferstechkunst.
1819 kehrte T. in seine Vaterstadt zurück und ward hier
Direktor der Akademie der schönen Künste, die er neu
organisierte. Zu seinen gelungensten Stichen gehören noch
Albanis Venus und Adonis und Lo spasimo di Sicilia nach Raffaels
Ge-
773
Tosi - Totenbestattung.
mälde in Madrid, Correggios Madonna della Scodella und die
Blätter nach dessen Fresken im Kloster San Paolo zu Parma, an
welchen seine Schüler mit thätig waren. T. starb 30. Juli
1854.
Tosi, Pietro Francesco, Sänger und Gesanglehrer,
geboren um 1650 zu Bologna, gestorben um 1730 in London, wirkte
anfangs als Sänger in Dresden und an andern italienischen
Bühnen Deutschlands und von 1692 an, nachdem er seine Stimme
verloren, als Gesanglehrer in London. Er hinterließ ein
Gesanglehrbuch von höchster Bedeutung: "Opinioni de' cantori
antichi e moderni o sieno osservazioni sopra il canto figurato",
welches in verschiedene Sprachen übersetzt wurde. Eine
deutsche Bearbeitung dieses epochemachenden Werkes ist die
"Anleitung zur Singekunst" von J. F. Agricola (s. d. 5).
Tosken, Volksstamm, s. Albanesen.
Töß, ein im voralpinen Gebiet des schweizer.
Kantons Zürich entspringender Fluß, der in
nordwestlicher Richtung dem Rhein zufließt und fast auf dem
ganzen 49 km langen Lauf durch sein enges, waldiges Thal im Dienst
industrieller Etablissements steht. Auch das Dorf T., bei
Winterthur, an der Bahnlinie Winterthur-Bülach-Koblenz, mit
(1888) 3388 Einw., einst Sitz eines Dominikanerklosters, ist
Fabrikort geworden. Das Tößthal wird von der Bahnlinie
Winterthur-Wald durchzogen. Vgl. Geilfus, Das Tößthal
(Zürich 1881).
Tossefta (Tosifta, chald., "Zusatz, Ergänzung"), ein
der Mischna (s. Talmud) ähnliches Sammelwerk aus 60 Traktaten
und 452 Abschnitten, den von der authentischen Mischna
differierenden, größtenteils in dieselbe nicht
aufgenommenen religiös-gesetzlichen Stoff des rabbinischen
Judentums nebst umfangreichen haggadischen Bestandteilen (s.
Haggada) enthaltend. Die T. ergänzt und berichtigt die Mischna
und ist eine Fundgrube für Bibelexegese, Archäologie u.
a. Ausgaben besorgten Zuckermandel (Pasewalk 1880) und
Friedländer (Preßb. 1889 ff.); einzelne Teile
bearbeitete Schwarz (Karlsr. 1879-82).
Tössuh, Längenmaß, s. Tussoo.
Tost, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Oppeln,
Kreis T.-Gleiwitz, an der Linie Oppeln-Borsigwerk der
Preußischen Staatsbahn, 268 m ü. M., hat eine
evangelische und eine kath. Kirche, eine Synagoge, eine Burgruine,
eine große Korrigendenanstalt, ein Amtsgericht, eine
Dampfbrauerei, eine große Flaschenstrohhülsenfabrik u.
(1885) 2434 meist kath. Einw.
Tostedt, Dorf im preuß. Regierungsbezirk
Lüneburg, Landkreis Harburg, an der Linie Harburg-Bremen der
Preußischen Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, ein
Amtsgericht, Bienenzucht und (1885) 1081 Einwohner.
Tosto (ital.), eilig, geschwind.
Tot, ein in bergmännischer Beziehung gebrauchter
Ausdruck für Unnutzbares, z. B. totes Feld, ein
unbauwürdiges Grubenfeld; dann bedeutet das Wort so viel wie
vollständig, z. B. tot gasen, Erze völlig fein gasen, tot
rösten, geschwefelte Erze durch Röstung vollständig
von Schwefel befreien.
Total (lat.), ganz, vollständig.
Totalisator, s. Wettrennen.
Totalität (neulat.), Gesamtheit, kommt als
Eigenschaft jedem Ding zu, insofern dasselbe als vollständiger
Komplex seiner einzelnen Teile in ihrem notwendigen Zusammenhang
aufgefaßt wird.
Totalreflexion und Totalreflektometer, s. Brechung, S.
375.
Totalschade (Totalverlust), im Versicherungswesen der
Schade, welcher durch Verlust des ganzen versicherten Wertes
eintritt, im Gegensatz zum Partialschaden (s. d.).
Totana, Bezirksstadt in der span. Provinz Murcia, an der
Sierra de España, mit schönen Orangengärten,
großen Töpfereien und (1878) 9648 Einw.
Totanus, Wasserläufer.
Tote Hand (Manus mortua), Bezeichnung der Kirche
rücksichtlich des Besitzes unbeweglicher Güter, die
regelmäßig nicht wieder veräußert werden
dürfen und somit für den öffentlichen Verkehr
gewissermaßen abgestorben sind; dann s. v. w. Mortuarium, s.
Baulebung.
Tote Konten, in der Buchhaltung (s. d., S. 565) s. v. w.
Sachkonten.
Totem, das Handzeichen der kanadischen Indianer, dessen
sich die Häuptlinge statt der Namensunterschrift bedienen,
meist in einem rohen Bilde des Tiers bestehend, von dem sie den
Namen tragen (schleichende Schlange, Otter etc.). Daher Totemismus,
nach Lubbock die bei den Indianern sich vorfindende Verehrung
sinnlich wahrnehmbarer Wesen, über die der Mensch keine Macht
besitzt (z. B. Himmelskörper, Tiere, Flüsse etc.), und
deren Gunst er durch Opferspenden und Geschenke zu erwerben sucht,
also eine Mittelstufe zwischen Fetischismus und Religion.
Totenamt, Gottesdienst zu Ehren eines Verstorbenen; in
der katholischen Kirche s. v. w. Seelenmesse (s. Messe und
Requiem).
Totenbestattung, die mit religiösen Gebräuchen
verbundene Übergabe menschlicher Leichname an die Elemente,
sofern nicht durch Einbalsamierung und Beisetzung in Gebäuden
die Verwesung künstlich verhindert werden soll. Die Bestattung
in freier Luft auf Reisiglagern u. dgl. findet sich
hauptsächlich in der Südsee; bei seefahrenden
Völkern weitverbreitet ist dagegen die Bestattung auf einem
kleinen, den Wellen ausgesetzten Kahn (Einbaum) gewesen, der die
Vorstellung zu Grunde lag, daß der Leichnam zur jenseit des
Meers belegenen Heimat zurückkehren müsse. Die
Charonsmythe ist ein Nachklang dieser auch im alten Europa
weitverbreiteten Bestattungsart. Doch hat man solche
"Wikinger-Begräbnisse" in großen Schiffen auch in
Erdhügeln der skandinavischen Länder angetroffen. Am
allgemeinsten und oft nebeneinander üblich sind aber über
den ganzen Erdball das Begräbnis, sei es in bloßer Erde
oder in Felsen- und Steingräbern, und die Verbrennung der
Toten. Dabei bestanden ursprünglich gewisse allgemeine
Gebräuche: die Versorgung der Toten mit Speise und Trank,
woraus sich Totenopfer, -Schmäuse und ähnliche Zeremonien
entwickelten, ferner die Beigabe der Waffen, Ehrenzeichen, die
Nachfolge von Gattin, Sklaven, Schlachtroß etc.,
Gebräuche, die auf der Vorstellung beruhten, daß der
Tote in bisheriger Weise weiterlebe, Speise, Waffen, Bedienung etc.
bedürfe. Die hiermit zusammenhängenden, zum Teil sehr
grausamen Gebräuche der Naturvölker waren selbst bei den
halbgesitteten Bewohnern des alten Europa noch im Schwange,
namentlich bei Begräbnissen von Fürsten und
Häuptlingen, die man mit ihrem ganzen Hofstaat begraben
findet; Marco Polo traf sie im Mittelalter noch in Asien so weit in
Übung, daß dem Toten alle dem Zug begegnenden Leute ins
Grab folgen mußten; sie sind jetzt noch bei afrikanischen
Häuptlingen und selbst in Indien (Witwenverbrennung) im Gange.
In den meisten Ländern fand dagegen eine Art Ablösung der
Menschenopfer statt, indem statt des Lebens einige Tropfen Blut,
ein Finger oder das Haar (s. Trauerverstümmelung) geopfert
wurden oder statt der Menschen (wie
774
Totenbestattung (Leichenverbrennung).
in Japan) thönerne oder metallene Puppen mit ins Grab
gelegt wurden. Hier und da, wie in Dahome und bei
nordamerikanischen Indianern, wurden sogar den bereits begrabenen
Häuptlingen noch Botschafter und Diener durch Ermordung am
Grab nachgesandt. Mit diesen Ideen über das Fortleben im
Einklang findet man bereits bei Naturvölkern einen
verhältnismäßig außerordentlichen Luxus bei
der T., dem Toten werden seine wertvollsten Waffen und
Schmuckstücke, die besten Kleider etc. mitgegeben, bei den
fortgeschrittenern Stämmen selbst Gold und Edelsteine. Die
ältesten Kulturvölker trieben diesen Luxus auf die
Spitze. Bei den Ägyptern wohnten die Lebenden in
Lehmhütten, die Toten in Palästen. Die Reichern dachten
schon im Leben daran, sich ein prächtiges, behagliches
Grabgewölbe zu bauen, und die Behandlung der Leichen (s.
Mumien) verschlang große Summen. Die Mumiensärge wurden,
wie die neuern Ausgrabungen gezeigt haben, oft mit guten
Porträten der Toten in Wachsmalerei versehen, außerdem
gab man hier, wie bei vielen andern Völkern, den Toten Masken
(s. d.) als Schutzmittel mit. Auch die Meder und Assyrer verwandten
auf prächtige Grabmäler große Summen, und auf den
Gipfel stieg dieser Gräberluxus bei den kleinasiatischen
Fürsten, wie denn das Mausoleum (s. d.) zu Halikarnassos der
ganzen Gattung prächtiger Grabdenkmäler den Namen gegeben
hat. In den letzten Jahren sind mehrere solcher kleinasiatischer
Prachtgrabmäler bekannt gemacht worden. Auch bei Griechen und
Römern maß der Volksglaube der Art der Bestattung einen
Einfluß auf das Los der Verstorbenen im jenseitigen Leben
bei, indem man wähnte, der unbestattete Tote müsse
hundert Jahre ruhelos an den Ufern des Styx umherirren. Darum
hielten es die Überlebenden für eine Pflicht der
Humanität, jedem irgendwo gefundenen Toten wenigstens durch
Aufwerfen von drei Handvoll Erde zur Ruhe zu verhelfen. Bei den
Spartanern wurden die Toten auf den Schilden hinausgetragen, und
alles Leichengepränge war durch die Gesetze verpönt. Bei
den Athenern aber fanden feierliche Leichenbegängnisse statt
und zwar unter dem Geleit der in schwarze Gewänder
gehüllten Verwandten und Freunde, von Klageweibern
(penthetriae, praeticae), Musikchören und seit Solons Zeit
auch von Lobrednern. Vor der eigentlichen Bestattung ward der Tote
dreimal gerufen, dann zur Erde gesetzt, wo liebende Hand sein
Antlitz bedeckte und seine Augen schloß. Auch ward ihm ein
Stück Geld (Obolos) als Fahrlohn für Charon (s. d.) in
den Mund und ein Stück aus Honig und Mehl bereiteten Kuchens
zur Beschwichtigung des Kerberos (s. d.) in die Hand gegeben. Vor
dem Trauerhaus ward der Persephone, der Königin des
Totenreichs, ein Opfer dargebracht. Ein den Verwandten im Haus
bereitetes Leichenmahl (perideipnon, lat. silicernium, Visceratio)
beschloß die Trauerfeier. Nach vollendeter T. wurde das Haus
sorgfältig gereinigt. Noch zu Platons Zeiten wurden die
Leichen häufig beerdigt; aber mit Verbreitung des Glaubens,
daß die Seele einer Reinigung bedürfe, um in die
Wohnungen der Seligen zu gelangen, ward später, ungefähr
seit dem Beginn des 4. Jahrh. v. Chr., das Verbrennen allgemeiner
Gebrauch. Auch bei den Römern waren feierliche
Leichenbegängnisse üblich und später sogar mit
blutigen Gladiatorenkämpfen verbunden. Seit dem Ende der
Republik wurde bei ihnen die Verbrennung allgemein und Kolumbarien
zur gemeinsamen Aufbewahrung der Asche erbaut, nur ganz kleine
Kinder und vom Blitz erschlagene Personen wurden stets beerdigt und
nicht verbrannt. Der Leiche folgten außer einem Mimen, der
Gang und Gebärde des Verblichenen nachahmte, die Klageweiber,
welche noch jetzt in manchen Teilen Italiens im Gang sind. Der
Luxus der Begräbnisse stieg in den Kaiserzeiten so hoch,
daß er durch Gesetze eingeschränkt werden mußte,
weil man Schiffsladungen mit Spezereien verbrannte. Bei der
Beerdigung wurde der Leichnam in Särgen aus Holz, Thon oder
Stein (s. Sarkophag) ins Grab gesenkt oder in gemauerten oder aus
dem Felsen gehöhlten Grabkammern beigesetzt. Bei der
Leichenverbrennung wurde die Asche des Verstorbenen in einer Urne
aufbewahrt und in dem Grabmal beigesetzt (s. Urne und Grabmal). Bei
den Völkern des Orients war und ist die T. im allgemeinen
einfacher. Ja, die Perser sollen, damit durch Begraben eines Toten
die von Ormuzd rein geschaffene Erde nicht verunreinigt werde,
früher ihre Toten den Hunden und Raubvögeln vorgeworfen
haben, was bei den Gebern in Indien noch heute Brauch ist (s.
Parsen). Bei den alten Hebräern wurden alle menschlichen
Leichname als unrein angesehen, daher die Beschleunigung der T. und
Anlegung der Totenäcker möglichst fern von den Wohnungen
der Lebendigen. Doch war auch die Leichenverbrennung bei den Juden
üblich, wie man aus Jer. 34, 5 und andern Bibelstellen
ersieht. Es war, wie bei den Römern, die vornehmere, weil
kostspieligere Begräbnisform. Bei den Christen wurden die
Toten, schon aus Opposition gegen das Heidentum, von jeher
beerdigt, nie verbrannt, wobei wohl der früh ausgebildete
Glaube an die Auferstehung des Leibes mitgewirkt haben mag.
Überall, wo das Christentum und der Mohammedanismus sich
ausgebreitet haben, schafften sie die heidnische Leichenverbrennung
ab, so später bei den Germanen, und noch Karl d. Gr. verbot
den Sachsen jene bei Todesstrafe. Seitdem das Christentum
herrschende Religion geworden, beging man die T. feierlich mit
Gesang von Hymnen auf Tod und Auferstehung, woran sich später
bei weiterer Ausbildung der kirchlichen Zeremonien Totenopfer,
Seelenmessen, Exequien nebst Almosenspenden und Leichenmahlzeiten
anschlossen. Särge machten die Deutschen in vorchristlicher
Zeit einfach aus einem Baumstamm, indem sie ihn durchschnitten, die
eine Hälfte aushöhlten und die andre als Deckel benutzten
(Baumsärge, Totenbaum). Holzsärge in Kastenform, neben
denen auch Steinsärge (Sarkophage) vorkommen, wurden seit
Einfuhrung des Christentums häufiger. Aus dem Reliquienkultus
mit seinen Heiligengerippen entwickelte sich seit dem 4. Jahrh. die
gefährliche Unsitte, Geistliche, Patrone,
Kirchenwohlthäter und angesehene Personen überhaupt in
den Krypten der zum gottesdienstlichen Gebrauch benutzten Kirchen,
ja in diesen selbst beizusetzen, ein Verfahren, gegen welches
anfangs die Konzile von Prag, Arles, Meaux etc. eiferten, bis es
etwa seit 1000 überall unbeanstandet blieb und erst seit
hundert Jahren völlig aufgehört hat. Seitdem findet die
T. allgemein auf den Begräbnisplätzen statt, die sich nur
noch auf den Dörfern zuweilen im unmittelbaren Umkreis der
Ortskirche befinden, in neuerer Zeit aber mehr und mehr
außerhalb der Ortschaften angelegt wurden (s.
Begräbnisplatz).
[Leichenverbrennung.] In neuerer Zeit ist die Bestattungsfrage
vom sanitären Standpunkt der Gegenstand zahlreicher
Erörterungen gewesen. Nachdem 1849 Jak. Grimm in einer
öffentlichen Rede die Vorzüge und die Erhabenheit der
altgermanischen Feuerbestattung geschildert, hat sich eine langsam
an-
775
Totenblume - Totengericht.
wachsende Agitation für dieselbe erhoben, zumal in
großen Städten und Gebirgsländern, woselbst die
Anlegung der Friedhöfe sanitäre und andre Schwierigkeiten
bereitet. Erfahrene Ärzte, wie der Oberstabsarzt Trusen, Bock
u. a., machten schon lange in Deutschland Propaganda für die
Verbrennung; italienische und schweizerische Ärzte schlossen
sich bald ihnen an. Der 1869 zu Florenz tagende internationale
Kongreß der Ärzte faßte eine dafür
eintretende Resolution, und die 1. Dez. 1870 in Florenz
stattgefundene feierliche Verbrennung des auf der Reise
verstorbenen Radscha von Kelapur auf großem Scheiterhaufen
nach indischem Ritus regte das Interesse in weitern Kreisen an. In
Italien beschäftigten sich seitdem die Ärzte Pini, Rota,
Ayr, Anelli, Amati, Gorini und sehr viele andre mit der Frage, und
die Professoren Polli in Mailand und Brunetti in Padua
konstruierten besondere Öfen, in denen die Verbrennung schnell
und möglichst wenig kostspielig vorgenommen werden kann. Durch
Mittel, welche der Kaufmann Alb. Keller aus Zürich bei seinem
1874 in Mailand erfolgten Tod aussetzte, konnten diese Versuche in
großartigem Maßstab durchgeführt werden, und
Mailand erbaute die erste Verbrennungshalle (1875), der solche zu
Lodi, Cremona, Varese, Rom, Como, Brescia, Padua, New York,
Washington und Philadelphia folgten. In Deutschland erwarb sich
insbesondere Reclam Verdienste um die Popularisierung des immer
noch manchem Widerspruch, namentlich von orthodoxer Seite,
begegnenden Gedankens; Kinkel u. a. traten dafür ein, die
Ingenieure Pieper und Siemens in Dresden beschäftigten sich
mit der Konstruktion praktischer Verbrennungsöfen, und seit
1877 hat auch Gotha eine Verbrennungshalle, in welcher 1878 die
erste Verbrennung einer Leiche ausgeführt wurde. Die
Regierungen haben sich bisher meistens ablehnend verhalten, kaum
daß einzelne die Verbrennung fakultativ gestattet haben. 1889
waren Verbrennungsöfen in Thätigkeit: in Italien 23,
Amerika 10, je einer in Stockholm, Kopenhagen, London, Paris,
Gotha, Zürich, und bis 1. Aug. 1888 wurden verbrannt: in Gotha
554, in Italien 998, in Amerika 287, in Schweden 39, in England 16,
in Frankreich 7, in Dänemark 1 Person. Es ist sehr
wahrscheinlich, daß man in Zukunft zu diesem System der T.
allgemein übergehen wird, denn es besitzt
außerordentliche sanitäre Vorzüge und kann in einer
die Pietät und das ästhetische Gefühl völlig
zufriedenstellenden Weise ausgeführt werden. Das einzige
gewichtige Bedenken (Vernichtung der Spuren eines an dem
Verstorbenen ausgeübten Verbrechens) könnte wohl durch
die Einführung der allgemeinen Leichenschau gehoben werden. In
der neuesten Zeit haben sich in vielen großen Städten
Vereine zur Agitation für die Leichenverbrennung gebildet,
deren Organisation von Mailand ausging. Von der neuerdings sehr
angeschwollenen Litteratur über die Verbrennung der Toten sei
nur erwähnt: J. Grimm, Über das Verbrennen der Leichen
(Berl. 1850); Trusen, Die Leichenverbrennung (Bresl. 1855);
Wegmann-Ercolani, Über Leichenverbrennung (4. Aufl.,
Zürich 1874); Küchenmeister, Die Feuerbestattung (Stuttg.
1875); Pini, La crémation en Italie et à
l'étranger de 1774 etc. (Mail. 1884); Thompson, Die moderne
Leichenverbrennung (deutsch, Berl. 1889); über die T.
überhaupt vgl. Weinhold, Die heidnische T. (Wien 1859); De
Gubernatis, Storia popolare degli usi funebri indoeuropei (Mail.
1873); Tegg, The last act, the funeral rites of nations (2. Aufl.,
Lond. 1878); Sonntag, Die T., Totenkultus alter und neuer Zeit
(Halle 1878); Wernher, Bestattung der Toten in Bezug auf Hygiene
etc. (Gießen 1880).
Totenblume, s. Calendula.
Totenbrocken, s. Schwanenhalseisen.
Totenbuch der alten Ägypter, s. Hieroglyphen (S.
521) und Totengericht.
Totenfest, das feierlich begangene Andenken der Toten. In
der ältern christlichen Kirche pflegten die Freunde und
Verwandten eines Toten den Jahrestag seines Todes durch eine
Kommunion zu begehen (s. Requiem). Später hielt man für
alle in einer Gemeinde während eines Jahrs Gestorbenen eine
gemeinsame Totenfeier. Die katholische Kirche bestimmte dazu das
Fest Allerseelen (s. Allerseelen), die griechische die Sonnabende
der 2., 3. und 4. Fastenwoche und den Sonnabend vor Pfingsten, wozu
in der russischen Kirche noch das Gedächtnis aller im Kriege
gefallenen Soldaten 21. Okt. kommt. In der protestantischen Kirche
feiert man das T. meist am letzten Sonntag des Kirchenjahrs.
Totenflecke, s. Tod, S. 736.
Totengericht, eine den alten Ägyptern zugeschriebene
Sitte, Gericht zu halten über einen Verstorbenen, ehe er
begraben wurde. 42 Männer prüften sein Leben und seine
Thaten; vor ihnen konnte jedermann den Verstorbenen anklagen. Ward
er für gerecht erfunden, so erfolgte die feierliche
Bestattung; wurde er für schuldig erklärt, so durfte er
nicht begraben werden, sondern wurde im Hause seiner Verwandten
aufgestellt. Die Richter versammelten sich nahe bei dem See
Möris, über welchen die Leichen in einem Kahn an das
jenseitige Ufer gebracht wurden. So lauten die Angaben Diodors
über ein T., welches bei den alten Ägyptern bestanden
haben soll. Indessen wird sein Bericht durch die mit der
Entzifferung der Hieroglyphen erschlossene altägyptische
Litteratur nicht bestätigt, vielmehr scheint derselbe auf
einem Mißverständnis zu beruhen. Das T. ist weniger eine
Sitte der alten Ägypter als ein Glaubensartikel ihres heiligen
Buches, ein Kapitel in dem sogen. Totenbuch, welches in vielen
Exemplaren auf Papyrus erhalten und in den Museen zu finden ist.
Der betreffende Text ist in der Regel durch eine Vignette
erläutert, welche die "Halle der zwiefachen Wahrheit", d. h.
der Wahrheit und der Lüge, darstellt, in welcher Osiris, der
Fürst der Unterwelt, thront; vor ihm sitzen die 42 Beisitzer
des Gerichts, eine Straußfeder auf dem Haupt und ein Schwert
in der Hand. Vor diese tritt der Verstorbene hin und spricht seine
Beichte. Wir sehen ferner eine große Wage mit einem über
dem Zünglein sitzenden Hundsaffen, auf der man die Thaten
abwägt, deren Symbol das Herz des Verstorbenen ist,
während ein Bildnis der Göttin der Wahrheit (Maat) auf
der andern Schale als Gewicht dient. Letztere führt den
Verstorbenen herzu, damit er zeige, ob er mit Wahrheit oder mit
Lüge behaftet kommt. Nicht selten ist der Verstorbene von zwei
Göttinnen der Wahrheit umgeben, von denen die eine
schützend die Hände erhebt, während die andre
gebieterisch Rechenschaft zu heischen scheint; manchmal werden
dieselben durch Isis und Nephthys oder Hathor vertreten. Der
Verstorbene tritt herzu, die Götter Anubis, der
schakalköpfige, und Horus, der sperberköpfige, stehen
prüfend an der Wage, während der ibisköpfige Thoth
vor ihnen das Ergebnis auf seiner Schreibtafel verzeichnet. Hat der
Verstorbene in der Halle der Doppelwahrheit vor Osiris bestanden,
so stehen ihm die Pforten der unterirdischen Welt offen,
während der, welcher nicht bestanden hat, ihren mannigfachen
Schrecken überliefert wird. Derselbe Gedankengang
776
Totengräber - Totensagen.
findet sich in der indischen, persischen, griechischen und
römischen Mythologie, wo gewöhnlich der erste Mensch
(Manu) oder der erste König (Minos oder Rhadamanthys) oder der
Gott der Unterwelt (Hades) als Totenrichter fungiert. Die
Darstellung des Erzengels Michael mit der Seelenwage auf
altdeutschen Gemälden beruht auf einem ähnlichen
Gedankengang.
Totengräber, s. Aaskäfer.
Totenhalle, Totenhaus, s. Leichenhaus.
Totenkäfer, s. Tenebrionen.
Totenkopf (Caput mortuum), s. Englischrot.
Totenkopf (Acherontia Atropos Ochs.), Schmetterling aus
der Familie der Schwärmer (Sphingidae), 11,5 cm breit, mit
kurzen, dicken Fühlern, sehr kurzen Tastern, schwach
entwickelter Rollzunge und plumpem Hinterleib von 19,5 mm
Querdurchmesser, auf dem dicht braun behaarten, blaugrau
schimmernden Thorax mit ockergelber, einem Totenkopf ähnlicher
Zeichnung und auf dem gelben, schwarz geringelten Hinterleib mit
breiter, blaugrauer Längsstrieme. Die Vorderflügel sind
tiefbraun, schwarz und ockergelb gewölkt mit zwei gelblichen
Querbinden, die Hinterflügel ockergelb mit zwei schwarzen
Querbinden. Der T. erzeugt, wenn er gereizt wird, einen pfeifenden,
schrillenden Ton, indem er aus einer sehr großen Saugblase im
Vorderteil des Hinterleibs Luft durch eine Rüsselspalte
ausstößt. Er findet sich in Süd- und Mitteleuropa,
Afrika, auf Java und in Mexiko, bei uns einzeln, vorübergehend
und örtlich im Herbste. Die 13 cm lange, grünlichgelbe,
schwarz-blau punktierte Raupe, mit blauen Winkelzeichnungen auf dem
Rücken, findet sich bei uns im Juli und August auf
Kartoffelkraut, Teufelszwirn, Stechapfel und verpuppt sich in der
Erde. In Mittel- und Norddeutschland pflanzt sich der T. nicht
fort, die dort gefundenen Raupen müssen von zugeflogenen
Weibchen herrühren.
Totenköpfchen, Vogel, s. Fliegenfänger.
Totenleuchten, im Mittelalter auf Kirchhöfen
(Begräbnisplätzen) errichtete Säulen mit
laternenartigen Aufsätzen, in welchen ewige Lampen brannten.
Eine mit Reliefs aus der Leidensgeschichte Christi geschmückte
Totenleuchte von 1381 findet sich vor der Stiftskirche zu
Klosterneuburg.
Totenmasken, s. Maske, S. 314.
Totenmesse, s. Requiem.
Totenmyrte, s. Vinca.
Totenopfer, s. Totenbestattung.
Totenorgel, s. Orgelgeschütz.
Totensagen. An die schon den rohesten Naturvölkern
geläufigen Vorstellungen vom Fortleben nach dem Tod
knüpfen sich eine Menge abergläubischer Gebräuche,
Vorstellungen und Sagen, die sich zum Teil aus dem grauesten
Altertum bis auf unsre Tage erhalten haben und jetzt durch den
Spiritismus (s. d.) von neuem belebt werden. Man meint, daß
die Seele, nachdem sie in Gestalt eines Wölkchens,
Schmetterlings, einer Schlange etc. dem Mund entflohen, in ihrem
neuen Zustand doch nicht ohne alle irdischen Bedürfnisse sei,
auf deren Befriedigung verschiedene Bestattungszeremonien (s.
Manendienst, Menschenopfer und Totenbestattung) abzielen. So werden
die Fenster des Sterbezimmers geöffnet, um der Seele freie
Bahn zu gewähren, und bei der Toteneinkleidung und -Einbettung
bestimmte Rücksichten und wohl auch Vorsichtsmaßregeln
gegen das Wiederkommen angewendet. Zu den einmaligen Pflichten
kommen dauernde; es opferten die Römer z. B. den Verstorbenen
von jeder Mahlzeit, indem sie von Speise und Trank etwas auf den
Boden schütteten; die Katholiken lassen Messen für die
Seelenruhe lesen, und auch durch zu vieles Weinen darf der Tote,
der die Thränen im Krüglein sammeln muß, nicht
gestört werden. Waren derartige Pflichten und Abfindungen
versäumt worden, so glaubte man, daß der Tote keine Ruhe
habe und die Nachgebliebenen beunruhige; so z. B. breiten die
Samoaner, wenn ein in der Ferne Verstorbener kein ordentliches
Begräbnis erhalten, ein Tuch aus und betrachten das erste
Tier, z. B. ein Insekt, welches sich darauf setzt, als die
umherirrende Seele, der dann die vorgeschriebenen
Begräbniszeremonien erwiesen werden. Auch Menschen, die nicht
ausgelebt haben und ermordet oder hingerichtet wurden, finden keine
Ruhe, bis der Mörder entdeckt ist, bei dessen Annäherung
ihre Wunden von neuem aufbrechen (s. Bahrrecht), oder bis ihre
Verbrechen gesühnt sind. Aber auch unerfüllte kirchliche
und bürgerliche Verpflichtungen rauben die Grabesruhe; die vor
der Hochzeit gestorbene Braut besucht den Bräutigam in der
griechischen, von Goethe umgedichteten Sage, die Wöchnerin das
nachgelassene Kind. Besonders häßlich ist die noch immer
sehr verbreitete Sage von den im Grab weiterlebenden Vampiren (s.
d.), die ihren Angehörigen das Blut aussaugen, bis sie ihnen
nachfolgen, wenn nicht besondere Vorsichtsmaßregeln gegen ihr
Wiederkommen getroffen werden. Sind die Toten befriedigt, so ziehen
sie in ein besseres Land (Elysium), welches in der Unterwelt oder
da, wo die Sonne zur Ruhe geht, gedacht wird. Manche Völker
erzählten von einer Toteninsel, zu der ein Fährmann
(Charon) die Verstorbenen hinüberfährt, wo sie dann unter
dem milden Zepter eines Totenkönigs ein schattenhaftes Dasein
führen; anderwärts müssen sie einen Berg der Seligen
(s. Glasberg) ersteigen. Aus dem Jenseits können sie nur durch
besondere Totenbeschwörer (s. Nekromantie) oder durch
spiritistische Veranstaltungen zurückgerufen werden, um den
Lebenden Auskünfte, Orakel, Ratschläge etc. zu erteilen.
Nur am Allerseelentag kommen sie freiwillig als langer "Zug des
Todes", die Kinder in weißen Hemdchen unter Führung und
Obhut der Totenmutter (Frau Holle), zur Erde, besuchen eine einsam
gelegene, um Mitternacht erleuchtet erscheinende Kirche, worin der
verstorbene Pfarrer Gottesdienst abhält, und die Gräber,
auf welche dann vielfach brennende Lichter gestellt werden. So
wurde schon im heidnischen Rom ein besonderes Laren- und
Lemurenfest gefeiert, bei welchem man besondere Totenspeisen
auftrug, weil dann die Unterwelt offen stand und die Toten
scharenweise die Wohnungen besuchten. In Rußland trägt
man noch heute am Allerseelentag Speise und Trank auf die
Gräber. Man spricht auch von besondern Vorzeichen, die einer
bestimmten Person den baldigen Tod verkünden sollen, von einem
Anpochen des Todes an der Thür, von dem Ruf des Uhu als
Totenvogel, von einer Totenuhr (s. Klopfkäfer), von einem
freiwilligen Anschlagen der Glocken, wenn ein hoher Geistlicher
sterben soll, von dem mahnenden Erscheinen einer weißen Frau
(s. d.) in verschiedenen Fürstenhäusern, von einem
Voraussehen des künftigen Leichenzugs (s. Zweites Gesicht),
und in Dänemark nennt man gewisse Lähmungserscheinungen
den Totengriff, gleichsam das erste Anpacken des Todesdämons.
Überhaupt wurde der Tod früh personifiziert und als
Dämon gedacht, der mit dem Erkrankten ringt und ihn endlich
niederwirft. In Seuchezeiten wollte man ihn als von Ort zu Ort
ziehenden oder auf lahmem Klepper durch das Stadtthor einziehenden
Pestmann erblickt haben, der die
777
Totenschau - Totentanz.
zum Tod Erwählten bloß mit seinem starren Blick ansah
oder sie anblies, um sie sofort auf das Sterbebett zu werfen. Das
Mittelalter war besonders reich an bildlichen Darstellungen vom
"Triumph des Todes", zu denen Allegorie und Sage den Stoff
lieferten (s. Totentanz). Eine reiche Fülle von T. findet man
gesammelt bei Henne-Am Rhyn, Die deutsche Volkssage (2. Aufl., Wien
1879).
Totenschau (Leichenschau), die polizeiliche oder
gerichtliche Besichtigung einer Leiche. Die erstere, die
Ausstellung der Leichen verunglückter Personen oder von
Selbstmördern behufs Rekognoszierung, wurde zuerst in Paris
organisiert, wo man die Leichen in der Morgue öffentlich zur
Schau stellte. In Berlin wurden von 1953 Leichen Erwachsener,
welche 1856 bis 1866 in Polizeigewahrsam gelangten, 10 Proz., von
4314 Leichen, welche 1876-85 ausgestellt wurden, 8,2 Proz.
unerkannt begraben. In dem in Berlin 1886 neuerrichteten
öffentlichen Leichenschauhaus liegen die Leichen in
gekühlten Räumen bei 0-2°, welche durch Glasscheiben
von den für das Publikum bestimmten Räumen getrennt sind.
Das Haus enthält außerdem Zimmer für bekannte
Leichen, für Obduktionen, polizeiliche und gerichtliche
Untersuchungen, für den wissenschaftlichen Unterricht in der
gerichtlichen Medizin und Chemie, Räume zur Aufbewahrung und
zum Verbrennen der Kleider der Leichen, Sargmagazin etc. Die T. zur
Feststellung des Todes wird an solchen Orten vorgenommen, an
welchen die Polizei die Ausstellung eines Totenscheins vom Arzt
fordert; der letztere (Totenbeschauer, Schauarzt) hat sich von dem
erfolgten Ableben zu überzeugen und sein Urteil über die
Todesart abzugeben. Die T. zur Feststellung der Todesart wird von
dem in der Regel beamteten Arzt auf polizeiliche oder gerichtliche
Anordnung vorgenommen, um zu bestimmen, ob an der Leiche schon bei
bloßer Besichtigung die Todesart erkannt werden kann
(Strangmarke Erhängter etc.), oder ob dieselbe durch Sektion
ermittelt werden muß. Im letztern Fall wird die gerichtliche
Obduktion (s. d.) von der Gerichtsbehörde, nach der deutschen
Strafprozeßordnung von der Staatsanwaltschaft, verfügt
und von zwei Ärzten ausgeführt, die über den Befund
ein Obduktionsprotokoll (Fundschein, Fundbericht, Visum repertum,
Parere medicum) aufnehmen. Zur Erlangung einer zuverlässigen
Statistik über die Todesarten, zur Gewinnung der
Möglichkeit eines klaren Einblicks in die tödliche
Krankheit, zur Aufdeckung von Verbrechen, zur Zerstreuung aller
Besorgnisse vor dem Lebendbegrabenwerden ist die allgemeine
Einführung der T. eventuell mit nachfolgender Sektion dringend
wünschenswert, Vorurteil und falsch verstandene Pietät
haben aber diesen Fortschritt bisher verhindert.
Totenstarre, s. Tod, S. 736, und Muskeln, S. 937.
Totentanz, seit dem 14. Jahrh. in Aufnahme gekommene
bildliche Darstellungen, welche in einer Reihe von allegorischen
Gruppen unter dem vorherrschenden Bilde des Tanzes die Gewalt des
Todes über das Menschenleben veranschaulichen sollen.
Ursprünglich ward dieser Stoff zu dramatischer Dichtung und
Schaustellung benutzt und in kurzen, meist vierzeiligen
Wechselreden zwischen dem Tod und anfangs 24 nach absteigender
Rangfolge geordneten Personen verarbeitet. Wahrscheinlich war darin
den sieben makkabäischen Brüdern mit ihrer Mutter und
Eleasar (2. Makk. 6, 7) eine hervorragende Rolle zugeteilt, und es
fand die Aufführung an deren Gedächtnisfest zu Paris im
Kloster der unschuldigen Kindlein (aux Innocents) statt; daher der
in Frankreich von alters her übliche lateinische Name Chorea
Machabaeorum (franz. la danse Macabre). In Paris war bereits 1407
die ganze Reihe jener dramatischen Situationen nebst den
dazugehörigen Versen an die Kirchhofsmauer des genannten
Klosters gemalt, und hieran schlossen sich bald weitere Malereien,
Teppich- und Steinbilder in den Kirchen zu Amiens, Angers, Dijon,
Rouen etc. sowie seit 1485 auch Holzschnitt- und Druckwerke, welche
die Bilder und Inschriften wiedergaben. Noch erhalten ist der
textlose, aber die Dichtung illustrierende T. in der Abteikirche
von La Chaise-Dieu in der Auvergne, dessen erster Ursprung in das
14. Jahrh. hinausreichen mag. Reime und Bilder des Totentanzes
verpflanzten sich von Frankreich aus auch nach England; die
mannigfaltigste und eigentümlichste Behandlung aber ward ihm
in Deutschland zu teil, wo er mit wechselnden Bildern und Versen in
die Wand- und Büchermalerei überging. Eine Darstellung in
einer Kapelle der Marienkirche zu Lübeck, deren niederdeutsche
Reime teilweise erhalten sind, zeigt den T. noch in seiner
einfachsten Gestalt: 24 menschliche Gestalten, Geistliche und Laien
in absteigender Ordnung, von Papst, Kaiser, Kaiserin, Kardinal,
König bis hinab zu Klausner, Bauer, Jüngling, Jungfrau,
Kind, und zwischen je zweien derselben eine springende oder
tanzende Todesgestalt als verschrumpfte Leiche mit umhüllendem
Grabtuch; das Ganze durch gegenseitig dargereichte und
gefaßte Hände zu einem einzigen Reigen verbunden und
eine einzelne Todesgestalt pfeifend voranspringend (vgl.
"Ausführliche Beschreibung und Abbildung des Totentanzes in
der Marienkirche zu Lübeck", Lüb. 1831). Aus dem 14.
Jahrh. (vielleicht von 1312) rührt der jetzt verwischte T. im
Kreuzgang des Klingenthals, eines ehemaligen Frauenklosters der
Kleinstadt Basel (Bilder und Reime bei Maßmann: "Baseler
Totentänze", Stuttg. 1847) her. Hier ist die Zahl der Personen
um einige neue, aus den niedern Ständen genommene vermehrt,
auch das Ganze in einzelne Paare aufgelöst. Ein andrer
wiederholt gedruckter T. mit 37 tanzenden Paaren ("der doten dantz
mit figuren") zeigt sowohl in den Figuren als in den Strophen
Nachahmung der erwähnten französischen Danse Macabre.
Seit der Mitte des 15. Jahrh. werden die Bilder des Totentanzes
immer mehr vervielfältigt, während die Verse wechseln
oder ganz weggelassen werden, und zuletzt gestalten sich beide,
Bilder und Verse, völlig neu. Zunächst ward der T. von
Kleinbasel nach Großbasel, vom Klingenthal an die
Kirhofsmauer des Baseler Predigerklosters (nicht vor der Mitte des
15. Jahrh.) übertragen, wobei Zahl und Anordnung der tanzenden
Paare dieselbe blieben, aber am Anfang ein Pfarrer und ein Beinhaus
und am Ende der Sündenfall hinzugefügt wurden,
während die das Ganze beschließende Person des Malers
vielleicht erst Hans Hug Kluber, welcher 1568 das Bild
restaurierte, anhängte. Bei dem Abbruch der Kirchhofsmauer
1805 ist das Original bis auf geringe Fragmente zu Grunde gegangen;
doch haben sich Nachbildungen nebst den Reimen erhalten, namentlich
in den Handzeichnungen Em. Büchels (bei Maßmann a. a.
O.). Der zum Volkssprichwort gewordene "Tod von Basel" gab neuen
Anstoß zu ähnlichen Darstellungen, obschon die
Dichtkunst den Stoff ganz fallen ließ. So ließ Herzog
Georg von Sachsen noch 1534 längs der Mauer des dritten
Stockwerks seines Dresdener Schlosses ein steinernes Relief von 24
lebensgroßen Menschen- und 3 Todesgestalten ausführen,
ohne Reigen oder tanzende Paare und nach Auffassung wie nach
Anordnung durchaus neu
778
Totenuhr - Totes Rennen.
und eigentümlich. Dieses Bildwerk ward bei dem großen
Brand von 1701 stark beschädigt, aber wiederhergestellt und
auf den Kirchhof von Neustadt-Dresden übertragen (abgebildet
bei Nanmann: "Der Tod in allen seinen Beziehungen", Dresd. 1844).
Von der Baseler Darstellung abhängig ist das aus dem 15.
Jahrh. herrührende Gemälde in der Predigerkirche zu
Straßburg, welches verschiedene Gruppen zeigt, aus deren
jeder der Tod seine Opfer zum Tanz holt (abgebildet bei Edel: "Die
Neue Kirche in Straßburg", Straßb. 1825). Aus den
Jahren 1470-90 stammt der T. in der Turmhalle der Marienkirche zu
Berlin (hrsg. von W. Lübke, Berl. 1861, und von Th.
Prüfer, das. 1876). Einen wirklichen T. malte von 15I4 bis
1522 Nikolaus Manuel an die Kirchhofsmauer des Predigerklosters zu
Bern, dessen 46 Bilder, die jetzt nur noch in Nachbildungen
vorhanden sind, bei aller Selbständigkeit ebensowohl an den
Baseler T. wie an den erwähnten "doten dantz mit figuren"
erinnern. Eine durchaus neue und künstlerische Gestalt erhielt
aber der T. durch H. Holbein d. j. Indem dieser nicht sowohl
veranschaulichen wollte, wie der Tod kein Alter und keinen Stand
verschont, sondern vielmehr, wie er mitten hereintritt in den Beruf
und die Lust des Erdenlebens, mußte er von Reigen und
tanzenden Paaren absehen und dafür in sich abgeschlossene
Bilder mit dem nötigen Beiwerk, wahre "Imagines mortis", wie
seine für den Holzschnitt bestimmten Zeichnungen genannt
wurden, liefern. Dieselben erschienen seit 1530 und als Buch seit
1538 in großer Menge und unter verschiedenen Titeln und
Kopien (neue Ausg. von F. Lippmann, Berl. 1879). Holbeins
"Initialbuchstaben mit dem T." wurden in Nachschnitten von
Lödel neu herausgegeben von Ellissen (Götting. 1849).
Daraus, daß Hulderich Frölich in seinem 1588
erschienenen Buch "Zween Todtentäntz, deren der eine zu Bern,
der andre zu Basel etc." dem T. am Predigerkirchhof
größtenteils Bilder aus Holbeins Holzschnitten
unterschob und Mechel sie in sein Ende des vorigen Jahrhunderts
erschienenes Werk "Der T." aufnahm, entstand der doppelte Irrtum,
daß man auch den ältern wirklichen T. im Predigerkloster
für ein Werk Holbeins hielt und des letztern "Imagines"
ebenfalls T. benannte. Im Lauf des 16., 17. und 18. Jahrh.
entstanden noch andre Totentänze in Chur
(erzbischöflicher Palast mit Benutzung der Holbeinschen
Kompositionen), Füssen, Konstanz, Luzern, Freiburg und Erfurt,
und Holzschneide- wie Kupferstecherkunst nahmen den Stoff wieder
auf, dessen sich auch die Dichtkunst wieder bemächtigte, z. B.
Bechstein ("Der T.", Leipz. 1831). Auch in neuester Zeit hat man
wieder Totentänze gezeichnet, so namentlich A. Rethel und W.
Kaulbach. Vgl. Peignot, Recherches sur les danses des morts (Par.
1826); Douce, Dissertation on the dance of death (Lond. 1833);
Langlois, Essai sur les danses des morts (Rouen 1851, 2 Bde.);
Maßmann, Litteratur der Totentänze (Leipz. 1841); W.
Wackernagel, Der T. (in "Kleine Schriften", Bd. 1, das. 1874);
Wessely, Die Gestalten des Todes etc. in der darstellenden Kunst
(das. 1877). Die reiche Litteratur findet sich verzeichnet in den
"First proofs of the universal catalogue of books on art" (Lond.
1870).
Totenuhr, s. Klopfkäfer.
Totenvogel, s. Eulen, S. 906.
Toter Winkel, s. Bestreichen.
Totes Gebirge, Gebirgsgruppe der Salzkammergutalpen,
durch die Ausseer Niederung vom Kammergebirge geschieden, mit dem
Quellengebiet der Traun und Steyr, eine Hochebene mit den
auffallendsten Kontrasten, meist kahl und zerrissen, dazwischen mit
schönen Alpen, am Nordende im Großen Priel 2514 m hoch.
S. Karte "Salzkammergut".
Totes Kapital, s. v. w. müßig liegendes,
keinen Gewinn abwerfendes Kapital (s. d.).
Totes Meer, 1) (in der Bibel Salzmeer, Meer der
Wüste, der Asphaltsee der Griechen und Römer, arab. Bachr
Lût, "Lots Meer") Landsee im asiatisch-türk. Wilajet
Surija (Syrien), an der Südostgrenze Palästinas, ist 76
km von N. nach S. lang und 3½-16 km breit und wird durch die
an der Ostküste hervortretende Halbinsel Lisân ("Zunge")
in zwei Becken geteilt (s. Karte "Palästina"). Es wird im O.
und W. von steil abfallendem Hochtafelland begleitet, welches sich
700-800 m über den Wasserspiegel erhebt, und von welchem sich
viele Thalschluchten (Wadis) herabziehen, in denen sich einige
Vegetation zeigt, während die sonstige Umgebung meist steril
ist. Die beiden Becken sind von verschiedener Tiefe; während
diese im nördlichen Becken in der Mitte meist über 300 m
(größte Tiefe unter 31° 36' nördl. Br. 399 m)
und im gesamten Durchschnitt 329 m beträgt, scheint sie im
südlichen Becken nirgends über 3,6 m zu messen. Doch
schwankt der Seespiegel je nach der Jahreszeit und scheint im
allgemeinen im Sinken begriffen zu sein. Das Wasser ist ziemlich
hell und klar, aber so mit Mineralien gesättigt, daß
hineingeworfenes Salz sich nicht mehr auflöst und weder Fische
noch Schaltiere darin existieren können. Die salzigen
Bestandteile (etwa 25 Proz.) sind Chlormagnesium, Chlorcalcium und
Chlornatrium; dieselben verleihen dem Wasser ein spezifisches
Gewicht von 1,166, so daß dasselbe weit größere
Lasten als das gewöhnliche Seewasser trägt und der
menschliche Körper darin nicht untersinkt. Jene Salze werden
durch Verdunsten des Wassers in Gruben in Menge gewonnen. Der Boden
des Sees besteht aus Sand, unter welchem sich eine Lage von Asphalt
(Judenpech) befinden soll, der zuweilen in großen
Stücken durch das Wasser aufgespült wird. Nach andern
stammt der Asphalt von einer Breccie am Westufer des Sees her. Das
Tote Meer liegt 394 m unter dem Spiegel des Mittelmeers und ist die
tiefste bekannte Einsenkung der ganzen Erde. Es empfängt an
seinem Nordende den Jordan (s. d.), außerdem mehrere
Bäche, von denen die bedeutenden vom östlichen Hochland
kommen. Ein sichtbarer Abfluß ist nicht vorhanden, und wenn
trotzdem das Niveau des Sees immer ziemlich gleichbleibt, so
rührt dies nur von der überaus starken Verdunstung her.
Wegen der tiefen Lage des Sees herrscht im Bereich desselben eine
außerordentliche Wärme, welche die Verdunstung sehr
befördert. Nach der biblischen Sage entstand das Bassin des
Toten Meers, welches einst die fruchtbare Ebene Siddim mit den
Städten Sodom und Gomorrha einnahm, durch einen Schwefelregen
(vulkanische Eruption). Vgl. Lynch, Bericht über die
Expedition der Vereinigten Staaten nach dem Jordan und dem Toten
Meer (deutsch, Leipz. 1850); Hull, Memoir on the geology and
geography of Arabia Petraea etc. (Lond. 1886); Luynes, Voyage
d'exploration à la Mer Morte (Par. 1871-76, 3 Bde.). -
2) S. Karkinitischer Meerbusen.
Totes Papier (franz. Valeur morte), ein Wertpapier,
welches an der Börse zwar eingeführt ist, aber fast gar
nicht gehandelt wird.
Totes Rennen (engl. Dead heat), ein Rennen, in welchem
zwei oder mehrere Pferde so zu gleicher Zeit das Ziel passieren,
daß ein Richter nicht im stande ist, den Sieger zu
ermitteln.
779
Tote Wechsel - Totpunkt.
Tote Wechsel, s. v. w. eigne Wechsel.
Totfall (unrichtig Todfall), s. Baulebung.
Tóth, 1) Koloman, ungar. Dichter, geb. 30. Juni
1830 zu Baja im Bács-Bodroger Komitat, veröffentlichte
1854 die erste Sammlung seiner Gedichte, die durch patriotische
Tendenz und Gemütlichkeit beliebt wurden, und denen dann
mehrere ähnliche Sammlungen aus seiner Feder folgten. Er
schrieb auch verschiedene Dramen, von welchen "Egy
királyné" ("Eine Königin") einen Preis der
Akademie davontrug und "A nök az alkotmányban" ("Frauen
im konstitutionellen Leben") mit großem Erfolg
aufgeführt wurde. T. wurde 1860 von der Kisfaludy-Gesellschaft
und 1861 von der Akademie zum Mitglied gewählt. Er starb 4.
Febr. 1881 in Pest.
2) Eduard, ungar. Dramatiker, geb. 1844 zu Putnok im
Gömörer Komitat, widmete sich dem Kaufmannsberuf, wirkte
später als Schauspieler und Theaterdichter bei
Provinzbühnen, wurde jedoch erst bekannt, als er 1871 mit
seinem Volksstück "A falu roszsza" ("Der Dorflump", deutsch
von A. Sturm) einen vom Pester Nationaltheater ausgeschriebenen
Preis gewann. Er erhielt infolgedessen eine Anstellung an diesem
Theater, starb aber schon 27. Febr. 1876. Andre namhafte
Stücke von ihm sind das zweite preisgekrönte
Volksstück, "A kintornás családsa" ("Die Familie
des Leiermanns"), und das erst nach seinem Tod aufgeführte
Drama "A tolonc" ("Der Schübling"), dessen Stoff gleichfalls
dem Volksleben entnommen ist. T. zeichnete sich durch originelle
Erfindung und poetisches Gemüt aus, war aber noch nicht zur
vollen Beherrschung der dramatischen Form durchgedrungen.
Totilas, König der Ostgoten, ward 541 auf den Thron
erhoben, eroberte in kurzer Zeit das von Belisar den Goten
entrissene Italien wieder, 546 nach hartnäckiger Belagerung
auch Rom, verlor es 547 wieder an Belisar, nahm es aber 549 zum
zweitenmal ein und machte es zu seiner Hauptstadt. Auch Sizilien,
Sardinien und Corsica brachte er wieder an das Gotenreich, erlitt
aber im Juli 552 bei Tagina gegen Narses eine Niederlage, in
welcher er selbst fiel.
Totis (ungar. Tata, lat. Theodatum), Markt im ungar.
Komitat Komorn, Station der Ungarischen Staatsbahnlinie
Budapest-Bruck, in ungemein quellenreicher Umgebung, besteht aus T.
(Oberstadt) und Tóváros (Seestadt) an einem 4 km im
Umfang messenden fischreichen See, mit Schloß u. Park des
Grafen Esterhazy, großem Kastell, vielen Teichen, Kloster
samt Gymnasium, Kapuzinerkloster, Bezirksgericht, großen
Marmorbrüchen, römischen Altertümern und (1881) 6507
Einw., welche Spiritus-, Steingut- und Lederfabrikation und Weinbau
treiben.
Totlaufen, sich, sagt man von einem Gesims, welches an
einem Vorsprung endigt, ohne sich um denselben herumzuziehen (mit
demselben zu verkröpfen); auch von einem Gang oder einer
Straße, die an einem Ende keinen Ausweg haben.
Totleben (Todleben), Eduard Janowitsch, Graf von, russ.
General, geb. 20. Mai 1818 zu Mitau als Sohn eines angesehenen
Großhändlers, ward erst auf der Kadettenschule in Riga,
dann 1832-36 auf der Ingenieurschule in Petersburg gebildet, trat
1837 als Unterleutnant in das Geniekorps, kämpfte 1847-50 im
Kaukasus, nahm als Stabshauptmann an den Belagerungen der
Tschetschenzenfestungen Salti und Tschoch teil und war dann 1854
als Oberstleutnant an der Seite des Generals Schilder-Schuldner bei
der Belagerung von Silistria thätig. Darauf nach der Krim
beordert, erwarb er sich durch schnelle Herrichtung von
Verteidigungswerken auf der Südseite von Sewastopol, welche
allein die lange Verteidigung ermöglichte, einen weit
berühmten Namen. Am 20. Juni 1855 am Fuß verwundet,
mußte er seine Wirksamkeit einstellen und ward dann zum
Generalleutnant und Generaladjutanten des Kaisers sowie 1860 zum
Direktor des Ingenieurdepartements im Kriegsministerium ernannt.
Außerdem ward er Adjunkt des Großfürsten Nikolaus
des ältern als Generalinspektor des Geniewesens. 1877 ward er
erst im September auf den Kriegsschauplatz nach Bulgarien berufen
und mit der Oberleitung der Belagerungsarbeiten vor Plewna betraut,
nach dessen durch ihn bewirktem Fall in den Grafenstand erhoben,
mit der Zernierung der bulgarischen Festungen und im April 1878 mit
dem Oberbefehl in der Türkei beauftragt. 1879 wurde er
Generalgouverneur von Odessa, 1880 von Wilna und starb 1. Juli 1884
in Bad Soden. Er schrieb "Défense de Séwastopol"
(Petersb. 1864 ff.; deutsch von Lehmann, Berl. 1865 bis 1872, 2
Bde.). Vgl. Brialmont, Le général comte T.
(Brüssel l884); Krahmer, Generaladjutant Graf T. (Berl.
1888).
Totliegendes, s. v. w. Rotliegendes, s.
Dyasformation.
Totma, Kreisstadt im russ. Gouvernement Wologda, an der
Suchona, mit Lehrerseminar, weiblichem Progymnasium und (1885) 3412
Einw. Dabei Salzquellen, deren eine jährlich 75,000 Pud Salz
liefert.
Totnes, altes Städtchen in Devonshire (England), am
Dart, mit (1881) 4089 Einw. Dabei Serge- und Wollwarenfabriken.
Totonicapan, Hauptstadt des gleichnamigen Departements im
zentralamerikan. Staat Guatemala, liegt auf einer gut angebauten
Hochebene und hat 25,000 Einw., meist Indianer, die sich neben
Ackerbau mit Fabrikation von Wollzeugen, Töpferwaren und
musikalischen Instrumenten beschäftigen.
Totpunkt, diejenige Stellung gewisser Mechanismen, in
welcher eine eingeleitete Kraft keine Bewegung hervorzubringen
vermag. Sehr verbreitete Mechanismen mit Totpunkten sind die
gewöhnlichen Kurbelgetriebe. An jeder Drehbank oder
Nähmaschine mit Fußbetrieb (Trittbrett, Lenkstange und
Kurbel) lassen sich zwei Stellungen finden, von welcher aus die
Maschinen mit dem Trittbrett allein nicht in Bewegung gesetzt
werden können, vielmehr dazu einer Nachhilfe mit der Hand am
Schwungrad etc. bedürfen. Es sind das die Totpunkte des
Kurbelmechanismus, welche eintreten, wenn die Lenkstange und die
Kurbel in einer geraden Linie liegen. Die Lenkstange zieht oder
drückt hierbei nur in radialer Richtung an der Kurbel, so
daß eine senkrecht zur Kurbel (also tangential zum
Kurbelkreis) gerichtete Komponente, durch welche allein eine
Kurbelbewegung möglich ist, nicht auftreten kann. Die
Totpunkte müssen in der Technik einerseits häufig
unschädlich, können aber anderseits geradezu nutzbar
gemacht werden. Das erstere ist der Fall z. B. bei allen durch
Kurbelantrieb in Bewegung gesetzten Maschinen (Dampf-,
Heißluft-, Gaskraft-, Wassersäulenmotoren,
Fußdrehbänken, Bohrmaschinen, Spinnrädern,
Nähmaschinen etc.), und zwar werden die Totpunkte entweder
durch Schwungräder oder dadurch überwunden, daß
mehrere gleiche Mechanismen mit abwechselnd eintretenden Totpunkten
angewendet werden, wobei sie sich gegenseitig über die
Totpunte hinweghelfen (z. B. bei den Zwillingsdampfmaschinen).
Nützliche Verwendung finden die Totpunkte be-
780
Totreife - Toul.
sonders bei der Mehrzahl der durch Klemmung wirkenden
Befestigungen und Verschlüsse, z. B. bei Gürtelschnallen,
Feststellvorrichtungen für Rouleausschnüre,
Hosenträger, Strumpfbänder etc. sowie bei Handschuh-,
Portemonnaie- und Flaschenverschlussen etc.
Totreife, der Zustand der Getreidekörner, in welchem
dieselben auf dem stehenden Halm völlig hart sind.
Totrokan (das antike Transmarisca), Kreishauptstadt in
Bulgarien, an der Donau, zwischen Silistria und Rustschuk, mit
Export von Rohprodukten und Holz und (1881) 7164 Einw. (viele
Rumänen).
Totschlag, die widerrechtliche Tötung eines
Menschen, welche zwar mit Vorsatz, aber nicht mit Überlegung
ausgeführt wird. Durch das Vorhandensein der
Tötungsabsicht unterscheidet sich das Verbrechen von der
fahrlässigen Tötung (s. d.), durch den Mangel der
Überlegung von dem Verbrechen des Mordes (s. d.). Der T. ist
die im Affekt begangene absichtliche, widerrechtliche Tötung,
welche, weil durch die leidenschaftliche Erregung das
Bewußtsein des Thäters als getrübt erscheint, mit
geringerer Strafe bedroht ist als der Mord. Das deutsche
Reichsstrafgesetzbuch bestraft den Totschläger mit Zuchthaus
von 5-15 Jahren. Dabei gilt es als Straferhöhungsgrund, wenn
der T. an einem Verwandten aufsteigender Linie, oder wenn er bei
Unternehmung einer strafbaren Handlung verübt wurde, um ein
der Ausführung der letztern entgegentretendes Hindernis zu
beseitigen, oder um sich der Ergreifung auf frischer That zu
entziehen. Als strafmilderndes Moment wird es dagegen angesehen,
wenn der Totschläger ohne eigne Schuld durch eine ihm oder
einem Angehörigen zugefügte Mißhandlung oder
schwere Beleidigung von dem Getöteten zum Zorn gereizt und
hierdurch auf der Stelle zur That hingerissen worden war. In diesem
Fall erscheint der bloße Versuch des Totschlags, welcher
sonst mit Strafe bedroht ist, nicht als strafbar. Es soll auch in
ebendiesem Fall, oder wenn sonstige mildernde Umstände
vorliegen, nur auf Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis zu
fünf Jahren erkannt werden. Vgl. Deutsches Strafgesetzbuch,
§ 212 ff. - Das österreichische Strafgesetzbuch
bezeichnet als T. die nicht absichtliche, aber als Folge einer
sonstigen absichtlichen Feindseligkeit erscheinende Tötung und
bedroht die im Affekt begangene absichtliche Tötung sogar mit
Todesstrafe. Vgl. Österreichisches Strafgesetzbuch § 140
ff.
Tottenham, nördliche Vorstadt von London, 9 km von
der Londonbrücke, mit Diakonissenanstalt und (1881) 46,441
Einw.
Totum (lat.), das Ganze.
Tötung (Tötungsverbrechen, Homicidium), das
Verbrechen desjenigen, welcher widerrechtlicherweise den Tod eines
andern Menschen verursacht. Hiernach fällt also der Selbstmord
nicht unter den Begriff der strafbaren T., ebensowenig die T. im
Krieg nach Kriegsrecht oder die rechtmäßige T. eines zum
Tod Verurteilten und die T. im Fall der Notwehr (s. d.). Ebenso ist
die Abtreibung der Leibesfrucht, welche ein erst im Werden
begriffenes Menschenleben zerstört, hier auszuscheiden. Je
nachdem nun der Tötende mit oder ohne Absicht handelte, wird
zwischen vorsätzlicher und fahrlässiger (kulposer) T.
unterschieden. Letztere wird nach dem Strafgesetzbuch des Deutschen
Reichs (§ 222) mit Gefängnis bis zu drei Jahren und, wenn
der Thäter zu der Aufmerksamkeit, welche er
fahrlässigerweise aus den Augen setzte, vermöge seines
Amtes, Berufs oder Gewerbes besonders verpflichtet war, mit
Gefängnis bis zu fünf Jahren bestraft. Bei der
vorsätzlichen T. wird je nach der Verschiedenheit des
Thatbestandes wiederum zwischen Mord (s. d.), Totschlag (s. d.) und
Kindesmord (s. d.) unterschieden. Dazu kommt noch die T. im
Zweikampf (s. d.) und die T. eines Einwilligenden, welch letztere
nach dem deutschen Strafgesetzbuch (§ 216), wofern der
Thäter durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen
des Getöteten zur That bestimmt worden war, mit Gefängnis
von 3-5 Jahren geahndet wird. Das österreichische
Strafgesetzbuch dagegen behandelt die T. eines Einwilligenden nicht
als ein besonderes Vergehen. In allen diesen Fällen muß
aber der Tod die zurechenbare Folge einer Handlung des Thäters
sein. Die frühern Einteilungen in absolut und relativ, in
notwendig und zufällig, in per se und per accidens
tödliche (letale) Verletzungen sind heutzutage für den
Begriff der T. indifferent, und die Unterscheidungen, welche die
ältere Doktrin mit Rücksicht hierauf in Ansehung der
Tödlichkeit (Letalität) von Verletzungen machte, werden
nicht mehr berücksichtigt. Die sogen. tödliche
Körperverletzung endlich, bei welcher der Tod des Verletzten
die nicht beabsichtigte Folge der Verletzung ist, fällt nicht
unter den Begriff der T., sondern unter den der
Körperverletzung (s. d.). Vgl. Deutsches Strafgesetzbuch,
§ 2l1-222, 237 f.; Österreichisches, § 134-143, 335;
Französisches, Art. 195-304, 319, 321-329; Brunnenmeister, Das
Tötungsverbrechen im altrömischen Recht (Leipz.
1887).
Tot verbellen, das Anbellen eines verendeten Wildes durch
den Schweißhund.
Touage (franz., spr. tu-ahsch), s. Tauerei.
Touchant (franz., spr. tuschang), ruhrend, bewegend;
Touche, Berührung, Neckerei, Beleidigung (s. Tusch);
touchieren, tastend berühren, untersuchen; in Rührung
versetzen; beleidigen.
Toucouleurs (Tukulör), ein von den Franzosen den
Bewohnern des untern und mittlern Senegal beigelegter Name, den man
davon hat ableiten wollen, daß hier eine Mischung der
verschiedenfarbigen Dscholof, Mandingo und Fulbe stattgefunden hat,
während derselbe viel wahrscheinlicher von Tukurol, dem alten
Namen des Landes, herstammt. Die Portugiesen nannten schon im 16.
Jahrh. die Eingebornen Tacurores. Unter dem Einfluß des Islam
erwuchs hier die Theokratie der Torodo, welche im 18. Jahrh. ihre
Herrschaft über das ganze Senegalbecken ausdehnte und unter
Othman Dar Fodie das große Fulbereich zwischen Niger und
Tsadsee gründete. Sie haben den Franzosen häufig den
entschiedensten Widerstand entgegengesetzt, doch wurde diesen bei
der Feindseligkeit der einzelnen Stämme gegeneinander die
Unterwerfung leicht gemacht.
Toucy (spr. tußi), Stadt im franz. Departement
Yonne, Arrondissement Auxerre, an der Ouanne und der Eisenbahn
Triguères-Clamecy, mit Schloß, Fabrikation von
Wollenstoffen, Gerberei, Handel mit Vieh und Eisenwaren und (1881)
2125 Einw.
Toujours (franz., spr. tuschuhr), alle Tage, immer.
Toul (spr. tuhl), Arrondissementshauptstadt und Festung
zweiter Klasse im franz. Departement Meurthe-et-Moselle, an der
Mosel und am Marne-Rheinkanal, Station der Bahnlinie
Paris-Avricourt (mit Abzweigung nach Frenelle la Grande), hat eine
im 15. Jahrh. vollendete gotische Kathedrale mit zwei schönen
Türmen, ein ansehnliches Stadthaus (früher
Bischofspalast), Collège, Sekundärschule für
Mädchen, Bibliothek und (1886) 7610 (Gemeinde 10,459) Einw.,
welche etwas Industrie (Stickerei, Hutfabrikation etc.) und Handel
treiben. Seit 1871 ist die Festung T. durch einen Gürtel von
Forts in einer Ausdehnung von
781
Toulon.
35 km, darunter das starke Fort St.-Michel nordwestlich der
Stadt, erweitert worden. T. ist Geburtsort des Marschalls Gouvion
Saint-Cyr. - T., das Tullum Leucorum der Römer, Hauptstadt des
gallischen Stammes der Leuci, ist eine sehr alte Stadt und
gehörte unter den fränkischen Merowingern und Karolingern
zum fränkischen Königreich Austrasien. 612 wurde der
König Theuderich von Austrasien von Theoderich von Burgund bei
T. besiegt. 870 fiel T. an das Deutsche Reich, wurde dann von
eignen Grafen regiert und fiel nach deren Erlöschen 1136 an
Lothringen, blieb aber deutsche Reichsstadt, über welche die
Herzöge von Lothringen nur das Schirmrecht ausübten. Im
J. 1552 ward die Stadt vom König Heinrich II. von Frankreich
infolge seines Bundes mit dem Kurfürsten Moritz von Sachsen
gegen Karl V. nebst Metz und Verdun besetzt und mit diesen
Bistümern im Westfälischen Frieden 1648 definitiv an
Frankreich abgetreten. Das um 410 gegründete Bistum T. bestand
bis 1807. Im Krieg von 1870 ward T. 16. Aug. vom 4. deutschen Korps
vergeblich berannt, vom 12. Sept. an vom 13. Korps unter dem
Großherzog von Mecklenburg förmlich belagert, da es die
einzige Eisenbahn vom Rhein nach Paris sperrte, u. am 23. nach nur
achtstündigem Bombardement mit schwerem Geschütz zur
Kapitulation gezwungen. Vgl. Thiery, Histoire de la ville de
T.(Toul 1841, 2 Bde.); Daulnoy, Histoire de la ville et cité
de T. (das. 1887 ff.); Pimoden, La réunion de T. à la
France (Par. 1885); v. Werder, Die Unternehmungen der deutschen
Armee gegen T. im J. 1870 (Berl. 1875).
Toulon (spr. tulong, T. sur Mer),
Arrondissementshauptstadt im franz. Departement Var, nächst
Brest der wichtigste Kriegshafen Frankreichs, Festung ersten Ranges
und Hauptstation der französischen Mittelmeerflotte, liegt am
Fuße steil abfallender Berge im Grund einer tiefen Bai des
Mittelländischen Meers, deren Eingang südlich durch die
Halbinsel Cépet geschlossen wird. Die eigentliche alte Stadt
mit ihren engen Straßen hat, seit infolge des Dekrets von
1852 die Schanzmauern an der nördlichen Seite demoliert
wurden, durch Erweiterung und Verschönerung sehr gewonnen. Die
neue Umfassungsmauer zieht sich nun weiter hinaus und
schließt ein neues Stadtviertel mit breiten Straßen und
schönen Bauten ein. Die wichtigsten Straßen sind: der
Boulevard, die Bahnhofsavenue, der Cours Lafayette mit
Platanenallee, die Straße des Chaudronniers u. a.
Hervorragende Gebände sind: die romanische Kathedrale
Ste.-Marie Majeure (1096 gegründet), die Kirchen St.-Louis,
St.-François de Paule und St.-Pierre, das protestantische
Bethaus (Maison Puget), das Stadthaus am Hafen, das neue Theater
und das Justizpalais. T. zählt (1886) 53,941 (Gemeinde 70,122)
Einw. Abgesehen von den umfangreichen Werkstätten des
Marinearsenals (s. unten), gibt es nur wenige industrielle
Etablissements; auch der Handel ist hauptsächlich auf die
Approvisionierung der Marine beschränkt, weshalb auch der
Verkehr von Handelsschiffen ein sehr geringer ist (1887 sind 273
beladene Schiffe mit 78,672 Ton. eingelaufen). T. steht durch die
Eisenbahn Marseille-Nizza mit dem französisch-italienischen
Verkehrsnetz, dann durch regelmäßige
Dampfschiffahrtslinien mit den Häfen des Mittelmeers in
Verbindung. Der Hafen ist einer der sichersten, welche es gibt, und
wird durch zahlreiche Forts, Batterien und feste Türme, welche
die umliegenden Höhen und Vorgebirge krönen,
geschützt; mehrere Leuchttürme sichern die Einfahrt. Er
umfaßt die Darse vieille und die Darse neuve, welche den
Kriegshafen bilden, und östlich davon den kleinen
Handelshafen, vor welchem ein durch zwei Molen zu schützender
äußerer Hafen mit Docks angelegt werden soll. Zum
Kriegshafen gehört das Marinearsenal, welches, 1680 nach
Vaubans Plänen erbaut, aus einer Reihe von Etablissements
besteht, welche 270 Hektar einnehmen und 13,000 Arbeiter
beschäftigen. Den Eingang bildet ein monumentales Thor (von
1738) mit Statuen von Mars und Bellona. Den Hof des Arsenals
umgeben das große Magazin (für die Materialien zum Bau
und zur Ausrüstung der Schiffe), die Seilerei, die
Eisenguß- und Hammerwerke, der Uhrpavillon mit den
Gebäuden für die Direktion, das Marinemuseum mit Modellen
aller Arten von Fahrzeugen, der Waffensaal, die Waffenschmiede,
Feilerei und Modellkammer. Zwischen dem alten und neuen Hafenbassin
des Kriegshafens liegt eine Insel, welche durch eine drehbare
Brücke über den Verbindungs-
[Karte der Umgebung von Toulon.]
782
Toulon - Toulouse..
kanal mit dem Festland zusammenhängt und drei Docks, das
Bagno und das Marinehospital enthält. Das Bagno wurde 1682
unter Colberts Verwaltung hergestellt und dient jetzt als Depot
für die nach Cayenne und Neukaledonien zu deportierenden
Verbrecher. An den Kriegshafen schließt sich westlich, durch
den Quai de la Garniture (mit Magazinen) von demselben getrennt,
das Hilfsarsenal von Castigneau mit einem Bassin an, welches mit
dem Kriegshafen durch einen Kanal in Verbindung steht. Dieses
Arsenal umfaßt eine Bäckerei, Fleischerei, eine
Eisengießerei, Hammerwerke, große Viktualienmagazine
und Kohlendepots. Noch weiter westlich ist das neue Bassin von
Missiessy (mit Magazinen) hinzugekommen. In der
südöstlichen Vorstadt Mourillon endlich liegt ein drittes
Arsenal, welches große Magazine für Schiffbauholz und
Metalle sowie verschiedene Werkstätten und
Schiffbauplätze enthält. Zu den Marine-Etablissements
gehört auch das unter Ludwig XIV. erbaute Marinehospital mit
naturhistorischem Kabinett; einen Annex desselben bildet das
Hospital von St.-Mandrier auf der Halbinsel Cépet. Bei
letzterm befindet sich ein botanischer Garten und in der Nähe
südöstlich eine Pyramide zum Andenken an den Admiral
Latouche-Tréville und westlich das Quarantänelazarett.
T. hat ein Lyceum, eine hydrographische Schule, Normalschule,
Sekundärschule für Mädchen, eine
Marineartillerieschule, eine Munizipalbibliothek (16,000
Bände), ein Museum, ein Observatorium, eine Börse, eine
Filiale der Bank von Frankreich und ist der Sitz eines
Marinepräfekten, eines Marinetribunals, der Direktion der
Marineartillerie, eines Handelsgerichts und mehrerer Konsulate
fremder Staaten. In der Vorstadt Mourillon befinden sich
Seebäder. Schöne Punkte in der Umgebung sind das Fort
Lamalgue mit prächtiger Aussicht, der nördlich
aufsteigende Berg Faron (521 m), die westlich gelegene Halbinsel
Sicié mit der Stadt La Seyne (s. d.), dem hoch gelegenen
alten Ort Six Fours mit uralter Kirche und dem Vorgebirge
Sicié mit Wallfahrtskirche, endlich im S. die Halbinsel
Cépet (s. oben). - T. bestand schon im Altertum als
griechische Kolonie Telonion (Telo Martius), war damals schon ein
bedeutender Ort und namentlich durch seine Färbereien
berühmt. Im 10. und 12. Jahrh. litt die Stadt sehr durch
Einfälle der Sarazenen. Sie teilte dann die Schicksale der
Provence. 1524 nahm sie der Connétable von Bourbon und 1536
Karl V. ein. Ludwig XIV. ließ durch Vauban die Stadt stark
befestigen. Während des spanischen Erbfolgekriegs wurde sie
1707 von den Verbündeten unter dem Herzog Viktor Amadeus von
Savoyen und dem Prinzen Eugen zu Land sowie von der
englisch-holländischen Flotte zur See bombardiert und
großenteils in Asche gelegt, aber nicht erobert. 1744
erfochten die Engländer zwischen T. und den Hyèrischen
Inseln einen Seesieg über die spanisch-französische
Flotte. Während der ersten französischen Revolution erhob
sich die Bevölkerung von T. im Juli 1793 gegen den Konvent und
übergab, nachdem der Konvent die Stadt geächtet und ein
republikanisches Heer sie eingeschlossen hatte, im
Einverständnis mit der Besatzung die Stadt 29. Aug. an die
vereinigte englisch-spanische Flotte unter dem Admiral Hood. Darauf
ward sie tapfer verteidigt, aber hauptsächlich infolge der
Eroberung des Forts Mulgrave durch Bonaparte gelang es den
Republikanern, die Engländer und Spanier 19. Dez. 1793 zum
Abzug zu zwingen. Hierauf rückten die Konventstruppen in die
Stadt, und die Konventskommissare Barras, Fréron und der
jüngere Robespierre verhängten über sie ein
furchtbares Strafgericht. 3000 Menschen wurden hingewürgt; die
Einwohnerzahl sank von 28,000 auf 7000 herab. Vgl. Teissier,
Histoire des divers agrandissements et des fortitications de la
ville de T. (Par. 1874); Lambert, Histoire de T. (Toul. 1886
ff.).
Toulouse (spr. tuluhs'), Hauptstadt des franz.
Departements Obergaronne, ehemals Hauptstadt von Languedoc, 133 m
ü. M., in fruchtbarer, aber einförmiger Ebene, an der
hier bereits schiffbaren Garonne, am Canal du Midi und an der
Eisenbahn von Bordeaux nach dem Mittelmeer gelegen, die hier nach
Albi, Foix, Bayonne und Auch abzweigt, ist der natürliche
Mittelpunkt des ganzen obern Garonnebeckens, zu welchem
Ariége und l'Hers sowie auch der Tarn vor seiner
Abschwenkung nach NW. hinleiten; zugleich ist es der wichtigste
Punkt an der alten historischen Straße vom Mittelmeer zum
Ozean. Dieser Lage verdankt T. sein hohes Alter, die große
Rolle, die es stets in der Geschichte gespielt hat, und seine
jetzige Blüte. Die Stadt ist mit der auf dem linken niedern
Ufer der Garonne gelegenen Vorstadt St.-Cyprien durch eine
1543-1626 erbaute Brücke sowie durch zwei
Hängebrücken verbunden und bietet mit ihren
einförmigen roten Backsteinhäusern und im allgemeinen
engen Straßen keinen malerischen Anblick, hat aber namentlich
durch die an Stelle der alten Wälle getretenen Boulevards und
Alleen sowie durch die neuen in der innern Stadt ausgeführten
Straßen ein modernes, großstädtisches Aussehen
gewonnen. Zentrum der Stadt ist der Kapitolsplatz. Von den Kirchen
sind besonders zu erwähnen: die Kathedrale St.-Etienne; die
große fünfschiffige romanische Kirche St.-Saturnin
(St.-Sernin) mit Krypte und 64 m hohem Turm; die Jakobinerkirche
aus dem 14. Jahrh. (jetzt Dominikanerkirche) mit dazu
gehörigem Kloster (jetzt Unterrichtsgebäude); die Kirche
Dalbade (ehemalige Malteserkirche) in frühgotischem Stil mit
reichem Renaissanceportal. Unter den übrigen Gebäuden
sind die hervorragendsten: das Stadthaus (Kapitol genannt) mit
mehreren schönen Sälen, darunter der Salle des Illustres
und dem Festsaal der poetischen Blumenspiele (Jeux floraux); das
ehemalige Augustinerkloster, welches mit seinen Kreuzgängen
gegenwärtig als Antikenmuseum und Gemäldegalerie benutzt
wird; der Justizpalast, mehrere schöne
Renaissancegebäude, das große Theater, zwei
Spitalgebäude aus dem 11. Jahrh. Die Zahl der Einwohner
beträgt (1886) 123,040 (Gemeinde 147,617). Die Stadt hat sehr
bedeutende Industrie, darunter an Staatsanstalten eine
Artilleriewerkstätte, eine Pulver- und eine Tabaksfabrik,
ferner Fabriken für Sicheln, Wagenfedern und Feilen, Wagen,
Maschinen, Parkette, Papier, chemische Produkte etc. sowie
zahlreiche Mühlen. Von großer Wichtigkeit ist auch der
Handel, besonders mit Getreide, Mehl, Wein, Bauholz, Marmor,
Branntwein, Wolle, Tuch, Vieh etc. Für den Lokalverkehr dient
eine Pferdebahn; auch ist die Stadt mit einer ältern und einer
neuen Wasserleitung versehen. T. hat Fakultäten für
Rechte, philosophisch-historische und
mathematisch-naturwissenschaftliche Disziplinen (zusammen mit 1100
Studierenden), eine freie katholische Universität, ein Lyceum,
ein Collège, eine Tierarzneischule, ein großes und
kleines Seminar, eine Normalschule, eine Kunstschule, ein
Konservatorium der Musik, ein Taubstummen- und Blindeninstitut,
eine Akademie der Wissenschaften wie auch andre gelehrte
Gesellschaften, eine öffentliche Bibliothek von 60,000
Bänden, ein reichhaltiges Kunst- und Antikenmuseum, eine
naturhistorische Sammlung, eine Sternwarte, einen botanischen
Garten, 3 Thea-
783
Toupet - Touristenvereine.
ter, ein Irrenhaus, eine Börse und eine Filiale der Bank
von Frankreich. T. ist der Sitz der Präfektur, eines
Erzbischofs (von T. und Narbonne), eines protestantischen
Konsistoriums, eines Appell- und Assisenhofs, eines
Handelsgerichts, einer Handelskammer und des 17.
Armeekorpskommandos. - Zur Zeit der Römer hieß T.
Tolosa, war die Hauptstadt der Volcae Tectosages und schon im 2.
Jahrh. v. Chr. eine reiche Handelsstadt und Mittelpunkt des
westeuropäischen Handels. In dem heiligen Teich des
großen Nationalheiligtums war der ungeheure Schatz von 15,000
Talenten versenkt, durch dessen Raub der Prokonsul Cäpio das
Aurum Tolosanum sprichwörtlich machte. Trotz mehrfacher
Eroberungen und Plünderungen war es auch im 4. Jahrh. n. Chr.
noch immer eine durch Handel, Reichtum und Wissenschaften
blühende Stadt. 413 von den Westgoten eingenommen, wurde sie
nun Residenz der Könige des westgotischen Reichs, bis Alarich
II. sie 507 an den Frankenkönig Chlodwig verlor. Von da an
wurde sie durch fränkische Grafen verwaltet und ward 631
Residenz der Herzöge von Aquitanien (s. d.). 721 wurden die
Araber von Eudo von Aquitanien bei T. besiegt. Nach dem Untergang
der Selbständigkeit Aquitaniens (771) war T. 778 wieder Sitz
einer Grafschaft, deren Dynastengeschlecht die Landschaften Quercy,
Albigeois sowie Teile der Graffch asten Auvergne und Aquitanien und
der Provence mit T. vereinigte. Die Grafen von T. führten
meist den Namen Raimund (s. Raimund von St.-Gilles), ihre Macht
ging in den Albigenserkriegen zu Grunde. Des letzten Grafen,
Raimunds VII., einzige Tochter, Johanna, vermählte sich mit
Ludwigs IX. Bruder, dem Grafen Alfons von Poitiers, dem sie T.
zubrachte. Als dieser 1271 nach einer kinderlosen Ehe starb,
vereinigte Philipp III. die Grafschaft T. für immer mit der
Krone Frankreich, nur den Titel eines Grafen von T. verlieh Ludwig
XIV. seinem dritten Sohn von der Montespan, Louis Alexandre de
Bourbon, Grafen von T. (geb. 6. Juni 1678, gest. 1. Dez. 1737). In
der Nacht vom 16. zum 17. Mai 1562 wurden in T. gegen 4000
Hugenotten ermordet. Am 10. April 1814 erfocht die vereinigte
britisch-spanische Armee unter Wellington bei T. einen Sieg
über die Franzosen unter Soult. Vgl. Catel, Histoire des
comtes de T. (Toul. 1623); "T. Histoire, archéologie
monumentale, facultés, etc." (das. 1887); Jourdan, Panorama
historique de T. (2. Aufl., das. 1877).
Toupet (franz., spr. tupa), Haarbüschel, Bezeichnung
einer namentlich gegen Ende des vorigen Jahrhunderts üblichen
Mode, die unmittelbar über der Stirn befindlichen Haare, auch
die der Perücke, rückwärts in die Höhe
gekämmt und gekräuselt zu tragen.
Tour (franz., spr. tuhr), Umlauf, Umdrehung, z. B. einer
Welle; Wendung (beim Tanz etc., auch in der Rede); Spaziergang,
Rundfahrt, Reise (daher Tourist, Vergnügungsreisender);
gewandt ausgeführter Streich; falsche Haarfrisur.
Tour (La T. du Pin, spr. tuhr du pang),
Arrondissementshauptstadt im franz. Departement Isère, an
der Bourbre und der Eisenbahn Lyon-Grenoble, mit Lein- und
Seidenweberei, Fabrikation von Handschuhen und Posamentierwaren und
(1886) 3197 Einw.
Tour, Abbé de la, Pseudonym, s.
Charrière.
Touraine (spr. turähn), ehemalige franz. Landschaft,
von Orléanais, Berry, Poitou und Anjou begrenzt,
umfaßte das jetzige Departement Indre-et-Loire und einen Teil
des Departements Vienne. Sie bildete seit 941 eine besondere
Grafschaft, kam 1045 an die Grafen von Anjou, dann an die
Plantagenets und 1204 unter Philipp II. August an die Krone, ward
1360 zum Herzogtum erhoben und mehrmals an nachgeborne
französische Prinzen verliehen, aber 1584 nach dem Tode des
Herzogs Franz von Alençon, des Bruders Heinrichs III.,
wieder mit der Krone vereinigt. Wegen ihrer Fruchtbarkeit ward die
Landschaft der Garten Frankreichs genannt. Vgl. Bourassé, La
T., son histoire et ses monuments (Tours 1855); Carré de
Busserolle, Dictionnaire géographique, historique et
biographique de l'Indre-et-Loire et de l'ancienne province de T.
(das. 1878-84, 6 Bde.).
Tourcoing (spr. turkoang), Stadt im franz. Departement
Nord, Arrondissement Lille, Knotenpunkt der Eisenbahnen
Lille-Mouscron und Somain-Menin, nahe der belgischen Grenze,
Schwesterstadt von Roubaix, mit dem es immer mehr verwächst,
mit Collège, Gewerbekammer, Filiale der Bank von Frankreich,
zahlreichen Spinnereietablissements für Schafwolle, Baumwolle,
Flachs und Seide (zusammen 400,000 Spindeln), Wollkämmereien,
Webereien, Färbereien, Fabriken für Möbelstoffe,
Teppiche und Wirkwaren, Seife, Maschinen und Zucker, lebhaftem
Handel und (1886) 41,183 (Gemeinde 58,008) Einw. An hervorragenden
Bauwerken ist die Stadt arm. Hier 17. und 18. Mai 1794 Sieg der
Franzosen unter Pichegru über die Österreicher und
Engländer unter Clerfait.
Tourenzähler, Apparat zum Zählen der
Umdrehungen von Wellen, Rädern etc.
Touristenvereine (Gebirgsvereine) sind solche, deren
Arbeitsfeld vorwiegend sich auf Mittelgebirge oder Vorberge der
Hochalpen erstreckt, während Alpenklubs (vgl. Alpenvereine)
sich ausschließlich mit Hochgebirgen befassen; strenge
Grenzen lassen sich jedoch nicht ziehen. Die meisten T. sind in
Zweigvereine (Sektionen) gegliedert, die über ein
Vereinsgebiet zerstreut sind, und die durch eine Zentralgewalt
zusammengehalten werden. Jede Sektion arbeitet selbständig;
alle aber erstreben gemeinsam für ihr Gebiet das gleiche Ziel.
Verkehrserleichterungen, Erschließung und Verschönerung
von Aussichtspunkten und neuen Partien, Hebung der Regsamkeit und
Wohlfahrt der Gebirgsbewohner; ferner pflegen sie kleinere
populärwissenschaftliche Forschungen und gemeinsame Touren
etc. Fast jeder Touristenverein gibt eigne Jahresberichte heraus;
mehrere lassen vierteljährlich, monatlich oder halbmonatlich
Zeitschriften, außerdem Karten, Panoramen, Jahrbücher,
Spezialführer u. dgl. erscheinen. Die Summe, welche durch die
Kassen aller Touristen- und Alpenvereine zusammengenommen ins Land
fließt, beläuft sich pro Jahr auf ca. 400,000 Mk.,
ungerechnet die großen Umsätze, welche sie indirekt
hervorrufen. Im Deutschen Reich bestehen zur Zeit über 40 T.
mit ca 27,000 Mitgliedern (ohne die Sektionen des Deutschen und
Österreichischen Alpenvereins mit ca. 8000 Mitgliedern) und
zwar: Schwarzwaldverein (Freiburg i. Br., seit 1864, reorganisiert
1882, 2000 Mitglieder), Taunusklub (Frankfurt a. M., seit 1868,
reorganisiert 1882, 1000 Mitgl.), Vogesenklub (Straßburg i.
E., 1876, 3000 Mitgl.), Rhönklub (Fulda, 1876, 2000 Mitgl.),
Freigerichtenbund (Maisenhaus, 1876), Gebirgsverein für die
Sächsisch-Böhmische Schweiz (Dresden, 1877, 1500 Mitgl.),
Vaterländischer Gebirgsverein Saxonia (Dresden 1879),
Spessarttouristenverein (Hanau, 1879), Gebirgsverein Rathewalde
(1879), Gebirgsverein Lusatia (Zittau, 1880, 1200 Mitgl.),
Thüringerwaldverein (Eisenach, 1880, 2600 Mitgl.), Verein der
Spessartfreunde (Aschaffenburg, 1880, 500 Mitgl.), Gebirgsverein
Oybin (1880), Schlesischer Gebirgsverein für das
784
Tourn. - Tournai.
Riesengebirge (Hirschberg, 1880, 4000 Mitgl.), Heideklub
(Dresden, 1880), Gebirgsverein für die Grafschaft Glatz
(Glatz, 1881, 950 Mitgl.), Taunusklub Wetterau (Nauheim-Friedberg,
1881), Gebirgsverein für Öderan im Erzgebirge (1881),
Verband vogtländischer Touristenvereine (Plauen, 1881, 1000
Mitgl.), Vogelsberger Höhenklub (Schotten, 1881, 1000 Mitgl.),
Verschönerungsverein für das Siebengebirge (Bonn etc.,
1881), Touristenverein Annaberg-Buchholz (1881), Rheinischer
Touristenklub (Mainz, 1882), Odenwaldklub (Erbach, 1882, 1200
Mitgl.), Rhein- und Taunusklub (Wiesbaden, 1882), Im Spreegebiet
(Bautzen, 1882), Oberes Spreethal (Neusalza, 1882), Verband der
Gebirgsvereine des Eulen- und Waldenburger Gebirges (Reichenbach i.
Schl., 1882/83, 500 Mitgl.), Gebirgsverein Charlottenbrunn in den
Sudeten (1882), Bayrischer Waldverein (Bodenmais, 1883, 500
Mitgl.), Verschönerungsverein Naturfreund (Meißen, 1881,
400 Mitgl.), Verein Wendelsteinhaus (München, 1881),
Schweidnitzer Gebirgsverein (1883), Württembergischer
Schwarzwaldverein (Stuttgart, 1884), der Harzklub (Goslar, 1887,
mit 2400 Mitgl. in 23 Zweigvereinen), Westerwaldklub (Selters),
Eifelverein (Trier); ferner T. in Offenbach, Stettin, Köln,
Kassel, Potsdam, Bingen, Hannover etc. Die
Österreichisch-Ungarische Monarchie zählt über 25 T.
mit ca. 20,000 Mitgliedern ohne folgende 3 alpine Vereine:
Sektionen des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins (ca.
7000 Mitgl.), Österreichischer Alpenklub (ca. 600 Mitgl.),
Società degli Alpinisti Tridentini (ca. 500 Mitgl.) und
zwar: Österreichischer Touristenklub (Wien, 1869, ca. 10,000
Mitgl.), Steirischer Gebirgsverein (Graz, 1869, 2000 Mitgl.),
Ungarischer Karpathenverein (Käsmark, 1873, 3000 Mitgl.),
Kroatischer Gebirgsverein (Agram, 1874, 450 Mitgl.),
Lehrer-Touristenklub (Wien, 1874), Galizischer Tatraverein (Krakau,
1874, 2200 Mitgl.), Verein der Naturfreunde (Mödling, 1877,
400 Mitgl.), Nordböhmischer Exkursionsklub
(Böhmisch-Leipa, 1878, 1350 Mitgl), Gebirgsverein für die
Böhmische Schweiz (Tetschen, 1878, 350 Mitgl.), Böhmische
Erzgebirgsvereine (Karlsbad, Görkau, Oberleutensdorf,
Brüx, Komotau, Joachimsthal, Teplitz, Eger, Marienberg etc.,
seit 1879, ca. 2000 Mitgl.), Böhmischer Riesengebirgsverein
(Hohenelbe, 1880, 600 Mitgl.), Siebenbürgischer
Karpathenverein (Hermannstadt, 1880, 1500 Mitgl.), Sannthaler
Alpenklub (Cilli, 1880), Gebirgsverein in Gmünd in
Kärnten (1880), Gebirgsverein der mährisch-schlesischen
Sudeten (Gräfenberg, 1881, 1600 Mitgl.), Alpenklub Salzburg
(1881), Verein zur Förderung des Fremdenverkehrs (Graz, 1881),
Touristenverein Hermagor in Kärnten (1882), Plattenseeverein
(1883), Società degli Alpinisti Triestini (Triest, 1883),
Mittelgebirgsverein in Aussig in Böhmen (1883), Deutscher
Böhmerwald-Bund (1884), Deutscher Gebirgsverein für das
Jeschken- und Isergebirge (Reichenberg in Böhmen, 1884, 600
Mitgl.); ferner kleinere alpintouristische Privatkreise in Graz und
Wien. In der Schweiz besteht außer dem Schweizer Alpenklub
nur der Club jurassien (Neuchâtel, 1868). In Frankreich
außer dem Club Alpin Français, der sich auch mit den
Pyrenäen und dem Atlas Algeriens beschäftigt, und der
Société Ramond in Bagnères de Bigorre
(Oberpyrenäen, seit 1865): Société des Touristes
du Dauphiné (Grenoble, 1875, 650 Mitgl.), Club Alpin
International (Nizza, 1879, mehr ein Cercle für
Kurgäste). In Italien außer dem Club Alpino Ita1iano und
der Società Alpina Friulana (Udine, l874); Circulo Alpino
dei Sette Comuni (Asiago), Club dei Monti Berici, Club Alpino di
Garafagnana. In andern Ländern: Club Alpin Belge
(Brüssel, 1883), Norske Turistforening (Christiania, 1868,
2000 Mitgl.), Associacio d'excursions Catalana (Barcelona, 1878,
500 Mitgl.), Himalaya-Club (Kalkutta, 1880), Appalachian
Mountain-Club (Boston, 1876, 700 Mitgl.), Rocky Mountain-Club
(Philadelphia, 1876), Alpine Club of Massachusetts (Williamstown,
1863), Krimscher Gebirgsklub (Odessa, 1889). Für das Deutsche
Reich besteht seit 1883 ein Verband deutscher T. (Zentralsitz in
Frankfurt a. M.), dem etwa 27 Vereine mit ca. 24,000 Mitgliedern
angehören. Organ des Verbandet ist die Zeitschrift "Der
Tourist" (Berl., seit 1887). Man kann auch in gewissem Sinn die
lokalen Verschönerungsvereine unter die Gebirgsvereine, bez.
T. rechnen, zumal sie, wie z. B. derzeit 1843 bestehende Verein zu
Wiesbaden, neben dem Londoner Alpine Club (von 1857 bis 1861 unter
dem Namen The Englishmen's Playground) zu den Vorläufern
unsrer gesamten touristischen Vereinsbewegung zu zählen sind.
Vgl. Köhler, Die touristischen Vereine der Gegenwart (Eisen.
1884); Nicol, Das touristische Vereinswesen (Wiesb. 1886).
Tourn., bei botan. Namen Abkürzung für
Tournefort (s. d.).
Tournachon (spr. -schóng), Schriftsteller, s.
Nadar.
Tournai (spr. turnä, vläm. Doornick),
Hauptstadt eines Arrondissement und ehemalige Festung in der belg.
Provinz Hennegau, an beiden Ufern der Schelde, Knotenpunkt der
Eisenbahnen nach Gent, Brüssel, Valenciennes, Lille und Douai,
hat sieben Vorstädte, breite Kais, regelmäßige
Straßen, eine Kathedrale romanischen Stils aus dem 12. Jahrh.
mit fünf Türmen, Gemälden von Jordaens, Rubens,
Gallait u. a. und dem reichen Reliquienschrein des heil.
Eleutherius, ersten Bischofs von T., die Kirche St.-Brice mit dem
Grabmal des Frankenkönigs Childerich und viele andre Kirchen
und Kapellen, einen alten, neuhergestellten Belfried und ein
Stadthaus mit öffentlichem Garten. Den Marktplatz
schmückt das von Dutrieux modellierte Bronzestandbild der
Prinzessin Maria von Epinoy (s. unten). Die Bevölkerung
zählte 1888: 34,805 Seelen. Die wichtigsten Industriezweige
sind: Fabrikation von Teppichen, Leinen-, Wollen- und
Baumwollenstoffen, Porzellan, Fayence und Bronzewaren, Mützen-
und Strumpfwirkerei, Gerberei und Brauerei. Der lebhafte Handel
wird durch die schiffbare Schelde begünstigt. T. hat ein
geistliches Seminar, Athenäum, Industrieschule,
Lehrerinnenseminar, eine Kunstakademie, öffentliche
Bibliothek, ein naturhistorisches Museum, eine Entbindungsanstalt,
ein Theater. Es ist Sitz eines Bischofs und eines Tribunals. - T.
hieß im Altertum Civitas Nerviorum, Turris Nerviorum oder
Tornacum, ward im 5. Jahrh. den Römern von den Franken
abgenommen und teilweise zerstört, aber bald wieder aufgebaut
und bis Chlodwig Sitz der merowingischen Könige. Später
gehörte es zu Flandern, seit Philipp dem Schönen zu
Frankreich, bis es im Frieden von Madrid 1526 an die spanischen
Niederlande kam. Während der niederländischen Unruhen
ward es 1581 von dem Herzog von Parma belagert, aber von der
Prinzessin Maria von Evinoy tapfer verteidigt. 1667 von Ludwig XIV.
erobert, wurde es im Aachener Frieden von 1668 förmlich an
Frankreich abgetreten. Ludwig XIV. ließ die Festungswerke
durch Vauban ansehnlich verstärken; dessenungeachtet ward der
Platz 1709 von den Kaiserlichen unter Prinz Eugen und Marlborough
wieder erobert und im Frieden von
785
Tournantöl - Tours.
Utrecht mit den österreichischen Niederlanden vereinigt,
doch erhielten die Holländer kraft des Barrieretraktats das
Besatzungsrecht. Als Joseph II. 1781 den Barrieretraktat aufhob,
wurde auch T. geschleift. Hier wurden 19. Mai 1794 die
Engländer unter dem Herzog von York von den Franzosen unter
Pichegru geschlagen. T. fiel nun an Frankreich, wurde im ersten
Pariser Frieden von 1814 an Holland abgetreten und kam 1830 an
Belgien. Vgl. Bourla, T.-guide, histoire etc. (Tourn. 1884);
Cloquet, T. et Tournaisis (Lille 1885).
Touruantöl, s. Olivenöl.
Tourné (franz.), umgedreht, umgeschlagen!
substantivisch: das als Trumpf aufgeschlagene Kartenblatt.
Tournebroche (franz., spr. turn'brósch),
Bratenwender.
Tournedos (franz., spr. turn'doh), Lendenbratenschnitzel,
welche vor dem Braten in einer Marinade von Provenceröl,
Zitronensaft, Pfeffer etc. mariniert worden sind und mit
Béarner, Scharlotten- oder Tomatensauce serviert werden. T.
à la Rossini, berühmtes Gericht, zwei Lendenschnitzel,
zwischen welchen Trüffel- und Gänseleberschnitte
liegen.
Tournée (franz.), Rundreise (besonders
amtliche).
Tournefort (spr. turnfor), Joseph Pitton de, Botaniker,
geb. 5. Juni 1656 zu Aix, studierte bei den Jesuiten daselbst, ward
1683 Professor der Botanik am königlichen Pflanzengarten in
Paris, bereiste von 1700 bis 1702 auf Kosten der Regierung
Griechenland und Kleinasien, worüber er in "Voyage au Levant"
(Par. 1717, 3 Bde.; deutsch, Nürnb. 1776) berichtete, und von
wo er über 1300 neue Pflanzenarten mitbrachte. Er starb als
Professor der Medizin am Collège de France 28. Nov. 1708 in
Paris. Das in seinen "Institutiones rei herbariae" (Par. 1700, 3
Bde.; neue Aufl. von A. de Jussieu, Lyon 1719, 3 Bde.) aufgestellte
Pflanzensystem, welches 22 Klassen umfaßte und sich aus den
Bau der Blumenkrone gründete, fand trotz der geringen
Berücksichtigung der natürlichen Verwandtschaft wegen der
Handlichkeit des Buches in der Zeit vor Linné allgemeine
Anerkennung. Auch war T. der erste vor Linné, welcher den
Schwerpunkt der beschreibenden Botanik in die Charakteristik der
Gattungen verlegte, wobei er freilich die spezifischen
Verschiedenheiten innerhalb der Gattungen als Nebensache
behandelte. Von seinen übrigen Werken sind noch zu nennen:
"Histoire des plantes qui naissent aux environs de Paris" (Par.
1698; 2. Aufl. von Jussieu, 17.25); "Éléments de
botanique" (Lyon 1694, 3 Bde. mit 489 Tafeln); "Traité de la
matière médicale" (Par. 1717, 2 Bde.).
Tournesollappen, s. v. w. Bezetten (s. d.).
Tournesolpflauze, s. Crozophora.
Tournieren (franz.), drehen, wenden, z. B. im Kartenspiel
(s. Skat); in der Kochkunst die Manipulation, mittels welcher man
eine Speise ohne Rühren mit der Sauce mischt oder eine
Flüssigkeit erhitzt, ohne daß sie am Boden des
Gefäßes gerinnt; eine tournierte Suppe oder Sauce ist
mit Ei vermischt, welches durch Kochen geronnen ist. Auch s. v. w.
Drechseln, Drehen, daher das Ausschneiden oder Abdrehen von
Rüben, Kartoffeln u. dgl. in Form von Kugeln etc. beim
Garnieren großer Fleischschüsseln.
Tourniquet (franz., spr. turnikeh. Aderpresse), chirurg.
Instrument zum Zusammenpressen von Arterien, um Verblutung bei
Amputationen und sonstigen Blutungen zu verhüten. Dasselbe
besteht (s. Figur) in einem Polster, welches oberhalb der Blutung
(beim Bein in der Schenkelbeuge, beim Arm nahe der
Achselhöhle) auf den Hauptstamm der Arterie gesetzt und mit
einem 1 m langen Band mittels Knebels oder Schnalle um das Glied
befestigt wird. - T. heißt auch eine drehbare Barriere
(Drehkreuz) vor Billetschaltern etc.
Tournois (franz., spr. turnoa), altfranzösische,
nach der Stadt Tours benannte Münzwährung, nach welcher
bis 1795 und 1796 ganz Frankreich mit Einschluß der Kolonien
rechnete. Der Livre t. hatte 20 Sous à 12 Deniers und stand
um 1¼ Proz. im Wert niedriger als der heutige Frank, indem
81 Livres t. 80 Frank galten.
Tournon (spr. turnóng), Arrondiffementshauptstadt
im franz. Departement Ardeche, am Rhone, über welchen zwei
Hängebrücken nach der Stadt Tain hinüberführen,
an der Eisenbahn Givors-La Voulte, hat ein Lyzeum, eine Bibliothek,
ein Schloß, Seidenfilanden, Weinhandel und (1886) 3793
Einw.
Tournüre (franz., spr. turn-), gewandtes Benehmen;
auch s. v. w. Cul de Paris.
Tournus (spr. turnüh), Stadt im franz. Departement
Saône-et-Loire, Arrondissement Mâcon, an der
Saône und der Eisenbahn Dijon-Lyon, hat eine Abteikirche,
St.-Philibert, aus dem 11. und 12. Jahrh., ein Denkmal des hier
gebornen Malers Greuze (von Falguière), ein Handelsgericht,
Collège, Fabrikation von Rübenzucker, Maschinenbau,
Seiden- und Weinbau und (1886) 4201 Einw.
Tourons (franz., spr. turóng), feines Gebäck
aus Eiweißschnee, Zitronensaft und Mehl, welches noch warm um
ein fingerdickes rundes Holz gewunden wird.
Tours (spr. tuhr), Hauptstadt des franz. Departements
Indre-et-Loire und ehemalige Hauptstadt der Provinz Touraine, in
fruchtbarer Ebene am linken Ufer der Loire, über welche eine
434 m lange, steinerne Brücke nebst zwei
Hängebrücken führt, wichtiger Eisenbahnknotenpunkt
(Linien über Vendôme nach Paris, nach Orléans,
Vierzon, Châtellerault, Poitiers, Sables d'Olonne, Nantes, Le
Mans), ist von Boulevards (an Stelle der alten Festungswerke)
umgeben und hat sich im S. durch neue Stadtteile bis zum Ufer des
Cher erweitert. Die schöne Rue Royale teilt die Stadt in zwei
fast gleiche Teile. Die hervorragendsten Gebäude sind: die
gotische Kathedrale (mit zwei 70 m hohen Türmen und
prächtigem Portal), die Kirchen St.-Julien (mit schönen
Fresken) und St.-Martin (mit zwei schönen Türmen), der
erzbischöfliche Palast, die Präfektur, das
Justizgebäude, das Rathaus und das Theater. Am Platz vor der
Brücke
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl., XV.Bd
50
786
Tourtia - Towarczy.
das Denkmal Descartes' (von Nieuwerkerke). Die Stadt zählt
(1886) 59,585 Einw., welche Industrie in Woll- und Seidenstoffen,
Teppichen, Chemikalien etc., eine große Buchdruckerei, Wein-
und Gemüsebau und starken Handel treiben. T. hat ein Lyceum,
eine Vorbereitungsschule für Medizin und Pharmazie, ein
Seminar, eine Maler- und Zeichenschule, Gewerbeschule,
öffentliche Bibliothek (40,000 Bände), ein Gemälde-
und Skulpturenmuseum, Antiquitäten-, Naturalien- und
mineralogisches Kabinett, einen botanischen Garten, eine
Irrenanstalt und mehrere gelehrte Gesellschaften. Es ist der Sitz
des Präfekten, eines Erzbischofs, eines Assisenhofs und eines
Handelsgerichts. 1853 ward hier ein großes römisches
Amphitheater aufgefunden. - T. hieß zur Römerzeit
Cäsarodunum, später Turones und war die Hauptstadt der
Turones, kam dann unter westgotische und nachher unter
fränkische Herrschaft und stand bis in das 11. Jahrh. unter
eignen Grafen. 732 siegte Karl Martell in der Nähe von T.
über die Araber. 853 wurde die Stadt von den Normannen
geplündert und verbrannt. Karl VII. und Ludwig XI. residierten
oft und gern in der Umgegend, letzterer im Schloß Plessis
lès T. König Heinrich III. verlegte 1583 das Parlament
hierher, wodurch die Stadt außerordentlich wuchs. Auch wurden
hier die französischen Generalstaaten mehrmals zusammenberufen
sowie mehrere Konzile abgehalten. 1870 war T. vom 11. Sept. bis 10.
Dez. Sitz der Delegation der Regierung der Nationalverteidigung. Am
19. Jan. 1871 ward es vom Generalleutnant v. Hartmann besetzt. Vgl.
Giraudet, Histoire de la ville de T. (Tours 1874, 2 Bde.);
Grandmaison, T. archéologique (das. 1879).
Tourtia, s. Kreideformation, S. 183.
Tourville (spr. turwil), Anne Hilarion de Contentin, Graf
von, franz. Seeheld, geb. 24. Nov. 1642 auf dem Schloß
Tourville bei Coutances (La Manche), trat 1656 in den
Malteserorden, kämpfte ruhmvoll gegen die Barbaresken, nahm
1660 Dienste in der französischen Marine, ward 1667
Schiffskapitän und befehligte von 1672 bis 1674 ein
Linienschiff im Kriege gegen die Holländer und Spanier im
Mittelländischen Meer. 1675 diente er erst unter dem Chevalier
de Valbette, dann unter Duquesne; auf der Rückkehr von Agosta,
wo er mit Auszeichnung gefochten, nach Frankreich vernichtete er
1677 bei Palermo zwölf Schiffe der holländisch-spanischen
Flotte. 1680 zum Generalleutnant der Seetruppen ernannt,
bombardierte er 1682, 1683 und 1688 Algier und nahm 1684 an der
Beschießung Genuas teil. 1689 zum Vizeadmiral des
Levantischen Meers erhoben, befehligte er 1690 mit d'Estrées
die Flotte, welche die Unternehmung Jakobs II. in Irland
unterstützte. Als Oberbefehlshaber der im Kanal aufgestellten
französischen Flotte errang er in der Seeschlacht bei Beachy
Head in der Nähe der Insel Wight im Juli 1690 den Sieg
über die aus 112 Segeln bestehende britisch-holländische
Flotte. Um die beabsichtigte Landung der Jakobiten an der
britischen Küste zu ermöglichen, mußte er 29. Mai
1692 auf der Höhe des Kaps La Hougue die 88 Segel starke
britisch-holländische Flotte unter dem Admiral Russell mit 44
Schiffen angreifen, geriet aber zwischen zwei Feuer und ward
geschlagen. 1693 zum Marschall von Frankreich erhoben, nahm er im
Juni beim Kap St.-Vincent von einer britisch-holländischen
Handelsflotte 27 Handels- und Kriegsfahrzeuge weg und
zerstörte 45 bei der Verfolgung. Er starb 28. Mai 1701. Die
"Mémoires de T." (Amsterd. 1758, 3 Bde.) sind unecht. Vgl.
Delarbre, T. et la marine de son temps (Par. 1889).
Toury (spr. turi), Dorf im franz. Departement
Eure-et-Loir, Arrondissement Chartres, an der Eisenbahn
Paris-Orléans, ward gelegentlich der Operationen des
Generals v. d. Tann und des Großherzogs von Mecklenburg gegen
die französische Loirearmee genannt. Nach T. ging 10. Nov.
1870 der Rückzng v. d. Tanns, und hier vereinigte der
Großherzog einige Tage später seine Armeeabteilung.
Toussaint, Gertruide, s. Bosboom.
Toussaint-Langenscheidtsche Unterrichtsmethode, s.
Langenscheidt u. Sprachunterricht, S. 185.
Toussaint l'Ouverture (spr. tussäng
luwärtühr), Obergeneral der Neger auf Haïti, geb.
1743 als Sklavenkind auf einer Pflanzung des Grafen Noé
unweit des Kaps François, erwarb sich als Kutscher eines
Plantagenaufsehers durch Benutzung von dessen Bibliothek eine
gewisse Bildung. Als im August 1791 die erste Negerempörung
auf Haïti ausbrach, brachte T. seinen Herrn auf das Festland
von Amerika in Sicherheit und nahm dann bei dem Negerheer Dienste.
Als dasselbe in spanische Dienste gegen die franzöfsische
Republik trat, wurde er zum spanischen Obersten ernannt; doch ging
er 1794 mit einem Teil der Armee zu den Franzosen über und
ward vom Konvent für seine Verdienste bei der Vertreibung der
Spanier und der Unterdrückung eines Mulattenaufstandes (1795)
zum französischen Brigadegeneral, 1797 zum Divisions- und
endlich zum Obergeneral aller Truppen auf Haïti ernannt. Er
stellte Ordnung und Disziplin wieder her, machte sich aber 1800
unabhängig und ließ sich zum Präsidenten auf
Lebenszeit ernennen. Leclerc, der 1801 mit einem französischen
Heer landete, zwang ihn zur Kapitulation. Nachdem er hierauf einige
Zeit auf seinem Gut gelebt, ward er 1802 plötzlich verhaftet
und nach Frankreich in das Fort Joux bei Besançon gebracht,
wo er 27. Juli 1803 starb. Vgl. Gragnon-Lacoste, T. L. (Par. 1877);
Schölcher, Vie de T. L. (das. 1889).
Tout (franz., spr. tu), das Ganze, Alles.
Tout comme chez nous (franz.), ganz wie bei uns.
Tovar, serb. Gewicht, = 100 Oken.
Tovar, deutsche Kolonie in der südamerikan. Republik
Venezuela, eine Tagereise westlich von Caracas, am südlichen
Abhang des Küstengebirges gelegen, ward 1843 auf einem von der
Familie Tovar unentgeltlich abgetretenen Terrain gegründet,
zählt aber jetzt nur noch 20-30 Familien.
Tow (spr. toh), engl. Name für Werg. Die in allen
deutschen Handelsnotizen vorkommenden Towgarne sind aus Flachswerg
gesponnen.
Towarczy (slaw., "Kamerad"), früher in Rußland
und Polen aus dem kleinen Adel hervorgegangene Soldaten, die weder
zu den Offizieren noch Unteroffizieren gehörten u. zu
verschiedenen Malen als Truppe im brandenburgisch-preußischen
Heer, zuerst 1675 als zwei Kompanien Reiter, vorkommen. Um in
Preußen die große Zahl kleiner adliger Grundbesitzer in
den ehemals polnischen Provinzen, welche mangelnder Bildung und
Mittel wegen nicht als Offiziere, ihrer Standesvorurteile wegen
aber auch nicht als Gemeine zu verwerten waren, unterzubringen,
versuchte man Ende vorigen Jahrhunderts eine mit Lanzen bewaffnete
Reitertruppe aus ihnen zu bilden und wandelte 1800 das Regiment
Bosniaken in T. um. Den Plan, sie den Husaren zuzuteilen,
vereitelte das Jahr 1806; nachdem die T. 1807 tapfer mitgefochten,
wurden sie nach dem Friedensschluß wegen Abtretung ihrer
Kantone in Ulanen umgewandelt.
787
Tower - Trabea
Tower (engl., spr. tauer), die Gesamtbezeichnung für
einen ausgedehnten Komplex von Türmen, Festungswerken,
kirchlichen und profanen Gebäuden in der Altstadt von London,
dessen Geschichte mit derjenigen der englischen Krone selbst
für lange Jahrhunderte eng verbunden ist. Der älteste
Teil dieser merkwürdigen Festung ist der sogen. weiße
Turm (White T.), den Wilhelm der Eroberer durch den Bischof Gundulf
von Rochester errichten ließ; daß dies auf Grundlage
älterer römischer oder angelsächsischer Anlagen
geschehen sei, ist nicht zu erweisen. Weitere Werke wurden unter
Wilhelm II. Rufus und Stephan hinzugefügt, unter denen die
innere Reihe der Befestigungsanlagen im wesentlichen vollendet
wurde. Später hat sich besonders Heinrich III., der den T.
1217 in seine Hände bekam, des Ausbaues derselben angenommen
und durch seinen Architekten Adam von Lamburn die äußere
Reihe der Werke entwerfen und zum größten Teil
ausführen lassen; einzelne Gebäude, so die jetzige St.
Peterskirche, sind noch später unter Eduard I.
hinzugefügt worden. Seit den ersten normännischen
Königen war der T. Residenz der englischen Könige, die
sich oft genug hierher vor drohenden Gefahren zurückzogen und
die Festung durch eine ständige Besatzung unter einem
Constable (das Amt war zuerst der Familie de Mandeville anvertraut)
schützten, zugleich aber auch Schatzkammer, Sitz der obersten
Behörden und ein sicheres Staatsgefängnis, das die
Gefangenen oft genug nur verließen, um auf einem offenen
Platz innerhalb der Festung, dem Tower-hill, ihr Leben unter dem
Beil des Henkers zu beschließen. Hier wurde Johann ohne Land
von seinen Baronen belagert, hier Richard II. zum Verzicht auf die
Krone gezwungen, hier Heinrich VI. ermordet und der Herzog von
Clarence im Wein ertränkt, hier starben Eduard V. und sein
Bruder Richard von York eines geheimnisvollen Todes. Zu den
Gefangenen des Towers gehören die erlauchtesten Namen der
englischen Geschichte, und unter den Enthaupteten von Tower-hill
sind Graf Warwick, der letzte Plantagenet, Bischof Fisher von
Rochester und Sir Thomas More, Anna Boleyn, Katharina Howard und
Jane Grey, der Protektor Somerset und Elisabeths Günstling,
Graf Essex, Sir Walter Raleigh und Graf Strafford, Algernon Sidney
und der Herzog von Monmouth, der natürliche Sohn Karls II. Als
königliche Residenz für längere Zeit hat der T.
zuletzt unter Heinrich VII. gedient; von da ab begaben sich die
Herrscher nur noch im Beginn ihrer Regierung hierher, um von hier
aus den feierlichen Krönungszug durch die City nach
Westminster anzutreten. Erst Jakob II. hat diesen Brauch
aufgegeben, und unter ihm sind die königlichen
Wohngemächer abgerissen worden. Seit der Mitte des 18. Jahrh.
sind keine Hinrichtungen auf Tower-hill mehr vorgenommen, seit 1820
dient er nicht mehr als Staatsgefängnis und wird
gegenwärtig nur als Arsenal und Kaserne benutzt, obwohl noch
1792 einmal, aus Furcht vor revolutionären Bewegungen in
London, seine Werke verstärkt und in Verteidigungszustand
gesetzt worden waren. Vgl. Bayley, History and antiquities of the
T. of London (2. Aufl., Lond. 1830); de Ros, Memorials of the T. of
London (das. 1866); W. H. Dixon, Her Majesty's T. (7. Aufl., das.
1884; deutsch, Berl. 1870, 2 Bde.).
Tower Hamlets (spr. tauer hämmlets), ein
Parlamentswahlbezirk der Stadt London, die östlich vom Tower
liegenden Stadtteile (ehemalige "Weiler") umfassend, mit (1881)
439,137 Einw.
Towianski, Andreas, poln. Mystiker, geb. 1. Jan. 1799 zu
Antoszwiniec in Litauen, war 1818-26 Advokat zu Wilna und begab
sich, nachdem er mittlerweile auf seinem väterlichen Gut
gelebt hatte, 1835 nach Paris, wo er den Saint-Simonismus kennen
lernte. Ebendahin kehrte er 1840 zurück und eröffnete 27.
Sept. 1841 seine mystischen Vorträge, deren Tendenz auf eine
totale Umgestaltung des gesamten sozialen Zustandes der Menschheit
durch beständige Begeisterung hinauslief. Für diese Ideen
gewann er den Dichter Mickiewicz und andre Vertreter der polnischen
Romantik. Vgl. Mickiewicz, L'Église of officielle et le
Messianisme (Par. 1842-43, 2 Bde.). Der Meister selbst hat dem
System keinen authentischen Ausdruck verliehen; 1842 und dann
wieder 1848 aus Frankreich verwiesen, ging er über Rom nach
der Schweiz, wo er 13. Mai 1878 in Zürich starb. Vgl. Semenko,
T. et sa doctrine (Par. 1850).
Tow Law (spr. tau lah), Stadt in der engl. Grafschaft
Durham, 16 km westlich von Durham, hat Kohlengruben,
Eisenhütten, Kalksteinbrüche und (1881) 5005 Einw.
Town (engl., spr. taun), Stadt.
Township (engl., spr. taunschip), in England Kirchspiel
oder Teil eines solchen, mit eigner Armenverwaltung; in den
Vereinigten Staaten von Nordamerika Name der Unterabteilung der
Counties, auch Hauptsektion der vermessenen Ländereien, =
23,040 Acres.
Towyn (spr. tohwin), Stadt in Merionethshire (Nordwales),
an der Cardiganbai, hat Schieferbrüche, eine Mineralquelle,
Seebäder und (1881) 3365 Einw.
Toxichämie (griech.), Blutvergiftung, bei welcher das Blut
nicht nur als Transportmittel für aufgenommene Gifte dient,
sondern durch letztere selbst (namentlich der Inhalt der roten
Blutkörperchen) verändert wird.
Toxikologie (griech.), die Lehre von den Giften (s.
d.).
Toxoceras, s. Tintenschnecken.
Toxonose (griech.), durch Einwirkung von Giften
hervorgerufene Krankheit.
Toxteth Park, Wohnstadt im S. von Liverpool in Lancashire
(England), mit (1881) 10,368 Einw.
Tr., bei Alkoholometerangaben die Skala nach Tralles; bei
naturwissenschaftl. Namen Abkürzung für Friedr.
Treitschke, geb. 1776 zu Leipzig, gest. als Hoftheaterökonom
in Wien (Schmetterlinge).
Trab, Traben, s. Gangarten des Pferdes und Laufen;
über das Trabrennen s. d.
Trabakel, zweimastiges Fahrzeug mit luggerartiger
Takelung, an den österreichischen Küsten des Adriatischen
Meers im Gebrauch.
Trabanten (ital. trabanti, v. deutsch. traben, lat.
Satellites), dienende Begleiter, Leibwächter zu Fuß,
waren schon im Altertum, besonders aber im Mittelalter üblich
und dienten teils als Schutzwache fürstlicher Personen und
hoher Beamten, der Landsknechtobersten, teils als Vollstrecker
ihrer Befehle. Die Trabantengarden bildeten häufig den Stamm
der Haustruppen (s. d.) oder auch der Feldtruppen, wie in
Brandenburg. Aus den zwei Kompanien T. des Großen
Kurfürsten, welche 1675 bei Fehrbellin mitfochten, gingen 1692
die heutigen Gardes du Corps (s. d.) hervor. - In der Astronomie
ist Trabant s. v. w. Nebenplanet (s. d.).
Trabea (lat.), ein mit Purpurstreifen gesäumtes,
mantelartiges Obergewand aus altrömischer Zeit, welches auch
später noch das Amtskleid der Ritter und Augurn blieb. Die T.
ist mit der Toga praetexta (s. Tafel "Kostüme I", Fig. 6) in
Form und Bedeutung verwandt.
50*
788
Traben - Tracheen.
Traben, Marktflecken im preuß. Regierungsbezirk
Koblenz, Kreis Zell, an der Mosel, am Trabenberg und an der Linie
Reil-T. der Preußischen Staatsbahn, 97 m ü. M., hat
Obst- und vortrefflichen Weinbau, große Weinhandlungen und
(1885) 1704 meist evang. Einwohner. Gegenüber am rechten
Moseluser die Stadt Trarbach (s. d.).
Traber, Pferderassen, bei denen der Trab bis zur
größten Vollkommenheit ausgebildet ist. Die
berühmten russischen Orlowtraber werden auf den Gestüten
Chränowoi und Tschesmenka gezüchtet, doch liefert in
neuester Zeit auch Nordamerika ausgezeichnete T. Vgl.
Trabrennen.
Träber, s. Treber.
Traberkrankheit (Gnubberkrankheit, Wetzkrankheit,
Schruckigsein), langwierige, fieberlose Krankheit der Schafe, die
vorzugsweise zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr mit
gesteigerter Empfindlichkeit und Schwäche, endlich
Lähmung des Hinterteils ausfritt und meist unter
fortschreitender Abzehrung zum Tod führt. Die noch vielfach
rätselhafte Krankheit entwickelt sich unter wenig
auffälligen Erscheinungen: die Schafe zeigen dummen, stieren
Blick, scheues, furchtsames Wesen, Schüchternheit,
Schreckhaftigkeit beim Ergreifen und Festhalten (Schruckigsein) und
beginnende Muskelschwäche. Nach 4-8 Wochen tritt Schwäche
im Hinterteil hervor, die Tiere gehen schwankend, mit kurzen,
trippelnden, trabartigen Schritten (Traber), und allmählich
breitet sich die Schwäche auch auf die vordere
Körperhälfte aus. Meistens besteht dabei juckende
Emfindung der Haut, namentlich in der Kreuzbein- und Lendengegend,
welche die Tiere zu fast fortwährendem Scheuern und Nagen an
diesen Stellen veranlaßt (daher Gnubber- oder Wetzkrankheit).
Unter zunehmender Schwäche und Hinfälligkeit, die sich
bis zur völligen Lähmung des Hinterteils steigern
(Kreuzdrehen, Kreuzschlagen), tritt allgemeine Abmagerung ein, und
nach monatelanger Krankheitsdauer gehen die Tiere an
Erschöpfung zu Grunde. Genesungsfälle von der
ausgebildeten Krankheit kommen nicht vor. In den Kadavern findet
man nur am Rückenmark und an dessen Häuten höhere
Rötung, Erweichung, Schwund, Wassererguß, in manchen
Fällen jedoch gar nichts, woraus die Erscheinungen im Leben zu
erklären wären. Nachweislich ist in Deutschland die
Krankheit bereits vor Einführung der spanischen Schafe
beobachtet worden; aber erst seit Einführung der Zucht feiner
Schafe hat sie jene Verbreitung erlangt, in der sie
gegenwärtig den größern Schäfereien oft ganz
erhebliche Verluste bereitet. Die Krankheitsanlage wird
unzweifelhaft ererbt, kann aber auch durch organische Schwäche
des Nervensystems wie des gesamten Körperbaues bedingt sein,
daher die Krankheit in überfeinerten, verzärtelten Herden
häufig ist. Ebenso werden zu früher und zu starker
Gebrauch der Zuchttiere, namentlich der männlichen, angeklagt.
Ansteckend ist die T. nicht. Heilmittel sind bisher ohne Erfolg
angewendet worden, frühzeitiges Schlachten der Erkrankten ist
daher anzuraten. Die viel wichtigere Vorbauung gegen die aus einer
Herde nur schwer wieder zu beseitigende Krankheit beruht auf
Herstellung eines kräftigen und von erblicher Anlage freien
Stammes, daher auf Ausschließung der Tiere von der Zucht, die
aus traberkranken Familien abstammen oder bereits traberkranke
Nachkommen erzeugt haben, nicht zu früher Benutzung der Tiere
zur Zucht, Schonung der Böcke und rationeller
Ernährung.
Trabrennen, früher besonders in Holland
gebräuchliche Rennen, wo ein guter Stamm von Traberpferden (s.
Traber) existierte: mit diesen und mit dem Entstehen der Orlowrasse
übernahm Rußland die Pflege der T.; in neuerer Zeit ist
auch in Frankreich und Deutschland die Neigung für diesen
Sport rege geworden, indessen behauptet Amerika zur Zeit den ersten
Platz mit seinen Pferden (Hardtrabers) im T. Die bisher erreichte
größte Geschwindigkeit amerikanischer Traber, welche
entweder unter dem Sattel oder in zweiräderigen, ganz leichten
Wagen gehen, ist 2 Minuten 12 Sekunden für die englische
Meile. Als Regel gilt bei den T., daß Pferde, welche in
Galopp fallen, eine Volte (eine Kreiswendung) machen müssen.
Zu beachten bei den Zeitangaben für die Rennen ist, daß
die Amerikaner einen sogen. fliegenden Ablauf (Start) haben, d. h.
daß sie die Pferde schon im Trab befindlich ablaufen lassen,
während in andern Ländern die Pferde aus dem ruhigen
Stehen ablaufen; man rechnet 4 Sekunden als Differenz für
diesen verschiedenartigen Ablauf.
Trace (franz., spr. traß), eigentlich die Spur,
dann Absteckungslinie einer Verkehrslinie, z. B. einer
Straße, einer Eisenbahn oder eines Kanals. Man versteht unter
T. die Achse eines Verkehrswegs mit Einschluß aller seiner
Krümmungen, Steigungen und Gefälle, welche sich durch
einen Grundplan (Situationsplan) und einen Höhenplan
(Längenprofil) darstellen läßt. Beim Abstecken
läßt sich die T. zunächst nur auf der
Terrainoberfläche fixieren, hiernach aber auf Grund eines
Nivellements erst durch Auftrag und Abtrag des Bodens wirklich
herstellen. Die Operation des Aufsuchens und Absteckens nennt man
tracieren und unterscheidet die technische Tracierung von der
kommerziellen, je nachdem man nur die rein technische oder die rein
kommerzielle Seite der Aufgabe ins Auge faßt. Bei der erstern
handelt es sich um die bei übrigens gleicher Solidität
geringsten Baukosten, bei der letztern um die bei gleicher
Transportmenge geringsten Betriebskosten: Gesichtspunkte, welche
bei dem Aufsuchen der vorteilhaftesten T. stets gleichzeitig in
Betracht zu ziehen sind. Näheres hierüber s. unter
Eisenbahnbau. Tracieren, entwerfen, abstecken.
Tracee (franz. tracé, spr. traßé),
Abriß, Grundrißform (besonders einer Festung).
Trachea (lat.), Luftröhre.
Trachea, s. Eulen, S. 908.
Trachealrasseln, helles rasselndes Atemgeräusch bei
Ansammlung von viel Schleim in der Luftröhre und ihren ersten
Verzweigungen; kommt meist nur bei Sterbenden vor.
Tracheen (griech.), Luftröhren, die Atmungsorgane
der Tracheentiere, d. h. der Insekten, Spinnen etc. (s. unten). Die
T. (Fig. 1 u. 2) sind dünne Röhren, deren Wandungen aus
Zellen und einer von diesen abgeschiedenen Schicht eines
hornartigen Stoffes (Chitin, s. d.) bestehen. Letztere ist in den
feinsten Zweigen der T. glatt, in den gröbern aber mit
spiralig angeordneten Verdickungen versehen und hält so die T.
stets offen. Die T. beginnen in der Haut mit einer Öffnung,
dem Stigma oder Luftloch, hinter dem sich gewöhnlich ein
besonderer Verschlußapparat befindet, und verzweigen sich
dann in einer bei den einzelnen Tieren verschiedenen Art im Innern
des Körpers. Die allerfeinsten, auch bei starken
Vergrößerungen nur schwierig sichtbaren Zweige umspinnen
alle Organe und dringen in sie hinein, so daß die Atemluft
überall hingeleitet wird. Die Luftlöcher wechsele sehr an
Zahl, Größe und Form, doch befindet sich bei den
Insekten wenigstens in der Regel an fast jedem Lei-
789
Tracheentiere - Trachyte.
besring ein Paar. Manche Arten Insekten pumpen sich, bevor sie
fliegen, den Körper voll Luft (das "Zählen" des
Maikäfers) und haben darum an ihren T. noch bis zu mehreren
Hundert kleiner Ballons (Tracheenblasen). Übrigens fehlen in
einzelnen Fällen, namentlich an Larven von Wasserjungfern
etc.,
Fig. 1. Larve einer Eintagsfliege mit 7 Paar Tracheenkiemen
(Tk). - Fig. 2. Tracheensystem der Larve von Agrion
(Wasserjungfer). Tst Seitliche Tracheenlängsstämme, D
Darm, Tk. Tracheenkiemen.
die Stigmen vollständig, so daß das Tracheensystem zu
einem geschlossenen im Gegensatz zum offenen, d. h. mit Stigmen
versehenen, wird. Die Atmung geschieht in diesem Fall
gewöhnlich so, daß ein Teil der T. in besonders
dünnen Hautstellen, die über die
Körperoberfläche oder am Darm blattartig hervorragen,
angebracht ist; diese wirken, da die betreffenden Tiere in Wasser
oder feuchter Luft leben, wie Kiemen (sogen. Tracheenkiemen). Bei
den Spinnen sind die T. in eigentümlicher Weise angeordnet,
indem die dicht nebeneinander entspringenden zahlreichen Zweige
eines Astes wie die Blätter eines Buches abgeplattet
zusammenliegen (sogen. Tracheenlungen oder Fächertracheen).
Als Tracheentiere (Tracheata) bezeichnet man die mit T. versehenen
Arthropoden oder Gliederfüßler (s. d.). Es sind dies die
Insekten, Tausendfüße, Spinnen und Urtracheaten
(Protracheata). Letztere wurden früher wegen ihrer Gestalt zu
den Würmern gerechnet, bis man in neuester Zeit an ihnen die
T. auffand. Augenscheinlich vermitteln sie den Übergang
zwischen den schon lange als Tracheaten bekannten Insekten etc. und
den Ringelwürmern und sind daher für den Zoologen sehr
interessante Tiere. Zu ihnen gehört nur die Gattung Peripatus,
deren Arten in den Tropen an feuchten Orten leben. Wegen der
übrigen Tracheentiere s. die einzelnen Artikel über die
genannten Gruppen.- In der Pflanzenanatomie bezeichnet man mit dem
Namen T. die Gefäße (s. d., S. 1005).
Tracheentiere, s. Tracheen.
Tracheiden, in der Pflanzenanatomie
gefäßartige Zellen, welche sich von den Tracheen oder
echten Gefäßen nur durch ihr völliges
Geschlossensein unterscheiden; sie bilden den Hauptbestandteil des
Holzes bei Koniferen und Cykadeen sowie der
Gefäßbündel vieler Monokotylen und Farne.
Tracheitis (griech.), Luftröhrenkatarrh.
Trachenberg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Breslau, Kreis Militsch, an der Bartsch, Knotenpunkt der Linien
Berlin-Posen und T.-Herrnstadt der Preußischen Staatsbahn, 94
m ü. M., hat eine evangelische und eine kath. Kirche, eine
Synagoge, ein Amtsgericht, 2 Zuckerfabriken, eine
Dampfmahlmühle, Leinweberei und (1885) 3570 meist evang.
Einwohner. T. erhielt 1253 deutsches Stadtrecht. Dabei das
gleichnamige Schloß des Fürsten von Hatzfeld-T., in
welchem 12. Juli 1813 der von Knesebeck entworfene Kriegsplan von
König Friedrich Wilhelm III., Kaiser Alexander und dem
Kronprinzen von Schweden unterzeichnet ward.
Tracheobronchitis (griech.), Katarrh der Luftröhre
und der Bronchien.
Tracheoskopie (griech.), Untersuchung der Luftröhre
vermittelst des Kehlkopfspiegels.
Tracheostenose (griech.), Luftröhrenverengerung.
Tracheotomie (griech.), s. Luftröhrenschnitt.
Trachom (griech.), s. Ägyptische
Augenentzündung.
Tracht, s. Kostüm.
Tracht, in der Jägersprache die Gebärmutter des
Mutterwildes.
Trächtigkeit, s. Schwangerschaft, S. 685.
Trachydolerit, s. Andesite.
Trachyte (Trachytgesteine), gemengte kristallinische
Gesteine, gewöhnlich aus mehreren Feldspaten (vorwiegend
Sanidin), Hornblende, Augit, Glimmer zusammengesetzt, bald
quarzführend, bald quarzfrei. Es sind jungvulkanische Gesteine
mit hohem Gehalt an Silicium (60-80 Proz. SiO2), teils Laven jetzt
noch thätiger Vulkane, teils Eruptionsmaterial, welches
während der Diluvial- und Tertiärperiode geflossen ist.
Zu ihnen gehören neben den Trachyten im engern Sinn
Quarztrachyt, Domit und als glasartige Modifikationen
Trachytpechstein (s. d.), Obsidian(s. d.), Perlstein (s. d.) und
Bimsstein (s. d.). Die typischen Varietäten des Quarztrachyts
(Liparit, felsitischer Rhyolith, Trachytporphyr) besitzen
phorphyrische Struktur: in einer felsitischen Grundmasse, die sich
unter dem Mikroskop als aus Quarz, Sanidin, wenig Oligoklas und
Hornblende neben nicht individualisierter Glasmasse zusammengesetzt
zeigt, liegen Quarz-, Glimmer- und Hornblendekristalle. Die
Grundmasse ist weißlich, gelblich, hellgrau oder rötlich
gefärbt, mitunter rauh, zellig oder porös, die Wandung
der Hohlräume mit Quarzvarietäten überkleidet. Das
Gestein kommt an einigen Stellen des Siebengebirges, häufiger
in den Euganeen, auf Island, in Siebenbürgen vor, ist aber als
Lava jetzt thätiger Vulkane nicht bekannt. Domit ist eine
durch matte, sehr feinkörnige und wenig glasige Grundmasse
ausgezeichnete Varietät des Quarzporphyrs (Auvergne,
namentlich Puy de Dôme). Quarzfreier Trachyt besitzt
ebenfalls gewöhnlich porphyrische Struktur, und zwar sind es
meist die Sanidinkristalle (bis 8 cm groß), welche die
Porphyrstruktur
790
Trachytpechstein - Traduzianismus.
hervorrufen. Es gibt Trachyt, welcher fast nur aus Sanidin
(Sanidintrachyt, Sanidinit) mit wenig Hornblende, Glimmer und
Oligoklas besteht. Tritt der letztere Bestandteil, namentlich als
Einsprengling, mehr hervor, so unterscheidet man die Varietät
als Oligoklas-Sanidintrachyt. Andre Varietäten (Augittrachyte)
führen Augit. Die Grundmasse der T. besteht nach der
mikroskopischen Untersuchung aus denselben Mineralien, welche auch
mikroskopisch beobachtbar sind, dazu Glassubstanz, Magneteisen,
wohl auch Tridymit, der aber besonders häufig als Auskleidung
der Hohlräume auftritt. Quarzfreie T. kommen sowohl als Laven,
in historischen Zeiten geflossen, wie auch als solche älterer
Vulkane (Siebengebirge, Westerwald, Rhön, Monte Olibano bei
Neapel u. a. O.) vor. Hierher gehören auch die
Auswürflinge (Lesesteine) des Laacher Sees, die sich durch
ihren Reichtum an accessorischen Bestandteilen (Nephelin, Hauyn,
Nosean, Titanit, Olivin, Zirkon, Saphir, Spinell etc.) auszeichnen.
Als Trümmergesteine der T. treten Trachytkonglomerate,
Trachytbreccien und Trachyttuffe auf. Zu letztern zählen unter
andern die opalführenden Gesteine von Kaschau in Ungarn, die
Bimssteintuffe Ungarns und der Auvergne, der Traß (Duckstein)
vom Niederrhein, die Puzzolane und der Pausilipptuff von Neapel,
die Tosca von Teneriffa, sämtlich zur Herstellung von
hydraulischen Mörteln geeignet. Auch der Alaunstein (Alunit,
s. d.) ist ein Zersetzungsprodukt trachytischer Gesteine. Der
Verwitterung gegenüber verhalten sich die T. je nach
physikalischer Beschaffenheit und je nach der Natur der
Bestandteile äußerst verschiedenartig. Während die
glasigen Modifikationen den Atmosphärilien einen
hartnäckigen Widerstand entgegenstellen, sind die weniger
geschlossenen hinfälliger und zerfallen schließlich zu
einer vom Kaolin oft wenig verschiedenen Masse, gewöhnlich
noch mit Sanidinsplittern untermengt. T. dienen oft als
Baumaterialien, die quarzführenden und porösen als
Mühlsteine (Mühlsteinporphyr); die Tuffe werden zur
Herstellung hydraulischer Mörtel und zu feuerfesten Mauerungen
(Backofenstein) benutzt.
Trachytpechstein, Gestein, in mineralogischer und
chemischer Hinsicht mit Pechstetn (s. d.), der glasartigen
Modifikation des Porphyrs, identisch, genetisch aber nicht mit
Porphyr, sondern mit den jüngern (tertiären) Trachyten zu
vereinen. Die Pechsteine Ungarns, der Euganeen, der vulkanischen
Gebiete Frankreichs und Islands gehören hierher.
Tracieren (franz., spr. traßieren), s. Trace.
Tractus (lat.), Kanal, Gang, z. B. T. alimentarius,
Verdauungskanal.
Tractus cantus (lat., "gezogener", d. h. langsamer,
Gesang), der Gesang der römischen Kirche, welcher in der
Fastenzeit und bei andern Trauerfesten der Kirche im Choralgesang
an Stelle des (ursprünglich jubelnd vorgetragenen) Halleluja
tritt.
Trade (engl., spr. trehd), Handel, Gewerbe; Tradedollar,
Silberdollar (Handelsmünze); Trademark, Fabrikzeichen;
Tradesales, im englischen Buchhandel Versteigerung von
Auflageresten.
Traders (engl., spr. trehders, "Händler"), im brit.
Nordamerika Pelzhändler im Dienste der Hudsonbaikompanie,
zugleich untere Verwaltungsbeamte.
Tradescantia L., Gattung aus der Familie der
Kommelinaceen, krautartige Pflanzen, von denen T. guianensis Miq.,
aus Mittelamerika, mit langen, hängenden Zweigen,
eiförmigen, zugespitzten, stengelumfassenden Blättern und
selten erscheinenden, weißen Blüten als Ampelpflanze,
zur Bildung eines grünen Grundes in Terrarien,
Gewächshäusern und im Zimmer kultiviert wird und auch als
Vogelfutter benutzt werden kann. T. zebrina hort., der vorigen
ähnlich, aber mit braunen, weiß gestreiften
Blättern, ist etwas empfindlicher. T. discolor Sm., aus
Brasilien, mit dickem, aufrechtem Stengel, lanzettförmigen,
oben grünen, unten violetten Blättern und weißen
Blüten, gedeiht auch im Zimmer. T. virginica L., 60-80 cm
hoch, mit linienlanzettförmigen Blättern und
violettblauen Blüten in dichten Dolden, wird in Gärten
als Zierpflanze kultiviert.
Trades' Unions (engl., spr. trehds juhnjons), s.
Gewerkvereine.
Tradition (lat.), Überlieferung, Übergabe. In
der Rechtswissenschaft versteht man unter T. die Übertragung
des Besitzes an einer Sache seitens des bisherigen Besitzers
(Tradent) an einen andern. Soll durch die T. das Eigentum an der zu
übergebenden Sache auf den Empfänger übergehen, so
ist es nötig, daß dem Tradenten selbst das Eigentum
daran zusteht, da niemand mehr Recht auf einen andern
übertragen kann, als er selbst hat. Erfolgt die
Übertragung des Eigentumsbesitzes an den dermaligen Inhaber
(natürlichen Besitzer) der Sache, so spricht man von einer
Traditio brevimanu (s. Besitz). Bei Grundstücken sind an die
Stelle der T., welche nach älterm deutschen Rechte durch
symbolische Handlungen erfolgte (s. Effestukation), die
gerichtliche Auflassung (s. d.) und der Grundbuchseintrag
getreten.
T. bezeichnet ferner die der geschriebenen Geschichte
entgegengesetzte, nur durch die mündliche Überlieferung
auf die Nachwelt gelangende Kunde, insbesondere die jüdischen
und christlichen Satzungen und Lehren, die nicht in der Bibel
schriftlich fixiert sind, sich aber durch mündliche
Überlieferung in Synagoge und Synedrion (s. d.) oder in der
Kirche erhalten und fortgepflanzt haben. Die Sicherheit dieser T.,
deren sich die römisch-katholische Kirche nicht nur zur
Begründung von Lehren, geschichtlichen Thatsachen und
Gebräuchen, sondern auch zur Rechtfertigung der hergebrachten
Schriftauslegung bedient, weshalb eine dogmatische, rituelle,
historische und hermeneutische T. unterschieden wird, wurde von den
Reformatoren angefochten, welche höchstens die T. der ersten
christlichen Jahrhunderte beachtet, aber auch diese der Heiligen
Schrift untergeordnet wissen wollten. Dagegen setzte die
römisch-katholische Kirche auf dem Konzil von Trient die T.
ausdrücklich der Schrift als ebenbürtig an die Seite, und
Gleiches ist auch die Voraussetzung der griechischen Dogmatik,
während die protestantische Dogmatik der T. nur insofern eine
prinzipielle Bedeutung beilegen kann, als sie für ihre
Aussagen sich nicht bloß auf die in der Heiligen Schrift
unmittelbar bezeugte Glaubenserfahrung der ersten Generationen der
werdenden Christenheit zurückzubeziehen, sondern auch die
ganze Glaubenserfahrung der geschichtlich gewordenen Christenheit
kritisch in sich aufzunehmen und dabei besonders die grundlegende,
symbolbildende Epoche des Protestantismus selbst zu
berücksichtigen hat. Vgl. Weiß, Zur Geschichte der
jüdischen T. (Wien 1871-76); Holtzmann, Kanon und T.
(Ludwigsb. 1859).
Traditionell (franz.), durch Tradition (s. d.)
überkommen.
Traditor (lat.), Überlieferer, Auslieferer
(besonders der Heiligtümer bei den Christenverfolgungen unter
Diokletian); im Festungswesen der in den Kehlgraben vorspringende
Teil von Kehlreduits in Forts, zur Kehlbestreichung dienend.
Traduzianismus (lat.), die in der Dogmatik im
791
Traduzieren - Träger.
Gegensatz zum Kreatianismus (s. d.) auftretende Lehre, nach
welcher bei der Entstehung des menschlichen Lebens auch die Seele
nur als mittelbare göttliche Schöpfung in Betracht kommt.
So lehren nach dem Vorgang Tertullians und im Interesse an der
Erbsünde die Lutheraner, doch nicht in dem Sinn einer
Entstehung der Seelen aus physischer Zeugung (ex traduce), sondern
nur mittels derselben als Fortleitung des in Adam eingesenkten
Keims (per traducem).
Traduzieren (lat.), hinüberführen,
übersetzen.
Traëtto (jetzt Minturno), Stadt in der ital. Provinz
Caserta, Kreis Gaeta, nahe dem Garigliano, hat Reste eines
Aquädukts und eines Theaters (der antiken Stadt Minturnä,
s. d.) und (1881) 4394 Einw.
Trafalgar (sonst Junonis promontorium), Vorgebirge an der
Küste der span. Provinz Sevilla, am Atlantischen Meer, nahe
der Straße von Gibraltar, berühmt durch die Seeschlacht
21. Okt. 1805 zwischen der englischen Flotte unter Nelson und der
vereinigten französisch-spanischen unter Villeneuve und
Gravina. Letztere, mit 33 Linienschiffen vor Cadiz ankernd,
ließ sich von Nelson, der 27 Linienschiffe hatte, durch
scheinbaren Rückzug in das offene Meer locken und wurde dann
21. Okt. beim Kap T. angegriffen. Die drei Stunden lange Linie der
spanisch-französischen Flotte ordnete sich bei Annäherung
der in zwei Kolonnen geteilten englischen Schiffe in einen
Halbkreis, ward aber bald auf zwei Punkten durchbrochen. Es
entspann sich nun ein furchtbarer Kampf zwischen den hart
aneinander liegenden Schiffen, der nach drei Stunden zu gunsten der
Engländer entschieden war. Die spanisch-französische
Flotte verlor 19 Schiffe; Admiral Villeneuve ward gefangen, Gravina
starb an seinen Wunden. Es war dies Nelsons glorreichster und
letzter Sieg; er fiel durch die Kugel eines feindlichen
Scharfschützen, der ihn an seinen Orden erkannt hatte.
Trafik (v. ital. traffico), Handlung, Verschleiß,
insbesondere Detailhandel, in Österreich namentlich auf die
Tabaksverkaufsstellen angewendet.
Trafoi, kleine Alpenansiedelung (85 Einw.) in Tirol,
Bezirkshauptmannschaft Meran, in großartiger Landschaft am
Fuß der Ortlergruppe an der Straße über das
Stilfser Joch gelegen.
Tragaltar, s. Altar, S. 413.
Tragánt (Gummi Tragacanthae), aus dem Stamme
mehrerer vorderasiatischer Arten von Astragalus (s. d.) freiwillig
oder nach zufälligen oder absichtlichen Verletzungen
ausschwitzendes Gummi, bildet flache, gedrehte oder gekrümmte,
von verdickten, konzentrischen, halbkreisförmigen Striemen
durchzogene, farblose oder gefärbte Stücke. Er ist
hornartig, fast durchscheinend, zäh, geruchlos, schwillt im
Wasser stark auf, gibt gepulvert mit 20 Teilen Wasser einen derben
Schleim und besteht aus Bassorin, löslichem Gummi,
Stärkemehl und mineralischen Stoffen. Im Handel unterscheidet
man: Blätter- oder Smyrnaer T., aus großen, flachen,
platten oder bandförmigen Stücken mit
dachziegelförmig übereinander geschobenen Schichten
bestehend, als beste Sorte; Morea-T. (Vermicelli), in
unförmlichen, wulstigen oder nudelförmigen, gewundenen
oder gedrehten Stücken; syrischen oder persischen T., in
stalaktitenförmigen oder flachen, gewundenen oder gedrehten,
mitunter sehr großen Stücken. Man benutzt T. in der
Zeugdruckerei und Appretur, zu Wasserfarben, zu plastischen Massen,
als Bindemittel zu Konditorwaren und in der Medizin. Über das
dem T. sich anschließende Kuteragummi s. Cochlospermum. - T.
war bereits den Alten bekannt, ebenso den spätern Griechen und
den Arabern des frühen Mittelalters. In Deutschland wurde er
im 12. Jahrh. zu Arzneiformen benutzt, auch fand er bald technische
Verwendung.
Tragelaphos (Tragelaph, griech., "Bockshirsch"),
phantastisch gebildetes Tier, das den Griechen nur aus Abbildungen
auf Teppichen und andern Kunsterzeugnissen des Orients bekannt war
(Persien und Babylon) und nur auf hochaltertümlichen Vasen
nachgeahmt ist. Es war eine Hirschgestalt mit Bart und Zotteln am
Bug.
Traeger, Albert, Dichter, geb. 12. Juni 1830 zu Augsburg,
von wo sein Vater nach einigen Jahren nach Naumburg
übersiedelte, studierte 1848-51 in Halle und Leipzig Rechts-
und Staatswissenschaften und wurde 1862 Rechtsanwalt und Notar zu
Kölleda in Thüringen, von wo er 1875 in gleicher
Eigenschaft nach Nordhausen übersiedelte. T. ist seit 1871
zugleich Reichstagsabgeordneter und gehört als solcher der
deutschen freisinnigen Partei an. Als talentvoller Lyriker bewies
er sich in seinen "Gedichten" (Leipz. 1858, 16. vermehrte Auflage
1884). Außerdem veröffentliche er "1870", sechs
Zeitgedichte (Berl. 1870); die Novelle "Übergänge"
(Leipz. 1860); "Tannenreiser", Weihnachtsarabesken (Tropp. 1864);
"Die letzte Puppe" (Soloszene, Wien 1864); "Morgenstündchen
einer Soubrette", dramatisches Genrebild (mit Em. Pohl, Berl.
1879); ferner die illustrierten Sammelwerke: "Stimmen der Liebe"
(Leipz. 1861) und "Deutsche Lieder in Volkes Mund und Herz^ (das.
1864). Auch gab er 1865-83 das Jahrbuch "Deutsche Kunst in Bild und
Lied, Originalbeiträge deutscher Dichter, Maler und
Tonkünstler", heraus.
Träger, im Bauwesen wagerechter, zum Tragen von
Lasten bestimmter Bauteil aus Stein, Holz, Eisen oder Holz und
Eisen, welcher auf zwei (abgesetzter T.) oder mehreren
(fortgesetzter, kontinuierlicher T.) Stützen ruht oder an
einem Ende befestigt ist (Krag- oder Konsolträger). T. aus
Stein sind vierkantige, prismatische Balken, T. aus Holz entweder
einteilige und mehrteilige (verzahnte, Fig. 1 [S. 792],
verdübelte, Fig. 2) Balken mit rechteckigem Querschnitt, oder
aufgeschlitzte und gespreizte (Fig. 3, Lavessche, Fig. 4) Balken,
oder gegliederte, aus Fachwerk (Fachwerkträger, Fig. 5) oder
Netzwerk oder Gitterwerk (Netzwerkträger, Gitterträger)
bestehende Balken, während T. aus Eisen die mannigfaltigste
Ausbildung zeigen. Nach der Form derselben unterscheidet man
Dreieckträger (Fig. 8), Rechteck- (Parallel-) T. (Fig. 10 u.
11), Trapezträger (Fig. 9), Vieleck- (Polygonal-) T. und unter
den letztern Parabel- (Fig. 12), Halbparabel- (Fig. 13), Hyperbel-
und Ellipsenträger (Fischbauch- und Fischträger, Fig. 14
u. 15). Nach ihrer Zusammensetzung unterscheidet man wieder massive
(gewalzte und Blechträger) und gegliederte T. (Fachwerk- und
Netzwerkträger, Fig. 10 u. 11). Im Hochbau werden die T. zur
Unterstützung, vorzugsweise der Decken, und zwar als
hölzerne oder eiserne Unter- oder Oberzüge, ferner zur
Unterstützung von Balkonen, Galerien und Erkern als
Konsolträger, im Brückenbau zur Herstellung des
Überbaues als Hauptträger, Querträger,
Schwellenträger, Konsolträger verwandt, wo sie aus Eisen
und nur für vorübergehende Zwecke aus Holz oder aus Holz
und Eisen konstruiert werden. T., welche man gekuppelt, d. h. dicht
nebeneinander liegend, verwendet, nennt man, besonders wenn sie aus
Walzeisen bestehen, Zwillingsträger, während man die
Walzeisenträger selbst, je nachdem sie einen T- oder
I-förmigen Querschnitt besitzen, kurzerhand mit T-T. und I-T.
be-
792
Trägerrecht - Tragisch.
[Abbildungen mit Unterschriften]
zeichnet. Armierte T. sind hölzerne oder eiserne
Balken, welche zur Erhöhung ihrer Tragfähigkeit
künstlich, z. B. durch einfache Häng- oder Sprengwerke
(Fig. 6 u. 7), verstärkt werden. Vgl. die Artikel "Balken",
"Brücke", "Decke" und "Eisenbau".
Trägerrecht, s. Baurecht, S. 526.
Trägheit, im physikalischen Sinn s. v. w.
Beharrungsvermögen (s. d.); im psychologischen Sinn das aus
dem Unlustgefühl, welches durch die Vorstellung der Bewegung
hervorgerufen wird, entspringende Bestreben, in dem gegebenen
Ruhezustand zu beharren.
Trägheitsmoment, in der Mechanik diejenige ideale
Masse, welche, in der Entfernungseinheit von der Drehungsachse
eines rotierenden Körpers konzentriert gedacht, bei gleicher
Winkelgeschwindigkeit dieselbe lebendige Kraft (s. Kraft, S 132)
besitzt wie der rotierende Körper. Bezeichnet man die
Winkelgeschwindigkeit, d. h. die Geschwindigkeit in der Entfernung
1 von der Drehungsachse, mit w, so würde demnach das T. (T)
diejenige Größe sein, welche, mit ½ w²
multipliziert, die gesamte lebendige Kraft des rotierenden
Körpers ergibt. Diese letztere aber ist gleich der Summe der
lebendigen Kräfte aller seiner Massenteilchen. Sind m, m',
m''... solche einzelne Massenteilchen, welche bez. um r, r', r''...
von der Drehungsachse abstehen, so bewegen sich dieselben bez. mit
den Geschwindigkeiten rw, r'w, r''w... und besitzen die lebendigen
Kräfte ½ mr²w², ½ m'r'²w²,
½ m''r''²w²...; die gesamte lebendige Kraft des
rotierenden Körpers ist demnach =
½w²(mr²+m'r'²^+m''r''²+...), wenn die
eingeklammerte Summe über sämtliche Massenteilchen des
Körpers erstreckt gedacht wird. Mit dieser Summe, welche kurz
durch sum(mr²) ausgedrückt wird, muß also, wie man
sieht, ½w² multipliziert werden, um die lebendige Kraft
des rotierenden Körpers zu erhalten, d. h. diese Summe ist dem
T. gleich oder T = ^sum(mr²). Man findet demnach das T. eines
Körpers, indem man die Summe bildet aus den Produkten aller
Massenteilchen mit den Quadraten ihrer Abstände von der
Drehungsachse.
Tragikomisch (griech.), Verschmelzung des Tragischen mit
dem Komischen, gewöhnlich von Ereignissen gebraucht, die in
ihrer ganzen Entwickelung einen tragischen Ausgang erwarten
ließen, allein plötzlich eine Wendung zu einem komischen
Ende nehmen.
Tragikomödie (griech.), die dramatische Darstellung
einer tragikomischen Handlung; im weitern Sinn eine Tragödie,
welche, wie z. B. die alten spanischen und englischen
Tragödien, neben den tragischen auch komische Bestandteile
enthält.
Tragisch (griech.) heißt nach Aristoteles ein
Ereignis, welches zugleich Mitleid (mit dem von demselben
Betroffenen) und Furcht (für uns selbst) erweckt. Dasselbe
muß einerseits ein Leiden sein, weil dessen Anblick sonst
nicht selbst ein Leid wecken könnte; aber es darf kein
verdientes (nicht die gerechte Strafe eines wirklichen Verbrechens)
sein, denn ein solches bedauern wir zwar, aber bemitleiden es
nicht. Dasselbe muß anderseits furchtbar sein, weil wir es
sonst nicht (weder für andre, noch für uns)
fürchten, und es muß willkürlich (ohne
Rücksicht auf Schuld oder Unschuld) verhängt sein, weil
wir es sonst nicht für uns ebensogut wie für den
Schuldigen fürchten würden. Nur das mehr oder minder
unverdiente Leiden, sei es nun, daß das vermeintliche
Verbrechen eine Helden- oder Wohlthat, der rächende Gott oder
das launenhafte Fatum der eigentliche Verbrecher sei (der Feuerraub
des Prometheus, der dafür von dem neidischen und
fürchtenden Zeus an den Felsen geschmiedet wird), sei es,
daß der vermeintlich Schuldige nur halb schul-
793
Tragkraft - Tragopogon.
dig, die "himmlischen Mächte", welche "den Armen haben
schuldig werden lassen", die eigentlich Schuldigen seien
(Ödipus, den die tyrannischen Götter schon im Mutterleib
zum künftigen Vatermörder und Muttergemahl ausersehen
haben; Wallenstein, von dessen Schuld "unglückselige Gestirne"
die "größere Hälfte" tragen), ist wirklich t., das
gänzlich unverdiente (das Martyrium der Unschuld, die Passion
Christi) nicht t., sondern gräßlich. Das Tragische ruht
daher ebenso wie das Komische (s. d.) auf einem Kontrast
desjenigen, was wirklich geschieht (des Ungerechten im Tragischen,
des Ungereimten im Komischen), mit dem, was (nach der Forderung der
sittlichen Vernunft [der Gerechtigkeit] im Tragischen, des
Verstandes [der Klugheit] im Komischen) eigentlich geschehen
sollte, nur mit dem Unterschied, daß dasjenige, was wirklich
geschieht, im Tragischen ein Leiden, also schädlich, im
Komischen dagegen nur eine Thorheit, also unschädlich, ist. Da
nun der Eindruck des Tragischen, wie jener des Komischen,
wesentlich durch die Einsicht in obigen Kontrast entsteht, so
muß er, wie bei diesem, als gemischter ausfallen. Das
wirklich Geschehende, das unverdiente Leiden und der Untergang der
tragischen Person, der Sieg des Fatums oder der "neidischen"
Götter, ist ein Triumph der Ungerechtigkeit und bringt als
solcher das "zermalmende" Gefühl menschlicher Schwäche
und Ohnmacht dem "großen, gigantischen Schicksal"
gegenüber hervor. Die Verurteilung dessen, was wirklich
geschieht, durch den Richterspruch der Vernunft (in uns oder im
Helden), welche sich selbst durch den nahen und sichern Untergang
wie durch die Übermacht des feindlichen Schicksals in ihrer
Festigkeit nicht erschüttern und nicht dazu zwingen
läßt, das Unverdiente für verdient, den ungerechten
Gott als gerechten anzusehen, ist der Triumph der Gerechtigkeit und
erzeugt als solcher das "erhebende" Gefühl menschlicher Hoheit
und Überlegenheit gegenüber dem grausamen Schicksal,
welches "den Leib töten, aber die Seele nicht töten
kann". In ersterer Hinsicht ist der Eindruck des Tragischen (der
tragische Affekt) jenem des Grausamen (der blinden
Naturnotwendigkeit), welches Verzweiflung, in dieser jenem des
(nach Kant: moralisch) Erhabenen (der sittlichen Freiheit)
verwandt, welches Bewunderung erzeugt. Werden beide Seiten des
(tragischen) Kontrastes an verschiedene Personen verteilt, so
daß das (zermalmende) Gefühl des Unterliegens unter das
Schicksal in die tragische Person, das (erhebende) der
(moralischen) Erhabenheit des Menschen über dasselbe in den
Zuschauer verlegt wird, so entsteht das Naiv- oder
Objektiv-Tragische; werden beide dagegen in der (tragischen) Person
vereinigt, welche sodann, während sie (physisch) dem Schicksal
unterliegt, (moralisch) als tragischer "Held" dasselbe besiegt, so
entsteht das Bewußt- oder Subjektiv-Tragische. Jenes, bei
welchem die tragische Person sich leidend (passiv) verhält,
wirkt vorzugsweise ergreifend, dieses, bei welchem dieselbe,
wenigstens moralisch, thätig (aktiv) auftritt, vorzugsweise
erhebend. Die Eigentümlichkeit des erstern besteht darin,
daß der tragische Held dem Beschauer, die des letztern darin,
daß er sich selbst t. erscheint, Mitleid und Furcht nicht
bloß andern, sondern sich selbst (für sich)
einflößt. Iphigenia, Antigone, Thekla (im "Wallenstein")
beklagen ihr Geschick. Das Subjektiv-Tragische ist durch die
Gemütsstimmung des Helden, welche aus Mitleid mit sich, der
dem Schicksal unterliegt, und Hohn über den Gegner, der (nur
scheinbar) triumphiert, zusammengesetzt ist, dem Humor (s. d.) und
zwar, weil der (physische) Untergang unvermeidlich ist, dem
bösen Humor (Weltschmerz) verwandt und heißt um dieser
Verwandtschaft willen Humoristisch-Tragisches. Je nachdem in dem
Eindruck des Tragischen das "zermalmende" oder das "erhebende"
Element als das stärkere erscheint, wird das
Rührend-Tragische vom Pathetisch-Tragischen unterschieden.
Durch Kombination beider Einteilungen entstehen als Unterarten des
Rührend-Tragischen das Rührende, bei welchem das
mitleiderregende, und das Schreckliche, bei welchem das
furchterweckende Element des Ergreifenden überwiegt; als
Unterarten des Pathetisch-Tragischen das humoristische Pathos, bei
welchem die Klage über sein Schicksal, und der tragische
Humor, bei welchem der Hohn über dasselbe im Helden die
Oberhand gewinnt; jene machen uns weinen, diese "unter Thränen
lächeln". Die Auflösung des Tragischen erfolgt, wie die
des Komischen, durch die Aufhebung des Kontrastes, indem entweder
das (anscheinend) Ungerechte als gerecht (der anscheinend
Schuldlose oder nur halb Schuldige als wirklich Schuldiger)
erkannt, oder das vermeintlich durch blinden Willen oder
feindselige Absicht herbeigeführte Leiden als das Werk des
Zufalls oder eines mechanischen Naturprozesses (natürlicher
Tod) anerkannt wird, welche als völlig heterogen, mit der
Vernunft nicht vergleichbar, also auch nicht als Kontrast zu
derselben betrachtet werden können. Vgl. Bohtz, Die Idee des
Tragischen (Götting. 1836); R. Zimmermann, Über das
Tragische und die Tragödie (Wien 1856); Baumgart, Aristoteles,
Lessing und Goethe. Über das ethische und ästhetische
Prinzip der Tragödie (Leipz. 1877); Duboc, Die Tragik vom
Standpunkt des Optimismus (Hamb. 1885); Günther,
Grundzüge der tragischen Kunst, aus dem Drama der Griechen
entwickelt (Leipz. 1885).
Tragkraft, s. v. w. rückwirkende Festigkeit, s.
Festigkeit, S. 176.
Tragödie (griech., Trauerspiel), die dramatische
Darstellung einer tragischen, d. h. (nach Aristoteles) einer
ernsten, Mitleid für den Helden und Furcht für uns selbst
erweckenden Handlung (s. Tragisch). Dieselbe steht als Darstellung
eines tragischen Vorganges der Komödie (s. d.), als Drama mit
(für den Helden) unglücklichem Ausgang dem (gleichfalls
ernsten) Schauspiel gegenüber. Als Untergattung des Dramas (s.
d.) gilt von der T. alles, was von diesem als solchem gilt. Als
tragisches Drama entlehnt die T. ihre Gesetze und Einteilung vom
Tragischen. Da die "erhebende" Wirkung des Tragischen desto
stärker ausfällt, je mächtiger vorher dessen
"zermalmende" Wirkung gewesen ist, so geht das Streben der T. vor
allem dahin, das Leiden der Helden und die Gewalt des Schicksals so
schrecklich zu schildern, daß der Sieg über dasselbe
desto erhabener erscheint. Die Einteilung der T. erfolgt nach den
Gattungen des Tragischen in die rührende T., in welcher das
ergreifende, und in die pathetische T., in welcher das erhebende
Element des Tragischen vorherrscht, welche mit der in antike T., in
welcher das Schicksal die (physische) Übermacht über den
Helden, und moderne T., in welcher der Held die (moralische)
Übermacht über das Schicksal behauptet,
zusammenfällt. Über die Bedeutung des Wortes und die
Geschichte der T. s. Drama.
Tragopogon L. (Bocksbart, Haferwurzel), Gattung aus der
Familie der Kompositen, zwei- oder mehrjährige, kahle oder
flockig-wollige Kräuter mit abwechselnden,
lineallanzettlichen, ganzrandigen, zugespitzten, am Grund
scheidigen Blättern, einzeln endständigen
Blütenköpfen, gelben oder blauen Blüten und
längsrippigen, lang geschnäbelten Früchten mit
794
Tragus - Trajanswall.
mehrreihigem Pappus. Etwa 40 Arten in Europa, Nordafrika und
Asien. Die sechs deutschen Arten haben genießbare Wurzeln und
Blätter. T. porrifolius L., mit violetten Blüten, in
Südeuropa, schon den Griechen bekannt, wird als
Wurzelgemüse kultiviert.
Tragus (lat.), die vordere Ohrecke, welche mit der
gegenüberliegenden hintern (antitragus) vor der Öffnung
des äußern Gehörganges steht.
Tragzapfen, Zapfen, bei welchen der Druck
größtenteils in der Richtung rechtwinkelig gegen die
Achse derselben wirkt (vgl. Zapfen).
Traiguen (spr. traighen), Hauptstadt der Provinz Cautin
der südamerikan. Republik Chile, am gleichnamigen
Nebenfluß des Rio Cauto, mit 3000 Einw. Die Gründung
deutscher Kolonien in der Nähe ist beabsichtigt. Das
gleichnamige Departement hat (1885) 24,408 Einw.
Traille (franz., spr. traj), Fähre, fliegende
Brücke. Bisweilen fälschlich für Tralje (s. d.).
Train (franz., spr. träng), das Fuhrwesen der Heere,
welches diesen Bedürfnisse jeder Art nachzuführen hat, u.
zwar nennt man T. sowohl die einem Heer oder einer einzelnen Truppe
folgenden Fahrzeuge (T. eines Bataillons etc.) mit den
zugehörigen Leuten (Trainsoldaten) und Pferden als auch die
besondere Truppengattung. Hiernach unterscheidet man Verpflegungs-,
Sanitäts-, Administrations-, Feldbrücken- und
Belagerungstrains. Die beiden erstern, mit der Truppe in engster
Verbindung stehend, sind zur Erhaltung der Schlagfertigkeit
derselben von höchster Bedeutung, müssen daher eine
größere Bewegungsfähigkeit zur Anpassung an die
Operationen der kämpfenden Truppen besitzen und werden deshalb
auch von den Trainbataillonen als Truppenteile formiert. In
Deutschland hat jedes Trainbataillon (also pro Armeekorps) 5
Proviantkolonnen, 1 Feldbäckereikolonne, ein Pferdedepot, 3
Sanitätsdetachements und 5 Fuhrparkskolonnen bei der
Mobilmachung zu formieren, für welche das Material im Frieden
bei den Traindepots bereit gehalten und verwaltet wird. Die
Administrations-, Feldbrücken- und Belagerungstrains sind im
allgemeinen nur Transporttrains, erstere gehören zu den von
den Armeekorps beider Mobilmachung aufzustellenden Branchen und
zwar zu den Intendanturen, der Korpskriegskasse, dem Haupt-, 4
Feldproviantämtern, 12 Feldlazaretten, dem Feldpostamt, 4
Feldpostexpeditionen. Jedes mobile Pionierbataillon formiert ein
Korps- und 2 Divisionsbrückentrains. Außerdem werden von
den Pionieren die Pionier-, von der Fußartillerie die
Artilleriebelagerungstrains aufgestellt, letztern sind die
Munitions- Fuhrparkskolonnen beigegeben. Während der T. bei
den Römern, namentlich seit Cäsar, auf das beste
ausgerüstet und geschult wurde, blieb er in Deutschland,
dessen Heeresverfassung entsprechend, ein ungeheurer Troß von
Fahrzeugen (bei einem Heer von 20,000 Mann oft 8000-10,000),
geführt von nicht militärischen Troßknechten und
begleitet von zahllosen Dirnen, Troßbuben und Gesindel aller
Art. Der Große Kurfürst verbesserte zwar das
Armeefuhrwesen, doch blieb die militärische Organisation
desselben Friedrich d. Gr. vorbehalten, welcher auch die
Bezeichnung T. einführte. 1778 gehörten zu einer Armee
von 30,000 Mann 6 Proviantkolonnen, eine Feldbäckerei, ein
Feldlazarett, eine Feldapotheke und der T. für die Beamten.
Der T. als Friedensformation (ein Stamm) trat erst 1853 ins Leben,
welcher 1856 vergrößert und 1859 die Organisation
erhielt, welche die Grundlage der jetzigen bildet. Vgl.
Schäffer, Das deutsche Heerfuhrwesen (Berl. 1881); Derselbe,
Der Kriegstrain des deutschen Heers (das. 1883); Kiesling,
Geschichte der Organisation des Trains der königlich
preußischen Armee (das. 1889).
Trainieren (engl., spr. treh-), in die Länge ziehen,
abrichten, einüben; die Vorbereitung zu einer hervorragend
körperlichen Leistung, besonders bei Pferden Vorbereitung zum
Wettrennen (training), welche in besondern Anstalten
(Trainieranstalten) und von speziell für diese Kunst
ausgebildeten Leuten (Trainer) geleitet wird, beruht auf einer
methodischen Ausbildung der Muskelkraft bei sehr intensiver, aber
nicht fett machender Ernährung. Die Füllen werden schon
im Alter von 18-20 Monaten angeritten oder eingebrochen (break);
sie erhalten anfangs Belegung im Schritt und Trab, später im
langsamen und raschen Galopp, am besten unter Leitung eines
ältern Pferdes, des Führpferdes. Überflüssiges
Fett der Pferde sucht man, soweit dieses nicht durch die Arbeit
möglich ist, durch das Verabreichen von Abführpillen
(Physic) und durch Schwitzen unter Decken zu entfernen. Das Gewicht
des Reiters darf für junge Pferde nicht zu groß sein,
deshalb werden nur Knaben oder sehr leichte Männer zu Reitern
in den Trainierställen verwendet. Als Futter benutzt man Hafer
von möglichst schwerer Qualität mit Zusatz von
Bohnenschrot für Rennpferde und vermeidet möglichst
alles, was Volumen oder Fett erzeugt. Vgl. die Schriften von Digby
Collins (Lond. 1865), Hochwächter (3. Aufl., Neuw. 1867), v.
Heydebrand (2. Aufl., Leipz. 1882), Silberer und Ernst (Wien 1883)
und Graf Wrangel (Stuttg. 1889).
Traisen, rechter Nebenfluß der Donau in
Niederösterreich, berührt St. Pölten und mündet
unterhalb des Fleckens Traismauer; 80 km lang.
Trait (franz., spr. trä), Gesichts-,
Charakterzug.
Traité (franz., spr. träté), s. v. w.
Traktat (s. d.).
Traiteur (franz., spr. trätör), Speisewirt.
Trajanspforte, s. Roterturmpaß.
Trajanssäule (Columna Trajana), die dorische
Ehrensäule Trajans auf dessen Prachtforum in Rom, einer
Schöpfung des Architekten Apollodoros von Damaskus. Sie
befindet sich noch an ihrer ursprünglichen Stelle, zur Seite
der Reste der Basilica Ulpia, kolossaler, jetzt wieder
aufgerichteter Granitsäulen. Ihre Erbauung fällt in das
Jahr 113 n. Chr. Sie mißt mit dem 5 m hohen Postament 39 m;
der untere Durchmesser beträgt 4 m, der obere 3,3 m.
Zusammengesetzt ist sie aus 34 Blöcken weißen Marmors,
wovon 23 auf den Schaft kommen; dieser ist mit spiralförmig um
die Säule sich windenden Reliefs bedeckt, welche die
Feldzüge des Kaisers gegen die Dacier darstellen und 2500
menschliche Figuren von 60-75 cm Höhe enthalten. Das
vierseitige Piedestal, zugleich das Grabmal für die Aschenurne
des Kaisers, ist mit Trophäen geschmückt und trägt
die Weihinschrift. Die Stelle der kolossalen Statue des Kaisers
nimmt seit 1587 die des Apostels Petrus ein. Eine Schneckentreppe
von 184 in die Marmorblöcke eingehauenen Stufen führt im
Innern bis auf die Plattform. Vgl. Fröhner, La colonne Trajane
(Par. 1871-74, 220 Tafeln).
Trajanswall, eine von den Römern herrührende
Befestigungslinie in der Dobrudscha (Mösien), welche sich in
zwei-, auch dreifacher Wiederholung von der Donau zwischen Rassowa
und Tschernawoda 48 km östlich bis Constanza (s. d.) am
Schwarzen Meer erstreckt, aus einem 2,5-3 m, an manchen Stellen 5,8
m hohen Erdwall besteht und im Krieg von 1854 eine gewisseg
Bedeutung hatte.
795
Trajanus - Traktieren.
Trajanus, Marcus Ulpius T., nach der Adoption durch Nerva
in der Regel Nerva T. genannt, röm. Kaiser, geboren
wahrscheinlich 56 n. Chr. zu Italica (in der Nähe des heutigen
Sevilla) in Spanien, war 91 Konsul und kommandierte 97 die Legionen
am Niederrhein, als er von Nerva adoptiert und zum Mitregenten
erklärt wurde. Im J. 98 durch Nervas Tod zur Herrschaft
gelangt, war er während seiner ganzen Regierung
unablässig bemüht, die Wohlfahrt und den Glanz des Reichs
zu erhöhen. Wie groß seine Sorgfalt für die
Verwaltung des Reichs, seine Milde, seine Einsicht und seine
Gerechtigkeit waren, geht am deutlichsten aus dem Briefwechsel mit
dem jüngern Plinius hervor, als dieser 111-113 in besonderm
Auftrag die Verwaltung von Bithynien führte; nur den Christen
gegenüber, die er mit Strenge verfolgt wissen wollte, da er in
ihrer Ausbreitung eine Gefahr für das Reich sah, kann man
diese Milde vermissen. Zu seinen wohlthätigen Einrichtungen
gehören namentlich auch die Anstalten, die er in Rom und in
Italien für die Erziehung mittelloser Kinder durch die
Verwilligung reicher Mittel und die Bestellung geeigneter
Aufsichtsbehörden traf. Eine besondere Hervorhebung verdienen
unter seinen Friedenswerken noch die großartigen Bauten, die
auf seine Veranlassung ausgeführt wurden, namentlich der Bau
der Brücke, die 104 über die Donau unterhalb der
Stromschnellen derselben geschlagen wurde, die Herstellung eines
neuen nach ihm benannten Forums, die Errichtung der noch jetzt
vorhandenen, 39 m hohen, mit den Reliefs von Kriegsszenen aus den
dacischen Kriegen gezierten Trajanssäule, die Erweiterung des
Circus Maximus, der Bau eines Odeums, eines Gymnasiums in Rom und
viele andre Bauten. Seine friedliche Thätigkeit wurde zuerst
durch die beiden dacischen Kriege, 101-102 und 105-106,
unterbrochen, durch die der dacische König Decebalus
völlig besiegt und Dacien zur römischen Provinz gemacht
wurde. Hierauf unternahm T. 113 noch einen großen Feldzug
nach dem Osten, der hauptsächlich gegen die Parther gerichtet
war, und auf dem er Armenien und Mesopotamien zu römischen
Provinzen machte und über den Tigris bis nach Ktesiphon
vordrang. Während er aber im fernen Osten weilte, erhoben sich
in seinem Rücken mehrfache Aufstände, namentlich auch
unter den Juden in Ägypten und Kyrene, und ehe er dieselben
völlig unterdrücken konnte, wurde er 117 zu Selinus in
Kilikien vom Tod ereilt. Wie sehr seine Verdienste anerkannt
wurden, geht auch daraus hervor, daß ihm der Senat den
Beinamen des Besten (Optimus) beilegte und spätere Kaiser mit
dem Zuruf begrüßt wurden: "Sei glücklicher als
Augustus und besser als T." Vgl. Francke, Zur Geschichte Trajans
(2. Ausg., Quedlinb.1840); Dierauer, Beiträge zu einer
kritischen Geschichte Trajans (Leipz. 1868); de La Berge, Essai sur
le règne de Trajan (Par. 1877).
Rrajectum, lat. Name für Utrecht.
Trajekt (lat.), Überfahrt (von Ufer zu Ufer);
Trajektschiff, s. Dampfschiff, S. 485.
Trajektorie (neulat.), in der Geometrie eine ebene krumme
Linie, die alle einzelnen Kurven eines gegebenen Systems unter
demselben Winkel schneidet; so ist z. B. für alle Ellipsen,
welche dieselben Brennpunkte haben, eine beliebige Hyperbel mit
denselben Brennpunkten die orthogonale T., d. h. sie schneidet alle
diese Ellipsen rechtwinkelig. In der Mechanik ist T. die Bahn eines
unter dem Einfluß einer Kraft sich bewegenden Punktes, z. B.
die Bahn eines schräg in die Höhe geworfenen Körpers
(Wurflinie).
Trakasserie (franz.), Plackerei, Stänkerei.
Trakehnen, Dorf im preuß. Regierungsbezirk
Gumbinnen, Kreis Stallupönen, 5 km vom Bahnhof T. an der Linie
Seepothen-Eydtkuhnen der Preußischen Staatsbahn, hat ein
königliches Hauptgestüt (1732 von Friedrich Wilhelm I.
gegründet), zu dem 12 Vorwerke gehören, mit einem Areal
von 4151 Hektar und 1070-1250 Pferden, eine Ziegelei und (1885)
1837 Einw. Vgl. Frenzel, Über Landespferdezucht im
Regierungsbezirk Gumbinnen (Berl. 1875).
Trakehner, Pferdestamm, s. Pferd, S. 948.
Trakt (lat.), Zug, Ausdehnung in die Länge, z. B.
Eisenbahntrakt; Strecke Landes; katholischer Festgesang nach dem
Graduale, bestehend aus einigen Schriftversen ohne Hallelujah (so
genannt von der langsamen, gedehnten Sangweise, in der er
früher vorgetragen wurde).
Traktabel (lat.), fügsam; umgänglich.
Traktament (mittellat.), Behandlung, Behandlungsweise;
Bewirtung, Gastmahl; Löhnung, Sold.
Traktarianer, s. v. w. Puseyiten, s. Pusey.
Traktat (lat.), Unterhandlung wegen eines
abzuschließenden Vertrags; auch der Vertrag selbst; sodann
Abhandlung über einen Gegenstand, insbesondere Bezeichnung
für kleine im Sinn einer bestimmten religiösen Richtung
geschriebene Flugschriften (Traktätchen). Besondere
Traktatengesellschaften hat die sogen. Innere Mission (s. d.) ins
Leben gerufen.
Traktatshäfen (Vertragshäfen), die in China dem
Verkehr mit dem Ausland durch besondere Abmachungen geöffneten
Häfen. Bis 1842 war den Fremden nur Kanton und auch dies nur
unter Beschränkungen und ohne sichere Gewährleistung
geöffnet. Durch den am 29. Aug. 1842 abgeschlossenen Vertrag
wurden aber außer Kanton noch die Häfen Amoy, Futschou,
Ningpo und Schanghai dem britischen Handel geöffnet. Durch den
Friedensschluß von Tiëntsin (1860) und später kamen
Swatau, Taiwan, Takao, Tamsui, Kelung, Tschinkiang, Kiukiang,
Hankeou, Tschifu, Niutschuang, Tiëntsin, Kiungtschau,
Itschang, Wuhu, Wentschou und Pakhoi hinzu. Außer mit England
und Frankreich schloß China einen Vertrag mit Preußen
zu Tiëntsin 2. Sept. 1861, der für alle
Zollvereinsstaaten Gültigkeit hatte und mit der Gründung
des Deutschen Reichs auf dieses überging. Ähnliche
Verträge wurden 1862 mit Spanien, Portugal und Belgien, 1863
mit Dänemark geschlossen. Gegenwärtig stehen die oben
genannten T. allen Nationen offen. Der Handelsverkehr in denselben
bezifferte sich 1887 auf 190,3 Mill. Haikuan Tael (Einfuhr 104,4,
Ausfuhr 85,9 Mill. Haikuan Tael), wovon auf Schanghai allein nicht
weniger als 96,2 Mill. Haikuan Tael entfallen. Den Hauptanteil
(über zwei Drittel) vermitteln Großbritannien und
Hongkong. In diesen Häfen verkehrten 28,244 Schiffe von
21,755,760 Ton. (davon 23,262 Dampfer von 20,619,615 T.). Auf die
englische Flagge entfielen 14, auf die chinesische 5,4 Mill. T. In
den T. bestanden 1885: 396 fremde Firmen (233 englische, 57
deutsche, 27 amerikanische, 23 französische, 24 japanische, 15
russische etc.) und lebten 6698 Fremde (2534 Briten, 761
Amerikaner, 638 Deutsche, 443 Franzosen, 747 Japaner etc.). In den
Häfen von Niuts, Tiëntsin, Tschifu, Hankeou, Kiukiang,
Wuhu, Tschinkiang, Schanghai, Ningpo, Futschou, Tamsui, Amoy,
Swatau, Kanton und Pakhoi bestehen Zolldirektionen mit
Europäern als Vorständen, welche sämtlich dem
Generalzollinspektor (Sir Robert Hart) in Peking untersteht
sind.
Traktieren (lat.), behandeln; ein Gastmahl geben,
bewirten; auch s. v. w. unterhandeln.
796
Traktorie - Transbaikalien.
Traktorie (neulat., Zuglinie), eine ebene Kurve, bei
welcher alle Tangenten vom Berührungspunkt bis zum
Schnittpunkt mit einer gegebenen geraden oder krummen Linie, der
Direktrix, gleich lang sind. Die einfache T. mit geradliniger
Direktrix ist schon von Huygens ("Hugenii Opera varia", Teil 2,
Seite 617) untersucht worden.
Traktur (lat.), in der Orgel die innern Teile des
Regierwerkes, besonders der Abstrakten.
Tralee (spr. tralih), Hauptstadt der irischen Grafschaft
Kerry, an der Mündung des Lee in die Traleebai des
Atlantischen Ozeans und mit seinem Außenhafen Blennerville
durch einen Schiffskanal verbunden, hat ein Dominikanerseminar,
Fischerei (442 Boote), lebhaften Handel und (1881) 9910 Einw.
Tralje (holl.), Gitterstab an Fenstern.
Tralles, Johann Georg, Physiker, geb. 15. Okt. 1763 zu
Hamburg, studierte seit 1782 in Göttingen, ward 1785 Professor
der Mathematik und Physik zu Bern, 1810 Professor der Mathematik in
Berlin, starb 19. Nov. 1822 in London. Er erfand das nach ihm
benannte Alkoholometer (s. d.) und schrieb "Untersuchungen
über die spezifischen Gewichte der Mischungen aus Alkohol und
Wasser" (Leipz. 1812).
Trambahnen, s. v. w. Straßeneisenbahnen.
Trametes Fr., Pilzgattung aus der Unterordnung der
Hymenomyceten, von der Gattung Polyporus nur darin verschieden,
daß die Röhren keine von der Substanz des Huts
verschiedene Schicht bilden, sondern gleichfalls in dieselbe
eingesenkt sind, weil letztere zwischen die Röhren
hinabsteigt. Es sind holzbewohnende Schwämme mit stiellosem,
halbiertem Hute. T. pini Fr. (Kiefernschwamm), mit
polsterförmigen, 7-14 cm breiten, bis 11 cm dicken, sehr
harten, korkig-holzigen, schmutzig braunschwarzen, tief gefurchten,
meist dachziegelförmig übereinander wachsenden Hüten
mit rötlichgelben Röhren, wächst an
Kiefernstämmen und verursacht die Rotfäule und
Ringschäle der Kiefern. Letztere Krankheit zeigt sich an den
obern Stammteilen und stärkern Ästen und besteht darin,
daß das dunkler gefärbte Kernholz mürbe wird und
ringförmige Zonen von weißen Flecken bekommt, welche aus
dem Pilzmycelium bestehen, dessen Fäden die Holzzellen nach
und nach verzehren. Nur an alten Aststümpfen bildet der Pilz
die oft über 50 Jahre alt werdenden Fruchtkörper. Die
Infektion des Baums findet nur von abgebrochenen oder
abgesägten Ästen aus und erst bei 40-50jährigen
Bäumen statt, da der Pilz mit seinem Mycelium nur im Kernholz
wuchert.
Tramieren (franz.), anzetteln.
Tramin, Marktflecken in Südtirol,
Bezirkshauptmannschaft Bozen, am Abhang des Mendelgebirges, hat
eine alte Pfarrkirche, berühmten Weinbau und Weinhandel (von
hier stammt die Traminer Rebe), Seidenfilande und (1880) 1798
Einw.
Tramontane (ital.), jenseit der Berge, d. h. in Italien
von Norden her wehender Wind, Nordwind; auch s. v. w.
Polarstern.
Trampeltier, s. Kamel, S. 420.
Trampoline (it.), Schwungbrett für
Kunstspringer.
Tramrecht, s. Balkenrecht und Baurecht.
Tramseide (Trama), s. Seide, S. 825.
Tramway (engl., spr. -ueh), s.
Straßeneisenbahnen.
Tramwaylokomotive, s. Lokomotive, S. 890.
Trance (engl., spr. tränns), Verzückung,
Entrückung (bei den Spiritisten gebräuchlicher
Ausdruck).
Trancheekatze (Trancheekavalier), s. Kavalier.
Tranchcen (franz., spr. trangsch-), s.
Laufgräben.
Tranchen (franz., spr. trangschen), die "Schnitte" beim
Tranchieren von Fleisch und Fisch.
Tranchieren (franz., spr. trangsch-), zerschneiden,
besonders das Zerlegen der Fleischspeisen (Braten) in einzelne
Stücke mit dem Tranchiermesser und der zweizinkigen
Tranchiergabel, am besten auf einer hölzernen Platte. Vgl.
Grimod de la Reynière, Manuel des amphitryons (Par. 1808);
Bernardi, L'écuyer tranchant (das. 1845); Klein, Die
Tranchierkunst (2. Aufl., Hildburgh. 1886).
Trani, Stadt in der ital. Provinz Bari, Kreis Barletta,
am Adriatischen Meer und an der Eisenbahn Ancona-Brindisi, ist Sitz
eines Erzbistums, eines Appellhofs und eines Zivil- und
Korrektionstribunals, hat ein Gymnasium, eine technische Schule,
ein Seminar, eine schöne Kathedrale (aus dem Anfang des 12.
Jahrh., mit großer Unterkirche, einem fünfgeschossigen
normannischen Turm und bronzenen Thürflügeln von 1175),
alte Basteien, einen stark versandeten Hafen, bedeutenden Handel
mit Landesprodukten, starke Fischerei u. (1881) 25,173 Einw. T.
hatte im Mittelalter große Bedeutung als Handelsplatz nach
dem Orient, verlor dieselbe aber infolge Verschüttung des
Hafeneinganges durch die Venezianer.
Trankebar (Tarangambadi), kleine Hafenstadt der
britisch-ind. Präsidentschaft Madras, an der
Koromandelküste, mit (1881) 6189 Einw., ist jetzt ein
verfallener Platz, war aber unter dänischer Herrschaft
(1616-1845) Hauptort der dänischen Kolonien in Indien; 1845
wurde es für 20,000 Pfd. Sterl. an die Britisch-Ostindische
Kompanie verkauft. In T. wurde 1706 die erste protestantische
Mission in Indien angelegt, die noch heute besteht und eine Schule
und Druckerei besitzt; in letzterer werden Werke in Tamil gedruckt.
Die Europäer wohnen in dem alten dänischen Fort am
Strand.
Tranksteuer, s. v. w. Getränkesteuer (s. d.).
Tranquillität (lat.), Ruhe, Gelassenheit.
Tranquillo (ital., auch Tranquillamente), ruhig.
Trans (lat.), über, jenseit, kommt häufig in
Zusammensetzungen vor, bei geographischen Namen dem Cis
entgegengesetzt.
Transactions (engl., spr. tränsacksch'ns),
Abhandlungen, besonders Titel für die periodischen
Publikationen der gelehrten Gesellschaften in England.
Transaktion (lat.), Verhandlung; Unterhandlung zur
Beilegung von Streitigkeiten; Vergleich, Übereinkunft; auch
Handelsunternehmung.
Transalpinisch (lat.), jenseit der Alpen gelegen.
Transanimation (neulat.), Seelenwanderung.
Transatlantisch (lat.), jenseit des Atlantischen Meers
gelegen.
Transbaikalien, russ. Gebiet im Generalgouvernement
Ostsibirien, zwischen dem Baikalsee, China, der Amurprovinz und dem
Gebiet Jakutsk, 603,228 qkm (10,955 QM.) mit (1885) 530,896 Einw.,
zur Hälfte Russen und Sibiriaken, außerdem 122,000
Buräten, 5600 Tungusen, 2000 Polen, ferner Chinesen, Juden u.
a. Das Land ist vorwiegend gebirgig und wird vom Jablonowoigebirge
mitten durchzogen, im NW. breitet sich das große, unwirtliche
Witimplateau aus. Unter den zahlreichen Flüssen sind die
namhaftesten Selenga mit der Uda, Ingoda und Schilka, der Witim
bildet die Nordgrenze. Die mittlere Jahrestemperatur schwankt
zwischen -1,7° und +4° C., die Niederschläge zwischen
300 und 762 mm. Daher ist vielfach künstliche Bewässerung
zur Erzeugung von Pflanzenwuchs nötig, und dichter Wald
wechselt mit nackten Steppen. Der Ackerbau hat durch die
Förderung der Regierung neuerdings zugenommen, viel
bedeutender ist aber die Viehzucht; man zählt 400,000 Pferde,
½ Mill. Rinder, 1 Mill. Schafe, in der Steppe
797
Transcendent - Transfusion.
dient das Kamel als Lasttier. Fischerei, Bienenzucht und Jagd
(Hermelin, Zobel, Wiesel) liefern gute Erträge. Eine
große Bedeutung hat T. durch seinen großen
Mineralreichtum (1880: 2483 kg); Gold, dann Silber, Blei, Eisen,
Kupfer, Graphit, Zinn, Zink, Steinkohlen, Asphalt und Salz werden
gefunden, doch ist der frühere großartige Bergbau- und
Hüttenbetrieb in den letzten Jahren so gesunken, daß von
den ehemaligen sieben Hüttenwerken jetzt nur noch zwei
bestehen. Die Salzproduktion beträgt 204,000 kg im Jahr. Das
Land wird von dem Sibirischen Trakt durchzogen, hat gute
Poststraßen, und der Transithandel nach China, der
Amurprovinz, Nord- und Westsibirien ist ein bedeutender. Sitz der
Verwaltung ist Tschita, Mittelpunkt der Montanindustrie
Nertschiusk, andre nennenswerte Orte sind Kiachta und
Werchne-Udinsk. Vgl. Wenjukow, Die russisch-asiatischen Grenzlande
(deutsch, Leipz. 1874).
Transzendént und Transcendental (lat.),
wissenschaftltche Kunstausdrücke, die besonders in der
Mathematik und Philosophie gebräuchlich sind. In der
Mathematik heißt nach der von Leibniz eingeführten
Bezeichnung alles das transcendent, was über die Algebra
hinausgeht. Transcendente Operationen sind daher solche, welche
nicht zu den als algebraische bezeichneten gehören, z. B. die
Ermittelung des Logarithmus einer Zahl, einer trigonometrischen
Funktion zu einem Winkel; Logarithmen und trigonometrische
Funktionen heißen deshalb auch transzendente Funktionen. In
der Philosophie heißt transcendental nach der von Kant
eingeführten Terminologie alle Erkenntnis, die nicht sowohl
mit den Gegenständen selbst als vielmehr mit der Art ihrer
Erkenntnis sich beschäftigt; transcendent dagegen das, was die
durch die Natur des erkennenden Wesens gegebenen Grenzen der
Erkenntnis übersteigt und dadurch überschwenglich
wird.
Transcendénz (neulat.), im Gegensatz zur Immanenz,
welche ein Innewohnen in einem andern (z. B. Gottes in der Welt:
Pantheismus) bezeichnet, der Ausdruck des vollkommenen Außer-
oder Über einem andern Seins (z. B. des Seins Gottes
außer und über der Welt: Theismus).
Transeat (lat.), es gehe vorüber, weg damit;
substantivisch (das T.) s. v. w. Verwerfung (im Gegensatz zu
Placet, s. d.).
Transept (Transsept, lat.), in der Baukunst jeder Querbau
(z. B. das Kreuzschiff der großen mittelalterlichen Kirchen),
welcher die Längenausdehnung des Gebäudes unterbricht und
Querflügel bildet.
Transeúndo (lat.), im Vorübergehen.
Transeunt (lat., "übergehend") heißt eine
Wirksamkeit, durch welche das Wirksame über sich hinaus auf
ein andres übergeht, im Gegensatz zu immanenter Wirksamkeit,
bei welcher das Wirksame innerhalb seiner selbst auf sich selbst
als andres wirkt.
Transferieren (lat.), übersetzen (aus einer Sprache
in die andre); versetzen, verschieben; übertragen,
überschreiben (in der Geschäftssprache oft im Sinn von
cedieren gebraucht); Transferierung im Staatshaushalt s. v. w.
Virement (s. d.).
Transfert (lat.), die Übertragung von Nervenreizen,
Schmerzempfindungen, Lähmungen u. dgl. bei somnambulen und
hypnotisierten Personen von der einen Körperhälfte auf
die andre (s. auch Metallo-Therapie); im Börsenwesen (engl.
transfer) die Übertragung des Eigentums an Renten oder Stocks
(Consols) auf einen Dritten unter bestimmten Formen, in Paris in
das Livre des mutations, in London in das Transfer book.
Transfiguration (lat.), Verklärung, besonders
diejenige Christi auf dem Berg Tabor (Matth. 17), zu deren Andenken
die griechische und römische Kirche 6. Aug. ein besonderes
Fest feiern. Berühmt ist Raffaels Gemälde, welches die T.
Christi darstellt; andre Darstellungen lieferten Fiesole, Bellini,
Perugino und Holbein der ältere.
Transformationstheorie, s. Evolutionstheorie und
Deszendenztheorie.
Transformatoren (sekundäre Generatoren,
Sekundärinduktoren), Induktionsrollen zur Umwandlung
hochgespannter Wechselströme in solche von geringerer
Spannung, aber größerer Stromstärke, wobei durch
passende Wahl der Widerstandsverhältnisse und Windungszahlen
beider Spiralen die Spannung in den sekundären Kreisen dem
Bedürfnis angepaßt werden kann. Sie finden in der
elektrischen Beleuchtung Anwendung, um die Kosten der
Leitungsanlage zu verringern, da die hochgespannten Ströme des
primären Kreises auf verhältnismäßig
dünnen Drähten fortgeleitet werden können, und
ermöglichen die gleichzeitige Speisung von Bogen- und
Glühlampen aus derselben Stromquelle. Die T. von Gaulard u.
Gibbs bestehen aus einer großen Anzahl radial geschlitzter
dünner Kupferscheiben, welche durch isolierende
Zwischenschichten voneinander getrennt und an vorragenden
Ansätzen untereinander dergestalt in leitende Verbindung
gebracht sind, daß die Scheiben mit ungeraden Nummern eine
fortlaufende Spirale, die primäre Spule, bilden. während
die Scheiben mit geraden Nummern der sekundären Spirale zu
mehreren, in der Regel zu sechs, nebeneinander geschaltet werden
können. Die säulenförmig übereinander
geschichteten Scheiben sind in der Mitte mit einer
kreisförmigen Öffnung versehen und umgeben einen zur
Verstärkung der Induktionswirkung dienenden Eisenkern; bei den
neuern T. sind zwei Säulen mit in sich geschlossenem Eisenkern
zu einem Apparat vereinigt. Die T. von Zipernowsky u. Deri
enthalten die Kupfer- und Eisenmassen in umgekehrter Anordnung. Um
ein ringförmiges Bündel, in welchem die isolierten
Kupferdrähte der primären und sekundären Spirale
vereinigt sind, werden mit Baumwolle umsponnene oder mit einem
Lacküberzug versehene Eisendrähte in dichten Lagen so
gewickelt, daß keine Streuung der magnetischen Kraftlinien
eintreten kann und die schädliche Bildung Foucaultscher
Ströme vermieden wird. In den ähnlich konstruierten T.
von Westinghouse kommt ein flach gedrückter Doppelring von
isolierten Drähten zur Anwendung, der mit passend
ausgeschnittenen Scheiben von Eisenblech umgeben ist. Vgl.
Uppenborn, Geschichte der T. (Münch. 1888).
Transformieren (lat.), umbilden, umgestalten; einer
Funktion, einer Gleichung etc. eine andre Gestalt und Form geben,
ohne ihren Wert zu ändern; daher Transformation,
Umgestaltung.
Transfundieren (lat.), hinübergießen.
Transfusion (lat.), Überführung von frischem
lebensfähigen Blut eines gesunden Menschen in das
Gefäßsystem eines Kranken nach lebensgefährlichem
Blutverlust oder nach tiefgreifender Beeinträchtigung der
Lebensfähigkeit der Blutkörperchen, wie z. B. nach
Kohlenoxidvergiftung. Die T. wurde zuerst 1667 von Denis
ausgeführt, geriet aber bald in Mißkredit und wurde vom
Parlament und vom Papst verboten. Im zweiten und dritten Jahrzehnt
unsers Jahrhunderts führten sie Blundell, Dieffenbach und
Martin wieder in die Praxis ein, und später schufen ihr Panum
und Ponfick eine feste wissenschaftliche Basis. Danach
798
Transigieren - Translator.
handelt es sich darum, nur solches Blut anzuwenden, dessen
Blutkörperchen überhaupt lebensfähig sind, und
welches auch auf dem fremden Boden, auf den es verpflanzt wird,
gedeihen kann. Man darf deshalb bei Menschen nur Menschenblut, aber
niemals Tierblut benutzen. Man wendet die T. an nach schweren
Blutverlusten bei Entbindungen, Verletzungen, Operationen und bei
Kohlenoxidvergiftung. Hauptregel ist, die Einführung von
Fibringerinnseln und Luftblasen, die plötzlichen Tod
herbeiführen können, sorgfältig zu vermeiden. Zur
Ausführung der T. wird einem gesunden, kräftigen Menschen
ein Aderlaß von 200-250 g gemacht. Das in einem reinen Glas
aufgefangene Blut wird gequirlt oder mit einem Stäbchen
geschlagen, bis keine Abscheidungen mehr erfolgen, und darauf durch
saubere feine Leinwand filtriert, um die abgeschiedenen
Fibrinflocken zu entfernen. Durch das Quirlen, resp. Schlagen ist
das Blut auch von seiner Kohlensäure befreit und
sauerstoffreich gemacht worden. Es ist ziemlich gleichgültig,
ob man das Blut weiterhin auf 35° künstlich erwärmt
oder bei gewöhnlicher Temperatur stehen läßt.
Nunmehr wird bei dem Kranken eine Vene, gewöhnlich eine
oberflächliche Armvene, freigelegt und geöffnet. (Die
sogen. arterielle T. hat keine besondern Vorteile.) Im Fall einer
Kohlenoxidvergiftung muß dem Patienten vor der Einspritzung
des neuen Bluts ein adäquates Quantum eignen Bluts entzogen
werden, um einer schädlichen Überfüllung des
Gefäßsystems vorzubeugen. Handelt es sich um einen Fall
von Blutverlust, so erfolgt die Einspritzung sofort. Das neue Blut
wird in eine Spritze aufgesogen und, nachdem die etwa mit
eingedrungene Luft ausgetrieben, vermittelst einer in das
geöffnete Venenlumen eingeführten feinen Kanüle in
das Gefäß langsam und vorsichtig eingespritzt. Aveling,
Landois und Roussel haben Apparate angegeben, um das Blut direkt
aus der Vene des spendenden Individuums in die des Kranken
überzuleiten. Wird die T. rechtzeitig ausgeführt, und
gelingt sie, was immerhin von einer gewissen technischen
Gewandtheit abhängt, so hebt sich bei dem durch Blutverlust
lebensgefährlich geschwächten Kranken der Puls bald
wieder, die Leichenblässe des Gesichts schwindet, das
Bewußtsein kehrt wieder; der Kohlenoxydvergiftete erwacht
allmählich aus seinem tiefen Sopor, wird wieder
willkürlicher Thätigkeiten fähig und geht, wenn auch
oft langsam, der Genesung entgegen. Vgl. Gesellius, Die T. des
Blutes (Petersb. 1873); Landois, Die T. des Blutes (Leipz. 1875);
Berns, Beiträge zur Transfusionslehre (Freiburg 1874); Hasse,
Lammbluttransfusion beim Menschen (Petersb. 1874).
Transigieren (lat.), verhandeln, Vergleichsverhandlungen
pflegen; transigendo, auf dem Wege gütlichen Vergleichs;
transigibel, worüber verhandelt (transigiert) werden kann.
Transit (ital.), s. Durchfuhr.
Transition (lat.), Übergang, Übergehung;
transitiv, übergehend; Transitivum, s. Verbum.
Transitlager, s. Zollniederlagen.
Transitorisch (lat.), vorübergehend, nur für
eine Übergangszeit geltend; daher Transitorien, im Budget die
Posten, welche vorübergehend verwilligt sind und später
von selbst in Wegfall kommen.
Transitverbot, das Verbot der Durchfuhr fremder Waren
durch ein Land (f. Durchfuhr).
Transitwechsel, solche von einem fremden Land auf ein
drittes gezogene Wechsel, für welche das Inland nur zur
Vermittelung dient. Dieselben sind in Deutschland steuerfrei.
Transitzölle, s. v. w. Durchfuhrzölle (s.
Durchfuhr und Zölle).
Transkai, Dependenz des brit. Kaplandes an der
Südostküste zwischen dem Großen Kaifluß und
dem Bashee, 6565 qkm (119 QM.) groß mit (1885) 119,552 Einw.,
worunter nur 820 Weiße.
Transkaspisches Gebiet, Gebietsteil der russ.
Statthalterschaft Kaukasien, 1881 aus der transkaspischen
Militärsektion (die Kreise Manyschlak und Krassnowodsk) und
dem Gebiet der Tekke-Turkmenen gebildet, grenzt im W. an das
Kaspische Meer, im N. an das Gouvernement Uralsk, im O. an das
Chanat Chiwa, im S. an Afghanistan und Persien und hat einen Umfang
von 550,629 qkm (9990 QM.) mit (1885) 301,476 Einw. Die Küste
des Kaspischen Meers wird von zahlreichen Buchten zerschnitten. Im
N. bilden der Mertwyi-Kultukbusen und die Kaidakbai die Halbinseln
Busatschi und Manyschlak, dann folgen die Kinderkibucht, der
große Busen von Karabuges, die Balkan- und die Hassankulibai.
Das Land ist größtenteils Wüste und Steppe; den
nördlichen Teil nimmt die wasserlose, felsige Hochebene des
Ust-Urt, den großen südöstlichen die Sandwüste
Karakum ein. Die mittlere Temperatur des Sommers ist 29° C.,
während im Winter oft weite Strecken des Kaspischen Meers sich
mit Eis bedecken. Regen fällt nur ausnahmsweise, im Winter
herrschen in den Wüsten oft furchtbare Schneestürme. Der
Wassermangel ist groß; von Flüssen sind nur der einen
Teil der Südgrenze bildende Atrek zu nennen und im SO. der
Herirud und Murghab, die sich beide in der Karakumwüste
verlieren. Wo aber Wasser vorhanden ist, bringt der Boden reiche
Ernten an Baumwolle, Reis, Mais, Hirse, Melonen, Gurken, auch
Fruchtbäume (Kirschen, Granaten, Pfirsiche, Aprikosen) finden
sich an begünstigten Orten, Produkte aus dem Mineralreich sind
Salz, Erdöl (allein auf der Insel Tschalcken im Schwarzen Meer
gewinnt man 115,000 Pud jährlich), Schwefel, Steinkohlen. Als
Haustiere sind besonders hervorzuheben: das Kamel, das Pferd (von
bewundernswerter Leistungsfähigkeit und Genügsamkeit),
das Schaf; von wilden Tieren finden sich Tiger, Leoparden, wilde
Katzen, Füchse, Wölfe, Schakale, wilde Schweine, auf dem
Ust-Urt wilde Pferde, wilde Esel u. a. Die Bewohner, Turkmenen,
sind erst in den letzten Jahren durch die Russen unterworfen
worden. Dieselben setzten sich zuerst 1869 am östlichen Ufer
des Kaspischen Meers fest, indem sie an der Stelle eines
kosakischen Fischerdorfs die Militärstation Krassnowodsk
gründeten; 1871 nahmen sie Tschikisliar an der Mündung
des Atrek, gaben diese Niederlassung aber bald wieder auf; doch
machte Lazarew diesen Hafenplatz 1878 zum Ausgang seiner
unglücklichen Expedition. Skobelew nahm 1881 Gök-Tepe,
und damit kam das Tekke-Turkmenengebiet unter russische Herrschaft,
1884 unterwarf sich Merw freiwillig; durch Abkommen mit England
wurde die Grenze gegen Afghanistan geregelt. Die aus Anlaß
der Expedition gegen die Tekke-Turkmenen gebaute Transkaspische
Eisenbahn, welche von Michailow über Kisil Arwat, Askabad,
Merw nach Tschardschui führt, bietet den Russen eine
vortreffliche Operationsbasis für weiteres Vorgehen nach S.
Hauptort und Sitz der Verwaltung ist Askabad. Vgl. Heyfelder,
Transkaspien und seine Eisenbahn (Hannov. 1887).
Transkaukasien, Gebietsteil der russ. Statthalterschaft
Kaukasien (s. d.).
Transkolation (neulat.), Durchseihung.
Translation (lat.), Übertragung, Verlegung.
Translator, Übersetzer (insbesondere ein
vereideter
799
Transleithanien - Transmontan.
zur Übersetzung von Dokumenten etc.); translatorisch,
übertragend.
Transleithanien, s. Leitha.
Translozieren (lat.), an einen andern Ort versetzen;
Translokation, Versetzung.
Translunarisch (lat.), jenseit des Mondes.
Transmarin (neulat.), überseeisch.
Transmigration (lat.), Übersiedelung.
Transmission (lat.), Übersendung; im Erbrecht die
Übertragung einer angefallenen, aber von dem Erben noch nicht
angetretenen Erbschaft auf die Erben dieses Erben (successio in
delationem); in der Technik eine Vorrichtung zur Übertragung
von Kraft (Energie) von einem Motor auf eine Arbeitsmaschine oder
auch von einer Kraftquelle auf einen Motor. Kraft kann auf
verschiedene Weise und durch verschiedene Mittel übertragen
werden, von denen einige eine Kraftübertragung auf weite
Entfernungen gestatten während andre nur auf kurze
Entfernungen hin Kraft abzugeben geeignet sind. Folgende Arten der
T. sind in Gebrauch: 1) T. aus festen (starren oder biegsamen)
Körpern: a) Wellenleitungen (mit Riementrieben,
Hanfseiltrieben, Zahnrädern, Kurbeln, Exzentriks, Stangen
etc.) können zur Kraftübertragung auf große
Entfernungen nicht benutzt werden, weil die Kraftverluste durch
Reibung mit der Entfernung so stark wachsen, daß etwa auf
2000 m Entfernung die ganze eingeleitete Kraft durch Reibung
aufgezehrt wtrd, also die übertragene Kraft = 0 ist. Dagegen
sind sie zur Verteilung der Kraft der Motoren auf die einzelnen
Arbeitsmaschinen innerhalb der Fabriken u. Werkstätten fast
ausschließlich in Anwendung (T. im engern Sinn,
Fabriktransmission). b) Gestänge, d. h. lange, aus vielen
Teilen zusammengefügte Stangen, welche hin und her bewegt
werden, sind gleichfalls zur Fernleitung von Kraft nicht geeignet,
weil sie, vertikal verwendet, zu schwer werden und als horizontale
oder geneigte Gestänge vieler Unterstützungen durch
Rollen oder schwingende Stangen bedürfen, welche teils die
Anlage kompliziert machen, teils große Reibungsverluste
herbeiführen. Sie finden zur vertikalen Kraftübertragung
in Bergwerken als Pumpengestänge und Gestänge der sogen.
Fahrkünste Verwendung (in ältern Bergwerken sind auch
noch horizontale Gestange vorhanden). c) Der Drahtseiltrieb (s.
Seiltrieb) eignet sich sowohl zur T. innerhalb einer Fabrik als
auch zur Kraftübertragung in die Ferne (von einer
Kraftstätte nach verschiedenen Fabriken hin bis zu 10,000 m).
Seine Verwendbarkeit ist jedoch durch seine tief
herabhängenden Seiltrümmer in den Fällen
beschränkt, wenn diese entweder zu hohe und kostspielige
Pfeiler für die Leitrollen verlangen oder über belebte
Gegenden (besonders Städte) hinweggeführt werden
müßten. Mit den Seiltrieben nahe verwandt sind die
Seilbahnen und die Seilförderungen. d) Die Kettentransmission
kann auf mäßige Entfernungen, wie sie bei Berg- und
Hüttenwerken zum Materialtransport (horizontale und geneigte
Kettenförderungen) vorkommen, sehr gut verwendet werden. 2) T.
durch Flüssigkeiten (tropfbare oder luftförmige): a)
Druckwasser, wie es entweder durch natürliche Gefälle
oder durch Druckpumpen erzeugt und in Röhren bis zum
Verwendungsort geführt wird, bietet ein vorzügliches
Mittel zur Übertragung eines großen Druckes auf
bedeutende Entfernungen dar, welches in Verbindung mit einem
Akkumulator (s. d.) noch den besondern Vorzug hat, die Arbeit von
verhältnismäßig wenig leistungsfähigen Motoren
eine Zeitlang in solcher Menge aufspeichern zu können,
daß danach auf kurze Zeit sehr hohe Leistungen hervorgebracht
werden können. Hieraus erklärt sich die ausgebreitete
Verwendung der hydraulischen T. bei Bahnhofs-, Hafen-,
Speicheranlagen, Bessemerwerken etc. zum Betrieb von Aufzügen,
Kränen, Schiebebühnen etc. Auch in Bergwerken leistet die
hydraulische T. teils als hydraulische Gestänge für
Pumpen, teils zum Betrieb unterirdischer Maschinen (Pumpen,
Fördermaschinen, Bohrmaschinen) gute Dienste. b) Komprimierte
Luft ist als kraftübertragendes Mittel für weite
Entfernungen besonders da zu empfehlen, wo die Luft nach der
Arbeitsleistung noch eine weitere Verwendung zur Ventilation finden
kann, also besonders bei dem Bau von Tunnels und beim Bergbau zum
Betrieb von Gesteinsbohrmaschinen. Ein Nachteil der
Lufttransmission, welcher nicht unbedeutende Arbeitsverluste zur
Folge hat, ist der Umstand, daß die Expansionswirkung der
Luft in den Arbeitsmaschinen nur in beschränktem Maß
angewendet werden kann, weil sonst leicht Eisbildung störend
auftritt. c) Verdünnte Luft kann wegen ihres geringen
nutzbaren Druckes (etwa ¾ Atmosphäre) nur für
mäßige Leistungen und geringe Entfernungen zur
Verwendung kommen. Mit Vorteil wird sie bei kontinuierlichen
Eisenbahnbremsen gebraucht. d) Die Verwendung von gespanntem Dampf
zur Kraftübertragung ist in Fabrikanlagen, also auf
verhältnismäßig geringe Entfernungen, sehr
gebräuchlich, aber auch für weitere Entfernungen bis 1500
m anhängig, obwohl dabei ziemlich bedeutende
Kondensationsverluste auftreten. Außer bei unterirdischen
Bergwerksmaschinen werden lange Dampfleitungen in amerikanischen
Städten zur Kraftverteilung benutzt, in welch letzterm Fall
der Vorteil erreicht wird, daß der Dampf entweder direkt oder
nach der Wirkung in den Maschinen auch zu Heizzwecken Verwendung
finden kann. e) Leuchtgas ist bezüglich seiner Verwendung zur
Krafttransmission wegen seines hohen Preises als ein Notbehelf
anzusehen. Voraussichtlich wird jedoch in Zukunft durch billiges
Heizgas (Wassergas) ein vorteilhafter Ersatz geschaffen werden. 3)
Die Elektrizität erscheint als das Mittel, welches von allen
auf die weitesten Entfernungen Kraft übertragen kann. Dennoch
sind die Entfernungen auch bei ihr nicht unbegrenzt. Auch ist die
Elektrizität wegen der an den Maschinen auftretenden Funken
nicht überall verwendbar (z. B. in Bergwerken mit schlagenden
Wettern). Der Gesamtnutzeffekt der wichtigsten Transmissionsarten
beträgt nach Lauriol:
Länge der Transmission in Metern
Art der Transmission
Elektrizität Druckwasser Komprimierte Luft Drahtseil
Nutzeffekt
100 0,647 0,54 0,45 0,96
500 0,646 0,52 0,45 0,93
1000 0,642 0,51 0,45 0,90
5000 0,610 0,47 0,42 0,60
10000 0,570 0,39 0,38 0,36
20000 0,500 0,22 0,35 0,13
Die Kosten der T. sind im allgemeinen nicht anzugeben, da sie in
zu hohem Maß und in jedem einzelnen Fall von lokalen
Verhältnissen abhängig sind. Vgl. Meißner-Hartmann,
Die Kraftübertragung auf weite Entfernungen (Jena 1887);
"Anleitung zur Einrichtung von Triebwerken" (Braunschw. 1889).
Transmissionsriemen, s. Treibriemen.
Transmitter (engl., "übersender"), s. v. w.
Mikrophonsender.
Transmittieren (lat.), überschicken,
übertragen.
Transmontan (lat.), jenseit der Berge, besonders der
Alpen, daher s. v. w. ultramontan.
800
Transmutation - Transportschraube.
Transmutation (lat.), Umwandlung;
Transmutationshypothese, s. Deszendenztheorie.
Transmutieren (lat.), umwandeln; davon transmutabel,
veränderlich, umwandelbar.
Transoxanien, Land, s. Bochara, S. 97.
Transpadanische Republik, der von Bonaparte 1796 nach der
Schlacht bei Lodi (10. Mai) jenseit des Po (d. h. von Italien aus,
also nördlich desselben) aus der österreichischen
Lombardei nach dem Muster der französischen Republik
errichtete Freistaat, ward schon im Juli 1797 mit der
Cispadanischen Republik zur Cisalpinischen Republik (s. d.)
vereinigt.
Transparént (franz.), durchscheinend,
halbdurchsichtig; besonders von Gemälden, Sprüchen etc.
auf Papier oder feinem weißen Baumwollenzeug gebraucht, das,
mit Öl getränkt, mittels dahinter zweckmäßig
angebrachter Erleuchtung in hell glänzenden Farben
erscheint.
Transparénz (lat.), s. Durchsichtigkeit.
Transpiration (neulat.), s. v. w. Hautausdünstung;
transpirieren, schwitzen.
Transplantation (lat.), die Überpflanzung von
Geweben auf andre Körperstellen behufs Anheilung. Die T. wird
entweder bei unvollständiger oder bei vollständiger
Trennung vom Mutterboden ausgeführt. Im erstern Fall
vermittelt ein Stiel, welcher die Blutgefäße
enthält, die vorläufige Ernährung des losgetrennten
Gewebstücks, wie bei vielen "plastischen Operationen" (s. d.),
z. B. der künstlichen Nasenbildung. Im andern Fall heilen die
Teile auf einem geeigneten Boden ohne weiteres an und werden durch
Gefäße ernährt, welche sich von dem neuen
Mutterboden aus in dasselbe entwickeln. Es ist seit alters bekannt,
daß ein Hahnensporn sich auf einer wund gemachten Stelle des
Hahnenkammes anheilen läßt, und die Chirurgie hat von
dieser Erfahrung den Gebrauch gemacht, Hautstückchen oder
Haarwurzeln auf Wundflächen überzupflanzen, um diese
dadurch zum Überhäuten zu bringen. Das Verfahren findet
bei Unterschenkelgeschwüren ausgebreitete Anwendung. In
neuester Zeit ist sogar die T. ausgeschnittener Nervenstücke
an Tieren geglückt, ein Erfolg, dessen Verwertung für den
Menschen ausgezeichnete Aussichten für die Heilung mancher
Lähmungen eröffnet.
Nach dem Volksglauben werden auch menschliche Schwächen und
Krankheiten auf Tiere und Pflanzen übertragen. Die Juden
legten beim jährlichen Versöhnungsopfer alle Sünden
des Volkes auf einen "Sündenbock" und jagten denselben in die
Wüste. In ähnlicher Weise wurden die Teufel, welche die
Besessenheit erzeugten, auf Säue übertragen, und
ähnliche Zeremonien der Sünden- und
Krankheitsübertragung findet man noch heute in Sibirien,
China, Amerika etc. Bei den Totenfeierlichkeiten der Drawida legt
man die Sünden des Verstorbenen und seines ganzen Geschlechts
auf zwei Büffelkälber, die man ebenfalls in die
Wüste jagt. Im Mittelalter bildete sich die Lehre von der T.
zu einer besondern Heilmethode aus. Man legte kleine Tiere auf
Geschwülste u. dgl. und nahm Hunde ins Bett, damit sie den
"Krankheitsstoff" oder die als persönliches dämonisches
Wesen gedachte Krankheit an sich ziehen sollten. Besonders
üblich war aber die T. auf Pflanzen und Bäume. So glaubte
man Fieber und andre Krankheiten durch bestimmte Zeremonien in
hohle Bäume (Holunder) einsperren zu können, indem man
das zu diesem Zwecke gebohrte Loch nachher sorgfältig
zupflöckte. Auch konnte die Überweisung durch einen
bloßen Spruch geschehen, oder man knüpfte die Krankheit
in drei Knoten eines lebenden Weidenzweigs. Besonders üblich
war das Durchkriechen (s. d.) durch zu diesem Zweck gespaltene
Bäume oder durch die Wurzeln oder durch enge Spalten
megalithischer Denkmäler, in dem Glauben, daß dadurch
das Siechtum gleichsam von dem Baum etc. abgestreift und behalten
werde. Im übrigen kam es darauf an, daß die Pflanze,
welche die Krankheit übernommen hatte, lebenskräftig
blieb, weil sonst ein Rückschlag zu befürchten stand,
weshalb man vielfach die sehr zählebige Fetthenne (Sedum
Telephium) hierzu wählte. Der Kranke mußte sie mit einem
Spruch ausreißen und dann zwischen seinen Beinen wieder
einpflanzen.
Transponieren (lat.), an eine andre Stelle versetzen; in
der Mathematik: die Glieder einer Gleichung von der einen Seite mit
entgegengesetzten Zeichen auf die andre bringen; in der Musik: ein
Tonstück mit strenger Beibehaltung aller Tonverhältnisse
aus einer Tonart in eine andre übertragen.
Transponierende Instrumente, solche Blasinstrumente,
für welche diejenige Tonart als C dur (ohne Vorzeichen)
notiert wird, welche ihrer Naturskala (Obertonreihe) entspricht. T.
I. sind die Hörner, Trompeten und Klarinetten unsers
Orchesters. Auf einem Horn in D klingt der als c'' notierte Ton wie
d', auf einer B-Klarinette dasselbe c'' wie b'. Das Umstimmen
einzelner oder aller Saiten der Violine (meist um einen Halbton
nach oben), welches einige Violinvirtuosen angewendet haben (die
sogen. Scordatura), verwandelt die Violine ganz oder teilweise in
ein transponierendes Instrument.
Transpórt (lat.), die Fortschaffung,
Wegführung von Dingen von einem Ort zum andern; in der
Buchhaltung s. v. w. Übertrag (Vortrag) der Summe einer Seite
auf die andre.
Transportausweis, der amtlich ausgestellte Schein,
welcher Ausweis über auf dem Transport befindliche und einer
besondern Steuer- oder Zollkontrolle unterstellte Waren gibt (vgl.
Passierzettel).
Transporteur (franz., spr. -tör), ein mit
Gradeinteilung versehener (quadrierter) Viertel-, Halb- oder
Vollkreis von Metall, Papier, oft durchsichtig von Horn oder Glas,
zum Nachmessen und Ablesen oder Auftragen von Winkelgraden beim
geometrischen Zeichnen, auch Hilfsinstrument bei der
topographischen Aufnahme mit der Bussole; oft auch wohl mit einem
System von Linealen verbunden, durch deren Öffnung
gleichzeitig der am Gradbogen ablesbare Winkel graphisch auftragbar
gegeben wird.
Transporthäuser dienen in Österreich zum
vorübergehenden Aufenthalt für Mannschaften auf
Reisen von und zu ihren Truppenteilen. Die Garnison- und im Krieg
auch die Feldtransporthäuser stehen unter eigner Verwaltung,
während die Truppentransporthäuser von den betreffenden
Truppen verwaltet werden.
Transportpapier, s. Warenpapier.
Transportschiffe, Schiffe einer Kriegsmarine, welche
bestimmt sind, Truppen und Kriegsmaterial über See zu
transportieren. Seemächte mit vielen und wichtigen Kolonien
bedürfen derselben am meisten; gegebenen Falls werden
geeignete Handelsdampfer, die bereits in Friedenszeiten zu dem
Zweck designiert sind, als solche requiriert.
Transportschraube, in horizontaler oder wenig geneigter
Lage in einen Kasten eingeschlossene Schraube mit steilen
Schraubenflächen aus Eisen- oder Zinkblech, welche die Wand
des entsprechend geformten Kastens nahezu berühren. Der Kasten
besitzt an beiden Enden eine Öffnung, und die durch eine
Riemenscheibe in langsame Rotation versetzte Schraube
801
Transportsteuern - Trapa.
bewegt sich in der Richtung, daß das durch die eine
Öffnung eingeführte Material allmählich ans andre
Ende des Kastens befördert wird. Die T. wird namentlich in
Mühlen zum Transportieren von Getreide, Mehl und Grieß,
in Pulver- und Ölmühlen, Aufbereitungsanstalten etc.
angewandt, um das Material von einer Maschine zur andern zu
führen.
Transportsteuern (Transportverkehrsteuern), Abgaben,
welche in Gebührenform (Konzessionsgebühr,
Stempelabgaben, Tonnengelder etc.) als echte Gewerbesteuer (s. d.)
oder als Aufwandsteuer in Form von Zuschlägen zum
Transportpreis erhoben werden. Vgl. Eisenbahnsteuer.
Transportversicherung soll dem Versicherten Ersatz bieten
für den Verlust oder Schaden, welchen der versicherte
Gegenstand auf dem Transport erleidet. Man unterscheidet See-,
Fluß- (Strom-) und Landtransportversicherung. Die
Seetransportversicherung ist die wichtigste der drei und zugleich
diejenige Versicherungsart, welche zuerst rationeller ausgebildet
und (in Italien bereits im 14. Jahrh.) gesetzlich geregelt worden
ist. Auch die neuere Gesetzgebung, so das deutsche
Handelsgesetzbuch (Artikel 782-905), wandte ihr eine eingehende
Aufmerksamkeit zu. Die Seeversicherung hat vorzüglich deswegen
mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, weil bei
vorkommenden Unfällen ein Nachweis der Verschuldung schwer
oder überhaupt nicht zu erbringen ist und die Gefahr, nach
welcher die Prämie sich zu richten hat, nicht allein von
Naturereignissen und von der Route, sondern auch von der Ladung
(Art, Menge), Bemannung (Zahl, Brauchbarkeit), von der
Seetüchtigkeit der Schiffe etc. abhängig ist. Über
die letztern werden unter andern vom Germanischen Lloyd in Hamburg,
vom Büreau Veritas in Paris eigne Register (Lloydregister)
geführt. Die meisten Gesellschaften, welche die
Seetransportversicherung betreiben, befassen sich
ausschließlich mit diesem Versicherungszweig und haben
naturgemäß ihren Sitz in den großen
Seeplätzen; in Hamburg, wo allein 14 Gesellschaften mit einer
Anzahl Einzelversicherer und auswärtiger Anstalten einen
Versicherungsbestand von etwa 2000 Mill. Mk. haben, Bremen,
Stettin, Danzig etc. befindet sich eine große Anzahl
derartiger Institute. Es gibt indes auch
Transportversicherungsanstalten, welche neben der Seeversicherung
noch andre Zweige der T., und ebenso allgemeine
Transportversicherungsgesellschaften, welche auch andre Zweige der
Versicherung, namentlich die Feuerversicherung, betreiben.
Allgemeine deutsche Transportgesellschaften gibt es in Deutschland
über 30; von ihnen sind der Rheinisch-Westfälische Lloyd,
die Vaterländische, die Transatlantische, die Dresdener
Allgemeine, die Düsseldorfer Allgemeine, die Berliner
Deutsche, der Deutsche Lloyd, die Niederrheinische und die
Aachen-Leipziger die bedeutendsten. An der Ostseeküste haben
sich viele Vereine (Kompakten) zu gegenseitiger Versicherung der
Schiffe auf Küstenfahrten gebildet (vgl. Seeversicherung). Der
Seeversicherung wird gewöhnlich die Versicherung von
Transportmitteln, Güter- und Wertsendungen auf dem Transport
zu Land (auf der Achse, Eisenbahn) und auf Flüssen als T. im
engern Sinn gegenübergestellt. Eine hohe Bedeutung hat heute
die Eisenbahnversicherung gewonnen. Eine besondere Art derselben
ist die Lieferfristversicherung, d. h. die Versicherung
rechtzeitiger Ankunft aufgegebener Güter am Ablieferungsort
(vgl. Lieferungszeit). Der Umstand, daß die Post für
Verlust deklarierter Wertsendungen nicht immer genügenden
Ersatz leistet, gab Veranlassung zur Entstehung der Valoren-
(Wert-) Versicherung, d. h. der Versicherung von Geld- und
sonstigen Wertsendungen gegen die Gefahren des Transports. Dieselbe
ist nur zulässig bis zur Höhe des Wertes der Sendung. Sie
erfolgt oft auf Grund einer ausgestellten Generalpolice, indem
jeweilig der Versicherungsgesellschaft über aufgegebene
Sendungen Mitteilung gemacht wird. Auch die deutschen Postanstalten
erheben für solche deklarierte Sendungen Portozuschläge,
welche sie als Versicherungsgebühren bezeichnen; doch ist
dieser Ausdruck nur insoweit zutreffend, als die Post etwa
über ihre allgemeine Haftpflicht als einer Transportanstalt
hinausgehende Haftverbindlichkeiten gegen eine dann ungenau
"Gebühr" genannte Prämie erhebt.
Transposition (lat.), Versetzung, Umsetzung (vgl.
Transponieren).
Transrhenanisch (lat.), jenseit des Rheins.
Transsept, s. Transept.
Transkribieren (lat.), schreibend übertragen,
umschreiben. Transskription, Umschreibung; in der Musik im
Unterschied von Arrangement (s. d.) Übertragung eines
Tonstücks, z. B. eines Gesangstücks, auf Klavier oder ein
andres Instrument, meist mit ausschmückenden Zuthaten oder
sonstigen durch die Natur des gewählten Instruments bedingten
Veränderungen versehen.
Transskriptionsbücher, s. Grundbücher.
Transsubstantiation (neulat., griech. Metusiosis),
scholast. Kunstausdruck für die kraft der Konsekration (s. d.)
bewirkte Verwandlung der Substanz des Brotes und Weines in die
Substanz des Leibes und Blutes Christi, welche den Kern der
römisch- wie griechisch-katholischen Lehre vom Abendmahl (s.
d.) im Gegensatz zu den protestantischen Konfessionen bildet.
Transsudate (lat.), s. Absonderung (3), S. 60.
Transsylvania, s. Siebenbürgen, S. 943.
Transsylvanische Allpen, s. Karpathen,S. 558.
Transvaal, s. Südafrikanische Republik.
Transversale (lat.), im allgemeinen s. v. w.
Schnittlinie, auch Schnittfläche (s. Durchschnitt).
Trap, Jens Peter, dän. Historiker und Statistiker,
geb. 19. Sept. 1810 zu Randers, wurde, nachdem er in Kopenhagen
Rechtswissenschaft studiert und nebenbei den schönen
Wissenschaften obgelegen, 1834 im Kabinettssekretariat angestellt,
1851 Chef desselben und Kabinettssekretär bei Friedrich VII.,
welchen Posten er auch seit der Thronbesteigung Christians IX.
innehatte. 1859 wurde er zum Geheimen Etatsrat und später zum
Ordenssekretär ernannt. Er starb 21. Jan. 1885. Seit 1842 gab
er das dänische Staatshandbuch ("Konglik dansk Hof-og
Statskalender") heraus, das er zu einem Musterbuch in seiner Art
gestaltete. Sein Hauptwerk ist die "Statistisk-topographisk
Beskrivelse af Kongeriget Danmark" (2. Aufl., Kopenhagen 1870-80, 6
Bde.), aus welcher der Teil über Kopenhagen auch besonders
erschienen ist (1880).
Trapa L. (Wassernuß), Gattung aus der Familie der
Onagraceen, einjährige, schwimmende Wasserpflanzen, deren
untergetauchte Blätter gegenständig, linealisch,
hinfällig sind, während die schwimmenden eine Rosette
bilden, in der Mitte aufgeblasene Blattstiele und eine lederige,
rhombische, ungleich buchtig gezahnte Spreite besitzen. Die
Blüten stehen einzeln achselständig, und die bleibenden
Kelchblätter wachsen zu dornartigen Hörnern an der
einsamigen, am bleibenden Diskus gekrönten Nuß aus. T.
natans L. (Wasserkastanie, Jesuitennuß), in Seen und Teichen
durch ganz Europa und Asien, doch überall selten, hat
weiße Blüten und eine vierstachlige Frucht
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl., XV. Bd.
51
802
Trapani - Trapp.
von der Größe einer Haselnuß, deren Kern roh
und gekocht gegessen, auch zu Brot verbacken und als Schweinefutter
benutzt wird, weshalb man die Pflanze hier und da kultiviert. Man
benutzt die Früchte auch zu Halsketten etc. T. bicornis L.,
wird in China gegefsen, T. bispinosa Roxb. in Indien, beide werden
kultiviert. Vgl. Jäggi, Die Wassernuß und der Tribulus
der Alten (Zürich 1883).
Trapani, ital. Provinz auf der Insel Sizilien, den
äußersten Westen derselben umfassend, 3145, nach
Strelbitsky nur 2408 qkm (43,73 QM.) groß mit (1881) 283,977
Einw. Sie besteht aus der westlichen, allmählich zur Ebene
zwischen Trapani und Marsala hinabsinkenden Abdachung Siziliens und
hat nur im NO. höhere Berge (Monte Sparagio 1109 m). Der Fiume
San Bartolommeo zum Golf von Castellammare, der Belice, der
Fluß von Mazzara und der Birgi sind die namhaftesten
Wasserläufe. Weizen (1887: 663,009 hl) und Wein (1,044,741
hl), dann Oliven (44,887 hl Öl) und Sumach sind die
Haupterzeugnisse des Pflanzenreichs, Korallen und Thunfische des
Tierreichs, Seesalz an der ganzen Westküste entlang die des
Mineralreichs. Die Korallen- und Alabasterverarbeitung in T. ist
sehr zurückgegangen, wogegen sich Weinproduktion, Handel und
Schifffahrt stetig entwickeln. Die Provinz zerfällt in die
Kreise Alcamo, Mazzara del Vallo und T. - Die gleichnamige
Hauptstadt (das antike Drepanon) liegt, von Mauern und
Festungswerken umgeben, an der Westküste auf einer weit
vorspringenden Landzunge, am Fuß des Monte Giuliano (Eryx),
von welchem eine Wasserleitung herführt, am Endpunkt der
Eisenbahn Palermo-T., hat mehrere mittelalterliche Paläste,
viele Kirchen (mit guten Gemälden), einen vortrefflichen
Hafen, ein Lyceum, Gymnasium, Seminar, eine technische Schule,
nautische Vorbereitungsschule, Gemäldegalerie, ein Theater,
Schiffbau und (1881) 32,020 Einw. Im Hafen von T., der durch ein
Kastell geschützt und mit einem Leuchtturm versehen ist,
liefen 1886: 2325 Schiffe mit 224,626 Ton. ein. Zum großen
Fischfang und zur Schwammfischerei sind 99 Schiffe mit 1066 T.
ausgelaufen. Die Wareneinfuhr belief sich auf 43,950, die Ausfuhr
(hauptsächlich Seesalz, dann Wein und Mehl) auf 175,421 T. Mit
Palermo steht T. in regelmäßiger Dampferverbindung. T.
ist Sitz des Präfekten und eines Bischofs, eines Zivil- und
Korrektions- sowie eines Handelstribunals, einer Filiale der
Nationalbank und mehrerer Konsuln (darunter auch eines
deutschen).
Trapez (griech.), ebenes Viereck mit zwei parallelen
Seiten (a und b in nebenstehender Figur) und zwei nicht parallelen
(c und d); sind letztere gleich lang, so ist das T. symmetrisch.
Die Fläche des Trapezes ist gleich der halben Summe der
parallelen Seiten, multipliziert mit ihrem senkrechten Abstand oder
der Höhe h ^[...]; auch findet man sie durch die Formel
^[...]. T. ist auch s. v. w. Schaukel- oder Schwebereck (s. Reck).
Trapezoid, ebenes Viereck ohne parallele Seiten.
Trapezius musculus (lat.), Mönchskappenmuskel im Nacken und
obern Teil des Rückens.
Trapezkapitäl, das im byzantin. Stil und häufig
im deutschen Backsteinbau der spätromanischen Zeit vorkommende
Kapitäl, welches aus Kegelabschnitten zwischen
trapezförmigen (bisweilen dreieckigen) Seitenflächen
besteht (vgl. nebenstehende Abbildung).
Trapezoëder, s. v. w. Ikositetraeder imen gern Sinn,
s. d. und unter Kristall, S. 230.
Trapezoidalkörper, s. v. w. Prismatoid (s. d.).
Trapezúnt (in der Linguafranca Trebisonda,
türk. Tarabzon), befestigte Hauptstadt des gleichnamigen
türk. Wilajets in Kleinasien, zwischen Bergen am Schwarzen
Meer gelegen, ist wegen der vielen Gärten von bedeutendem
Umfang, hat enge, unreinliche Straßen, 22 griech. Kirchen, an
40 Moscheen und Schulen, ansehnliche Bazare, ein altes verfallenes
Schloß, Woll-, Seiden- u. Leinweberei, Gerberei,
Färberei, eine Schiffswerfte, Fischerei und 40-50,000 Einw.
(Türken, Armenier, Griechen, Perser und einige Europäer).
T. ist Sitz eines griechischen Bischofs und infolge seiner
günstigen Lage ein Hauptstapel- und Speditionsplatz des
Handels zwischen Europa und Vorderasien, dessen Gesamtbetrag auf
jährlich 50 Mill. Mk. angegeben wird, trotzdem er durch die
Vernachlässigung der Straßen im Innern, die
türkischen Zollplackereien und die Bahn Poti-Tiflis neuerdings
sehr gelitten hat. Der Import aus England allein beläuft sich
aus durchschnittlich 16 Mill. Mk. jährlich.
Regelmäßige Dampfschiffahrt verbindet die Stadt mit
Konstantinopel, den Donaumündungen und einigen
Mittelmeerhäfen, während der Verkehr mit Erzerum, Tebriz
und Syrien durch Karawanen vermittelt wird. - Das Wilajet T.,
welches früher die ganze Küstenlandschaft am Schwarzen
Meer von der Mündung des Kisil Irmak bis über Batum
hinaus umfaßte, hat neuerlich bedeutend an Umfang verloren,
indem im O. etwa ein Drittel des frühern Sandschaks Batum mit
dieser Stadt selbst 1878 an Rußland abgetreten werden
mußte und Ende Dezember 1878 die Kazas Scheiran, Kelkit
Ispir, Tortum und Keskem zum "Sandschak Baiburt" vereinigt und zum
Wilajet Erzerum geschlagen wurden. Gegenwärtig ist das Wilajet
nur ein ca. 520 km langer Küstenstreif mit einem Areal von ca.
32,000 qkm und 1,100,000 Einw. - T. (Trapezus), eine griechische,
um 700 v. Chr. von Milesiern aus Sinope angelegte Pflanzstadt,
erhielt, wiewohl schon im Altertum ein nicht unbedeutender Ort,
doch erst im Mittelalter eine größere Wichtigkeit, indem
nach der Gründung des lateinischen Kaisertums ein Prinz des
kaiserlichen Hauses, Alexios, 1204 im östlichen Kleinasien ein
kleines Kaisertum errichtete und seinen Sitz in T. nahm. Der Thron
von T. teilte bald das Schicksal des byzantinischen. David
Komnenos, der letzte Kaiser von T., ward 1461 in seiner Hauptstadt
vom türkischen Sultan Mohammed II. belagert und mußte
sich, aller Hilfe beraubt, demselben 1461 auf Gnade und Ungnade
ergeben. Der Sieger ließ ihn 1462 mit seiner Familie in
Adrianopel hinrichten und verleibte das Land dem türkischen
Reich ein. Vgl. Fallmerayer, Geschichte des Kaisertums zu T.
(Münch. 1827).
Trapp, Sammelname, besonders von englischen,
amerikanischen und skandinavischen Geologen zur Be-
[Trapez.]
[Trapezoid.]
[Trapezkapitäl.]
803
Trapp - Trappisten.
zeichnung jüngern und ältern eruptiven Materials
(Dolerit, Melaphyr, Diabas, Diorit etc.) gebraucht.
Trapp, Ernst Christian, philanthrop. Pädagog, geb.
8. Nov. 1745 zu Friedrichsruhe bei Drage (Holstein), wirkte nach
seinem theologischen Studium als Rektor zu Itzehoe (1773-76),
Konrektor zu Altona (bis 1777) und Professor am Dessauer
Philanthropin. Durch den Minister v. Zedlitz 1779 als Professor der
Pädagogik nach Halle berufen, legte er die Professur 1783
nieder, um die Campesche Erziehungsanstalt in Trittau zu
übernehmen, die er 1786 nach Salzdahlum bei Wolfenbüttel
verlegte, wo er 18. April 1818 starb. T. war eifriger Mitarbeiter
am Campeschen Revisionswerk (vgl. Campe 1). Unter seinen Schriften
war ehedem besonders angesehen der "Versuch einer Pädagogik"
(Berl. 1780). Vgl. Andreae, Die Pädagogik Trapps (Kaisersl.
1883, Programm); Paulsen, Geschichte des gelehrten Unterrichts
(Leipz. 1885).
Trappe (Otis L.), Gattung aus der Ordnung der
Stelzvögel und der Familie der Trappen (Otididae), große
oder mittelgroße, schwere Vögel mit mittellangem, dickem
Hals, ziemlich großem Kopf, mittellangem, kräftigem, an
der Wurzel niedergedrücktem, übrigens kegelförmigem,
vorn am Oberkiefer etwas gewölbtem Schnabel, großen,
sanft muldenförmigen Flügeln, mittellangem, breit
abgerundetem Schwanz, mittelhohen, starken Beinen und dreizehigen
Füßen. Sie fliegen schwerfällig, leben monogamisch
in kleinen Trupps und nach der Brutzeit in Herden auf großen
Ebenen der Alten Welt, am zahlreichsten in den Steppen als Stand-
oder Strichvögel, nähren sich von Körnern, Knospen
und Blüten, in der Jugend auch von Insekten, und nisten in
seichten Mulden. Das Weibchen brütet allein. Der große
T. (Trappgans, Otis tarda L., s. Tafel "Watvögel I"), der
größte europäische Landvogel, über 1 m lang,
2,4 m breit, am Kopf, Hals und dem obern Teil der Flügel hell
aschgrau, auf dem Rücken rostgelb, schwarz gebändert, im
Nacken rostfarbig, unterseits schmutzig weiß, der Schwanz
rostrot und vor der weißen Spitze mit schwarzem Bande; das
Auge ist braun, der Schnabel schwarz, der Fuß grau. Das
Männchen ist durch etwa 30 lange, zerschlissene,
grauweiße Kehlfedern ausgezeichnet, das Weibchen blässer
gefärbt und um ein Drittel kleiner. Der Großtrappe lebt
truppweise in den größern Ebenen Mittel- und
Südeuropas und Mittelasiens, besonders in Ungarn,
Rumänien, Südrußland und Asien, ist dagegen in
Deutschland ziemlich selten geworden. Hier lebt er als Standvogel,
in Rußland und Asien wandert oder streicht er. Er bevorzugt
getreidereiche, weite Ebenen und meidet den Busch und menschliche
Wohnungen. Sein Gang ist langsam und gemessen, doch läuft er
auch sehr schnell und fliegt sehr ausdauernd. Er frißt am
liebsten Kraut und Kohl, im Winter Raps und Getreide. Zur Brutzeit
paaren sich die Trappen, doch scheint der Hahn noch ein zweites
Weibchen zu suchen, so bald das erste brütet. Er nistet gern
im Getreide, und das Gelege besteht aus zwei, selten vier matt
graugrünen, dunkel gefleckten und gewässerten Eiern (s.
Tafel "Eier II"), welche in etwa 30 Tagen ausgebrütet werden.
Jung eingefangene oder von Putern ausgebrütete Trappen halten
sich recht gut, schreiten aber nicht zur Fortpflanzung; alt
eingefangene gehen zu Grunde. Der T. gehört zur hohen Jagd; wo
diese Vögel in Menge vorkommen, richten sie auf den Getreide-
und Rapsfeldern oft beträchtlichen Schaden an. Das Fleisch der
Jungen ist schmackhaft. Der Zwergtrappe (O. tetrax L.), 50 cm lang
und 95 cm breit, mit seitlich etwas verlängerten Oberhals- und
Hinterkopffedern, am Halse schwarz, mit einem von den Ohren nach
der Kehle herablaufenden weißen Ringband und einem breiten,
über den Kropf sich hinziehenden weißen Querband
gezeichnet; der Oberkopf ist hellgelblich, braun gefleckt, der
Rücken hell rötlichgelb, in die Quere schwarz gefleckt
und gewellt; die Flügelränder, die Schwanzdeckfedern und
die Unterseite sind weiß, die Schwingen dunkelbraun, die
hinterste bis auf ein breites Band vor der Spitze weiß, die
Schwanzfedern weiß mit zwei Binden; das Auge ist braungelb,
der Schnabel grau, an der Spitze schwarz, der Fuß strohgelb.
Der Zwergtrappe bewohnt das südöstliche Europa,
namentlich Südungarn, Sardinien, die russischen und
sibirischen Steppen, auch Südfrankreich und Spanien, Mittel-
und Westasien und Nordwestafrika und brütet seit 1870 auch in
Schlesien und Thüringen, wo er vom April bis November weilt.
Aus seinem Zug berührt er die Atlasländer. In der
Lebensweise gleicht er dem vorigen, er frißt besonders gern
Klee und Esparsette, junges Getreide und Löwenzahn und
brütet im Mai in Kleefeldern. Das Gelege besteht aus 3-4
dunkel olivengrünen, braun gefleckten Eiern (s. Tafel "Eier
II"). Sein Fleisch ist sehr schmackhaft; in der Gefangenschaft
hält er sich sehr gut. Man erlegt die Trappen, indem man im
Spätherbst und Winter dieselben auf eine in Löchern
gedeckt stehende Schützenlinie zutreibt. Nebeliges Wetter ist
für diese Art der Jagd besonders günstig, weil die
Vögel dann nicht hoch streichen und das Anstellen der
Jäger bei ihrem scharfen Gesicht nicht gewahren können.
Junge Trappen schießt man auch wohl auf der Suche mit dem
Vorstehhund in spät reifenden Hafer- und Gerstenfeldern. Bei
Glatteis werden sie von schnellen Windhunden eingeholt, welche man
möglichst nahe verdeckt in einem Bauernwagen oder Schlitten
heranzubringen sucht, weil die Trappen sich nur schwer erheben
können und erst eine Strecke laufen müssen, ehe sie
aufzufliegen vermögen. Nur schwer gelingt es, dem sehr scheuen
Vogel mit einem dem Ackerwagen ähnlichen Gefährt so weit
nahezukommen, daß man darauf einen Schuß aus der
Büchse anzubringen vermag.
Trappe, La, Kloster im einsamen Thal des Iton, im franz.
Departement Orne, mit Kolonie jugendlicher Sträflinge;
merkwürdig als Stiftungsort des Trappistenordens (s.
Trappisten).
Trappers (engl., "Fallensteller"), Bezeichnung der
nordamerikanischen Pelzjäger.
Trappgranulit, s. Granulit.
Trappisten, Mönchsorden, gestiftet von de
Rancé (s. d.) in der ihm 1636 als Kommende zugeteilten
Cistercienserabtei La Trappe im Departement Orne, bei Mortagne.
Dieselbe war schon 1122 gegründet worden und hieß
anfangs Notre Dame de la maison Dieu, erhielt aber später
wegen des engen Einganges in das Thal den Namen La Trappe
("Fallthür"). Rancé berief Mönche von der
strengsten Observanz der Benediktiner, stellte das zum Raubnest
gewordene Kloster wieder her, wurde selbst Mönch und nach
vollendetem Probejahr 1665 Abt von La Trappe, wo er eine Regel
durchführte, welche einen vollständigen Rückfall zu
der orientalischen Schweigsamkeit der Askese darstellt. Die T.
müssen sich täglich elf Stunden mit Beten und Messelesen
beschäftigen und die übrige Zeit bei harter Feldarbeit
zubringen. Abends arbeiten sie einige Minuten an Herstellung ihrer
Gräber und schlafen dann in Särgen auf Stroh. Es darf
außer Gebeten und Gesängen und dem "Memento mori", womit
sie einander grüßen, kein Wort über ihre Lippen
kommen. Ihre Nahrung besteht aus
51*
804
Trappporphyr - Traubenkrankheit.
Wurzeln und Kräutern, Früchten, Gemüsen und
Wasser, ihre Kleidung aus Holzschuhen, Kutte, Kapuze und Strick.
Sie teilen sich in Laienbrüder und Professen; außerdem
gibt es auch sogen. Frères donnés, d. h. solche,
welche nur eine Zeitlang behufs der Bußübung dem Orden
angehören. Die Prinzessin Louise von Condé stiftete
einen weiblichen Zweig des Ordens. Als die Stürme der
Revolution die geistlichen Orden aus Frankreich verscheuchten,
flüchteten sich die T. teils in die Schweiz, teils nach
Rußland, teils nach Preußen, hatten aber allenthalben
Ausweisung und Verfolgung zu erdulden. Zusammengehalten durch den
Novizenmeister Augustin (Henri de Lestrange), kehrten sie 1817 in
ihr Stammkloster in Frankreich, das sie wieder angekauft hatten,
zurück und gründeten zahlreiche neue Niederlassungen, die
besonders unter dem Generalprokurator Geramb (s. d.)
aufblühten. Selbst nach der Julirevolution durfte der Orden
unter dem ihm vom Papst 1834 beigelegten Namen Congrégation
des religieux Cisterciens de Notre Dame de la Trappe fortbestehen;
1880 wurden 1450 T. aus Frankreich ausgewiesen. Vgl. Gaillardin,
Les Trappistes (Par. 1844, 2 Bde.); Pfannenschmidt, Geschichte der
T. (Paderb. 1873).
Trappporphyr, s. Melaphyr.
Trarbach, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Koblenz,
Kreis Zell, an der Mosel und der Linie Reil-Traben der
Preußischen Staatsbahn, 97 m ü. M., hat eine
evangelische und eine kath. Kirche, ein Progymnasium, ein
Amtsgericht, eine Oberförsterei, Weinbau und bedeutenden
Weinhandel und (1885) 1850 meist evang. Einwohner. Die frühern
Festungswerke wurden 1734 von den Franzosen geschleift. Auf der
Höhe über der Stadt die Ruine der Gräfinburg und T.
gegenüber der Flecken Traben (s. d.); 4 km südlich in dem
romantischen Kautenbachthal das Bad Wildstein mit einer Therme von
35° C.
Trasimenischer See (ital. Lago Trasimeno), flacher, eine
Mulde ausfüllender See in der ital. Provinz Perugia (Umbrien),
115 qkm groß, mit drei kleinen Inseln, meist von anmutigen,
bis 600 m hohen Gebirgen umgeben, ohne Abfluß, berühmt
durch die Niederlage, welche Hannibal 217 v. Chr. den Römern
unter dem Konsul Gajus Flaminius an seinem nördlichen Ufer
beibrachte. Seine Austrocknung ist projektiert. Vgl.
Stürenburg, De Romanorum cladibus Trasimenna et Cannensi
(Leipz. 1883, Ergänzung 1889).
Traß, trachytischer Tuff, s.Trachyte. Vgl.
Zement.
Trassieren (ital.), das Ziehen eines Wechsels auf einen
andern. Der Aussteller eines solchen Wechsels wird Trassant, der
Bezogene Trassat, der gezogene Wechsel selbst Tratte genannt. Sind
Trassant und Trassat eine und dieselbe Person, so spricht man von
einem trassiert-eignen Wechsel (s. Wechsel).
Trastevere, s. Rom, S. 904.
Trätabel (franz. traitable), fügsam,
umgänglich.
Tratte (ital.), s. Trassieren.
Trattoria (ital.), Speisehaus, Restaurant.
Traù (slaw. Trogir, das alte Trigonium), Stadt in
Dalmatien, Bezirkshauptmannschaft Spalato, in reichbebauter Gegend,
mit der gegenüberliegenden Küsteninsel Bua durch eine
drehbare Brücke verbunden, hat ein Bezirksgericht,
Kollegiatkapitel, ein altes venezianisches Thor an der Landseite,
einen schönen gotischen Dom mit Bildhauerarbeiten, einen
runden Festungsturm von Sanmicheli, Weinbau, Oliven-, Feigen- und
Mandelkultur, Handel, einen guten Hafen (1886: 4741 beladene
Schiffe mit 103,639 Ton. eingelaufen), 2 Kreditbanken und (1880)
3129 Einw.
Traube, eine Art des Blütenstandes (s. d., S.
80).
Traube, Ludwig, Mediziner, geb. 12. Jan. 1818 zu Ratibor,
studierte in Breslau, beschäftigte sich aber hier unter
Purkinje und seit 1837 in Berlin unter Joh. Müller fast
ausschließlich mit Physiologie. 1841 ließ er sich
daselbst als Arzt nieder und begann 1843 besonders jüngern
Ärzten Kurse in den neuern Untersuchungsmethoden der
Perkussion und Auskultation zu geben. In die nächsten Jahre
fallen seine experimentellen Studien an Tieren, durch welche er der
Begründer der experimentellen Pathologie in Deutschland
geworden ist. Er untersuchte die Ursachen und die Beschaffenheit
der Veränderungen des Lungenparenchyms nach der
Durchschneidung des Nervus vagus und gab mit Virchow und Reinhardt
"Beiträge zur experimentellen Pathologie" (Berl. 1846-47, 2
Hefte) heraus. 1848 habilitierte sich T. als Dozent, 1849 wurde er
Zivilassistent Schönleins und Lehrer der Auskultation und
Perkussion. 1853 wurde er zum dirigierenden Arzt an der Charitee,
1857 zum außerordentlichen Professor ernannt und seine
Krankenabteilung zur propädeutischen Klinik erhoben. 1862
folgte seine Ernennung zum ordentlichen Professor am Friedrich
Wilhelms-Institut, aber erst 1872 an der Universität. Er starb
11. April 1876 in Berlin. Seine wissenschaftlichen Arbeiten legte
er in den "Gesammelten Beiträgen zur Pathologie und
Physiologie" (Berl. 1871-78, 3 Bde.) nieder. Alle seine Arbeiten
sind ausgezeichnet durch die exakte naturwissenschaftliche Methode,
die genaue Beobachtung und Untersuchung. Er betrachtete das
Experiment als die Grundlage einer wissenschaftlichen Pathologie
und verlangte für die Therapie, daß man in
systematischer Weise versuchen solle, die an Tieren hervorgerufenen
Krankheitsvorgänge durch die genauer bekannten Arzneimittel zu
modifizieren. Zu seinen wichtigsten Untersuchungen gehören die
über Digitalis und das Fieber, durch welch letztere er der
Begründer der wissenschaftlichen Thermometrie in der Medizin
wurde. Daran schließen sich die Arbeiten über die
Lungen-, Herz- und Nierenkrankheiten. Dieselbe Bedeutung wie als
Forscher hatte T. auch als klinischer Lehrer und Arzt. Die exakte
wissenschaftliche Methode, welche er selbst übte, hat er in
Norddeutschland allgemein gemacht. Seine Verdienste um die
physikalische Diagnostik stellen ihn neben Laennec und Skoda. Er
schrieb noch: "Über den Zusammenhang von Herz- und
Nierenkrankheiten" (Berl. 1856); "Die Symptome der Krankheiten des
Respirations- und Zirkulationsapparats" (das. 1867). Vgl.
die"Gedächtnisreden auf L. T." von Leyden (Berl. 1876) und
Freund (Bresl. 1876).
Traubenampfer, s. Coccoloba.
Traubenbirne, s. Amelanchier.
Traubenfarn, s. Osmunda.
Traubenfäule, s. Traubenkrankheit.
Traubenhaut, s. Auge, S. 74.
Traubenhyazinthe, s. Muscari.
Traubenkernöl (Rosinenöl), fettes Öl,
welches aus Traubenkernen, namentlich in Frankreich und Italien,
durch Pressen gewonnen wird. Es ist goldgelb, fast geruchlos,
schmeckt süßlich, warm gepreßt schwach herb, spez.
Gew. 0,91-0,92, erstarrt bei -11° und wird an der Luft schnell
ranzig. Man benutzt es als Speise- und Brennöl.
Traubenkirsche, s. Padus.
Traubenkrankheit (Traubenfäule), eine Krankheit des
Weinstocks, welche ein Verderben der Beeren zur Folge hat. Sie
wurde zuerst 1845 in England beobachtet und verbreitete sich bald
darauf durch Frank-
805
Traubenkraut - Traubenvitriol.
reich nach dem südlichen Europa, nach der Schweiz und
Deutschland. Die Krankheit besteht in dem Auftreten eines
weißen, dünnen, meltauartigen Überzugs auf braun
werdenden Flecken der Blätter und der Zweige des Weinstocks
(vgl. Tafel "Pflanzenkrankheiten", Fig. 16), später auf den
jungen Beeren. An letztern wird dadurch die Epidermis ebenfalls
braun, stirbt ab, noch ehe die Frucht die Hälfte ihrer
normalen Größe erlangt hat, und zerreißt bei
weiterer Ausdehnung des Beerenfleisches, so daß die Beere
abstirbt und verfault. Der weiße Überzug besteht aus
einem Pilz, Oïdium Tuckeri Berk., welcher das Braunwerden und
Absterben der Epidermis veranlaßt. Sein Mycelium m (vgl.
Tafel "Pflanzenkrankheiten", Fig. 17) besteht aus langen und
verzweigten Fäden, welche auf der Epidermis hinwachsen und
stellenweise an den Berührungspunkten sogen. Haustorien
entwickeln, d. h. kurze, seitliche Fortsätze des Fadens,
welche wie kleine, gelappte Warzen erscheinen, die der Epidermis
aufliegen. Aus der dem Pflanzenteil abgewendeten Seite treiben die
Myceliumfäden einfache Fruchthyphen, deren jede an ihrer
Spitze eine einzige länglichrunde, einzellige, farblose
Konidie (c) abschnürt. Diese Sporen trennen sich sehr leicht
ab und werden vom Regen und Wind weiter geführt auf
benachbarte Blätter, Trauben etc. So wird durch sie der Pilz
und damit die Krankheit weiter verbreitet, denn die Konidien keimen
bei Vorhandensein von Feuchtigkeit leicht und schnell mittels eines
Keimschlauchs, der sich auf der Nährpflanze wieder zu einem
Mycelium entwickelt. Der Pilz gehört der Gruppe der Erysipheen
unter den Kernpilzen an und hat mit den zahlreichen Arten
derselben, welche den Meltau aus den verschiedensten Pflanzen
hervorbringen, die Art der krankmachenden Wirkung und die Symptome
des Auftretens gemein. Er kommt indes immer nur im Konidienzustand
vor; seine vollkommene Fruchtform, die Perithecien, welche die
Gattung Erysiphe charakterisieren und bei den übrigen Arten in
der Regel nach der Bildung der Konidienträger auftreten, sind
bis jetzt nicht gefunden worden. Auf manchen traubenkranken
Weinstocken besitzt das Oidium auf kurzen, den Konidienträgern
ähnlichen Hyphen eine längliche, kapselartige Frucht,
welche an der Spitze aufgeht und zahlreiche sehr kleine,
einzellige, länglichrunde Sporen in Schleim eingebettet
ausstößt. Diese Bildungen gehören einem
schmarotzenden Pilz, Cicinnobolus Cesatii De Bary, an, welcher auch
auf andern Arten von Erysiphe vorkommt; sein Mycelium wächst
in Form sehr feiner Fäden innerhalb der Myceliumfäden des
Oidiums und steigt auch in die jungen Konidienträger auf, um
hier innerhalb der dadurch sich ausweitenden Konidie seine
Pyknidenfrucht zu entwickeln. Eine den Traubenpilz schädigende
Einwirkung seines Schmarotzers läßt sich nicht bemerken.
Da Perithecien, aus deren Sporen bei den andern Erysiphe-Arten die
Entwickelung im Frühjahr zu beginnen pflegt, fehlen, so
scheint das Oidium der T. entweder mit Konidien oder in Form
lebensfähig bleibender Myceliumteile am Weinstock zu
überwintern. Gesteigerte Feuchtigkeit begünstigt die T.,
daher zeigen die feuchten Inseln und Küstenländer im
Verhältnis zum Binnenland die Krankheit viel mehr, und im
südlichen Europa ist der Weinbau durch sie im höchsten
Grad geschädigt worden. Ebenso leiden Orte mit
regelmäßigen häufigen Niederschlägen, wie die
Südabhänge der Alpen, mehr als die nördlich davon
gelegenen Länder. Auch in einer und derselben Gegend sind die
niedern und feuchten Lagen der Krankheit mehr ausgesetzt als hoch
und trocken gelegene Weinberge. Unter den Sorten sollen
Muskateller, Malvasier und verwandte blaue Sorten öfters von
der Krankheit zu leiden haben, andre, wie Rieslinge, Traminer,
widerstandsfähiger sein. Man bekämpft die T. erfolgreich
durch das Schwefeln, d. h. das Überpudern der Weinstöcke
mit Schwefelblumen, wodurch der Pilz getötet und gesunde
Pflanzen geschützt werden. Man bedient sich dabei eines
trocknen Maurerpinsels oder eigens dazu gefertigter Puderquasten
oder besonderer Blasebälge und soll die Operation während
des Morgentaues und zwar dreimal, kurz vor, kurz nach der
Blüte und im August, ausführen. Wahrscheinlich wirkt das
Schwefelpulver nur mechanisch, erstickend auf den Pilz, denn man
hat ähnlich günstige Wirkungen auch vom Chausseestaub
gesehen, wenn die Pflanzen dicht damit überzogen waren. Durch
Einführung amerikanischer Rebensorten ist die T. nicht zu
umgehen, weil das Oidium auch auf diesen gedeiht. Vgl. v.
Thümen, Die Pilze des Weinstocks (Wien 1878).
Traubenkraut, s. Chenopodium.
Traubenkur, der mehrere Wochen lang fortgesetzte
reichliche Genuß von Weintrauben, wobei sehr nahrhafte,
fette, mehlige oder blähende Speisen vermieden werden
müssen. Mit hinreichender Körperbewegung verbunden, soll
diese Kur bei Stockungen im Unterleib und davon abhängiger
Hypochondrie, bei Hämorrhoidalbeschwerden und bei Gicht gute
Dienste leisten. Die Wirksamkeit der Weintrauben beruht vornehmlich
auf dem starken Zuckergehalt derselben, welcher als Nahrungsstoff
von Wert ist; anderseits haben sie, in größerer Menge
genossen, eine leicht und angenehm abführende Wirkung, so
daß sie das mildeste Mittel gegen Unterleibsstockungen
darstellen. Die besuchtesten Kurorte sind Meran in Tirol,
Dürkheim in der Rheinpfalz und Grünberg in Schlesien.
Vgl. Knauthe, Die Weintraube (Leipz. 1874).
Traubenmade, s. Wickler.
Traubenöl, s. Drusenöl.
Traubensäure (Paraweinsäure) C4H6O6 findet sich
im rohen Weinstein und entsteht aus der isomeren Weinsäure bei
anhaltendem Erhitzen von deren Lösung mit Salzsäure oder
verdünnter Schwefelsäure, auch bei oxydierender
Behandlung von Mannit, Rohr- und Milchzucker, Gummi etc. Bei
Verarbeitung des rohen Weinsteins erhält man sie in den
spätern Kristallisationen in kleinen Kristallen mit einem
Molekül Kristallwasser. Sie ist farb- und geruchlos, vom spez.
Gew. 1,69, schmeckt sauer, löst sich leicht in Wasser und
Alkohol, ist optisch inaktiv, verwittert an der Luft, wird bei
100° wasserfrei und verhält sich im allgemeinen der
Weinsäure sehr ähnlich. Von ihren Salzen ist das saure
Kalisalz viel löslicher als Weinstein, während das
Kalksalz schwerer löslich ist als weinsaurer Kalk. Das
Kaliumnatrium- und das Ammoniumnatriumsalz, das Cinchonicin- und
Chinicinsalz kristallisieren nicht, sondern geben große,
hemiedrische Kristalle, von denen man zwei Formen unterscheiden
kann, die sich zu einander wie Spiegelbilder verhalten. Bei der
einen Form liegen nämlich die hemiedrischen Flächen
rechts, bei der andern links. Aus den Kristallen der ersten Art
kann man durch eine stärkere Säure gewöhnliche
Rechtsweinsäure, aus der andern Linksweinsäure
abscheiden, und wenn man die Lösungen dieser beiden
Säuren mischt, so kristallisiert wieder T. Bei Einwirkung von
Fermenten auf T. wird die Rechtsweinsäure zerstört, und
es bleibt Linksweinsäure übrig.
Traubenvitriol, s. Eisenvitriol.
806
Traubenzucker - Trauer.
Traubenzucker (Krümel-, Stärke-, Kartoffel-,
Obst-, Honigzucker, Glykose, Glukose, Dextrose) C6H12O6 findet sich
im Pflanzenreich, fast stets begleitet von Levulose (Fruchtzucker)
oder Rohrzucker, sehr verbreitet, besonders in süßen
Früchten (kristallisiert im gedörrten Obst, in Rosinen,
auf welchen er oft als weißer Beschlag erscheint), auch im
Honig, im tierischen Organismus normal im Dünndarminhalt und
Chylus nach dem Genuß stärkemehl- und zuckerhaltiger
Nahrung, in der Leber des Menschen und der Säugetiere, im
Lebervenenblut, im Harn schwangerer Frauen, in der Amnion- und
Allantoisflüssigkeit der Rinder, Schafe und Schweine,
pathologisch im Harn bei Zuckerruhr und nach Reizung und Verletzung
des verlängerten Marks. T. entsteht aus den übrigen
Kohlehydraten (am leichtesten aus Rohrzucker) bei Einwirkung
eigentümlicher Fermente oder verdünnter Säuren
(daher in Bier- und Branntweinwürze) und bei der Spaltung der
Glykoside. Dargestellt wird T. aus Most, indem man denselben durch
Kreide entsäuert, mit Blut klärt und verdampft; viel mehr
T. aber wird aus Kartoffelstärke dargestellt und als feste
Masse, gekörnt, als Sirup (Stärkesirup, Kartoffelsirup)
oder als zähflüssige Masse (sirop impondérable,
weil er nicht mit dem Saccharometer gewogen werden kann) in den
Handel gebracht. Man erhitzt Wasser mit etwa 1 Proz.
Schwefelsäure zum Kochen, trägt die mit Wasser zu einer
milchigen Flüssigkeit angerührte Stärke unter
lebhaftem Umrühren ein und kocht, bis das zuerst gebildete
Dextrin vollständig in T. umgewandelt ist (bis 1 Teil der
Flüssigkeit mit 6 Teilen absolutem Alkohol keinen Niederschlag
mehr gibt). Bei Zusatz von etwas Salpetersäure soll die
Umwandlung viel schneller erfolgen. Zur Beseitigung der
Schwefelsäure neutralisiert man mit Ätzkalk, Kreide oder
Marmor oder kohlensaurem Baryt, zapft die Flüssigkeit von dem
abgelagerten unlöslichen schwefelsauren Kalk oder Baryt ab,
verdampft sie bis 15 oder 16° B., filtriert über
Knochenkohle und verdampft den Sirup (meist in Vakuumapparaten) bis
30° B. (Stärkesirup) oder bis zur Kristallisation.
Läßt man die kristallisationsfähige Masse in
Fässern oder Kisten vollständig erstarren, so erhält
man ein sehr unreines Produkt (Kistenzucker, Blockzucker). Zur
Gewinnung eines reinern Produkts preßt man die in
Kristallisation befindliche Masse in starken hydraulischen Pressen
(Preßzucker), um den Sirup abzuscheiden, schmelzt wohl auch
den gepreßten Zucker (hart kristilisierter Zucker), oder man
läßt aus der weniger stark eingekochten Masse den Sirup
von den Kristallen abfließen und trocknet letztern auf
Gipsplatten in der Trockenstube. 1 Ztr. Stärke liefert etwa 1
Ztr. Zucker oder 1,5 Ztr. Sirup. Auch Holzfaser, Flechten, Lumpen
etc. geben bei Behandlung mit Schwefelsäure T.; doch kann die
aus solchen Materialien gewonnene zuckerhaltige Flüssigkeit
nur auf Spiritus verarbeitet werden. Der T. des Handels
enthält 60-76 Proz. reinen T., 9-17 Proz. Dextrin, 11-25 Proz.
Wasser, 2-7 Proz. fremde Bestandteile. Reinen T. erhält man
durch Lösen von Rohrzuckerpulver in salzsäurehaltigem
Alkohol und Verdampfen der Lösung zur Kristallisation. T.
bildet meist warzig-krümelige, farb- und geruchlose Massen mit
1 Molekül Kristallwasser, schmeckt weniger süß als
Rohrzucker (man braucht 2,5 mal so viel T. als Rohrzucker, um
demselben Volumen Wasser dieselbe Süßigkeit zu
erteilen), löst sich in 1,3 Teilen kaltem, in allen
Verhältnissen in kochendem Wasser, auch in Alkohol, dreht die
Ebene des polarisierten Lichts nach rechts (daher Dextrose),
erweicht bei 60°, wird bei 100° wasserfrei, schmilzt bei
146°, zersetzt sich bei 170° und gibt in höherer
Temperatur Karamel. Mit Alkalien zersetzt sich die Lösung
schon bei 60-70°. Eine mit Kali versetzte
Traubenzuckerlösung reduziert in der Siedehitze
Kupferoxydhydrat zu Kupferoxydul, Silberoxyd zu metallischem
Silber. Durch Hefe zerfällt T. in Alkohol und
Kohlensäure; in alkalischer Lösung vergärt er zu
Milchsäure und Buttersäure, und unter gewissen
Umständen tritt schleimige Gärung ein, und es bilden sich
Mannit und ein gummiähnlicher Körper. T. dient in
großer Menge zur Weinbereitung (beim Gallisieren), als
Surrogat des Braumalzes in der Bierbrauerei, des Honigs in der
Zuckerbäckerei und Lebküchlerei, zum Verschneiden des
indischen Sirups und Honigs, in Mostrich- und Tabaksfabriken, zur
Darstellung von Zuckerkouleur, Likören, Bonbons etc. T. wurde
zuerst während der Kontinentalsperre fabrikmäßig
dargestellt. Später verschwand dieser Industriezweig und
gewann erst neuerdings durch das Gallisieren und die Benutzung des
Traubenzuckers in Brauereien größere Bedeutung. Vgl.
Wagner, Die Stärkefabrikation (Braunschw. 1876).
Trauer, die durch ein betrübendes Ereignis,
namentlich durch den Verlust nahestehender oder verehrter Personen,
oder durch die Erinnerung an solche Verluste (wie in den
religiösen Trauerfesten um Adonis, Osiris etc.) verursachte
Gemütsstimmung und deren Kundgebung nach außen. Letztere
äußert sich beim weiblichen Geschlecht, bei
sanguinischen Naturen, südlichen Völkern etc. in mehr
lauter, aber schneller vorübergehender Klage, bei nordischen
Völkern in länger nachwirkenden, aber stummen und
gefaßten Gemütsbewegungen. Natürlich sind die
Kundgebungen vor der aufgebahrten Leiche und am offenen Grab am
stärksten, und man hatte dazu bei Natur- und
Kulturvölkern bestimmte Trauergesänge, wie die von
Schiller umgedichtete "Nadowessische Totenklage", das Adonis-,
Linos- und Maneros-Lied der Griechen, Syrer und Ägypter. Im
Orient wie bei den Slawen und im südlichen Italien werden
besondere Klageweiber angenommen, die das mit Cypressen und andern
Trauersymbolen geschmückte Sterbehaus mit ihrem Geschrei
erfüllen. Religiöse Vorstellungen und Herkommen bedingen
für den äußern Ausdruck mannigfache
Verschiedenheiten. Bei den Naturvölkern gilt die
Trauerverstümmelung (s. d.) als der natürliche Ausdruck
des beherrschenden Gefühls, die Kulturvölker deuten durch
Unterlassen jedes Putzes, Vernachlässigung der Haarpflege,
Anlegen von Florstreifen etc. an, daß sie für eine
gewisse, nach der Sitte bestimmte und für Frauen länger
als für Männer dauernde Zeit allen Freuden der Welt
abgestorben sind, weshalb auch alle weltlichen Vergnügungen,
wie Theater, Bälle, Konzerte u. dgl., streng gemieden werden.
In Attika dauerte die Privattrauer 30 Tage, in Sparta mußte
sie bereits am 12. Tag mit einem Opfer an Demeter beendet werden;
in Rom war nur den Frauen (seit Numas Gesetzgebung) eine bestimmte
Trauerzeit geboten. Bei den Griechen und Orientalen, wo Bart und
Haupthaar den Stolz des Mannes bilden, wurden und werden vielfach
beide geschoren; doch galt anderwärts, z. B. in Rom, eine
gewisse Vernachlässigung durch Langwachsenlassen ebenfalls als
Trauerzeichen. In der Kleidung wurden überall bunte Farben und
kokette Formen vermieden. Die Juden verhüllten den Körper
mit einem groben, sackartigen, in der Mitte gegürteten Gewand
und bestreuten, wie auch die Griechen (und katholischen Christen zu
Aschermitt-
807
Trauerbäume - Traum
woch), das Haupt mit Asche, woher die Redensart: "in Sack und
Asche trauern". Als Trauerfarben galten vorwiegend, z. B. den
Griechen und Römern, die dunkeln, schwarzen, welche auch
früh bei den Christen Eingang fanden, obwohl Cyprian,
Chrysostomus und andre Kirchenlehrer dieselbe tadelten, weil sie
der Hoffnung auf die ewigen Freuden zu widersprechen schienen.
Dagegen trauerten die alten Ägypter in gelben Kleidern, die
Argiver weiß; bei den Chinesen sind noch heute weiße,
blaue und graue Trauerkleider üblich. Grau gilt auch bei uns
als die Farbe der nach einer gewissen Zeit eintretenden sogen.
Halbtrauer, die besonders bei der schon in alten Kulturländern
gesetzlich oder durch bestimmte Erlasse (Trauerordnungen)
geregelten Landes- und Hoftrauer nach dem Tode des eignen oder
befreundeter Landesfürsten streng beobachtet wird, wobei alle
öffentlichen Lustbarkeiten für eine bestimmte Zeit
unterbleiben, die Flaggen in halber Höhe geheißt werden
und Militär wie Hofbeamte in vorgeschriebener Trauerkleidung
zu erscheinen haben. Das schon bei den Römern gesetzlich
vorgeschriebene und auch bei uns meist eingehaltene sogen.
Trauerjahr der Witwen bezieht sich nur auf etwa noch zu erwartende
Nachkommenschaft und kann daher auf ärztliches Attest
abgekürzt werden.
Trauerbäume, Gehölze mit hängenden
Zweigen, welche als Symbol der Trauer auf Gräbern, aber auch
wirkungsvoll im Park und Garten einzeln stehend angepflanzt oder zu
Lauben benutzt werden. Den schönsten Effekt machen T. mit
dünnen Zweigen und schmalen Blättern, während
starkästige Bäume mit großen, breiten Blättern
leicht plump erscheinen. Der klassische Trauerbaum ist die
Trauerweide (Salixbabylonica), der sich andre Weidenarten
anschließen. Sehr schön sind auch einige Birkenformen,
Fichten und namentlich weiße Rosen, während die
Traueresche nur in höherm Alter ihre Steifheit verliert.
Trauerjahr, s. Trauer.
Trauerkrüge, Kreußener Kannen aus perlgrauem
Steinzeug, welche weiß und schwarz emailliert und zuweilen
vergoldet sind.
Trauermantel, s. Eckflügler.
Trauerparade, s. Ehrenbezeigungen.
Trauerspiel, s. Tragödie.
Trauerverstümmelung. Bei den Naturvölkern und
ältern Kulturvölkern, die jenen noch nahestanden,
äußerte sich die Trauer um Verstorbene nicht bloß
in Farbe und Schnitt der Kleider, sondern in heftigen Angriffen und
Verstümmelungen des eignen Körpers. Die Bewohner der
Nikobaren verbrennen, wie Hamilton erzählt, das Besitztum des
Toten, und sein Weib muß sich am Grab ein Fingerglied
abschneiden lassen. Bei den Charruah sind beim Tode des
Familienhauptes die Witwen, Töchter und verheirateten
Schwestern verpflichtet, sich ein Fingerglied abnehmen zu lassen.
Bei den Fidschianern wurden (nach Williams) beim Tode des
Häuptlings 100 Finger als Opfer verlangt. Diese Fingeropfer
sind offenbar Ablösungsformen für das Leben der Witwe
oder fürstlichen Diener, die früher dem Gatten oder
Häuptling in den Tod zu folgen hatten, und bei einigen
nordamerikanischen Indianerstämmen, die ebenfalls das
Fingeropfer kennen, muß die Witwe einige Augenblicke ihr
Haupt neben das des Toten auf den Scheiterhaufen legen (vgl.
Manendienst und Menschenopfer). Auf den Sandwichinseln wurde (nach
Ellis) beim Tode des Herrschers jedem Unterthanen ein Vorderzahn
ausgeschlagen, oder es wurden ihm beide Ohren abgeschnitten. An
vielen Orten trat die Hergabe von Blut am Grab an die Stelle des
Fingeropfers, und die Lakedämonier hatten (nach Herodot) die
barbarische Sitte, daß sich beim Tode des Königs
Männer, Weiber und Sklaven in großen Haufen versammeln
und mit Dornen und Nadeln das Fleisch von der Stirn reißen
mußten. Den Juden gebot das mosaische Gesetz: "Ihr sollt euch
keine Wunden in euer Fleisch schneiden für die Toten . . . . "
(3. Mos. 19, 28). Bei dem Begräbnis Attilas zerfleischten die
Hunnen ihr Gesicht, und dieselbe Sitte blieb noch länger bei
den Türken herrschend. Als letztes Überbleibsel dieser
Hingabe des Teils für das Ganze gilt das Abschneiden von Bart-
und Haupthaar. Diese Sitte hatte eine weite Ausdehnung;
nordamerikanische Indianer opferten ihre Skalplocke, und bei den
Neuseeländern wurden (nach Pollack) die abgeschnittenen Haare
auf dem Begräbnisplatz an Bäumen aufgehängt.
Trauervogel, s. Fliegenfänger.
Trauformular, s. Trauung.
Traufrecht, die Dienstbarkeit, vermöge deren ein
Grundeigentümer berechtigt ist, von seinem Gebäude den
Wasserabfall auf ein Nachbargrundstück fließen zu
lassen. Zuweilen bezeichnet man auch damit den Grund und Boden,
welcher durch ein vorspringendes Dach überdeckt wird, und von
welchem man annimmt, daß er zu dem betreffenden Gebäude
gehöre.
Traum (lat. Somnium), die Fortsetzung der geistigen
Thätigkeit während des Schlafs bei mangelndem vollen
Bewußtsein des Schläfers. Nach den neuern Anschauungen
liegt der Unterschied zwischen Schlaf und Wachen wesentlich darin,
daß das Bewußtsein "ausgeschaltet" ist, und daß
der Blut- und Sauerstoffstrom, der dazu dient, die geistige
Thätigkeit zu unterhalten, im Schlaf dazu verwendet wird, das
Gehirn und den übrigen Körper von den Schlacken der
Tagesarbeit zu reinigen und neu zu kräftigen. Nun brauchen
aber nicht alle Teile des geistigen Organs gleichmäßig
außer Thätigkeit gesetzt zu sein, oder es können
vielmehr einzelne wieder in Thätigkeit treten, ohne daß
volles Selbstbewußtsein und damit Erwachen eintritt. Es sind
dies namentlich die Sinnessphäre, in der die äußern
Eindrücke bewußt werden, und die Erinnerungssphäre,
in welcher ältere Eindrücke als Erinnerungsbilder
aufbewahrt werden (s. Gedächtnis). Manche unsrer Sinnespforten
bleiben bekanntlich auch im Schlaf offen, und wie im wachen Zustand
die völlig geöffneten Sinnesorgane die Anregung zur
Seelenthätigkeit geben, so sind es im Schlaf meist das Ohr,
die Nase, das Tast- und Gemeingefühl, welche den ersten
Anlaß zu innern Erregungen und Traumbildern liefern. Mit dem
Pulsmesser oder Plethysmographen kann man nachweisen, daß
sodann alsbald eine stärkere Blutströmung als vorher ins
Gehirn eintritt, aber zunächst wahrscheinlich nur in die durch
äußere oder innere Empfindungen erregten Teile. Die
Empfindung gestaltet sich alsdann zu einer ihr entsprechenden
dunkeln Vorstellung. So bewirkt eine unbequeme Lage oder ein
körperlicher Schmerz einen T. von Fesselung und
thätlichen Angriffen, Senfpflaster oder ein brenzliger Geruch
erregen Träume von Feuersgefahr, ein plötzliches
Ausstrecken soll das bekannte, meist mit Erwachen verknüpfte
Gefühl eines tiefen Sturzes erzeugen, Töne und
Geräusche aller Art, in der Nähe gesprochene Worte und
dergleichen werden mit wunderbarer Schlagfertigkeit zu einem T.
ausgesponnen, namentlich gegen Morgen, wenn der Geist nur noch im
Halbschlummer liegt. A. Maury hat dies durch zahlreiche
Selbstversuche erprobt, indem
808
Trauma - Traumdeutung.
er sich nach der Mittagsmahlzeit unmittelbar nach dem
Einschlafen gewisse Geräusche und andre Eindrücke
beibringen und gleich darauf wecken ließ, um sich der dadurch
hervorgerufenen Traumvorstellungen zu erinnern. Man kann sich so
ganze Träume einblasen (soufflieren) lassen. Häufig
spiegeln sich die sogen. Binnenempfindungen oder krankhafte
Zustände im T. So träumen die Personen, welche an
Atmungsbeschweren oder Luftmangel leiden, von einem durch das
Schlüsselloch eindringenden und sie bedrückenden Gespenst
(s. Alp), von engen Höhlengängen, Menschengedränge,
Stößen gegen die Brust, Herzleidende haben
beängstigende Träume, Erregungen in der Sexualsphäre
bringen wollüstige Träume hervor. Der Inhalt der
Träume besteht meist aus Wiederbelebung und Verbindung von
Erinnerungsbildern, wobei frische Erinnerungen, Dinge, mit denen
man sich zur Zeit stark beschäftigt, oder an die man in den
Stunden vor dem Einschlafen lebhaft erinnert wurde, den Vordergrund
einnehmen. Eine besondere Erklärung verlangt die dramatische
Lebendigkeit dieser Bilder, welche den Träumer verleitet, sie
für Wirklichkeiten zu halten und zu glauben, daß er
seinen T. mit offenen Sinnen erlebt. Einige Forscher haben deshalb
an eine besonders starke Erregung des Sensoriums geglaubt und den
T. mit den Zuständen der Opium- und Hanfnarkose verglichen, in
denen der Betäubte mit offenen Augen träumt. Andre, wie
Johannes Müller, Gibbert und Brewster, haben sogar gemeint,
die innere Erregung gehe so weit, daß sie von innen aus ein
Bild auf der Netzhaut erzeuge, im Ohr Klänge errege, kurz die
peripherischen Nerven zu wirklichen Empfindungen veranlasse. Gegen
diese Annahmen, die auch in neuerer Zeit von Lazarus und Hagen
wiederholt wurden, hat zuerst E. Krause in seiner "Naturgeschichte
der Gespenster" geltend gemacht, daß Empfindungen immer nur
im Zentarlorgan zu stande kommen, und wozu oder auf welchen Wegen
sollte das letztere Empfindungen erst nach außen werfen, um
sie von da wieder zurückzuerhalten. Auch eine abnorme Erregung
des Gehirns braucht zur Erklärung der Vorgänge nicht
angenommen zu werden; die Lebhaftigkeit der Traumbilder
erklärt sich vielmehr ganz von selbst durch die Abwesenheit
der Sinnenkonkurrenz und des wachen Urteils, vor denen im Wachen
alle diese innern Bilder verblassen. Das Selbstbewußtsein ist
nicht ganz aufgehoben, regt sich vielmehr, namentlich gegen Morgen,
oft in Zweifeln und in der Frage: "Träume ich denn?", worauf
in der Regel baldiges Erwachen folgt. Durch den Mangel des vollen
Bewußtseins erklärt sich sowohl das Durcheinander der
Bilder als das Unsinnige, ja Unmoralische vieler dabei vor sich
gehender Handlungen, die Ideen und Bilder folgen einfach dem Gesetz
der Ideenassociation (s. d.), und das Urteil ist so schwach,
daß verstorbene Personen lebend erscheinen, die Einheit des
Ortes nicht beobachtet wird, jedes Zeitmaß verschwindet und
selbst die Person des Träumers sich in ihren Urteilen und
Handlungen oftmals dramatisch in mehrere Personen spaltet. Ein
bedeutendes Licht wird in dieser Richtung durch das Studium des
Hypnotismus (s. d.) und namentlich durch die Möglichkeit der
Suggestion (s. d.) auf den T. geworfen, denn hierbei ist das
Selbstbewußtsein so tief niedergedrückt, daß sich
die unsinnigste Idee einflößen läßt und zur
Wirklichkeit gestaltet, selbst die Verleugnung der eignen
Persönlichkeit. Gleichwohl sind diese wie die
Traumeindrücke so schwach, daß sie nach dem Erwachen
mehr oder weniger vollständig aus dem Gedächtnis
verschwunden sind; nur Träume, aus denen man mitten
herausgerissen wird, pflegen eine genauere Erinnerung zu gestatten.
Unter bestimmten Körperbedingungen kann aber der Schlaf und
das Niederliegen der Urteilskraft von selbst so tief werden wie in
der Hypnose, und dann kann der Schläfer umhergehend und
handelnd weiterträumen, beim sogen. Schlaf- oder Traumwandeln
(s. Somnambulismus). Das Traumleben spielt in der
Völkerpsychologie und in den religiösen Vorstellungen
eine sehr bedeutende Rolle, und eine Anzahl der namhaftesten
Forscher auf diesem Gebiet nimmt an, daß sich die
Grundpfeiler der religiösen Lehrgebäude (namentlich der
Glaube an übernatürliche, den Schranken der Leiblichkeit,
der Zeit und des Raums entrückte Wesen, sowie an das Fortleben
nach dem Tod) vorzugsweise aus den Erfahrungen des Traumlebens
entwickelt haben. Das Naturkind nimmt eben das Geträumte
für Wirklichkeit; es glaubt im T. von seinen Göttern und
Toten besucht zu werden und meint anderseits, daß seine eigne
Seele, wenn es von fremden Ortschaften träumt, sich
vorübergehend vom Körper gelöst habe und frei
umherschwärme. Daher bildete der Tempeltraum noch bei manchen
Kulturvölkern einen Bestandteil des anerkannten Kults (vgl.
Traumdeutung). Auch neuere Mystiker, wie K. du Prel, sprechen noch
von "Eingebungen", Lösungen schwieriger Probleme im T., und
wollen dem Traumleben sogar einen höhern geistigen Wert
beimessen als dem wachen Leben; allein die erwähnten
Lösungen und Eingebungen, die von dem Träumenden
angestaunt werden, erweisen sich nach dem Erwachen meist als
vollendeter Blödsinn. Vgl. Scherner, Das Leben des Traums
(Berl. 1861); Maury, Le sommeil et les rêves (4. Aufl., Par.
1877); Siebeck, Das Traumleben der Seele (Berl. 1877); Spitta, Die
Schlaf- und Traumzustände der Seele (Tübing. 1878); Binz,
Über den T. (Bonn 1878); Radestock, Schlaf und T. (Leipz.
1879); Simon, Le monde des rèves (2. Aufl., Par. 1888).
Trauma (griech.), Wunde, äußere Verletzung;
daher traumatisch, s. v. w. durch eine Verletzung, Wunde etc.
entstanden. Traumatische Entzündung, eine Entzündung,
hervorgerufen durch Verwundung, Quetschung, Verletzung irgend eines
Körperteils (s. Gehirnbruch).
Traumaticin, s. Guttapercha.
Traumbücher, s. Traumdeutung.
Traumdeutung, die von der ehemals allgemein verbreiteten
Anschauung, daß der Traum das natürliche
Verbindungsmtttel mit der übersinnlichen Welt sei, und
daß der Träumende mit seinen Göttern und
verstorbenen Vorfahren verkehre und von ihnen Eingebungen,
Ratschläge und Winke für die Zukunft in einer Art
Bildersprache erhalte, veranlagte Bemühung, diese Bilder zu
deuten. Anderseits suchte man aber auch solche Traumoffenbarungen
absichtlich herbeizuführen. Bei den meisten Naturvölkern
übernimmt der Medizinmann oder Schamane gegen Bezahlung den
Auftrag, sich durch allerhand erprobte Mittel in Traumzustände
zu versetzen und dann die Götter oder Vorfahren über das
Schicksal einer Person zu befragen. Diese Traum- oder Totenorakel
bestanden noch bei Griechen und Römern; die peruanischen
Priester bedienten sich der scharf narkotischen Gräberpflanze
(Datura sanguinea), um Götter- und Ahnenerscheinungen zu
erhalten. Von der Rolle prophetischer Träume in der alten
Geschichte weiß Herodot und die Bibel zu erzählen:
Joseph und Daniel erlangten als Traumdeuter ihren Einsluß. In
Assyrien befand sich auf der Plattform der Stufenpyra-
809
Traumwandeln - Trautenau.
miden das Gemach, in welchem die babylonische Sibylle den
nächtlichen Besuch des Orakelgottes empfing, und das Amt
Daniels bei Nebukadnezar finden wir schon im altbabylonischen
Heldengedicht von Izdubar, dem sein Traumausleger Eabani als steter
Begleiter zur Seite steht. Von den Ägyptern hat Brugsch
mitgeteilt, daß sie zu solchen Zwecken die Hypnotisierung
durch Anschauen glänzender Gegenstände übten. Bei
den Griechen und Römern fanden Traumorakel, außer an den
Stätten der Totenorakel, namentlich in den Äskulaptempeln
statt; die Kranken (oder auch an ihrer Stelle die Priester)
streckten sich auf den Fellen frisch geopferter Widder nieder, und
aus der Art ihres Traums wurde das einzuschlagende Heilverfahren
von den Priestern gefolgert. Für die Kreise des Volkes, die
sich nicht wie die Fürsten einen eignen Traumdeuter halten
konnten, dienten früh Traumbücher, Aufzeichnungen
über die angebliche Bedeutung der einzelnen Träume. Das
älteste derselben hat man bruchstückweise auf Ziegelstein
in der Bibliothek von Ninive gefunden, und man kann dort lesen, was
es bedeutet, wenn man von Hunden, Bären, Tieren mit fremden
Füßen und andern Dingen träumt, die sich hier nicht
bezeichnen lassen. Im klassischen Altertum genoß dann des
höchsten Ansehens' das Traumbuch ("Oneirokritika") des
Artemidoros (s. d. 2), welches bald nach Erfindung der
Buchdruckerkunst auch in lateinischer Übersetzung gedruckt
wurde. Ein mohammedanisches Traumbuch gab Vattier nach dem
arabischen Text ("L'oneirocrite musulmane", Par. 1664) heraus. In
neuerer Zeit haben zwar die Naturphilosophen G. H. v. Schubert
("Die Symbolik des Traums", 4. Aufl., Leipz. 1862) und Pfaff ("Das
Traumleben und seine Deutung", 2. Aufl., Potsd. 1873) den Glauben
an vorbedeutende Träume zu retten gesucht, aber die
Traumbücher werden nur noch von der Landbevölkerung auf
Jahrmärkten gekauft. Vgl. Büchsenschütz, Traum und
T. im Altertum (Berl. 1868); Lenormant, Die Magie und Wahrsagekunst
der Chaldäer (deutsch, Jena 1878).
Traumwadeln, s. Somnambulismus.
Traun (lat. Truna), Fluß in Österreich,
entsteht im steirischen Salzkammergut aus den Gewässern des
Aufseer, Grundel- und Ödensees, fließt durch den
Hallstätter und den Gmundener oder Traunsee, bildet bei dem
Dorf Roitham einen Wasserfall (der durch einen Kanal umgangen wird)
und mündet nach 178 km langem Lauf unweit Linz in die Donau.
Ihre Zuflüsse bringen ihr das Wasser aller andern Seen des
Salzkammerguts: die Ischl vermittelt den Abfluß des St.
Wolfgangsees, die Ager den des Attersees, dem die Ach das Wasser
aus dem Mondsee, Zeller See und Fuschelsee zuführt, endlich
die Alm den Abfluß des Almsees. Außerdem empfängt
die T. die Krems. Die Schiffahrt auf derselben, einst sehr lebhaft,
hat durch die Eisenbahnen Eintrag erlitten.
Traun, Julius von der, Pseudonym, s. Schindler 1).
Traunsee (Gmundener See), einer der schönsten Seen
der Deutschen Alpen (s. Karte "Salzkammergut"), liegt bei der Stadt
Gmunden in Oberösterreich, 422 m ü. M., ist 12 km lang, 3
km breit und 191 m tief, bedeckt eine Fläche von 24,6 qkm und
wird von S. nach N. von der Traun durchflossen. Die Ufer sind im N.
und W. wohlbebaut und dicht bevölkert (hier befinden sich die
schönen Villen der Familien Toscana, Hannover, Herzog von
Württemberg etc.); nur im O. und S. ragen steile
Felswände aus dem grünen Gewässer empor. Am Ostufer
erhebt sich der Traunstein zu 1661 m Höhe. Der See hat bei
normalem Wetter seinen regelmäßigen Passatwind, wirbelt
aber oft ohne deutlich sichtbare Ursache heftig auf und friert sehr
selten zu (zuletzt 1830 und 1880). Köstliche Fische
(Lachsforellen, Saiblinge, Hechte etc.) bevölkern ihn.
Zwischen Gmunden, am Nordende, der Saline Ebensee, am Südende,
und dem reizend auf einer Landzunge am Westufer gelegenen
Traunkirchen (mit schöner Pfarrkirche und 523 Einw.) besteht
rege Dampfschiffahrt. Längs des Westufers zieht sich die
Salzkammergutbahn hin.
Traunstein, unmittelbare Stadt und klimatischer
Terrainkurort im bayr. Regierungsbezirk Oberbayern, an der Traun,
Knotenpunkt der Linien Salzburg-München und T.-Trostberg der
Bayrischen Staatsbahn, 534 m ü. M., hat eine schöne kath.
Kirche, eine Realschule, ein Institut der Englischen Fräulein,
ein Waisenhaus, ein Landgericht, ein Forstamt, eine große
Saline (s. Reichenhall), ein Solbad, große Brauereien,
bedeutenden Holzhandel und (1885) 4820 meist kath. Einwohner. In
der Umgegend große Waldungen mit hübschen
Spaziergängen und das schön gelegene Bad Empfing mit
alkalisch-erdiger Mineralquelle. Zum Landgerichtsbezirk T.
gehören die 13 Amtsgerichte zu Aibling, Altötting,
Berchtesgaden ,Burghausen, Laufen, Mühldorf, Prien,
Reichen-hall, Rosenheim, Tittmoning, T., Trostberg und Wasserburg.
Vgl. Sailer, Traunstein (Münch. 1886).
Trauordnung, s. Trauung.
Trauringe, s. Trauung und Ring.
Trausnitz, 1) Pfarrdorf im bayr. Regierungsbezirk
Oberpfalz, Bezirksamt Nabburg, mit (1885) 541 Einw. Im dortigen
Schloß wurde der 1322 in der Schlacht bei Mühldorf
gefangen genommene Erzherzog Friedrich der Schöne von
Österreich bis 1325 vom Kaiser Ludwig dem Bayern gefangen
gehalten. -
2) Über der Stadt Landshut in Niederbayern gelegenes
ehemaliges Residenzschloß der Herzöge von Niederbayern
(1255-1340) und von Bayern-Landshut (1402-1503), um 1230 erbaut,
enthält das Kreisarchiv von Niederbayern, in neuerer Zeit
restauriert.
Trautenau, Stadt im nordöstlichen Böhmen, im
Aupathal des Riesengebirges, an der Österreichischen
Nordwestbahn (Linie Chlumetz-Parschnitz, mit Abzweigung nach
Freiheit), ist nach einer großen Feuersbrunst seit 1861
größtenteils neu gebaut, hat 4 Vorstädte, eine
schöne Dechanteikirche, eine Bezirkshauptmannschaft, ein
Bezirksgericht und Hauptzollamt, eine Oberrealschule,
Lehrerbildungsanstalt, 2 Flachsspinnereien (40,000 Spindeln), eine
Kunstmühle, Bierbrauerei, Papierwarenfabrik, Gasanstalt,
große Flachs-, Garn- und Leinwandmärkte, eine Filiale
der Böhmischen Eskomptebank, Sparkasse (Einlagen 4,3 Mill.
Guld.) und (1880) 11,253 Einw. In der Nähe mehrere andre
Flachsspinnereien und Steinkohlenwerke. - T. bildete während
des österreichisch-preußischen Kriegs im Sommer 1866 den
Schauplatz wiederholter Kämpfe. Am 27. Juni wurde das 1.
preußische Korps unter Bonin beim Einrücken in
Böhmen bei T. vom 10. österreichischen Korps unter
Gablenz zurückgeschlagen. Die Österreicher verloren 190
Offiziere und 4596 Mann an Toten und Verwundeten, die Preußen
56 Offiziere und 1282 Mann. Vgl. Roth, Achtzig Tage in
preußischer Gefangenschaft und die Schlacht bei T. 27. Juni
1866 (3.Aufl., Prag 1868). Im zweiten Gefecht von T., auch als
Gefecht bei Soor oder bei Burkersdorf und Altrognitz bezeichnet,
ward das 10. österreichische Korps unter Gablenz 28. Juni von
der preußischen Garde geschlagen und verlor 4000 Gefangene, 2
Fahnen und 10 Geschütze. Vgl.
810
Trautmann - Trauung.
Simon Hüttels "Chronik der Stadt T. 1484-1601" (bearbeitet
von Schlesinger, Prag 1881).
Trautmann, 1) Franz, Schriftsteller, geb. 28. März
1813 zu München als Sohn des Hofjuweliers T., verlebte einen
Teil seiner Jugend im Kloster Wessobrunn, wo ihm eine Fülle
romantischer Eindrücke zuströmte, studierte in
München die Rechte und trat dann beim Münchener
Stadtgericht in die juristische Praxis ein, verließ aber
dieselbe nach sieben Jahren, um sich hinfort, in seiner Vaterstadt
lebend, ausschließlich der schriftstellerischen
Thätigkeit und eingehenden Kunststudien zu widmen. Bereits mit
17 Jahren hatte er ein Bändchen "Gedichte" herausgegeben, dem
andres Lyrische folgte, dann eifrig an verschiedenen Blättern
mitgearbeitet, sich auch hin und wieder in dramatischen Arbeiten
versucht, bis er sich endlich dem Gebiet zuwandte, das recht
eigentlich seine Domäne ward, und auf dem er die allgemeinste
Anerkennung fand. Seine dem Mittelalter entnommenen
Erzählungen gehören zu den vorzüglichsten
Leistungen, welche unsre Litteratur in dieser Richtung aufzuweisen
hat. Den Reigen derselben eröffnete die köstliche
Geschichte von "Eppelein von Gailingen" (Frankf. 1852). In rascher
Folge schlossen sich derselben an: "Die Abenteuer des Herzogs
Christoph von Bayern" (Frankf. 1853, 2 Bde.; 3. illustr. Aufl.,
Regensb. 1880); "Die gute alte Zeit", Münchener Geschichten
(Frankf. 1855); der Schelmenroman "Chronika des Herrn Petrus
Nöckerlein" (das. 1856, 2 Bde.); "Das Plauderstüblein"
(Münch. 1855); das "Münchener Stadtbüchlein" (das.
1857). Weiter folgten: "Münchener Geister" (Münch. 1858);
"Heitere Städtegeschichten aus alter Zeit" (Frankf. 1861); das
satirische Buch "Leben, Abenteuer und Tod des Theodosius
Thaddäus Donner" (das. 1864); der Roman "Die Glocken von St.
Alban" (Regensb. 1875, 3 Bde.; 2. Aufl. 1884); "Meister Niklas
Prugger, der Bauernbub von Trudering" (das. 1878, 3 Bde.); "Heitere
Münchener Stadtgeschichten" (Münch. 1881); "Im
Münchener Hofgarten, örtliche Skizzen und
Wandelgestalten" (das. 1884) und "Aus dem Burgfrieden.
Alt-Münchener Geschichten" (Augsb. 1886). Von seinen lyrischen
Arbeiten der spätern Zeit sind die Sammlungen: "Astern und
Rosen, Disteln und Mimosen", Zeitgedichte (Berl. 1870), "Hell und
Dunkel" (das. 1885) und "Traum und Sage" (das. 1886), von den
dramatischen die Lustspiele: "Frauenhuld tilgt jede Schuld^ (1853)
und "Meine Ruh' will ich, oder: Blemers Leiden" (1864) zu
erwähnen. T. starb 2. Nov. 1887 in München. Die
Ergebnisse seiner Kunststudien, behufs deren er auch ausgedehnte
Reisen in Deutschland, nach England und Schottland unternommen,
legte er nieder in dem Werke "Kunst und Kunstgewerbe vom
frühsten Mittelalter bis Ende des 18. Jahrhunderts"
(Nördling. 1869). Auch veröffentlichte T. eine Biographie
Schwanthalers ("L. Schwanthalers Reliquien", Münch. 1858).
2) Moritz, Philolog, geb. 24. März 1847 zu Kloden in der
Provinz Sachsen, studierte zu Halle und Berlin klassische
Philologie und neuere Sprachen, machte 1867-70 Reisen nach Italien,
Frankreich und England, war dann als Gymnasiallehrer in Leipzig
thätig, habilitierte sich für englische Sprache und
Litteratur daselbst und wurde 1880 als außerordentlicher
Professor nach Bonn berufen, 1885 zum ordentlichen Professor
daselbst befördert. Sein Hauptwerk ist: "Die Sprachlaute im
allgemeinen und die Laute des Englischen, Französischen und
Deutschen insbesondere" (Leipz. 1886). Außerdem schrieb er:
"Über Verfasser und Entstehungszeit einiger alliterierender
Gedichte des Altenglischen" (Halle 1876), "Lachmanns
Betonungsgesetze und Otfrieds Vers" (das. 1877) u. a.
Trauttmansdorff, österreich. Adelsgeschlecht, in
ältester Zeit auf Stuchsen (Stixenstein) im Wienerwald
seßhaft; von demselben sollen in der Schlacht auf dem
Marchfeld (1278) 14, bei Mühldorf (1322) 20 Mitglieder unter
habsburgischem Banner gefallen sein. Das Geschlecht erhielt 1625
die reichsgräfliche und 1805 die reichsfürstliche
Würde und teilte sich im 17. Jahrh. in mehrere Linien. Der
erste Fürst war Ferdinand, geb. 12. Jan. 1749, gest. 27. Aug.
1827 als k. k. Obersthofmeister; jetziger Fürst ist Karl, geb.
5. Sept. 1845. Bemerkenswert sind:
1) Maximilian, Graf von T., österreich. Staatsmann, geb.
23. Mai 1584 zu Graz, gewann seine Bildung teils durch Studien,
teils auf Reisen und in Feldzügen, erwarb sich durch seinen
Übertritt zum Katholizismus die Gunst Ferdinands II.,
schloß 1619 dessen Bündnis mit Maximilian von Bayern und
verabredete dann als kaiserlicher Gesandter in Rom mit dem Papst
und dem spanischen Gesandten die gemeinschaftlichen Maßregeln
zur Führung des Kriegs. Er war einer der ersten, welche
Wallenstein bei dem Kaiser hochverräterischer Absichten
beschuldigten, und ward mit zur nähern Untersuchung des
Tatbestandes in dessen Lager abgesendet. Nach der Nördlinger
Schlacht 1634 bewog er den Kurfürsten von Sachsen, sich von
Schweden zu trennen, und 1635 schloß er den Frieden zu Prag
ab. Bei den Friedensunterhandlungen zu Münster und
Osnabrück fungierte er als kaiserlicher Prinzipalkommissarius
und hatte den wesentlichsten Anteil am Zustandekommen des Friedens.
Er starb 7. Juli 1650 in Wien als Hauptgünstling Kaiser
Ferdinands III. und dessen Prinzipalminister.
2) Ferdinand, Graf, österreich. Staatsmann, geb. 27. Juni
1825, widmete sich wie sein Vater Graf Joseph von T., der
längere Zeit österreichischer Gesandter in Berlin war und
1870 starb, dem diplomatischen Beruf, war mehrere Jahre
Gesandtschaftssekretär in London, dann Legationsrat in Berlin,
ward 1859 als außerordentlicher Gesandter und
bevollmächtiger Minister an den badischen Hof nach Karlsruhe
versetzt, wo er den Großherzog 1863 zur Teilnahme am
Fürstentag in Frankfurt a. M. und 1866 zur Teilnahme am Kriege
gegen Preußen zu bewegen wußte, 1867 zum Gesandten in
München befördert und 1868 zum Botschafter bei der
päpstlichen Kurie in Rom ernannt. 1872 legte er diesen Posten
nieder und ward zum zweiten Vizepräsidenten des Herrenhauses
ernannt, dem er schon längere Zeit als Mitglied
angehörte. Als nach dem konservativ-partikularistischen
Ausfall der Wahlen zum Abgeordnetenhaus im Juli 1879 Fürst
Carlos Auersperg das Amt eines ersten Präsidenten des
Herrenhauses niederlegte, ward T. vom Kaiser zu seinem Nachfolger
und 1884 zum Oberstkämmerer ernannt.
Trautv. et Mey., bei botan. Namen Abkürzung für
E. R. v. Trautvetter, Professor der Botanik in Kiew, bereiste
Sibirien. Salix, Pentastemon. Flora Nordrußlands. - Mey., s.
d.
Trauung (Kopulation), die kirchliche Weihe eines
Ehebundes. Auch die in der gesetzlichen Form erfolgende
Eheschließung wird als T. bezeichnet, und man spricht daher
von einer Ziviltrauung, wenn die amtliche Bestätigung des
Ehebundes durch eine weltliche Behörde (Standesamt) erfolgt.
Nachdem jedoch in Deutschland die obligatorische Zivilehe
eingeführt ist (s. Ehe, S. 339), versteht man unter T.
schlechthin regelmäßig nur die kirchliche Einsegnung der
Eheleute, nachdem die Eheschließung selbst vor dem
811
Travailleur-Expedition - Travankor.
weltlichen Standesbeamten erfolgt ist. Im ältern deutschen
Recht ist T. die Übergabe der Braut in die Schutzgewalt
(Mundium) des Verlobten, dem sie "anvertraut" wird. Fast bei allen
Völkern werden eheliche Bündnisse mit gewissen Zeremonien
gestiftet (s. Hochzeit). Die T. in der christlichen Kirche ist aber
weder von Christus noch von der alten Kirche angeordnet. Zwar ward
es bald Sitte, das Verlöbnis dem Bischof oder
Kirchenältesten anzuzeigen, und zum wirklichen Anfang der Ehe
wurde die kirchliche Einsegnung häufig begehrt und erteilt;
ein die Gültigkeit der Ehe bedingendes Erfordernis ward jene
aber erst im 9. Jahrh., im Abendland durch Karl d. Gr., für
die griechische Kirche durch Leo VI. Philosophus. Auch Papst
Nikolaus I. machte die Gültigkeit des ehelichen
Bündnisses davon abhängig, daß dieses mit dem
kirchlichen Segen und einer Messe geschlossen sei. Noch aber
erfolgte die Eheschließungserklärung vor dieser
Brautmesse. Erst seit 1100 etwa befragt der segnende Priester die
Eheschließenden um die Ernstlichkeit ihres Vorhabens. Aber
noch die großen Dichtungen des deutschen Mittelalters lassen
die Paare erst am Tag nach ihrer Verehelichung sich zur Kirche
begeben, und erst seit dem 15. Jahrh. finden sich
Trauungsformulare, in welchen der Priester als Stellvertreter
Gottes die Eheleute zusammenspricht. Aber selbst das tridentinische
Konzil verlangt zur Gültigkeit einer Ehe nur die
Willenserklärung derselben vor dem Pfarrer und zwei oder drei
Zeugen, ohne die T. selbst für etwas Wesentliches zu
erklären. Dies that erst die protestantische Kirche, und so
herrschte bald in der alten wie in der neuen Kirche dieselbe
Praxis, wonach die Ehe ganz als Kirchensache behandelt, ihre
Gültigkeit aber von der kirchlichen T. abhängig gemacht
ward. Die T. wurde vollzogen, wenn nach dem öffentlichen
Aufgebot kein Einspruch erfolgte. Das tridentinische Konzil
erklärte die Advents- und Fastenzeit für geschlossene
Zeiten, d. h. Zeiten, in denen Trauungen nicht stattfinden sollen.
Neuere evangelische Trauordnungen haben die geschlossenen Zeiten
erheblich reduziert, so z. B. in Preußen auf die Karwoche,
die ersten Festtage der drei hohen Feste, das Totenfest und die
Bußtage. Der Ort der T. ist die Kirche; zu Haustrauungen
bedarf es einer besondern Dispensation. Die T. wird von dem Pfarrer
verrichtet, in dessen Kirchspiel die Braut einheimisch ist (ubi
sponsa, ibi copula); zum Vollzug an einem andern Ort gehört
das Dimissoriale (Entlassungsschein) des berechtigten Geistlichen.
Neuere Gesetze erklären aber auch den Pfarrer am Wohnort des
Bräutigams sowie denjenigen des Wohnorts, welchen die Eheleute
nehmen, für zuständig. In der katholischen Kirche
gehört das schon bei den alten Griechen, Römern und
Germanen übliche Wechseln der Trauringe zu den notwendigen
Formalitäten der T., was bei den Protestanten meist schon bei
der Verlobung geschieht. In der griechischen Kirche trinken die
eine metallene Krone tragenden Verlobten vor der Einsegnung Wein
aus einem vom Priester dargereichten Kelch. Von den
Hochzeitskränzen, die in der alten Kirche beiden Verlobten bei
ihrer Einsegnung aufgesetzt wurden, ist unter den
abendländischen Christen nur noch der Brautkranz als Bild der
unverletzten Jungfrauschaft übriggeblieben und die
Verweigerung desselben für solche, die nicht mehr Jungfrauen
sind, als Mittel der Kirchenzucht. Fürstliche Personen lassen
ihre Bräute, wenn sie weit von ihnen entfernt wohnen, zuweilen
mittelbar durch einen Bevollmächtigten sich antrauen (T. durch
Prokuration). Bei morganatischen Ehen wird die T. "zur linken Hand"
bewirkt (s. Ebenbürtigkeit). Personen, die 50 Jahre in der Ehe
gelebt haben, werden als Jubelpaar gewöhnlich wieder kirchlich
eingesegnet. Die katholische Kirche verlangt bei gemischten Ehen,
daß das Paar jedenfalls von einem ihr angehörigen
Geistlichen eingesegnet sowie daß das Versprechen gegeben
wird, die Nachkommenschaft der katholischen Kirche zuzuführen.
Ist dies nicht zu erreichen, so leistet der katholische Geistliche
bei der T. nur "passive Assistenz". Nach dem deutschen Reichsgesetz
vom 6. Febr. 1875 darf kein Geistlicher eine T. vornehmen, bevor
ihm nachgewiesen ist, daß die Ehe vor dem Standesbeamten
abgeschlossen worden. Die ausdrückliche Erklärung des
Personenstandsgesetzes, daß die kirchlichen Verpflichtungen
in Beziehung auf die T. durch dies Gesetz nicht berührt
werden, enthält eigentlich nur etwas
Selbstverständliches. Die katholische Kirche, welche die Ehe
als Sakrament auffaßt und das bürgerliche
Eheschließungsrecht grundsätzlich ignoriert, hat nach
der Einführung der Zivilehe in Deutschland sich nicht
veranlaßt gesehen, den bisherigen Ritus bei der T. zu
verändern. Dagegen haben die in den einzelnen Staaten
erlassenen protestantischen Trauordnungen (z. B. preußisches
Kirchengesetz vom 30. Juli 1880, Trauordnung für die Provinz
Hannover von 1876, für Bayern von 1879, Sachsen von 1876,
Württemberg von 1875, badische Agende von 1879 etc.)
namentlich das sogen. Trauformular, d. h. die agendarische Formel,
mit welcher der Geistliche die Eheschließenden zusammengibt,
abgeändert, indem dabei der Gedanke zum Ausdruck gebracht
wird, daß die Ehe selbst bereits abgeschlossen sei. Die von
den Eheleuten zu bejahende Gelöbnisfrage des Geistlichen ist
dem entsprechend nur darauf gerichtet, ob die Eheleute als
christliche Ehegatten einträchtig miteinander leben, einander
treu und herzlich lieben, sich weder in Leid noch in Freud'
verlassen, sondern den Bund der christlichen Ehe heilig und
unverbrüchlich halten wollen, bis der Tod sie einst scheiden
werde. Das vorgängige kirchliche Aufgebot ist meistens als
eine einmalige "Eheverkündigung" beibehalten, sei es vor, sei
es nach dem bürgerlichen Aufgebot; doch ist Dispens von dem
erstern zulässig. Eine ohne nachfolgende kirchliche T. nur vor
dem Standesbeamten geschlossene Ehe ist bürgerlich
gültig. Die Kirche kann nur durch Disziplinarmittel auf die
Nachholung einer unterlassenen T. hinwirken. Als Kirchenzuchtmittel
kennt die protestantische Kirche bei hartnäckiger Verweigerung
der Traupflicht die Entziehung der kirchlichen Wahlrechte, mitunter
auch die Unfähigkeit zur Patenschaft oder auch die
Ausschließung vom Abendmahl. Vgl. Friedberg, Das Recht der
Eheschließung (Leipz. 1865); Derselbe, Verlobung und T. (das.
1876); Sohm, T. und Verlobung (Weim. 1876); Derselbe, Zur
Trauungsfrage (Heilbronn 1879); Dieckhoff, Zivilehe und kirchliche
T. (Rost. 1880); v. Scheurl, Das gemeine deutsche Eherecht (Erlang.
1882); Grünwald, Die Eheschließung (nach den
Bestimmungen der verschiedenen Staaten, Wien 1881).
Travailleur-Expedition 1880-82, s. Maritime
wissenschaftliche Expeditionen, S. 257.
Travankor (Travancore), britisch-ind. Vasallenstaat auf
der Südspitze (Westseite) von Vorderindien, 17,230 qkm (319
QM.) groß mit (1881) 2,401,158 Einw. (498,542 Christen, nur
146,909 Mohammedaner, im übrigen Hindu). Von der flachen
Küste, hinter der sich Strandseen hinziehen, welche als
vorzügliches Kommunikationsmittel dienen, steigt das Land
812
Trave - Trawna.
allmählich zu den bis 2500 m hohen Bergzügen auf,
welche die östliche Grenze bilden. In den Ebenen werden Reis,
Kokos- und Arekapalmen, Pfeffer, Tapioka, in den Hügeln
Kardamome und Kaffee kultiviert, die Wälder enthalten
vorzügliche Holzarten (Teak-, Ebenholz) sowie zahlreiche
Elefanten, Tiger, Leoparden, Bären, große Hirscharten.
Das Klima an der Küste ist heiß, der Regenfall stark.
Die Verwaltung ist eine gute, für das Schulwesen wird gesorgt,
eine höhere Schule zu Trivandrum ist gut besucht. Die
Einkünfte betragen 600,000 Pfd. Sterl. jährlich. Die
Armee besteht aus 1470 Mann mit 4 Geschützen; die Post hat 87
Ämter. Hauptstadt ist Trivandrum (s. d.). Der erste
Freundschaftsvertrag mit England wurde 1788 geschloffen, der letzte
1805, wodurch T. in ein Vasallenverhältnis zu England
trat.
Trave, Fluß in Norddeutschland, entspringt bei
Giesselrade in dem zu Oldenburg gehörigen Amt Ahrensbök,
geht bald nach Schleswig-Holstein über, fließt hier erst
südwestlich durch den Wardersee nach Segeberg, auf dieser
Strecke bei Travenhorst durch den Seekamper und Seedorfer See, mit
der Tensfelder Aa (zum Plöner See) zusammenhängend, dann
nach S. bis Oldesloe, wendet sich hierauf nach O. und NO. und tritt
in das lübecksche Gebiet, wo sie sich unterhalb Lübeck
seeartig erweitert und kurz vor ihrer Mündung bei
Travemünde in die Lübische Bucht die Pötenitzer Wiek
bildet, mit welcher der Dassower See zusammenhängt. Die T. ist
112 km lang, von Oldesloe ab 38 km schiffbar, trägt von
Lübeck ab Seeschiffe bis zu 5 m Tiefgang und nimmt links die
Schwartau, rechts die Beste, die Stecknitz, aus welcher der
Stecknitzkanal zur Elbe führt, die schiffbare Wakenitz und
durch den Dassower See die schiffbare Stepenitz auf.
Traveller (engl., spr. träwweler), Reisender.
Travemünde, Amts- und Hafenstadt im Gebiet der
Freien Stadt Lübeck, an der Mündung der Trave und an der
Eisenbahn Lübeck-T., hat eine evang. Kirche, einen Leuchtturm,
ein besuchtes Seebad, Schiffahrt, Fischerei, eine Lotsenstation,
eine Station der Deutschen Gesellschaft zur Rettung
Schiffbrüchiger und (1885) 1666 fast nur evang. Einwohner. T.
gehört seit 1329 dauernd zu Lübeck. Vor der Vollendung
der Stromlaufkorrektion der Trave war T. der Hafenort für
Lübeck.
Traventhal (Travendal), Amtsort im preuß.
Regierungsbezirk Schleswig, Kreis Segeberg, an der Trave, mit einem
frühern Lustschloß der Herzöge von
Holstein-Plön, Landesgestüt und 160 Einw., ist
bemerkenswert wegen des hier 18. Aug. 1700 zwischen Karl XII. von
Schweden und Friedrich IV. von Dänemark abgeschlossenen
Friedens, worin letzterer den Herzog Friedrich IV. von
Holstein-Gottorp zu entschädigen und das Bündnis mit
Polen und Rußland aufzugeben versprach.
Travers (das, franz., spr. -währ), Quere,
Unregelmäßigkeit; Grille, Wunderlichkeit.
Travers, Val de (spr. wall d'trawähr), Thal im
schweiz. Kanton Neuenburg, von der Areuse (fälschlich La
Reuse) durchflossen und der Eisenbahn Pontarlier-Neuchâtel
durchzogen, öffnet sich vor Boudry zur Ebene des Neuenburger
Sees und enthält in elf Gemeinden eine protestantische,
gewerbfleißige Bevölkerung von (1888) 16,664 Seelen.
Seine Asphaltminen sowie die Fabrikation von Schokolade und Absinth
haben ihm Ruhm verschafft. Der Asphalt, in der Nähe des an der
genannten Eisenbahn liegenden Dorfs T. (2000 Einw.), bildet ein
Lager von 6 m Mächtigkeit mit einem durchschnittlichen
Bitumengehalt von 10 Proz. Aus dem Thalkessel von St.-Sulpice (779
m ü. M.) steigt die Bahn zu den Höhen von Les
Verrières (933 m) an, zwei Grenzorten, Verrières
Suisses und Verrières Françaises. Hier betrat 1.
Febr. 1871 die geschlagene Armee Bourbakis, 80,000 Mann stark, den
Boden der Schweiz, um von den Schweizer Milizen entwaffnet und
interniert zu werden. Hauptort des Thals ist Motiers; aber die
volkreichsten Gemeinden sind Fleurier (3208 Einw.) und Couvet (2285
Einw.).
Traverse (franz., "Querstück, Querweg"), in der
Kriegsbaukunst ein Querwall, der hinter der Brustwehr von
Befestigungen senkrecht zu dieser aufgeworfen wird, um die
Verteidiger gegen Feuer von seitwärts zu decken. Die T. ist
entweder voll in Erde angeschüttet, Volltraverse, oder mittels
Schanzkörben, resp. in Mauerwerk als Hohltraverse
aufgeführt zum Schutz für Mannschaften und leichte
Geschütze und heißt dann Schutzhohlraum. Befindet sich
in einem solchen eine Geschoßhebevorrichtung, so heißt
die T. Munitionsfördertraverse. Sie liegt senkrecht über
dem Verbrauchsgeschoßmagazin des Ladesystems (s. d.). In den
Flügelmauern der Hohltraversen befinden sich durch
Stahlblechläden geschlossene Munitionsnischen. - T.
heißt auch eine Querschranke, ein Querverschlag in einem
Saal; im Bauwesen ein eiserner Träger; an Dampfmaschinen auch
die Teile zwischen Kolbenstange und Balancier.
Traversieren (franz., travers reiten), der Quere nach
bewegen, durchschneiden, überschreiten; in der Reitkunst
Schullektion, bei welcher das Pferd auf zwei Hufschlägen, und
zwar mit dem Vorderteil gegen die Wand, mit dem Hinterteil gegen
das Innere der Bahn gerichtet, sich so vorwärts bewegt,
daß die äußern Beine vor und über die
inwendigen gesetzt werden. Die Vorhand beschreibt somit den
größern Kreis (vgl. Renversieren). In der Fechtkunst
bedeutet der Ausdruck: seitwärts ausfallen.
Travertin (Lapis Tiburtinus), Kalktuffbildungen in
Italien, bildet stellenweise mächtige Ablagerungen, z. B. bei
Tivoli (Tibur), und ist seit dem Altertum ein gesuchtes Baumaterial
(Kolosseum, Peterskirche etc.). Vgl. Kalktuff.
Travestie (vom ital. travestire, verkleiden), eine
komische (auch wohl satirische) Dichtungsart, in welcher ein ernst
gemeintes poetisches Erzeugnis dadurch lächerlich gemacht
wird, daß dessen Inhalt beibehalten, aber in eine zu
demselben nicht passende äußere Form gekleidet
(verkleidet, daher der Name) wird, während bei der Parodie (s.
d.) das Umgekehrte geschieht, d. h. die Form beibehalten, aber ihr
ein unpassender Inhalt gegeben wird. In Hinsicht der Form kann die
T. episch, lyrisch und dramatisch sein. Unter den Neuern hat die
französische Frivolität sich am meisten dieses Feldes
bemächtigt; vorzugsweise sind hier Marivaux und Scarron zu
nennen. In Deutschland wird die T. fast allein durch Blumauers
"Äneide" vertreten, hinter welcher der holländische
"Virgilius in de Nederlanden", von Leplat im 18. Jahrh. gedichtet,
weit zurücksteht.
Traviata (ital.), die Verirrte, Verführte.
Trawl (engl., spr. trahl), Schleppnetz, s. Fischerei, S.
304.
Trawna, Kreishauptstadt in Bulgarien, am Balkan,
über den von hier der Paß von T. führt, das
"bulgarische Nürnberg" genannt, liefert treffliche
Holzschnitzereien und Heiligenbildnisse, Posamentierarbeiten,
Rosenöl, Decken und andre Artikel aus Pferdehaar etc. und
hatte 1881: 2222 Einw. In der Nähe ein großes, aber noch
unbenutztes Kohlenflöz.
813
Trawnik - Trebonius.
Trawnik, Kreisstadt in Bosnien, im schmalen Lasvathal
gelegen und teilweise auf einer steilen Lehne einer Seitenschlucht
erbaut, bietet mit seinen zahlreichen Minarets, Kuppeln und
Bauminseln, den steilen Felshöhen des Vlasic, der alten
Burgfeste, den imposanten Kasernenbauten sowie den zahllosen
Landhäuschen und Kiosken von der Ferne einen herrlichen
Anblick. T. hat 16 Moscheen und (1885) 5933 meist mohammedan.
Einwohner und ist Sitz eines Militär-Platzkommandos und
Kreisgerichts. Bis 1850 war T. die eigentliche Hauptstadt und die
Residenz des bosnischen Gouverneurs. Das Trawniker Becken
enthält reiche Braunkohlenlager.
Traz os Montes (spr. tras. "jenseit der Berge"), die
nordöstlichste Provinz Portugals, grenzt nördlich und
östlich an Spanien, südlich an die Provinz Beira,
westlich an Minho und umfaßt 11,156 qkm (201,9 QM.), nach
Strelbitsky nur 11,033 qkm, mit (1878) 393,279 Einw. Diese Provinz
ist das am höchsten gelegene Terrain Portugals und von wilden
Felsgebirgen durchzogen. Das höchste Gebirge, die Serra de
Monte Zinho, mit Heiden bedeckt, steigt bis zu 2270 m auf; aus der
Provinz Minho ziehen sich die Serra de Gerez und Serra de
Marão herüber; niedriger sind die südlichen
Bergreihen. Der Hauptfluß ist der Douro, welcher die Ost- und
Südgrenze der Provinz bildet und von hier den Sabor, die Tua
und die Tamega aufnimmt. Das Klima ist im Sommer sehr heiß,
im Winter aber rauh und kalt. Der Boden, obgleich meist felsig und
steinig, ist doch in vielen Gegenden trefflich angebaut. Der Norden
erzeugt Roggen und Weizen, Flachs und Hanf, der Süden Mais,
Mandeln und Orangen; Haupterzeugnis aber ist der Wein, besonders am
obern Douro (Portwein). Die Provinz ist reich an Erzen (besonders
Eisen), welche aber nicht mehr ausgebeutet werden, und hat auch
mehrere Mineralquellen. Die Bewohner charakterisiert der heitern
Bevölkerung der Provinz Minho gegenüber ein düsteres
und abergläubisches Wesen. Ausfuhrartikel sind namentlich:
Maulesel, Wolle, Seide und Wein. Die Provinz zerfällt in die
beiden Distrikte Villa Real und Braganza. Hauptstadt ist
Braganza.
Treasure (engl., spr. tresch'r), Schatz; Treasurer,
Schatzmeister; Lord High Treasurer (First Lord of the Treasury),
Großschatzmeister; Treasury, Schatzkammer, Schatzamt;
Treasury Note, Schatzschein, Kassenschein. Der First Lord of the
Treasury in England ist gewöhnlich der erste Minister, und
sein Departement (Treasury) kontrolliert sämtliche Einnahmen
und Ausgaben des Staats, während der eigentliche
Finanzminister den Titel Chancellor of the Exchequer
führt.
Trebbia (im Altertum Trebia), Fluß in Oberitalien,
entspringt am Nordabhang des ligurischen Apennin in der Provinz
Genua, fließt nordöstlich, tritt in die Provinz Piacenza
und fällt dort nach einem Laufe von 115 km oberhalb der Stadt
Piacenza rechts in den Po. Die T. ist historisch berühmt durch
zwei Schlachten: in der ersten besiegte Hannibal 218 v. Chr. den
römischen Konsul Sempronius Longus. Die zweite fand 17.-20.
Juni 1799 statt zwischen den Franzosen unter Macdonald und den
vereinigten Österreichern und Russen unter Suworow, wobei
erstere unterlagen.
Trebbin, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Potsdam,
Kreis Teltow, an der Nuthe und an der Linie Berlin-Halle der
Preußischen Staatsbahn, 39 m ü. M., hat eine evang.
Kirche, ein Amtsgericht, Zigarrenfabrikation, Dampfdrechslerei,
Ziegelbrennerei und (1885) 2855 meist evang. Einwohner. Hier 21.
Aug. 1813 siegreiches Gefecht des französischen Korps Oudinot
gegen die preußische Brigade v. Thümen.
Trebel, Fluß im preuß. Regierungsbezirk
Stralsund, entspringt im Kreis Grimmen, fließt westlich und
südöstlich, bildet eine Strecke weit die Grenze Pommerns
gegen Mecklenburg, steht durch den Mohrgraben mit der Recknitz in
Verbindung und mündet bei Demmin links in die Peene. Sie ist
bei hohem Wasserstand 28 km weit schiffbar.
Trebellins Maximus, röm. Konsul 62 n. Chr., nach
welchem der Senatsschluß über die Universalfideikommisse
(senatusconsultum Trebellianum) benannt ist, womit Justinian das
Pegasianische Senatuskonsult (unter Vespasian) verschmolz, das vom
Abzug des rechtmäßigen Viertels handelt. Letzteres
heißt daher Quarta Trebelliana.
Treber (Träber, Trester, Seih), die ausgezogenen
Malzhülsen der Bierbrauereien und die ausgepreßten
Weintrauben. Erstere bilden ein wertvolles Viehfutter, dessen
Nahrungswert mit der Stärke des Biers schwankt. Am besten
eignen sich die T. zu Milchfutter. 100 kg Darrmalz liefern
durchschnittlich 133 kg nasse T., welche, auf den Darrungsgrad des
Malzes zurückgebracht, 33 kg betragen. Die Weintreber
verfüttert man mit Spreu, Häcksel, Ölkuchen,
Getreideschrot für Rindvieh, Schafe und Schweine; auch dienen
sie zur Bereitung von Tresterwein, Branntwein, Essig,
Grünspan, Leuchtgas, Frankfurter Schwarz.
Treberausschlag, s. v. w. Schlempemauke, s. Mauke.
Trebinje, Bezirksstadt in Bosnien, Kreis Mostar, am
Fluß Trebincica, leicht befestigt, hat ein Schloß und
(1885) 1659 Einw., ist Sitz eines katholischen Bischofs, eines
Militär-Platzkommandos und Bezirksgerichts und war früher
die Hauptstadt des Fürstentums Terbunia. Sehr interessant ist
das gegen NW. sich hinziehende Thal der Trebincica, auch
Popovopolje (Popenfeld) genannt, zu dem ein steiler Geröllpfad
hinaufführt. Daselbst wohnen die im ganzen Land herumziehenden
Mauren (Katholiken).
Trebisonda, Stadt, s. Trapezunt.
Trebitsch, Stadt in Mähren, an der Iglawa und der
Eisenbahn Brunn-Okrzisko, Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und
eines Bezirksgerichts, besteht aus der eigentlichen Stadt, 5
Vorstädten und der Judenstadt, hat ein gräflich
Waldsteinsches Schloß mit schöner Schloßkirche und
Park, eine baulich interessante Abteikirche im Übergangsstil
mit großer Krypte und reichem Nordportal, eine Synagoge, ein
Staatsobergymnasium, bedeutende Leder- und Schuhfabrikation,
Dampfmühle, Bierbrauerei und Mälzerei,
Likörfabrikation, Tuchweberei, Leimsiederei, stark besuchte
Märkte und nebst dem angrenzenden Unterkloster (1880) 10,452
Einw.
Trebnitz, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk
Breslau, am Trebnitzer Wasser und am Fuß des Trebnitzer
Landrückens (Katzengebirge), 146 m ü. M., an der Linie
Hundsfeld-T. der Preußischen Staatsbahn, hat eine
evangelische und eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, Bierbrauerei
und (1885) 4920 meist evang. Einwohner. T., das 1228 deutsches
Stadtrecht erhielt, ist ein berühmter Wallfahrtsort; das
ehemalige Cistercienserkloster (jetzt Krankenanstalt der Schwestern
vom heil. Borromeus) wurde 1203 von Hedwig, der Gemahlin Herzog
Heinrichs des Bärtigen, gestiftet.
Trebonius, Gajus, röm. Ritter, gab als Volkstribun
55 v. Chr. die nach ihm genannte Lex Trebonia, wodurch Pompejus
Spanien, Crassus Syrien aus fünf Jahre als Provinzen verliehen
und Cäsar die Provinz Gallien auf weitere fünf Jahre
verlängert wurde. Er begleitete Cäsar als Legat nach
Gal-
814
Trebsen - Treiben.
lien, wurde 45 Konsul, nahm aber später an der
Verschwörung gegen Cäsar teil. Im Mai 44 ging er als
Prokonsul nach Asien und wirkte hier für Brutus und Cassius,
ward aber im Februar 43 von P. Dolabella in Smyrna erschlagen.
Trebsen, Stadt in der sächs. Kreishauptmannschaft
Leipzig, Amtshauptmannschaft Grimma, Knotenpunkt der Linien
Glauchau-Wurzen und Döbeln-Wermsdorf der Sächsischen
Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, ein Schloß,
Porphyrbrüche und (1885) 1122 evang. Einwohner. Dabei der 220
m hohe Kohlenberg mit Aussichtsturm.
Trebur, Flecken in der hess. Provinz Starkenburg, Kreis
Großgerau, unweit des Rheins, hat eine evang. Kirche,
bedeutende Käsefabrikation und (1885) 1826 Einw. - T.
(ursprünglich Tribur) war schon zu Karls d. Gr. Zeit eine
königliche Pfalz, kam später unter die Vogtei der Herren
von Münzenberg, ward 1246 von Wilhelm von Holland an den
Grafen Diether III. von Katzenelnbogen verpfändet und mit dem
größten Teil seines Gebiets von Rudolfvon Habsburg dem
Grafen Eberhard von Katzenelnbogen verliehen. Den Rest der
Besitzungen, welcher bisher den Herren von Falkenstein gehört
hatte, erwarb Graf Johann 1422. T. war in der Zeit der Karolinger
und der salischen Kaiser häufig Sitz von Reichstagen; am
bekanntesten sind die von 1066, wo Adalbert von Bremen
gestürzt wurde, und von 1076, wo die Fürsten Heinrich IV.
aufgaben, die Lossprechung vom Bann binnen Jahresfrist zu erwirken.
895 fand daselbst eine Synode statt, zu welcher auch König
Arnulf erschien.
Trecate, Flecken in der ital. Provinz Novara, an der
Eisenbahn Mailand-Novara, hat Reste alter Befestigungswerke, Reis-
und Seidenbau, Käsebereitung und (1881) 5259 Einw.
Trecento (spr. -tschennto. "dreihundert"), in der
Kunstgeschichte übliche Bezeichnung für die italienische
Kunst des 14. Jahrh., insbesondere für Giotto und seine Schule
und für Giovanni Pisano und seine Nachfolger (Trecentisten).
Vgl. Quattrocento und Cinquecento.
Treckfahrtskanal, Schiffahrtskanal zwischen Emden und
Aurich, in der preuß. Provinz Hannover, ist 23,5 km lang und
3 m tief.
Treckschuiten (holl., spr. -scheuten), s. Halage.
Tredegar, Stadt in Monmouthshire (England), inmitten des
reichsten Kohlen- und Eisenreviers, mit (1881) 18,771 Einw.
Tredgold, Thomas, Zivilingenieur, geb. 22. Aug. 1788 zu
Lerrendon bei Durham, trat, nachdem er längere Zeit praktisch
gearbeitet, 1813 in das Büreau des Architekten Atkinson,
Erbauers des Zeughauses in London, ein und trieb eingehende
theoretische Studien. Neben zahlreichen Aufsätzen über
physikalische Gegenstände veröffentlichte er: die
vielfach aufgelegten "Elementary principles of carpentry" (Lond.
1820, 7. Aufl. 1886; daneben andre Ausgaben); "Essay on the
strength of cast iron" (neue Ausg. 1860) und die "Treatise on
warming and ventilating" (neue Ausg. 1842); "Practical treatise on
rail-roads and carriages"; "The steam-engine" (1827; neue Ausg.
1853, 3 Bde.). Er starb 28. Jan. 1829.
Tredici Comuni (spr. treditschi), s. Comuni.
Tredjakowskij, Wasilij Kirillowitsch, russ.
Schriftsteller, geb. 1703 zu Astrachan, starb als Hofdichter 6.
Aug. (a. St.) 1769. Er war ein talentloser Reimschmied, der durch
Liebedienerei sich die Gunst des Hofs erwarb und dadurch zu hohen
Ehren stieg, so unter anderm von der Kaiserin Anna Iwanowna zum
Mitglied der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften ernannt wurde
und den Auftrag erhielt, "die russische Sprache sowohl durch Verse
als auch durch Prosa zu reinigen". Alle seine Festgesänge in
steifen schwunglosen Versen sind längst vergessen; sein Name
lebt nur noch in der litterarischen Kritik fort als Synonym
für Talentlosigkeit, dichterische Überhebung und Buhlerei
um Hofgunst.
Treene, Fluß in Schleswig-Holstein, entsteht
südöstlich von Flensburg, ist 21 km schiffbar und
mündet bei Friedrichstadt rechts in die Eider.
Treffen, Kampf zwischen größern Truppenmassen
(s. Gefecht); ferner die einzelnen Schlachtlinien, in denen die
Truppen nacheinander mit dem Feind in Berührung treten. Man
unterscheidet in dieser Hinsicht: ein Vorder- und Hintertreffen,
ein erstes, zweites, drittes T. Während das erste T. im
unmittelbaren Kampf mit dem Feind sich befindet, ist das zweite zur
Unterstützung, Ablösung, Sicherung des Rückens und
der Flanken bereit; das dritte dient in der Regel nur als
Reserve.
Treffurt, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Erfurt,
Kreis Mühlhausen, an der Werra, hat eine evangelische und eine
kath. Kirche, eine Schloßruine (Normanstein),
Zigarrenfabrikation, Obstbau und (1885) 1814 meist evang.
Einwohner.
Trèfle (franz., spr. träfl, "Klee,
Kleeblatt"), Farbe der franz. Spielkarte, deutsch Treff
("Eichel").
Trefort, August, ungar. Staatsmann, geb. 1817 zu Homonna
im Zempliner Komitat, studierte zu Pest die Rechte, trat 1837 in
den Staatsdienst, gab 1840 im Verein mit Baron Joseph
Eötvös und Ladislaus Szalay die "Budapesti Szemle"
(Revue) heraus, wurde 1843 von der Stadt Pest in den Reichstag
gewählt, trat 1844 in die Redaktion des Kossuthschen "Pesti
Hirlap" ein, ward 1848 Staatssekretär des damaligen
Handelsministers Gabriel Klanzal, nach dessen Rücktritt selbst
Minister, zog sich aber schon im Oktober vom politischen Leben
zurück und reiste (bis 1850) mit Baron Joseph Eötvös
ins Ausland. Seit dem Wiedererwachen des konstitutionellen Lebens
1860 war er fortwährend öffentlich thätig teils als
Deputierter, teils als Leiter öffentlicher Unternehmungen. Die
Alföldbahn ist sein Werk. Seit 1865 Mitglied des
Abgeordnetenhauses, stand er stets in den vordersten Reihen der
Deákpartei. 1872 wurde er zum Kultusminister ernannt und
1885 zum Präsidenten der ungarischen Akademie erwählt. Er
starb 22. Aug. 1888 in Pest. Von ihm erschienen "Reden und Studien"
(deutsch, Leipz. 1883) und "Essays und Denkreden" (das. 1887).
Tréguier (spr. treghjeh), Stadt im franz.
Departement Côtes du Nord, Arrondissement Lannion, am
gleichnamigen Küstenfluß, welcher die größten
Schiffe trägt und bald darauf in den Kanal (La Manche)
fällt, hat einen guten Handelshafen, Stockfisch-, Makrelen-
und Austernfang, Schiffahrt, Handel und (1881) 3125 Einw.
Treibeis, s. Eis, S. 399, und Polareis.
Treibel, s. Lammfelle.
Treiben, das Jagen der Tiere und Ricken durch die Hirsche
und Böcke in der Brunftzeit, um sie zu beschlagen; auch ein
Revierteil, aus welchem das Wild dem vorstehenden Schützen
zugetrieben wird.
Treiben, dehnbare Metalle mit Hammer (Treibhammer) und
Amboß (Treibstock) bearbeiten, namentlich Gefäße
etc. aus Blech herstellen, indem man durch Ausdehnung der mittlern
Teile eines Blechstücks eine Vertiefung erzeugt (Auftiefen)
oder den Rand aufbiegt (Aufziehen) und die Wandung ver-
815
Treibendes Zeug - Treibjagd.
engert (einzieht) oder erweitert (schweift). Hierbei kommen auch
die übrigen Blecharbeiten, wie Bördeln, Sieken etc., zur
Anwendung und bei kunstindustriellen Gegenständen namentlich
das T. mit Bunzen. Vgl. Getriebene Arbeit. In der Metallurgie s. v.
w. abtreiben. - In der Gärtnerei heißt T., gewisse
Pflanzen durch Anwendung künstlicher Wärme und andrer
Bedingungen früher als naturgemäß zur Ausbildung
von Blättern, Blüten und Früchten bringen. Die
Treiberei bezieht sich besonders auf feinere Gemüse,
Blütenpflanzen u. Obst. Zur Wärmeerzeugung benutzt man,
um gleichzeitig feuchte Luft zu erhalten, Mist, Laub, Lohe,
Baumwollabfälle, Wasser- und Dampfheizung in Treibkästen
oder Gewächshäusern (s. d.). Das T. beginnt, je nach
Bedürfnis und Treibfähigkeit der Pflanzen, früher
oder später vom Oktober bis März, z. B. bei Hyazinthen im
November, bei Tulpen, Roman-Hyazinthen, Maiblumen noch früher.
Von Blumen werden getrieben: Blumenzwiebeln, Stauden, schön
blühende Gesträuche, vorzugsweise Rosen; von
Früchten: Wein, Pfirsiche, Himbeeren, Ananas, Erdbeeren,
Aprikosen, Pflaumen und Kirschen; von Gemüsen in Mistbeeten
und Treibhäusern: Blumenkohl, Kohlrabi, Kopfsalat, Gurken,
Bohnen, Melonen, Karotten, Radieschen etc. Alle getriebenen Blumen
sind empfindlich gegen Luftwechsel und müssen weit von
Öfen aufgestellt, auch sorgfältig verwahrt transportiert
werden. Blütensträucher, Blumenzwiebeln u. a.
bedürfen einiger Zeit der Ruhe, ehe sie zu ungewöhnlicher
Zeit in Blüte gebracht, d. h. getrieben, werden können.
Letztere, Hyazinthen, Tulpen, Krokus u. a., pflanzt man, nachdem
sie bereits mehrere Wochen außerhalb der Erde zugebracht, in
Töpfe mit leichter Erde und gutem Wasserabzug, gräbt sie
dann sortenweise 50 cm tief im Erdboden ein oder stellt sie im
kühlen, dunkeln Keller auf, bis sie genügend Wurzeln
gebildelt haben, was man bemerkt, wenn man den Topf mit der Zwiebel
zwischen den Fingern der linken Hand umkippt; dann kann man sie
sofort warm stellen, gibt ihnen aber eine Papierhaube, um durch
Abschluß des Lichts den Blütenschaft zu verlängern;
Krokus müssen aber im Keller angetrieben werden.
Blütensträucher werden erst kalt und nach und nach
wärmer gestellt, auch öfters durch Spritzen angefeuchtet;
Staudenblumen dürfen nicht vor Sichtbarwerden der Blüte
warm stehen. Gemüsepflanzen zieht man zuerst im besondern
Kasten an und bringt sie genügend entwickelt in einen andern,
inzwischen warm angelegten Kasten. Gurken u. a. treibt man auch im
Gewächshaus. Für das T. von Obst, auch Erdbeeren, hat man
besondere Häuser, in denen die Sträucher, Bäumchen
und Pflanzen nach und nach wärmer und feuchter gehalten
werden. Ananasfruchtpflanzen kommen sofort ins warme Haus, am
besten mit Unterwärme von Mist, Baumwollabfällen und
ausgekochtem Hopfen, die wie beim Mistbeet (s. d.) vorbereitet
werden. Vgl. Jäger, Winterflora (4. Aufl., Weim. 1880);
Derselbe, Gemüsetreiberei (2. Aufl., das. 1863); Lucas,
Gemüsebau (4. Aufl., Stuttg. 1882); Tatter, Anleitung zur
Obsttreiberei (das. 1878).
Treibendes Zeug, gangbares Zeug, s. Vorgelege.
Treibhaus, s. Gewächshäuser.
Treibjagd, eine Jagd mit Schützen und Treibern. Im
Wald können meist nur Vorstehtreiben (Standtreiben), d. h.
solche Treiben eingerichtet werden, bei welchen sich eine Treibwehr
auf die an der andern Seite des Treibens angestellten Schützen
zu bewegt und das Wild auf diese zutreibt. Die Treiber müssen
in einer solchen Entfernung voneinander aufgestellt werden,
daß sie sich gegenseitig sehen können, sie müssen
mit Innehaltung derselben auf ein gegebenes Signal sich in
möglichst gerader Linie langsam fortbewegen und dabei durch
Klappern, Husten, Schlagen an den Stämmen Lärm machen.
Die Schützen, welche an Wegen, Schneisen etc. möglichst
geräuschlos in 50-60 Schritt Abstand angestellt werden,
müssen sich thunlichst an Bäumen oder Sträuchern zu
decken suchen, bewegungslos verhalten und dürfen ihre
Stände nicht vor beendetem Trieb verlassen. Bei den auf Hasen
abgehaltenen Feldjagden können die Treiben als Vorstehtreiben,
als Kesseltreiben und als böhmische Treiben veranstaltet
werden. Die Vorstehtreiben werden ebenso wie im Wald gemacht, nur
gräbt man wohl für die Schützen Standlöcher in
die Erde oder baut Jagdschirme aus Reisig, wenn es an Bäumen
und Sträuchern fehlt, um sie gedeckt aufstellen zu
können. Bei den Kesseltreiben läßt man Treiber und
Schützen von einem geeigneten Punkt ablaufen. Rechts und links
davon wird zur Bestimmung der Entfernung, in welcher sie gehen
sollen, in 60-80 Schritt Abstand je nach der Zahl derselben und der
Größe des Kessels ein Treiber aufgestellt oder ein
Markierpfahl errichtet. Zuerst laufen nun die beiden
Flügelführer, d. h. Jäger oder Treiber, die genau
ortskundig sind, ab und richten ihren Zug so ein, daß sie
nach rechts und links auf der Grenzlinie des Kessels entlang gehen,
um auf dem der Auslaufstelle entgegengesetzten Punkt wieder
zusammenzutreffen. Sobald sie den Markierpunkt überschritten
haben, folgt je ein Treiber und, nachdem 2-4 Treiber abgelaufen
sind, nach dem Verhältnis zwischen Treibern und Schützen,
je ein Stütze. Ist sämtliches Personal in der
vorstehenden Weise abgelaufen, so rückt der Sack, d. h. die
hintere Linie, nach, bis die Flügelführer durch ein
Hornsignal melden, daß sie zusammengetroffen sind, also der
Kessel geschlossen ist. Nunmehr bewegen sich alle langsam nach dem
Mittelpunkt, welcher öfters durch eine Stange bezeichnet wird,
zu, bis der Trieb so weit ins Enge gekommen ist, daß die
Schützen auf 40-50 Schritt Entfernung stehen. Auf das Signal
oder den Ruf "Treiber vor" begeben sich diese in den Kessel,
während die Schützen stehen bleiben und von da ab auf das
Wild, welches noch aufgetrieben wird, nicht mehr in den Kessel,
sondern nur noch rückwärts schießen dürfen.
Zur Veranstaltung der böhmischen Treiben sind zwei mindestens
tausend Schritt lange Leinen erforderlich, in welche auf etwa 40
Schritt Entfernung Zeichen eingeknüpft sind. Auf einen Haspel
gewunden, werden diese auf den beiden Punkten des Treibens
aufgestellt, von welchen die Flügel ablaufen sollen. Die
Flügelführer nehmen die Enden derselben in die Hand und
gehen wie beim Kesseltreiben vorwärts. Sobald nun beim
Abhaspeln der Leine ein Markierzeichen erscheint, faßt ein
Treiber dieselbe dort mit der Hand und folgt den voraufgehenden u.
s. f., bis die Lappenleinen abgewickelt sind. Auf der Linie, welche
in ihren Endpunkten durch die Enden der Lappenleinen bestimmt ist,
werden nun die Schützen aufgestellt, zwischen welchen man
noch, falls die Entfernungen beträchtlich sind, je 1-3 Treiber
einreiht, damit diese etwa auf sie zulaufendes Wild nach den
Schützen abkehren. Ebenso werden noch 2-3 Schützen
zwischen den dem Sack zunächst an der Lappenleine gehenden
Treibern postiert, welche Lappenschützen heißen und
gewöhnlich die meisten Hasen erlegen. In der angegebenen
Aufstellung wird nun das ganze für einen Trieb bestimmte Feld
abgestreift. Die Hasen rücken anfangs vorwärts, sobald
aber die Entfernung
816
Treibrad - Treja.
von ihrem Lager zu erheblich wird, kehren sie um und versuchen
durch die im Sack postierte Schützenlinie zurückzugehen,
wobei sie zu Schuß kommen. An der Grenze des Treibens
angelangt, schwenken zuletzt die Flügelführer zusammen
und bilden dadurch schließlich einen Kessel. Die
Vorstehtreiben, welche man auf Rot-, Dam- und Rehwild sowie auf
Sauen veranstaltet, haben gewöhnlich dann wenig Erfolg, wenn
man dazu eine aus vielen Treibern bestehende, sehr
geräuschvolle Wehr verwendet. Das Wild geht leichter
zurück, es wird eher von wenigen ortskundigen Leuten, welche
die Treiben abgehen, vorgebracht. Man erlegt auch Waldschnepfen und
Wildenten, selbst Gänse und Trappen auf Standtreiben. Am
leichtesten lassen sich der Wolf und der Fuchs treiben, und
letzterer wird meist auf solchen Treibjagden erlegt, welche man im
Wald zugleich auf Hasen veranstaltet.
Treibrad (Triebrad), ein Rad, auf welches die bewegende
Kraft, z. B. bei Dampfmaschinen die Kolbenstange, direkt
einwirkt.
Treibriemen (Transmissionsriemen), bandförmige
Riemen zum Betrieb der Riemenräderwerke (s. d.). Das beste
Material zu denselben ist starkes Leder, welches mit der
genügenden Festigkeit die wertvolle Eigenschaft verbindet, auf
den abgedrehten eisernen Riemenscheiben durch beträchtliche
Reibung zu haften. Diese T. bestehen aus einfachem, doppeltem oder
dreifachem Leder und werden in Breiten bis zu im ausgeführt.
Die Zusammensetzung der einzelnen Teile in der Längsrichtung
geschieht durch Nähen, am besten aber durch Zusammenleimen der
auf 15-20 cm schräg gefrästen Enden mit einem besonders
präparierten Leim. Die Enden der Lederriemen näht man mit
dünnen Lederstreifen zusammen oder verbindet sie durch Bolzen,
Schrauben, Niete oder durch besonders konstruierte
Verbindungsstücke (Riemenschlösser). Zum Aufbringen des
Treibriemens auf die Riemenscheiben dient ein
Riemenspannflaschenzug. Um die ledernen T. vor dem Brechen zu
bewahren, legt man sie vor dem Gebrauch 24 Stunden in Glycerin. In
sehr feuchten Räumen verdienen die Guttaperchariemen mit
Einlage von festem Hanfgewebe den Vorzug. Seit einiger Zeit hat man
versucht, die Lederriemen durch Gurte aus Baumwoll- oder Hanfgewebe
zu ersetzen, ohne jedoch damit den erstern gegenüber
wesentliche Vorteile zu erzielen. Andre Bestrebungen sind dahin
gerichtet, an Stelle der Lederriemen etc. solche aus Metall
herzustellen. Dieselben bestehen entweder aus einer Anzahl
paralleler Drahtseile, welche durch Stücke von Hirnleder in
der Querrichtung verbunden sind, oder aus Ketten mit daran
befestigten Riemenstreifen, welche nur die Reibung vermehren
sollen, oder aber aus ordentlichen Drahtgeweben. Bis jetzt hat sich
jedoch noch keine Art der Metalltreibgurte einer allgemeinen
Anwendung zu erfreuen. Vgl. auch Riemenräderwerke.
Treibsätze, s. Feuerwerkerei, S. 225.
Treibschnur, s. Seiltrieb.
Treibstock, s. Treiben.
Treibströmungen, s. v. w. Driftströmungen.
Treideln, s. Halage.
Treignac (spr. tränjack), Stadt im franz.
Departement Corrèze, Arrondissement Tulle, an der
Vézère, hat ein Kommunalcollège, ein
Zweigetablissement der Waffenfabrik zu Tulle, Gerberei,
Bierbrauerei, Hutfabrikation, lebhaften Handel und (1881) 1803
Einw.
Treilhard (spr. träjar), Jean Baptiste, Graf,
Mitglied des franz. Direktoriums, geb. 3. Jan. 1742 zu Brives im
Limousin, studierte zu Paris die Rechte, wurde Advokat beim
Parlament, 1789 von der Stadt Paris als Deputierter in die
Generalstaaten, nach dem Schluß der Nationalversammlung zum
Präsidenten des Kriminalhofs im Departement Seine-et-Oise und
1792 von der Stadt Paris in den Nationalkonvent gewählt. Er
stimmte für den Tod des Königs, jedoch für Aufschub
der Hinrichtung. Im April 1793 ward er Mitglied des
Wohlfahrtsausschusses und mit einer Sendung in die westlichen
Departements beauftragt, aber nach seiner Rückkehr wegen allzu
großer Milde nicht wieder gewählt. Erst nach
Robespierres Sturz trat er wieder in den Wohlfahrtsausschuß,
dessen gewöhnlicher Berichterstatter er war. 1795 trat er in
den Rat der Fünfhundert und ward endlich Präsident
desselben. Am 20. Mai 1797 schied er aus und übernahm die
Präsidentschaft einer Sektion des Kassationshofs, ward aber
bald darauf als Unterhändler des Friedens mit England nach
Lille, sodann als bevollmächtigter Minister nach Neapel und
zuletzt zum Kongreß nach Rastatt geschickt, wo er aber nur
kurze Zeit verweilte. 1798 ward er Mitglied des Direktoriums,
unterstützte den Staatsstreich Bonapartes vom 18. Brumaire und
ward daher von demselben später zum Präsidenten des
Pariser Appellhofs und Mitglied des Staatsrats ernannt, als welcher
er bei der Bearbeitung des Code Napoléon wesentliche Dienste
leistete. 1804 ward er zum Präsidenten der
Gesetzgebungssektion im Staatsrat ernannt und in den Grafenstand
erhoben. Er starb 1. Dez. 1810.
Treisam, Fluß, s. Dreisam.
Treitschke, Heinrich Gotthard von, namhafter
Geschichtschreiber und Publizist, geb. 15. Sept. 1834 zu Dresden,
Sohn des 1867 gestorbenen sächsischen Generalleutnants v. T.,
studierte in Bonn, Leipzig, Tübingen und Heidelberg, war
1858-63 Privatdozent der Geschichte in Leipzig, dann Professor in
Freiburg, legte aber 1866 wegen der Haltung Badens in der deutschen
Krisis sein Amt nieder und ging nach Berlin, wo er die Leitung der
"Preußischen Jahrbücher" übernahm, zu deren
thätigsten Mitarbeitern er seit 1858 gehört hatte. Im
Herbst 1866 als Professor nach Kiel berufen, erhielt er 1867 den
durch Häussers Tod erledigten Lehrstuhl in Heidelberg, von wo
er 1874 als Professor nach Berlin ging. 1871-88 war er liberales
Mitglied des Reichstags. Nach Rankes Tod wurde er zum
Historiographen des preußischen Staats ernannt. Treitschkes
Schriften sind: "Die Gesellschaftswissenschaft" (Leipz. 1859);
"Historische und politische Aufsätze" (5. Aufl., das. 1886, 3
Bde.); "Zehn Jahre deutscher Kämpfe 1865-74" (Berl. 1874, 2.
Aufl. 1879) sowie die kleinern: "Der Sozialismus und seine
Gönner" (das. 1875); "Der Sozialismus und der Meuchelmord"
(das. 1878); "Zwei Kaiser" (das. 1888). Auch gab er
"Vaterländische Gedichte" (2. Aufl., Götting. 1859)
heraus. Sein Hauptwerk ist die "Deutsche Geschichte im 19.
Jahrhundert", von welcher bisher 3 Bde. (Leipz. 1879-85, bis 1830
reichend) erschienen sind. In diesem auf sehr gründlichen
Forschungen beruhenden und glänzend geschriebenen Buch
prägten sich Treitschkes leidenschaftlicher Patriotismus und
seine Abneigung gegen den herkömmlichen Liberalismus so scharf
aus, daß es vielfach auf Widerspruch stieß, wie er denn
durch einige tadelnde Artikel gegen die Überhebung mancher
Juden sich deren Haß zuzog, was zum Anlaß wurde,
daß er im Juli 1889 von der Leitung der "Preußischen
Jahrbücher" zurücktrat.
Treitzsauerwein, s. Weiß-Kunig.
Treja, Stadt in der ital. Provinz Macerata, Bischofsitz,
mit Kathedrale, Gymnasium, technischer Schule und (1881) 2214
Einw.
817
Trelawny - Trenck.
Trelawny (spr. treláhni), Edward John, engl.
Offizier und Schriftsteller, Freund Byrons und Shelleys, geboren im
Oktober 1792 aus einer alten, in Cornwall begüterten Familie,
trat sehr jung in die englische Marine ein und führte in den
Kriegsunruhen jener Zeit ein sehr wechselvolles Leben. 1821
ließ er sich in Pisa nieder, wo er in ein freundschaftliches
Verhältnis zu Shelley trat, den er unmittelbar vor der
verhängnisvollen Bootfahrt, auf der er ertrank, noch sah. Er
war es auch, welcher die Leiche des Dichters auffand und mit Lord
Byron deren Verbrennung anordnete. 1823 folgte er Byron nach
Griechenland, ging in dessen Auftrag von Kephalonia in den
Peloponnes und nach Livadien, um mit den Führern des
Aufstandes zu verhandeln, und wurde Adjutant des Häuptlings
Odysseus, mit dessen Tochter er sich verheiratete. Nach seines
Schwiegervaters Tod kehrte T. 1827 nach England zurück, wo er
fortan teils in London, teils auf seinem Gut Sompting bei Worthing
in den Southdownhügeln lebte; hier starb er in hohem Alter 13.
Aug. 1881. Seinem Willen gemäß wurde sein Leichnam in
Gotha verbrannt und seine Asche in der Nähe der Gräber
von Shelley und Keats bei der Cestiuspyramide in Rom beigesetzt.
Seine Schriften sind: "The adventures of a younger son" (1831, neue
Aufl. 1856; deutsch, Stuttg. 1835), eine Art biographischen Romans,
worin er in höchst anziehender Weise sein reichbewegtes Leben
in verschiedenen Weltgegenden schildert; die sehr bemerkenswerten
"Recollections of the last days of Shelley and Byron" (1858),
welche er später in "Records of Shelley, Byron and the author"
(1878, 2 Bde.; neue Ausg. 1887) bedeutend erweitert hat. Vgl.
Edgcumbe, Edward T. (Lond. 1882).
Trelleborg, Seestadt im schwed. Län Malmöhus,
an der Ostsee und den Eisenbahnen Lund-T. und Malmö-T., hat
einige Fabriken und (1885) 2266 Einw. T. ist Sitz eines deutschen
Konsulats.
Trema, s. Diäresis.
Tremadocschichten, s. Silurische Formation.
Trematoden (Saugwürmer), s. Platoden.
Trembecki (spr. -bétzki), Stanislaw, poln.
Dichter, geboren um 1726 in der Nähe von Krakau, machte in
seiner Jugend Reisen durch ganz Europa, verweilte längere Zeit
am Hof Ludwigs XV. in Paris und wurde nach seiner Rückkehr
Kammerherr des Königs Stanislaw August, den er nach seiner
Absetzung nach Petersburg begleitete. Später fand er am Hof
des Grafen Felix Potocki zu Tulczyn in Podolien ein Unterkommen.
Der einst glänzende Kavalier, der an 30 Duelle hatte, meist
wegen Damen, verfiel jetzt in Armut und starb als ein
menschenscheuer und vergessener Sonderling 12. Dez. 1812. Als
Dichter ist T. das Muster eines schmeichlerischen und
gesinnungslosen Hofdichters, dabei aber der erste Stilist seiner
Zeit, dessen Verdienste um die polnische Sprache hoch anzuschlagen
sind. Das bedeutendste seiner Gedichte ist "Zofijowka", eine im
hohen Alter verfaßte poetische Schilderung eines Parks, den
Graf Potocki seiner Gemahlin Sophie zu Ehren angelegt hatte.
Sammlungen seiner Werke erschienen in Breslau (1828, 2 Bde.) und
Leipzig (1836, 2 Bde.).
Tremblade, La (spr. trangblad), Stadt im franz.
Departement Niedercharente, Arrondissement Marennes, an der
Mündung der Seudre in den Atlantischen Ozean und der Eisenbahn
Saujon-La Grève, hat (1881) 2874 Einw., Fabrikation von
Weingeist, Essig und Flaschen, Salzgewinnung, besuchte
Seebäder und (mit Marennes) berühmte Zucht von Austern,
welche als weiße junge Austern in der Bretagne gekauft und
hier gemästet werden (Jahresertrag 30 Mill. Stück, im
Wert von mehr als 2 Mill. Frank).
Trembowla, Stadt in Ostgalizien, südöstlich von
Tarnopol, Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines
Bezirksgerichts, hat vorzügliche Steinbrüche,
Mühlenbetrieb und (1880) 6432 Einw.
Tremellini (Zitterpilze), s. Pilze (9), S. 71.
Tremessen (poln. Trzemeszno), Stadt im preuß.
Regierungsbezirk Bromberg, Kreis Mogilno, an einem See und der
Linie Posen-Thorn der Preußischen Staatsbahn, hat eine
evangelische und 3 kath. Kirchen, ein Augustiner-Chorherrenstift,
ein Progymnasium, ein Amtsgericht, ein öffentliches
Schlachthaus, Stärke- und Sirupfabrikation und (1885) 4766
meist kath. Einwohner. Hier Gefecht 10. April 1848 mit polnischen
Insurgenten.
Tremiti, ital. Inselgruppe (San Nicola, San Domino,
Capraja u. a.) im Adriatischen Meer, 25-30 km von der Küste
der Provinz Foggia entfernt. Sie sind alle felsig, vulkanischen
Ursprungs, ohne Quellwasser und dienen als Strafkolonie (1881: 518
Bewohner). Im Altertum hießen sie Diomedeae Insulae.
Tremoille, La, s. La Tremoille.
Tremola, Val, s. Tessin (Fluß).
Tremolith, Mineral, s. Hornblende.
Tremolo (tremolando, ital. "Beben, bebend"), in der Musik
die schnell wiederholte Angabe derselben Töne
(intermittierend) oder einander schnell folgende Verstärkungen
des Tons (beim Singen eine bald ermüdende Manier, bei
Streichinstrumenten ein höchst wirksamer Effekt, auf dem
Klavier das den Ton zu höchster Fülle steigernde
Trommeln).
Tremor (lat.), das Zittern; T. artuum, das
Gliederzittern.
Tremse, Kornblume, s. Centaurea.
Tremulánt (lat.), in der Orgel eine durch einen
besondern Registerzug in oder außer Funktion zu setzende
Vorrichtung, welche dem Ton ein mehr oder weniger starkes Beben
mitteilt. Der T. ist eine leicht bewegliche Klappe, welche, wenn
das Register angezogen wird, den Kanal nahe vorm Windkasten
verschließt, aber durch den Orgelwind in eine pendelnde
Bewegung versetzt wird.
Tremulieren (lat.), beim Gesang mit der Stimme zittern
(vgl. Tremolo); Tremulation, zitternde Bewegung.
Trenck, 1) Franz, Freiherr von der, kaiserl.
Pandurenoberst, geb. 1. Jan. 1711 zu Reggio in Kalabrien, wo sein
Vater, ein geborner Preuße, als kaiserlicher Oberstleutnant
in Garnison stand, ward bei den Jesuiten in Ödenburg erzogen
und trat, 17 Jahre alt, in kaiserliche Kriegsdienste. Er war
schön, kräftig und trotz seiner Blatternarben in
Liebesabenteuern sehr glücklich, reichbegabt, so daß er
sieben Sprachen beherrschte. Wegen seines ausschweifenden Lebens
und seiner Händelsucht bald wieder entlassen, trat er als
Rittmeister in ein russisches Husarenregiment, ward aber auch dort
wegen Subordinationsvergehen kassiert und zu mehrmonatlicher
Schanzarbeit auf der Festung Kiew verurteilt, wonach er auf seine
Güter in Slawonien zurückkehrte. Beim Ausbruch des
österreichischen Erbfolgekriegs (1740) erhielt er von der
Kaiserin die Erlaubnis, ein Korps von 1000 Panduren auf eigne
Kosten auszurüsten und nach Schlesien zu führen.
Dasselbe, zuletzt 5000 Mann stark, bildete stets die Vorhut der
Armee und zeichnete sich ebensosehr durch Grausamkeit wie
Tapferkeit aus. Endlich wurde ihm 1746 wegen vieler Greuelthaten
und Subordinationsvergehen ein peinlicher Prozeß gemacht, dem
zufolge er in lebensläng-
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl, XV. Bd.
52
818
Trendelburg - Trente et quarante.
liche Gefangenschaft auf den Spielberg bei Brünn gebracht
wurde, wo er 14. Okt. 1749 starb. Vgl. seine Autobiographie (Leipz.
1748 u. Wien 1807, 2 Bde., reicht bis 1747); "Franz von der T.,
dargestellt von einem Unparteiischen" (Hübner), mit einer
Vorrede von Schubart (Stuttg. 1788, 3 Bde.); Wahrmann, Leben,
Thaten, Abenteuer, Gefängnis und Tod des Franz Freih. v. d. T.
(Leipz. 1837) und "Freiherr Franz v. d. T." (3. Aufl., Celle 1868,
3 Bde.).
2) Friedrich, Freiherr von der, Abenteurer, geb. 16. Febr. 1726
zu Königsberg i. Pr., Vetter des vorigen, nahm 1740
preußische Kriegsdienste und wurde beim Ausbruch des zweiten
Schlesischen Kriegs 1744 Ordonnanzoffizier Friedrichs d. Gr. Bald
hernach fiel er in Ungnade, angeblich wegen einer Liebesintrige mit
der Schwester des Königs, der Prinzessin Amalia, und die
Entdeckung seines an sich unschuldigen Briefwechsels mit seinem
Vetter gab dem König erwünschten Anlaß, ihn auf die
Festung Glatz bringen zu lassen. Von hier im Januar 1747 entkommen,
erhielt T. 1749 in Wien eine Anstellung als Rittmeister bei einem
kaiserlichen Kürassierregiment in Ungarn. Als er aber 1753 in
Familienangelegenheiten nach Danzig reiste, ward er hier auf
Friedrichs II. Befehl verhaftet, nach Magdeburg in die Sternschanze
abgeführt und nach einem vereitelten Fluchtversuch an
Händen, Füßen und Leib mit schweren Fesseln
angeschmiedet. Im Dezember 1763 endlich in Freiheit gesetzt, begab
er sich nach Aachen, beschäftigte sich daselbst mit
litterarischen Arbeiten und trieb nebenbei einen Weinhandel. Von
1774 bis 1777 bereiste er England und Frankreich und wurde dann von
der Kaiserin Maria Theresia zu mehreren geheimen Sendungen
gebraucht. Nach dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms II.
erhielt er seine in Preußen eingezogenen Güter
zurück. Sein unruhiger Geist trieb ihn beim Ausbruch der
französischen Revolution nach Paris, wo ihn Robespierre 1794
als angeblichen Geschäftsträger fremder Mächte
guillotinieren ließ. Seine Selbstbiographie (Berl. u. Wien
1787, 3 Bde.) ist wohl nicht frei von Übertreibungen. Seine
übrigen Schriften sind enthalten in "Trencks sämtliche
Gedichte u. Schriften" (Leipz.1786, 8 Bde.). Vgl. Wahrmann, Friedr.
Freih. v. d. T. Leben, Kerker und Tod (Leipz. 1837); "Freiherr
Friedrich v. d.T." (3. Aufl., Celle 1868, 3 Bde.) und "Kollektion
Spemann", Bd. 44.
Trendelburg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Kassel, Kreis Hofgeismar, an der Diemel und der Linie
Hümme-Karlshafen der Preußischen Staatsbahn, hat eine
evang. Kirche, ein altes Schloß und (1885) 772 Einw.
Trendelenburg, Friedrich Adolf, Philosoph, geb. 30. Nov.
1802 zu Eutin, studierte in Kiel, wo Joh. Erich v. Berger
nachhaltigen Einfluß auf ihn übte, Leipzig und Berlin
Philosophie und Philologie, habilitierte sich an der Berliner
Universität, wurde 1833 außerordentlicher, 1837
ordentlicher Professor, 1846 Mitglied der Akademie und war seit
1847 beständiger Sekretär der historisch-philosophischen
Klasse. Kurze Zeit war er in konservativem Sinn auch politisch
thätig und auf die Gestaltung des preußischen
Universitätswesens sehr einflußreich. Er starb 24. Jan.
1872 in Berlin. Die Leistungen Trendelenburgs teilen sich in
philologisch-historische und philosophische. Zu den erstern
gehören seine für den ersten Unterricht in der Logik sehr
verdienstlichen "Elementa logices Aristotelicae" (Berl. 1837, 8.
Aufl. 1878), zu welcher Schrift er eine deutsche Bearbeitung und
Ergänzung: "Erläuterungen zu den Elementen der
aristotelischen Logik" (das. 1842, 3. Aufl. 1876), lieferte.
Für das tiefere Studium des Aristoteles ging er den
philosophierenden Philologen bahnbrechend voran mit seiner Ausgabe
der Aristotelischen Schrift über die Seele ("Aristotelis de
anima etc.", Jena 1833, mit Kommentar). 1840 trat er mit seinen
"Logischen Untersuchungen" (Berl. 1840, 2 Bde.; 3, Aufl., Leipz.
1870) hervor, in welchen er die formale Logik der Kantianer und die
dialektische Methode Hegels treffend kritisierte, selbst aber ein
logisch-metaphysisches System aufstellte, in welchem unter Anklang
an Aristotelische Denkweise die Bewegung als das dem Denken und dem
Sein Gemeinsame zum Ausgangspunkt einer spekulativen
Erkenntnistheorie und zum Mittel einer Ableitung der Grundbegriffe
und Grundanschauungen (namentlich von Raum und Zeit) gemacht wird.
Die ethische Seite seiner Philosophie entwickelte er in dem
Aufsatz: "Die sittliche Idee des Rechts" (Berl. 1849), die
ästhetische in den Vorträgen: "Niobe" (das. 1846) und
"Der Kölner Dom" (Köln 1853). Gegen das Ende seines
Lebens geriet er in einen durch seinen Tod unterbrochenen
litterarischen Streit mit Kuno Fischer (s. d. 10) über die
Auffassung der Kantschen Lehre, als dessen Frucht die Schrift "Kuno
Fischer und sein Kant" (Leipz. 1869) zu betrachten ist. Ein andres
systematisches Werk Trendelenburgs ist: "Das Naturrecht auf dem
Grunde der Ethik" (Leipz. 1860, 2. Aufl. 1868). Seine "Historischen
Beiträge zur Philosophie" enthalten im 1. Band (Berl. 1846)
eine Geschichte der Kategorienlehre, im 2. und 3. (das. 1855 und
1867) vermischte Aufsätze, unter denen besonders die
Abhandlungen über Spinoza und Herbart hervorzuheben sind.
Seine geist- und gehaltvollen akademischen Reden sind
größtenteils gesammelt in den "Kleinen Schriften"
(Leipz. 1870, 2 Bde.), welche auch die 1843 anonym erschienene
Schrift "Das Turnen und die deutsche Volkserziehung" enthalten.
Vgl. Bonitz, Zur Erinnerung an T. (Berl. 1872); Bratuscheck, Adolf
T. (das. 1873).
Trennen, sich, in der Turfsprache Euphemismus für
Herabfallen vom Pferd.
Trense, s. Zaum.
Trent, Fluß in England, entspringt im
nördlichen Staffordshire, fließt bei Stoke und Rugeley
vorbei, wird bei Burton (193 km oberhalb seiner Mündung)
schiffbar und ergießt sich, nachdem er noch Nottingham,
Newark und Gainsborough berührt hat, nach einem Laufe von 269
km in den Humber. Der Grand-Trunkkanal (s. d.) verbindet den T. mit
dem Mersey und somit die Nordsee mit dem Irischen Meer. Wichtigere
Nebenflüsse sind links: Dove, Derwent (s. d.) und Idle;
rechts: Stow, Tame und Soar.
Trentaffaire, Streitsache zwischen Großbritannien
und den Vereinigten Staaten von Nordamerika, veranlaßt durch
die Verhaftung der südstaatlichen Agenten Mason und Slidell,
welche sich 1861 in Havana auf dem englischen Postdampfer Trent
nach Europa einschifften, um dort für die Sache der
Südstaaten zu wirken, aber 8. Nov. im Bahamakanal von dem
amerikanischen Kreuzer San Jacinto unter Kapitän Ch. Wilkes
(s. d.), der den Trent anhielt, mit Gewalt nach Nordamerika
gebracht wurden. Die englische Regierung drohte mit Abbruch des
diplomatischen Verkehrs, wenn die Unionsregierung nicht binnen
sieben Tagen das Verhalten des Kapitän Wilkes mißbillige
und die Verhafteten freilasse. Die Unionsregierung erfüllte
dies Verlangen 26. Dez. 1861, obwohl die öffentliche Meinung
in Amerika gegen England sehr aufgeregt und zum Krieg mit demselben
geneigt war.
Trente et quarante (franz., spr. trangt e karangt,
819
Trente-un - Tréport, Le.
"dreißig und vierzig"), das um zwei Einsatzfelder
vermehrte Rouge et noir (s. d.), welches seiner Zeit neben dem
Roulette das Hauptlockmittel in den deutschen Spielbädern
bildete. Zu den Feldern für Rot und Schwarz (R und S
bezeichnet) kommen hinzu diejenigen für Couleur und Inverse (C
und I markiert).
Trente-un (franz., spr. trangt-ong,
"einunddreißig"), ein Glücksspiel, ähnlich dem Onze
et demi. Bei demselben zählt jedes Bild zehn, das As nach
Belieben des Spielers elf oder eins, die übrigen Karten nach
Augen. As und zwei Bilder sind also "gebornes" T. Jeder erhält
anfangs drei Blätter und kann nun hinzukaufen; bekommt er aber
dabei über 31 Augen, so ist er tot und verliert unbedingt
seinen Satz.
Trenton, Hauptstadt des nordamerikan. Staats New Jersey,
am schiffbaren Delaware, ist Knotenpunkt vieler Eisenbahnen, hat
ein schönes Staatenhaus (Kapitol), 2 öffentliche
Bibliotheken, ein Lehrerseminar, 24 Kirchen, eine Irrenanstalt, ein
Zuchthaus, ein Zeughaus, starke Industrie (Töpferei,
Walzwerke, Woll- und Papierfabrikation), lebhaften Handel und
(1885) 34,386 Einw. T. wurde 1680 gegründet und 1790 zur
Hauptstadt erhoben. Hier 26. Dez. 1776 Sieg Washingtons über
die Engländer, wobei 900 Hessen gefangen genommen wurden.
Trentongruppe, s. Silurische Formation.
Trentowski, Bronislaus, poln. Philosoph, geb. 1808 zu
Kopcie in Polen, studierte zu Berlin unter Hegel Philosophie,
habilitierte sich als Dozent der Philosophie an der
Universität zu Freiburg i. Br., starb 1869 daselbst. T.
versuchte in seinem deutsch geschriebenen Hauptwerk: "Grundlage der
universellen Philosophie" (Freiburg 1837), eine selbständige
"slawische Philosophie" zu begründen. Er weist darin den drei
Hauptrassen Europas ihre Stelle in der weltgeschichtlichen
Entwickelung der Philosophie an, indem er an der Hand der
dialektischen Methode die Romanen als Träger des Realismus,
deren Gegensatz, die Germanen, als solche des Idealismus, dagegen
die Slawen als Träger einer künftigen Synthese beider
einander zugleich ausschließenden und gegenseitig
ergänzenden Geistesrichtungen und dadurch als das Volk "der
Philosophie der Zukunft" zu konstruieren unternimmt. Unter seinen
polnischen Werken ist zu erwähnen "Chowanna", System einer
nationalen Pädagogik (Posen 1842, 2 Bde.), das durch
Kühnheit der Gedanken, energischen Stil und allerlei
Überschwenglichkeiten in Polen großes Aufsehen erregte;
"Myslini" ("Logik", das. 1844); "Panteon" oder Propädeutik des
allgemeinen Wissens (1873) und "Verhältnis der Philosophie zur
Staatskunst" (ebenfalls in poln. Sprache, das. 1843). Neben Libelt
trug T. das meiste zur Belebung der philosophischen Richtung in
Polen bei.
Trentschin (ungar. Trencsen), ungar. Komitat am linken
Donauufer, 4620 qkm (83,9 QM.) groß, grenzt westlich an
Mähren, nördlich an Schlesien und Galizien, östlich
und südlich an die Komitate Arva, Turócz und Neutra und
wird von unzähligen Bergketten der Bieskiden und der Kleinen
Tátra durchzogen. Ebenes Gebiet findet sich lediglich im
prachtvollen Waagthal, dessen Romantik durch zahlreiche Burgen
erhöht wird, und im SO. bei Baán. Hauptfluß ist
die von O. gegen S. fließende Waag mit der Kisucza. Der nicht
sehr fruchtbare Boden erzeugt Kartoffeln, Hafer, Obst (besonders
Zwetschen), Gartenfrüchte, Flachs, Hanf, viel Holz und in der
Ebene auch Getreide. Die Einwohner (1881 : 244,919), meist
Slowaken, beschäftigen sich neben der Landwirtschaft mit
Viehzucht (Schafe) und mit Branntwein-, Käse- und
Honigproduktion. Der Handel mit Holz, das auf der Waag auf
Flößen befördert wird, ist sehr lebhaft. Die
königliche Freistadt T., an der Waag, Station der Waagthalbahn
und Sitz des Komitats und eines Gerichtshofs mit (1881) 4402
slowakischen, deutschen und ungar. Einwohnern, hat mehrere Kirchen,
ein Piaristenkloster mit Obergymnasium, eine neue große
Kaserne, einen Park und Ruinen der uralten imposanten Bergfeste T.
In einem romantischen Seitenthal (8 km nordöstlich) liegt der
seit dem 14. Jahrh. bekannte Badeort T.-Teplitz, Bahnstation, mit
sehr heilsamen Schwefelquellen (36-40° C.), die gegen
Rheumatismus, Gicht, Lähmungen etc. benutzt werden
(jährlich über 3000 Kurgäste). Vgl. Ventura, Der
Kurort T.-Teplitz (6. Aufl., Wien 1888), und Nagel, T.-Teplitz (2.
Aufl., das. 1884).
Trepanation (franz.), chirurg. Operation am Knochen,
wobei ein Stück aus demselben ausgebohrt oder ausgesägt
wird. Die T. wird am häufigsten am Schädel vorgenommen,
und zwar 1) wo die Schädelknochen durch äußere
Gewalt tiefer als etwa 6 mm eingedrückt oder die innere
Lamelle des Schädelknochens abgesprengt ist und das Gehirn
beeinträchtigt; 2) wo fremde Körper (Kugeln,
Messerspitzen etc.) im Gehirn stecken oder auf dieses drücken
und man Hoffnung hat, durch Entfernung derselben die drohenden
Erscheinungen zu beseitigen; 3) wo zwischen den Schädelknochen
und dem Gehirn oder in den obern Schichten des letztern
größere Eiter- und Blutmassen liegen, vorausgesetzt
natürlich, daß man die Diagnose in allen diesen
Fällen überhaupt mit Sicherheit stellen kann. Das
Instrument, mit dem man ein rundes Stück aus dem Knochen
ausbohrt, nennt man Trepan (Trephine); sein gezahntes, einer
Kreissäge von etwa 1½ cm Durchmesser entsprechendes
Ende heißt die Trepankrone. Das ausgesägte
Knochenstück wird mit einem hebelartigen Instrument (Tirefond)
herausgehoben und sodann der Fall je nach seiner individuellen
Beschaffenheit weiter behandelt. Schon im Altertum, namentlich in
der Kriegschirurgie, sehr häufig vorgenommen, gehört die
T. jetzt zu den selten zur Ausführung kommenden Operationen,
da sie früher außer bei Verletzungen auch bei
Geisteskranken ausgeführt wurde (Wilhelm v. Saliceto). Auch
das Brustbein hat man trepaniert, namentlich um Eitermassen, welche
sich hinter demselben entwickelt hatten, zu entfernen. Unter allen
Umständen ist die T. eine lebensgefährliche Operation,
weil sie zu einer schweren ältern Verletzung eine nicht minder
schwere neue hinzufügt.
Trepang (auch Tripang, Béche de mer), die als
Handelsartikel zubereiteten Seegurken (s. Holothurioideen) aus der
Gattung Holothuria. In Japan und China werden diese teils als
Gewürz für Speisen, teils als Aphrodisiakum sowohl von
den Eingebornen als auch von den Europäern genossen. Sie
kommen meist von den Inselgruppen des Malaiischen Meers, von der
nordaustralischen Küste etc. Sofort nach dem Fang werden sie
abgekocht und entweder an der Sonne oder am Feuer getrocknet, auch
wohl leicht geräuchert; frisch erreichen sie eine Länge
von 25 cm und einen Durchmesser von 5 cm, büßen aber
durch jene Prozesse viel von ihrer Größe ein. Die
Chinesen unterscheiden über 30 Sorten, deren Preis von 0,70-2
Frank das Kilogramm schwankt. Die Einfuhr nach China betrug 1872
nicht weniger als 18,000 Pikuls. Vgl. Simmonds, The commercial
products of the sea (Lond. 1879).
Tréport, Le (spr. -por), Hafenstadt im franz.
Departement Niederseine, Arrondissement Dieppe, an der
52*
820
Treppe - Tresckow.
Mündung der Bresle in den Kanal (La Manche), durch
Eisenbahnlinien mit Abbeville, Amiens, Dieppe und über
Beauvais mit Paris verbunden, hat besuchte Seebäder, einen
Hafen und (1881) 3937 Einw., welche Fischerei, Seilerei und
Schiffbau treiben.
Treppe (Stiege), eine aus aufeinanderfolgenden Stufen
bestehende Baukonstruktion von Holz, Stein oder Eisen, durch welche
die Verbindung zwischen übereinander liegenden Räumen, z.
B. Stockwerken von Gebäuden, bewirkt wird. Hinsichtlich der
Form unterscheidet man: gerade Treppen (Fig. 1), bei denen die
Wangenstücke gerade sind; gebrochene Treppen (Fig. 2, 3), bei
welchen die Richtung der Wangen vom Antritt bis zum Austritt ein-
oder mehrmals wechselt und daher mehrere geradlinige Treppenteile
ohne oder mit Treppenabsätzen vorhanden sind; doppelarmige
Treppen (Fig. 4), bei welchen eine Mitteltreppe in zwei
Seitentreppen mit entgegengesetzter Steigung übergeht, wobei
auf der erstern oder auf den beiden letztern angetreten werden
kann; Wendeltreppen (Fig. 5-7), bei denen die Stufen, die an der
äußern Seite breit und an der innern schmal sind, in
einer kreis- oder ellipsenförmigen Richtung fortlaufen, und
die Spindeltreppen heißen, wenn die Stufen an der innern
Seite in einer runden oder eckigen Spindel befestigt sind,
Hohltreppen aber, wenn die Windungen der Spindel in einem hohlen
Cylinder liegen; gemischte Treppen (Fig. 8), welche aus gewendelten
und geraden Armen bestehen; Schneckentreppen, welche die Form eines
Kegels haben, aber bloß zu Treppenanlagen in Gärten und
bei kleinen Bergen dienen; romanische Treppen, schiefe Flächen
ohne Stufen, die zuweilen in Türmen und andern Gebäuden
in schneckenförmiger Richtung angebracht werden; Freitreppen,
welche außerhalb der Gebäude angebracht werden, wenn die
Hausthür der Trockenheit wegen, oder weil sich Souterrains im
Haus befinden, etwas hoch angelegt ist. Kurze Treppen pflegt man
nicht zu unterbrechen, längern Treppen gibt man nach 13 oder
15 Steigungen Ruheplätze oder Podeste. Jede ununterbrochene T.
oder Treppenabteilung heißt ein Treppenarm; daher nennt man
aus je einem, zwei und mehr Armen bestehende, mit Podesten
versehene Treppen beziehentlich ein-, zwei- und mehrarmige. Bei
Anordnung der T. müssen Auftritt und Steigung in einem solchen
Verhältnis stehen, daß die T. bequem bestiegen werden
kann. Gute Verhältnisse der Steigung zum Auftritt sind 12:33,
14:32, 15:31, 17:30, 18:29, 19:26. Was die Konstruktion der Treppen
betrifft, so werden steinerne Treppen aus gemauerten oder besser
massiven Stufen hergestellt, welche man untermauert,
unterwölbt oder seitlich so einmauert, daß sie die
nötige Unterstützung finden. Die hölzernen Treppen
sind solche mit eingesetzten Stufen, wobei Tritt- und Futterbretter
in Wangen eingeladen, oder solche mit aufgesattelten Stufen, wobei
die letztern auf die Treppenbäume geschraubt oder genagelt
werden. Eiserne Treppen werden aus einzelnen, meist durchbrochenen
gußeisernen Platten zusammengeschraubt. Bei Treppen aus
gemischtem Material werden meist gemauerte Stufen auf eisernen
Schienen oder gußeisernen Treppenbäumen angewandt, welch
erstere mit schwachen steinernen Auftrittplatten oder mit
hölzernen Auftritten belegt werden. Zum Belegen hat man in
neuerer Zeit auch hartgebrannte Thonplatten verwendet. Steinerne
Treppen sind die solidesten, hölzerne Treppen nicht
feuersicher, aber elastisch und leicht herstellbar, eiserne Treppen
zwar feuersicherer, doch bei Bränden wegen ihrer eignen Hitze
schwer passierbar, aber kompendiös und leicht elegant
herzustellen. Vgl. Nix, Handbuch der Treppenbaukunst (Leipz.
1887).
Fig. 1. Gerade Treppe.
Fig. 2 u. 3. Gebrochene Treppe.
Fig. 4. Doppelarmige Treppe
Fig. 5-7. Wendeltreppen.
Fig. 8 Gemischte Treppe.
Grundrisse verschiedener Treppen.
Treppengiebel, s. Staffelgiebel.
Treppenschnitt, s. Edelsteine, S. 314.
Treppenwitz, s. Esprit (d'escalier).
Trepprecht, s. Tretrecht.
Treptow, 1) (Alttreptow) Stadt im preuß.
Regierungsbezirk Stettin, Kreis Demmin, an der Tollense und der
Linie Berlin-Stralsund der Preußischen Staatsbahn, hat eine
große evang. Kirche, ein Amtsgericht, ein Warendepot der
Reichsbank, Eisengießerei und Maschinenbau, 3 Bierbrauereien,
eine große Wassermühle, Viehmärkte und (1885) 4103
meist ev. Einwohner. -
2) (Neutreptow) Stadt daselbst, Kreis Greifenberg, an der Rega
und der Eisenbahn Altdamm-Kolberg, hat 2 evang. Kirchen, eine
Synagoge, ein Gymnasium, ein Amtsgericht, einen Ritterschaftlichen
Kreditverein, Fabrikation landwirtschaftlicher Maschinen, von
Silberlöffeln und Essig, Bierbrauerei, eine Dampf- und eine
Wassermühle und (1885) 6943 Einw. Nahebei das Remontedepot
Neuhof-T. und das ehemalige Prämonstratenserkloster Belbuck
(1177 von Herzog Kasimir II. gegründet und sehr reich). In T.
ward auf dem Landtag von 1534 die Einführung der Reformation
in Pommern beschlossen. -
3) Dorf im preuß. Regierungsbezirk Potsdam, Kreis Teltow,
an der Spree und nahe der Berliner Ringbahn, mit Berlin durch
Pferdebahn und Dampfschiffahrt verbunden, Vergnügungsort der
Berliner, hat (1885) 1178 Einw.
Tres (lat.), drei.
Tresa, der Abfluß des Luganer Sees in den Lago
Maggiore.
Tresckow, Hermann von, preuß. General, geb. 1. Mai
1818 zu Blankenfelde bei Königsberg in der Neumark, trat 1835
in das Kaiser Alexander-Regiment, nahm 1848 als Adjutant des
Generals v. Bonin am Feldzug in Schleswig-Holstein teil, wurde 1852
Hauptmann im Großen Generalstab, 1855 Major und war 1854-56
der Gesandtschaft in Paris attachiert, ward 1856
Flügeladjutant des Königs, 1860 Kommandeur des 27.
Regiments, 1864 General-
821
Trescone - Tretrad.
stabschef bei den Zernierungstruppen an der polnischen Grenze,
dann in das Militärkabinett berufen, 1865 Generalmajor und
Chef der Abteilung für die persönlichen Angelegenheiten,
dann des Militärkabinetts selbst. Auf seine Bitte ward ihm im
November 1870 das Kommando der 17. Infanteriedivision
übertragen, welche er in den Kämpfen bei Orléans
und Le Mans befehligte. Ende Januar 1871 ward er zur Dienstleistung
als Generaladjutant in das große Hauptquartier kommandiert,
erhielt im Februar wieder die Leitung des Militärkabinetts und
bald darauf das Kommando der 19. Division, im Januar 1873 das
Kommando des 10. und im September d. J. das des 9. Armeekorps. Im
Januar 1875 wurde er zum kommandierenden General, bald darauf zum
General der Infanterie und im September 1875 zum Chef des 2.
Magdeburgischen Infanterieregiments Nr. 27 ernannt. Im August 1888
nahm er seinen Abschied.
Trescone, ital. Nationaltanz in Toscana.
Trescore Balneario, Badeort in der ital. Provinz Bergamo,
im Val Cavallina am Cherio gelegen, hat ein besuchtes Schwefelbad
(16° C., auch Schlammbad), eine ganz von Lotto ausgemalte
Kirche, Seidenindustrie und (1881) 1883 Einw.
Treseburg, Dorf im braunschweig. Kreis Braunschweig, in
einer der schönsten Gegenden des Harzes, am Einfluß der
Luppbode in die Bode, mit (1885) 191 Einw.; dabei der
Wilhelmsblick.
Tresett (tre sette, ilal., "drei Sieben"), ein aus
Italien stammendes Spiel mit L'hombrekarte unter vieren, von denen
wie im Whist die Gegenübersitzenden alliiert sind. Die
Kartenfolge ist stets Drei, Zwei, As, König, Dame, Bube,
Sieben, Sechs, Fünf, Vier. Es gelten die Whistregeln, doch
gibt es kein Atout, und man spielt nicht um Stiche, sondern um
Points. Jedes As in den Stichen zählt 1, je 3 Figuren (Drei
bis Bube) zählen 3 (2 überbleibende nichts), der letzte
Stich 1. Zum Spielen gesellt sich das Ansagen, welches vor dem
ersten Stich nur der Vorhand erlaubt ist. 3 Dreien gelten 4, 4
Dreien 8, die übrigen gedritten Blätter 1, die gevierten
2. 21 Points machen eine Partie. Wer 3 oder 4 Sieben meldet,
gewinnt die Partie sofort und legt noch außerdem 1, bez. 2
für die nächste an. Neapolitaine heißt die Sequenz
von der Drei an; sie zählt so viel Points, wie sie
Blätter stark ist.
Tres faciunt collegium (lat.), "drei machen ein
Kollegium", d. h. drei gehören mindestens zu einem Verein, aus
den Digesten stammender Rechtsspruch.
Treskow, Udo von, preuß. General, geb. 7. April
1808 zu Jerichow bei Magdeburg, trat 1824 in ein
Jägerbataillon, kommandierte 1856-64 das
sachsen-altenburgische Truppenkontingent, machte als Oberst u.
Kommandeur des 53. Regiments den Mainfeldzug 1866 mit, ward im Juli
zum Kommandeur der kombinierten Gardeinfanteriebrigade ernannt,
formierte in Leipzig die preuß. Division des 2.
Reservearmeekorps und zog mit derselben unter dem Oberbefehl des
Großherzogs von Mecklenburg nach Bayern. Nach 1866 als
Kommandeur der 33. Brigade mit Organisation der
Militärverhältnisse der Hansestädte betraut, erhielt
er im Anfang des Kriegs 1870 das Kommando der 1. Landwehrdivision,
mit welcher er an der Belagerung von Straßburg teilnahm, und
leitete dann die Belagerung von Belsort (s. d.), deren große
Schwierigkeiten er jedoch nicht zu überwinden vermochte, so
daß die Festung erst nach dem Waffenstillstand ehrenvoll
kapitulierte. Im Januar 1871 zum Generalleutnant avanciert, erhielt
er nach dem Friedensschluß die 2. Division, nahm 1875 seinen
Abschied und starb 20. Jan. 1885 in Stünzhain bei
Altenburg.
Tres Montes, Vorgebirge, s. Taytao.
Trésor (franz.), Schatz, Schatzkammer,
Geldschrank.
Trésorscheine, s. v. w. Schatzscheine (s. d.). So
hießen in Preußen die zuerst 4. Febr. 1806 ausgegebenen
und 1824 durch Kassenanweisungen ersetzten Scheine, deren Annahme
im Privatverkehr seit 1813 der freien Übereinkunft
überlassen war. Ein Teil derselben (die gestempelten) dienten
dem Zweck der Antizipation von Steuern. Vgl. Bon.
Trespe, Pflanzengattung, s. Bromus.
Tressan (spr. -ssang), Louis Elisabeth de la Vergne, Graf
von, franz. Schriftsteller, geb. 4. Nov. 1705 zu Le Mans, wurde mit
dem jungen Ludwig XV. gemeinsam unterrichtet, stieg dann bis zum
Generalleutnant empor und bekleidete später beim König
Stanislaus die Stelle eines Großmarschalls. Er starb 31. Nov.
1783. Mit Voltaire, Fontenelle und Raynard freundschaftlich
verbunden und im Salon der Madame Tencin ein ständiger Gast,
hatte T. die Litteratur und die Wissenschaften gepflegt und
zahlreiche Gelegenheitsgedichte, ein philosophisches Werk:
"Réflexions sommaires sur l'esprit", u. einen "Essai sur le
fluide électrique" verfaßt. Als seine Hauptwerke aber
sind seine Übersetzung des "Orlando furioso" von Ariost, die
ihm die Aufnahme in die französische Akademie verschaffte
(1781), und das "Corps d'extraits de romans de chevalerie" (1782, 4
Bde.) zu nennen. Seine "OEuvres completes" gaben Campenon und A.
Martin heraus (1822-23, 10 Bde.).
Tressen (franz.), aus Gold - u. Silberfäden oder
auch mit Seide, Lahn und Kantille gewebte Bandstreifen oder Borten
zum Besatz von Kleidungsstücken, Tapetenbeschlägen u.
dgl. Die Kette ist in der Regel von gelber oder weißer Seide,
der Schuß von Gold- oder Silbergespinst. Die besten T. sind
auf beiden Seiten rechts. Nach den verschiedenen Mustern gibt es:
Gaze-, Galonen- und Korallenarbeit und Massiv- oder Drahttressen,
sämtlich durchsichtig und leicht, in der Kette von Seide und
im Einschlag von dünnem Gold- oder Silberdraht;
Bandtressenligaturen, rechts von Gold oder Silber, links ganz von
Seide, und geschleifte T., bei welchen auf der rechten Seite nach
zwei Einschlagfäden von reichem Gespinst nur ein Seidenfaden
zu sehen ist.
Trester, s. v. w. Treber.
Tretgöpel, s. Göpel.
Tretrad (Tretmühle), Maschine zur Aufnahme von Tier-
und Menschenkraft. Das gewöhnliche Tret- oder Laufrad ist aus
Holz und ähnlich wie ein Wasserrad gebaut, aber an seinem
äußern oder innern Umfang nicht mit Schaufeln oder
Zellen, sondern mit Sprossen oder Leisten versehen, welche der
arbeitende Mensch benutzt, um durch fortgesetztes Steigen sich
selbst immer auf derselben Stelle zu behaupten, während das
große hölzerne Rad unter seinen Füßen
ausweicht, d. h. sich unter Abgabe von Arbeit umdreht. Die
Räder können beliebig breit gemacht werden, so daß
mehrere, selbst bis 20 Arbeiter nebeneinander Platz haben. Steigen
nun diese 20 Mann jeder in der Stunde 3000 Stufen von 0,2 m
Höhe, und wird täglich 7 Stunden gearbeitet, so
beträgt die tägliche Leistung, wenn der Mensch 65 kg
wiegt, 21,000.65.0,2=273,000 Meterkilogramm. Dieser bedeutenden
Nutzleistung halber macht man auch heute noch unter gewissen
Umständen von Lauf- und Treträdern Gebrauch. Durch Tiere
betriebene Lauf- und Treträder sind wegen großer
Reibungswiderstände, kolossalen Baues, bedeutender
Herstellungs- und Unterhaltungskosten etc. fast ganz außer
Gebrauch gekommen; nur für manche landwirtschaftliche Zwecke
haben
822
Tretrecht - Treviranus.
sich die Tretwerke oder Trittmaschinen noch erhalten. Sie nehmen
weniger Raum ein als Göpel und ermöglichen
größere Arbeitsleistungen der Tiere, indem diese durch
ihr eignes Gewicht wirken und dabei die stete ermüdende
Wendung des Körpers wegfällt. Dagegen fehlt den meisten
dieser Maschinen die erforderliche Einfachheit und damit die
Möglichkeit, ohne öftere Störungen arbeiten zu
können.
Tretrecht (Trepprecht), das Recht, beim Ackern das
Nachbargrundstück betreten, namentlich auf demselben den Pflug
umkehren zu dürfen (vgl. Anwenderecht).
Tretsch, Aberlin, deutscher Architekt des 16. Jahrh.,
erbaute in den Jahren 1553-70 das alte Schloß in Stuttgart,
eine der hervorragendsten Schöpfungen der deutschen
Renaissance.
Treubund, ein zu Ende 1848 in Berlin gegründeter
antidemokratischer Verein, der bald zahlreiche Anhänger
zählte. Zwiespalt zwischen den Anhängern der Konstitution
und denen des Absolutismus führte um diese Zeit zu einem
Bruch, worauf im November ein neuer Bund: "Die Treue mit Gott
für König und Vaterland", ins Leben trat, der sich aber
bald wieder auflöste. Vgl. Kunze, Der T. (Berl. 1849). Auch in
Kurhessen bestand 1850-53 ein T.
Treuchtlingen, Flecken im bayr. Regierungsbezirk
Mittelfranken, Bezirksamt Weißenburg, an der Altmühl,
Knotenpunkt der Linien München-Bamberg-Hof und
T.-Aschaffenburg-Würzburg der Bayrischen Staatsbahn, hat eine
evangelische und eine kath. Kirche, ein Schloß, eine
Burgruine, ein Forstamt, Töpferwarenfabrikation und (1885)
2596 Einw.
Treue (lat. Fides) ist das dauernde, aus dem
Bewußtsein unsrer Pflicht gegen andre entspringende, wie
Anhänglichkeit (franz. attachement, Hundetreue) das
bewußtlose Festhalten an diesen.
Treue, Hausorden der, badischer Hausorden, 17. Juni 1715
von Markgraf Karl Wilhelm als Ordre de la fidélité
mit Einem Grad gestiftet, 1803 mit Hinzufügung von
Kommandeuren erneuert und 1840 mit neuen Statuten versehen;
zunächst für auswärtige Fürsten, dann für
höhere Staatsbeamte mit Exzellenzrang bestimmt. Die Insignien
des jetzt wieder nur Einen Grad habenden Ordens bestehen in einem
goldenen, achtspitzigen, rot emaillierten, durch vier ineinander
verschlungene C verbundenen Kreuz, in dessen Mittelavers das
verschlungene C über Felsen mit der Umschrift "Fidelitas"
steht, während sich auf dem Revers das badische Wappen
befindet. Das Kreuz wird am orangefarbenen, silbereingefaßten
Band getragen, dazu ein silberner Stern mit vier Haupt- und vier
Zwischenstrahlen, in dessen Mitte sich das Kreuz befindet.
Treuen, Stadt in der sächs. Kreishauptmannschaft
Zwickau, Amtshauptmannschaft Auerbach, an der Trieb und an der
Linie Herlasgrün-Falkenstein der Sächsischen Staatsbahn,
471 m ü. M., hat eine evang. Kirche, 2 Schlösser, ein
Amtsgericht, bedeutende Fabrikation wollener und baumwollener
Tücher, von Treibriemen und Segeltuch, Woll- und
Baumwollspinnerei und (1885) 5867 Einw.
Treuenbrietzen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Potsdam, Kreis Zauch-Belzig, an der Linie Juterbog-T. der
Preußischen Staatsbahn, 69 m ü. M., hat 2 evang. Kirchen
aus dem 13. Jahrh., ein Amtsgericht, Papier-, Tuch- und
Holzpantinenfabrikation, bedeutende Landwirtschaft und (1885) 4890
fast nur evang. Einwohner. T., das ursprünglich Brizen (zuerst
1217 urkundlich erwähnt) hieß, erhielt jenen Namen, weil
es zur Zeit des falschen Waldemar den Wittelsbachern treu
blieb.
Treuga Dei (lat.), s. Gottesfriede.
Treuhänder, s. Testamentsvollstrecker.
Treuschatz, s. Mahlschatz.
Trevelyan (spr. triwilljen), Georg Otto, engl.
Schriftsteller und Politiker, geb. 20. Juli 1838 zu Rothley Temple
in Leicestershire, Neffe Macaulays, studierte zu Cambridge, folgte
1860 seinem Vater, Sir Charles Edward T., der Gouverneur von Madras
geworden, nach Indien, wurde 1865 als Liberaler ins Unterhaus
gewählt, 1868 unter Gladstone für kurze Zeit Lord der
Admiralität, 1880 Sekretär derselben, 1882
Staatssekretär für Irland, 1885 für kurze Zeit
Kanzler von Lancaster. 1886 trennte er sich von Gladstone, weil er
dessen Homerulepolitik nicht billigte, versöhnte sich aber
schon 1887 mit ihm. Er schrieb: "Competition Wallah" (1864);
"Cawnpore, and the massacre there" (1865, 4. Aufl. 1886); "Ladies
in Parlament" (1870); "The life and letters of Lord Macaulay"
(1876, 2 Bde.; deutsch, 2. Aufl., Jena 1883); "The early history of
Charles James Fox" (1880).
Treverer (Treveri, Treviri), Volk im belg. Gallien,
welches sich germanischer Abstammung rühmte, aber keltisch
sprach, unterwarf sich Cäsar erst freiwillig, machte 54 v.
Chr. unter Induciomarus einen Aufstandsversuch, welcher aber von
Labienus unterdrückt wurde; ebenso wurde ein Aufstandsversuch
unter Julius Florus (21 n. Chr.) niedergeschlagen. Beim Aufstand
der Bataver unter Civilis blieben die T. den Römern treu. Ihre
Hauptstadt war Augusta Treverorum (Trier). Vgl. Steininger,
Geschichte der T. (Trier 1845).
Trèves (spr. trähw), franz. Name für
Trier.
Trevi, Stadt in der ital. Provinz Perugia, Kreis Spoleto,
in prächtiger Berglandschaft, an der Eisenbahn Rom-Foligno,
hat mehrere Kirchen (mit Gemälden von Spagna u. a.), eine
kleine Gemäldesammlung, eine technische Schule und (1881) 1238
Einw. In der Nähe der berühmte kleine Tempel des
Clitumnus (jetzt Kirche).
Treviglio (spr. -wiljo), Kreishauptstadt in der ital.
Provinz Bergamo, an der Eisenbahn Mailand-Venedig (mit Abzweigungen
nach Bergamo und Cremona), hat ein altes Schloß, eine
schöne Hauptkirche, ein Gymnasium, eine technische Schule,
Lehrerbildungsanstalt, Bibliothek, ein hübsches Theater, rege
Industrie (besonders Tuch- und Seidenmanufakturen), lebhaften
Handel und (1881) 9854 Einw.
Treviranus, 1) Gottfried Reinhold, Naturforscher, geb. 4.
Febr. 1776 zu Bremen, studierte seit 1792 in Göttingen Medizin
und Naturwissenschaft, ward 1797 Professor der Mathematik und
Physik am Lyceum zu Bremen und starb daselbst 16. Febr. 1837. Unter
den Schriften des ausgezeichneten Forschers sind hervorzuheben:
"Physiologische Fragmente" (Hannov. 1797-99, 2 Bde.); "Biologie
oder Philosophie der lebenden Natur" (Götting. 1802-1822, 6
Bde.) und "Die Erscheinungen und Gesetze des organischen Lebens"
(Brem. 1831-33, 3 Tle.).
2) Ludolf Christian, Botaniker, Bruder des vorigen, geb. 10.
Sept. 1779 zu Bremen, studierte Medizin in Göttingen, wurde
dann Arzt in seiner Vaterstadt, 1807 Lehrer am Lyceum daselbst,
1812 Professor der Botanik und Naturgeschichte zu Rostock, 1816
Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens in
Breslau und kam 1830 in gleicher Eigenschaft nach Bonn, wo er 6.
Mai 1864 starb. Seine Thätigkeit war anfangs vorwiegend der
Phytotomie und Physiologie der Pflanzen, später mehr der
Bestimmung und Berichtigung der Spezies gewidmet.
823
Trevirer - Triangulation.
Er entdeckte die Intercellularräume und den Bau der
Epidermis, auch betonte er in seinen Untersuchungen die
entwickelungsgeschichtlichen Gesichtspunkte und sprach über
einige der fundamentalsten Fragen der Phytotomie Ansichten aus, in
welchen sich die ersten Keime der später von Mohl
ausgebildeten Theorien finden. Auch über die Sexualität
der Pflanzen lieferte er mehrere Untersuchungen. Er schrieb: "Vom
inwendigen Bau der Gewächse" (Götting. 1806);
"Beiträge zur Pflanzenphysiologie" (das. 1811); "Von der
Entwickelung des Embryo und seiner Umhüllungen im Pflanzenei"
(Berl. 1815) und "Physiologie der Gewächse" (Bonn 1835-38, 2
Bde.).
Trevirer, Volk, s. Treverer.
Treviso, ital. Provinz in der Landschaft Venetien, 2438,
nach Strelbitsky 2467 qkm (44,8 QM.) groß mit (1881) 375,704
Einw., ist größtenteils eben und enthält zahlreiche
zur Bewässerung und Schiffahrt dienende Flüsse (Piave,
Livenza etc.) und Kanäle. Die hauptsächlichsten Produkte
sind: Mais (1887: 771,300 hl), Weizen, Wein (67,900 hl), Kastanien
und Obst. Gut entwickelt ist auch die Viehzucht, insbesondere die
Rinderzucht (1881: 100,099 Stück Rindvieh). Auch die
Seidenzucht ist ausgedehnt (1887: 1,6 Mill. kg Kokons). Die Provinz
zerfällt in die acht Distrikte: Asolo, Castelfranco Veneto,
Conegliano, Montebelluna, Oderzo, T., Valdobbiadene, Vittorio. -
Die Hauptstadt T., an der Eisenbahn Udine-Venedig (mit Abzweigungen
nach Feltre, Vicenza und Motta di Livenza) und am schiffbaren Sile
gelegen und von alten Festungswerken umgeben, ist von
altertümlicher Bauart. Hervorragende Bauwerke sind: die
Kathedrale San Pietro (eine im 15. Jahrh. durch Pietro Lombardo
restaurierte dreischiffige Pfeilerbasilika mit Fresken von
Pordenone und Gemälden von Tizian, Paris Bordone u. a.), die
gotische Dominikanerkirche San Niccolò (aus dem 14. Jahrh.),
das Theater, das Leihhaus (mit berühmtem Gemälde,
angeblich von Pordenone) u. a. T. zählt (1881) 18,301 Einw.,
welche Fabrikation von Metallwaren, Maschinen u. Instrumenten,
Seidenwaren, Tuch, Papier, Töpferwaren, Kerzen und Ceresin,
Baumwollspinnerei sowie lebhaften Handel betreiben. Es hat ein
königliches Gymnasium und Lyceum, ein bischöfliches
Lycealgymnasium und Priesterseminar, eine technische Schule, ein
Athenäum und eine Bibliothek (mit Gemäldesammlung) und
ist Sitz des Präfekten, eines Bischofs, eines Hauptzollamtes
und einer Handelskammer.- T. war schon im 6. Jahrh. eine bedeutende
Stadt (Tarvisium), ward 776 von Karl d. Gr. belagert und
eingenommen und kam, nachdem es seine Herren mehrmals gewechselt,
1388 an Venedig, dessen Schicksale es bis 1797 teilte, wo es von
den Franzosen unter Mortier, der dafür den Titel eines Herzogs
von T. erhielt, in Besitz genommen ward. Am 5. Mai 1809 fand hier
ein Gefecht zwischen den Österreichern und Franzosen statt. Am
21. März 1848 brach in T. ein Aufstand aus, infolge dessen die
schwache österreichische Besatzung die Stadt räumen
mußte. Am 11. Mai wurden hier die Piemontesen
zurückgeschlagen, worauf die Beschießung der Stadt unter
Nugent erfolgte. Ein zweites Bombardement unter Welden zwang die
Stadt, 24. Juni zu kapitulieren und sich an Österreich zu
ergeben. 1866 ward T. italienisch.
Trévoux (spr. -wuh). Arrondissementshauptstadt im
franz. Departement Ain, ehemalige Hauptstadt der Landschaft Dombes,
an der Saône und der Eisenbahn Paris-Lyon, mit
Goldwarenfabrikation und (1886) 1902 Einw. Über das 1704
erschienene "Dictionnaire de T." s. Französische Sprache, S.
618.
Treysa, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Kassel,
Kreis Ziegenhain, an der Schwalm, Knotenpunkt der Linien
Kassel-Frankfurt a. M. und T.-Leinefelde der Preußischen
Staatsbahn, 238 m ü. M., hat 2 Kirchen, ein Amtsgericht,
Weberei, Strumpfwirkerei, Spinnerei, Holzschneiderei und (1885)
2413 meist evang. Einw. In der Nähe das von Hugenotten erbaute
Dorf Franzosendorf. Vgl. Keulenkamp, Geschichte der Stadt T.
(1806).
Triade (Trias, lat.), Dreiheit von drei gleichartigen
Dingen; daher triadisches Zahlensystem, System, dessen Grundzahl 3
ist.
Triage (franz., spr. -ahsch), Ausschuß, Ware, aus
der das Beste ausgesucht ist; insbesondere Kaffeeabfall.
Triakisoktaëder (Pyramidenoktaeder), 24flächige
Kristallgestalt des tesseralen Systems, s. Kristall, S. 230.
Trial (engl., spr. trei-el), Untersuchung,
Verhör.
Triándrus (griech.), dreimännig, Blüten
mit drei Staubgefäßen; daher Triandria, 3. Klasse des
Linnéschen Systems, Gewächse mit drei freien
Staubgefäßen enthaltend.
Triangel (lat., "Dreieck"), ein in unsern Orchestern
gebräuchliches Schlaginstrument einfachster Konstruktion,
bestehend aus einem im Dreieck gebogenen Stahl- oder Messingstab,
der, durch einen andern Stab angeschlagen, ein hohes klirrendes
Geräusch gibt.
Triangularzahlen, s. Trigonalzahlen.
Triangulation (lat., auch trigonometrische Netzlegung),
Inbegriff aller Arbeiten, welche einer geregelten topographischen
Aufnahme (s. d.) eines Landes vorausgehen müssen, aber auch
bei Gradmessungen etc. ausgeführt werden. Zweck der T. ist im
eigentlichen Sinn: Bestimmung der Lage von Punkten der
Erdoberfläche. Denkt man sich einen Punkt auf eine Fläche
projiziert (s. Projektion), so ist die Lage des Punktes bestimmt,
sobald die Höhe des Punktes über dieser Fläche und
die Lage seiner Projektion auf dieser Fläche bekannt ist.
Diese, die Projektionsfläche, ist die Meeresfläche, und
die Höhe der Punkte über derselben wird durch
Höhenmessung oder Nivellement, ihre Lage auf der
Projektionsfläche durch Horizontalmessung oder (eigentliche)
T. bestimmt. Die T. zerfällt in Basismessung und
Horizontalwinkelmessung.
Unter einer Basis versteht man diejenige auf die
Projektionsfläche projizierte Entfernung von Punkten, die der
folgenden Bestimmung der Entfernung aller Punkte voneinander als
Grundlage dient. Die Länge der Basis beträgt im
allgemeinen 3-5 km und ihre Lage wird so ausgesucht, daß sie
die Vergrößerung der Seiten ermöglicht und das
Terrain zwischen ihren Endpunkten nicht Unebenheiten bietet, die
nicht durch den Basismeßapparat überwunden werden
könnten. Der Wichtigkeit der Basis für die folgende T.
entsprechend, muß man die Basis mit der größten
Sorgfalt und mit einem Apparat messen, der die Garantie
möglichst kleiner Fehler bietet. Die verschiedenen
Basismeßapparate schließen sich im wesentlichen dem von
Bessel 1834 zu der Gradmessung in Ostpreußen konstruierten
und später verbesserten an. Der Basismeßapparat besteht
aus Meßstangen, Glaskeilen u. Zubehör. Die
Meßstangen a a (Fig. 1, S. 824), 3-5 an der Zahl, sind von
Eisen u. etwa 4 m lang. Auf ihnen liegen Zinkstangen b b von der
halben Breite und der ganzen Dicke. An dem einen Ende c sind diese
Stangen durch Schrauben u. Lötung fest miteinander verbunden;
sonst nicht weiter vereinigt, berühren sie sich der ganzen
Länge nach. An beiden Enden der Zinkstange d und e sind
Stücke von Stahl aufgelötet, deren
824
Triangulation (Basismessung).
Enden horizontal abgeschrägt sind. Die Eisenstange
trägt dagegen nur auf dem einen Ende f ein Stahlstück,
welches auch keilförmige Abschärfungen hat, deren
Schneiden aber senkrecht zur Ebene der Stange stehen. Aus der
ungleichen Ausdehnung von Eisen und Zink folgt, daß die
Entfernung e f mit der Temperatur der Meßstangen variiert.
Aus der Größe e f ist daher auf diese Temperatur zu
schließen, und da die Länge der Stangen bei einer
gewissen Normaltemperatur durch vorangegangene Untersuchung bekannt
ist, so ist unter fernerer Berücksichtigung des
Ausdehnungskoeffizienten des Eisens die jedesmalige Länge der
Stangen zu bestimmen. Um die Biegung der Meßstange zu
verhüten, liegt dieselbe mittels der Rollenpaare g g (Fig. 2)
auf einer eisernen Stange h, die auf dem Boden eines Holzkastens
iiii befestigt ist, der die Meßstange der Länge nach
einschließt. Aus den Ruhepunkten ist die Stange mittels
Mikrometerschraube k beweglich, die auf einer Seite aus dem Kasten
heraustritt. Zur Horizontallegung der Stange, resp. zur Ablesung
des Winkels, um welchen diese von der horizontalen Lage abweicht,
befindet sich auf ihr eine Libelle l mit graduierter Schraube. In
der obern Fläche des Kastens sind ein oder zwei mit Glas
geschlossene Einschnitte angebracht zur Ablesung der
Stangentemperatur an einem auf den Meßstangen ruhenden
Thermometer. Die Glaskeile (3-5), in Einem Stück geschliffen,
sind nach dem Schleifen so voneinander getrennt, daß die
parallelen Ebenen 3 Linien Entfernung haben. Die Stärke der
Keile steigt von 0,8-2,0 Linien. Zwischen diesen beiden Grenzen
sind auf einer der parallelen Ebenen 120 Striche in gleichen
Zwischenräumen so gezogen, daß sie die den Winkel der
geneigten Ebenen des Keils halbierende Linie senkrecht
durchschneiden. Diese 120 Striche füllen eine Länge von
41 Linien, sind also 1/3 Linie voneinander entfernt und sehr nahe
von 0,01 zu 0,01 Linie der Dicke des Keils fortgehend. Da
außerdem die Zehntel eines Zwischenraums von 1/3 Linie leicht
durch das Augenmaß geschätzt werden, so bieten die Keile
das Mittel, noch Tausendstel der Linie zu messen. Zubehör sind
Böcke zum Auflegen der Stangen, Gewichte, Pfähle etc.
Der Basismessung gehen die Planierungsarbeiten des Basisterrains
voraus, um Unebenheiten des Terrains über 3°
Böschung, die durch den Apparat nicht überwunden werden
können, durch Abkämmen, resp. Aufführung von
Pfahlrosten etc. zu entfernen. Ist dieses geschehen, so werden bei
einer langen Basis mittels eines über einem Endpunkt
aufgestellten Theodolits (s. d.) in der Richtung nach dem andern
Endpunkt Zwischenpunkte bestimmt und diese durch feine Stifte
markiert. Von dem einen Endpunkt anfangend, werden dann so viel
Böcke aufgestellt, daß auf diese sämtliche
Meßstangen hintereinander gelegt werden können. (Fig. 2
zeigt eine auf zwei Böcke gelegte Meßstange.) Das
vorderste Ende der ersten Meßstange wird mit dem ersten
Endpunkt der Basis in Verbindung gebracht und diese Stange wie auch
alle andern mittels Theodolits so eingerichtet, daß sie genau
in der Richtung der Basis liegen. Es werden dann mittels der
Glaskeile die Entfernung e f (Fig. 1) sowie die Zwischenräume
zwischen je zwei Meßstangen gemessen; endlich wird an den
Libellenschrauben die Neigung der Meßstange abgelesen. Ist
eine Stange entweder zu nahe oder zu weit von der vorliegenden
gelegt worden, so daß der Gebrauch der Glaskeile nicht
durchführbar, so muß vorher die Stange mittels
Mikrometerschraube in den nötigen Abstand gebracht werden.
Sind die Ablesungen gemacht und notiert, so wird die erste Stange
in die Verlängerung der letzten gebracht und die Messung in
derselben Weise fortgesetzt. Da die Messung einer Basis mindestens
14 Tage angestrengter Thätigkeit erfordert, die Arbeit mithin
öfters unterbrochen und wieder angeknüpft werden
muß, so sind provisorische Festlegungen erforderlich, die mit
größter Genauigkeit ausgeführt werden müssen
und besondere Maßregeln erfordern, damit bei Wiederaufnahme
der Messung auch die kleinsten
825
Triangulation (erster Ordnung).
Fehler vermieden werden. Die bei der Messung ausgeführten
Beobachtungen geben das Mittel, die Länge der Basis zu
berechnen und auch ferner den wahrscheinlichen Fehler in Bezug auf
die Länge zu bestimmen (im allgemeinen kaum ein Milliontel der
ganzen Länge). Die Endpunkte der Basis werden behufs
späterer Wiederbenutzung sehr fest im Terrain markiert. Der
beschriebene Basismeßapparat ist der Reichenbachsche oder
Besselsche "Keilapparat", derselbe wird in Preußen, Bayern
und Italien gebraucht, Rußland und Schweden benutzen den
"Fühlhebelapparat" (s. d.), die Niederlande, Spanien und
Portugal den Brunnerschen "Mikroskopenapparat". Ein neuerer von
General Baeyer und Bauernfeind empfohlener Apparat ist das
Steinheilsche, auf Schienenbahn laufende gußstählerne
"Meßrad" mit Zählapparat (im hoch, zwischen
Holzwandungen laufend); letzterer Apparat etwa analog dem von
Fernel in Frankreich 1525 und Müller in Mähren 1720 zur
dortigen Landesvermessung angewendeten Meßrad.
Ist die Länge der Basis durch Messung und nachherige
Berechnung bekannt, so ist es möglich, in einem Umkreis von
200 km Halbmesser beliebig viele Punkte zu bestimmen. Dieses
geschieht wie folgt: 1) Die Basis A B (Fig. 3) wird bis zu einer
Entfernung G H von 40-100 km Länge auf die in der Figur
veranschaulichte Weise vergrößert. In jedem der
vorhandenen Dreiecke brauchen nur je zwei Winkel gemessen zu
werden, um demnächst die Seiten C B, C A und D A, D B, dann C
D, darauf E C, E D, F C, F D etc., endlich G H zu berechnen. 2) Von
der Seite G H ausgehend, werden Ketten von Dreiecken nach
verschiedenen Richtungen bis zu 200 km Entfernung von der Basis
geführt und diese Ketten miteinander so verbunden, daß
Flächen, welche von Dreiecken nicht überzogen, jedoch
ganz umschlossen sind, dazwischen bleiben. Es folgt 3) die
Ausfüllung der zwischen den Ketten freigelassenen Räume
mit Dreiecken. 4) In die unter 2 und 3 aufgeführten Dreiecke
werden Dreiecke eingeschaltet, deren Seitenlängen bis zu 10 km
herabsteigen. 5) In letztere Dreiecke werden endlich solche
eingeschoben, deren Seitenlängen sich bis zu 2 km vermindern.
Alle Messungen, die sich auf 1 und 2 beziehen, umfassen die T.
erster Ordnung, die auf 3 bezüglichen die sekundäre T.
erster Ordnung, die auf 4 bezüglichen die T. zweiter Ordnung,
die auf 5 bezüglichen die Detailtriangulation oder T. dritter
Ordnung.
Die T. erster Ordnung gibt die Grundlage zu allen folgenden
Triangulationsarbeiten; sie erfordert daher die Anwendung der
vorzüglichsten 10-15zölligen Theodolite (s. d.) sowie die
größte Sorgfalt bei den Messungen. Die Arbeiten beginnen
mit der Rekognoszierung des Terrains und der Auswahl der Punkte,
welche behufs Ausführung der Beobachtungen namentlich in
waldigem und etwas koupiertem Terrain durch Aufführung von
bedeutenden Bauten (Signalen) sichtbar gemacht werden müssen.
Die Höhe der Signale variiert je nach den Hindernissen, welche
die Durchsicht von einem Punkt zum andern decken, von 3-30 m. Die
Signale werden aus starkem Holz so errichtet, daß sie bei
heftigem Wind nicht erschüttert werden, und daß
derjenige Teil, auf dem das Instrument zu stehen kommt,
vollständig isoliert ist von demjenigen Teil, auf dem sich der
Beobachter befindet. Dies erreicht man durch zwei ineinander
stehende, völlig getrennte Bauten. Statt der Holzsignale
werden bei geringern Höhen Steinpfeiler errichtet (1 m hoch),
bei Kirchtürmen auf deren Plattform. Diesen
Vorbereitungsarbeiten folgen die Beobachtungen. Wegen der
großen Entfernung der Punkte voneinander und in
Rücksicht auf die möglichst besten Einstellungsresultate
wird aber bei der T. erster Ordnung davon abgesehen, die auf den
Signalen angebrachten Spitzen oder Tafeln etc. als
Einstellungsobjekte zu nehmen, vielmehr stets das mittels des auf
dem Nachbarsignal aufgestellten Heliotrops (s. d.) reflektierte
Licht eingestellt. Behufs der Beobachtungen wird der
Horizontalkreis des Theodolits genau horizontiert, und dann auf
jedem Punkt sämtliche vorhandene Richtungen mindestens 24 mal
eingestellt, so daß alle Winkel gleich oft gemessen werden.
Zur Eliminierung der sehr kleinen, aber stets vorhandenen
Einteilungsfehler des Horizontalkreises nimmt man sämtliche
Beobachtungen nicht auf einer Station in derselben Stellung des
Kreises vor, sondern verändert unter Beibehaltung derselben
Stellung des Instruments den Horizontalkreis um einen bestimmten
Winkel (gewöhnlich 60°). Auch wird bei der exzentrischen
Lage des Fernrohrs in jeder Kreislage jedes Objekt ebenso oft in
der einen wie in der andern genau um 180° entgegengesetzten
Stellung des Fernrohrs eingestellt. Aus dem Mittel beider Resultate
folgt dann der auf das Zentrum des Instruments sich beziehende
Winkel. Zwei weitere Feldarbeiten sind: a) Das Nehmen der
Zentrierelemente. Da es nicht immer möglich, den Heliotropen
oder den Theodolit im Zentrum der Station aufzustellen, so ist die
Abweichung hiervon zu messen, um diese den später zu
berechnenden Winkeln als Korrektion hinzufügen zu können.
b) Das Festlegen des Punktes. Dieses ist unbedingt erforderlich,
wenn die Messungen einen dauernden Wert haben und die
Anknüpfung späterer Messungen ermöglichen sollen. Es
geschieht durch Marksteine, bei der T. erster Ordnung durch eine
versenkte, ca. 50 cm im Quadrat große Platte und einen
daraufgestellten, ca. 1 m hohen, ca. 50 cm zu Tage tretenden Block.
In beide, Stein und Platte, sind in der Mitte der Steinflächen
Kreuzschnitte angebracht, deren Mittelpunkte das Zentrum der
Station bedeuten. Nach Beendigung der Feldarbeiten beginnt die
Berechnung der Kette. Da es nur selten möglich, auf einer
Station stets sämtliche Objekte einzustellen, so wird das
Mittel aus allen Einstellungen auch nicht deren wahrscheinlichsten
Wert ergeben. Die Ermittelung desselben wird durch die Ausgleichung
der Stationen erreicht. Es folgt sodann das Zentrieren der Winkel
bei denjenigen Stationen, bei denen der Theodolit oder der
Heliotrop nicht im Zentrum der Station aufgestellt war. Sind die
wahrscheinlichsten Werte der Richtungen hiernach korrigiert, so
folgt die Ausgleichung der Kette. Da nämlich in jedem Dreieck
sämtliche Winkel gemessen werden und es unmöglich ist,
dieselben absolut richtig zu messen, so folgt, daß die Summe
der gemessenen Winkel nicht gleich sein wird 180° + dem
sphärischen Exzeß (d. h. der Zusatz an
Winkelgröße über 180° an der Summe der Winkel
eines Kugeldreiecks). Außerdem folgt aus der nicht absoluten
Richtigkeit der Winkel, daß bei der Berechnung der
Dreiecksseiten stets verschiedene Werte gefunden werden
müssen,
826
Triangulation (zweiter Ordnung, Detailtriangulation,
Höhenmessungen).
je nachdem der eine oder der andre Winkel zur Berechnung benutzt
wird. Beides wird durch die Ausgleichung eliminiert, sämtliche
Dreiecke werden so auf 180° + sphärischen Exzeß
gebracht, und außerdem erhält jede Dreiecksseite in dem
ganzen Netz nur einen einzigen Wert. Die Ausgleichung erfordert die
Aufstellung und Auflösung von Gleichungen, deren Anzahl von
der Zahl der zu bestimmenden Punkte und der vorhandenen Richtungen
abhängt. Die Grenze für die wahrscheinlichen Fehler der
Dreiecksseiten erster Ordnung beträgt 1/100000 der
Länge.
Die T. zweiter Ordnung (sekundäre T.) wird im allgemeinen
wie die T. erster Ordnung ausgeführt; nur gestattet der feste
Rahmen, der diese Dreiecke umschließt, bei den Beobachtungen
wie bei den Ausgleichungen ein etwas abgekürztes Verfahren.
Bei der sekundären T. erfolgen die Rekognoszierungen, die
Bebauung und Festlegung wie bei der T. erster Ordnung. Die
Beobachtungen werden mit achtzölligen Theodoliten
ausgeführt, die Pyramidenspitzen, Kirchturmspitzen als
Einstellungsobjekte genommen und jeder Winkel zwölfmal
gemessen. Stationsausgleichung findet nicht statt, und die
Ausgleichung des Netzes wird nicht im ganzen, sondern nur
gruppenweise ausgeführt. Die Fehlergrenze der Dreiecksseite
beträgt 1/50000 der Länge. Bei der Detailtriangulation
endlich ist wegen der geringen Entfernung der Punkte voneinander
die Rekognoszierung und Bebauung bedeutend vereinfacht. Die Signale
sind im allgemeinen nur ca. 4-6 m hohe drei- oder vierseitige
Pyramiden. Die Festlegung besteht in einem einfachen Block mit
Kreuzschnitt. Zu den Beobachtungen werden fünfzöllige
Theodoliten benutzt und die Winkel durch sechsmalige Einstellung
gewonnen. Bei der Berechnung wird der sphärische Exzeß
nicht berücksichtigt. Dreiecksfehler werden auf die drei
Winkel verteilt und die Länge der Seiten aus dem
arithmetischen Mittel der aus den verschiedenen Dreiecken sich
ergebenden Werte derselben Seite mit 1/25000 Fehlergrenze
ermittelt. In Fig. 4 sind die Triangulationen der verschiedenen
Ordnungen veranschaulicht, und es bezeichnen die starken Linien die
T. erster Ordnung, die schwachen die T. zweiter Ordnung und die
punktierten die Detailtriangulation.
Was die Höhenmessungen betrifft, so werden die Nivellements
eingeteilt in trigonometrische und geometrische Nivellements.
Letztere werden unterschieden in geometrische
Präzisionsnivellements und einfache geometrische Nivellements.
Über einfache Nivellements s. Nivellieren. In der höhern
Geodäsie kommen nur trigonometrische und geometrische
Präzisionsnivellements zur Anwendung. Die früher
angewendeten trigonometrischen Nivellements sind
erfahrungsmäßig infolge der Refraktionseinflüsse
nicht völlig genau; als Grundlage aller Höhenbestimmungen
werden jetzt daher nur geometrische Präzisionsnivellements
ausgeführt. Die Fehlergrenze von 3 mm bei guten, 5 mm auf 1 km
bei noch brauchbaren Nivellements bedingt die Anwendung
vorzüglichster Nivellierinstrumente (Fernrohre mit ca. 32
maliger Vergrößerung) und größte Sorgfalt bei
den Beobachtungen. Die Nivellements werden, von dem Nullpunkt eines
Pegels ausgehend, auf möglichst ebenen Straßen,
Chausseen etc. ausgeführt; von 1/4 Meile zu 1/4 Meile wird ein
Punkt der Höhe nach bestimmt und im Terrain, z. B. durch einen
in einen Granitblock horizontal eingelassenen gußeisernen
Nivellementsbolzen, fest markiert. Von diesen so bestimmten Punkten
werden Seitennivellements nach allen in der Nähe liegenden
trigonometrisch bestimmten Punkten ausgeführt und so auch
deren Höhe über dem Nullpunkt des Pegels ermittelt. Das
Nivellement geschieht stets von der Mitte aus, jede Linie wird
mindestens zweimal nivelliert, auf den Chausseen findet der
Kontrolle halber polygonaler Abschluß statt. Die durch
denselben sich ergebenden kleinen Differenzen werden durch die
Ausgleichung eliminiert, mittels welcher die definitiven Höhen
der Punkte gefunden werden. Näheres über
Präzisionsnivellements s. Nivellieren.
Gleichzeitig mit der Horizontalwinkelmessung bei der T. zweiter
und dritter Ordnung werden trigonometrische Höhenmessungen
zwischen allen denjenigen Punkten vorgenommen, deren Höhen
nicht bereits durch geometrische Nivellements bekannt sind. Mit der
T. erster Ordnung werden keine Höhenmessungen verbunden, da
bei den großen Entfernungen der einzelnen Hauptdreieckspunkte
die Unregelmäßigkeiten der Refraktion die Güte des
Resultats benachteiligen würden. Da ferner die Refraktion
mittags am geringsten ist, so werden die Beobachtungen nur in der
Zeit von 10-3 Uhr ausgeführt. Soll der Höhenunterschied h
der beiden Punkte A u. B (Fig. 5), dessen Horizontalentfernung a
durch die vorangegangene T. bekannt ist, gefunden werden, so ist
nur erforderlich, den Winkel z, die Zenithdistanz, zu messen; denn
da z = alpha, so folgt: h = a/ tang z. Dieser Höhenunterschied
h, zu der absoluten Höhe von A addiert gibt die absolute
Höhe von B. Die Zenithdistanzen werden mittels der mit
Höhenkreisen versehenen Theodolite genommen. Um richtige
Resultate zu erhalten, hat man die Höhe des Fernrohrs in A und
die Höhe des eingestellten Objekts in B in Bezug auf die
Dreieckspunkte A und B zu messen und in Rechnung zu bringen. Wie in
A nach B, wird auch in B nach A
826a
Triasformation I.
von vorn Coratites nodosus.
von der Seite (Art. Ammoniten und Tintenschnecken.~)
Encrinus liliiformis; a Stielglied von der Gelenkfläche.
(Art. Krinoideen.)
Stück eines Zahndurchschnittes von Mastodonsaurus Jaegeri,
stark vergrößert. (Art. Labyrinthodonten,')
Ein ganzer Gaumen von Placodus Andriani; die Mahlzähne sind
erhalten, die Schneidezähne ausgefallen. (Art.
Reptilien.')
von der Seite o von vorn Lima striata. (Art.
Kammmuscheln.')
Zahn von Mastodonsaurus.
Avicula socialis.
(Art. Muscheln.}
Schädel von Mastodonsaurus Jaegeri. (Art.
Labyrinthodonten.)
Fährtenabdrüeke von Chirotherium. (Art.
Labyrinthodonten.)
von der Seite von vorn
Cardita crenata. (Art. Muscheln.')
Terebratula vulgaris. (Art. Brachiopoden.}
Posidonomya Clarai. (Art. Muscheln.)
Fährtenabdruck von Brontozoum (Ornitichnites) giganteum
und sogen, fossile Regentropfen (Abdrücke von
Luftblasen).
(Art. Dinosaurier,)
Zum Artikel »Triasformation«
826b
Triasformation II.
Pflanzen der Keuperformation.
1. Nadelhölzer (Voltzien). -- 2. Riesenschachtelhalm
(Equisetum arenaceum). -- 3. Brandblattpflanze (Aethophyllum
speciosum). -- 4. Kammwedel (Pecopteris Meriani). -- 5.
Kammwedel (Pecopteris angusta). -- 6. Netzfarn
(Clathropteris). -- 7. Kalamiten (Calamites Meriani). --
8. Bandfarn (Taeniopteris marantacea). -- 9. Flügelzamie
(Pterophyllum Jaegeri).
827
Triangulation - Triasformation.
die Zenithdistanz gemessen und sowohl von hier aus als auch aus
der Zusammenstellung der von B über andre Punkte, C D etc.
(Fig. 6), nach A zurück ermittelten Höhenunterschiede
eine Kontrolle über die Güte der Arbeit ausgeführt.
Existieren in einem größern Terrainabschnitt keine durch
geometrische Nivellements bestimmten Dreieckspunkte, so ist es
erforderlich, wenigstens einige Punkte möglichst sicher der
Höhe nach zu bestimmen. Es werden dazu
gegenseitig-gleichzeitige Zenithdistanzen genommen. Es seien z. B.
die Höhen der Punkte A und F (Fig. 6) bekannt, und es sollen
die Höhen der Punkte B, C, D, E bestimmt werden, so messen
zunächst auf A und B je ein Beobachter die Zenithdistanzen von
A nach B, resp. B nach A und zwar mit Hilfe des Heliotropen oder
bei nähern Entfernungen mit Hilfe eines durch Senken einer
Tafel etc. gegebenen Zeichens in demselben Zeitmoment. Ist die
vorgeschriebene Anzahl von Beobachtungen beendigt, so begibt sich
der Beobachter von A nach C. Es werden dann die Zenithdistanzen von
B nach C und von C nach B gemessen. Darauf geht der Beobachter von
B nach D etc. bis zu Ende.
Die gegenseitig-gleichzeitigen Beobachtungen haben den Vorteil,
daß sie annähernd den Einfluß der Refraktion
aufheben, kommen indes nur in beschränkter Weise zur
Anwendung. Im großen und ganzen werden die trigonometrischen
Höhenmessungen durch gegenseitige, aber nicht gleichzeitige
Beobachtungen ausgeführt, und nur ausnahmsweise, wenn ein
Punkt die Aufstellung des Instruments (wie bei einzelnen
Kirchtürmen etc.) nicht erlaubt, oder wenn eine allzu
große Genauigkeit nicht verlangt wird, werden einseitige
Zenithdistanzen genommen; dann muß aber die Höhe eines
solchen Punktes der Kontrolle halber stets von mindestens drei
andern bereits bestimmten Punkten aus ermittelt werden. Ist auf
beschriebene Weise durch T. und Höhenmessung die Lage eines
Punktes auf und über der Projektionsfläche ermittelt
worden, so ist die geographische Position desselben festzustellen.
Dieses geschieht durch Polhöhen-, Längen- und
Azimutbestimmung. In der höhern Geodäsie kommen aber alle
diese Arbeiten nur ausnahmsweise vor, da es, wenigstens in Europa,
stets möglich sein wird, einen Dreieckspunkt mit einer
Sternwarte unmittelbar zu verbinden und so deren Position auf einen
Dreieckspunkt zu übertragen. Ist die geographische Position
Eines Dreieckspunktes bekannt, so wird mit Hilfe der noch als
gültig angenommenen Erddimensionen von Bessel durch einfache
Rechnung Breite, Länge und Azimut jedes andern trigonometrisch
bestimmten Punktes ermittelt. Vgl. Puissant, Traité de
géodésie (Par. 1805); Späth, Die höhere
Geodäsie (Münch. 1816); Decker, Lehrbuch der höhern
Geodäsie (Mannh. 1836); Fischer, Lehrbuch der höhern
Geodäsie (Darmst. 1845-46, 3 Abtlgn.); Bessel und Baeyer,
Gradmessung in Ostpreußen (Berl. 1838); Baeyer,
Küstenvermessung (das. 1849); die Werke von Gauß und die
Veröffentlichungen des Büreaus der Landestriangulation;
Bauernfeind, Elemente der Vermessungskunde (6. Aufl., Stuttg.
1879); Jordan, Handbuch der Vermessungskunde (2. Aufl., das. 1878);
Börsch, Geodätische Litteratur (Berl. 1889).
Triangulation, in der Gärtnerei die Veredelung mit
dem Geißfuß (s. d. und Pfropfen).
Triangulieren (lat.), ein Stück Erdoberfläche
behufs trigonometrischer Vermessung in Dreiecke zerlegen (vgl.
Triangulation).
Trianon (spr. -nong, Groß- und Klein-T.), zwei
Lustschlösser im Park von Versailles. Ersteres 1685 von Ludwig
XIV. für Frau von Maintenon nach Mansarts Plänen
errichtet, nur ein Stockwerk hoch, von Ludwig Philipp mannigfach
umgebaut; letzteres unter Ludwig XV. für die Dubarry erbaut,
später Lieblingsaufenthalt der Königin Marie Antoinette,
mit schönem englischen Park. Vgl. Lescure, Les palais de T.
(Par. 1867); Desjardins, Le Petit-T. (Versaill. 1885); Bosq,
Versailles et les Trianons (Par. 1887).
Triarchie (griech.), Dreiherrschaft, Triumvirat.
Triarier (lat.), die ältesten Kerntruppen der
altrömischen Legionen vor der Zeit des Marius, deren
charakteristische Waffe die Hasta (s. d.) war. Im Gefecht bildeten
sie das dritte Treffen.
Trias (griech.), im allgemeinen die "Dreiheit", jede
Zusammstellung von drei irgendwie zusammengehörigen Dingen (s.
Trinität). In der Zeit des Deutschen Bundes verstand man unter
T. die Dreiteilung Deutschlands in Österreich, Preußen
und das "eigentliche Deutschland", die "rein deutschen" Mittel- und
Kleinstaaten, welch letztern eine festere und engere politische
Organisation gegeben werden sollte. Besonders Bayern und sein
König Maximilian II. förderten die sogen. Triasidee, weil
sie sich davon die Begründung einer bayrischen Hegemonie
versprachen. Die Ereignisse von 1866 und 1870-71 haben diese
Pläne für immer begraben. - Trias harmonica (lat.), in
der Musik s. v. w. konsonierender Dreiklang (Dur- oder Mollakkord);
T. superflua, übermäßiger Dreiklang; T. deficiens,
verminderter Dreiklang.
Triasformation (hierzu Tafel "Triasformation"), die
älteste der mesozoischen Formationen, die Dyasformation
bedeckend und von der Juraformation überlagert. Schon
hinsichtlich des zusammensetzenden Gesteinsmaterials macht sich die
Dreiteilung bemerklich, indem wenigstens in vielen Gegenden der
Entwickelung eine vorwiegend aus Sandstein bestehende unterste
Abteilung von einer wesentlich aus Kalkstein zusammengesetzten
mittlern Abteilung abgelöst wird, welcher als drittes Glied
eine Mergelbildung aufgelagert ist. Die Sandsteine sind
Quarzsandsteine mit thonigem (meist eisenschüssigem und dann
rotem, aber auch kaolinigem und dann weißem) oder kieseligem
Bindemittel, dem Korne nach sehr verschieden, feinkörnige
vorwiegend, andre Übergänge bis zu großbrockigen
Konglomeraten bildend. Die Kalksteine sind der Hauptmasse nach
dicht und dunkel gefärbt, durch thonige und organische
Substanzen stark verunreinigt, in einzelnen Lagen auch deutlich
kristallinisch und dann reiner, mitunter fast ausschließlich
aus organischen Resten gebildet. Unter den Mergeln walten bunt
gefärbte (marnes irisées) vor; ganz gewöhnlich
enthalten sie schwefelsaures Calcium, als Anhydrit oder Gips,
beigemengt. In einzelnen Lagen sind sie verkieselt (Steinmergel).
Untergeordnet kommen Mergel in der untersten und in der mittlern,
Sandsteine in der obersten, seltener in der mittlern, Dolomite,
Anhydrite, Gipse und Hornsteine in allen drei Etagen vor. In
mehreren Niveaus sind hier und da Steinsalzlinsen eingelagert.
Gliederung und Verbreitung. Die Dreiteilung der T. in
Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper ist am deutlichsten an den
kontinentalen, speziell den deutschen, außeralpinen
Schichtensystemen durchzuführen, während sich das Bild in
England und Amerika dadurch verwischt, daß die mittlere
Abteilung
828
Triasformation (Gliederung).
(Muschelkalk) überhaupt nicht zur Entwickelung kam und in
der alpinen, übrigens sonst auch weitverbreiteten Facies die
Gesteinsunterschiede zwischen den einzelnen Gliedern nicht so
charakteristisch hervortreten. Zunächst von der deutschen
außeralpinen Facies ausgehend, läßt sich in der
untersten Abteilung, dem Buntsandstein, wiederum eine Dreiteilung
durchführen: zuerst, bei vollständiger Entwickelung der
Formationen, dem Zechstein (s. Dyasformation), oft aber auch
ältern Bildungen, beispielsweise dem Granit, aufgelagert,
Letten (Leberschiefer), weiße, oft fleckige Sandsteine
(Tigersandsteine), in einzelnen Gegenden (am Harz) Roggenstein.
Dieser untersten Abteilung folgt der Hauptbuntsandstein
(Vogesensandstein), überwiegend rot gefärbt; das bald
thonige, bald kieselige Bindemittel ist in den Schichten oft
regellos verteilt, so daß durch die Verwitterung groteske
Felsenklippen (Annweiler Thal) oder Blockanhäufungen
(Felsenmeere) entstehen. Mitunter konzentriert sich das thonige
Bindemittel zu größern Gallen oder kleinen,
gewöhnlich bald auskeilenden Zwischenschichten. Hin und wieder
sind einzelne Sandsteinpartien von kugeligen, aus kieselreicher
Masse gebildeten Konkretionen (Kugelfelsen) durchspickt. Das
oberste Glied des Buntsandsteins, den Röt, bilden Mergel mit
untergeordneten Dolomiten und ebenfalls zurücktretenden, oft
pflanzenführenden Sandsteinen (Voltziensandsteinen), nicht
selten sehr dünnschieferig, glimmerreich und mit
Steinsalzpseudomorphosen und Tierfährten
(Chirotheriumsandstein) auf den Oberflächen der Schichten. Als
untere Grenze des Muschelkalks, der zweiten Hauptabteilung der T.,
empfiehlt es sich, einen gegen die Farben des Röts scharf
abstechenden, gelblich- oder bräunlich gefärbten Dolomit
(Wellendolomit) zu nehmen, welcher zusammen mit dem gewöhnlich
sehr mächtigen Wellenkalk dann die unterste Abteilung des
ebenfalls dreigliederigen Muschelkalks bilden würde. Letzterer
ist ein sehr dünnschieferiger Kalk, mit eigentümlichen
Fältelungen und gebogenen Wülsten (sogen.
Schlangenwülsten) versehen, beide wohl
Eintrocknungserscheinungen. Hier und da ist dem eintönigen
Schichtenaufbau eine stärkere versteinerungsreichere Lage
eingeschaltet, so namentlich nach oben der Schaumkalk (Mehlbatzen),
im deutschen Norden mit größerer, in Mitteldeutschland
mit geringerer Mächtigkeit entwickelt, im Süden ganz
fehlend. In den Reichslanden und den angrenzenden
Länderstrichen ist diese ganze untere Etage des Muschelkalks
als eine Sandsteinfacies ausgebildet. Die auf den Wellenkalk
folgende Anhydritgruppe wird im allgemeinen aus Mergeln mit
Dolomiten (wegen ihrer zelligen Struktur Zellendolomite genannt),
auch Hornsteinen, reich an kleinen Versteinerungen, gebildet, wozu,
namentlich in Südwestdeutschland, Gips, Anhydrit und Steinsalz
kommen, und ist vom Hauptmuschelkalk (Friedrichshaller Kalk)
überlagert. Dieser stellt einen Wechsel von Kalksteinen und
thonigen Zwischenmitteln dar, in bald dünnen, bald
mächtigern Schichten. Die Führung von Versteinerungen ist
gewöhnlich auf einzelne Lagen beschränkt, die aber
bisweilen überreich an Exemplaren einer Spezies sind, so
namentlich mehrere Bänke mit den Stielgliedern von Encrinus
liliiformis (Encrinus-, Kriniten- oder Trochitenkalk, s.
nebenstehende Abbildung), andre voll von einer kleinen kugeligen
Varietät (cycloides) der auf Tafel I abgebildeten Terebratula
Vulgaris. In obern Schichten des Hauptmuschelkalks treten als Reste
namentlich zwei Ceratiten (Ceratites nodosus und semipartitus) als
charakteristische Versteinerungen (Ceratitenkalke) auf. Den
Schluß bildet in Süddeutschland ein oft dolomitischer
Kalk, nach einem Leitfossil (Trigonodus Sandbergeri),
Trigonoduskalk oder -Dolomit genannt. Einige Geologen rechnen
dagegen dem Muschelkalk noch die untere Hälfte des Keupers,
die Lettenkohlenformation (grauer Keuper, Kohlenkeuper), zu, ein
Schichtenprofil von vorwiegend grauen bis schwarzen Mergeln, denen
Sandsteine (Lettenkohlensandstein) und Dolomite eingelagert sind,
letztere namentlich im obersten Teil sehr mächtig
(Grenzdolomit), während an der untern Grenze der
Lettenkohlenformation direkt auf dem Trigonodusdolomit oft ein Kalk
lagert, in welchem die Schalen eines kleinen Krebses häufig
sind (Bairdia pirus, daher Bairdienkalk). Fast allgemein wird im
Gegensatz zu dieser Zuziehung der Lettenkohlenformation (welche
ihren Namen nach einer an Pflanzenfragmenten reichen, als
Feuerungsmaterial aber unbrauchbaren lettigen Kohle trägt) dem
Keuper zugezählt, mitunter wohl auch als selbständiges
Glied dem Keuper, Muschelkalk und Buntsandstein
gegenübergestellt, wobei dann freilich der Name "T."
hinfällig werden würde. Den echten (obern, bunten) Keuper
eröffnen Gipse, mitunter (Lothringen) Steinsalz führend,
in lokal sehr verschiedener Mächtigkeit Anhydrit- oder
Gipsmergeln eingelagert, welche außerdem von einzelnen
Steinmergelschichten mit Einschlüssen von metallischen
Substanzen (Bleiglanz, Kupfererze) durchzogen werden.
Größere Sandsteinetagen unterbrechen die bunten Mergel
und zwar, von unten nach oben aufgezählt, der Schilfsandstein
(nach den schilfartigen Resten von Equiseten so genannt), der
Semionotussandstein (mit den Resten eines Fisches, Semionotus
Bergeri) und der Stubensandstein (der Name stammt von der
gelegentlichen Verwendung zu Sand zerfallener Partien). Zwischen
und über diesen Sandsteinetagen sind bunte Mergel entwickelt,
zu oberst meist Konkretionen und zahlreiche Knochensetzen
führend (Knollenmergel). Was darüber liegt, in
Deutschland teils pflanzenführende Thone, teils Sandsteine mit
einer fast nur aus Knochenfragmenten und Zähnen bestehenden
Lage (Knochenbett, Bonebed), wird wegen der großen
Mächtigkeit
829
Triasformation (Verbreitung, organische Reste).
gleichaltriger Schichten in den Alpen (s. unten) am besten als
selbständige Zwischenbildung zwischen Keuper und Lias
(rätische Formation) betrachtet, ist aber auch bald zum
Keuper, bald zum Lias (Infralias) gestellt worden.
Die eben geschilderte Gliederung der T. bezieht sich im
wesentlichen auf die Entwickelung in Deutschland, wo die T.
über große Strecken hinweg in Schlesien, in Nordwest-
und Südwestdeutschland und in den Reichslanden eine bedeutende
Verbreitung als Oberflächenbildung besitzt und namentlich an
der Zusammensetzung einiger Mittelgebirge (Rhön, Spessart,
Steigerwald, Odenwald, Schwarzwald, Vogesen) einen hervorragenden
Anteil nimmt. Da die nähere Kenntnis der T. speziell von
Deutschland ausging, so war man unwillkürlich versucht, gerade
in dieser Gliederung eine Art Normalprofil zu erblicken. Aber schon
der Versuch einer Parallelisierung mit dem der englischen, noch
mehr mit der amerikanischen T. stößt dadurch auf
Schwierigkeiten, daß in beiden Ländern der New red
Sandstone ein Äquivalent für Buntsandstein und Keuper
darstellt, ohne daß sich als trennendes Signal zwischen
beiden Gliedern der Muschelkalk nachweisen ließe. So bleibt
es bei der großen Ähnlichkeit der obersten Schichten des
Röt und der untersten des bunten Keupers unentschieden,
welchem der beiden Glieder die englischen Steinsalzlager
zuzuzählen sind, während sich für die rätische
Formation in England vollkommen sichere Parallelen an der Hand
übereinstimmender Petrefakten nachweisen lassen. Nach neuern
Forschungen scheint es übrigens auch sicher, daß der
Sandstein von Elgin, aus dem die Tafel zur devonischen Formation
die Reste des Telerpeton abbildet, nicht, wie schon in dem Artikel
"Devonische Formation" als zweifelhaft bezeichnet wurde, zum Old
red Sandstone, sondern zum New red Sandstone und speziell zum
Keuper gehört. Auf ganz besondere Schwierigkeiten
stößt die Parallelisierung mit der alpinen Facies der
T., wobei aber betont werden muß, daß nicht diese,
sondern die deutsche sich als die rein lokal entwickelte und wenig
verbreitete darstellt, indem die Untersuchungen der T. schon in den
übrigen europäischen, besonders aber in den übrigen
Kontinenten die größte Übereinstimmung mit der
alpinen Facies ergeben haben, so für die Apenninen und
Karpathen in Europa, den Himalaja und den Salt Range in
Südasien, auf Neuseeland, in Japan, in Sibirien, in
Südamerika und dem westlichen Nordamerika. Soweit einzelne
beiden, der deutschen und der alpinen, Facies gemeinschaftliche
Versteinerungen einen Schluß erlauben, sind die meist rot
gefärbten Sandsteinschiefer der Werfener Schichten mit
Posidonomya Clarai (s. Tafel I) und die Guttensteiner Kalke als
Äquivalente des Buntsandsteins, der Virgloriakalk
(Recoarokalk, reich an Brachiopoden, und Reiflinger Kalk oder
Cephalopodenkalk mit Ammoniten, namentlich aus der Abteilung der
Globosen), einschließlich des lokal entwickelten
Mendoladolomits, als solche des Muschelkalks aufzufassen. Ihnen
sind als obere Trias, neuerdings in zwei (norische u. karnische)
Stufen eingeteilt, aufgelagert: die Wengener Schiefer mit Halobia
(Daonella) Lommeli. die Cassianer Schichten mit einer überaus
reichen Fauna, der Lunzer Sandstein, der Schlerndolomit, der
Esinokalk, der Wettersteinkalk, die unter dem Namen der
Hallstädter bekannten Marmorarten von Berchtesgaden, Hallein
etc., die Raibler Schichten und die Carditaschichten mit Cardita
crenata (s. Tafel I), wobei eine Mehrzahl der genannten Glieder nur
lokal entwickelte Facies darstellen. Der rätischen Formation
(rätischen Stufe) entsprechen der in den Alpen in Form
zerklüfteter Bergmassen weitverbreitete Hauptdolomit, der
Dachsteinkalk mit seinen berüchtigten Karrenfeldern (s. d.),
die sogen. Dachsteinbivalve, Megalodon triqueter. führend, und
die Kössener Schichten mit zahlreichen Versteinerungen,
darunter die auch im deutschen Röt verbreitete Avicula
contorta.
Von organischen Resten fehlen solche pflanzlicher Natur der
alpinen Facies der T. sowie dem deutschen Muschelkalk fast
gänzlich: was gelegentlich als große Seltenheit in
letzterm vorkommt, trägt den Charakter zufällig
eingeschlämmten Materials. An Einzelindividuen einer
beschränkten Anzahl von Pflanzenarten reich sind bestimmte
Horizonte des obern Buntsandsteins und die Sandsteine des Keupers
(Lettenkohlen-, Schilf- und Stubensandstein). Die Tafel (Seite II)
bildet von Kryptogamen eine Mehrzahl Farnkräuter ab, ferner
riesige Schachtelhalme und Kalamiten (letztere häufig,
vielleicht immer Steinkerne von Equiseten), das seiner
systematischen Stellung nach noch strittige Aethophyllum (nach
einigen Paläontologen zu den Typhaceen gehörig, nach
andern den Equisetaceen verwandt) aus dem Buntsandstein, von
Cykadeen einige Pterophyllum-Arten und von Koniferen Voltzia. Ganz
besonders häufig sind im Stubensandstein verkieselte
Koniferen-(Araukarien-) Stämme, deren mikroskopische Struktur
mitunter vorzüglich erhalten ist. Tierreste sind in der
deutschen T. nur im Muschelkalk zahlreicher vorhanden, im
Buntsandstein und Keuper auf einige Horizonte beschränkt,
während der alpine Keuper (s. oben) einige an Versteinerungen
sehr reiche Schichten enthält. Als Beispiele bringt die Tafel
(I) zunächst von Krinoiden Krone und Stielglieder von Encrinus
liliiformis zur Darstellung, aus welchen (vgl. die Abbildung im
Text) bestimmte Lagen des deutschen Muschelkalks fast
ausschließlich zusammengesetzt sind. Von den abgebildeten
Mollusken gehören der Brachiopode Terebratula vulgaris, die
beiden Muscheln Avicula (Gervillia) socialis und Lima striata sowie
der Cephalopode Ceratites nodosus ebenfalls dem Muschelkalk an. Die
Muscheln Posidonomya Clarai und Cardita crenata wurden schon als
Leitfossilien bestimmter Etagen der alpinen T. erwähnt. Von
Wirbeltieren sind Fische und Saurier im Muschelkalk und Keuper
nicht selten, meist in Form von Knochenfragmenten und Zähnen,
gelegentlich aber auch, wie namentlich im süddeutschen
Stubensandstein, von wohlerhaltenen Schädeln und ganzen
Skeletten. Dieser Etage entstammt Mastodonsaurus Jaegeri, von
welchem die Tafel I Schädel und Zähne, letztere auch im
mikroskopischen Bild mit den eigentümlich gekröseartigen
Windungen der Zahnsubstanz (welche den Namen der Labyrinthodonten
für die Abteilung veranlaßt hat) darstellt. Ebenfalls
der Stubensandstein hat die besonders im Stuttgarter Museum in
unübertroffener Schönheit vertretenen Belodonten
geliefert sowie die im gleichen Museum befindliche berühmte
Gruppe von 24 etwa halbmetergroßen Individuen von Aetosaurus
ferratus. Der auf der Tafel dargestellte Placodus mit seinen
großen Mahlzähnen auf Gaumen und Oberkiefer, jetzt
allgemein zu den Sauriern gerechnet, entstammt dem Muschelkalk.
Endlich seien noch die eigentümlichen Fußspuren
erwähnt: aus dem deutschen Buntsandstein Chirotherium und aus
dem amerikanischen New Red die dreizehigen Spuren von Brontozoum,
jetzt einem auf Vogelbeinen wandernden Saurier zugeschrieben,
früher für Vogelspuren (Ornitichnites) ge-
830
Tribadie - Tribunen.
halten. In der rätischen Formation sowohl Deutschlands als
Englands haben sich die ältesten Säugetierreste
vorgefunden: Zähne und Kiefer von Microlestes, wahrscheinlich
einem Beuteltier.
Vulkanisches Material gleichzeitigen Datums der Entstehung
läßt sich im Gebiet der deutschen T. nicht nachweisen,
wohl aber sind jüngere Eruptivgesteine, namentlich Basalte, in
Berührung mit triadischen Schichten gekommen und haben an
vielen Orten, besonders in benachbartem Buntsandstein,
Kontaktwirkungen (Frittung, Bleichung und säulenförmige
Absonderung) hervorgerufen. In den Alpen sind granitische und
syenitische Gesteine, Porphyre und Melaphyre, in Nordamerika
Diorite und Melaphyre triadischen Alters bekannt.
An technisch wichtigen Substanzen sind Buntsandstein, die
mächtigern Lagen des Muschelkalks, die Sandsteine des
deutschen Keupers, die Marmorarten der Alpen als architektonisch
verwendbar zu verzeichnen. Bestimmte Lagen des Muschelkalks dienen
zur Bereitung von Luftmörtel und hydraulischem Zement.
Steinsalzlager kommen im Röt (Braunschweig, Salzgitter etc.),
in der Anhydritgruppe des Muschelkalks (Südwestdeutschland)
und den Gipsmergeln des Keupers (Vic und Dieuze in Lothringen) vor;
auch das alpine Salz (Ischl, Hallein, Berchtesgaden etc.)
dürfte dem untersten Keuper zuzuzählen sein, wonach die
Notiz in "Übersicht der geologischen Formationen" (Bd. 7) zu
berichtigen sein würde. Von bauwürdigen Kohlenlagern
enthält die deutsche T. nichts; die sogen. Lettenkohle kann
nur, wenn sie viel Eisenkies oder Strahlkies enthält, auf
Vitriol und Alaun verarbeitet werden. Dagegen wird auf Schonen der
rätischen Formation angehörige Kohle gewonnen, und ein
Teil der bedeutenden Kohlenschätze Chinas soll triadischen
Alters sein. In Bezug auf Erzführung sind die Knottenerze von
Kommern in der Eifel zu erwähnen, Buntsandsteine mit
Körnern von Bleiglanz, ferner ebenfalls im Buntsandstein an
vielen Orten Gänge von Schwerspat, Eisen- und Kupfererzen. Dem
Muschelkalk sind in Oberschlesien und Baden Zink-, Bleiglanz- und
Eisenerzlager eingeschaltet, und der Erzbau von Raibl ist an die
gleichnamigen Schichten geknüpft. Die Gipse der verschiedenen
Etagen werden namentlich zu landwirtschaftlichen Zwecken abgebaut,
und das kaolinige Bindemittel der weißen Buntsandsteine ist
ein wertvolles Rohmaterial für die Porzellanfabrikation. Als
Bodenbildner verhalten sich die Schichten natürlich sehr
verschieden: die Keupermergel, die an thonigen Zwischenmitteln
reichern Muschelkalketagen und der Röt liefern gute
Böden, an welche in Franken und Schwaben der Weinbau
geknüpft ist, schlechte dagegen der Wellenkalk und der
Hauptbuntsandstein, letzterer der vorzüglichste Waldboden,
wenn die Wälder nicht, wie in der Nähe des Weinbaues,
durch Streuentnahme geschädigt werden.
[Litteratur.] Vgl. Alberti, Monographie des bunten Sandsteins,
Muschelkalks u. Keupers (Stuttg. 1834); Derselbe, Überblick
über die Trias (das. 1864); Eck, Über die Formationen des
bunten Sandsteins und Muschelkalks in Oberschlesien (Berl. 1865);
Giebel, Die Versteinerungen des Muschelkalks von Lieskau bei Halle
(das. 1856); Bornemann, Über organische Reste der
Lettenkohlengruppe Thüringens (das. 1856); Gümbel, Die
geognostischen Verhältnisse des fränkischen Triasgebiets
("Bavaria", Bd. 4, Münch. 1865); Schenk, Fossile Flora der
Grenzschichten des Keupers und des Lias Frankens (Wiesb. 1867);
Emmrich, Übersicht der geognostischen Verhältnisse um
Meiningen (Meining. 1868-74); Frantzen, Übersicht der
geologischen Verhältnisse bei Meiningen (das. 1882); Nies,
Beiträge zur Kenntnis des Keupers im Steigerwald (Würzb.
1868); Derselbe, Die angebliche Anhydritgruppe im Kohlenkeuper
Lothringens (das. 1873); Schalch, Beiträge zur Kenntnis der
Trias am südöstlichen Schwarzwald (Schaffh. 1873);
Benecke, Über die Trias in Elsaß-Lothringen und
Luxemburg (Straßb. 1877); Thürach, Der fränkische
Keuper (Münch. 1889). An Werken über die
Verhältnisse der alpinen T. seien außer den betreffenden
Kapiteln in Hauers "Geologie" (2. Aufl., Wien 1878) angeführt:
Emmrich, Geologische Geschichte der Alpen (Jena 1874); Benecke,
Trias und Jura in den Südalpen (Münch. 1866); v.
Mojsisovics, Gliederung der obern Triasbildungen der östlichen
Alpen (Wien 1869), und eine Reihe meist im "Jahrbuch der Wiener
geologischen Reichsanstalt" erschienener Arbeiten desselben
Verfassers; Lepsius, Das westliche Südtirol (Berl. 1878).
Tribadie (griech.), s. Lesbische Liebe.
Triberg (Tryberg), Bezirksamtsstadt und Luftkurort im
bad. Kreis Villingen, im Schwarzwald und an der Linie
Offenburg-Singen der Badischen Staatsbahn, 686 m ü. M., hat
eine kath. Kirche, eine Gewerbehalle mit permanenter Ausstellung
von Schwarzwald-Industrieerzeugnissen, elektrische Beleuchtung,
eine Gewerbe- und eine Schreinerschule, ein Amtsgericht, eine
Bezirksforstei, eine Nervenheilanstalt, bedeutende
Uhrenfabrikation, Metall- und Holzwarenfabriken, Strohflechterei,
Sägemühlen und (1885) 2461 meist kath. Einwohner. Dabei
der herrliche Fallbach, von der Gutach (s. d.) gebildet.
Tribometer (griech.), s. Reibung.
Tribon (griech.), kurzer Umhang der Männer und
Epheben in den dorischen Staaten Altgriechenlands, Tracht der
Philosophen, besonders der Cyniker.
Tribonianus, berühmter röm. Rechtsgelehrter,
geboren zu Side in Paphlagonien, war erst Sachwalter, wurde unter
dem Kaiser Justinian Quaestor sacri palatii, Magister officiorum,
Praefectus praetorio und Konsul. In Gemeinschaft mit den
ausgezeichneten Rechtsgelehrten jener Zeit besorgte er 530-34 die
Justinianische Kodifikation des römischen Rechts (s. Corpus
juris). Er starb 545.
Tribrachys (griech.), dreisilbiger, aus drei Kürzen
bestehender Versfuß (^[...]), welcher in metrischen Systemen
nur als Auflösung des Jambus oder Trochäus vorkommt.
Tribsees, Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Stralsund, Kreis Grimmen, an der Trebel, hat eine schöne
gotische evang. Kirche aus dem 15. Jahrh. mit kunstvollem Altar,
ein neues gotisches Rathaus, eine Präparandenanstalt und
(1885) 2950 Einw.
Tribulieren (lat.), plagen, quälen.
Tribunal (lat.), bei den Römern der erhöhte
Ort, wo der Magistrat, namentlich der Prätor, auf der Sella
curulis sitzend, sein Amt verwaltete; jetzt s. v. w. Gerichtshof,
besonders ein höherer, wie das ostpreußische T. in
Königsberg (bis 1879), das Obertribunal zu Berlin.
Tribüne (franz.), Rednerbühne, namentlich
für parlamentarische Redner; auch die für die
Zuhörer bestimmte Galerie in Parlamentslokalen;
Schaugerüst; in den altchristlichen Basiliken s. v. w. Apsis
(s. Basilika, S. 425).
Tribunen (Tribuni) wurden im alten Rom ursprünglich
die Vorsteher der Stammtribus (s. Tribus) genannt; dann wurde das
Wort auch überhaupt als Bezeichnung der Vorsteher von
Abteilungen grö-
831
Tribur - Trichiasis.
ßerer Gemeinschaften gebraucht. So hießen die
Anführer von Abteilungen der Reiterei unter den Königen
Tribuni celerum, so ferner die Anführer der Legionen Tribuni
militum oder Tribuni militares. Dieser letztern gab es in jeder
Legion sechs, die den Oberbefehl wechselnd zwei Monate führten
und außerdem die Aushebung, die Führung der Listen und
andre ähnliche Geschäfte zu besorgen hatten. Dieselben
wurden anfangs von den Konsuln ernannt; 362 v. Chr. wurde aber die
Wahl von 6, 311 die von 16 der 24 für die
regelmäßig zur Aushebung gelangenden 4 Legionen
erforderlichen Militärtribunen und endlich 207 die Wahl von
sämtlichen 24 dem Volk eingeräumt, während, wenn
außerordentlicherweise eine größere Zahl von
Legionen ausgehoben wurde, die Ernennung der übrigen T. den
Konsuln verblieb. Ferner gab es Tribuni aerarii, welche für
bestimmte Abteilungen des Volkes den Tribut einzuziehen und an die
Soldaten den Sold zu zahlen hatten. Eine besondere Art von T. waren
die Kriegstribunen mit konsularischer Gewalt (tribuni militum
consulari potestate), welche nach einem 445 gegebenen Gesetz bis
366 öfters statt der Konsuln ernannt wurden, um auch den
Plebejern, welche für dieses Amt wählbar waren, den
Zugang zu der höchsten obrigkeitlichen Gewalt zu
eröffnen. Die geschichtlich wichtigsten aber waren die
Volkstribunen (tribuni plebis), welche 493 eingesetzt wurden, um
den Plebejern gegen den Mißbrauch der Amtsgewalt von seiten
der damals ausschließlich patrizischen Konsuln Schutz zu
gewähren, zu welchem Zweck sie unter besondern religiösen
Feierlichkeiten für unverletzlich (sacrosancti) erklärt
wurden. Anfangs beschränkte sich ihre Wirksamkeit auf die
Einsprache (intercessio) zu gunsten einzelner von Maßregeln
der Magistrate bedrohter Plebejer, die ihnen übrigens auch nur
in der Stadt und innerhalb einer römischen Meile im Umkreis
derselben zustand. Sie dehnten dieselbe indessen, auf ihre
Unverletzlichkeit gestützt, immer weiter aus. Sie richteten
ihre hindernde Einsprache gegen Amtshandlungen jeder Art, sie luden
selbst Patrizier vor das Gericht der Tributkomitien, sie wohnten
den Sitzungen des Senats bei und hinderten Beschlüsse
desselben durch ihr Verbot (veto), und als die Tributkomitien 449
das Recht erlangt hatten, das ganze Volk bindende Beschlüsse
zu fassen, benutzten sie dieselben, um in ihnen Gesetze im
Interesse der Plebejer zu beantragen und durchzusetzen, wogegen den
Patriziern nur das einzige Mittel zu Gebote stand, die Einsprache
eines Tribuns gegen seine Kollegen zu gewinnen, da durch eine
solche das Vorgehen der übrigen verhindert werden konnte.
Später, als nach den Punischen Kriegen der Gegensatz zwischen
Patriziern und Plebejern im wesentlichen aufgehoben war,
änderte sich die Wirksamkeit der T. insofern, als sie nicht
mehr das Interesse der Plebejer gegen die Patrizier, sondern das
des niedern Volkes gegen die Nobilität zu vertreten hatten,
obwohl es mit dem fortschreitenden Verfall der Republik immer mehr
dahin kam, daß das Tribunat nur zu persönlichen
ehrgeizigen Zwecken gesucht und benutzt wurde. Indessen blieb es
auch später noch Regel, daß dasselbe, wie von Anfang an,
nur von Plebejern bekleidet werden durfte. Die Zahl der T. war bei
ihrer Einsetzung fünf oder nach einer andern Angabe zwei,
wurde aber 457 auf zehn erhöht. Unter Sullas Diktatur (82-79)
wurde das Tribunat auf seine anfängliche geringe Wirksamkeit
eingeschränkt, durch Pompejus aber in seinem ersten Konsulat
70 wieder in alle seine Rechte eingesetzt. Unter den Kaisern wurde
den T. ihre Bedeutung entzogen, indem jenen die tribunizische
Gewalt verliehen wurde; sie wurden aber beibehalten, bis endlich
Konstantin d. Gr. ihre Abschaffung verfügte. Im Mittelalter
wurde noch einmal ein kurzer Versuch gemacht, das Tribunat
wiederherzuhellen, indem vom römischen Volk 1347 die Republik
erklärt und Cola di Rienzi zum Tribun erhoben wurde. - Das in
Frankreich nach dem Staatsstreich vom 18. Brumaire durch die
Verfassung von 1799 eingeführte, von Sieyès ersonnene
Tribunat bestand aus 100 Mitgliedern und übte mit dem
Gesetzgebenden Körper die gesetzgebende Gewalt, indem es die
Gesetzentwürfe der Regierung beraten, der letztere aber
dieselben ohne Diskussion verwerfen oder annehmen sollte. Durch
Senatuskonsult vom 18. Mai 1804 ward es umgestaltet, indem der
größere Teil seiner Mitglieder dem Gesetzgebenden
Körper einverleibt ward, die Generalversammlungen
aufhörten und nur drei Tribunatsektionen für das Innere,
die Gesetzgebung und die Finanzen übrigblieben. Auch diese
Schattengewalt ward endlich durch Senatuskonsult vom 19. Aug. 1807
beseitigt, indem an die Stelle der Tribunatsektionen drei
Kommissionen des Gesetzgebenden Körpers traten.
Tribur, Flecken, s. Trebur.
Tribus (lat.), 1) Name der drei Stämme des
ursprünglichen (patrizischen) röm. Volkes, der Ramnes,
Tities und Luceres, von denen der erste aus dem Volk des Romulus,
der zweite aus den mit diesem unter Titus Tatius vereinigten
Sabinern und der dritte, wie gewöhnlich angenommen wird, aus
Etruskern bestand. Sie hatten eine jede ihren Vorsteher, Tribunus
genannt, und zerfielen in je zehn Kurien, von denen wiederum eine
jede ihren besondern Vorsteher (curio) hatte. Jede dieser
Abteilungen hatte ihre eignen Opfer und sonstigen heiligen
Gebräuche, deren Verwaltung den Tribunen und Kurionen oblag.
Von diesen T. völlig verschieden sind
2) die örtlichen T. oder Bezirke, welche der
Überlieferung nach von Servius Tullius eingerichtet wurden und
das ganze Volk, Patrizier und Plebejer, umfaßten. Es sollen
ihrer anfänglich 30 gewesen sein, durch Gebietsverlust in dem
Krieg mit Porsena soll diese Zahl auf 20 herabgemindert worden
sein; dann aber wurden mit der Erweiterung des Gebiets immer neue
T. gebildet, bis 241 n. Chr. die Zahl 35 erreicht wurde, bei
welcher man stehen blieb; vier derselben hießen
städtische (t. urbanae), weil sie aus vier städtischen
Bezirken gebildet waren; die übrigen gehörten der
Landschaft an und hießen daher ländliche (t. rusticae).
Auf der Grundlage dieser T. entstand eine besondere Art von
Komitien (s. d.), die Comitia tributa, in denen innerhalb der T.
nach der Kopfzahl gestimmt wurde, und die daher einen
demokratischen Charakter hatten.
Tribut (lat.), ursprünglich die Steuer im alten Rom,
welche die Bürger von ihrem Vermögen an den Staat zu
zahlen hatten, dann die von den Provinzen erhobene Kopfsteuer
(tributum capitis). Jetzt versteht man darunter Abgaben, welche
bezwungene Völker an den Sieger zahlen müssen; auch wird
im figürlichen Sinn die Gewährung der schuldigen
Hochachtung oder Verehrung so genannt.
Tributär (franz.), tributpflichtig.
Tricarico, Stadt in der ital. Provinz Potenza, Kreis
Matera, Bischofsitz, mit alten Mauern und Türmen, Kathedrale,
Seminar, Seidenzucht, Wein-, Tabaks- und Safranbau und (1881) 7482
Einw.
Trichechus, Walroß.
Trichiasis und Distichiasis (griech.), verschiedene Grade
von Einwärtskehrung der Augenwimpern bei normaler Stellung der
Lidfläche. Die Wimpern selbst
832
Trichine.
sind entweder normal oder verkümmert und verbogen. Die
Ursache dieses lästigen und für das Auge
gefährlichen Leidens sind langwierige Entzündungen des
Augenlidrandes. Die nach einwärts sich krümmenden
Härchen reizen die Oberfläche des Auges, veranlassen
dadurch ein höchst quälendes Gefühlvon Kratzen,
Stechen, Reiben im Auge, ferner Lichtscheu und weiterhin mehr oder
weniger intensive Entzündungen der Bindehaut und Hornhaut. In
den mildern Graden genügt zur Beseitigung des Leidens das
periodische Ausziehen der falsch stehenden Wimpern vermittelst
einer feinen Pinzette, in hartnäckigern Fällen muß
auf plastisch operativem Wege geholfen werden.
Trichine (Trichina spiralis Ow., s. Tafel "Würmer"),
Gattung der Trichotracheliden, einer Familie der Nematoden oder
Fadenwürmer, schmarotzt im Körper des Menschen und
einzelner Säugetiere. Ihr Vorkommen in den Muskeln
höherer Tiere ist schon lange bekannt, nicht aber ihre
Herkunft und Gefährlichkeit. Beschrieben, aber nicht richtig
gedeutet wurden die verkalkten Trichinenkapseln im Menschen zuerst
1831 von Hilton. Den in der Kapsel enthaltenen Wurm entdeckte 1835
Paget; Owen beschrieb ihn genau und gab ihm den Namen Trichina
spiralis. Weiterhin fanden Gurlt und Leidy auch bei der Katze und
dem Schwein eingekapselte Trichinen; aber erst Zenker in Dresden
machte 1860 die epochemachende Beobachtung, daß eine
angeblich am Typhus gestorbene Person an der Trichinenkrankheit (s.
d.) zu Grunde gegangen war. Die Sektion der Leiche ergab eine
förmliche Überschwemmung der Muskeln mit Trichinen, auch
im Darm wurden reife Trichinen gefunden. Die Nachforschung zeigte
ferner, daß die Erkrankung von dem Genuß von Schinken,
Blut- und Cervelatwurst eines geschlachteten Schweins
herrühren mußte; denn diese Teile enthielten ebenfalls
Trichinen, und auch andre Personen, welche davon gegessen hatten,
waren zu gleicher Zeit alle mehr oder weniger schwer erkrankt.
Fütterungsversuche mit trichinösem Fleisch, welche von
Zenker selbst sowie von Virchow und Leuckart aus Anlaß dieses
Falles bei Tieren angestellt wurden, führten zu dem Resultat,
daß die im Fleisch eingekapselten Trichinen im Magen und Darm
des damit gefütterten Tiers durch die Verdauung aus ihrer
Kapsel befreit werden und sich daselbst schnell, ohne weitere
Umwandlung, zu erwachsenen, geschlechtsreifen Tieren ausbilden,
deren lebendig geborne Junge alsbald den Darm des Tiers
durchbohren, in das Fleisch desselben einwandern und, wenn das
betreffende Tier nicht daran stirbt, hier eingekapselt werden. Wird
solches Fleisch vom Menschen oder gewissen Säugetieren
verzehrt, so geht der Entwickelungsgang abermals vor sich. Man
unterscheidet hiernach Muskeltrichinen und Darmtrichinen (s. Tafel
"Würmer"). Erstere stellen den unentwickelten Zustand dar,
werden 0,7-1,0 mm lang, zeigen deutlich den Verdauungskanal und den
nicht völlig ausgebildeten Geschlechtsapparat. Die
Darmtrichine, das erwachsene, geschlechtsreife Tier, ist ein
feiner, fadenförmiger, runder Wurm mit leicht geringelter
chitinöser Körperhülle; das zugespitzte,
dünnere Ende ist der Kopf, das dickere, kurz abgerundete der
Hinterleib. An ersterm beginnt der Verdauungskanal mit der
Mundöffnung, von der im Innern die feine, in ihrer ganzen
Länge von einem eigentümlichen Zellkörper
umfaßte Speiseröhre ausgeht. An diese schließt
sich der flaschenförmig erweiterte und an seinem Ansang mit
zwei kleinen, birnförmigen, blindsackartigen Anhängen
versehene Magen und weiter der wieder engere und im hintern Teil
meist dunkler erscheinende Darm an. Bei dem bis 1,5 mm langen
Männchen besitzt das Schwanzende zwei lappenartige
Fortsätze, und die Geschlechtsöffnung ist mit dem Ende
des Darms zu einer vorstülpbaren Kloake verbunden. Die
Länge der Weibchen beträgt 3-4 mm. An innern
Geschlechtsorganen besitzen dieselben einen einfachen Eierstock,
einen Uterus und eine Scheide. Die äußere
Geschlechtsöffnung befindet sich weit nach vorn, etwa an der
Grenze des ersten und zweiten Viertels der ganzen
Körperlänge. Die Eier sind rundlich, zartwandig und
besitzen eine wasserhelle Dotterschicht. Im Uterus entwickeln sich
in ihnen die jungen Trichinen und werden etwa am siebenten Tag nach
der Ankunft des trichinösen Fleisches im Magen lebendig
geboren. Eine erwachsene Trichinenmutter hat etwa 100 lebendige
Junge in ihrem Leib, hinter diesen erzeugt sie aber immer neue Eier
und Junge. Sie liegt 5-8 Wochen, bis zu ihrem Tod, im Darm vor
Anker und liefert immer neue Brut, so daß man auf eine Mutter
mindestens 500-1000 Junge rechnen kann. Die Jungen wandern sofort
durch die Darmwand, Bauchwand und das lockere Bindegewebe,
vielleicht auch durch Vermittelung des Blutstroms in die
Körpermuskeln ein. Hier dringen sie in die Primitivfasern,
zerstören den Inhalt derselben, buchten an ihrer Lagerstelle,
indem sie sich spiralig zusammenrollen, die Hülle der
Muskelfaser aus und reizen dieselbe, so daß sie sich
verdickt, zum Teil zerstört wird und eine helle,
zitronenförmige Kapsel um das Tierchen herum bildet. Zuweilen
sind übrigens 2-4 Trichinen in Einer Kapsel vereinigt.
Darüber vergehen 2-4 Wochen, aber schon mit 14 Tagen hat die
Muskeltrichine ihre volle Größe als solche erreicht. Die
Kapsel wird mit der Zeit immer dicker und durch Ablagerung von
Kalksalzen undurchsichtig, so daß sie mit bloßem Auge
als weißes Pünktchen erkannt werden kann. In dieser
Kalkschale lebt die T. in einer Art Scheintod; sie stirbt aber
nicht ab, sondern noch nach Jahrzehnten zeigt sie sich, wenn die
Kalkkapsel durch Säure gelöst wird, bewegungsfähig
oder wird, wenn sie mit dem Fleisch in den Magen eines Tiers kommt
und dort durch den sauren Magensaft frei wird, geschlechtsreif.
Abgesehen vom Menschen und Schwein, hat man die Trichinen bis jetzt
bei Ratten, Mäusen, Katzen, Füchsen, beim Iltis, Marder,
Hamster, Dachs, Igel und Waschbären gefunden. Es gelingt
indessen auch sicher, sie dem Kaninchen und Meerschweinchen,
unsicher, sie dem Schaf und Kalb anzufuttern. Von Haus aus leben
sie übrigens wahrscheinlich in den Ratten und werden, da diese
sich gegenseitig auffressen, vor dem Aussterben geschützt;
zugleich gelangen sie bei Gelegenheit in das Schwein und so auch in
den Menschen. Bei letzterm sind sie in allen Erdteilen gefunden
worden, in Europa am häufigsten in Deutschland, Schottland,
England, Dänemark und Schweden. In Deutschland finden sie sich
bei 2-3 Proz. aller menschlichen Leichen. Seit dem erwähnten
Zenkerschen Fall ist eine große Reihe epidemischer
Trichinenerkrankungen der Menschen festgestellt worden.
Erwähnenswert ist besonders die große Epidemie in
Hedersleben bei Quedlinburg 1865, wo in einem Dorfe von 2000 Einw.
337 erkrankten und 101 starben. Aktenmäßige Thatsachen
und Beobachtungen von dick verkapselten Trichinen in den 60er
Jahren und früher weisen darauf hin, daß die Krankheit
auch schon früher existierte. Man hat sie nur einem
vermeintlichen Wurstgift oder Schinkengift zugeschrieben, und die
Häufigkeit der Erkrankungen in der Neuzeit erklärt sich
zur Genüge aus der jetzigen Schnellräucherung u. aus der
Neigung, das Fleisch roh oder oberflächlich
833
Trichinenkrankheit - Trichinenversicherung.
gebraten, saftig und blutigrot zu genießen. Vgl. Leuckart,
Untersuchungen über Trichina spiralis (2. Aufl., Leipz. 1866);
Pagenstecher, Die Trichinen (das. 1865); Gerlach, Die Trichinen
(Hannov. 1866); Virchow, Lehre von den Trichinen (3. Aufl., Berl.
1866); Claus, Über die T. (Wien 1877).
Trichinenkrankheit (Trichinose) tritt in der Zeit vom
1.-30. Tag ein. Die ersten Symptome hängen ab von der
Gegenwart und Fortentwickelung der Trichinen im Magen und Darm, die
zweite Gruppe von dem Eindringen unzähliger Embryos in die
Muskeln, die letzte von der Beendigung der Wanderung und der
allmählichen Beruhigung der Muskelreizung während der
beginnenden Einkapselung der Trichinen. Abgesehen von dem
anfänglich schleichenden Verlauf oder den zuweilen
beobachteten stürmischen choleraähnlichen
Magendarmerscheinungen, klagen die Patienten in der Regel einige
Stunden oder Tage nach dem Genuß trichinösen Fleisches
über heftiges Magendrücken, über Aufstoßen und
Übelkeit, verbunden mit dem Gefühl großer
Mattigkeit und Abgeschlagenheit. Meist tritt einigemal Erbrechen
schleimiger und galliger Massen ein. Vom siebenten Tag ab, dem
Beginn der Einwanderung der Embryos in die Muskeln, stellen sich,
gleichviel ob deutliche gastrische Symptome vorangegangen waren
oder nicht, vage Schmerzen, Gefühl von Steifsein und
wassersüchtige Anschwellung des Gesichts, besonders der
Augenlider, ein. Die Bewegungen werden nun bald sehr erschwert, da
die Muskeln starr, unnachgiebig werden, beträchtlich
anschwellen, kautschukähnliche Resistenz bekommen und
äußerst schmerzhaft sind. Dabei besteht typhöses
Fieber, welches früher gewöhnlich und auch jetzt noch
zuweilen einen Unterleibstyphus vortäuscht. Der Tod kann an
Zwerchfelllähmung oder an allgemeiner Erschöpfung
eintreten, er ist von der 2.-7. Woche zu befürchten. Leichte
Trichinosefälle gelangen in einigen Tagen bis Wochen zur
Genesung; in schwereren Fällen zieht sich die Krankheit 6-7
Wochen hin, ja manchmal vergehen mehrere Monate bis zur vollen
Gesundung. Die Gefährlichkeit der Krankheit hängt ab von
der Quantität der genossenen Trichinen, in einzelnen Epidemien
stieg die Sterblichkeit bis auf 30 Proz. der Erkrankten. Wirksame
Heilmittel der Trichinose sind bis jetzt nicht gefunden; Mittel,
welche auf die auf der Wanderung befindlichen und in die Muskeln
eingedrungenen Trichinen wirken, fehlen ganz, und selbst für
frische Fälle, wo es darauf ankommt, die noch im Darm
vorhandenen Trichinen zu töten und aus dem Körper zu
schaffen, sind noch keine sichern Abführmittel entdeckt
worden. Die mit Trichinen behafteten Schweine erkranken nicht,
ebensowenig die andern für diese Würmer
empfänglichen Tiere, mit Ausnahme der Kaninchen, die auch wohl
daran sterben. Nach dem Vorhergehenden läßt sich die
Gefahr für den Menschen nur durch eine richtige Prophylaxts
abwenden. Die Schweine müssen möglichst vor der Infektion
durch Trichinen bewahrt werden. Überall, wo trichinöse
Ratten gefunden sind, hat man auch trichinöse Schweine oder
andre Fleischfresser entdeckt. Das Schwein erhält seine
Trichinen durch Verschlucken von mit dem Kot andrer Schweine
abgegangenen Darmtrichinen u. Embryos, außerdem durch das
Fressen trichinösen Fleisches anderer Schweine, wie der
Fleischabfälle vom Schweineschlachten. Gerade die
Abdeckereien, wo Abfälle von Schweinekadavern verfüttert
werden, gelten als die raffiniertesten
Trichinenschweine-Züchtungsanstalten. Ein zweites Schutzmittel
liegt in der obligatorischen mikroskopischen Untersuchung aller
frisch geschlachteten Schweine sowie der jetzt zahlreich
eingeführten amerikanischen Speckseiten. Da die Trichinen an
gewissen Körperstellen und zwar im Zwerchfell, den
Zwischenrippen-, Hals-, Kehlkopf-, Kiefer- und Augenmuskeln und
besonders an den Übergängen der Muskeln in die Sehnen
sehr reichlich sich vorfinden, so wählt man solche Stellen zur
Untersuchung. Man schneidet aus jedem dieser sechs Muskeln ein 2-3
mm langes Stückchen aus und fertigt von jedem Stückchen
etwa fünf Präparate an. Hat man bei genaueer Untersuchung
in diesen 30 Präparaten keine Trichinen gefunden, so darf man
auch die Ungefährlichkeit des Schweins annehmen. Die
Erfahrungen in Rostock, Berlin, Braunschweig etc. haben den Wert
dieser obligatorischen Trichinenschau bestätigt. In der Stadt
Braunschweig z. B. hat man in sieben Jahren unter 93,099 Schweinen
18 trichinöse entdeckt. Wer wissentlich trichinenhaltiges
Fleisch feilhält oder verkauft, verfällt nach dem
deutschen Reichsstrafgesetzbuch (§ 367) in eine Geldstrafe bis
zu 150 Mk. oder in Haftstrafe bis zu 6 Wochen, während es in
der Regel als fahrlässige Tötung oder
Körperverletzung zu bestrafen sein wird, wenn dadurch der Tod
oder die Krankheit einer Person herbeigeführt wurde. Das
letzte und sicherste Schutzmittel vor Trichinen besteht darin,
daß man Speisen aus Schweinefleisch nur gehörig
durchkocht oder durchbraten genießt. Kurze Einwirkung einer
Wärme von etwa 45° R, wie es bei dem sogen. Wellfleisch
geschieht, tötet die Trichinen nicht, ebensowenig längere
Einwirkung einer höhern Wärme von 60° R. und
darüber auf dickere Stücke, so daß diese im Innern
saftig rot bleiben. Letzternfalls werden nur die in den
Außenteilen befindlichen Trichinen getötet, während
die im Innern vorhandenen lebendig bleiben und beim Genuß
eine Infektion vermitteln. Nur längeres Kochen und Braten
nicht zu dicker Stücke bei mindestens 50-55° R. richtet
die Trichinen sicher zu Grunde. Ebenso sterben sie zweifellos nach
einer zehntägigen Einpökelung des Fleisches in nicht zu
großen Stücken ohne Hinzufügung von Wasser, 30 g
Kochsalz auf 1 kg Fleisch gerechnet, sowie nach energischer
Heißräucherung, bei der eine Temperatur von 52° R.
erreicht wird. Dagegen ist ein schwächeres Pökeln,
welches den Trichinen weniger Wasser entzieht, sowie die
Kalträucherung oder gar die Schnellräucherung, bei der
die Schinken und Würste nur mit Holzessig oder Kreosot
überstrichen werden, völlig wirkungslos. Indessen
unterstützen sich Salz, Wärme und Rauch gegenseitig in
ihrem Effekt, so daß die stärkere Wirkung des einen die
schwächere des andern ersetzen kann. Vgl. Wolff, Untersuchung
des Fleisches auf Trichinen (6. Aufl., Bresl. 1880) und die
Schriften gleichen Inhalts von Tiemann (3. Aufl., das. 1887), Johne
(3. Aufl., Berl. 1889) und Long (das. 1886).
Trichinenversicherung wird von einzelnen Personen und
Firmen, von Interessentenverbänden, von besondern
Gesellschaften (die Anhaltische Trichinenversicherungs-Anstalt in
Köthen, die Hannoversche, die Einbecker etc.) oder als
Nebengeschäft der Viehversicherungsgesellschaften betrieben
und unterscheudet sich von der Viehversicherung (s. d.) dadurch,
daß diese gegen Vermögensverluste durch den vom
Versicherten nicht gewünschten Tod seines Viehs infolge von
Seuchen und Verunglückung, jene aber gegen den aus der
unvorhergesehenen Entdeckung der Wertschmälerung
geschlachteter Tiere (Schweine) infolge der Fleischdurchsetzung mit
Trichinen drohenden Schaden schützen soll. Mit der T. pflegt
die ihr analoge Finnenversicherung verbunden zu sein.
Meyers Konv.- Lexikon, 4. Aufl., XV. Bd.
53
834
Trichinopolly - Tridentinisches Konzil.
Trichinopolly, Stadt, s. Tritschinapalli.
Trichite, mikroskopisch kleine, haarförmige,
gewöhnlich dunkel gefärbte Mineralkörper, die sich
häufig in glasiger Gesteinsmasse bei Obsidian, Bimsstein,
Perlit, Rhyolith, Porphyr, Basalt etc. vorfinden. Ihre
mineralogische Bestimmung ist wegen ihrer Kleinheit schwierig und
meist nur durch Analogie mit gleichzeitig vorkommenden
größern Mineralindividuen mit einiger Wahrscheinlichkeit
möglich.
Trichloraldehyd, s. Chloral.
Trichlormethan, s. Chloroform.
Trichoblásten (griech.), haarartig geformte
Pflanzenzellen, die sich wesentlich durch Form oder Inhalt von
ihren Nachbarzellen unterscheiden, wie die Sternhaare in den
Luftgängen von Nymphaea.
Trichocephalus, Peitschenwurm.
Trichodéctes, s. Pelzfresser.
Trichoglossus, s. Papageien, S. 667.
Trichogyne (griech., Befruchtungshaar), bei den Florideen
und Koleochäteen das haarförmig gestaltete
Empfängnisorgan, an welchem die männlichen
Befruchtungselemente haften müssen, um Befruchtung des
Karpogons zu bewirken. Bisweilen steht die T. auf einer besondern
Zellreihe, dem Trichophor. Auch kann sie auf besondern Ästen
der Pflanze, z. B. bei der Florideengattung Dudresnaya, auftreten
(s. Algen, S. 345 f.).
Trichologie (griech), Lehre vom Haar.
Trichoma (griech.), s. Weichselzopf.
Trichome (griech.), s. Haare der Pflanzen.
Trichomstachel, s. v. w. Hautstachel, s. Stachel.
Trichomykose (griech.), durch Pilze verursachtes
Haarleiden.
Trichophor, s. Trichogyne.
Trichophthora (griech.), Haarvertilgungsmittel.
Trichoptera (Pelzflügler), Zunft aus der Ordnung der
Netzflügler (s. d.).
Trichord (griech.), dreisaitiges Tonwerkzeug.
Trichotomie (griech.), logische Zerlegung in drei Teile,
Dreiteilung; auch s. v. w. peinlich genaue Behandlung unbedeutender
Dinge, Haarspalterei.
Trichotracheliden (Trichotrachelidae), Familie der
Nematoden oder Fadenwürmer, Eingeweidewürmer mit
halsartig verdünntem Vorderteil und kleiner Mundöffnung
ohne Papillen. Zu ihnen gehören zwei im Menschen schmarotzende
Gattungen, von denen die eine (Trichocephalus oder Peitschenwurm,
s. d.) im allgemeinen unschädlich ist, die andre aber
(Trichina, s. Trichine) häufig durch ihre Menge tödlich
wirkt. Die übrigen T. leben in den Eingeweiden
warmblütiger Wirbeltiere.
Trichroismus (griech.), Dreifarbigkeit, s.
Pleochroismus.
Trichterlilie, s. Funkia.
Trichterwinde, s. Ipomoea.
Tricinium (lat.), Komposition für drei Singstimmen
(a cappella).
Trick (engl.), im Whistspiel Bezeichnung für jeden
Stich, den man über sechs macht.
Tricktrack, ein auf dem Puffbrett mit den Puffsteinen und
Würfeln auszuführendes Spiel; oft auch gleichbedeutend
mit Puff (s. d.).
Tricoccae, Ordnung im natürlichen Pflanzensystem
unter den Dikotyledonen, Choripetalen, charakterisiert durch stets
eingeschlechtige Blüten, die oft nackt und dann
gewöhnlich männliche mit einer weiblichen in einer
Hülle vereinigt sind oder ein einfaches Perigon oder auch
Kelch- und Blumenblätter besitzen, hauptsächlich durch
den zwei oder drei knöpsigen, ebenso viele Fächer
bildenden, oberständigen Fruchtknoten mit einem oder zwei im
Innenwinkel der Fächer befindlichen Samen und durch die
ebenfalls zwei- oder dreiknöpfige Frucht, deren Fächer
bei der Reife meist von der Mittelsäule sich ablösen und
einen meist mit einem Nabelanhang versehenen Samen mit geradem
Keimling und ölhaltigem Endosperm enthalten. In diese Ordnung
gehören die Familien der Euphorbiaceen, Empetreen und
Kallitrichaceen.
Tricycle (spr. -ßihkl), Dreirad, s. Velociped.
Tridácna, Riesenmuschel.
Tridens (lat., Trident), Dreizack, besonders Attribut des
Neptun.
Tridentinische Alpen (Trientiner Alpen), s. Alpen, S.
400, und Ortleralpen.
Tridentinisches Konzil (Concilium Tridentinum), die zur
Beseitigung der durch die Reformation entstandenen kirchlichen
Wirren nach Trient berufene allgemeine Kirchenversammlung. Die
erste Veranlassung zu derselben war die Appellation der
protestantischen Fürsten an eine allgemeine Synode; ihr traten
dann auch die katholischen Fürsten bei, und Kaiser Karl V.
hatte schon Clemens VII. zum Ausschreiben einer solchen zu
vermögen versucht, jedoch vergeblich. Paul III. rief das
Konzil endlich auf den 23. Mai 1537 nach Mantua zusammen, aber nur,
um es, weil sich immer neue Hindernisse einstellten, auf
unbestimmte Zeit zu verschieben. Im Regensburger Reichsabschied vom
29. Juli 1541 versprach der Kaiser von neuem, für das
Zustandekommen eines Generalkonzils zu sorgen, und der Papst berief
nun aus Besorgnis, die Deutschen möchten sonst ihre
kirchlichen Angelegenheiten selbständig regeln, dasselbe auf
1. Nov. 1542 nach Trient; aber der Wiederausbruch der
Feindseligkeiten zwischen dem Kaiser und dem König von
Frankreich verzögerte seinen Zusammentritt, und das Konzil
ward erst 13. Dez. 1545 in der Kathedrale zu Trient eröffnet.
Die Sessionen desselben sind freilich nur leere Formalitäten
zur Verkündigung der Beschlüsse gewesen, die in den
Ausschüssen vorbereitet und debattiert wurden. Die Abstimmung
geschah nicht nach Nationen, wie in Konstanz, sondern nach
Köpfen. Da die Italiener zahlreicher als alle andern Nationen
zusammen vertreten waren und der präsidierende Kardinallegat
del Monte fortwährend mit dem Papst korrespondierte, so konnte
das Konzil kein freies sein. Nachdem in der 1. Session das
Zeremonial bestimmt, in der 2. der Modus vivendi für die
Konzilsväter festgestellt, in der 3. das Bekenntnis zu den
alten Glaubenssymbolen abgelegt war, wurden in der 4.-8. die
protestantischen Lehren vom Ansehen der Schrift und Tradition, von
der Erbsünde und Rechtfertigung sowie von den Sakramenten
verdammt und der katholische Lehrbegriff darüber festgestellt.
Als aber in demselben Maß, wie das Waffenglück den
Kaiser begünstigte, auch die kaiserlichen Gesandten immer
selbständiger auftraten, verlegte der Papst, angeblich wegen
einer in Trient ausgebrochenen Seuche, das Konzil 11. März
1547 nach Bologna. Eine Minderheit kaiserlicher Bischöfe blieb
in Trient zurück, während der Kaiser feierlich gegen die
Verlegung protestierte. Jedoch auch zu Bologna erließen die
Legaten in der 9. und 10. Sitzung 1547 bloß Dekrete, wodurch
die Versammlung vertagt wurde; die förmliche Aussetzung des
Konzils wurde 13. Sept. 1549 von Paul III. ausgesprochen. Nach
dessen Tod schrieb der neue Papst und bisherige Kardinallegat
Julius III. auf Betrieb des Kaisers die Fortsetzung des Konzils in
Trient aus, und sein Legat, der Kardinal Marcellus Crescentius,
eröffnete dasselbe 1. Mai 1551; Frankreich aber legte
Protest
835
Tridi - Trieb.
ein, weil die Physiognomie des Konzils auf diese Weise von
vornherein eine vorwiegend kaiserliche war. Es wurde nun in der 13.
Sitzung die Lehre von der Transsubstantiation, in der 14. und 15.
auch die von der Buße und Letzten Ölung festgesetzt.
Aber zu der vom Kaiser gewünschten Verständigung mit den
Protestanten kam es nicht. Zwar erschienen brandenburgische und
württembergische weltliche Prokuratoren sowie Abgeordnete aus
einigen oberländischen Städten, endlich 7. Jan. 1552 auch
die weltlichen Gesandten des Kurfürsten von Sachsen. Die 25.
Jan. 1552 abgehaltene Sitzung beschloß, die Bestimmungen
über das Meßopfer und andre Punkte bis zum 19.
März, d. h. bis zum Erscheinen derer zu vertagen, qui
protestantes se vocant. Am 18. März trafen wirklich die
württembergischen und Straßburger theologischen
Abgeordneten ein, die kursächsischen befanden sich auf dem
Weg, da wurde vom päpstlichen Legaten die Sitzung auf 1. Mai
verlegt. Der unerwartete Feldzug des Kurfürsten Moritz gegen
den Kaiser und sein Erscheinen vor Innsbruck hatte aber die
Vertagung des Konzils auf zwei Jahre, die in der 16. Sitzung (28.
April 1552) beschlossen ward, zur Folge. Aus den zwei Jahren wurden
zehn Jahre. Zwar erließ Papst Pius IV. 1560 und 1561 neue
Einladungen zur Fortsetzung des Konzils, aber erst 18. Jan. 1562
wurde dasselbe unter dem Vorsitz des Kardinallegaten Prinzen
Herkules Gonzaga von Mantua mit der 17. Sitzung wieder
eröffnet. Entschiedener erneuerten der Kaiser, der
Kurfürst von Bayern und der König von Frankreich ihre
Anträge auf Reformation der Kirche, auf Verstattung des
Laienkelchs im Abendmahl, der Priesterehe und der verbotenen
Speisen. In der Behauptung, daß die Residenz der
Bischöfe in ihren Diözesen nicht auf päpstlichem,
sondern auf göttlichem Recht beruhe, konzentrierte sich die
Opposition der spanischen Bischöfe gegen die italienischen.
Die 18. Sitzung handelte von der Bücherzensur; die 19. und 20.
beschlossen nur, daß in diesen beiden Sitzungen nichts
bestimmt werden solle; in der 21. und 22. Sitzung kamen die Dekrete
von der Abendmahlsfeier und dem Meßopfer zu stande, der
Laienkelch wurde von der Erlaubnis des Papstes abhängig
gemacht. Am 13. Nov. erschien bei dem Konzil noch der Kardinal von
Lothringen mit 14 Bischöfen, 3 Äbten und 18 Theologen aus
Frankreich. Da derselbe die Oppositonspartei im Sinn des
Episkopalsystems verstärkte und 34 französische
Reformationsartikel mitbrachte, so wußte die päpstliche
Partei die nächste Sitzung von einem Monat zum andern
hinauszuschieben. Darüber starb 2. März 1563 der
Kardinallegat Gonzaga. An seiner Stelle präsidierten die
Legaten Morone und Navageri, welche die Kirchenversammlung durch
theologische Zänkereien zu ermüden wußten,
während der Kaiser Ferdinand und der Kardinal von Lothringen
von den schlauen Italienern für die Sache des Papstes gewonnen
wurden. Die Jesuiten Laynez und Salmeron leisteten wackere
Beihilfe. So entstanden in der 23. Sitzung (15. Juli 1563) die
Dekrete von der Priesterweihe und Hierarchie, in der 24. (11. Nov.)
von dem Sakrament der Ehe, in der 25. (3. und 4. Dez.) von dem
Fegfeuer, dem Heiligen-, Reliquien- und Bilderdienst, den
Klostergelübden, dem Ablaß, Fasten, den Speiseverboten
und dem Verzeichnis der verbotenen Bücher, dessen
Fertigstellung nebst der Abfassung eines Katechismus und Breviers
dem Papst überlassen wurde. In den Reformationsdekreten, die
in der 21.-25. Session publiziert wurden, sorgte man für
Abstellung einiger der bisherigen Mißbräuche bei
Erteilung und Verwaltung geistlicher Ämter sowie für die
Bildung der Geistlichkeit durch die Vorschrift der Anlegung von
Seminaren und Prüfung der Ordinanden. Am Schluß der 25.
Sitzung, 4. Dez. 1563, rief der Kardinal von Lothringen: "Verflucht
seien alle Ketzer!", und die Prälaten stimmten ein:
"Verflucht, verflucht!" Die Beschlüsse wurden von 255
Prälaten unterschrieben und trennten für immer die
protestantische von der katholischen Kirche, für welche sie
die Bedeutung eines symbolischen Buches erhielten. Papst Pius IV.
bestätigte dieselben 26. Jan. 1566 durch die Bulle "Benedictus
deus" und behielt dem Papst allein ihre Auslegung vor, für die
1588 von Sixtus V. eine besondere Kongregation von Kardinälen
niedergesetzt wurde. Die Dekrete der Synode von Trient fanden in
den italienischen Staaten (aber nicht in Neapel), in Portugal und
Polen unbedingte, dagegen in Spanien und den von Spanien
abhängigen Ländern eine durch die Reichsgesetze bedingte
Annahme.^[sic] in Frankreich, Deutschland und Ungarn sogar
Widerspruch, der sich nur nach und nach zu stillschweigender
Billigung der den Glauben betreffenden Dekrete bequemte.
Die "Canones et decreta oecumenici concilii Tridentini" wurden
oft herausgegeben, am besten von Schulte und Richter (Leipz. 1853),
zuletzt in deutscher Übersetzung von Petz (Passau 1877). Am
gebräuchlichsten in der katholischen Kirche Deutschlands ist
die Ausgabe von Smets (lateinisch und deutsch, 6. Aufl., Bielef.
1868). Die Geschichte des Tridentinischen Konzils schrieben Sarpi
(s. d.) und gegen ihn Pallavicini (Rom 1656-57, 2 Bde.). Aber erst
neuerdings ist das Material zur Geschichtschreibung dieser Synode
in ausgiebigerm Maß bekannt geworden. Die
Geschäftsordnung des Konzils ist 1871 in Wien erschienen.
Weitere Beiträge veröffentlichten Sickel
("Aktenstücke zur Geschichte des Konzils zu Trient", Wien
1871), Theiner ("Acta genuina oecumenici concilii Tridentini",
Agram 1874, 2 Bde.; die Protokolle des Konzilsekretärs
Massarelli enthaltend), Calenzio ("Documenti inediti e nuovi lavori
letterarii sul concilio di Trento", Rom 1874), Maynier
("Étude historique sur le concile de Trente", Par. 1874),
Döllinger ("Ungedruckte Berichte und Tagebücher",
Nördling. 1876, Bd. 1), Druffel ("Monumenta Tridentina",
Münch. 1883-88, Heft 1-3).
Tridi (lat.-franz.), im franz. Revolutionskalender der
dritte Tag einer Dekade (s. d.).
Triduum (lat.), Zeit von drei Tagen.
Tridymit, Mineral aus der Ordnung der Anhydride, bildet
triklinische, dem hexagonalen System sehr nahe stehende Kristalle
(meist Drillinge, daher der Name) und besteht wie Quarz aus
Kieselsäureanhydrid SiO2, ist farblos oder weiß,
glasglänzend, Härte 7, spez. Gew. 2,28-2,33, wurde 1866
durch vom Rath entdeckt, seitdem aber in Trachyten, Andesiten,
Rhyolithen als ein reichlich vorhandener Gemengteil nachgewiesen,
während er in ältern vortertiären Felsarten nur
äußerst spärlich vorkommt. Außerdem ist T.
vielen Opalen beigemengt, die auch durch Glühen, ebenso wie
Quarzpulver und amorphe Kieselsäure, sich zu T. umsetzen;
Fundorte: Drachenfels, Mont Dore, Alleret, Frauenberg bei
Brückenau, Ungarn, Siebenbürgen, Irland, Mexiko etc.
Trieb, junger, noch nicht ein Jahr alter Ast.
Trieb, das sinnliche bleibende Begehren, bei welchem der
Grund der Dauer in der Beschaffenheit des leiblichen Organismus
gelegen ist. Die unaufhörliche Zersetzung und Ausscheidung der
kleinsten Bestandteile des Leibes erzeugt ebenso viele unange-
53*
836
Trieb - Trient.
nehme Gefühle des Mangels, die als Begehrungsreize wirken
und mit dem periodischen Wechsel des organischen Lebens in stets
gleicher Weise wiederkehren. Derselbe währt daher so lange,
als das letztere selbst währt, und ist darum so
unwiderstehlich, weil die Hinwegräumung seiner Ursache
außer unsrer Macht liegt. Das Begehren nach Schlaf
(Schlafbedürfnis), wenn die Organe erschöpft sind, nach
Nahrung (Nahrungstrieb), wenn es an Stoffersatz, nach Bewegung
(Bewegungstrieb), wenn es infolge dauernder Bewegungslosigkeit dem
Leib an Umsatz fehlt, kehrt trotz der Befriedigung in bestimmter
Zeit wieder, weil der Prozeß des physischen Lebens die Reize,
welche zu Begehrungen werden, immer von neuem erzeugt. Nichts
erfordert zu seiner Besiegung größere Kraft als
dasjenige Begehren, welches durch Triebe unterstützt wird, und
mancher derselben läßt sich nur durch Zerstörung
der Ursachen im Organismus (Fortpflanzungstrieb) oder des letztern
selbst (Selbsterhaltungstrieb) unterdrücken. Der T. gibt dem
Begehrungsleben eine bestimmte Gestalt, indem alles dasjenige, was
durch ihn unterstützt wird, infolge der unaufhörlichen
Reize leichter und öfter als andres Begehren zur Befriedigung
gelangt und daher von selbst zur Disposition, Neigung, Hang, Sucht
und Leidenschaft sich steigert, wenn nicht künstliche Hilfen
(praktische Grundsätze, Charakter) den natürlichen des
Leibes zum Widerstand entgegengesetzt werden. Gesellt sich zu dem
seiner Natur nach blinden (bewußtlosen) T. die gleichfalls
bewußtlose Kenntnis der zur Befriedigung desselben tauglichen
Mittel, so geht der T. in Instinkt über.
Trieb, Nebenfluß der Elster, s. Vogtländische
Schweiz.
Triebel, Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Frankfurt, Kreis Sorau, hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht,
Schuhmacherei, Weberei und (1885) 1657 Einw.
Triebrad, bei Fahrzeugen s. v. w. Treibrad; sonst im
Gegensatz zum Treibrad das in Bewegung gesetzte Rad; in der Uhr ein
kleineres Zahnrad, welches ein größeres treibt.
Triebstahl, s. Draht, S. 105.
Triebwerke, Maschinenteile, welche die Kräfte in
passender Weise nach bestimmten Richtungen übertragen, wirken
direkt wie Räder- und Kurbelgetriebe oder indirekt wie
Riemen-, Schnur- und Seilgetriebe.
Triefaugen, eine chronische Entzündung der
Augenbindehaut, deren Hauptsymptom in Rötung der
Lidränder und fortwährender Thränenabsonderung
besteht. Am häufigsten kommen T. bei skrofulösen
Individuen, nicht selten bei alten Frauen, vor, bei denen diese das
Aussehen stark entstellende Entzündung im Mittelalter manche
alte Matrone als Hexe auf den Scheiterhaufen gebracht hat. Die
stärksten Grade der Entzündung führen zu
Verkrümmungen der Augenlider nach auswärts oder
einwärts (Ektropium, Entropium) und sind nur durch plastische
Operation zu beseitigen. Betreffs der Behandlung s.
Augenentzündung.
Triel, Vogel, s. Dickfuß.
Triënnium (lat.), Zeit von drei Jahren. Akademisches
T. (t. academicum), die fast allgemein übliche Zeit von drei
Jahren, welche in Deutschland zum Besuch der Universität
verwendet und als Minimum für die meisten Staatsprüfungen
der Beamten sogar gesetzlich gefordert wird.
Trient (spr. triang), linksseitiger Nebenfluß des
Rhône in der Schweiz, entspringt aus dem Glacier du T. und
gelangt, durch die Eau Noire verstärkt, aus seinem Alpenthal
durch eine tiefe, schauerliche Schlucht (Gorge du T.) von 2 km
Länge bei Vernayaz in das Rhônethal hinaus.
Triént (ital. Trento, lat. Tridentum), Stadt (mit
selbständiger Gemeindeverwaltung) in Welschtirol, 190 m
ü. M., links an der schiffbaren Etsch, in welche hier die
Fersina mündet, und an der Südbahnlinie Kufstein-Ala,
Sitz eines Fürstbischofs, eines Domkapitels, einer
Bezirkshauptmannschaft und eines Kreisgerichts, hat zwei
Vorstädte (San Martino und Santa Croce), spärliche Reste
der alten hohen Stadtmauern (der Sage nach aus der Gotenzeit) mit
zwei angeblich von den Römern erbauten Türmen, gut
gepflasterte Straßen und ganz im italienischen Stil erbaute
Häuser. In den letzten Jahren ist T. durch Anlage von
Außenforts zu einer Lagerfestung geworden. Die ansehnlichsten
Plätze sind die Piazza del Duomo mit dem Neptunsbrunnen und
die Piazza d'Armi. Unter den 15 Kirchen ragen hervor: der Dom, eine
dreischiffige romanische Pfeilerbasilika mit zwei Kuppeln (im 13.
Jahrh. begonnen, im 15. vollendet); die Kirche Santa Maria
Maggiore, aus rotem Marmor erbaut, mit den Bildnissen der
Kirchenfürsten, welche dem in dieser Kirche abgehaltenen
Konzil (s. unten) beiwohnten; die Peterskirche mit einer Kapelle
des heil. Simon von T., der als dritthalbjähriger Knabe 1472
angeblich von den Juden ermordet wurde; die Jesuiten-, jetzt
Seminarialkirche; die Kirche dell' Annunziata mit hoher, von vier
Säulen getragener Kuppel und die Martinskirche. Andre
ansehnliche Gebäude sind: das Renaissanceschloß Buon
Consiglio (einst Residenz der Fürstbischöfe, jetzt
Kastell) mit vielen Fresken, das Rathaus, der Justizpalast, das
Theater, mehrere Privatpaläste und das große Waisenhaus.
Die Stadt hat ein Franziskaner- und Kapuzinerkloster, 3
Nonnenklöster, ein Klerikalseminar mit theologischer
Diözesanlehranstalt, ein Obergymnasium, ein bischöfliches
Privatgymnasium, eine Lehrerinnenbildungsanstalt, eine Fachschule
für Steinbearbeitung, eine Handelsschule, ein Musiklyceum, ein
bischöfliches Taubstummeninstitut, ein städtisches
Museum, eine Volksbibliothek, verschiedene
Wohlthätigkeitsanstalten, eine Volksbank, Pfandleihanstalt,
Sparkasse und (1880) 19,585 Einw. Die Industrie wird durch
zahlreiche Seidenfilanden, eine Seidenspinnerei,
Glockengießerei, Töpferwaren- und
Konfitürenfabrikation etc. vertreten. Der Handel ist lebhaft.
In der Umgebung große Brüche roten Marmors, Obst- und
Weinbau. Auf dem rechten Etschufer liegt der befestigte
Felshügel Dos di Trento (289 m), auf dem einst das
Römerkastell Verruca stand. - Im Altertum war T. römische
Kolonie. Im 4. Jahrh. wurde es Bischofsitz und um 574 Residenz
eines langobardischen Herzogs. Bekannt ist es durch Secundus von T.
(gest. 604), der eine Geschichte der Langobarden geschrieben hat,
die leider verloren ist. Unter Karl d. Gr. kam es an das
fränkische Reich und unter Otto I. mit Italien an Deutschland.
König Konrad II. belehnte 1027 den Bischof von T. mit der
fürstlichen Würde und weltlichen Herrschaft über die
Stadt. Das Konzil von 1545 bis 1563 (s. Tridentinisches Konzil) gab
letzterer eine welthistorische Bedeutung. 1803 wurde das Hochstift
säkularisiert und den österreichischen Landen
einverleibt. 1805 fiel es an Bayern und, nach den Kämpfen von
1809 im Angesicht der Stadt, an das Königreich Italien. 1813
kam es wieder an Österreich. Vgl. Barbacovi, Memorie storiche
della città e del territorio di Trento (Trient 1808);
Ambrosi, Trento e suoi circondario (das. 1881); Öribauer,
Führer für T.-Arco etc. (Reichenberg 1884).
837
Trier (Bistum) - Trier (Stadt).
Trier, vormaliges deutsches Erzstift und geistliches
Kurfürstentum im kurrheinischen Kreis, umfaßte ein Areal
von 8314 qkm (151 QM.) mit 280,000 meist kath. Einwohnern und
teilte sich in das obere und niedere Stift, deren erstes Trier, das
andre Koblenz zur Haupt- und Residenzstadt hatte. Suffragane von T.
waren die Bischöfe von Metz, Toul und Verdun und seit 1777 die
neukreierten von St.-Dié und Nancy. Der Erzbischof und
geistliche Kurfürst nahm unter den Kurfürsten die zweite
Rangstufe ein. Die jährlichen Einkünfte beliefen sich auf
½ Mill. Thaler. Das Wappen war ein gevierter Schild mit
einem roten Kreuz im silbernen Feld und einem weißen Lamme
mit einem Fähnlein auf einem Hügel im roten Feld. In
Trier soll nach der Legende im 1. Jahrh. durch Eucharius, Valerius
und Maternus ein Bistum gestiftet worden sein; indessen ist erst um
314 ein Bischof Agritius historisch nachzuweisen. Bei Maximin
(332-349) fand Athanasius Zuflucht. Erst unter Hetti (814-847)
erscheint T. als Erzbistum, dem schon die Metropolitangewalt
über das Bistum Toul zustand. Radbod (883-915) erlangte
für sein Stift die Rechte einer eignen Grafschaft,
Abgabenfreiheit, Münze und Zoll. Robert (930-956) nahm als
Inhaber des ältesten Kirchensitzes das Recht in Anspruch, Otto
I. zu krönen, was dieser damals auch zugab. Doch erkannte T.
1315 den Vorrang Kölns an. Heinrich I. (956-964) erhielt vom
Papst Johann XII. das Pallium, Theoderich I. 969 von Johann XIII.
den Primat in Gallien und Germanien. Das unter Diether III. von
Nassau (1300-1307) arg verschuldete Erzstift nahm einen bedeutenden
Aufschwung unter Balduin von Luxemburg (1307-54), dem Bruder
König Heinrichs VII. Derselbe erwarb 1314 die Würde eines
Erzkanzlers für Gallien und Arelat (d. h. Burgund), erweiterte
die Besitzungen seiner Kirche durch Annahme zahlreicher Lehnsleute
und begründete die Territorialhoheit. In der Folgezeit ward
aber die Lage des Erzstifts wegen zwiespältiger Wahlen und
zahlreicher Kriege so mißlich, daß die Stände,
bestrebt, eine weitere Verschuldung des Landes zu verhüten,
sich 1456 zu einer Union vereinigten, welche für künftige
Zeiten eine genaue Wahlkapitulation und Eidesleistung des zu
erwählenden Erzbischofs für erforderlich erklärte.
Unter Richard von Greiffenklau (1511-31) begann die
öffentliche Verehrung des heiligen Rockes, wozu des Ablasses
wegen bisweilen über 100,000 Pilger in Trier
zusammenströmten. Der Reformation trat Richard in seinem Land
mit Nachdruck entgegen. Johann VI. von der Leyen (1556-67) nahm die
Jesuiten in sein Land auf, für welche sein Nachfolger Jakob
III. von Elz (bis 1581) ein Kollegium in Koblenz errichtete, und
denen Johann VII. (1581-99) auch den Unterricht in den Schulen der
Stadt T. überwies. Zur Bildung der Geistlichen stiftete
derselbe 1585 Seminare in Trier und Koblenz. Erzbischof Philipp
Christoph von Sötern (1623-52), durch seine Streitigkeiten mit
dem Domkapitel und dem Adel daheim, durch seine Hinneigung zu
Frankreich dem Kaiser verhaßt, wurde 1635 von den Spaniern
festgenommen und bis 1645 in Wien gefangen gehalten. Unter seinem
Nachfolger Karl Kaspar von der Leyen (1652 bis 1676) wurde der seit
dem 12. Jahrh. bestehende Streit mit der Abtei St. Maximin beendet,
indem diese 1669 auf ihre Reichsfreiheit verzichtete. Der letzte in
der Reihe der Erzbischöfe von T. war Klemens Wenzeslaus,
Herzog von Sachsen (1768-1802), der daneben die Bistümer
Freising, Augsburg und Regensburg besaß. Derselbe ging von
der bisherigen Gewohnheit, den Evangelischen die Ansiedelung im
Erzstift zu untersagen, ab und gewährte endlich 1782 ein
Toleranzedikt. Während des ersten Koalitionskriegs hatte das
Land viel von den Einfällen der Franzosen zu leiden, so
daß sich 1794 der Erzbischof zur Flucht veranlaßt sah.
Als er im Frieden von Lüneville 1801 seine linksrheinischen
Besitzungen an Frankreich hatte abtreten müssen, dankte er
1802 ab und begnügte sich mit dem Bistum Augsburg und einem
Jahrgehalt von 100,000 Gulden. Durch den
Reichsdeputationshauptschluß von 1803 wurde das Erzstift zu
gunsten von Nassau-Weilburg säkularisiert. Schon 10. April
1802 war ein neues Bistum T. für das französische
Saardepartement gebildet und dem Erzstift Mecheln unterstellt. 1814
fielen die kurtrierschen Lande wieder an Deutschland, worauf sie
bis auf wenige Bezirke, wie St. Wendel (das an Koburg und erst 1834
an Preußen kam), Birkenfeld und Meisenheim, mit Preußen
vereinigt wurden. Der preußische Anteil gehört
gegenwärtig zu den Regierungsbezirken T. und Koblenz. Durch
die Bulle "De salute animarum" 1821 wurde das Bistum T.
reorganisiert und unter den Erzbischof von Köln gestellt. Die
Diözese umfaßt seitdem wieder dieselben Gebiete wie im
Mittelalter und ist nur auf dem linken Rheinufer geschmälert.
Der Bischof Wilhelm Arnoldi (1842-64) gab 1844 großen
Anstoß durch die neue Ausstellung des heiligen Rockes. Nach
dem Tode des Bischofs Eberhard (30. Mai 1876) blieb das Bistum
während des Kulturkampfes unbesetzt; erst 1881 wurde der
Bischof Korum (s. d.) ernannt. Vgl. Hontheim, Historia Trevirensis
diplomatica (Augsb. 1750, 3 Bde.); Derselbe, Prodromus historiae
Trevirensis (das. 1757, 2 Bde.); "Urkundenbuch zur Geschichte der
mittelrheinischen Territorien" (hrsg. von Beyer, Eltester und
Görz, Kobl. 1860-74, 3 Bde.); Görz, Regesten der
Erzbischöfe von T. (Trier 1859-61); Marx, Geschichte des
Erzstifts T. (das. 1858-64, 5 Bde.); "Gesta Treverorum" (hrsg. von
Waitz in den "Monumenta Germaniae, Scriptores", Bd. 8).
Trier (lat. Augusta Trevirorum, franz. Trèves),
Hauptstadt des vormaligen Erzbistums und des jetzigen gleichnamigen
Regierungsbezirks in der preuß. Rheinprovinz, liegt rechts an
der Mosel, über welche hier eine interessante alte, auf acht
Schwibbogen ruhende Brücke (ursprünglich ein
Römerbau) führt, im Knotenpunkt der Linien Hillesheim-T.,
Konz-Ehrang und Perl-Koblenz der Preußischen Staatsbahn, 124
m ü. M., und hat sechs öffentliche Plätze, aber
meist unregelmäßige, enge Straßen. Unter den
Gebäuden verdienen Erwähnung: die Porta nigra, nach
inschriftlichen Zeugnissen aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. und
früher zugleich als Bollwerk dienend, 36 m lang, 21 m breit
und 23 m hoch, seit dem 11. Jahrh. in eine Kirche verwandelt,
gegenwärtig aber von allen mittelalterlichen Anbauten, mit
Ausnahme einer romanischen Apsis, befreit; der Dom, dessen
mittlerer Teil aus dem 6. Jahrh. herrührt, während die
verschiedenartigen Anbauten im 8. und 12. Jahrh. hinzugefügt
worden sind, mit schönen Grabmälern, bedeutenden
Reliquien (darunter der berühmte heilige Rock); die
Liebfrauenkirche, im frühsten gotischen Stil 1227-43 erbaut
und mit dem
[Wappen von Trier.]
838
Triere - Triest.
Dom durch einen Kreuzgang verbunden, mit figurenreichem Portal
und kühn gewölbtem Schiff; die Gangolfskirche, Jesuiten-
oder Dreifaltigkeitskirche (mit dem Grab des Dichters Fr. v. Spee),
endlich Krypten in der Matthias- und Paulinuskirche. Im ganzen hat
die Stadt 11 katholische, eine evang. Kirche und eine Synagoge.
Noch sind zu nennen: die Palastkaserne (bis 1786
erzbischöflicher Palast), die ehemalige Benediktinerabtei St.
Maximin (jetzt Kaserne), auf den Ruinen eines römischen
Prachtbaues errichtet, und das neue Theater. Interessante
Denkmäler aus der Römerzeit sind außer den schon
genannten noch: der römische Kaiserpalast; die römischen
Bäder (zum Teil noch verschüttet); Überreste eines
römischen Amphitheaters, welches 28,000 Menschen faßte;
die durch König Friedrich Wilhelm IV. wiederhergestellte
Basilika (gewöhnlich Konstantinspalast genannt, seit 1856 zur
evangelischen Kirche eingerichtet). Der sogen. Frankenturm diente
in der fränkischen Zeit wahrscheinlich als Getreidemagazin.
Die Zahl der Einwohner beläuft sich (1885) mit der Garnison (2
Infanterieregimenter Nr. 29 und 69 und ein Husarenregiment Nr. 9)
auf 26,126 Seelen, meist Katholiken; sie beschäftigen sich
vornehmlich mit Obst- und Weinbau, Gerberei, Woll-, Baumwoll- und
Leinweberei, Färberei, Wachsbleicherei, auch Tabaks- und
Hutfabrikation und treiben ansehnlichen Handel mit Moselweinen,
Vieh und Holz. Auch Steine, für ganze Kirchen im gotischen
Stil zugehauen, werden in Menge verschifft. An Bildungsinstituten
und andern Anstalten besitzt T. ein Gymnasium (darin die
Stadtbibliothek von 100,000 Bänden, Handschriften [Codex
aureus] und Inkunabeln sowie wertvolle Sammlungen), ein
Realgymnasium, eine Taubstummenanstalt, ein Provinzialmuseum mit
römischen Altertümern, ein Landarmenhaus, ein
Bürgerhospital, ein Militärlazarett etc. Die
städtischen Behörden zählen 4 Magistratsmitglieder
u. 24 Stadtverordnete. Sonst ist T. Sitz einer königlichen
Regierung, eines Landratsamtes (für den Landkreis T.), eines
katholischen Bischofs, eines Landgerichts, einer Oberpostdirektion,
einer Forstinspektion und zweier Oberförstereien, eines
Bergreviers, eines Hauptsteueramtes, einer Handelskammer, einer
Reichsbanknebenstelle etc.; ferner des Stabes der 16. Division, der
31. und 32. Infanterie- und der 16. Kavalleriebrigade. 8 km
entfernt ist bei dem Dorf Igel (s. d.) die sogen. Igelsäule,
neben der auch noch ein Kastell oberhalb Saarburg (Grabkapelle
König Johanns von Böhmen) und ein Mosaikfußboden in
Nennig zu erwähnen sind. Zum Landgerichtsbezirk T.
gehören die 16 Amtsgerichte zu Bernkastel, Bitburg, Daun,
Hermeskeil, Hillesheim, Merzig, Neuerburg, Neumagen, Perl,
Prüm, Rhaunen, Saarburg, T., Wadern, Waxweiler und Wittlich. -
T. war im Altertum die Hauptstadt der Treverer, wurde im 3. Jahrh.
Residenz römischer Kaiser und unter Konstantin I. Metropole
einer der vier Präfekturen des Reichs. Um die Mitte des 5.
Jahrh. kam es unter die Herrschaft der Franken, wurde aber 451 von
den Hunnen zerstört. Durch den Vertrag von Verdun zu
Lothringen geschlagen, ward es unter Heinrich I. auf immer
Deutschland einverleibt. Zunächst von Grafen, seit dem 9.
Jahrh., als die Grafengewalt an die Erzbischöfe überging,
vom Vogt des Erzstifts verwaltet, strebte die Stadt später
danach, reichsunmittelbar zu werden, und erhielt auch 1212 von
Kaiser Otto IV. einen Freibrief, den Konrad IV. bestätigte.
Allein 1308 erkannte sie wieder die Gerichtsbarkeit des Erzbischofs
an, und ihre Eigenschaft als erzbischöfliche Stadt ward noch
1364 von Karl IV. und 1580 vom Reichskammergericht bestätigt.
An ihrer Spitze stand ein Schöffengericht, das 1443 vom
Erzbischof Jakob I. durch Einsetzung zweier Bürgermeister
ergänzt wurde. Erzbischof Theoderich I. und sein Nachfolger
Arnold II. befestigten im 13. Jahrh. die Stadt durch Mauern.
Später, besonders aber nach Vollendung des neuen Schlosses
(1786), ward Koblenz Residenz der Erzbischöfe. 1473 wurde in
T. eine Universität gestiftet, die 1797 aufgehoben ward. 1512
fand daselbst ein Reichstag statt, auf welchem die Kreisverfassung
im Reich endgültig festgestellt wurde. 1634 wurde T. von den
Spaniern erobert, aber 1645 von den Franzosen unter Turenne wieder
genommen. Schon 1674, 1688 und auf längere Dauer 1794 von den
Franzosen erobert, kam die Stadt 1801 an Frankreich und ward
Hauptstadt des Departements Saar. 1814 fiel sie an Preußen.
Denkwürdig ist die Zusammenkunft Kaiser Friedrichs III. mit
Karl dem Kühnen 1473 in T. Vgl. Haupt, Triers Vergangenheit
und Gegenwart (Trier 1822, 2 Bde.); Leonardy, Panorama von T. (das.
1868); Derselbe, Geschichte des trierschen Landes und Volkes
(Saarlouis 1871); Freeman, Augusta Trevirorum (a. d. Engl., Trier
1876); Hettner, Das römische T. (das. 1880); Wilmowsky, Der
Dom zu T. (das. 1874, 26 Tafeln); Derselbe, Archäologische
Funde in T. (das. 1873); Beissel, Geschichte der Trierer Kirchen
(das. 1888 ff.); Lokalführer von Braun, Lintz, Steinbach u.
a.
Der Regierungsbezirk T. (s. Karte "Rheinprovinz") umfaßt
7183 qkm (130,46 QM.) mit (1885) 675,225 Einw. (116,945
Evangelische, 551,521 Katholiken und 6534 Juden) und 13 Kreise:
Kreise QKilometer QMeilen Einwohner Einw. auf 1 QKilom.
Bernkastel .... 668 12,13 44389 66
Bitburg ..... 780 14,17 43494 56
Daun ...... 610 11,08 27305 45
Merzig ...... 418 7,59 37996 91
Ottweiler ..... 307 5,58 72514 236
Prüm ...... 919 16,69 35519 39
Saarbrücken .... 385 6,99 124374 323
Saarburg ..... 454 8,25 30946 68
Saarlouis ..... 444 8,06 68126 153
St. Wendel .... 537 9,75 45594 85
Trier (Stadtkreis) .. 8 0,15 33019 -
Trier (Landkreis) .. 1011 18,36 73949 73
Wittlich ..... 642 11,66 38000 59
Vgl. Bärsch, Beschreibung des Regierungsbezirks T. (Trier
1846-49, 2 Bde.).
Triere, s. Triremen.
Triesch, Marktflecken in Mähren,
Bezirkshauptmannschaft Iglau, an einem Teiche gelegen, mit alter
Pfarrkirche, Schloß mit Gartenanlagen, Synagoge, Tuch-,
Möbel- und Zündwarenfabriken und (1880) 4374 Einw.
Triést (ital. Trieste, slaw. Trst, lat. Tergeste),
wichtigster Hafen- und Seehandelsplatz der
österreichisch-ungar. Monarchie, hervorragendstes Emporium am
Adriatischen Meer, Hauptstadt des österreichisch-illyrischen
Küstenlandes, innerhalb dessen die Stadt mit ihrem Gebiet von
94,6 qkm (1,7 QM.) autonome Gemeindeverwaltung besitzt, erhebt sich
in reizender Lage terrassenförmig am Fuß des
amphitheatralisch aufsteigenden Karstgebirges am Meerbusen von T.
Sie bietet vom Meer und vom Land aus einen malerischen Anblick dar
und besteht aus zwei Hauptteilen: der Altstadt, die, an den
Abhängen des Schloßbergs erbaut, meist
unregelmäßige und enge Straßen hat, und der
Neustadt, welche sich an
839
Triest (Beschreibung der Stadt, Bevölkerung).
der Reede hinzieht und breite, regelmäßige, sich
rechte winkelig kreuzende Straßen enthält. In die
Neustadt tritt der 380 m lange, 16 m breite, 4 m tiefe "große
Kanal" mit zwei Drehbrücken ein, welcher den Schiffen
ermöglicht, unmittelbar an den Magazinen löschen zu
können. Die Stadt T. mit ihrem Gebiet zerfällt in 12
Bezirke, nämlich 5 innere Bezirke (Stadt), 5 äußere
Bezirke (Umgebung) und 2 das übrige Gebiet von T. (13
Dörfer) umfassende Bezirke. Unter den öffentlichen
Plätzen sind hervorzuheben: der Große Platz mit der
Marmorstatue Karls VI. u. großem Brunnen, durch einen
öffentlichen Garten vom Fischplatz (mitlebhaftem Fischmarkt)
am Meer getrennt; der Börsenplatz mit dem 1668 errichteten
Standbild Leopolds I.; der Ponte Rosso-Platz am Canal grande; der
Giuseppinaplatz mit dem Monument des Erzherzogs Maximilian, Kaisers
von Mexiko (von Schilling); der Stationsplatz, der Dogana- oder
Mautplatz, der Holzplatz, der mit einem anmutigen Square besetzte
Leipziger Platz, die große Piazza d'Armi etc. Von den
Straßen sind der Corso, die Acquedottogasse (mit schöner
Allee, besuchter Spaziergang), die Torrente- und Stadiongasse die
breitesten und schönsten. Die Via Giulia führt zum
Boschetto (Wäldchen), einem beliebten Vergnügungsort der
Triester Bevölkerung. Die Stadt hat außerdem breite
Kais, von denen der nordöstliche zum neuen Hafen und nach dem
im Winter besuchten Küstendorf San Bartolo, der
südwestliche zu dem am Meer gelegenen Spaziergang Sant' Andrea
und weiter zum Lloydarsenal führt. Unter den Kirchen steht
obenan der Dom von San Giusto, auf einem Hügel unterhalb des
Kastells, ein schon im 5. Jahrh. gegründeter, im 14. Jahrh.
vollendeter byzantinischer Bau mit fünf Schiffen, sehenswerten
Altertümern, Mosaiken, Reliquien und einem mit Benutzung
antiker Fragmente um 1000 erbauten Glockenturm. Vor dem Dom erhebt
sich die 1560 zu Ehren des Kaisers Ferdinand I. errichtete sogen.
Adlersäule. Sonstige erwähnenswerte Kirchen sind: die
1627 erbaute Kirche Santa Maria Maggiore (Jesuitenkirche) mit
Fresken von Sante, die Kirche Beata Vergine del Soccorso (Sant'
Antonio Vecchio), die 1830 von Nobile erbaute Kirche Sant' Antonio
am Ende des Großen Kanals, die Kirche San Giacomo, die reich
ausgestattete, mit Gemälden von Dell' Acqua gezierte
griechische Kirche San Niccolò mit zwei Türmen (1782
erbaut), die neuerbaute prächtige serbische Kirche im
byzantinischen und die neue lutherische Kirche im gotischen Stil,
die reformierte Kirche und die englische Kapelle. Die Israeliten
haben fünf Synagogen. Weitere hervorragende Gebäude sind:
das neue Rathaus am Großen Platz; das Tergesteum auf dem
Börsenplatz (1840 errichtet), ein gewaltiges Gebäude, im
Innern mit kreuzweiser Glasgalerie, Sitz der Börse; das alte
Börsengebäude im dorischen Stil (1802 erbaut), das
Statthaltereigebäude und der Lloydpalast am Großen
Platz, das Gebäude der Allgemeinen Versicherungsgesellschaft
am Kai, die Paläste Carciotti, Revoltella, Rittmeyer, Genel,
Salem, das große Schulgebäude am Leipziger Platz, das
Hôtel de Ville, die Villa Necker (einst Eigentum
Jérômes, Königs von Westfalen), die Villa Murat,
das vom Triester Turnverein errichtete Turnschulgebäude, das
geschmackvolle Stadttheater, das Armoniatheater, das Amphitheater
Fenice und das Teatro Filodrammatico, endlich das große, in
der Acquedottogasse erbaute Politeama Rossetti (Stadttheater); das
den Schloßberg krönende Kastell, an der Stelle des
römischen Kapitols 1508-1680 errichtet, mit herrlicher
Aussicht über Stadt und Meer, mehrere Kasernen, die
Reitschule, das alte Lazarett (jetzt Artilleriearsenal), der 33 m
hohe Leuchtturm (1833 erbaut), der Südbahnhof mit dem neuen
großen Stationsgebäude und der 1886 auf dem Kai von
Sant' Andrea erbaute Staatsbahnhof. Von Altertümern sind zu
erwähnen: die Überreste eines römischen
Amphitheaters, eine römische Wasserleitung und ein
Triumphbogen (Arco di Riccardo) aus der Kaiserzeit, welcher als
Stadtthor diente. In neuester Zeit sind auch im Küstenort San
Bartolo Überreste römischer Bauwerke (mit
Mosaikböden) gefunden worden. T. samt Gebiet zählte Ende
1880: 144,844 Einw., wovon auf die Stadt 74,544, auf die Vororte
58,475 und auf das weitere Gebiet von T. 11,825 entfallen. Für
Ende 1887 wurde die Bevölkerung mit 158,478 berechnet; 1810
zählte T. erst 29,908 Einw. Die Bevölkerung ist aus den
verschiedensten Elementen zusammengesetzt. Die Mehrheit bilden
Italiener, bez. italienisierte Südslawen (108,000), wie
überhaupt die Stadt einen vorwiegend italienischen Charakter
hat. Doch gibt es in T. auch zahlreiche Deutsche (über 6000,
meistens dem Beamten- und Handelsstand angehörig) sowie
Angehörige andrer Nationalitäten, als Griechen,
Engländer, Armenier, Türken etc. Die Bauern der Umgegend
sind Slowenen (im ganzen über 26,000), welche Sonntags in
malerischer Tracht einhergehen. Die Fischer und Seeleute sind meist
Dalmatiner und Istrianer. Der Religion nach sind von der gesamten
Einwohnerzahl 136,168
[Wappen von Triest.]
[Karte der Umgebung von Triest.]
840
Triest (Industrie, Handel und Verkehr).
Katholiken, 1861 nichtunierte Griechen, 1862 Evangelische, 4640
Israeliten, 217 konfessionslos.
Die Industrie besteht vornehmlich im Schiffbau, in der
Maschinenfabrikation, in der Mehl-, Seifen- und Biererzeugung. Die
Schiffswerfte des Österreichisch-Ungarischen Lloyd ist eins
der größten derartigen Etablissements des Kontinents;
ihr reiht sich die Schiffbauanstalt des Stabilimento tecnico
(für Kriegsschiffe) an. Die Maschinenfabriken liefern Schiffs-
und industrielle Dampfmaschinen und Kessel. Zwei große
Dampfmühlen versenden Schiffsladungen Mehl nach allen
Weltteilen. Die Drehersche Bierbrauerei in Guardiella versorgt
nicht nur die Stadt mit diesem Getränk, sondern versendet es
bis nach dem fernen Osten. In zweiter Linie reihen sich die
Gerberei, die Fabrikation von Seilen und Segeltuch, Möbeln,
Spielkarten und Zigarrettenpapier, Teigwaren, Essig, Schokolade,
Wachskerzen, Weinstein, chemischen Präparaten etc. an. Auch
die Versendung von Fischen nach den an der Südbahn gelegenen
Städten, insbesondere nach Wien, ist lebhaft. In T. befindet
sich ferner die Leitung mehrerer in den südlichen
österreichischen Provinzen gelegener industrieller
Etablissements. Die Umgegend von T. produziert vorzüglichen
Wein, Obst, Getreide, Öl und Steine. Seine eigentliche
Bedeutung verdankt T. aber dem Handel. 1887 belief sich der
Warenverkehr auf einen Gesamtwert von 665,2 Mill. Gulden, und zeigt
derselbe im Rückblick auf frühere Jahre eine ansehnliche,
stetige Entwickelung (1857: 280,3, 1867. 320,2, 1877: 448,3 Mill.
Guld.). Auf die Einfuhr kamen 1887: 342,1 (zur See 196,8, zu Land
145,3), auf die Ausfuhr 323,1 (zur See 175,5, zu Land 147,6) Mill.
Guld. Die Hauptartikel sind in der Einfuhr zur See: Kaffee (1887:
328,000 metr. Ztr.), Wein (306,000 metr. Ztr.),
Südfrüchte (650,000 metr. Ztr.), Getreide (548,000 metr.
Ztr.), Reis (110,000 metr. Ztr.), Olivenöl (96,000 metr.
Ztr.), Baumwollsamen-, Palm- und Kokosöl (79,000 metr. Ztr.),
Petroleum (294,000 metr. Ztr.), Baumwolle (617,000 Ztr.; von
Ostindien, Ägypten etc.), Valonen (175,000 Ztr.), Kolophonium
(102,000 Ztr.), Seesalz (104,000 metr. Ztr.), Steinkohlen (659,000
Ztr.), Roheisen und Eisenwaren (75,000 Ztr.), Faßdauben und
andre Holzwaren (1 Mill. Stück), Farbholz (50,000 Ztr.),
Indigo und andre Farb- und Gerbstoffe, Sämereien, Tabak, Hanf,
Jute, Häute und Felle, Gummiarten und Harze, Seefische,
Pfeffer und andre Gewürze, Schwefel, Maschinen etc. Die
Hauptgegenstände des Exports zur See, welcher vorzugsweise die
aus Österreich zugeführten Waren verfrachtet, zu einem
Teil aber auch auf dem Zwischenverkehr für die zur See
importierten Waren beruht, sind: Spiritus (83,500 metr. Ztr), Rum
(49,000 metr. Ztr.), Wein (215,000 Ztr.), Bier (112,000 Ztr.),
raffinierter Zucker (633,000 metr.Ztr.), Mehl (533,000 metr.Ztr.),
Papier (144,000 Ztr.), Baumwollwaren (31,000 Ztr.), Eisen u.
Eisenwaren (140,000 Ztr.), Holzwaren, als Faßdauben, Bretter
etc. (34 Mill. Stück), Glaswaren (57,000 Ztr.),
Zündhölzchen (55,000 Ztr.), Steinkohlen, Maschinen,
Kurzwaren, Juwelierarbeiten, Baumwolle, Schafwollwaren, Getreide
und Reis, verschiedene Früchte, Sämereien, Kaffee etc. Es
landeten 1887 in T. 8033 Schiffe mit 1,384,877 Ton. Gehalt (davon
3664 Dampfer mit 1,172,092 T.) und liefen aus 8128 Schiffe mit
1,393,524 T. Gehalt (darunter 3678 Dampfer mit 1,174,893 T.). Den
größten Anteil an diesem Schiffsverkehr haben
außer der österreichisch-ungarischen die britische und
italienische Flagge. Die wichtigsten Länder der Herkunft und
Bestimmung der ein- und ausgelaufenen Schiffe sind außer
Österreich-Ungarn: Italien, die Türkei,
Großbritannien, Ägypten, Frankreich, Ostindien,
Rußland (Schwarzes Meer), Griechenland und China. T. besitzt
zwei Häfen. Der alte, südöstliche ist eigentlich
eine offene Reede mit mehreren Steindämmen und Molen, als
deren größte der Molo San Carlo, auf dem Wrack eines
1737 hier versunkenen Kriegsschiffs erbaut, sodann die Molen Santa
Teresa mit dem 33 m hohen Leuchtturm auf der Spitze, Giuseppina,
Sartorio, Molo del Sale etc. zu nennen sind. Nordöstlich von
der Reede ist 1868-83 der neue Hafen angelegt worden. Derselbe
umfaßt vier Molen, je 95 m breit und 200-215 m lang, welche
durch zwischenliegende Kaistrecken verbunden sind, wonach die
Hafenanlage eine Ausdehnung von 1228 m erreicht; ferner einen
äußern Schutzdamm (Wellenbrecher) von 1088 m Länge.
Außerdem wurden in den Bassins des neuen Hafens eiserne
Anbindpfahlwerke, ferner an den Kais und Molen Eisenbahnanlagen und
Kräne sowie endlich Warenlagerhäuser hergestellt. T. ist
1719 zum Freihafen erklärt worden. Doch ist bereits bei
Abschluß des österreichisch-ungarischen Zoll- und
Handelsbündnisses von 1878 mit der Beseitigung der
Zollausschlüsse der Monarchie auch die Aufhebung des
Freihafenprivilegiums von T. prinzipiell ausgesprochen und nur
vorläufig noch für einige Jahre (bis 1891) aufgeschoben
worden. Die großartige Bedeutung als Seehandelsplatz dankt T.
übrigens nicht diesem Privilegium allein, sondern vor allem
seiner geographischen Lage am Nordende des tief ins Festland
einschneidenden Adriatischen Meers sowie dem Umstand, daß
sein offener Hafen für große Schiffe zugänglicher
ist als jener Venedigs. Ungünstig wirkt dagegen das T. gegen
die Landseite umgebende unwirtliche und den Verkehr mit den
Ländern des Donauthals hindernde Karstgebirge, wodurch sich
der Verbindung mit dem österreichischen, ungarischen und
deutschen Bahnnetz große Schwierigkeiten entgegenstellen. Von
T. läuft denn auch nur eine große Eisenbahnlinie
(Südbahn) aus, welche sich in Nabresina in die Linie nach
Wien, anderseits in die Linie über Cormons nach Italien teilt.
Außerdem führt eine Zweigbahn von T. nach Herpelje zur
Istrianer Staatsbahn; alle andern Projekte (Lacker Bahn, Predil-
und als Fortsetzung die Tauernbahn) scheitern an den technischen
Schwierigkeiten und den Kosten. Die Entwickelung des
österreichischen und ungarischen Eisenbahnnetzes hat daher dem
Handel Triests manchmal geradezu Abbruch gethan, wie insbesondere
die Linien nach Fiume und die Pontebbabahn. Dazu kommt die auch in
andrer Beziehung von der ungarischen Regierung wirksam
unterstützte Konkurrenz des Fiumaner Hafens sowie endlich
manche Mängel in den Triester Handelsverhältnissen
selbst. Infolge dieser Umstände ist trotz der Eröffnung
des Suezkanals und der dadurch erleichterten Verbindung mit
Ostindien, der Einrichtung von subventionierten Schiffahrtslinien
nach Bombay, Kalkutta, Singapur und Hongkong der Aufschwung im
Handels- und Schiffahrtsverkehr von T. in den letzten Jahrzehnten
hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Neuestens sind durch
Vervollständigung der Hafeneinrichtungen, Anlage großer
Lagerhäuser, Einführung von Differentialzöllen
(ermäßigte Zollsätze für die zur See
eingeführten Waren), Subventionierung neuer Schiffahrtslinien
des Lloyd (insbesondere nach Südamerika) Maßregeln zur
Belebung des Triester Hafen- und Handelsverkehrs ergriffen worden.
Unter den zahlreichen Instituten
841
Triester Holz - Trifolium.
und Vereinen für Verkehr, Kreditwesen und Industrie
behauptet den ersten Platz der 1836 errichtete Österreichische
(jetzt Österreichisch-Ungarische) Lloyd, der über eine
aktive Handelsflotte von 83 Dampfern verfügt. Andre Institute
sind: die Triester Kommerzialbank, die Volksbank, die
städtische Sparkasse, dann die Filialen der
Österreichisch-Ungarischen Bank, der Kreditanstalt, der
Unionbank u. a. T. ist der Sitz von vier Versicherungsanstalten,
darunter die weltbekannten Assicurazioni generali und Riunione
Adriatica di sicurtà. Es operieren hier außerdem 41
österreichisch-ungarische und ausländische
Versicherungsgesellschaften.
Von Wohlthätigkeitsanstalten sind hervorzuheben: das
städtische Krankenhaus samt Gebäranstalt und Siechenhaus,
in welchem bis 2000 Personen Unterkunft finden können, das
große Militärspital, das Irrenhaus, die Findelanstalt,
das Hauptarmeninstitut (mit 600 Betten für Pfründner und
arme Kinder), eine Verpflegungs- und Arbeitsanstalt für
verwahrloste Kinder u. a. Das Seelazarett befindet sich
außerhalb der Stadt in dem südlich bei Muggia gelegenen
Valle San Bartolommeo. An Unterrichtsanstalten besitzt die Stadt:
eine Handels- und nautische Akademie und eine Handelshochschule
(Stiftung Revoltella), 2 Obergymnasien und 2 Oberrealschulen (je
eine staatliche deutsche und eine städtische italienische
Anstalt), eine Staatsgewerbeschule, 2 gewerbliche Zeichenschulen,
eine Hebammenlehranstalt, eine zoologisch-zootomische
Übungsstation, ein städtisches Mädchenlyceum,
endlich 4 Bürger-, 35 öffentliche und 19
Privatvolksschulen. An Museen und andern Sammlungen befinden sich
in T.: ein naturhistorisches Museum (Ferdinando-Massimiliano),
welches unter anderm eine Fauna des Adriatischen Meers
enthält; ein städtisches Museum mit Altertümern,
insbesondere aus Aquileja, das Museo lapidario, gleichfalls mit
römischen Antiquitäten, einem Münzkabinett, alten
Manuskripten und dem 1823 errichteten Marmordenkmal Winckelmanns
(s. d.); eine städtische Bibliothek mit 65,000 Bänden
(worunter die kostbarste Sammlung von Petrarcas Werken), eine
öffentliche Studienbibliothek, ein hydrographisches Institut
der k. k. Kriegsmarine mit Sternwarte, ein Kunstmuseum im Palast
Revoltella und mehrere Privatgemäldesammlungen. In T.
erscheinen 29 Zeitungen (24 italienische, 2 deutsche, eine
griechische und 2 slowenische). - Die Stadt ist Sitz der
Statthalterei des Küstenlandes, des Stadtmagistrats, der
österreichischen Seebehörde, des Oberlandes- und
Landesgerichts, des Handels- und Seegerichts, des Hafen- und
Seesanitätskapitanats, der Finanz-, Post- und
Telegraphendirektion, eines Hauptzollamtes und einer Handels- und
Gewerbekammer. Der Bürgermeister von T. trägt den Titel
Podestà und ist zugleich Präsident des Landtags
(Landeshauptmann); der Triester Stadtrat (54 Mitglieder) fungiert
zugleich als Landtag. T. ist außerdem Sitz eines Bischofs,
eines k. k. Divisionskommandos, eines Seebezirkskommandos, einer
Polizeidirektion und zahlreicher Konsulate fremder Staaten
(darunter auch eines deutschen). Das Budget der Stadt T. belief
sich 1889 auf 3,363,000 Gulden Einnahmen und 3,431,000 Guld.
Ausgaben; die Schuld betrug 1887: 4,583,330 Guld., das
Vermögen von T. nach Abzug aller Passiva 5,242,344 Guld. T.
besitzt mehrere Seebadeanstalten. Für den Lokalverkehr sorgt
eine Pferdebahn (14 km Länge). Die Umgebung ist
terrassenförmig, mit prächtigen Villen besäet.
Über dem Boschetto befinden sich die aussichtsreichen Villen
Ferdinanda und Revoltella, hoch über T. an der
Poststraße das Dorf Optschina mit Obelisk und herrlichem
Überblick über Stadt und Meer, in der Mitte einer
schönen Eichenwaldung das k. k. Hofgestüt Lipizza. Am
nördlichen Meeresstrand liegen der Küstenort San Bartolo
(Barcola), mit Fabriken und Seebadeanstalt und weiter das
schöne Schloß Miramar (s. d.). Die Stadt wird von
mehreren Brunnen der Umgebung sowie durch eine Wasserleitung aus
dem Abhang des Gebirgszugs Santa Croce mit gutem Wasser versehen.
Das Wappen von T. s. auf Tafel "Österreichisch-Ungarische
Länderwappen".
T. (Tergeste) ward 178-177 v. Chr. mit Istrien dem
römischen Reich einverleibt und unter Augustus zu einer
römischen Kolonie gemacht. Im Mittelalter tritt es
zunächst als Bischofsstadt mit einem bedeutenden Territorium
(der römischen regio) hervor. Der Kommune gelang es im 13.
Jahrh., dem Bischof die wichtigsten Hoheitsrechte teils abzuringen,
teils abzulösen. Doch befand es sich, im wechselnden Kampf um
seine Selbständigkeit Venedig gegenüber, in einer
schwankenden Stellung zum Patriarchen von Aquileja als "Markgrafen
von Istrien" und zu dessen Vögten, den Grafen von Görz,
als "Grafen von Istrien". Nach dem großen venezianischen
Krieg von 1379 bis 1381 kam es 1382 an Österreich und blieb
fortan unter dessen Herrschaft, mit Ausnahme der Zeit von 1797 bis
1805, in der es die Franzosen besetzt hielten, und von 1809 bis
1813, in der es zu der illyrischen Provinz Frankreichs
gehörte, bis auf die Gegenwart. Die Stadt ward nun bald die
glückliche Rivalin Venedigs und, besonders seitdem Kaiser Karl
VI. sie zum Freihafen erklärt, die Beherrscherin des
Adriatischen Meers. 1818 ward sie nebst Gebiet dem deutschen
Bundesgebiet einverleibt. Durch kaiserliches Dekret vom 2. Okt.
1849 ward die Stadt nebst Gebiet zur reichsunmittelbaren Stadt
erhoben. Vgl. Mainati, Croniche ossia memorie stor.-sacro-prof. di
Trieste (Venedig 1817-18, 7 Bde.); Löwenthal, Geschichte der
Stadt T. (Triest 1857); Scussa, Storia cronografica di Trieste
(neue Aufl., das. 1885-86); della Croce, Storia di Trieste (das.
1879); Cavalli, Storia di Trieste (das. 1877); Neumann-Spallart,
Österreichs maritime Entwickelung und die Hebung von T.
(Stuttg. 1882); Scubitz, T. und seine Bedeutung für den
deutschen Handel (Leipz. 1881); die jährlichen Publikationen
der Triester Börsendeputation: "Navigazione di Trieste" und
"Commercio di Trieste"; "Führer durch T. und Umgebung" (2.
Aufl., Wien 1886).
Triester Holz, s. Celtis.
Triëterien (Mänadenfeste), s. Dionysos, S.
998.
Trieur (franz., spr. triör), s.
Getreidereinigungsmaschinen.
Trifels, Burgruine auf der Hardt in Rheinbayern,
südöstlich bei Annweiler, 494 m ü. M. Die Burg T.
war ehemals sehr bedeutend und ein Reichsgut, wo 1076 der gebannte
Kaiser Heinrich IV. Schutz fand, wo Heinrich V. den Erzbischof
Adalbert von Mainz und Heinrich VI. 1193-94 den König Richard
Löwenherz von England gefangen hielten, und wo die
Hohenstaufen ihre Schätze verwahrten. Nach dem
Dreißigjährigen Krieg verfiel die Burg.
Trifles (engl., spr. treifls, "Kleinigkeiten,
Spielereien"), in England beliebte Mischung von allerlei beliebig
zusammengestellten Leckereien, z. B. in Wein getränkter
Biskuits, in feinem Likör getränkter Makronen, Zitronat,
kandierter Orangenschalen, Obstmarmeladen, Gelees etc.; das Ganze
wird mit Creme bedeckt und dann mit Schlagsahne
übergossen.
Trifolium, s. Klee.
842
Triforium - Trigonometrie.
Triforium (lat.), eigentlich Drillingsbogen, eine in
gotischen Kirchen in der Dicke der Mittelschiffmauer
herumgeführte, auf Säulchen ruhende Galerie (s. Fig. a
b), die anfangs wirklich nach außen geöffnet,
später zu rein dekorativem Zweck auf die äußere
Mauerfläche aufgesetzt war.
Trift, der Weg für das Weidevieh; Triftgerechtigkeit
(Triftrecht), die einem Grundeigentümer zustehende Befugnis,
sein Vieh über fremde Grundstücke zu treiben, wobei aber
das Vieh sich nicht aufhalten darf, um zu fressen, wofern nicht mit
dem Triftrecht eine Weidegerechtigkeit (s. d.) verbunden ist.
Triftenfreund, s. Nemophila.
Triftlieschgras, s. Phleum.
Triga (lat.), Dreigespann.
Trigeminus, dreigeteilter Nerv, s. Gehirn, S. 2 f.
Triggiano (spr. tridschano), Stadt in der ital. Provinz
Bari, nahe südlich von Bari gelegen, mit Mandel-, Wein- und
Ölbau und (1881) 8217 Einw.
Trigla, Knurrhahn.
Triglaw, Berg, s. Terglou.
Triglaw (slaw.), Gott der Wenden, dreiköpfig
dargestellt, hatte die Herrschaft über Himmel, Erde und
Unterwelt. Ein schwarzes, ihm geweihtes Roß lenkte durch
seine Orakelzeichen jegliches Unternehmen. Tempel hatte er zu
Stettin, Wollin und Brandenburg a. H.
Triglyph (griech., Dreischlitz), Teil des Gebälkes
der dorischen Säulenordnung, welchen man als das Kopfende
eines über den Architrav gestreckten Balkens zu betrachten
hat, das mit drei lotrechten Vertiefungen (Schlitzen) versehen ist.
Die Triglyphen (s. Abbild. a) bilden einen Teil des Frieses, worin
sie mit den (b) Metopen (s. d.) abwechseln; s. Tafel
"Säulenordnungen", Fig. 1, 2 u. 3.
Trigon (griech.), Dreieck; trigonal, dreieckig.
Trigonalschein (Gedrittschein), s. Aspekten.
Trigonalzahlen (Triangularzahlen), Zahlen von der Form
1/2n(n+1), deren Einheiten man in Gestalt regelmäßiger
Dreiecke ordnen kann; vgl. Polygonalzahlen.
Trigondodekaëder (Pyramidentetraeder), von Dreiecken
eingeschlossene zwölfflächige Kristallgestalt, Hemieder
des tesseralen Trapezoeders; s. Kristall, S. 232.
Trigonella L. (Kuhhornklee, Käseklee), Gattung aus
der Familie der Papilionaceen, Kräuter mit fiederig
dreizähligen Blättern, einzelnen, in Köpfchen,
Dolden oder kurzen, dichten Trauben achselständigen, gelben,
bläulichen oder weißen Blüten und linealischen,
zusammengedrückten oder walzigen, geraden oder
sichelförmigen, mehrsamigen Hülsen. Etwa 70 Arten,
vorzüglich im Mittelmeergebiet. T. Foenum graecum L.
(Bockshornklee, griechisches Heu), einjährig, 30-50 cm hoch,
mit verkehrt-eiförmigen oder länglich-keilförmigen
Blättchen, einzeln oder zu zweien stehenden, blaßgelben
Blüten und 8-12 cm langen, kahlen, linealischen, schwach
sichelförmigen, längsgestreiften Hülsen, zwischen
dem Getreide im südlichen Europa, in Kleinasien und
Nordafrika, in Indien, auch in Europa der Samen halber kultiviert.
Diese schmecken widerlich bitter, riechen stark melilotenartig und
standen bei den Ägyptern, Griechen und Römern in hohem
Ansehen, sie wurden als Arzneimittel, Viehfutter, geröstet als
Speise benutzt, und auch Karl d. Gr. befahl den Anbau in
Deutschland. Jetzt dienen die Samen fast nur noch in der
Veterinärpraxis. Mit Milch zubereitet, genießen sie die
Frauen im Orient, um die in den Harems beliebte Wohlbeleibtheit zu
gewinnen. Das Stroh dient zu Pferdefutter.
Trigonia, s. Muscheln, S. 912.
Trigonoduskalk, s. Triasformation, S. 828.
Trigonometer, der mit der Triangulierung eines Landes
beauftragte Geodät.
Trigonometrie (griech., Dreiecksmessung), der auf die
Ähnlichkeitslehre sich gründende Teil der Geometrie,
welcher aus drei zur Bestimmung ausreichenden Stücken eines
Dreiecks die übrigen durch Rechnung finden lehrt. Das
Hilfsmittel hierzu bilden die goniometrischen (trigonometrischen)
Funktionen, welche den Zusammenhang zwischen geradlinigen Strecken
und Winkeln vermitteln. Um die Bedeutung dieser Funktionen zu
verstehen, denke man sich einen Winkel u durch Drehung eines
Schenkels um den Scheitel O entstanden; der Winkel sei dann positiv
oder negativ, je nachdem die Drehung der Bewegung eines Uhrzeigers
entgegengesetzt oder mit ihr gleichgerichtet ist; es ist also in
Fig. 1 der spitze Winkel AOP positiv, dagegen der spitze Winkel A O
S negativ, wenn der zuerst geschriebene Radius O A der
Anfangsschenkel ist. In dem Kreis (Fig. 1) sind zwei aufeinander
senkrechte Durchmesser gezogen, der horizontale A' A und der
vertikale B' B. Indem man von P die Senkrechten P C auf A' A u. P D
auf B' B fällt, erhält man die horizontale Projektion O C
und die vertikale O D des Radius O P, des Endschenkels des Winkels
u = A O P. Die horizontale Projektion wird positiv gerechnet, wenn
sie von O nach rechts, die vertikale, wenn sie nach oben liegt, bei
entgegengesetzter Lage sind sie negativ. Man versteht nun unter
Sinus von u, geschrieben sin u, die Vertikalprojektion des
Endschenkels, dividiert durch diesen selbst; unter Kosinus von u,
cos u, die Horizontalprojektion, dividiert durch den Endschenkel;
es ist also
sin u = O D / O P, cos u = O C / O P. [s. Bildansicht]
Dabei wird der im Nenner stehende Radius O P stets positiv
gerechnet, während den im Zähler stehen-
[Triforium.]
[Triglyphen (a) des dorischen Frieses.]
843
Trigynus - Triklinium.
den Projektionen ihr Vorzeichen zu erteilen ist. Ferner ist die
Tangente von u (tan u, tang u oder tg u) gleich dem Sinus,
dividiert durch den Kosinus, die Kotangente (cot u) gleich Eins,
dividiert durch Tangente, die Sekante (sec u) gleich Eins durch
Kosinus, die Kosekante (cosecu) gleich Eins durch Sinus. Die
früher üblichen Funktionen Kosinus versus (cos vers u = 1
- sin u) und Sinus versus (sin vers u = 1 - cos u) werden jetzt
kaum mehr benutzt. Aus Fig. 1 und den gegebenen Definitionen ist
ersichtlich, daß sämtliche goniometrische Funktionen
dieselben absoluten Werte, die sie für einen spitzen Winkel u
= A O P haben, auch für die Winkel 180° - u = A O Q,
180° + u = A O R und 360° - u = A O S haben. Das Vorzeichen
ist aber in den verschiedenen Quadranten verschieden nach dem
folgenden Schema:
0°-90° 90°-180° 180°-270°
270°-360°
sin + + - -
cos + - - +
tan + - + -
cot + - + -
sec + - - +
cosec + + - -
Man braucht sonach nur die Werte der trigonometrischen
Funktionen für die Winkel des ersten Quadranten zu kennen.
Diese Werte, gewöhnlicher die Logarithmen derselben, finden
sich in Tabellen zusammengestellt, die den Sammlungen
logarithmischer Tafeln (s. Logarithmus) einverleibt sind. Die
Untersuchung der Eigenschaften dieser goniometrischen Funktionen
ist Aufgabe der Goniometrie (s. d.). Im rechtwinkeligen Dreieck
(Fig. 2) kann man, mit dem Obigen sachlich übereinstimmend,
definieren den Sinus als die Gegenkathete des Winkels, dividiert
durch die Hypotenuse, Kosinus als anliegende Kathete durch die
Hypotenuse, Tangente als Gegenkathete durch anliegende:
sin alpha = a/c, cos alpha = b/c, tan alpha = a/b.
Diese drei Gleichungen, in Verbindung mit dem Pythagoreischen
Satz c² - a² + b² und der Formel beta = 90°
-alpha, genügen zur Berechnung der fehlenden Stücke eines
rechtwinkeligen Dreiecks. In einem schiefwinkeligen Dreieck mit den
Seiten a, b, c und den Gegenwinkeln alpha, beta, gamma (Fig. 3)
dienen zur Berechnung der fehlenden Stücke die zwei Formeln:
a² = b² + c² - 2bc.cos alpha und a sin beta = b sin
alpha nebst den vier andern, welche sich durch Vertauschung der
Buchstaben ergeben. Die erste Formel, eine Erweiterung des
Pythagoreischen Satzes, lehrt aus zwei Seiten u. dem
eingeschlossenen Winkel die dritte Seite (a aus b, c und alpha)
finden, aber auch den Winkel alpha aus den drei Seiten. Der
Unbequemlichkeit der Rechnung halber wendet man aber in beiden
Fällen häufig andre Formeln an. Die zweite Formel, der
Sinussatz (weil man schreiben kann a : b = sin alpha : sin beta, d.
h. zwei Seiten verhalten sich wie die Sinus der Gegenwinkel), dient
in Verbindung mit der Formel alpha + beta + gamma = 180° dann
zur Rechnung, wenn sich unter den bekannten Stücken zwei
gegenüberliegende befinden. Das hier Angedeutete bildet den
Inhalt der ebenen T., an die sich die Polygonometrie, die
Berechnung der Polygone, anschließt. Die sphärische T.
hat es mit der Berechnung sphärischer Dreiecke zu thun, die
durch Bogen größter Kreise auf einer Kugel gebildet
werden. Vgl. über ebene und sphärische T. Dienger,
Handbuch der T. (3. Aufl., Stuttg. 1867); Reuschle, Elemente der T.
(das. 1873). Da die Erde keine genaue Kugel, sondern ein
Sphäroid ist, so hat man unter dem Namen sphäroidische T.
eine Erweiterung der sphärischen T. ausgebildet, welche sich
mit den Dreiecken auf dem Sphäroid beschäftigt. Vgl.
Grunert, Elemente der ebenen, sphärischen und
sphäroidischen T. (Leipz. 1837). - Die Astronomen des
Altertums bestimmten die Winkel durch die Sehnen, die sie in einem
um den Scheitel beschriebenen Kreis umspannten; der syrische Prinz
Albategnius (Mohammed ben Geber al Batani, gest. 928) führte
zuerst die halben Sehnen der doppelten Winkel, d. h. die Sinus als
absolute Längen (nicht Quotienten), ein; auch rührt von
ihm die erste Idee der Tangenten her, die von Regiomontanus dauernd
eingeführt wurden. Die Auffassung der trigonometrischen
Funktionen als Verhältniszahlen datiert von Euler.
Trigynus (griech.), dreiweibig, Blüten mit drei
Pistillen; davon Trigynia, Ordnung im Linnéschen System,
Pflanzen mit drei Griffeln umfassend.
Trihemitonium (griech.), "anderthalb Töne", d. h.
die kleine Terz.
Trijodmethan, s. Jodoform.
Trikkala (türk. Tirhala), Hauptstadt des
gleichnamigen thessal. Nomos im Königreich Griechenland, der
auf 5700 qkm (103,5 QM.) 117,109 Einw. zählt, am Trikkalinos
(Zufluß des Salamvria), Sitz eines griechischen Erzbischofs,
hat ein noch jetzt benutztes byzantinisches Kastell, 10 griech.
Kirchen, 7 Moscheen, ein griech. Gymnasium, 2 Synagogen,
Färberei, Gerberei, Baumwollbau und (1883) 5563 griechische
und türk. Einwohner (im Winter, wenn die walachischen Hirten
der Umgebung dazu kommen, bedeutend mehr). Dabei die dürftigen
Ruinen der alten thessalischen Festung Trikke, welche den
ältesten und berühmtesten Asklepiostempel
besaß.
Triklines (triklinometrisches) Kristallsystem, s.
Kristall, S. 231.
Triklinium (lat.), bei den alten Römern das
gepolsterte Lager, auf dem man beim Essen lag. Es nahm drei Seiten
eines quadratischen Tisches ein (während die vierte für
die Bedienung frei blieb), und jede Seite desselben bot in der
Regel für drei Personen Raum (vgl. obenstehende Skizze). Jeder
der Plätze war mit einer Seitenlehne und einem Kissen
versehen, auf welches man sich mit dem linken Arm stützte,
während die Füße nach außen gerichtet waren.
Hinsichtlich der Reihenfolge der neun Plätze herrschte eine
strenge Etikette. Das mittelste Ruhe-
844
Trikolore - Triller.
bett (lectus medius) und das ihm zur Linken stehende oberste
(lectus summus) waren für die Gäste bestimmt und zwar das
erstere für die vornehmsten, das ihm zur Rechten stehende
unterste (lectus imus) für den Wirt und seine Familie. Als
gegen Ende der Republik Tische aus kostbarem Citrusholz mit runden
Platten aufkamen, wendete man ein halbkreisförmiges Ruhebett
an, das nach seiner Form Sigma oder auch Stibadium genannt wurde.
Ehrenplätze auf dem Sigma waren die Eckplätze. T.
heißt übrigens auch das Speisezimmer selbst, und die
vornehmen Römer der spätern Zeit hatten für die
verschiedenen Jahreszeiten mehrere solcher Zimmer (s. Tafel
"Baukunst VI", Fig. 4); in den Klöstern Saal zur Bewirtung der
Pilger.
Trikolore (franz.), "dreifarbige" Kokarde oder Fahne, wie
sie Frankreich, Belgien, Italien, Rußland, Deutschland etc.
haben, besonders aber die der Franzosen (rot, blau und weiß),
welche durch die erste Revolution eingeführt wurde (s. Fahne,
S. 1016, Kokarde und Nationalfarben).
Trikot (franz., spr. -koh), ursprünglich aus Seide,
Wolle oder Baumwolle gewirkte Beinkleider und Jacken für
Schauspieler etc.; dann auf dem Rundstuhl gefertigte, nach Art des
Tuches gewalkte und geschorne Gewebe, welche eine Art leichtes
Sommer- oder Damentuch bilden; endlich glatte, melierte oder
verschieden gemusterte, den Buckskins ähnliche wollene Gewebe,
welche aber elastischer als letztere sind.
Trikupis, 1) Spyridon, griech. Gelehrter und Staatsmann,
geb. 20. April 1788 zu Missolunghi, ward von dem damals in
Griechenland reisenden Lord North, nachmaligem Grafen Guilford, zur
Vervollkommnung seiner Kenntnisse nach Paris und London gesandt,
dann dessen Privatsekretär, als derselbe Gouverneur der
Jonischen Inseln wurde. Im griechischen Freiheitskampf bekleidete
er, mit Ausnahme der Zeit der Präsidentschaft Kapo d'Istrias',
die wichtigsten Posten in der Verwaltung und der Diplomatie. Er war
unter der Regentschaft Konseilpräsident, nachdem
Regierungsantritt des Königs Otto zu zwei verschiedenen Malen
(1835-38 und 1841-43) außerordentlicher Gesandter zu London,
nach der Revolution vom 15. Sept. 1843 Minister des
Auswärtigen und des öffentlichen Unterrichts, von 1844
bis 1849 Vizepräsident des Senats, außerordentlicher
Gesandter zu Paris während der Blockade der griechischen
Häfen durch die englische Flotte 1850 und dann zum drittenmal
in London. Während der Bewegungen in den 60er Jahren war er
wiederum verschiedene Male Mitglied der zahlreichen ephemeren
Ministerien. Er starb 24. Febr. 1873. T. genoß außerdem
eines großen Rufs als Schriftsteller und Redner. Eine
große Anzahl von ihm während der Revolution gehaltener
Reden, religiösen wie politischen Inhalts, wurde 1836 in Paris
herausgegeben. Auch als Dichter trat er auf und zwar mit einem
Kriegsgedicht auf die Klephthen: "[griech. Titel, s. Bildansicht]"
(Par. 1821). Sein Hauptwerk ist jedoch die Geschichte des
hellenischen Aufstandes ("[griech. Titel, s. Bildansicht]", Lond.
1853-57, 4 Bde.; 2. Aufl. 1862).
2) Charilaos, griech. Staatsmann, Sohn des vorigen, geb. 23.
Juli 1832 in Nauplia, studierte in Athen und Paris die Rechte, trat
1852 in den diplomatischen Dienst und schloß 1865 den Vertrag
mit England über die Abtretung der Jonischen Inseln ab. Als
Mitglied der Kammer schloß er sich der radikalen Partei an,
ward 1867 Minister des Auswärtigen und war 1875-76
Ministerpräsident, 1877 in dem Koalitionsministerium Kanaris'
Minister des Äußern und 1882-85 sowie seit 1886 wieder
Ministerpräsident. Seine Grundsätze wurden mit der Zeit
gemäßigter, und um die Regelung der Finanzen und die
Reform der Wehrkraft Griechenlands hat er sich hervorragende
Verdienste erworben.
Trikuspidalklappe, die dreizipfelige Herzklappe (s. Tafel
"Blutgefäße", Fig. 1), bedingt bei
Schlußunfähigkeit die Trikuspidalinsuffizienz.
Trilateral (lat.), dreiseitig.
Trilemma (griech.), Schlußform, s. Schluß, S.
544.
Trilinguisch (lat.), dreisprachig.
Triller, die bekannteste und häufigste der
musikalischen Verzierungen (s. d.), gefordert durch tr~~~ oder
einfach tr, auch t oder +, ist der den ganzen Wert der verzierten
Note ausfüllende wiederholte schnelle Wechsel der Hauptnote
mit der höhern Nachbarnote, wie sie die Vorzeichen ergeben;
doch darf niemals im Intervall der übermäßigen
Sekunde getrillert werden. Früher pflegte man den T. als mit
der Hilfsnote beginnend anzusehen: (Beispiel 1), doch ist seit etwa
Anfang unsers Jahrhunderts die Auffassung, daß die Hauptnote
beginnen müsse, allmählich die herrschende geworden (2).
Soll (in neuern Werken) der T. mit der Hilfsnote beginnen, so
muß diese noch besonders als Vorschlagsnote eingezeichnet
werden (3). Wird die untere Sekunde als Vorschlagsnote
vorgeschrieben, so entsteht der T. mit Vorschleife (4 u. 5), dessen
älteres Zeichen (noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts)
Beispiel 6 angibt, während Beispiel 7 dem T. mit Vorschleife
von oben entspricht. Auch der Nachschlag konnte durch eine
ähnliche Schleife am Schluß des Trillerzeichens
gefordert werden, u. es kommen daher auch T. mit beiden Schleifen
vor (8). Das einfache ~~~ ist das alte Zeichen des Trillers, wurde
aber häufig so ausgeführt, daß nur ein Teil des
Notenwerts aufgelöst wurde und dann die Note ausgehalten (s.
Pralltriller). Die Frage, wann dem T. ein Nachschlag als
Schluß beizugeben sei, ist das einzige Problem, welches der
T. bietet. In neuerer Zeit ist es üblich, den Nachschlag mit
kleinen Noten hinzuschreiben, wo er gewünscht wird (beim
längern T. fast ausnahmslos); auch bei neuen Ausgaben
älterer Werke findet man in Menge die Nachschläge
hinzugefügt, leider ist darin aber zweifellos von manchen
Editoren des Guten zu viel geschehen, z. B. von Moscheles bei
Mozart und Beethoven. Als Hausregel kann gelten, daß der
Nachschlag entbehrlich ist, besonders nach kürzern Trillern,
wenn von der Trillernote ein Sekundschritt abwärts geschieht,
Trillerketten erhalten gewöhnlich keine Nachschläge.
Wo
845
Triller - Trimurti
bei Bach und andern ältern Komponisten das Zeichen des
Trillers über der ersten Note eines punktierten Rhythmus
auftritt, darf nicht der ganze Notenwert aufgelöst werden,
sondern es wird dann nur ein paarmal schnell geschlagen und ohne
Nachschlag innegehalten, um den Rhythmus noch zur Geltung zu
bringen. Ein maßgebendes Gesetz für die Ausführung
aller Verzierungen ist, daß sie nicht die Rhythmik des
Stückes schädigen und verwischen dürfen; man thut
daher in vielen Fällen gut, eine Stelle erst ohne die
Verzierung zu spielen und dieselbe dann einzufügen. Eine
Aneinanderhängung mehrerer T. heißt Trillerkette
(Kettentriller). Steigt oder fällt die Trillerkette
sekundenweise, so erhalten die einzelnen T. gewöhnlich keine
Nachschläge, da der T. selbst als steigend und fortdauernd
angesehen wird; geradezu fehlerhaft ist der Nachschlag bei
chromatischer Veränderung des Trillers: Springende
Trillerketten dürfen Nachschläge erhalten, nur der eine
Oktave springende T. ist als Fortdauer desselben Trillers anzusehn,
d. h. erhält keinen Nachschlag.
Triller, s. Sächsischer Prinzenraub.
Trillhaus (Triller), ein hölzernes, vergittertes, an
einer horizontalen Welle befestigtes Häuschen, in welches
ehedem die wegen Polizeivergehen Verurteilten eingesperrt wurden,
um durch Herumdrehen desselben zu allerhand lächerlichen
Bewegungen und Übelkeit gebracht und dem öffentlichen
Spott preisgegeben zu werden.
Trilling (Drehling, Stockgetriebe), ein
größeres Getriebe, bei dem die Getriebstöcke
zwischen zwei hölzernen Scheiben (Trillingsscheiben) befestigt
sind.
Trillion, die dritte Potenz einer Million, geschrieben 1
mit 18 Nullen; vgl. Zahlensystem.
Trillo, Flecken in der span. Provinz Guadalajara, am
Tajo, mit (1878) 782 Einw. und besuchtem Mineralbad.
Trilobiten (Trilobitae), Gruppe völlig
ausgestorbener und nur den ältesten geologischen Schichten
angehöriger Tiere, die man früher allgemein zu den
Krebsen rechnete, neuerdings jedoch getrennt von ihnen behandelt.
Sie besaßen (vgl. die Abbildungen von Calymene,
Ellipsocephalus, Trinucleus, Paradoxides und Arges auf den Tafeln
"Silurische" und "Devonische Formation") einen durch zwei
Längsfurchen dreiteiligen Körper, der aus vielen Ringen
zusammengesetzt war und sich bei manchen Arten igelartig
zusammrollen konnte. Am ersten Ring, dem Kopf, saßen meist
zwei große Augen. Vielfach waren an Kopf und Rumpf lange
Stacheln vorhanden. Wichtig ist der Umstand, daß man
früher fast nie auch nur Spuren von Beinen gefunden hat; diese
müssen also im Vergleich zum Körper sehr weichhäutig
gewesen sein. Erst in der neuesten Zeit gelang es, durch Reihen von
mühsam hergestellten Schliffen durch T. zu ermitteln,
daß um den Mund herum 4 Paar Kaufüße und an jedem
Ring der Brust und des Hinterleibes ein Paar Gehbeine mit Kiemen
saßen. Vgl. Brongniart, Histoire naturelle des
crustacés fossiles, savoir Trilobites (Par. 1822);
Burmeister, Die Organisation der T. (Berl. 1843); Beyrich,
Untersuchungen über T. (das. 1845-46); Barrande,
Système silurien. Bd. 1 (Prag 1852); Salter, Monograph of
British Trilobites (Lond. 1864-66); Walcott, The Trilobite
(Cambridge, Mass., 1881).
Trilogie (griech.), bei den Griechen die Verbindung je
dreier Tragödien, mit denen an den Dionysosfesten die
dramatischen Dichter miteinander um die ausgesetzten Preise
kämpften. Gewöhnlich schloß sich diesen
Tragödien noch ein Satyrspiel an, und diese Verbindung
hieß dann eine Tetralogie. Am meisten bildete Äschylos
die T. aus, indem er entweder ausgedehntere Mythenstoffe in drei
miteinander in inniger Verbindung stehenden Dramen behandelte oder
drei an sich nicht zusammenhängende Stoffe wenigstens durch
eine gemeinsame symbolische Beziehung miteinander verknüpfte.
Unter den erhaltenen Stücken von ihm befindet sich eine
vollständige T., die "Orestie", bestehend aus "Agamemnon", den
"Choephoren" und "Eumeniden", welchen sich in stofflichem
Zusammenhang das nicht mehr vorhandene Satyrdrama "Proteus"
anschloß. Von Neuern haben Schiller ("Wallenstein"), Hebbel
("Die Nibelungen"), Swinburne ("Mary Stuart") u. a. Trilogien
gedichtet. Auch R. Wagners "Ring des Nibelungen" will als T. (mit
einem Vorspiel) angesehen sein.
Trim, Hauptstadt der irischen Grafschaft Meath, am Boyne,
mit Gerichtshof, Denksäule Wellingtons, Lateinschule, einem
merkwürdigen anglonormännischen Turm und (1881) 1586
Einw. Südlich dabei Laracor, wo Swift und Stella wohnten.
Trimalchio, bei Petronius ein ganz dem Wohlleben
hingegebener Greis, allgemeiner s. v. w. dreifacher Weichling.
Trimberg, s. Hugo von Trimberg.
Trimester (lat.), Zeit von drei Monaten.
Trimeter (griech., lat. Senarius,
"Sechsfüßler"), das gewöhnliche Versmaß der
griech. Dramatiker, bestehend aus drei Metren oder Doppeliamben
(Dipodien), mit einer Cäsur, die, gewöhnlich nach der
fünften, seltener nach der siebenten Silbe eintretend, den
Vers in zwei ungleiche Hälften teilt. Im ersten, dritten und
fünften Fuß oder zu Anfang jeder Dipodie kann statt des
Jambus auch ein Spondeus stehen, so daß folgendes Schema
entsteht [s. Bildansicht]:
Bewundert viel und | viel gescholten, Helena.
Der T. zeichnet sich durch Ernst und feierlichen Gang aus, der
durch die erlaubten Spondeen noch würdevoller gemacht wird.
Die Komödiendichter behandeln ihn übrigens viel freier
als die Tragiker, namentlich geben sie ihm durch Einführung
von Anapästen an Stelle der Spondeen einen leichtern
Charakter. Von unsern Dichtern haben den T. Goethe in der "Helena",
Schiller in einigen Szenen der "Jungfrau", Platen in seinen
Litteraturkomödien in Anwendung gebracht. Die Versuche andrer,
wie Minckwitz, Märcker etc., ihn für große
Tragödien zu verwenden, sind als mißlungen zu
bezeichnen.
Trimethylamin, s. Methylamine.
Trimm, Timothée, Pseudonym, s. Lespès.
Trimmen (engl., auch trümmen), die nicht in
Stückgütern bestehende Schiffsladung (Getreide, Kohlen
etc.) eben schaufeln, um sie im Schiffsraum angemessen zu
verteilen. Das Schiff ist in gutem Trimm, wenn es gerade tief genug
geladen, weder zu viel noch zu wenig achterlastig ist.
Trimorphismus (griech.), Dreigestaltung, s.
Heteromorphismus.
Trimurti, im Religionssystem des neuern Brahmanismus die
Vereinigung der bis dahin ziemlich unvermittelt nebeneinander
stehenden drei großen Götter Brahma als des
Schöpfers, Wischnu als des Erhalters, Siwa als des
Zerstörers, ausgegangen von dem Bestreben, die verschiedenen
Religionsele-
846
Trinakria - Trinität.
mente gegen den Buddhismus und andre feindliche Strömungen
zu verbinden. Verehrt wird die T. in einem dreiköpfigen Bild
aus einem Stein, das vorn den Brahma mit dem Almosentopf und dem
Rosenkranz, rechts den Wischnu u. links den Siwa darstellt.
Trinakria (Thrinakia), altertümlicher und poetischer
Name der Insel Sizilien wegen ihrer dreieckigen Gestalt.
Tring, Stadt im westlichen Hertfordshire (England), hat
Strohhut- und Stuhlfabriken, einen Park mit Schloß, welches
Karl II. seiner Mätresse Nell Gwynne schenkte, und (1881) 4354
Einw.
Tringa, Strandläufer (Vogel).
Trinidad, 1) britisch-westind. Insel, die südlichste
und größte der Kleinen Antillen, an der östlichen
Nordküste von Venezuela vor der Mündung des Orinoko
gelegen. Die Insel wird von O. nach W. von drei parallelen
Bergketten durchkreuzt, von denen die nördliche im Cerro de
Aripo 945 m Höhe erreicht, und zwischen denen zwei von Meer zu
Meer reichende Ebenen liegen. Flüsse und auch Sümpfe sind
zahlreich. Bei Brea liegt der merkwürdige Asphaltsee (Pitch
Lake), und Schlammvulkane sind bei der Südwestspitze
vorhanden. In seiner Pflanzen- und Tierwelt gehört T. eher zum
nahen Kontinent als zu den Antillen. Palmen und Zedern bedecken
große Strecken. Von Tieren sind Affen, Tigerkatzen,
Ameisenbären, ferner Hirsche, wilde Schweine, Gürteltiere
und Beuteltiere, dann Schlangen, Alligatoren und Schildkröten
zu nennen. Das Klima kennt eine trockne Jahreszeit, die von
Dezember bis Mai anhält. Die mittlere Temperatur von Port of
Spain ist 25,5° C., und es fallen 1950 mm Regen. Stürme
wüten im Oktober fast täglich. T. hat ein Areal von 4518
qkm (82,5 QM.) und (1887) 183,486 Einw. (1871: 109,638). Nur 40,500
Hektar sind angebaut. Hauptprodukt ist Zucker, und außerdem
werden Kaffee, Kakao und Baumwolle gebaut und Kokospalmen sowie
Nahrungspflanzen gezogen. Die Viehzucht ist ohne Bedeutung. Den
Verkehr vermitteln (1887) 88 km Eisenbahnen. Die günstige Lage
in der Nähe der Orinokomündung ist dem Handel
förderlich. Der Wert der Ausfuhr war 1887: 1,870,612 Pfd.
Sterl., diejenige der Einfuhr 1,918,670 Pfd. Sterl. T. erfreut sich
seither keiner repräsentativen Verfassung. Seine Revenüe
ist (1887) 456,167 Pfd. Sterl. bei einer Schuldenlast von 562,440
Pfd. Sterl., großenteils durch Einführung von Kulis
entstanden. Hauptstadt ist Port of Spain (31,858 Einw.) an der
Westküste. Geräte, Vasen und Glaspasten, welche man auf
T. findet, machen es wahrscheinlich, daß die Insel in der
Vorzeit eine weit zivilisiertere Bevölkerung gehabt habe, als
die Kariben waren, die man bei der Entdeckung der Insel vorfand. T.
wurde von Kolumbus 31. Juli 1496 entdeckt, aber die Spanier nahmen
erst 1588 Besitz von der Insel. Später siedelten sich
Franzosen unter spanischer Hoheit auf T. an und brachten den
Plantagenbau zu hoher Blüte. Endlich 1797 wurde die Insel fast
ohne Schwertstreich eine britische Kolonie. Die 1838 verfügte
Emanzipation sämtlicher Negersklaven der Insel (über
20,000) hatte den Verfall der Bodenkultur und Zuckerproduktion im
Gefolge. In neuerer Zeit hat sich dieselbe durch Herbeiziehung von
Kulis aus Ostindien wieder sehr gehoben. S. Karte "Antillen". Vgl.
Borde, Histoire de l'ile de la T. sous le gouvernement espagnol
(Par. 1876-1883, 2 Bde.); Wall u. Sawkins, Geological survey of T.
(Lond. 1860); Clark, T., a field for emigration (Port of Spain
1886); Collens, Guide to T. (2. Aufl. 1889). - 2) (T. de Cuba,
Maritima de T.) Stadt auf der Südküste der Insel Cuba,
inmitten von Palmenhainen, an der Casildabai, 1514 gegründet,
hat 2 höhere Schulen, lebhafte Ausfuhr von Zucker und
Hölzern und (1877) 27,654 Einw. T. ist Sitz eines deutschen
Konsuls. - 3) (T. de Mojos) Hauptstadt des Departements Beni in der
südamerikan. Republik Bolivia, 1687 von den Jesuiten im Lande
der Mojosindianer gegründet, 10 km nördlich von Rio
Mamoré entfernt, mit (1882) 4535 Einw.
Trinitapoli (früher Casaltrinita), Stadt in der
ital. Provinz Foggia, an der Eisenbahn Ancona-Brindisi und am Lago
di Salpi, mit (1881) 7789 Einw. Von hier bis nach Barletta
erstrecken sich Lagunen, welche zur Seesalzgewinnung ausgebeutet
werden.
Trinitarierorden (Dreifaltigkeitsorden, regulierte
Chorherren, Ordo S. Trinitatis de redemptione captivorum), Orden,
gestiftet 1198 von Johannes von Matha und Felix von Valois, zwei
Einsiedlern in der Diözese Meaux, und von dem Papst Innocenz
III. 1198 bestätigt, setzte sich die Loskaufung gefangener
Christensklaven von den Sarazenen zum Zweck und fand von seinem
Mutterhaus Cerfroy (Aisne) aus schnell Verbreitung, vorzüglich
in Südeuropa. Ein Nachlassen in der Strenge des Wandels
führte einige Reformen des Ordens herbei; namentlich
entstanden in Spanien 1596 die Trinitarier-Barfüßer. Die
Mönche trugen weiße Kleider mit einem roten und blauen
Kreuz auf der Brust. Weil sie nur auf Eseln reisten, ward der Orden
vom Volk Eselsorden (ordo asinorum), die Mitglieder
Eselsbrüder genannt. Mathuriner hießen die Trinitarier
in Frankreich von einer Kapelle in Paris, die dem heil. Mathurin
geweiht war. Zu gleichem Zweck und unter gleicher Regel schlossen
sich dem Orden 1201 regulierte Chorfrauen (Trinitarierinnen) an
sowie Trinitarier-Tertiarier und die Brüderschaft zum
Skapulier der heiligen Dreieinigkeit, die 1584 reguliert wurden.
Der Orden ist jetzt erloschen, nachdem er angeblich 900,000
Gefangene losgekauft hat. Vgl. Gmelin, Die Trinitarier in
Österreich (Wien 1871).
Trinität (Trias, Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit),
nach der christlichen Kirchenlehre die Beschaffenheit des
göttlichen Wesens, wonach dasselbe unbeschadet seiner Einheit
drei Personen, Vater, Sohn und Heiligen Geist, in sich begreift.
Die Lehre von der T., die besonders auf die Taufformel Matth. 28,
19 und auf die unechte Stelle 1. Joh. 5, 7 basiert ward, bildete
sich als charakteristisch für das Christentum (s. d.) im
Verlauf von drei Jahrhunderten zu derjenigen dogmatischen Fixierung
aus, in welcher sie seitdem in den öffentlichen
Bekenntnisschriften aller christlichen Kirchen, die unitarischen
ausgenommen, auftritt. Und zwar wurde zunächst auf den beiden
großen Synoden von 325 und 381 (s. Arianischer Streit und
Nicänisch-konstantinopolitanisches Glaubensbekenntnis) die
volle Gottheit des Sohns und Geistes festgestellt, ihr
persönliches Verhältnis zum Vater aber sowie ihre Einheit
in der T. vornehmlich durch Meletius, Gregor von Nazianz, Gregor
von Nyssa und Basilius formuliert. Im Abendland siegte durch das
sogen. Athanasianische Bekenntnis die eigentümlich
symmetrische, von Augustin herrührende Form des Dogmas,
während im Morgenland doch immer der Vater eigentlicher Gott,
"Anfang und Quelle der Gottheit", blieb, von welchem auf der einen
Seite der Sohn erzeugt wird, auf der andern der Geist ausgeht: ein
Rest des Paulinischen Subordinatianismus (s. Christologie). Die
Lehre von der T. ging ohne alle weitere Durchbildung samt
847
Trinitatisfest - Trinkgelage.
dem abendländischen Filioque (s. Heiliger Geist) in die
evangelische Kirche über, ja es ward der scholastische
Lehrbegriff von den altprotestantischen Dogmatikern nur noch
systematischer durchgeführt. Vgl. Baur, Die christliche Lehre
von der Dreieinigkeit (Tübing. 1841-43, 3 Bde.); Meier, Die
Lehre von der T. (Hamb. u. Gotha 1844, 2 Bde.).
Trinitatisfest (Festum trinitatis), Fest zur besondern
Verehrung der göttlichen Dreieinigkeit, wurde im 11. Jahrh.
zuerst in den Klöstern gefeiert, auf der Synode von Arles 1260
in Frankreich eingeführt und vom Papst Johann XXII. 1334 zu
einem allgemeinen Kirchenfest erhoben. Es fällt auf den ersten
Sonntag nach Pfingsten; die darauf folgenden Sonntage bis zum Ende
des Kirchenjahrs heißen Trinitatissonntage. Die griechische
Kirche begeht das T. an einem der beiden Pfingstfeiertage.
Trinitrin, s. Nitroglycerin.
Trinitrokarbolsäure, s. Pikrinsäure.
Trinitrophenyl, s. Pikrinsäure.
Trinity House (spr. trinniti haus'), "Haus der
Dreieinigkeit", eigentlich "Korporation der ältern Brüder
der heiligen und ungeteilten Dreieinigkeit", eine bereits 1518 in
England geschaffene Behörde, welche mit der Anlage und
Unterhaltung von Leuchtfeuern, Land- und Seemarken beauftragt ist
und das Lotsenwesen leitet. Ihr Sitz ist Trinity House beim Tower
von London. Nur Seeleute werden als "jüngere" Brüder
zugelassen. Die "ältern" Brüder ergänzen sich aus
ihnen. An der Spitze steht ein "Master".
Trinityland, s. Südpolarländer.
Trinity River, Fluß im nordamerikan. Staat Texas,
entspringt im N. desselben, ist wasserreich und mündet nach
530 km langem Lauf in die Galvestonbai. Er ist 300 km weit
schiffbar.
Trinkerasyle, s. Trunksucht.
Trinkgefäße, aus Metall, Thon, Glas und andern
Materialien hergestellte Gefäße, deren Grundformen der
tiefe Napf, die flachere Schale und der cylindrische Becher sind.
Wie noch heute bei den Naturvölkern ausgehöhlte
Kürbis- oder Melonenschalen, Kokosnüsse u. dgl. als T.
dienen, so wird auch bei den Urvölkern der aus ähnlichen
Stoffen hergestellte Napf das erste Trinkgefäß gewesen
sein, der bei wachsender Kultur dann aus Thonerde geformt und
gebrannt wurde, und aus welchem durch Hinzufügung eines
Fußes die Schale entstand. Schale und Becher sind die T. in
den Homerischen Gedichten. Zu einem Trinkgefäß
(Trinkschädel) hergerichtete Menschenschädel werden in
prähistorischen Fundstätten hier und da angetroffen
(Byciskálahöhle in Mähren). Die Sitte, aus den
Schädeln der Feinde zu trinken, war im Altertum bei vielen
Völkern (Kelten, Bojern und Skordiskern) verbreitet. Auch die
Schädel der christlichen Märtyrer und Heiligen wurden in
frühmittelalterlicher Zeit in Kirchen und Klöstern
sorgfältig aufbewahrt und vielfach als T. benutzt. In dem
Maß, als sich die Thonbildnerei und die Metallotechnik der
Griechen entwickelten, nahmen die T. die mannigfaltigsten Formen
an. Kantharos, Kylix und Phiale sind die Hauptnamen für Becher
und Schalen zum Trinken (s. die einzelnen Artikel, vgl. auch
Keramik und Vasen). Die Römer trieben einen besondern Luxus in
Trinkgefäßen aus Edelmetall und Kristall. Silberne
Becher aus römischer Zeit haben sich noch erhalten (s.
Hildesheimer Silberfund). Im Mittelalter entwickelte sich aus dem
Abendmahlskelch als bevorzugtes Trinkgefäß bei
feierlichen Gelegenheiten der Pokal, ein auf einen mehr oder minder
hohen, gegliederten Fuß gestellter Becher mit und ohne
Deckel, während im gewöhnlichen Gebrauch Humpen, Krug,
Kanne und Becher die üblichen T. waren. Die Ausbildung der
Glasindustrie brachte neue Formen der T. auf, welche man unter dem
allgemeinen Namen Gläser begreift. Die Formen wurden
später durch die Flüssigkeit bedingt, für welche die
T. bestimmt waren. Näheres über die Formen der
verschiedenen T. findet man in den einzelnen Artikeln: Humpen,
Paßglas, Pokal, Römer, Stengelgläser, Trinkhorn,
Willkomm etc.
Trinkgelage, festliche Vereinigung zum Zweck des Genusses
geistiger Getränke. Bei den Griechen begann das T. (Symposion)
nach der Beendigung des eigentlichen Festmahls (s. Gastmahl), wenn
der Nachtisch aufgetragen und dem guten Geist ein Trankopfer
dargebracht worden war. Gäste, welche an dem T. nicht
teilnehmen wollten, waren berechtigt, sich beim Auftragen des
Desserts zu entfernen. Getrunken wurde nur mit kaltem oder warmem
Wasser gemischter Wein; das kalte Getränk wurde noch mit
Schnee gekühlt. Die Mischung selbst geschah im
Mischgefäß (krater), gewöhnlich im Verhältnis
von 3 Teilen Wasser zu einem Teil Wein, höchstens von 3 Teilen
Wasser zu 2 Teilen Wein; aus dem Krater wurde dann das Getränk
mit dem Schöpfer (oinochoe) in die Becher gefüllt. Man
trank rote, weiße und gelbe Weine und mischte diese Sorten
miteinander, namentlich magere, aber boukettreiche Weine mit
fetten, auch wurden Würzen oder Honig oder sogar
Wohlgerüche zugesetzt. Auch Obstweine wurden genossen. Die
Leitung des Gelages übernahm ein von der Gesellschaft
gewählter oder durch das Los (bez. Würfel) bestimmter
Vorsteher (Symposiarch, basileus, archon tes poseos). Dieser setzte
das Mischungsverhältnis fest, bestimmte die Zahl der den
Trinkern zu verabreichenden Becher, die Regel, nach denen getrunken
werden mußte, und legte bei Zuwiderhandlungen gegen diese
Regeln Strafen auf, die gewöhnlich darin bestanden, daß
ein Becher in einem Zuge geleert werden mußte. Wenn es auf
starkes Trinken angelegt wurde (pinein pros bion), mußten
tüchtige Quantitäten geschluckt werden. Auch das
Zutrinken zur Rechten um den Tisch herum (epi dexia) und das
Vortrinken von Person zu Person waren Sitte. Nicht minder
mußte Strafe trinken, wer die vom Symposiarchen gestellten,
oft scherzhaften Aufgaben, scherzhaften Rätsel und Fragen oder
allerlei schwer ausführbare Kunststückchen nicht
löste. Bei diesen Gelagen herrschte große
Ungezwungenheit des Tons und geistreiche, witzige Unterhaltung. Zur
Erhöhung des Genusses traten Flöten- und
Zitherspielerinnen (Kitharistinnen) auf, jugendliche Sklaven
produzierten mimische Darstellungen, und selbst Gaukler und
Gauklerinnen wurden herbeigezogen. Wer im Wettkampf das Feld
behauptete, erhielt zur Belohnung einen Kuchen; die Eingeschlafenen
wurden verhöhnt und mit Wein begossen. In Rom wurde die
Abhaltung besonderer T., welche sich ebenfalls an die Hauptmahlzeit
(coena) anzuschließen pflegten, erst allgemeiner, als die
Römer griechische Sitten angenommen hatten. Auch hier wurde
das Trinken systematisch betrieben, und man hielt sich ziemlich
streng an das griechische Vorbild. Eine besondere Sitte bildete das
ad numerum bibere, wobei man so viele Becher leerte, als der Name
des zu Feiernden Buchstaben enthielt, oder so viele Lebensjahre man
ihm wünschte. Das in der Runde Trinken (circumpotatio) artete
namentlich bei den Leichenschmäusen derartig aus, daß
dieser althergebrachte Brauch durch besondere Gesetze der Dezemvirn
ver-
848
Trinkgeld - Trinkhorn.
boten wurde. Während des Gelages spendete man den
Göttern zahlreiche Libationen. Um den Durst zu reizen, wurden
pikante Leckerbissen serviert (bellaria). Eigentümliche T.
finden im Orient, namentlich in der Türkei, statt und zwar vor
dem Abendessen bei Gelegenheit des Servierens eines
appetitreizenden Imbisses (Tschakmak-Zechen). Man trinkt nur
Branntwein (Raki oder Mastika), erst mit Wasser verdünnt, nach
und nach aber immer ungemischter, und diese mit dem unschuldigen
Titel eines Imbisses belegten Gelage werden oft stundenlang
fortgesetzt und arten schließlich zu wüsten Saufereien
aus. Die schiitischen Perser huldigen aber dem Wein. Ein Zechgelage
in Persien führt den anspruchslosen Namen einer Bewirtung
(mihmani), wird im Enderun (Harem) abgehalten und zwar nach dem
Nachtmahl. Die persische Trinketikette ist sehr lax, sie
beschränkt sich im wesentlichen darauf, daß der Trinker
sich hüten muß, den Bart beim Trinken zu benetzen sowie
Kleider und Fußboden mit vergossenem Wein zu verunreinigen.
Diese Gelage arten zu wahren Orgien aus; sie werden in
öffentlichen Gärten, ja sogar auf den Friedhöfen
arrangiert. Indes beteiligen sich an solchen Festen nur die Spitzen
der Gesellschaft. Bei den Deutschen finden wir schon aus den
ältesten Zeiten Nachrichten über T. Dieselben hatten
zugleich eine religiöse Grundlage: die Seligkeit in Walhalla
bestand vornehmlich in der Teilnahme an den ewigen
Göttergelagen, bei denen die Helden Met und nur Odin Wein
zechten. An Stoff konnte es nie fehlen, denn die
unerschöpfliche Ziege des Heidrun füllte stets die Schale
mit schäumendem Met. Auf Erden wurden zu Ehren der Götter
mancherlei Trinkfeste veranstaltet, den Göttern selbst wurden
reichliche Libationen ausgebracht, anfänglich von Met,
später von Wein. So oft der Priester opferte, goß er ein
Horn zu den Füßen des Götzen aus, füllte es
wieder und trank es ihm zu. In den Tempeln wurden die Becher in
folgender Ordnung geleert: der erste zu Ehren Odins, der zweite zu
Ehren Thors und der Freyja, der dritte zum Gedächtnis
berühmter Helden (Bragakelch) und der vierte zum Andenken
abgeschiedener Freunde (Minnebecher). So wurde das Trinken und das
Abhalten von förmlichen Trinkfesten zur eigentlichen
Volkssitte. Schon zu Anfang des 6. Jahrhunderts war sie ganz
allgemein. "Sänger sangen Lieder und spielten die Harfe dazu;
umher saßen Zuhörer bei ehernen Bechern und tranken wie
Rasende Gesundheiten um die Wette. Wer nicht mitmachte, ward
für einen Thoren gehalten. Man muß sich glücklich
preisen, nach solchem Trinken noch zu leben." So erzählt der
römische Schriftsteller Venantius Fortunatus. In
gefüllten Bechern brachte man sich die durch die Sitte
vorgeschriebenen Höflichkeiten dar: Willkommen, Valettrunk,
Ehrentrunk, Rund-, Kundschafts- und Freundschaftstrunk. Hieran
schloß sich das nach ganz bestimmten Regeln geordnete Zu- und
Vortrinken, das Wett- und Gesundheittrinken (s. d.). So pflanzte
sich die Sitte festlicher T. bis zum Mittelalter fort; sie wurden
abgehalten in den Burgen der Ritter, in den Festsälen der
Städte, an den Höfen der Fürsten und selbst auch in
den Refektorien der Klöster. Über das Trinken bestanden
ganz bestimmte durch Trinkordnungen festgestellte Gesetze, z. B.
die Hoftrinkordnung des sächsischen Kurfürsten Christian
II. Die Chroniken des 15. und 16. Jahrh. berichten über die
mit größter Verschwendung und Pracht gefeierten
Trinkfeste an den Höfen unglaubliche Dinge; der Wein wurde in
großen Massen getrunken, und am Schluß des Gelages
pflegte die Trunkenheit eine allgemeine zu sein. Besonders
berühmt sind die Zechgelage am Hof Augusts des Starken, wo die
sächsischen Kavaliere die Aufgabe hatten, ihre polnischen
Standesgenossen unter den Tisch zu trinken. Eine besondere Abart
bildeten die studentischen Zechgelage; besonders die
Universität Tübingen war durch Handhabung von Trinkregeln
berühmt. Ein wahrhaft vorzügliches Gemälde eines
Studentengelages jener Zeit gibt Michael Moscherosch in seinen
"Wunderlichen und wahrhaften Gesichten Philanders von Sittewalt".
Ebenso gibt Hans Sachs in seinem Gedicht "Wer erstlich hat erfunden
das Bier" eine drastische Beschreibung eines Saufgelages. In der
Gegenwart werden eigentliche T., d. h. Festversammlungen, bei denen
das Trinken Alleinzweck ist, nicht mehr abgehalten. Nur der
studentische Kommers gehört in diese Kategorie. Freilich
greift die Sitte, Kommerse abzuhalten, mehr und mehr auch in andre,
nicht studentische Kreise. Im gewissen Sinn kann man die englische
Sitte, daß die Damen nach dem Diner den Tisch verlassen,
während die Herren zum fröhlichen und starken Zechen
beisammen bleiben, als die Abhaltung von Trinkgelagen bezeichnen.
Vgl. Schultz, Geschichte des Weins und der T. (Berl. 1868);
Samuelson, History of drink (2. Aufl., Lond. 1880); Rogers, Drinks,
drinkers and drinking (Albany 1881).
Trinkgeld, die Extravergütung, welche für
Dienstleistungen insbesondere an Kellner, Dienstboten, Kutscher
etc. gezahlt wird. Ursprünglich wohl zu einem dem Wortsinn
entsprechenden Zweck gegeben, hat das T. heute vielfach die
Bedeutung einer vollständigen Bezahlung für die
Dienstleistung angenommen. Infolgedessen kommt es sogar vor,
daß Leute, welche Trinkgelder empfangen, wie Kellner,
Hausknechte, Portiers etc., für ihre Stellen eine Art Pacht
entrichten. Mit übler Nebenbedeutung wird das Wort T. auch
für Bezahlungen angewandt, welche aus Gründen der Moral
nicht angeboten und angenommen werden sollten. Das Wort hat sich
auch in der französischen Sprache eingebürgert. In
neuerer Zeit wurde mehrfach gegen die sich immer weiter
verbreitende Sitte, Trinkgelder zu geben, oder gegen das
Trinkgelderunwesen angekämpft. Vgl. Jhering, Das T. (3. Aufl.,
Braunschw. 1888).
Trinkhorn, ein schon im Altertum gebräuchliches
Trinkgefäß, welches ursprünglich aus
Tierhörnern angefertigt, von den Griechen aber, wie das
Rhython, dessen Mündung von einem Tierkopf gebildet wurde
(vgl. Abbild.), zur Zeit verfeinerter Kultur in Thon und Metall
nachgebildet wurde. Die alten Germanen tranken aus
Tierhörnern, u. diese wurden im gotischen Mittelalter
Gegenstand künstlerischer Verzierung, indem sie in Metall,
vornehmlich in vergoldetes Silber, gefaßt und mit einem
Fuß oder gar mit einem architektonischen Unterbau versehen
wurden. Neben Tierhörnern wurden auch ausgehöhlte
Elefantenzähne, später Rhinozeros- und Narwalzähne
benutzt, welche entweder nur poliert, oder mit Schnitzereien
verziert wurden. Die Renaissance bildete das
849
Trinkitat - Tripitaka.
T. zu einem Prunkgefäß von höchstem Luxus aus.
Zuletzt wurden auch die Hörner selbst in Glas und Silber
nachgebildet. Jetzt dienen sie meist als Schaustücke.
Trinkitat, Hafenplatz am Roten Meer, südöstlich
von Suakin. Hier Niederlage Baker Paschas 4. Febr. 1884 durch die
Mahdisten, worauf Baker nach Suakin zurückkehrte; dagegen
siegte der hier gelandete General Graham 29. Febr. d. J. bei El Teb
(s. d.).
Trinkonomali, stark befestigte Haupt- und Hafenstadt des
Ostdistrikts von Ceylon, auf einer schmalen Halbinsel 65 m ü.
M. gelegen, mit einer katholischen und evang. Mission, Hindutempeln
und Moscheen und (1881) 10,000 Einw. T. ward den Holländern
1782 von den Engländern entrissen, mußte sich jedoch
schon 30. Aug. d. J. an die Franzosen ergeben. Letztere gaben die
Stadt den Holländern zurück; allein diese verloren sie
1795 abermals an die Engländer, welche sie seitdem im Besitz
behielten.
Trino, Stadt in der ital. Provinz Novara, Kreis Vercelli,
hat ein Gymnasium, eine Kollegiatkirche, einige Paläste,
starke Schweinezucht (treffliche Schinken), Reisbau und (1881) 8267
Einw.
Trinomium (griech.), dreigliederige
Zahlengröße, z. B. a+b+c; trinomisch, dreigliederig.
Trinucleus, s. Trilobiten.
Trio (ital.), eine Komposition für drei Instrumente;
insbesondere nach heutigem Sprachgebrauch jede in Sonatenform
geschriebene Komposition für Klavier, Violine und Cello
(Klaviertrio) oder eine solche für Violine, Bratsche und Cello
oder für zwei Violinen und Cello (Streichtrio). Alle andern
Kombinationen von Instrumenten müssen näher bezeichnet
werden. Kompositionen im ältern Stil (aus dem 17.-18. Jahrh.)
werden häufig als T. bezeichnet, wenn sie für drei
konzertierende Instrumente geschrieben sind (z. B. zwei Violinen
und Viola di Gamba), zu denen als viertes nicht mitgezähltes
das einen Basso continuo ausführende Instrument (Cello,
Theorbe, Klavier, Orgel) kommt. - Bei Tanzstücken (Menuetten
etc.), Märschen, Scherzi etc. für Klavier heißt T.
ein dem lebhaftern und rauschendern Hauptthema
gegenüberstehender Mittelsatz von ruhigerer Bewegung und
breiterer Melodik und zwar darum, weil solche Sätzchen
früher dreistimmig gesetzt zu werden pflegten, während
das Hauptthema sich überwiegend zweistimmig hielt. - Auch
dreistimmige Orgelstücke für zwei Manuale und Pedal, also
für drei Klaviere, deren jedes anders registriert ist, so
daß sich die drei Stimmen scharf gegeneinander abheben, wird
T. genannt. Eine Eigentümlichkeit des Orgeltrios ist,
daß die eine Hand eine gebundene Melodie in derselben Tonlage
vortragen kann, in welcher die andre (auf dem zweiten Klavier)
Figurenwerk ausführt.
Trioecus (griech., "dreihäusig"), Bezeichnung
für polygamische (s. Polygamus) Pflanzen, deren
männliche, weibliche und zwitterige Blüten auf drei
verschiedene Exemplare verteilt sind.
Triole, eine Figur von drei gleichen Notenwerten, die so
viel gelten sollen wie zwei derselben Gattung bei der
vorgeschriebenen Taktteilung. Eine T. anzunehmen, welche für
vier Noten einträte, liegt kein Grund vor: [siehe Bildansicht]
Die T. wird meist durch eine übergeschriebene 3 als solche
gekennzeichnet.
Triolett (franz.), Gedicht von 8-12 Zeilen, welche nur
zwei Reimlaute haben. Die beiden ersten Verse enthalten den
Hauptgedanken und werden am Schluß wiederholt, und da der
erste Vers auch in der Mitte vorkommt, so erscheint derselbe im
ganzen dreimal, was zur Bezeichnung des kleinen Gedichts die
Veranlassung gab. Die Reimstellung beim T. ist also (wobei wir die
wiederkehrenden Zeilen mit großen Lettern bezeichen): ABb Aab
AB. Ein Gedicht von drei Strophen in der Form des Trioletts, aber
ohne die Wiederholung des ersten Verses in der Mitte, wofür
ein neues Reimpaar eintritt, nennt man Rondel (Geibels Lied: "Wenn
sich zwei Herzen scheiden" etc.).
Trionyx. s. Schildkröten, S. 471.
Tripang, s. v. w. Trepang.
Tripartition (lat.), Dreiteilung.
Tripel (franz. triple), dreifach.
Tripel, mattes, gelblichgraues bis gelbes, mager
anzufühlendes, zerreibliches Mineral, welches Wasser einsaugt
und dadurch erweicht, enthält 90 Proz.
Kieselsäureanhydrid, etwas Thon und Eisenoxyd und hat seinen
Namen von der Stadt Tripolis in Syrien (daher terra Tripolitana),
kam früher nur aus der Levante in den Handel, wird jetzt aber
auch in Böhmen, Sachsen, Tirol und Bayern gewonnen und zum
Polieren von Glas, Metallen und Edelsteinen, auch zu
Gußformen benutzt. Übrigens gebraucht man mancherlei
Kieselablagerungen organischen und anorganischen Ursprungs zu
ähnlichen Zwecken, so den sogen. Moderstein (rotten stone) aus
Derbyshire in England. Vgl. Polierschiefer.
Tripelallianz (Dreibund), Bund zwischen drei
Mächten. Berühmt und vorzugsweise T. genannt ist das
Bündnis zwischen England, den Niederlanden und Schweden,
welches Temple (s. d.), de Witt und Graf Dohna 23. Jan. 1668 im
Haag abschlossen, und welches gegen die Eroberungspläne
Ludwigs XIV. in den spanischen Niederlanden gerichtet war. Die
Folge der T. war der Friede von Aachen (1. Mai 1668).
Tripeltakt, s. v. w. dreiteiliger Takt (3/1, 3/2, 3/4,
3/8, 9/8, 9/16). Der 6/4- und 6/8-Takt dagegen sind als zweiteilige
Takte (durch 3 untergeteilt) anzusehen, wenn nicht die Bewegung so
langsam ist, daß die Sechstel (Einheiten der Doppeltriole)
als Einheiten (nach denen gezählt wird) empfunden werden.
Tripes (lat.), Dreifuß.
Triphan (Spodumen), Mineral aus der Ordnung der Silikate
(Augitreihe), findet sich in monoklinen Kristallen, gewöhnlich
aber derb in breitstängeligen und dickschaligen Aggregaten. T.
ist graulichweiß, grünlichweiß bis grün,
glasglänzend, durchscheinend, Härte 6,5-7, spez. Gew.
3,13-3,19, besteht aus Lithiumaluminiumsilikat Li2Al2Si4O12, ist
gewöhnlich etwas natrium- oder calciumhaltig, kommt in
Graniten und Gneisen in Tirol, auf der Insel Utöen, in
Schottland und Massachusetts vor und wird zur Darstellung von
Lithiumpräparaten benutzt. Eine Varietät des T. ist der
Hiddenit (s. d.).
Triphaena, s. Eulen, S. 907.
Triphylin, Mineral aus der Ordnung der Phosphate,
kristallisiert rhombisch, findet sich fast nur derb in
individualisierten Massen oder großkörnigen Aggregaten,
ist grünlichgrau, blau gefleckt, fettglänzend,
kantendurchscheinend, Härte 4-5, spez. Gew. 3,5-3,6, besteht
aus phosphorsaurem Lithion mit etwas Natron und phosphorsaurem
Eisen- und Manganoxydul (LiNa)3PO4+(FeMn)3P2O8, findet sich bei
Bodenmais in Bayern, Norwich in Massachusetts, Grafton in New
Hampshire.
Tripitaka ("Dreikorb"), zusammenfassende Bezeichnung der
heiligen Schriften der südlichen Buddhisten, bestehend aus den
drei Abteilungen Winaja (Disziplin), Sûtra (Aussprüche)
und Abhidharma
850
Tripla - Tripolis.
(Metaphysis). Der singhalesische Name ist Tunpitaka, im
Pâli heißen sie Pitakattajan.
Tripla (Proportio t.), in der Mensuralmusik der
große Tripeltakt (Longa = 3 Breves), während der kleine
(Brevis = 3 Semibreves) Sesquialtera hieß.
Triplet, s. Lupe.
Triplexbrenner, s. Lampen, S. 435.
Triplik (lat.), im rechtlichen Verfahren die Beantwortung
der Duplik des Beklagten durch den Kläger; triplizieren, die
T. abgeben.
Triplit (Eisenpecherz, mit welchem Namen aber auch der
Stilpnosiderit belegt wird), Mineral aus der Ordnung der Phosphate,
nur derb, in großkörnigen Aggregaten, ist braun,
fettglänzend, undurchsichtig, Härte 5-5,5, spez. Gew.
3,6-3,8, besteht aus phosphorsaurem Eisen- und Manganoxydul mit
Fluoreisen und Fluormangan (FeMn)3P2O6+(FeMn)Fl2, enthält auch
etwas Calcium und Magnesium; Limoges in Frankreich, Schlaggenwald
in Böhmen, Pritau in Schlesien und in Argentinien.
Triplum (lat.), das Dreifache; triplieren,
verdreifachen.
Tripmadam, s. Sedum.
Tripode (Tripus, griech.), s. v. w. Dreifuß.
Tripodie (griech.), eine aus drei Versfüßen
bestehende metrische Periode.
Tripolis (türk. Tarablusi Gharb, auch Tripolitanien
genannt), der östlichste unter den Staaten der Berberei (s.
Karte "Algerien"), am Mittelländischen Meer zwischen Tunis und
Ägypten gelegen, umfaßt mit Fezzan und Barka 1,033,000
qkm (18,760 QM.). Es bildet eine nur von niedrigen
Höhenzügen unterbrochene Ebene und ist namentlich an der
Küste meist niedrig und sandig. Während die westlichen
Küstengegenden ziemlich bewässert und fruchtbar sind, ist
der östlich vom Kap Mesurata am Golf von Sidra gelegene
Landstrich Sort (Wüste) mit Dünen und Salzsümpfen
bedeckt. Nach dem Innern zu erstreckt sich die Ebene im W. bis an
die 900 m hohen Schwarzen Berge, welche die Nordgrenze Fezzans
bilden und tief eingeschnittene Wadis zeigen, die zum Teil eine
üppige Vegetation hervorbringen. Das Klima hat einen mehr
kontinentalen Charakter als in den übrigen Uferländern
des Mittelmeers, an der Küste herrscht eine Mitteltemperatur
von 20-22, in der Oase Dschofra 30° C.; dagegen soll hier auch
Schnee gefallen sein, ebenso wie auf den Schwarzen Bergen. Der
Regenfall ist an der Küste gering, bleibt im Innern sogar
jahrelang aus. Die Einwohner (1 Mill.) sind in den Städten
Mauren, auf dem Land arabische Beduinen, Berber und Neger und
bekennen sich sämtlich zum Islam. Außer ihnen gibt es
zahlreiche Juden und in der Stadt T. auch Europäer. Die
Beduinen treiben vornehmlich Viehzucht, die Mauren Handel, meist
Karawanenhandel. Man baut Weizen, Krapp, Safran, Lotusbohnen,
Datteln (die Zahl der Dattelpalmen soll 2 Mill. betragen),
Südfrüchte aller Art, Oliven, Johannisbrot und gewinnt
aus den Seen u. Sümpfen an der Küste Salz u. Schwefel.
Münzeinheit ist der türkische Piaster (Girsch), = 40 Para
(Abu Aschrin). Fünffranken zirkulieren, wie in ganz
Nordafrika, sehr häufig. Die Flagge s. auf Tafel "Flaggen I".
Die Industrie liefert schöne Seiden-, Wollen- u.
Baumwollenstoffe, Leder, Waffen und verschiedene Metallwaren. Die
Handelsbewegung ist nach dem Süden von T. (nach dem
Sudân, Bornu, Wadai) eine sehr lebhafte. T. gilt als
Schlüssel zum Sudân. Leider ist das Land noch sehr wenig
erforscht. Hauptgegenstände der Ausfuhr sind: Öl,
Getreide, Schlachtvieh, Wolle, Rindvieh, Krapp, Halfa und Ginster.
Handelsgegenstände, die durch Karawanen aus dem Innern kommen,
sind: Straußfedern, Elfenbein, Gummi, Aloe,
Sennesblätter und andre Droguen. Eingeführt werden
Manufaktur-, Fabrik- und Kolonialwaren, Spirituosen, Droguen,
Seife, Tabak, Eisen, Bauholz etc. Die Haupthäfen, T. und
Bengasi, vermitteln fast ausschließlich den Verkehr mit dem
Ausland. Die Post hatte 1886: 33, die Telegraphen 12 Ämter. T.
bildet ein Wilajet des türkischen Reichs unter einem von der
Pforte eingesetzten Generalgouverneur und wird in fünf
Sandschaks eingeteilt.
Die gleichnamige Hauptstadt (arab. Tarabolos), auf einer
Landzunge am Mittelländischen Meer gelegen, hat hohe Mauern,
einen Palast des Generalgouverneurs, enge, aber reinliche
Straßen, einen durch Batterien gedeckten, aber wenig sichern
Hafen, in den 1887: 1206 Schiffe (311 Dampfer) von 344,666 Ton.
einliefen, eine kath. Kapelle, 12 Moscheen, mehrere Synagogen,
schöne öffentliche Bäder, Bazare, Karawanseraien,
Schulen, Hotels, lebhaften Handel, Fabrikation von Korduan,
Wollen-, Seiden- und Baumwollenstoffen etc. und 30,000 Einw.,
worunter 4-5000 Italiener und Malteser. Die Umgebung, Meschija
genannt, ist auf viele Kilometer bedeckt mit Palmenhainen, in denen
30,000 Menschen in zahllosen Wohnungen verstreut sind. T. steht
durch Dampferlinien mit den tunesischen Häfen und mit Malta in
Verbindung und ist Sitz eines deutschen Konsuls. - T. ist das alte
Öa und ward mit den benachbarten Städten Sabratha und
Groß-Leptis von den sizilischen Griechen unter dem Namen T.
zusammengefaßt. In der Umgegend finden sich noch viele
Altertümer. T. bildete im Altertum ein mittelbares Gebiet
Karthagos, die sogen. Regio Syrtica. Nach dem zweiten Punischen
Krieg ward es von den Römern den numidischen Königen
überlassen, nach deren Unterwerfung zu der römischen
Provinz Africa geschlagen. Unter Septimius Severus wurde im 3.
Jahrh. n. Chr. die Provincia Tripolitana gebildet mit Öa als
Hauptstadt, auf welche sodann der Name T. überging. Nach der
Invasion der Araber im 7. Jahrh. teilte T. die Geschicke der
Berberei. Nachdem es längere Zeit zu Tunis gehört hatte,
erlangte es zu Ende des 15. Jahrh. seine Unabhängigkeit. 1509
wurde die Stadt T. von den Spaniern unter Graf Pietro von Navarra
erobert und ein spanischer Statthalter eingesetzt. Kaiser Karl V.
überließ sie 1530 den Johannitern als Lehen, aber schon
1551 ward sie von den Türken wiedererobert und seitdem ein
Hauptsitz der Seeräuberei an der nordafrikanischen Küste.
1681 ließ Ludwig XIV. durch den Admiral Duquesne die
tripolitanischen Korsaren in dem Hafen von Skio angreifen und viele
ihrer Schiffe in den Grund bohren, und 1685 bombardierte Marschall
d'Estrées die Stadt so erfolgreich, daß der Dei den
Frieden mit ½ Mill. Livres erkaufen mußte. 1714 machte
sich der türkische Pascha Hamed Bei (der Große) fast
unabhängig von der Pforte, indem er nur noch Tribut zahlte,
und begründete die Dynastie der Karamanli. Der 1728
unternommene Kriegszug der Franzosen gegen T. endigte mit der fast
gänzlichen Zerstörung von T. Dessen ungeachtet machte
erst die französische Eroberung Algiers (1830) der
Seeräuberei auch in T. ein Ende. 1835 fand sich die Pforte
durch die in T. herrschende innere Zerrüttung zum Einschreiten
veranlaßt und machte der Herrschaft der Familie Karamanli ein
Ende, worauf T. als Wilajet dem türkischen Reich einverleibt
würde. Vgl. Maltzan, Reise in den Regentschaften Tunis und T.
(Leipz. 1870, 3 Bde.); Rohlfs, Kufra (das. 1881); Brunialti,
Algeria, Tunisia e Tripolitana
851
Tripolis - Triptis.
(Mail. 1881); Haimann, Cirenaica-Tripolitana (2. Aufl., das.
1885).
Tripolis, 1) Stadt in Syrien, s. Tarabulus. - 2) Stadt in
Griechenland, s. Tripolitsa.
Tripolith, von Gebrüder Schenk in Heidelberg
angegebene Mischung, welche nach der Patentschrift durch Erhitzen
von Gips mit Thon und Koks, nach dem englischen Patent aus Gips,
Kohle und Eisenhammerschlag erhalten wird, ein hell
bläulichgraues Pulver bildet und für Bauzwecke sowie zu
chirurgischen Verbänden empfohlen wird.
Tripolitsa (offiziell Tripolis), Hauptstadt des griech.
Nomos Arkadien, liegt auf einer wellenförmigen Ebene, der
antiken Tegeatis, ist Sitz des Nomarchen, eines Erzbischofs und
eines Bezirksgerichts sowie eines deutschen Konsuls, hat ein
Gymnasium, eine niedere theologische Schule, Eisen- und
Kupferindustrie und (1879) 10,057 Einw. Es ist erst in neuerer Zeit
entstanden und war im vorigen und im Beginn dieses Jahrhunderts
eine der blühendsten Städte des Peloponnes. Seit dem
Passarowitzer Frieden von 1718 Hauptstadt von Morea, ward sie 17.
Okt. 1821 von den Griechen mit Sturm genommen und fast völlig
in Asche gelegt, aber bald wieder aufgebaut und 23. April 1823 zum
Sitz der griechischen Regierung ausersehen. Ibrahim Pascha eroberte
sie 21. Juni 1825 und verließ sie erst 1828 wieder. 6 km
südöstlich davon liegen die Ruinen von Tegea, welche die
Bausteine für T. geliefert haben, 12 km nördlich
diejenigen von Mantineia.
Trippel, Alexander, Bildhauer, geb. 1744 zu Schaffhausen,
bildete sich in Kopenhagen, ging 1771 nach Paris und 1776 nach Rom,
wo er 1793 starb. Unter seinen Werken, die bei sorgfältiger
Durchführung meist eine glückliche Nachahmung der Antike
bekunden, sind hervorzuheben: eine Bacchantin, ein sitzender
Apollo, eine schlafende Diana, das Denkmal des Grafen Tschernyschew
für die Stadt Moskau, die Büsten von Goethe und Herder,
1789 in Marmor ausgeführt (in der Bibliothek zu Weimar), und
das Monument des Dichters Geßner für die Stadt
Zürich.
Trippen, s. Schnabelschuhe.
Tripper (Gonorrhöa), eine mit Eiterabsonderung
verbundene virulente Entzündung der Harnröhrenschleimhaut
und die häufigste durch einen unreinen Beischlaf entstehende
Krankheit. Der T. ist zwar nicht eine im engern Sinn venerische,
d.h. syphilitische, aber doch eine in hohem Grad ansteckende
Krankheit; der Ansteckungsstoff, ein Mikrokokkus (Gonococcus), als
dessen Träger der von der Harnröhren- und
Scheidenschleimhaut abgesonderte Eiter anzusehen ist, haftet indes
nur auf der Schleimhaut der Harnröhre, der weiblichen Scheide
und der Bindehaut des Auges (Augentripper). Der T. kommt sowohl
beim männlichen als beim weiblichen Geschlecht vor und
verläuft bald akut, bald chronisch. Der T. des männlichen
Geschlechts kündigt sich gewöhnlich durch ein Kitzeln in
der Eichel an, deren Mündung leicht verklebt. Bald rötet
sich letztere, schwillt etwas an, und es treten
schneidend-stechende Schmerzen, namentlich beim Urinlassen, auf. Es
stellt sich dann ein mißfarbiger, später rein eiteriger
Ausfluß aus der Harnröhre ein. Die genannten
Erscheinungen erreichen in der Regel den höchsten Grad am Ende
der ersten acht Tage. In der Nacht stören sehr schmerzhafte
Erektionen den Schlaf. Die Schmerzen verbreiten sich in den
Hodensack, machen sogar den Stuhlgang und das Sitzen lästig.
Beim Urinlassen sind sie ganz besonders heftig. In der zweiten
Woche lassen die Entzündungserscheinungen in der Regel etwas
nach, aber der Ausfluß bleibt noch bestehen; doch ändert
sich später sein Aussehen, er wird mehr schleimig, hört
entweder ganz auf, oder wird chronisch: Nachtripper (gonorrhoea
chronica, goutte militaire). Dieser Verlauf ist der
gewöhnliche. Zuweilen aber schreitet die Entzündung der
Harnröhrenschleimhaut auf das Zellgewebe, das unter ihr liegt,
fort, und es entstehen dann schmerzhafte Verdickungen, wodurch das
Glied bei den Erektionen eine Krümmung macht, die sehr
schmerzhaft ist und, wenn sie auszugleichen versucht wird, kleine
Blutungen veranlaßt, welche von Einrissen der Schleimhaut
herrühren. Schreitet die Entzündung bis zum Blasenhals
fort, so entsteht ein heftiger Urinzwang, ja unter Umständen
Harnverhaltung. Entzündet sich die Vorsteherdrüse, so
klagen die Kranken über heftige Schmerzen am Damm; die
geschwollene Drüse ist vom Mastdarm aus fühlbar,
Harnlassen und Stuhlgang sind beschwert und äußerst
schmerzhaft. Die Kranken können weder gehen, noch sitzen,
sondern sind zu liegen genötigt. Auch die Lymphdrüsen in
der Leistengegend sind angeschwollen, können sich
entzünden und vereitern. Bei dem Nachtripper sind die
Erscheinungen weniger heftig, die Schmerzen fehlen oder sind ganz
unbedeutend; aber der schleimige Ausfluß kann wochen- und
monatelang fortbestehen. Die Mündung der Harnröhre
verklebt, namentlich gern über Nacht. Als Folgen des Trippers
sind vornehmlich Verengerungen der Harnröhre, die meist tief
nach hinten sitzen, hervorzuheben (s. Striktur). Die Behandlung des
Trippers erfordert vor allem Ruhe und gleichmäßige
Wärme, gegen heftige Entzündungserscheinungen und
Hodenschwellung Kälte, Blutegel oder feuchtwarme
Bähungen, innerlich kühlende Salze und beruhigende
Mittel, fleißiges Wassertrinken und schmale, reizlose
Diät. Vor allen Dingen hat sich der Kranke des Biergenusses
gänzlich zu enthalten, beim Gehen ein Suspensorium zu tragen.
Als spezifische Mittel gelten der Kopaivabalsam und der
Kubebenpfeffer, doch kommt man in den allermeisten Fällen bei
richtigem Allgemeinverhalten auch ohne sie ans Ziel. Später,
wenn die Schmerzen nachlassen, wende man leicht zusammenziehende
Einspritzungen (schwache Lösungen von Zinksulfat) in die
Harnröhre an, gegen die schmerzhaften Erektionen Opium,
Lupulin. Der T. beim weiblichen Geschlecht beschränkt sich
fast niemals auf die Harnröhre, er ist vielmehr nur eine
Teilerscheinung des bösartigen weißen Flusses (s. d.).
Bei beiden Geschlechtern kann der T. mit Syphilis kompliziert sein
(s. Syphilis). - Über Eicheltripper s.
Eichelentzündung.
Trippergicht (Tripperrheumatismus), eine
Gelenkentzündung, welche namentlich bei Männern nicht
selten im Verlauf des Trippers, am häufigsten im Stadium des
Nachtrippers, sich einstellt. Der Sitz ist meistens das Kniegelenk
(Tripperknie); jedoch werden auch Hand-, Fuß- und andre
Gelenke befallen. Wie der Tripper selbst durch den Eintritt eines
infektiösen Stoffes in den Körper entsteht, so ist auch
die T. als bedingt durch die Fortschleppung desselben Gifts in die
Gewebe der Gelenke aufzufassen. Verlauf und Behandlung der T. ist
dieselbe wie bei jeder anderweit entstandenen
Gelenkentzündung.
Tripsis (griech.), Reibung; triptisch, durch Reibung
bewirkt.
Triptis, Stadt im weimar. Kreis Neustadt, am Ursprung der
Orla, Knotenpunkt der Linien Gera-Eichicht und T.-Blankenstein der
Preußischen Staatsbahn, 361 m ü. M., hat 2 Kirchen,
einen alten Turm aus der Sorbenzeit, Gerberei, Leimsiederei und
(1885) 1632 evang. Einwohner.
852
Triptolemos - Tristan da Cunha.
Triptolemos, im griech. Mythus Sohn des Königs
Keleos von Eleusis und der Metaneira, Liebling der Demeter,
Verbreiter des Ackerbaues und der Kultur überhaupt, Heros der
Eleusinischen Mysterien. Er fuhr auf einem mit Drachen bespannten
Wagen über die ganze Erde dahin und streute Getreidesamen aus.
Nach seiner Zurückkunft nach Eleusis wollte Keleos ihn
töten lassen, mußte ihm jedoch auf Befehl der Demeter
sein Land abtreten, worauf T. die Thesmophorien (s. d.)
stiftete.
Triptychon (griech.), ein aus drei Teilen (Mittelbild und
Flügelbildern) bestehendes Altargemälde. S. auch
Diptychon.
Tripudium (lat.), der Tanz der römischen Priester um
die Altäre, besonders der der Salier und Arvalbrüder.
Triquetrum (parallaktisches Lineal, Instrumentum
parallacticum, -Ptolemäische Regel), astronom. Instrument der
Alten, dessen sich noch Kopernikus bediente, aus drei Linealen
bestehend, die ein gleichschenkeliges Dreieck bilden (s. Figur).
Der eine der gleichen Schenkel, A B, steht vertikal, der andre, A
C, um den obern Endpunkt A des ersten drehbar, ist mit Absehen
(Visieren) versehen und wird nach dem zu beobachtenden Stern
gerichtet; auf dem dritten, mit einer Teilung versehenen Lineal B D
wird die Länge der ungleichen Seite B C gemessen und dadurch
der Winkel an der Spitze, d. h. Zenithdistanz des Sterns,
bestimmt.
Triremen, "Dreiruderer", bei den Römern und im
Mittelalter gebräuchliche Kriegsschiffe; bei den Griechen
Trieren genannt. Sie hatten drei Reihen Ruder übereinander
(Fig. 1 u. 2). Vgl. Galeere.
Trisektion des Winkels, Teilung desselben in drei gleiche
Teile, ein im Altertum berühmtes geometrisches Problem, mit
dem sich Pappus, Proklos, Nikomedes, von den Neuern Vieta, Albrecht
Dürer, Newton u. a. beschäftigt haben; mit Zirkel und
Lineal (Kreis und gerader Linie) allein nicht lösbar.
Trisetum Beauv. (Goldhafergras), Gattung aus der Familie
der Gramineen, der Gattung Avena, Hafer, sehr nahestehend, mit
zwei- bis dreiblütigen Ährchen, nur fruchtbaren
Blüten und einer am Grund nur wenig dunklern Granne an der
Deckspelze. T. pratense Pers. (Avena flavescens L., kleiner
Wiesenhafer, s. Fig.), ein perennierendes Gras mit mehr oder
weniger fein behaarten Blättern und nur in der Blüte
ausgebreiteten, gelbgrünen Rispen, wächst auf guten
frischgrundigen Wiesen, gehört zu den Schnittgräsern
erster Klasse und gibt reichliches, sehr feines, weiches Heu.
Trishagion (griech., Hymnus angelicus, cherubicus,
triumphales), der im Konsekrationsakt der Messe übliche Gesang
des "Dreimalheilig", genommen aus Jes. 6, 3, war schon im 4. Jahrh.
gebräuchlich und galt als liturgisches Bekenntnis der
Dreieinigkeit.
Trismegistos, s. Hermes Trismegistos.
Trismus (griech.), Mundsperre, häufig
Teilerscheinung des Starrkrampfes.
Trissino, Giovanni Giorgio, ital. Dichter und Gelehrter,
geb. 8. Juni 1478 zu Vicenza, lebte unter den Päpsten Leo X.
und Clemens VII. als päpstlicher Nunzius längere Zeit in
Venedig und Wien und starb 1550 in Rom. Er ist besonders bekannt
als Verfasser der "Sofonisba" (Rom 1524; mit den Anmerkungen von T.
Tasso hrsg. von Paglierani, Bologna 1885; deutsch von Feit,
Lübeck 1888), der ältesten regelmäßigen
Tragödie der Italiener. Dieselbe ist streng nach den
Aristotelischen Regeln abgefaßt, in reimlosen
fünffüßigen Jamben (versi sciolti), die T. zuerst
in die italienische Litteratur eingeführt haben soll,
geschrieben und verrät, trotz ihrer Abhängigkeit von
antiken Mustern, ein nicht gewöhnliches Talent, hat aber
heutzutage fast nur noch einen litterarhistorischen Wert. Trissinos
Lustspiel "Isimillimi" (Vened. 1548) ist eine Nachahmung des
Plautus. Sein Epos "Italia liberata da' Goti" (Vened. 1547-48, 3
Bde.; Par. 1729, 3 Bde.), in 27 Gesängen, ist unpoetisch und
langweilig und gegenwärtig vergessen. Nicht ohne Wert sind
dagegen manche seiner "Rime" (Vicenza 1529). Auch ist er Verfasser
einer Poetik (Vicenza 1529) sowie verschiedener Schriften über
die italienische Sprache und hat Dantes Schrift "De vulgari
eloquio" zuerst ins Italienische übersetzt. Eine Gesamtausgabe
seiner Werke erschien Venedig 1729. Vgl. Nicolini, Giangiorgio T.
(Vicenza 1864); Morsolin, G. T. (das. 1878).
Trist (lat.), traurig, betrübt; öde.
Tristan da Cunha (spr. kúnja), Inselgruppe im
südatlant. Ozean, südwestlich vom Kap der Guten Hoffnung,
besteht aus drei Inseln vulkanischen Ursprungs, deren
größte, vorzugsweise T. genannt, eigentlich nur ein
erloschener Vulkan ist, der bis zu 2600 m ansteigt und 116 qkm (2,1
QM.) umfaßt. Sie wurde nach dem portugiesischen Entdecker
(1506) benannt, ist rund von Gestalt und wohlbewässert und
erscheint als ein günstiger Platz für
Schildkrötenfang und zum Wassereinnehmen für Seefahrer,
die, nach Indien oder Australien bestimmt, nicht am Kap an-
853
Tristan und Isolde - Tritonshörner.
legen wollen. Während der Gefangenschaft Napoleons auf St.
Helena hielt die britische Regierung die Insel besetzt; als sie
1821 verlassen werden sollte, erlangten der Korporal William
Glaß und zwei Seeleute die Erlaubnis, sich dauernd auf der
Insel niederzulassen. So entstand eine kleine Kolonie, welche 1886:
94 Köpfe zählte; sie steht unter dem Schutz des
Kapgouverneurs und führt seit 1867 den Namen Edinburgh.
Tristan und Isolde, die beiden Hauptpersonen einer
ursprünglich keltischen Sage, welche von mehreren
nordfranzösischen Dichtern im 12. Jahrh. behandelt ward und
sodann in die spanische, italienische, slawische, skandinavische
und sogar in die griechische Litteratur überging. Auf
deutschen Boden verpflanzte zuerst Eilhart von Oberge (s. d.) die
Sage gegen Ende des 12. Jahrh. durch ein nach dem
Französischen bearbeitetes Gedicht, das auch einer
spätern Prosaauflösung (zuerst gedruckt 1484; auch in
Simrocks "Volksbüchern" enthalten) zu Grunde liegt. Die
vorzüglichste deutsche Dichtung aber, welche die Sage von T.
u. I. zum Gegenstand hat, ist das ebenfalls nach einem
französischen Original bearbeitete Gedicht Gottfrieds von
Straßburg. Über den Inhalt der Sage sowie neuere
Bearbeitungen derselben s. Gottfried von Straßburg. Vgl.
Mone, Über die Sage von Tristan (Heidelb. 1822); Golther, Die
Sage von T. u. I. (Münch. 1887).
Tristen, s. Feimen.
Tristichon (griech.), dreiteiliges Gedicht.
Tristien (lat.), Trauerlieder (ursprünglich Titel
von Elegien, welche Ovid im Exil schrieb).
Tristychius, s. Selachier.
Trisyllabum (griech.), dreisilbiges Wort.
Triterne (lat.), s. Duernen.
Tritheim (Trittenheim, latinisiert Trithemius), Johannes,
eigentlich Heidenberg, berühmter Humanist, geb. 1. Febr. 1462
zu Trittenheim im Trierschen, studierte in Heidelberg, ward 1482
Benediktinermönch und starb 16. Dez. 1516 als Abt zu St. Jakob
in Würzburg. Er hat sich um die Beförderung der
Wissenschaften Verdienste erworben; doch nahm er in seine
geschichtlichen Werke Märchen und Fälschungen ohne alle
Kritik auf. Seine "Opera spiritualia" (Mainz 1604) und
"Paralipomena" (das. 1605) wurden von Busäus, seine "Opera
historica" von Freher (Frankf. 1601, 2 Bde.) herausgegeben. Vgl.
Silbernagl, Joh. Trithemius (2. Aufl., Regensb. 1885); Schneegans,
Abt J. T. und Kloster Sponheim (Kreuzn. 1882).
Tritheismus (griech.), in der christlichen
Dogmengeschichte die die Einheit des Wesens überwiegende
Betonung des persönlichen Unterschiedes innerhalb der
Trinität (s. d.), wie dieselbe im kirchlichen Altertum dem
Monophysiten Joh. Philoponus, später dem Scholastiker
Roscellinus schuld gegeben wurde.
Triticum, Pflanzengattung, s. Weizen.
Tritogeneia, Beiname der Athene (s. d.).
Triton, Molch.
Triton, im griech. Mythus Sohn des Poseidon und der
Amphitrite, wohnte mit diesen auf dem Grunde des Meers in goldenem
Palast. Als seine eigentliche Heimat galt der fabelhafte Tritonsee
in Afrika, besonders in der Argonautensage. Man stellte sich ihn
mit menschlichem Oberkörper, der in einen Delphinschwanz
ausläuft, vor; auch werden ihm kurze Stierhörner und
Spitzohren gegeben. Sein Attribut ist eine gewundene Seemuschel,
auf der er bald stürmisch, bald sanft bläst, um die
Fluten zu erregen oder zu beruhigen. Allmählich bildete sich
dann die Vorstellung von einer großen Zahl von Tritonen, die
ebenfalls als doppelgestaltige Wesen, bisweilen außer dem
menschlichen Oberkörper und dem Fischschweif noch mit den
Vorderfüßen eines Pferdes, gedacht und dargestellt
werden. Von antiken Bildwerken ist besonders der Torso des
vatikanischen Museums (Fig. 1) zu erwähnen, welcher mit der
wilden, unbändigen Natur, die sich in Bewegungen und
Körperbau ausspricht, jene erregte Wehmut in den Zügen,
wie sie allen Seegöttern von der antiken Kunst gegeben wird,
vortrefflich vereinigt. Vgl. auch die schöne statuarische
Gruppe des Neapeler Museums (Fig. 2), in welcher T., von Eroten
umspielt, eine Nereide entführt.
Tritonikon, s. Kontrafagott.
Tritonshörner (Tritoniidae Ad.), Schneckenfamilie
aus der Ordnung der Vorderkiemer (Prosobranchia), besitzen einen
großen, weit hervortretenden Kopf, einen langen Rüssel
und eine lange Atemröhre, große, kegelförmige
Fühler mit Augen in der Mitte ihrer Außenseite und eine
ei- oder spindelförmige Schabe mit geradem oder leicht
aufgebogenem Kanal, dornenlosen Höckern auf den Windungen und
gesuchter oder faltiger Spindel. Tritonium nodiferum Lam.
854
Tritonus - Triumvirn.
(Kinkhorn, Trompetenschnecke), im Mittelmeer, ist die Buccina
der Alten, welche schon die alten Quiriten zu den Waffen rief und
auch heute noch zum Signalgeben bei ländlichen Arbeiten
Verwendung findet. T. Variegatum Lam., im Indischen Ozean, dient
noch jetzt als Kriegstrompete. Eine große Rolle spielten die
T. in den mythologischen Darstellungen und dann in den Bildern,
Statuengruppen und Reliefs der Rokokozeit. Vgl. auch
Faßschnecke.
Tritonus, griech. Name der übermäßigen
Quarte, welche ein Intervall von drei Ganztönen ist (z. B.
f-h); als Stimmenschritt war der T. im strengen Satz verpönt.
Vgl. Stimmführung.
Tritoprismen und Tritopyramiden, s. Deuteroprismen,
Deuteropyramiden und Kristall, S. 232 f.
Tritschinapalli (Trichinopolly), Hauptstadt eines
Distrikts (9104 qkm od. 165,3 QM. mit [1881] 1,215,033 Einw.) in
der indobrit. Präsidentschaft Madras, an der Kaweri und der
Südbahn, ist Sitz eines katholischen Bischofs, hat ein
meteorologisches Observatorium, mehrere Hospitäler und
Kirchen, 3 evang. Missionen (2 englische, eine deutsche) und 2
Colleges. Auf einer 91 m hohen Felsnadel in der Mitte der Stadt ein
berühmter Wallfahrtstempel der Hindu. T. hat eine Garnison und
(1883) 84,449 Einw. (darunter 11,155 Christen), welche
berühmte Zigarren und Goldwaren fabrizieren.
Tritschler, Alexander von, Architekt, geb. 10. Febr. 1828
zu Biberach, besuchte das Polytechnikum in Stuttgart, war von 1848
bis 1859 bei Eisenbahnbauten in Württemberg und der Schweiz
beschäftigt und wurde 1860 Professor an der technischen
Hochschule in Stuttgart, später Oberbaurat und durch
Verleihung der ersten Klasse des württembergischen
Kronenordens geadelt. Seine zumeist im Renaissancestil
ausgeführten Hauptwerke sind: die Restaurierung der Kapelle
des alten Schlosses, das Zentral-Postgebäude, die Realschule,
das Haus der Württembergischen Hypothekenbank, die
Vergrößerung des königlichen Polytechnikums in
Stuttgart.
Tritt, der Abdruck eines Laufs des Wildes; Tritte, die
Füße der Hühner, Tauben und kleinen Vögel.
Trittau, Dorf in der preuß. Provinz
Schleswig-Holstein, Kreis Stormarn, unweit der Bille, hat eine
evang. Kirche, ein Amtsgericht und (1885) 1386 Einw.
Tritteisen, s. Tellereisen.
Trittmaschine, s. Tretrad.
Triumph (lat.), bei den alten Römern der feierliche
Einzug eines siegreichen Feldherrn mit seinem Heer in die Stadt
Rom. Der Antrag dazu beim Senat ging vom Feldherrn aus und ward, da
derselbe vor dem T. die Stadt nicht betreten durfte, im Tempel der
Bellona oder auf dem Marsfeld gestellt. Hatte der Senat den auf
Kosten des Staats zu veranstaltenden T. bewilligt, so erteilte das
Volk dem Feldherrn für den Tag des Triumphs das Imperium in
der Stadt. Der Zug bewegte sich vom Marsfeld durch die Porta
triunmphalis in den Circus Flaminius, in dem sich ein geeigneter
Platz für eine Menge der Zuschauer bot, von dort durch die
Porta Carmentalis in die Stadt, dann über das Velabrum und
Forum Boarium in den Circus Maximus; weiterhin die Via sacra
entlang über das Forum nach dem Kapitol. Den Zug
eröffneten die Magistrate und der Senat, ihnen folgten Musiker
und eine lange Reihe von erbeuteten Prachtgegenständen, von
Abbildungen der eroberten Städte oder Länder und die
goldenen Kränze, welche die Provinzen dem Triumphator gewidmet
hatten (vgl. die Tafel "Bildhauerkunst IV", Fig. 14, wo eine Gruppe
aus dem Triumphzug des Titus mit der Beute des jüdischen
Kriegs dargestellt ist). Ein Zug von weißen Stieren mit
vergoldeten Hörnern, zum Opfer auf dem Kapitol bestimmt,
folgte, denen sich die vornehmen Gefangenen in Ketten anschlossen,
die unmittelbar nach dem T. hingerichtet wurden. Endlich hinter
seinen purpurgekleideten Liktoren erschien der Triumphator selbst
auf einem von vier weißen Rossen gezogenen Wagen. Sein Ornat,
die Tunica palmata (s. d.) und die Toga picta (s. d.), war der des
kapitolinischen Jupiter selbst und dazu aus dem Tempelschatz
hergegeben, in der Rechten führte er einen Lorbeerzweig, in
der Linken ein elfenbeinernes, mit einem Adler geschmücktes
Zepter. Über seinem Haupt hielt ein Sklave die goldene Krone
Jupiters, der ihm aber auch bei dem Jo triumphe, dem Jubelgeschrei
des Volkes, zurief: "Bedenke, daß du ein Mensch bist!" Die
Söhne und Töchter und die nächsten Verwandten
umgaben den Triumphator; durch den Sieg desselben aus der
Knechtschaft befreite römische Bürger folgten, und die
ganze Armee bildete den Schluß. Auf dem Kapitol verrichtete
der Triumphator ein Dankgebet, ließ die Opfertiere
schlachten, legte den Lorbeerzweig, später eine Palme in den
Schoß des Jupiter nieder und weihte dem Gott einen Teil der
Beute. Ein Gastmahl, das er seinen Freunden und den angesehensten
Männern der Stadt gab, beschloß den Tag. Eine geringere
Art des Triumphs war die Ovation (s. d.). Seit des Augustus, noch
mehr aber seit Vespasians Regierung wurden die Triumphe seltener
und kamen meist nur noch den Kaisern zu. über die gefeierten
Triumphe wurden Verzeichnisse, die sogen. Fasti triumphales,
geführt. Außer dem eigentlichen T. kamen noch vor der
Triumphus navalis und der Triumphus in monte Albano, welch
letzterer von Feldherren, denen der solenne T. nicht zugestanden
war, auf dem Albanerberg gehalten wurde.
Triumphbogen (Arcus oder Fornix triumphalis), ein frei
stehendes, thorförmiges Gebäude, welches
ursprünglich in Rom zu Ehren triumphierender Kaiser oder
Feldherren errichtet wurde und entweder nur einen Durchgang oder
einen Hauptdurchgang und zwei Nebendurchgänge, sämtlich
mit halbkreisförmigem Abschluß, enthält. Noch
erhaltene T. in Rom sind, außer den Trümmern des
Triumphbogens des Drusus, diejenigen des Titus, Septimius Severus
und Constantinus (s. Tafel "Baukunst VI", Fig. 7). Andre Bauten der
Art sind Ehrenbogen, wie der des Gallienus, oder Durchgangsbogen,
wie die des Janus und der des Dolabella. Außerhalb Roms sind
erhalten: der T. des Augustus zu Rimini, dann die zu Susa, Aosta
und Fano; die des Trajan zu Ancona und Benevent, der des Hadrian in
Athen, der des Marius zu Orange in Frankreich. Außerdem gibt
es noch T. zu Pola, Verona, St.-Remy in Südfrankreich und
Capara in Spanien. In neuerer Zeit sind T. in Paris (Arc de
triomphe de l'Étoile und du Carrousel), Mailand (Arco della
Pace), Innsbruck, München (Siegesthor) u. a. O. errichtet
worden. Alle diese T. sind mit reichem bildnerischen Schmuck,
besonders mit Reliefs (s. Tafel "Bildhauerkunst IV, Fig. 14),
ausgestattet. In der altchristlichen und armenischen Basilika
heißt T. der vor dem Sanktuarium, in der gotischen Kirche
zwischen Schiff und Chor befindliche hohe Scheidebogen, über
welchem gewöhnlich der triumphierende Erlöser dargestellt
war, oder in welchem ein mächtiges Kruzifix hing.
Triumvirat (lat.), s. Triumvirn.
Triumvirn (Triumviri oder Tresviri, lat., "Drei-
855
Triunfo - Trochu.
männer"), in Rom der Name mehrerer aus drei Mitgliedern
bestehenden Kollegien, deren Bestimmung durch einen Zusatz
näher angegeben wird. Zu den Magistratus minores, den niedern
Magistraten, gehörten: die Triumviri capitales, um 289 v. Chr.
eingesetzt, welchen die Aufsicht über die Gefängnisse,
die Vollstreckung der Todesurteile und die meisten Verrichtungen
der niedern öffentlichen Polizei übertragen waren; die T.
monetales, die Vorsteher des Münzwesens, wahrscheinlich 269 v.
Chr. eingesetzt; die T. nocturni, die für die Sicherheit der
Städte zur Nachtzeit zu sorgen hatten, über deren
sonstige Obliegenheiten aber und die Zeit ihrer Einsetzung nichts
Sicheres zu ermitteln ist. Von weit größerer politischer
Bedeutung sind die Vereinigungen von je drei Männern im
letzten Jahrhundert der Republik zu dem Zweck, die gesamte
Staatsgewalt an sich zu reißen, welche Triumvirate genannt
werden. Das erste dieser Triumvirate, das des Cäsar, Pompejus
und Crassus, 60 v. Chr. geschlossen, war eine bloße
Privatvereinigung. Das zweite ward 43 n. Chr. auf einer Insel des
Reno zwischen Antonius, Octavianus und Lepidus geschlossen. Nachdem
diese in Rom eingezogen waren, wurden sie 27. Nov. durch ein Gesetz
als T. rei publicae constituendae, d. h. für die Ordnung des
Staats, mit höchster Gewalt auf die Zeit bis zum letzten
Dezember 38 vom Volk bestätigt, und nach Ablauf dieser Zeit
wurde ihnen diese Vollmacht auf weitere fünf Jahre
verlängert.
Triunfo (El T.), Stadt im südlichen Teil des
mexikan. Territoriums Kalifornien, im Innern, mit Silber- und
Goldgruben und 4000 Einw.
Trivandrum, Hauptstadt des indobrit.
Vasallenfürstentums Travankor, 3½ km vom Indischen
Meer, Residenz des Maharadscha in einem alten Fort sowie des
britischen Residenten und eines katholischen Bischofs, hat mehrere
sehr schöne Gebäude, eine medizinische Schule, College,
Museum, Hospitäler, eine Sternwarte, eine evang. Mission u.
(1881) 41,173 Einw.
Trivénto, Stadt in der ital. Provinz Campobasso,
am Trigno, Bischofsitz, mit Kathedrale und (1881) 4072 Einw.
Trivia, Beiname der Hekate (s. d.).
Trivial (lat.), alltäglich, abgedroschen;
Trivialitat, Alltäglichkeit, Plattheit, Gemeinplatz.
Trivialschulen s. Freie Künste.
Trivium (lat.) [s. Freie Künste.]
Trivúlzio, berühmte, aus Mailand stammende,
besonders im 16. Jahrh. blühende Familie Italiens.
Bemerkenswert sind: Gian Giacomo T.,M archese von Vigevano, geb.
1436 zu Mailand, nahm 1466 teil am Zug nach Frankreich,
unterdrückte 1476 den Aufstand der Ghibellinen in Genua, trat
1486 in die Dienste des Königs von Neapel, 1494 in
französische, eroberte 1499 das Herzogtum Mailand, wurde
dafür Marschall von Frankreich, später Statthalter von
Mailand. Verdächtigt, mit Venedig und der Schweiz Verbindungen
unterhalten zu haben, fiel er bei dem König in Ungnade, und
als er behufs seiner Rechtfertigung 1518 bei Hof erschien, ward er
so ungnädig empfangen, daß er aus Alteration
darüber bald darauf starb. Vgl. Rosmini, Istoria della vita e
della gesta di J. G. T. (Mail. 1815, 2 Bde.). Sein Bruder
René stand auf seiten der Ghibellinen und starb in
venezianischen Diensten. Dessen Neffe Teodoro trat in
französische Dienste, ward später Obergeneral der
venezianischen Armee, 1524 Gouverneur von Mailand, dann Marschall
von Frankreich und Gouverneur von Genua, übergab dieses an
Andrea Doria und starb 1531 als Gouverneur von Lyon.
Troas, Landschaft in Kleinasien, der nordwestlichste,
zwischen dem Hellespont und dem Adramyttenischen Meerbusen (Golf
von Edremid) vortretende Teil der Halbinsel, seit der Diadochenzeit
unter dem Gesamtnamen Mysien mit inbegriffen, ist
größtenteils erfüllt von den Verzweigungen des zu
1750 m Höhe steil aufsteigenden waldreichen Idagebirges (Kaz
Dagh), zwischen denen nur das eine größere Thal des
Skamandros (Menderes), der zum Hellespont hinab mehrere breitere
Stufenebenen durchfließt, sich hinzieht. Nach dem
vorhistorischen (vielleicht den Illyriern verwandten) Volk der
Troer benannt, wurde es, namentlich an der Küste, von
peloponnesischen Achäern und böotischen Äoliern
besetzt, während sich im Binnenland Reste des alten, mit den
Troern einst eng verbundenen Volkes der Dardaner oder Teukrer bis
in die Zeit der persischen Herrschaft erhielten. T. entspricht etwa
dem heutigen Liwa Tschanak-Kalessi. T. war die Stätte des
Homerischen Troja (s. d.). Wichtigere Orte aus historischer Zeit
waren Dardanos, Abydos, Lampsakos u. a.
Trocadero, Inselfort bei Puerto Real in der Bai von
Cadiz, 21. April 1810 und 31. Aug. 1823 von den Franzosen genommen.
Zur Erinnerung an die letztere Einnahme erhielt diesen Namen eine
Anhöhe auf dem rechten Seineufer in Paris, gegenüber der
Jenabrücke, wo zur Weltausstellung von 1878 von Davioud und
Bourdais ein kolossaler Palast von halbelliptischem Grundriß
erbaut wurde, dessen Mittelbau zu Festen, Musikaufführungen
etc. dient, während die Flügel zu einem
kunstgeschichtlichen Museum von Gipsabgüssen eingerichtet
sind.
Trochanter major, minor (lat.), der größere,
kleinere Rollhügel auf dem obern Abschnitt des Oberschenkels;
s. Hüfte.
Trochäus (griech., auch Choreus), zweisilbiger
Versfuß, aus einer Länge und darauf folgender Kürze
(- ^) bestehend, kommt als Wortfuß vorzüglich im
Deutschen außerordentlich häufig vor. Der
dreifüßige T., Ithyphallikus genannt, findet sich meist
in Verbindung mit andern Rhythmen wie mit Daktylen; der
vierfüßige im dritten Vers der Alkäischen Strophe
und in der neuern spanischen Romanze. Am gebräuchlichsten war
der katalektische Tetrameter (s. d.).
Trochiliden, s. v. w. Kolibris.
Trochilium, s. Glasflügler.
Trochilus, Kolibri; Trochilidae, Familie der Kolibris (s.
d.).
Trochisci, s. v. w. Pastillen.
Trochiten, s. Enkriniten.
Trochitenkalk, s. Triasformation, S. 828.
Trochocephalus, s. Brachykephalen.
Trochtelfingen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Sigmaringen, Oberamt Gammertingen, an der Seckach, hat eine kath.
Kirche, ein Schloß und (1885) 1246 Einw.
Trochu (spr. -schü), Louis Jules, franz. General,
geb. 12. Mai 1815 zu Palais bei Belle-Isle en Mer (Morbihan), trat
1840 als Leutnant in die Generalstabsschule, wurde in Algerien
Adjutant von Lamoricière, 1846 wegen seines tapfern
Verhaltens Adjutant des Marschalls Bugeaud und kam 1851 als
Oberstleutnant ins Ministerium. 1854 ward er Adjutant des
Marschalls Saint-Arnaud und nachher des Generals Canrobert in der
Krim, 24. Nov. Brigadegeneral, erhielt 1855 die 1. Brigade des 1.
Korps und zeichnete sich bei dem Sturm auf den Malakow aus. Als
Divisionsgeneral that er sich 1859 in der Schlacht bei Solferino
hervor. Nach dem Frieden
856
Trockenästung - Trocknen.
trat er wieder ins Kriegsministerium und war von Niel zu seinem
Nachfolger ausersehen. Aber seine Schrift "L'armée
française en 1867" (Par. 1867, 20. Aufl. 1870), welche mit
unerhörtem Freimut alle Schäden der französischen
Armee aufdeckte und die einzige Heilung in der Annahme des
preußischen Wehrsystems sah, entzog ihm die Gunst des Hofs
und machte ihn als Minister des Kaiserreichs unmöglich. Zu
Anfang des Kriegs 1870 erhielt er das Kommando der 12.
Territorialdivision zu Toulouse und ward dann zum Befehlshaber der
Landungsarmee an der deutschen Küste ausersehen. Da diese
Landung unterblieb, ernannte ihn der Kaiser im Lager von
Châlons 17. Aug. zum Gouverneur von Paris. Indes seine
Popularität nützte dem sinkenden Kaiserreich nichts mehr,
und als 4. Sept. dasselbe zusammenbrach, trat T. an die Spitze der
Bewegung und ließ sich zum Präsidenten der Regierung der
nationalen Verteidigung ernennen, blieb aber Generalgouverneur von
Paris und Oberbefehlshaber sämtlicher Streitkräfte in der
Hauptstadt. Während der Belagerung entfaltete er eine
großartige und erfolgreiche Thätigkeit in der
Organisation der Verteidigungsarmee; auch war sein Plan, nach
Nordwesten, nach Rouen, durchzubrechen, gar nicht
unverständig. Derselbe kam jedoch nicht zur Ausführung,
weil T. sich mit der Regierung in Tours nicht verständigen
konnte und selbst unschlüssig war, denn er hatte kein
Vertrauen auf den Erfolg und hielt überhaupt die Verteidigung
von Paris für eine "noble Tollheit". Als die Kapitulation, die
er mit hochtönenden Phrasen verschworen, unvermeidlich war,
legte er sein Amt als Gouverneur 22. Jan. 1871 nieder;
Präsident der Regierung blieb er bis zum Zusammentritt der
Nationalversammlung. Als Mitglied der Nationalversammlung ergriff
er mehrere Male das Wort zu seiner Rechtfertigung; da er indes in
der Armeereformfrage Gegner von Thiers war, erhielt er kein
Kommando und zog sich 1872 in das Privatleben zurück. Vgl.
Trochus Schriften: "L'Empire et la défense de Paris devant
le jury de la Seine" (1872); "Pour la vérité et pour
la justice" (1873); "La politique et le siége de Paris"
(1874) und "L'armée française en 1879, par un
officier de retraite" (anonym, 1879).
Trockeaästung, die Beseitigung abgestorbener, daher
trockner Äste von jungen Nadelhölzern durch Abschneiden
mit der Säge unmittelbar am Stamm zur Verhinderung des
Einfaulens der Aststummel und zur Erzielung astreinen Holzes.
Trockenbagger, s. Bagger und Erdarbeiten.
Trockenblumen, Blumen, welche entweder vermöge ihrer
trocknen Beschaffenheit nach dem Abschneiden ihre Form und Farbe
bewahren, sogen. Immortellen, oder solche, die durch ein
künstliches Verfahren diese Eigenschaft mehr oder weniger
bekommen. Die Immortellen werden noch etwas vor der vollkommensten
Ausbildung geschnitten und, in Bündeln aufgehängt, im
Schatten getrocknet und gefärbt. Die schönsten
Immortellen kommen aus Frankreich, vom Kap und aus Australien.
Wichtiger und interessanter sind die Fortschritte im Trocknen
weicher Blumen, welches vor 40 Jahren die ersten Anfänge
zeigte. Man trocknet jetzt Rosen, Malven, Nelken, Astern, Veilchen
etc. und bindet von allen diesen Blumen prachtvolle
Sträuße, Kränze etc. Die nicht immortellen Blumen
werden, wenn nötig, mit Säuren behandelt, damit sie ihre
Farbe behalten oder trocken eine schönere bekommen. Die ihre
Form leicht verlierenden Blumen trocknet man in Sand, welcher
heiß mit Walrat und Stearin überzogen wurde. Vgl. Lebl,
Zimmergärtnerei (Stuttg. 1878); Hein, Das Trocknen und
Färben natürlicher Blumen und Gräser (Weim. 1875);
Braunsdorf, Das Trocknen, Bleichen etc. natürlicher Blumen und
Gräser (Wien 1888).
Trockendocks, s. Dock.
Trockenfäule (Stockfäule), Kartoffelkrankheit,
bei welcher die Knollen Löcher zeigen, die häufig mit
gelben oder violetten Pilzmassen ausgekleidet sind, und das
gebräunte, zuckerhaltige Gewebe zunderartig locker erscheint.
Die Schale ist meist besetzt mit weißlichen, dichten, etwas
fleischigen Pilzpolstern. Die T. steht in engster Beziehung zur
Naßfäule (s. d.), hat aber mit der durch Peronospora
infestans erzeugten Kartoffelkrankheit nichts zu thun und wird
wahrscheinlich durch Bakterien hervorgerufen. Die Schimmelpilze
siedeln sich erst später an. Die T. trat zuerst 1830 in der
Eifel auf, verbreitete sich bis 1842 mit zunehmender Heftigkeit und
ist seitdem mehr zurückgetreten.
Trockenfrüchte, nich taufspringende
Pflanzenfrüchte, welche keine saftig-fleischige
Fruchthülle haben, wie die Achene (s. d.) und die Nuß
(s. d.).
Trockenmaschine, Vorrichtung zum Trocknen der Gewebe
mittels Wärme, nachdem dieselben gewaschen, gestärkt,
gefärbt oder bedruckt sind. Die Trockenmaschinen führen
ununterbrochen heiße, trockne Luft über die Zeuge oder
bringen letztere mit heißen Körpern in Berührung.
Bei der ersten Anordnung ist der Stoff entweder in einen
horizontalen Rahmen gespannt, der über einen langen Kasten
hinweg bewegt wird, während ein Flügelgebläse
heiße Luft von unten gegen das Zeug treibt
(Rahmentrockenmaschine), oder das letztere wird im Zickzack
über Walzen gezogen, die in geschlossenen Stuben liegen, durch
welche mittels Exhaustoren heiße Luft hindurch gesogen wird.
Bei der zweiten Anordnung benutzt man ausschließlich 3-15 mit
Dampf geheizte, horizontale Drehtrommeln aus Kupfer, mit welchen
der zu trocknende Stoff sich bewegt (Trommel-T.), wie bei der
Papiermaschine (s. Papier, S. 676) beschrieben wurde.
Trockenobst, s. Obst, S. 310.
Trockenöl, s. v. w. Sikkativ.
Trocknen (Austrocknen), Operation, welche die Entfernung
von Wasser aus einer Substanz bezweckt. Sehr wasserreiche
Substanzen werden oft durch eine besondere Operation zunächst
von einem Teil ihres Wassergehalts befreit (entwässert) und
dann erst mehr oder weniger vollständig getrocknet. Da Wasser
schon bei gewöhnlicher Temperatur verdunstet, so trocknen
viele Körper beim Liegen an der Luft, verlieren aber hierbei
ihren Wassergehalt stets nur bis zu einem gewissen, von der
Temperatur, der Feuchtigkeit der Luft, der Stärke des
Luftwechsels und von ihrer eignen Beschaffenheit abhängigen
Grad, sie werden lufttrocken und können durch Erhitzen oder
andre Mittel vollständig getrocknet werden. Die wenigsten
Körper verharren indes im Zustand völliger Trockenheit,
nehmen vielmehr aus der Luft alsbald wieder Feuchtigkeit auf und
folgen den Schwankungen des Wassergehalts der Luft. Zum
Entwässern dienen je nach der Natur des zu behandelnden
Stoffes verschiedene Vorrichtungen. Am häufigsten benutzt man
Pressen, oft aber auch Walzen, die häufig mit Filz oder
Kautschuk überzogen werden. Den zu entwässernden Stoff
leitet man auf endlosem Sieb oder Tuch den Walzen zu und erreicht
auf diese Weise die Möglichkeit kontinuierlichen Arbeitens.
Für viele Zwecke eignen sich vortrefflich die
Zentrifugalmaschinen (Hydroextrakteure), die z. B. zum
Entwässern von Geweben und breiförmigen Substanzen
857
Trocknen (Trockenvorrichtungen).
sehr häufig angewandt werden. Letztere verarbeitet man auch
häufig auf Filterpressen. Mit Wasser durchtränkte Pulver
(Niederschläge) bringt man auf ein geeignetes
Filtriermaterial, welches z. B. auf einer Schicht von
Schamottesteinen ausgebreitet ist, und verdünnt die unter
letztern befindliche Luft, indem man den Kasten, in welchem die
Schamottesteine liegen, mit einer Luftpumpe oder mit einem
Dampfkessel verbindet, der mit Dampf gefüllt und nach
Austreibung der Luft verschlossen und abgekühlt wird
(Vakuumfilter). In ähnlicher Weise entwässert man
kristallinische Massen, indem man sie in konische, an der Spitze
durchlöcherte Blechformen bringt und diese auf einen
Nutschapparat stellt. Letzterer besteht aus horizontal liegenden
Röhren mit zahlreichen kleinen Stutzen, in welche die Spitzen
der Formen luftdicht passen. Ist der ganze Apparat mit Formen
bestellt, so wird er mit einer Luftpumpe in Verbindung gebracht,
welche die zwischen den Kristallen befindliche Flüssigkeit
absaugt. Bisweilen legt man auch die breiartige Masse auf
poröse Platten aus gebranntem Thon oder Gips, und in manchen
Fällen erlaubt die Natur der zu entwässernden Substanz
das Erhitzen in Pfannen, um das Wasser zu verdampfen.
Vorrichtungen zum T. an der Luft sind in der Regel sehr einfach:
Gewebe werden völlig ausgebreitet aufgehangen, knetbare Massen
bringt man in Ziegelform, die auf Stellagen in luftigen Schuppen
aufgestellt werden, und andre Materialien, wie z. B. Leimtafeln,
legt man auf Netze, die in Rahmen ausgespannt sind. Das T. an der
Luft ist aber der wechselnden Witterungsverhältnisse halber
wenig praktisch, und man wendet deshalb ganz allgemein
künstliche Trockenvorrichtungen an, die je nach der Natur der
zu trocknenden Substanz und der zu erzeugenden Temperatur sehr
verschieden konstruiert sind. Ist Temperaturerhöhung
überhaupt ausgeschlossen, so ist man meist auf die
Herbeiführung starken Luftwechsels, wie auf den
Trockenböden oder durch Ventilatoren, beschränkt, da die
Anwendbarkeit hygroskopischer Substanzen eine eng begrenzt ist.
Beim Arbeiten im kleinen benutzt man einen Exsikkator, eine
Glasglocke mit abgeschliffenem Rande, die man auf eine matt
geschliffene Glasplatte stellt. Unter die Glocke bringt man eine
flache Schale mit konzentrierter Schwefelsäure oder
Chlorcalcium und auf einen Dreifuß aus Draht oder
Glasstäben eine Porzellanschale, in welche die zu trocknende
Substanz gelegt wird. In ähnlicher Weise kann man einen gut
schließenden Kasten oder Schrank zum T. von Zigarren
anwenden.
Bei den Trockenvorrichtungen mit erwärmter Luft hat man zu
unterscheiden, ob die Substanz in dem Trockenraum unverändert
an einer Stelle verbleibt oder ihren Platz wechselt. Ersteres
geschieht z. B. in den Trockenstuben der Zuckerfabriken, in welchen
Gestelle angebracht sind, um sie bis zur Decke mit Zuckerbroten
füllen zu können. Nahe am Boden liegen
Dampfheizröhren und sind Öffnungen angebracht, durch
welche trockne Luft einströmt, während die feuchte Luft
durch Öffnungen in der Decke abzieht. Die Heizung solcher
Trockenkammern, in welchen das Material auch auf Horden
ausgebreitet werden kann, geschieht auch durch Röhren, welche
von den abziehenden Feuerungsgasen durchströmt werden, durch
heiße Luft. durch Kanäle mit eigner Feuerung etc.
Bisweilen kann man auch die Feuerungsgase direkt zum T. benutzen,
wie in manchen Malzdarren und in den Holzdarröfen, welche aus
langen Kanälen zur Aufnahme des Holzes bestehen, vor denen die
Feuerung angebracht ist. Um in diesem Fall das Überschlagen
der Flamme, Funkenfliegen und Schwärzung des Holzes durch
Ruß zu vermeiden, hat man eine Feuerung konstruiert, bei
welcher die Verbrennung von oben nach unten fortschreitet und die
Verbrennungsgase durch das Brennmaterial und den Rost strömen
und dann aufwärts über eine Mauer steigen müssen, um
zu dem zu trocknenden Holze zu gelangen. Der Eingang zur Esse liegt
am andern Ende des Trockenraums am Boden. Pulverförmige
Materialien werden häufig in Pfannen oder auf Herden aus
Eisenblech, Kalksteinplatten od. dgl. getrocknet, welche man mit
aus Abdampfpfannen entweichenden Dämpfen oder mit
Feuerungsgasen, nachdem sie unter Abdampfpfannen zirkuliert haben,
heizt. Die Feuerungsgase geben eine höhere Temperatur als
Dampf. Bei der Kastentrocknung bringt man die zu trocknende
Substanz auf Horden, die den Boden eines Kastens bilden, leitet
durch eiserne Röhren, welche auf irgend eine Weise erhitzt
werden, warme, trockne Luft unter die Horden, so daß dieselbe
das zu trocknende Material durchströmt, und läßt
sie über demselben durch die Esse entweichen. Ähnlich
sind Malzdarren konstruiert, bei welchen das Malz auf einem
horizontalen Drahtgeflecht, auf durchlochtem Blech etc.
ausgebreitet wird. Unter diesem Boden liegen Röhren oder
Kanäle, die von heißer Luft durchströmt werden, und
zwischen denselben steigt die Luft auf, welche die Malzschicht
durchdringen soll. Vorteilhaft bringt man über der letztern
noch eine oder zwei Darrflächen an, welche von der warmen,
noch nicht völlig mit Dampf gesättigten Luft, die von der
ersten Darrfläche aufsteigt, durchströmt werden
müssen. Sehr beschleunigt wird das T., wenn man die
Verdampfung des Wassers und die Ableitung der gebildeten
Dämpfe durch Anwendung einer Luftpumpe befördert. Man
bringt die zu trocknende Substanz in luftdicht verschließbare
eiserne Gefäße, erhitzt diese von außen durch
Dampf und setzt sie dann mit einer Luftpumpe in Verbindung. Hat man
brei- oder pulverförmige Substanzen zu trocknen, so muß
man durch Umrühren für beständige Erneuerung der
Oberfläche sorgen. Beim T. der Exkremente werden dieselben
zunächst im Vakuum zu dickem Brei eingedampft, den man durch
langsam rotierende Bürsten auf mit Dampf gegeheizte kupferne
Walzen in dünnen Lagen aufträgt. Während die Walzen
sich langsam umdrehen, trocknet die Masse und wird durch andre
kleine, mit Spitzen besetzte Walzen von der Trockenwalze
abgelöst und in Pulver verwandelt. Ein sehr brauchbarer
Apparat zum T. von Salz besteht aus sechs übereinander
zwischen vier Säulen angebrachten hohlen und durch Dampf
heizbaren Scheiben, durch welche eine rotierende vertikale Welle
hindurchgeht. An dieser Welle sind Rührapparate befestigt, die
das Salz abwechselnd nach der Peripherie und der Mitte der Scheibe
befördern, von wo es durch Löcher von einer Scheibe auf
die andre gelangt. Außerdem rollt auf der dritten und der
letzten Scheibe eine Walze, welche Salzklümpchen zerkleinert.
Dieser Apparat gestattet kontinuierliche Arbeit ebenso wie die
Malzdarren mit mehreren Darrflächen, bei denen das Malz von
der obersten allmählich auf die unterste und heißeste
Darrstäche gelangt. Ein ähnliches Prinzip findet bei den
Trockenapparaten Anwendung, bei welchen heiße Luft einen
langen Kanal durchströmt, während die zu trocknende
Substanz in Behältern oder auf endlosen Tüchern oder
Ketten durch den Kanal dem Luftstrom entgegengeführt wird.
Dies muß so langsam geschehen, daß sie völlig
getrocknet am heißesten Ende des Kanals anlangt. Gewebe
werden auch über Walzen durch einen geheizten Raum
858
Trockner Wechsel - Troizko-Sergiewsches Kloster.
geleitet, oder man leitet sie wie auch das Papier über
hohle, durch Einleiten von Dampf erhitzte Walzen (vgl.
Trockenmaschine). Derartige Walzen kann man auch zum T. von Pulver
benutzen, wenn man dies auf endlosen Tüchern über die
Walzen leitet. - Zum T. von Flüssigkeiten genügt
anhaltendes Erhitzen, wenn der Siedepunkt der betreffenden
Flüssigkeit bedeutend höher liegt als der des Wassers.
Flüchtige Flüssigkeiten kann man vorteilhaft destillieren
und unter Anwendung von Rektifikatoren und Dephlegmatoren, wie sie
zur Trennung des Alkohols vom Wasser in der Spiritusfabrikation
benutzt werden, vom Wassergehalt befreien. Ein vollständiges
T. erreicht man indes auf diese Weise in der Regel nicht, vielmehr
muß man zur Entfernung der letzten Spuren von Wasser
hygroskopische Substanzen anwenden, welche bei längerm
Verweilen in der Flüssigkeit die Feuchtigkeit vollständig
absorbieren. Oft führt nur wiederholte Destillation über
solche Substanzen zum Ziel. Die Auswahl der letztern richtet sich
nach der Natur der Flüssigkeit, die nicht chemisch auf die
Trockensubstanz einwirken darf. Am häufigsten benutzt man
Chlorcalcium, gebrannten Kalk, wasserfreies kohlensaures Kali oder
schwefelsaures Kupferoxyd, wassersreie Oxalsäure,
Phosphorsäureanhydrid etc. - Gase verlieren den
größten Teil ihres Wassergehalts durch starkes
Abkühlen in einer Röhrenleitung von hinreichender
Länge (vgl. Leuchtgas, S. 734). Wo dies nicht genügt,
kann man sie durch Trockenröhren leiten, welche mit
porösem Chlorcalcium gefüllt sind, oder durch
konzentrierte Schwefelsäure. Man befeuchtet mit letzterer auch
Bimsstein, den man in Röhren füllt, oder läßt
die Schwefelsäure in einem mit Koks gefüllten Turm in
gleichmäßiger Verteilung herabfließen,
während das Gas unten in den Turm eintritt und der Säure
entgegenströmt.
Trockner Wechsel, s. Wechsel.
Trockner Weg, s. Nasser Weg.
Troctes, Bücherlaus.
Troddelblume, s. Soldanella.
Trödelhandel (Trödelgewerbe), Kleinhandel,
durch welchen gebrauchte Sachen (gebrauchte Kleider, Betten,
Wäsche, altes Metallgerät, Metallbruch u. dgl.) umgesetzt
werden. Mit Rücksicht darauf, daß der T. leicht zur
Hehlerei mißbraucht werden kann, ist in der deutschen
Gewerbeordnung (§ 35) bestimmt, daß dieser Handel
untersagt werden kann, wenn Thatsachen vorliegen, welche die
Unzuverlässigkeit des Gewerbtreibenden in Bezug auf diesen
Gewerbebetrieb darthun. Im Umherziehen darf der T. nicht
ausgeübt werden (deutsche Gewerbeordnung, § 56, Ziffer
2).
Trödelvertrag (Contractus aestimatorius), der
Vertrag, vermöge dessen jemand einem andern eine Sache mit der
Auflage übergibt, nach einer gewissen Zeit entweder diese
Sache zurückzugeben, oder einen bestimmten Geldbetrag
dafür zu überliefern. Die Übergabe jener Sache
erfolgt in der Erwartung, daß der Trödler dieselbe zu
verkaufen suchen werde. Ein etwaniger Mehrerlös kommt, wenn
nichts andres verabredet war, dem Trödler zu gute.
Trogen, Dorf und gewissermaßen Hauptort des
schweizer. Halbkantons Appenzell-Außer-Roden, am Fuß
des Gäbris, mit Kantonschule, Baumwollweberei,
Musselinstickerei und (1880) 2629 Einw.; ist mit Hundwyl
abwechselnd Sitz der Landsgemeinde, zugleich Sitz des
Obergerichts.
Troglodyten (griech., Höhlenbewohner), allgemeine
Bezeichnung auf einer niedrigen Kulturstufe stehender Völker,
welche in bloßen Erdhütten oder Höhlen wohnten.
Troglodytenland (Troglodytica) hieß insbesondere die
Küste des heutigen Abessinien von Berenike nach S. zu.
Troglodytes, Schimpanse.
Troglodytes, Vogel, s. v. w. Zaunkönig;
Troglodytidae (Schlüpfer), Familie der Sperlingsvögel (s.
d. 3).
Trogons (Trogonidae), s. Klettervögel (12).
Trogus Pompejus (oder in richtigerer Ordnung Pompejus
Trogus), röm. Geschichtschreiber zur Zeit des Augustus,
stammte aus Gallien, schrieb eine Universalgeschichte von
Erschaffung der Welt bis auf seine Zeit, welche den Namen
"Historiae Philippicae" führte, weil die Geschichte des
makedonischen Reichs und der mit diesem in Zusammenhang stehenden
Völker den Hauptinhalt bildete. Nur die "Prologi" zu den 44
Büchern (hrsg. von Grauert, Münst. 1827; nebst einigen
andern, meist als unecht erwiesenen Fragmenten von Bielowski, Lemb.
1853) und der Auszug des Justinus (s. d. 1) sind auf uns
gekommen.
Troika (russ.), s. Kibitka.
Troikart, s. Trokar.
Troilit, Mineral, Bestandteil vieler Meteoriten, besteht
aus Schwefeleisen FeS.
Troilos, der von Achilleus getötete jüngste
Sohn des Priamos und der Hekabe.
Troina, Stadt in der ital. Provinz Catania (Sizilien),
Kreis Nicosia, auf einem Felskamm, 1113 m ü. M., nahe am
Fluß T., einem Zufluß des Simeto, gelegen, hat Reste
des antiken Imachara, Mützen- und Strumpfwirkerei und (1881)
10,072 Einw. T. ward 1062 von den Normannen unter Roger eingenommen
und erhielt 1078 das erste katholische Bistum in Sizilien.
Trois Rivières (spr. troa riwjähr, auch Three
Rivers, "drei Flüsse"), Stadt in der britisch-amerikan.
Provinz Quebec, an der Mündung des St. Maurice in den St.
Lorenzstrom, hat Eisengießerei, Sägemühlen,
lebhaften Holzhandel und (1881) 9296 Einw.
Troizk, Kreisstadt im russ. Gouvernement Orenburg, am Ui
und der Uwelka, hat 3 griech. Kirchen, 2 Moscheen, besuchte Messen,
ein Gymnasium und ein weibliches Progymnasium, einen großen
Kaufhof und (1885) 18,497 Einw., welche lebhaften Tauschhandel mit
den Kirgisen treiben.
Troizkosawsk, russ. Grenzfestung im sibirischen Gebiet
Transbaikalien, Sitz des Befehlshabers der Transbaikalischen
Kosaken, ein großer wohlgebauter Ort mit Kirchen und
steinernen Gebäuden, freundlich und schmuck wie keine andre
sibirische Stadt, nur 4 km nördlich von dem tiefer gelegenen
Kiachta (s. d.), hat eine Realschule, ein weibliches Progymnasium
und (1885) 6117 Einw.
Troizko-Sergiewsches Kloster (Troiza Lawra Sergiew,
"Dreieinigkeitskloster des heil. Sergius"), das größte,
reichste und geschichtlich berühmteste Kloster des russischen
Reichs, im Gouvernement Moskau, 70 km von Moskau, an der Eisenbahn
Moskau-Jaroslaw gelegen. Dasselbe gleicht, mit hohen Mauern,
Wällen und Gräben umgeben, einer Festung und enthält
einen kaiserlichen Palast, die Wohnung des Metropoliten und des
Archimandriten, 11 Kirchen und Kapellen, eine geistliche Akademie
mit wertvoller Bibliothek, ein theologisches Seminar, eine
Elementarschule für arme Kinder, ein großes Kaufhaus,
große Gärten etc. Die größte und
schönste Kirche ist die der Verklärung Mariä
gewidmete Uspenskikathedrale mit fünf Goldkuppeln und den
Grabmälern geschichtlich berühmter Männer und
Frauen. Die kleine Kirche der Dreieinigkeit (Troizky Chram)
enthält den silbernen, mit Edelsteinen ge-
859
Troja.
schmückten Sarkophag des heil. Sergius. Das Kloster soll
einen Schatz von 600 Mill. Silberrubel besitzen und hatte 1764 zur
Zeit der Einziehung der Klostergüter 106,608 leibeigne Bauern.
Die Zahl der dahin Wallfahrenden beträgt jährlich fast
eine Million. - Das Kloster ward 1338 vom heil. Sergius unter der
Regierung Simeons des Stolzen erbaut und ist den Russen als Ort
wichtiger Begebenheiten heilig. Hier segnete Sergius 1380 den
Großfürsten Dmitrij, als er in den Kampf gegen Mamai
zog; in der Regierungszeit des Wasilij Schuiskij wurde es vom 29.
Sept. 1608 bis 12. Jan. 1610 von den Polen unter Lisowski und dem
Hetman Sapieha und wieder 1615 von dem polnischen Prinzen Wladislaw
vergeblich belagert. Hier fanden 1685 die Zaren Iwan und Peter vor
den aufständischen Strelitzen Schutz, und letzterer machte von
hier aus der Herrschaft seiner Schwester Sophia ein Ende. Vgl.
Philareth, La vie de saint Serge (a. d. Ruff., Petersb. 1841).
Troja (Ilion, Ilios), mythische Hauptstadt des Volkes der
Troer in der Landschaft Troas (s. d.), am Fuß einer
Anhöhe des Ida an oder in der Küstenebene des Skamandros
(heute Menderes) gelegen, war mit starken Mauern umgeben und wurde
durch die feste, auf der Spitze der Anhöhe liegende Burg
Pergamos beschützt, in welcher sich sämtliche Tempel, vor
allen der der Pallas gewidmete Haupttempel, befanden. Nach der
gewöhnlichen Annahme wurde T. 1184 (nach andern 1127) v. Chr.
von den Griechen zerstört (s. Trojanischer Krieg). Die Lage
dieses ältesten Homerischen T. wurde seit Le Chevalier, der
1785-86 die troische Ebene besuchte, auf dem Felsen von Bunarbaschi
(144 m ü. M.) gesucht, wo einige aus Feldsteinen
aufgeschüttete Hügel als "Grab des Priamos", "Grab des
Hektor" etc. bezeichnet werden. Die dort vorhandenen Mauerreste
stammen jedoch nach Schliemann meist erst aus hellenistischer Zeit;
sie gehören einer Burg an, welche mit einer gegenüber,
auf der andern Seite des Skamandros gelegenen Burg das
Flußthal beherrschte. Weiter unterhalb macht der Menderes
(Skamandros) eine Biegung nach WNW.; ihm parallel zieht sich weiter
nördlich der Kalafatli-Asmak (das alte Bett des Skamandros)
hin. Auf dessen nordöstlichem Ufer erhebt sich eine zweite
Anhöhe, welche nordwärts zum Thal des Dumbrek-Tschai (des
alten Simoeis) abfällt; es ist die Höhe von Hissarlyk, 50
m ü. M., 35 m über der Ebene. Hier war zur Zeit, als in
Lydien die Mermnaden herrschten (689-546 v.Chr.), also vor der
Unterwerfung Kleinasiens durch die Perser und lange nach der
Zerstörung Trojas, ein neues äolisches Ilion entstanden,
das in der Römerzeit eine gewisse Bedeutung erlangte (Reste
eines Athenetempels und eines Thorgebäudes), aber
gegenwärtig in Trümmern liegt. Schliemann (s. d.) hat nun
durch fortgesetzte, in den Jahren 1870-82 vorgenommene Ausgrabungen
nachgewiesen, daß auf dem die Ebene um 18 m überragenden
Felsen von Hissarlyk sieben verschiedene untergegangene
"Städte" (richtiger Burgen) übereinander gelegen haben.
In der zweiten von ihnen, etwa 7-10 m unter der jetzigen
Oberfläche glaubt er die Burg der Homerischen Stadt entdeckt
zu haben, eine Annahme, die darin eine Stütze findet,
daß die Trümmer von einer starken Schicht von
Brandschutt überdeckt sind. Schliemanns Ausgrabungen (s.
obenstehende Kärtchen) erstrecken sich auf mehrere Thore im S.
und W. der Burg, die Mauern auf der Süd- und Westseite, zwei
kleinere Gebäude, welche für Teile des ehemaligen
Königspalastes gelten dürfen. Von weit höherer
Bedeutung ist der sogen. Große Schatz, welcher unweit des
Südwestthors in der obern Lehmziegelmauer gefunden wurde. Er
enthält außer vielen Kupfergeräten eine Menge
Gefäße (Becher, Schalen) und Schmuckgegenstände
(Ketten, Armbänder,
[Kärtchen der Ebene von Troja.]
[Plan von Troja (Ausgrabungen Schliemanns).]
860
Troja - Trokar.
Diademe, Ringe) aus Gold und Silber, welche eine dem 2.
Jahrtausend v. Chr. angehörende Kulturstufe kennzeichnen. Sie
sind zum größten Teil in das Museum für
Völkerkunde zu Berlin, wenige ins türkische Museum im
Serail zu Konstantinopel oder in Schliemanns Haus in Athen gelangt.
Schliemanns Hypothese fand sofort die Anerkennung englischer
Forscher, die deutschen wiesen sie zunächst zurück, wie
z. B. R. Hercher, der noch 1876 behauptete, daß Homers
Schilderung rein dichterisch die natürlichen Verhältnisse
umgestaltet habe und durchaus nicht mit der wirklichen
Örtlichkeit zu vereinigen sei. Erst neuerdings hat Schliemann
auch in Deutschland mehr und mehr Anklang gefunden. Aus der
reichhaltigen Litteratur über T. vgl. außer den
ältern Werken von Le Chevalier ("Voyage de la Troade", 3.
Aufl., Par. 1802, 3 Bde.), Webb ("Topographie de la Troade", das.
1844), Forchhammer (Frankf. a. M. 1850), Clarke (Edinb. 1863)
hauptsächlich die Veröffentlichungen Schliemanns:
"Trojanische Altertümer" (Leipz. 1874), "Ilios" (das. 1881),
"Reise in der Troas" (das. 1881), "Troja" (das. 1883); ferner
Christ, Topographie der trojanischen Ebene und die Homerische Frage
(Münch. 1874); Eckenbrecher, Die Lage des Homerischen T.
(Düsseld.1875); O. Keller, Die Entdeckung Ilions zu Hissarlik
(Freiburg 1875); Steitz, Die Lage des Homerischen T.
("Jabrbücher für klassische Philologie" 1875); Hercher,
Über die Homerische Ebene von T. (Berl. 1876); Ed. Meyer,
Geschichte von Troas (Leipz. 1877); E. Brentano: Alt-Ilion im
Dumbrekthal (Heilbr. 1877), Zur Lösung der trojanischen Frage
(das. 1881), T. und Neu-Ilion (das. 1882); Virchow, Beiträge
zur Landeskunde der Troas (Berl. 1880).
Troja, Stadt in der ital. Provinz Foggia, Kreis Bovino,
am Celone, Bischofsitz, hat ein geistliches Seminar, eine 1093
gegründete schöne Kathedrale und (1881) 6722 Einw. T.
ward im 10. Jahrh. von Griechen angelegt; hier 1462 Sieg Ferdinands
I von Aragonien über die Anhänger des Herzogs von
Anjou.
Trojan, Kreishauptstadt in Bulgarien, am Osem
südlich von Lowatz im Balkan gelegen, 400 m ü. M., mit
(1881) 6301 Einw., welche hauptsächlich Viehzucht, Acker- und
Obstbau treiben.
Trojanischer Krieg, der zwischen Griechen und
Kleinasiaten bei Troja nach der gewöhnlichen Annahme von 1193
bis 1184 v. Chr.geführte Krieg. Die Sage berichtet über
denselben: Als Paris, der zweite Sohn des Königs Priamos von
Troja, das Recht der Gastfreundschaft verletzend, des Königs
Menelaos von Sparta Gemahlin, die von Aphrodite ihm bestimmte
schöne Helena, entführt hatte, verweigerte Priamos der an
ihn geschickten Gesandtschaft deren Herausgabe. Darauf ward von den
griechischen Fürsten der Rachezug gegen Troja beschlossen. Die
hervorragendsten unter den Helden, welche sich zu Aulis in
Böotien versammelten, waren: Menelaos und dessen Bruder
Agamemnon, Odysseus, Diomedes, Achilleus, Patroklos, Nestor, Aias
der Oilier und Aias der Telamonier, Philoktetes und Idomeneus.
Agamemnon ward zum Oberanführer gewählt, und nach einigem
durch Windstille verursachten Aufenthalt (s. Iphigenie) segelte die
Flotte ab nach Kleinasiens Küste. Unterdes hatten aber auch
die Trojaner ihre Stadt befestigt. Ihre Bundesgenossen waren
Makedonier, Thraker, Assyrer, Äthiopier und ihr vornehmster
Held Hektor, des Priamos ältester Sohn. Neun Jahre lang
währte der Kampf ohne Entscheidung, und die Griechen
unternahmen während dessen zahlreiche
Plünderungszüge in Kleinasien. Im 10. Jahr brach der
Zwist zwischen Agamemnon und Achilleus aus, infolge dessen sich
dieser eine Zeitlang vom Kampf zurückzog und die Griechen
wiederholte Niederlagen erlitten. Schon rieten im Lager der
Griechen viele zum Rückzug, aber nach Achills Wiedereintritt
in den Kampf und dem Fall Hektors kam für Troja dennoch der
Tag des Untergangs. Infolge eines Orakelspruchs schlichen sich
Diomedes und Odysseus in die Stadt und entwendeten aus dem Tempel
der Athene das ihr geheiligte Bild (Palladium), das Schutzheiligtum
der Stadt, wodurch das Glück von den Trojanern wich. Hierauf
ließen die Griechen auf des Odysseus Rat ein kolossales
hölzernes Pferd erbauen, in dessen hohlem Bauch sich eine
auserlesene Schar verbarg. Die übrigen Griechen begaben sich
auf ihre Schiffe und fuhren in der Nacht davon. Als nun am andern
Tag die Trojaner das Griechenlager verlassen sahen, strömten
sie scharenweise aus der Stadt, sich wundernd über das
seltsame Ungeheuer, bis ihnen ein im nahen Schilf aufgefundener
Grieche, Sinon, berichtete, daß die über den Raub ihres
Heiligtums erzürnte Göttin Athene den Trojanern zum
Ersatz dies Pferd geschenkt habe. Des warnenden Laokoon Schicksal
beschwichtigte jeden Argwohn, es ward ein Stück der Mauer um
Troja eingelegt, der Koloß nach der Stadt gezogen und neben
dem Tempel der Athene aufgestellt. In der Nacht entstiegen die
Griechen dem Bauch des Pferdes, und die griechischen Schiffe
kehrten zurück. Ein allgemeines Blutbad begann, die Stadt ward
angezündet und geplündert. Nur einer kleinen Schar von
Trojanern unter der Anführung des Äneas gelang es, sich
durch die Flucht zu retten und in Italien eine neue Heimat zu
begründen. Viele der heimkehrenden Griechen fanden unterwegs
ihren Untergang; andre, namentlich Odysseus, erreichten erst nach
mancherlei Irrfahrten ihr Vaterland; noch andre fanden in der
Heimat ihre Herrschersitze von andern eingenommen, weshalb entweder
sie selbst oder ihre Söhne in fremden Ländern Kolonien
gründeten. Dies ist der Inhalt der Sage, wie sie uns in den
Homerischen Gedichten, vor allen in der Iliade, welche aber nur den
Zorn des Achilleus und den Tod Hektors erzählt, dann in den
Epen der Kykliker und nach diesen in Vergils Äneide
überliefert ist. Die griechischen Historiker haben den
Trojanischen Krieg für wirkliche Geschichte gehalten und ihn
als festen Punkt angenommen, an den sie ihre Zeitrechnung
anknüpften. Auch neuere Gelehrte nehmen wenigstens einen
historischen Kern der Sage an, während die Ansicht mehr
Wahrscheinlichkeit für sich hat, daß der Krieg nur ein
Spiegelbild der Kämpfe ist, welche die Äolier und
Achäer um 1050 v. Chr. bei der Kolonisation der
kleinasiatischen Küste mit den den Griechen stammverwandten
Dardanern am Hellespont zu bestehen hatten; an den Thaten ihrer
Vorfahren, welche sie in ihren Gesängen verherrlichten,
ermutigten und stärkten sich nicht nur die Hellenen in dem
langwierigen Kampf, sondern sie glaubten auch durch die Annahme
einer frühern Eroberung Trojas durch ihre Väter ein
Anrecht auf die begehrten Länder zu erwerben. Vgl. E.
Rückert, Trojas Ursprung, Blüte, Untergang (Gotha 1846),
und die Litteratur zu Troja; ferner Schneider, Der troische
Sagenkreis in der ältesten griechischen Kunst (Leipz.
1886).
Trokar (Troikart, v. franz. trois quarts), dolchartiges
chirurg. Instrument, das aus einem dreikantig zugespitzten Stilett
von Stahl mit Holzgriff und aus einer Metallhülse
zusammengesetzt ist, welche, über den Dolch gestreift, nur
dessen Spitze frei läßt. Man bedient sich des Trokars,
um aus natürlichen oder
861
Troki - Trollope.
krankhaften Körperhöhlen durch Punktion abnorme
Flüssigkeiten zu entleeren, da das Stilett, nachdem der
Einstich gemacht ist, herausgezogen wird. Durch die Röhre
können, wenn der Ausfluß beendet ist, auch Medikamente
eingespritzt werden. Anwendung findet der T. bei Wassersuchten
aller Art, Wasserbruch, Kropf, Brustfellentzündungen,
Echinokokkusblasen, Eierstocksgeschwülsten etc., auch zur
Entfernung der Luft aus dem durch zu viel frisches Futter
aufgeblähten Pansen der Wiederkäuer. Die Figuren zeigen
einen großen (1), zwei kleine (2 u. 3), einen Probetrokar (4)
und einen gebogenen T. (5).
[Trokare.]
Troki, Kreisstadt im litauisch-russ. Gouvernement Wilna,
an einem See, mit (1885) 2456 Einw.
Trokieren, s. Barattieren.
Troll, in der nord. Mythologie eine Art böser
Geister, Zauberwesen in Menschengestalt. Hübsche Sagen von
ihnen in Asbjörnsens "Norwegischen Volksmärchen" (Leipz.
1881).
Trollhättafälle, s. Götaelf.
Trollius L., Gattung aus der Familie der Ranunkulaceen,
Kräuter mit gelappten Blättern und einzeln stehenden,
großen, meist gelben Blüten. Von den neun in der
nördlichen gemäßigten Zone heimischen Arten kommt
T. europaeus L. (Trollblume, Glotzblume) auf Wiesen auch in
Deutschland vor, sie wird wie T. asiaticus L. mit orangegelben
Blüten, aus dem nördlichen Asien, und andre Arten in
Gärten als Zierpflanze kultiviert.
Trollope (spr. tróllop), 1) Frances, engl.
Schriftstellerin, geboren um 1779 zu Heckfield, Tochter des
dortigen Vikars Multon, verheiratete sich 1809 mit dem Advokaten
Thomas Anthony T., welcher 1835 starb. Eine Frucht ihres
dreijährigen Aufenthalts in Amerika war: "Domestic manners of
the Americans" (Lond. 1832, neue Ausg. 1849), worin sie
schonungslos und einseitig die Schwächen des amerikanischen
Volkscharakters rügt. Das Buch wurde mit begreiflicher
Entrüstung in Amerika aufgenommen, mag aber doch nicht ohne
Einfluß auf die fernere Entwickelung des amerikanischen
Charakters geblieben sein. Derselbe satirische Geist spricht aus
der Novelle "The refugee in America" (1830, 3 Bde.), während
sie indem Reisewerk "Belgium and Western Germany" (1833, 2 Bde.)
mehr Anerkennung für die Vorzüge dieser Länder
zeigt. Ihren Kampf mit den Amerikanern erneuerte sie in der Novelle
"The adventures of Jonathan Jefferson Whitlaw" (1836), welche das
Elend der farbigen Bevölkerung in den Sklavenstaaten Amerikas
schildert. Zugleich erschien: "Paris and the Parisians in 1835"
(1836, neue Ausg. 1842); darauf "The vicar of Wrexhill" (1836, neue
Ausg. 1860; deutsch, Aachen 1837, 3 Bde.), ihre beste Novelle, zwar
voll von Vorurteilen, jedoch auch voll trefflicher
Sittenschilderung, und ein neues Reisewerk: "Vienna and the
Austrians" (1838), worin sie sich weit vorurteilsvoller zeigt als
in jenem über Belgien. Es folgte eine Reihe von Novellen und
ein Reisebericht über Italien ("Visit to Italy". 1842, 2
Bde.). T. starb 6. Okt. 1863 in Florenz.
2) Thomas Adolphus, engl. Romanschriftsteller und
Kulturhistoriker, Sohn der vorigen, geb. 29. April 1810, studierte
in Oxford und nahm 1842 seinen dauernden Wohnsitz in Florenz, wo er
sich in vollem Maß in die italienischen Dinge einlebte,
für die er denn auch eine Autorität geworden ist. Er
veröffentlichte: "Girlhood of Catharine de Medici" (1856);
"Tuscany in 1849 and 1850" (1859); "A decade of Italian women"
(1859); "Paul the Pope and Paul the Friar" (1860); "Filippo
Strozzi: last days of old Italian liberty" (1860); "Lenten journey
in Umbria and the Marches", Reisebild (1882); "History of the
commonwealth of Florence", sein Hauptwerk (1865, 4 Bde.); "Papal
conclaves" (1876); eine vielfach angegriffene Geschichte des
Papstes Pius IX. (1877, 2 Bde.) u. a. Auch hat T. seine Studien
italienischen Volkslebens in Romanen niedergelegt, von denen wir
nennen: "La Beata" (1861), "Marietta" (1862), "Beppo the conscript"
(1864), "Gemma" (1866), "Durnton Abbey"^ (1871) und "Diamond cut
diamond" (1875), ein Gemälde italienischen Hirtenlebens, und
zuletzt das autobiographische Werk veröffentlicht: "What I
remember" (1887, 2 Bde.). - Seine Gattin Frances Eleanor T., seit
1866 mit ihm vermählt, hat ebenfalls eine Reihe von Romanen
veröffentlicht, so: "Aunt Margaret's trouble" (1866); "The
sacristan's household" (1876); "Veronica" (1876); "Black spirits
and whitte" (1877); "Like ships upon the sea" (1883); "My own
love-story" (1882); "That unfortunate marriage" (1888) u. a. Mit
ihrem Gatten gab sie "The homes and haunts of Italian poets" (1881,
2 Bde.), eine Reihe von anziehenden Aufsätzen, heraus.
3) Anthony, Bruder des vorigen, Romanschriftsteller, geb. 24.
April 1815, erhielt seine Erziehung in Winchester und Harrow und
bekleidete viele Jahre eine höhere Stellung in der englischen
Postverwaltung. Sein erster Roman: "The Macdermots of Ballycleran"
(1847), errang großen Erfolg, und hierdurch ermutigt, schritt
er rüstig vorwärts auf der eingeschlagenen Bahn,
englisches Leben und zwar vorzugsweise das Kleinleben der
höhern Stände in künstlerischen Gebilden
vorzuführen. Wir nennen von seinen angenehm und mit
großem Talent, aber ohne besondere Vertiefung geschriebenen
Romanen, deren Zahl sich auf etwa 80 Bande beläuft: "The
Kellys and the O'Kellys" (1848); "The Warden" (1855); "The three
clerks" (1857); "The Bertrams" (1859); "Castle Richmond" (1860),
ein Lebensbild aus dem südlichen Irland; "Rachel Ray" (1863);
"Sir Harry Hotspur of Humble Thwaite" (1870); "Lady Anna" (1874);
"The American senator" (1876); "Mr. Scarborough's family" (1883)
etc. Auch hat T., der in dienstlichen Angelegenheiten wiederholte
Reisen nach den Kolonien unternahm, viele Reiseschriften
veröffentlicht, so: "West Indies and Spanish main" (1859, 7.
Aufl. 1869), "Nortb America" (1862, 2 Bde.), "Travelling sketches"
(1866), "Australia and New Zealand" (1873), "South Africa" (4.
Aufl. 1878, 2 Bde.), "New South Wales and Queensland" (1874),
"Victoria and Tasmania" (1874) u. a. Er starb 6. Dez. 1882 in
London. Eine Ausgabe gesammelter Romane erschien 1871 in 11
Bänden. Vgl. seine "Autobiography" (Lond. 1883, 2 Bde.).
4) Francis, Pseudonym, s. Féval.
862
Tröltsch - Trommelsucht.
Tröltsch, 1) Eugen, Freiherr von, Kartograph, geb.
28. April 1828 zu Ulm, gehörte bis 1864 der
württembergischen Armee an und erhielt 1879 den Majorsrang. Er
gab Dislokationskarten der deutschen, französischen und
russischen Heere heraus und übernahm im Auftrag der Deutschen
Anthropologischen Gesellschaft den Entwurf der prähistorischen
Karte von Deutschland und Nachbarländern, von welcher bis
jetzt Südwestdeutschland und die Schweiz erschienen sind.
Außerdem veröffentlichte er das Werk "Fundstatistik der
vorrömischen Metallzeit im Rheingebiet" (Stuttg. 1884), eine
prähistorische Karte von Schwaben sowie eine Karte über
die Verbreitung der Werkzeuge aus Nephrit, Jadeit und
Chloromelanit. T. ist auch Mitarbeiter an dem im amtlichen Auftrag
von Paulus herausgegebenen Werk "Die Kunst- und Altertumsdenkmale
im Königreich Württemberg".
2) Anton Friedrich, Freiherr von, Mediziner, geb. 3. April 1829
zu Schwabach bei Nürnberg, studierte seit 1847 in Erlangen die
Rechte, seit 1848 in München Naturwissenschaft und 1849-53 in
Würzburg Medizin. Nachdem er sich noch in München mit
Chemie und Physik beschäftigt hatte, widmete er sich in Berlin
und Prag der Augenheilkunde und ging nach England und Irland, um
unter Toynbee und Wilde die Behandlung der Ohrenkrankheiten zu
studieren. Nach einem Winteraufenthalt in Paris kehrte er nach
Würzburg zurück und arbeitete hier über die Anatomie
des Trommelfells. 1857 begann er seine Praxis, welche er bald
ausschließlich auf Ohrenkrankheiten beschränkte. 1860
habilitierte er sich daselbst als Privatdozent, und 1864 wurde er
zum Professor ernannt. Einer der bedeutendsten Ohrenärzte der
Jetztzeit, hat T. die Ohrenheilkunde durch eigne wissenschaftliche
Untersuchungen wesentlich gefördert. Außer vielen
anatomischen Arbeiten lieferte er auch eine neue
Untersuchungsmethode des Ohrs, nämlich die mit reflektiertem
Tages- oder Lampenlicht mittels des von ihm angegebenen Reflektors,
eine Methode, welche zur Entwickelung der Ohrenheilkunde wesentlich
beigetragen hat und jetzt nahezu allgemein benutzt wird. T.
schrieb: "Die Anatomie des Ohrs in ihrer Anwendung auf die Praxis
und die Krankheiten des Gehörorgans" (Würzb. 1861);
"Lehrbuch der Ohrenkrankheiten" (das. 1862, 7. Aufl. 1881); "Die
chirurgischen Krankheiten des Ohrs" (in Pitha und Billroths
"Handbuch der Chirurgie", Erlang. 1866); "Krankheiten des
Gehörorgans im Kindesalter" (in Gerhardts "Handbuch der
Kinderkrankheiten", Tübing. 1870); "Gesammelte Beiträge
zur pathologischen Anatomie des Ohrs und zur Geschichte der
Ohrenheilkunde" (Leipz. 1883). Im J. 1864 begründete er das
"Archiv für Ohrenheilkunde", die erste Zeitschrift in diesem
Fach.
Tromba (ital.), s. v. w. Trompete; T. marina
(Meertrompete), s. Trumscheit.
Trombe (v. ital. tromba, Trompete), Wettersäule,
Windhose, Wasserhose, Sandhose, eine dunkle, oft ganz schmale
Säule, die sich wie ein Trichter (oder Trompete) von den
Wolken herabsenkt und an ihrem untern Ende, wenn sie über das
feste Land hinstreicht, Sand und andre leichte Gegenstände
aufhebt und in die Luft hinaufwirbelt (Sandhose), wenn sie
über dem Wasser sich bildet, dieses aufwühlt und unter
wirbelnder Bewegung gegen den von den Wolken herabhängenden
Trichter hinaufsaugt. Die Tromben stellen Tornados (s. d.) in
kleinerm Maßstab dar und sind oft von starkem Regen, zuweilen
auch von Hagel, Blitz und Donner begleitet. Sie bilden sich
vorzugsweise bei ruhiger und stark erwärmter Luft, als Wirkung
von aufsteigenden Luftströmen und zeigen sich fast
ausschließlich in der heißen Zeit des Jahrs. Die
drehende Bewegung der T. kann nach rechts, auch nach links sein,
und ihre Kraft ist oft so stark, daß Bäume entwurzelt
und Häuser abgedeckt werden. Vgl. Reye, Die Wirbelstürme
etc. (Hannov. 1872).
Trombidium, s. Milben; Trombidina (Pflanzenmilben),
Familie aus der Ordnung der Milben (s. d., S. 607).
Tromblon, s. Espingole.
Trombooue (ital.), s. v. w. Posaune.
Tromlitz, A. von, Pseudonym, s. Witzleben 1).
Trommel (ital. Tamburo, Cassa; franz. Tambour, Caisse;
engl. Drum), bekanntes Schlaginstrument, bestehend aus einem aus
Holzdauben gefügten oder blechernen Cylinder (dem sogen.
Sarg), der auf beiden offenen Enden mit einem Kalbfell bespannt
ist, das durch Holzreifen festgehalten wird. Die Holzreifen sind
durch eine im Zickzack gespannte Schnur miteinander verbunden,
durch deren schärferes Anziehen vermittelst Schlingen, welche
über je zwei Schnurstücke geschoben sind, der Ton der T.
heller gemacht werden kann. Auf dem einen Fell der T. wird mit
Klöppeln (Trommelstöcken, bei der großen T. mit
einem lederbezogenen Schlägel) geschlagen, über das andre
Fell ist eine Darmsaite (die Sangsaite) straff gezogen. Wird nun
die eine Membran in Schwingung versetzt, so tönt die andre mit
und zwar vermöge der immer erneuten Berührung mit der
Darmsaite stark schnarrend; ohne die Schnarrsaite ist der Ton kurz
und dumpf. Die T. wird nicht abgestimmt und daher wie die
übrigen Schlaginstrumente außer der Pauke nur dem
Rhythmus nach notiert. Der Trommelwirbel wird wie bei der Pauke auf
einer Linie als Triller oder Tremolo notiert. Die verschiedenen
Arten der T. sind: 1) Große T. (Gran tamburo, Grosse caisse,
Bass-drum), gewöhnlich mit den Becken vereinigt; 2) die
Rolltrommel (Caisse roulante), kleiner als die vorige, aber doch
noch größer als die 3) Militärtrommel, deren Ton
hell und durchdringend ist. Gegen frühere Zeiten werden die
Cylinder der Trommeln jetzt stark verkürzt, besonders bei der
Militärtrommel. Vgl. Kling, Trommelschule (Hannov. 1882).
Trommel, rotierender Hohlcylinder bei Krempel-,
Rauhmaschinen, Zentrifugen; auch eine cylindrische Scheibe zum
Aufwinden eines Seils etc. In der Architektur nennt man Trommeln
die einzelnen cylindrischen Blöcke von Haustein, aus welchen
Säulen zusammengesetzt werden.
Trommelfell, Trommelhöhle, s. Ohr, S. 349.
Trommelinduktor, s. Magnetelektrische Maschinen, S.
79.
Trommelrad, als Tympanum schon den Alten bekannte
Wasserhebemaschine, welche aus einem um eine hohle horizontale
Welle drehbaren Hohlcylinder besteht. Radiale Wände teilen
diesen in eine Anzahl Zellen, deren jede durch eine periphale
Schöpföffnung mit der Umgebung, durch eine
Ausgußöffnung in der hohlen Welle mit dieser
kommuniziert. Bei der Drehung dieses Rades tritt Wasser in die
unten gelegenen Zellen, wird dann bis zur Höhe der Achse
emporgehoben und entweicht durch diese in eine Rinne. Die
Schneckenräder, gleichfalls Tympanons genannt, haben statt der
durch radiale Scheidewände gebildeten Zellen spiralförmig
gebogene Gqnge, deren äußere Enden Wasser schöpfen
und dasselbe während der Drehung nach innen bis in die hohle
Achse und von da in ein Gerinne fließen lassen.
Trommelsucht, s. Blähungen und Aufblähen.
863
Trommsdorff - Trompete.
Trommsdorff, Johann Bartholomäus, Chemiker, geb. 8.
Mai 1770 zu Erfurt, erlernte in Weimar die Pharmazie, übernahm
1794 die Apotheke seines Vaters in Erfurt, erhielt 1795 an der
Universität daselbst die Professur der Chemie und Physik und
errichtete 1796 eine pharmazeutisch-chemische Lehranstalt, welche
bis 1828 blühte. 1823 wurde er Direktor der königlichen
Akademie zu Erfurt. Er starb 8. März 1837. Seine Hauptwerke
sind: das "Systematische Handbuch der Pharmazie" (Erf. 1792, 4.
Aufl. 1831); das "Systematische Handbuch der gesamten Chemie" (2.
Aufl., das. 1805-20, 8 Bde.); "Die chemische Rezeptierkunst" (5.
Aufl., Hamb. 1845); auch gab er das "Journal der Pharmazie" heraus
(1793-1817), das erste pharmazeutische Journal in Deutschland, bis
1834 als "Neues Journal der Pharmazie" fortgesetzt. Biographien
erschienen Kopenhagen 1834 und von Mensing (Erf. 1839).
Tromp, 1) Martin Harpertzoon, berühmter
holländ. Admiral, geb. 1597 zu Briel, trat jung in den
Seedienst, ward 1624 zum Fregattenkapitän ernannt und 1637 zum
Admiralleutnant und Befehlshaber eines Geschwaders von 11 Schiffen
befördert, mit dem er 18. Febr. 1639 auf der Höhe von
Gragelingen eine weit stärkere spanische Flotte schlug. Zum
Admiral ernannt, schlug er 21. Okt. 1639 eine spanische Flotte vor
den Dünen und eroberte 13 reichbeladene Gallionen. Nachdem er
jedoch 1652 durch einen Sturm im Kanal die Hälfte seiner
Flotte verloren, mußte er das Oberkommando an de Ruyter
abgeben, erhielt es aber noch in demselben Jahr zurück und
schlug 10. Dez. die englische Flotte unter Blake bei den
Dünen. 1653 bestand er im Verein mit de Ruyter einen
dreitägigen Kampf (28. Febr. bis 2. März) gegen die
überlegene englische Flotte und brachte die ihm zur Deckung
anvertrauten Handelsschiffe glücklich in den Hafen. Ein neuer
Angriff auf die englische Flotte 12. und 13. Juni mißlang.
Nachdem T. seine Flotte wiederhergestellt hatte, segelte er mit de
Ruyter an die Küste von Zeeland, zog hier noch 27 Schiffe
unter dem Admiral de With an sich und griff (8. Aug. 1653) bei
Ter-Heyde die 120 Schiffe zählende englische Flotte an. Er
durchbrach zwar die feindliche Linie, wurde aber vom Feind
umzingelt, von seiner Flotte abgeschnitten und fiel 10. Aug. tapfer
kämpfend, worauf die völlige Niederlage der
Niederländer den zweitägigen Kampf endete. Er soll in 33
Seetreffen gesiegt haben. In der Kirche zu Delft ward ihm ein
prächtiges Grabmal errichtet.
2) Cornelis, holländ. Seeheld, Sohn des vorigen, geb. 9.
Sept. 1629 zu Rotterdam, befehligte schon in seinem 19. Jahr ein
Schiff gegen die afrikanischen Seeräuber und ward zwei Jahre
später zum Konteradmiral befördert. Nach der
unglücklichen Schlacht bei Solebay (13. Juni 1665) rettete er
durch einen geschickten Rückzug die holländische Flotte
und ward von de Witt, obgleich Anhänger der oranischen Partei,
bis zu de Ruyters Rückkehr mit dem Oberbefehl betraut. In der
viertägigen Schlacht bei den Dünen (vom 11.-14. Juni
1666) focht er mit Auszeichnung, ward aber dann, als er im August
eine englische Flotte, die er geschlagen, zu hitzig verfolgte, von
der Hauptflotte abgeschnitten und, weil er in dieser Lage dem
Admiral de Ruyter nicht hatte zu Hilfe eilen können,
abberufen. Im Kriege gegen die verbündeten Mächte England
und Frankreich 1673 wieder zum Befehlshaber ernannt, bewährte
er in den drei blutigen Schlachten 7. und 14. Juni und 21. Aug.
sein Talent und seinen Mut in glänzendster Weise und erwarb
sich selbst auf gegnerischer Seite solche Achtung, daß ihn
König Karl II. von England nach Abschluß des Friedens
1675 zum Baronet ernannte. Hierauf führte T. eine Flotte zur
Unterstützung der Dänen gegen die Schweden und ward nach
de Ruyters Tod zum Oberbefehlshaber der Flotte der vereinigten
niederländischen Provinzen befördert. Er starb 29. Mai
1691 in Amsterdam und wurde zu Delft in dem Grabmal seines Vaters
beigesetzt.
Trompe, vorgekragte, eine Fläche doppelter
Krümmung bildende Wölbung, welche in der Architektur beim
Übergang aus einer Grundform in eine andre größere
oder mindestens mit einzelnen Teilen vor jener vorstehende
angewandt wird, wenn ein einzelner Kragstein nicht ausreicht. Man
unterscheidet äußere oder Ecktrompen und innere, Winkel-
oder Nischentrompen (s. Abbild.).
Tromper Wiek, Meerbusen an der Nordwestseite der Insel
Rügen, zwischen den Halbinseln Jasmund u.Wittow.
Trompete (ital. Tromba, franz. Trompette, engl. Trumpet),
bekanntes Blechblasinstrument, mit den Hörnern und Kornetts
eine Familie bildend und der Tonhöhe nach zwischen beiden die
Mitte haltend, d. h. T. ist das Oktavinstrument des Kornetts und
Kornett das der T. Die T. ist alt, spielte besonders in der
Militärmusik (Felttrummet) schon im Mittelalter eine Rolle.
Das entsprechende Instrument des Altertums war die Tuba, eine
gerade Metallröhre; die Kunst, Röhren zu winden, ist
jüngern Datums, und selbst noch die Trompeten des 16. Jahrh.
weisen keine in sich zurückgehenden, sondern nur
Schlangenlinien auf. Die moderne T. unterscheidet sich vom Horn
auch durch die Gestalt der Windungen, welche beim Horn mehr
kreisförmig, bei der T. dagegen gestreckter sind. Wie dem Horn
wird auch der T. durch Einsatzstücke eine verschiedenartige
Stimmung gegeben (in As, A, B, H, C, Des, D, Es, E, F, Fis, G und
hoch As). Die T. ist ziemlich eng mensuriert, ihr tiefster Eigenton
daher nicht zu brauchen (nur bei den höchsten Trompetenarten
von der in F ab), und auch der zweite Partialton ist bei den
tiefsten Arten (bis zu der in B) noch von schlechtem Klang. Notiert
wird für die T. wie für das Horn (transponierend), nur
klingt die T. eine Oktave höher als das Horn, d. h. ein c''
für F-Horn geschrieben klingt wie f'; für F-T. dagegen
wie f''. Der Umfang der T. in der Höhe ist für alle Arten
ungefähr derselbe, nämlich der wie: [s. Bildansicht]
klingende Ton; nur virtuose Bläser beherrschen mit Sicherheit
höhere Töne. Der Klang der T. ist scharf und
durchdringend, im Verein mit andern Blechblasinstrumenten
glänzend und festlich und dann berufenes Melodieninstrument;
dagegen klingt eine Trompetenmelodie, die nicht durch andre
Blechinstrumente gedeckt oder sehr getragen ist, gemein. Wagner
schrieb stets für drei Trompeten, um vollständige
Dreiklänge mit Instrumenten derselben Klangfarbe geben zu
können. Im Symphonieorchester, wo in der Regel nur zwei
Trompeten zu finden sind, bilden diese bald mit den Hörnern,
bald (im Gegensatz zu den vier Hörnern) mit den Posaunen eine
selbständige Gruppe. Die Naturtrompeten verschwinden jetzt
mehr und mehr vor den Ventiltrompeten, die wie die
Ventilhörner durch Ventile (Cylinder, Pistons etc.) die
Tonhöhe der Naturskala zu verschieben gestatten. Die
Ventil-
864
Trompetenbaum - Tropen.
trompeten stehen gewöhnlich in F und werden dem
entsprechend notiert. Von Schulwerken für T. sind besonders zu
empfehlen die "Große Schule für Cornet à pistons
und T." von Kosleck (2 Tle.) und die "Orchesterstudien für T."
von F. Gumbert. Vgl. Eichborn, Die T. in alter und neuer
Zeit(Leipz.1881).
Trompetenbaum, s. Catalpa und Cecropia.
Trompetenblume, s. Bignonia.
Trompetenblütler, s. Bignoniaceen.
Trompetengeige, s. Trumscheit.
Trompetenschnecke, s. Tritonshörner.
Trompetervögel (Psophiidae Bp.), Familie der
Watvögel, Vögel mit kräftigem Leib, mittellangem
Hals, kurzem Schnabel, hohen, langläufigen, kurzzehigen
Füßen, kurzen, gewölbten Flügeln und kurzem,
schwachfederigem Schwanz. Der Agami (Psophia crepitans L.), 52 cm
lang, schwarz, am Bug purpurschwarz schillernd, an Unterhals und
Oberbrust stahlblau schillernd, mit rotbraunem Auge,
grünlichweißem Schnabel und gelblich fleischfarbenem
Fuß, lebt in zahlreichen Scharen in den Wäldern
nördlich vom Amazonas, läuft sehr schnell, fliegt schwach
und besitzt eine sonderbare Stimme. Nach einem scharfen, wilden
Schrei folgt ein ungemein tiefes Trommeln oder Brummen, welches
durch eigentümliche sackartige Anhängsel der
Luftröhre hervorgebracht wird. Der Agami nährt sich von
Früchten, Körnern, Insekten, nistet an der Erde und legt
zehn und mehr hellgrüne Eier. In allen Indianerniederlassungen
lebt der Agami als Haustier, als Wächter und Beherrscher des
übrigen Geflügels und erscheint auch in den Straßen
der Ortschaften.
Tromsö, Hauptstadt des gleichnamigen norweg. Amtes,
das sich zwischen den Ämtern Nordland und Finnmarken erstreckt
und, in die zwei Vogteien Senjen und T. geteilt, 24,569,6 qkm
(446,2 QM.) mit (1876) 54,019 Einw. umfaßt. Die Stadt liegt
auf der 8 km langen Insel T., ist Sitz eines Bischofs, eines
Amtmanns und eines deutschen Konsuls, hat mehrere Kirchen (auch
eine katholische), einige Fabriken, Gymnasium, Lehrerseminar,
lebhaften Handel (mit Fischen, Thran, Nickelerz etc.; Wert der
Ausfuhr über 2,5 Mill. Frank) und (1876) 5409 Einw. Das
gleichnamige Stift, erst 1844 gebildet, umfaßt den
nördlichsten und nordöstlichsten Teil des Landes und zwar
die Ämter: Nordland, T. und Finnmarken und hat einen
Flächeninhalt von 111,609 qkm (2027 QM.) mit (1876) 182,245
Einw.
Trona, s. Soda, S. 1047.
Trouchet (spr. trongschä), Francois Denis, franz.
Advokat und Verteidiger Ludwigs XVI., geb. 1726 zu Paris, erlangte
als Advokat einen bedeutenden Ruf, wurde 1789 von der Stadt Paris
in die Nationalversammlung gewählt, bewies sich hier als
Anhänger des konstitutionell-monarchischen Prinzips und ward
vom König 1792 zu seinem Verteidiger erwählt. Seine
Verteidigung war gründlich gearbeitet, aber von geringer
Wirkung, da sie sich streng auf juristischem Boden hielt. Unter
Robespierre mußte T. fliehen, unter dem Direktorium trat er
in den Rat der Alten, unter dem Konsulat ward er Präsident des
Kassationshofs, erhielt nebst Bigot-Préameneu, Mulleville
und Portalis die Redaktion des neuen Zivilkodex übertragen und
ward 1801 in den Erhaltungssenat berufen. Er starb 10. März
1806.
Tronchiennes (spr. trongschiénn, vläm.
Drongen), Flecken in der belg. Provinz Ostflandern, Arrondissement
Gent, an der Lye und der Eisenbahn Gent-Brügge, mit
großer Krappfabrik und (1888) 4957 Einw.
Trondhjem, Stadt, s. Drontheim.
Tronto (im Altertum Truentus), Küstenfluß in
Mittelitalien, entspringt in den Bergen von Campotosto (Provinz
Aquila), fließt anfangs nördlich, dann östlich,
nimmt bei Ascoli den Castellano auf, wird bei Martino Sicuro
für kleine Fahrzeuge schiffbar und fällt nach einem Laufe
von 88 km in das Adriatische Meer.
Troon (spr. truhn. "Vorgebirge"), Seestadt im mittlern
Ayrshire (Schottland), mit sicherm Hafen, bedeutender Kohlenausfuhr
und (1881) 2383 Einw. Zum Hafen gehörten 1888: 53
Fischerboote.
Tropäoleen (Tropaeolaceae), dikotyle, etwa 35 Arten
umfassende, in Südamerika einheimische Pflanzenfamilie aus der
Ordnung der Gruinales, welche sich durch zygomorphe Blüten mit
acht Staubgefäßen und einem dreifächerigen
Fruchtknoten von den nächstverwandten Familien
unterscheidet.
Tropäolin, s. Azofarbstoffe und
Phenylfarbstoffe.
Tropaeolum L. (Kapuzinerkresse), Gattung aus der Familie
der Tropäoleen, ein- oder mehrjährige, windende, seltener
niedergestreckte Kräuter mit oft knolligen Wurzeln,
wechselständigen, schild- oder handförmigen, eckigen,
gelappten oder eingeschnittenen Blättern, einzeln
achselständigen, gelben, selten purpurnen oder blauen,
gespornten Blüten und trocknen oder schwammig-fleischigen
Früchten. 35 südamerikanische Arten. T. majus L.
(spanische, türkische Kresse, unechte Kaper), einjährig,
1684 aus Peru nach Europa verpflanzt und jetzt in zahlreichen
Varietäten in allen Gärten zu finden, mit meist
kletterndem Stengel, schildförmigen Blättern und
großen, orangegelben bis purpurbraunen Blüten, schmeckt
kressenartig und wirkt antiskorbutisch, wird auch als Salat
gegessen, während man die Blütenknospen und die unreifen,
in Essig oder Salz eingelegten Früchte wie Kapern benutzt. Aus
dieser Art und dem ähnlichen T. minus L. aus Peru sind
zahlreiche Varietäten, auch Zwergformen gezüchtet worden.
T. tuberoseum R. et P., mit knolligem Wurzelstock und
fünflappigen Blättern, wird in Peru der genießbaren
Knollen halber kultiviert und gedeiht auch bei uns. Andre
knollentragende Arten, wie T. Lobbianum Paxt. aus Kolumbien, mit
leuchtend kapuzinerroten Blüten (s. Tafel "Zimmerpflanzen I"),
T. pentaphyllum Lam. aus Montevideo, mit scharlachroten, grün
zugespitzten Blüten, etc., kultiviert man als Zierpflanzen in
Gewächshäusern.
Tropea, Stadt in der ital. Provinz Catanzaro, Kreis
Monteleone, am Tyrrhenischen Meer, Bischofsitz, mit Kathedrale,
Schloßruinen, kleinem Hafen, Fischerei, Fabrikation von
Stiefelsohlen und Baumwolldecken und (1881) 5032 Einw.
Tropen (griech.), s. v. w. bildliche Ausdrücke,
durch welche der eigentliche Ausdruck mit dem uneigentlichen, die
Sache mit dem Bild vertauscht wird, um das Geistige zu
versinnlichen und das Sinnliche zu vergeistigen (s. Figur); daher
tropisch, s. v. w. bildlich, figürlich (Gegensatz:
kyriologisch). Die wichtigsten T. sind: Allegorie, Antonomasie,
Epitheton, Hyperbaton, Hyperbel, Ironie, Katachresis, Metalepsis,
Metapher, Metonymie, Onomatopöie, Periphrasis, Rätsel und
Synekdoche. Vgl. Groß, Die T. und Figuren (2. Aufl., Leipz.
1888). - Im Gregorianischen Gesang heißen T. die
verschiedenen Gesangsformeln für den Schluß der dem
Introitus angehängten kleinen Doxologie "Gloria patri et filio
et spiritui sancto sicut erat in principio et nunc et in secula
seculorum amen" (vgl. Evovae). - In der Astronomie heißt
tropisch auf den Tierkreis bezüglich;
865
Tropfen - Tropikvogel.
tropischer Umlauf eines Himmelskörpers die Zeit, nach
welcher er wieder zum Frühlingspunkt zurückkehrt. In der
Erdbeschreibung sind T. s. v. w. Wendekreise; daher
Tropenländer, die zwischen den Wendekreisen, also in der
heißen Zone, gelegenen Länder (auch
Äquinoktialgegenden genannt); tropische Gewächse, die
dort einheimischen Gewächse (vgl. die Litteratur zum Artikel
"Landwirtschaft", S. 480); tropische Krankheiten, die durch das
tropische Klima bedingten und daher vorzugsweise in den
Tropenländern herrschenden Krankheiten, als Dysenterie,
Diarrhöe und Erbrechen, Abdominalplethora, Gallen- und
intermittierende Fieber etc. Vgl. Friedmann, Über Arzneikunde
und Akklimatisation in den Tropenländern (Erlangen 1850);
Sullivan, The endemic diseases of tropical climates (Lond. 1877);
Falkenstein, Ärztlicher Ratgeber für Seeleute,
Kolonisten, Reisende etc. (Berl. 1882).
Tropfen, für sich bestehende Flüssigkeitsmenge
mit abgerundeter Oberfläche. T., auf welche außer ihrer
eignen Kohäsion und Massenanziehung keine andre Kraft wirkt,
bilden vollkommene Kugeln. Ruht ein T. auf einer Unterlage, so wird
er nicht nur durch die Schwere abgeplattet, sondern auch die
Adhäsion zur Unterlage übt Einfluß auf seine
Gestalt. Die Größe und Gestalt von T., die von einem
Körper herabhängen, wird bestimmt durch ihr spezifisches
Gewicht, ihre Kohäsion und Temperatur und durch die
Adhäsion zu jenem Körper, von welchem die Körper
abfließen. Nach Gay-Lussac ist das Gewicht der T.
verschiedener Flüssigkeiten, welche aus einer Röhre von
bestimmtem Durchmesser herabfallen, nicht den Dichtigkeiten dieser
Flüssigkeiten proportional. 100 T. Wasser von 15° wogen
8,9875 g, 100 T. Alkohol (spez. Gew. 0,8543) nur 3,0375 g. Ein T.
destillierten Wassers wird gewöhnlich zu 1 Gran angenommen
oder 20 T. zu 1 g. Über den "Leidenfrostschen T." s. d.
Tropfgläser, Fläschchen mit einem kleinen Loch
im Hals und einem eingeriebenen Glaspfropfen mit einem Kanal, der,
auf jenes Loch eingestellt, in die Flasche Luft eintreten
läßt, während gleichzeitig ein zweiter Kanal zu
einem Ausguß im Flaschenhalsrand führt. T. dienen zu
Arzneimitteln, die tropfenweise genommen werden müssen.
Tropfhäusler, s. Bauer, S. 462.
Tropfstein, Mineralien, welche sich als Absatz aus
herabtropfenden Flüssigkeiten gebildet haben (vgl. Sinter). T.
findet sich in Höhlen, Gewölben, Grubenbauten etc., meist
von cylindrischer oder zapfenförmiger Gestalt, bisweilen
platt, häufig hohl. Dem allmählichen Absatz entsprechend,
ist er meist aus einzelnen, durch verschiedene Färbung oder
Haarspalten voneinander abgehobenen Lagen gebildet, und die
einzelnen Lagen sind aus faserigen Individuen, welche senkrecht zur
Längsachse oder zur Begrenzungsfläche stehen,
zusammengesetzt, oder er stellt grobkörnige Aggregate dar,
besitzt mitunter aber auch eine durchsetzende Spaltungsrichtung und
ist dann also aus einem einheitlichen Individuum gebildet. T.
besteht meist aus kohlensaurem Calcium (Kalkspat, seltener
Aragonit); doch kommen auch Vitriole, Brauneisenstein, Zinkblende,
Bleiglanz, Eisenkies, Malachit, Chalcedon, Eis etc. als T. vor. Man
unterscheidet die von der Decke der Gewölbe nach abwärts
hängenden Stalaktiten und die denselben entgegenwachsenden
Stalagmiten. Vereinigen sich beide zu einer erst
sanduhrförmigen, später cylindrischen Gestalt, so
entstehen Säulen, deren Mehrheit man auch wohl Orgeln nennt.
Berühmte Tropfsteinhöhlen sind: die Sophien- und andre
Höhlen in der Fränkischen Schweiz, mehrere Höhlen
der württembergischen Alb, die Baumannshöhle u. a. im
Harz, die Dechenhöhle u. a. in Westfalen, die Adelsberger
Höhle in Krain, die auf der griechischen Insel Antiparos
(Aragonit), diejenigen am obern Mississippi (Schwefelmetalle).
Trophäe (lat., griech. Tropäon), bei den
Griechen ein an der Stelle, wo sich der besiegte Gegner zur Flucht
gewendet hatte, aus erbeuteten Waffen errichtetes Siegesmal.
Münzen zeigen oft einen Baumstamm mit Querbalken und daran
gehängten Rüstungsstücken und Waffen (s. Figur). Von
den Griechen überkamen die Römer den Brauch, pflegten
aber als Siegesdenkmäler feststehende Monumente mit
Reliefdarstellungen zu errichten. Heute nennt man Trophäen die
mit bewaffneter Hand im Kampf eroberten Fahnen, Standarten und
Geschütze (früher auch noch die Pauken der Kavallerie),
auch Zusammenstellungen von Waffen und Waffenteilen zur
Ausschmückung von Zeughäusern etc.
^[T r o p ä o n (böotische Münze).]
Trophoneurosen (griech.), Ernährungsstörungen,
welche von Nervenerkrankungen abhängig sind. Das Gebiet der T.
ist nicht sicher zu begrenzen, weil wir über die
Abhängigkeit der Ernährungsstörungen von den Nerven
überhaupt noch nicht genügend unterrichtet sind.
Vielleicht gehören gerade die wichtigsten Erkrankungen,
nämlich die elementaren Prozesse der Kongestion, der
Entzündung, der Exsudation und Sekretion, ihrem Wesen nach zu
den T. Zu den T. im engern Sinn rechnet man Atrophien der Muskeln
bei Erkrankung der Vorderhörner des Rückenmarks,
halbseitige Atrophien des Gesichts, die Gürtelflechte etc.
Trophonios, mythischer Baumeister der Minyer, Sohn des
Königs Erginos von Orchomenos in Böotien oder des
Apollon, erbaute mit seinem Bruder Agamedes den Apollontempel zu
Delphi und verschiedene Schatzhäuser, namentlich das des
Hyrieus, Königs von Hyria in Böotien. Bei letzterm hatten
die beiden Brüder einen Stein so eingefügt, daß er
leicht herausgenommen werden konnte, um sich auf diese Weise
Zutritt zu dem Schatze zu verschaffen. Der König legte endlich
Schlingen, in denen Agamedes sich fing. Um nicht verraten zu
werden, schnitt T. seinem Bruder den Kopf ab und floh in den Wald
bei Lebadeia. Hier ward er von der Erde verschlungen, an der
Stelle, welche später durch die sogen. Höhle des T.
bezeichnet ward, in der Orakel erteilt wurden. Nach andrer Sage
sandte Apollon den beiden Brüdern als Lohn für den
Tempelbau frühen Tod.
Tropidonotus, s. Nattern.
Tropikvogel (Phaëton L.), Gattung aus der Ordnung
der Schwimmvögel und der Familie der Tropikvögel
(Phaëtontidae), gedrungen gebaute Vögel mit kopflangem,
seitlich stark zusammengedrücktem, auf der Firste seicht
^[sic] gebogenem, an der Spitze geradem, an den eingezogenen
Rändern gesägtem Schnabel, langen Flügeln,
mittellangem Schwanz, dessen beide fast fahnenlose Mittelfedern
sich stark verlängern, und schwachen Beinen, deren Zehen nur
durch eine schmale Haut verbunden sind. Der T. (P. aethereus L., s.
Tafel "Schwimmvögel III"), einschließlich der beiden
etwa 60 cm langen Schwanzfedern 1 m lang, ebenso breit, ist
weiß, rosenrötlich überflogen, Zügelstreifen
und Außenfahnen der Handschwingen sind schwarz, die hintern
Armschwingen
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl., XV. Bd.
55
866
Tropisch - Trosse.
schwarz und weiß gesäumt, die Schwanzfedern
weiß; das Auge ist braun, der Schnabel rot, der Fuß
gelb, Zehen und Schwimmhäute schwarz. Der T. gehört zu
den schönsten Vögeln des Weltmeers; er wohnt zwischen den
Wendekreisen des Atlantischen, Indischen und Großen Ozeans,
entfernt sich oft sehr weit von den Küsten, fliegt
vortrefflich, begleitet die Schiffe oft tagelang und erinnert in
seinem Wesen am meisten an die Raubseeschwalbe. Er fischt mit
kräftigem Stoßen und Tauchen und frißt außer
Fischen auch Kopffüßer. Er nistet auf einsamen Inseln
und legt die Eier einfach auf den Boden unter Gebüsch, wo er
aber öfters beunruhigt wurde, in Höhlungen der Klippen.
Das einzige Ei ist lehmfarben, rötlich oder violett gezeichnet
und wird von beiden Eltern ausgebrütet. Die langen Federn des
Schwanzes dienen auf mehreren Inseln des südlichen Stillen
Meers zum Zierat; man erbeutet sie, indem man den Vogel auf dem
Nest fängt.
Tropisch, s. Tropen.
Troplong (spr. trolóng), Raymond Théodore,
franz. Jurist, geb. 8. Okt. 1795 zu St.-Gaudens, ward nacheinander
Staatsprokurator auf Corsica, Generaladvokat zu Bastia, Rat am
Pariser Kassationshof, 1848 erster Präsident des
Appellationshofs in Nancy, 30. Dez. 1852 erster Präsident des
Senats, 1. Febr. 1858 Mitglied des Geheimen Konseils und starb 1.
März 1869 in Paris. Sein Hauptwerk: "Le droit civil
expliqué suivant l'ordre des articles du Code " (Par.
1833-56, 28 Bde.), enthält eine Reihe von Monographien
über das französische Zivilrecht. Vgl. Dufour, T., son
oeuvre et sa méthode (Par. 1869).
Tropp (vom griech. tropos), die deklamierende,
psalmodierende Vortragsweise der Pentateuchabschnitte nach
bestimmten Accenten beim israelitischen Gottesdienst.
Troppau, vormaliges schles. Fürstentum, das jetzt
zum Teil den Troppauer Kreis von Österreichisch-Schlesien, zum
Teil den Leobschützer Kreis des preußischen
Regierungsbezirks Oppeln bildet. Der böhmische König
Ottokar II. erhob das Gebiet zum Fürstentum und verlieh es
1261 seinem natürlichen Sohne Nikolaus. Nachdem es unter
dessen Nachkommen 1377 in die Fürstentümer
Jägerndorf, Leobschütz und T. geteilt worden, fiel es
1460 durch Kauf an den König Podiebrad von Böhmen. Dessen
Sohn Viktorin überließ es durch Tauschvertrag 1485 an
Matthias Corvinus, dessen Sohn Johann Corvinus es 1501 aber wieder
an den König Wladislaw von Böhmen und Ungarn verkaufte,
der es 1511 der Krone Böhmen für immer einverleibte. 1526
ward es vom Erzherzog Ferdinand von Österreich als König
von Böhmen in Besitz genommen und teilte seitdem die Geschicke
Schlesiens. Mit Nichtbeachtung des Landesprivilegiums von 1511
verlieh es Kaiser Matthias 1613 als erbliches Mannlehen an das Haus
Liechtenstein, in dessen Besitz es noch jetzt ist. Vgl. Ens, Das
Oppaland (Wien 1835 bis 1837, 4 Bde.); Biermann, Geschichte der
Herzogtümer T. und Jägerndorf (Tesch. 1874).
Troppau (slaw. Opava), Hauptstadt von
Österreichisch-Schlesien wie ehemals von ganz Oberschlesien,
liegt 247 m ü. M. in lieblicher Ebene am rechten Ufer der
Oppa, welche unterhalb der Stadt die Mohra aufnimmt, nahe der
preußischen Grenze, an den Eisenbahnlinien T.-Jägerndorf
der Mährisch-Schlesischen Zentralbahn und T.-Schönbrunn
der Nordbahn, hat Vorstädte, mehrere schöne Plätze,
6 Kirchen, darunter die alte gotische Hauptpfarkirche und eine
evang. Kirche, ein altes Rathaus (neuerlich im gotischen Stil
umgebaut), ein fürstlich Liechtensteinsches Schloß, das
Landhaus, das Stadttheater, schöne Anlagen um die Stadt (an
Stelle der alten Wälle und Schanzen), eine Zuckerraffinerie,
Fabrikation von Tuch, Fes, Jutewaren, Hüten, Zündwaren,
Pottasche, Spiritus u. Likör, Bierbrauerei,
Ringofenziegeleien, Mühlen etc., eine Gasanstalt, lebhaften
Handelsverkehr, große Märkte u. (1880) mit 1273 Mann
Militär 20,562 Einw. T. ist Stadt mit eignem Gemeindestatut,
Sitz der Landesregierung und Landesvertretung, des Landesgerichts,
einer Bezirkshauptmannschaft (für die Umgebung), einer
Finanzdirektion, einer Handels- u. Gewerbekammer und hat ein
deutsches Obergymnasium und ein tschechisches Gymnasium, eine
Oberrealschule, eine Lehrer- und eine Lehrerinnenbildungsanstalt,
eine Handelsschule, ein Landesmuseum, eine Bibliothek (35,500
Bände), eine Landeskranken- und Irrenanstalt und andre
Wohlthätigkeitsanstalten, eine Bodenkreditanstalt, eine
Filiale der Österreichisch-Ungarischen Bank und eine
Sparkasse. Jenseit der Oppa liegt das Dorf Katharein, mit
Rübenzuckerfabrik, Spiritusbrennerei und (1880) 4292 Einw. -
T. entwickelte sich als deutsche Ansiedelung in der Nähe der
Burg Gräz (Gradec), wird urkundlich zuerst 1195 genannt, 1224
erscheint es bereits als Stadt mit deutschem Recht. Hier ward 20.
Okt. bis 30. Sept. 1820 ein durch die neapolitanische Revolution
veranlaßter Fürstenkongreß abgehalten, auf welchem
sich die Monarchen von Österreich, Preußen und
Rußland zur Aufrechterhaltung des Zustandes von 1815 in
Europa verpflichteten. Die weitere Ordnung der neapolitanischen
Frage wurde dem Kongreß von Laibach (s. d.)
überlassen.
^[Wappen von Troppau.]
Troppo (ital.), zu sehr, z. B. Adagio no troppo, langsam,
doch nicht zu sehr.
Troquieren (franz., trokieren), s. v. w. barattieren (s.
d.).
Trosch., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung
für F. H. Troschel (s. d.).
Troschel, Franz Hermann, Zoolog, geb. 10. Okt. 1810 zu
Spandau, studierte seit 1831 in Berlin Mathematik und
Naturwissenschaft, fungierte 1835-49 als Lehrer an der
Königsstädter höhern Bürgerschule, habilitierte
sich 1844 an der Universität als Privatdozent für
Zoologie, nachdem er seit 1840 unter Lichtenstein eine
Kustedenstelle am zoologischen Museum bekleidet hatte, und folgte
1849 einem Ruf als Professor der Zoologie und der allgemeinen
Naturwissenschaft nach Bonn, wo er 6. Nov. 1882 starb. Er schrieb:
"System der Asteriden" (mit Joh. Müller, Braunschw. 1842);
"Horae ichthyologicae" (mit Joh. Müller, Berl. 1845-49, 3
Hefte); "Das Gebiß der Schnecken zur Begründung einer
natürlichen Klassifikation" (das. 1856-79, 2 Bde.). Nach dem
Tod Wiegmanns bearbeitete er die 2. Auflage von Wiegmann und Ruthes
"Handbuch der Zoologie" (7. Aufl., Berl. 1871). An den
Jahresberichten im "Archiv für Naturgeschichte" beteiligte er
sich seit 1837 (anfangs über Mollusken, später über
Fische, Amphibien, Säugetiere schreibend), und 1849
übernahm er die Redaktion des Archivs.
Trossachs, malerischer Paß in Schottland, zwischen
Callander am Teith und dem untern Ende des Loch Katrine.
Trosse, Schiffstaue, welche aus dünnen
Hanffäden (Kabelgarnen) hergestellt werden. Die Garne, welche
fast stets von gleicher Stärke sind, werden in
große-
867
Trossin - Troyes.
rer oder geringerer Zahl je nach der Stärke des Taues zu
Duchten zusammengedreht, und drei bis vier solcher Duchten liefern
beim Zusammenschlagen die T. Schlägt man drei Trossen in
entgegengesetzter Richtung zusammen, so erhält man ein Kabel,
als dessen Bestandteile die Trossen Kardeele heißen.
Trossin, Robert, Kupferstecher, geb. 14. Mai 1820 zu
Bromberg, widmete sich der Kupferstecherkunst von 1835 bis 1846 in
Berlin unter Buchhorn und Mandel. Schon seine erste
größere Arbeit, der italienische Fischerknabe nach
Magnus, zeigte eine gediegene Technik, die sich dann in den
Porträten von Alex. v. Humboldt und E. M. Arndt weiter
vervollkommte. 1850 wurde er zur Leitung der Kupferstecherschule
nach Königsberg berufen, wo die Blätter: Jephthas Tochter
nach Jul. Schrader, mehrere Porträte für die Ausgabe der
Werke Friedrichs d. Gr., der betende Mönch am Sarg Heinrichs
IV. nach Lessing, das Dilettantenquartett nach Hiddemann,
Sonntags-Nachmittag in einem schwäbischen Dorf nach Vautier,
Morgengruß nach Karl Becker, die Mater dolorosa nach Guido
Reni und die Vision des heil. Antonius nach Murillo (im Berliner
Museum) entstanden. 1885 siedelte er nach Berlin über, wo er
unter anderm Im Witwenschleier nach Defregger und das venezianische
Mädchen nach Savoldo (im Berliner Museum) stach.
Trostberg, Flecken im bayr. Regierungsbezirk Oberbayern,
Bezirksamt Traunstein, an der Alz, 502 m ü. M., hat 2
schöne Kirchen, ein Amtsgericht und (1885) 1235 kath.
Einwohner.
Trotha, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Merseburg,
Saalkreis, an der Saale und der Linie Halle-Zellerfeld der
Preußischen Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, eine
Zuckerfabrik, eine chemische Fabrik, ein Farbenwerk, Schiffahrt und
(1885) 2878 Einw.
Trott (franz. trot), s. v. w. Trab, s. Gangarten des
Pferdes.
Trottel, s. v. w. Kretin.
Trottoir (franz., spr. -toahr, von trotter, traben), der
Fußweg zur Seite der städtischen Straßen, liegt
meist etwas höher als das Straßenpflaster, ist gegen
dieses durch größere Pflastersteine, besser durch
Bordschwellen aus Granit, Zementguß etc. abgegrenzt und
besitzt nach der Straße ein schwaches Gefalle. Das T. wird
mit kleinen Steinen (Mosaikpflaster), Klinkern oder sorgfältig
behauenen Steinen gepflastert, häufiger und besser mit
Steinplatten oder Asphalt belegt. Derartige Steige wurden bereits
in Pompeji angetroffen, und im Mittelalter legte man den
Bürgersteig in die Mitte der Straße.
Trotzendorf, s. Friedland, Valentin.
Trotzkopf, s. Klopfkäfer.
Troubadour (spr. trubaduhr), s. Provençalische
Litteratur.
Trousseau (franz., spr. trussoh), Schlüsselbund;
dann Aussteuer, Ausstattung einer Braut, insbesondere die von
Prinzessinnen.
Trouvère (spr. truwähr), in der nordfranz.
Litteratur des Mittelalters die Dichter und Erfinder von
Gesängen, die beim Vortrag derselben von den Weisen der
Jongleure (s. d.) begleitet wurden. Vgl. Französische
Litteratur, S. 591.
Trouville (spr. truwil, T. sur Mer), Stadt im franz.
Departement Calvados, Arrondissement Pont l'Evêque, an der
Mündung der Touques, über welche eine Brücke nach
dem gegenüberliegenden Seebadeort Deauville (s. d.)
führt, und an der Westbahnlinie Lisieux-T., hat ein
Hafenbassin, ein besuchtes Seebad (Lieblingsbad der vornehmen
Pariser), schöne Villen, Schiffahrt und (1886) 5749 Einw.
Trowbridge (spr. traubridsch), Stadt im westlichen
Wiltshire (England), auf einer felsigen Anhöhe im Thal des
Biß, 16 km südöstlich von Bath, hat blühende
Fabrikation von feinen Tuchen und andern Wollwaren,
Käsemärkte und (1881) 11,040 Einw.
Troxler, Ignaz Paul Vital, schweizer. Naturphilosoph und
liberaler Politiker, geb. 17. Aug. 1780 zu Beromünster im
Kanton Luzern, studierte in Jena unter Schelling, dann zu
Göttingen Philosophie und Medizin, praktizierte sodann
abwechselnd in Luzern und Wien, ward 1820 Professor der Philosophie
und Geschichte am Lyceum zu Luzern, gründete hierauf zu Aarau
ein Erziehungsinstitut, ging 1830 als Professor nach Basel, ward im
folgenden Jahr, der Teilnahme am Aufstand von Baselland
verdächtigt, abgesetzt, 1832 Mitglied des Großen Rats
des Kantons Aargau, 1834 Professor an der Universität Bern,
starb 6. März 1866 aus seinem Landgut bei Aarau. Als Philosoph
anfänglich Schelling, seit 1834 Jacobi folgend, schlug er eine
mystische Richtung ein, in welcher Ahnung und Gemüt eine Rolle
spielen; als Politiker gehörte er zu den eifrigsten
Verfechtern der schweizerischen Einheitsbestrebungen. Von seinen
zahlreichen (auch publizistischen) Schriften seien hervorgehoben:
"Naturlehre des menschlichen Erkennens" (Aar. 1828); "Logik"
(Stuttg. l829, 3 Bde.); "Vorlesungen über Philosophie" (Bern
1835, 2. Ausg. 1842).
Troy (spr. treu), Stadt im nordamerikan. Staat New York,
links am Hudson, auf einer von Hügeln beherrschten
Alluvialebene, hat ein polytechnisches Institut, ein kath. Seminar,
Eisengießereien, Wagenbau, Woll- und Baumwollfabrikation etc.
und lebhaften Handel und (1880) 56,747 Einw. Gegenüber liegt
West T., mit großartigem Zeughaus (Watervliet Arsenal) der
Vereinigten Staaten und 8820 Einw. T. wurde 1752 von den
Holländern gegründet.
Troy, Jean François de, s. De Troy.
Troya (spr. troja), Carlo, ital. Geschichtschreiber, geb.
7. Juni 1784 zu Neapel als Sohn eines Hofchirurgen, wuchs als
Taufpate der Königin Karoline im königlichen Palast auf,
widmete sich dem Studium der Rechte und bekleidete hierauf
Ämter unter dem König Joachim Murat. Nach der
Rückkehr der Bourbonen Advokat, beteiligte er sich an den
revolutionären Bestrebungen von 1820 und wurde zur Strafe
dafür in die Verbannung geschickt. Er bereiste Italien,
durchforschte die Bibliotheken und die Archive der Klöster und
veröffentlichte 1826 zu Florenz seine Schrift "Il veltro
allegorico di Dante", ein äußerst reichhaltiges und
bedeutendes Werk historischer Forschung, aber in papstfreundlichem
Sinn geschrieben. Neue Studien, neue Reisen und unermüdliche
Durchforschunggen der Archive befähigten ihn zu dem noch
großartigern Unternehmen seiner "Storia d'Italia del medio
evo" (1839-59, 17 Bde.), eines Werkes, das den Zeitraum von 476 bis
zu Dantes Tod (1321) umfassen sollte, jedoch nur bis auf Karl d.
Gr. fortgeführt ist. Seiner papstfreundlichen Gesinnung
ungeachtet übertrug man ihm 1848 die Präsidentschaft des
Revolutionsministeriums, welche er vom 3. April bis 14. Mai
bekleidete. Er starb 27. Juli 1858 in Neapel.
Troyer (spr. treuer), in der deutschen Marine das
blauwollene Hemd der Mannschaften, in Österreich Bordhemd
genannt.
Troyes (spr. troá), Hauptstadt des franz.
Departements Aube, vormals Hauptstadt der Champagne, an der hier in
mehrere Arme geteilten Seine, am Oberseinekanal und an der
Ostbahnlinie Paris-Belfort (Abzweigungen nach Châlons sur
Marne, Châtillon und Sens), war früher befestigt, ist
jetzt mit
55*
868
Troygewicht - Truchseß.
schönen Promenaden, Obst- und Weinpflanzungen sowie
zahlreichen Bewässerungskanälen umgebenem Innern jedoch
größtenteils eng und unregelmäßig gebaut.
Unter den Kirchen zeichnen sich namentlich die Kathedrale zu
St.-Pierre, ein schöner gotischer Bau mit prächtigem
Portal und alten Glasmalereien, sowie die Kirchen St.-Urbain,
Ste.-Madeleine und St.-Remy aus. Die übrigen hervorragenden
Gebäude sind: das Rathaus, das Spital, das
Lyceal-Gebäude, das Theater und die Kaufhallen. Die Zahl der
Einwohner beträgt (1886) 44,864 (als Gemeinde 46,972). T. hat
eine Ackerbau- und Handelskammer, eine Filiale der Bank von
Frankreich, zahlreiche Spinnereien für Schafwolle und
Baumwolle, Fabrikation für wollene, baumwollene und leinene
Stoffe, Wirkwaren, Handschuhe, Stickereien, künstliche Blumen,
Blechwaren, Nadeln, Leder, Wachsleinwand, Pergament, Papier etc.,
Brauereien, Brennereien, Bereitung von berühmten
Cervelatwürsten und geräucherten Hammelzungen und
lebhaften Handel. Es hat ein Lyceum, eine Zeichen- und Bauschule,
eine Handels- und Gewerbeschule, einen Kursus für angewandte
Chemie, Normalschulen für Lehrer und Lehrerinnen, eine
öffentliche Bibliothek von 110,000 Bänden und gegen 5000
Handschriften, eine Gemäldegalerie, Münz- und
Antikensammlung und mehrere gelehrte und industrielle
Gesellschaften. T. ist der Sitz eines Bischofs, des Präfekten,
eines Gerichtshofs und eines Handelsgerichts. - T. war im Altertum
die Hauptstadt der keltischen Tricasser und hieß Noviomagus,
erhielt von Augustus den Namen Augustobona und nahm im 5. Jahrh.
den Namen Trecä an. In der Nähe, bei Mery, fand 451 die
große Hunnenschlacht (s. d.) statt. 889 von den Normannen
zerstört, ward es 950 wieder aufgebaut, kam 1019 in den Besitz
der Grafen von Champagne als deren Hauptstadt und fiel 1339 mit der
Champagne an die Krone Frankreich. 1111 wurde hier ein Konzil
abgehalten, auf welchem die Gregorianischen Edikte wegen der
Investitur erneuert wurden. 1415 wurde T. von dem Herzog Johann von
Burgund zerstört. Am 21. Mai 1420 wurde hier der Friede
zwischen Frankreich und England geschlossen, in welchem der
König Heinrich V. von England mit der Hand Katharinas, der
Tochter des Königs Karl VI. von Frankreich, die Anwartschaft
auf den französischen Thron nach des Schwiegervaters Tod und
bis dahin die Regentschaft in Frankreich erhielt. 1429 eroberte es
Karl VII. wieder. Im Feldzug von 1814 war T. als einer der
Hauptoperationspunkte der österreichischen Armee von
Wichtigkeit. Vgl. Boutiot, Histoire de la Ville de T. (Troyes
1870-80, 5 Bde.).
Troygewicht (spr. treu-), Gewicht in England für
Gold, Silber und Juwelen, das auch als Apothekergewicht und
für wissenschaftliche Gewichtsvergleichungen dient. Das
Troypfund wird eingeteilt in 12 Unzen zu 20 Pfenniggewicht (dwt.)
à 24 Grän, also 5760 Troygrän, und wiegt 373,242
g. Apotheker teilen dieses Pfund in 12 Unzen (^) zu 8 Drachmen (^)
zu 3 Skrupel (^)) zu 20 Grän ein. 7000 dieser Grän Troy
sind gleich einem Pfund Avoirdupois, so daß 175 Pfd. Troy =
144 Pfd. Avoirdupois sind. Der Name T. kommt von der Stadt Troyes
her (vgl. Avoirdupois).
Troyon (spr. troajóng), Constant, franz. Maler,
geb. 25. Aug. 1810 zu Sèvres, bildete sich bei Riocreux und
Poupart, wurde aber erst durch den Einfluß von Roqueplan auf
das unmittelbare Studium der Natur hingelenkt, welchem er schon
seit 1836 in seinen Landschaften Ausdruck gab. Eine 1847 nach
Holland unternommene Reise vollendete seinen Übergang zu einer
völlig realistischen Naturanschauung, mit welcher er
Größe der Auffassung und Energie und Breite der
koloristischen Behandlung verband. Er belebte seine Landschaften
besonders mit Tieren (Rindvieh, Pferden, Schafen), welche einen
immer breitern Raum einnahmen. Schließlich wurde T. als
Tiermaler ebenso bedeutend wie als Landschafter, und es gelang ihm,
selbst naturgroße Darstellungen von Tieren mit
landschaftlichem Hintergrund eindrucksvoll und fesselnd zu
gestalten, wobei er die Wirkungen des Sonnenlichts zu Hilfe nahm.
Seine Hauptwerke sind: die Rückkehr aus der Meierei (1849, im
Louvre), das Thal der Touque, die zur Feldarbeit getriebenen Ochsen
(1855, im Louvre), der Wagen mit dem Esel, ein Spätsommertag
in der Normandie, die Furt, Schafherde nach dem Gewitter, Schafe am
Morgen. Die Motive zu seinen Landschaften entnahm er zumeist der
Umgegend von Paris, der Touraine und der Normandie.
Überanstrengung führte 1863 eine Geisteskrankheit herbei,
der er 21. Febr. 1865 erlag. Vgl. Dumesnil, T. (Par. 1888).
Troypfund, s. Troygewicht.
Troyunze (abgekürzt oz.), im engl. Bankverkehr die
Gewichtseinheit, nach welcher Gold und Silber gehandelt werden (s.
Troygewicht). Dieselbe wird für Silber in Zehntel-, für
Gold in Tausendstelunzen eingeteilt.
Trözen (Trözene), im Altertum Stadt in der
griech. Landschaft Argolis, 20 Stadien von der Ostküste, an
welcher die dazu gehörigen Häfen Kelenderis und Pogon
lagen, ursprünglich von Ioniern bewohnt, ward nach der
Wanderung der Herakliden dorisiert, gelangte zu Macht und
Blüte auch auf der See und nahm am Perserkrieg rühmlichen
Anteil. 430 und 425 v. Chr. brandschatzten die bisher mit T.
befreundeten Athener das Land. Im korinthischen Krieg 394 stand T.
auf seiten der Lakedämonier, ebenso kämpfte es 373 gegen
Athen. In der makedonischen Zeit ging es aus einer Hand in die
andre und kam endlich an den Achäischen Bund. Zu Pausanias'
Zeit war es noch eine ansehnliche Stadt. Unbedeutende Reste beim
heutigen Dorf Damalá.
Trübau, 1) (Mährisch-T.) Stadt in Mähren,
an der Trebowka, Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines
Bezirksgerichts, mit Obergymnasium, fürstlich
Liechtensteinschem Schloß, Seiden-, Leinwand- und
Kattunweberei, Färberei und Druckerei sowie (1880) 6056 Einw.
In der Nähe Steinkohlenbergbau. -
2) Stadt, s. Böhmisch-Trübau.
Trübmaß (Trübeichmaß), s.
Altmaß.
Trübner, Nikolaus, Buchhändler und Bibliograph,
geb. 12. Juni 1817 zu Heidelberg, begründete 1852 ein
Verlagsgeschäft (T. u. Komp.) in London, das sich durch seine
Umsicht und Thätigkeit zu einem der ersten der Welt
aufgeschwungen hat und einen bedeutenden Vermittelungseinfluß
in der Weltlitteratur ausübt. Er verfaßte:
"Bibliographical guide to American literature" (1859) und gab in
Monatsheften "Truebner's American and Oriental literary Records"
(seit 1865) heraus. Er starb 30. März 1884.
Trubtschewsk, Kreisstadt im russ. Gouvernement Orel, an
der Desna, mit (1885) 5275 Einw. und Getreidehandel nach Riga und
Petersburg.
Truchmenen, Volksstamm, s. v. w. Turkmenen.
Truchseß (v. altd. truhtsâzo, "Vorgesetzter
der truht", des Trosses; auch Seneschall, lat. Dapifer. franz.
Écuyer de cuisine, Écuyer tranchant, engl. Steward),
im mittelalterlichen Königtum der Küchenmeister, zugleich
der erste Diener des Monarchen
869
Truchtersheim - Trüffel.
bei der Tafel, dann der Oberaufseher über den ganzen
Hofhalt. Im vormaligen Deutschen Reich gehörte seit Otto I.
das Truchsessenamt zu den Erzämtern (s. d.). Erztruchseß
war bis 1623 der Kurfürst von der Pfalz, dann der
Kurfürst von Bayern, 1706-1714 wieder Pfalz, und von da bis
zur Auflösung des Reichs wieder Bayern. Als Erbtruchseß
fungierte der Graf von Waldburg. Am österreichischen Hof
rangieren die Truchsesse unter den Kämmerern. Diese
Truchsessenwürde ist häufig mit dem Besitz von
Gütern verbunden.
Truchtersheim, Dorf und Kantonshauptort im deutschen
Bezirk Unterelsaß, Landkreis Straßburg, hat eine kath.
Kirche, ein Amtsgericht, eine Mineralquelle, Weinbau und (1885) 639
Einw.
Truck (Ruck), Insel der span. Gruppe der Karolinen (s.
d.).
Truckee (spr. tröcki), Stadt im nordamerikan. Staat
Kalifornien, an der Pacificbahn, 1774 m ü. M., westlich vom
2139 m hohen T.-Paß der Sierra Nevada, hat
Sägemühlen und (1880) 1147 Einw.
Trucksystem (spr. tröck-, v. engl. truck, "Tausch,
Tauschhandel"), das Verfahren, Arbeiter, besonders Fabrikarbeiter,
nicht in barem Geld, sondern in Naturalien, namentlich in
Anweisungen auf einen vom Arbeitgeber gehaltenen Laden abzulohnen.
Vielfach von habsüchtigen Fabrikanten mißbraucht, wurde
dasselbe schon früher in England heftig bekämpft und
meist gesetzlich verboten. (Das erste gegen das T. ankämpfende
Gesetz wurde in England 1464 erlassen; zu demselben kamen in den
folgenden Jahrhunderten noch eine Reihe [etwa 16] weiterer Gesetze.
Dieselben wurden durch das noch bestehende Gesetz von 1831
aufgehoben, welches durch die Truck-Amendment Act vom 16. Sept.
1887 ergänzt und erweitert wurde. In Preußen allgemeines
Verbot 1847, während im Bergbau und in der Textilindustrie
schon im 16. Jahrh. Verbote vorkamen; Verbot in Belgien durch
Gesetz vom 16. Aug. 1887.) Die deutsche Gewerbeordnung verpflichtet
die Arbeitgeber (ursprünglich nur die Fabrikinhaber sowie
diejenigen, welche mit Ganz- oder Halbfabrikaten Handel treiben,
seit 1878 alle Gewerbtreibenden, vgl. Fabrikgesetzgebung, S. 1002),
die Löhne ihrer Arbeiter bar auszuzahlen; sie dürfen
denselben keine Waren kreditieren; zuwiderlaufende Verträge
sind nichtig. Nun gibt es freilich auch Fälle, in denen die
Gewährung von Naturalien nicht zu umgehen und für den
Arbeiter selbst vorteilhaft ist. Deshalb wurde auch gestattet, den
Arbeitern Wohnung, Feuerungsbedarf, Landnutzung,
regelmäßige Beköstigung, Arzneien und
ärztliche Hilfe sowie Werkzeuge und Stoffe zu den von ihnen
anzufertigenden Fabrikaten unter Anrechnung bei der Lohnzahlung zu
verabfolgen. In Rußland ist das T. in verschiedenen Formen
noch sehr verbreitet.
Trude, Trudenfuß, s. Druden, Drudenfuß.
Trudpert, Missionär im Breisgau, soll um 650 (nach
den sehr dürftigen Nachrichten) von einem Grafen Othbert in
einem Thal des Flüßchens Neumage ein Grundstück zu
einer geistlichen Stiftung erhalten haben, doch bei der Herstellung
des Gebäudes ermordet worden sein. Deshalb wurde er als
Heiliger verehrt. Vgl. Körber, Die Ausbreitung des
Christentums im südlichen Baden (Heidelb. 1878).
Trueba (T. y la Quintana), Antonio de, span. Dichter und
Novellist, geb. 24. Dez. 1821 im baskischen Dörfchen
Montellana (Provinz Viscaya) als der Sohn armer Landleute, kam mit
15 Jahren nach Madrid, um die Kaufmannschaft zu erlernen, trieb
nebenbei mit großem Eifer Studien und erlangte an der
Universität mehrere Grade. 1846 endlich dem Handelsstand Valet
sagend, wandte er sich ganz der litterarischen Thätigkeit zu
und machte sich durch seine in Zeitschriften erscheinenden Lieder
und Gedichte einen Namen. Königin Isabella ernannte ihn 1862
zum Archivar von Viscaya mit einem Gehalt von 18,000 Realen und
verlieh ihm den Titel eines Poeta de la reina, den er nach der
Revolution von 1868, infolge deren er sein Amt verlor, mit dem
eines Poeta del pueblo vertauschte. Seitdem wieder in Madrid
lebend, starb er daselbst 10. März 1889. T. ist der
populärste spanische Dichter der Gegenwart. Seine Lieder,
gesammelt in dem oft aufgelegten "Libro de los cantaras" (Madr.
1852), leben im Munde des Volkes und haben ihm den Namen des
"spanischen Béranger" verschafft. Sie verherrlichen
vorzugsweise die baskische Heimat des Dichters und zeichnen sich
aus durch Treuherzigkeit der Gesinnung, gefällige Form und
natürliche Sprache wie durch Tiefe der Emfindung bei meist
melancholischem Grundton. Außerdem veröffentlichte er
eine große Anzahl von Erzählungen (Novellen,
Märchen, Schwänke) unter verschiedenen Titeln: "Cuentos
de color de rosa" (1859), "Cuentos campesinos" (2. Aufl. 1862),
"Cuentos de vivos y muertos" (1866), "Marta Santa" (1874), "Cuentos
de varios colores" (1874), "Narraciones populares"(1875), "Cuentos
de madres é hijos"(1879), "Nuevos cuentos populares" (1880)
etc., welche gleiche Beliebtheit wie sein Liederbuch erlangten und
zum Teil auch ins Deutsche, Französische, Englische, Russische
und Italienische übersetzt wurden. Sie sprechen an durch die
natürliche Einfachheit der Erzählung und die Anmut in der
Beschreibung des ländlichen Lebens, lassen aber die
reaktionäre Gesinnung und ultramontanen Sympathien des
Verfassers zu sehr hervortreten. Endlich sind von T. auch
historische Romane, wie "El Cid Campeador", "El redentor moderno"
(1876) u. a., und seine neuesten Werke: "Arte de hacer versos"
(1881), "De flor en flor" (1882), "El gaban y la chaqueta" (1884),
zu erwähnen. Eine Auswahl aus seinen Schriften enthält
die "Coleccion de autores españoles" (Leipz. 1874 ff.).
Trueba y Cosio, Telesforo de, span. Dichter, geb. 1805 zu
Santander, machte, zur diplomatischen Laufbahn bestimmt, seine
darauf bezüglichen Studien in London und Paris und wurde
sodann Attache bei der dortigen Gesandtschaft. Nach seiner
Rückkehr in das Vaterland 1822 stiftete er mit andern die
Akademie, in welcher sich damals alle jüngern Dichter Spaniens
vereinigten. Zu Cadiz, wohin er als Anhänger der
Cortesregierung 1823 flüchten mußte, schrieb er die
beiden Lustspiele: "El veleta" und "Casarse con 60,000 duros", die
ihm für immer einen Platz unter den besten spanischen
Dramatikern sichern. Nach der Wiederherstellung des Absolutismus in
Spanien wandte sich T. nach London. Hier schrieb er in englischer
Sprache mehrere historische Romane, unter welchen "Gomez Arias"
(1828) und "The Castilian" (1829) am bekanntesten sind, das
historisch-biographische Werk "Lives of Cortes and Pizarro" (1830),
das große Verbreitung fand, viele Lustspiele und das
historische Drama "The royal delinquent". Den bedeutendsten Ruf
aber verschaffte ihm das Sittengemälde "Paris and London"
(1833). 1834 nach Spanien zurückgekehrt, ward er hier zum
Prokurator und dann zum Sekretär der Zweiten Kammer
gewählt. Er starb 4. Okt. 1835 in Paris.
Trüffel (Speisetrüffel, Tuber Mich.),
Pilzgattung aus der Unterordnung der Tuberaceen und der
870
Trüffel.
Ordnung der Askomyceten, meist vollständig unterirdisch
wachsende Pilze mit einem im Boden verbreiteten fädigen
Mycelium und ziemlich großen, knollenförmigen, festen,
fleischigen Fruchtkörpern (Peridien), welche nicht hohl,
sondern auf dem Querdurchschnitt durch marmorartige Adern in
unregelmäßige, massive Kammern geteilt sind. Man
unterscheidet feine, dunkel gefärbte Adern, welche von der
Peridie ausgehen und die eigentlichen Kammerwände darstellen,
auf denen das stark entwickelte, braune, fruchtbare Gewebe
(Hymenium) aufsitzt, während weiße Adern das zwischen
dem Hymenialgewebe befindliche lufthaltige Füllgewebe der
engen, gewundenen Kammern darstellen. In dem dicken Hymenialgewebe
nisten zahlreiche große, runde oder eirunde
Sporenschläuche mit je 1-8, meist 4 ordnungslos liegenden,
kugeligen oder elliptischen, mit stachligem oder netzförmig
gezeichnetem, gefärbtem Episporium versehenen Sporen (vgl.
Tafel "Pilze II", Fig. 11). Die Peridie ist an der Oberfläche
warzig oder glatt, im reifen Zustand stets schwarz oder braun
gefärbt. Die Gattung zählt ungefähr 20 Arten, welche
in der gemäßigten Zone Europas, besonders in Frankreich
und Italien, in Deutschland und England, aber auch in Asien, Afrika
und Nordamerika vorkommen. Die seit dem Altertum wegen ihres
aromatischen Geruchs und Geschmacks als kulinarischer Luxusartikel
berühmten Trüffeln sind sehr nahrhaft und werden bald
für sich allein, gebraten oder mit Rotwein gekocht und mit
Butter, genossen, bald als Bestandteil von Pasteten
(Straßburger Gänseleberpasteten) oder als Zusatz in
Fleischspeisen, Brühen, Suppen etc. verwendet. Sie wachsen
herdenweise in der Erde und zwar alljährlich immer an
denselben bestimmten Plätzen, den sogen.
Trüffelplätzen (truffières). Nach Ascherson fehten
sie gegenwärtig in der Mark, dagegen sind sie in den
Laubwäldern um Bernburg seit langer Zeit bekannt und treten
hier am reichlichsten unter Eichen und Roßkastanien auf.
Andre Fundorte sind: München-Nienburg, Neugatersleben im
Bodethal, das Forstrevier Lödderitz bei Dessau, Zerbst,
mehrere Orte Thüringens, Ahrbergen und Eberholzen unweit
Hildesheim, die Rheinwaldungen bei Rastatt. Im Nordosten
Deutschlands finden sich Trüffeln (Tuber mesentericum, die
auch in Böhmen und Mähren häufig ist) in der
Weichselniederung bei Kulm sowie bei Ostromatzko gegenüber der
Brahemündung. Das Vorkommen der schwarzen T. scheint auf den
Peisterwitzer Odenwald bei Ohlau und auf Tillowitz unweit
Falkenberg beschränkt zu sein. Dafür ist die weiße
T. (Choiromyces maeandriformis) in Oberschlesien, Böhmen,
Mähren, Ungarn, Siebenbürgen, Italien und Rußland
nicht selten. Die Fundplätze haben meist einen kalkigen oder
aus Kalk und Thon oder Sand gemengten Boden. Überall aber ist
die Anwesenheit von Bäumen eine notwendige Bedingung. Wenn der
Waldbestand abgetrieben wird, so verschwinden auch die
Trüffeln; aber sie erscheinen nach Jahren genau an denselben
Stellen wieder, wenn der Boden wieder mit Gehölz bewachsen
ist. Vorzüglich kommen sie unter Eichen und Hainbuchen, aber
auch unter Kastanien, Haselnußsträuchern, Rotbuchen und
zahlreichen andern Holzpflanzen vor. Man findet sie im Umkreis der
Bäume, bis wohin die Wurzeln, nicht aber der Schatten
derselben reichen; überhaupt lieben sie lichte Gehölze,
in denen die Bäume in größern Entfernungen stehen.
Das Mycelium schmarotzt perennierend auf den Wurzeln von
Holzgewächsen, wie schon daraus hervorgeht, daß junge in
den Boden eingesetzte Trüffeln sich nicht weiter entwickeln.
Für eine mit der T. nahe verwandte Art, die Hirschtrüffel
(Elaphomyces granulatus Nees), wurde der Parasitismus durch Boudier
und Rees direkt bewiesen. Da auf den Wurzeln zahlreicher
einheimischer Gewächse durch Frank parasitische Hüllen
von Pilzmycelien aufgefunden wurden (s. Mycorhiza), so lag der
Gedanke nahe, ein ähnliches symbiotisches Verhältnis auch
zwischen den Mycelien der echten T. und den Wurzeln bestimmter
Holzpflanzen anzunehmen. Direkte Kulturversuche fehlen zur Zeit
noch. Ganz junge Trüffeln sind nur erbsengroß,
blaß oder rötlich; sie scheinen ein Jahr zu ihrer Reife
zu bedürfen. Im Herbst oder Winter findet man reif nur Tuber
brumale und T. melanosporum, Ausgang Winters, im Frühling und
Sommer Tuber aestivum und T. mesentericum; die letztern werden
daher in den ersten Monaten des Jahrs noch unreif gesammelt und in
der Provence als Maitrüffeln bezeichnet. Man läßt
die Trüffeln von abgerichteten Hunden (Trüffelhunden;
Burgund, Italien, Deutschland) oder von Schweinen (Provence,
Poitou, auch in Westpreußen), in Rußland früher
auch von Bären aufsuchen, welche durch ihren Geruch die 5-16
cm unter der Erde verborgenen Pilze aufspüren. Nach
Deutschland kamen um 1720 die ersten dressierten Trüffelhunde,
von welchen der König August II. von Polen in Italien zehn
Stück angekauft hatte. Die Trüffeljagd findet statt vom
November bis Februar. Der französische Trüffelhandel
datiert seit 1770 und erstreckt sich jetzf fast über ganz
Mittel- und Südfrankreich. Am meisten produzieren die
Provence, besonders das Departement Vaucluse mit dem Zentralort
Carpentras, ferner die Dauphiné, Périgord, Dordogne,
Charente, Niederalpen und Lot; besonders berühmt sind die
Trüffelkulturen am Fuß des Mont Ventoux im Departement
Vaucluse, der 1858 mit Eichen aufgeforstet wurde. Die Ausfuhr aus
Frankreich beziffert sich auf 1,5 Mill. kg; im Departement
Vaucluse, in der Stadt Apt, kommt zur Winterszeit eine
Trüffelernte von 15,000 kg zu Markt. Große Bedeutung
haben die Trüffeln auch im Orient. Barth berichtet über
das häufige Vorkommen einer Trüffelart (jedenfalls
Terfezia leonis Tul.) in der nördlichen Sahara. Zu derselben
Art gehören auch die hellfarbigen Trüffeln, welche in der
Syrisch-Arabischen Wüste stellenweise massenhaft vorkommen und
kamelladungsweise in die syrischen Städte gebracht werden. In
diesen Gegenden gilt Helianthemum salicifolium Pers. als sicheres
Anzeichen des Vorkommens der T. Die Ernte währt in Syrien und
Palästina von Mitte Februar bis Mitte April, sie ist
abhängig von den Regen im Oktober und November, durch welche
auch die Kräuterdecke hervorgerufen wird, mit deren
üppigkeit die Häufigkeit der T. steigt und sinkt. In
Algerien findet sich die oben genannte Terfezia leonis im Schatten
des strauchartigen Helianthemum halimifolium, und auf der
kanarischen Insel Fuertaventura sucht man Trüffeln unter
Helianthemum canariense. Die gewöhnlichsten, als
Speisetrüffeln verwendeten Arten sind: Tuber brumale Vittad.,
mehr oder weniger kugelig, schwarz, auf der Oberfläche mit
polygonalen Warzen, nuß- bis faustgroß und dann bis 1
kg schwer, innen schwärzlich aschgrau, weiß
geädert, mit zahlreichen vier- bis sechssporigen
Sporenschläuchen, die Sporen mit stachligem Episporium, ist im
Winter in den Trüffelgegenden Frankreichs und Italiens sehr
häufig, selten in den Rheingegenden. T. melanosporum Vittad.
(T. cibarium Pers.), von voriger Art durch rötlichschwarze
Farbe, rötliche Flecke auf den War-
871
Trüffelpilze - Trumpp.
zen und durch rötlich- oder violettschwarzes Innere mit
weißen, zuletzt rötlichen Adern unterschieden, hat das
gleiche Vorkommen. T. aestivum Vittad., 2,5-5,5 cm,
unregelmäßig kugelig, schwarzbraun, mit sehr
großen Warzen, innen blaßbraun, mit elliptischen,
braunen, mit netzförmig gezeichnetem Episporium versehenen
Sporen, im Sommer und Spätsommer in Frankreich und in Italien
sehr häufig, stellenweise in Deutschland, z. B. in
Thüringen, und England. T. mesentericum Vittad., von voriger
Art durch schwarze Farbe und dunkleres Fleisch mit vielen sehr eng
gewundenen, weißen Adern unterschieden, an der Basis oft
gehöhlt, kommt wie vorige Art und oft mit ihr zusammen vor.
Nur in Italien, wo sie häufig gegessen wird, stellenweise in
Deutschland kommt vor T. magnatum Pico (Rhizopogon magnatum Corda).
1,5-11 cm, unförmig lappig, von den andern Arten durch die
wurzelartige Basis und durch die glatte Oberfläche
unterschieden, anfangs weiß, später blaß
ockerbraun, daher von den Lombarden Trifola bianca genannt, innen
gelblich, bräunlich oder rötlich mit weißen Adern,
von stark knoblauchartigem Geruch, reift im Spätsommer. Die
weiße T. (Choiromyces maeandriformis Vittad., Tuber album
Sow., Rhizopogon albus Fr.) ist glatt, hellbraun, faustgroß
und von allen echten Trüffeln unterschieden durch das
weiße, fleischige Innere, welches nur von einerlei feinen,
dunklern Adern (Hymenium) durchzogen ist. S. Tafel "Pilze I" u.
Taf. H, Fig. II. Vgl. Vittadini, Monographia Tuberacearum (Mail.
1831); Tulasne, Fungi hypogaei (Par. 1851); Chatin, La truffe (das.
1869); Planchon, La truffe (das. 1875); Rees u. Fisch,
Untersuchungen über Bau und Lebensgeschichte der
Hirschtrüffel (Kassel 1887); Bosredon, Manuel du trufficulteur
(Périgueux 1887); Ferry de la Bellone, La truffe (Par.
1888).
Trüffelpilze, s. Pilze (13), S. 72.
Trugdolde, eine Art des Blütenstandes (s. d., S.
81).
Trugdoldenrispe (Corymbus cymiformis), reichverzweigte
Schirmrispe mit quirlig gestellten Hauptverzweigungen, wie beim
Holunder.
Trugratten (Echimyidae), s. Nagetiere (5).
Trugschluß (Sophisma), ein auf falschen
Voraussetzungen oder falscher Verknüpfung derselben oder auf
zweideutig gebrauchten Wörtern beruhender Fehlschluß,
bei dem man die Absichtlichkeit einer Täuschung voraussetzt;
s. Schluß, S. 544. - In der Musik heißt T. (Trugkadenz,
ital. Inganno, franz. Cadence trompeuse) das Vermeiden eines nach
der vorausgegangenen Akkordfolge erwarteten Schlusses durch
Substitution eines andern Akkords für den tonischen (vgl.
Kadenz und Auflösung).
Truhe, langer, niedriger hölzerner Kasten mit
Deckel, welcher seit den frühsten Zeiten des Mittelalters zur
Aufbewahrung von Kleidungsstücken, Kostbarkeiten und zugleich
als Sitzmöbel diente. Anfangs war es mit der
Wandvertäfelung verbunden, wurde aber später
transportabel und auch auf Reisen mitgeführt. Die Truhen
wurden bemalt oder an den vier Seiten, später auch am Deckel,
mit reichem Schnitzwerk, Bemalung und Vergoldung versehen. Die
Brauttruhen, welche die Ausstattung der Braut enthielten, wurden
besonders reich verziert, zumeist mit auf Liebe und Ehe
bezüglichen Emblemen oder Darstellungen aus der antiken Sage
(s. Tafel "Möbel", Fig. 11). Zur größern Sicherung
wurden die Truhen auch mit eisernen Bändern beschlagen oder
auch mit eisernen Deckeln in durchbrochener Arbeit versehen (s.
Tafel "Schmiedekunst", Fig. 15).
Trujillo (Truxillo, beides spr. truchhílljo),
Sektion des Staats Andes der Bundesrepublik Venezuela, 13,549 qmn
(246,1 QM.) groß mit (1873) 108,672 Einw., ist im
südöstlichen Teil, wo die Andeskette von Merida
fortsetzt, hohes Gebirgsland, im nordwestlichen niedrig, wird vom
Rio Motaban, der dem See von Maracaibo zufließt,
bewässert, hat alle Klimate (vom heißen bis zum kalten)
und erzeugt vorzüglichen Kaffee und alle Südfrüchte
sowie etwas Weizen. - Die Hauptstadt T., in einem engen Kessel
gelegen, 826 m ü. M., hat eine höhere Schule, Handel
(hauptsächlich Kaffee- und Weizenexport) und 2648 Einw. T.
wurde 1559 gegründet, und war bis 1668, wo Flibustier sie
zerstörten, eine der schönsten Städte des Landes.
Nordwestlich davon liegt das Dorf Santa Ana, durch den
Friedensschluß zwischen den beiden Generalen Bolivar u.
Morillo 26. Nov. 1820 bekannt.
Trujillo (Truxillo, beides spr. truchhílljo), 1)
Bezirkshauptstadt in der span. Provinz Caceres, teils auf einem
Felsen, teils am Fuß desselben in 485 m Höhe gelegen,
hat 5 Kirchen und (1878) 9428 Einw welche sich mit Leinweberei,
Gerberei und Töpferei beschäftigen. T. ist Geburtsort
Pizarros. -
2) (Chimú) Hauptstadt des Departements Libertad (Peru),
in fruchtbarer, von Wüsten umgebener Gegend am Chimú,
65 m ü. M., ist gut gebaut und von Wällen und Bastionen
umgeben, die 1686 als Schutz gegen die Flibustier errichtet wurden,
hat eine Kathedrale, eine 1831 gegründete Universität,
ein bischöfliches Seminar, eine höhere Schule und (1876)
7538 Einw., die lebhaften Handel treiben. Die Häfen der Stadt
sind das 5 km entfernte Huanchaco und das wichtigere Salaverry, der
Ausgangspunkt der ins Innere führenden Eisenbahn und mit
Hafendamm (Molo). T. wurde 1535 von Pizarro gegründet, litt
wiederholt durch Erdbeben und war 1823 Sitz des Kongresses. 2 km
westlich davon liegen die Ruinen von Gran Chimú, der
angeblichen Hauptstadt des alten Chimúreichs. -
3) Stadt im Departement Yoro des zentralamerikan. Staats
Honduras, am Karibischen Meer, 1524 gegründet, hat einen guten
Hafen und 4000 Einw.; die Ausfuhr(1887: 628,100) Pesos) besteht aus
Bananen, Kokosnüssen, Mahagoni, Häuten, Gummi etc.
Trullanische Synoden heißen von Trullos, dem
gewölbten Saal des kaiserlichen Palastes zu Konstantinopel,
darin sie gehalten worden, das sechste ökumenische Konzil (s.
Monotheleten) und das sogen. Quinisextum (s. d.).
Trum (Plur. Trume oder Trümer, fälschlich
Trümmer), in der Geologie ausgefüllte Nebenspalten einer
Hauptspalte (Gang) von größern Dimensionen, im Gegensatz
zu den kleinern Apophysen; besonders eine durch Gabelung sich rasch
auskeilende Gangmasse (vgl. Gang, S. 890); im Bergbau auch s. v. w.
Förderseil.
Trümeau (franz., spr. -moh), Fensterpfeiler; ein
denselben deckender Wandspiegel, überhaupt ein bis nahe an den
Fußboden gehender Wandspiegel.
Trümletenthal, s. Jungfrau.
Trümmergesteine, s. Gesteine.
Trumpp, Ernst, Orientalist, geb. 13. März 1828 zu
Ilsfeld im württemb. Oberamt Besigheim, studierte in
Tübingen evangelische Theologie und orientalische Sprachen,
ging später zur Fortsetzung seiner orientalischen Studien nach
England und trat hier in die Dienste der Church Missionary Society,
in deren Auftrag er 1854-55 und 1857 die Sprache des Induslandes
erforschte und bearbeitete, während er den größten
Teil des Jahrs 1856 zur Erlernung des Neuarabischen in Ägypten
und Syrien zubrachte. 1858 ging er nach Peschawar, um die Sprache
der Afghanen zu untersuchen und zu bearbeiten. Aus Gesund-
872
Trumscheit - Trunksucht
heitsrücksichten 1860 in die Heimat zurückgekehrt,
privatisierte er zunächst in Stuttgart, nahm 1864 die
Diakonatsstelle in Pfullingen an, begab sich aber 1870 im Auftrag
der englischen Regierung von neuem nach Indien und zwar nach Lahor
im Pandschab, um daselbst in Verbindung mit einigen Sikhpriestern
eine Übersetzung der heiligen Bücher der Sikh
auszuführen. 1872 habilitierte er sich in Tübingen als
Privatdozent und erhielt 1874 die ordentliche Professur der
orientalischen Sprachen an der Universität zu München, wo
er 5. April 1885 starb. Sein Hauptwerk ist "The Adi Granth, or the
holy scriptures of the Sikhs, translated from the original
Gurmukhi" (Lond. 1877). Außerdem veröffentlichte er:
"Materialien zum Übersetzen aus dem Deutschen ins
Hebräische" (Heilbr. 1854); "Sindhi reading book" (Lond.
1858); "Über die Sprache der sogen. Kasirs im indischen
Kaukasus" (im 20. Bd. der "Zeitschrift der Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft"); "The Sindhi Diwan of
Abd-ul-Latif Shah" (1866); "Grammar of the Sindhi language" (Lond.
1872); "Grammar of the Pashto or language of the Afghans etc."
(das. 1873); "Einleitung in das Studium der arabischen Grammatiker"
(Münch. 1876); "Das Taufbuch der äthiopischen Kirche"
(äthiopisch u. deutsch, das. 1876); "Der Kampf Adams"
(äthiopischer Text, das. 1880); "Die Religion der Sikhs"
(Leipz. 1881); "Der arabische Satzbau" (Münch. 1879);
"Grammatische Untersuchungen über die Sprache der Brahuis"
(das. 1881); "Das Hexaemeron des Pseudo-Epiphanius"
(äthiopisch und deutsch, das. 1882); "Der Bedingungssatz im
Arabischen" (das. 1882) etc.
Trumscheit (Trumbscheidt, Scheidtholt, Trompetengeige,
Tromba marina, Tympanischiza), primitives, in Deutschland im
14.-16. Jahrh. und noch länger beliebtes Streichinstrument,
bestehend aus einem langen, schmalen, aus drei Brettchen
zusammengesetzten Resonanzkörper, über den eine einzige
Saite gespannt war, wenigstens nur eine Griffsaite, während
etwa noch hinzugefügte Saiten als Bordune unabänderlich
mitgestrichen wurden. Der zweifüßige Steg des
Trumscheits war nur mit einem Fuß aufgeleimt, während
der andre, wenn die Saite schwang, durch schnelles Berühren
des Resonanzbodens einen etwas schnarrenden Ton hervorbrachte.
Truncus (lat.), der Stamm der Bäume etc.; vgl.
Stengel und Baum.
Trunkelbeere, s. Vaccinium.
Trunkenheit, im allgemeinen der durch den Genuß
betäubender Stoffe, z. B. Opium, Alkohol, Haschisch, Kumys und
andrer gegorner Getränke, auf den Organismus hervorgebrachte
abnorme Zustand der Gehirnthätigkeit etc. Für
gewöhnlich wird die T. erzeugt durch alkoholhaltige
(spirituöse) Getränke. Man unterscheidet als den ersten
Grad der T. den Rausch. Derselbe gibt sich anfangs in einer
Steigerung des ganzen Lebensprozesses kund, die sich besonders als
eine höhere gemütliche Anregung im Gemeingefühl
durch Heiterkeit und Wohlbehagen, raschern Puls, gerötetes
Gesicht, belebte, glänzende Augen, lebhafte, wechselnde
Vorstellungen und leicht zu Gemütsbewegungen sich steigernde
Gefühle zu erkennen gibt. Beim zweiten Grade, der
Betrunkenheit (ebrietas), sind alle jene physischen Erscheinungen
gesteigert, zuweilen bis zu einer Art von Tobsucht und
Zerstörungswut, das Bewußtsein ist getrübt, die
Geistesthätigkeiten verwirren sich, und es entsteht Delirium.
Als dritten Grad unterscheidet man die sinnlose Besoffenheit, bei
der die sensorische Nerventhätigkeit völlig ruht, so
daß dem Menschen Bewußtsein, Empfindung und
willkürliche Bewegung verloren gehen. Den zur Gewohnheit
gewordenen übermäßigen Genuß spirituöser
Getränke bezeichnet man als Trunksucht oder
Trunkfälligkeit (ebriositas). Diese hat nach und nach eine
dauernde Verderbnis des Bluts, den Alkoholismus oder die
Säuferkrankheit, zur Folge. Da das preußische
Strafgesetz für Verbrechen, welche im trunkenen Zustand
begangen sind, mildernde Umstände bewilligt, so ist es
für den Gerichtsarzt wichtig, das Vorhandensein von T. zu
konstatieren. Diese Aufgabe erfordert große Vorsicht und
Beurteilung des individuellen Falles, da die Menge des genossenen
Getränks, welche erforderlich ist, um T. zu bedingen, bei
verschiedenen Personen äußerst verschieden groß
ist. Jedenfalls wird der Nachweis erbracht werden müssen,
daß zur Zeit der strafbaren Handlung ein so starker Rausch
bestanden hat, daß dadurch das Bewußtsein getrübt
und die freie besonnene Aktion aufgehoben worden ist. S.
Trunksucht.
Trunkmaschine, s. Dampfmaschine, S. 468.
Trunksucht, der gewohnheitsmäßige
Mißbrauch alkoholischer Getränke, welcher zu einer
Schädigung des körperlichen, geistigen und sittlichen
Lebens (Alkoholismus) führt. Unmäßiger
Alkoholgenuß zerstört alle Gewebe und Systeme des
Körpers und vernichtet die normale Konstitution des
Individuums und der Rasse. Am frühsten erkrankt der
Verdauungsapparat bei dem Trunksüchtigen; auf der
anfänglich katarrhalisch erkrankten Magenschleimhaut entstehen
Geschwürsbildungen, ein beständiges Gefühl von Druck
und Schmerz in der Magengegend, Säurebildung,
Appetitlosigkeit, häufiges, bald täglich wiederkehrendes
Erbrechen von zähem Schleim, besonders des Morgens, auch
Blutbrechen. Der absorbierte Alkohol wird der Leber zugeführt,
und je konzentrierter er war, desto früher und desto
intensiver sind die Veränderungen dieses Organs. Wein- und
Biertrinker erleiden niemals jene schweren Formen der
Leberdegeneration wie Schnapstrinker. Fettleber, Lebercirrhose,
Entzündung der Leber mit Schwund ihrer Bestandteile,
Gelbsuchten sind häufige Krankheiten der Trinker. Bei
gewohnheitsmäßigen Trinkern findet sich immer eine
Vergrößerung des Herzmuskels (Hypertrophie), später
fettige Entartung in demselben und in den Blutgefäßen.
Der Katarrh des Kehlkopfes, kenntlich durch die eigentümlich
rauh belegte Stimme, geht auf die innern feinen
Luftröhrenverzweigungen und Lungenbläschen über;
Ausweitungs- und Zerstörungsprozesse führen zur
Verkleinerung der Lungenoberfläche, zur Behinderung der
Blutzirkulation und des Gasaustausches in den Lungen und erzeugen
die bläuliche Gesichtsfarbe und die Kurzatmigkeit der Trinker.
Die gesteigerte Thätigkeit der Nieren nach Aufnahme von
alkoholischen Getränken führt nicht selten zur sogen.
Brightschen Niere, zur Nierenschrumpfung, einer Krankheit, die
meist zum Tod führt und auch in der Blutbeschaffenheit der
Trinker und in den vielen schädlichen Einwirkungen,
Durchnässungen etc., denen Trinker ausgesetzt sind, ihre
Ursache findet. Auch der Genitalapparat erleidet bei T. krankhafte
Veränderungen. Sehr mannigfach sind die Störungen des
Nervensystems. Die Anhäufung von Blut in den Hirnhäuten
und im Gehirn selbst, der Austritt von Blut (Schlaganfall) mit der
großen Reihe von krankhaften Störungen durch diese
Vorgänge, Entzündung der Hirnsubstanz und Schwund,
ähnliche Erkrankungen und Veränderungen im
Rückenmark und seinen Häuten sind die Ursachen vieler
Erscheinungen: Gefühl von Taubheit, Kribbeln, Ameisenlaufen,
Empfindungslosigkeit, Muskelzittern,
873
Trunksucht (gesetzliche Maßregeln, Trinkerasyle).
Krämpfe, Schwäche und Lähmung der Glieder,
Störungen der Intelligenz bis zum vollen Wahn- und
Blödsinn und zur allgemeinen Paralyse. Auch das Auge, das Ohr
und die Haut werden in ihren Funktionen durch den anhaltenden
Mißbrauch der spirituösen Getränke
beeinträchtigt. Das Blut der Trinker wird reicher an Wasser
und ärmer an Faserstoff und verändert sich in noch
unbekannter Weise in seiner Beschaffenheit; in den frühen
Stadien des Alkoholismus findet eine exzessive Fettbildung statt.
In allen Organen und Geweben tritt eine abnorme Anhäufung von
Fett auf, die selbst im Blut sich kenntlich macht. Es ist erwiesen,
daß Trinker viel häufiger erkranken als Nichttrinker,
nicht nur an den von der toxischen Einwirkung des chronischen
Alkoholgenusses direkt verursachten krankhaften Veränderungen
der einzelnen Organe, sondern daß sie wegen ihrer gesunkenen
Widerstandskraft auch mehr den allgemeinen
Krankheitseinflüssen ausgesetzt sind. Die Trinker verfallen
auch allen Krankheiten in einem viel intensivern Grad als
Nichttrinker; nicht nur, daß bei allen entzündlichen
Krankheiten, bei allen operativen Eingriffen und Wundverletzungen
jene den Säufern eigentümliche Erkrankung des Gehirns,
das Delirium tremens, hinzutritt und den Verlauf der Krankheit sehr
erheblich beeinflußt, sondern wegen der schlechten
Blutbeschaffenheit und der geschwächten Lebenskraft nehmen die
auftretenden, sonst relativ ungefährlichen Krankheiten einen
bösartigen Charakter an. Die T. steigert die Sterblichkeit,
indem viele Trinker nach Art einer akuten Vergiftung oder nach
einem Alkoholexzeß sterben; viel mehr aber gehen an den
geschilderten Folgen der T. und an Verunglückungen in der
Trunkenheit zu Grunde. Eine beträchtliche Anzahl von
Selbstmorden geschehen in und aus T. Die Lebensdauer der Trinker
ist in dem Maß verkürzt, daß, während ein
normal Lebender im Alter von 20 Jahren eine Lebensdauer von 44,2
Jahren zu erwarten hat, ein Trinker in gleichem Alter nur noch auf
15,6 Jahre rechnen darf. Die in der T. erzeugte Nachkommenschaft
ist schwächlich und kränklich und disponiert besonders zu
Idiotie, Konvulsionen, Epilepsie etc. In Gegenden, wo T. weit
verbreitet ist, zeigt sich die Militärbrauchbarkeit der Jugend
herabgemindert. T. erzeugt Müßiggang und Liederlichkeit
und wird dadurch eine der wirksamsten Ursachen der Einzel- und
Massenarmut, zugleich aber auch der Vermehrung der Verbrecher und
der Verbrechen. Mehr als Armut und Unwissenheit ruft T. die Neigung
zum Verbrechen hervor und beschönigt sie.
In dem Kampf gegen die T. sind nur solche Mittel anzuwenden,
die, den Anschauungen des Volkes angepaßt, auf Anerkennung
und Mitthätigkeit der Gesellschaft rechnen dürfen. Auch
hier sollte man nur das zu erreichen suchen, was zu erreichen
möglich ist. Die absolute Unterdrückung des Genusses
alkoholischer Getränke, die von vielen Seiten zum Prinzip
erhoben ist, wird nur in sehr beschränktem Maß zu
erreichen sein und nur in einzelnen Ländern ein
erstrebenswertes Ziel bleiben. Der Kampf gegen die T. ist mit
großer Energie von Vereinigungen selbstloser Männer
unter verschiedenen Formen und nicht ohne Verirrungen geführt
wordene (s. Mäßigkeitsvereine). Die gesetzlichen
Maßregeln gegen die T. haben nicht immer den beabsichtigten
Erfolg gehabt, weil sie aus fiskalischen Gründen nicht immer
streng durchgeführt werden, weil sie leicht zu umgehen sind,
und weil es fast unmöglich ist, eingewurzelte Gewohnheiten und
Neigungen aus dem Volk durch das Gesetz mit einemmal zu vertilgen.
So hat das Gesetz, welches den Verkauf aller spirituösen
Getränke bei hohen Strafen absolut verbietet und 1851 im Staat
Maine (Liquor Maine law) und später auch in mehreren andern
Staaten von Nordamerika eingeführt wurde, in keiner Weise
bewirkt, was seiner Rigorosität und den Anstrengungen, es
durchzuführen, entspricht. Als wirksame Angriffspunkte der
Gesetzgebung sind die Verminderung der Zahl der kleinen
Brennereien, namentlich der Hausbrennereien, anzusehen, ferner die
Einschränkung des Kleinhandels mit Spirituosen, Verminderung
der großen Zahl der Schankstellen durch strenge Prüfung
der Bedürfnisfrage und der Moralität des Schenkwirts.
(England: Gesetze von 1828 und 1872, nach denen der Betrieb eines
Schankgewerbes nur auf Grund einer alljährlich zu erneuernden
Konzession gestattet ist. Gesetze in Norwegen 1871, in Schweden
1857 und 1869, nach denen in jeder Gemeinde die Zahl der Schenken
durch die Behörde unter Mitwirkung der Gemeindeorgane
festgesetzt und die Schenken auf bestimmte Zeit an den
Meistbietenden verpachtet werden; niederländisches Gesetz von
1881, in Kraft getreten 1885; Gesetz für Galizien und die
Bukowina von 1877, weitergehende Bestimmungen enthält ein
für ganz Österreich geplantes "Gesetz zur Hintanhaltung
der Trunkenheit". Entsprechende Bestimmungen für Deutschland
enthalten die Gewerbeordnung von 1869, die Ergänzungsgesetze
vom 23. Juni 1879 und vom 7. Mai 1883, dann das Reichsstrafgesetz,
§ 361. Weiter als letzteres Gesetz gehen die
Polizeistrafgesetze einzelner Bundesstaaten sowie Gesetze in
Schweden [1864], England [1872], Frankreich [1873] etc., welche
diejenigen mit Strafe bedrohen, welche in Wirtschaften, auf der
Straße oder an andern öffentlichen Plätzen im
Zustand offenbarer oder Ärgernis erregender Trunkenheit
gefunden werden.) Weniger zuverlässig ist die
Branntweinsteuer, weil eine zu hohe Besteuerung die Defraudation
geradezu provoziert, während eine zu geringe Steuer den
Alkoholkonsum allerdings ganz direkt begünstigt.
Nachahmenswert ist die Maßnahme, die in Schweden, zuerst
in Gotenburg (gotenburgisches System), ergriffen ist, um die Zahl
der Schankstellen zu vermindern und die Beförderung des
Alkoholkonsums durch die Habgier der Schenkwirte zu verhüten.
Hier hat sich eine Aktiengesellschaft gebildet, um die
Schankstellen (s. oben) anzukaufen und ohne jeden Nutzen für
sich den Handel im Sinn der Mäßigkeit zu betreiben. In
einzelnen Staaten von Nordamerika wird der Schenkwirt gesetzlich
für alle Folgen der Trunkenheit, zu welcher er verholfen,
haftbar, so daß er bei Verunglückungen eines Trinkers an
dessen Familie Schadenersatz leisten muß und auch mit
bestraft werden kann, wenn ein Trinker, dem er die Getränke
verabfolgt, ein Verbrechen begeht. Von größter Bedeutung
sind die Trinkerasyle zur Heilung Trunksüchtiger. In diesen
Anstalten, in welchen nicht die unbeugsame Strenge eines
Gefängnisses, aber auch nicht die nachsichtige Zucht einer
Krankenanstalt herrschen darf, sollen alle Personen zwangsweise
verwahrt werden, welche durch T. die Herrschaft über sich
verloren haben, die Pflichten gegen sich und ihre Angehörigen
anhaltend vernachlässigen, sich und andern eine Gefahr werden
können. In diesen Asylen sollen ferner diejenigen Personen
untergebracht werden, welche in der Trunkenheit eine gesetzwidrige
Handlung begangen haben und zu einer Freiheitsstrafe verurteilt
sind. Das erste Trinkerasyl wurde 1857 in Boston errichtet, bald
waren alle Staaten der Union diesem Beispiel gefolgt, und noch
874
Trupial - Truppen.
jetzt ist die Zahl dieser staatlichen und privaten Asyle im
Zunehmen begriffen. Diese Asyle werden teils durch Beiträge
von Privaten, teils auch mit Unterstützung von seiten des
Staats oder auch ganz auf Kosten des letztern unterhalten. Das
Washingtonian Home in Boston, das älteste Institut dieser Art,
das anfangs nur durch Privatwohlthätigkeit erhalten wurde und
sehr bald so ausgezeichnete Erfolge aufweisen konnte, daß der
Staat ihm eine jährliche Unterstützung von 5000 Dollar
zuwies, wurde 1869 als eine Staatsanstalt anerkannt. In dieser
Anstalt waren 1857-72: 3811 trunksüchtige Personen behandelt
worden, von denen mehr als die Hälfte aus freien Stücken
zugegangen und die andern auf richterlichen Ausspruch zugebracht
waren. Von 400 Kranken, die 1875 hier behandelt waren,
gehörten 189 den wohlhabenden Ständen an. Das Prinzip der
Behandlung bestand hier in der vollen Enthaltsamkeit von allen
berauschenden Getränken, in der Beseitigung jedes Zwanges, in
der Wiederherstellung der körperlichen Gesundheit und in der
Kräftigung des sittlichen Moments. Bis zum 1. Mai 1876 sind in
dieser Anstalt ca. 5000 Kranke behandelt worden, und es soll
wenigstens ein Drittel vollkommen geheilt, ein Drittel erheblich
gebessert und würde von dem letzten Drittel auch noch ein
erheblicher Teil unter andern günstigen Verhältnissen
gebessert sein. Ein Trinkerasyl in Brooklyn (The Inebriate Home for
Klug's County, Brooklyn, New York), welches 1866 durch Privatmittel
gegründet wurde, nimmt lediglich Personen auf, die wegen T. zu
Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Hier ging man von der sehr
richtigen Erfahrung aus, daß solche Personen in den
Gefängnissen eher verschlechtert als gebessert würden,
und daß anstatt der bisherigen Bestrafung eine eigne
Behandlung der Trinker eintreten müsse. Ein besonderes Gesetz
ermächtigt, daß alle verurteilten Gewohnheitstrinker aus
den Grafschaftsgefängnissen in diese Anstalt verbracht werden,
und daß der Richter trunksüchtige Personen bis auf ein
Jahr in dieses Institut verbringen lassen könne. Die Kranken,
Männer und Weiber, werden in besondern Werkstätten und
beim Landbau zwangsweise beschäftigt. Über den Wert
dieser Einrichtungen ist ein vollgültiges Urteil noch nicht
gesprochen. Man macht den amerikanischen Asylen den Vorwurf,
daß sie ihre Insassen, die durchaus nicht immer als Kranke
gelten können, mit zu vieler Sentimentalität und Milde
behandeln, so daß diese Leute in ihren Neigungen und in ihren
lästerten Angewohnheiten eine gewisse Glorifizierung
erblicken, daß nicht überall nach geordneten strengen
Grundsätzen verfahren werde, daß in einzelnen Anstalten
die Insassen selbst leicht zu dem Genuß von Spirituosen
gelangen können, daß mehrere Anstalten unter der
Verwaltung von Nichtärzten sich befinden, und daß dies
im ärgsten Widerspruch mit dem immer proklamierten und
hervorgehobenen Grundsatz steht, daß T. eine Krankheit sei
(intemperance is a disease). Indessen sind die angeführten
Thatsachen durchaus nicht geeignet, den Grundwert dieser
Einrichtung, den hohen Nutzen derselben und ihre
Nachahmungswürdigkeit zu diskreditieren. In England haben
schon seit vielen Jahren ganz vornehmlich die Irrenärzte die
Zweckmäßigkeit und die unentbehrliche Notwendigkeit
solcher Anstalten hervorgehoben und verlangt. Privatasyle haben
hier mehrfach schon seit Jahren existiert, und vielfältig ist
hier die Frage erörtert worden, ob nach der bestehenden
Gesetzgebung trunksüchtige Personen in Irrenanstalten
aufgenommen werden dürfen. Aber auch hier war die Ansicht
vorherrschend, daß zur Aufnahme und Behandlung von
Gewohnheitstrinkern ganz besondere Anstalten vorhanden sein
müßten, daß ihre Einschließung auf
gesetzlichem Wege geregelt und bis auf ein Jahr ausgedehnt werden
müßte. Ein 1880 auf die Dauer von zehn Jahren in Kraft
getretenes Gesetz läßt jedoch nur Privatinstitute zu,
und in diese können Personen freiwillig eintreten, wenn sie
ihren Willen in einem schriftlichen Antrag erklärt haben, und
wenn dieser Antrag von zwei angesehenen Bürgern, welche vor
einem Friedensrichter bezeugen, daß der Antragsteller ein
Gewohnheitstrinker sei, mit unterzeichnet worden. Diese Asyle
dürfen nur auf eine besondere Lizenz hin errichtet werden, und
wie die Irrenanstalten werden auch sie alljährlich von
königlichen Beamten inspiziert. Auch in Deutschland hat man
Trinkerasyle aus Privatmitteln errichtet. In sehr wirksamer Weise
wird die T. bekämpft durch Beförderung der Verbreitung
derjenigen Getränke, die einen Ersatz für den Branntwein
gewähren: Begünstigung des Konsums von leichtem Wein und
besonders von gutem, billigem Bier, von Kaffee und Thee. In England
hat man von philanthropischer Seite große Kaffeehäuser
für die arbeitenden Klassen errichtet. Ebenso wichtig ist die
Förderung des körperlichen Wohls der arbeitenden Klassen
durch Beschaffung billiger und gesunder Nahrungsmittel und
menschenwürdiger Wohnung, die Stärkung des sittlichen
Gefühls im Volk durch Hebung des Wissens und der Bildung
vermittelst der Schule und der Kirche. Volksbibliotheken,
belehrende Vorträge, Theater mit sittlicher Tendenz, Museen,
Arbeitervereine erweisen sich mit der Verbreitung von gesunder
Aufklärung als gute Waffen gegen den gemeinsamen Feind des
Volksglücks, gegen die T. Vgl. Huß, Chronische
Alkoholkrankheit (a. d. Schwed., Stockh. 1852); Baer, Der
Alkoholismus (Berl. 1878); Monin, L'alcoolisme (Par. 1888);
"Mitteilungen zur Bekämpfung der T." (hrsg. von Böhmert
u. a., Leipz. 1889 ff.).
Trupial (Icterus Briss.), Gattung aus der Ordnung der
Sperlingsvögel, der Familie der Stärlinge (Icteridae) und
der Unterfamilie der Beutelstare (Icterinae), Vögel mit
schlankem, fein zugespitztem, auf der Firste gerundetem,
schneppenartig in das Stirngefieder eingreifendem, durch hohen
Mundwinkel ausgezeichnetem Schnabel, ziemlich kräftigen,
langzehigen Füßen mit hohen, stark gekrümmten
Nägeln, ziemlich langen Flügeln, unter deren Schwingen
die zweite die längste ist, langem, abgerundetem, seitlich
stufig verkürztem Schwanz. Der Baltimorevogel (I. Baltimore
L.), 20 cm lang, 30 cm breit, an Kopf, Hals, Kehle, Mantel,
Schultern, Flügeln und den beiden mittelsten Schwanzfedern
schwarz, an den Oberflügeldecken, dem Bürzel und den
Oberschwanzdeckfedern und den übrigen Unterteilen feurig
orange, auf den Flügeln mit breiten, weißen Querbinden,
die äußern Schwanzfedern halb orange, halb schwarz; das
Auge ist braun, Schnabel und Fuß grau. Er bewohnt die
Oststaaten Nordamerikas, geht im Winter bis Westindien und
Mittelamerika, lebt besonders an Flußufern, baut ein an
Baumzweigen hängendes, sehr künstlich geflochtenes Nest
und legt 4-6 blaßgraue, dunkler gefleckte und gestrichelte
Eier. Ernährt sich im Frühjahr fast ausschließlich
von Kerbtieren, aber im Sommer richtet er an Feigen und Maulbeeren
oft großen Schaden an. Wegen seines angenehmen Gesangs
hält man ihn viel im Käfig.
Truppen, militärische Abteilungen, die ihrer
Organisation nach ein in sich geschlossenes Ganze bilden, z. B.
Bataillon, Regiment. Im Gegensatz zu den
875
Truppenverbandplatz - Tsad.
Garden unterscheidet man Linientruppen, zu den T. der aktiven
Armee Reserve-, Landwehr- und Landsturmtruppen, reguläre,
irreguläre und Miliztruppen. Truppenkorps bestehen aus
gemischten Waffen; T.- oder Waffengattungen unterscheiden sich nach
ihrer Ausrüstung, Bewaffnung, Kampfweise etc. als Infanterie,
Kavallerie, Feld- und Fußartillerie etc. Truppenkörper,
Truppenteil bezeichnen gewisse Einheiten verschiedener
Größe. Truppenfahrzeuge, s. Bagage.
Truppenverbandplatz, bei jedem größern Gefecht
von dem beteiligten Truppenteil durch Aufstellung seines
Medizinwagens, bez. Medizinkastens errichteter Verbandplatz, auf
welchem die Hälfte der Ärzte und Lazarettgehilfen
verbleiben. Derselbe soll dem Gewehrfeuer möglichst entgegen
und leicht zugänglich sein. Hier erhalten die Verwundeten die
erste Hilfe. Die Truppenverbandplätze sind möglichst bald
mit dem Hauptverbandplatz zu vereinigen, damit Personal und
Material derselben baldthunlichst sich ihren Truppenteilen wieder
anschließen können.
Truro, 1) Stadt in der engl. Grafschaft Cornwall, am
gleichnamigen Fluß, der hier in den Falmouthhafen
mündet, die schönste Stadt der Grafschaft, mit neuer
Kathedrale, Museum, anglikan. Seminar, Schmelzhütten,
Papiermühlen u. (1881) 10,619 Einw. -
2) Stadt in der britisch-amerikan. Provinz Neuschottland, am
obern Ende der Cobequidbai, in fruchtbarer Gegend, mit (1881) 3461
Einw.
Trüsche, s. Quappe.
Truthuhn (Meleagris L.), Gattung aus der Ordnung der
Hühnervögel (Rasores) und der Familie der Hokkovögel
(Cracidae), große, hochbeinige, kurzflügelige und
kurzschwänzige Vögel mit unbefiedertem, warzigem Kopf und
Oberhals, zapfenförmiger, ausdehnbarer Fleischklunker an der
Oberschnabellade und schlaffer Haut an der Gurgel, kurzem, starkem,
oben gewölbtem und gebogenem Schnabel, ziemlich hohen,
langzehigen Füßen, sehr gerundeten Flügeln und
aufrichtbaren Schwanzfedern; einzelne Federn der Vorderbrust
wandeln sich in borstenartige Gebilde um, welche das übrige
Gefieder an Länge weit überragen. Das T. (Puter,
kalikutisches Huhn, M. Gallopavo L.), 100-110 cm lang, bis 150 cm
breit, ist oberseits bräunlichgelb, metallisch schimmernd, mit
schwarz gesäumten Federn, am Unterrücken und an den
Schwanzdeckfedern dunkelbraun, grün und schwarz
gebändert, auf der Brust gelblichbraun, am Bauch und an den
Schenkeln bräunlichgrau, in der Steißgegend schwarz,
Schwingen und Steuerfedern schwarzbraun, letztere schwarz gewellt,
an den nackten Kopf- und Halsteilen blau mit roten Warzen; der
Schnabel ist hornfarben, das Auge gelbblau, der Fuß violett
oder rot. Das T. lebt in Ohio, Kentucky, Illinois, Indiana,
Arkansas, Tennessee und Alabama in großen Waldungen,
zeitweilig gesellig, macht unregelmäßige Wanderungen,
geht im Herbst in Gesellschaften, die nur aus Männchen oder
aus Weibchen mit den Jungen bestehen, in das Tiefland des Ohio und
Mississippi, immer zu Fuß wandernd und nur mit
Überwindung größere Ströme überfliegend.
Nachts ruhen sie auf Bäumen. Die Henne legt in einer seichten
Vertiefung 10-15 oder 20 bräunlichgelbe, rot punktierte Eier
und bebrütet diese mit großer Treue; namentlich gegen
Ende der Brutzeit verläßt die Henne das Nest unter
keiner Bedingung. Bisweilen benutzen mehrere Hennen ein gemeinsames
Nest. Das T. frißt Gras und Kräuter, besonders
Pekannüsse und die Früchte der Winterrebe, Getreide,
Kerbtiere etc. Nicht selten mischen sich abgemattete
Truthühner gezähmten Hühnern bei, gehen in die
Ställe, begatten sich auch mit zahmen Truthennen. Von letztern
ausgebrütete Eier der wilden Hühner liefern Junge, welche
fast vollständig zahm werden. Man jagt das T. mit großem
Eifer, ähnlich wie den Auerhahn, fängt es aber auch ohne
Mühe in Fallen. Schon früh hat man angefangen, es zu
züchten, und gegenwärtig ist es sehr verbreitet. Man
findet es überall auf Hühnerhöfen, doch ist es
seines jähzornigen, zanksüchtigen Wesens halber wenig
beliebt; seine Dummheit ist erstaunlich, und namentlich wenn es
Küchlein führt, gebärdet es sich oft
lächerlich. Man hält auf einen Hahn 4-10 Hennen und
läßt sie ein-, auch zweimal im Jahr brüten. Die
Zahl der Eier beträgt 12-24. Die Henne brütet sehr eifrig
vier Wochen (man benutzt sie auch als zuverlässigste
Brüterin in der Hühnerzucht), und man muß Futter
und Wasser ganz in die Nähe stellen, den Hahn aber und andre
Hennen entfernt halten. Die jungen Hühnchen sind sehr
weichlich, dumm und ungeschickt und müssen sehr
sorgfältig vor Nässe, auch vor zu starker Hitze
geschützt und mit gekochten Eiern, gemischt mit Brotkrume,
Grütze, gequetschtem Hanfsamen und gehacktem Grünzeug
gefüttert werden. Nach vier Monaten kann man sie auf
Stoppelfelder und Wiesen treiben. Für den Markt werden sie
gemästet. Zweijährige Truthühner wiegen oft 10-15
kg. Das Fleisch ist sehr geschätzt, und ein mit Trüffeln
gefüllter Truthahn gilt namentlich in Frankreich als
beliebtester Braten. Das T. kam ziemlich früh nach Europa,
Gyllius erwähnt es als Hausvogel der Europäer; in England
soll es 1524, in Deutschland zehn Jahre später, bald darauf
auch in Frankreich eingeführt worden sein. 1557 war es aber
noch so kostbar, daß der Rat von Venedig bestimmte, auf
welche Tafel "indische Hühner" kommen durften.
Gegenwärtig ist es wohl am häufigsten in Spanien, wo man
Herden von mehreren hundert Stück trifft. Vgl. Rodiczky,
Monographie des Truthuhns (Wien 1882); Mariot-Didieux, Die
Truthühnerzucht (2. Aufl., Weim. 1873); Schuster, Das T.
(Kaisersl. 1879).
Trutta, Lachs.
Trutzfarben, s. Darwinismus, S. 566.
Trutzwaffen, die Angriffs-, Kampfwaffen, gegenüber
den Schutzwaffen.
Truxillo, s. Trujillo.
Trybock, mittelalterliche Kriegswurfmaschine, s. v. w.
Balliste.
Trygon, s. Rochen.
Trypeta, Bohrfliege.
Tryphiodoros (richtiger Triphiodoros), griech. Dichter zu
Ende des 5. Jahrh. n. Chr., aus Ägypten, Verfasser eines
epischen Gedichts von der "Eroberung Trojas" in 691 Versen. Ohne
dichterischen Schwung, ist es in leidlicher Sprache geschrieben
(hrsg. von Wernicke, Leipz. 1819, und Köchly, Zürich
1850; deutsch von Torney, Mitau 1861).
Tryphoniden (Tryphonides), s. Schlupfwespen.
Trypograph (griech.), s. Hektograph.
Trypsin, s. Bauchspeichel.
Trzemeszno, Stadt, s. Tremessen.
Tsad (Tschad), großer Süßwassersee im
Sudân (Afrika), stellt das Zentrum der Abflachung dar, in
welcher sich die Abflüsse Bornus, Bagirmis, der Länder im
S. Wadais und eines Teils der Haussastaaten sammeln,und liegt
zwischen 12°30'-14°30' nördl. Br. und 13°-15°
östl. L. v. Gr. in 244 m Meereshöhe (s. Karte
"Oberguinea"). Im SO. setzt sich derselbe durch das gelegentlich
von ihm überströmte, 500 km lange, nach NO. ziehende Thal
des Bahr el Ghazal
876
Tsanasee - Tschandarnagar.
oder Gazellenflusses (s. d. 2) fort, welches in den Niederungen
von Egai und Bodele endigt. Während der See aus der Wüste
im N. keine Zuflüsse erhält, münden von W. her der
spärlich Wasser führende Waube, von S. der gleichfalls
nicht bedeutende Mbulu und von SO. der allezeit wasserreiche Schari
in denselben. Der T. hat einen sehr schwankenden Wasserstand, der
im November infolge der Flut des Schari am höchsten ist; seine
Ufer sind teilweise ganz unbestimmt, man schätzt seinen
Flächeninhalt aus 27,000 qkm (fast 500 QM.). Er hat eine
dreieckige Gestalt und besteht in seinem westlichen Teil aus
offenem Wasser, während der östliche nur ein netzartig
verzweigtes Gewirr von Wasseradern mit zahlreichen Inseln ist, auf
denen das Volk der Jedina oder Budduma haust. Sind die
Regenfälle sehr stark, so müssen die Inselbewohner wohl
auf das Uferland flüchten, während lange Trockenheit die
Vereinigung der Inseln mit dem Ufer herbeiführt. Häufig
sind die Ortschaften an den Ufern durch die Anschwellungen des Sees
vernichtet worden. Nahe dem Westufer liegt Kuka, die Hauptstadt
Bornus. Die Umwohner sind Kanembu, Bornuaner, im SO. nomadisierende
Araber. Die ersten Europäer, welche den See erblickten, waren
Clapperton, Denham und Oudney; der erste aber, welcher ihn befuhr,
war oer Deutsche A. Overweg (1851); Vogel untersuchte ihn 1853,
Nachtigal 1870. Vgl. Nachtigal in der Berliner "Zeitschrift
für Erdkunde" (Bd. 12); Derselbe, Sahara und Sudân, Bd.
2 (Berl. 1880).
Tsanasee, s. Tanasee.
Tsang, Getreidemaß, s. Thang.
Tsch..., slaw. Worte, die hier vermißt werden,
suche man unter C oder Cz...
Tschabuschnigg, Adolf, Ritter von, österreich.
Staatsmann und Dichter, geb. 9. Juli 1809 zu Klagenfurt, studierte
in Wien die Rechte, trat 1832 in den Staatsdienst, ward 1850
Oberlandesgerichtsrat in Klagenfurt, 1854 in Graz, 1859 Hofrat beim
obersten Gerichtshof in Wien, 1861 Mitglied des Reichsrats, 1870
des Herrenhauses, war vom 12. April 1870 bis 4. Febr. 1871
Justizminister im Kabinett Potocki; starb 1. Nov. 1877. Er schrieb:
"Gedichte" (Dresd. 1833; 4. Aufl., Leipz. 1872); "Neue Gedichte"
(Wien 1851); "Aus dem Zauberwalde", Romanzenbuch (Berl. 1856);
Novellen und Romane: "Die Ironie des Lebens" (Wien 1841), "Der
moderne Eulenspiegel" (Pest 1846), "Die Industriellen" (Zwick.
1854), "Sünder und Thoren" (Brem. 1875) u. a. Seine
"Gesammelten Werke" erschienen Bremen 1875-77, 6 Bde. Vgl. v.
Herbert, A. Ritter v. T. (Klagenf. 1878).
Tschad, See, s. Tsad.
Tschadda, Nebenfluß des Niger, s. Binuë.
Tschadir (türk., "Zelt"), in Persien Name des langen
Stückes blauer Leinwand, in welches die Perserinnen sich
außer dem Haus einhüllen.
Tschagatai (Dschaggatai), der zweite Sohn des
Dschengis-Chan, dem nach dessen Tode die Länder am Oxus und
Jaxartes, die Bucharei und Turkistan zufielen, die in jenen Teil
des mongolischen Reichs einverleibt wurden, welcher unter dem Namen
"Chanat von Tschagatai" von den uigurischen Pässen bis nach
Amaje am Oxus sich erstreckte. T. starb 1241, seine Nachkommen
behaupteten sich bis auf Timur.
Tschagischer Thee, die Blätter der sibir. Saxifraga
crassifolia, werden in Rußland als Thee benutzt.
Tschai (türk.), Fluß.
Tschaïken (Csaïken), kleine galeerenartige, mit
Segeln und Rudern versehene Boote, welche, mit Kanonen und
Haubitzen ausgerüstet, im ehemaligen
österreichisch-ungarischen Militärgrenzland zur
Beschützung und Bewachung der Wassergrenze gegen die
Türken dienten. Es waren 25 solcher Schiffe im Gang, mit 1-8
Kanonen und mit dem Tschaikistenbataillon bemannt, das den
Marktflecken Titel (Titul) an der Theißmündung zum
Stabsort hatte.
Tschaikowsky, Peter Iljitsch, Komponist, geb. 25. Dez.
1840 auf dem Hüttenwerk Wotkinsk im Gouvernement Perm im
östlichen Rußland, studierte Rechtswissenschaft in
Petersburg und arbeitete von 1859 an im Justizministerium, bis er,
seiner Neigung zur Musik folgend, den Staatsdienst verließ
und in das von A. Rubinstein neubegründete Konservatorium
eintrat. Nach Absolvierung seiner Studien (1866), und nachdem er
für eine Kantate nach Schillers Gedicht "an die Freude" die
Preismedaille errungen, erhielt er die Stelle eines
Kompositionslehrers am Konservatorium zu Moskau, die er bis 1877
bekleidete, in welchem Jahr er aus Gesundheitsrücksichten
seine Entlassung nahm. T. lebt seitdem zurückgezogen teils in
Italien und in der Schweiz, teils in Rußland. Seine
namhaftesten Werke sind: die Opern "Vakula der Schmied" und "Eugen
Onägin", "Opritschnik", 4 Symphonien, die symphonischen
Dichtungen: "Der Sturm", "Romeo und Julie", "Francesca da Rimini",
3 Streichquartette, 2 Klavierkonzerte, Sonaten und andre
Klavierstücke, Kompositionen für Violine und Violoncello
etc. Auch veröffentlichte er eine "Harmonielehre" und eine
russische Übersetzung von Gevaerts "Traité
d'instrumentation".
Tschako (ungar. Czakot), eine seit dem Anfang dieses
Jahrhunderts übliche militärische Kopfbedeckung in Form
einer hohen Mütze, entweder oben und unten gleich weit, oder
oben schmäler als unten, wie der jetzige T. der Jäger und
des Trains, oder oben breiter als unten, in welcher unpraktischen
Form er überall verschwunden ist; gewöhnlich von Filz,
mit ledernem Deckel und Kopfrand, vorn mit einem Schild
versehen.
Tschamara (tschech.), mit einer engen Reihe kleiner
Knöpfe besetzter Schnurrock mit niedrigem Stehkragen,
tschechische Nationaltracht.
Tschambal, Hauptfluß der Landschaft Malwa in
Zentralindien, entspringt im Windhyagebirge, fließt gegen NO.
und mündet in die Dschamna; 689 km lang.
Tschambesi, Fluß in Zentralafrika, mündet an
der sumpfigen Ostseite des Bangweolosees und könnte somit als
Quellfluß des Congo angesehen werden.
Tschanak-Kalessi ("Topfburg"; bei den Europäern
Dardanellen genannt), Hauptstadt des zum türk. Wilajet Karasi
gehörigen, etwa die alte Landschaft Troas umfassenden Liwa
Bigha, an der engsten Stelle des Hellespont auf asiatischer Seite
gelegen, Sitz zahlreicher militärischer und
Zivilbehörden, eines internationalen Telegraphenamtes, eines
Quarantäne- und Hafenamtes, mit über 7000 Einw. (zur
Hälfte Mohammedaner). T. ist Transithafenplatz für Holz,
Galläpfel, Wolle und Getreide, betreibt Schiffbau, exportiert
viel Töpferwaren und hat ein Regierungsgebäude, eine
Kaserne, 10 Moscheen, 3 Kirchen, 2 Synagogen, 9 türkische, 4
christliche und 2 jüd. Schulen, 11 Vizekonsulate etc. Am Meer
das alte Fort Kale Sultanie, dessen Name häufig für die
Stadt selbst gebraucht wird.
Tschandal, eine der niedrigsten Hindukasten in Bengalen
und Assam, nichtarischen Bluts und 1881: 1,749,608 Köpfe
stark. Sie sind sehr geschickte Schiffer, kräftig und waren
von den Ariern tief verachtet, aber zugleich auch gefürchtet;
sie bekennen sich zum Teil zum Islam.
Tschandarnagar (Chandernagur), franz. Enklave in der
britisch-ind. Provinz Bengalen, am Hugli,
877
Tschang - Tschechische Litteratur.
^85 km oberhalb Kalkutta, 10 qkm groß mit (1885) 25,842
Einw., steht unter einem von dem Generalgouverneur in Ponditscherri
abhängigen Beamten und hatte 1883 eine Einnahme von 210,009,
eine Ausgabe von 166,500 Frank. T. erhält von der
britisch-indischen Regierung jährlich 300 Kisten Opium unter
der Bedingung, daß es selbst kein Opium bereitet. Es wurde
1673 von den Franzosen besetzt, der Ort erlangte schnell
große Bedeutung als Handelsplatz, wurde von den
Engländern mehrmals erobert, 1815 endgültig
zurückgegeben, hat sich aber nicht wieder erholen können.
Vgl. Fras, Études sur Chandernagor (Lyon 1886).
Tschang, Längenmaß in China, à 10
Tschih; im Zollamt nach englischen Verträgen = 3,58, nach
französischen = 3,55 m.
Tschangscha, s. Hunan.
Tschantabon, Handelsstadt im südöstlichen Siam,
an der Mündung des gleichnamigen Küstenflusses in den
Golf von Siam, mit angeblich 6000 Einw.
Tschapat (türk.), Post, das Postwesen, auch
Postreiter in Persien. T.-Chan, Poststation.
Tschardaken, Wachthäuser an der
österreichisch-türk. Militärgrenze für
Militär- und Zeltwache und den Pestkordon. Vgl. Karaul.
Tschardas, s. v. w. Csárdás.
Tscharka, Flüssigkeitsmaß, s. Kruschka.
Tscharnikau, s. Czgrnikau.
Tschaslau (tschech. Cáslav), Stadt in
Ostböhmen, in fruchtbarer Ebene, an der Österreichischen
Nordwestbahn, Sitz einer Bezirkshauptmannschaft, einer
Finanzbezirksdirektion und eines Bezirksgerichts, hat eine
Dechanteikirche mit hohem Turm, eine neue evang. Kirche, ein
schönes Rathaus, ein Denkmal Ziskas, ein Theater, ein
Untergymnasium, eine tschechische evang. Lehrerbildungsanstalt,
eine Rübenzuckerfabrik (außerdem 7 in der Umgebung von
T., einem Hauptsitz dieser Industrie), Bierbrauerei,
Dampfmühlen, Fabrikation von Spiritus, Preßhefe, Seife
und (1880) 7178 Einw. Von T. führt eine Lokalbahn nach
Butschitz (mit Zuckerfabrik und Eisenwerk Hedwigsthal) und
Zawratetz. T. ist sehr alt, war ein Hauptplatz der Hussiten und
litt sehr im Dreißigjährigen Krieg.
Tschataldscha, 1) Städtchen 60 km westlich von
Konstantinopel, an der Eisenbahn nach Adrianopel, nach welchem die
umfangreichen, 1878 zum Schutz Konstantinopels errichteten
Verteidigungswerke benannt werden; Sitz eines Mutefsarif. -
2) Früherer türk. Name der jetzt griech. Stadt
Pharsalos (s. d.).
Tschatschak, Hauptstadt eines Kreises im Königreich
Serbien, rechts an der Morawa, mit Kirche, Untergymnasium und
(1884) 3137 Einw. Hier zweimal (1806 und 1815) Sieg der Serben
über die Türken. Der Kreis umfaßt 3164 qkm (57,4
QM.) mit (1887) 82,358 Einw.
Tschausch (türk.), ehemals Leibgardist oder
Polizist, deren Vorgesetzter (T.-Baschi) mit wichtigen
Staatsfunktionen betraut war; jetzt s. v. w. Wachtmeister, auch
Vorreiter eines Wesirs; in Persien Unternehmer und Anführer
von Pilgerkarawanen; in Serbien der Spaßmacher bei der
Hochzeit.
Tschaussy, Kreisstadt im russ. Gouvernement Mohilew, hat
eine griechisch-orthodoxe und eine Uniertenkirche, Fabriken in
Leder, Wolle, Seife und Talg und (1885) 5202 Einw., zur Hälfte
Juden.
Tschautschau, Handelsstadt in der chines. Provinz Fukien,
mit katholischer und evang. Mission und angeblich 1 Mill. Einw. T.
sollte nach dem Vertrag von Tientsin (1858) den Fremden als
Vertragshafen geöffnet sein. Da es aber infolge seiner Lage
oberhalb der Mündung des Han der Schiffahrt schwer
zugänglich ist, so wird das an der Mündung gelegene
Swatau (s. d.) als Vorhafen benutzt.
Tschay (Czay), Mischung von Thee, Zucker und Rum oder
Rotwein; auch ein aus gestoßenem Mais, heißem Wasser,
Zucker und Rum bereitetes, in Rußland und Ungarn sehr
beliebtes Getränk.
Tschebokssary, Kreisstadt im russ. Gouvernement Kasan, an
der Wolga, mit 12 Kirchen, dem Troizti-Kloster mit
wundertätigem Bilde des heil. Nikolaus und (1885) 5081 Einw.,
welche Juftengerberei und Handel mit Honig und Wachs treiben.
Tschech, Heinrich Ludwig, geb. 1789 zu Klein-Kniegnitz in
Schlesien, studierte die Rechte und wurde Bürgermeister in
Storkow. Aus Privatrache machte er 26. Juli 1844 in Berlin einen
Mordversuch auf Friedrich Wilhelm IV. und wurde 14. Dez. d. J. in
Spandau enthauptet.
Tschechen (Tschechoslawen, ^Ce^si), Volksstamm der
Nordslawen in der österreichisch-ungar. Monarchie, vorwiegend
in Böhmen und Mähren seßhaft, wohin sie zu Ende des
5. Jahrh. n. Chr. aus dem Karpathenland an der obern Weichsel nebst
andern verwandten Stämmen einwanderten. In Böhmen
erlangten sie bald ein solches Übergewicht, daß ihr Name
bereits im 9. Jahrh. die allgemeine Bezeichnung für
sämtliche im Land wohnende Slawen ward und Böhmen selbst
die Bezeichnung Tschechy erhielt. Ihr Name stammt nach
gewöhnlicher Annahme von ihrem ersten Anführer, Tschech.
Der tschechische Stamm umfaßt außer den eigentlichen T.
in Böhmen auch die Mähren oder mährischen T.
(Moravani) in Mähren (im westlichen Gebirge Horaken, in der
Hanna Hannaken, im östlichen Gebirge Walachen genannt), zum
Teil auch in Schlesien, ferner die Slowaken im nordwestlichen Teil
Ungarns. Sonst sind die T. in einzelnen Ansiedelungen auch in
andern Kronländern vertreten. Ein starker Zuzug tschechischer
Handwerker und Arbeiter (namentlich Erd- und Bauarbeiter) findet
nach Niederösterreich, insbesondere nach Wien statt. Die
Gesamtzahl der T. beträgt 7,14 Mill. Die tausendjährige
Anstrengung, das eigne Wesen vor dem mächtigern Deutschtum zu
retten, hat dem T. manchen Charakterzug aufgedrückt, der sonst
den Slawen fremd ist: Mißtrauen, Verschlossenheit und eine
gewisse verbitterte nationale Erregtheit, da er sich immer durch
den Deutschen gedrückt meint, hinter dem er, mit Vorliebe dem
Ackerbau obliegend, in Gewerbe und Handel zurückbleibt. Seine
Natur zeigt aber manche schöne Eigenschaften. Er ist
arbeitsam, tüchtig als Soldat und Beamter, hat
natürlichen Verstand und rege Phantasie, faßt schnell,
eignet sich leicht fremde Sprachen an und treibt gern Poesie, Musik
und Wissenschaft. Eine gemeinsame Nationaltracht aus älterer
Zeit hat sich nicht erhalten; dagegen besitzen einzelne Gegenden,
wie die Hanna, malerische Kostüme. Die volkstümliche
Bauart des Block- und Pfahlwandbaues mit geringer Breite des
Hauses, hohem Dach u. waldkantig behauenen Blöcken, die auf
gemauertem Unterbau ruhen, und deren Zwischenräume mit Lehm
und Moos verstopft sind, hat sich nur im östlichen Teil
Böhmens erhalten. Weiteres s. in den Artikeln "Böhmen",
"Österreich", "Slawen" etc. Vgl. Vlach, Die ^Cecho-Slawen
(Teschen l883).
Tschechische Litteratur. Die t. L. hat sich unter den
slawischen Literaturen am frühsten entwickelt, wurde
jedoch in der hussitischen Zeit von theologisch-polemischen
Schriften überflutet und durch die Reaktion nach der Schlacht
am Weißen Berg (1620) fast voll-
878
Tschechische Litteratur (bis zum 16. Jahrhundert)
ständig unterbrochen. In den 20er Jahren des 19. Jahrh.
beginnt ihre Erneuerung und zwar vorwiegend in wissenschaftlicher
Richtung unter starker Anlehnung an gesamtslawische Ideen.
I. Periode.
Von den ältesten Zeiten bis zu Huß (800-1410).
Die ältesten Proben tschechischer und überhaupt
slawischer Poesie sind die sogen. "Grünberger Handschrift" (s.
d.), angeblich aus dem 9. Jahrhundert, und die "Königinhofer
Handschrift" (s. d.), die in das 13. oder 14. Jahrh. verlegt wird
und eine Reihe epischer und lyrischer Gedichte enthält, von
denen einige aus vorchristlicher Zeit stammen sollen. Die exklusiv
nationale Richtung, wie sie in den Dichtungen dieser Handschriften
(deren Echtheit übrigens seit ihrer Entdeckung bis auf den
heutigen Tag mannigfach angezweifelt wird) zu Tage tritt, konnte
sich dem Andrang der westeuropäischen Zivilisation
gegenüber nicht lange behaupten. Schon unter Wenzel I. und
Ottokar I. drangen mit deutscher Rittersitte auch die damals
beliebten poetischen Stoffe nach Böhmen. So ward die
"Alexandreïs" Walters von Châtillon von einem
unbekannten Dichter tschechisch bearbeitet (13. Jahrh.), ebenso die
Artussage in "Tristram", mit starker Nachahmung Gottfrieds von
Straßburg, und in "Tandarias a Floribella" (14. Jahrh.).
Höher an poetischem Wert stehen indessen die dem Dalimil (s.
d.) zugeschriebene (in Wirklichkeit von einem unbekannten Ritter
kurz nach 1314 verfaßte) Reimchronik der böhmischen
Geschichte und die in trefflicher Prosa geschriebene Erzählung
"Tkadlecek" aus dem 14. Jahrh. (hrsg. von Hanka, Prag 1824). Auch
didaktische Dichtungen, namentlich Tierfabeln, waren damals in
Böhmen sehr verbreitet (darunter "Nová Rada" und
"Radazvirat" des Smil Flaska von Pardubitz) wie nicht minder
kirchliche Poesien (bemerkenswert die "Legende von der heil.
Katharina", aus dem 14. Jahrh., 1860 von Erben herausgegeben) und
religiöse Dramen oder "Mysterien", als deren älteste
bekannte Probe der nur in einem Fragment erhaltene
"Mastickár" ("Salbenkrämer"), aus dem Anfang des 14.
Jahrh., zu nennen ist (hrsg. von Hanka im "Vybor"). - Die
tschechische Prosa begann mit Bibelübersetzungen. Ein kleines
Fragment des Evangeliums Johannis, der Schrift nach aus dem 10.
Jahrh., ist neben der Grünberger Handschrift das älteste
Denkmal der tschechischen Litteratur. Die Gründung der Prager
Universität 1348 gab dann den Wissenschaften in Böhmen
einen raschen Aufschwung. Einer ihrer ersten Schüler war
Thomas v. Stitny (s. d.), dessen theologisch-philosophische
Abhandlungen von der herrschenden Scholastik stark abwichen. Die
älteste Chronik in tschechischer Prosa ist die des Priesters
Pulkava von Hradenin (gest. 1380), der sich die übersetzung
der Reisen des Engländers Mandeville von v. Brezow und die des
Marco Polo anschlossen. Das älteste Denkmal endlich der
böhmischen Rechtsgeschichte ist die "Kniha starého
pána z Rozenberka" aus dem Anfang des 14. Jahrh.
II. Periode. Von Huß bis zur Schlacht am Weißen Berg
(1410-1620). Das Jahr, in welchem Joh. Huß seinen Bruch mit
der römischen Kurie vollzog, wird mit Recht als der Anfang
einer neuen Periode der tschechischen Litteratur bezeichnet. Um
sich in dem Streit mit Rom die Unterstützung der Volksmassen
zu sichern, schlug Huß kühn die Bahnen ein, welche vor
ihm bereits Thomas v. Stitny betreten hatte, gab die lateinische
Gelehrtensprache auf und wandte sich in gemeinverständlichen
tschechischen Predigten und Schriften an das Volk. Hierbei
entwickelte er die tschechische Sprache nicht nur praktisch,
sondern unterzog sich auch der Mühe, die bis dahin
außerordentlich schwankende Orthographie in einer besondern
Schrift zu regeln (vgl "M. J. Husi ortografie ceská". hrsg.
von Sembera 1857). Diese Bemühungen um die Vervollkommnung der
tschechischen Sprache wurden im 15. und 16. Jahrh. eifrig
fortgesetzt von der Gemeinschaft der Böhmischen oder
Mährischen Brüder (s. d.), welche die vorzüglichsten
tschechischen Stilisten hervorbrachte und zuerst in Jungbunzlau und
Leitomischl, darauf in Prerau Druckereien anlegte. Wesentlich
gefördert wurde der Aufschwung der tschechischen Litteratur
auch durch humanistische Einflüsse, namentlich unter Wladislaw
II. (1471-1516), als Bohuslaw v. Lobkowitz, welcher eine der
reichhaltigsten Bibliotheken seiner Zeit sammelte, und nach ihm
eine Reihe namhafter Gelehrten ausgezeichnete lateinische Gedichte
schrieben und ein andrer Kreis böhmischer Humanisten, an deren
Spitze der Rechtsgelehrte Cornelius v.Vsehrd stand, die klassischen
Studien für die tschechisch-nationale Litteratur zu verwerten
suchte. Gleichwohl konnte sich unter den erbitterten nationalen und
religiösen Kämpfen die tschechische Poesie nicht in dem
Maß fort entwickeln, als es sonst ihre glänzenden
Anfänge versprachen. Satire und Kriegslieder traten in den
Vordergrund. Der "Májovy sen" ("Maitraum") des Prinzen Hynek
Podiebrad (1452-91) ist nur seines Verfassers wegen zu
erwähnen; das satirische Gedicht "Prostopravda" des Nikolaus
Dacicky von Heslow (1555 bis 1626) hat nur noch für die
Kulturgeschichte Wert. Der bedeutendste tschechische Dichter dieser
Zeit ist Simon Lomnicky (gestorben nach 1622), obschon es ihm an
sittlichem Gehalt fehlte, um als didaktischer und moralisierender
Dichter Großes zu leisten. Für seine Hauptwerke gelten:
"Krátké naucení mladému
hospodári" ("Kurze Anleitung für einen jungen
Hauswirt), ein didaktisches Gedicht mit Zügen der damaligen
Sitten, und die Satire "Kupidova strela" ("Die Hoffart des
Lebens"), welche ihm bei Rudolf II. den Adel und einen Jahrgehalt
einbrachte; auch versuchte er sich in kirchlichen Dramen. Unter den
zahllosen kirchlichen Gesängen sind besonders die von dem
Bischof der Böhmischen Brüder, Joh. Augusta (1500 bis
1572), größtenteils im Gefängnis verfaßten
schwungvollen Lieder hervorzuheben.
Auch in der tchechischen Prosa dieser Periode überwiegt die
theologisch-polemische Richtung, indem Kalixtiner, Katholiken und
später Protestanten in kirchlicher Propaganda litterarisch
wetteiferten. Am wertvollsten sind die teils lateinischen, teils
tchechischen Schriften von Joh. Huß, dem Begründer des
Protestantismus (1369-1415), von denen die letztern neuerdings von
Erben (Prag 1865-68, 3 Bde.) herausgegeben wurden. Auf katholischer
Seite zeichnete sich der Prager Dekan Hilarius von Leitmeritz
(Litomericki, gest. 1469) aus. Durch kernhaften Stil ragen des
genialen Peter Chelcicky (s. d., 1390-1460) Schriften hervor,
welche der Böhmischen Brüderschaft als Richtschnur
galten. Unter den theologischen Schriftstellern dieser
Brüderschaft zeichnete sich besonders Lukas (1458-1528) durch
glänzenden Stil aus. Die erste tschechische Übersetzung
des Neuen Testaments von Lupác erschien 1475. die erste
Gesamtübersetzung der Bibel 1488; bis 1620 erschienen 15
tschechische Bibeln, die beste davon ist die 1579-93 in
Mährisch-Kralitz auf Kosten des Johann von Zerotin
veröffentlichte ("Bible Kralicka"), die noch heute für
das höchste Muster der tschechischen Sprache gilt. Die
Begründer der böhmischen Rechtswissenschaft
879
Tschechische Litteratur (16.-18. Jahrhundert).
sind Viktorin v. Vshehrd ("Neun Bücher vom Recht und
Gericht und von der Landtafel in Böhmen", 1550; hrsg. von
Jirecek, Prag 1874), der Landmarschall Ctibor von Cimburg in dem
sogen. "Tobitschauer Buch" (für Mähren) und P. Chr. v.
Koldin (1579), dessen Schrift "Prava mestska Kralostvi ceskeho"
für die Städteordnungen in Böhmen und Mähren
maßgebend wurde. Eifriger Pflege erfreuten sich die
historischen Wissenschaften. Den Übergang zur zweiten Periode
bilden die "Stari letopisove cesti", anonyme Annalisten der Jahre
1378 bis 1527 (hrsg. von Palacky 1829). Bedeutende Förderung
erhielt dann die tschechische Geschichtschreibung durch Adam v.
Veleslavín (1546-99), der zahlreiche eigne und fremde
historische Werke in musterhafter Sprache veröffentlichte
(Übersetzung der "Historia bohemica" von Äneas Sylvius,
"Politia historica", "Kalendar historicky" u. a.). Die Kämpfe
zwischen den Kalixtinern und den Protestanten in Prag 1524-30
wurden von dem eifrigen Lutheraner Bartos (gest. 1535) parteiisch,
aber anschaulich geschildert; den Widerstand der böhmischen
Stände gegen Ferdinand I. 1546-48 beschrieb Sixt v. Ottersdorf
(1500-1583) ebenfalls vom protestantischen Standpunkt aus, aber
durchaus pragmatisch und in klassischem Stil. Die gesamte
böhmische Geschichte behandelte der Kanonikus Vaclav Hajek von
Libocan (1495-1553), dessen "Chronik" eine beliebte Lektüre,
aber wenig zuverlässige Geschichtsquelle ist. Joh. Blahoslaw
(1523-71) von der Böhmischen Brüderschaft verfaßte
eine wertvolle Geschichte der letztern. Ein andrer Bruder, Vaclav
Brezan (1560-1619), Archivar des Grafen Rosenberg, schilderte in
einer Biographie dieses Magnaten die Ereignisse von 1530 bis 1592;
doch kommt dieses Werk stilistisch den Schriften Blahoslaws nicht
gleich. Zur Brüdergemeinde gehört ferner der Historiker
Jaffet (gest. 1614), der außer andern Werken eine Geschichte
vom Ursprung der Brüderunitäten schrieb. Wertvolle
Beiträge zur politischen und Kulturgeschichte Böhmens
enthalten die Briefe des Karl v. Zerotin (s. d.), neben dem noch
der polnisch-tschechische Historiker Barthol. Paprocki (1540-1614,
Beschreibungen der böhmischen, mährischen und
schlesischen Adelsgeschlechter) und der Hofhistoriograph des
Königs Mathias, Georg Zaveta, Verfasser einer "Hofschule"
("Scholaaulica",Prag 1607) zu erwähnen sind. Endlich
gehört hierher die reichhaltige Korrespondenz der Herren v.
Schlik, Rabstein, Sternberg, Rosenberg, Cimburk, Wilh. v. Pernstein
und des Königs Georg von Podiebrad. - In der Länder- und
Sittenkunde tritt uns zuerst die"Kosmografie ceska" des Siegmund v.
Puchov (1520-84) entgegen, der sich die Beschreibung der Reisen des
Joh. v. Lobkowitz nach Palästina (1493), Vratislavs v.
Mitrowitz nach Konstantinopel (1591; hrsg. in der "Staroceska
biblioteka", Bd. 3), Harants von Polzic nach Ägypten,
Jerusalem etc. (1598; neue Ausg. von Erben, 1854) u. a.
anschlossen. Unter den Humanisten zeichneten sich aus: Gregor Hruby
Jeleny (1450-1514) als Übersetzer von Cicero u. a., Siegmund
Hruby Jeleny (gest. 1554), Verfasser eines "Lexicon symphonum" der
griechischen, lateinischen, tschechischen und deutschen Sprache,
Vaclav Pisecki (gest. 1511), der Übersetzer des Isokrates.
Auch die tschechische Sprachforschung verdankt der Böhmischen
Brüdergemeinde vielfache Förderung ("Grammatika ^eska"
von Joh. Blahoslaw, 1571). Naturwissenschaftliche Schriften
hinterließen Tadeus Hajek (gest. 1600) und Adam Zaluzanski
(gest. 1613).
III. Periode. Die Unterdrückung der tschechischen Sprache;
die Exulanten (1620-1774). Die Niederlage der Böhmen in der
Schlacht am Weißen Berg, die gewaltsame Austreibung und
Auswanderung von 30,000 Böhmen, darunter viele durch
hervorragende Stellung und Vermögen einflußreiche
Förderer der nationalen Litteratur, die Vernichtung des
Wohlstandes und die allgemeine Verwilderung während des
Dreißigjährigen Kriegs schienen den Untergang der
tschechischen Litteratur herbeizuführen. Gegen die alten
Schätze derselben wüteten die Sieger unter dem Vorwand,
daß sie von hussitischen oder protestantischen Tendenzen
durchdrungen seien. So gingen von den ältern Werken viele
unter, andre wurden außerordentlich selten. Bald verwilderte
denn auch die tschechische Sprache, die immer allgemeiner als
Bauerndialekt verachtet und endlich vom Kaiser Joseph II. durch
Dekret vom 6. Jan. 1774 aus Amt und Schule ausgeschlossen wurde.
Damit war das 1620 unternommene Werk formell beendet, allein sofort
trat eine kräftige Gegenwirkung zu Tage. Die litterarischen
Traditionen der zweiten Periode wur den zunächst von den
Emigranten oder Exulanten fortgesetzt. Karl v. Zerotin setzte von
Breslau aus, wohin er 1628 ausgewandert war, seine litterarisch
wertvolle Korrespondenz mit seinen Freunden, namentlich mit den
Böhmischen Brüdern, fort. In enger Verbindung mit seinem
Namen erscheint der des bedeutendsten tschechischen Schriftstellers
jener Zeit, J. Amos Komenskys (genannt Comenius, 1592 bis 1670),
dem die t. L. die großartige, wenn auch zuweilen in Pietismus
ausartende allegorische Dichtung "Labyrint sveta a ráj
srdce" ("Labyrinth der Welt", 1623) verdankt, worin er dem tiefen
Schmerz seiner Seele in ergreifenden Tönen Ausdruck verlieh.
Von demselben unerschütterlichen Gottvertrauen zeugt seine
treffliche metrische Übersetzung der Psalmen. In seinen
pädagogischen Schriften trat er gegen die herrschende
pädagogische Scholastik und den verkehrten Klassizismus auf
(weiteres s. Comenius). Neben Komensky zeichneten sich unter den
Exulanten aus: Paul Skála (gestorben nach 1640), der
Verfasser einer Kirchengeschichte in 10 Bänden, Martin v.
Drazov, Paul Stránsky, (gest. 1657), der in seiner in
Amsterdam veröffentlochten "Respublica bojema" eine
überaus klare Darstellung der politischen Verhältnisse
und des innern Zustandes Böhmens entwirft. Noch
spärlicher entwickelte sich die t. L. nach der Katastrophe von
1620 in Böhmen selbst. Eigentümlicherweise verdankt man
hier das bedeutendste Werk jenem Grafen Wilhelm Slavata (s. d.),
einem der Opfer des berühmten Fenstersturzes, dessen
14bändiges Geschichtswerk ("Spisovani historicke"), ein
Gegenstück der vom protestantischen Standpunkt verfaßten
Geschichte Skálas, eine wichtige Geschichtsquelle bildet. Im
Sinn der kirchlich-politischen Reaktion schrieben ferner der Jesuit
Bohuslaw Balbin (gest. 1688), Thomas Pesina (gest. 1680), dessen
"Predchudce Moravopisu" die chronologische Geschichte Mährens
bis 1658 umfaßt, Joh. Beckovsky (gest. 1725), Verfasser einer
böhmischen Chronik: "Poselkyne starych pribehuv", Johann
Hammerschmid (gest. 1737), Franz Kozmanecky, der schon ältere
Wenzel Sturm, der schlimmste Gegner der Brüdergemeinde (gest.
1601), ferner der jesuitische Fanatiker Anton Konias (gest. 1760)
u. a.
IV. Periode. Die Wiedererweckung (1774 bis 1860). Die
plötzliche Unterdrückung der tschechischen Sprache in Amt
und Schule rief alsbald ernste
880
Tschechische Litteratur (18. und 19. Jahrhundert).
Proteste hervor. Kurz nach dem Erscheinen des betreffenden
kaiserlichen Patents forderte Graf Franz Kinsky in der deutschen
Schrift "Erinnerungen über einen hochwichtigen Gegenstand"
(1774) die Erhaltung und Ausbildung der tschechischen Sprache, und
ein Jahr darauf gab Franz Pelcel eine lateinische
Verteidigungsschrift der tschechischen Sprache des oben genannten
Balbin ("Dissertatio apologetica linguae slovenicae") heraus.
Wichtiger aber für das Wiedererwachen der tschechischen
Nationalität war der Aufschwung der historischen Forschung
unter der Regierung Maria Theresias und Josephs II. Zuerst
untersuchte Fel. Jak. Dobner (s. d.) die alten tschechischen
Geschichtsquellen und gründete 1769 einen wissenschaftlichen
Verein, welcher 1784 zur königlich böhmischen
Gesellschaft der Wissenschaften erhoben wurde. Unter dem anregenden
Einfluß dieser Gesellschaft erwachte das Interesse für
die Sprache und Litteratur der Tschechen, für welche 1793 F.
Pelcel als ordentlicher Professor an der Prager Universität
angestellt wurde, während Joseph Dobrovsky (s. d., 1753-1829)
die eigentliche Grundlage der neuern tschechischen Sprachforschung
schuf. Mit dem 1818 durch den Grafen Sternberg begründeten
Nationalmuseum, das bald eine Zeitschrift in deutscher und
tschechischer Sprache herausgab und später den wichtigen
Verein der Matice ceska zur billigen Verbreitung von tschechischen
Schriften zu Tage förderte, erhielt dann die litterarische
Bewegung der Tschechen einen festen Stützpunkt. Den
Übergang von diesen ersten Versuchen der Wiedererweckung der
tschechischen Litteratur zu dem ansehnlichen Aufschwung dieser
Litteratur nach 1820 bildet die fruchtbare Thätigkeit Joseph
Jungmanns (s. d., 1773-1847), der sich namentlich durch zwei Werke,
seine "Geschichte der tschechischen Litteratur" (1825) und sein
"Tschechisch-deutsches Wörterbuch" (1835-39, 5 Bde.), die
größten Verdienste erwarb. Auf dem Gebiet der Poesie
wirkte, nach den schwachen Anfängen Puchmajers, Polaks und
Jungmanns, die Auffindung der Königinhofer und der
Grünberger Handschrift (1817) epochemachend und befruchtend.
In der nationalen Richtung gingen voran Joh. Kollar (1793-1852) und
Wladislaw Celakowsky (1799-1852). Zahlreiche andre Lyriker, wie
Vaclav Hanka (1791-1864), Vlastimil Kamaryt (gest. 1833; "Pisen
vesnicanuv"), Fr. Jaroslaw Vacek (gest. 1869), ferner Vinaricky,
Chmelenski, Picek, Pravoslav Koubek, Boleslav Jablonsky, W. Stulc
u. a., schlossen sich ihnen an. - Die epische Dichtung, besonders
angeregt durch die Auffindung der genannten nationalen
Handschriften, fand ihre Pflege durch den Slowaken Joh. Holly
(1785-1849; "Svatopluk"), den Romanzendichter Erasm. Vocel
(1803-71), Joh. Marek (1801-53), Jos. Kalina (1816-47), den unter
Byronschem Einfluß stehenden Karl Hynek Macha (1810-36;
"Máj"), den vielseitigen Jaromir Erben (1811-70), der
indessen schon den Übergang zu der neuen Richtung vermittelt.
Unter den Satirikern zeichneten sich Franz Rubes (1814-53) und Karl
Havlicek (1821-56) aus. - Die Anfänge des modernen
tschechischen Dramas knüpfen sich an das 1785 von Karl und
Wenzel Tham in Prag begründete Liebhabertheater. Nep.
Stepánek (1783-1844) schuf durch zahlreiche originale oder
übersetzte Stücke das tschechische Repertoire; höher
stehen der fruchtbare Wenzel Klicpera (1792-1859) und Jos. Kajetan
Tyl (1808-56), dessen "Cestmir", "Pani Marjanka", "Strakonicky
dudak", "Jan Hus" u. a. sich auf dem Repertoire erhalten haben.
Noch sind zu erwähnen: S. Machacek (gest. 1846), Fr.
Turinský (gest. 1852), Ferdinand Mikovec (gest. 1862). -
Auch das Gebiet des Romans (im Sinn W. Scotts) und der Novelle
wurde fleißig angebaut, so namentlich von Tyl, Rubes, K. I.
Mácha und Marek, dem Begründer der tschechischen
Novellistik, Sabina (1813 bis 1877), Prokop Chocholousek (1819-64),
J. Ehrenberger (geb. 1815) und Adalbert Hlinka (pseudonym Franz
Prawda, geb. 1817), durch letztern besonders in Erzählungen
aus dem Volksleben.
Bedeutender als auf dem Gebiet der Poesie gestaltete sich die
neuere t. L. auf dem der Wissenschaften und insbesondere der
historischen. Als Historiker stehen in erster Linie: Franz Pelcel
(1734-1801), der Verfasser einer Reihe historischer Untersuchungen
(darunter Biographien Karls IV., Wenzels IV. etc.) und einer "Nova
kronika ceská", die wesentlich zur Erweckung des
tschechischen Nationalgefühls beitrug; sodann Paul Jos.
Safarik (Schafarik, 1795-1861), der in seinen "Starozitnosti
slovanské" den ersten den modernen Bedürfnissen
entsprechenden Versuch machte, die slawische Urgeschichte bis zum
10. Jahrh. aufzuhellen, und besonders Franz Palacky (1798-1876),
mit dessen monumentaler "Geschichte Böhmens von den
ältesten Zeiten bis 1526", deren 1. Band 1836 erschien, die
tschechische Historiographie sich plötzlich aus mühsamer
und schwerfälliger Altertumsforschung auf die Höhen
moderner, künstlerischer Darstellung emporschwang. Auch um die
slawische Sprachforschung erwarb sich nach den schon genannten
Gelehrten, Dobrovsky und Jungmann, besonders Paul Safarik durch
seine "Pocátkové staroceske mluvnice" große
Verdienste. Diesen Bahnen folgen: Martin Hattala (geb. 1821),
Wenzel Zikmund (1863-73), Jos. Kolar u. a.
V. Periode. Die neueste Zeit. Mit der Einführung der
konstitutionellen Ära in Österreich (um 1860) fielen die
letzten Schranken, welche das Wiederaufblühen der
tschechischen Litteratur bis dahin vielfach gehindert hatten. An
Zahl, innerm Gehalt und Formvollendung übertreffen denn auch
die Produkte der neuesten Periode alle frühern. Das tritt am
auffälligsten auf poetischem Gebiet zu Tage. Hier sei
zunächst, gleichsam als Übergang in die Neuzeit, der
hyperromantische Lyriker J. Vaclav Fric (pseudonym Brodsky, geb.
1829) erwähnt, der sich auch als Dramatiker einen Namen
gemacht hat. In Viteslav Halek (1835-74) erstand sodann der
böhmischen Poesie ein Dichter von durchaus moderner Stimmung
und trefflicher Naturmalerei. Schwungvoller sind die lyrischen
Gedichte von Adolf Heyduk (geb. 1836), der auch in der poetischen
Erzählung ungewöhnliches Talent bekundet. Sehr
geschätzt werden ferner die geistreichen, im übrigen der
dichterischen Unmittelbarkeit entbehrenden Gedichte von Joh. Nerud
a (geb. 1834). Der bedeutendste Dichter Böhmens auf
lyrisch-epischem Gebiet ist indessen Jaroslaw Vrchlický
(eigentlich Frida, geb. 1853). Noch sind unter den Lyrikern zu
erwähnen: Eliza Krasnohorska (geb. 1847), die populärste
böhmische Dichterin der Neuzeit, der vorwiegend elegische
Joseph Vaclaw Sladek (geb. 1845), Spindler, Dörfl, Mokry etc.
Als Dichter von epischer Begabung zeigte sich Svatopluk Cech (geb.
1846), doch hat ein Epes im großen Stil die neuere
tschechische Poesie bisher nicht zu Tage gefördert. Die
bedeutendsten Erfolge sind im Drama errungen worden, besonders
durch Franz Wenzel Jerábek (geb. 1836), der im sozialen
Schauspiel und der Tragödie Werke von hohem sittlichen und
künstlerischen Wert schuf. Von Bedeutung
881
Tschechische Litteratur - Tschechische Sprache.
sind der Lustspieldichter Emanuel Bozdech (1841-1889), der
nationale Vaclav Vlcek (geb. 1839), bei dem aber zuweilen das
epische Motiv überwiegt; der noch der ältern Schule
angehörende fruchtbare Schauspieler Jos. Georg Kolar (geb.
1812), der mit besonderm Geschick düstere Helden- oder
Intrigantentypen zur Geltung bringt; Fr. A. Subert,
gegenwärtig Direktor des böhmischen Nationaltheaters.
Weniger glücklich war der oben erwähnte Jaroslaw
Vrchlický in seinen dramatischen Versuchen. Sonst sind noch
zu erwähnen Stroupeznicky ("Cerne duse" etc.), Neruda,
Zakreys, Durdik ("Stanislav i Ludmila"), Stolba, Samberk, Krajnik
etc. - Als die Gründerin des tschechischen Romans gilt Frau
Karoline Svetlá (eigentlich Johanna Muzák, geb.
1830), die Verfasserin zahlreicher dem Volksleben entnommener
Erzählungen. In erster Reihe steht gegenwärtig der
bereits unter den Dramatikern erwähnte Vaclav Vlcek, dessen
"Zlatov ohni" (neue umgearb. Ausg. 1883) sowohl durch
großartig angelegten Plan (Naturgeschichte der Familie von
der Ehe bis zur Völkerfamilie) als auch durch meisterhafte
Detailmalerei hervorragt. Auf dem Gebiet des historischen Romans
waren vor andern Jos. Georg Staúkovský (gest. 1880;
"König und Bischof", "Die Patrioten der Theaterbude" etc.) und
der schon unter den Dramatikern genannte Fr. A. Subert (15.
Jahrh.), auf dem des sozialen Svatopluk Cech thätig. Ferner
sind als Erzähler zu nennen: Gustav Pfleger-Moravsky (gest.
1875; "Aus der kleinen Welt") und Aloys Adalbert Smilowski (gest.
1883), beide auch als Lyriker und Dramatiker bekannt; Jakob Arbes
(geb. 1840); der schon unter den Dichtern erwähnte Joh. Neruda
("Erzählungen von der Kleinseite"); Aloys Jirásek (geb.
185l; "Die Felsenbewohner", "Am Hof des Wojewoden", "Eine
philosophische Geschichte" etc.); Bohumil Havlasa (gest. 1877; "Im
Gefolge eines Abenteurerkönigs", "Stille Wasser" etc.); Servac
Heller, Julius Zeyer, Franz Herites (geb. 1851), Joseph Stolba
(geb. 1846) u. a.
Die moderne böhmische Geschichtsforschung wurde von Fr.
Palacky (s. oben) begründet; seine große "Geschichte
Böhmens" gelangte 1876 zum Abschluß und hat auf alle
Zweige des öffentlichen Lebens, auf Politik, Kunst und
Wissenschaft, in Böhmen den nachhaltigsten Einfluß
ausgeübt. Sein Nachfolger als böhmischer
Landeshistoriograph, Anton Gindely (geb. 1829), hat sich durch die
groß angelegte (deutsch geschriebene) "Geschichte des
Dreißigjährigen Kriegs" einen Namen gemacht,
während ihm von nationaler Seite Mangel an patriotischer
Wärme vorgeworfen wird. Durch Bienenfleiß zeichnet sich
Vaclav Vladivoj Tomek (geb. 1818) aus, dessen "Geschichte der Stadt
Prag" (1855 ff.) eine in solcher Vollständigkeit fast
beispiellose Monographie der böhmischen Hauptstadt bringt und
sich zugleich zu einem überreichen Material für die
Geschichte Böhmens gestaltet. Von den übrigen Historikern
sind besonders der populäre K. Vladislaw Zap (gest. 1870),
Anton Bocek (gest. 1847) und Beda Dudik (geb. 1815; "Geschichte
Mährens") namhaft zu machen. Eine fruchtbare Thätigkeit
auf literarhistorischem, linguistischem und historischem Gebiet
entfaltet Joseph Jirecek (geb. 1825), der Verteidiger der
Königinhofer Handschrift. Einzelne Epochen der böhmischen
Geschichte bearbeiteten Karl Tieftrunk, Fr. Dworsky, Rezek, Ferd.
Schulz, Koran, Bilek u. a., die Geschichte slawischer Völker
W. Krizek (gest. 1882), Konstantin Jirecek (geb. 1854; "Geschichte
der Bulgaren"), Joseph Perwolf (geb. 1841; "Die Geschichte der
slawischen Idee" etc.). Wichtige Beiträge zur böhmischen
Rechtsgeschichte lieferten, außer Palacky, Vorel und Tomek,
in der neuesten Epoche Hermenegild Jirecek (s. d.), der
mährische Landesarchivar Vinzenz Brandl (geb. 1834; "Die
Anfänge des Landrechts" etc.), Joseph Kalousek ("Die
böhmische Krone"), Karl Jicinsky, Tornan, Emler, Rybicka u. a.
In der Rechtswissenschaft hat sich Randa (s. d.) einen weit
über die Grenzen Böhmens bekannten Namen erworben. Ferner
sind hier zu nennen: I. Slavicek, A. Meznik, J. Skarda, Havelka, A.
Pavlicek u. a.
Die philosophische Litteratur beginnt in Böhmen erst 1818
mit einem Aufsatz von W. Zahradnik (in der Zeitschrift "Hlasitel").
Palacky, Purkyne, Marek, Hanus, Kvet behandelten in Zeitschriften
einzelne Zweige der Philosophie. Erst Dastich (geb. 1834),
Professor der Philosophie an der Prager Universität,
veröffentlichte größere Werke philosophischen
Inhalts ("Formelle Logik", "Empirische Logik","Erläuterungen
zum System des Thomas Stitny" etc.). Der bedeutendste Vertreter der
philosophischen Litteratur ist gegenwärtig I. Durdik (s. d.),
der sich entschieden an die neuern deutschen Systeme anlehnt und
sich mit Erfolg der Ästhetik zugewendet hat. In den
Vordergrund trat neuestens T. G. Masaryk ("Konkrete Logik"), der
mit seinen "Slawischen Studien" ("Slovanske studie") auch die
slawische Frage zum erstenmal vom rein realistisch-philosophischen,
aller Romantik entkleideten Standpunkt behandelt, überdies
auch die Echtheit der Königinhofer Handschrift bekämpft.
Unter den Naturforschern zeichnen sich die Schüler des
Physiologen Purkyne (s. d.): I. Krejci ("Geologie", 1878), der
Zoolog A. Fric, der Botaniker L. Celakowsky (s. d. 2), Fr.
Studnicka ("Aus der Natur") und der oben erwähnte der
Ästhetik zugewandte I. Durdik ("Kopernikus und Kepler",
"Über den Fortschritt der Naturwissenschaft" etc.) aus.
Die moderne tschechische Literaturgeschichte wurde von F.
Prohazka mit den "Miscellaneen der böhmischen und
mährischen Litteratur" (1784) begründet. Reichhaltiger,
wenn auch den modernen kritischen Ansprüchen nicht gewachsen
ist Jungmanns "Historie literatury ceske" (1825); erst I. Jirecek
begann 1874 die Herausgabe einer erschöpfenden tschechischen
Literaturgeschichte: "Rukovet k dejinam literatury ceske",
während der "Dajepis literatury ceskoslavanske" von Sabina
(gest. 1877) die beiden ersten Perioden der tschechischen
Litteratur mit ausführlicher Beleuchtung der
Kulturverhältnisse behandelt. Als in biographischer Hinsicht
ausgezeichnet sind die "Dejiny reci a literatury ceske" von A.
Sembera (1869) zu erwähnen. Wertvolle Beiträge zur
tschechischen Literaturgeschichte lieferten: W. Nebesky, K. I.
Erben, Vrtatko, Brandl (über Karl v. Zerotin), Cupr (über
Veleslavin), Kiß (über Sixt v. Ottersdorf und Lomnicky),
Hanus (über Celakowsky), Zoubek (über Komensky), Jirecek
(über Safarik), Zeleny (über Palacky, Kollar, Jungmann)
etc. Auch enthält die große unter Leitung Riegers
veröffentlichte Encyklopädie "Slovnik naucny" (1854-74,
12 Bde.) ausführliche Artikel zur tschechischen Litteratur.
Vgl. K. Tieftrunk, Historie literatury ceske (Prag 1876); Fr.
Bayer, Strucne dejiny literatury ceske (Olmütz 1879);
Backovsky, Zevrubné dejiny ceskeho pisemnictv i doby nove
("Eingehende Geschichte der tschechischen Litteratur der Neuzeit",
Prag 1888); Pypin u. Spasovic, Geschichte der slaw. Literaturen,
Bd. 1 (deutsch, Leipz. 1880 ff.).
Tschechische Sprache (böhmische Sprache) ist ein
Zweig des slawischen Sprachstammes, der nebst dem
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl., VX. Bd.
56
882
Tschego - Tscherdyn.
nahe damit verwandten Slowakischen (s. Slowaken) im innern
Böhmen, in Mähren, um Troppau und in
Oberungarn von ungefähr 6½ Mill.
Menschen gesprochen wird. Unter allen slawischen Dialekten scheint
sie sich am frühsten, schon im Beginn des
Mittelalters, ausgebildet und sich lange in ihrer
ursprünglichen Reinheit erhalten zu haben; den
höchsten Grad ihrer Ausbildung erreichte sie im 16.
Jahrh. Seit dem 17. Jahrh. begann die deutsche Sprache mehr und
mehr Eingang zu finden; die meisten tschechischen
Bücher wurden als ketzerisch
verdächtigt, neue in den kriegerisch unruhigen
Zeiten nicht geschrieben, und die t. S. blieb fast nur noch
Eigentum der untern Schichten des Volkes. Infolge davon verlor sie
ihre Eigentümlichkeit immer mehr, bis sich seit der
Mitte des 18. Jahrh. gelehrte Patrioten des fast vergessenen Idioms
wieder annahmen und 1776 ein Lehrstuhl der tschechischen Sprache an
der Wiener und 1793 ein solcher an der Prager Hochschule errichtet
wurde. Infolge davon kam die t. S. nach und nach wieder zu solchem
Ansehen, daÃY die österreichische
Regierung sich bewogen fand, 1818 die Erlernung derselben auch in
den böhmischen Gymnasien wieder anzuordnen und zu
befehlen, daÃY in Böhmen anzustellende
Zivilbeamte der tschechischen Sprache mächtig sein
sollten. In neuester Zeit haben sich sogar die Deutschen in
Böhmen zu beklagen über die
übermäÃYige Protektion,
die dem Tschechischen von oben herab, durch das Ministerium Taaffe,
zu teil wird. Das Tschechische wird seit 1831 mit lateinischen
Buchstaben geschrieben, während
früher dafür die deutsche Schrift im
Gebrauch war. Die Anzahl der Buchstaben ist verschieden, je nachdem
man die accentuierten Vokale und punktierten Laute als besondere
Buchstaben aufführt oder nicht; im erstern Fall
kommen 42 Buchstaben heraus. Die accentuierten Vokale, z. B.
á, é, sind lang zu sprechen, die
übrigen sind kurz. Auch r und l kommen als
selbständige Vokale vor (wie im Sanskrit), sind aber
immer kurz; im Slowakischen erscheinen sie auch als lange Vokale.
Eigentümlich sind auch die Vokale ^e = je,
ù = ou, ů = u, y = i. Unter den
Konsonanten ist c = z, ^c = tsch, ^n = franz. gn in Champagne, ^r =
rsch (das sch weich gesprochen), z = franz. j (weiches sch); d' und
t' sind mouillierte Dentale, etwa wie dj, tj zu sprechen. Viele
Lautveränderungen treten beim Zusammentreffen der
Laute in der Wortbildung ein; so verwandelt das j ein folgendes a
und e in e und i, ein vorausgehendes a in e. Die Orthographie ist
jetzt vollkommen geregelt, während sie sich in der
ältern tschechischen Litteratur in einem chaotischen
Zustand befand und der nämliche Laut oft auf
sechserlei verschiedene Arten ausgedrückt wurde. An
Formenreichtum wird die t. S. von andern slawischen Sprachen,
namentlich von den serbokroatischen Dialekten,
übertroffen; doch finden sich manche
später in Abnahme gekommene Formen, z. B. der Dualis
und der Aorist, im Altböhmischen noch durchgehends
bewahrt, und die meisten grammatischen Verluste sind durch
Neubildungen ersetzt worden. Der Wortschatz ist
natürlich viel reicher und mannigfaltiger als in den
bis in die neueste Zeit fast litteraturlosen
südslawischen Sprachen; doch herrscht in dem
Gebrauch der vielen neuen Wörter, welche in diesem
Jahrhundert von nationaleifrigen tschechischen Schriftstellern
eingeführt worden sind, teilweise eine
groÃYe Unsicherheit. Grammatisch bearbeitet wurde die
t. S. zuerst im 16. Jahrh. von den Böhmischen
Brüdern, besonders von Blahoslaw. Die brauchbarsten
neuern Grammatiken sind die von Negedly (Prag 1804, 1821 u.
öfter), Dobrovsky (das. 1809 u. 1819), Trnka (Wien
1832, 2 Bde.), Burian (Königgrätz
1843), Koneczny (Wien 1842-46, 2 Bde.), Hattala (Prag 1854, durch
wissenschaftliche Haltung ausgezeichnet), Tomicek (4. Aufl., das.
1865), Censky (3. Aufl., das. 1887) u. a. Ein kurzes Lehrbuch der
altböhmischen Grammatik verfaÃYte Safarik
(2. Aufl., Prag 1867). Wörterbücher
gaben Tomsa (Prag 1791), Dobrovsky (das. 1821), Palkowicz (das.
1821, dabei auch ein slowakisches Wörterbuch), Hanka
(das. 1833), Jungmann (das. 1835-39, 5 Bde.) und Franta-Schumavsky
(das. 185l) heraus. Für den praktischen Gebrauch
dienen die Wörterbücher von Rank (3.
Aufl., Prag 1874) und Jordan (4. Aufl., das. 1887).
Tschego, s. Schimpanse.
Tscheki (Cheky), Handelsgewicht in der
Türkei für Opium und Kamelhaare;
für Opium = 250 Drachmen = 800,648 g;
für Kamelhaare - 800 Drachmen = 2,562 kg; auch
Gewicht für Gold und Silber, = ¼ Oka =
100 Drachmen = 321,25 g.
Tschekiang, Küstenprovinz des mittlern
China, 92,383 qkm (1678 QM.) groÃY mit (1885)
11,685,348 Einw., ist Haupterzeugungsgebiet für
Seide und Thee; Hauptorte: Hangtschou, Ningpo und
Wêntschou.
Tscheljabinsk, Kreisstadt im russ. Gouvernement Orenburg,
am Mijash, mit weiblichem Progymnasium und (1885) 9542 Einw.
Tscheljuskin, Kap, s. Taimyr.
Tschembar, Kreisstadt im russ. Gouvernement Pensa, mit
Handel in Landesprodukten und (1885) 5753 Einw.
Tschempin, Stadt, s. Czempin.
Tschenab (Tschinab), einer der fünf
Ströme des Pandschab, von denen die Provinz ihren
Namen empfängt, entspringt in der Landschaft Lahol
von Kaschmir, nimmt in der Ebene den Dschelam,
später den Rawi auf und mündet
unterhalb Bahawalpur in den Satledsch.
Tscheng (Cheng), altes chines. Blasinstrument, bestehend
aus einem ausgehöhlten Flaschenkürbis,
der als Windbehälter dient und mittels einer
S-förmigen Röhre vollgeblasen wird; auf
dem offenen obern Ende des Kürbisses steht eine
Reihe (12-24) Zungenpfeifen mit durchschlagenden Zungen. Diese
letztern wurden dem Abendland erst durch das T. bekannt, fanden
seit Anfang dieses Jahrhunderts Eingang in die Orgeln und
führten zur Konstruktion der Expressivorgel
(Harmonium).
Tschengri, kleinasiat. Stadt, s. Kjankari.
Tschenstochow, s. Czenstochowa.
Tschepewyan (Chippewyan, Cheppeyan), ein zum Stamm der
Athabasken gehöriges Indianervolk im brit.
Nordamerika, nicht zu verwechseln mit den den Algonkin
angehörenden Tschippewäern oder
Odschibwä. Sie nennen sich selbst Saw-eessaw-dinneh
("Männer der aufgehenden Sonne") und betrachten die
Gegenden zwischen dem GroÃYen Sklavensee und dem
Mississippi als ihre ursprünglichen Jagdreviere. Als
Jäger der Hudsonbaikompanie stehen sie namentlich
mit deren Forts am GroÃYen Sklaven- und Athabascasee in
Verbindung. Das von ihnen bewohnte Gebiet ist reich an Renntieren,
welche ihnen Subsistenzmittel und Kleidung verschaffen, besteht
aber gröÃYtenteils aus Barren-Grounds,
wodurch sie gezwungen sind, sich im Winter in die
Wälder und in die Nachbarschaft der
GroÃYen Seen zurückzuziehen. Ihre Zahl
dürfte kaum 2000 betragen.
Tscheram (Schelam), ind. Stadt, s. Salem 2).
Tscherdyn, Kreisstadt im russ. Gouvernement Perm, an der
Kolwa, mit (1885) 3490 Einw., die sich viel mit dem Bau von
FluÃYfahrzeugen beschäftigen.
883
Tscheremissen - Tscherkessen.
Tscheremissen, finn. Volk im europäischen
Rußland, am linken Ufer der Wolga, in den Gouvernements
Nishnij Nowgorod, Kasan, Orenburg, Simbirsk und Wjatka
ansässig. Der Name T. ist ihnen von den Mordwinen beigelegt,
sie selbst nennen sich Mara ("Mensch"). Sie sind mittelgroße,
meist schwächliche, blonde oder rötliche Leute,
träge, furchtsam und gelten für Betrüger. Seit
Aufgebung ihres frühern nomadischen Lebens sind sie Hirten,
Ackerbauer, Jäger, Fischer und eifrige Bienenzüchter,
leben aber nicht in Städten und geschlossenen Dörfern,
sondern vereinzelt, besonders in den ausgedehnten Urwäldern an
der Wolga. Die Weiber verstehen sich auf das Weben und Färben
verschiedener Stoffe. Das Volk, 260,000 Köpfe stark, bekennt
sich zwar zur griechisch-russischen Kirche, hat aber eine Menge
heidnischer Gebräuche beibehalten, so hat der Getreidegott
Agedarem bei ihnen noch große Geltung. Die Sprache der T.
gehört zu der finnisch-ugrischen Gruppe des ural-altaischen
Sprachstammes. Grammatiken derselben verfaßten Castren
("Elementa grammaticae tscheremissae", Kupio 1845) und Wiedemann
(Reval 1847).
Tscherepowez, Kreisstadt im russ. Gouvernement Nowgorod,
an der Scheksna, mit Realschule, Lehrerseminar, weiblichem
Progymnasium, großer Fischerei, einem besuchten Jahrmarkt und
(1886) 6134 Einw. Im Kreis T. ausgedehnte Fabrikation von
Nägeln.
Tscheri, die durchaus mohammedan. Gerichtsbehörden
des türkischen Reichs, im Gegensatz zu den Nisâmijes,
welche für Streitigkeiten zwischen Bekennern verschiedener
Religionen dienen. Weiteres über ihre Organisation vgl.
Türkisches Reich, S. 923.
Tscheribon (Cheribon, Tjeribon), niederländ.
Residentschaft auf der Nordküste von Java, 6751 qkm (122,7
QM.) mit (1886) 1,346,267 Einw. (darunter 708 Europäer, 6859
Chinesen, 380 Araber), ist im nördlichen Teil eben und
sumpfig, im südlichen dagegen, wo sich der Pik Tscherimai, ein
Vulkan von 3043 m Höhe, erhebt, gebirgig. Hauptprodukte sind:
vortrefflicher Kaffee, Indigo und Zuckerrohr. Die Bevölkerung
ist halb sundanesisch, halb javanisch. Die gleichnamige Hauptstadt
liegt in der Ebene an der Mündung des Flusses T. in die
Javasee und hat gegen 15,000 Einw. Nördlich von der Stadt, auf
dem Gunong Dschati, ist Kaliastana, das heilig gehaltene Grab des
Ibn Mulana, der den Islam auf Java einführte. Der
holländische Resident wohnt in Tanakil, 4 km von der
Stadt.
Tscherikow (Czerikow), Kreisstadt im russ. Gouvernement
Mohilew, an der Sosh, mit 3 griech. Kirchen, evangel. Kapelle,
Lehranstalten für Russen, Polen und Juden, großem
Kaufhof, mehreren industriellen Etablissements, Getreide- und
Holzhandel und (1885) 3987 Einw.
Tscherkasski, Wladimir Alexandrowitsch, Fürst, russ.
Staatsmann, geb. 13. April 1821 aus einer alten adelstolzen
Familie, studierte in Moskau die Rechte, trat in den Staatsdienst,
schloß sich der nationalrussischen, eifrig liberalen Partei
der russischen Aristokratie an, wirkte bei der Emanzipation der
Leibeignen mit, gehörte zu dem Organisationskomitee, welches
während des polnischen Aufstandes 1861-64 Polen auf
demokratischer Grundlage neu gestalten wollte, trat nach dem
Scheitern dieses Unternehmens aus dem Staatsdienst, war Mitglied
der Slawischen Gesellschaft, deren panslawistische Bestrebungen er
mit Eifer förderte, und ward Stadthaupt von Moskau. 1877 bei
Ausbruch des russisch-türkischen Kriegs erhielt er den
Auftrag, die Verwaltung Bulgariens als selbständigen
Fürstentums zu organisieren. Er starb 3. März 1878 in
Santo Stefano.
Tscherkassy, Kreisstadt im russ. Gouvernement Kiew, am
Dnjepr und der Zweigbahn Bobrinskaja T., der älteste Sitz der
Saporoger Kosaken, hat 6 griechisch-russische, eine evangelische
und eine kathol. Kirche, ein jüd. Bethaus, Zuckerfabriken,
einen wichtigen Flußhafen und (1885) 20,755 Einw. (meist
Kleinrussen, Polen und Juden). Deutsche und französische
Kaufleute treiben hier einen lebhaften Handel mit Wolle, Leinwand,
Spiritus, Cerealien und Vieh.
Tscherkessen (s. Tafel "Asiatische Völker", Fig.
26), eine die westliche Familie der nördlichen Abteilung des
kaukasischen Stammes umfassende Völkergruppe in der
Westhälfte des Kaukasus und den an sie sowie an ihre Zweige
sich anlehnenden Ebenen zwischen dem nördlichen Ufer des
Schwarzen Meers von der Meerenge von Kertsch bis zu den Grenzen
Mingreliens, durch den ganzen Lauf der Flüsse Kuban und Malka,
einen Teil des nach N. gerichteten Terekstroms und die kaukasische
Hauptkette von der grusinischen Militärstraße bis zum
Elbrus. Die T. teilen sich in die Adighe und die Asega oder
Abchasen. Die Adighe (Adyche), von den Türken T., von uns
danach Cirkassier oder nach ihrem Wohnplatz, der Kabarda, auch
Kabardiner genannt, zerfallen in die Abadschen (Abadzen) am
Nordabhang der Kaukasuskette in den Thälern der in den Kuban
fallenden Flüsse Schaguascha, Laba, Pschisch, Pszekups,
Wuanobat und Sup, die Schapszugen und die Natkuadsch oder
Natuchaizen in den Gebirgen und den der Festung Anapa angrenzenden
Ebenen, die Kabardiner zwischen den Flüssen Malka und Terek
und von letztern bis zu den Vorbergen des Kaukasus und zur
Sisnischa, die Beszlenei im Kubanbecken zwischen dem Fers, dem
Großen und Kleinen Tegen und dem Woarp, die Mochosch im
Gebiet des Tschechuradsh, Belogiak und Schede, die Kemgoi und
Temirgoi zwischen dem Kuban und der untern Laba und Belaja, die
Chatiukai zwischen Belaja und Schisch, die Bsheduchen in den Ebenen
des Pschisch und Pszekups, endlich die Shan oder Shanejewzen auf
der Kubaninsel Karabukan. Die Asega oder Abchasen grenzen
nördlich am Kapoeti an die Adighe, südlich am Enguri an
die Mingrelier, westlich ans Schwarze Meer und östlich an die
Suanen und die basilianischen Türken. Zu ihnen gehören
die Sadzen oder Dschigeten, die Abszne oder Abchasen, die Sambal
oder Zebeldiner auf der Südseite des Hauptgebirges im W. der
Mingrelier, die Barakin, Bag, Schegerai-Tam, Kisilbek, Baschilbai
und Basschog auf der Nordseite der Bergkette im Quellgebiet der
Kchoda, Urup, der Kleinen und Großen Laba und des
Großen Selentschuk, endlich die Ubychen am Südabhang des
Hauptgebirges zwischen den Natuchaizen und den Dschigeten. Die Zahl
sämtlicher T. wurde von Bergé auf 490,000 Seelen
geschätzt, davon 325,000 Adighe und 125,000 Asega; der
größte Teil derselben ist jedoch nach den
unglücklichen Kämpfen gegen Rußland auf
türkisches Gebiet übergesiedelt, so daß man 1880
nur noch 115,449 T. berechnete. Es beziehen sich daher die
vorstehenden und folgenden ethnologischen Bemerkungen nur auf die
frühere Zeit. Die T. sind ein sehr schöner und deshalb
berühmter Menschenschlag von reichlich mittlerer Statur,
schlank und kräftig mit edlen, fein geformten Gesichtern und
braunen, zuweilen blonden Haaren. Früher bekannten sie sich
teils zum armenischen, teils zum orthodox-griechischen Christentum,
haben aber später den Islam angenommen; doch sind nur die
Häuptlinge und Vornehmen als Moham-
56*
884
Tscherkessen (Geschichte).
medaner anzusehen, bei dem Volk haben sich sowohl christliche
Gebräuche als zahlreiche Spuren des alten Heidentums erhalten.
Die Richter, die Ältesten des Stammes, urteilen in Ermangelung
geschriebener Gesetze, da die T. keine Schriftzeichen besitzen,
nach dem Herkommen. Für den Verurteilten ist der ganze Stamm
verantwortlich. Der einzige Fall, in welchem ein Gericht auf Tod
erkennen kann, ist offener oder geheimer Dienst beim Feinde; doch
auch da begnügt man sich meist mit einer hohen Geldstrafe.
Dagegen kostet die Blutrache alljährlich vielen T. das Leben,
da dieselbe an dem ganzen Stamm des Beleidigers ausgeübt wird.
Die Sprache der T., selbständig für sich dastehend, ist
kenntlich an vielen Gurgeltönen, reich, zur Poesie geeignet
und zerfällt in einen nördlichen (Abesech) und
südlichen (Ubuch) Dialekt (s. Kaukasische Sprachen). Sie haben
Sänger (Kikoakoa), welche in hohem Ansehen stehen. Vgl.
L'Huilier, Russisch-tscherkessisches Wörterbuch und Grammatik
(Odessa 1846); Löwe, Circassian dictionary (Lond. 1854). Seit
der Einführung des Korans hat die arabische Sprache sich
bedeutend ausgebreitet, und in ihr werden auch die Dokumente
ausgestellt. Die Verfassung ist eine feudal-aristokratische; die
Bevölkerung teilt sich in vier Stände: Pschi
(Fürsten), Work oder Elsden (Ritter), Tsokol oder Waguscheh
(Freie) und Pschitli (Sklaven). Von den Pschi sollen im Lande der
Adighe nur noch vier, aber gliederreiche Familien vorhanden sein;
die Work sollen noch einige hundert Höfe besitzen. Die
Pschitli sind die Nachkommen kriegsgefangener Frauen und Kinder
sowie solcher Adighe, welche durch Richterspruch zur Sklaverei
verurteilt wurden. Sie sind jetzt persönlich frel und haben
nur einige Naturalabgaben, Fron- und Kriegsdienste zu leisten. Die
Geistlichkeit kann man in zwei Klassen teilen; die erste davon ist
die alte christlich-heidnische (Dschiur genannt), welche aber von
der mohammedanischen Geistlichkeit mehr und mehr verdrängt
wird. Die Männer gehen stets bewaffnet und zwar mit Flinte,
Säbel, Pistole und Dolchmesser. Eigentümlich sind die auf
der Brust getragenen orgelpfeifenähnlichen
Patronenhülsen. Die Hauptcharakterzüge des Volkes sind:
Anhänglichkeit an die Familie, Tapferkeit, Entschlossenheit,
Gastfreiheit, Ehrfurcht vor dem Alter und Gemeinsinn, aber auch
Leichtsinn, Roheit, Habgier, Neigung zur Dieberei und namentlich
Lügenhaftigkeit. Der Hausvater ist auf seinem Gehöft
unumschränkter Herr; die Söhne bleiben, solange er lebt,
ihm zur Seite; der älteste Sohn wird Erbe des Hofs und des
größern Teils der beweglichen Habe. Das Heiraten
geschieht nach freier Wahl, und zwar wird das Mädchen aus dem
elterlichen Haus heimlich entführt und erst später nach
der Hochzeit der vereinbarte Preis vom Mann bezahlt. Die Stellung
der Frauen ist nicht die sklavische wie sonst im Morgenland. Das
Mädchen wird früh in weiblichen Handarbeiten, Nähen,
Stricken etc., geübt und tummelt sich als Jungfrau mit den
Brüdern und Vettern im Gehöft umher, lernt den Bogen
spannen und das Roß lenken. Diese Selbständigkeit
verhindert aber nicht, daß Mädchen von den eignen Eltern
verkauft werden, um in türkischen Harems eine mehr oder minder
glanzvolle Rolle zu spielen. Vgl. Kaukasien.
[Geschichte.] Schon im Altertum traten die T. unter dem Namen
der Sychen als Seeräuber auf. Im 13. Jahrh. wurden sie von den
georgischen Königen unterworfen und zum Christentum bekehrt,
doch errangen sie 1424 ihre Unabhängigkeit wieder. Inzwischen
hatten sie sich über die Ebenen am Asowschen Meer verbreitet
und waren dadurch mit den Tataren in Konflikt geraten. Die
Bedrückungen, welche sich der Chan der Krim gegen die
Gebirgsstämme erlaubte, nötigten diese, sich 1555 dem
russischen Zaren Iwan IV. Wasiljewitsch zu unterwerfen, der ihnen
hierauf gegen die Tataren Hilfe leistete. Nach dem Abzug der
russischen Truppen überzog Chan Schah Abbas Girai 1570 die
Transkubaner mit Krieg, siedelte sie jenseit des Kuban an und zwang
sie zur Annahme des Islam. 1600 kehrten sie in ihre alten Wohnsitze
zurück; da sie aber von seiten der neuen Ansiedler Hindernisse
fanden, zogen sie an den Fluß Bassan und drängten auf
die Kabardiner. Daraus entstand ein innerer Krieg, und infolge
dessen fand die Teilung des kabardinischen Volkes in die
Große und Kleine Kabarda statt. Erst 1705 befreite ein
entscheidender Sieg die T. von harter Bedrückung. Nach dem
Frieden von Kütschük Kainardschi wurde 1774 Rußland
Herr der beiden Kabarden. Seit 1802 Georgien eine russische Provinz
geworden war, strebte Rußland, dessen Grenzen bereits bis an
den Kuban vorgerückt waren, durch den Besitz des Kaukasus eine
Verbindung zwischen jenem Land und Kaukasien herzustellen. 1807
nahmen die Russen Anapa, mußten es aber infolge des Friedens
von Bukarest 1812 wieder räumen. Die Türken fanatisierten
nun die T. immer mehr gegen die Russen, und die T. unternahmen von
jetzt an fortwährend Einfälle ins russische Gebiet. 1824
leisteten sogar mehrere Stämme dem Sultan den Eid der Treue.
Im russisch-türkischen Krieg von 1829 fiel Anapa jedoch
abermals in die Hände der Russen, und im Frieden von
Adrianopel kamen die türkischen Besitzungen auf dieser
Küste überhaupt an Rußland. Seitdem begann die
systematische Unterwerfung der Bergvölker, welche anfangs
angriffsweise ins Werk gesetzt wurde, aber keinen Erfolg hatte. Man
gab endlich die verderblichen Expeditionen in das Innere des Landes
auf und beschränkte sich auf die Absperrung des Landes, reizte
aber durch diese defensive Haltung die Unternehmungslust der
Bergvölker. 1843 rief Schamil (s. d.), welcher schon seit 1839
die Tschetschenien und andre östliche Gebirgsstämme zum
Kampf gegen die Russen zu begeistern gewußt, auch die T. zur
Erneuerung der Angriffe auf, so daß seitdem fast alle
Bergvölker vereint gegen Rußland im Kampf begriffen
waren. Nach dem Beginn des russisch-türkischen Kriegs von 1853
setzten Schamil und die übrigen Häuptlinge um so
energischer den Kampf fort, als sie jetzt von den Türken
unterstützt wurden. Nach dem Einlaufen der
englisch-französischen Flotte ins Schwarze Meer (Januar 1854)
waren die T. namentlich bei der Eroberung und Zerstörung der
russischen Küstensorts eifrig mit thätig. Indes wirkte
die Spaltung zwischen den Muriden Schamils und den übrigen
Mohammedanern einem einheitlichen Handeln entgegen, und als 1856
Fürst Barjatinskij den Oberbefehl im Kaukasus übernahm,
hatte er auf der lesghischen Seite nur noch vereinzelte
Raubzüge zurückzuweisen. Die Russen besetzten nach und
nach wieder die im Krieg verlassenen festen Punkte und setzten die
Ausführung ihres Unterwerfungsplans gegen die Bergvölker
durch Lichten der Wälder nicht ohne Erfolg fort. Anfang Juli
1857 schlug Fürst Orbeliani II. auf der Hochebene Schalatawia
die Hauptmacht Schamils, der am 6. Sept. 1859 in seinem letzten
Schlupfwinkel zur Unterwerfung gezwungen wurde. Damit war der Kampf
in der Hauptsache beendet; er hatte der russischen Armee im ganzen
½ Mill. Menschen gekostet. Die T. wanderten in den
nächsten Jahren in großen Scharen nach der
885
Tschermak - Tschernigow.
Türkei aus, bis 1864 im ganzen 450,000 Seelen, wo sie in
den Grenzprovinzen, namentlich in Bulgarien und in Thessalien,
angesiedelt wurden, um die mosleminische Bevölkerung zu
vermehren, aber durch ihre unruhige Wildheit und Roheit viele
Klagen hervorriefen. Auch bei der Bekämpfung des Aufstandes in
der Herzegowina 1875 und in Bulgarien 1876 sowie im neuen
russisch-türkischen Krieg 1877 thaten sich die
tscherkessischen Truppen durch Zügellosigkeit und barbarische
Wildheit hervor, während ihre kriegerische Tüchtigkeit
sich im geregelten Kampf wenig bewährte. Die im Kaukasus
zurückgebliebenen T. machten 1877 ebenfalls Aufstandsversuche,
doch ohne einheitlichen Plan und daher ohne Erfolg. Als besondere
Nation haben die T. aufgehört zu existieren, und ihre
Zerstreuung unter fremde Völker wird sie, die keinen
Zusammenhang mehr haben, dem Untergang entgegenführen. Vgl.
Bodenstedt, Die Völker des Kaukasus (2. Aufl., Berl. 1855, 2
Bde.); Lapinsky, Die Bergvölker des Kaukasus und ihr
Freiheitskampf gegen die Russen (Hamb. 1863, 2 Bde.); Berge, Sagen
und Lieder des Tscherkessenvolkes (Leipz. 1866).
Tschermak, Gustav, Mineralog, geb. 19. April 1836 zu
Littau bei Olmütz in Mähren, studierte 1856 bis 1860 zu
Wien, habilitierte sich 1861 an der Universität daselbst,
wurde 1862 Kustos am k. k. Hofmineralienkabinett, erhielt 1868 die
Professur an der Universität und die Direktion des
Hofkabinetts, welch letztere er bis 1877 führte. Von seinen
durch Ideenreichtum ausgezeichneten und zum Teil die wichtigsten
Mineralien betreffenden Arbeiten, deren viele in den von ihm
herausgegebenen "Mineralogischen Mitteilungen" (Wien 1871-77, seit
Anfang 1878 "Mineralogische und petrographische Mitteilungen")
erschienen sind, seien hervorgehoben: "Untersuchungen über das
Volumgesetz flüssiger chemischer Verbindungen" (das. 1859);
"Über Pseudomorphosen" (das. 1862-66); "Die Feldspatgruppe"
(das. 1864); "Die Verbreitung des Olivins in den Felsarten und die
Serpentinbildung" (das. 1867); "Die Porphyrgesteine
Österreichs" (das. 1869); "Die Pyroxen-Amphibolgruppe" (das.
1871); "Die Aufgaben der Mineralchemie" (das. 1871); Berichte
über verschiedene Meteoriten (das. 1870 ff.); "Die Bildung der
Meteoriten und der Vulkanismus" (das. 1875); "Über den
Vulkanismus als kosmische Erscheinung" (das. 1877); "Die
Glimmergruppe" (Leipz. 1877-78); "Die Skapolithreihe" (das. 1883);
"Die mikroskopische Beschaffenheit der Meteoriten" (Stuttg. 1885);
auch schrieb er ein "Lehrbuch der Mineralogie" (3. Aufl., Wien
1888).
Tschern, Kreisstadt im russ. Gouvernement Tula, am
Fluß T., der in die Suscha fällt, und an der Eisenbahn
Moskau-Kursk, hat 4 Kirchen und (1885) 2666 Einw.
Tschernagora (besser Crnagora), slaw. Name für
Montenegro; Tschernagorzen, die Montenegriner.
Tschernaja (T.-Rjetschka, Kasulkoi), Fluß im S. der
Krim (s. d.), welcher von O. her durch das Thal von Inkerman bei
den Ruinen dieses letztern in die Reede von Sebastopol mündet,
war im Krimkrieg während der Belagerung von Sewastopol die
Scheidelinie der feindlichen Armeen. Hier erfocht Canrobert 25. Mai
1855 einen Sieg über die Russen. Der vom Fürsten
Gortschakow 16. Aug. 1855 vergeblich unternommene Angriff auf die
Stellung der Alliierten wird die Schlacht an der T. genannt.
Tschernajew, Michael Grigorjewitsch, russ. General, geb.
1828, trat erst in die Armee, kämpfte in der Krim und im
Kaukasus, ward dann im diplomatischen Dienst verwendet und
russischer Generalkonsul in Belgrad, leitete 1864 als General den
Feldzug nach Taschkent, das er eroberte, erhielt aber wegen
Unbotmäßigkeit seinen Abschied und ließ sich als
Notar in Moskau nieder. Er war einer der thätigsten
Führer der panslawistischen Partei und übernahm im Juli
1876 das Kommando des serbischen Heers an der Morawa, ward aber 29.
Okt. bei Alexinatz geschlagen. 1877 im russischen Heer nicht
verwendet, setzte er die Agitationen für das slawische
Wohlthätigkeitskomitee im In- und Ausland fort. Alerander III.
ernannte ihn 1882 zum Generalgouverneur von Taschkent, setzte ihn
aber schon im Februar 1884 wegen Eigenmächtigkeit wieder ab.
Da er die Maßregeln der Regierung in Asien und namentlich die
Transkaspische Bahn in den Zeitungen rücksichtslos
bekämpfte, ward er 1886 auch seiner Stelle als Mitglied des
Kriegsrats entsetzt.
Tschernawoda (Crnavoda, bei den Türken
Boghasköi), kleine Stadt in der rumän. Dobrudscha,
Distrikt Constanza, rechts an der Donau, von wo die 1860
eröffnete Eisenbahn nach Constanza am Schwarzen Meer
führt, hat eine Kirche, eine Moschee, einen Hafen und 2635
Einw. Im April 1854 nahmen die Russen die Stadt.
Tschernebog ("schwarzer Gott"), der oberste der finstern
Götter der nordischen Wenden und Slawen, als böses
Prinzip der Gegensatz von Swantewit (s. d.), ursprünglich der
"schwarze" Gott der Gewitternacht gegenüber dem "lichten"
Sonnen- und Tagesgott. Er wurde in abschreckender, kaum
menschenähnlicher Gestalt dargestellt und erhielt Trankopfer
zur Sühne. Auch mehrere Berge, vorzeiten jedenfalls
Opferstätten, führen noch den Namen T. (Corneboh), z. B.
einer in der Nähe von Bautzen (558 m).
Tschernigow, ein Gouvernement Kleinrußlands (s.
Karte "Polen etc."), wird von den Gouvernements Kiew, Poltawa,
Kursk, Orel, Mohilew und Minsk begrenzt und umfaßt 52,397 qkm
(nach Strelbitsky 52,402 qkm = 951,58 QM.). Die bedeutendsten
Flüsse sind: der Dnjepr, der jedoch nur die Westgrenze
berührt, die Desna, Sosh und Trubesch. Außerdem gibt es
viele kleinere Flüsse und eine Menge ganz unbedeutender Seen.
Das Land ist im allgemeinen eben und sehr flach und wird nur durch
einige hügelige Flußufer etwas wellig und
schluchtenreich. Der nördliche Teil desselben ist waldreich;
im Kreis Gluchow wird der berühmte Gluchowsche weiße
Thon gewonnen (jährlich 60,000 Pud), aus dem 9/10 aller
Porzellanwaren in Rußland bereitet werden. In geologischer
Beziehung ist das rechte, hohe Ufer der Desna bemerkenswert, das
aus Kreideschichten besteht, in denen Sandadern mit Kiesel und
Muschelteilen vorkommen. Das Klima ist gemäßigt und
gesund. Die Bevölkerung belief sich 1885 auf 2,075,867 Einw.,
40 pro QKilometer, meist Kleinrussen, außerdem
Großrussen, Deutsche, Juden, Griechen. Die Zahl der
Eheschließungen war 1885: 17,193, der Gebornen 100,917, der
Gestorbenen 66,500. Das Areal besteht aus 54 Proz. Acker, 20,2
Proz. Wald, 16,7 Proz. Wiese und Weide, 9,1 Proz. Unland. T. hat in
vielen Kreisen einen zum Ackerbau wenig geeigneten Boden; Getreide
wird aus Poltawa und Kursk herbeigeführt. Immerhin bleibt die
Landwirtschaft die Hauptbeschäftigung der Bewohner und liefert
im N. des Gouvernements als die wichtigsten Produkte Hanf,
Hanföl, Runkelrüben u. Flachs (nach Riga), im S.
außer Runkelrüben Roggen, Hafer, Buchweizen, Kartoffeln,
Gerste, Arbusen, Melonen u. geringe Tabaksorten. Die Ernte betrug
1887: 5,8 Mill. hl Roggen, 2,9 Mill. hl Hafer, 1,2 Mill. hl
Buchweizen, 1,5 Mill. hl Kartoffeln. Der
886
Tschernij-Jar - Tschernyschew.
Viehstand bezifferte sich 1883 auf 515,334 Stück Hornvieh,
572,182 Pferde, 915,719 grobwollige, 32,236 feinwollige Schafe,
420,000 Schweine, 37,000 Ziegen. Der Waldreichtum liefert einen
großen Gewinn durch das Bau- und Brennholz, durch
Kohlenbrennerei und Teerschwelen. Die Industrie wurde 1884 in 587
Fabriken und gewerblichen Anstalten mit 14,439 Arbeitern betrieben
und der Gesamtwert der Produktion auf 21,384,000 Rubel beziffert.
Hervorragend sind Rübenzuckerfabrikation und -Raffinerie (6,1
Mill. Rub.), Tuchweberei (2,4 Mill. Rub.) und Branntweinbrennerei
(1,1 Mill. Rub.). Ansehnliche Industriezweige sind ferner:
Zündholzfabrikation, Ölschlägerei, Ziegelei,
Lederfabrikation, Holzsägerei. In 10 Fabriken wurden 1886/87:
72,600 Doppelzentner weißer Sandzucker produziert. Der Handel
ist ziemlich lebhaft und führt die genannten Produkte
hauptsächlich auf den Eisenbahnen, die sich bei dem Flecken
Bachmatsch kreuzen, aus. Lehranstalten gab es 1885: 631 elementare
mit 38,706 Schülern, 18 mittlere mit 3731 Schülern, 4
Fachschulen mit 525 Schülern, nämlich 2 Lehrerseminare,
ein geistliches Seminar und eine Feldscherschule. T. zerfällt
in 15 Kreise: Borsna, Gluchow, Gorodnja, Konotop, Koselez,
Krolewez, Mglin, Njeshin, Nowgorod Sjewersk, Nowosybkow, Oster,
Sosniza, Starodub, Surash und T. - Die gleichnamige Hauptstadt, an
der Desna, hat eine Kathedrale aus dem 11. Jahrh., 17 andre
Kirchen, 4 Klöster, einen erzbischöflichen Palast, ein
klassisches Gymnasium, ein Lehrerseminar, ein
Mädchengymnasium, eine Gouvernementsbibliothek, etwas Handel
und Industrie und (1886) 27,028 Einw. Sie ist Sitz des Erzbischofs
von T. und Njeshin. T. wird schon zu Olegs Zeit 907 erwähnt,
war längere Zeit die Hauptstadt des tschernigowschen
Fürstentums, wurde 1239 vom Mongolenchan Batu erobert und
verbrannt, gehörte seit dem 14. Jahrh. den Litauern,
später den Polen und wurde 1648 für immer mit
Rußland vereinigt.
Tscheruij-Jar, Kreisstadt im russ. Gouvernement
Astrachan, an der Wolga, hat alte unbedeutende Festungswerke,
Fischerei, Viehzucht, Schiffahrt und (1886) 4871 Einw. Im Kreis in
der Nähe des Bergs Bogdo liegt der See Boskuntschat (Bogdo),
123,9 qkm groß, 20 km lang und 9,5 km breit, der
vortreffliches weißes Salz liefert.
Tscherning, 1) Andreas, Dichter, geb. 18. Nov. 1611 zu
Bunzlau, flüchtete vor den Dragonaden des Grafen Dohna (s. d.
2) nach Görlitz, studierte später in Breslau, seit 1635
in Rostock, wohin ihn M. Opitz an Lauremberg empfohlen hatte, wurde
1644 an des letztern Stelle Professor der Dichtkunst in Rostock;
starb 27. Sept. 1659 daselbst. Seine Gedichte, meist
Gelegenheitspoesien, die ihn als einen der bessern Nachahmer von
Opitz erkennen lassen, erschienen unter den Titeln: "Deutscher
Gedichte Frühling" (Bresl. 1642) und "Vortrab des Sommers
deutscher Gedichte" (Rost. 1655). Auswahl in W. Müllers
"Bibliothek deutscher Dichter des 17. Jahrhunderts" (Bd. 7).
2) Anton Friedrich, dän. Staatsmann, geb. 12. Dez. 1795 auf
Frederiksvärk, trat 1813 in das Artilleriekorps, studierte,
seit 1816 als Leutnant in Frankreich stehend, in den
Artillerieschulen zu Paris und Metz, ward 1820 bei dem Inspektorat
der Fabriken auf Frederiksvärk angestellt und 1830 zum Lehrer
an der militärischen Hochschule zu Kopenhagen ernannt. Seit
1841 privatisierend, war er anfangs 1848 einer der Hauptleiter der
Gesellschaft der Bauernfreunde. Am 24. März d. J. zum
Kriegsminister ernannt, entwickelte er besondere Thätigkeit
für das dänische Heerwesen, schied aber im November aus
dem Ministerium und trat als Oberst in das Privatleben zurück,
wirkte jedoch als Mitglied der Grundgesetzgebenden Versammlung. Zum
ersten Reichstag in das Volksthing gewählt, war er eine der
gewichtigsten Stützen des Ministeriums. 1854 ward er zum
Reichsrat ernannt und nahm als hervorragendster Führer der
Bauernpartei an den Verfassungskämpfen bedeutenden Anteil. Er
starb 29. Juni 1874. Er schrieb "Zur Beurteilung des
Verfassungsstreits" (1865).
Tschernomorskibezirk (Bezirk des Schwarzen Meers), eine
Provinz der russ. Statthalterschaft Kaukasien, am Südabfall
des Kaukasus von der Straße von Kertsch bis etwa zum 38.
Meridian gelegen, umfaßt 5287 qkm (96,03 QM.) mit (1885)
22,932 Bewohnern. Dieser schmale, lange Streifen, von
Gebirgsrücken durchzogen, wurde früher besonders von
tscherkessischen Stämmen bewohnt, die sich infolge des sehr
durchschnittenen Terrains in eine Menge Unterabteilungen spalteten.
Nach der Auswanderung der Tscherkessen nach der Türkei hoffte
man auf die Einwanderung von Russen; dieselbe ist jedoch noch eine
spärliche. Noworossijsk und Anapa (s. d.) sind die einzigen
Städte.
Tschernomorzen, s. Kosaken, S. 110.
Tschernosem (Tschernosjom, "Schwarzerde"),
äußerst fruchtbare schwarze Erde, mitunter bis 6 m
mächtig, reich an Phosphorsäure, Kali und Ammoniak, mit
5-16 Proz. organischer Substanz, im mittlern und südlichen
Rußland sowie in Südsibirien weitverbreitet, liefert
ohne Düngung die reichsten Ernten (vgl. Humus, S. 796). Aus
Texas sind ähnliche Erdarten bekannt. Vgl. Kostytschew, Die
Bodenarten des T. (Petersb. 1886, russ.).
Tschernyschew, russ. Grafen- und Fürstengeschlecht,
das in einer ältern und einer jüngern Linie blüht.
Zur letztern gehörte Grigorij T., einer der tüchtigsten
Generale Peters d. Gr., geb. 1672. Er ward 1742 durch die Kaiserin
Elisabeth in den Grafenstand erhoben und starb 30. Juli 1745. Sein
ältester Sohn, Graf SacharT., geb. 1705, Kriegsminister unter
Katharina II., befehligte im Siebenjährigen Krieg ein
russisches Korps von etwa 20,000 Mann. Nach der Thronbesteigung des
Kaisers Peter III. erhielt T. im Mai 1762 den Befehl, sein Korps
den Preußen zuzuführen, worauf er, mit Friedrich d. Gr.
vereinigt, bei Burkersdorf auf Daun stieß, der Schweidnitz
decken sollte. Der König hatte bereits beschlossen, den Feind
anzugreifen, als die Order eintraf, daß T. sich sofort von
der preußischen Armee trennen solle. Auf Friedrichs Bitten
verheimlichte jedoch T. den erhaltenen Befehl und blieb mit seinem
Heer bei den Preußen, die nun die Österreicher
zurückwarfen. Später ward T. Präsident des
Kriegskollegiums und Reichsfeldmarschall; starb 1775. Sein Bruder,
Graf Iwan, war russischer Marineminister unter Katharina II. und
Paul I., ein dritter Bruder, Graf Peter, russischer
bevollmächtigter Minister am preußischen Hof bei
Friedrich II. und in Frankreich bei Ludwig XV. Graf Sachar, Enkel
des Grafen Iwan, beteiligte sich an der Verschwörung vom 14.
Dez. 1825, weshalb er nach Sibirien verbannt wurde. - Der
namhafteste Sprößling des ältern Zweigs ist
Fürst Alexander Iwanowitsch T., geb. 1779. Er nahm teil an der
Schlacht bei Austerlitz sowie an dem Feldzug vom Jahr 1807, wo er
insbesondere bei Friedland sehr wesentliche Dienste leistete.
Wiederholt erschien er hierauf als Diplomat in Paris. In den
Schlachten bei Wagram und Aspern befand sich T. an der Seite
Napoleons. Mit einer Mission nach Paris be-
887
Tschernyschewskij - Tschetschenzen.
traut, wußte er dort durch Bestechung den
französischen Operationsplan gegen Rußland in Erfahrung
zu bringen. Im Feldzug von 1812 führte er den kühnen Zug
im Rücken der französischen Armee aus, durch welchen er
den General Wintzingerode aus der Gefangenschaft befreite. 1813 zum
Divisionsgeneral avanciert, bedrohte er im März den
französischen General Augereau in Berlin, unternahm im
September 1813 einen Streifzug ins Königreich Westfalen, zu
dessen Sturz er wesentlich beitrug, und erstürmte 1814
Soissons. Zum Generalleutnant befördert, begleitete er den
Kaiser Alexander I. auf den Kongreß zu Wien, später nach
Aachen und Verona. Bei der Krönung des Kaisers Nikolaus ward
er in den Grafenstand erhoben und 1832 zum Kriegsminister und Chef
des kaiserlichen Generalstabs ernannt. 1841 wurde er in den
Fürstenstand erhoben und 1848 zum Präsidenten des
Reichsrats und des Ministerkonseils ernannt. Er starb 20. Juni 1857
in Castellammare.
Tschernyschewskij, Nikolai Gawrilowitsch, russ.
Schriftsteller, geb. 1828 zu Saratow, besuchte zuerst ein
geistliches Seminar, studierte dann in Petersburg, wo er den
Universitätskursus 1850 absolvierte, redigierte in der Folge
eine militärische Zeitschrift und war 1855-64 Mitarbeiter an
dem "Zeitgenossen", den er teils mit ästhetischen, teils mit
politisch-ökonomischen Artikeln und Abhandlungen versorgte.
Nebenbei veröffentlichte er ein Werk über Lessing (1857)
und bearbeitete Adam Smiths Werk über den Nationalreichtum
unter dem Titel: "Grundlagen der politischen Ökonomie" (1864).
Während einer Festungshaft schrieb er den nihilistisch
gefärbten, dabei durch die Schilderung neuer
gesellschaftlicher und staatlicher Verhältnisse
ausgezeichneten Tendenzroman "Was thun?" (2. Aufl. 1877; deutsch,
Leipz. 1883), der seine Verbannung nach Sibirien zur Folge hatte.
Er lebt, seit 1883 teilweise begnadigt, in Astrachan.
Tscherokesen (Cherokee, Tschilake), ein großes, zu
der sogen. Appalachengruppe gehöriges Indianervolk in
Nordamerika, bewohnt gegenwärtig, seit seiner Verpflanzung aus
dem ursprünglichen Gebiet auf die Westseite des Mississippi,
einen Distrikt im N. und O. des Indianerterritoriums von ca. 9,75
Mill. Acres Areal. Das Land wird vom Arkansas und dessen
Nebenflüssen reichlich bewässert und ist zum Ackerbau,
der fleißig betrieben wird, wohlgeeignet. Die Zahl der
T.betrug 1853: 19,367 und 1883: 22,000 Seelen. Sie sind unter den
Indianern Nordamerikas jedenfalls die am weitesten in der Kultur
vorgeschrittene Nation, haben große Dörfer mit wohnlich
eingerichteten Häusern, über 30 öffentliche Schulen
mit zum Teil eingebornen Lehrern und 5000 Schülern, betreiben
zahlreiche Sägemühlen sowie ausgedehnte Rindvieh-, Schaf-
und Pferdezucht. Was sie an Kleidung, Ackergerätschaften etc.
bedürfen, fertigen sie selbst an und produzieren auch Salz aus
den zahlreichen Salzquellen ihres Gebiets. In den letzten
Jahrzehnten haben sie auch schon einen Teil ihrer
landwirtschaftlichen Produkte flußabwärts nach New
Orléans ausgeführt. Sie haben ihre besondern Gesetze
und eine nach dem Muster der Vereinigten Staaten eingerichtete
republikanische Regierung mit geschriebener Verfassung. Ihre
Sprache, für welche 1821 ein Halbindianer, Sequoyah (G.
Gueß), eine eigne syllabische Schrift erfand, besteht aus 85
Zeichen, die zu Wörtern zusammengefügt werden, und ist
sehr wohlklingend; sie steht übrigens in der Reihe der
nordamerikanischen Sprachen ganz vereinzelt da. Mittelglieder,
welche die Sprache mit den Sprachen der südlichen Nachbarn
verbanden, sind verloren. Eine kurze Grammatik lieferte H. C. von
der Gabelentz in Höfers Zeitschrift; auch im 2. Bande der
"Archaeologia americana" finden sich grammatische Notizen. Daneben
haben die T. die englische Sprache in großem Umfang
angenommen und schon sämtlich ihre Nationaltracht für die
europäische aufgegeben. Von der Union erhalten sie noch
bedeutende Jahrgelder für ihre im O. des Mississippi
abgetretenen Ländereien; auch Handwerkswerkführer werden
ihnen kontraktlich von der Zentralregierung geliefert. Zahlreiche
Missionäre arbeiten unter ihnen mit gutem Erfolg, auch ihre
periodische Presse nimmt einen achtbaren Platz ein. Über die
Bedeutung ihres Namens ist man nicht im klaren. Gott nannten sie
Oonawleh Unggi ("den ältesten der Winde"). Nach Whipple
("Report on the Indian tribes") hatten sie einen der christlichen
Taufe ähnlichen Ritus, der streng beobachtet wurde, weil sonst
der Tod des Kindes die unvermeidliche Folge war. Auch besitzen sie
phantastische Sagen von einer Sintflut, einer gehörnten
Schlange etc. Die T. bewohnten ursprünglich ein großes
Gebiet im Innern von Südcarolina, Georgia und Tennessee,
lebten anfangs in gutem Einvernehmen mit den europäischen
Kolonisten und erkannten 1730 die britische Oberhoheit an.
Später kam es jedoch zu Kämpfen zwischen ihnen und den
Briten, die von beiden Seiten mit unmenschlicher Grausamkeit
geführt wurden, bis sie sich 1785 der Oberhoheit der
Vereinigten Staaten unterwarfen. Im Jahr 1819 siedelte ein Teil des
Volkes nach Arkansas über, während die übrigen in
Georgia, wozu ihr Gebiet nominell gehörte, zurückblieben.
Endlich wurden sie 1838 insgesamt genötigt, nach dem
Indianerterritorium auszuwandern, wo sie ihr jetziges Gebiet
angewiesen erhielten.
Tschers (pers.), aus dem indischen Hanf in Form einer
Pasta bereitetes Narkotikum, das, wie in der Türkei das
Esrar(s. d.),in Afghanistan, Persien und Mittelasien (hier auch
Anascha oder Chab genannt) unter den Tabak gemischt geraucht wird.
Vgl. Haschisch.
Tscheschme (bei den Griechen Krene genannt), Hafenstadt
im asiatisch-türk. Wilajet Aïdin, am Ägeischen Meer,
Chios gegenüber, mit mittelalterlicher Citadelle,
Rosinenhandel und ca. 20,000 fast nur griech. Einwohnern. Bei T.
wurde in der Nacht vom 5. zum 6. Juli 1770 eine Seeschlacht
geliefert, in welcher die Russen die türkische Flotte
verbrannten, die sich unvorsichtigerweise in die enge und seichte
Bucht nach T. zurückgezogen hatte. Zum Andenken an den Sieg
gründete Katharina II. 15 km südlich von St. Petersburg
ein gleichnamiges Militärkrankenhaus. Im April 1881 wurde T.
durch Erdbeben arg zerstört.
Tschesskajabai, Teil des Nördlichen Eismeers,
zwischen der Halbinsel Kanin, der Insel Kalgujew und dem
Festland.
Tschetschenzen, die russ. Bezeichnung für die zum
kaukasischen Stamm gehörigen, von den Georgiern Khisten
(Kisten), von den Lesghiern Mizdscheghen genannten
Völkerschaften, die sich selber Nachtschuoi nennen. Ihr Gebiet
wird im W. und NW. von Dagheftan, im NO. vom obern Terek, im N. von
der Kleinen Kabarda und dem Sundschafluß, im S. vom Kaukasus,
im O. vom obern Jakhsai und Enderi begrenzt. Zu ihnen gehören
namentlich die Inguschen, Karabulaken, Thusch oder Mosok,
Chewsuren, Pshawen und die T. im engern Sinn zwischen den
Karabulaken und dem Aksaifluß. Ihre Zahl beträgt etwa
161,500 Seelen. Die Männer zeichnen sich durch schlanken Wuchs
und Körpergewandtheit aus; den Frauen ist natürliche
Anmut eigen. Die Wohnorte, Aul genannt, sind befestigte
Dörfer. Jedes Dorf
888
Tschettik - Tschilau.
wählt aus der Mitte seiner Bewohner seine Ältesten.
Fürsten gibt es nicht; sie gelten alle als frei und teilen
sich in Geschlechter (Tochum), die sich nach den Auls nennen, aus
denen ihre Stammväter zur Zeit der Übersiedelung aus dem
Gebirge in die Ebene ausgeganzen sind. Ihre Sprachen sind mit
keinem andern Sprachstamm verwandt (s. Kaukasische Sprachen). Als
Mohammedaner enthalten sie sich des Weins, dafür
genießen sie desto mehr Branntwein. Hinsichtlich der
Gesittung stehen sie andern Kaukasiern nach; von Gewerbebetrieb und
sonstiger friedlicher Beschäftigung ist, von etwas Feldbau und
Viehzucht abgesehen, bei ihnen nicht die Rede. 1818 Rußland
unterworfen, erhoben sich die T., aufgeregt durch den Muridismus
(s. Muriden), in Masse gegen die Fremdherrschaft, und erst 1859,
nachdem sich Schamil (s. d.) den Russen hatte ergeben müssen,
gelangte die russische Herrschaft im östlichen Kaukasus zu
fester Begründung (s. Kaukasien, S. 635). Gleichwohl blieben
die T. stets unruhige und unwillige Unterthanen, die noch
während des orientalischen Kriegs 1877 gegen die Russen
aufstanden, bald aber wieder unterworfen wurden.
Tschettik (Tschettek), s. Strychnos und Pfeilgift.
Tschetwert (Kul), Einheit des russ. Getreidemaßes,
= 8 Tschetwerik = 64 Garnetz = 2,099 hl.
Tschi (Covid), Längenmaß in China, = 10 Tsun
oder Pant à 10 Fen, Fan oder Fahn = 0,3581 m. Auch
Getreidemaß, s. Hwo.
Tschibtscha (Chibcha, auch Muisca), amerikan. Volksstamm,
welcher im heutigen Kolumbien vom obern Zuila im N. bis gegen Pasto
im S. und von den Quellen des Atrato im W. bis gegen Bogota im O.
einen Staat gründete, der sich, wie Reste von Bauwerken
beweisen, zu verhältnismäßig hoher Kultur
entwickelte (vgl. Amerikanische Altertümer, S. 482, und
Sogamoso).
Tschibuk (türk.), Rohr, Pfeifenrohr; die türk.
Tabakspfeife im allgemeinen, die aus einem deckellosen Thonkopf
(Lule), aus dem Rohr, dem Mundstück (Imame) und dem
Verbindungsrohr zwischen dem letztern und der Pfeife besteht. Als
beste Sorte der kleinen, breiten und rötlichen
Pfeifenköpfe gelten die in einigen Fabriken von Top-Hane
verfertigten. Die besten Jasminrohre stammen aus der Umgebung von
Brussa; das Mundstück wird aus Bernstein angefertigt.
Bisweilen sind diese Pfeifen mit kostbaren Edelsteinen geziert. Der
Tabak im Pfeifenkopf wird durch eine glimmende Kohle
angezündet und, um das Herabfallen desselben auf den Teppich
zu verhüten, eine kleine Metallschale unter den Pfeifenkopf
gelegt. Der T. ist ein steter Begleiter des Türken; einem
besondern Diener, dem Tschibuktschi, ist die Pflege desselben
anvertraut; derselbe folgt mit den Rauchutensilien beständig
seinem Herrn und ist zugleich eine Vertrauensperson desselben. Vgl.
Vambery, Sittenbilder aus dem Morgenland (Berl. 1876).
Tschichatschew, Peter von, russ. Naturforscher und
Reisender, geb. 18l2 zu Gatschina bei St. Petersburg, war Attache
bei der Gesandtschaft in Konstantinopel und bereiste 1842-44
Kleinasien, Syrien und Ägypten. Nachdem er dann verschiedene
Länder Europas besucht und den Altai im Auftrag des Kaisers
erforscht hatte, konzentrierte er seit 1848 seine
Hauptthätigkeit auf die Durchforschung Kleinasiens, wo er bis
1853 ganz auf eigne Kosten sechs ausgedehnte Reisen ausführte
und zwar in erster Linie als Geognost und Botaniker; auch 1858 war
er wieder in Kleinasien und Hocharmenien. Außer den
Reisewerken: "Voyage scientifique dans l'Altaï oriental et les
parties adjacentes de la frontière de Chine" (Par. 1845, mit
Atlas), "Asie Mineure" (das. 1853-68, 8 Bde. mit Atlas), "Lettres
sur la Turquie" (Brüss. 1859), "Une page sur l'Orient" (2.
Aufl. 1877), "Le Bosphore et Constantinople" (3. Aufl. 1877) und
"Espagne, Algérie et Tunésie" (Par. 1880; deutsch.
Leipz. 1882) veröffentlichte er auch mehrere wissenschaftliche
Arbeiten und politische Schriften sowie eine Übersetzung von
Grisebachs Pflanzengeographie und ein kleines Werk: "Kleinasien"
(deutsch, das. 1887). Sein Bruder Plato v. T. bereiste gleichfalls
Nordafrika, Südeuropa und Südamerika, machte den Feldzug
gegen China mit und lebte dann in Italien und Frankreich.
Tschiervaporphyr, s. Granitporphyr.
Tschiftlik (türk.), Landgut, früheres
Militärlehen. T.-Sahibi (auch Aga), in Bosnien eine Art
Grundherr, der nicht den Zehnten, sondern ein volles Drittel des
Rohertrags bezog. T.-Humajun (auch Mici genannt), die
Privatgüter des Sultans.
Tschifu (engl. Cheefoo), einer der chines.
Traktatshäfen, in der Provinz Schantung am Eingang des Golfs
von Petschili gelegen, mit etwa 32,000 Einw. Der
fremdländische Handel (Totalwert 1887: 1,6 Mill. Taels) nimmt
stetig zu. T. ist Sitz eines deutschen Konsuls und verschiedener
Missionen, im ganzen ca. 120 Europäer und Amerikaner.
Tschigirin, Kreisstadt im russ. Gouvernement Kiew, an der
Tjasmina (Nebenfluß des Dnjepr) in steppenartiger, aber
fruchtbarer Gegend, hat 5 russische und eine evang. Kirche und
(1885) 16,009 Einw., welche Branntwein, Seife, Leder (Kalbleder und
Juften) und Leinwand zur Ausfuhr bringen. - T., im 16. Jahrh.
gegründet, wurde 1546 Hauptort der kleinrussischen Kosaken;
1596 schlug hier der Kosak Nelimaiko den polnischen Hetman
Zolkjemski, 1677 und 1678, nachdem die Stadt 1659 russisch geworden
war, belagerten die Türken dieselbe, wobei Gordon (s.d. 2)
heldenmütigen Widerstand leistete; schließlich
mußten die Russen die Festung räumen, ohne daß die
Türken dieselbe dauernd zu behaupten vermocht hätten.
Diese Kämpfe, die ersten, welche unmittelbar zwischen Russen
und Türken erfolgten, werden als die "Tschigirinfeldzüge"
bezeichnet.
Tschikasa (engl. Chickasaws), ein den Tschokta verwandter
Indianerstamm in Nordamerika, früher ziemlich mächtig und
am mittlern Mississippi und Yazoofluß (in den Staaten Alabama
und Tennessee) wohnhaft. Die T. zeigten sich früh (1699) den
von den Gebirgen Carolinas herabsteigenden und mit ihnen Handel
treibenden Engländern geneigt, während sie einen tiefen
Haß gegen die den Mississippi heraufkommenden und sie
übermütig behandelnden Franzosen nährten. Es kam zu
offenen Feindseligkeiten (1736-40), infolge deren der Stamm teils
vernichtet oder gefangen, teils aus seinem Gebiet auf das andre
Mississippiufer vertrieben wurde. 1786 schlossen die T. mit der
Union Freundschaft und wanderten 1837 und 1838 mit den Tschokta
nach dem Indianerterritorium aus, dessen südwestlichen Teil
sie, 1883 ca. 6000 Köpfe stark, bewohnen. Sie haben ihre eigne
Legislatur, bestehend aus Senat und Repräsentantenhaus, dazu
gute Schulen, geregelte Finanzen und zeichnen sich überhaupt
durch Fortschritte in der Zivilisation vor andern aus. Ihre Sprache
ist von der der Tschokta wenig verschieden. Vokabularien derselben
finden sich in Adairs "History of the American Indians" (Lond.
1775) und im 2. Bande der "Archaeologia americana".
Tschikischlar, Fort, s. Atrek.
Tschilau (pers.), ein dem türk. Pilaw (s. d.)
äzhn-
889
Tschili - Tschitschagow.
liches Gericht, das aber weniger fett in luftdichtem
Gefäß durch Dampf gekocht wird; es vertritt bei
Mahlzeiten die Stelle des Brots.
Tschili, chines. Provinz, s. Petschili.
Tschilka (Chilka), See (richtiger Lagune) in der
britisch-ind. Provinz Orissa, an der Westküste des
Bengalischen Meerbusens, hat bei 1-2½ m Tiefe je nach der
Jahreszeit 891-1165 qkm (16-21 QM.) Umfang und steht mit dem Meer
durch einen an 300 m breiten Kanal in Verbindung. Bei Hochwasser
frisch, wird das Wasser später ganz salzig.
Tschille (pers.), die 40 Tage der strengen
Winterkälte (in Konstantinopel sehr gefürchtet); auch die
40 Tage, welche die Frau nach der Niederkunft in
Zurückgezogenheit zu verbringen hat.
Tschimin (türk.), Wasserpfeife in Mittelasien,
plumper als der persische Kalian (s. d.), besteht aus einem
länglichen Kürbis oder einer Holzflasche mit kurzem Rohr;
der Tabak wird nicht in benetztem, sondern in trocknem Zustand
geraucht.
Tschin (russ.), Rang; Bezeichnung für die russischen
Rangstufen (Tschiny), in welchen die Zivil- und Militärbeamten
gemeinschaftlich rangieren. Mit der vierten Klasse (Wirklicher
Staatsrat, Generalmajor) ist der Adel verbunden.
Tschinab, Fluß, s. Tschenab.
Tschindana (Tjindana), früher Name der Insel Sumba
(s. d.).
Tschinghai, lebhafter Vorhafen der chines. Stadt Ningpo,
links am Yungfluß, nahe der Mündung desselben, seit 1842
dem europaischen Handel geöffnet. Eine verfallene Citadelle
und eine neuerbaute Batterie von zehn Geschützen verteidigen
die Reede. Im Krieg Frankreichs mit China wurde T. 1885 von den
Franzosen wiederholt beschossen und das Fort Siaokung
zerstört.
Tschingkiang (Chinkiang), Name verschiedener chines.
Städte, darunter am wichtigsten die für den
europäischen Handel geöffnete Hafenstadt in der Provinz
Kiangsu, an der Mündung des Jantsekiang, Sitz eines deutschen
Konsuls, mit einer katholischen und evang. Mission und etwa 135,000
Einw. Im Hafen verkehrten 1886: 3526 Schiffe von 2,328,052 Ton.,
davon 126 deutsche von 72,540 T.; die Einfuhr wertete 1887: 98,000
Haikuan Tael. Die Stadt wurde 1842 von der britischen Flotte
bombardiert, 1853 von den Taiping zerstört, später aber
wieder aufgebaut.
Tschingtu, Hauptstadt der chines. Provinz Setschuan, an
einem Nebenfluß des Jantsekiang, hat breite Straßen,
schöne Häuser, einen immer bedeutender werdenden Handel
und 350,000 Einw.
Tschintschotscho (Chinchoxo), Faktorei und ehemalige
Station der Deutschen Afrikanischen Gesellschaft, im
portugiesischen Teil der Loangoküste an der Mündung des
Lukulu.
Tschippewäer, Indianerstamm der Algonkin, s.
Odschibwä.
Tschirch, Wilhelm, Männergesangskomponist, geb. 8.
Juni 1818 zu Lichtenau (Schlesien), machte seine Studien am
Lehrerseminar zu Bunzlau und von 1839 an auf Staatskosten am
königlichen Institut für Kirchenmusik zu Berlin, wo er
gleichzeitig den Kompositionsunterricht von Marx genoß. 1843
wurde er in Liegnitz als städtischer Musikdirektor und 1852 in
Gera als fürstlicher Kapellmeister angestellt. Seine
Männergesangskompositionen verbreiteten sich in die weitesten
Kreise, selbst nach Amerika, woselbst T. auch persönlich
enthusiastisch gefeiert wurde, nachdem er einer Einladung zu dem
1869 in Baltimore veranstalteten Sängerfest gefolgt war.
Außer seinen Mannerchören, unter denen die von der
Akademie der Künste zu Berlin mit dem ersten Preis
gekrönte Tondichtung "Eine Nacht auf dem Meere" Erwähnung
verdient, komponierte er noch eine Oper: "Meister Martin und seine
Gesellen" (aufgeführt 186l zu Leipzig), sowie kleinere Sachen
für Orgel und Klavier.
Tschirmen, Flecken im türk. Wllajet Adrianopel,
rechts an der Maritza, westlich von Adrianopel, mit Citadelle und
2000 Einw., welche Seidenzucht treiben.
Tschirnau (Groß-T.), Stadt im preuß.
Regierungsbezirk Breslau, Kreis Guhrau, an der Linie
Breslau-Stettin der Preußischen Staatsbahn, hat eine
evangelische und eine kath. Kirche, eine Präparandenanstalt,
ein adliges Fräuleinstift, Spiritusbrennerei und (1885) 758
meist evang. Einwohner.
Tschirnhaus (Tschirnhausen), Ehrenfried Walter, Graf von,
Naturforscher, geb. 10. April 1651 auf Kieslingswalde bei
Görlitz, studierte zu Leiden Mathematik, war 1672 und 1673
Freiwilliger in holländischen Diensten, bereiste seit 1674
Frankreich, Italien, Sizilien und Malta und zog sich später
auf sein Gut Kieslingswalde zurück; starb 11. Okt. 1708 in
Dresden. Er errichtete in Sachsen drei Glashütten und eine
Mühle zum Schleifen von Brennspiegeln von
außerordentlicher Vollkommenheit. Er experimentierte mit
einem Brennspiegel von 2 Ellen Brennweite und beschrieb die
erhaltenen Resultate (1687 und 1688). Ein nicht geringes Verdienst
gebührt ihm bei der Erfindung des Meißener Porzellans.
Als Philosoph erwarb er sich eine gewisse Bedeutung durch seine
"Medicina mentis" (Amsterd. 1687, Leipz. 1695). Auch als
Mathematiker hat er sich namhafte Verdienste erworben, und die
"Acta Eruditorum" aus den Jahren 1682-98 enthalten von ihm eine
Reihe von Arbeiten über Brennlinien, das Tangentenproblem,
Quadraturen, Reduktion von Gleichungen u. a. Vgl. Kunze,
Lebensbeschreibung des E. W. v. T. ("Neues Lausitzisches Magazin",
Bd. 43, Heft 1, Görl. 1866); Weißenborn,
Lebensbeschreibung des E. W. v. T. (Eisenach 1866).
Tschirokesen, s. Tscherokesen.
Tschistopol, Kreisstadt im russ. Gouvernement Kasan, an
der Kama, hat ein weibliches Progymnasium, Ackerbau, Viehzucht,
Fischerei, lebhaften Handel und (1885) 24,288 Einw.
Tschita, Hauptstadt des sibir. Gebiets Transbaikalien,
mit (1885) 5728 Einw.
Tschitah, s. Gepard.
Tschitraga, ein hieroglyphisches Zeichen, das die Inder
mit rotem Sandelholz oder Asche von Kuhmist oder heiliger Erde auf
Brust und Stirn malen, um die religiöse oder philosophische
Sekte anzudeuten, zu der sie sich bekennen. Am Stoff der Farbe
erkennt man den Gott, den man verehrt. Das Malen selbst wird jeden
Tag nach den gewöhnlichen Abwaschungen unter Hersagung eigner
Gebetsformeln vorgenommen.
Tschitschagow, Wasilij Jakowlewitsch, russ. Admiral, geb.
1726, nahm 1765 und 1766 an großen Expeditionen im Eismeer
teil, befehligte im Türkenkrieg 1773-75 die donische Flottille
und wurde 1788 während des schwedisch-russischen Kriegs nach
S. Greighs Tod Oberbefehlshaber der baltischen Flotte; er siegte
1790 über die Schweden bei Reval und beschleunigte durch die
Erfolge der Russen zur See den Abschluß des Friedens. Er
starb 1809. -
Sein Sohn Paul Wasiljewitsch, geb. 1762, ward 1802 zum
Vizeadmiral und Dirigierenden des Seeministeriums und 1812 zum
Admiral ernannt. Im Mai d. J. übernahm er an Kutusows Stelle
den Oberbefehl über die russische Moldauarmee und schloß
28. Mai den
890
Tschitschenboden - Tschudi.
Frieden von Bukarest ab; sodann befehligte er die dritte
Westarmee, eroberte zwar im November Minsk und Borissow, ward aber
28. Nov. mit 27,000 Mann an der Beresina von 8000 Mann Franzosen,
Schweizern und Polen unter Oudinot, Ney und Dombrowski geschlagen
und von Ney bis nach Stachowa zurückgeworfen. Deshalb in
Ungnade gefallen, nahm er Urlaub auf unbestimmte Zeit und lebte
seitdem meist in Frankreich und England, wo er auch zu seiner
Rechtfertigung eine Denkschrift: "Retreat of Napoleon" (Lond.
1817), veröffentlichte. Da er dem 1834 erlassenen Ukas,
welcher allen im Ausland verweilenden Russen befahl, in ihr
Vaterland zurückzukehren, nicht nachkam, ward er aus den
Listen der russischen Marine gestrichen, seiner Würde als
Reichsrat entsetzt und seiner Güter beraubt. Er starb 1. Sept.
1849 in Paris. Seine "Mémoires" über den Krieg von 1812
erschienen 1855 in Berlin und 1862 in Paris.
Tschitschenboden, die südöstliche Fortsetzung
des eigentlichen Karstes (s. d.), welche den größten
Teil Istriens erfüllt und sich insularisch in Cherso etc.
fortsetzt; nach dem diesen Landstrich bewohnenden kroatischen Stamm
der Tschitschen benannt. Er bildet Flächen, die von NW. nach
SO. gefurcht sind, und kulminiert im Monte Maggiore (1394 m).
Tschobe, Name des Cuando in seinem untern Lauf, da wo er
südlich und dann, sich nach N. biegend, auch nördlich vom
18.° südl. Br. ein langes und breites Sumpfgebiet bildet,
ehe er wiederum als Cuando bei Mpalewa sich in den Sambesi
ergießt.
Tschoga (türk.), in Afghanistan und Indien langes,
weites Oberkleid, in Mittelasien Pelzgewand.
Tschoh, s. Chow.
Tschohadar (Tschokadar, türk.), Diener.
Tschokta (Choctaws, Chactas), großer nordamerikan.
Indianerstamm, der ursprünglich in Mexiko wohnte, dann nach
dem mittlern Mississippi und Yazoofluß übersiedelte,
seit 1837 aber einen Teil des Indianerterritoriums (nördlich
am Red River) innehat. Die T. treiben ausgedehnten Ackerbau (Mais
und Baumwolle), unterhalten einen ansehnlichen Viehstand, haben gut
gebaute Häuser, verstehen sich auf Spinnen, Weben und die
wichtigsten Handwerke und haben eine der Unionsverfassung
nachgeahmte geschriebene Konstitution mit einem gesetzgebenden Rat
(legislature) von 40 Mitgliedern sowie geschriebene Gesetze. Die
Exekutivgewalt wird von einem Gouverneur ausgeübt. Alle
Männer der Nation sind wehrpflichtig. Die Sprache der T. ist
eine der drei Hauptsprachen der Indianer. Für die
religiösen Bedürfnisse derselben sorgen die Sendlinge der
amerikanischen Missionsgesellschaften. Das Neue Testament und
einige andre Bücher sind von ihnen in die Sprache der T.
übersetzt worden. Für die 36 Schulen wird ein bestimmter
Teil der Jahrgelder verwendet, welche die Union für die
Länderabtretungen im Betrag von 36,000 Dollar zu bezahlen hat.
Vor Verpflanzung der T. nach dem Westen wurde die Zahl derselben
auf 18,500 Seelen geschätzt, 1883 auf 18,000. Eine Grammatik
der Tschoktasprache schrieb Byrington (Philad. 1870), ein
Wörterbuch Wright (engl., St. Louis 1880).
Tschorba, türk. Nationalspeise, ein Ragout aus
Hammelfleisch, Kartoffeln, Reis und Zwiebeln.
Tschorlu, Stadt im türk. Wilajet Adrianopel, am
Tschorlu Dere und an der Eisenbahn von Konstantinopel nach
Adrianopel, Sitz eines griechischen Bischofs, mit 8000 Einw., meist
Griechen. In der Umgegend viel Weinberge und Obstgärten.
Tschouschan (bei den Europäern Tschusan, engl.
Chusan), Inselgruppe an der Ostküste von China, in der Provinz
Tschekiang, Ningpo gegenüber, 1½ km von der Küste,
besteht aus einer 600 qkm großen Hauptinsel mit dem
befestigten Hauptort Tinghai (30,000 Einw.) und gegen 400 Eilanden
mit 400,000 Einw., darunter das mit Klöstern für 1000
buddhistische Mönche, Tempeln etc. bedeckte Put u. Die
Hauptinsel wurde 1840, 1841 und 1860 von den Engländern
besetzt und erst nach Eröffnung Chinas für den Handel mit
Europa zurückgegeben.
Tschu, japan. Längenmaß, = 60 Keng = 360
Schaku (1 Schaku = 0,3036 m); auch Flächenmaß, = 3000
QKeng = 99,57 Ar.
Tschu (Tschui), Fluß in der asiatisch-russ. Provinz
Turkistan, entspringt als Koschkar im Mustagh, fließt
nördlich vom Issikul in westlicher Richtung, bis er sich nach
NW. wendet, den Kungei-Alatau durchbricht und, nachdem er links den
Karagatai aufgenommen, die Wüste Mujunkum bis zum Saumalkul
begrenzt, worauf er in den Tatalkul sich ergießt.
Tschuchloma, Kreisstadt im russ. Gouvernement Kostroma,
am See T., mit (1885) 1978 Einw.
Tschuden, allgemeiner Name der im russ. Reich
verbreiteten finnischen Völkerschaften; im engern Sinn ein zur
Gruppe der baltischen Finnen gehöriges, einst weitverbreitetes
Volk, das man auch als Wepsen (Wepsälaiset), Wessen oder
Nordtschuden bezeichnet, von dem aber nur noch 56,000 Seelen in den
am Ladoga- und Onegasee gelegenen Strichen des Gouvernements Olonez
und im Gouvernement Wologda übrig sind. Nahe verwandt mit
ihnen sind die Woten oder Südtschuden, die sich selbst
Waddjalaiset nennen; im ganzen noch 12,000 Köpfe in den
Gouvernements Nowgorod und St. Petersburg, aber im Aussterben
begriffen. Grammatik von Ahlquist (Helsingfors 1855).
Tschudi, ältestes Adelsgeschlecht der Schweiz im
Kanton Glarus. Nachdem dasselbe 906-1288 das säckingische
Meieramt besessen, erlangte es durch Jost T., der mehr als 30 Jahre
Glarus als Landammann vorstand und 1446 den Sieg bei Ragaz
entschied, neues Ansehen. Sein Sohn Johannes T. befehligte die
Glarner in den Burgunderkriegen und dessen Sohn Ludwig T. in den
Schwabenkriegen. Des letztern jüngerer Sohn war Ägidius
(s. unten). Vgl. Blumer, Das Geschlecht der T. von Glarus (St.
Gallen 1853). Bemerkenswert sind:
1) Ägidius (Gilg), Geschichtschreiber, geb. 5. Febr. 1505,
empfing seinen ersten Unterricht von Zwingli, damals Pfarrer in
Glarus, studierte in Basel u. Paris und verfaßte 1528 eine
"Beschreibung Rätiens", welche gegen seinen Willen von Seb.
Münster gedruckt wurde. In verschiedenen hohen
eidgenössischen und kantonalen Stellungen wirkte er
anfänglich, obwohl der Reformation entschieden abgeneigt,
eifrig im Sinn der konfessionellen Versöhnung. 1558 zum
Landammann gewählt, nahm er jedoch als Haupt der katholischen
Minderheit in Glarus allmählich eine schroffere Stellung ein.
Als er deshalb bei der Neuwahl 1560 von der Landsgemeinde
übergangen wurde, widmete er sich bis zu seinem 28. Febr. 1572
erfolgten Tod fast ausschließlich der Vollendung seiner zwei
großen Geschichtswerke, der "Gallia Comata", welche neben
einer Beschreibung des alten Gallien namentlich die Altertümer
und Vorgeschichte der Schweiz enthält, und der viel
wertvollern, bis 1470 reichenden "Schweizerchronik", welche bis auf
Joh. v. Müller herab als Hauptquelle für die ältere
Schweizergeschichte benutzt, aber erst 1734-36 zu Basel gedruckt
wurde (2 Bde.). Tschudis Darstellung der Entstehung der
Eidgenossenschaft, die auf einer geschickten Verknüpfung
von
891
Tschudisches Meer - Tschuktschen.
Urkunden, sagenhafter Überlieferung und freier Erfindung
des Autors beruht, ist jahrhundertelang die herrschende geblieben
und durch Joh. v. Müller und Schiller europäisches
Gemeingut geworden. Seit Kopps Forschungen dieselbe als Sage oder
Roman haben erkennen lassen, beruht der Wert der Chronik Tschudis,
abgesehen von ihrem litterarischen Verdienst, hauptsächlich
auf den zahlreichen, jetzt verlornen Urkunden, deren Wortlaut sie
uns erhalten hat. Vgl. Euch s, Ägidius Tschudis Leben und
Schriften (St. Gallen 1805, 2 Bde.); Vogel, Egidius T. als
Staatsmann und Geschichtschreiber (Zürich 1856); Blumer,
Ägidius T. (im "Jahrbuch des Historischen Vereins Glarus" 1871
u. 1874); Herzog, Die Beziehungen des Chronisten Ä. T. zum
Aargau (Aarau 1888).
2) Iwan von, geb. 19. Juni 1816 zu Glarus, seit 1846 Mitbesitzer
der Verlagsbuchhandlung Scheitlein u. Zollikofer in St. Gallen,
gest. 28. April 1887 daselbst, machte sich als Alpenforscher
besonders verdient durch die Herausgabe eines trefflichen
Reisehandbuchs: "Tourist in der Schweiz und dem angrenzenden
Süddeutschland, Oberitalien und Savoyen" (1855, 30. Aufl.
1888).
3) Johann Jakob von, Naturforscher, Bruder des vorigen, geb. 25.
Juli 1818 zu Glarus, studierte in Leiden, Neuchâtel,
Zürich und Paris, später auch in Berlin und Würzburg
Naturwissenschaft, bereiste 1838-43 Peru, lebte seit 1848 auf
seiner Besitzung Jakobshof in Niederösterreich, bereiste
1857-59 Brasilien, die La Plata-Staaten, Chile, Bolivia und Peru,
ging 1859 als Gesandter der Schweiz nach Brasilien, wo er
namentlich auch zum Studium der Einwanderungsverhältnisse die
mittlern und südlichen Provinzen bereiste, kehrte 1861
zurück, ging 1866 als schweizerischer
Geschäftsträger nach Wien und wurde 1868 zum
außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten
Minister daselbst ernannt. Seit 1883 lebt er wieder auf seinem Gut.
Er schrieb: "System der Batrachier" (Neuchât. 1838);
"Untersuchungen über die Fauna peruana" (St. Gallen 1844-47,
mit 76 Tafeln); "Die Kechuasprache" (Wien 1853, 3 Tle.); "Ollanta,
ein altperuanisches Drama, aus der Kechuasprache übersetzt und
kommentiert" (das. 1875); "Organismus der Khetsuasprache" (Leipz.
1884); "Peru, Reiseskizzen" (St. Gallen 1846, 2 Bde.);
"Antiguedades peruanas" (mit Don Mariano de Rivero, Wien 1851, mit
Atlas); "Reisen durch Südamerika" (Leipz. 1866-69, 5 Bde.).
Auch bearbeitete er Winckells "Handbuch für Jäger" (5.
Aufl., Leipz. 1878, 2 Bde.).
4) Friedrich von, Bruder der vorigen, geb. 1. Mai 1820 zu
Glarus, studierte in Basel, Bonn und Berlin Theologie, wurde 1843
Stadtpfarrer in Lichtensteig (Toggenburg), lebte seit 1847 als
Privatmann in St. Gallen, übernahm dort seit 1856 verschiedene
Beamtenstellungen, saß seit 1864 im Großen Rat, seit
1874 im Regierungsrat, wurde 1877 Mitglied des schweizerischen
Ständerats und starb 24. Jan. 1886. Er erwarb sich besondere
Verdienste um das Erziehungswesen und führte den Kampf mit dem
Klerus ebenso taktvoll wie entschieden. Sein bekanntes Hauptwerk
ist: "Das Tierleben der Alpenwelt" (Leipz. 1853, 10. Aufl. 1875;
vielfach übersetzt), ein auf eignen Forschungen und
sorgfältigster Beobachtung beruhendes, auch sprachlich
ausgezeichnetes Buch; andre Schriften von ihm sind: "Der Sonderbund
und seine Auflösung" (unter dem Pseudonym C. Weber, St. Gallen
1848); "Landwirtschaftliches Lesebuch" (8. Aufl., Frauenfeld 1888);
"Der Obstbau und seine Pflege" (mit Schultheß, 4. Aufl., das.
1887).
Tschudisches Meer, See, s. v. w. Peipus.
Tschugujew, Kreisstadt im russ. Gouvernement Charkow, an
der Mündung der Tschugewka in den Donez, hat Obstbau, Handel
und (1885) 10,147 Einw.
Tschukiang (Perlfluß), Fluß in der chines.
Provinz Kuangtung, welcher aus dem Ssi-, Pe- und Tungkiang
zusammenfließt und unterhalb Kanton in eine Bucht des
Chinesischen Meers mündet.
Tschuktschen (auch Tschautschen), ein zu den Arktikern
oder Hyperboreern gehöriges Volk im nordöstlichsten
Sibirien (s. Tafel "Asiatische Völker", Fig. 1). Nach ihrer
Lebensweise unterscheidet man nomadisierende oder
Renntiertschuktschen und seßhafte oder Jagd und Fischerei
treibende T. Die erstern ziehen zwischen der Beringsstraße,
Indigirka und der Penschinabai herum, ihre Zahl ist unbekannt. Die
andern wohnen in festen oder verrückbaren Zelten am Ufer des
Eismeers von Kap Schelug bis zum Ostkap und weiter von hier an den
Ufern des Beringsmeers bis zum Anadyrbusen. Die sogen.
Tschuktschenhalbinsel ist ein ödes Land mit sterilen Bergen
und Thälern, auf denen nur Renntiermoos gedeiht. Die
Seßhaftigkeit ist nicht wörtlich zu nehmen; wenn an
einem Orte die Lebensmittel mangeln, so wird auch im Winter ein
andrer Aufenthalt gewählt. Man schätzt die Zahl der
seßhaften T. auf 2000-2500 Köpfe, die beider Abteilungen
auf 4-5000. Unzweifelhaft sind die T. hervorgegangen aus der
Mischung mehrerer früher kriegerischer und wilder, von fremden
Eroberern von S. nach N. gejagter Rassen, die daselbst eine
gemeinsame Sprache annahmen, und denen die Lebensbedingungen am
Polarmeer einen unvertilgbaren Stempel aufdrückten. Der
gewöhnliche Typus ist: Mittellänge, steifes,
großes, schwarzes Haar, fein gebildete Nase, horizontal
liegende, keineswegs kleine Augen, schwarze Augenbrauen, lange
Augenwimpern, hervorstehende Backenknochen und helle, wenig braune
Haut, die bei jungen Weibern nahezu ebenso weiß und rot ist
wie bei den Europäern. Trotz der großten Unsauberkeit am
Körper und in ihren Behausungen erfreuen sie sich doch guter
Gesundheitsverhältnisse. Ihre Kleidung besteht aus einem
Päsk aus Renntier- oder Seehundsfell, der auf dem bloßen
Körper getragen wird, und über den man bei Regen oder
Schnee noch einen Rock von Gedärmen oder Baumwollenzeug zieht.
Unter dem Päsk, der bis an die Kniee reicht, werden zwei Paar
Hosen aus demselben Stoff getragen, das innere mit den Haaren nach
innen, das äußere mit den Haaren nach außen. Die
Füße stecken in Strümpfen aus Seehundshaut oder in
Mokassins mit Sohlen aus Walroß- oder Bärenfell; der
Kopf ist mit einer Haube geschützt, über welche bei
strenger Kälte noch eine andre gezogen wird. Ihre Nahrung
bilden Fisch, Fleisch und Gemüse, soweit sie deren habhaft
werden können. Außer Fischfang und Renntierzucht treiben
sie Jagd auf Walrosse und Robbenarten. Die Walroßzähne
sind ein Haupthandelsartikel im Verkehr mit den Amerikanern, von
welchen sie Tabak, Branntwein, Pulver, Blei, Flinten etc. erhalten.
Zu den Russen haben sie äußerst geringe Beziehungen;
einen Jasak (s. d.) entrichten nur die T., welche nach
Nishne-Kolymsk zum Jahrmarkt fahren. Von irgend einer
gesellschaftlichen Ordnung gibt es keine Spur; anerkannte
Häuptlinge oder dem Ähnliches kennen sie nicht. Sie sind
Heiden und haben nicht die geringste Vorstellung von einem
höhern Wesen. Die religiösen Begriffe, die sich an
vorhandene Schnitzereien (Menschenbilder) knüpfen, sind
äußerst unbestimmt und scheinen weniger ein im Volk
fortlebendes Bewußtsein als eine Erinnerung von
892
Tschuma - Tsuga.
ehemals. Die wenig entwickelte Sprache der T. zeigt mit keiner
andern bekannten Sprache als mit den Sprachen der benachbarten
Korjaken und Kamtschadalen Verwandtschaft. Den Zahlwörtern
liegt das Vigesimal- (Zwanziger-) System zu Grunde. Vgl. die
Schilderungen von Nordquist in Nordenskjölds Reisewerk und in
Krause ("Die Tlinkitindianer", Jena 1885); Radloff, über die
Sprache der T. (in den "Mémoires" der Petersburger Akademie,
1860).
Tschuma, s. Chinagras.
Tschumak (russ.), der kleinruss. Ochsenfuhrmann;
insbesondere Bezeichnung der Fuhrleute aus der Ukraine und
Podolien, die, zu großen Gesellschaften vereinigt,
alljährlich im Frühjahr unter einem eignen Anführer
nach dem Schwarzen Meer zogen, um dort Salz und getrocknete Fische
zu laden, womit sie dann das innere Rußland versorgten. In
der Volkspoesie spielen die Tschumakenlieder eine besondere
Rolle.
Tschungking, Stadt in der chines. Provinz Setschuan, an
der Mündung des Kialing in den Jantsekiang, eine bedeutende
Handels- und Fabrikstadt für Seide und Zucker, mit 120,000
Einw. Seit Abschluß des Vertrags von Tschifu (1876) ist T.
den Engländern eröffnet worden, doch beschränkte
sich die englische Regierung bis jetzt auf die Unterhaltung eines
Konsularbeamten.
Tschupria (Cuprije), Kreishauptstadt im Königreich
Serbien, rechts an der Morawa, mit (1884) 3408 Einw. Eine hier
stationierte Pontonierkompanie überwacht die
Schiffbrücken über die Morawa. Zur Zeit der
Römerherrschaft stand hier Horreum Margi, von dem noch
Überreste einer steinernen Brücke vorhanden sind. Der
Kreis umfaßt 1635 qkm (27,9 QM.) mit (1887) 74,094 Einw. In
demselben, beim Dorf Senje, 8 km südöstlich von T.,
befindet sich ein großes Steinkohlenlager.
Tschusan, Insel, s. Tschouschan.
Tschussowaja (bei den Wogulen Suscha), Fluß im
russ. Gouvernement Perm, entspringt am westlichen Abhang des Urals,
fließt nordwestlich und westlich und mündet nach einem
500 km langen Lauf oberhalb Perm in die Kama. Die T. hat einen
ungewöhnlich raschen Lauf und große Steinmassen in ihrem
Bett, wodurch der Transport der Uralprodukte, mit Ausnahme des
Holzes, auf ihr erschwert wird.
Tschuwanzen, Volksstamm in Sibirien, eine Unterabteilung
der Jukagiren (s. d.).
Tschuwaschen, ursprünglich ein finnisches, jetzt
tatarisiertes Volk, das in seiner Lebensweise sehr den
Tscheremissen gleicht, aber eine zum türkisch-tatarischen
Zweig des uralaltaischen Sprachstammes gehörende Sprache
spricht. Sie leben in einer Zahl von 570,000 Köpfen am rechten
Wolgaufer und der Sura in den Gouvernements Simbirsk, Samara, Ufa.
Sie gelten als phlegmatisch, fleißig, sittenrein, gutartig,
sehr reinlich. Die Frauen sind bei ihnen gleichberechtigt. Viele T.
sind noch Heiden, die Mehrzahl hat das Christentum angenommen; doch
steht auch bei den Christen der Jomsa oder heidnische
Zauberpriester in hohem Ansehen. Sie sind Ackerbauer, Vieh- und
Bienenzüchter, Fischer und Jäger.
Tseng, Y-Yong, Marquis von, chines. Diplomat, geb. 1839
in der Provinz Honan, stammte aus einer der ältesten Familien
Chinas; sein Vorfahr Tseng-Tzü war einer der vier Schüler
des Konfucius und Verfasser des klassischen Buches "Taheo". Er
begleitete seinen Vater Tseng-Kuo-Fan im Kriege gegen die Taiping
und erwarb sich durch Klugheit und Umsicht große Verdienste,
ward aber durch die Trauer um seine Eltern lange Zeit von weiterer
öffentlicher Thätigkeit fern gehalten. Erst als 1879
Tschunghan in Livadia den Vertrag mit Rußland über
Kuldscha abschloß, welchen die chinesische Regierung nicht
anerkennen wollte, wurde T. zum Botschafter beim russischen Hof
ernannt mit dem Auftrag, eine Änderung des Vertrags zu
erwirken. Unterstützt von seinem geschickten Sekretär
Macartney, erlangte T. wirklich die Rückgabe der wichtigen
Provinz Ili von Rußland. Darauf zum chinesischen Botschafter
in London und Paris ernannt, führte er 1882-84 die
Verhandlangen mit der französischen Regierung über
Tongking. 1885 von Paris abberufen, blieb er Gesandter in London
und Petersburg bis 1886 und ist seitdem Mitglied des
Tsungli-Yamen.
Tsetsefliege (Glossina morsitans Westw., s. Tafel
"Zweiflügler"), Insekt aus der Ordnung der Zweiflügler
und der Familie der Fliegen (Muscariae), unsrer gemeinen
Stechfliege (Stomoxys calcitrans L.) verwandt, 11 mm lang, mit lang
gekämmter Borste an der Wurzel des langen, messerförmigen
Endgliedes der angedrückten Fühler, vier schwarzen
Längsstriemen auf dem grau bestäubten, kastanienbraunen
Rückenschild, zwei dunkeln Wurzelflecken und kräftigem
Borstenhaar auf dem schmutzig gelben Schildchen,
gelblichweißem Hinterleib mit dunkelbraunen Wurzelbinden auf
den vier letzten Ringen, welche nur je einen dreieckigen
Mittelfleck von der Grundfarbe freilassen, gelblichweißen
Beinen und angeräucherten Flügeln. Die T. findet sich im
heißen Afrika, wo ihre Verbreitung von noch nicht hinreichend
bekannten Verhältnissen, z. B. dem Vorkommen des Büffels,
des Elefanten, des Löwen, abhängig zu sein scheint. Sie
nährt sich vom Blute des Menschen und warmblütiger Tiere
und verfolgt ihre Opfer besonders an gewitterschwülen Tagen
mit der größten Hartnäckigkeit, sticht aber nur am
Tag. Dem Menschen und den Tieren des Waldes, Ziegen, Eseln und
säugenden Kälbern bringt der Biß keinen Schaden;
andre Haustiere aber erliegen dem Anfall selbst sehr weniger
Fliegen nach kürzerer oder längerer Zeit, meist kurz vor
Eintritt der Regenzeit, so sicher, daß die als "Fliegenland"
bekannten Gegenden ängstlich gemieden und mit Weidevieh
höchstens nachts durchzogen werden. An den gebissenen Tieren
verschwellen zuerst die Augen und die Zungendrüsen; nach dem
Tod zeigen sich besonders die Muskeln und das Blut, auch Leber und
Lunge krankhaft verändert, während Magen und Eingeweide
keine Spur von Störungen zeigen. Nach neuern Beobachtungen ist
zweifelhaft geworden, ob Glossina morsitans die berüchtigte T.
ist, ja ob die, wie es scheint, sehr übertriebeue Plage
überhaupt auf den Stich eines Insekts und nicht vielmehr auf
eine Infektionskrankheit zurückzuführen ist.
Tsién (Mas, Mehs), chines. Gewicht, = 3,757 g.
Tsinan, Hauptstadt der chines. Provinz Schantung, Sitz
einer katholischen Mission, mit angeblich 60,000 Einw.
Tsing (Taitsing), die seit 1644 in China regierende
Mandschudynastie; s. China, S. 17.
Tsjubo (Tsubu), Einheit des japan. Feldmaßes, = 36
QSchaku (Fuß) = 3,319 qm.
Tsuga Endl. (Hemlocktanne), Gattung der Familie der
Abietineen, Bäume mit in der Regel nach zwei Seiten
gestellten, flachen, am obern Ende fein gezähnelten, auf der
Unterfläche mit Ausnahme des Mittelnervs
bläulichweißen Blättern und kleinen,
gewöhnlich am Ende der Zweige stehenden, meist
überhängenden Zapfen, deren Fruchtteller sich nicht von
der Achse lösen. T. (Abies) canadensis Carr. (ka-
893
Tsun - Tuareg.
nadische Hemlocktanne, Schierlings-, Sprossentanne, s. Tafel
"Gerbmaterialien liefernde Pflanzen"), ein 19-25 m hoher Baum mit
wagerecht abstehenden untern Hauptästen,
pyramidenförmiger, später ausgebreiteter Krone, kurzen,
am obern Ende abgerundeten, in der ersten Jugend fein behaarten
Nadeln und 2 cm langen, eiförmig länglichen, oft mehrere
Jahre am Baum bleibenden Zapfen und geflügelten Samen,
wächst in ganz Nordamerika, besonders auf der Ostseite, von
Kanada bis Nordcarolina und westwärts bis ins Felsengebirge,
liefert Terpentin, Harz, Gerberrinde, und aus den jungen Sprossen
bereitet man Bier; bei uns wird er seit etwa 1730 vielfach als
Parkbaum angepflanzt. Die Rinde wird in der Gerberei benutzt. T.
Douglasii Carr. (Douglasfichte), ein schöner, 70 m hoher Baum
mit kurzen oder mäßig langen, am obern Ende stumpfen
Nadeln und aufrechten, 6-8 cm langen, länglichen, oben
abgerundeten, am Ende sehr kurzer Zweige stehenden Zapfen mit
über die Fruchtteller weit hervorragenden, an der Spitze
dreiteiligen Deckblättern, bildet im nordwestlichen
Nordamerika große Wälder und verdient als prachtvoller,
schnell wachsender, auch in Norddeutschland, wenn einmal gut
angewachsen, harter Baum größte Beachtung. Man
kultiviert ihn in Europa seit etwa 1830. Vgl. Booth, Die
Douglasfichte (Berl. 1877).
Tsun, chines. Längenmaß, s. Fen.
Tsungli-Yamên, in China das Ministerium des
Auswärtigen, 1860 errichtet, besteht meist aus
Präsidenten des exekutiven Departements unter dem Vorsitz
eines Prinzen erster Klasse.
Tsungming, Insel an der Ostküste von China, Provinz
Kiangsu, vor der Mündung des Jantsekiang in das Chinesische
Meer, mit einem Hafenplatz gleiches Namens.
Tu, große Oase in der östlichen Sahara, s.
Tibesti.
Tuam, Stadt in der irischen Grafschaft Galway, am Clare,
Sitz eines katholischen Erzbischofs und eines protestantischen
Bischofs, hat ein katholisches Seminar (St. Jarlath's), 2
Klöster, eine Lateinschule und (1881) 3567 Einw.
Tuamotuinseln (Paumotu- oder Niedrige Inseln),
großer Archipel des Stillen Ozeans, erstreckt sich
östlich von den Gesellschaftsinseln zwischen
14°5'-23°12' südl. Br. und 135°33'-148°45'
östl. L. v. Gr. (s. Karte "Ozeanien"). Es sind
durchgängig flache Korallen- und fast ohne Ausnahme
Laguneninseln, aber nach Größe und Beschaffenheit der
Riffe und Lagunen sehr verschieden. Der dürre und wasserarme
Korallenboden trägt eine einförmige und dürftige
Vegetation (Kokospalmen, Pandanus); nur in den westlichen Inseln
sind von Tahiti aus auch einige Kulturpflanzen (Brotfrucht,
Bananen, Arum, Ananas) eingeführt worden. Die Landtiere
(Ratten, einige Landvögel, sehr wenige Insekten) zeigen eine
gleiche Einförmigkeit; dagegen sind die Seetiere (Delphine,
Seevögel, Schildkröten, Fische, Mollusken, darunter
besonders Perlenmuscheln, Krustaceen etc.) ebenso häufig wie
verschiedenartig. Das Klima gilt für gesund und erfrischend;
der Wechsel der Jahreszeiten ist weniger regelmäßig als
in andern Archipelen. Der Passatwind (von SO. und NO.) ist der
vorherrschende Wind, wird aber nicht selten von Westwinden und
Windstillen unterbrochen; Regengüsse und Nebel sind nicht
ungewöhnlich. Man teilt den Archipel in fünf Gruppen:
eine zentrale Hauptgruppe, darunter Rangiroa (Rairoa), Fakarawa,
Anaa, Makemo und Hao; eine nördliche Seitengruppe, darunter
Oahe, Raroia, Ahangatu, Fakaina, Disappointmentinsel, Tatakotorou,
Pukaruha, Natupe; eine südliche Seitengruppe, darunter
Hereheretue, Duke of Gloucester-Insel, Tematangi (Bligh), Mururoa,
Actäon- (Amphitrite-) Gruppe, Marutea, die Mangarewagruppe und
die Pitcairngruppe, wozu noch die Osterinsel mit Sala y Gomez
kommt. Danach berechnet sich das Gesamtareal auf ca. 1100 qkm (20
QM.). Die Inseln stehen mit Ausnahme der Pitcairngruppe, der
Osterinsel und Sala y Gomez unter französischem Schutz, also
ein Gesamtareal von ca. 1000 qkm (18 QM.) mit (1885) 5500 Einw.,
davon 49 Europäer, von denen die meisten auf Anaa (s. d.) sich
befinden. Die Bewohner (s. Tafel "Ozeanische Völker", Fig. 28)
sind Polynesier und im ganzen den Tahitiern ähnlich. Sie
führen eine Art Wanderleben, indem sie in Familien oder
kleinen Stämmen von Insel zu Insel ziehen und sammeln, was
diese an Nahrungsmitteln bieten. Von Charakter zeichnen sie sich
durch Redlichkeit, Zuverlässigkeit und Keuschheit aus; dazu
sind sie ausdauernde und mutige, aber auch grausame Krieger. Von
Körper groß und stark gebaut, übertreffen sie die
Tahitier an Kraft und Gewandtheit, sind aber dabei viel dunkler,
überaus schmutzig und (namentlich die Frauen) oft von
auffallender Häßlichkeit. Früchte der Kokospalme
und Pandanus, Fische, Schildkröten, Krebse etc. sind ihre
Nahrung. Auf den östlichen Inseln finden sich auch noch
Anthropophagen. Ein schmaler, aus Matte geflochtener Gürtel
bildet fast ihre einzige Kleidung, die Tättowierung, roh
ausgeführt, ihren einzigen Schmuck. Die Bewohner der
westlichen Inseln stehen schon seit Ende des 18. Jahrh. unter der
politischen Herrschaft von Tahiti und sind von dort aus auch
für das (evangelische) Christentum gewonnen worden,
während sich in neuester Zeit katholische Missionäre
nicht ohne Erfolg mit der Bekehrung der Einwohner der
östlichen T. beschäftigt haben. Seit die Europäer
auf Tahiti Fuß gefaßt, sind die T. Schauplatz eines
nicht unbedeutenden Handelsverkehrs geworden, als dessen
Ausfuhrartikel besonders Trepang, Perlen (auch Perlmutter) und
Kokosöl sowie etwas Schildpatt zu nennen sind, während
Zeuge, eiserne Geräte, Mehl, Tabak etc. eingeführt
werden. - Einzelne Inselgruppen fanden schon Quiros, Le Maire und
Schouten. Genaueres erfuhr man erst seit 1767. Krusenstern gab
ihnen den Namen Niedrige Inseln, Bougainville nannte sie wegen
ihrer für die Schiffahrt schwierigen und gefährlichen
Natur Gefährliche Inseln, auch Perleninseln sind sie von
Händlern genannt worden. Schouten nannte diese Meeresgegend
die Böse See, Roggeveen das Labyrinth.
Tuareg (Tuarik, Singul. Targi), arab. Name des zu den
Berbern gehörigen Volkes der mittlern Sahara, das sich selbst
Imoscharh (Imuharh, Imazirhen) nennt, im N. bis an den Atlas, im S.
bis über den Niger, im W. bis zu den maurischen Stämmen
und im O. bis zu den Tibbu seine Wohnsitze ausgebreitet hat. Die T.
zerfallen in zwei Abteilungen, in die sogen. freien (Ihaggaren) und
in die unterworfenen Stämme (Imrhad), und in mehrere, meist
einander feindliche Stämme: die Asgar und Hogar im N., die
Kelowi, Itissa, Sakomaren weiter südlich, die Auelimiden am
Niger u. a. Sie sind ein schöner, bräunlicher
Menschenschlag mit echt kaukasischen Gesichtszügen, wo er sich
von Negerbeimischung frei erhalten hat. Als Nomaden durchstreifen
sie, raubend und Viehzucht treibend, die Wüste; wichtig sind
sie als Vermittler des Karawanenverkehrs zwischen dem Nordrand
Afrikas und dem Sudan, ausgezeichnet in der Tracht vor den
übrigen Völkern
894
Tua res agitur - Tuberkulose.
Afrikas durch ein Mundtuch (Litham). Sie werden als treulos und
unzuverlässig geschildert; Alexine Tinne, E. v. Bary u. a.
fielen ihrer Mordlust zum Opfer. Alle sind fanatische Mohammedaner.
Ihre Zahl dürfte 300,000 nicht übersteigen. Ihre Sprache,
Ta-Maschek oder Ta-Maschirht, ist als Abkömmling der
altlibyschen zu betrachten. Vgl. Duveyrier, Les Touaregs du Nord
(Par. 1864); Rohlfs, Quer durch Afrika, Bd. 1 (Leipz. 1874);
Nachtigal, Sahara und Sudân, Bd. I (Berl. 1879); Bissuel, Les
Touareg de l'ouest (Par. 1889).
Tua res agitur (paries cum proximus ardet, lat.), "es
handelt sich um deine Habe (wenn das Haus des Nachbars brennt)",
Citat aus Horaz ("Epist.", I, 18, 84).
Tuât, Oasengruppe in der Sahara, bestehend aus den
Oasen Tidikelt, T., Gurara u. a., im SO. von Marokko gelegen und zu
diesem in einem losen politischen Verhältnis stehend. Es ist
ein im allgemeinen flaches Land, bewässert vom Wadi Saura
(Msand) und einigen aus dem algerischen Tell kommenden Wadis,
welche T. indessen nur unterirdisch erreichen. Unter den Produkten
stehen die Datteln obenan; von Getreide baut man Gerste, Weizen und
Bischna, jedoch reicht das Korn zur Ernährung der Bewohner
nicht aus. Schlecht gedeihen Wein und Granatäpfel, an
Gemüse fehlt es nicht. Baumwolle wird kultiviert, Henna und
Senna wachsen wild. Opium wird in den nördlichen, Tabak in den
südlichen Oasen gewonnen. Als Haustiere hält man Kamele,
Esel, wenige Pferde, Schafe und Ziegen. Die Hühner haben die
Größe von Küchelchen. Die Bewohner, ca. 300,000 an
der Zahl, sind teils Araber, teils Berber (Schellah), beide stark
mit Negern gemischt. Gastfreundschaft, Rechtlichkeit, Treue werden
ihnen nachgerühmt; als fanatische Mohammedaner verweigern sie
Christen den Eintritt in ihr Land, das 1864 von Rohlfs unter der
Maske eines Mohammedaners erforscht und im J. 1874 von dem
Franzosen Soleillet besucht wurde. Von Tasilet werden Thee und
Kattun, aus dem Sudan Goldstaub, Elfenbein und Sklaven
eingeführt. Hauptort ist Inçalah oder Ain Salah in der
Oase Tidikelt. Vgl. Rohlfs, Reise durch Marokko (Bremen 1869);
Derselbe, Mein erster Aufenthalt in Marokko (das. 1873); Soleillet,
Exploration du Sahara (Algier 1874).
Tuba (lat., "Röhre"), die Kriegstrompete der
Römer, ward zum Signalgeben, beim Zusammenrufen von
Versammlungen, dann bei Opfern, Spielen und selbst bei
Leichenbegängnissen gebraucht. Die T. unsrer Orchester
(Baßtuba in F) ist ein 1835 von Moritz und Wieprecht
konstruiertes Blechblasinstrument von weiter Mensur und das tiefste
Kontrabaßinstrument, das bis zum Doppelkontra-A und
chromatisch hinauf bis zum eingestrichenen as reicht. Sie hat
fünf Ventile; ihr Klang ist voller, edler als der des
Bombardons, doch ist sie nur zu brauchen, wenn andre (höhere)
Blechinstrumente mitwirken, weil sie sonst mit ihrem dicken Ton
unangenehm auffällt. In Frankreich behandelt man die
Baßtuba als transponierendes Instrument und baut sie auch in
Es und D. Die eine Oktave höher stehende Tenortuba ist nach
denselben Prinzipien konstruiert. - T. stentorea. das Sprachrohr,
auch: erhabener Stil.
[Antike Tuba (Kriegstrompete).]
Tuba Eustach.i.i, Eustachische Röhre, Ohrtrompete
(s. Ohr, S. 349). T. Fallopii, Eileiter, Muttertrompete.
Tubai (Motu-iti), die nördlichste Laguneninsel der
Gesellschaftsinseln im südöstlichen Polynesien, 12 qkm
groß mit 200 Einw. Die Insel wird wegen des
Schildkrötenfanges und der roten Federn des Tropikvogels
besucht.
Tubalkain, Sohn Lamechs, nach 1. Mos. 4, 22 Erfinder der
Erz- und Eisenarbeit (daher der Vulkan der Hebräer, Stammvater
der Schmiede und Handwerker).
Tubangummi, s. v. w. Guttapercha.
Tuben, s. Tubus.
Tuber (lat.), Höcker, z. B. T. frontale,
Stirnhöcker. In der Botanik s. v. w. Knolle, z. B. T. Mich.,
Pilzgattung, s. Trüffel; T. Aconiti, Akonitknolle; T. (Radix)
Jalappae, Jalappenknolle; T. (Radix) Salep, Salepknolle.
Tuberaceen (Trüffelpilze), eine Familieder Pilze,
aus der Ordnung der Askomyceten; s. Pilze (13), S. 72.
Tuberaster, s. Polyporus.
Tuberkel (lat.), ursprünglich kleiner Höcker
oder kleines Knötchen, gegenwärtig Name für eine
ganz bestimmte Gewebsneubildung, welche in der Form von
hirsekorngroßen (miliaren), selten größern Knoten
in den verschiedensten Organen und Geweben auftritt und aus einer
Anhäufung kleiner Rundzellen ohne Gefäße besteht;
s. Tuberkulose.
Tuberkulose (Tuberkulosis), eine Krankheit, bei welcher
in den Organen des Körpers kleine, von der Größe
des eben Sichtbaren zu Hirsekorngröße wechselnde, graue
Knötchen entstehen, welche in ihrer Mitte käsig zerfallen
und erweichen. Wenn diese Knötchen in der Haut oder in der
Oberfläche von Schleimhäuten liegen, so entstehen durch
ihren Zerfall anfangs kleine, linsenförmige
(lentikuläre), später durch Hinzukommen immer neuer
Knötchen in der Nachbarschaft große, tuberkulöse
Geschwüre, durch welche schließlich ein Schwund der
Schleimhäute, z. B. des Kehlkopfes, der Luftröhre, des
Darms, der Gebärmutter, der Harnblase, des Nierenbeckens,
bedingt werden kann, welcher insgemein als tuberkulöse
Entzündung dieser Organe oder als Schwindsucht derselben
bezeichnet wird. Auch in den Gehirnhäuten kommen solche
Knötchen vor, doch führen sie hier wie in dem Gehirn
selbst nicht zur Geschwürsbildung, es kommt dagegen oft zu
einer eiterigen Gehirnhautentzündung oder zur Bildung
größerer Geschwulstknoten. In der Leber kommen entweder
sehr kleine, kaum ohne Mikroskop wahrnehmbare, oder
größere Knoten vor, welche nicht zerfallen. Ein sehr
mannigfaltiges Bild bieten die Lungenschwindsucht (s. d.) sowie die
T. der Lymphdrüsen, welche durch käsigen Zerfall des
Drüsengewebes ausgezeichnet sind, und die durch T. bedingten
Gelenkentzündungen (Tumor albus, s. Gelenkentzündung, S.
58). Die T. wurde zwar schon lange für eine übertragbare
Krankheit gehalten, doch ist es erst Koch 1882 gelungen, die
eigentliche Ursache in einem Bacillus von außerordentlicher
Kleinheit zu entdecken. Dieser Tuberkelbacillus (s. Tafel
"Bakterien", Fig. 4) siedelt sich in den Geweben an, ruft durch
seine Wucherung jene knotenförmigen und flächenhaft
ausgebreiteten Entzündungen hervor, welche unter Einwirkung
eigenartiger chemischer Spaltungsprodukte der Bacillen
verkäsen, und bringt durch ihren Verfall allmählich ganze
Organe zum Schwund. Am Krankenbett stellen sich die Erscheinungen
der T. natürlich in höchst mannigfacher Form dar, je nach
dem Organ, welches Sitz der T. geworden ist. Am häufigsten ist
Hauptsitz der T. der Atmungsapparat, besonders die
895
Tuberogemma - Tübingen.
Lungen; bei Kindern nicht selten der Darm, die Gelenke, Knochen
und Hirnhäute, während vielleicht in den Lungen wenig
oder gar keine Veränderungen vorhanden sind; zuweilen ist der
Harn- u. Geschlechtsapparat zuerst befallen, selten die
äußere Haut, die Zunge, der Magen. Die T. befällt
vorwiegend Kinder und schwächliche, schlecht genährte
jüngere Personen; die Anlage zur Erkrankung ist häufig
ererbt (s. Skrofeln), indessen kommt T. auch bis ins höchste
Alter vor und ist unzweifelhaft diejenige Krankheit, welche bei uns
die meisten Opfer fordert, da etwa ein Siebentel aller Menschen an
T. zu Grunde geht. Der Verlauf der T. kann sich über Jahre und
Jahrzehnte erstrecken, sofern die T. auf einen Teil der Lungen oder
eines andern Organs beschränkt bleibt. Sehr gewöhnlich
aber werden die Bacillen im Lymphstrom fortgespült, die
benachbarten Lymphdrüsen werden ergriffen, die Bacillen gehen
ins Blut über, und es erfolgt Verbreitung der T. auf alle
Organe. Wenn der übertritt großer Massen von Bacillen
ins Blut auf einmal erfolgt, etwa durch Durchbruch käsiger
Herde direkt in ein Blutgefäß, so verläuft die T.
unter dem Bild einer fieberhaften, typhösen Erkrankung in
wenigen Wochen tödlich (akute Miliartuberkulose). Die
Behandlung der T. erfordert, wenn der erkrankte Teil chirurgischen
Eingriffen zugänglich ist, Entfernung der von Tuberkeln
durchsetzten Gewebe, wodurch bei Gelenkentzündungen,
Lymphdrüsengeschwülsten, Hoden-, Brustdrüsen- und
Hauttuberkulose zuweilen völlige Heilung erzielt wird. Bei
Erkrankung innerer Organe ist außer der lokalen Behandlung
eine sehr wesentliche Rücksicht auf Hebung des
Allgemeinbefindens, gute Ernährung, frische Luft etc. zu
nehmen, um den Körper nach Möglichkeit gegen das
Vordringen der Bacillen widerstandsfähig zu machen.
Unzweifelhaft können selbst weiter vorgeschrittene
Zerstörungsprozesse in Lungen und Darm zum völligen
Stillstand, d. h. zu relativer Heilung, kommen. Vgl. Villemin,
Études sur la tuberculose (Par. 1868); Hérard u.
Cornil, La phthisie pulmonaire (das. 1867); Waldenburg, T.,
Lungenschwindsucht und Skrofulose (Berl. 1869); Langhans,
Übertragbarkeit der T. (Marb. 1867); Virchow, Die krankhaften
Geschwülste (Berl. 1863 bis 1867, 3 Bde.); Buhl,
Lungenentzündung, T., Schwindsucht (2. Aufl., Münch.
1874); Schüppel, Untersuchungen über
Lymphdrüsentuberkulose (Tübing. 1871); Predöhl,
Geschichte der T. (Hamb. 1888); Cohnheim, Die T. vom Standpunkt der
Infektionslehre (2. Aufl., Leipz. 1881); Koch, Berichte aus dem
kaiserlichen Gesundheitsamt. - Über T. des Rindes s.
Perlsucht.
Tuberogemma, s. Knospenknöllchen.
Tuberose, Pflanzengattung, s. Polianthes.
Tübet, Land, s. Tibet.
Tubifloren, Ordnung im natürlichen Pflanzensystem
aus der Abteilung der Dikotyledonen, charakterisiert durch
regelmäßige, mit Kelch- und verwachsenen
Blumenblättern versehene, fünfzählige Blüten,
fünf mit der Blumenkrone verwachsene Staubblätter und 2-5
verwachsene Fruchtblätter, umfaßt nach Eichler die
Familien der Konvolvulaceen, Polemoniaceen, Hydrophyllaceen,
Borragineen und Solanaceen.
Tübingen, Oberamtsstadt im württemb.
Schwarzwaldkreis, am Neckar, Knotenpunkt der Linien
Plochingen-Villingen und T.-Sigmaringen der Württembergischen
Staatsbahn, in schöner Lage auf einem Bergrücken zwischen
dem Neckar und der Ammer, 340 m ü. M., ist
unregelmäßig gebaut und hat freundliche Vorstädte.
Hervorragende Gebäude sind: das 1535 vollendete Schloß
Hohentübingen mit schönem Portal, das 1845 vollendete
Universitätsgebände, das Rathaus mit schöner
Freskomalerei u. die 1469-1483 erbaute gotische Stiftskirche mit
den Grabmälern von zwölf meist württembergischen
Fürsten, welche hier residierten. Die Bevölkerung
zählte 1885 mit der Garnison (ein Füsilierbat. Nr. 127)
12,551 Seelen, darunter 1749 Katholiken und 106 Juden. T. hat
Fabrikation von chemischen Artikeln, Handschuhen, Essig,
physikalischen und chirurgischen Instrumenten etc., eine bedeutende
Dampfziegelei, Kunstmühlen, Färberei, Buchdruckerei,
Buchhandel, Obst-, Hopfen- und Weinbau, besuchte Fruchtmärkte
etc. Außer den Verwaltungsbehörden befindet sich dort
ein Landgericht. Unter den Schulen steht die Universität
(Eberhard Karls-Universität) obenan. Sie wurde 1477 gestiftet
und mit derselben 1817 die katholisch-theologische Studienanstalt
zu Ellwangen als katholisch-theologische Fakultät vereinigt;
außer dieser kamen zu den vier alten Fakultäten 1818
noch eine staatswirtschaftliche und naturwissenschaftliche. Die
Gesamtzahl der Dozenten betrug 1888/89: 95, die der Studierenden
1228. Mit der Universität in Verbindung stehen: die
Universitätsbibliothek von 300,000 Bänden, ein
physiologisches und ein anatomisches Institut, ein botanischer
Garten, 2 chemische Laboratorien, verschiedene Kliniken und
wissenschaftliche Sammlungen, ein bedeutendes Münz- und
Medaillenkabinett, eine große geognostische Sammlung, eine
Sternwarte (im Schloß) etc. Außerdem besitzt T. ein
höheres evangelisch-theologisches Seminar (das sogen. Stift,
1537 gegründet, im ehemaligen Augustinerkloster) und ein
katholisches Konvikt (Wilhelmsstift, in der ehemaligen
Ritterakademie), ein Gymnasium und eine Oberrealschule. Zum
Landgerichtsbezirk T. gehören die 9 Amtsgerichte zu
Herrenberg, Kalw, Nagold, Neuenbürg, Nürtingen,
Reutlingen, Rottenburg, T. und Urach. Am Fuß des
Österbergs die schöne Besitzung des Dichters Uhland, der
hier seinen Wohnsitz hatte, und dem 1873 in T. ein von Kietz
modelliertes Denkmal gesetzt wurde. - T. wird zuerst 1078
erwähnt und war frühzeitig der Sitz von Grafen, die 1148
die Pfalzgrafschaft in Schwaben erwarben, doch erscheint es erst
1231 als Stadt. Die Pfalzgrafen von T. teilten sich im 13. Jahrh.
in die Linien: Horb, Herrenberg, Asperg und Böblingen.
Pfalzgraf Gottfried von Böblingen, dessen Hause Burg und Stadt
T. 1294 zugefallen waren, verkaufte sie 1342 an Württemberg.
Sein Zweig erlosch als der letzte des pfalzgräflichen
Geschlechts 1631. Eberhard im Bart, Graf von Württemberg,
stiftete 1477 die Universität T., welche zu Ende des 15.
Jahrh. schon 230 Studierende zählte, und verlieh der Stadt
1493 ein neues Stadtrecht. Am 8. Juli 1514 wurde in T. der
berühmte Tübinger Vertrag zwischen dem Herzog Ulrich von
Württemberg und den Landständen abgeschlossen, die durch
Übernahme der Schulden des Herzogs ihn auf dem Thron erhielten
und zugleich das Land vor weiterm Druck bewahrten. 1519 ward die
Stadt von dem Schwäbischen Bund unter Herzog Wilhelm von
Bayern belagert und 25. April erobert. 1647 wurde sie von den
Franzosen besetzt, ebenso 1688, bei welcher Gelegenheit auch die
Mauern
[Wappen von Tüdingen.]
896
Tübinger Schule - Tuch.
geschleift wurden. Vgl. Eifert, Geschichte der Stadt T.
(Tübing. 1849); Klüpfel, Die Universität T. in ihrer
Vergangenheit und Gegenwart (das. 1877); "T. und seine Umgebung"
(2. Aufl., das. 1887, 2 Hefte).
Tübinger Schule, Bezeichnung für die von F.
Chr. Baur (s. d. 1) in Tübingen begründete und von seinen
Schülern (Zeller, Schwegler, K. R. Köstlin u. a.)
befolgte kritische Richtung. Vgl. die betreffenden Artikel.
Tubize (spr. tübihs'), Gemeinde in der belg. Provinz
Brabant, Arrondissement Nivelles, an der Senne, Knotenpunkt an der
Staatsbahnlinie Brüssel-Quiévrain, mit Eisen- und
Baumwollindustrie und (1888) 4386 Einw.
Tubu, Volksstamm, s. Tibbu.
Tubuaiinseln (Australinseln), Gruppe im Stillen Ozean,
südlich von den Gesellschaftsinseln und diesen in ihrer Natur
sehr ähnlich, besteht aus sieben Inseln: Tubuai, 103 qkm
groß mit (1885) 385 Einw., Vavitao oder Raiwawai, 660 qkm
groß mit 309 Einw., Rurutu (s. d.), Oparo (s. d.), Rimitara,
Morotiri (Baß) und dem unbewohnten Hull oder Narurota,
zusammen 286 qkm (5,2 QM.) mit 1350 Einw., welche ebenfalls den
Bewohnern der Gesellschaftsinseln gleichen, seit 1822 durch
englische Missionäre zum Protestantismus bekehrt sind und in
den westlichen Inseln einen tahitischen, in Oparo (Rapa) aber einen
rarotongischen Dialekt sprechen. Die Insel Tubuai wurde 1777,
Rurutu 1769 von Cook entdeckt. Politisch hingen die T. schon
früh von den Gesellschaftsinseln ab, daher dehnten die
Franzosen ihr Protektorat zuerst über Tubuai, Vavitao und
Oparo, 1889 auch über Rurutu und Rimitara aus, so daß
die ganze Gruppe dem französischen Einfluß
untersteht.
Tubulus (lat., "Röhrchen", Tubulatur), die mit
Stöpseln verschließbaren kurzen Hälse auf den
Kugeln der Retorten oder Kolben.
Tubus (lat.), Rohr, Röhre, besonders s. v. w.
Fernrohr; Tuben, röhrenförmige Behälter für
Ölfarben etc.; Orgeltuben, s. v. w. Orgelpfeifen.
Tucacas, Hafenstadt in der Sektion Yaracuy des Staats
Lara der Republik Venezuela, an der Mündung des Aroa. Eine
Eisenbahn verbindet sie mit den reichen Kupferminen von Bolivar, am
obern Aroa, die 1880-83: 75,200 Ton. Erz und Regulus im Wert von
16,137,951 Frank erzeugten.
Tuch, aus Streichwollgarn hergestellter, meist
leinwandartig gewebter Stoff, welcher durch Walken verfilzt und
durch Rauhen mit einer Decke feiner Härchen versehen wird, die
gewöhnlich durch Scheren gleich gemacht sind und daher eine
glatte, feine Oberfläche bilden. Der Tuchmacherstuhl
unterscheidet sich von den Webstühlen zu andern glatten
Stoffen hauptsächlich nur durch seine große Breite, weil
das T. wegen seines beträchtlichen Eingehens in der Walke viel
breiter gewebt werden muß, als es im fertigen Zustand
erscheint. Ein T., das nach der Appretur 8/4 breit sein soll,
muß auf dem Stuhl 14/4-17/4 Breite haben. Aus dem rohen
Gewebe (Loden) werden durch das Noppen Holzsplitterchen, Knoten
etc. entfernt. Dies geschieht mit Hilfe von kleinen Zangen durch
Handarbeit oder mit der Noppmaschine. Nach dem Noppen folgt das
Waschen in besondern Waschmaschinen, wodurch Fett, Leim und Schmutz
aus dem Loden entfernt werden. Dann wird das Gewebe zum zweitenmal
genoppt und unter Zusatz von Seife, gefaultem Urin oder Walkererde
gewalkt. Hierdurch verfilzen sich die feinen aus dem Garn
hervorstehenden Fäserchen und bis zu einem gewissen Grade die
Garnfäden selbst, so daß man aus gut gewalktem T. keinen
Faden von einiger Länge unversehrt ausziehen kann. Das
gewalkte Gewebe wird wieder gewaschen und auf dem Trockenrahmen
unter einer gewissen Spannung getrocknet. Die Appretur (s.
Appretur) des Tuches beginnt nun damit, daß die Härchen,
welche aus der Filzdecke ohne alle Regelmäßigkeit
hervorragen, mehr und gleichmäßiger herausgezogen und
nach Einer Richtung niedergestrichen werden (das Rauhen). Hierzu
dienen die voll kleiner Widerhaken sitzenden Fruchtköpfchen
der Kardendistel (Dipsacus fullonum), mit welchen das nasse T.
bearbeitet wird. Die Handrauherei ist gegenwärtig durch die
Maschinenrauherei fast vollständig verdrängt worden; aber
es ist noch nicht gelungen, für die teuern Weberkarden einen
genügenden Ersatz zu finden. Ungemein erleichtert wird das
Rauhen, wenn man auf das T., während die Karden darauf
einwirken, Wasserdampf strömen läßt. Die
herausgezogenen Härchen werden auf dem trocknen T. gegen den
Strich aufgebürstet und durch große Handscheren oder
durch scherenartige mechanische Vorrichtungen (Schermaschinen) zu
gleicher und geringer Länge abgeschnitten, damit sie zusammen
eine glatte, feine Oberfläche bilden (das Scheren). Das Ziel
des Rauhens und Scherens kann aber nur durch einen stufenweisen
Gang erreicht werden, weshalb beide Behandlungen je nach der
Feinheit des Tuchs ein- bis fünfmal abwechselnd hintereinander
vorgenommen werden. Die abgeschnittenen Härchen bilden die
Scherwolle. Nach dem Scheren wird das T. zum drittenmal genoppt,
dann dekatiert und gepreßt. Hinsichtlich des Färbens
unterscheidet man in der Wolle, im Loden oder im T. gefärbtes.
Ersteres ist aus gefärbter Streichwolle gefertigt, das
lodenfarbige ist vor dem Walken gefärbt und das tuchfarbige
nach dem Walken. Letzteres T. zeigt oft einen weißlichen
Anschnitt und verliert die Farbe beim Gebrauch. Feine hellfarbige
Tuche können aber in der erforderlichen Lebhaftigkeit nur im
Stück gefärbt werden. Weiße Tuche werden
geschwefelt und in Wasser mit abgezogenem Indigo gebläut, die
schlechtesten aber in einer Brühe von Wasser und
Schlämmkreide bearbeitet, so daß die nach dem Trocknen,
Klopfen und Bürsten zurückbleibenden Kreideteilchen den
gelblichen Stich der Wolle verdecken. Die schwarzen Tuche
prüft man auf ihre Farbe mit verdünnter Salzsäure
und unterscheidet Falschblau, das durch Behandeln mit der
Säure ganz rot wird, Halbechtblau, welches einen violetten
Schein bekommt, wenn der Grund mit Indigo angeblaut ist, und
Ganzechtblau, welches durch die Säure nicht verändert
wird, also mit reinem Indigo gefärbt worden ist. In der
Tuchfabrikation nehmen neben Preußen und Sachsen, welche
durch ihre ausgezeichneten Wollen begünstigt sind,
Österreich, Frankreich, England und Belgien den ersten Rang
ein. Von den preußischen Tuchen war vormals das Brandenburger
Kerntuch sehr beliebt, die rheinpreußischen Tuche gehen als
Niederländer. Holland liefert wenig, aber vortreffliches T.
Österreich fertigt alle Sorten Tuche, vorzüglich viel
farbige Tuche für den Orient. Die englische und belgische
Tuchfabrikation erstreckt sich vorzugsweise nur auf die mittlern
und ordinären Qualitäten. Vgl. Stommel, Das Ganze der
Weberei der T.- und Buckskinfabrikation (2. Aufl., Düsseld.
1882); Ölsner, Lehrbuch der T.- und Buckskinweberei (Altona
1881, 2 Bde.); Behnisch, Handbuch der Appretur (Grünb.
1879).
Tuch, Johann Christian Friedrich, Orientalist, geb. 17.
Dez. 1806 zu Quedlinburg, studierte in Halle, ward 1830
Privatdozent der Philosophie daselbst, 1841 Professor der Theologie
zu Leipzig, später noch Domherr und Kirchenrat; starb daselbst
12. April 1867.
897
Tuchel - Tudor.
Sein Hauptwerk ist der "Kommentar über die Genesis" (Halle
1838; 2. Aufl. von Arnold, das. 1871). Sonst sind zu erwähnen
seine Abhandlungen über Ninive (Leipz. 1845), Christi
Himmelfahrt (1857), Josephus (1859-60), Antonius Martyr (1864), zur
Lautlehre des Äthiopischen u. a.
Tuchel, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk
Marienwerder, unweit der Brahe und an der Linie Konitz-Laskowitz
der Preußischen Staatsbahn, hat eine evangelische und eine
kath. Kirche, ein altes Schloß, ein katholisches
Schullehrerseminar, ein Amtsgericht und (1885) 3061 meist kath.
Einwohner. Östlich von T. erstreckt sich im Gebiet des
Schwarzwassers und der Brahe die 112 km lange und 30-35 km breite,
meist mit Kiefernwald bedeckte Tuchelsche Heide.
Tüchersfeld, Dorf im bayr. Regierungsbezirk
Oberfranken, Bezirksamt Pegnitz, in dem engen, romantischen
Tüchersfelder Thal der Fränkischen Schweiz, an der
Püttlach, mit auf und unter den obeliskenartig aufsteigenden,
seltsam gebildeten Kalkfelsen erbauten Häusern und (1885) 199
kath. Einwohnern.
Tuchfarblg heißt im Stück nach dem Walken
gefärbtes Tuch.
Tuchleder, s. v. w. Ledertuch.
Tückebote, s. v. w. Irrlicht.
Tuckerman (spr. tockermän), Henry Theodore,
amerikan. Schriftsteller, geb. 20. April 1813 zu Boston, besuchte
1833 Frankreich und Italien, 1837 England, Malta, Sizilien etc. und
ließ sich 1845 in New York nieder, wo er 17. Dez. 1871 starb.
Seit W. Irving hat kaum ein Amerikaner im anmutigen und
gefälligen Genre der nationalen Schriftstellerei
Größeres geleistet und als Kunstkritiker die Pflege der
künstlerischen Interessen der Republik in höherm Grad
gefördert als T. Er debütierte als Autor mit dem mehrfach
aufgelegten "Italian sketch-book" (1835), dem nach seiner zweiten
Reise "Isabel, or Sicily" (1839) folgte. Als gewiegter Kritiker
that er sich dann hervor in den Werken: "Thoughts on the poets"
(1846; deutsch, Marb. 1857); "Artist life, or sketches of American
painters^ (1847); "Characteristics of literature" (1849-51, 2
Serien) und "The optimist", Essays (1850). Außerdem sind zu
erwähnen: das Reiseskizzenbuch "A month in England" (1853);
"The leaves from the diary of a dreamer" (1853); "A memorial of
Horatio Greenough" (1853); "Biographical essays" (1857) und das
treffliche "Book of the artists", Charakteristiken amerikanischer
Künstler (1867); endlich eine Biographie des Novellisten I. P.
Kennedy (1871). Auch Poetisches, z. B. das didaktische Gedicht "The
spirit of poetry" (1851) und "Poems" (1864), hat T.
veröffentlicht.
Tuckum, Kreisstadt in Kurland, westlich von Riga, mit
welchem es durch eine Eisenbahn verbunden ist, mit hebräischer
Kreisschule und (1885) 6678 Einw. Die vom Heermeister Gottfried von
Rogge im 14. Jahrh. erbaute Ordensburg gleiches Namens ist
längst in Trümmer gesunken. In der Nähe der Berg
Hüning (250 m).
Tucopiainseln, drei östlich von dem Santa
Cruz-Archipel gelegene kleine Inseln: Tucopia, Anuda oder Cherry
und Fataka oder Mitre, zusammen 66 qkm (1,2 QM.) mit 650
polynesischen Einwohnern. Auf den T. lebte Martin Bucher, ein
deutscher Matrose aus Stettin, 1813-26 mit einem indischen
Gefährten.
Tucson (spr. töcks'n), Hauptstadt des nordamerikan.
Territoriums Arizona, am Santa Cruz, einem Nebenfluß der
Gila, in ergiebigem Bergbaurevier, mit (1886) 9000 Einw.
Tucuman (von tucma, "Baumwollland"), Binnenprovinz der
Argentin. Republik, umfaßt 31,166 qkm (566 QM.) mit (1887)
210,000 Einw., ist einer der gesegnetsten Teile des Staats mit
lieblichem Klima, im W. von der malerischen Sierra de Aconquija
durchzogen, im O. aber fruchtbares, vom Rio Dolce bewässertes
Gelände, wo Mais, Weizen, Zuckerrohr, Reis, Tabak, Kaffee
gedeihen. Baumwolle wird jetzt nur wenig gebaut. Überhaupt
sind 66,370 Hektar der Kultur gewonnen. Bedeutend ist auch die
Viehzucht, und der nach einer ehemaligen Hacienda der Jesuiten
genannte Tasikäse erfreut sich eines guten Rufs. Bergbau wird
nicht getrieben, obgleich verschiedene Metalle vorkommen. - Die
Hauptstadt T. liegt am Sil (obern Rio Dolce), 6 km vom Fuß
des Gebirges, 450 m ü. M. und hat (1884) 26,300 Einw. Ihre
öffentlichen Gebäude sind meist in sonderbar barockem
Geschmack aufgeführt, dagegen sind viele der Privathäuser
recht hübsch und zeugen von Wohlstand. An der Plaza
Independenzia liegen die dorische Hauptkirche (1856 vollendet), das
Cabildo (Regierungsgebäude), ein Klub und ein
Franziskanerkloster, an der Plaza Urquiza die Gerichtshöfe und
das Gefängnis. Ferner hat T. eine höhere Schule, ein
Lehrerseminar, ein Theater, 2 Waisenhäuser, ein Hospital und
ein Versorgungshaus. Die Industrie ist vertreten durch 7
Sägemühlen, 8 Kornmühlen und 3 Brauereien, und in
der Umgegend liegen außer Orangewäldchen auch
große Zuckerplantagen und Brennereien. T. wurde 1564
gegründet. Am 24. Sept. 1812 siegte Belgrano in der
benachbarten Ebene über die Spanier, und 9. Juli 1816
erklärte der in T. eröffnete Kongreß die
Unabhängigkeit der La Plata-Staaten.
Tudela, Bezirksstadt in der span. Provinz Navarra, links
am Ebro (mit breiter Steinbrücke von 17 Bogen) und an den
Eisenbahnen Saragossa-Alsasua und T.-Bilbao in fruchtbarer Ebene
gelegen, mit sehenswerter romanischer Kathedrale, einem Instituto,
gutem Weinbau, Fabrikation von Tuch, Seiden- und Thonwaren,
lebhaftem Handel und (1878) 10,086 Einw. Südöstlich dabei
das große Schleusenwerk am Ebro (Bocal del Rey), wo der
Kaiserkanal von Aragonien beginnt. T. war von 1784 bis 1851
Bischofsitz. Die Stadt wurde 1141 von Alfons V. den Mauren
entrissen. Hier 23. Nov. 1808 Sieg der Franzosen unter Lannes
über die Spanier unter Palafox.
Tudor (spr. tjuhdor), engl. Dynastie, regierte von 1485
bis 1603, leitete ihren Ursprung von einem Walliser Edelmann, Owen
ap Mergent (Meridith) ap T. (Theodor), ab, welcher 1422 Katharina
von Frankreich, die Witwe Heinrichs V. von England, heiratete und
dadurch der Stiefvater Heinrichs VI. von England wurde. Sein Sohn
Edmund T., Graf von Richmond, vermählte sich 1455 mit
Margarete von Beaufort, welche durch ihren Vater von Johann von
Gent, dem Stammvater des Hauses Lancaster, abstammte, und der Sohn
dieser Ehe, Heinrich T., Graf von Richmond, bestieg, nachdem er bei
Bosworth 1485 dem König Richard III. aus dem Haus York Thron
und Leben geraubt, als Heinrich VII. den englischen Thron, indem er
zugleich durch seine Vermählung mit Elisabeth, der
ältesten Tochter Eduards IV. aus dem Haus York, die
Ansprüche der beiden Rosen in seiner Person vereinigte. Er
hinterließ drei Kinder: Margarete, zuerst mit Jakob IV. von
Schottland vermählt und durch ihn
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl., XV. Bd.
57
898
Tudorblatt - Tugendbund.
Mutter Jakobs V. und Großmutter der unglücklichen
Maria Stuart, nachher mit dem Grafen Douglas von Angus
vermählt und durch ihn Mutter Margaretes, der Gemahlin des
Grafen von Lennox, sowie Großmutter Heinrich Darnleys, des
Gemahls der Maria Stuart, so daß also der Sohn dieser
letztern, welcher als Jakob I. 1603 den englischen Thron bestieg,
väterlicher- wie mütterlicherseits der Urenkel
Margaretes, der Tochter Heinrichs VII., war; Heinrich, der seinem
Vater als Heinrich VIII. (1509) in der Regierung folgte, welche
nach seinem Tod (1547) nacheinander auf seine drei Kinder Eduard
VI. (1547-53), Maria (1553-58) und Elisabeth (1558-1603)
überging; Maria, zuerst mit dem König Ludwig XII. von
Frankreich und nach dessen Tod 1515 mit Charles Brandon, Herzog von
Suffolk, vermählt, durch welche Ehe sie Großmutter der
unglücklichen Johanna Gray wurde. Mit Eduard VI. starb der
letzte männliche T.; nach dem Tod seiner Schwester Elisabeth
1603 ging die Krone auf die Stuarts über.
Tudorblatt, ein der engl. Spätgotik
eigentümliches, epheuähnliches Blatt, das in Firsten oder
als Dachkamm oder als oberer Schmuck einer Krone häufig
vorkommt (s. Abbild.). Als einzelnes Vierblatt gestaltet,
heißt es auch Tudorblume.
[Tudorblatt.]
Tudorbogen, in der Baukunst ein gedrückter
Spitzbogen, meist in England angewandt, deshalb auch englischer
Spitzbogen genannt; s. Bogen, Fig. 9.
Tudorstil, in der engl. Baukunst die letzte Periode des
gotischen Stils (ca. 1380-1540), s. v. w. Perpendikularstil (s.
d.).
Tü-düc, Kaiser (Hoangti, d. h. Erdenwalter) von
Anam, geb. 1830, war der zweite Sohn des Kaisers Thinutri und
hieß eigentlich Hoang-Nham. Mit Übergehung seines
ältern Bruders, Hoang-Bao, ward er von seinem Vater zum
Nachfolger bestimmt und bestieg nach dessen Tod 1847 den Thron.
Anfangs Freund der Christen, begann er sie 1848 zu verfolgen, als
der französische Missionsbischof Lefèvre sich für
seinen enterbten und in strenger Kerkerhaft gehaltenen Bruder
erklärte. Lefèvre rief nun die Einmischung Frankreichs
an, das 1856 einen Gesandten an T. schickte. Als dieser die Annahme
eines Schreibens der französischen Regierung verweigerte, ja
sogar den Gesandten nicht landen ließ, bemächtigten sich
die Franzosen der Citadelle von Turan, räumten sie aber 1857
wieder. Da die Christenverfolgungen fortdauerten und ein spanischer
Missionsbischof, Diaz, hingerichtet wurde, nahm ein
französisch-spanisches Geschwader 1858 von neuem Turan und
dann 1859 Saigon, das T. 1862 an Frankreich abtreten mußte.
In einem spätern Vertrag vom 15. März 1874 ward er
genötigt, die französische Schutzherrschaft anzuerkennen
und den Franzosen die Häfen in Tongking zu öffnen. Als
ein neuer Streit mit Frankreich auszubrechen drohte, starb T. 20.
Juli 1883.
Tuff, in der Geologie oft gebraucht für lockere
Absätze aus Wasser (wie Kalktuff, Kieseltuff), besser aber zu
beschränken auf die Bezeichnung des erhärteten,
ursprünglich in Aschenform ausgestoßenen Materials
jetziger oder prähistorischer Vulkane (Diabastuff, Trachyttuff
etc.).
Tüffer, Marktflecken in Steiermark,
Bezirkshauptmannschaft Cilli, am linken Ufer des Sann und an der
Südbahn, hat ein Bezirksgericht, ein Schloß, Burgruinen
und (1880) 706 Einw. Am rechten Sannufer das Kaiser
Franz-Josephsbad, mit drei indifferenten Thermen (35-39° C.)
und Badehaus; unfern das Römerbad (slaw. Teplitz), in
herrlicher Lage an der Südbahn, mit gleichartigen Thermen, gut
eingerichteten Bädern, Kurhaus etc. In der Umgebung
bedeutender Braunkohlenbergbau (im Becken von T.-Hrastnigg-Trifail,
jährliche Ausbeute über 4 Mill. metr. Ztr.), Glas- und
Chemikalienfabrik. Vgl. Brum, Das Mineralbad T. (Wien 1875).
Tuffkalk (Tuffstein), s. v. w. Kalktuff.
Tuffstein, s. v. w. Tuffkalk oder Kalktuff (s. d.), auch
vulkanischer Tuff (s. Tuff).
Tuffwacke, s. v. w. Tuff.
Tugéla, Fluß in Südafrika, bildet die
Grenze zwischen Natal und dem Zululand, mündet in den
Indischen Ozean.
Tugend, der Etymologie nach s. v. w. Tauglichkeit,
Tüchtigkeit, dem jetzigen Sprachgebrauch nach insbesondere
diejenige Tüchtigkeit, Ordnung und Harmonie des geistigen
Lebens, welche auf der zur Gewohnheit gewordenen Betätigung
der sittlichen Freiheit und Thatkraft beruht. Der Begriff der T.
entspricht durchaus dem Begriff des Sittengesetzes und der
moralischen Pflicht. Da nun diese in einer Mehrheit von Normen
bestehen, insofern das Wollen und Handeln des Menschen auf
verschiedene Interessen gerichtet sein kann, so pflegt man zwischen
der "T. im allgemeinen" und einzelnen "Tugenden" zu unterscheiden.
Letztere lassen sich auf einige Hauptarten, die sogen.
Kardinaltugenden (s. d.), zurückführen. Der Begriff der
T. ist von den verschiedenen philosophischen Schulen immer nach dem
bestimmt worden, was ihnen als der Ausdruck des sittlichen Ideals
galt. Kant bestimmte die T. als moralische Stärke des Willens
des Menschen in Befolgung seiner Pflicht oder in der Unterordnung
der Neigungen und Begierden unter die Vernunft.
Tugendbund, der "sittlich-wissenschaftliche Verein",
welcher sich im Frühjahr 1808 zu Königsberg durch den
Zusammentritt einiger Männer (Mosqua, Lehmann, Velhagen, Both,
Bardeleben, Baczko und Krug) bildete, 30. Juni vom König
genehmigt wurde und sich zum Zweck setzte: die durch das
Unglück verzweifelten Gemüter wieder aufzurichten,
physisches und moralisches Elend zu lindern, für
volkstümliche Jugenderziehung zu sorgen, die Reorganisation
des Heers zu betreiben, Patriotismus und Anhänglichkeit an die
Dynastie allenthalben zu pflegen etc. Diesen offenen Bestrebungen
reihte sich die geheime Tendenz an, die Abschüttelung des
französischen Jochs anzubahnen. In Schlesien und in Pommern
fand die Idee Anklang, weniger in der Mark, am wenigsten in Berlin.
Übrigens wirkte manches zusammen, was einer größern
Ausbreitung des Vereins hinderlich ward. Viele ängstliche
Vorsteher von Zivil- und Militärbehörden verboten ihren
Untergebenen den Beitritt. Andern erschienen die Statuten zu weit
aussehend und unpraktisch; am meisten schadete dem Verein aber der
Umstand, daß Preußen sich nicht schon 1809 der Erhebung
Österreichs anschloß, und daß die Schillsche
Unternehmung, die mit Unrecht dem T. aufgebürdet wurde,
mißlang. Die Zahl der Teilnehmer belief sich auf 300-400.
Unter ihnen fanden sich Namen wie Boyen, Witzleben, Grolman,
899
Tugendrose - Tula.
v. Thile, v. Ribbentrop, Merkel, Ladenberg, Eichhorn, Manso u.
a., wogegen mehrere, welche man als Hauptträger der ganzen
Idee zu betrachten pflegt, wie Stein, Niebuhr, Gneisenau,
Scharnhorst, nie zum Verein gehört haben. Am 31. Dez. 1809
dekretierte der König auf Drängen Napoleons I. durch eine
Kabinettsorder die Auflösung des Vereins. Später wurde
der T. von der Reaktionspartei in Preußen wegen
Beförderung der Demagogie verdächtigt. Vgl. Voigt,
Geschichte des sogen. Tugendbundes (Berl. 1850); Baersch,
Beiträge zur Geschichte des Tugendbundes (Hamb. 1852);
Lehmann, Der T. (Berl. 1867).
Tugendrose, s. v. w. Goldene Rose.
Tuggurt, Hauptort der Oase Wad-Rir im algerischen
Departement Konstantine, in ungesunder, sumpfiger Lage, ist eine
der Hauptetappen der Wüste, hat große Haine von
Dattelpalmen (170,000), lebhaften Handel und 6000 Einw. (meist
Berber). T. ward 1854 von den Franzosen erobert.
Tugra (türk.), Handzeichen des Sultans auf
offiziellen Aktenstücken, Münzen, auch als Insignie auf
öffentlichen Gebäuden angebracht, besteht eigentlich aus
künstlich verschlungenen Linien in der Form einer offenen
Hand, von welcher drei Finger in die Höhe und je einer nach
rechts und links laufen, enthält jetzt aber meist in
verschlungenen Initialen die Namen des regierenden Fürsten und
seines Vaters.
Tugraorden, türk. Orden, nach Vertreibung der
Janitscharen von Sultan Mahmud II. bei Errichtung einer
disziplinierten Armee gestiftet, besteht in einem goldenen, von
Diamanten umgebenen Medaillon, in dessen Mitte die Tugra (s. d.)
sich befindet.
Tuilerien (franz. Tuilerien, spr. tuile-), ehemaliger
Palast in Paris, ward 1564 unter Katharina von Medici von Philibert
Delorme im Bau begonnen und in den folgenden Jahrhunderten
stückweise, nach oft veränderten Plänen, von
verschiedenen Architekten vollendet, war zeitweilig Residenz, so
Ludwigs XV. während seiner Minderjährigkeit und Ludwigs
XVI. von 1789 bis 1792, dann ständige Residenz Napoleons I.
und der folgenden Herrscher Frankreichs. Napoleon III. ließ
die T. mit dem Louvre (s. d.) in Verbindung bringen. Ende Mai 1871
wurden die T. von den Kommunarden in Brand gesteckt und lagen lange
in Ruinen. In neuester Zeit wurden der nördliche und
südliche Flügel wiederhergestellt, wogegen die Reste des
Haupttraktes 1883 gänzlich abgetragen wurden. Westlich von den
T. liegt der vielbesuchte Tuileriengarten. Vgl. auch Paris, S.
722.
Tuisco (Tuisto), der erdgeborne Gott, welchen die alten
Germanen nach Tacitus' Bericht ("Germania", Kap. 2) als den ersten
Urheber ihres Volkes besangen. In seinem Namen liegt der Begriff
des Zwiefachen, Zwiegeschlechtigen: er erscheint als eine
zwitterhafte Gottheit, welche noch die männliche (zeugende)
mit der weiblichen (empfangenden) Kraft in sich verbindet und so
aus sich selbst den Mannus (s. d.), das erste Wesen in
Menschengestalt, zeugt.
Tukan (Ramphastus L.), Gattung aus der Ordnung der
Klettervögel und der Famtlie der Pfefferfresser
(Ramphastidae), Vögel mit auffallend großem, am Grund
sehr dickem, gegen das Ende hin stark Zusammengedrücktem, auf
der Firste scharfkantigem Schnabel, dessen Wandungen sehr dünn
sind und ein schmales, großmaschiges Knochennetz
umschließen, so daß der Schnabel sehr leicht ist. Die
Zunge ist schmal, bandartig, hornig, am Rand gefasert; die
abgerundeten Flügel reichen nur bis zum Anfang des kurzen,
breiten, stumpf gerundeten Schwanzes. Die starken, langzehigen
Läufe sind vorn und hinten mit tafelförmigen
Gürtelschildern versehen. Das Gefieder zeigt auf meist
schwarzem Grund sehr lebhafte Farben; auch die Augen, Beine und der
Schnabel sind glänzend gefärbt. Die Tukane leben in den
südamerikanischen Urwäldern, nähren sich von
Früchten und Fruchtkernen, richten in den Bananen- und
Guavapflanzungen großen Schaden an, fressen auch Eier und
junge Vögel, sollen zwei Eier in hohle Bäume oder
Baumäste legen und werden ihres Fleisches und der Federn
halber in Menge gejagt. Der Pfefferfresser (Toko, Ramphastus Toco
L., s. Tafel "Klettervögel"), 58 cm lang, schwarz, an Kehle,
Vorderhals, Wangen und Oberschwanzdeckfedern weiß, am
Bürzel blutrot, mit orangerotem Schnabel, der an der Spitze
des Unterkiefers feuerrot, an der Spitze des Oberkiefers schwarz
ist, dreieckigem, gelbem Fleck vor dem Auge, blauem Augenring,
dunkelgrünem Auge und hellblauem Fuß, bewohnt die
höher gelegenen Teile Südamerikas von Guayana bis
Paraguay, be^ sonders bewaldete Flußufer und die offene
Savanne, welche er in kleinen Trupps durchschweift; er hält
sich gewöhnlich hoch oben in den Waldbäumen auf, ist
beweglich, scheu, neugierig und mordlustig. In der Gefangenschaft
erscheint er sehr anziehend. In Europa sieht man oft mehrere Arten
in den zoologischen Gärten. Man jagt die Tukane des Fleisches
und der schönen Federn halber. Die Eingebornen erlegen sie mit
ganz kleinen Pfeilen, welche mit äußerst schwachem Gift
bestrichen sind, so daß der Vogel nur betäubt wird und,
nachdem er seiner wertvollsten Federn beraubt ist, sich wieder
erholt und davonfliegt, um später vielleicht abermals
geschossen zu werden. Vgl. Gould, Monograph of the Ramphastidae (2.
Aufl., Lond. 1854-55, 3 Tle.).
Tula, Zentralgouvernement Großrußlands,
grenzt im N. an das Gouvernement Moskau, im O. an Rjäsan und
Tambow, im S. an Orel, im W. an Kaluga, umfaßt 30,959,2 qkm
(562,25 QM.). Das Land ist im allgemeinen eben und flach, mit nur
einigen Hügeln an den Ufern der Oka und Upa. Der Untergrund
ist devonischer Formation, an der Oka lehmiger, gelber und
grünlicher Mergel, gemischt mit unreinem, sandigem Kalkstein;
in den Flußthälern im südlichen Teil des
Gouvernements tritt Kalkstein der obern Schicht der devonischen
Formation zu Tage, und an der Upa und dem Osetr sind ergiebige
Steinbrüche. Der Boden ist von sehr geringer Fruchtbarkeit,
doch findet sich in mehreren Kreisen fruchtbare Schwarzerde
(Tschernosem). Das Areal setzt sich zusammen aus 73,4 Proz. Acker,
10,5 Wald, 10,7 Wiese und Weide, 2,4 Proz. Unland. Von Flüssen
sind erwähnenswert: die Oka (teilweise Grenzfluß gegen
W. und N.), der Osetr, die Plawa, die Upa und der Don. Das Klima
ist mild und gesund. Die Einwohnerzahl beläuft sich auf (1885)
1,409,432 (45 pro Quadratkilometer), die fast nur Großrussen
sind. Die Zahl der Eheschließungen war 1885: 11,043, der
Geburten 73,017, der Sterbefälle 56,589. Hauptprodukte sind:
Getreide, Runkelrüben, Tabak, Ölpflanzen, während
Flachs und Hanf minder gute Ernten geben. Die Ernte betrug 1887: 6
Mill. hl Roggen, 7-8 Mill. hl Hafer, 3,6 Mill. hl Kartoffeln, andre
Cerealien in bedeutend geringerer Menge. Die Viehzucht wird im
ganzen Gouvernement sehr schwach betrieben; seit neuester Zeit
findet die Bienenzucht starke Verbreitung. Der Viehstand bezifferte
sich 1883 auf 203,495 Stück Rindvieh, 380,622 Pferde, 780,935
grobwollige Schafe, 94,096 Schweine. Dagegen ist neben der
Landwirtschaft die Fabrikthätigkeit sehr entwickelt. Sie geht
(1884) in 558 gewerblichen Anstalten mit 11,790 Arbeitern vor sich
und bringt für
57*
900
Tula - Tulipa.
28½ Mill. Rubel Waren hervor. Bemerkenswerte
Industriezweige sind: Rübenzuckerfabrikation und Raffinerie
(2,3 Mill. Rub.), Kupferverarbeitung (1 1/2 Mill.),
Branntweinbrennerei (1,2 Mill. Rub.), Gewehr- und
Patronenfabrikation, Lederindustrie, Getreidemüllerei,
Schlosserindustrie, Stärkefabrikation, Verfertigung
musikalischer Instrumente (besonders Harmoniken), Ziegeleien.
Trotzdem suchen jährlich sehr viele Bauern in andern
Gouvernements Arbeit. Der Handel vertreibt Getreide,
Schweinsborsten, Runkelrüben, Eisen-, Stahl- und Bronzewaren
und hat seinen Hauptsitz in der Stadt T. und in Bjelew.
Bildungszwecken dienen (1885) 728 Elementarschulen mit 39,270
Schülern, 12 mittlere Lehranstalten mit 2572 Schülern und
5 Fachschulen mit 672 Lernenden (darunter ein geistliches Seminar,
eine Feldscher- und eine Hebammenschule). Im Tulaischen befinden
sich einige alte Erdwälle (Gorodischtschi) und Kurgane, Zeugen
der mit den Litauern und Tataren hier geführten Kämpfe.
T. zerfällt in zwölf Kreise: Alexin, Bjelew, Bogorodizk,
Epifan, Jefremow, Kaschira, Krapiwna, Nowosil, Odojew, Tschern, T.
und Wenew. Die gleichnamige Hauptstadt, an der Upa, Knotenpunkt der
Eisenbahnen Moskau-Kursk und Wjasma-Rjaschsk, eine der
gewerbthätigsten Städte des russischen Reichs, hat 28
Kirchen (darunter die Himmelfahrtskirche und die
Allerheiligenkirche), 2 Klöster, und unter den sonstigen
öffentlichen Bauten ragen hervor das Exerzierhaus und die
Gouvernementsgebäude. Die Zahl der Einwohner betrug 1885:
63,928. Die Bedeutung der Stadt beruht vornehmlich auf der
großen kaiserlichen Gewehrfabrik, die 1712 von Peter I.
gegründet wurde, jetzt über 7000 Arbeiter
beschäftigt und jährlich 70,000 Gewehre, eine große
Menge blanker Waffen sowie treffliche andre Stahl- und Eisenwaren
liefert. Die tulaischen Waren aus Stahl und Eisen (physikalische
und mathematische Instrumente, Messer, Scheren, Zangen etc.), aus
Weißkupfer und andern Kompositionen, vorzüglich dem
sogen. Tulametall (s. Niello), wie Theemaschinen, Dosen und
Galanteriewaren, sind berühmt. Ferner sind noch hervorzuheben
die großen Gerbereien, Talgschmelzereien, Fabrikation von
Seife, Kerzen, Siegellack etc. (im ganzen 133 Fabriken). T. ist
Bischofsitz, hat ein klassisches Gymnasium, eine Realschule, ein
Militärgymnasium, ein Mädchengymnasium, ein geistliches
Seminar und mehrere andre Lehranstalten, ein Armen-, Zucht-,
Arbeits- und Findelhaus, ein Arsenal, ein Museum einheimischer
Industrieprodukte, ein Theater. Die Stadt wird zuerst im 12. Jahrh.
erwähnt.
Tula, Stadt im mexikan. Staat Hidalgo, 2080 m ü. M.,
am Rio de T. und an der Eisenbahn nach Mexiko, angeblich die alte
Hauptstadt der Tolteken, mit Baumwollfabrik und (1880) 5834
Einw.
Tulacingo (spr. -ssingo), Stadt im mexikan. Staat
Hidalgo, 1820 m ü. M., in reizender Vega, hat eine Kathedrale,
ein bischöfliches Seminar, eine Baumwollfabrik und (1880) 9739
Einw. im Munizipium.
Tulametall, s. v. w. Niello.
Tularesee, See im S. des nordamerikan. Staats
Kalifornien, 1683 qkm groß, wird vom Kernfluß gespeist
und hat durch einen Sumpf periodischen Abfluß zum St.
Joaquinfluß.
Tulasne (spr. tülahn), Louis René, Botaniker,
geb. 12. Sept. 1815 zu Azay le Rideau (Indre-et-Loire), war
Aide-naturaliste am Museum der Naturgeschichte zu Paris, trat 1872
in den Ruhestand und starb 22. Dez. 1885 in Hyeres. Seine ersten
Arbeiten bezogen sich auf Systematik der Phanerogamen (Leguminosen,
Podostemaceen, Monimiaceen); dann veröffentlichte er mit
seinem Bruder Charles T. (geb. 5. Sept. 1816 zu Langeais im
Departement Indre-et-Loire) mykologische Arbeiten, durch welche die
Kenntnis mehrerer Familien der Pilze, besonders der kleinern
parasitischen Pilze, wesentlich vervollkommt, insbesondere die
Pleomorphie der Fruktifikationsorgane und der Generationswechsel
dieser Pilze, zumal der Pyrenomyceten und Diskomyceten,
nachgewiesen wurden. Außer zahlreichen Abhandlungen schrieb
er: "Fungi hypogaei" (Par. 1851) und "Selecta fungorum carpologia"
(das. 1861-65, 3 Bde.).
Tulbau (Tulbend), s. v. w. Turban.
Tulcan, Stadt im südamerikan. Staat Ecuador, 2077 m
ü. M., dicht bei der Grenze von Kolumbien, am Nordfuß
des 3405 m hohen Passes Paramo de Balicho, mit 4000 Einw.
Tulcea, Stadt, s. Tultscha.
Tulipa L. (Tulpe), Gattung aus der Familie der Liliaceen,
Zwiebelgewächse mit riemenförmigen oder
lineal-lanzettlichen, häufig blaugrünen Blättern,
einblütigem Stengel, sechsblätteriger, glockiger
Blütenhülle u. oblonger oder verkehrt-eiförmiger,
stumpf dreikantiger, vielsamiger Kapsel. Etwa 50 Arten, meist im
Orient. T. silvestris L. (wilde Tulpe), mit breit
lineal-lanzettlichen Blättern und gelben, äußerlich
grünen, wohlriechenden Blüten, wächst in Süd-
und Mitteleuropa und in Sibirien auf Waldwiesen und in Weinbergen.
T. suaveolens Roth, mit sehr kurzem Stengel und roten, am obern
Rand gelben, wohlriechenden Blüten, findet sich in
Südeuropa und wird in mehreren Varietäten, auch mit
gefüllten Blumen kultiviert; eine der beliebtesten Formen ist
Duc van Toll. Auch von T. praecox Tenor, bei Neapel, und T. turcica
W., in der Türkei, hat man Varietäten (von letzterer die
Monströsen oder Perroquetten mit zerschlitzten
Blumenblättern). Viel wichtiger aber ist T. Gesneriana L.
(Gartentulpe), mit 30-45 cm hohem Schaft, eirund-lanzettlichen
Blättern und ursprünglich karmesinroten, im Grund
gelblichen Blüten. Sie ist in Südosteuropa, bis zum Altai
und zur Dsungarei heimisch, kam durch Busbecq, den Gesandten
Ferdinands I. in Konstantinopel, wo sie damals schon von den
Türken kultiviert wurde, nach dem westlichen Europa,
blühte 1560 in Augsburg, wurde von Gesner zuerst gezogen und
beschrieben, kam 1573 an Clusius in Wien, 1577 nach England und
Belgien und ward schon 1629 in 140 Spielarten kultiviert. 1634-40
erreichte in Haarlem die Tulpenliebhaberei ihren Gipfel, und man
zahlte für eine einzige Zwiebel bis 13,000 holländ.
Gulden; es gab Sammlungen mit mehr als 500 klassifizierten
Varietäten. Gegenwärtig ist die Zahl der verbreitetern
Varietäten verhältnismäßig niedrig. Man
unterscheidet als Hauptvarietäten Früh- und
Spättulpen. Die frühen Tulpen, mit kürzerm Stengel,
blühen an einem warmen Standort schon im April oder noch
früher und lassen sich sehr gut treiben. Ihre Hauptfarben
sind: Weiß, Gelb, Rot und Purpurrot, einfarbig oder
schön geflammt. Die Spättulpen teilen die
holländischen Blumisten in einfarbige (Exspektanten oder
Muttertulpen, welche anfangs nur eine Farbe haben, nach 2-4 Jahren
aber nach und nach mehr Illuminationsfarben annehmen und aus den
Samen neue bunte Sorten liefern) und bunte und gestreifte Tulpen.
Nach der Beschaffenheit ihrer Zeichnung teilt man letztere in
Baquetten, Bybloemen und Bizarden. Die gefüllt blühenden
Varietäten werden von den Blumisten den einfachen nachgesetzt.
Die Monströsen (Perroquet- oder Papa-
901
Tüll - Tümpling.
geientulpen) haben sehr große, unförmliche Blumen von
schöner Farbe (gelb und rot), mit weit abstehenden, zerrissen
gefransten Kronblättern. Die Kultur stimmt im wesentlichen mit
der der Hyazinthen überein. Die zur Erlangung neuer Spielarten
aus Samen gezogenen Tulpen blühen meist erst im siebenten
Jahr.
Tüll, Gewebe, bei welchen feine, untereinander gut
gebundene Fäden regelmäßige Zellen bilden, indem je
zwei beisammenliegende Kettenfäden nach jedem Einschuß
sich kreuzend verschlingen. T. wird aus Gespinsten von
verschiedener Feinheit (bis zu Nr. 120) gewebt und kommt glatt und
einfach oder gestreift, gemustert, in Seide broschiert oder auch
auf weißem oder schwarzem Grund mit bunten Blumen gestickt
vor. Englischer T., s. v. w. Bobbinet.
Tullamóre, Hauptstadt der irischen King's County,
hat lebhaften Handel, Brennerei, Tabaksfabrikation und (1881) 5098
Einw. Dabei Tullabeg mit Jesuitenschule.
Tulle (spr. tüll), Hauptstadt des franz.
Departements Corrèze, früher Hauptstadt von
Niederlimousin, am Einfluß der Solane in die Corrèze
und an der Eisenbahn Clermont-Brive, hat meist alte Häuser und
abschüssige Straßen, aber schöne Promenaden, eine
Kathedrale aus dem 12. Jahrh., ein Kommunalcollège, ein
Priester- und ein Lehrerseminar, eine Gewerbeschule, eine
öffentliche Bibliothek und ein Theater. T. hat eine
große Waffenfabrik, dann Fabriken für Papier, Leder,
Woll- und Baumwollenzeuge, Eisenwaren, Schokolade etc.,
Färbereien, starken Handel und (1886) 8974 (als Gemeinde
16,277) Einw. Die Fabrikation der nach der Stadt benannten Spitzen
(Plisse de T.) hat aufgehört. Die Stadt ist der Sitz eines
Bischofs, eines Präfekten, eines Gerichts- und Assisenhofs und
eines Handelsgerichts. In der fränkischen Zeit kommt T. als
Tutela vor.
Tullins (spr. tüllang), Stadt im franz. Departement
Isère, Arrondissement St.-Marcellin, an der Eisenbahn
Valence-Chambéry, hat Fabrikation von Maschinen,
Bändern, Packpapier, wollenen Decken etc. und (1881) 3342
Einw.
Tullius, röm. Geschlecht, dem unter andern die
plebejische Familie der Ciceronen angehörte. S. Cicero.
Tulln, Stadt in der niederösterreich.
Bezirkshauptmannschaft Hernals, an der Mündung der beiden
Tullnbäche in die Donau und an der Staatsbahn
Wien-Gmünd-Prag, welche hier die Donau auf einer großen
Gitterbrücke überschreitet, und an welche hier die Linie
T.-St. Pölten anschließt, hat ein Bezirksgericht, 2
Kirchen, eine alte Dreikönigskapelle, Kasernen, Schiffahrt und
(1880) 3234 Einw. T. ist eine der ältesten Städte an der
Donau, das Comagenä der Römer, Standort ihrer
Donauflotte. Nach dem Nibelungenlied empfing hier Etzel Kriemhild.
Die fruchtbare Umgebung der Stadt heißt das Tullner Feld.
Vgl. Kerschbaumer, Geschichte der Stadt T. (Wien 1874).
Tüllpapier, s. v. w. Spitzenpapier.
Tullus Hostilius, der dritte röm. König,
672-640 v. Chr., Nachfolger des Numa Pompilius, Enkel des Hostius
Hostilius, der unter Romulus gegen die Sabiner gekämpft hatte,
zerstörte Albalonga und siedelte die Einwohner auf dem Mons
Cälius in Rom an. Auch mit den Sabinern führte T.
glückliche Kriege. Da er aber den Dienst der Götter
vernachlässigte, so schickten diese erst einen Steinregen,
dann eine Pest und schlugen ihn endlich selbst mit einer schweren
Krankheit, und als er deshalb den Jupiter Elicius durch gewisse
geheime Gebräuche nötigen wollte, ihm die Mittel der
Sühne zu offenbaren, traf ihn Jupiters Blitz, der ihn und sein
Haus verbrannte.
Tuloma, Fluß im russ. Lappland, kommt aus dem
Nuotsee, fließt nordöstlich und mündet unterhalb
Kola in eine tiefe Bucht des Eismeers.
Tulpe, s. Tulipa.
Tulpenbaum, Pflanzengattung, s. Liriodendron.
Tultscha (Tulcea), Hauptstadt eines Distrikts in der
rumän. Dobrudscha, rechts an der Donau, welche sich in der
Nähe der Stadt in ihre drei Hauptmündungsarme teilt, hat
7 Kirchen, darunter eine armenische und eine katholische, 2
Moscheen, ein Gymnasium, einen stark besuchten Hafen und 21,826
Einw. (darunter 3000 Russen, 1600 Griechen, 800 Türken, 700
Tataren, 200 Deutsche). T. ist Sitz eines Divisionskommandos.
Zwischen Matschin und T. 9. Juni 1791 Sieg der Russen unter Repnin
über 20,000 Türken.
Tulu, drawidische Volkssprache in Südindien (s.
Drawida), in und um Mangalur, mit eignem, aber mit der
Sanskritschrift verwandtem Alphabet, nur von etwa 30,000 Menschen
gesprochen. Vgl. Brigel, Grammar of the T. language (Mangalur
1872).
Tulucunaöl, s. Carapa.
Tulumbadschi (türk.), Name der Feuerwehr in
Konstantinopel, die seit alten Zeiten ein strenges Zunftwesen
bildete und ihre Hilfe für Geld verdingte. In neuerer Zeit hat
die Pforte eine Umgestaltung der T. nach europäischem Muster
veranlaßt, welche von dem Grafen Edmund
Széchényi ins Werk gesetzt wurde.
Tuluniden, die älteste selbständige arab.
Dynastie in Ägypten, nach ihrem Gründer Achmed ibn Tulun
(gest. 888) genannt, herrschte 872-904.
Tum, ägypt. Gott in menschlicher Gestalt mit der
Pschentkrone abgebildet (s. Figur) ist eine Form des Sonnengottes,
die besonders in Heliopolis verehrt wurde. Wie Ra die Sonne des
Tags ist, so T. die der Nacht, welche die untere Hemisphäre
erleuchtet.
[Tum.]
Tumaco, Bai und kleine Hafenstadt auf gleichnamiger Insel
im Staat Cáuca der Republik Kolumbien, am Stillen Ozean, mit
Zollhaus und (1870) 2642 Einw. Es ist der Hafen von
Barbacóas.
Tumba (lat.), ein kistenartiges oder auf Füßen
ruhendes Grabdenkmal.
Túmbes, Hafenort im Departement Piura (Peru), am
Fluß gleiches Namens, mit (1876) 1851 Einw. Hier landete 1527
Pizarro.
Tumerikwurzel, s. Curcuma.
Tumlung, siames. Münze, = 4 Bat od. Tikal (s.
d.).
Tummler (niederd., hochd. Taumler), ein
halbkugelförmiges, henkel- u. fußloßes
Glasgefäß zum Trinken, welches sich, zur Seite gelegt,
wieder aufrichtet, im Volksmund auch Stehauf genannt (s.
Abbildung).
[Tummler.]
Tümmler, s. Delphine (S. 652) und Tauben (S.
536).
Tumor (lat.), Geschwulst; T. albus, Gliedschwamm.
Tümpling, Wilhelm von, preuß. General, geb.
30. Dez. 1809 zu Pasewalk, studierte anfangs die
902
Tumult - Tungusische Sprache
Rechte, trat 1830 in das Regiment Garde du Korps ein und machte
später seine Karriere hauptsächlich im Generalstab. Von
1853 an kommandierte er die Gardekürassiere, von 1854 an das
1. Gardeulanenregiment, als Oberst dann die 11. Kavalleriebrigade.
1863 führte er als Generalleutnant die 5. Division nach
Schleswig-Holstein, kommandierte dieselbe Division mit Auszeichnung
im österreichischen Feldzug 1866, in dem er bei Gitschin 29.
Juni schwer verwundet wurde, und erhielt zu Beginn des Kriegs von
1870/71 als General der Kavallerie das Kommando des 6. Armeekorps,
fand aber wenig Gelegenheit, sich auszuzeichnen. 1883 zur
Disposition gestellt, starb er 13. Febr. 1884 in Thalstein bei
Jena.
Tumúlt (lat.), s. v. w. Aufruhr; tumultuarisches
Verfahren, diejenige Behandlung eines Prozesses, in welcher die
prozessualischen Handlungen nicht in der ordnungsmäßigen
Reihenfolge geschehen.
Tumulus (lat.), Erd-, Grabhügel; s. Gräber,
prähistorische.
Tun (spr. tönn), engl. Flüssigkeitsmaß
für Wein, = 252 Gallons, für Bier = 216 Gallons (s.
d.).
Tûn, ansehnliche Stadt in der pers. Provinz
Chorasan, unter 34° nördl. Br. gelegen und mit einem
für jene wüsten Gegenden bedeutenden Kulturgürtel
umgeben. Obwohl eine der festesten Städte Persiens, vermag sie
doch einem regelrechten Angriff nicht standzuhalten, weil die Werke
total vernachlässigt sind. Sie mißt ca. 6 km im Umfang
(wovon jedoch nur etwa ein Achtel mit Häusern bedeckt ist) und
zählt etwa 8000 Einw. Produziert wird viel Tabak, Opium und
auch Seide.
Tunbridge (Tonbridge, spr. tönnbriddsch), Stadt in
der engl. Grafschaft Kent, am schiffbaren Medway, hat eine 1554
gegründete Lateinschule, ein Schloß mit
normännischem Thorweg, Fabrikation von lackierten Holz- und
Drechslerwaren und (1881) 9317 Einw.
Tunbridge Wells (spr. tönnbriddsch), Stadt in der
engl. Grafschaft Kent, 8 km südlich von Tunbridge, nächst
Bath der älteste Badeort Englands, aber mehr wegen seiner
guten Luft als seiner Stahlquellen besucht, hat einen Kursaal,
Badeanstalten, zahlreiche Villen, liegt malerisch auf drei
Hügeln, hat Fabrikation von lackierten Holz- und
Drechslerwaren und (1881) 24,309 Einw.
Tundra ("Moossteppe"), die im nördlichsten Asien und
Europa jenseit der Baumgrenze gelegenen weiten Landstrecken mit
kümmerlichem Pflanzenwuchs, der hauptsächlich aus Moosen
und Flechten besteht. Bedingt wird diese mangelhafte, mit einem
Vorwiegen der Kryptogamenflora und einem Zurücktreten der
Phanerogamen verbundene Entwickelung der Vegetation einerseits
durch die Bodenform und Höhenlage der betreffenden Gebiete,
anderseits durch das Klima und die mangelhafte Wirkung der
Sonnenstrahlen. Letztere vermögen den Boden nur bis zu sehr
geringer Tiefe aufzutauen, die Luft nur dicht am Boden zu
erwärmen, so daß die Existenz tiefwurzelnder und
hochstämmiger Pflanzen unmöglich wird. In neuester Zeit
wird der Name T. auch auf die gleichartigen Barren Grounds von
Nordamerika angewandt.
Tundscha, Fluß in Ostrumelien, entspringt auf dem
Balkan bei Kalifer, fließt erst östlich zwischen Balkan
und Tscherna Gora, dann südlich und fällt bei Adrianopel
links in die Maritza.
Tunesien, s. Tunis.
Tungbaum, s. Aleurites.
Tungrer (Tungri), german. Völkerschaft in Gallia
Belgica, welche die Sitze der 53 vernichteten Eburonen an der
mittlern Maas einnahm, mit dem Ort Aduatuca Tongrorum (jetzt
Tongern).
Tungstein, s. Scheelit.
Tungsteinsäure, s. Wolfram.
Tungting, See, s. Hunan.
Tunguragua, Provinz des südamerikan. Staats Ecuador,
umfaßt die Hochebene von Ambato (2573 m) und den Ostabhang
der Kordillere und hat ein Areal von 5050 qkm (91,7 QM.) mit (1885)
79,526 Einw. Genannt ist die Provinz nach dem noch thätigen
Vulkan von T. (5087 m) in der östlichen Kordillere. Hauptstadt
ist Ambato.
Tunguragua, 1) Vulkan der Kordilleren im sudamerikan.
Staat Ecuador, nordöstlich von Riobamba, 5087 m hoch; 1873 von
A. Stübel zum erstenmal bestiegen. Ein furchtbarer Ausbruch,
bei welchem mehrere Berggipfel zusammenstürzten, erfolgte
1797. -
2) Fluß, s. Amazonenstrom, S. 444.
Tungusen (s. Tafel "Asiatische Völker", Fig. 11),
zur mongol. Rasse gehöriges Jägernomadenvolk in Sibirien,
das in ganz Ostsibirien verbreitet ist und in zahlreiche, nach
Sprache und Sitte mehr oder weniger weit auseinander gegangene
Stämme zerfällt. Ihre eigentliche Heimat scheint das
Amurland zu sein, in welchem sie das höchste Maß der
ihnen bisher zugänglichen Kultur erreicht, und von wo aus sie
sich bis zum Jenissei, den Eismeerküsten und Kamtschatka
verbreitet haben. Sie sind von mittlerm Wuchs mit
verhältnismäßig ziemlich großem Kopf, breiten
Schultern, etwas kurzen Extremitäten und kleinen Händen
und Füßen; ihre Konstitution ist eine trockne, hagere,
sehnig-muskulöse; fettleibige Gestalten findet man unter ihnen
nicht. Die Hautfarbe ist mehr oder weniger gelbbräunlich, das
Auge braun, das Haar schwarz, schlicht, struppig und stark, das
Barthaar auf Lippen, Backen und Kinn sehr spärlich; die
Kopfbildung ist entschieden, wenn auch abgeschwächt,
mongolisch. Das Gesicht trägt den Ausdruck der
Gutmütigkeit und Indolenz. Ihre Zahl wird auf 70,000
geschätzt. Unter den verschiedenen Stämmen lassen sich in
sprachlicher Beziehung vier Gruppen bilden: 1) Dauren und Solonen,
Stämme mit starker mongolischer Beimischung; 2) Mandschu,
Golde, Orotschen; 3) Orotschonen, Manägirn, Biraren, Kile; 4)
Oltscha, Oloken, Negda, Samagirn (s. Tungusische Sprache). Die
beiden ersten Gruppen bilden den südlichen oder
mandschurischen Ast des tungusischen Volksstammes, die beiden
andern umfassen Zweige seines nördlichen, bis zum Jenissei,
dem Eismeer und Kamtschatka verbreiteten sibirischen Astes. Der
Hauptreichtum der T. ist das Renntier, die Jagd auf Pelztiere ihre
Hauptbeschäftigung; ihre Hauptnahrung besteht in Fleisch und
Milch des Renntiers, getrockneten Fischen, einer Art Käse und
Butter u dgl. Ihre Kleidung setzt sich zusammen aus Beinkleidern,
der Parka, einer Art Bluse, die vorn geschlossen ist und über
den Kopf weg angelegt wird, der Dacha, einem Mantel ohne
Ärmel, alles aus Renntierfell, wobei die beiden letztern
Stücke mit den Haaren nach außen getragen werden. Dazu
eine Pelzmütze und Stiefel und Strümpfe von demselben
Material wie Parka und Dacha. Wenige T. sind Christen, die Mehrzahl
bekennt sich zum Schamanismus. Vgl. Hiekisch, Die T. (2. Aufl.,
Dorpat 1882); F. Müller, Unter T. und Jakuten (russische
Olenek-Expedition, Leipz. 1882); Schrenck, Die Völker des
Amurlandes (St. Petersb. 1881).
Tungusische Sprache. Tungusisch im weitern Sinn heißen
alle zur tungusischen Gruppe des uralaltaischen Sprachstammes
(s. d.) gehörigen Sprachen, von denen die Mandschusprache (s.
d.) die hervorra-
903
Tunguska - Tunikaten.
gendste ist. Im engern Sinn versteht man darunter die Sprache
der Orotschonen und andrer in Sibirien lebender Stämme, die
von Castren ("Grundzüge einer tungusischen Sprachlehre",
Petersb. 1856) und Schiefner (im "Bulletin der Petersburger
Akademie" 1859) grammatisch bearbeitet worden ist.
Tunguska (Obere T.), Fluß, s. Angara.
Tunika (lat.), röm. Kleidungsstück für
Männer und Frauen, das unter der Toga unmittelbar auf dem
Körper getragen wurde. Sie wurde über den Hüften
durch einen Gürtel zusammengehalten und reichte bis unter die
Kniee herab. Sie war von weißer Wolle gefertigt und anfangs
ohne Ärmel; später wurden kurze, nicht bis an die
Ellbogen reichende Ärmel üblich. Die Frauen trugen
über der innern, ärmellosen T. noch eine zweite mit
Ärmeln (stola), die den halben Oberarm bedeckte und nach der
Außenseite einen durch Agraffen (tibulae) zusammengehaltenen
Schlitz hatte. Die T. der Knaben und Soldaten war hochrot (tunica
russa). An der T. der Senatoren war in der Mitte von der Brust
herab bis zum untern Saum ein Purpurstreif angewebt (t.
laticlavia); die der Ritter war durch zwei dergleichen schmale
Streifen ausgezeichnet (t. angusticlavia), doch trugen letztere zur
Kaiserzeit auch die t. laticlavia. Die Triumphatoren trugen
Purpurtuniken, auf deren Saum Palmen in Gold gestickt waren (t.
palmata). Die einfarbige, unverzierte T. (t. recta) erhielten die
Jünglinge zugleich mit der toga virilis und Jungfrauen, wenn
sie heirateten, als Brautkleid von ihren Eltern. - Die T. der
römischen Bischöfe ist ein leinenes Gewand von
weißer Farbe, das bis auf die Füße reicht und
durch das Cingulum (s. d.) um die Hüften festgehalten
wird.
Tunikaten (Tunicata Lam., Manteltiere), hoch entwickelte
Seetiere, deren meist sack- oder tonnenförmiger Körper
von einem Mantel, d. h. einer eigentümlichen, oft
außerordentlich dicken, bald gallertigen, bald lederartigen
oder knorpeligen Hülle, umgeben ist (s. Tafel "Mollusken und
Tunikaten"). Diese wird von der eigentlichen Haut des Tiers
abgeschieden und enthält einen der pflanzlichen Cellulose
ungemein nahe verwandten Stoff. Sie besitzt zwei Öffnungen,
die eine zur Einfuhr von frischem Wasser mit den in ihm
befindlichen Nahrungssubstanzen, die andre zur Entfernung des zum
Atmen unbrauchbar gewordenen Wassers sowie der Exkremente, Eier
etc. Beide Öffnungen liegen entweder einander sehr nahe oder
an den entgegengesetzten Körperenden und sind durch Muskeln
mehr oder weniger verschließbar. Der Innenfläche des
Mantels, welcher zu seiner Ernährung von
Blutgefäßen durchzogen wird, liegt die Hautschicht des
Tiers dicht an. Von ihr umschlossen ist im Vorderende die sehr
geräumige Atemhöhle, in welcher das aufgenommene Wasser
mit der in ihr befindlichen Kieme in Berührung kommt und so
die Atmung vermittelt. Die Kieme selbst besteht bei vielen T. aus
einem grobmaschigen Sack, bei andern aus einem hohlen Cylinder mit
durchbrochener Wandung oder einfach aus einer dünnen, in der
Atemhöhle ausgespannten Scheidewand mit vielen Lücken. In
allen Fällen bewegt sich das Wasser, durch zahllose
Flimmerhaare in fortwährender Strömung längs den
Wandungen der Kieme erhalten, vom Vorderende weiter nach hinten, wo
im Grunde der Atemhöhle der eigentliche Mund des Tiers liegt.
Die Nahrungsteilchen, welche es mitbringt, werden aber schon von
der Eingangsöffnung ab durch eine besondere Flimmerrinne,
welche einen zähen Schleim zu ihrer Festhaltung absondert, dem
Mund zugeführt und gelangen darauf in den Magen. Der Darm
endet durch den After entweder direkt in den hintern Teil der
Atemhöhle oder in einen besondern Abschnitt derselben, die
sogen. Kloake. Neben dem Darm liegt das dünnwandige,
beutelförmige Herz. Das Blut wird von demselben einige Minuten
in den Gefäßen in einer bestimmten Richtung
vorwärts getrieben, hört dann kurze Zeit ganz zu
fließen auf und zirkuliert darauf in der entgegengesetzten
Richtung, so daß die kurz vorher als Arterien fungierenden
Gefäße nun zu Venen werden und umgekehrt. Das
Nervensystem besteht in der Hauptsache aus einem zwischen Einfuhr-
und Ausfuhröffnung gelegenen Ganglion, in dessen Nähe
sich meist ein Auge sowie ein Gehörbläschen befindet.
Über die Niere ist nichts Genaueres bekannt. Die
Geschlechtsorgane sind im allgemeinen einfach gebaut. Alle T. sind
im anatomischen Sinn Zwitter, befruchten sich jedoch nicht selbst
und haben gewöhnlich auch nicht einmal zu gleicher Zeit reife
Eier und reifen Samen, sondern vielfach erstere früher als
letztern. Außer der geschlechtlichen Fortpflanzung ist aber
noch die ungeschlechtliche durch Knospung sehr verbreitet. Sie
liefert Kolonien, bei welchen die Individuen häufig ganz
bestimmt und charakteristisch gruppiert sind. Die Eier entwickeln
sich in der Atemhöhle oder der Kloake, so daß meist die
Jungen lebendig geboren werden. Bei den im Alter festsitzenden T.
(s. Ascidien) schwärmen sie, mit einem später abfallenden
Ruderschwanz versehen, noch eine Zeitlang umher, heften sich dann
an und bilden unter Umständen sofort durch Knospung eine
kleine Kolonie. Bei der andern, frei schwimmenden Gruppe (s.
Salpen) wechselt geschlechtliche u. ungeschlechtliche Fortpflanzung
regelmäßig miteinander ab, so daß ein
Generationswechsel vorliegt. Über die Stellung der T. im
Tierreich sind die Forscher nicht einig. Früher ordnete man
sie aus Grund ihres weichen Körpers allgemein den Mollusken
unter, hat sie aber gegenwärtig von diesen abgetrennt und
vereinigt sie entweder mit den Bryozoen (s. d.) zu der Gruppe der
Molluskoideen oder läßt sie besser ganz selbständig
sein. Da sie aber aus andern Tieren hervorgegangen sein
müssen, so gibt man ihnen als Vorfahren entweder die
Würmer, und zwar eine ausgestorbene Gruppe derselben, oder die
Wirbeltiere. Mit den letztern haben sie nämlich in der
Entwickelung so viel Gemeinsames (vgl. Ascidien und Amphioxus),
daß nahe Verwandtschaft zwischen beiden mit Recht angenommen
werden darf. Indessen ist bisher noch nicht festgestellt worden, ob
die Wirbeltiere von den T. oder diese von jenen abstammen. Im
erstern Fall gäbe es eine stetig aufsteigende Linie:
Würmer; T. (Ascidien); Amphioxus als ältestes Wirbeltier;
fischähnliche Wesen; echte Fische etc.; im zweiten dagegen
sowohl eine absteigende: fischähnliche Wesen; Amphioxus als
erst wenig rückgebildet; T. (Ascidien) als völlig
rückgebildet, als auch eine aufsteigende: fischähnliche
Wesen; Fische etc., so daß dann die T. sozusagen einen
herabgekommenen Seitenzweig des Hauptstammes der Wirbeltiere
darstellen würden. Die T. sind ohne Ausnahme Bewohner des
Meers. Teils sind sie auf allen möglichen Unterlagen
festgewachsen und finden sich dann sowohl an der Flutgrenze als in
bedeutenden Tiefen; teils schwimmen sie auf der Oberfläche oft
weit von den Küsten und in großen Scharen umher. Sie
nähren sich von kleinsten tierischen und pflanzlichen Wesen,
die mit dem Wasser in ihre Atemhöhle geraten und dort zum Mund
gelangen. Viele unter ihnen leuchten mit prachtvollem Licht.
Fossile Formen sind bisher nicht aufge-
904
Tunis (Beschreibung des Landes).
funden worden. - Man teilt die T. in zwei große Gruppen:
die meist festsitzenden Ascidien (s. d.) oder Seescheiden und die
frei schwimmenden Salpen (s. d.).
Tunis (Tunesien), ehemaliger Vasallenstaat des türk.
Reichs in Nordafrika (s. Karte "Algerien etc."), seit 12. Mai 1882
Schutzstaat Frankreichs, wird im N. und O. vom
Mittelländischen Meer, im SO. von Tripolis, im SW. und W. von
Algerien begrenzt und hat ein Areal von 116,000 qkm (2107 QM.). Der
östliche Küstensaum ist flach, sandig und unfruchtbar,
der nördliche dagegen hoch, steil und felsig. Der
nördliche und westliche Teil des Innern ist im allgemeinen
sehr gebirgig. Waldreiche Gebirgsmassen bilden eine maritime
Gebirgszone, welche im S. durch eine breite ebene Zone begrenzt
wird, und an welche sich weiter im S. eine zweite hohe
Gebirgsregion als dritte Zone anschließt, sich im Dschebel
Mechila bis 1477 m erhebt und in einem langen Ast in den Ras Addar
(Kap Bon) ausläuft. Im SW. des Landes, nach Gafsa zu, steigen
nochmals Bergmassen auf, und südlich von diesen bilden die
wüsten, felsigen Ebenen des Biled ul Dscherid eine vierte
Zone. Am Küstenrand treten zahlreiche Vorgebirge hervor, so an
der Nordküste Ras Addar (Kap Bon), Kap Blanc u. a. Von den
Meerbusen sind im NO. der Golf von T., an der Ostseite die
Meerbusen von Hammamet und Gabes (Kleine Syrte) die ansehnlichsten;
vor dem letztern liegen die Inseln Kerkena und Dscherba. Die
gebirgigen Teile im N., NW. und W. des Landes sind sehr
quellenreich; desto wasserärmer sind die großen Ebenen
im südlichen Teil des Landes, in denen jedoch ausgedehnte
unterirdische Wasserbecken nachgewiesen worden sind. Die meisten
von den Gebirgen herabkommenden Bäche und Flüßchen
(Wadi) verlieren sich im Sand oder erreichen als
Küstenflüsse nach kurzem Lauf das Meer. Kein einziger
Fluß ist schiffbar. Der bedeutendste ist der Medscherda, der
bei Porto Farina in das Mittelmeer mündet, nächst ihm der
Wadi el Kebir und der Wadi el Miliana. Man meinte früher,
daß die Schotts im S. des Landes eine Depression bildeten,
indes ist dies nur mit dem Schott Gharsa (-21 m), welcher mit dem
schon auf algerischem Gebiet liegenden Schott Melrir (-29 m) in
Verbindung steht, der Fall. Die von diesen durch eine Bodenschwelle
getrennten, weit größern Schotts Dscherid und
Fedschedsch liegen bereits 16-25 m ü. M.; die (von Roudaire
befürwortete) Durchstechung der Landenge von Gabes würde
daher nur ein beschränktes Binnenmeer schaffen. Mineralquellen
gibt es bei Tunis (Hammam el Enf), zu Gurbos, Tozer und Gafsa. An
der Küste ist das Klima gemäßigt, gleichförmig
und gesund, der Winter gleicht unserm Frühjahr. Im Juli und
August steigt unter dem Einfluß der Glutwinde aus der Sahara
das Thermometer bis auf 40, ja 50° C. Vom Oktober bis zum April
regnet es häufig. Die Vegetation hat mediterranen Charakter;
auch an kahlen Hochebenen wächst massenhaft das Halfagras und
harzgebende Akazien, die Schotts sind von großen
Dattelpalmenhainen umsäumt; Wälder befinden sich zwar nur
an der Nordküste, enthalten dort aber prachtvolle Bäume.
Aus dem Tierreich ist Rindvieh in großer Zahl vorhanden, auch
hat man eine zur Fettschwanzgattung gehörige Art von Schafen;
ausgezeichnet sind die Pferde und Dromedare. Bei Tabarka fischt man
Korallen. Mineralprodukte sind außer dem an der Küste
gewonnenen Salz nur die Salpeterablagerungen bei Kairuan, Bleierze
an mehreren Stellen, bei Bescha und am Dschebel Resas (Bleiberg)
bei Tunis, endlich Quecksilber, das nicht gefördert wird, bei
Porto Farina. Die Bevölkerung beträgt ca. 1½ Mill.
Seelen, darunter 45,000 Israeliten, 35,000 Katholiken, 400
Griechisch-katholische und 100 Protestanten; den Rest bilden
Mohammedaner. Die Juden, meist aus Spanien und Portugal stammend,
wohnen in den Städten, wurden vor der französischen
Okkupation sehr unterdrückt, haben jetzt aber gleiche Rechte
mit andern. Die Zahl der Fremden (schnell zunehmend) war 1881:
55,987, davon 10,249 Italiener, 8979 englische Malteser, 3395
Franzosen. Der Ackerbau wird bei der hohen
Produktionsfähigkeit des Bodens sehr lässig betrieben.
Fabriziert werden besonders rote tunesische Mützen (Fesse),
Saffian, Seiden- und Wollwaren und irdene Geschirre. Der
ansehnliche Handel konzentriert sich besonders in Tunis (Goletta),
Sfaks, Susa und Dscherba. Ausfuhrartikel sind: Olivenöl,
Esparto, Olivenabfälle, Schwämme, Datteln, Leder, Wolle,
Wollenstoffe, Fesse, Wachs, Felle etc.; Einfuhrartikel: baumwollene
Zeuge, Eisen, Blei und Manufakturwaren aus England, Wein und
Branntwein aus Spanien, Eisen aus Schweden, Uhren, feine Leinwand,
wollene und baumwollene Stoffe, Gewürze, Zucker und Kaffee aus
Frankreich, Glaswaren aus Triest, Gewehre und Säbel aus Smyrna
etc. Die Karawanen aus dem Innern Afrikas bringen Senna,
Straußfedern, Goldsand, Gummi, Elfenbein und nehmen
dafür Tuch, Musselin, Seidenzeuge, rotes Leder, Gewürze,
Waffen und Kochenille zurück. Der Wert der Gesamteinfuhr der
Regentschaft betrug 1887: 27,7, der Ausfuhr 21,4 Mill. Frank, davon
Weizen 6,1, Gerste 2,5, Olivenöl 4,5, Esparto 1,7,
Schwämme 8, Wollenstoffe 0,6 Mill. Fr. In die verschiedenen
Häfen liefen ein: 6725 Schiffe (1056 französische) von
1,672,266 Ton., aus: 6596 Schiffe (1056 französische) von
1,674,323 T. Die Handelsmarine zählte 300 Fahrzeuge von 10-150
T. Die Länge der Eisenbahnen von Tunis nach Goletta, Bardo,
Bone, Hammamet el Lis beträgt 410,5, die der Telegraphenlinien
(mit 31 Büreaus) 2004 km, untermeerische Kabel verbinden T.
mit Algerien und Europa, Postverbindung hat T. mit Europa dreimal
wöchentlich. An der Spitze der Regentschaft steht der Bei
(seit 1882 Sidi Ali), welcher den Titel "Besitzer des
Königreichs T." führt und durch den Vertrag von Kasr el
Said (12. Mai 1881) zum Vasallen Frankreichs geworden
[Kärtchen der Umgebung von Tunis.]
905
Tunis (Stadt; Geschichte).
ist, indem die verschiedenen in T. funktionierenden Dienstzweige
in Abhängigkeit von den entsprechenden französischen
Ministerial-Departements gebracht wurden. Von der 1882
aufgelösten tunesischen Armee ist nur noch die dem Bei
bewilligte Ehrengarde (ein Bataillon, eine Schwadron, eine
Batterie) geblieben; die übrigen Mannschaften sind in die
neugebildeten 4 Tirallleurregimenter übergegangen. Von
französischen Truppen stehen in der Regentschaft 3 Regimenter
Infanterie, 2 Regimenter Kavallerie, 2 Batterien Artillerie. Eine
eigne Kriegsmarine besteht nicht mehr; ein französisches
Kriegsschiff ist beständig hier stationiert. Die Einnahmen der
Regentschaft betrugen 1886-87: 25,853,848, die Ausgaben 5,852,381,
die Staatsschuld 142,550,000 Fr. Die Flagge s. Tafel "Flaggen
I".
Die gleichnamige Hauptstadt liegt 45 km von der Küste
zwischen dem seichten Salzsee El Bahira im O. und dem im Hochsommer
fast ganz trocknen Sebcha el Seldschumi und wird von einer Mauer
umgeben, durch welche zehn Thore führen, und deren
südlicher Teil durch das europäische Viertel durchbrochen
ist, in welchem das Zollhaus und das Seearsenal liegen. Die meisten
Straßen sind eng, krumm, ungepflastert und namentlich im
Judenviertel im höchsten Grad unsauber. Im W. liegt die halb
in Ruinen befindliche Citadelle (Kasba). T. hat zahlreiche
Moscheen, eine katholische Kirche, ein Kapuzinerkloster, ein
griechisches Kloster mit Kirche, einen im maurischen Stil erbauten
Palast des Beis, der aber 3 km westlich außerhalb der Stadt
im Bardo, einem einer kleinen Stadt gleichenden
Gebäudekomplex, oder in Marsa wohnt, ferner zahlreiche
öffentliche Bäder, Bazare und Karawanseraien, bedeutende
Industrie, namentlich in Seidenweberei, roten Mützen,
Saffianleder und Waffen, ansehnlichen Handel, besonders nach
Marseille, Ägypten, Genua, der Levante und nach dem innern
Afrika, und etwa 150,000 Einw., darunter 25,000 Juden, 7000
Malteser, 6000 Italiener, 2500 Franzosen und 500 andre Christen.
Der Hafen von T. ist Goletta (s. d.). Die Stadt hat mehrere
Medressen, viele Koranschulen, ein katholisches Collège, 23
jüdische und 33 französische Elementarschulen und ist
Sitz eines deutschen Berufskonsuls. Eisenbahnen gehen von T. nach
allen Richtungen aus. Vgl. Kleist, T. und seine Umgebung (Leipz.
1888).
[Geschichte.] T. (Tunes) bestand schon im Altertum, war aber
neben Karthago ohne Bedeutung. 255 v. Chr. wurde bei T. der
römische Feldherr Regulus von den Karthagern unter Xanthippos
besiegt und gefangen. Erst nach Karthagos Zerstörung durch die
Araber 699 kam T. empor. Es gehörte zum Reich Kairwan, seit
1100 zu Marokko. Seit 1140 herrschten die Almohaden, seit 1260 die
Meriniden in T., das ein blühendes Land war. 1270 unternahm
Ludwig IX. von Frankreich den letzten Kreuzzug gegen T., starb aber
bei der Belagerung. 1534 bemächtigte sich der Korsar
Chaireddin Barbarossa der Herrschaft in T. und begründete
einen gefürchteten Seeräuberstaat, der 1535, als Karl V.
T. eroberte und 20,000 Christensklaven befreite, zerstört
wurde. Seitdem war T. spanisch. 1574 ward es aber wieder der
Oberherrschaft des Sultans unterworfen. Der türkische Admiral
Sinan Pascha, der es eroberte, behielt es als Lehnsmann der Pforte.
Nach seinem Tod (1576) entriß der Boluk-Baschi seinem
Nachfolger Kilik Ali die höchste Gewalt. Die türkische
Miliz wählte nun einen Dei als Inhaber der höchsten
Gewalt, entthronte und ermordete aber die meisten nach einer kurzen
Regierung. Unter dem dritten, Kara Osman, bemächtigte sich der
Bei (anfangs nur ein mit der Eintreibung der Steuern und des
Tributs beauftragter Beamter) Murad der öffentlichen Gewalt
und machte dann dieselbe in seiner Familie erblich, den
wählbaren Dei in gänzlicher Abhängigkeit erhaltend.
Murad Beis Nachkommen regierten über 100 Jahre und
vergrößerten ihre Macht durch Eroberungen auf dem
Festland und durch Seeraub. Doch mußten sie die Oberhoheit
des Deis von Algier durch Tributzahlung anerkennen. Die jetzige
Dynastie von T. begann 1705 mit Hussein Ben Ali. Indessen bietet
die Geschichte von T. wenig mehr als eine Reihe von
Palastrevolutionen, Janitscharenaufständen und Hofintrigen.
Nach der Eroberung von Algier durch die Franzosen unterstützte
T. anfangs Abd el Kader, ward aber schon 8. Aug. 1830 zu einem
Vertrag gezwungen, in welchem es die Abschaffung der
Seeräuberei und Sklaverei sowie die Abtretung der Insel
Tabarka versprach. Der Bei Sidi Mustafa, der 1835 seinem Bruder
Sidi Hussein folgte, schloß sich gegen die Franzosen mehr an
die türkische Regierung an. Sidi Mustafas Sohn und Nachfolger
seit 1837, Sidi Achmed, unternahm große Bauten und verwendete
beträchtliche Summen auf die Erweiterung seiner
Militärmacht, geriet aber dadurch mit der Psorte in ernstliche
Konflikte und ward von derselben durch Intervention der
Großmächte zur Reduktion seiner Armee und
jährlichen Ablegung eines Rechenschaftsberichts über den
Stand der Finanzen gezwungen. Ihm folgte 1855 sein ältester
Sohn, Sidi Mohammed, in der Regierung, der das Heer reduzierte,
dagegen namentlich den Handel förderte. Eine im Juni 1857
ausbrechende Judenverfolgung veranlaßt die europäischen
Konsuln zur Intervention, und es kam hierauf unter dem Beistand des
französischen und englischen Generalkonsuls eine liberale
Gesetzgebung und Verwaltungsorganisation zu stande. Am 23. Sept.
1859 starb der Bei Sidi Mohammed. Sein Bruder und Nachfolger
Mohammed es Sadok gab im April 1861 in Gegenwart der Vertreter der
christlichen Mächte dem Land sogar eine konstitutionelle
Verfassung. Doch entfaltete der neue Bei einen
übermäßigen Glanz und ahmte ohne Anlaß die
Einrichtungen der Großstaaten nach. Die großen Kosten
seiner Regierung, welche er überdies unwürdigen,
habgierigen Günstlingen überließ, beschaffte er
durch Anleihen, deren Erträge zum geringsten Teil in die
Staatskasse flossen, deren Zinsen aber einen verderblichen
Steuerdruck notwendig machten. Der Bei mußte endlich die
Zinszahlung der Staatsschulden (275 Mill.) einstellen. Dies gab
1869 den Anlaß zu einer Einmischung, welche die ganze
Verwaltung in T. und namentlich ihre finanzielle Seite in
vollkommene Abhängigkeit von Frankreich zu bringen strebte.
Unter Mitwirkung der ebenfalls dort interessierten Mächte
England, Italien und Preußen kam dann eine Art von
europäischer Kontrolle über die tunesischen Finanzen zu
stande, und es wurde durch Abtretung der Zolleinnahmen für die
Verzinsung der auf 125 Mill. Fr. reduzierten Staatsschuld Sorge
getragen. Das Verhältnis von T. zur Pforte ward auf Betreiben
des Ministers Chaireddin während Frankreichs Ohnmacht nach dem
deutsch-französischen Krieg durch Ferman vom 25. Okt. 1871 so
geregelt, daß der Sultan auf den Tribut verzichtete, der Bei
dafür seine Oderhoheit anerkannte, ohne seine Erlaubnis keinen
Krieg zu führen, in keine diplomatischen Verhandlungen mit dem
Ausland einzutreten etc. versprach. 1877 schickte der Bei dem
Sultan ansehnliche Hilfsmittel an Geld und Truppen für den
Krieg gegen Rußland. Die Mißwirtschaft wurde
906
Tunja - Tunnel.
unter dem Minister Mustafa ben Ismain immer ärger. Unter
den Ausländern erlangten inzwischen die Italiener immer
größere Bedeutung, und selbst deren Regierung suchte
sich in T. festzusetzen. Dies veranlaßte Frankreich 1881,
einen Einfall der räuberischen Krumirs zum Vorwand zu nehmen,
um in T. einzurücken und den Bei 12. Mai zum Bardovertrag zu
zwingen, der T. unter französisches Protektorat stellte. Eine
Erhebung der Eingebornen gegen die Fremdherrschaft wurde durch die
Eroberung von Sfaks und Kairuan niedergeschlagen und die Verwaltung
1882 nach französischem Muster organisiert. Die Ämter
wurden mit Franzosen besetzt, und der französische
Ministerresident ist der Herr des Landes; eine französische
Besatzung sichert den Besitz. Ein neuer Vertrag mit dem Bei vom 8.
Juni 1883 gab der französischen Regierung Vollmacht zu allen
Reformen und zur Regelung der Finanzen. Der Bei (seit 28. Okt. 1882
Sidi Ali) erhielt eine Zivilliste von 1,200,000 Fr. Die
Kapitulationen und die Konsulargerichtsbarkeit wurden 1884
abgeschafft. Vgl. Rousseau, Annales tunisiennes (Algier 1863);
Hesse-Wartegg, T., Land und Leute (Wien 1882); die Monographien von
Duveyrier (Par. 1881), Brunialti (Mail. 1881), Dona (Padua 1882),
La Berge (Par. 1881), Rivière (das. 1886), Lanessan (das.
1887), Antichan (2. Aufl., das. 1887); Tissot, Exploration
scientitique de la Tunisie (das. 1884 ff.); Kobelt,
Reiseerinnerungen aus Algerien u. T. (Frankf. 1885); Baraban, A
travers la Tunisie (Par. 1887); Graham und Ashbee, Travels in
Tunisia (Lond. 1887); Leroy-Beaulieu, Algérie et Tunisie
(Par. 1887); Vignon, La France dans l'Afrique du Nord (das. 1887);
Bois, La France a Tunisie 1881-82 (das. 1886); Piesse,
Algérie et Tunisie, Reisehandbuch (das. 1885); Karte von
Kiepert (l : 800,000).
Tunja, Hauptstadt des Staats Boyacá der
südamerikan. Republik Kolumbien, 2760 m ü. M., auf
steilem Terrain, hat eine Universität, 2 Lehrerseminare, ein
Hospital, Fabrikation von Woll- und Baumwollzeugen und (1870) 5479
Einw. Dabei eine Kupfergrube und heiße Quellen. T. ist die
alte Hauptstadt der Cipas von Bogota und wurde 1538 von den
Spaniern besetzt.
Tunkers (spr. tönkers, Sekte, s. Baptisten.
Tunnel (engl., "Röhre"), unterirdischer Stollen,
welcher zur Herstellung entweder eines Land- oder eines
Wasserverkehrs durch hügeliges oder gebirgiges Terrain
(Landtunnel), oder zur Herstellung eines Landverkehrs, einer
Wasserzuleitung oder einer Ableitung von Abfallstoffen unter dem
Bett eines Flusses, Sees oder Meeresarms (Unterwassertunnel) erbaut
wird. Bauten dieser Art führten bereits die Römer aus,
unter welchen der wahrscheinlich von Furius Camillus 396 v. Chr.
herrührende, etwa 1900 m lange Ablaßstollen des
Albanersees, der durch Kaiser Claudius ausgeführte, etwa 3700
m lange Ablaßstollen des Lacus Fucinus sowie der um 37 durch
Coccejus hergestellte, etwa 1000 Schritt lange Stollen durch den
Posilipo und der um 79 n. Chr. unter Vespasian in der Straße
von Rom nach Ariminum ausgeführte, etwa 200 Schritt lange
Stollen (petra pertusa) hervorzuheben sind. Das einzige
größere Werk des Mittelalters ist der 1450 zur
Verbindung von Nizza und Genua begonnene, jedoch bis jetzt
unvollendete T. durch den Col di Tenda. Die bedeutendsten, gegen
Ende des 17. und im Lauf des 18. Jahrh. in Frankreich
ausgeführten Tunnels sind der von Riquet 1679-81 zur
Durchleitung des Kanals von Languedoc hergestellte Malpastunnel
sowie der 1770 im Givorskanal erbaute T. von Rive de Gier und der
1787 im Centrekanal erbaute T. von Torcy. Erst im Anfang des 19.
Jahrh. führte man den für den Kanal von St.-Quentin
bestimmten 8 m breiten T. bei Tronquoi durch sandiges, druckreiches
Gebirge, während in den Jahren 1803-30 Tunnels teils in festem
Gebirge, wie die zum Schutz vor Lawinen dienenden Galerien der
Alpenstraßen über den Simplon, Mont Cenis, Splügen,
Bernhardin und St. Gotthard, teils in weicherm Gebirge in
Frankreich und England, meist behufs Durchführung von
Kanälen zur Ausführung kamen. Die bei weitem schwierigste
und kühnste Leistung dieser Zeit war jedoch der von Isambert
Brunel 1825 begonnene und trotz elfmaligen Einbruchs des Wassers
nach 16jähriger harter Arbeit vollendete T. unter der Themse.
Den größten Aufschwung erfuhr der Tunnelbau erst durch
den Eisenbahnbau. Die ersten Eisenbahntunnels baute Stephenson in
der Linie Liverpool-Manchester 1826-30. In Deutschland begann man
die ersten Eisenbahntunnels 1837 in der Linie Köln-Aachen bei
Königsdorf und in der Linie Leipzig-Dresden bei Oberau,
während 1839 der erste österreichische Bahntunnel in der
Linie Wien-Triest bei Gumpoldskirchen zur Ausführung kam. Von
da ab nahm der Tunnelbau in Eisenbahnlinien so zu, daß 1874
die Gesamtlänge der Tunnels auf preußischen Bahnen 46
km, auf allen österreichischen Bahnen 43 km betrug,
während sie in Frankreich 1868 bereits eine Ausdehnung von 193
m erreicht hatte. Zum Vergleich einer Anzahl der bedeutendsten
Eisenbahntunnels diene folgende Tabelle. Es beträgt die
Länge:
Meter
St. Gotthard-Tunnel 14920
Mont Cenis-Tunnel 13233
Arlbergtunnel 10270
Giovigalerie (Novi-Genua) 8260
Hoosac-Tunnel (Massachusetts) 7640
Tunnel von Marianopoli (Catania-Palermo) 6480
Sudrotunnel in Nevada 6000
Tunnel bei Slandridge (London-Birmingham) 4970
Nerthetunnel (Marseille-Avignon) 4620
Belbo-Galerie (Turin-Savona) 4240
Kaiser Wilhelm-Tunnel bei Kochem (der längste in
Deutschland) 4216
Blaisytunnel (Paris-Lyon) 4100
Krähbergtunnel (Odenwaldbalm) 3100
Brandleitetunnel (Thüringerwald) 3030
Hauensteintunnel (Schweiz) 2490
Sommerautunnel (Schwarzwaldbahn) 1696
Semmeringtunnel 1431
Mühlbachtunnel (Brennerbahn) 855.
Zu den bedeutendsten Wasertunnels der Gegenwart zählen der
zur Versorgung von Chicago mit reinem Wasser aus dem Michigansee
dienende Wasserleitungstunnel sowie die für Eisenbahnverkehr
bestimmten unter dem Meer und unter dem Mersey in England und der
Hudsonflußtunnel in Nordamerika. Zu den bedeutendsten
Projekten von Tunnelbauten zu Verkehrszwecken gehören der
für Eisenbahnverkehr bestimmte T. unter dem Kanal zur
Verbindung von Frankreich und England, dessen Ausführung
übrigens aus militärischen Rücksichten von dem
englischen Oberhaus zunächst nicht genehmigt worden ist (vgl.
über ihn in geologisch-technischer Beziehung die Schrift von
Hesse, Leipz. 1875), ferner die Tunnels unter der Meerenge von
Messina zur Verbindung von Italien und Sizilien und unter der
Meerenge von Gibraltar.
Landtunnels sind entweder ein- oder zweigeleisige
Eisenbahntunnels, Straßentunnels oder zur Durchführung
eines Kanalbettes bestimmte Kanaltunnels. Bei geringer Tiefe unter
der Oberfläche und bei unfester Beschaffenheit des Bodens
werden dieselben mit Vorteil in zuvor hergestellte offene
Einschnitte eingebaut, und, nachdem das Mauerwerk der Sohle, der
Wandungen und der Gewölbe vollendet, also das Querprofil
geschlossen ist, der T. mit einem hinreichen-
907
Tunnel (Unterwassertunnels).
den Teil des Einschnittmaterials bedeckt. Bei
größerer Tiefe unter der Oberfläche und bei fester
Beschaffenheit des Bodens müssen die Tunnels bergmännisch
hergestellt werden. Je nach der Art des Arbeitsvorganges beim Abbau
ihres Profils und der Herstellung ihrer Mauerung unterscheidet man
die "deutsche", "belgische", "englische", und
"österreichische" Tunnelbaumethode, wobei je nach der
Anordnung des Zimmerwerks und der Lage des sogen. Richtstollens
weitere Unterscheidungen gemacht werden. Die beim Tunnelbau
vorkommenden bergmännischen Arbeiten bestehen in dem
Lösen des Bodenmaterials, des sogen. "Gesteins", dem Entfernen
der gelösten Massen, dem sogen. "Schleppen" und "Fördern"
der "Berge", und dem "Verbauen", d. h. der Sicherung des
hergestellten Hohlraums gegen Einsturz, provisorisch durch
"Verzimmerung" in Holz oder Eisen, definitiv durch "Ausbau" meist
in Stein, unter besondern Verhältnissen jedoch auch in Holz
(Amerika) oder Eisen. Die Landtunnels werden bei günstigen
Steigungsverhältnissen gerade, andernfalls in Kurven und, wo
es sich um Ersteigung bedeutender Höhen mit mäßigem
Gefälle auf beschränktem Terrain handelt, in Schleifen
(Kehrtunnels) oder selbst in Spiralen (Spiraltunnels) angelegt.
Unterwassertunnels sind für einen Eisenbahn- und
Straßenverkehr oder für die Zuleitung von reinem Wasser
oder Ableitung von Abfallstoffen bestimmt und erfordern hiernach
die verschiedensten Querschnitte und Gefälle. Von besonderer
Wichtigkeit sind die erstern, Verkehrszwecken dienenden
Unterwassertunnels, welche an die Stelle unsicherer, durch
Stürme, Nebel u. Eisgänge bedrohter Schiffsverbindungen,
zumal da, wo der Bau fester Brücken wegen der notwendigen
Erhaltung des Verkehrs großer Schiffe zu hohe Pfeiler, tiefe,
kostspielige Fundamente und lange, gegen Sturmdruck schwer zu
sichernde Träger erfordern würde, eine feste, stets
benutzbare, den Schiffsverkehr nicht hindernde, rasch
fördernde Verbindung setzen. Die Schwierigkeiten, welche sich
der Ausführung dieser Tunnels entgegenstellen und
hauptsächlich in der mangelhaften Kenntnis des zu
durchfahrenden Bodens und der etwa eintretenden Wasserzuflüsse
sowie in der Notwendigkeit, mehr oder minder lange,
größtenteils unterirdische Zufahrtswege anlegen zu
müssen, bestehen, haben dazu geführt, die
Unterwassertunnels entweder nur so viel wie nötig in den Grund
zu versenken, um sie gegen die Berührung durch den Kiel der
Schiffe und gegen Wellenschlag zu schützen (Senktunnels), oder
sie nur so tief unter die Sohle des Wassers zu legen, als es die
Sicherheit des Baues und des Betriebs durchaus erfordern
(Bohrtunnels). Dagegen ist die Versenkung eiserner
Tunnelröhren nur bis zu einer durch Schiffsverkehr und
Wellenschlag bedingten Tiefe unter Wasser, wo sie schwimmend
erhalten und durch Verankerungen gegen nachteilige Bewegungen
gesichert werden sollten, oder bis auf die Sohle des Wassers, wo
sie durch Verankerungen gegen den Auftrieb und gegen Wellenbewegung
geschützt werden sollten, wegen der damit verbundenen
Unsicherheit bis jetzt nicht zur Ausführung gelangt. Als
Vorläufer der unter Wasser bergmännisch hergestellten
Tunnels sind die bereits im vorigen Jahrhundert allmählich
vorgetriebenen Stollen des Bergwerks von Huel-Cock in England
anzusehen, welche sich weit unter den Meeresboden erstreckten, und
wobei die zwischen Stollenscheitel und Meeressohle verbliebene
Bodenschicht stellenweise nicht über 1,5 m betrug, so
daß die hier beschäftigten Bergleute bei bewegter See
das Rollen der Gesteine auf dem Meeresboden deutlich hören
konnten. Der erstere in größern Dimensionen für
Fußverkehr ausgeführte Wassertunnel ist der eingangs
erwähnte, von Brunel zur Verbindung der Stadtteile Rotherhithe
u. Wapping erbaute Themsetunnel (s. d.). Der zweite, 1869 von
Barlow im festen blaugrauen Thon mit einer Öffnung von 2,2 m
Durchmesser erbaute, 375 m lange Themsetunnel verbindet die
Stadtteile Tower Mill und Tooley Street und ist an beiden Ufern
durch 18 m tiefe, 3 m weite Schächte, in welchen Treppen mit
je 96 Stufen angeordnet sind, zugänglich. Die neuesten
englischen Bauwerke dieser Art sind die beiden zweigeleisigen
Wassertunnels unter dem Severn und unter dem Mersey. Der 9 m breite
Severntunnel erreicht eine Länge von 7250 m, wovon sich 3620
unter dem Fluß befinden, fällt mit 1:100 von den beiden
Ufern nach dem Fluß und durchfährt meist harten
Sandstein, der jedoch unter der Mitte des Flusses zerklüftet
ist und die Anwendung mächtiger Dampfpumpen zur
Bewältigung des Wassers erforderte. Die von beiden Ufern aus
begonnenen Stollen wurden teilweise mit Mac Keanschen Bohrmaschinen
aufgefahren und trafen mit nur 7 cm Abweichung von der
Hauptrichtung zusammen. Der 7,5 m breite und 6,5 m hohe
Merseytunnel (Fig. 1) nebst den beiden erforderlichen
Entwässerungsstollen wurde von den an beiden Ufern abgeteuften
Schächten aus begonnen und durchsetzt roten Sandstein so tief
unter der Flußsohle, daß zwischen ihr und der
Tunnelfirst eine Felsschicht von mindestens 8 m Stärke
verbleibt. Unter den amerikanischen Wassertunnels ist die
Eisenbahnunterführung unter dem Hudson
Fig. 1. Längenprofil des Merseytunnels.
Fig. 2. Hudsonflußtunnel.
Fig. 2. Grundriß am New Jersey-Ufer.
908
Tunnelkrankheit - Turban.
(Fig. 2) hervorzuheben, welche New York mit Jersey City
verbindet. Der 1670 m lange, unter dem Fluß befindliche Teil
desselben besteht aus zwei 4,9 m breiten, 5,5 m hohen, dicht
nebeneinander liegenden elliptischen Röhren mit je einem
Geleise, während die beiden Zufahrtstunnel eine Weite von 7,5
m erhalten haben und die beiden Geleise aufnehmen. Unter den zur
Zuleitung reinen Wassers dienenden Wassertunnels sind die zur
Wasserversorgung der Stadt Chicago aus dem Michigansee und der
Stadt Cleveland aus dem Eriesee bestimmten Tunnels hervorzuheben,
wovon der erstere aus zwei 15 m voneinander entfernten, je 3200 m
weit und 10 m tief unter dem Seegrund liegenden Tunnels von 1,52
und 2,1 m Weite bei 1,75 m Höhe, der letztere aus einem
über 2 km langen, 1,5 m weiten, 1,6 m hohen und 12,5-21 m
unter dem Seegrund liegenden elliptischen T. besteht. Der zur
Entwässerung und Abführung der Fäkalien der Stadt
Boston bestimmte, 45 m unter dem Wasserspiegel der Dorchesterbai,
dem Hafen dieser Stadt, durchgeführte Wasserstollen besitzt
eine Länge von 1860 m und eine Weite von 2,3 m.
Senktunnel. Bei geringen Wassertiefen läßt sich der
T. zwischen wasserdichten Einschließungen, den sogen.
Saugdämmen, aus welchen das Wasser durch Pumpen entfernt wird,
fast ganz im Trocknen herstellen und erst dann unter Wasser setzen.
Bei größern Wassertiefen und ungünstigem
Meeresgrund hat man vorgeschlagen, die Tunnels mit Hilfe von unten
offenen hölzernen oder eisernen Kasten, aus welchen das Wasser
während des Baues durch verdichtete Luft von einem der
Wassertiefe entsprechenden Druck hinausgepreßt wird, d. h.
pneumatisch, zu versenken. In Bezug auf die Beschreibung einzelner
besonders hervorragender Tunnelbauten der neuern Zeit verweisen wir
auf die Spezialartikel (Themse, Mont Cents, St. Gotthard, Arlberg
etc.). Vgl. Lorenz, Praktischer Tunnelbau (Wien 1860); Schön,
Der Tunnelbau (das. 1874); Rziha, Lehrbuch der gesamten
Tunnelbaukunst (Berl. 1872); Zwick, Neuere Tunnelbauten (2. Aufl.,
Leipz. 1876); Mackensen u. Richard, Der Tunnelbau (das. 1880);
Dolezalek, Der Tunnelbau (Hannov. 1888 ff.); Birnbaum, Das
Tunnellängsträger-System, System Menne (Berl. 1878).
Tunnelkrankheit, s. v. w. Minenkrankheit.
Tunstall, Stadt in Staffordshire (England), in den sogen.
Potteries, hat Töpfereien, Ziegelbrennerei, chemische Fabriken
und (1881) 14,244 Einw.
Tupan (Tupana), Gewittergott und Stammvater brasilischer
Indianerstämme, von dem die Tupistämme, -Sprachen und
-Religionen ihren Namen herleiten.
Tupelostifte, aus einer in Maryland, Virginia, Carolina
wachsenden Sumpfpflanze, Nyssa aquatica Mich., aus der Familie der
Korneen geschnittene Stifte, welche bei ihrer großen
Quellbarkeit ähnlich wie Laminaria in der Chirurgie zur
Erweiterung von Kanälen und Öffnungen benutzt werden.
Tüpfelfarn, s. Polypodium.
Tupi (Tupinamba, Tupiniquim), eine mit den Guarani und
Omagua (vgl. Brasilien, S. 336) nahe verwandte, jetzt sehr
zusammengeschmolzene indianische Völkerfamilie in
Südamerika, welche ursprünglich vom Amazonenstrom bis
über den Uruguay hinaus wohnte, durch die Weißen aber
vielfach zurückgedrängt worden ist. Wahrscheinlich
gehören ihnen die Völkerstämme der brasilischen
Ostküsten an, mit Ausnahme der Botokuden; die Bestimmung der
Zugehörigkeit ist dadurch sehr erschwert, daß die
Jesuiten überall in ihren Missionen die Tupisprache als Lingoa
geral eingeführt und frühere Sprachen verdrängt
haben. Wirklich herrschend ist die Tupisprache aber nur zwischen
dem Tapajos und Xingu (Nebenflüssen des Amazonenstroms) und in
der bolivianischen Provinz Chiquitos. Mit den ihnen nahestehenden
Guarani bilden sie eine Gruppe, welche die Caracara, Albegua,
Carios, Choras, Munnos, Bates, Gualaches, Apiacas, Bororos u. a. m.
umfaßt. Vgl. Martius, Die Pflanzennamen und die Tiernamen in
der Tupisprache (in den Berichten der bayrischen Akademie 1858 u.
1860); Porto Seguro, L'origine touranienne des Américains
Tupis-Caribes (Wien 1876).
Tupinamba, Volksstamm, s. Tupi.
Tupiza, Stadt in der südamerikan. Republik Bolivia,
Departement Potosi, unweit des San Juan, 3050 m ü. M.,
Grenzort gegen Jujuy, hat Landbau, ergiebige Silbergruben,
lebhaften Verkehr u. 3000 Einw.
Tupy, Eugen, unter dem Pseudonym Boleslaw Jablonski
bekannter tschech. Dichter, geb. 14. Jan. 1813 zu Kardasch
Rjetschitz, studierte Theologie, wurde 1847 Propst des
Prämonstratenserklosters in Krakau, wo er im März 1881
starb. T. ist einer der beliebtesten Lyriker Böhmens, dessen
Liebeslieder ("Pisne milosti") namentlich weite Verbreitung fanden,
auch vielfach komponiert wurden. Auch ein Lehrgedicht: "Die
Weisheit des Vaters" ("Moudrost otcova"), schrieb T. Eine
Gesamtausgabe seiner Gedichte ("Básne") erschien in 5.
Auflage (Prag 1872).
Túquerres, Stadt im Staat Cáuca der
südamerikan. Republik Kolumbien, am obern Patía, 3057 m
ü. M., mit höherer Schule und (1870) 7I95 Einw.
Tura, Fluß in Rußland, entspringt am
östlichen Abhang des Urals im Gouvernement Perm, fließt
südöstlich in das Gouvernement Tobolsk an den
Städten Werchoturje, Turinsk und Tjumen vorbei und mündet
links in den Tobol. Nebenflüsse sind: der Tagil (mit Solda),
die Niza und die Pyschma (mit Gold- und Steinkohlenlagern an ihren
Ufern).
Turacin, roter Farbstoff der Schwungfedern des
Bananenfressers, enthält gegen 6 Proz. Kupfer, welches beim
Verbrennen der roten Federn die Flamme grün färbt.
Turalinzen, Hauptstamm der eigentlichen Tataren (s. d.)
am Irtisch und der Demjanka, meist Christen.
Turan, im Gegensatz zu dem persischen Tafelland Iran (s.
d.) das im N. desselben gelegene, zur aralokaspischen Niederung
sich abdachende Land, gleichbedeutend räumlich mit dem
russischen Anteil an Turkistan (s. d.).
Turanische Sprache, s. Uralaltaische Sprachen.
Turanius, Kirchenschriftsteller, s. Rufinus 2).
Turbae (lat., "Haufen"), in den Passionen, geistlichen
Schauspielen, Oratorien etc. die in die Handlung eingreifenden
Chöre des Volkes (der Juden oder der Heiden) zum Unterschied
von den betrachtenden Chören (Chorälen etc.).
Turbaco, Indianerdorf in der Republik Kolumbien
(Südamerika), 15 km südöstlich von Cartagena,
bekannt durch seine Luft- und Schlammvulkane sowie Fundort goldener
und kupferner Gefäße. Ruinen einer alten Indianerstadt
und indianischer Gräber.
Turban (pers. dulband, dulbend, "doppelt gebunden"), die
bei den Mohammedanern, insbesondere den Türken, übliche
Kopfbedeckung, eine bald höhere, bald niedrigere Kappe,
künstlich umwunden mit einem Stück Musselin oder Seide;
die Kappe gewöhnlich rot, die Umwindung weiß,
ausgenommen bei den Emiren, denen ausschließlich eine
grüne Umwindung zustand. Den sonstigen Schmuck des Turbans
bilden Edelsteine, Perlschnüre, Reiherfedern etc.
909
Turban - Turenne.
Der T. des Sultans war sehr dick, mit drei Reiherbüschen
nebst vielen Diamanten und Edelsteinen geziert. Der Großwesir
hatte auf seinem T. zwei Reiherbüsche; andre Beamte und
Befehlshaber die Paschas u. dgl. erhielten Einen als Auszeichnung.
Heute ist der T. in der Türkei bei der Beamtenwelt und der
Intelligenz durch das Fes, in Persien durch das Kulah
verdrängt, und vorschriftsmäßig ist er nur noch bei
den Mollas (Geistlichen). (S. die Abbildung.)
[Turbane.]
Turban, Ludwig Karl Friedrich, bad. Staatsminister, geb.
5. Okt. 1821 zu Bretten, studierte Philologie, dann Jurisprudenz in
Heidelberg und Berlin, machte darauf größere Reisen nach
Frankreich und Italien und bestand 1845 das juristische
Staatsexamen. Nachdem er bei verschiedenen Behörden als
Rechtspraktikant beschäftigt gewesen, ward er 1851 zum
Sekretär im Ministerium des Innern, 1852 zum
Regierungsassessor in Mannheim und 1855 in Karlsruhe ernannt und
1856 zum Regierungsrat befördert; 1860 trat er als
Ministerialrat in das neuerrichtete Handelsministerium ein. Auch
war er litterarisch als Mitarbeiter an mehreren Zeitschriften
thätig und gab einen Kommentar zum badischen Gewerbegesetz von
1861 und der norddeutschen Gewerbeordnung mit dem badischen
Einführungsgesetz von 1871 heraus. Im Landtag vertrat er die
Regierung öfters und gehörte der Zweiten Kammer 1860-70
und seit 1873 auch als Abgeordneter an; er schloß sich der
nationalliberalen Partei an. 1872 wurde er zum Präsidenten des
Handelsministeriums und 1876 nach Jollys Rücktritt
gleichzeitig zum Staatsminister und Präsidenten des Staats-
und Auswärtigen Ministeriums ernannt; auch war er seit 1872
Mitglied des Bundesrats. Als 1881 das Handelsministerium aufgehoben
wurde, übernahm T. das Ministerium des Innern.
Turbanigel, s. Echinoideen.
Turbation (lat.), Verwirrung, Störung; turbieren,
beunruhigen, stören.
Turbe (Türbe, arab.), Mausoleum, Grabstätte.
Besonders glänzend sind die der verstorbenen türkischen
Herrscher in Konstantinopel und Brussa: meist architektonisch
prachtvoll geschmückte Kapellen, in deren Innerm der Sarg des
Toten steht.
Turbellarien (Strudelwürmer), s. Platoden.
Turbiglio (spr. -billjo), Sebastiano, ital. Philosoph,
geb. 7. Juli 1842 zu Chiusa in Piemont, widmete sich dem Studium
der Philosophie an der Universität zu Turin, wurde 1873
Professor der Philosophie am Lyceum Quirino Visconti und
später an der Universität zu Rom. Er schrieb: "Storia
della dottrina di Cartesio" (1866); "La filosofia sperimentale di
Giovanni Locke ricostrutta a priori" (1867); "La mente dei filosofi
eleatici ridotta alla sua logica espressione" (1869); "Trattato di
filosofia elementare, parte logica" (1869); "L'impero della logica"
(1870); "B. Spinoza e le trasformazioni del suo pensiero" (1875);
"Le antitesi tra il medio evo e l'età moderna, nella storia
della filosofia" (l878); "Analisi storico-critica della Critica
della ragion pura" (8 Vorlesungen, 1881). Seine von ernster Arbeit
zeugenden Werke haben auch im Ausland Beachtung gefunden.
Turbine, s. Wasserrad.
Turbinolia, s. Korallen.
Turbot, s. Schollen.
Turbulént (lat.), stürmisch,
ungestüm.
Türckheim, Johann, Freiherr von, bad. Staatsmann,
geb. 17. Okt. 1778 zu Straßburg, Sohn des Freiherrn Johann
von T., frühern Ammeisters von Straßburg, dann
großherzoglich hessischen Gesandten (gest. 28. Jan. 1824),
studierte erst in Tübingen und Erlangen die Rechte, war
1799-1803 österreichischer Offizier, dann sächsischer
Gesandter bei der Kreisversammlung in Nürnberg, trat 1808 in
den badischen Staatsdienst, ward 1813 Direktor des Dreisamkreises,
1819 Staatsrat und Mitglied der Ersten Kammer, wo er die
historischen Rechte des Adels gegen die Büreaukratie
verteidigte, aber eine echt deutsche nationale Gesinnung bekundete,
1831 Minister des großherzoglichen Hauses und der
auswärtigen Angelegenheiten, in welcher Stellung er
genötigt war, die reaktionären Bundesbeschlüsse zur
Ausführung zu bringen, trat 1835 zurück, lebte seitdem
meist auf seinem Landsitz in Altdorf und starb 30. Juli 1847 zu
Ragaz in der Schweiz. Er schrieb: "Betrachtungen auf dem Gebiet der
Verfassungs- und Staatenpolitik" (Freiburg 1845, 2 Bde.). - Sein
Sohn Hans, Freiherr von T., geb. 15. Dez. 1814 zu Freiburg i. Br.,
war 1849-64 vortragender Rat im Auswärtigen Ministerium zu
Karlsruhe und 1864-83 badischer Gesandter in Berlin.
Turco (ital.), türkisch; alla turca, auf
türkische Art (von Tonstücken mit vollgriffiger, zwischen
wenigen Akkorden wechselnder Begleitung).
Turdetaner, eine der Hauptvölkerschaften der
Hispanier, in der Provinz Bätica, westlich vom Flusse Singulis
(Jenil), an beiden Ufern des Bätis (Guadalquivir) und bis ins
südliche Lusitanien hinein seßhaft. Sie waren als
Küstenanwohner (ihr Land ist das Tarschisch der Bibel) zuerst
mit zivilisierten Phönikern in engere Berührung gekommen
und hatten von ihnen neben andrer Kultur den Gebrauch der Schrift,
das Wohnen in wohlgebauten Städten den Betrieb vieler
Handwerke gelernt, aber zugleich als friedliches Kulturvolk den
kriegerischen Charakter der übrigen Stammesgenossen
allmählich ganz eingebüßt, daher ihre Romanisierung
leicht fiel. Hauptstädte ihres Gebiets waren: Gadeira oder
Gades (Cadiz) und Hispalis (Sevilla).
Turduler, ein mit den Turdetanern (s. d.) nahe verwandtes
Volk in Hispania Baetica, das höher hinauf am Bätis
wohnte, aber bald ganz mit den Turdetanern verschmolz. Ihre
Hauptstadt war Corduba (Cordova).
Turdus, Drossel; Turdidae (Drosseln), Familie der
Sperlingsvögel (s. d.).
Turek, Kreisstadt im russisch-poln. Gouvernement Kalisch,
mit (1885) 7320 Einw.
Turenne (spr. türenn), Henri de Latour d'Auvergne,
Vicomte de, Marschall von Frankreich, geb. 11. Sept. 1611 zu Sedan,
zweiter Sohn des Herzogs Heinrich von Bouillon und der Prinzessin
Elisabeth von Nassau-Oranien, wurde, nachdem er 1623 seinen Vater
verloren, von seinem Oheim, dem
910
Turf - Turgenjew.
Prinzen Moritz von Oranien, in Holland erzogen, trat 1625 in
holländische Kriegsdienste und lernte unter Prinz Friedrich
Heinrich die Kriegskunst. 1630 trat T. als Oberst in die
französische Armee, machte unter Laforce einen Feldzug nach
Lothringen und 1634 als Marechal de Camp unter Lavalette einen Zug
an den Rhein mit, wo er Mainz entsetzte. Zum Generalleutnant
ernannt, stieß er 1638 mit einem Hilfskorps zum Herzog
Bernhard von Weimar, diente 1639-43 in Piemont unter dem Grafen
d'Harcourt, dann unter Prinz Thomas von Savoyen, siegte namentlich
1640 bei Casale und Turin, eroberte Montecalvo und Ivrea und
säuberte Piemont vom Feind. Zum Marschall ernannt und mit dem
Oberbefehl über die französischen Truppen in Deutschland
betraut, reorganisierte er rasch die Truppen im Elsaß,
überschritt im Mai 1644 den Rhein, entsetzte mit dem Herzog
von Enghien (Condé) Freiburg i. Br., das General Mercy
belagerte, und befreite das ganze Rheingebiet von den Kaiserlichen.
1645 wagte er einen Einfall in Württemberg, wurde aber von
Mercy 5. Mai bei Mergentheim geschlagen und zum Rückzug hinter
den Rhein genötigt. Hier vereinigte er sich wieder mit dem
Herzog, und beide erfochten 3. Aug. bei Nördlingen einen Sieg,
worauf T. 18. Nov. noch Trier eroberte. Durch seine Leidenschaft
für die Herzogin von Longueville bestimmt, mit an die Spitze
der Fronde zu treten, vereinigte er nach der Verhaftung der Prinzen
(18. Jan. 1650) die Truppen der Fronde mit den spanischen und fiel
von Belgien aus in Frankreich ein. Er eroberte Le Catelet, La
Capelle und Rethel, ward aber 15. Dez. 1650 vom Marschall Duplessis
bei Chamblanc geschlagen und söhnte sich 1651 mit der
Königin Anna aus, worauf er seinen ehemaligen
Waffengefährten, den großen Condé, 1652 bis an
die Grenze von Flandern zurückdrängte. In den folgenden
Feldzügen eroberte T. eine Stadt nach der andern und bis zum
Pyrenäischen Frieden (1659) auch fast ganz Flandern. Zum
Generalmarschall ernannt, erhielt er im Devolutionskrieg 1667 unter
des Königs Oberbefehl das Kommando über die Armee, welche
in die spanischen Niederlande einrückte. Auf Ludwigs XIV.
Wunsch trat er 1668 zum Katholizismus über. In dem Kriege
gegen Holland 1672 befehligte er die Armee am Niederrhein gegen die
Kaiserlichen und Brandenburger, zwang den Großen
Kurfürsten 16. Juni 1673 zum Frieden von Vossem, ward aber
dann von Montecuccoli zurückgedrängt. 1674
überschritt er bei Philippsburg den Rhein, schlug 16. Juni den
Herzog von Lothringen bei Sinzheim und eroberte die ganze Pfalz,
die er auf das entsetzlichste verwüstete. Er besiegte darauf
Bournonville bei Enzheim (4. Okt.), räumte im Oktober das
Elsaß, trieb aber Anfang 1675 die Verbündeten wieder aus
diesem Land, ging über den Rhein und traf im Juli bei Sasbach
auf die Kaiserlichen unter Montecuccoli. Ehe es aber zur Schlacht
kam, wurde T. beim Rekognoszieren des Terrains 27. Juli 1675 von
einer Kanonenkugel getötet. Sein Leichnam ward auf Ludwigs
Befehl in der königlichen Gruft zu St.-Denis beigesetzt, bei
der Zerstörung der Gräber in der Revolution gerettet und
auf Napoleons I. Befehl im Dom der Invaliden, Vaubans Grabmal
gegenüber, bestattet. Bei Sasbach ward T. durch den Kardinal
Rohan 1781 ein Denkstein errichtet, den 1829 die französische
Regierung durch einen Granitobelisken ersetzen ließ. In Sedan
wurde ihm eine Statue errichtet. T. war ein methodisch gebildeter
und vorsichtiger Feldherr, ein ausgezeichneter Taktiker, daneben
überaus sorgsam in der Verpflegung und Verwendung der Truppen.
Er hat noch mehr Unglücksfälle verhütet oder wieder
gutgemacht, als Schlachten gewonnen. Eine gewinnende
Liebenswürdigkeit und Bescheidenheit zeichneten ihn aus. T.
hat selbst Memoiren hinterlassen, die von 1643 bis 1658 reichen und
unter dem Titel: "Collection des mémoires du maréchal
de T." (Par. 1782, 2 Bde.) veröffentlicht wurden. Eine
Ergänzung dazu sind die "Mémoires" von Deschamps (Par.
1687, neue Aufl. 1756). Seine Briefe gaben Grimoard (1782, 2 Bde.)
und Barthélemy (Par. 1874) heraus. Das Leben Turennes
beschrieben unter andern Ramsay (Par. 1733, 4 Bde.), Raguenet
(1738, neue Ausg. 1877), Duruy (5. Aufl. 1889) und Hozier (Lond.
1885). Vgl. außerdem Neuber, T. als Kriegstheoretiker und
Feldherr (Wien 1869); Roy, T., sa vie et les institutions
militaires de son temps (Par. 1884); Choppin, La campagne de T. en
Alsace (das. 1875); "Précis des campagnes de T."
(Brüssel 1888).
Turf (engl., spr. törf, "Rasen"), die Rennbahn und
das darauf Bezügliche (s. Wettrennen).
Turfan, Grenzprovinz Ostturkistans gegen China, grenzt an
die Gobiwüste, ist wasserlos und, bei einer
Längenausdehnung von 320 km, von nur l26,000 Einw. (Dunganen,
dann Chinesen) bevölkert. Die Stadt T. war sonst ein
blühender Karawanenplatz (für Thee und Seide) auf dem Weg
von China nach dem westlichen Asien, verlor aber zwischen 1860 und
1870 ihren Reichtum wie ihre Kaufleute infolge des
Dunganenaufstandes und der Kämpfe des ehemaligen Beherrschers
von Kaschgar um ihren Besitz.
Turfol, aus Kohlenwasserstoffen bestehendes Leuchtöl
aus Torfteer.
Turgenjew, 1) Alexander Iwanowitsch, russ. Geschichts-
und Altertumsforscher, geb. 1784, gest. 17. Dez. 1845 zu Moskau als
Geheimer Staatsrat, erwarb sich durch Forschungen für
Rußlands Geschichte, Diplomatie, alte Statistik und altes
Recht Verdienste. Die Resultate seiner Forschungen wurden von der
archäographischen Kommission veröffentlicht unter dem
Titel: "Historiae Russiae monumenta" (Petersb. 1841-42, 2 Bde.;
Nachtrag 1848).
2) Nikolai Iwanowitsch, russ. Historiker, Bruder des vorigen,
geb. 1790, studierte in Göttingen, trat dann in den
Staatsdienst seines Vaterlandes und ward 1813 dem Freiherrn vom
Stein in der Verwaltung der Frankreich abgenommenen deutschen
Provinzen als russischer Kommissar beigegeben. Nach Rußland
zurückgekehrt, ward er Wirklicher Staatsrat, trat 1819 in den
"Bund des öffentlichen Wohls" und ward dadurch in die
Verschwörung von 1825 verwickelt. Eben auf Reisen begriffen,
ward er in contumaciam zum Tod verurteilt und lebte seitdem in
Paris, wo er im November 1871 starb. Er schrieb: "La Russie et les
Russes" (Par. 1847, 3 Bde.; deutsch, Grimma 1847).
3) Iwan Sergejewitsch, berühmter russ. Dichter und
Schriftsteller, geb. 28. Okt. (a. St.) 1818 in der
Gouvernementsstadt Orel als der Nachkomme einer alten russischen
Adelsfamilie, die zur Zeit der Mongolenherrschaft in russische
Dienste trat. Seine Eltern waren sehr wohlhabend und ließen
dem künftigen Dichter und seinen beiden (vor ihm gestorbenen)
Brüdern eine gute häusliche Erziehung angedeihen, wobei
ein großer Nachdruck auf die Sprachen, namentlich
Französisch und Deutsch, gelegt wurde. 1828 siedelte die
Familie nach Moskau über, und der junge Iwan kam in eine
Privatlehranstalt. Seine weitere Ausbildung erfolgte unter
besonderer Anleitung und
911
Turgeszieren - Turgot.
Fürsorge des Professors Krause, des Direktors des
Lazarewschen Instituts. Mit 16 Jahren bezog der frühreife
Knabe die Moskauer Universität, wo er sich
historisch-philologischen Studien widmete, vertauschte dieselbe
aber schon nach einem Jahr, als 1835 sein Vater starb, mit der
Petersburger Universität, auf welcher er den vollen Lehrkursus
absolvierte. Nachdem er 1838 mit dem Grad eines Kandidaten die
Universität verlassen, begab er sich zur
Vervollständigung seiner Kenntnisse ins Ausland, wobei er auf
der Überfahrt nach Deutschland bei dem Brande des Dampfers
Nikolai I. in Travemünde fast ums Leben gekommen wäre. Er
hielt sich namentlich in Berlin auf, wo er an der Universität
Geschichte und Philosophie hörte. 1840 kehrte er zurück
und erhielt eine Anstellung in der Kanzlei des Ministers des
Innern, welche Stellung er schon im folgenden Jahr aufgab, um sich
ganz ins Privatleben zurückzuziehen. Er lebte nun bald auf
seinem Gut Sposikoje (Kreis Mzensk, Gouvernement Orel), bald in St.
Petersburg, bald im Ausland. Sein erstes Werk war das Poem
"Parascha" (1842), worauf in den folgenden Jahren einige kleine
Skizzen erschienen, welche später in das "Tagebuch eines
Jägers" aufgenommen wurden. 1852 wurde er plötzlich wegen
eines von ihm verfaßten, im übrigen durchaus nicht
politisch verfänglichen Artikels: "Ein Brief über Gogol"
("Moskauer Zeitung" 1852, Nr. 32), arretiert, bei der Polizei
eingesperrt und dann auf sein Gut verwiesen, welches er zwei Jahre
lang (bis 1855) nicht verlassen durfte. Seit 1863 lebte T. fast
ganz im Ausland, meist in Baden-Baden oder Paris, in der Regel nur
die Sommermonate auf seinem Gut zubringend. Er starb 3. Sept. 1883
in Bougival bei Paris. In Rußland werden nicht nur die
epischen, sondern auch die im Ausland weniger gekannten lyrischen
und dramatischen Dichtungen sehr hoch geschätzt. Seine
lyrischen Versuche erschienen 1841-47 in verschiedenen russischen
Monatsschriften; sie bilden zusammen einen kleinen Band. Auf
epischem und dramatischem Gebiet besitzt die russische Litteratur
folgende Dichtungen von T., die wir in chronologischer Reihenfolge
anführen: "Parascha" (Poem, 1842); "Unvorsichtigkeit",
dramatische Skizze; "Andrei" (Poem, 1843); "Eine Unterredung",
Poem; "Andrei Kolossow", "Drei Porträte" (Erzählungen,
1844); "Kein Geld!" (Szenen aus dem Petersburger Leben eines
russischen Edelmanns, 1846); "Der Jude", "Der Raufbold", "Pater
Petrowitsch Karatajew" (Erzählungen, 1847); "Petuschkow",
Erzählung; "Allzudünn reißt bald "(Lustspiel,
1848); "Der Junggeselle" (Lustspiel, 1849); "Das Tagebuch eines
überflüssigen Menschen", Erzählung; "Ein Monat im
Dorfe" (Lustspiel, 1850; letzteres hatte T. auf Verlangen der
Zensur umarbeiten müssen, und es erschien erst 1869 in seiner
ursprünglichen Form); "Eine Unterredung auf der
Landstraße", Erzählung; "Eine Dame aus der Provinz
"(Lustspiel, 1851); "Tagebuch eines Jägers", "Drei
Begegnungen" (Erzählungen, 185.2); "Zwei Freunde", "Rudin"
(Erzählungen, 1854); "Fern von der Welt", "Jakow Passynkow",
Erzählungen; "Ein Imbiß beim Adelsmarschall" (Lustspiel,
1855); "Fremdes Brot" (Lustspiel, 1857); "Asja" (Erzählung,
1858); "Das adlige Nest", Roman; "Ein Fragment aus einem Roman"
(1859); "Am Vorabend, oder Helene", "Erste Liebe"
(Erzählungen, 1860); "Väter und Söhne" (Roman,
1862); "Visionen", Phantasiebild; "Der Hund" (Skizze, 1865);
"Rauch", Roman; "Geschichte des Leutnants Jergunow", "Die
Unglückliche", "Der Brigadier" (Erzählungen 1867); "Eine
wunderliche Geschichte", "Ein König Lear der Steppe"
(Erzählungen, 1870); "Es klopft" (Erzählung, 1871);
"Frühlingswogen", "Tscherptochanows Ende" (Erzählungen,
1872); "Eine lebende Mumie" (Erzählung, 1874); "Punin und
Baburin" (Erzählung, 1875); "Die Uhr" (Erzählung, 1876);
"Neuland", Roman; "Die Erzählung des Vaters Alexei" und "Der
Traum" (Erzählungen, 1877). Außerdem sind noch, von
einigen kritischen Artikeln abgesehen, zu nennen: "Hamlet und Don
Quichotte", eine Parallele, und "Erinnerungen an W. Belinskij".
Turgenjews Romane und Erzählungen sind weniger durch
sensationelle Verwickelungen als durch eine wunderbare
Meisterschaft in der Gestalten- und Charakterzeichnung wie in der
Darlegung psychologischer Vorgänge ausgezeichnet. Ganz dem
nationalen Boden und der unmittelbaren Gegenwart angehörend,
spiegeln sie die jeweiligen Zustände und Bewegungen in
Rußland so treu wider, daß man an ihnen die Geschichte
der innern Entwickelung der Gesellschaft von Werk zu Werk wie an
Marksteinen verfolgen kann. Sie wurden vielfach ins Deutsche
übertragen; eine Sammlung "Ausgewählter Werke" in der
einzig vom Dichter autorisierten Ausgabe erschien deutsch seit 1871
in Mitau (12 Bde.); seine "Briefe" gab Ruhe in Übersetzung
heraus (erste Sammlung, Leipz. 1886). Vgl. Zabel, Iwan T. (Leipz.
1883); Thorsch, I. T. (das. 1886).
Turgeszieren (lat.), an-, aufschwellen.
Túrgor (lat., Turgeszenz), der natürliche
straffe Zustand der Gewebe des lebenden Körpers; in der
Botanik der hydrostatische Druck im Innern der lebenden Zelle.
Turgot (spr. türgo), Anne Robert Jacques, Baron de
l'Aulne, franz. Staatsmann, geb. 10. Mai 1727 zu Paris, studierte
Theologie und ward 1749 Prior der Sorbonne, trat jedoch 1751 aus
derselben aus und wandte sich den Rechts- und Staatswissenschaften
zu. Schon 1752 ward er Substitut des Generalprokurators, sodann
Parlamentsrat, 1753 Requetenmeister, endlich Mitglied der
königlichen Kammer (chambre royale). In dieser Stellung
widmete er sich besonders nationalökonomischen Studien und
neigte sich zu den Prinzipien von Quesnays physiokratischer Schule
hin. Von 1761 bis 1773 Intendant von Limoges, richtete er sein
Hauptaugenmerk aus Entlastung, Hebung und Bildung des gemeinen
Mannes, Gründung öffentlicher
Wohlthätlgkeitsanstalten, Anlage von Kanal- und Wegebauten,
Beförderung des Ackerbaues etc. Ludwig XVI. ernannte ihn kurz
nach seiner Thronbesteigung 24. Aug. 1774 zum Generalkontrolleur
der Finanzen (Finanzminister). Die in seinem berühmten Brief
an den König entwickelten Reformpläne Turgots
umfaßten eigentlich alles, was später die Revolution
durchsetzte: Dezentralisation und Selbstverwaltung, Reform des
Steuerwesens, Beseitigung des Zunftzwanges u. a., verletzten aber
alle, die dabei ein Opfer bringen sollten. Als T. 1775 die
Erlaubnis gab, an Fasttagen Fleisch zu verkaufen, bezichtigte ihn
der Klerus des Versuchs, die Religion zu vernichten, und als
infolge des vorjährigen Mißwachses eine Teurung
entstand, welcher T. durch Freigebung des Getreidehandels im Innern
von Frankreich 13. Sept. 1774 hatte abhelfen wollen, schob man die
Schuld jener Not auf diese Maßregel des Ministers. Es kam zu
mehreren Aufständen (dem sogen. Mehlkrieg, guerre des
farines), denen die privilegierten Stände noch Vorschub
leisteten. Von allen Plänen Turgots kamen so nur wenige,
wenngleich wichtige Verbesserungen und Ersparungen in den Finanzen
zur Ausführung, und der König
912
Turin (Provinz) - Turin (Stadt).
sah sich durch den allgemeinen Widerstand der privilegierten
Stände gegen Turgots neue Edikte, betreffend die Aufhebung der
Wegfronen und Zünfte, genötigt, seinen Minister im Mai
1776 plötzlich zu entlassen. T. widmete sich fortan nur
wissenschaftlichen Arbeiten und starb 8. März 1781 in Paris.
Seine "OEuvres" veröffentlichten Dupont de Nemours (Par.
1808-11, 9 Bde.) und Daire (das. 1844, 2 Bde.). Vgl. Batbie, T.,
philosophe, économiste et administrateur (Par. 1861);
Tissot, T., sa vie, son administrativ, ses ouvrages (das. 1862);
Mastier, T., sa vie et sa doctrine (das. 1862); Foncin, Essai sur
le ministère de T. (das. 1877); Jobez, La France sous Louis
XVI, Bd. 1: T. (das. 1877); Neymarck, T. et ses doctrines (das.
1885, 2 Bde.); kleine Biographien von L. Say (das. 1888) und
Robineau (das. 1889).
Turin (ital. Torino), ital. Provinz, umfaßt den
nordwestlichen Teil von Piemont, grenzt östlich an die
Provinzen Novara und Alessandria, südlich an Cuneo, westlich
an Frankreich, nördlich an die Schweiz (Kanton Wallis) und hat
ein Areal von 10,535, nach Strelbitsky 10,452 qkm (189,8 QM.). Das
Land ist zum größten Teil gebirgig und wird von den
Kottischen, Grajischen und Penninischen Alpen nebst ihren
Ausläufern durchzogen. An der Grenze gegen die Schweiz erheben
sich die Hochgipfel des Montblanc, Matterhorn und Monte Rosa. Die
zahlreichen Thäler münden alle in die bei Turin auf 12 km
verengerte Ebene des Po, der von hier an schiffbar wird und den
Pellice mit Clusone, die Chisola, Dora Riparia, Stura und Dora
Baltea aufnimmt. Die Bevölkerung belief sich 1881 auf
1,029,214 Einw. Der Boden ist namentlich in der Poebene höchst
fruchtbar und liefert Weizen (1887: 761,000 hl), Mais (692,000 hl),
Flachs, Hanf, Kastanien, Wein (333,691 hl) etc. Von Bedeutung ist
auch die Viehzucht (1881 zählte man 288,042 Stück
Rindvieh, 154,792 Schafe, 54,825 Ziegen); die Seidenzucht lieferte
1887: 1,3 Mill. kg Kokons. Das Mineralreich bietet Eisen, Blei,
Kupfer, Silber, Kobalt, Marmor, Salz etc. Die Industrie ist
namentlich durch Seidenspinnereien u. -Zwirnereien,
Seidenwebereien, Schaf- u. Baumwollmanufakturen, Papierfabriken,
Gerbereien und sonstige Lederverarbeitung, Fabriken für
Kerzen, Seife, Chemikalien, metallurgische Produkte, Ziegel, Glas-
u. Thonwaren u. a. vertreten. Die Provinz zerfällt in
fünf Kreise: Aosta, Ivrea, Pinerolo, Susa und T.
Turin (Augusta Taurinorum), Hauptstadt der gleichnamigen
ital. Provinz, bis 1861 Hauptstadt des Königreichs Sardinien
und bis 1865 des Königreichs Italien, liegt 239 m ü. M.,
in einer herrlichen, ostwärts von den Höhen der
montferratischen Berge begrenzten Ebene. Die Lage ist für
kriegerischen wie friedlichen Verkehr hervorragend günstig,
denn es geht hier die obere piemontesische Ebene mit den dort
vereinigten Straßen durch die Verengerung von T. in die
mittlere und untere Poebene über, so daß hier der
Verkehr zwischen beiden Ebenen, den das Bergland von Montferrat
sonst hindern würde, vermittelt wird. Der Po wird hier durch
Aufnahme der Dora Riparia schiffbar, in deren Thal die beiden
wichtigen Alpenstraßen von Savoyen über den Mont Cenis
(jetzt Eisenbahn) und aus der Dauphiné über den Mont
Genèvre vereinigt auf T. gehen, das damit zu einem wichtigen
Straßenknoten und Schlüssel der gangbarsten Pässe
über die Westalpen wird. Selbst die Straßen über
den Großen und Kleinen Bernhard im Dora Baltea-Thal
aufwärts lassen sich noch von T. aus beherrschen. So hat T.
als natürlicher Mittelpunkt des ganzen obern Pogebiets in der
Kriegsgeschichte, bis 1801 auch als starke Festung, eine
große Rolle gespielt (s. unten, Geschichte). Dank seiner Lage
und dem durch die Mont Cenis-Bahn mächtig gewachsenden
Verkehr, hat es die Verlegung der Hauptstadt leicht verwunden und
ist in hoffnungsvollem Aufschwung begriffen. Außer dieser
Bahn vereinigen sich hier die Linien über Novara nach Mailand,
über Alessandria nach Genua und Piacenza, über Brà
nach Savona, nach Cuneo, Pinerolo, Rivoli, Lanzo, Rivarolo,
über Ivrea nach Aosta, Biella, Arona. Die reizende Lage und
die regelmäßige Bauart machen T. zu einer der
schönsten Städte Italiens. Es zerfällt in sieben
Stadtteile (Dora, Moncenisio, Monviso, Po, Borgo San Salvatore,
Borgo Po und Borgo Dora) und hat langgedehnte, breite und gerade
Straßen und weite, stattliche Plätze. Die ehemaligen
Festungswerke sind zu schönen Spaziergängen umgewandelt.
Die schönsten Straßen sind die Via di Po, die Via di
Roma, die Via Garibaldi und der Corso Vittorio Emmanuele. Unter den
40 Plätzen zeichnen sich aus: die Piazza Castello, rings von
Hallen umgeben; die Piazza Carlo Alberto; die Piazza Carlo Felice
(mit hübschen Anlagen versehen); die große, 1825
angelegte Piazza Vittorio Emmanuele, welche sich bis zu der 1801
unter Napoleon I. erbauten großen steinernen Pobrücke
hinzieht; die Piazza del Palazzo di Città, die Piazza dello
Statuto mit dem Denkmal für den Bau des Mont Cenis-Tunnels und
die Piazza Cavour (mit Anlagen). Die hervorragenden
Monumentalbauten sind nicht die Kirchen, sondern die Paläste,
welche mit Ausnahme des Palazzo Madama auf der Piazza Castello (von
1416) meist einer spätern Zeit angehören (17. und 18.
Jahrh.). Dazu gehören das königliche Schloß auf der
Nordseite der Piazza Castello (1660 erbaut), mit den Reiterstatuen
von Kastor und Pollux und dem Reiterbild des Herzogs Viktor Amadeus
I. (im Vestibül), der königlichen Bibliothek (50,000
Bände, 2000 Manuskripte), einer reichen Sammlung von
Handzeichnungen (über 20,000 Stück) und Münzen, der
berühmten königlichen Rüstkammer (armeria reale),
einem schönen Schloßgarten und, hieran anstoßend,
einem zoologischen Garten; der Palazzo Carignano (von 1680),
ehemals Sitz des Parlaments, jetzt der Gemeinde gehörig; der
Palast der Akademie der Wissenschaften (früher
Jesuitenkollegium, 1678 von P. Guarini erbaut); das
Universitätsgebäude (von 1713), das Stadthaus (von 1665),
der Palazzo delle due Torri, das Teatro regio (von 1738) und das
Teatro Carignano (von 1787), wozu neuerdings der Zentralbahnhof
(1865-68 von Mazzucchetti erbaut), die Galleria Industriale und
mehrere kleinere Theater hinzugekommen sind. Unter den 40 Kirchen
von T. zeichnen sich aus: die Kathedrale San Giovanni, ein
Renaissancebau mit der schwarzmarmornen Grabkapelle del Sudario
(1657-1694 von Guarini erbaut); die Kirchen Beata Vergine della
Consolazione (1679 ausgeführt), San Filippo (1714 vollendet),
Corpus Domini (von 1753), die Kuppelkirche San Massimo, die Rotunde
Gran Madre di Dio (1818-49 erbaut) und die protestantische Kirche
(tempio Valdese, 1851 erbaut). T. ist außerordentlich reich
an Denkmälern, welche das savoyische Haus, die
Staatsmänner und großen Geister
[Wappen von Turin.]
913
Turinsk - Türk.
des Landes verherrlichen. Dazu gehören: das Reiterbild
Emanuel Philiberts auf der Piazza San Carlo (von Marochetti, 1838);
das Denkmal Amadeus' VI. auf der Piazza Palazzo di Città;
die Marmorstatuen des Prinzen Eugen von Savoyen und des Prinzen
Ferdinand (1858) vor dem Rathaus; die der Könige Karl Albert
und Viktor Emanuel in der Vorhalle des Rathauses; ferner auf der
Piazza Carlo Alberto die Reiterstatue Karl Alberts (von Marochetti,
1861); auf der Piazza Carignano das Denkmal Giobertis (von
Albertoni, 1860); auf der Piazza Carlo Felice die Statue d'Azeglios
(von Balzico, 1873); auf der Piazza Carlo Emmanuele II. das
große Denkmal Cavours (von Dupré, 1873); ferner
Statuen von Lagrange, Brofferio, Cassini, Micca (des Retters der
Stadt 1706), Pepe, Bava, Balbo, Manin, des Herzogs Ferdinand von
Genua u. a.
Die Zahl der Bewohner beträgt (1881) 230,183, mit dem
Gemeindebezirk 252,832. Die Industrie hat in der neuern Zeit
erhebliche Fortschritte gemacht, besonders in der Fabrikation von
Seidenstoffen und Tapeten; außerdem bestehen Fabriken
für Bijouteriewaren, Möbel, Pianofortes, Maschinen,
Liköre, Leder, Handschuhe und andre Lederarbeiten, Tuch,
Zündhölzchen, Papier, Tabak u. a. Zur Förderung der
Industrie und des Handels besitzt die Stadt eine Sparkasse, 10
Bankinstitute, 25 Aktiengesellschaften u. a. Für den Verkehr
sorgen die oben erwähnten Eisenbahnen, mehrere Pferdebahnen
und Dampftramways und die Poschiffahrt. Unter den Bildungsanstalten
der Stadt behauptet den ersten Rang die 1412 gegründete
Universität (250 Lehrer, über 2100 Studierende,
nächst der Universität in Neapel die größte
Frequenz in Italien) mit vier Fakultäten und einer Bibliothek
von 225,000 Bänden nebst zahlreichen Manuskripten. Sie ist
auch mit allen notwendigen Museen und Instituten ziemlich gut
versehen. Andre Bildungsinstitute sind: eine Ingenieurschule, ein
Seminar, ein Lyceum, ein Lycealgymnasium, 2 Gymnasien, ein
Gewerbeinstitut, die Kriegsschule, eine Artillerie- und
Genieschule, eine Militärakademie, 4 technische Schulen, eine
Tierarzneischule etc.; ferner die Akademie der Wissenschaften (1759
gegründet) mit wertvoller Bibliothek (40,000 Bände) u.
Altertumsmuseum, eine medizinisch-chirurgische Akademie mit
Bibliothek (20,000 Bände), eine Akademie der schönen
Künste (Albertina), ein Kunstverein, ein Industriemuseum
(welches auch Gewerbeschullehrer heranbildet), eins der reichsten
Staatsarchive in Europa (mit Urkunden der Karolinger), eine
Gemäldesammlung (über 500 Nummern, darunter Gemälde
von P. Veronese, Raffael, van Dyck, Memling u. a.), ein
städtisches Museum, ein Museum der Renaissance (1863 als
Synagoge erbaut), zahlreiche Gesellschaften und Vereine. T. besitzt
ferner eine bedeutende Anzahl gut dotierter
Wohlthätigkeitsanstalten verschiedenster Art und ist der Sitz
des Präfekten, eines Erzbischofs, eines Kassationshofs, eines
Appell- und Assisenhofs, eines Zivil- und Korrektionstribunals,
einer Finanzintendanz, eines Generalkommandos, einer Handelskammer
und eines Handelstribunals sowie eines deutschen Konsuls. Unter den
öffentlichen Spaziergängen sind namentlich der Nuovo
Giardino pubblico, woran sich der botanische Garten und das
malerische Castel del Valentino anschließen, und von wo eine
Kettenbrücke aufs rechte Ufer des Po führt, der
Schloßgarten mit dem zoologischen Garten und der Giardino di
Città anzuführen. Der schönste Punkt der weitern
Umgegend ist die 678 m hoch gelegene, seit 1884 durch eine
Drahtseilbahn zugängliche prachtvolle Klosterkirche La Superga
mit der königlichen Familiengruft und herrlicher Aussicht auf
die Alpen.
Geschichte. T. war im Altertum unter dem Namen Taurasia Hauptort
der gallischen Taurini, wurde 218 v. Chr. von Hannibal erobert und
erhielt unter Augustus eine römische Kolonie und den Namen
Augusta Taurinorum. Die Langobarden, in deren Besitz die Stadt um
570 n. Chr. kam, ließen sie durch Herzöge verwalten. In
der Folge bemächtigten sich die Markgrafen von Susa der
Herrschaft, und nach deren Aussterben (um 1060) folgte das Haus
Savoyen. Venedig u. Genua schlossen 1381 unter Vermittelung des
Herzogs Amadeus von Savoyen in T. Frieden. 1506 von den Franzosen
erobert, blieb T. in deren Besitz bis 1562. Damals erhielt es
Herzog Philibert zurück, machte es zu seiner Residenz und
erbaute 1567 die Citadelle. 1640 nahmen die Franzosen unter
Harcourt T. nach 17tägiger Belagerung ein. Am 29. Aug. 1696
wurde hier der Separatfriede zwischen Savoyen und Frankreich
geschlossen. Von den Franzosen unter dem Herzog von Orléans
belagert, ward T. durch den Sieg der Kaiserlichen unter Prinz Eugen
7. Sept. 1706 befreit. 1798 von den Franzosen eingenommen, ward es
25. Mai 1799 von den Österreichern und Russen unter Suworow
wieder befreit. Nach der Schlacht bei Marengo (1800) kam T. aufs
neue in die Gewalt der Franzosen und blieb in derselben als
Hauptstadt des Podepartements, bis es, seiner Befestigungswerke bis
auf die Citadelle beraubt, 1814 durch den Pariser Frieden dem
König von Sardinien zurückgegeben ward und nun wieder
Residenz und Hauptstadt wurde. Es blieb dies, bis infolge der
sogen. Septemberkonvention (15. Sept. 1864) die Residenz und der
Sitz der Zentralbehörden des Reichs im Mai 1865 nach der neuen
Hauptstadt Italiens, Florenz, verlegt wurde. Nach dem Bekanntwerden
der Septemberkonvention kam es 20.-22. Sept. 1864 zu einem blutigen
Aufruhr, der nur durch Waffengewalt unterdrückt werden konnte.
Vgl. Promis, Storia dell' antica Torino (Tur. 1869); Cibrario,
Storia di Torino (das. 1847, 2 Bde., für das Mittelalter);
Borbonese, Torino illustrata e descritta (das. 1884).
Turinsk, Stadt im russisch-sibir. Gouvernement Tobolsk,
an der Mündung der Jalimka in die Tura, hat eine Kirche, ein
Nonnenkloster und (1885) 4658 Einw., welche ansehnliche Gerberei
betreiben.
Turiones (lat.), Sprosse; T. (Gemmae) Pini,
Kiefernsprosse.
Türk, 1) Daniel Gottlob, ausgezeichneter Organist
und Musiktheoretiker, geb. 10. Aug. 1756 zu Klaußnitz bei
Chemnitz, besuchte die Kreuzschule in Dresden, 1772 die
Universität Leipzig, wo er unter Hiller die schon früher
begonnenen Musikstudien fleißig fortsetzte, wurde 1776 Kantor
an der Ulrichskirche in Halle, 1779 Universitätsmusikdirektor
und 1787 Organist an der Frauenkirche; starb 26. Aug. 1813 da
selbst. Seine theoretischen und didaktischen Werke sind: "Von den
wichtigsten Pflichten eines Organisten" (Leipz. u. Halle 1787, neue
Ausg. 1838); "Klavierschule", mit kritischen Anmerkungen (das.
1789); "Kurze Anweisung zum Generalbaßspielen" (das. 1791; 5.
Aufl. von Naue, 1841); "Anleitung zu Temperaturberechnungen" (das.
1806) etc. Von seinen Kompositionen erschienen ein Oratorium: "Die
Hirten bei der Krippe in Bethlehem", 18 Klaviersonaten, Lieder u.
a. im Druck.
2) Karl Christian Wilhelm von, namhafter Schulmann, geb. 8. Jan.
1774 zu Meiningen, studierte in Jena die Rechte und ward 1794
mecklenburgischer
Meyers Konv.-Lexikon, 4 Aufl., XV. Bd.
58
914
Turka - Türkische Sprache und Litteratur.
Kammerjunker und Justizrat in Neustrelitz. Seit 1800 mit
Schulsachen betraut, faßte er für diese entschiedene
Vorliebe, besonders seit einer Reise durch Deutschland und die
Schweiz mit längerm Aufenthalt bei Pestalozzi (1804). Er
folgte 1805 einem Ruf als Justiz- und Konsistorialrat nach
Oldenburg, legte aber wegen der Schwierigkeiten, denen seine
pädagogischen Bestrebungen begegneten, sein Amt 1808 nieder
und widmete sich anfangs als Gehilfe Pestalozzis zu Yverdon, dann
als Leiter einer selbständigen Anstalt in Vevay der Erziehung.
1815 als Regierungs- und Schulrat nach Frankfurt a. O. berufen,
1816 nach Potsdam versetzt, reorganisierte er das Schul- und
Seminarwesen der Mark in Pestalozzis Sinn. 1833 legte er seine
Stelle nieder, um sich der Leitung einer von ihm gegründeten
Zivilwaisenanstatt zu widmen, und starb 31. Juli 1846 in
Kleinglienecke bei Potsdam. Auch um Einführung des Seidenbaues
in Deutschland hat er sich verdient gemacht. Türks zahlreiche
Schriften haben seiner Zeit Aufsehen erregt, sind aber jetzt
überholt worden. Vgl. "Leben und Wirken des Regierungsrats W.
v. T., von ihm selbst niedergeschrieben" (Potsd. 1859).
Turka, Stadt in Galizien, an der Nordseite der Karpathen,
Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines Bezirksgerichts, mit
(1880) 4685 Einw.
Türken, einer der drei Zweige der altaischen
Völkerfamilie, der sich gegenwärtig in seinen einzelnen
Ausläufern von den grünen Gestaden des Mittelmeers bis an
die eisigen Ufer der Lena in Sibirien erstreckt. Ihre Urheimat ist
Turkistan, von wo wahrscheinlich schon vor Beginn unsrer
Zeitrechnung mehrere Stämme nach verschiedenen Richtungen
ausgezogen sind und sich den einzelnen Eroberungen der
hochasiatischen Völker angeschlossen haben. Schon von den
Römern gekannt, haben sie gleich den Mongolen große,
mächtige Reiche gegründet, das Römerreich
gezüchtigt und ganz Europa in Schrecken versetzt. Die Throne
Chinas, Persiens, Indiens, Syriens, Ägyptens und des
Kalifenreichs wurden von den T. in Besitz genommen. Man hat zu den
T. die jetzt nicht mehr existierenden Petschenegen, Kumanen,
vielleicht auch die Chasaren und weißen Hunnen zu rechnen,
gegenwärtig gehören zu ihnen die Jakuten, die sibirischen
Tataren, Kirgisen, Uzbeken (Özbegen), Turkomanen,
Karakalpaken, Nogaier, Kumüken, basianischen T., Karatschai,
die sogen. kasanschen Tataren, Osmanen (die von den frühern
Seldschukken abstammen), Dunganen und Tarantschi; sprachlich sind
hierher auch zu rechnen die Baschkiren, Tschuwaschen,
Meschtscherjäken u. Teptjaren im südlichen Ural und an
der Wolga. Mit Ausnahme der Jakuten sind die T. durchweg
Anhänger des Islam, alle sind trotz der vielfachen Eroberungen
nomadisierende Hirten geblieben, die sich aber bei gebotener
Gelegenheit in räuberische Kriegshorden verwandelten.
Gegenwärtig versteht man unter T. gewöhnlich die Osmanen
(Osmanly) und bezeichnet die von ihnen eroberten und beherrschten
Länder als Türkei oder türkisches Reich. Vgl.
Vambéry, Skizzen aus Mittelasien (Leipz. 1868); Derselbe,
Das Türkenvolk in seinen ethnologischen und ethnographischen
Beziehungen (das. 1885); Radloff, Ethnographische Übersicht
der Türkstämme Sibiriens und der Mongolei (das.
1883).
Türkenbund, s. v. w. Turban; dann eine Pflanze, s.
v. w. Lilium Martagon L. (s. Lilium).
Türkenpaß, s. Algierscher Paß.
Türkensattel, eine Vertiefung im Keilbein, s.
Schädel, S. 373.
Türkensteuern, Steuern, welche seit dem 16. Jahrh.
aus Veranlassung der Türkenkriege (besonders in
Österreich) erhoben wurden.
Turkestan, s. Turkistan.
Turkestan, Stadt im asiatisch-russ. Generalgouvernement
Turkistan, Provinz Sir Darja, an der Poststraße nach
Orenburg, mit (1881) 6700 Einw. Die alte Moschee Asret war bis zur
Eroberung der Stadt durch die Russen (1864) ein in hohem Ruf
stehender Wallfahrtsort der Mohammedaner.
Turkeve, Stadt im ungar. Komitat
Jász-Kis-Kun-Szolnok mit (1881) 12,042 ungar. Einwohnern
(Katholiken und Reformierte).
Türkheim, Stadt im deutschen Bezirk Oberelsaß,
Kreis Kolmar, an der Fecht, aus der hier der Logelbach nach Kolmar
führt, und an der Eisenbahn Kolmar-Münster, hat eine
kath. Kirche, Baumwollspinnerei, Papierfabrikation, vortrefflichen
Weinbau und (1885) 2544 Einw. Nordwestlich davon, auf der Höhe
der Vogesen, liegt Drei-Ähren (s. Ammerschweier). -T., ehemals
Thorencoheim oder Türnicheim, erhielt 1312 Stadtrecht und
gehörte dann zu den zehn elsässischen freien
Reichsstädten. Hier 5. Jan. 1675 Sieg der Franzosen unter
Turenne über den kaiserlichen Feldherrn v. Bournonville, den
Herzog Karl von Lothringen und den Kurfürsten Friedrich
Wilhelm von Brandenburg. Vgl. Gérard, La bataille de T.
(Kolmar 1870).
Türkis (Kalait, Agraphit, Johnit), Mineral aus der
Ordnung der Phosphate, findet sich amorph in Trümern oder
Adern, nierensörmig und stalaktitisch, auch derb, eingesprengt
und als Gerölle, ist blau oder grün, undurchsichtig,
wenig glänzend, Härte 6, spez. Gew. 2,62-2,80, besteht
aus wasserhaltiger phosphorsaurer Thonerde Al2P2O8 + H2A2O6 + 2H2O
mit etwas Eisen und Kupfer, letzteres als färbendes Prinzip.
Der orientalische T., der in Adern, Thonschiefer durchsetzend, zu
Nischapur und Mesched in Persien (s. Tafel "Edelsteine", Fig. 8)
und im Porphyr des Megarathals in Arabien vorkommt, war ein im
Mittelalter als glückbringendes Amulett hochgeschätzter
und ist auch jetzt ein vielbenutzter Edelstein, aber von geringem
Wert. Weniger schöne Varietäten stammen von der
Jordansmühle in Schlesien, von Ölsnitz in Sachsen, von
Mexiko und Nevada. Der sogen. Zahntürkis (Beintürkis,
occidentalischer T., T. vom jüngern Stein) ist natürlich
oder künstlich gefärbter Zahnschmelz oder Elfenbein, in
ersterm Fall von Mastodon und Dinotherium. Er erreicht beinahe die
Härte des mineralischen Türkises, ist meist intensiver
gefärbt, erscheint aber bei Kerzenbeleuchtung
bläulichgrau. Natürliche Zahntürkise kommen in
Sibirien und im Languedoc vor.
Türkische Becken, s. Becken, S. 588.
Türkische Kresse, s. v. w. Tropaeolum majus.
Türkische Melisse, s. Dracocephalum.
Türkischer Klee, s. v. w. Esparsette, s.
Onobrychis.
Türkischer Weizen, s. Mais.
Türkische Sprache und Litteratur. Die türkische
oder osmanische (türk. Osmanli) Sprache gehört zur
türkisch-tatarischen Abteilung der großen uralaltaischen
Sprachenfamilie (s. d.). Im weitern Sinn bezeichnet man alle
Sprachen dieser Abteilung, die bis zur Lena in Sibirien reichen und
sehr nahe miteinander verwandt sind, als türkische;
gewöhnlich versteht man aber im engern Sinn die Sprache der
Osmanen, d. h. der europäischen und klein-asiatischen
(anatolischen) Türken, darunter. Die beiden charakteristischen
Eigentümlichkeiten des uralaltaischen Sprachstammes, die
Agglutination und die Vokalharmonie (s. d.), treten im
Türkischen in
915
Türkische Sprache und Litteratur
kräftigster Weise hervor. Erstere ermöglicht
namentlich die Bildung einer bedeutenden Menge von Konjugationen,
wobei der Stamm des Verbums stets unverändert an der Spitze
des Wortes stehen bleibt. So heißt sev-mek "lieben",
sev-isch-mek "einander lieben", sev-isch-dir-mek "einander lieben
machen", sev-isch-dir-il-mek "einander lieben gemacht werden",
sev-isch-dir-il-me-mek "nicht einander lieben gemacht werden" etc.
Während so der grammatische Bau rein uralaltaisch ist, hat der
Wortschatz eine mannigfache Versetzung mit europäischen,
namentlich aber mit arabischen und persischen Sprachelementen
erfahren. Die natürliche Folge dieser Vermischung mit fremden
Sprachelementen ist eine beträchtliche Verminderung des
ursprünglichen türkischen Wortschatzes gewesen. Ihr
Alphabet haben die Türken von den Arabern entlehnt, den 28
arabischen Konsonantenzeichen aber fünf neue Konsonanten
hinzugefügt, von denen drei ihnen mit den Persern gemein sind,
einer rein persisch und einer rein türkisch ist. Wie die
Araber und Perser, schreiben und lesen die Türken von rechts
nach links. In der Schrift und im Druck werden die Zeichen des
Alphabets in verschiedener Weise kalligraphisch gemodelt. Es gibt
daher besondere Schriftgattungen für den Bücherdruck, die
Fermane (amtlichen Erlasse), die Poesie, den Briefverkehr
(Kursivschrift) etc. Vgl. Grimm, Über die Stellung, Bedeutung
und einige Eigentümlichkeiten der osmanischen Sprache (Ratib.
1877, Schulprogramm); ferner die Grammatiken von Redhouse
("Grammaire raisonnée de la langue ottomane", Par. 1846;
"Simplified grammar", Lond. 1884) und Kazem Beg (deutsch von
Zenker, Leipz. 1848), die zur praktischen Erlernung der Sprache
dienenden Handbücher von Bianchi ("Guide de la conversation en
français et en turc", Par. 1839), Wahrmund ("Praktisches
Handbuch der osmanisch-türkischen Sprache, mit
Wörtersammlung etc.", 2. Aufl., Gieß. 1884), Wells ("A
practical grammar of the Turkish language", Lond. 1880), A.
Müller ("Türkische Grammatik", Berl. 1889) u. a. und die
Wörterbücher von Meninski ("Thesaurus linguarum
orientalium", Wien 1660; 2. Ausg., das. 1780, 4 Bde.), Kieffer und
Bianchi ("Dictionnaire-turc-français", 2 Tle., 2. Aufl.,
Par. 1850), von Bianchi ("Dictionnaire francais-turc à
l'usage des agents diplomatiques", 2. Aufl., das. 1843-46, 2 Tle.),
Redhouse ("Turkish dictionary", 2. Aufl., 1880), Barbier de Meynard
("Dictionnaire turc-français", Par. 1881 ff., bisher 2
Bde.), Zenker ("Türkisch-arabisch-persisches
Handwörterbuch", Leipz. 1866-76, 2 Bde.), Mallouf
("Dictionnaire français-turc", 3. Aufl., Par. 1881);
für seinen besondern Zweck sehr wertvoll ist v.
Schlechte-Wssehrds "Manuel terminologique français-ottoman"
(Wien 1870), ein bequemes Handbuch Vambérys
"Deutsch-türkisches Handwörterbuch" (Konstantinop. 1858).
Für Reisezwecke dienen Finks "Türkischer Dragoman" (2.
Aufl., Leipz. 1879) und Heintzes "Türkischer
Sprachführer" (das. 1882). Die beste Chrestomathie ist
diejenige von Wickerhausen (Wien 1853), für Anfänger
recht praktisch die von Dieterici (Berl. 1854, mit grammatischen
Paradigmen und Glossar).
Wie den Islam, haben die Türken auch ihre geistige Bildung
durch die Araber und Perser erhalten. Die türkische Litteratur
bietet uns daher wenig Originelles dar, sie ist vielmehr
größtenteils eine Nachahmung persischer und arabischer
Muster. Eins der ältesten poetischen Denkmäler der
osmanischen Sprache ist das "Bâz nâmeh", ein Gedicht
über die Falknerei, welches Hammer-Purgstall mit einem
neugriechischen und mitteldeutschen von ähnlichem Inhalt
zusammen unter dem Titel: "Falknerklee" herausgegeben und
übersetzt hat (Pest 1840). Die osmanischen Dichter sind sehr
zahlreich; Hammer-Purgstall hat in seiner "Geschichte der
osmanischen Dichtkunst" (Pest 1836-38, 4 Bde.) uns allein 2200
Dichter mit Proben aus ihren Werken und kurzen biographischen
Notizen vorgeführt. Hier heben wir nur die
hauptsächlichsten hervor. Vor allen ist Lami (s. d.) zu
nennen, wohl der fruchtbarste unter den osmanischen Dichtern (gest.
1531) und besonders durch seine vier großen epischen Gedichte
berühmt. Ein sehr selbständiger Dichter ist Fasli, der
unter Soliman d. Gr. lebte und 1563 starb. Sein allegorisches
Gedicht "Gül u Bülbül" ("Rose und Nachtigall",
deutsch von Hammer-Purgstall, Pest 1834) ist unter allen
türkischen Gedichten europäischem Geschmack am meisten
entsprechend. Der größte Lyriker der Osmanen ist Baki
(gest. 1600), dessen "Diwan" Hammer-Purgstall (Wien 1825, wozu noch
zu vergleichen "Geschichte der osmanischen Dichtkunst", Bd. 2, S.
360 ff.) deutsch herausgegeben hat. Die Osmanen selbst haben eine
erhebliche Anzahl von Blumenlesen aus ihren Dichtern
zusammengestellt. Die größte unter denselben ist
"Subdet-ul-esch'âr" ("Creme der Gedichte") von Mollah Abd ul
hajj ben Feisullah, genannt Kassade (gest. 1622), welche
Auszüge aus 514 Dichtern nebst biographischen Notizen
enthält. Auf dem Gebiet der Märchen und Erzählungen
sind zu erwähnen: das "Humajunnâme" ("Kaiserbuch", vgl.
v. Diez, Über Vortrag, Entstehung und Schicksale des
Königlichen Buches, Berl. 1811; gedruckt Bulak 1836), eine
Übersetzung der persischen Bearbeitung der Fabeln des Bidpai
von Ali Tschelebi; ferner das "Tutinâme" ("Papageienbuch")
des Sari Abdallah, ebenfalls aus dem Persischen (gedruckt Bulak
1838, Konstantinop. 1840; übers. von G. Rosen, 2 Bde., Leipz.
1858, und Wickerhauser, Hamb. 1863); die aus dem Arabischen
übersetzten Geschichten der vierzig Wesire von Scheich Sade
(türkisch hrsg. von Belletête, Par. 1812; deutsch von
Behrnauer, Leipz. 1851). Zur Volkslitteratur gehören vor allem
der unter dem Namen "Sîret-i Sejjid Batthâl" bekannte
Ritterroman (vgl. Fleischer, Kleinere Schriften, Bd. 3, S. 226 ff.;
gedruckt Kasan 1888, übers. von Ethé, Leipz. 1871, 2
Bde.) und die "Latha'if-i Chodscha Nassreddin Efendi"
("Schwänke des Herrn Meisters Nassr ed din", des
türkischen Eulenspiegel, Konstantinop. 1837 u. ö., Bulak
1838; franz. von Decourdemanche, Par. 1876, Brüss. 1878;
deutsch von Murad Efendi, Oldenb. 1877). Türkische Volkslieder
veröffentlichte I. Kunos in der Wiener "Zeitschrift für
die Kunde des Morgenlandes", 2. u. 3. Bd. (1888-89);
Volksmärchen derselbe (ungarisch, Budapest 1887; deutsch in
der "Ungarischen Revue" 1888-89), ebenso ein Volksschauspiel
("Ortaojunu", Budapest 1888, türk. u. ungar.). Zahlreich und
charakteristisch sind die türkischen Sprichwörter, von
denen eine beliebte Sammlung Schinasi veranstaltet hat (gedruckt
Konstantinop. 1863 u. öfter); eine andre ist von der Wiener
orientalischen Akademie herausgegeben worden ("Osmanische
Sprichwörter", Wien 1865, mit deutscher und franz.
Übersetzung); "1001 proverbes turcs" übersetzte
Decourdemanche (Par. 1878). Für die Geschichte ihres Reichs
haben die Osmanen viel Material zusammengetragen. Ihre
Reichsannalen beginnen mit dem Ursprung des osmanischen
Herrscherhauses und reichen bis in die Gegenwart. Die Verfasser
derselben sind: Saad ed
916
Türkische Sprache und Litteratur.
din, dessen Annalen bis 1522 reichen (bis Murad I.,
türkisch und lateinisch hrsg. von Kollar, Wien 1750); Naima
Efendi, von 1591 bis 1659 (Konstantinop. 1734, 2 Bde.; 1863, 6
Bde.; engl. von Fraser, Lond. 1832, 2 Bde.); Raschid, von 1660 bis
1721 (Konstantinop. 1741, 3 Bde.; 1865); Tschelebisade, von 1721
bis 1728 (das. 1741); Sami, Schakir und Sübhi, von 1730 bis
1743 (das. 1784); Izzi, von 1744 bis 1752 (das. 1784));
Waßif, von 1752 bis 1773 (das. 1805, 2 Bde., und Kairo 1827
u. 1831); Enweri, von 1759 bis 1769 (Bulak 1827); Dschewdet, von
1774 bis 1825 (Konstantinop. 1855-84, 12 Bde.; Bd. 1-8, neue Ausg.,
das. 1886); Aßim, von 1787 bis 1808 (das. 1867); Lutfi, von
1832 bis 1838 (das. 1873-85). Eine Art Zusammenfassung und
Ergänzung zu den Reichsannalen bildet die große
"Geschichte der osmanischen Dynastie" von Cheirullah Efendi (15
Bde., Konstantinop. 1853-69; Bd. 1-10 in neuer Ausg., das. 1872).
Ein großer Teil des in diesen Reichsannalen niedergelegten
historischen Materials ist von Hammer-Purgstall in seiner
"Geschichte des osmanischen Reichs" verarbeitet worden; daneben
fehlt es nicht anzahlreichen Einzelschriften, wie des
Kemâlpaschasâde "Geschichte des Feldzugs von
Mohácz" (türk. u. franz. von Pavet de Courteille, Par.
1859). Die neuern türkischen Geschichtschreiber hat v.
Schlechta-Wssehrd ("Die osmanischen Geschichtschreiber der neuern
Zeit", Wien 1856) behandelt. Als einer der gelehrtesten Historiker
der Türken ist noch Hadschi Khalfa zu erwähnen. Er
schrieb das "Takwim-ut-tewarich" ("Tafel der Geschichte",
Konstantinop. 1733) und das "Tochfet-ul-kibâr" ("Geschenk der
Großen"), welches die Seekriege der Osmanen behandelt (das.
1729 u. 1873-76; ein Teil engl. von I. Mitchell, Lond. 1831). Um
die Geographie machte er sich verdient durch sein geographisches
Wörterbuch "Dschihân-numâ" ("Buch der Weltschau",
Konstantinop. 1732; lat. von Norberg, Lund 1818, 2 Bde.). Von
sonstigen geographischen Werken erwähnen wir die Reisen in
Europa, Asien und Afrika des Evlia Efendi (von Hammer-Purgstall ins
Englische übersetzt, Lond. 1834-46), des Mohammed Efendi
(hrsg. von Jaubert, Par. 1841) und eine geographische Beschreibung
Rumeliens und Bosniens, die Hammer-Purgstall (Wien 1812)
übersetzt hat. Auf dem Gebiet der Sprachwissenschaft dienen
den Türken die Araber zum Vorbild. Eine brauchbare Grammatik
ihrer eignen Sprache haben Mohammed Fuad Efendi und Ahmed Dschewdet
Efendi geliefert. Das Buch führt den Titel: "Kawâid-i
Osmânijje" ("Grundregeln der osmanischen Sprache",
Konstantinop. 1851 u. 1859) und ist von H. Kellgren (Helsingf.
1855) ins Deutsche übersetzt worden. Auf dem Gebiet der
Lexikographie haben die Türken ihre eigne Sprache
vernachlässigt, desto eifriger aber das Arabische, das bei
ihnen die Gelehrtensprache ist, und das Persische bearbeitet. Zu
nennen sind hier: Wânkûlis Übersetzung des
arabischen Wörterbuchs von Dschauhari (Konstantinop. 1803, 2
Bde.); Aßim Efendis Übersetzung des arabischen
Wörterbuchs "Kamus" (das. 1814-17, 3 Bde.; 1856, 3 Bde.; Kairo
1835, 3 Bde.), mit vielen gehaltvollen Zusätzen; Achmet Emin
Efendis Übersetzung des persischen Wörterbuchs
"Burhân-i kati" (Konstantinop. 1799, Kairo 1836). Das zu
Konstantinopel 1742 in 2 Bänden erschienene
persisch-türkische Wörterbuch "Ferheng-i Schu'uri" ist
durch seine zahlreichen Citate aus persischen Dichtern besonders
wichtig. Es existieren ferner eine Reihe sachlicher und
grammatischer Kommentare zu den beliebtesten persischen
Dichterwerken, wie die Kommentare des Sudi zu Saadis "Gulistan"
(Konstantinop. 1833) und zu den Gedichten des Hafis (Kairo 1834, 3
Bde.; zum Teil von H. Brockhaus seiner Ausgabe der Gedichte des
Hafis, Leipz. 1855-63, beigefügt), des Ismael Hakki zu dem
"Pendnâme" des Ferid ed din Attar (Kairo 1834) und zu dem
"Mesnewi" des Dschelâl ed din Rumi (das. 1836, 6 Bde.). Die
Medizin ist in neuerer Zeit durch außerordentlich zahlreiche
Schriften vertreten, welche zeigen, daß die türkischen
Ärzte mehr und mehr den Forschungen ihrer westlichen Kollegen
Rechnung zu tragen bemüht sind. Die eigentliche türkische
Jurisprudenz ruht auf der festen Grundlage des Korans und der
Sunna. An den türkischen Akademien wird sie neben der
Theologie des Islam am meisten kultiviert. Viele juristische Werke
sind auch bereits durch den Druck veröffentlicht, so:
große Sammlungen der sogen. Fetwas, gerichtlicher
Entscheidungen in schwierigen Fällen, der sogen. Sakks,
Urkunden oder Formulare für alle möglichen Fälle der
Gerichtsordnung, das Strafgesetzbuch etc. In neuerer Zeit haben die
Berührungen mit dem Abendland eine von der islamitischen
Tradition unabhängige Nebengesetzgebung erzwungen, die mehr
und mehr auf das Gebiet des echten islamitischen Rechts
übergreift, wenn sie auch zunächst auf die Erfordernisse
des internationalen Verkehrs (Handelsgesetzbuch, Zollreglements u.
dgl.; Verträge aller Art; Verfassungsurkunden und sonstige
diplomatische Aktenstücke) zugeschnitten ist. Mit der
juristischen Litteratur steht auch bei den Türken die
religiös-dogmatische in enger Verbindung; doch wird für
dieses Gebiet die arabische Sprache vorgezogen, so daß sich
in türkischer hauptsächlich populäre, zum Teil
katechismusartige Schriften geringern Wertes finden. Sehr beliebt
ist von diesen der Abriß der Glaubenslehre von Mohammed Pir
Ali el Birgewi (Konstantinop. 1802 u. öfter; franz. von Garcin
de Tassy, Par. 1822); erwähnenswert auch der mystische Traktat
"Die Erfreuung der Geister" von Omar ben Suleiman (hrsg. u.
übers. von L. Krehl, Leipz. 1848). Die Bibel ist mehrere Male
ins Türkische übersetzt worden, so das Neue Testament von
Redhouse (Lond. 1857, Bibelgesellschaft) und Schauffler
(Konstantinop. 1866), Teile des Alten Testaments von Schauffler (5
Bücher Mosis, Wien 1877; Jesaia, das. 1876; Psalmen,
Konstantinop. 1868). Eine vollständige türkische Bibel
erschien Paris 1827 (für die englische Bibelgesellschaft).
Eine mangelhafte Übersicht über das ganze geistige
Leben der Türken gab Toderini in seiner "Letteratura
turchesca" (Vened. 1787, 3 Bde.; deutsch von Hausleutner,
Königsb. 1790, 2 Bde.). Vgl. Hammer-Purgstalls Darstellung der
türkischen Litteratur im 3. Band von Eichhorns "Geschichte der
Litteratur" (Götting. 1810-12); Dora d'Istria, La
poésie des Ottomans (Par. 1877); Redhouse, On the history,
system and varieties of Turkish poetry (Lond. 1879). Eine den
jetzigen Ansprüchen genügende Darstellung der ganzen
türkischen Litteratur fehlt (vgl. indes den Artikel von Gibb
u. Fyffe in der "Encyclopaedia britannica", 9. Ausg., Bd. 23); zum
Ersatz muß man sich an Zenkers "Bibliotheca orientalis"
(Leipz. 1846-61, 2 Bde.) und an die Kataloge der größern
Handschriftensammlungen halten (besonders Pertsch, Die
türkischen Handschriften der Bibliothek zu Gotha, Wien 1864;
Flügel, Die arabischen, persischen und türkischen
Handschriften der Hofbibliothek zu Wien, das. 1865-67, 3 Bde.;
Rieu, The Turkish manuscripts in the British Museum,
TÜRKISCHES REICH.
Maßstab 1:10.000.000.
Die Hauptstädte der Wilajets sind unterstrichen.
D=Dagh (türk.) od. Dschebel (arab.)=Berg.
BALKAN-HALBINSEL.
Maßstab 1:6.000.000
Die Hauptstädte der Staaten sind doppelt, die der Wilajets
in der Türkei einfach unterstrichen.
Eisenbahnen.
Dampferrouten.
9l7
Türkisches Reich (europäische Türkei: Grenzen,
Gebirge, Flüsse).
Lond. 1888). Über die in den letzten Jahrzehnten in
Konstantinopel selbst gedruckten Bücher haben berichtet
Hammer-Purgstall und Schlechta-Wssehrd in den "Sitzungsberichten
der Wiener Akademie" seit 1849, Bianchi, Belin und Huart im
"Journal asiatique" seit 1843; s. das Einzelverzeichnis bei A.
Müller, Türkische Grammatik (Berl. 1889, S. 43* f.).
Türkisches Reich (vgl. beifolgende
Übersichtskarte "Türkisches Reich"). Das türkische
oder osmanische Reich (türk. Memâlik-i Osmanije, "die
osmanischen Länder", oder Devlet-i Alije, "das hohe Reich")
umfaßt die gesamte Ländermasse, welche unter der
Herrschaft des Sultans (Padischah) in Konstantinopel steht, d. h.
also Teile der sogen. Balkanhalbinsel, Kleinasien, Syrien, Teile
von Armenien, Kurdistan und Arabien sowie den Nordosten von Afrika.
Es sind dies teils unmittelbare Besitzungen, teils tributäre
Staaten (wie Bulgarien, Samos, Ägypten). Doch ist dabei zu
bemerken, daß große, namentlich gebirgige Strecken
Landes in Albanien, Kleinasien und Kurdistan faktisch der
Türkenherrschaft gänzlich entzogen sind, daß
Bosnien (s. d.), die Herzegowina und Teile des Sandschaks Novipasar
sowie Cypern nur in der Theorie zum türkischen Reich,
tatsächlich aber zu Österreich, resp. (Cypern) England
gehören, und daß die Grenzen des Reichs besonders gegen
das unabhängige Arabien und Afrika hin nicht feststehen.
Deswegen und wegen des Fehlens jeder brauchbaren offiziellen
Statistik können die Angaben über Grenzen, Areal und
Bevölkerung stets nur beschränktes Vertrauen
beanspruchen; auch ist die Bemerkung, daß das Areal des
Reichs selbst nicht auf Zehntausende von Quadratkilometern genau
anzugeben ist, für die Erkenntnis türkischer
Zustände wertvoller als genaue Ziffern, welche ganz
imaginäre und wertlose Zahlenreihen darstellen.
Die europäische Türkei.
(Hierzu die Karte "Balkanhalbinsel".)
Die europäische Türkei, zu welcher nach den letzten
Veränderungen (Vertrag von Berlin, 13. Juli 1878, und
Konferenzen von Berlin und Konstantinopel, 24. Juni 1880, resp. 24.
Mai 1881) als unmittelbare Besitzungen nur noch die Wilajets
Kossowo (nebst einem Teil des Sandschaks Novipasar), Monastir,
Skutari, Janina, Saloniki, Adrianopel, Kreta und ein Teil des
Wilajets Konstantinopel gehören, liegt (ohne
Berücksichtigung der Inseln, privilegierten Provinzen etc.)
zwischen 39° und 43½° nördl. Br., inkl.
Bulgariens und Ostrumeliens zwischen 39° und 44° 12'
nördl. Br. und grenzt im N. an Rumänien und Serbien, im
NW. an den österreichischen Kaiserstaat (d. h. an das von
Österreich-Ungarn besetzte Bosnien), im W. an das Adriatische
und Ionische Meer, im S. an Griechenland, das Ägeische und das
Marmarameer, im O. an das Schwarze Meer.
Physische Beschaffenheit.
Die Balkanhalbinsel wird zum größten Teil von
Bergketten erfüllt, in denen sich drei Hauptrichtungen
unterscheiden lassen. Das Gebirgssystem des Hämos erstreckt
sich vom Thal des Timok an als Hämos im engern Sinn oder
Balkan (s. d.) in westöstlicher Richtung bis zum Kap Emineh am
Schwarzen Meer. Es bildet, von dem dasselbe durchbrechenden Isker
abgesehen, die Wasserscheide zwischen der Donau und dem
Ägeischen Meer. Vom Schardagh (s. d.) zieht sich eine zweite
Hauptkette als Wasserscheide zwischen dem Ionischen und
Ägeischen Meer nach S., bildet die Grenze zwischen Albanien
und Makedonien, zwischen Thessalien und Epirus und findet ihre
Fortsetzung in den Gebirgen Moreas. Auf sie wird der Name des
Pindos (zwischen 39° und 40° nördl. Br.)
verallgemeinert angewendet. Die dritte Hauptrichtung vertritt ein
System von Bergzügen, die unter verschiedenen Namen in der
Richtung von NW. nach SO., also dem Apennin parallel, die
Herzegowina und Bosnien erfüllen. Neben diesen Hauptketten
erheben sich teils selbständige, denselben parallele Gebirge
von geringerer Ausdehnung (z. B. im W. die Akrokeraunien oder das
Tschikagebirge, im O. die Gruppe des Olympos), teils zweigen sich
von den Hauptketten Nebenketten ab, welche die Provinzen der
europäischen Türkei meist als terrassenförmig gegen
die Hauptketten ansteigende Bergländer erscheinen lassen.
Albanien (s. d.) wird in seinem östlichen Teil von
zusammenhängenden, von NW. nach SO. streichenden
Hochgebirgsketten durchzogen: dem Pindos (Tsurnata 2168 m,
Budzikaki 2160 m), dessen nördlichen Fortsetzungen (Smolika
2570 m) und dem jenen parallelen Peristeri östlich vom
Presbasee (2350 m) bis hinauf zum 2280 m hohen Prokletjagebirge,
unweit der Südgrenze Montenegros. Eine abweichende Richtung,
von NO. nach SW., hat der etwa in gleicher Breite gelegene
Schardagh (bis 3050 m hoch). Das Land zwischen dem Adriatischen und
Ionischen Meer einerseits und jenen Gebirgen anderseits
enthält an den Mündungen der Flüsse ziemlich
ausgedehnte Alluvialebenen, welche durch Gebirgszüge getrennt
werden. Die bedeutendste Erhebung liegt nördlich von 40°
nördl. Br., wo die Viosa (Aoos) durchbricht und das bis 2040 m
hohe Tschikagebirge nebst seiner halbinselförmigen
Verlängerung, den Akrokeraunien des Altertums, senkrecht zum
Meer abfällt. Das Zentrum der europäischen Türkei
bildet die zu 2300 m ansteigende, auf allen Seiten von niedrigern
und höhern Gebirgszügen umgebene gewaltige Syenitmasse
des Witosch, südlich von Sofia, auf bulgarischem Gebiet
gelegen. Zwischen Mesta (dem alten Nestos) und Maritza erhebt sich
zu 2300 m das Rhodopegebirge (s. d.). Es umfaßt eine Reihe
von NW. nach SO. verlaufender Bergzüge, zwischen denen sich
Längenthäler hinziehen. Das größte derselben
ist das der Arda, deren Quellgebiet die Zentralmasse des Rhodope
bildet. Zwischen Balkan und Rhodope liegen Mittelgebirgszüge,
dem erstern parallel streichend, wie die Sredna Gora und Tscherna
Gora, und ausgedehnte Ebenen am Oberlauf der Maritza und ihren
Nebenflüssen. Makedonien (s. d.) wird durch den dem
Rhodopegebirge parallelen Perimdagh (Orbelos 2700 m) von Thrakien,
durch die Pindoskette von Epirus geschieden; nach N. und S. hat es
keine so bedeutenden Grenzgebirge. Einen Anhang dazu bildet die
Chalkidike mit ihren drei langgestreckten Halbinseln und dem
heiligen Berg Athos. Von Thessalien (s. d.) ist nur der
nördlichste gebirgige Teil mit dem Olympos beim
türkischen Reich verblieben, der fruchtbare Süden aber
1881 an Hellas abgetreten worden. Von Ebenen, die einen geringen
Raum des Gesamtareals einnehmen, sind der Türkei namentlich
geblieben die Tiefebenen an der Maritza, am Strymon oder Karasu, an
den Mündungen des Wardar, der Vistritza und der albanischen
Flüsse.
An schiffbaren Flüssen ist die europäische Türkei
sehr arm; ein Teil der Maritza ist dank der Nachlässigkeit der
türkischen Behörden jetzt das einzige schiffbare
Binnenwasser. Die übrigen bedeutenden Flüsse sind im
Gebiet des Schwarzen Meers: der Kamtschyk, welcher zwischen Warna
und Misivri mündet; im Gebiet des Ägeischen Meers: die
Maritza mit der Arda, in den Meerbusen von Enos mündend,
der
918
Türkisches Reich (Klima, Areal und Bevölkerung).
Karasu (Mesta), der Strymon (türk. Karasu), den Tachynosee
durchfließend und in den Busen von Orfano mündend, der
Wardar und die Vistritza, alle in den Meerbusen von Saloniki
mündend; im Gebiet des Ionischen Meers: die Arta, in den
Meerbusen von Arta mündend, der Kalamas und Pawla, durch den
Liwarisee fließend; im Gebiet des Adriatischen Meers: Viosa,
Semeni mit Dewol, Schkumbi, Mati, Drin und die auf
österreichischem Gebiet mündende Narenta. Unter den
Landseen sind die bedeutendsten: die Seen von Skutari, Ochrida,
Janina, der Presba- und Ventroksee in Albanien, der See von
Kastoria, von Ostrowo, Doiran, der Beschik- und Tachynosee in
Makedonien. Von Mineralquellen finden sich in der Türkei
vornehmlich warme in Bosnien und namentlich am Südfuß
des Balkans sowie Schwefelquellen.
Das Klima ist im ganzen mild und angenehm, wenn auch die
Temperatur infolge der vorherrschend gebirgigen Beschaffenheit des
Landes sehr wechselnd und wegen der rauhen Nordostwinde kälter
ist als in Italien und Spanien, welche Länder mit der
Türkei unter gleicher Breite liegen. Im ganzen werden dadurch
Klima und Vegetation denen Mitteleuropas sehr ähnlich. Der
Balkan macht eine sehr merkliche Wetterscheide, denn während
in den Donauländern der Winter ziemlich streng, oft
schneereich ist und das Thermometer nicht selten auf -10° C.
und darunter sinkt, steigt im S. dieses Gebirges die Kälte
selten über -3° und ist der Sommer bei fast beständig
heiterm Himmel oft drückend heiß. Während die
kalten Nordwinde für die Gegenden am Bosporus
Schneestürme bringen, kennt man in den Küstenländern
des Ägeischen Meers und auf den Inseln winterliche Witterung
nur auf den Gebirgshöhen. Die Luft ist, wenige Sumpfstriche
ausgenommen, überall rein und gesund; wohl aber werden manche
Gegenden durch Erdbeben heimgesucht. Konstantinopel hat mit Venedig
gleiche mittlere Jahrestemperatur. Die Türkei gehört zum
größten Teil zu der subtropischen Regenzone mit
dürren Sommern. Der Balkan und der Westen des Landes (Bosnien
und Albanien) empfangen durchschnittlich noch über 100 cm
jährlichen Niederschlags, der Rest noch über 70 cm und
nur das Thal der Maritza weniger.
Areal und Bevölkernng.
Das Areal der europäischen Türkei beträgt
insgeamt 326,375 qkm (5927,3 QM.), nämlich:
Unmittelbare Besitzungen . . 165438 qkm (3004,5 QM.)
Ostrumelien ....... 35900 ( 652 - )
Bulgarien. ....... 63972 - (1161,8 - )
Bosnien, Herzegowina u. Novipasar ...... 61065 - (1109 - )
Was die Zahl der Bevölkerung anlangt, so fand die erste
partielle Volkszählung im osmanischen Reich 1830-31 statt, der
seitdem mehrere gefolgt sind. Auf dieselben ist aber deshalb wenig
Gewicht zu legen, weil es zunächst erwiesen ist, daß die
Beamten möglichst niedrige Summen angeben, um die von dem
verheimlichten Überschuß an Unterthanen eingehenden
Steuern zu unterschlagen. Sodann wird nur die erwachsene
männliche Bevölkerung gezählt, und es fehlt an
Angaben, in welchem ungefähren numerischen Verhältnis
dieselbe zu den Frauen und den Kindern beiderlei Geschlechts steht.
Als dritter Faktor kommen die (unbekannten) Verluste durch den
Krieg von 1877 bis 1878 hinzu, um sämtliche Schätzungen
als durchaus unzuverlässig erscheinen zu lassen. Das
Staatshandbuch (Salname) für 1879 gab folgende Übersicht
der Bevölkerung der europaischen Türkei:
Wilajets Einw.
Edirne (Adrianopel) ......... 597794
Selanik (Saloniki) ......... 1000558
Kossowo. ............. 1079654
Jania (Janina) ........... 736904
Schkodra (Skutari) nach Abzug des 1880 an Montenegro
abgetretenen Gebiets . ca. 203000
Girid (Kreta) . ........... 449246
Unmittelbare Besitzungen: 4167156
Dazu kommen noch nach Behm und Wagner (VI):
Wilajet Konstantinopel (europ. Anteil) . . 540000 Einw.
Inseln Thasos, Imbros, Lemnos, Samothrake 42374 -
Die in Europa stehende Armee .... 130 000 Mann (?)
Fremde und Polizei . . ...... 170000 -
Im ganzen ca.: 5050000 Seelen,
wovon etwa 2 Mill. Mohammedaner. (Die Bevölkerungsziffern
von Bosnien, Bulgarien, Ostrumelien s. unter diesen
Ländernamen.) Die neueste Schätzung (für 1887) nahm
für die unmittelbaren Besitzungen nur etwa 4½ Mill. und
fast ebensoviel für Bosnien, Bulgarien und Ostrumelien an; es
entfielen danach auf das Quadratkilometer in den unmittelbaren
Besitzungen 27, in der gesamten europäischen Türkei
einschließlich der tributären und von Österreich
besetzten Länder 28 Bewohner. Ein sicherer Maßstab, um
die entschieden in letzter Zeit eingetretene Abnahme der
Bevölkerung zu schätzen, fehlt uns vollständig, und
es läßt sich lediglich die Thatsache, daß eine
solche infolge des Kriegs mit Rußland stattgefunden hat,
konstatieren. Auch auf alle sonstigen Fragen der
Bevölkerungsstatistik fehlt absolut jede Antwort, und nur
über die räumliche Verteilung der Nationalitäten
sind wir durch Arbeiten westeuropäischer Forscher
einigermaßen unterrichtet. Der herrschende Stamm der
osmanischen Türken sitzt auf der Balkanhalbinsel, von
Konstantinopel abgesehen, nirgends in größerer Masse,
sondern nur inselartig zerstreut, meist in der Nähe
größerer Städte, wie Adrianopel, Seres, Istib,
Saloniki, Monastir, Skutari u. a. Im westlichen und mittlern
Bulgarien, wo sie früher zwischen den Bulgaren wohnten, sollen
sie ziemlich verschwunden sein, im östlichen Bulgarien, in
einem großen Teil von Ostrumelien und im N. des Wilajets
Adrianopel wohnen sie mit Bulgaren gemischt. Den Westen des noch
unmittelbar türkischen Gebiets nehmen Albanesen ein, von den
Grenzen Montenegros und Serbiens an bis zum 40.° nördl.
Br. und vom Adriatischen Meer östlich bis etwa zum 21.°
östl. L. v. Gr., den sie bei Prischtina in einzelnen
Sprachinseln sogar überschreiten. Im nördlichen Epirus
wohnen sie mit Griechen gemischt. Den Süden von Epirus und
Makedonien, die Chalkidike und viele Küstenpunkte des
Ägeischen und des Schwarzen Meers haben Griechen besetzt, die
in der südlichen Hälfte des Wilajets Adrianopel mit
Türken gemischt sind. Den Westen Bulgariens, Ostrumeliens
sowie des alten Thrakien haben in kompakter Masse Bulgaren inne. Im
Pindos (Grenze zwischen Epirus und Thessalien) sitzen Zinzaren
(Kutzowlachen), in Altserbien und dem nördlichen Makedonien
Serben. Die Tscherkessen sind meist nach Kleinasien
ausgewandert.
Die Osmanen (Osmanli), das herrschende Volk, obwohl sie
keineswegs die Mehrzahl bilden, sind ein Turkmenenstamm, ein
schöner Menschenschlag mit edlen Gesichtszügen. Ihre
hervorstechenden Nationalzüge sind: Ernst und Würde im
Benehmen, Mäßigkeit, Gastfreiheit, Redlichkeit im Handel
und Wandel, Tapferkeit, anderseits Herrschsucht, übertriebener
Nationalstolz, religiöser Fanatismus, Fatalismus und Hang zum
Aberglauben. Trotz ihrer hohen körper-
919
Türkisches Reich (Religionsverhältnisse, geistige
Kultur).
lichen und geistigen Befähigung sind sie in wahrer Kultur
hinter den meisten europäischen Völkern
zurückgeblieben und haben nur langsam und mit Widerstreben der
abendländischen Zivilisation Eingang bei sich gestattet. Die
Ehe ist durch zahlreiche ins einzelne gehende Bestimmungen
geregelte Polygamie, die aber nur vier rechtmäßige
Frauen gestattet, während das Halten von Konkubinen und
Sklavinnen unbeschränkt ist. Die Frauen der Reichen, auf
welche sich die Polygamie beschränkt, leben in Harems
eingeschlossen. Die gemeinen Osmanen haben selten mehr als eine
Frau. Die Ehe ist nur ein bürgerlicher Kontrakt, welcher von
dem Mann mit der Familie der Frau vor dem Kadi geschlossen wird.
Die mit Konkubinen und Sklavinnen erzeugten Kinder sind ebenso
legitim wie die mit rechtmäßigen Frauen erzeugten.
Scheidung der Ehe ist nicht erschwert, kommt aber selten vor. Die
Wohnungen sind unansehnlich und schmucklos, meist von Holz und
einstöckig; sie haben im Innern einen viereckigen Hof, nach
welchem die Fenster gehen, während nach der Straße zu
nur einige Gitterfenster vorhanden sind. Die Kleidung der
Männer besteht in einem faltenreichen Rock (Kaftan) oder einer
kurzen Jacke, weiten, faltigen Beinkleidern, einer Weste ohne
Kragen, einer um den Leib gewundenen Binde von farbigem Zeug und
meist gelben Pantoffeln oder Stiefeln. Kopfbedeckung ist der
Turban. Bei den Beamten und Vornehmern ist diese Nationaltracht
durch den fränkischen schwarzen Rock, die engern Pantalons und
den roten Fes mit schwarzer Quaste verdrängt worden. Der Kopf
wird bis auf einen Büschel am Scheitel glatt geschoren, der
Bart lang getragen und wohl gepflegt. Die Frauen, wenigstens in den
Städten, haben eine Kleidung, welche sackförmig den
ganzen Leib einhüllt, und gehen nie aus, ohne das Gesicht
durch Musselinbinden und Schleier zu verhüllen. Die Osmanen
sind die Inhaber der Zivil- und Militärstellen oder treiben
Gewerbe, Ackerbau aber besonders in Kleinasien.
[Religionsverhältnisse.] Die Hauptreligionen in der
Türkei sind die mohammedanische und die
griechisch-katholische. Zu jener, zum Islam, bekennen sich die
Bewohner osmanischen Stammes sowie diejenigen ältern Bewohner,
welche bald nach ihrer Unterwerfung diesen Glauben angenommen
haben, und die vereinzelten Gruppen neuerer Renegaten. Die Bekenner
des Islam heißen Moslems (danach verderbt Muselmanen). Ihre
Heilige Schrift und ihr Gesetzbuch ist der Koran (s. d.). Die
Adepten des Koranstudiums, das sowohl zu juristischen als
kirchlichen Ämtern befähigt (denn einen Unterschied
zwischen Staat und Kirche kennt der Islam nicht), sind die Ulemas
("Gelehrte"), deren Rat in allen zweifelhaften Fällen des
religiösen und bürgerlichen Lebens in Anspruch genommen
wird. Der Ulema tritt, wenn er, 10-12 Jahre alt, die
Elementarschule verlassen hat, als Novize in eine der mit den
großen Moscheen verbundenen Medressen (Seminare des Islam),
in welcher er als Softa Unterricht in der Grammatik, Logik, Moral,
Rhetorik, Philosophie, Theologie, Rechtsgelehrsamkeit, im Koran und
in der Sunna erhält. Er empfängt dann vom Scheich ul
Islam das Diplom als Kandidat (Mulazim), und dadurch zur untersten
Stufe der Ulemas erhoben, kann er Richter (Kadi) werden. Will er
aber zu den höchsten Würden gelangen, so muß er
noch sieben Jahre auf das Studium der Rechtsgelehrsamkeit, Dogmatik
etc. verwenden, worauf er zum Grad eines Muderris befördert
wird. Die Gotteshäuser der Moslems, die sogen. Moscheen, worin
am Freitag Gottesdienst abgehalten wird, sind entweder
größere (Dschami) oder kleinere (Medschid,
Bethäuser). Die Geistlichkeit teilt sich in fünf Klassen:
Scheichs ("Älteste"), die ordentlichen Prediger der Moscheen,
die alle Freitage nach dem Mittagsgottesdienst über moralische
und dogmatische Gegenstände Vorträge halten; Chatibs oder
Vorbeter des Chutbeh (Kutbé), des öffentlichen Gebets,
welches alle Freitage in den großen Moscheen für den
Sultan verrichtet wird; Imame, denen der gewöhnliche Dienst in
den Moscheen und die Besorgung der Trauungs- und
Begräbniszeremonien obliegen; Muezzins, welche von den
Minarets die Stunden des Gebets verkündigen; Kaims,
Wächter und Diener der Moscheen, die nicht zu den Ulemas
gehören. Wenn die Ulemas gewissermaßen die
Weltgeistlichkeit repräsentieren, können die Orden der
Derwische als Ordensgeistlichkeit bezeichnet werden. Die
griechisch-orthodoxe Kirche der Türkei hat ihre älteste
Verfassung, insoweit dies unter der Herrschaft der Moslems
überhaupt möglich war, treu bewahrt. Die Würden der
Patriarchen zu Konstantinopel, Antiochia und Alexandria bestehen
noch. Das höchste Ansehen besitzt der Patriarch von
Konstantinopel, in welchem die zahlreichen Metropoliten,
Erzbischöfe und Bischöfe, welche unter ihm stehen, sowie
die übrigen Patriarchen das Oberhaupt der
morgenländischen Kirche verehren. Er präsidiert auf der
beständigen Synode zu Konstantinopel, welche aus den
Patriarchen, 12 Metropoliten und Bischöfen und 12 angesehenen
weltlichen Griechen besteht, im ganzen türkischen Reich die
oberste geistliche Gerichtsbarkeit über die Bekenner des
griechisch-katholischen Glaubens ausübt und die Patriarchen,
Metropoliten, Erzbischöfe und Bischöfe, die aber von der
Pforte bestätigt werden, wählt. Der Patriarch von
Konstantinopel wird zwar scheinbar frei gewählt, in Wahrheit
werden aber die Stimmen der Wähler gekauft. Um nun die bei
seiner Wahl verausgabten Summen wiederzubekommen, verkauft der
Patriarch die ihm untergeordneten Bischofsitze gleichfalls an den
Meistbietenden; die Bischöfe machen es ebenso mit den ihnen
untergebenen Pfarreien, und die Pfarrer endlich pressen die
Gemeinden aus. Diesem Mißbrauch sind vornehmlich die geringe
Bildung und die Entwürdigung der griechischen Geistlichkeit
zuzuschreiben. Erst 1857 fand sich der Patriarch veranlaßt,
die Wahl eines Ausschusses anzuordnen, der sich mit den
nötigen Reformen befassen sollte. Die Mönche und Nonnen
folgen der Regel des heiligen Basilius; die berühmtesten
griechischen Klöster sind die auf dem Berg Athos (s. d.) in
Makedonien. Die armenisch-christliche Kirche steht unter den vier
Patriarchen zu Konstantinopel, Sis, Achtamar und Jerusalem. Die
römisch-katholische Kirche zählt in der Türkei, mit
Einschluß der ihr unierten orientalischen Christen, 27
Patriarchen und Erzbischöfe, von denen 3 auf die
europäische Türkei kommen. Die Juden haben in
Konstantinopel einen Großrabbiner (Chacham Baschi), unter
welchem 7 Oberrabbiner und 10 Rabbiner stehen. Alle nicht zum Islam
sich bekennenden Bewohner der Türkei werden unter dem Namen
Rajah (Volk, Herde) zusammen begriffen. Der Islam duldet die
christliche und die jüdische Religion neben sich und gebietet
nur, die Götzendiener zu vernichten.
[Bildung und Unterricht.] Die geistige Kultur steht im
türkischen Reich im allgemeinen noch auf einer ziemlich
niedrigen Stufe. Die Lehranstalten zerfallen in drei Kategorien: 1)
Elementarschulen, deren Lehrgegenstände Lesen, Schreiben,
Rechnen, Religion, Erdbeschreibung und Türkisch sind, und die
von allen
920
Türkisches Reich (Landwirtschaft, Industrie).
mohammedanischen Kindern, welche das Alter von sechs Jahren
erreicht haben, besucht werden müssen, und die etwas
höher stehenden Vorbereitungsschulen; 2) die Ruschdijeschulen,
470 an Zahl, eine Art Mittel- oder Realschulen mit den
Lehrgegenständen Türkisch, Arabisch, Persisch,
Geschichte, Geographie, Arithmetik und Geometrie; 3) die
höhern Schulen, wie das kaiserliche Lyceum von Galata-Serai,
die Verwaltungs-, Rechts-, Forst- und Bergwerksschule, die Kriegs-
u. Marine-, zwei medizinische Schulen, Kadettenanstalten etc.
Bedeutend ist die Anzahl und Leistungsfähigkeit der im
türkischen Reich verbreiteten armenischen und namentlich
griechischen Schulen, darunter die griechische Nationalschule in
Konstantinopel zur Heranbildung von Lehrern, die Handels- und die
theologische Schule auf Chalki bei Konstantinopel. In den
größern Küstenplätzen finden sich auch
europäische, meist von katholischen Geistlichen geleitete
Schulen.
Landwirtschaft. Industrie.
Den Vorschriften des Korans gemäß beansprucht in der
Türkei der Staatsschatz das Obereigentumsrecht alles Grundes
und Bodens, dessen Verwalter demgemäß der Sultan ist.
Bei der Eroberung eines Territoriums teilte derselbe letzteres in
drei Teile, von denen einer dem Staat, einer den Moscheen und
religiösen Stiftungen (Wakuf) und ein dritter der Benutzung
der Privaten überlassen ward. Zu den Staatsdomänen
gehören: 1) Miri, d. h. Güter, deren Einkünfte in
den Staatsschatz fließen; 2) unbewohnte oder unbebaute
Landstriche; 3) die Privatdomänen des Sultans und seiner
Familie; 4) verwirkte oder verfallene Ländereien; 5)
Länder, die den Wesirämtern, Paschas zweiten Ranges,
Ministern und Palastbeamten zugewiesen sind, und 6)
militärische Lehnsgüter (je nach der Größe
Beiliks, Ziamets und Timars genannt), die unter Sultan Mahmud
eingezogen wurden. Die Wakufgüter gehören Moscheen,
religiösen Instituten und wohlthätigen Stiftungen, welche
von einer besondern Behörde (Evkaf) verwaltet werden; es sind
teils Grund und Boden oder dessen Ertrag, teils Privatpersonen
gehöriges, aber mit einer Abgabe belastetes Land, welches beim
Tode des Besitzers, sofern er keine direkten Erben hat, zum Wakuf
wird. Der Privatgrundbesitz (Mulk) ist auf den Namen des Besitzers
eingeschrieben, kann vererbt, verkauft und dabei mit gewissen
Servituten belastet werden. Erst seit 18. Juni 1867 können
Fremde Grund und Boden in der Türkei erwerben. Die
Gutsbesitzer in der Türkei wohnen fast ausnahmslos nicht auf
ihren Besitzungen, welche vielmehr von einem Verwalter und einer
Anzahl Pachter bewirtschaftet werden. Meist müssen letztere
dem Besitzer die Hälfte der Ernte nach Abzug der Saat und des
Zehnten abgeben, so daß dieser in schlechten Jahren sehr
wenig, in guten aber viel erhält. Die Landwirtschaft,
insbesondere der Ackerbau, steht noch auf tiefer Stufe. Die
Ländereien bleiben in der Regel ein Jahr in der Brache und
werden höchstens durch darauf getriebenes Vieh gedüngt.
Die Hauptgetreidearten sind: Weizen, Roggen, Gerste und Mais, und
zwar produzieren die unmittelbaren Besitzungen: Weizen 8 Mill. hl,
Roggen 4,700,000, Gerste 4,400,000, Hafer 700,000, Mais 3 Mill. hl.
Als Durchschnittszahl gilt eine achtfache Ernte, eine zehnfache als
gut; Mais gibt den 200-300fachen Betrag. Der Cerealienexport betrug
1863-72 jährlich durchschnittlich 13½ Mill. Frank aus
Konstantinopel und nahe 16 Mill. Fr. aus Saloniki, ist aber
neuerdings hinter der Einfuhr sehr zurückgeblieben (1887 bis
1888 bei Weizen um 7,3 Mill., Gerste um 3,1 Mill., Mehl um 9,6
Mill. Mk.). Von Hülsenfrüchten werden vornehmlich Bohnen,
Erbsen, ägyptische Faseln und Linsen gebaut; die verbreiterten
Gemüse sind: Zwiebeln, Knoblauch, Kohl, Gurken. Als sonstige
Gartengewächse sind zu nennen: spanischer Pfeffer, die
Eierpflanze, Melonen, Kürbisse etc. Von Öbstbäumen
werden besonders Pflaumenbäume gezogen, deren Früchte
gedörrt ein bedeutender Ausfuhrartikel sind oder zur
Branntweinfabrikation dienen. Außerdem finden sich Kirsch-,
Apfel-, Birn-, Aprikosen-, Quitten-, Nuß- und
Mandelbäume an den Küsten des Adriatischen Meers und des
Archipels. Von Ölpflanzen wird außerdem namentlich Sesam
und zwar in den Ebenen Thrakiens, im südlichen Makedonien
sowie in einzelnen Gegenden von Epirus gebaut und besonders aus
Saloniki ausgeführt. Die Kultur des Weinstocks ist
überall verbreitet und hat ebenso wie die Weinausfuhr seit der
Verwüstung der französischen Weinberge durch die Reblaus
namentlich in Rumelien (sowie im westlichen Kleinasien) bedeutende
Fortschritte gemacht. Von Gespinstpflanzen sind besonders Hanf,
Lein und Baumwolle hervorzuheben. Tabak wird in Menge gebaut
(jährlich 15-18 Mill. kg), der beste in Makedonien; doch ist
diese Kultur in den letzten Jahren durch unvernünftige
Finanzmaßregeln schwer geschädigt worden. 1883 wurde die
Tabaksregie eingeführt und einem Bankkonsortium auf 30 Jahre
übertragen. Ein Teil wird im Inland konsumiert, der bei weitem
größere Teil nach Rußland, England,
Österreich ausgeführt. Von Farbepflanzen ist Krapp die
verbreiterte. Große Aufmerksamkeit wird in manchen Gegenden,
namentlich in Ostrumelien, der Rosenzucht zugewendet. Die
Forstwissenschaft steht noch auf sehr niedriger Stufe, und die
Waldverwüstung ist ungeheuer. Einzelne Provinzen sind
stellenweise noch mit dichten Waldungen bedeckt, während in
andern es an Holz fast gänzlich mangelt. Eine
Haupterwerbsquelle der Landbewohner der europäischen
Türkei ist außerdem die Viehzucht. Die türkischen
Pferde, klein, aber sehnig und ausdauernd, dienen
hauptsächlich zum Lasttragen; die Esel und Maulesel der
Türkei wetteifern an Schönheit mit denen Italiens. Die
Stelle des Kamels, das nur in Konstantinopel vorkommt, vertritt der
Büffel, der die schwersten Fuhren bewältigt. Das Rindvieh
ist klein, gut gebaut und meist gelblichgrau mit braunen Flecken.
Kühe werden fast nur für die Zucht gehalten. Sehr
erheblich ist die Schafzucht, insbesondere in Albanien, von wo
jährlich im Frühjahr große Schafherden nach
Makedonien und Thessalien zum Weiden getrieben werden. Die
Wollausfuhr aus der europäischen Türkei, besonders nach
Frankreich, wertete früher im Durchschnitt an 24 Mill. Frank,
ist aber auf 7¾ Mill. Fr. (1887/88) gesunken; feinere Wolle
produziert die Gegend von Adrianopel. In den Gebirgsgegenden werden
viele Ziegen gehalten. Von Wichtigkeit ist auch die Bienen- und
Seidenraupenzucht, obwohl letztere infolge der großen
Preisschwankungen jetzt sehr abgenommen hat. Der Fischfang wird
vornehmlich an den Küsten betrieben. Hierher gehört auch
das Einsammeln von Badeschwämmen an den Küsten des
Ägeischen Meers, während der Blutegelfang in Makedonien
von der Regierung als Monopol betrieben wird. Der Bergbau liegt
noch ganz danieder, wiewohl reiche Erzlager vorhanden sind, welche
später in der wirtschaftlichen Wiederbelebung dieser
Länder eine Rolle zu spielen berufen sind.
Was die technische Kultur anlangt, so findet der Gewerbebetrieb
in der Türkei noch ganz nach al-
921
Türkisches Reich (Handel).
ter Art statt. Mit Ausnahme der für den täglichen
Verkehr unentbehrlichen Gewerbe sind letztere, soweit sie
überhaupt in der Türkei betrieben werden, auf gewisse
Orte und gewisse Personen beschränkt; fabrikmäßiger
Betrieb findet fast nirgends statt. Früher bezog das Abendland
eine Menge kostbarer Stoffe (Seidenstoffe, Teppiche,
Fayencearbeiten etc.) aus der Türkei; jetzt hat dies nicht nur
aufgehört, sondern es werden auch dieselben Stoffe und zwar
von besserer Qualität und um wohlfeilern Preis aus dem Ausland
eingeführt. Die industrielle Thätigkeit beschränkt
sich jetzt auf Herstellung der notwendigen Verbrauchsartikel durch
die bäuerliche Bevölkerung selbst und in einigen Gegenden
auf die nach ererbten Mustern betriebene Hausindustrie.
Inländische und ausländische Spekulanten haben wiederholt
versucht, irgend eine Industrie ins Leben zu rufen; aber jedesmal
scheiterten alle diese Projekte an dem bösen Willen der
Provinzialstatthalter, welche in ihrem Fremdenhaß die
Auswärtigen fern hielten, während das inländische
Kapital mit Steuerpachten, Lieferungen und Börsenspiel
leichter und besser sich verzinste. Grundsätzlich wurden z. B.
Ausländer vom Betrieb der Bergwerke fern gehalten. Erst
neuerdings ist eine kleine Wendung zum Bessern eingetreten.
Handel und Verkehr.
Haupthindernis des für die Türkei sehr wichtigen Land-
und Seehandels sind die immer noch mangelhaften Verkehrsmittel.
Kunststraßen besitzt die Türkei, von den neuerdings
erbauten Eisenbahnen abgesehen, nur wenige, und die Landwege sind
selbst in der Gegend von Konstantinopel so schlecht, daß sie
fast nur Saumwege und für das landesübliche Fuhrwerk
benutzbar sind. Für den Binnenhandel sehr förderlich sind
die Messen und Märkte, die in verschiedenen Orten abgehalten
werden, und deren wichtigste vom 23. Sept. bis 2. Okt. zu Usundscha
Owa, nordwestlich von Adrianopel, stattfindet. Der Handel mit
Mittel- und Westeuropa befindet sich vorwiegend in den Händen
Fremder, besonders der Griechen; im Levantiner und
Küstenhandel sind dagegen auch viele türkische
Unterthanen beschäftigt. Bankier- und Wechselgeschäfte
werden fast nur von Armeniern und Griechen betrieben, in deren
Händen sich auch fast ausschließlich der Binnenhandel
befindet. Im Frühjahr 1882 hatte das türkische Reich
sämtliche Handelsverträge gekündigt und 1884 und
1885 vorläufig einen einheitlichen 8proz. Wertzoll
eingeführt, welcher seit 24. April 1888 auch im Verkehr mit
Ostrumelien in Kraft getreten ist. Von Waren, welche vom Ausland
kommen, werden 7/8 des 8proz. Wertzolls (bei den über
Trapezunt gehenden der gesamte Zoll) zurückerstattet, wenn die
Wiederausfuhr nach dem Ausland innerhalb sechs Monaten nach der
Einfuhr erfolgt. Erst neuerdings ist es wieder zum Abschluß
von neuen Handelsverträggen gekommen, nach welchen jeder Staat
auf die Einfuhr des andern die mit einem dritten vereinbarten
niedrigsten Zölle anwendet, nämlich mit Rumänien
(ratifiziert 12. Jan. 1888) und Serbien (ratifiziert 28. Aug.
1888). Die Statistik über Aus- und Einfuhr ist noch keineswegs
eine befriedigende zu nennen; doch veröffentlicht das "Journal
de la chambre de commerce de Constantinople" seit 1881 offizielle
Tabellen, die einen gewissen Anhalt geben. Danach nehmen in der
Ausfuhr bei weitem die erste Stelle ein die Rosinen, dann folgen
Seide, Wolle, Mohair, Valonen, Opium, Häute, Feigen, Kokons,
Wein, Olivenöl, Erze, Datteln, Teppiche, Seife,
Haselnüsse etc. Es betrug der Wert der Ausfuhr in Millionen
Piaster (zu 16-17 Pfennig):
1885/86 1886/87 1887/88
Rosinen 146 183 172
Mohair 59 86 50
Opium 90 80 42
Seide 77 79 84
Baumwolle 55 53 31
Valonen 43 51 46
Wolle 34 50 57
Häute 30 37 38
Feigen 34 35 30 Kokons 27 34 39 Wein 23 31 29 Olivenöl 38
27 36 Erze 14 16 18 Datteln 17 15 21 Teppiche 13 14 16 Seife 16 14
10 Haselnüsse 15 13 7
Im ganzen aber übersteigt die Einfuhr den Export: das
Verhältnis beider ist wie 10:6. Eingeführt werden
besonders Tuche, Baumwollwaren, Garne, Eisen- und Stahlwaren,
Droguen, Farben, Öle, Zucker, Getränke, Lebensmittel,
Spiritus, Petroleum, Stearinlichte, Zündwaren, Glaswaren,
Papier, Bijouterien, Arzneien, Parfümerien, Möbel,
Waffen, Kurzwaren, Modeartikel etc., vorzüglich englischen,
französischen, österreichischen, deutschen und
schweizerischen Ursprungs. Nach offiziellen Angaben, welche
indessen wegen der vielen Betrügereien der Beamten und der
Defraudationen um ein Viertel zu niedrig ausfallen sollen, betrug,
unter Ausschluß Ägyptens, der Waffen etc. für die
Regierung, der Gegenstände für Gesandte, Konsuln,
Schulen, Stiftungen, der Maschinen und Geräte für Gewerbe
und Ackerbau etc., der Wert der
1884/85 1885/86 1886/87 1887/88
Einfuhr 2063,8 2000,4 2070,3 2010,6 Mill. Piaster
Ausfuhr 1279,8 1207,6 1270,7 1128,9 -
Davon entfällt mehr als ein Drittel allein auf
Konstantinopel. Hauptausfuhrplätze sind ferner: Saloniki und
Dedeaghatsch und in der asiatischen Türkei Smyrna, Trapezunt,
Mersina, Alexandrette und Beirut. Von diesem Handelsverkehr besorgt
den Hauptanteil Großbritannien (1887/88: 42,38 Proz. der
Einfuhr, 31,66 Proz. der Ausfuhr); dann folgen Frankreich mit
12,06, bez. 37,26 Proz. und Österreich-Ungarn mit 19,14, bez.
8,79, dann Rußland (11,25, bez. 2,56 Proz.), endlich Italien,
Ägypten, Griechenland etc. Die Sendungen aus und nach dem
Deutschen Reich, ebenso wie der Schweiz und Belgiens gehen
gewöhnlich über Marseille und Triest und werden darum als
französische und österreichische Provenienzen, resp.
Ausfuhr bezeichnet, was bei nachstehender Tabelle zu
berücksichtigen ist. Der Anteil der wichtigsten Länder an
der Handelsbewegung der Türkei beträgt in Tausenden
Piaster:
Einfuhr Ausfuhr
1886/87 1887/88 1886/87 1887/88
Großbritannien. . . . 894028 851812 434923 357444
Deutsches Reich. ... 2513 3802 729 216
Österreich-Ungarn. . . 417600 384771 111718 99314
Italien . . . . . . 635l4 48976 37351 33461
Persien ...... 48867 53402 1070 1206
Amerika ...... 12352 15596 15333 12751
Belgien ...... 38395 42913 28 203
Bulgarien ..... 49370 50974 2325 2292
Tunesien ...... 7742 10353 12 382
Rußland ...... 178614 226155 30715 28910
Rumänien ..... 32238 25903 10770 13094
Serbien ...... 7266 7006 1019 623
Niederlande ..... 3389 2878 12771 10245
Frankreich ..... 250079 242483 473802 420701
Ägypten ...... 1957 1770 90527 87765
Griechenland. .... 41138 37739 46519 59108
Die türkische Handelsmarine selbst ist unbedeutend, und es
existieren darüber keine sichern Angaben. 1879 wurde ihr
Gesamtinhalt auf 181,500 Ton. geschätzt; 1886 umfaßte
sie nur 17 Dampfer (7297 T.), 416 große Segelschiffe (69,627
T.) und eine große Anzahl kleiner Küstenfahrzeuge.
922
Türkisches Reich (Verkehrswesen, Münzen, Maße
etc.; staatliche Verhältnisse).
Für die Schiffahrtsbewegung liegen, abgesehen von Daten
für einzelne große Hafenstädte (Konstantinopel,
Saloniki, Smyrna, Dedeaghatsch, Trapezunt, Beirut, Samsun, Jafa
etc., s. d.), nur Angaben für das Jahr vom 1. März 1881
bis 28. Febr. 1882 vor. Danach umfaßte dieselbe 195,703
Schiffe, darunter 37,924 ausländische mit 15,864,032 Ton. und
157,779 türkische mit 3,703,261 T. Während des
Kriegsjahrs war die Tonnenzahl auf 12,810,003 gesunken, bis 1887/88
jedoch wieder auf 21,984,576 T. in der fremden Schiffahrt und
5,597,351 T. in der Küstenschiffahrt gestiegen. Die am meisten
dabei beteiligten Nationen sind England mit 9,274,752 T.,
Österreich-Ungarn mit 3,722,122, Frankreich mit 2,979,457,
Griechenland mit 2,425,124, Rußland mit 2,030,714, Italien
mit 956,537, Schweden und Norwegen mit 208,587, das Deutsche Reich
mit 163,833 T. Am auswärtigen Schiffsverkehr ist der Hafen von
Konstantinopel mit 36,36 Proz. der Tonnenzahl beteiligt.
Regelmäßige Dampfschiffsverbindungen werden zwischen den
Hauptseeplätzen der Türkei und den Häfen des
Schwarzen, Ägeischen und Adriatischen Meers wie des westlichen
Mittelmeerbeckens (Odessa, Triest, Brindisi, Messina, Marseille
etc.) durch die österreichischen Lloyddampfer, die Messageries
maritimes, Fraissinet & Comp., Navigazione Generale Italiana,
die Compagnie Russe de navigation à vapeur et de commerce,
griechische und türkische Schiffe unterhalten. Das
türkische Postwesen wurde 1840 neu eingerichtet (1886: 408
Postämter, im ganzen Reich 1187); doch haben bei der
Unsicherheit desselben das Deutsche Reich, Österreich,
Frankreich, Großbritannien etc. ihre Postämter in
Konstantinopel und einigen andern Hafenstädten beibehalten.
Eisenbahnbauten sind in der europäischen Türkei erst in
neuerer Zeit in Angriff genommen worden; bis jetzt sind
einschließlich Ostrumeliens 1170 km im Betrieb (in der
asiatischen Türkei 660 km); die sehr wichtigen Verbindungen
der Bahnen Saloniki-Mitrowitza und Konstantinopel-Sarambei sind
1888 eröffnet worden. Das Telegraphennetz ist (wohl im
Interesse der Regierung) ziemlich ausgedehnt, selbst über
abgelegene und menschenarme Provinzen. Es existieren 233 (im ganzen
Reich 683) Telegraphenbüreaus. Die bedeutendsten Orte der
europäischen Türkei sind: Konstantinopel, Adrianopel,
Gallipoli, Saloniki, Janina, Skodra, Prisrend, Prischtina und
Monastir. Münzeinheit ist der Piaster (zu 40 Para), deren 100
auf die türkische Lira (= 18½ Mk.) gehen sollen. Da
aber Gold Agio genießt, so ist der Piaster weniger wert
(16-17 Pf.). Es kursieren Goldstücke zu 500, 250, 100, 50 und
25 Piaster, Silbermünzen zu 20, 10, 5, 2, 1 und ½
Piaster und Münzen aus einer Legierung von Silber mit Kupfer,
nämlich ganze, halbe und viertel Altilik (ein Altilik,
nominell = 6 Piaster, enthält 52 Proz. Silber und verliert ca.
17 Proz.) und ganze, halbe, 2/5, 1/5 und 1/10 Beschlik
(enthält 25 Proz. Silber, nominell = 5 Piaster, und verliert
im Verkehr 50 Proz.). Der Kurs der Gold- und Silbermünzen ist
übrigens in den verschiedenen Städten ein verschiedener.
In Bezug auf Maß und Gewicht gilt offiziell seit 1871 das
französische (metrische) System. Frühere Gewichtseinheit
war die Okka = 1284 g, Getreidemaß das Kilé = 25-37
Lit., Längenmaß der Pik Hâlebi ("Elle von Aleppo")
= 0,686 m. Diese Maße sind noch überall im Gebrauch.
Staatliche Verhältnisse.
Das osmanische Reich ist eine absolute Monarchie, deren
Herrscher, Sultan oder Padischah ("Großherr"), die
höchste weltliche Gewalt mit dem Kalifat, der höchsten
geistlichen Würde, verbindet. Der Sultan gilt bei seinen
Unterthanen als Nachfolger des Propheten und hat seine
Autorität von Gott. Der Thron ist erblich im Mannesstamm des
Hauses Osman und geht in der Regel auf das älteste Mitglied
desselben über. Der Padischah wird in der Moschee Ejub zu
Konstantinopel von dem Mufti, unter Assistenz des Vorstehers der
Emire, mit dem Säbel Osmans, des ersten Sultans der Osmanen
(1299), umgürtet, wobei er die Aufrechterhaltung des Islam
verspricht und einen Schwur auf den Koran ablegt. Der jetzig Sultan
ist Abd ul Hamid Chan, geb. 21. Sept. 1842, Sohn des Sultans Abd ul
Medschid Chan (seit 3l. Aug. 1876), der 34. Souverän aus dem
Haus Osmans und der 28. seit der Eroberung von Konstantinopel. Der
Hof des Sultans heißt die Hohe Pforte. Die
Würdenträger desselben zerfallen in zwei Klassen: die
einen, die Agas des Äußern, wohnen außerhalb des
Palastes oder Serails; die andern, die Agas des Innern, bewohnen
den Mabeïn, einen Teil des Serails neben dem Harem. In die
erste Kategorie gehören: der erste Imam oder
Großalmosenier des kaiserlichen Palastes, der erste Arzt, der
erste Sekretär, der erste Adjutant, der Oberstallmeister etc.
Zur zweiten Kategorie (Mabeïndschi) gehören fast lauter
Eunuchen, welche zu ihrem Namen den Titel "Aga" setzen. Der erste
an Rang und darin einem Feldmarschall gleich ist der Kislar-Aga
("Hauptmann der Mädchen"), der Chef der schwarzen Eunuchen.
Dann folgen: der Chef der Privatkasse des Sultans, der
Schatzmeister der Krone, der Kapu-Aga oder der Chef der
weißen Eunuchen, der Oberhofmeister, der Oberkämmerer,
der erste Kammereunuch, der Pagendirektor etc. Die Frauen des
Harems, der als Staatseinrichtung gilt, zerfallen je nach ihrem
Rang in mehrere Klassen. Die ersten im Rang sind die Kadinen, deren
gesetzmäßige Zahl 7 ist, die Beischläferinnen des
Sultans; diesen folgen 50-60 Odalik, d. h. kaiserliche
Stubenmädchen, die zu besondern Diensten des Sultans bestimmt
sind, auch wohl mit den Kadinen die Gunst desselben teilen. Im
ganzen enthält der Harem 300-400 Frauen, meist
Tscherkessinnen. Den Titel Sultanin führen nur die
Töchter oder Schwestern des Großherrn. Seine Mutter
heißt Sultan-Walidé oder Sultanin-Mutter und hat nach
dem Sultan den ersten Rang im Reich. Die osmanische Gesetzgebung
besteht aus zwei Hauptteilen, dem theokratischen
(religiös-bürgerlichen) Gesetz oder Scheriat und dem
politischen Gesetz oder Kanun. Das Scheriat ist basiert auf den
Koran, die Sunna oder Überlieferung, das Idschma i ümmet
(die Auslegungen und Entscheidungen der vier ersten Kalifen
enthaltend) und das Kyas oder die Sammlung gerichtlicher, durch die
vier großen Imame (Ebn Hanifé, Maliki, Schafi'i und
Hambali) gegebenen Entscheidungen in den ersten drei Jahrhunderten
der Hedschra bis zu den Sammlungen der Fetwas (s. d.). Das System
der türkischen Gesetzgebung ist das Werk von ca. 200
Rechtsgelehrten, aus deren Arbeiten man zuletzt umfassende
Sammlungen bildete, welche die Stelle der Gesetzgebung vertreten.
Die erste, "Dürrer" ("Perlen") genannt, reicht bis 1470 (875
der Hedschra); die zweite, "Mülteka ül Buhur"
("Verbindung der Meere"), das Werk des gelehrten Scheichs Ibrahim
Halebi (gest. 1549), ward 1824 gänzlich umgearbeitet und ist
religiöses, politisches, militärisches,
bürgerliches, Zivil- und Kriminalgesetzbuch; das
Handelsgesetzbuch ist eine ungeschickte Kopie des
französischen Code de commerce von 1807.
923
Türkisches Reich (Staatsverwaltung, Rechtspflege).
In der Türkei besteht jetzt der Theorie nach die 23. Dez.
1876 erlassene Verfassung zu Recht, obwohl die Regierung sich um
dieselbe sehr wenig kümmert. Im wesentlichen setzt dieselbe
fest: die Unteilbarkeit des Reichs; die Unverantwortlichkeit und
Unverletzlichkeit des Sultans, dessen Vorrechte die der
übrigen europäischen Herrscher sind; die Freiheit der
Unterthanen, die ohne Unterschied Osmanen heißen, ist
unverletzlich. Staatsreligion ist der Islam, doch dürfen die
anerkannten Konfessionen frei ausgeübt werden und behalten
ihre Privilegien. Sodann wird Preßfreiheit, Petitions- und
Versammlungsrecht, Gleichheit aller Unterthanen vor dem Gesetz (die
Sklaverei existiert aber faktisch noch!), Unterrichtsfreiheit,
Befähigung aller Osmanen ohne Unterschied der Religion zu
allen Beamtenstellungen, gerechte Verteilung der Steuern etc.
garantiert. Der Konseil der Minister soll unter dem Präsidium
des Großwesirs beraten. Die Minister sind für ihr
Ressort verantwortlich und können von dem Abgeordnetenhaus
angeklagt werden; Auflösung des letztern oder Entlassung der
Minister bei einem Konflikt zwischen beiden, Interpellationsrecht
der Abgeordneten, Unabsetzbarkeit der Beamten, sofern kein
rechtlicher Grund gegen sie vorliegt, alles wie in zivilisierten
Staaten; ebenso die Zusammensetzung des Parlaments (seit 1878 nicht
mehr einberufen) aus zwei Kammern, das Institut der Thronrede, die
Freiheit der Abstimmung, die Öffentlichkeit der Sitzungen, die
Votierung des Budgets etc. Doch ist diese Verfassung bald nach
ihrer Entstehung nicht weiter berücksichtigt worden.
[Staatsverwaltung.] Was die Staatsverwaltung betrifft, so
übt der Sultan seine gesetzgebende und vollziehende Gewalt
durch den (1878 vorübergehend abgeschafften) Großwesir
und den Mufti (Scheich ul Islam) aus. Der Großwesir
(Sadrasam) ist der Repräsentant des Sultans, führt im
Geheimen Rat den Vorsitz und ist tatsächlich der Inhaber der
Exekutivgewalt. Er erhält seine Gewalt durch einen
Hattischerif des Sultans und hat seinen amtlichen Aufenthalt bei
der Hohen Pforte. Dem Mufti oder Scheich ul Islam (eingesetzt 1543
durch Mohammed II.) liegt die Auslegung des Gesetzes ob. Er ist
Chef der Ulemas (s. unten), selbst aber weder Priester noch
Gerichtsperson. Er nimmt an der Ausübung der gesetzgebenden
Gewalt teil in dem Sinn, daß seine Zustimmung notwendig ist
zur Gültigkeit jeder Verordnung, jedes von der höchsten
Behörde ausgehenden Aktes. Außerdem stehen an der Spitze
der Staatsverwaltung die für die einzelnen Zweige derselben
bestimmten Staatsminister, nämlich: der Präsident des
Staatsrats, der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, der
Kriegsminister und Großmeister der Artillerie (Seraskier),
der Finanzminister, der Marineminister (Kapudan-Pascha), der
Minister des Innern, der Minister des Handels, der
öffentlichen Arbeiten und des Ackerbaues, der Minister des
öffentlichen Unterrichts, der Justizminister und der Intendant
des Evkaf (d. h. der den Moscheen und frommen Stiftungen
gehörigen Güter). Der Geheime Rat oder Diwan, dessen
Mitglieder den Titel Muschir (Räte des Staatsoberhauptes)
führen, besteht ans dem Scheich ul Islam, den oben genannten
Ministern und dem Präsidium des Staatsrats und versammelt sich
in der Regel wöchentlich. Dann folgen die beiden
Reichsräte, der für Ausführung der Reformen und der
1868 gegründete Staatsrat (nachdem Muster des
französischen Conseil d'État). Mit jedem der
verschiedenen ministeriellen Departements, mit Ausnahme des der
auswärtigen Angelegenheiten, sind permanente Räte (z. B.
für das Gesundheitswesen, für Post und Telegraphie etc.)
verbunden, welche die Gegenstände bearbeiten und die
Verbesserungsprojekte vorbereiten. Alle Ämter des osmanischen
Reichs zerfallen in wissenschaftliche oder Ämter des
Lehrerstandes (Ulema), Ämter der Feder
(Administrativämter), Ämter des Säbels (Armee und
Flotte) und Hofämter. Die Minister führen den Titel
"Muschir" (und "Wesir"), die andern hohen Staatsbeamten der Pforte
und die Generale den Titel "Pascha", die höhern Beamten den
Titel "Efendi", die Söhne der Paschas und die obern Offiziere
den Titel "Bei", alle niedern Offiziere und Beamten den Titel
"Aga". Behufs der Verwaltung ist das türkische Reich in
Wilajets oder Generalgouvernements eingeteilt. Die Wilajets
zerfallen in Liwas oder Provinzen, diese wiederum in Kazas oder
Distrikte. An der Spitze eines jeden Wilajets steht ein Wali oder
Generalgouverneur als Chef der Verwaltung. Unter ihm fungieren,
ohne von ihm ernannt zu werden: der Defterdar für das
Finanzwesen, der Mektubdschi oder Generalsekretär, der
Sekretär der fremden Geschäfte, die Beamten für den
öffentlichen Unterricht, für Handel, Ackerbau,
Straßenbau, Landesvermessung, Polizei etc. Jedes Liwa wird
von einem Mutessarrif verwaltet, jedes Kaza von einem Kaimakam; an
der Spitze der Nahijes oder Kommunen steht ein von den Eingebornen
gewählter Mudir sowie dessen Beigeordneter, der Muavin. In
jedem Wilajet, Liwa, Kaza und Nahije steht dem betreffenden
Verwaltungsbeamten ein Medschlis i idareh (Verwaltungsrat) zur
Seite, worin die richterlichen, finanziellen, religiösen
Spitzen und 3-4 von der Einwohnerschaft gewählte Personen
sitzen. Am Schluß des Jahrs 1878 wurde der Entwurf eines
neuen organischen Reglements für die europäischen
Provinzen der Türkei veröffentlicht, wonach der Sultan
die Walis aller Wilajets auf fünf Jahre ernennt. Die Pforte
soll unter je drei von dem Wali vorgeschlagenen Kandidaten die
Mutessarrifs wählen und die Provinzialbeamten möglichst
aus den Einwohnern der betreffenden Provinz entnehmen. Ein
Generalrat, zusammengesetzt aus je zwei Delegierten jedes Kazas,
soll in jedem Wilajet eingesetzt werden. Außer den
Zolleinnahmen soll der Ertrag einer Grund- und Bodensteuer sowie
andre Einkünfte zur Bestreitung der Ausgaben der Provinzen
für die öffentlichen Arbeiten und die Gendarmerie
verwendet werden. Die Urteilssprüche der Gerichte sollen in
öffentlichen Sitzungen gefällt werden.
[Rechtspflege.] Die türkischen Justizbehörden
zerfallen in die ganz mohammedanischen Tscheris, an deren Spitze
der Scheich ul Islam steht, und in die weltlichen Nisâmijes,
die aus Christen und Mohammedanern zusammengesetzt sind. Das
Tribunal der Tscheris besteht aus dem hohen Appellhof (Arsadassi)
mit je einer Kammer für Europa und Asien, die einen
Kâsi-asker (Kazilesker, s. d.) und 14 Richter zählt. In
jedem Wilajet befindet sich ein Tscherigericht unter dem Vorsitz
eines Mollas mit dem Titel Nâib, der zugleich dem
Diwan-Temyisi (Appellationsgericht des Wilajets) präsidiert.
Ebenso hat jedes Liwa und Kaza sein Tscheri-Gericht, das
häufig der Bestechung sehr zugänglich ist. Für
Streitigkeiten zwischen Bekennern verschiedener Religionen,
zugleich auch für Kriminalfälle dienen die
Nisâmijes, deren jedes Wilajet, Liwa und Kaza eins hat, und
deren Mitglieder von der Bevölkerung gewählt werden.
Jedes höhere Gericht bildet die Appellinstanz für die
924
Türkisches Reich (Heer u. Flotte, Wappen u. Orden;
außereuropäische Besitzungen).
untern. Die höchste ist das Obertribunal in Konstantinopel
(gegründet 1868), welches unter anderm alle Todesurteile zu
bestätigen hat. Außerdem bestehen in Seestädten 49
Handelsgerichte, die 1847 errichtet wurden. In Prozessen, bei denen
beide Parteien Fremde sind, entscheiden die Konsulargerichte.
[Finanzen.] Was die Finanzen anlangt, so haben sich dieselben
nach dem Staatsbankrott vom 13. April 1876 (Einstellung der
Zinszahlungen) ein wenig gehoben infolge der am 20. Dez. 1881
dekretierten Konsolidation und Reduktion der äußern und
der Regulierung der schwebenden Schuld. Die Anleihen von 1858 bis
1874 im Betrag von 190,997,980 Pfd. Sterl. wurden auf 106,437,234
Pfd. Sterl. reduziert, und letztere werden seitdem aus den
Erträgnissen gewisser Steuern (Tabaks- und Salzmonopol,
Getränke- und Fischereisteuer, Stempel, Seidenzehnt, Tribut
von Bulgarien und Ostrumelien, Überschuß der
Einkünfte von Cypern) unter Aufsicht von Vertretern der
Gläubiger mit 1 Proz. verzinst und mit ¼ Proz.
amortisiert. Am 13. März 1887 betrug diese Schuld noch
104,458,706 Pfd. Sterl., die zu ihrer Verzinsung bestimmten innern
Steuern ergaben 1887/88: 114 Mill. Piaster (noch nicht 1 Mill. Pfd.
Sterl.). Außerdem gibt es aber noch eine innere Schuld von
ca. 22 Mill. türk. Pfd. (à 100 Piaster), eine
schwebende Schuld von ca. 9 Mill. türk. Pfd., die
unverzinsliche russische Kriegsschuld von 32 Mill. Pfd. Sterl., die
an russische Private zu leistende Entschädigung von 38 Mill.
Frank und Schulden für neuerdings geliefertes Kriegsmaterial
(ca. 3 Mill. Pfd. Sterl.). Das Budget ist ein ganz ungeregeltes;
die Zahlen desselben, soweit solche überhaupt noch
veröffentlicht werden, stehen lediglich auf dem Papier und
verdienen kein Vertrauen, das ständige Defizit wird durch
Verringerung und Nichtauszahlung der Beamtengehalte, kleine
Anleihen, selbst Zwangsanleihen nicht ausgeschlossen, und
ähnliche Mittelchen gedeckt. 1881/82 belief sich dasselbe auf
ca. 5¼ Mill. türk. Pfd., es schwankt meist zwischen 4
und 8 Mill. Im Finanzjahr 1884/85 waren die sonst ca. 12 Mill.
türk. Pfd. betragenden Einnahmen angeblich auf 7 Mill.
gesunken! Für 1887/88 schätzt man sie wieder auf
17½ Mill. türk. Pfd., ob mit Recht, ist sehr fraglich.
Die Hauptposten der Einnahmen, soweit dieselben nicht an die
Staatsgläubiger verpfändet sind, sind: Grundsteuer,
Einkommensteuer von einzelnen Gewerben, der Zehnte von den
Bodenerzeugnissen, der aber in der Höhe von 12½ Proz.
erhoben wird, die Hammelsteuer, die auf den Nichtmohammedanern
lastende Steuer für Befreiung vom Militärdienst, der
8proz. Einfuhr- und der 1proz. Ausfuhrzoll.
[Heer, Flotte, Wappen.] Im Mai 1879 erließ die
Armee-Reorganisationskommission eine neue Ordre de bataille
für den Friedensstand des türkischen Heers. Danach
umfaßt letzteres sieben Armeekorps (Ordu) mit den
Hauptquartieren in Konstantinopel (Garde), Adrianopel, Monastir,
Ersindschan, Damaskus, Bagdad und Sana'a in Arabien. Jedes
Armeekorps soll im Frieden durchschnittlich umfassen: 6
Infanterieregimenter zu 3 Bataillonen à 800 Mann, 6
Jägerbataillone zu 800 Mann, 4 Kavallerieregimenter zu 800
Pferoen, 1 Artillerieregiment zu 12 Batterien à 6
Geschütze und 100 Mann, 1 Pionierbataillon zu 400 Mann und
mehrere Gendarmeriebataillone. Das gäbe einen Etat von 210,000
Mann (134,400 Infanteristen, 22,400 Reiter, 9600 Mann Artillerie,
3600 Pioniere und 40,000 Gendarmen) mit 576 Geschützen, wozu
im Krieg noch je 100,000 Mann Reserven und Landwehr kämen mit
resp. 192 und 120 Geschützen. Die Feldarmee betrüge also
410,000 Mann mit 888 Geschützen, eine Zahl, die durch
Irreguläre und das ägyptische Kontingent auf eine halbe
Million gebracht würde. Faktisch zählte die
türkische Armee 1885: 63 Regimenter Infanterie zu 4
Bataillonen, 2 Zuavenregimenter zu 2 Bataillonen, 15 Bataillone
Jäger und 1 Bataillon berittene Infanterie; 39 Regimenter
Kavallerie zu 5 Schwadronen; 13 Regimenter Artillerie mit 144
fahrenden Batterien, 18 reitende und 36 Gebirgsbatterien, 8
Bataillone Festungsartillerie und 10 Bataillone
Artilleriehandwerker, 6 Bataillone Genietruppen, eine
Telegraphenkompanie, 5 Train-, 3 Feuerwehr- und 3
Handwerkerbataillone, zusammen 12,000 Offiziere, 170,000 Mann,
30,000 Pferde, 1188 Feld- und 2374 Festungsgeschütze;
außerdem Kadres für 96 Redifregimenter zu 4 Bataillonen.
Die Flotte, durch Verluste im letzten russischen Krieg und
nachherige Verkäufe an England wesentlich verringert,
zählte zu Ende 1886 wieder 12 Panzer-, 50 hölzerne und 12
Torpedofahrzeuge; im Bau befanden sich eine Panzerfregatte und 2
Panzerkorvetten. Die Flagge besteht aus einem roten Flaggtuch mit
weißem Halbmond und weißem achtstrahligen Stern (s.
Tafel "Flaggen I"); die Handelsflagge aus drei Horizontalstreifen
Rot-Grün-Rot.
Das Wappen des türkischen Reichs ist ein grüner Schild
mit wachsendem silbernen Monde. Den Schild umgibt eine
Löwenhaut, auf der ein Turban mit einer Reiherfeder liegt;
hinter demselben stehen schräg zwei Standarten mit
Roßschweifen. Es bestehen vier Ritterorden: der Orden des
Ruhms (Nischani iftichar, 1831 gestiftet), mit 4 Klassen; der
Medschidieh-Orden (1852 gestiftet, s. Tafel "Orden", Fig. 33), mit
5 Klassen, der Osmanje-Orden (1861 gestiftet), mit 3 Klassen, der
Verdienstorden (Nischani-Imtiaz, 1879 gestiftet), außerdem
ein Damenorden (1880 gestiftet). Sonstige Auszeichnungen sind
Kriegsmedaillen, Ehrenkaftane und Ehrensäbel.
Außereuropäische Besitzungen.
Die asiatische Türkei umfaßt eine Anzahl
verschiedenartiger Gebiete, welche den westlichsten Teil von Asien
bllden. Diese Gebiete sind: Armenien, Kurdistan, Irak Arabi oder
Babylonien, El Dschesireh oder Mesopotamien, Kleinasien, Syrien und
Palästina, die Halbinsel Sinai und das westliche
Küstenland von Arabien. Hinsichtlich der Verwaltung zerfallen
diese Länder in Wilajets, von denen jedes unter einem Pascha
als Statthalter steht, deren Grenzen und Namen aber häufig
wechseln. Dieselben sind im Sommer 1888, abgesehen von den zum
Polizeibezirk von Konstantinopel gehörigen Liwas Bigha und
Kodscha-Ili, das Inselwilajet (Dschezâiri-bahri-sefîd),
Chodawendikjâr, Aïdin, Kastamuni, Angora, Konia, Siwas,
Adana, Trapezunt, Erzerum, Wan, Bitlis, Diarbekr, Charput
(Ma'amuret el Aziz), Mosul, Bagdad, Basra, Aleppo, Surija oder
Damaskus und Beirut und in Arabien die Wilajets Hidschas und Jemen
(s. die einzelnen Artikel). Die Bevölkerung der asiatischen
Besitzungen der Pforte wird auf 16,133,000 Seelen veranschlagt, das
Areal derselben auf ca. 1,890,000 qkm (ca. 34,300 QM.). Die
direkten afrikanischen Besitzungen zählen auf 1,033,000 qkm
nur etwa 1 Mill. Einw. Die gesamten unmittelbaren Besitzungen des
türkischen Reichs umfassen also ca. 3,088,400 qkm mit
21½ Mill. Einw., unter Hinzurechnung aller
Tributärstaaten etc. aber 4¼ Mill. qkm mit 33 Mill.
Einw.
[Litteratur.] Vgl. v. Hammer-Purgstall, Die Staatsverfassung und
Staatsverwaltung des osma-
KARTE ZUR GESCHICHTE DER EUROPÄISCHEN TÜRKEI.
Türkei und Nachbarländer.
XIV. Jahrhundert bis vor 1453.
Türkei und Schutzstaaten.
Größte Ausdehnung bis zum Karlowitzer Frieden
1699.
Türkei und Schutz Staaten
1699 - 1877.
Türkei und Nachbarländer
nach dem Berliner Vertrag.
1878, 1881 u. 1885.
925
Türkisches Reich (Geschichte bis zum 15. Jahrhundert).
nischen Reichs (Wien 1814, 2 Bde.); v. Moltke, Briefe über
Zustände und Begebenheiten in der Türkei 1835 bis 1839
(Berl. 1841, 4. Aufl. 1882); Rigler, Die Türkei und deren
Bewohner (Wien 1852, 2 Bde.); Ubicini, Lettres sur la Turquie.
Tableau statistique, religieux, politique, administratif etc. (Par.
1854); Derselbe, État présent de l'empire ottoman
(mit Pavet de Courteille, das. 1877); Michelsen, The Ottoman empire
and its resources (Lond. 1853); Heuschling, L'empire de Turquie
(Brüssel 1860); "Stambul und das moderne Türkentum. Von
einem Osmanen" (Leipz. 1878); J. Baker, Die Türken in Europa
(deutsch, Stuttg. 1878); Aristarchi Bei, La legislation ottomane
(Konstant. u. Par. 1873-88, 7 Bde.); Baillie, Digest of moohummudan
law (2. Aufl., Lond. 1875 u. 1887, 2 Bde.); Zur Helle, Die
Völker des osmanischen Reichs (Wien 1877); Menzies, Turkey,
historical, geographical, statistical (Lond. 1880, 2 Bde.); L.
Diefenbach, Die Volksstämme der europäischen Türkei
(Frankf. 1877); Meyers Reisebücher: "Türkei und
Griechenland" (2. Aufl., Leipz. 1888); "Karte der Balkanhalbinsel"
(1:300,000, vom österreichischen militärtopographischen
Institut, seit 1876); H. Kiepert, Generalkarte der
südosteuropäischen Halbinsel (Berl. 1885).
Geschichte des türkischen Reichs.
(Hierzu "Geschichtskarte des türkischen Reichs".)
Übersicht der osmanischen Herrscher.
Osman (1288-1326)
Urchan (1326-59)
Murad I. (1359-89)
Bajesid I. (1389-1403)
(Suleiman, Musa) Mohammed I. (1413-21)
Murad II. (1421-51)
Mohammed II. (1451-81)
Bajesid II. (1481-1512)
Selim I. (1512-20)
Suleiman II. (1520-66)
Selim II. (1566-74)
Murad III. (1574-95)
Mohammed III. (1595-1603)
Achmed I. (1603-17)
Mustafa I. (1617-18)
Osman II. (1618-22)
Murad IV. (1623-40)
Ibrahim (1640-48)
Mohammed IV. (1648-87)
Suleiman III. (1687-91)
Achmed II. (1691-95)
Mustasa II. (1695-1703)
Ach.ned III. (1703-30)
Mahmud I. (1730-54)
Osman III. (1754-57)
Mustafa III. (1757-74)
Abd ul Hamid I. (1774-89)
Selim III. (1789-1807)
Mustafa IV. (1807)
Mahmud II. (1808-39)
Abd ul Medschid (1839-61)
Abd ul Asis (1861-76)
Murad V. (1876)
Abd ul Hamid II. (seit 1876)
[Gründung des türkischen Reichs.] Die Türken, ein
Stamm der schon im Altertum Turan bewohnenden, im 8. Jahrh. zum
Islam bekehrten Bevölkerung, von der bereits früher
zahlreiche Scharen unter Führung der Seldschukken (s. d.)
Vorderasien überschwemmt hatten, wanderten, 50,000 Seelen
stark, um 1225 unter ihrem Stammeshäuptling Suleiman I., um
dem Schwerte der Mongolen zu entrinnen, von Chorasan nach Armenien
aus. Suleimans Sohn Ertogrul (1231-88) trat als Lehnsträger in
die Dienste Ala ed dins, des seldschukkischen Sultans von Konia,
und erhielt einen Landstrich im nordwestlichen Phrygien zum
Wohnsitz, wo die Türken Gelegenheit fanden, im Kampf gegen das
absterbende griechische Kaiserreich Eroberungen zu machen. Osman,
Ertogruls Sohn und Nachfolger (1288-1326), erweiterte sein Gebiet
durch glückliche Kämpfe gegen die Griechen
beträchtlich und nahm 1299 nach Ala ed dins Tode den Titel
"Sultan" an; nach ihm führten die Türken fortan den Namen
osmanische Türken oder Osmanen. Türkische Freibeuter
wagten sich auf die See, eroberten 1308 Chios und plünderten
und verwüsteten zahlreiche Städte der kleinasiatischen
Westküste. Osmans Sohn Urchan (1326-59), einer der
bedeutendsten Herrscher seines Geschlechts, eroberte 1326 das feste
und volkreiche Brussa, wo er sich einen Palast erbaute, dessen Thor
die "hohe Pforte" genannt wurde, und unterwarf sich bis 1340 das
ganze Land bis an die Propontis mit Nikäa und Nikomedeia sowie
weite Länderstrecken im Innern Kleinasiens. Sein Sohn Suleiman
setzte sich 1356 schon auf der europäischen Seite des
Hellesponts, in Gallipoli, fest. Unter dem Beirat seines
einsichtsvollen Bruders Ala ed din, des ersten Wesirs der Osmanen,
organisierte Urchan das Reich nach den Satzungen des Korans und des
osmanischen Staatsrechts (Kanun) und teilte es in drei
Militärdistrikte, Sandschaks (Fahnen). Auch schuf er ein
stehendes Heer und errichtete die Janitscharen (d. h. neue Truppe),
ein aus christlichen Knaben rekrutiertes vortrefflich geschultes
Fußvolk, sowie die Spahis, eine reguläre Reitertruppe,
deren Mannschaften gegen erbliche Dienstpflicht mit den
Einkünften von Dörfern der unterworfenen Gebiete belehnt
wurden. Die Türken bildeten also ein politisch organisiertes
Heerlager, dessen Unterhaltung den unterworfenen christlichen
Volkerschaften oblag, und das sich trotz der fortwährenden
Kriege durch den massenhaften Übertritt von Christen zum
Islam, welchen sofort alle Vorrechte des herrschenden
Kriegerstammes gewährt wurden, rasch und unaufhörlich
vermehrte. Diese wohl organisierte Kriegsmacht gab zu einer Zeit,
der stehende Heere fremd waren, den Osmanen ihre Übermacht
über ihre Nachbarn.
Urchans zweiter Sohn, Murad I. (1359-89), eroberte Thrakien,
verlegte 1365 seine Residenz nach Adrianopel und beschränkte
das griechische Kaiserreich auf Konstantinopel und Umgebung. Serben
und Bulgaren mußten nach der Niederlage auf dem Serbierfeld
bei Adrianopel (1363) Tribut zahlen und sich zu Heeresfolge
verpflichten; die Fürsten Kleinasiens mußten die
Oberhoheit des Sultans anerkennen. Die Erhebung des
Serbenkönigs Lazarus, dem sich die Fürsten von Bosnien,
Albanien, der Herzegowina und der Walachei anschlössen, endete
mit der blutigen Niederlage auf dem Amselfeld bei Kossowa (15. Juni
1389); der siegreiche Murad wurde auf dem Schlachtfeld selbst von
einem verwundeten Serben ermordet. Sein Sohn Bajesid I. (1389-1403)
machte die Walachei zinspflichtig, unterjochte Bulgarien
völlig, eroberte ganz Makedonien und Thessalien und drang
siegreich in Hellas ein. Auch in Asien vermehrte er die
türkische Macht, indem er die Länder zwischen dem Halys
und dem Euphrat eroberte. Das christliche Kreuzheer, welches
König Siegmund von Ungarn aus dem Abendland herbeiführte,
schlug er 28. Sept. 1396 bei Nikopoli und schickte sich zur
Belagerung Konstantinopels an, als das Vordringen der Mongolen
unter Timur in Vorderasien ihn zwang, sich gegen diese zu wenden.
Doch unterlag er 20. Juli 1402 in der Schlacht bei Angora und
geriet selbst in Gefangenschaft, in welcher er 1403 starb. Durch
den Zwist seiner Söhne Suleiman, Musa und Mohammed geriet das
Reich in Gefahr, zu zerfallen. Doch glückte es dem letztern
1413, nach der Besiegung und dem Tode seiner Brüder das
osmanische Reich wieder in seiner Hand zu vereinigen und seine
Herrschaft gegen auswärtige Feinde und Aufstände im
Innern siegreich zu behaupten. Sein Sohn Murad II. (1421-51) konnte
1422 wieder die Eroberung Konstantinopels versuchen; doch
Aufstände in Asien sowie heftige Kriege an der Donau gegen die
Ungarn und Serben unter Johannes Hunyadi und in Albanien gegen
Georg Kastriota, in denen die Osmanen wiederholt Unfälle
erlitten, zwangen Murad, Illyrien den Serben, die Walachei den
Ungarn ab-
926
Türkisches Reich (Geschichte: 15.-17. Jahrhundert).
zutreten und von der völligen Vernichtung des
byzantinischen Reichs abzustehen. Erst als seine glänzenden
Siege über die Christen bei Warna (10. Nov. 1444) und auf dem
Amselfeld bei Kossowa (17.-20. Okt. 1448) die Herrschaft der
Osmanen an der Donau dauernd begründet hatten, zugleich auch
der südliche Teil der griechischen Halbinsel erobert worden
war, konnte die wieder erstarkte Osmanenmacht unter Murads
Nachfolger Mohammed II. (1451-81) sich gegen Konstantinopel wenden,
das nach tapferer Verteidigung 29. Mai 1453 in die Hände der
Türken fiel und zur Hauptstadt ihres Reichs erhoben wurde.
Höchste Macht und Blüte des Reichs.
Mohammed ordnete darauf die Angelegenheiten der zahlreichen
unterworfenen Christen (Rajah) und ihres Klerus; dieselben wurden
zwar nicht gewaltsam zum Islam bekehrt, vielmehr in der freien
Ausübung ihrer Religion belassen, blieben aber doch der
willkürlichen Gewalt der Türken preisgegeben, welche als
herrschendes Kriegervolk die Hilfsmittel der eroberten Länder
rücksichtslos zu ihrer Bereicherung und zur Verstärkung
ihrer militärischen Kraft verwendeten und durch
unaufhörliche Erweiterung ihres Machtgebiets sich selbst und
dem Islam die Welt zu unterwerfen strebten. 1456 wurde der
Peloponnes, 1460 das Kaiserreich Trapezunt, 1470 Albanien erobert,
1475 der Tatarenchan der Krim zur Unterwerfung gezwungen, 1478 die
Moldau Polen entrissen und unter die Oberhoheit der Türkei
gestellt. Mohammeds Nachfolger Bajesid II. (1481-1512), unter dem
in der gewaltigen Machtentfaltung des Osmanenstaats ein Stillstand
eintrat, da seine Kriegsunternehmungen gegen das Abendland wenig
glücklich waren, hatte trotz der in der osmanischen Dynastie
bereits üblichen Sitte, die Alleinherrschaft durch grausamen
Verwandtenmord zu sichern, mit fortwährenden Aufständen
zu kämpfen und ward, nachdem er einen Bruder (Dschem) und zwei
Söhne hatte hinrichten lassen, von seinem jüngsten Sohn,
Selim I. (1512-20), gestürzt und vergiftet. Selim besiegte
1514 den Schah von Persien, den er durch die Ermordung von 40,000
auf türkischem Boden lebenden Schiiten zum Kriege gereizt
hatte, bei Tschaldyran, eroberte Armenien und den Westen von
Aserbeidschân, dann nach Besiegung der Mamelucken 1517
Syrien, Palästina und Ägypten und wurde von den heiligen
Städten Mekka und Medina als Schirmherr anerkannt, worauf er
den Titel eines Kalifen annahm. Unter seinem Nachfolger Suleiman
(Soliman) II. (1520-66) erreichte die türkische
Machtentwickelung ihren Höhepunkt: er eroberte 1521 Belgrad,
vertrieb 1522 die Johanniter von der Insel Rhodos, vernichtete 29.
Aug. 1526 das ungarische Heer unter König Ludwig II. bei
Mohács, drang 1529 bis Wien vor und vereinigte Ungarn,
nachdem es seit 1533 unter dem siebenbürgischen Fürsten
Johann Zápolya ein türkisches Vasallenreich gewesen,
1547 zur Hälfte mit seinem Reich. Die Venezianer mußten
1540 ihre Inseln im Ägeischen Meer und ihre letzten
Besitzungen auf dem Peloponnes abtreten. Im Osten eroberte er durch
einen siegreichen Krieg mit Persien (1533-1536) Georgien und
Mesopotamien. Seine Flotten beherrschten das Mittelmeer bis
Gibraltar und beunruhigten durch Raubzüge im Indischen Ozean
die portugiesischen Kolonien. Die Barbareskenstaaten Nordafrikas
erkannten seine Oberhoheit an. Er starb 1566 im Lager vor Szigeth
in Ungarn. Mit ihm schloß die glänzende Reihe
hervorragender Kriegsfürsten, welche die osmanische Dynastie
auszeichnete und den großartigen Aufschwung der
türkischen Macht ermöglichte. Dem türkischen
Staatswesen galt nicht der Friede, sondern der Krieg als der
normale Zustand; um in diesem die nötige Kraft zu entfalten,
war in jenem ein rücksichtslos egoistischer, von allen Banden
des Rechts und der Sitte befreiter Despotismus nötig, der aber
allmählich ertötend wirkte. Die grausame Vertilgung aller
hervorragenden, aber deshalb gefährlichen Mitglieder der
Dynastie, die Serailerziehung und strenge Abschließung der
jungen Prinzen vom öffentlichen Leben vernichteten die Kraft
des Herrschergeschlechts. Das tapfere Kriegervolk verweichlichte in
den Genüssen des Friedens, die Soldateska der Janitscharen
wurde immer zügelloser.
Verfall des Reichs.
Selim II. (1566-74) war ein schwacher Fürst und ließ
seinen Großwesir Sokolli regieren. Dieser entriß zwar
den Venezianern Cypern, Zante und Kephalonia; dagegen wurde die
türkische Flotte 7. Okt. 1571 bei Lepanto von den Christen
besiegt. Murad III. (1574-95), welcher sich den Thron durch
Ermordung von fünf Brüdern sicherte, und Mohammed III.
(1595-1603), der 19 Brüder erdrosseln ließ, führten
erfolglose Kriege gegen Österreich und Persien; letzterer
verlor Tebriz und Bagdad und mußte Frankreich um Vermittelung
des Friedens mit Österreich angehen. Achmed I. (1603-17)
schloß 1612 mit den Persern einen ungünstigen Frieden.
Sein Bruder Mustafa I. (1617-18) ward nach dreimonatlicher
Herrschaft durch ein Fetwa des Muftis als blödsinnig
abgesetzt, Achmeds Sohn Osman II. (1618-22), als er nach einem
unglücklichen Feldzug gegen die polnischen Kosaken die
Janitscharen, denen er die Schuld beimaß, vernichten wollte,
von diesen ermordet und, nachdem Mustafa wieder als Sultan
anerkannt, aber 1623 zum zweitenmal abgesetzt worden war, Osmans
jüngerer Bruder, Murad IV. (1623-40), auf den Thron erhoben.
Dieser eroberte im Kriege gegen Persien (1635-38) Eriwan, Tebriz
und Bagdad wieder, züchtigte die Kosaken und legte den
Venezianern einen nachteiligen Frieden auf; auch stellte er die
Manneszucht wieder her und füllte durch strenge Sparsamkeit
den Staatsschatz. Sein Bruder und Nachfolger Ibrahim (1640-48), ein
feiger Wollüstling, unter dessen toller und blutiger
Serailwirtschaft die von Murad gewonnenen Vorteile wieder verloren
gingen, ward 1648 von den Janitscharen abgesetzt und erdrosselt und
sein siebenjähriger Sohn Mohammed IV. (1648-87) auf den Thron
erhoben.
Durch den Streit um die Vormundschaft ward das Reich der
Auflösung nahegebracht: Zerrüttung der Finanzen,
Meutereien der Janitscharen, Empörungen der
Provinzialstatthalter, Niederlagen gegen die Venezianer (1656 in
den Dardanellen) und Polen brachen über das Reich herein, bis
Mohammed Köprili, 1656 zum Großwesir ernannt, durch
blutige Strenge die Manneszucht in der Armee, den Gehorsam der
Provinzen und die Ordnung der Finanzen herstellte und die
Venezianer zurückschlug. Achmed Köprili eroberte im
Kriege gegen Österreich Gran und Neuhäusel und
behauptete, obwohl 1 Aug. 1664 bei St. Gotthardt geschlagen, diese
Eroberungen im Frieden von Vasvár, unterwarf 1669 Kreta und
zwang Polen im Frieden von Budziak 1672 zur Abtretung Podoliens und
der Ukraine, welche türkischer Schutzstaat wurde, freilich
nach Achmeds Tod (1676) durch einen neuen Krieg mit Polen und einen
Krieg mit Rußland nebst Asow 1681 wieder verloren ging. Der
neue Eroberungskrieg, den Achmeds Nachfolger Kara Mustafa 1683
gegen Österreich unternahm, verlief nach der vergeblichen
927
Türkisches Reich (Geschichte: 17.-19. Jahrhundert).
Belagerung Wiens (24. Juli bis 12. Sept. 1683) so
unglücklich, daß ganz Mittelungarn mit Ofen verloren
ging und die Kaiserlichen nach dem Sieg bei Mohács (12. Aug.
1687) in Serbien eindrangen, während gleichzeitig die
Venezianer den Peloponnes und Kephalonia wieder eroberten. Mohammed
ward daher 1687 entthront; aber weder Suleiman III. (1687-91) noch
Achmed II. (1691-95) vermochten den türkischen Waffen wieder
den Sieg zu verleihen. Nach den großen Niederlagen bei
Slankamen (19. Aug. 1691) und Zenta (11. Sept. 1697) mußte
Mohammeds Sohn Mustafa II. (1695-1703) im Frieden von Karlowitz
(Januar 1699) Ungarn und Siebenbürgen an Österreich, Asow
an Rußland, Podolien und die Ukraine an Polen, den Peloponnes
an Venedig abtreten. Mustafa ward 1703 von den Janitscharen
abgesetzt und sein Bruder Achmed III. (1703-30) zum Sultan erhoben.
Derselbe nahm nach der Schlacht bei Poltawa (1709) den
flüchtigen Schwedenkönig Karl XII. gastlich auf,
erklärte auch seinetwegen Rußland den Krieg; doch
ließ sein Großwesir 1711 den am Pruth eingeschlossenen
Zaren Peter d. Gr. gegen Rückgabe Asows frei. 1715 ward der
Peloponnes den Venezianern wieder entrissen; doch verloren die
Türken nach einem neuen unglücklichen Kriege gegen
Österreich im Frieden von Passarowitz (21. Juli 1718) einen
Teil von Serbien mit Belgrad. 1730 ward Achmed wegen eines
unglücklichen Kriegs mit Persien gestürzt.
Unter Mahmud I. (1730-54) ward die Türkei 1737 von
Österreichern und Russen von neuem angegriffen. Diese fielen
in die Krim ein und eroberten Asow wieder; die Österreicher
kämpften aber so unglücklich, daß die Türken
im Frieden von Belgrad (1. Sept. 1739) das Gebiet südlich der
Save und Donau sowie ihre an Rußland verlornen Grenzfestungen
mit Asow wieder zurückerhielten. Auf Mahmud folgte Osman III.
(1754-57), auf diesen sein Vetter Mustafa III. (1757-74), der 1768
mit Rußland wegen dessen drohender Haltung gegen Polen einen
Krieg begann, der aber höchst unglücklich für ihn
verlief. Die Russen besetzten die Moldau und Walachei, eine
russische Flotte erschien im Ägeischen Meer und vernichtete
die türkische 5. Juli 1770 bei Tscheschme; 1771 ward die Krim
den Türken entrissen, und 1773 drangen die Russen sogar in
Bulgarien ein, so daß Mustafas Nachfolger Abd ul Hamid I.
(1774-89) im Frieden von Kütschük Kainardschi (21. Juli
1774) die Krim aufgeben, alle Plätze an der Nordküste des
Schwarzen Meers abtreten, den Russen freie Schifffahrt im Schwarzen
und Ägeischen Meer zugestehen und für die Moldau und
Walachei Verpflichtungen übernehmen mußte, die ein
Schutzrecht Rußlands begründeten. Infolge der
unersättlichen Eroberungssucht Katharinas II. von
Rußland, die 1783 die Krim und die Kubanländer mit ihrem
Reich vereinigte und 1786 mit Kaiser Joseph II. ein Bündnis
schloß, brach 1788 ein neuer Krieg gegen Rußland und
Österreich aus, in dem die Türken sich mutig und tapfer
behaupteten, zwar Suworows siegreiches Vordringen nicht hemmen
konnten, aber den Österreichern wiederholt Verluste
beibrachten. Unter preußischer Vermittelung schloß
Selim III. (1789-1807) mit Österreich den Frieden von Sistova
(4. April 1791), mit Rußland den von Jassy (9. Jan. 1792) und
erhielt von beiden Mächten deren Eroberungen mit Ausnahme des
Gebiets rechts vom Dnjestr zurück.
Reformversuche.
Im Innern hatten die wiederholten langwierigen Kriege den
Verfall beschleunigt: die Finanzen waren völlig
zerrüttet, das Ansehen der Regierung geschwächt, die
Bande des Gehorsams gelockert und die Einheit des Reichs durch
Unabhängigkeitsbestrebungen mehrerer Paschas erschüttert.
Selims Reformversuche blieben diesen Schwierigkeiten gegenüber
wirkungslos. Dazu kamen wieder auswärtige Verwickelungen: 1798
der Einsall Bonapartes in Ägypten, 1806 wegen Verletzung des
Friedens von Jassy eine neue russische Kriegserklärung. Als
Selim die Errichtung eines neuen, nach europäischem Muster
ausgehobenen und organisierten Heers versuchte, welches die
Janitscharen ersetzen sollte, ward er 29. Mai 1807 auf Betrieb der
beim Volk beliebten Janitscharen durch die Ulemas abgesetzt und Abd
ul Hamids Sohn Mustafa IV. zum Sultan ernannt, und als sich der
Seraskier Mustafa Bairaktar, Pascha von Rustschuk, im Juli 1808
für Selim erhob, ward dieser im Gefängnis ermordet.
Bairaktar rückte nun auf Konstantinopel, erstürmte das
Serail und setzte an Mustafas Stelle dessen jüngern Bruder,
Mahmud II. (28. Juli 1808), auf den Thron, der einen neuen Aufstand
des von den Janitscharen aufgereizten fanatischen Volkes im
November 1808 blutig niederschlug u. Mustafa IV. hinrichten
ließ; sein Großwesir Bairaktar, vom Pöbel in einen
Turm eingeschlossen, sprengte sich mit diesem in die Luft.
Mahmud II. (1808-39), der jetzt als einzig überlebender
Nachkomme Osmans von den Türken als rechtmäßiger
Herrscher anerkannt wurde, machte sich besonders die
Wiederherstellung der Autorität der Pforte gegen die
zahlreichen Unabhängigkeitsbestrebungen der Paschas und der
christlichen Stämme zur Aufgabe. Die drohende Haltung
Napoleons gegen Rußland bewog dieses, trotz seiner
glänzenden Siege im Frieden von Bukarest (28. Mai 1812) die
meisten seiner Eroberungen wieder herauszugeben. Zwar gelang es
Mahmud, mehrerer unbotmäßiger Paschas, namentlich Ali
Paschas von Janina (1822), Herr zu werden und durch blutige
Ausrottung des sich jeder Neuerung widersetzenden Janitscharenkorps
(Juni 1826) wie durch Errichtung eines regulären, nach
europäischem Muster organisierten Heerwesens seine Macht
wiederherzustellen. Dagegen glückte es ihm nicht, den Aufstand
der Serben (seit 1804) und der Griechen (seit 1821) zu
unterdrücken; die Grausamkeit Mahmuds gegen die Griechen
isolierte die Pforte völlig den europäischen Mächten
gegenüber, und so konnte Rußland dem wehrlosen Reich
erst den Vertrag von Akjerman (6. Okt. 1826) abnötigen,
welcher die staatsrechtlichen Verhältnisse Serbiens und der
Donaufürstentümer im Sinn Rußlands regelte, und
nachdem die türkisch-ägyptische Flotte 20. Okt. 1827
mitten im Frieden bei Navarino durch die vereinigten Geschwader
Rußlands, Englands und Frankreich vernichtet worden, im April
1828 den offenen Krieg beginnen, indem es seine Heere in Bulgarien
und in Armenien einrücken ließ. 1828 eroberten die
Russen bloß Warna, Kars und Achalzych, 1829 aber auch
Erzerum, und Diebitsch drang sogar bis Adrianopel vor, wo 14. Sept.
unter preußischer Vermittelung ein Friede zustande kam, in
welchem die Türkei die Donaumündungen und Achalzych an
Rußland abtrat, die Privilegien der
Donaufürstentümer und des vergrößerten Serbien
bestätigte und die Unabhängigkeit Griechenlands
anerkannte.
Nun nahm Mahmud seine Bestrebungen, die Einheit des Reichs
wiederherzustellen, von neuem auf, geriet dabei aber in Konflikt
mit dem Pascha von Ägypten, Mehemed Ali, welchem er für
seine beim griechischen Ausstand geleistete Hilfe große
Zugeständnisse hatte machen müssen. Mehemeds Adoptivsohn
Ibrahim Pascha fiel 1831 in Syrien ein, schlug die
928
Türkisches Reich (Geschichte 1832-1856).
Türken dreimal, eroberte 1832 Akka und drang 1833 in
Kleinasien bis Kutahia vor. Die Pforte rief in ihrer
Bestürzung Rußlands Hilfe an, welches auch 15,000 Mann
zur See an den Bosporus warf und zugleich mit andern Truppen die
Donau überschritt, während Frankreich und England ihre
Flotte vor den Dardanellen vor Anker gehen ließen. Jetzt
verstand sich Mehemed Ali zum Frieden von Kutahia (4. Mai 1833), in
welchem der Sultan in Form eines großherrlichen
Amnestiefermans den Vizekönig als Erbstatthalter Ägyptens
anerkannte und ihm auf Lebenszeit die Verwaltung Syriens und
Kretas, Ibrahim die von Adana und Tarsos zugestand. Zum Dank
für die russische Hilfe schloß Mahmud mit Rußland
den Vertrag von Hunkiar Skelessi (8. Juli 1833), in welchem er sich
verpflichtete, allen Feinden Rußlands die Dardanellen zu
schließen und keinem Kriegsschiff die Einfahrt in das
Schwarze Meer zu gestatten. Um den Krieg mit Ägypten wieder
aufnehmen zu können, bemühte sich der Sultan, die
kriegerischen Hilfsmittel der Pforte durch straffe Zentralstation
zu steigern; den Bosniern, Albanesen und verschiedenen
kleinasiatischen Stämmen wurden die Reste ihrer
Selbständigkeit genommen, das obere Mesopotamien und Kurdistan
unterworfen. Als 1839 verschiedene Empörungen gegen die
ägyptische Herrschaft in Syrien ausbrachen, erklärte im
Mai Mahmud dem Vizekönig den Krieg. Doch starb er 1. Juli, ehe
er Kunde erhielt von der völligen Niederlage seines Heers bei
Nisib (24. Juni); dieser folgte der Abfall der Flotte, welche der
Kapudan-Pascha Achmed 14. Juli in Alexandria an Mehemed Ali
überlieferte. Die Lage der Türkei, in der Abd ul Medschid
(1839-61), Mahmuds 16jähriger Sohn, die Regierung antrat, war
daher eine höchst kritische, und sie wurde nur gerettet durch
die Intervention der vier Mächte England, Rußland,
Österreich und Preußen; dieselben schlossen, um
Frankreichs ehrgeizige Pläne zu durchkreuzen, 15. Juli 1840
die Quadrupelallianz, welche durch eine
österreichisch-englische Flotte Mehemed Ali zur Räumung
Syriens zwang; demselben blieb nur die Erbstatthalterschaft von
Ägypten. Unter dem Beirat Reschid Paschas erließ Abd ud
Medschid das großherrliche Edikt vom 3. Nov. 1839, welches
unter dem Namen Hattischerif von Gülhane berühmt geworden
ist. Dies Dokument, dessen Wichtigkeit in der Bestimmung gipfelte,
daß die "Unterthanen jeder Nationalität und Religion",
also auch Christen und Juden, gleiche Sicherheit in betreff ihres
Vermögens, ihrer Ehre und ihres Lebens haben sollten, bildete
einen gewaltigen Fortschritt in der sozialen Gesittung und hatte
durch Einleitung mannigfacher Reformen auf administrativem und
kommerziellem Gebrauch für die Staatswirtschaft eine hohe
Bedeutung. Übrigens sollte der Hatt nur die Grundsätze
aufstellen, aus denen die zu erlassenden Spezialgesetze zu
erfließen hätten; diese Gesetze, von den Türken
Tanzimatihairijeh ("heilsame Organisation") genannt, sollten
für das gesamte Pfortengebiet Gültigkeit haben, und auch
Mehemed Ali mußte sich zu ihrer Annahme bequemen. 1841 wurde
in London zwischen den Großmächten und der Pforte der
sogen. Dardanellenvertrag abgeschlossen, durch welchen die letztere
sich verpflichtete, die Dardanellenstraße und den Bosporus
für fremde Kriegsschiffe in Friedenszeiten verschlossen zu
halten.
Der Krimkrieg mit seinen Folgen.
Das Jahr 1848 mit seinen Freiheitsideen ging an der eigentlichen
Türkei spurlos vorüber; dagegen bildete sich in den
Donaufürstentümern, wo Rußland unter dem Namen
einer Schutzmacht jede freiere Entwickelung despotisch niederhielt,
eine Reformpartei, deren Häupter gern mit Hilfe der Pforte
eine liberale Repräsentativverfassung eingeführt
hätten. Um den Russen keinen Vorwand zu einer Besetzung der
Donaufürstentümer zu geben, gab die Pforte die Liberalen
preis; dennoch erfolgte die Besetzung. Die Hoffnungen, welche man
in Konstantinopel für eine Wiederherstellung der frühern
Herrschaft an der Donau auf die ungarische Insurrektion von 1849
gesetzt hatte, wurden durch die Kapitulation von Vilagos (13. Aug.
1849) vernichtet. Doch hatte die Pforte wenigstens den Mut,
unterstützt durch eine vor den Dardanellen erscheinende
englische Flotte, die Auslieferung der ungarischen Flüchtlinge
zu verweigern. Rußland und Österreich wichen damals
zurück, ließen aber bald nachher die Pforte ihren Zorn
empfinden. Als die französische Republik im Herbst 1850 in
Konstantinopel eine Reklamation wegen der heiligen Stätten in
Palästina erhob und die Pforte dieselbe nicht ganz ablehnte,
sondern wenigstens die Mitbenutzung einer Kirchenthür in
Bethlehem den Katholiken zugestand, erklärte Kaiser Nikolaus
sofort, daß hierdurch das religiöse Gefühl der
orthodoxen Russen aufs äußerste verletzt werde, und
verlangte Bürgschaften für die griechisch-katholische
Kirche in der Türkei, welche Rußland ein völliges
Schutzrecht über Unterthanen der Pforte gewährt
hätten. Zugleich forderte Österreich die sofortige
Zurückziehung der eben damals siegreich in das
aufständische Montenegro eingedrungenen türkischen
Truppen aus diesem österreichischen Grenzland und die
Erledigung einer Anzahl privatrechtlicher Forderungen
österreichischer Unterthanen. Als der außerordentliche
österreichische Gesandte Graf Leiningen 14. Febr. 1853 die
unbedingte Erfüllung dieser Forderungen erreichte, schickte
auch Kaiser Nikolaus den Fürsten Menschikow nach
Konstantinopel, um in schroffster Form den Abschluß eines
förmlichen Vertrags über die der orthodoxen Kirche zu
gewährenden Privilegien zu verlangen. Die Ablehnung dieser
Forderung hatte einen neuen russisch-türkischen Krieg zur
Folge (1853-56, s. Krimkrieg). Die türkische Armee bewies sich
tüchtiger und leistungsfähiger, als man geglaubt hatte,
und verteidigte die Donaufestungen sowie Armenien mit großer
Zähigkeit und die erstern mit solchem Erfolg, daß die
Russen über die Donau zurückgehen mußten. Dagegen
wurde gleich zu Anfang des Kriegs die Flotte der Türkei bei
Sinope vernichtet, und auch ihre Truppen kämpften, seit die
verbündete Armee der Westmächte auf dem Kriegsschauplatz
erschienen war, nur in Armenien selbständig; in der Krim
spielten sie bloß die Rolle von Hilfstruppen.
Für die innern Verhältnisse der Türkei hatte der
Krimkrieg besonders die Wirkung, daß die Westmächte,
gewissermaßen als Belohnung und Rechtfertigung ihrer
thatkräftigen Hilfe, die Einführung gründlicher
Reformen in dem türkischen Reich forderten. Diese
Bemühungen gipfelten in einem neuen großherrlichen
Edikt, welches, von einer Diplomatenkommission zusammen mit dem
türkischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten
ausgearbeitet, unter dem Namen Hatti-Humayum 8. Febr. 1856
publiziert und später dem am 30. März d. J. zu Paris
unterzeichneten Friedensinstrument als Annex beigegeben wurde.
Dieser Hatt proklamierte die bürgerliche Gleichstellung aller
Unterthanen, verbot die Bevorzugung einer Religionsgenossenschaft
vor der andern, gewährte allen Staatsbürgern gleiches
Recht auf Anstellung im Pfortendienst, gleiches Recht auf
Schulbesuch, verordnete
929
Türkisches Reich (Geschichte 1856-1860).
die Einsetzung gemischter (mohammedanisch-christlicher)
Tribunale, die Wehrpflicht der Christen bei Befugnis des
Stellvertreterkaufs, das Recht des Grundeigentumserwerbs für
Ausländer, unbedingte Toleranz etc. Türkischerseits war
gegen die gleichmäßige Zulassung von Nichtchristen zu
den Staatsämtern, gegen die dem Exterritorialitätsprinzip
widerstreitende Grunderwerbsbefugnis der Ausländer und gegen
die unbedingte Toleranz, d. h. die Aufhebung der vom
mohammedanischen Rechtsbewußtsein geforderten Strafen
für Abfall vom Islam, vergeblich Einsprache erhoben worden;
der Hatt, welcher den Christen die Wehrpflicht für den von
ihnen immer als etwas Feindliches betrachteten Osmanenstaat
auferlegte, wurde von diesen mit ebensoviel Verdruß und
Argwohn aufgenommen wie von den Mohammedanern aller
Parteischattierungen mit patriotischem und religiösem Ingrimm,
und die türkischen Staatsmänner konnten wenigstens mit
Recht beanspruchen, daß der Pforte hinlängliche Zeit
für die allmähliche Ausführung der Reformen
gewährt werde. Auch bei dem Pariser Friedenskongreß
kamen die türkischen Interessen nur, insofern sie mit denen
der Westmächte zusammenfielen, zur Geltung. Rußland
wurde um die Donaumündungen und einen denselben anliegenden
Streifen Bessarabiens gekürzt, trat aber diesen letztern an
die Moldau ab, während die Pforte sich mit den
Donaumündungen begnügen mußte. Eine erhebliche
Einbuße für Rußland war dagegen die
Neutralisierung des Schwarzen Meers. Die Aufnahme der Pforte in die
europäische Staatenfamilie und die Gewährleistung ihrer
Unverletzlichkeit schienen die Stellung der Türkei in Europa
beträchtlich zu heben; dagegen wurden durch die Erneuerung des
Dardanellenvertrags und die Gewährung autonomer Stellung an
die drei Donaufürstentümer, unter Bürgschaft der
Vertragsmächte gegen Tributzahlung an die Pforte, ihre
Selbständigkeit und ihre Macht erheblich verringert.
In der That wurden die Befugnisse der Pforte über die
Vasallenstaaten nicht nur nicht vermehrt, sondern, da das
europäische Konzert, von dem die Türkei bloß einen
Teil bildete, sich die oberste Entscheidung beimaß, mehr und
mehr verringert und schließlich beinahe völlig
aufgehoben. Sie konnte nicht hindern, daß 1859 auf Betrieb
Frankreichs in der Moldau und der Walachei derselbe Mann, Cusa, zum
Fürsten erwählt und so die Union faktisch
durchgeführt wurde, und mußte sich begnügen, ihre
Investitur mittels zweier verschiedener Diplome zu erteilen. In
Serbien wurde der der Pforte ergebene Alexander Karageorgiewitsch
1858 zur Abdankung gezwungen und die Obrenowitsch
zurückgerufen, unter denen Serbien der Herd panslawistischer
Agitationen wurde, welche 1861 auch einen Aufstand in der
Herzegowina erregten. Dem Druck der Großmächte
nachgebend, befahl die Pforte 1862 allen außerhalb der
Festung in Serbien lebenden Türken, auszuwandern, und
schleifte mehrere Binnenbefestigungen. Die unter den Auspizien der
Westmächte begonnenen Reformen in den Immediatprovinzen
gerieten bald ins Stocken. Es gelang nur, eine Anzahl wichtiger
materieller Verbesserungen durchzuführen: neue
Heerstraßen wurden erbaut, Häfen angelegt, die Post
besser eingerichtet und Telegraphenlinien gezogen. Die Kehrseite
dieser Fortschritte bildete die Zerrüttung der Finanzen.
Während die Pforte sich früher in bedrängten Zeiten
mit Münzverschlechterung und Papiergeld beholfen hatte, deren
nachteilige Folgen bald beseitigt waren, war während des
Krimkriegs neben einer bedeutenden schwebenden Schuld im Inland
eine Anleihe von 7 Mill. Pfd. Sterl. in England aufgenommen worden.
Dieser folgten 1858, 1860 und 1861 drei weitere Anleihen. Die
Ausgaben stiegen infolge der hohen Zinsen auf 14 Mill. Pfd. Sterl.
jährlich, während die Einnahmen nur 9 Mill. betrugen.
186l brach wegen der Finanznot eine Handelskrisis aus, welcher man
durch Ausgabe von 1250 Mill. Piaster Papiergeld mit Zwangskurs zu
begegnen suchte. Die willkürlich verteilten und mit Härte
eingetriebenen Steuern bedrückten die Bevölkerung aufs
äußerste und führten in den Provinzen
allmähliche Verarmung herbei, während die hohen Beamten
und die Bankiers sich übermäßig bereicherten.
Zerrüttung des Staats unter Abd ul Asis.
Am 25. Juni 1861 starb Abd ul Medschid; sein Nachfolger Abd ul
Asis (1861-76) ward, weil er für nüchtern, sparsam und
energisch galt, mit Übertriebenen Hoffnungen
begrüßt. Dieser Enthusiasmus kühlte sich bald ab,
als man sah, daß dem neuen Großherrn allerdings die
gutmütige, wohlwollende Gesinnung seines Bruders fehle,
daß aber, was man für Charakterfestigkeit gehalten, nur
Eigensinn sei, welcher sich, seiner mangelhaften geistigen Bildung
entsprechend, in der Regel nach verkehrter Richtung
äußerte. Er nahm, wie sein Vater, einen Anlauf, der
Regenerator seines Reichs zu werden; er wollte sogar dafür
Opfer bringen, seinen Harem abschaffen, auf einen Teil der
Zivilliste verzichten etc. Aber das auch bei ihm hervortretende
Mißverhältnis zwischen Wollen und Können erzeugte
Schwermutsanfalle und Ausbrüche von Despotenlaune. Die
Minister wechselten unaufhörlich, kein Regierungsplan konnte
systematisch zu Ende geführt werden, die Staatseinkünfte
wurden oft auf unsinnige Weise verschwendet. Den Ränken der
Mächte, den Bestechungen der hohen Beamten durch Unternehmer
und Bankiers waren Thür und Thor geöffnet. Dazu kam,
daß die Türkei bald auch mit ihren westlichen
Schutzmächten in mancherlei Konflikte geriet, welche ihr der
Fanatismus der mohammedanischen Bevölkerung und die steigende
Unzufriedenheit der christlichen Unterthanen verursachten. Zu
Dschidda in Arabien wurden im Juni 1858 der englische und der
französische Konsul ermordet. Am gräßlichsten kam
die christenfeindliche Stimmung in Syrien zum Ausbruch, woselbst
1860 zunächst im Libanon nach wiederholten gegen die Christen
begangenen Gewaltakten die friedliche maronitische Bevölkerung
von Hasbaia, Raschaia und Deir el Kamer, nachdem sie unter Zusage
vollkommenen Schutzes ihre Waffen an die türkischen
Platzkommandanten jener Orte abgegeben, von herbeieilenden Drusen
massenhaft abgeschlachtet wurde, und dann in Damaskus, der alten
syrischen Landeshauptstadt, wo unter heimlicher Zustimmung der
Behörde ein volles Viertel (5000 Seelen) der christlichen
Bevölkerung dem Fanatismus der Mohammedaner erlag. Entsetzt
über die verübten Greuelthaten, verlangte die
öffentliche Meinung ein Einschreiten der
Großmächte. Bis aber diese über die Modalität
eines solchen schlüssig geworden waren, verstrichen Monate.
Inzwischen hatte die Pforte den Großwesir Fuad Pascha als
Kommissar mit unbedingter Vollmacht an Ort und Stelle geschickt,
und derselbe hatte sich angelegen sein lassen, durch zahlreiche
Hinrichtungen in Damaskus und im Libanon die Einmischung der
Mächte unnötig zu machen. Doch war die Ende August
erfolgte Absendung eines französischen Okkupationsheers nach
dem Libanon nicht überflüssig, indem erst jetzt die
hochgestellten Urheber und Förderer des Blutbades zur
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl., XV. Bd.
59
930
Türkisches Reich (Geschichte 1861-1875).
Strafe gezogen wurden. Erst im Juni 1861, nachdem über die
Entschädigung der heimgesuchten christlichen
Bevölkerungen für die erlittenen materiellen Verluste
eine Einigung erzielt worden war, wurden die französischen
Truppen wieder abberufen. Der Libanon wurde zu einem besondern,
direkt von Konstantinopel abhängenden Verwaltungsbezirk
gemacht und unter einen Statthalter christlicher Konfession mit
Wesirsrang gestellt.
Auch in der christlichen Bevölkerung der europäischen
Türkei regte es sich unter dem Einfluß der
panslawistischen und panhellenischen Agitationen an verschiedenen
Orten. Besonders gefährlich ward der Aufstand in Kreta im
Frühjahr 1866. Erst im August schickte die Pforte Truppen nach
der Insel, um die Ordnung herzustellen; doch brach der Kampf im
Fruhjahr 1868 mit erneuter Heftigkeit aus, und erst, als die Pforte
Griechenland ein Ultimatum stellte, wenn es nicht aufhöre, den
kretischen Aufstand zu unterstützen, und die im Januar 1869 in
Paris zusammengetretene Konferenz der Mächte Griechenland
nötigte, sich diesem Ultimatum zu unterwerfen, gelang die
Pacifizierung der Insel, nachdem sie große Opfer an Gut und
Blut gekostet, für welche kein Ersatz geleistet wurde. Dieser
Ausgang mußte die andern unterworfenen Völker ermutigen.
1866 trat Serbien mit dem Verlangen der gänzlichen
Räumung des Landes seitens der türkischen Truppen hervor,
und im Mai 1867 fügte sich die Pforte auch wirklich demselben,
da Österreich entschieden darauf drang. Bloß
Ägypten gegenüber gelang es dem Sultan, seine
Autorität aufrecht zu erhalten. Er hatte 1866 dem
Vizekönig Ismail Pascha bereitwilligst die Zustimmung zur
neuen Thronfolgeordnung und 1867 den Titel Chedive mit erweiterten
Befugnissen erteilt. Als dieser aber 1869 auf einer Reise nach
Europa seine völlige Souveränität zu erlangen
suchte, befahl ihm die Pforte 29. Nov. d. J., seine Armee auf
30,000 Mann zu reduzieren, keine neuen Panzerschiffe zu kaufen,
ohne Genehmigung des Sultans keine Anleihen zu kontrahieren,
selbständigen Verhandlungen mit fremden Mächten zu
entsagen etc. Der Chedive unterwarf sich, erlangte aber im Mai 1873
bei einem persönlichen Besuch in Konstantinopel durch ein
großes Geldgeschenk und Erhöhung des Tributs, daß
der Sultan ihm alles, mit Ausnahme der Vermehrung der Flotte,
wieder erlaubte.
Bei allen Übelständen genoß die Regierung Abd ul
Asis' noch eines gewissen Ansehens, solange tüchtige
Staatsmänner, wie Fuad und Aali Pascha, welche, allerdings mit
Unterbrechungen, gegen 15 Jahre lang in den wichtigen Posten des
Großwesirs und des Ministers der auswärtigen
Angelegenheiten abwechselten, an der Spitze des Staats standen. Als
aber Fuad 1869 und Aali 1871 gestorben waren, da schwand mit der
Geschäftskunde der Regierung auch das äußere
Vertrauen zu ihr mehr und mehr. Der Sultan behielt bei der Wahl
seiner Räte nur das eine Kriterium im Auge, ob sie ihn bei
seinem Plan, die Thronfolge zu ändern und durch
Einführung des Rechts der Erstgeburt seinen Sohn Jussuf zum
Nachfolger zu bestimmen, unterstützen würden.
Zunächst ernannte er Mahmud Nedim Pascha zum Großwesir,
einen unwissenden und habsüchtigen Mann, welcher, um seine
Kreaturen in die einflußreichen Stellen zu bringen, auf das
willkürlichste unter den tüchtigern Beamten
aufräumte und sich eine große Unpopularität zuzog,
von welcher ein beträchtlicher Teil auf seinen Gebieter
überging. Ganz gewissenlos wurden die Finanzen verwaltet. Der
Sultan selbst ging mit der Verschwendung durch Prachtbauten voran.
Das Heer und die Flotte verschlangen ungeheure Summen für die
Neubeschaffung von Kanonen, Gewehren und Panzerschiffen.
Telegraphen und Eisenbahnen, mit großen Kosten, aber nur nach
den Wünschen und dem Vorteil der fremden Mächte und der
Unternehmer angelegt, dienten wenig dazu, die Hilfsquellen des
Landes zu vermehren, und belasteten zunächst bloß den
Staatsschatz. Althergebrachte Hilfsmittel, wie stärkere
Anziehung der Steuerschraube, Verpachtung von Staatsgütern,
von Einkünften und Gerechtsamen, Verminderung des Gehalts der
mittlern und niedern Beamten, wurden durch unverständige
Ausbeutung bald abgenutzt und erfolglos und vermehrten nur die
Verarmung und Unzufriedenheit im Volk. Zu immer drückendern
Bedingungen mußten demnach von Jahr zu Jahr Darlehen
aufgenommen werden; um nur zu Geld zu kommen, schien die
türkische Regierung in ihren Zugeständnissen an die
Kapitalisten keine Grenze zu kennen. Sie konnte daher bald auch die
Zinsen ihrer auf 5000 Mill. Frank angewachsenen äußern
Schuld nicht mehr bezahlen. Am 6. Okt. 1875 erklärte die
Pforte, daß sie außer stande sei, von den Zinsen der
Staatsschuld mehr als 50 Proz. zu bezahlen, daß sie aber
über die restierenden 50 Proz. 5proz. Obligationen ausstellen
wolle, welche später bar eingelöst werden sollten. Aber
alle Versuche, der Mißwirtschaft im Innern Einhalt zu thun,
waren erfolglos. Im Juli 1872 war es der patriotischen Opposition
gelungen, Mahmud zu stürzen; aber seine Nachfolger erlagen
alle nach kurzer Herrschaft den Ränken des russischen
Botschafters Ignatiew, bis im August 1875 Mahmud wieder in die
Regierung zurückberufen ward.
Innere Unruhen und neuer Krieg mit Rußlaud.
Rußland, seit 1864 durch Ignatiew in Konstantinopel
vertreten, hatte unaufhörlich und mit wachsendem Erfolg daran
gearbeitet, seine durch den Krimkrieg verlorne Stellung im Orient
wiederzugewinnen. Da Ignatiew in Griechenland nicht mehr einen
ohnmächtigen Schützling, sondern einen gefährlichen
Nebenbuhler sah, so trat er fortan nicht sowohl als Protektor der
orthodoxen Kirche als der slawischen Unterthanen der Türkei
auf. Von ihm angestachelt, verlangten die Bulgaren ihre
Loslösung von dem griechischen Patriarchat in Konstantinopel
und erlangten im März 1870 auch wirklich die Errichtung eines
eignen Exarchats. Um die Autorität der Westmächte zu
erschüttern, stellte Rußland im Oktober 1870
während des deutsch-französischen Kriegs die Forderung,
daß das durch den Pariser Frieden Rußland auferlegte
Verbot, auf dem Schwarzen Meer Kriegsschiffe zu halten, aufgehoben
werde. Die Pforte suchte vergeblich Hilfe bei Europa: Frankreich
war zu Boden geschmettert, England hatte sich durch seine
egoistische Politik im Sommer 1870 um alles Ansehen und allen
Einfluß gebracht, und auf der Londoner Konferenz im März
1871 mußte sich die Pforte dem von Bismarck
unterstützten russischen Verlangen fügen. Nach diesem
Erfolg setzte Ignatiew seine Bemühungen, kein
vernünftiges Verwaltungssystem aufkommen zu lassen, die
Türkei mit Europa zu verfeinden, im Innern durch Unruhen u.
dgl. zu zerbröckeln und so die völlige Unterwerfung
derselben unter Rußland herbeizuführen, rastlos fort,
und es gelang ihm, Mahmud Nedim Pascha durch Bestechung, den Sultan
durch die Aussicht auf russische Unterstützung seines
Thronfolgeplans völlig in seine Gewalt zu bringen.
1875 brach in der Herzegowina, angeblich durch Steuerdruck
hervorgerufen, ein Aufstand aus. Mon-
931
Türkisches Reich (Geschichte 1875-1877).
tenegro und Serbien machten sich trotz offizieller
Neutralitätserklärung zu Vermittlern der von
Rußland ausgehenden Förderung des Aufstandes. Die
lässige Bekämpfung des Aufstandes zog den Türken
einige Schlappen zu; sofort wurde der Pforte auf Betrieb
Rußlands von den Mächten eine Konsularkommission zur
Herstellung des Friedens aufgenötigt, und als die
Bemühungen dieser an der ablehnenden Haltung der
Aufständischen gescheitert und sogar eine die
Pacifikationsbedingungen zusammenfassende Note der Mächte
verworfen worden war, als auch eine österreichischerseits
versuchte Vermittelung zu nichts geführt hatte: da glaubte die
Pforte endlich selbständig agieren zu können. Durch zwei
befestigte Lager hielt sie Serbien in Schach und schnitt die
Insurgenten von Montenegro ab, worauf sofort der Aufstand auf
einige rauhe Gebirgsgegenden beschränkt wurde. Nun aber trat
Ignatiew energisch gegen eine Bedrohung Montenegros auf und erzwang
eine Verlegung der turkischen Truppen von der montenegrinischen
Grenze. In diesem Augenblick trat ein andres verhängnisvolles
Ereignis für die Pforte ein: in Saloniki wurden 6. Mai 1876
der deutsche und der französische Konsul bei einem Tumult von
fanatischen Mohammedanern, nicht ohne Verschulden der
Behörden, ermordet. Die Pforte beeilte sich, den sehr strengen
Genugthuungsforderungen der Mächte gerecht zu werden; doch war
ihre vermehrte Isolierung die natürliche Folge des
Verbrechens. Die gegen sie ganz Europa durchzuckende
Mißstimmung wurde von Rußland geschickt benutzt.
Dasselbe wußte von den beiden verbündeten
Kaiserhöfen die Zustimmung zu dem sogen. Gortschakowschen
Memorandum zu erlangen, welches die Schuld an dem Nichtgelingen der
Pacifikation der Herzegowina lediglich dem Sultan beimaß und
unter Androhung wirksamerer Maßregeln einen zweimonatlichen
Waffenstillstand verlangte, um mit den Insurgenten wegen des
Friedens zu unterhandeln. Auch die übrigen Mächte, mit
Ausnahme Englands, erklärten sich mit dieser Staatsschrift
einverstanden.
Alle Schichten der türkischen Nation waren überzeugt,
daß Rußland auf das Verderben der Pforte sinne, und
daß Eigennutz und Unverstand den Großherrn und seinen
ersten Wesir dem Erbfeind als Gehilfen zuführten. Über
die Verbindung des Sultans mit Rußland wurden die
aufregendsten Gerüchte verbreitet, als wolle Rußland
Konstantinopel mit seinen Truppen besetzen, um die neue
Thronfolgeordnung mit Gewalt durchzuführen und die
Unzufriedenen zu züchtigen, und der russische Botschafter trat
denselben mit keiner Ableugnung entgegen. Am 11. Mai kam es zu
stürmischen Auftritten vor dem Palast des Sultans; die Softas
(theolog. Studenten) hatten sich bewaffnet und verlangten
Entlassung Mahmuds, Entfernung Ignatiews und Krieg gegen
Montenegro. Keine Hand rührte sich für Abd ul Asis.
Umsonst suchte derselbe durch Berufung eines populären Mannes
auf den Posten Mahmuds sich aus der Verlegenheit zu ziehen, er war
selbst unmöglich geworden. Am 29. Mai vereinigte sich der neue
Großwesir, Mehemed Ruschdi, mit dem Kriegsminister Hussein
Avni und Midhat Pascha, den Sultan abzusetzen und den ältesten
Sohn Abd ul Medschids, Murad V., auf den Thron zu erheben. In der
Nacht zum 30. Mai ward die Palastrevolution ohne
Blutvergießen durchgeführt. Der abgesetzte Sultan wurde
darauf 4. Juni in dem Palast Tscheragan, wohin man ihn gebracht
hatte, auf Befehl der Minister ermordet; man gab vor, er habe sich
durch Aufschneiden der Pulsadern selbst getötet. Am 15. Juni
drang von neuem die Kunde einer grauenhaften Blutthat ins Publikum:
drei Minister, darunter der energische Hussein Avni, wurden im Haus
Midhats von einem tscherkessischen Offizier ermordet!
Während dies in Konstantinopel geschah, brach an
verschiedenen Stellen Bulgariens der von Rußland vorbereitete
Aufstand aus. Es war ein Ausrottungskrieg der Bulgaren gegen ihre
in der Minderzahl befindlichen mohammedanischen Mitbürger,
aber die Urheber hatten sich in betreff der Ohnmacht der Pforte
verrechnet. Von den gegen ihn aufgebotenen Irregulären, denen
sich später Linientruppen beigesellten, wurde der Aufstand
unter noch barbarischern Greueln und entsetzlichem
Blutvergießen zu Boden geworfen. Inzwischen hatte auch
Serbien seine Rüstungen vollendet und überschritt nunmehr
die Grenze, um, wie es in dem Manifest vom 2. Juli 1876 hieß,
den aufständischen Nachbarprovinzen den Frieden wiederzugeben.
Rußland sandte nach Serbien die Erfordernisse für den
Krieg an Geld, Waffen, Munition und vor allem an Mannschaften. Doch
fochten die Serben unglücklich und sahen sich 29. Aug.
genötigt, die Mächte um Vermittelung eines
Waffenstillstandes anzugehen, den sie verräterisch brachen,
sobald sie durch russische Hilfe ihre Kampffähigkeit
wiederhergestellt zu haben glaubten. Neue Siege bei Alexinatz (Ende
Oktober) eröffneten nunmehr den Türken den Weg in das
Herz Serbiens; aber ihren Erfolgen gebot ein Telegramm des Kaisers
Alexander II. aus Livadia vom 30. Okt. 1876 Halt, welches unter
Androhung sofortigen diplomatischen Bruches ihnen binnen 24 Stunden
Einstellung ihrer Operationen auferlegte. Inzwischen war in
Konstantinopel Murad V. wahnsinnig geworden; 31. Aug. folgte ihm
sein Bruder Abd ul Hamid II. In der nichtigen Hoffnung,
Rußland durch Nachgiebigkeit zu entwaffnen, unterzeichnete
dieser 31. Okt. die Waffenstillstandsakte, berief seine Truppen aus
Serbien zurück und gewährte dem treulosen Vasallenstaat
1. März 1877 den denkbar günstigsten Frieden unter
Herstellung des Status quo ante.
Gleich nach dem Abschluß des serbisch-türkischen
Waffenstillstandes schlug England eine Konferenz vor, welche unter
Wahrung der Integrität des Osmanenreichs eine administrative
Autonomie für die slawischen Balkanprovinzen feststellen
sollte. Beim Zusammentritt derselben, welche in Konstantinopel
tagte, ließ Midhat Pascha, seit 19. Dez. 1876
Großwesir, den Sultan seinem Reich eine Verfassung
oktroyieren, welche, 23. Dez. 1876 publiziert, die völlige
Rechtsgleichheit aller Pfortenunterthanen proklamierte und als
Trumpf von der türkischen Regierung gegen die Ansprüche
der Mächte zu gunsten der Slawen nicht ohne Geschick
ausgespielt wurde. Die Konferenz endigte ohne Resultat. Nachdem sie
selbst ihre Beschlüsse herabgemildert, wurden diese von Midhat
dem Großen Diwan, einer Versammlung von gegen 300 angesehenen
Personen, darunter 60 Christen, zur Prüfung vorgelegt und
einstimmig zurückgewiesen. Doch wurde der thatkräftige
Midhat schon im Februar 1877 infolge einer Palastrevolution
abgesetzt und verbannt; an seine Stelle als Großwesir trat
Edhem Pascha. Daher hatte auch die erste und einzige Session der
türkischen Kammer im Februar 1877 kein Ergebnis. Um so mehr
fühlte sich Rußland zu energischem Vorgehen ermutigt,
und nachdem es seine Rüstungen vollendet, erklärte es 24.
April 1877 an die Türkei den Krieg (vgl. Russisches Reich,
Geschichte, S. 94). Derselbe entbrannte zuerst in Asien, woselbst
im obern Kurthal 17. Mai die kleine Festung Ardahan
59*
932
Türkisches Reich (Geschichte: neueste Zeit).
von den Russen erobert wurde. Im Juni gingen die Russen
über die Donau, ohne daß der türkische
Oberbefehlshaber Abd ul Kerim es hinderte, eroberten 6. Juli
Tirnowa, überstiegen 12. Juli mittels des Twyodischkapasses
den Balkan,wiegelten die Bulgaren Nordthrakiens auf,
erstürmten 19. Juli den für schweres Geschütz
passierbaren Schipkapaß, besetzten Jamboli, Karlowo und andre
Städte im Süden des Balkans, eroberten Nikopoli an der
Donau und belagerten Rustschuk. Diesem glänzenden Anfang des
Feldzugs entsprach aber der Fortgang nicht. Bei dem Versuch, die
befestigten Höhen von Plewna zu nehmen, erlitten die Russen
20., 21. und 31. Juli Niederlagen, die eine rückgängige
Bewegung zur Folge hatten. In Thrakien von Suleiman Pascha
angegriffen, mußten sie sich in den Schipkapaß
zurückziehen, den sie mannhaft verteidigten; in der
Donaugegend wurden sie über den Schwarzen Lom geworfen. Sie
sahen sich genötigt, die früher nicht recht
gewürdigte Bundesgenossenschaft mit den Rumänen
anzunehmen, erlitten aber bei erneuten Angriffen gegen Plewna vom
7. bis 12. Sept. abermals Niederlagen, so daß bedeutende
Truppennachschübe nötig wurden. Auch in Asien stritten
sie bei Zewia unglücklich gegen die Türken und wurden auf
ihr eignes Gebiet zurückgeworfen, bis es ihnen 15. Okt.
gelang, auf dem Aladjaberg einen glänzenden Sieg
davonzutragen. Die Türken hatten militärisch mehr
geleistet, als man, namentlich nach dem Beginn des Kriegs, von
ihnen erwartet hatte. Da sie indes gar keine Unterstützung
fanden, mußten sie endlich doch der Übermacht
unterliegen. Auf dem asiatischen Kriegsschauplatz ging 18. Nov.
Kars verloren, und die Türken wurden nach Erzerum
zurückgetrieben; in Bulgarien aber besiegelte der Fall des
lange heldenmütig verteidigten Plewna (10. Dez.) den Verlust
eines großen Teils der westlichen Bulgarei, in welche zu
gleicher Zeit die Serben eindrangen, während die Montenegriner
in Albanien siegreich vorrückten. Anfang 1878
überschritten die Russen den Balkan an mehreren Stellen
zugleich. Die Armee Suleimans wurde bei Philippopel völlig
zersprengt, die Schipkaarmee gefangen genommen und 31. Jan. 1878 in
Adrianopel, das die Türken freiwillig geräumt, von den
Russen, welche bereits bis zum Marmarameer und bis an die Thore
Konstantinopels vorgedrungen waren, der Waffenstillstand diktiert.
Diesem folgte 3. März, da die Türken nirgends Hilfe
fanden, der Friede von San Stefano. In diesem wurden die
Unabhängigkeit Rumäniens und Serbiens, des letztern und
Montenegros Vergrößerung, die Abtretung der Dobrudscha
und eines Teils von Armenien, die Bildung eines autonomen
Fürstentums Bulgarien, welches außer dem eigentlichen
Bulgarien einen großen Teil Rumeliens und Makedoniens
umfaßte, stipuliert und die Zahlung einer beträchtlichen
Kriegsentschädigung der Türkei auferlegt.
Die Ausführung des Friedens verzögerte sich indes
infolge des Konflikts zwischen Rußland und England, das eine
Flotte in das Marmarameer einlaufen ließ. Während die
energische Haltung der englischen Regierung den Ausbruch eines
Kriegs mit Rußland erwarten ließ, wenn dieses sich
nicht nachgiebig zeigte, und die Mächte sich eifrig
bemühten, durch einen Kongreß eine friedliche
Lösung der orientalischen Wirren herbeizuführen, fehlte
es in Konstantinopel an jeder klaren, entschiedenen Haltung. Die
Minister kamen und gingen je nach den Launen des Sultans und seiner
Günstlinge. Die Kammern waren schon im Februar nach Haus
geschickt und damit die Komödie einer "osmanischen Verfassung"
geschlossen worden. Der unerfahrene Abd ul Hamid litt an fast
krankhafter Furcht vor Verschwörungen zu gunsten seines
Bruders Murad; eine solche wurde in der That im Mai 1878 versucht,
aber blutig unterdrückt. Am 1. Juni ward Mehemed Rüschdi
Pascha wieder zum Großwesir ernannt. Unter ihm warf sich die
Pforte endlich England in die Arme, indem sie 4. Juni einen
geheimen Vertrag mit diesem schloß, wonach England den Schutz
der asiatischen Besitzungen der Türkei übernahm, solange
Rußland nicht seine Eroberungen in Armenien herausgegeben
haben würde, und dafür das Recht erhielt, Cypern zu
besetzen. Mehemed ward bereits 8. Juni durch Savfet Pascha ersetzt.
Dieser leitete die türkische Politik während des Berliner
Kongresses (13. Juni bis 13. Juli 1878). Allerdings wurden in
Berlin mehrere Bestimmungen des Friedens von San Stefano zu gunsten
der Türkei verändert: Aladschkert und Bajesid in Armenien
fielen an sie zuruck; das autonome Fürstentum Bulgarien wurde
auf das Gebiet nördlich vom Balkan nebst Sofia
beschränkt, der südliche Teil, aber ohne Makedonien und
den Küstenstrich, als eine Provinz Ostrumelien (s. d.) unter
türkischer Oberhoheit belassen. Dagegen wurde Österreich
29. Juni mit der Okkupation Bosniens und der Herzegowina beauftragt
und der Protest der türkischen Bevollmächtigten dagegen
zurückgewiesen. Ferner wurde Griechenland das Recht zuerkannt,
auf eine Rektifikation seiner nördlichen Grenze (Abtretung des
südlichen Thessalien und Epirus mit Larissa und Janina)
Anspruch zu erheben. Die Pforte unterzeichnete und ratifizierte
zwar den Berliner Vertrag vom 13. Juli 1878, beeilte sich aber
nicht mit seiner Ausführung. Der definitive Friede mit
Rußland wurde 8. Febr. 1879 unterzeichnet und die an
Rußland zu zahlende Kriegsentschädigung auf 802 Mill.
Frank festgesetzt. Gegen die Okkupation Bosniens und der
Herzegowina durch österreichische Truppen im August 1878
leistete die Türkei keinen Widerstand und schloß 21.
April 1879 mit Österreich eine Konvention, durch welche sie
die Souveränität des Sultans in jenen Proinzen formell
wahrte.
Neueste Zeit.
Die Macht des türkischen Reichs war durch den Berliner
Frieden erheblich geschwächt worden, namentlich in Europa, und
die große Finanznot mußte ebenfalls dazu beitragen, die
Autorität der Pforte im Land selbst und bei den
auswärtigen Mächten herabzusetzen. Es blieben daher
weitere Zumutungen an sie nicht aus. Die Griechen verlangten
dringend die Verwirklichung der Grenzrektifikation durch Abtretung
von Epirus und Thessalien und erlangten auf der Berliner Konferenz
1880 eine Grenze zugebilligt, welche ihre Ansprüche beinahe
völlig befriedigte, so daß die Pforte 3. Juli 1881 fast
ganz Thessalien u. den epirotischen Bezirk Arta an Griechenland
abtreten mußte. In Albanien sah sie sich 1880 genötigt,
ihre eignen Unterthanen in Dulcigno mit Gewaltkur Unterwerfung
unter ihre Abtretung an Montenegro zu zwingen. Ihr Versuch, 1879
bei der Absetzung des Chedive von Ägypten ihre Hoheitsrechte
über dies Land zu vermehren, wurde durch den Einspruch der
Mächte vereitelt; ihre Unthätigkeit während der von
Arabi Pascha 1882 verursachten Unruhen ermöglichte England das
eigenmächtige Einschreiten in Ägypten und die
militärische Besetzung des Landes. Das 1871 enger an das
türkische Reich gekettete Tunis ging 1881 an Frankreich
verloren. Dennoch hatte die Pforte bei diesen Vorgängen eine
solche Geschicklichkeit und Sicherheit in den diplomatischen
Verhandlungen gezeigt, daß sich ihre Stellung den
Großmächten ge-
933
Türkischrot - Turkistan.
genüber zu ihrem Vorteil veränderte. Während sie
den Anmaßungen Englands mit Ruhe und Festigkeit entgegentrat,
gewann sie an Deutschland und Österreich seit Auflösung
des Dreikaiserbündnisses eine immer wirksamere Stütze,
wodurch es ihr möglich wurde, ihren Besitzstand in Europa zu
behaupten und ihren Einfluß in Afrika und Asien zu vermehren.
Im Innern scheiterte allerdings ein Reformversuch, den der zum
Großwesir ernannte, ehemals tunesische Minister Khereddin
Pascha 1879 machte, an dem Widerstand der alttürkischen Partei
und einiger allmächtiger Günstlinge des Sultans, wie
Osman und Mahmud Damat. Indes befreite sich der Sultan Abd ul
Hamid, je mehr er in Staatsgeschäften ein selbständiges
Urteil erlangte und handelnd eingriff, allmählich von diesem
verderblichen Einfluß. Um die Finanzreform
durchzuführen, berief er deutsche Beamte, welche auch 1881
eine durch Irade vom 20. Dez. bestätigte Einigung mit den
Gläubigern zu stande brachten, durch die der Betrag der
Staatsschuld von 250 aus 106 Mill. Pfd. Sterl. herabgesetzt und
für diese ein zunächst auf mindestens 1 Proz. reduzierter
Zinsfuß, zugleich aber auch eine Amortisation von 1/3 Proz.
und deren Zahlung durch Garantie mehrerer Einkünfte gesichert
wurde. Zur Vermehrung der Einnahmen wurde die Tabaksregie
eingeführt. Deutsche Offiziere begannen auf Grund eines 1880
vom Sultan genehmigten Plans eine Reorganisation des Heerwesens und
arbeiteten ein Militärgesetz für das ganze Reich aus, das
1887 in Kraft trat. Nach außen hin beobachtete die
Türkei eine große Zurückhaltung, da sie vor neuen
kriegerischen Verwickelungen zurückscheute. Dies zeigte sich
besonders 1885, als im September der Generalgouverneur von
Ostrumelien, Chrestowitsch, in Philippopel gestürzt wurde und
Fürst Alexander von Bulgarien diese türkische Provinz mit
seinem Fürstentum vereinigte. Obwohl die Türkei eine
ansehnliche Truppenmacht an der Grenze aufstellte, konnte sie sich
doch nicht zu bewaffnetem Einschreiten, um ihre Rechte zu wahren,
entschließen und gab im Frühjahr 1886 auf der Konferenz
zu Konstantinopel ihre Zustimmung dazu, daß der Fürst
von Bulgarien zum Generalgouverneur von Ostrumelien ernannt wurde.
Ebenso verhielt sie sich unthätig, als im August 1886
Fürst Alexander durch russische Ränke gestürzt
wurde, und ließ alle weitern Ereignisse in Bulgarien
geschehen, ohne sich anders als diplomatisch einzumischen, obwohl
Rußland die Pforte zum thätlichen Einschreiten
drängte, um die ihm verhaßte Regentschaft, dann den
Fürsten Ferdinand zu beseitigen. Sie gab damit
tatsächlich die Herrschaft über Ostrumelien auf. Die
Ereignisse in Bulgarien, welche wie Serbien so auch Griechenland zu
einer kriegs- und eroberungslustigen Haltung veranlaßten,
nötigten aber die Türkei zur Aufstellung einer
großen Heeresmacht, welche so große Kosten verursachte,
daß sie wieder Anleihen bei der Ottomanischen Bank machen und
dafür mehrere einträgliche Zölle verpfänden
mußte. 1889 kam durch Schiedsspruch endlich eine Einigung mit
dem Baron Hirsch, der die türkischen Eisenbahnen gebaut hatte
u. ausbeutete, zu stande, welche der Türkei die Verfügung
über die Bahnen teilweise zurückgab.
Vgl. Hammer-Purgstall, Geschichte des osmanischen Reichs (2.
Aufl., Pest 1834-36, 4 Bde.); Zinkeisen, Geschichte des osmanischen
Reichs in Europa (Hamb. u. Gotha 1840-63, 7 Bde.); Rosen,
Geschichte der Türkei, 1826-56 (Leipz. 1866-67, 2 Bde.);
Schmeidler, Geschichte des osmanischen Reichs im letzten Jahrzehnt
(das. 1875); Blochwitz, Die Türken, kurzer Abriß ihrer
Geschichte (Berl. 1877); de la Jonquière, Histoire de
l'empire ottoman (Par. 1881); Hertzberg, Geschichte der Byzantiner
und des osmanischen Reichs (Berl. 1884); v. Schlechta-Wssehrd, Die
Revolution 1807-1808 (Wien 1882); Engelhardt, La Turquie et le
Tanzimat ou l'histoire des réformes dans l'empire ottoman
depuis 1826 (Par. 1882-83, 2 Bde.).
Türkischrot, s. Färberei, S. 42.
Türkisgrün, s. Kobaltgrün.
Turkistan (Turkestan, "Land der Türken"), Name der
Länder in der großen Längssenkung des Tarimbeckens
in der östlichen, der Flußsysteme des Amu Darja und Sir
Darja in der westlichen Hälfte Innerasiens, zwischen welchen
die Gebirgsketten, welche die Pamirhochthäler einfassen, die
Wasserscheide bilden (s. Karte "Zentralasien"). Geographisch
gehört die Osthälfte zu dem großen Gebiet der seit
langen geologischen Zeitperioden abflußlosen Wasserbecken
Zentralasiens (s. d.); die Westhälfte dagegen endigt in der
erst seit jüngerer Zeit vom Meer verlassenen aralokaspischen
Niederung. Politisch bildet die westliche Hälfte das russische
Generalgouvernement T., die östliche Hälfte einen Teil
des chinesischen Kaiserreichs. Im folgenden sind beide Teile
selbständig behandelt.
I. Das russische Generalgouvernement Turkistan
grenzt im N. an die Kirgisensteppe (Akmollinsk, Turgai etc.), im
O. an das chinesische Ostturkistan, im S. an Bochara, im W. an
Chiwa und hat einen Flächeninhalt von 1,604,892 qkm (29,148
QM.) mit (1885) 3,426,324 Einw. Administrativ zerfällt es in
die folgenden Verwaltungsbezirke:
QKilom. QMeilen Einwohner
Transkaspische Provinz 550629 10000 301476
Semiretschinsk 381609 6930 666339
Ferghana 95227 1729 716133
Serasschan 54633 992 394446
Sir Darja 449822 8169 1214300
Amu Darja 102972 1870 133630
An der Spitze der Militär- und Zivilverwaltung steht ein
Generalgouverneur, der seinen Sitz in Taschkent hat, und welchem
Gouverneure und Kreis-, resp. Distriktschefs untergeordnet sind.
Die untersten Vollzugsorgane sind Eingeborne. Allgemeine
Wehrpflicht besteht hier nicht; von russischen Truppen stehen hier
1 Schützenbrigade, 19 Linienbataillone, 1 Artilleriebrigade (7
Batterien), 1 Gebirgsbatterie, 1 Sappeurhalbbataillon, 3 Orenburger
und 2 Ural-Kosakenregimenter, 3 Festungsartilleriekompanien, 11
Lokallommandos. Das Territorium wird in seinem gebirgigen Ostteil
von den westlichen Ketten des Thianschan (s. d.), welcher selbst
als Narat, Mustag, Sary-dshaß, Kok-schaal, Alai und
Hissarrücken die südöstliche Grenze bildet,
ausgefüllt. Im Pik Chan-Tengri erreicht er eine Höhe von
6558 m. Hier entspringen der Naryn, einer der Quellflüsse des
Sir Darja (s. d.), und der Tekeß, Quellfluß des Ili.
Das rechte Ufer des letztern bilden der Borochorskische und
Dsungarische Alatau. Rechts des Flußgebiets des Naryn und Sir
Darja zieht sich der Alatau hin, welcher sich beim Chan-Tengri vom
Thianschan abzweigt. Anfangs heißt er Terskei-tau, weiter
nach W. Sussamir-tau und endlich Urtak-tau. Durch die Flüsse
Tschirtschik, Aryß, Talaß, Tschu, den See Issi-kul, die
Flüsse Tschirik und Tscharyn und die rechten Zuflüsse des
Naryn wird der Alatau in verschiedene Gebirgszüge geteilt,
welche bald russische, bald kirgisische Namen haben. Dieser
gebirgige Teil des Territoriums ist teilweise bewaldet und von
vielen Flüssen
934
Turkistan (Russisch -T.: Geographisches).
(die hauptsächlichsten sind erwähnt) durchströmt.
Die Ebenen dagegen zeichnen sich im allgemeinen durch das Fehlen
geglichen Baumwuchses und durch Wassermangel aus. Je nach der Menge
der Feuchtigkeit und der Bodenbeschaffenheit zerfallen sie in
solche mit salzhaltigem Thonboden, am Fuß der Gebirge gelegen
(sie werden durch künstliche Bewässerung zu
außerordentlich fruchtbaren Gegenden), und in die
unbegrenzten wasserlosen Sandwüsten, wie im W. die Kisilkum,
im N. die Karakum, Dschitikonur und Mojunkum und endlich die am
Balchasch gelegenen Wüsten. Die Wasserlosigkeit ist jedoch nur
eine bedingte: in der Tiefe findet sich Wasser, so daß auch
eine gewisse Vegetation vorhanden ist; ferner sind längs der
Karawanenstraßen Brunnen angelegt. Die Sandsteppen scheiden
sich in veränderliche und feste. Erstere liegen zumeist an den
Rändern der Sandstrecken; sie sind vollständig
vegetationslos. Letztere werden dadurch charakterisiert, daß
sie mit einer dünnen Erdschicht von dunkelgrauer Farbe bedeckt
sind und infolge der in der Tiefe vorhandenen Feuchtigkeit eine
gewisse Vegetation haben; in den tiefer gelegenen Gegenden wachsen
sogar Bäume und Futterkräuter. Am meisten kommen Saxaul,
Wacholder und Disteln vor. Die wenigen Flüsse, welche die
Sandstrecken durchfließen, sind seicht und großtenteils
mit Schilf bewachsen, das an den Mündungen unpassierbare
Moräste bildet. Weite Sumpfflächen liegen am Balchasch,
am Alakulsee, am Tschu, an der Mündung des Sir Darja und an
dem untern Amu Darja. Schließlich sind noch die Seen (wie
Balchasch, Issi-kul, Karakul u. a.) und die Salzmoräste zu
erwähnen. Letztere sind meist ausgetrocknete Seen und finden
sich häufig in den Sandsteppen. Das Klima wird durch die
kontinentale Lage und außergewöhnliche Trockenheit
bedingt. Zwischen Tag und Nacht und in den verschiedenen
Jahreszeiten treten sehr große Temperaturunterschiede hervor.
Abgesehen von der Gebirgsgegend ist Regen nur eine seltene und
außergewöhnliche Erscheinung im Sommer. Dagegen regnet
es in den Gebirgen bei einer Hohe von 1200-1500 In im Mai und Juni
fast taglich zwischen 4 und 7 Uhr nachmittags, selten morgens und
nachts; in der Höhe von 2400 m regnet und schneit es
abwechselnd in den Sommermonaten; in einer Höhe von 2700 m
fällt nur noch Schnee. Wälder, vorzugsweise
Tannenwälder, trifft man nur in den Semiretschinskischen
Gebirgen, hier aber auch nur an den nördlichen und
nordwestlichen Abhängen, sofern die Berge mit Schnee bedeckt
sind. In klimatischer Beziehung kann man das gesamte Gebiet in vier
Teile teilen: 1) Der Norden etwa bis zum 45.° nördl. Br.;
Jahresmittel im W. +6,2° C., im O. +7,5. Winter von 2-3 Monaten
Dauer. Der Sir ist 123 Tage zugefroren. 2) Die südlich daran
sich schließende Gegend der Forts Tschulek, Perowski, der
Städte T., Aulinata und Wiernyi, mit der Jahrestemperatur von
+7° (Sommer +30, Winter -24°). Der Sir ist nur 97 Tage
zugefroren; Aprikosen werden reif. 3) Die Gegend um Tschemkent,
Taschkent, Kuldscha, Samarkand, Petro-Alexandrowsk; Jahresmittel in
Kuldscha +9,2° C., in Taschkent +14,3°; Pfirsich-,
Mandelbäume, Weinstock gedeihen. 4) Das Thal von Chodshent,
die Gegend der Stadt Chokand und südlich vom 42.°
nördl. Br.; mittlere Temperatur im Januar +2,4° C., im
Juli +28,8° C.; Pistazien gedeihen noch in 1000 m Höhe,
wilde Mandelbäume bis zu 1200 m, Aprikosen bis zu 1500 m,
wilde Apfelbäume bis zu 1900 m Höhe. Hinsichtlich der
Kultur sind 2,06 Proz. des Areals kultiviertes Land, 43,30
Weideland, 54,61 Proz. Unland. Ferghana und Serafschan nehmen die
erste Stelle ein. Ackerbau ist nur bei künstlicher
Bewässerung möglich. Dieselbe wird durch Aksakali
(Beamte) geleitet. Die erste Arbeit im Frühjahr ist die
Reinigung der Kanäle; dann wird das Land gepflügt,
gedüngt, bewässert und geeggt. Eine mittlere Ernte gibt
20, im Samarkander Distrikt von Weizen 25 Korn. Nach der Ernte von
Winterweizen und Gerste säet man noch in demselben Jahr Hirse,
Sesam, Linsen, Mohrrüben, seltener Mohn. Auf dem
größten Teil des zur Sommerernte bestimmten Bodens wird
Reis und Dschugara gebaut; dann folgt Baumwolle; Luzerne ist das
wichtigste Futterkraut; Krapp, Lein, Tabak werden nur noch in
unbedeutender Menge kultiviert, haben aber eine gute Zukunft,
ebenso wie der Weinbau; von Gartenfrüchten sind besonders
hervorzuheben: Melonen, Arbusen, Gurken, Kürbisse; unsre
Gemüse geben einen reichen Ertrag. Die Baumwolle, allerdings
von keiner guten Qualltät, hat für T. doch eine
große Bedeutung: 1867 wurde bereits für über 5
Mill. Rubel nach Rußland ausgeführt. Der Seidenbau
spielt ebenso eine wichtige Rolle: die Produktion ergibt
jährlich 1,816,000 Kokons. Die Wollproduktion bildet
ausschließliche Beschäftigung der Nomaden: Schafe,
Ziegen, Kamele werden geschoren. Auch die Viehzucht fällt
jenen ausschließlich zu und hat einen ganz bedeutenden
Umfang: man berechnet die Zahl der Kamele auf 390,361, der Pferde
auf 1,602,116, des Rindviehs auf 1,180,000, der Schafe auf
11,351,278. Die Flüsse und Seen sind überaus reich an
Fischen; der Fischfang wird aber noch wenig, fast nur von den
Nomaden, betrieben. An wilden Tieren gibt es Tiger, Panther, wilde
Schweine, Bären, Wölfe, Füchse, wilde Esel, wilde
Ziegen, wilde Katzen etc. An Salz ist großer Reichtum
vorhanden; die Nutzbarmachung ist aber unbedeutend. In Ferghana
gibt es Naphthaquellen, deren Ausbeute sehr nutzbringend werden
kann. Auch Goldsand, Silber-, Kupfer-, Blei- und Eisenerze,
Steinkohle, Schwefel, Salpeter, Türkise sind dort zu finden.
Die Ausbeute ist noch eine ganz unbedeutende. Vorläufig ist
der Besitz Turkistans für Rußland noch keine
Hilfsquelle; letzteres muß sogar für dies neuerworbene
Land noch erhebliche Opfer bringen.
Die Bevölkerung gehört zwei Rassen an: der
kaukasischen und der mongolischen. Die erstere umfaßt Russen,
Tadschik (s. d.), Perser und Afghanen, ferner Juden und Araber; die
letztere zerfällt in die altaischen (turkotatarischen)
Völkerschaften, welche hier als Kirgisen, Karakirgisen,
Uzbeken, Karakalpaken, Kiptschak, Turkmenen, Tataren (s. diese
Artikel) auftreten, und in die eigentlich mongolischen:
Kalmücken, Chinesen, Sibo, Solonen u. a. Die Sarten (s. d.),
Tarantschen (s. d.) und Kuraminzen, ein Gemisch verschiedener
Völkerschaften, können füglich zu den Turkotataren
gerechnet werden, ebenso wohl die Dunganen (s. d.), welche einen
Übergang von den türkischen zu den mongolischen
Völkerschaften bilden. Annähernd wird das ganze Gebiet
bewohnt von 59,283 Russen, 7300 Tataren, 690,305 Sarten, 137,283
Tadschik, 182,120 Uzbeken, 58,770 Karakalpaken, 70,107 Kiptschak,
5860 Turkmenen, 20,000 Dunganen, 36,265 Tarantschen, 1,462,693
Kirgisen, 77,301 Kuraminzen, 24,787 Kalmücken, 22,117
Mangow-Mandschuren, 2926 Persern, 857 Indern. Die Russen,
ungefähr 1 Proz. der Gesamtbevölkerung, konzentrieren
sich hauptsächlich in dem Semiretschinskischen Bezirk als
Kosaken, Bauern und Einwohner der Städte; in dem Sir
Darja-Gebiet wohnen sie groß-
935
Turkistan (Russisch-T.: Geschichte).
tenteils in Taschkent und in Kasalinsk und in sehr
beschränkter Anzahl in den übrigen Flecken etc.: nur 4000
(ca. 1 Proz. der Bevölkerung) bewohnen den Bezirk Serafschan,
1184 (1 Proz.) den Amu Darja-Distrikt als Kolonisten der
Uralkosaken, 1229 den Ferghanabezirk. Tataren sind das Handel
treibende Element in den Städten. Sarten, angesiedelte
Nomaden, beschäftigen sich mit Ackerbau und Handel und bilden
den Kern der eingebornen Stadt- und Landbevölkerung in den
südlichen Kreisen des Sir Darja-Bezirks und in ganz Ferghana
sowie im Serafschanbezirk; in Semiretschinsk kommen sie nur
vereinzelt vor. Kirgisen treiben als Nomaden Viehzucht, nur die
armen Stämme (die Igintschamen) sind angesessen und treiben
Ackerbau; sehr ungleichmäßig verteilt, bilden sie in
Semiretschinsk 78 Proz., im Slr Darja-Distrikt 62, im Amu
Darja-Distrikt 29, in Ferghana 17 und in Serafschan nur 0,2 Proz.
der Bevölkerung. Kuraminzen bewohnen als Ackerbauer den
Kuraminzkischen Kreis der Provinz Sir Darja. Kiptschak wohnen als
Handel und Ackerbau treibend ausschließlich im
nördlichen Teil von Ferghana. Nomadisierende Uzbeken treten in
größerer Masse im Kreis Serafschan, dann am rechten Ufer
des Amu Darja und in geringer Anzahl in der Provinz Sir Darja auf.
Karakalpaken haben sich als Ackerbauer und Viehzuchttreibende
hauptsächlich im Amu Darja-Distrikt angesiedelt. Turkmenen
leben ausschließlich als halbangesessene Nomaden in der
Provinz Amu Darja. Die Tarantschen nehmen das Ilithal ein und
siedeln jetzt zum großen Teil aus dem an China abgetretenen
Kuldschadistrikt auf russisches Gebiet über, Dunganen
hauptsächlich in dem an China abgetretenen Kuldschadistrikt,
dann aber auch in der Provinz Ferghana und im Kreis Serafschan; die
größte Ansiedelung, 4000 Seelen, befindet sich im Thal
Karakunuß im Kreis Tokmak. Kalmücken nomadisieren in den
Kreisen Wlärnyl und Issi-kul der Provinz Semiretschinsk.
Tadschik gibt es im Kreis Chodshent, im Kreis Serafschan, im Kreis
Kurama in dem Gebirge und in Ferghana. Perser, früher Sklaven,
kommen im Kreis Serafschan und im Kreis Amu Darja vor. Inder sind
in den Handelszentren verteilt; es sind nur Männer. Zigeuner
und Juden wohnen hauptsächlich im Kreis Serafschan. Araber
führen ein halbangesessenes Leben in der Umgegend von
Samarkand und Kattykurgan. Nach den Glaubensbekenntnissen teilt
sich die Einwohnerschaft des Generalgouvernements T. in 2,900,000
Mohammedaner (hauptsächlich Sunniten), 57,000
Griechisch-Orthodoxe, 2000 Katholiken, 1000 Protestanten, 50,000
Heiden, 3000 Juden. 1877 betrug die angesessene Bevölkerung
1,620,535, die nomadisierende 1,417,584. Vgl. Kostanco, Turkestan;
Materialien für die Geographie und Statistik Rußlands
(russ., Petersb. 1880).
[Geschichte.] Die ersten Beziehungen Rußlands zu
Mittelasien, speziell zu Chiwa (s. d.), datieren aus der
Regierungszeit Peters d. Gr. Einen positiven Erfolg hatten
dieselben nur insofern, als die zwischen der Wolga und dem Ural
wohnenden Kirgiskasaken russische Unterthanen wurden. 1725 lief die
russische Grenze in Asien längs der Flüsse Ural und Mijas
mit Kurgas und Omsk, längs des Irtisch und der Vorberge des
Altai zwischen Biisk und dem Telezkischen See hindurch, an den
Quellen des Abankan vorbei nach der jetzigen Grenzlinie mit China
hin. In Mittelasien hatte Rußland somit damals noch keine
Besitzungen. 1732 erlangte Rußland südlich dieser Grenze
die Herrschaft über die Kleine und Mittlere Horde der
Kirgisen. Um diese nur nominellen zu wirklichen Unterthanen zu
machen, legte man 1820 befestigte Punkte an zum Schutz der neuen
Grenze und zur Aufrechterhaltung der Ordnung in dem neuerworbenen
Gebiet. So entstand eine Linie in der Mittlern und die ilezkische
Linie in der Kleinen Horde der Kirgisen. Die
unbotmäßigen Kirgisen fanden Unterstützung an dem
Chan von Chiwa. Infolgedessen fand die unglückliche Expedition
des Generals Perowski 1839 nach Chiwa (s. d.) statt. Vorher jedoch
hatte man den Posten Nowo-Alexandrowsk an der Kaidakbucht des
Kaspischen Meers, den Embaposten 400 km südlich von Orenburg
und Akbulak etwa 160 km noch weiter südlich nach dem
Ust-Urt-Plateau zu angelegt. Nach dem niedergeworfenen
Kirgisenaufstand 1846 erhielten Embinsk und Akbulak feste
Garnisonen, und in der Steppe entstanden die Posten Uralskoje und
Orenburgskoje. 1846 erkannten auch die Kirgisen der Großen
Horde die russische Oberherrschaft an: Kopal südöstlich
des Balchaschsees wurde als Stützpunkt angelegt. Raimskoje an
der Mündung des Sir Darja entstand um dieselbe Zeit. 1847 zog
die russische Grenze von Osten nach Westen über den
Ilifluß zum Alataurücken und längs des Tschu zum
Sir Darja. Es begannen die Kämpfe mit Chokand (s. d.). Schon
1854 war die Linie des Sir Darja durch die Forts Nr. 1 (Raimskoje
war aufgegeben), 2 und Perowski, etwa 350 km östlich vom
Aralsee gelegen, gut befestigt. 1860 unterwarf man von Kopal her
die Karakirgisen und nahm an der Sirlinie die Forts Djulek und
Jany-Kurgan. 1864 wurden Aulinata, die Städte T. und
Tschimkent genommen. Anfang 1865 wurde das neuerworbene Land mit
der Sir Darja-Linie und den am See Issi-kul gelegenen Erwerbungen,
wo man vom Fort Wiernoje aus bis an den Naryn vorgegangen war, zu
dem Grenzgebiet T. verbunden. Am 10. März 1865 fiel Taschkent.
Jetzt trat Bochara (s. d.) in den Kampf mit Rußland ein. Am
8. Mai 1866 wurde der Emir auf der Ebene Ir Djar geschlagen, die
Stadt Chodshent 24. Mai erstürmt; 2. Okt. fiel Dschisak, am
18. Ura-Tjube, beides strategisch wichtige Befestigungen an
Pässen des Kaschgar-Dawan. Zu Ende dieses Jahrs war letzterer
die Südgrenze Rußlands. Im Frühjahr 1867 wurde
Jany-Kurgan besetzt. Ein Ukas vom 11. Juli d. J. verfügte die
Organisation des bis dahin dem Generalgouverneur von Orenburg
unterstellt gewesenen mittelasiatischen Gebiets zu einem
selbständigen Generalgouvernement T., das in den Sir
Darinskischen und Semiret-schinskischen Oblaßtj geteilt
wurde. Die Friedensverhandlungen mit Bochara hatten keinen Erfolg,
und so fielen im März 1868 Samarkand, Kurgan, Katty Kurgan und
Tschilek und wurden später als Serafschanbezirk einverleibt;
am 2. Juli wurde endlich die letzte bocharische Armee auf den
Höhen von Schachrissiabs total geschlagen. Waren so Bochara u.
Chokand Vasallenstaaten Rußlands geworden, so widerstand noch
Chiwa. Russischerseits verschaffte man sich zunächst
Stützpunkte im Osten dieses Chanats. 1869 entstand das
russische Fort Krassnowodsk an dem Ostufer des Kaspischen Meers. Im
Frühjahr 1870 besetzte man das in dem Balchangebirge gelegene
Tasch-Arwat mit den beiden Etappen Michael und Mulla-Kari-Posten.
Im Herbste desselben Jahrs führte eine Expedition die Russen
schon 200 km weiter nach Osten, um die mit Chiwa verbündeten
Turkmenen für deren Räubereien zu strafen. Weitere
Rekognoszierungen in der Richtung auf den See Sary-Kamysch fanden
1871 statt; das Fort Tschikischljar an der Mündung des Atrek
wurde angelegt.
936
Turkistan (Ostturkistan: Geographisches).
Im März 1873 trat Rußland nun in den Krieg gegen
Chiwa (s. d.) ein. In dem am 12. Aug. 1873 geschlossenen Frieden
wurde das Amu-Delta sowie das rechte Amu-Ufer dem
Generalgouvernement T. als Amu Darja-Distrikt einverleibt. Hier
entstand das Fort Petro-Alerandrowsk, 2½ km vom rechten Ufer
des Amu Darja zwischen Chanka und Schurachana gelegen. An die
Expedition gegen Chiwa reiht sich der Feldzug der Russen gegen
Chokand (s. d.). Dieses Chanat wurde erobert und durch Befehl vom
19. Febr. 1876 als das Gebiet Ferghana dem Generalgouvernement T.
einverleibt. Das zeitweise von den Russen 1871 in Besitz genommene
und dem Generalgouvernement T. zugewiesene Kuldschagebiet (s. d.)
ist bis auf einen kleinen Teil durch den Vertrag vom 2. (14.) Febr
1881 an China zurückgegeben. Durch Verfügung vom 25. Mai
1882 ist schließlich der Semiretschinskische Oblaßtj
von dem Generalgouvernement T. abgezweigt und mit dem
Akmollinskischen und Semipalatinskischen Oblaßtj zu einem
Steppen Generalgouvernement vereinigt, das mit dem Tobolskischen
und Tomskischen Gouvernement den Militärbezirk Omsk
bildet.
II. Ostturkistan.
Ostturkistan (chines. Thianschan Nanlu, "Weg südlich des
Thianschan", türk. Altischahar oder Dschitischahar, sonst auch
Kaschgarien) liegt zwischen 36-43° nördl. Br. und
73-92° östl. L. v. Gr. oder zwischen dem Randagebirge
Tibets im S., dem Thianschan im N., dem Alai- und Pamirplateau mit
dem Kisiljart als Randgebirge im W., während im O. das Reich
in die Gobiwüste ausläuft, und hat ein Areal von
1,118,713 qkm (20,135 QM.), wovon aber der größte Teil
unbewohnbar ist. Am Fuß der Hochgebirge, an der Grenze,
über welche Paßübergänge nirgends unter 3400 m
führen, liegt der anbaufähigste Boden, eine nach dem
Innern sich abdachende schiefe Ebene, von zahlreichen Flüssen
bewässert, die aber sämtlich nur für Fischerboote
(im untern Teil) schiffbar, doch sehr fischreich sind. Den tiefsten
Teil des Landes nehmen Steppen und Sandwüsten ein (700-1200 m
ü. M.) Vom Thianschan fließen ab: Kaidugol, Scharjar und
Kisilkungai (Aksu); vom Kisiljart: Kaschgar, Jamunjar; vom
Karakorum: Jarkand und Karakasch, später Chotanfluß
genannt; sie alle vereinigen sich im Tarim, der in den Sümpfen
und Süßwasserseen des zuerst 1877 von Prschewalskij
befahrenen Lobsees sein Ende findet. Das Klima kennzeichnen
große Trockenheit, mehr oder weniger dichter, mit
Wüstenstaub versetzter Duft, der selten ganz verschwindet,
heftige Nord- oder Nordwestwinde im Frühjahr und Herbst,
Windstille zu andern Zeiten, große Hitze im Sommer, strenge
Kälte im Winter. Im Sommer machen Trockenheit der Luft und
Ausstrahlung des erhitzten Bodens Arbeiten im Sonnenschein
unmöglich, man sieht dann weder Feldarbeiter noch Träger
oder Fußreisende; der August hat eine Wärme von
durchschnittlich 26° E. im Schatten. Im Winter fällt das
Thermometer bis zu -25° C.; das Frühjahr geht rasch in den
Sommer, ebenso der Herbst in den Winter über. In der Ebene
säet man Winterfrucht Ende August, Sommerfrucht Anfang April
und erntet im Juli. Für Jarkand ist die mittlere
Jahrestemperatur zu 12,2° C. geschätzt (genauere
Berechnungen geben Bkanfords "Indianmeteorological memoirs", Kalk.
1877). Die Gold- und Nephritlager Chotans waren schon im Altertum
berühmt; ausgezeichnete Steinkohle brennt man in Aksu und
Turfan. Von Eisen, Kupfer, Alaun, Blei kennt man ergiebige Lager,
die aber noch schlecht ausgebeutet werden; Salz stellt man sehr
unvollkommen aus ausgetrockneter Moorerde dar. Das Hochgebirge
liefert saftige Fettweiden, tiefer hinab folgen Dickichte von
Wacholder, Weiden, Tamarisken, Rosen etc. mit Pappeln als
hochstämmigen Bäumen. In den nicht angebauten Teilen der
Ebene und den Wüsten ist die Vegetation äußerst
spärlich, im Ackerland dagegen herrscht üppiges Wachstum.
Hauptfrüchte sind: Weizen, Gerste, Mais und Hirse, dann Reis;
Baumwolle, Flachs und Hanf werden als Gespinstpflanzen, Mohn zur
Opiumgewinnung fleißig angebaut. Die Gärten sind mit
unsern Gemüsen und Obstsorten bepflanzt; es reifen aber auch
Feige und Granatapfel, die Weinrebe wird am Spalier gezogen und im
Winter gedeckt; Seidenbau findet im S. und SW. statt. Das Tierreich
zeigt viel Eigenartiges. In den Umgebungen des Lobsees gibt es noch
wilde Kamele, wilde Pferde und Ochsen, im Hochgebirge das
große wilde Schaf (Ovis Ammon), stattliche Hirsche, Antilopen
und Hasen; dann Tiger, Panther, Luchse, Füchse und
Wildschweine in den Dickichten an den Flußufern. Zahlreiche
Schwäne und Wasservögel hausen an den Ufern des Lobsees.
Haustiere sind: Grunzochse (Yak), Kamel, Pferd, Esel, Schaf,
Schwein, Hund, Katze, Hühner und Tauben; große
Rinderherden sind zahlreich. Das Pferd ist klein, aber sehr
ausdauernd. Maultiere sind selten, dagegen werden Schafe in
großer Zahl gehalten, und Wolle und Fleisch sind gleich
ausgezeichnet (erstere ein Hauptausfuhrartikel). Die
Gewerbthätigkeit hat geringe Bedeutung; die altberühmte
Seidenkultur und -Weberei in Chotan ist verfallen; gesucht im
Ausland sind Filze und Teppiche, im Innern die landesüblichen
groben Baumwollenstoffe. Der Handel ging sonst nach China und in
geringern Beträgen nach Chokand und der Mongolei. Seit 1867
machten die Engländer große Anstrengungen, einen Verkehr
mit Indien einzurichten, setzten in Leh einen Handelsagenten ein,
verbesserten die Zugänge durch Tibet (Ladak) und erwirkten
1873 zu Jarkand den Abschluß eines günstigen
Handelsvertrags mit verhältnismäßig niedrigen
Zollsätzen (2½ Proz. Wertsatz) sowie die Zulassung
eines Engländers in Kaschgar als Konsularagenten. 1874 bildete
sich mit dem Sitz in Lahor eine Zentralasiatische
Handelsgesellschaft auf Aktien, die alle zwei Jahre eine
große Karawane nach Kaschgar abfertigt und sie im
nächsten Jahr beladen zurückgehen läßt. Diese
Gesellschaft hat belebend eingegriffen, und der Umsatz, der 1867
kaum 1 Mill. Mk. wertete, war 1874 bereits auf 2½ Mill. Mk.
gestiegen. Ebenso große Anstrengungen, Ostturkistan mit
seinen Waren zu versehen, macht Rußland. Durch den am 14.
Febr. 1881 abgeschlossenen Vertrag mit China hat dasselbe das Recht
erworben, neben den bereits bestehenden Konsulaten in Ili,
Tarbagatai, Kaschgar und Urga auch solche in Sutschshan und Turfan
zu errichten. Den russischen Unterthanen steht das Recht zu, in den
Bewirken Ili, Tarbagatai, Kaschgar, Noumzi Handel zu treiben, ohne
Abgaben zu zahlen.
Die Bevölkerung beträgt annähernd 580,000 Seelen;
am dichtesten ist die Provinz Jarkand bevölkert.
Städtische und ländliche Bevölkerung zeigen im
Äußern und in der Lebensweise merkliche Unterschiede. In
den Städten hat weitgehende Mischung von vielerlei
Völkerschaften stattgefunden; "alles, was man sagen kann, ist,
daß Tatar- (mongolisches) Blut überwiegt, daß
Turkblut in größerer oder geringerer Menge zugesetzt
ist, und daß fremde Tadschik- (persische) Formen mehr oder
weniger dick eingesprengt
937
Turkistan (Ostturkistan: Geschichte).
sind; was immer die Beschäftigung ist, der große
Haufe zeigt Gesichtszüge, die aus Tatar und Mandschu, aus
Kalmuk und Kirgis gemischt und keiner dieser Nationen bestimmt
zuzurechnen sind". Die Größe ist bei Männern 1,62,
bei Frauen 1,51 m, die Hautfarbe hell. Die seßhafte
Landbevölkerung ist von Turkabstammung und stellt die alten
Hiungnu oder Uighur dar, die Hunnen von Attilas anstürmenden
Scharen; dem Menschenschlag ist aber im W. deutlich arisches Blut
beigemengt, was sich in Statur, Gesichtsbildung und Bartfülle
ausspricht. Noch heute sitzen reine Arier in den Hochthälern,
die sich vom Mustag (Karakorum) herabziehen, ohne Zweifel Reste der
indogermanischen Urrasse, welche einst die Abhänge des
westlichen Thianschan bevölkerte. Echte Kirgisen ziehen sich
um das ganze Land herum und weiden die Steppen im Hochgebirge ab;
die Kalmücken sitzen in der Niederung und an den Sümpfen
im Lobdistrikt. Die Sprache ist türkisch mit vielen
altertümlichen Formen (vgl. Shaw, Turki language as spoken in
Kaschgar and Yarkand, Lahor 1875). Die Nahrung ist nahezu dieselbe
wie unter Europäern; man ißt alles, was genießbar
ist, insbesondere Fleisch und Fische in großen Mengen. Das
Getränk bildet Thee, gebrannte Getränke sind verboten.
Der Anzug besteht aus Hemd, Hose und darüber langem Rock; die
Füße stecken bei beiden Geschlechtern in Schuhen oder
Stiefeln, den Kopf schützt eine Mütze. Die Frauen tragen
Hemd, Hose, weiten Kittel, langen Rock und Schulterüberwurf,
auf dem Kopf eine niedrige Mütze. Unter den Sitten fällt
Gleichgültigkeit gegen weibliche Schamhaftigkeit, gegen
Abstammung und Glaubensbekenntnis auf. Zwischen dem 14. und 16.
Jahr erfolgt die Verlobung; Scheidung der Frau vom Mann ist
häufig und wird geradezu als Geschäft betrieben. Die
Religion ist der Islam, aber die jahrhundertelange
Zugehörigkeit zu China bewirkte Lauheit im Glauben. Nachdem
Jakub Beg (s. unten) sich die Regierung angeeignet hatte, hielt er
streng auf die Erfüllung aller Gebräuche des
mohammedanischen Glaubens. Nur diesen duldete er im Land; für
die Kalmücken fand indes eine Ausnahme statt. Er bot alles
auf, um Sittenstrenge wieder einzuführen. Seitdem aber die
Chinesen wieder Herren sind, griff auch die frühere lockere
Moralität wieder Platz.
[Geschichte.] Die Geschichte Ostturkistans reicht hinauf bis zum
2. Jahrh. v. Chr.; damals unterwarfen die Chinesen, die jedenfalls
schon seit längerer Zeit Beziehungen zu Ostturkistan hatten,
dieses wie das jenseit des Gebirges liegende Chokand, und wenn auch
Chinas Beziehungen zu Ostturkistan zeitweise unterbrochen wurden,
so gebot doch China im ganzen bis zum Einfall der Mongolen; die
Religion war in der ersten Zeit der Buddhismus, dem hier im 5. und
7. Jahrh. n. Chr. weitberühmte Klöster errichtet waren;
auch alte Christengemeinden (Nestorianer) gab es. Im 8. Jahrh. (713
nach arabischen Quellen) zogen Araber über den Terekpaß
östlich bis Turfan, der Buddhismus dauerte aber fort; erst
Mitte des 10. Jahrh. nahm Satuk (auch Ilikchan), der in Kaschgar
regierende (Türken-) Fürst, den Islam an. Dieser Satuk
vereinigte alle türkischen Stämme unter seinem Zepter,
überzog Bochara, selbst Chiwa, mit Krieg und starb 1037; ein
Angriff, den der Herrscher von Chotan auf das von Satuk
hinterlassene Reich machte, mißlang, brachte aber
Zerrüttung und erleichterte den Mongolen den Sieg. 1218
überzog Dschengis-Chan mit seinen Scharen Ostturkistan, und
dessen Herrscherfamilien, welchen die Regierung in Kaschgar,
Jarkand, Chotan etc. belassen wurde oder im Weg der Auflehnung
zufiel, blieben von nun an in größerer oder geringerer
Abhängigkeit von den mongolischen Herrschern aus der
Dschagataidynastie, lagen auch unter sich in stetem Hader und
hatten wiederholt Kämpfe mit den Tibetern zu bestehen. Die
islamitische Geistlichkeit erlangte seit dem 14. Jahrh.
großen Einfluß; in Kaschgar bildete sich aus ihren
Vorständen (Chodscha, Chwadscha) eine Partei der Weißen
Berge und der Schwarzen Berge; erstere wurde Mitte des 17. Jahrh.
mit Hilfe des ihr abgeneigten Herrschers von dort vertrieben,
wandte sich an den Kalmückenchan der Dsungarei und erwirkte,
daß dieser 1678 gegen Kaschgar zog und ihren Führer als
Vasallen einsetzte. 1757 besetzten die Chinesen unter ungeheurem
Blutvergießen das Land. Die Chodschas fanden Zuflucht im
benachbarten Chokand, und ihre Mitglieder benutzten im
Einverständnis mit den Eingebornen und mit Unterstützung
des Chans von Chokand jeden Anlaß, um den Chinesen die
Herrschaft wieder zu entreißen. Madalichan von Chokand zog
1820 selbst gegen Kaschgar und eroberte es; wenn auch der von ihm
als Regent eingesetzte Chodscha sich gegen die Chinesen nicht
halten tonnte, so sahen sich letztere doch veranlaßt, 1831
mit Madalichan einen Vertrag abzuschließen. Hauptbedingung
war, die Chodschas zu überwachen. Als indes Chudojarchan 1846
den Thron von Chokand bestiegen hatte, erhoben diese von neuem ihr
Haupt; ein Bund von sieben Chodschas kam zu stande, hatte aber
keinen Erfolg; ebensowenig die weitern Versuche 1855 und 1856.
Neues Blutvergießen brachte 1857 der vorübergehend
erfolgreiche Einfall Walichans; demselben fiel 26. Aug. d. J.
leider unser Landsmann Adolf v. Schlagintweit (s. d.) zum Opfer,
der erste Europäer, der Kaschgar von Indien aus erreichte. Von
nun an aber kam das Land nicht mehr zur Ruhe; eine kleine
Revolution folgte der andern. Der Aufstand der Dunganen (s. d.)
hatte einen solchen Erfolg, daß die Chinesen 1863 sich nur
noch in der Citadelle von Kaschgar und Jarkand und in der Stadt
Jani-Hissar halten konnten. Schon 1862 hatte Rascheddin-Chodscha
den "Hasawat" (heiligen Krieg) gegen die Chinesen erklärt, und
zu Anfang 1864 war er bereits als Herrscher von Kaschgarien
anerkannt. Da aber Rascheddin kein direkter Nachfolger der in
Kaschgarien herrschenden Chodschas war, so entstand bald ihm
gegenüber eine feindliche Partei. An die Spitze der letztern
stellte sich Sadyk Beg. Dieser wandte sich an den damals in
Taschkent und Chokand regierenden Alim-Kul mit der Bitte, den in
Kaschgarien sehr populären Busuruk-Chodscha zu senden, welchem
er zur Herrschaft verhelfen wollte. 1864 erschien Busuruk in
Begleitung eines Gefolges von 50 Mann, unter welchen sich Jakub Beg
(s. d.) als Befehlshaber befand, vor den Thoren Kaschgars und wurde
mit Freuden aufgenommen. Sadyk Beg übergab ihm die Herrschaft.
Jakub Beg wußte sehr bald Sadyk zu verdrängen und wurde
zum Oberkommandierenden ernannt. Die Organisation des Heers war
sein erstes Werk; schnell hatte er einige tausend Mann zusammen,
welche bei der Belagerung der noch von den Chinesen besetzten
Citadelle von Kaschgar im Waffenhandwerk geübt wurden. Bald
lehnten sich Rascheddin-Chodscha, welcher im Osten von Aksu
regierte, Abd ur Rahmân, der Regent von Jarkand, sowie die
Städte Aksu, Kutscha und Chotan gegen Busuruk auf. Jakub Beg
besiegte deren Truppen und gelangte noch 1865 in den Besitz der
Citadelle von Kaschgar. Der schwache Busuruk, nicht im stande,
Jakub entgegenzutreten, übergab ihm jetzt alle Geschäfte.
Ein Aufstand der
938
Turkistan - Turkmenen.
Kiptschak, mit welchen Busuruk im Bund war, wurde von Jakub
niedergeworfen; er setzte Busuruk ab, erhob an seiner Statt
Kattatjura, vergiftete denselben aber schon nach vier Monaten und
setzte Busuruk von neuem als Chan ein. 1866 u. 1867 hatte Jakub
schon die Bezirke von Kaschgar, Jangi-Hissar, Jarkand und Chotan
unter seine Herrschaft gebracht. Busuruk wurde nun abgesetzt und
Jakub als Chan ausgerufen. Er nannte sich anfangs Herrscher von
"Alti Schahar" (s. d.), dann von "Dschiti Schahar". Zuerst
führte er den Titel "Atalik Ghazi" ("Verteidiger des Glaubens)
und schließlich "Badaulet" ("der Glückliche"). Sein
einziger Gegner in Kaschgarien blieb Rascheddin in Aksu, gegen
welchen er sich 1867 wandte. Durch List kam derselbe in die Gewalt
Jakubs, wurde getötet und Aksu genommen, ebenso Kurlja. Mit
den Dunganen wurde ein Vertrag geschlossen und die Grenze zwischen
ihnen und Kaschgarien festgesetzt. Bald waren aber diese mit den
Abmachungen nicht zufrieden, sie überschritten die Grenze,
waren auch anfangs siegreich, wurden aber schließlich doch
von Jakub geschlagen, welcher nun Kunja-Turfan und Urumtschi (1869
bis 1870) in seine Gewalt brachte. Ein zweiter wieder
niedergeworfener Aufstand der Dunganen ließ noch 1872
Manaß in seine Gewalt kommen. 1872-1876 genoß
Kaschgarien endlich der Ruhe, und Jakub wurde von Türken und
Engländern als Emir anerkannt. Den Chinesen gelang es
mittlerweile, die Dunganen nach und nach niederzuwerfen und auch
Manaß und Urumtschi wiederzuerobern. Im Winter 1876-1877
hielten die Chinesen Urumtschi, Jakub Beg die kleine Festung
Dawantschi besetzt. Die Truppen des letztern waren in moralischer
Beziehung merklich schlechter geworden: die Desertion nahm
überhand; selbst auf die bis dahin ergebensten Diener konnte
Jakub nicht mehr rechnen. Die Überläufer wurden von den
Chinesen sehr freundlich aufgenommen. Am 3. April 1877 rückten
die Chinesen aus Urumtschi gegen Diwantschi aus; nach
dreitägiger schwacher Verteidigung ergab es sich, ebenso
Kunja-Turfan. Mit den Gefangenen verfuhr der chinesische
Oberbefehlshaber Lutscha darin sehr geschickt, daß er sie zum
Teil wieder freiließ und ihnen versicherte, daß er
lediglich Krieg mit Jakub Beg führe. Um die Verbreitung dieser
Nachrichten zu verhindern, wurde ein großer Teil der
zurückgekehrten Gefangenen auf das Geheiß des Badaulet
ermordet. Diese Maßregel erregte in ganz Kaschgarien den
bittersten Haß gegen den Chan. Am 28. Mai 1877 war Jakub
gegen seinen Sekretär Chamal wegen Nichterfüllung
gegebener Befehle so aufgebracht, daß er ihn tötete. Mit
seinem Schatzmeister Sabir Achun wollte er ebenso verfahren, wurde
aber plötzlich vom Schlage getroffen. Der Sprache und des
Bewußtseins beraubt, starb Jakub Beg 29. Mai 2 Uhr morgens
(daß er von seinem Sohn getötet oder sich selbst
vergiftet, sind Fabeln). Jakub hinterließ drei Söhne,
Bik Kuly Beg, Chak Kuly Beg und Chakim Chan Tjurja. Chak Kuly Beg
wurde, als er mit der Leiche seines Vaters auf dem Weg nach
Kaschgar war, von dem Abgesandten seines ältesten Bruders,
Machmed-siapanssat, ermordet. Kaschgarien stand nunmehr unter drei
Herrschern: in Kaschgar regierte Bik Kuly Beg, in Aksu Chakim Chan
Tjurja und in Chotan Nias Beg. Anfang Oktober war Bik Kuly Beg nach
Besiegung der beiden andern Alleinherrscher. Aber auch er
verließ als Flüchtling das Land, das unter Jakub Beg
eine so große Rolle zu spielen begann, als Anfang Dezember
die Chinesen gegen Kaschgar zogen. Mit ihrem Einzug hier sind sie
wieder Herren des Landes geworden: Kaschgarien ist jetzt
vollständig in den Besitz Chinas übergegangen. Vgl.
Gregorjew, Ostturkistan (russ., Petersb. 1873); Wenjukow, Die
russisch-asiatischen Grenzlande (deutsch, Leipz. 1874); Shaw, Reise
nach der Hohen Tatarei (deutsch, Jena 1872); Forsyth, Report of a
mission to Yarkand (Kalk. 1875; deutsch im Auszug, Gotha 1878), und
besonders Kuropatkin, "Kaschgarja, historisch-geographischer
Abriß" (russ., Petersb. 1879; engl. Ausg., Lond. 1883).
Turkmenen (Turkomanen, Türkmen, vom Eigennamen
Türk und dem Suffix men, "schaft", also "Türkenschaft"),
der Gesamtname für mehrere zum türkischen Zweig der
Altaier gehörige Volksstämme, deren Wohnplätze und
Ernährungsquellen sich in dem anbaufähigen Land finden,
das einem Ringe gleich die in dem Raum zwischen dem Kaspischen Meer
und dem Amu Darja gelegene ungeheure Sandwüste Karakum
umschließt. Die T. zerfallen in verschiedene Stämme,
Zweige, Geschlechter und Familien, die nicht selten sich feindlich
gegenüberstehen; ihre Rasseneinheit haben sie aber dennoch
treu bewahrt. Ursprünglich waren wohl alle T. Nomaden; doch
haben die Beschränkung ihres Weideterrains sowie ihre
Einengung durch die sie umgebenden Staaten, besonders
Rußland, einen Teil derselben zu Ackerbauern gemacht. Oft
nomadisiert der eine Teil der Glieder einer Familie, während
der andre Ackerbau treibt und ansässig ist. Die Nomaden
heißen Tschorwa, die Angesessenen Tschomur. Verliert ein
Tschorwa seine Kamele und Schafe, so wird er Tschomur, während
auch umgekehrt ein Tschomur wieder zu einem Tschorwa werden kann.
Die einzelnen Stämme sind:
1) Die Jomuden, deren einer Hauptzweig, die Kara Tschuka,
zwischen den Flüssen Atrek und Gurgen, der andre,
Bairam-Schali (20,000 Kibitken), ganz in Chiwa lebt. Die Kara
Tschuka zerfallen in die 8000 Kibitken zählenden Dschafarbai
mit 2 Untergeschlechtern und 10 Familien und die Atabai (7000
Kibitken) mit 7 Untergeschlechtern. Erstere gelten für
russische, letztere für persische Unterthanen. Von beiden
zusammen gehören etwa 6000 Kibitken zu den Tschomur, welche
neben Ackerbau noch Fischerei treiben.
2) Die Ogurdschalen wohnen in der Stärke von 800 Familien
an der Küste des Kaspischen Meers und auf der Insel
Tschaleken, wo sie sich mit der Fischerei und der Gewinnung von
Naphtha und Salz beschäftigen, und in 50 Kibitken auf der
Insel Ogurtschinskij, wo nur Fischerei getrieben wird.
3) Die Schichzen auf der Landzunge Bekowitsch und zwischen den
Buchten von Krassnowodsk und Kara Bugas fischen und gewinnen
Salz.
4) T. verschiedener Stämme, besonders Igdyr, leben auf der
Halbinsel Mangyschlak vom Kara Bugas bis zum Kap Tjub Kargan, etwa
1000 Kibitken stark. Während der Ackerbau der kaspischen
Tschomur sich hauptsächlich am Atrek und Gurgen konzentriert
und hier die Ernten in guten Jahren oft das 20., ja das 30. Korn
geben, ist das Dorf Hassan Kuli der Mittelpunkt der Fischerei. Salz
wird aus Seen, Salzmooren und Steinsalzlagern gewonnen, jedoch
nicht in bedeutendem Maß; Persien und auch Transkaukasien
bilden das Absatzgebiet. Die Naphthaproduktion gewinnt immer
bedeutendern Umfang, seitdem es den Einwohnern gestattet ist, ihre
Anteile an den Naphthabrunnen Industriellen in Pacht zu geben.
5) Goklanen, persische Unterthanen, nomadisieren östlich
von den Jomuden zwischen Atrek und Gurgen in der Stärke von
etwa 4000 Kibitken, während etwa 2000 in den Grenzstrichen von
Chiwa leben; sie teilen sich in 6 Zweige: die Gaï mit 25,
Bajandyr mit 6, Kyryk
939
Turkos - Turm.
mit 8, Ai-Derwisch mit 7, Tschakyr Beg Deli mit 10 und die
Jangak Sagri mit 7 Familien.
6) Die Tschoudoren leben in etwa 12,000 Kibitken in den
Grenzstrichen Chiwas.
7) Dem linken Ufer des Amu Darja weiter aufwärts folgend,
leben die Sakar, 3000 Kibitken, 20 km oberhalb der bocharischen
Stadt Tschardschui, und
8) die 30,000 Kibitken zählenden Erssary mit 4
Geschlechtern; sie sind mehr oder weniger von Bochara abhängig
und erstrecken sich bis Afghanistan.
9) Die Teke, der mächtigste, tapferste und zahlreichste
Stamm, haben die Achal-Oase und Merw-Oase inne. Die Achal-Teke
zählen etwa 30,000, die Merw-Teke etwa 50,000 Kibitken; der
ganze Stamm zerfällt in die Tochlamysch mit den beiden Zweigen
Beg (5 Geschlechter, 11 Familien) und Wekil (2 Geschlechter, 12
Familien) und die Otamysch mit den Zweigen Sytschmes (6
Geschlechter) und Bachschi (5 Geschlechter). Die Merw-Teke scheinen
sich in der Mitte der 30er Jahre von den Achal-Teke abgelöst
zu haben und sind weiter ostwärts gezogen, wo es ihnen in
blutigen Kriegen gegen Persien gelang, des ganzen Merwgebiets sich
zu bemächtigen. Die Achal-Teke wurden 1881 von den Russen
unterworfen, die Merw-Teke unterwarfen sich 1883 freiwillig; ihre
Gebiete wurden dem transkaspischen Bezirk einverleibt.
10) Die Saryk bewohnen die südöstlich von Merw am
Murghab gelegenen Landschaften Juletan und Pandsh-Dech; 12,000
Kibitken in 5 Geschlechtern mit 16 Familien; sie treiben Garten-
und Ackerbau und leben mit den Merw-Teke in Feindschaft.
11) Die Salyr, 3000 Kibitken, hatten sich in der persischen
Landschaft Sur-Abad niedergelassen, verlegten dann ihren Wohnsitz
nach Alt-Sarachs am Heri-Rud, wurden hier aber von den Merw-Teke
überfallen, mit ihrer ganzen Habe fortgeschleppt und diesen
einverleibt. Im ganzen beziffert sich somit die Stärke aller
T. auf 900,000-950,000, auch wohl 1 Mill. Köpfe.
Alle T. betrachten den Raub als eine vollständig gestattete
Erwerbsquelle; sie leben deshalb in fast steter Feindschaft
untereinander, sind aber besonders eine entsetzliche Geißel
für die benachbarten Völkerschaften, zumal wenn sie als
Sunniten den Schiiten gegenüberstehen. Nachdem aber
Rußland bis in das Herz Turkmeniens vorgedrungen ist, wird
diesen Räubereien wohl bald ein Ziel gesetzt werden, zumal
wenn Persien in seinen Nordprovinzen einen größern
Widerstand leistet, als dies jetzt der Fall ist. Das einzige, was
die T. achten, ist die Macht der Stärke und das Adat, das
uralte Gewohnheitsrecht. Die Stämme wählen wohl aus ihrer
Mitte Chane; doch haben diese keinerlei Gewalt, wenn sie auch durch
persönliche Vorzüge zuweilen bedeutenden Einfluß
ausüben. Die Mollas sind wenig geachtet, wie überhaupt
die T. sich leicht über die Lehren des Korans hinwegsetzen. Je
mehr aber die seßhafte Lebensweise Platz greift, desto mehr
werden die T. auch einer gesellschaftlichen Ordnung zugänglich
werden. Die den Frauen zugestandene geachtete Stellung, die Liebe
zu den Kindern, das Halten des gegebenen Wortes und stete
Gastfreiheit sind als Charaktereigenschaften hervorzuheben. Dabei
sind sie äußerst mäßig. Ein magerer,
zäher Körper, fast bronzefarbige Gesichter mit kleinen,
tief liegenden Augen, schwarze Haare, ungewöhnlich weiße
Zähne, lange Bärte kennzeichnen das Äußere.
Das nationale Kostüm besteht aus einem weiten, langen Gewand,
je nach dem Stand von Seide oder einem andern Stoff, und hohen
Lammfellmützen, welche die Frauen durch einen um den Kopf
gewundenen Shawl ersetzen. Letztere lieben und tragen viel Schmuck
und verhüllen sich nicht. Zur Wohnung dient die Filzjurte, in
welcher die Frauen frei schalten. Gewöhnlich hat der Turkmene
zwei Frauen, für welche er einen gewissen Kaufpreis zu zahlen
hat. Die Ehe kann aber willkürlich gelöst werden.
Ackerbau, Gartenbau, Fischerei, Viehzucht sind je nach den
Wohnplätzen die Hauptbeschäftigungen. Die Jagd wird nicht
sehr kultiviert. Die Industrie beschränkt sich auf Anfertigung
von Reitzeug, Kamelhaartuch, Ackergerätschaften etc.; die
Fischerboote, in Hassan Kuli gefertigt, und die Teppiche der Teke
haben einen großen Ruf. Vorläufig ist von Handel noch
keine Rede, daß aber die Transkaspische Eisenbahn in dieser
Beziehung einen Umschwung hervorbringen wird, dürfte kaum
bezweifelt werden. Vgl. "Petermanns Mitteilungen", Bd. 26 (1880);
v. Hellwald, Zentralasien (Leipz. 1880); Wenjukow, Die
russisch-asiatischen Grenzlande (deutsch, das. 1874);
Vambéry, The Turkomans between the Caspian and Merw (im
"Journal of the Anthropological Institute etc.", Februar 1880);
Weil, La Tourkménie et les Tourkmènes (Par. 1880);
Vambéry, Das Türkenvolk (Leipz. 1885).
Turkos, frühere Bezeichnung für die heutigen
Tirailleure Algeriens, afrikanische Fußtruppe der
französischen Armee, 1842 errichtet, jetzt 4 Regimenter
à 4 Bataillone zu je 4 Kompanien und einer Depotkompanie.
Die Offiziere vom Hauptmann aufwärts und pro Kompanie zwei
Leutnants sind Franzosen. Ihre Uniform entspricht der arabischen
Tracht: hellblaue Jacke und Weste, Turban, Burnus, Gamaschen
etc.
Turksinseln, Inselgruppe der brit. Bahamainseln
(Westindien), bestehend aus der Insel Grand Turk (18 qkm mit 2500
Einw.) und dem kleinern Inselchen Salt Cay (s. d.). Grand Turk ist
niedrig und sandig und liefert außer Fischen und
Schildkröten noch Salz. Es bildet mit den Caicos (s. d.) einen
Verwaltungsbezirk, der seit 1874 vom Gouverneur von Jamaica
abhängt, und insgesamt ein Areal von 575 qkm (10,4 QM.) mit
(1881) 4732 Einw. hat. Die Ausfuhr belief sich 1887 auf 26,015 Pfd.
Sterl., die Einfuhr auf 26,721 Pfd. Sterl. Lokalrevenue 1887: 6203
Pfd. Sterl.
Turlupin (franz., spr. türlüpäng),
ursprünglich Name einer übel berüchtigten
fanatischen Sekte, die im 13. und 14. Jahrh. in Frankreich
umherzog; dann Beiname des französischen Komikers Legrand
unter Ludwig XIII., daher s. v. w. Possenreißer. Turlupinade,
Hanswurstiade, Hänselei.
Turm, Gebäude von regulär prismatischer oder
cylindrischer Grundform, dessen Höhe die Abmessungen seiner
Grundfläche mehr oder minder bedeutend übertrifft. Die
Türme werden meist andern Gebäuden, wie Kirchen,
Schlössern, Rathäusern, Stadtthoren, Festungen,
angefügt und mit ihnen zu einem architektonischen Ganzen
verbunden, oder sie stehen isoliert. Bei der ägyptischen
Baukunst erkennen wir in den Pylonen ihrer Tempel und in ihren
Pyramiden die ersten Vorläufer der Turmbauten; von den
Griechen ist uns nur der achteckige, mit niederm Zeltdach versehene
"T. der Winde" (s. Tafel "Baukunst IV", Fig. 10) erhalten. Die
Römer kannten nur feste, oben mit Plattform und Zinnen
versehene Verteidigungstürme. Ähnlich waren die meist
runden oder quadratischen Festungstürme des Mittelalters,
welche oft noch eine Laterne auf den Zinnen oder einen kurzen
Steinhelm erhielten. Indes zeigten sich die Türme hier
überall noch als mehr oder minder willkürliche An- oder
Aufbauten. Erst der christlichen Baukunst war es vorbehalten, die
Türme zu einem integrieren-
940
Turma - Turmalin.
den Bestandteil der Kirchen und ihrer Architektur zu machen,
indem man in der Zeit Konstantins die christlichen Tempel mit
Glockentürmen zu versehen begann. Dieselben waren anfangs rund
und trugen einen Pavillon mit niedrigem Zeltdach, später
wurden sie viereckig, geböscht und mit einem Pavillon unter
hohem Zeltdach geschlossen. Anfangs standen die Türme isoliert
neben der Kirche; eine organische Verbindung des Turms mit der
Kirche zeigt sich erst im romanischen Stil. Die echt
architektonische Ausbildung und vollkommen organische Verbindung
mit den übrigen Gebäudeteilen zu einem Ganzen erhielten
die Türme aber erst in dem gotischen Kirchenbaustil, dessen
Idee in dem Bau des Turms ihren eigentlichen Ausdruck findet. Unter
die sowohl durch den Adel ihrer Bauart als die Höhe ihrer
Helme ausgezeichneten Turmbauten gehören unter andern die
Münster und Kirchen zu Köln, Straßburg, Freiburg,
Wien, Magdeburg, Marburg, Regensburg, Nürnberg, Trier,
Antwerpen, Brüssel, Venedig und Mailand. Der für die
Pariser Weltausstellung von 1889 auf dem Marsfeld von Eiffel und
Sauvestre errichtete T. ist 300 m hoch, bedeckt eine
Grundfläche von mehr als 1 Hektar und ruht auf vier
Mauerwerkskörpern, die durch Mauern zu einem Fundament
vereinigt sind. Der T. hat das Aussehen eines riesigen
Gerüstes, ist ganz aus Eisen konstruiert und enthält in
60 m Höhe das erste, in 115 m Höhe das zweite und in 275
m Höhe das dritte Stockwerk. Eine 250 qm große
Glaskuppel krönt den T. In quadratischen Röhren an den
vier Ecken des Turms befinden sich Treppen und acht hydraulische
Aufzüge. Die Erbauungskosten sollen 5-6 Mill. Frank betragen.
Vgl. Schmidt, Vergleichende Darstellung der höchsten
Denkmäler und Bauwerke (Berl. 1881); Sutter u. Schneider,
Turmbuch (das. 1888).
Übersicht der höchsten Türme.
Paris: Eiffelturm 300 m.
Washington: Washingtondenkmal (projektiert) 175 m.
Köln: Dom 156 m.
Rouen: Kathedrale 151 m.
Ulm: (projektiert) Münster 151 m.
Hamburg: Nikolaikirche 147 m.
Reval: Olauskirche 145 m.
Hamburg: Michaeliskirche 143 m.
Rom: Peterskirche 143 m.
Straßburg: Münster 142 m.
Riga: St. Peter 140 m.
Pyramide des Cheops 137,2 m.
Wien: St. Stephan 136,7 m.
Pyramide des Chefren 136,4 m.
Hamburg: Petrikirche 134,5 m.
Landshut: Martinskirche 133 m.
Rostock: Petrikirche 132 m.
Amiens: Kathedrale 130 m.
Petersburg: Peter-Paulsk. 128 m.
Lübeck: Marienkirche 124 m.
Antwerpen: Dom 123 m.
Hamburg: Katharinenk. 122 m.
Freiburg i. Br.: Münster 122 m.
Brüssel: Justizpalast 122 m.
Salisbury: Kathedrale 122 m.
Brügge: Liebfrauenkirche 120 m.
Cremona: Torrazzo 120 m.
Paris: Notre Dame (proj.) 120 m.
Florenz: Dom 119 m.
Gent: Belfried 118 m.
Chartres: Kathedrale 115 m.
Brüssel: Rathaus 114 m.
Hamburg: Jakobikirche 114 m.
Lüneburg: Johanniskirche 113 m.
London: St. Paulskathedrale 111 m.
Sevilla: Giraldakirche 111 m.
Dschagaunath: Pagode 110 m.
Breslau: Elisabethkirche 108 m.
Brügge: Hallenturm 107,5 m.
Wien: Rathaus 107 m.
Bordeaux: St.-Michel 107 m.
Chartres: Kathedrale 106,50 m.
Mailand: Dom 105 m.
Groningen: Martinikirche 105 m.
Paris: Invalidendom 105 m.
Moskau: Erlöserkirche 105 m.
Magdeburg: Dom 103,6 m.
Utrecht: Dom 103 m.
London: Parlamentsgeb. 102 m.
Augsburg: Dom 102 m.
Petersburg: Isaakskirche 102 m.
Nördlingen: Georgskirche 102 m.
Brannschweig: Andreask. 101 m.
Dresden: Schloßturm 101 m.
München: Frauenkirche 99 m.
Berlin: Petrikirche 96 m.
Berlin: Rathaus 88 m.
Meißen: Dom 78 m.
Schiefe Türme oder Turmhelme verdanken ihre Abweichung von
der lotrechten Stellung entweder einseitiger Senkung oder einer
beabsichtigten Baukünstelei. Bei dem berühmten schiefen
Glockenturm zu Pisa streitet man zur Zeit noch über den Grund
der Abweichung seiner Achse vom Lot, während man z. B. den
schiefen Turmhelm der Pfarrkirche in Gelnhausen als das
Kunststück eines Zimmermeisters zu betrachten hat, da er nicht
nur geneigt, sondern auch spiralförmig gewunden ist.
In der Kriegsbaukunst war der Gebrauch von Türmen schon bei
den Alten und im Mittelalter an der äußern Seite der
Stadtmauern in teils runder, teils viereckiger Gestalt zur
Ermöglichung der Seitenverteidigung üblich. Der Hauptturm
einer jeden Burg hieß Bergfried, bei den Burgen des Deutschen
Ordens bildete ein T. (Danziger) ein vorgeschobenes
Außenwerk. Nach Erfindung des Schießpulvers wurden sie
enger mit den Mauern verbunden, und es entstanden aus ihnen die
Bastione, während eigentliche Türme außer Gebrauch
kamen. Erst später wandte sie Vauban unter dem Namen
Bollwerkstürme wieder an. Montalembert verbesserte diese
Türme und gab ihnen eine vielfach veränderte Gestalt. Sie
sind kasemattiert und so eingerichtet, daß die innern
Gewölbe nicht auf den äußern Umfassungsmauern,
sondern auf innern Strebepfeilern ruhen und in bedeckten
Geschützständen mehrere Reihen Geschütze
übereinander stehen. Ähnlich eingerichtet sind die sogen.
Martellotürme (s. d.) in England zur Küstenverteidigung.
In neuester Zeit kommen Türme, mit Eisenpanzerung versehen und
mit ihrem obern Teil auf einer Unterlage drehbar, bei
Landbefestigungen, namentlich aber zum Küstenschutz und auf
den Kriegsschiffen selbst vor. Vgl. Panzerungen.
Turma (lat., "Haufe, Trupp"), die kleinste taktische
Abteilung in der Reiterei der alten Römer und ihrer
Bundesgenossen, betrug bei den erstern 30, bei den letztern 60 Mann
und hatte eine eigne Fahne.
Turmair, Johannes, s. Aventinus.
Turmalin (Schörl), Mineral aus der Ordnung der
Silikate (Turmalingruppe), kristallisiert rhomboedrisch,
ausgezeichnet hemimorphisch, meist mit vorwaltender,
gewöhnlich stark gestreifter Säule. Er findet sich aber
auch in derben, stängeligen (Stangenschörl) und
faserigen, auch körnigen Varietäten; er ist selten
farblos und durchsichtig, gewöhnlich grau, gelb, grün,
blau (Indikolit), rot (Rubellit), braun oder schwarz (Schörl),
glasglänzend, durchsichtig bis undurchsichtig, wird durch
Reiben oder Erhitzen stark elektrisch (daher sein Name:
Aschenzieher); Härte 7-7,5, spez. Gew. 2,94-3,21. Die
chemische Zusammensetzung des T. ist eine äußerst
komplizierte; nach Rammelsberg lassen sich indessen alle
Varietäten als isomorphe Mengungen der Silikate R(I)6SiO5,
R(II)3SiO5 und (R2)(IV)SiO5 [s. Bildansicht] auffassen, worin
Kalium, Natrium, Lithium, auch Wasserstoff als einwertige,
Magnesium, Eisen, Mangan und Calcium als zweiwertige Elemente,
Aluminium, Bor und Eisen in sechswertigen Doppelatomen auftreten
und ein Teil des Sauerstoffs durch Fluor ersetzt ist (s. Tafel
"Edelsteine", Fig. 17 u. 18). Von den Varietäten des T. findet
sich der Schörl in vielen alten Silikatgesteinen (Granit,
Gneis, Talk-, Chlorit- und Glimmerschiefer) sowie in Kalken und
Dolomiten und bildet im grob- oder feinkörnigen Gemenge mit
Quarz den Turmalinfels (Schörlfels), in lagenweiser Anordnung
den Turmalinschiefer (Schörlschiefer). Hauptfundorte für
große Kristalle sind der Hörlberg in Bayern, das
Zillerthal und andre Orte in Tirol, Norwegen, für farblosen T.
Elba, für Rubellit Elba und Rozna in Mähren; grüne,
braune und doppelfarbige kommen von Penig in Sachsen, vom St.
Gotthard, aus Kärnten, vom Ural, aus
941
Turmalinfels - Turners Gelb.
Massachusetts, Maine etc., Indikolith von der Insel Utö in
Schweden und aus Brasilien. T. dient als polarisierende Substanz in
Polarisationsinstrumenten, namentlich den sogen. Turmalinzangen,
und ist in einigen Varietäten (edler T.) ein geschätzter
Edelstein. Im Handel heißen die roten Turmaline Rubellit,
Sibirit oder sibirischer T., die blauen brasilischer T., die
grünen brasilischer Smaragd, die gelblichgrünen
ceylonischer Chrysolith.
Turmalinfels (Schörlfels), wenig verbreitetes
Gestein, aus Quarz und schwarzem Turmalin (in Körnern oder
Nadeln) gebildet. Gewöhnlich gleichzeitig mit
turmalinführenden Graniten, selten (Cornwall, Eibenstock und
im Erzgebirge) selbständig vorkommend, ist es teils dicht,
teils körnig, teils schieferig (Turmalinschiefer).
Turmalinzange, s. Polarisationsapparate.
Turmberg, s. Karthaus.
Turmequé (spr. -ke), Stadt im Staat Boyacá
der südamerikan. Republik Kolumbien, südlich von Tunja,
2720 m ü. M., mit (1870) 8182 Einw.
Turmero, Stadt in der Sektion Guzman Blanco des
gleichnamigen Staats der Bundesrepublik Venezuela, in reizender
Lage am gleichnamigen Fluß und am Fuß der
Küstenkordillere, mit (1873) 6040 Einw.
Turmfalke, s. Falken, S. 10.
Turmforts, s. Panzerungen.
Türmitz, Stadt in der böhm.
Bezirkshauptmannschaft Aussig, an der Biela und der
Aussig-Teplitzer Eisenbahn gelegen, mit einem Schloß, (1880)
2547 Einw., einer Zuckerfabrik, Bierbrauerei, Chemikalienfabrik,
Obst- und Weinbau und bedeutenden Braunkohlenwerken.
Turmkrähe, s. v. w. Dohle, s. Rabe.
Turmschiff, s. Panzerschiff, S. 661.
Turmschwalbe, s. Segler (Cypselus).
Turm- und Schwertorden, portugies. Orden, gestiftet 1459
von Alfonso V., erneuert 1808, und 1832 von Dom Pedro, Herzog von
Braganza, vollständig neu organisiert unter dem Titel: "Der
alte und sehr edle Orden vom Turm und Schwert für Tapferkeit,
Ergebenheit und Verdienst". Die Grade sind: Großmeister,
Großoffiziere, Großkreuze, Kommandeure, Offiziere und
Ritter, deren Zahl unbestimmt ist. Der Orden wird verliehen
für persönliches Verdienst, ausgezeichnete Thaten und
bürgerliche Treue, ist aber auch durch Nachweis derselben
Inländern und Ausländern zugänglich. Die Dekoration
der Ritter besteht aus einem silbernen (höhere Grade
goldenen), weiß emaillierten, fünfspitzigen Kreuz, auf
dessen Mittelschild im Avers ein Schwert in einem Eichenkranz ruht,
im Revers ein aufgeschlagenes Buch, links mit dem portugiesischen
Wappen, rechts mit dem Titel der Konstitution, sich befindet,
während auf dem blauen Ring vorn: "Valor, lealdade, merito",
hinten: "Pelo Rei e pela lei" steht. Das Kreuz hat zwischen den
zwei obern Armen einen Turm, an dem es hängt, und ist von
einem Eichenkranz umgeben. Großkreuze und Komture tragen
einen goldenen Stern mit dem Orden obenauf; die Ordenskette besteht
aus den Türmen und Schwertern in Kränzen des Ordens,
dessen Band dunkelblau ist. Ordenstag: der 29. April.
Turn (Dorne), Dichter, s. Reinbot von Turn.
Turnau, Stadt im nördlichen Böhmen, an der Iser
und an der Pardubitz-Reichenberger Eisenbahn, in welche hier die
Eisenbahn Prag-Kralup-T. einmündet, hat eine Dechantei- und
eine gotische Marienkirche, ein Franziskanerkloster, ist Sitz einer
Bezirkshauptmannschaft und eines Bezirksgerichts, hat eine
Gewerbeschule für Edelsteinbearbeitung, Bierbrauerei,
Mühlenbetrieb, Dampfsäge, Druckerei, Wachs- und
Seilerwarenfabrikation, Schleiferei böhmischer Granate und
andrer (echten und unechten) Edelsteine (früher viel
bedeutender) und zählt (1880) 4948 Einw. Hier 26. Juni 1866
siegreiches Gefecht der Preußen gegen die Österreicher.
In der durch ihre Sandsteinformation bemerkenswerten Umgebung sind
die Kaltwasserheilanstalt Wartenberg, die Ruine Waldstein,
Stammburg des berühmten Geschlechts, die Schlösser
Großskal, Sichrow, Groß-Rohosetz mit Parkanlagen zu
erwähnen.
Turnbulls Blau, s. Berliner Blau.
Turnen, s. Turnkunst.
Turner, 1) Sharon, engl. Geschichtschreiber, geb. 24.
Sept. 1768 zu London, widmete als Advokat in seiner Vaterstadt
seine Muße vorzüglich der Erforschung der Geschichte
seines Vaterlandes und begründete seinen Ruf durch die
"History of the Anglo-Saxons" (Lond. 1799 ff.; 7. Aufl. 1852, 3
Bde.). Es folgten: "History of England during the middle ages"
(neue Ausg. 1853, 4 Bde.); "The history of the reign of Henry
VIII." (neue Ausg. 1835, 2 Bde.); "Modern history of England" (1826
ff., 2 Bde.); "The history of the reigns of Edward VI., Mary and
Elizabeth" (neue Ausg. 1854, 2 Bde.); "Sacred history of the world"
(2. Aufl. 1848, 3 Bde.). T. starb 13. Febr. 1847 in London.
2) Joseph Mallord William, engl. Maler, geb. 23. April 1775 zu
London, trat 1789 als Schüler in die königliche Akademie
und erwarb sich durch seine Fluß- und Seelandschaften nach
englischen Motiven, die zumeist von den Holländern, Claude
Lorrain und Poussin beeinflußt waren, bald solchen Ruf,
daß ihn die Akademie 1802 zu ihrem Mitglied ernannte. Durch
wiederholte Studienreisen nach Schottland, Frankreich, der Schweiz,
Italien und nach dem Rhein erweiterte er seinen Gesichtskreis. 1807
wurde er zum Professor der Perspektive an der Akademie ernannt,
hielt aber nur wenige Jahre Vorlesungen. Er starb 19. Dez. 1851 in
Chelsea. T. nimmt unter den englischen Landschaftsmalern eine der
ersten Stellen ein. Obwohl seine Bilder, namentlich diejenigen
seiner letzten Zeit, oft an Maßlosigkeit der Phantasie und
Übertreibung im Kolorit leiden, besonders in den
Lichtwirkungen, so sind sie doch nach Auffassung und Behandlung
höchst originell. Außer Landschaften hat er auch Marine-
und Historienbilder gemalt, und eine besondere Virtuosität
entfaltete er im Aquarell. Eine reiche Sammlung seiner Gemälde
(112) besitzt die Londoner Nationalgalerie, darunter seine
Hauptwerke: Jason, die Schmiede, Apollo und Python, der
Schiffbruch, Dido und Äneas, der Fall Karthagos, die Bai von
Bajä, Odysseus verhöhnt den Polyphem, Hannibals Zug
über die Alpen, der Pier von Calais. Eine Sammlung seiner
Skizzen veröffentlichte er unter dem Titel: "Liber studiorum".
Außerdem lieferte er Illustrationen zu den Gedichten von
Byron, Campbell, Scott, Roger u. a. Von seinem großen
Vermögen setzte er 200,000 Pfd. Sterl. zum Bau eines Asyls
für arme Künstler aus. Vgl. Thornbury, Life of J. M. W.
T. (neue Ausg. 1877, 2 Bde.); Dafforne, The works of J. M. W. T.
(1878); Hamerton, T. (Par. 1889).
Turneraceen, dikotyle, etwa 100 Arten umfassende,
vorzugsweise im tropischen Südamerika einheimische
Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Passiflorinen, von den
nächsten Verwandten durch gedrehte Knospenlage der
Blumenblätter und den Mangel eines stielförmigen
Fruchtknotenträgers unterschieden.
Turners Gelb, s. Bleichlorid.
942
Turnhout - Turnkunst.
Turnhout (spr. törnhaut), Hauptstadt eines
Arrondissements in der belg. Provinz Antwerpen, in der sogen.
Campine, durch Eisenbahnen mit Tilburg und Lierre verbunden, hat
ein altes, 1371 von Maria von Geldern erbautes Schloß (jetzt
Justizpalast), eine höhere Knabenschule, ein Tribunal,
lebhafte Industrie in Baumwolle, Leinwand, Spitzen, Papier,
Branntwein etc., Färberei, Gerberei, Bleicherei, Handel nach
den Niederlanden und (1888) 17,800 Einw. Hier 22. Jan. 1597 Sieg
der Niederländer unter Moritz von Oranien über die
Spanier und 27. Okt. 1789 Sieg der belgischen Insurgenten
(Patrioten) über die Österreicher.
Turnier (Turnei, franz. Tournoi, lat. Torneamentum,
Hastiludium), eine im 11. Jahrh. angeblich von dem
französischen Ritter Godefroy de Preuilly erfundene
Umgestaltung der bei allen kriegerischen Völkern nachweisbaren
Waffenspiele. Während der Buhurt (s. d.) bloß die
Gelegenheit bot, die Gewandtheit des Reiters zur Geltung zu
bringen, in der Tjost (franz. joute, lat. justa, ital. giostra) nur
zwei Gegner sich gegenüberstanden, die mit abgestumpften, oft
aber auch mit scharfen Waffen miteinander kämpften, ist das T.
ursprünglich das Abbild einer großen Reiterschlacht,
vertritt gewissermaßen unsre Manöver. Vor Beginn des
Turniers wurden die Scharen geteilt, so daß auf jeder Partei
gleichviel Kämpfer sind. Schon den Tag vor dem Kampffpiel
hatten die Ritter in der Tjost ihre Kräfte gemessen; das ist
die Vesperie oder Vespereide. Das T. begann mit dem Speerkampf;
jeder suchte seinen Gegner durch einen geschickten Stoß gegen
das Kinnbein, gegen das Zentrum des Schildes (die vier Nägel)
etc. aus dem Sattel zu heben. Zugleich aber manövrierte auch
Schar gegen Schar unter Kommando ihrer Befehlshaber. Auch über
diese Angriffsarten sind wir ziemlich unterrichtet. Waren die
Speere verstochen, so wurde das Gefecht mit den Schwertern
fortgesetzt, endlich durch Ringen der Kampf entschieden; daß
einer unterlag und sich als Gefangener seinem Gegner ergab, das ist
die Sicherheit, die Fîanze. Das Roß des Besiegten
gehörte dem Sieger, der es von seinen Leuten in Sicherheit
bringen ließ; ebenso nahm er den Harnisch und die Waffen in
Anspruch und verlangte von seinem gefangenen Gegner auch noch ein
angemessenes Lösegeld. So ist die Teilnahme an einem T. eine
Art Glücksspiel: man konnte alles verlieren, aber auch viel
gewinnen, und es gab deshalb damals schon Leute
("Glücksritter"), die aus reiner Gewinnsucht sich an Turnieren
gewohnheitsmäßig beteiligten. Aber auch
lebensgefährlich war das T.; zahllose Unglücksfälle
haben sich bei ihnen ereignet, und deshalb erschien es durchaus
gerechtfertigt, daß die Päpste Innocenz II., Eugen III.,
Alexander III. und Cölestin III. die Teilnahme an den
Turnieren, freilich ohne jeden Erfolg, bei Strafe der
Exkommunikation verboten. Damen haben wohl hin und wieder bei den
Turnieren zugesehen, und in der zweiten Hälfte des 13. Jahrh.
mag auch zuweilen ein Preis dem hervorragendsten Ritter zuerkannt
worden sein; aber alle diese Verschönerungen, die das T. zu
einem höfischen Fest umgestalten, haben eigentlich mit der
Hauptsache: den Rittern Gelegenheit zu geben, sich im Reitergefecht
praktisch zu üben, nichts zu thun. Vgl. Niedner, Das deutsche
T. des 12. und 13. Jahrhunderts (Berl. 1881); Reinh. Becker,
Ritterliche Waffenspiele nach Ulrich v. Lichtenstein (Düren
1887); A. Schultz, Das höfische Leben zur Zeit der
Minnesinger, Bd. 2, S. 106 ff. (2. Aufl., Leipz. 1889).
Die Geldgier der Ritter machte schon in der zweiten Hälfte
des 13. Jahrh. die Turniere zu Schauplätzen der Roheit und der
gemeinen Raubsucht. Im 14. Jahrh. wird das T. als ein adliges
Vergnügen noch eifrig gepflegt, besonders war Johann von
Luxemburg, der König von Böhmen, ein großer Freund
dieser Leibesübung. Auch im 15. Jahrh. finden noch viele
Turniere statt, aber es sind schon mehr bloße Schaustellungen
von persönlicher Geschicklichkeit; den Charakter eines
Reitermanövers haben sie verloren. In der Regel handelt es
sich nur um einen Zweikampf, der auch bei den schweren
Eisenrüstungen kaum mehr gefährlich ist, natürlich
nur ganz kurze Zeit andauern konnte. Über die verschiedenen
Arten des Turniers, das Stechen und Rennen, im hohen Zeug etc., hat
Q. v. Leitner in der Einleitung seiner Ausgabe des "Freidal, des
Kaisers Marimilian I. Turniere und Mummereien" (Wien 1880-82) wohl
das Beste veröffentlicht. Die Ritter hatten sich im 15. Jahrh.
zu Turniergesellschaften vereinigt, welche die neugeadelten
Kaufleute von ihren Kampfspielen ausschlossen, über die Art
des Turniers, die Ehrenhaftigkeit der Teilnehmer etc.
Beschlüsse faßten. Diese Partie des ehedem so
hochgeehrten Turnierbuchs von dem bayrischen Herold Georg
Rüxner (2. Ausg. 1532) ist wohl unbedingt glaubwürdig.
Kaiser Maximilian I. war ein eifriger Pfleger der Turnierkunst und
hat sich um die Ausbildung derselben viele Verdienste erworben.
Nach dem Tod Maximilians werden die Turniere seltener, und der
Unglücksfall, der 1559 dem französischen König
Heinrich II. das Leben kostete, brachte das eigentliche Waffenspiel
immer mehr in Mißkredit. Statt des Turniers wird nun beliebt
das ungefährliche Karussellreiten, das Ringelrennen, das
Stechen nach der Quintane und wie alle diese Spiele heißen,
die dem Reiter Gelegenheit boten, seine Kunst und Geschicklichkeit
ins beste Licht zu setzen. Dabei konnte aller Prunk entfaltet
werden, und so entsprach ein solches Fest allen Anforderengen, die
man im 17. und 18. Jahrh. an höfische Vergnügungen
stellte. Seit dem Tode des Königs August des Starken sind auch
diese Leibesübungen in Vergessenheit gekommen, nur bei
großen Hoffestlichkeiten werden von Zeit zu Zeit noch
Schauspiele veranstaltet, die zwar als "Turniere" zuweilen
bezeichnet werden, mit den mittelalterlichen Turnieren der
ältern Zeit aber nichts als den Namen gemein haben.
Turnierkragen, s. Beizeiten.
Turnikett, s. v. w. Tourniquet.
Turnips, s. v. w. Wasserrübe, Brassica rapa rapifera
(s. Raps); in einigen Gegenden s. v. w. Runkelrübe (s.
d.).
Turnkunst (Turnen), die Kunst der Leibesübung
(Gymnastik) in ihrer deutschen Entwickelungsform. Der Name stammt
vom Turnvater Jahn, der ihn als einen vermeintlich echt deutschen
dem altdeutschen turnan (drehen) entnahm, welches aber nur ein
Lehnwort aus dem griechisch-lateinischen tornare (runden, drehen)
ist, verwandt mit Turnier und Tour. Die T. umfaßt die
Gesamtheit der bei uns einer geregelten Ausbildung des menschlichen
Körpers um dieser selbst willen dienenden Leibesübungen,
bietet so aber auch die Grundlage für die bestimmten Zwecken
dienenden leiblichen Fertigkeiten, wie z. B. für den Tanz und
die militärischen Bewegungsformen, für Fechten und
Reiten, schließt aber solche nicht schon in sich. Sie ist
somit als allgemein vorbildend ein wesentlicher Teil der Erziehung
und eine Pflicht der letztern insofern, als ihr die Ausbildung der
menschlichen Kräfte innerhalb der Grenzen eines harmoni-
943
Turnkunst (geschichtliche Entwickelung in Deutschland).
schen Zusammenwirkens derselben obliegt. Durch letzteres
unterscheidet sie sich von der die leibliche Kraft und Gewandtheit
ausschließlich und berufsmäßig ausbildenden
Athletik wie von dem nur einzelne Fertigkeiten pflegenden Sporte.
Die T. hat mit ihrem Einfluß auf die Funktionen der
Leibesorgane eine wesentliche Bedeutung für die Gesundheit,
sowohl durch Bewegung, Kräftigung und Abhärtung Krankheit
verhütend als eingetretenen Störungen des Organismus
entgegenwirkend. Das Turnwesen bildet somit einen wichtigen Teil
der auf Volksgesundheitspflege gerichteten Bestrebungen. Da nun
aber Leib und Geist als Teile desselben Organismus in steter
Wechselwirkung stehen, so wird die leibliche Ausbildung zur Pflicht
nicht nur um des Leibes willen, sondern die T. kann und will auch
an ihrem Teil geistige Frische und Rüstigkeit, Selbstvertrauen
in die Leibeskräfte, männliche Wehrhaftigkeit, sittliche
Beherrschung des Leibes mit fördern helfen. Auf den Namen
einer Kunst hat die T. nur in bedingter Weise, aber insofern
Anspruch, als sie, wie die Baukunst und andres Kunsthandwerk, bei
der Ausführung ihrer einem praktischen Zweck dienenden
Übungen nach Schönheit der Form strebt. Auch werden
manche ihrer reigenartigen Gebilde in den Ordnungsübungen,
gewissen Formen der Tanzkunst verwandt, oft nur um der Gestaltung
wohlgefälliger Formen willen geschaffen. Für den
Zusammenhang der T. mit geistigen Bestrebungen ist bezeichnend,
daß, wie die griechische Gymnastik sich bei dem geistig am
höchsten und vielseiligsten entwickelten Volk des Altertums
findet, so auch die T. einer Zeit voll höchster geistiger
Regsamkeit und begeisterten patriotischen Aufschwunges ihren
Anstoß verdankt, und daß auch ihre weitern Schicksale
mit den Wandlungen unsers nationalen Geisteslebens engen
Zusammenhang zeigen.
[Geschichte.] Das Leben setzt in jeder Form ein gewisses
Maß leiblicher Fertigkeit und Übung voraus, und wenn man
von mönchisch-asketischen, auf Ertötung des
Leiblich-Sinnlichen gerichteten Bestrebungen absieht, konnte der
Nutzen leiblicher Kraft und Gewandtheit kaum irgendwo verkannt
werden, ja vielmehr hat sich die Lust an leiblicher Regung, in
welcher Form es auch sei, noch zu allen Zeiten geltend gemacht.
Daher finden sich auch in Deutschland seit der Zeit des
Mittelalters, wo die Bewegungslust mit dem Waffenhandwerk den Bund
zu ritterlichem Kampf- und Turnierwesen eingegangen war,
mannigfache Leibesübungen in den verschiedenen Kreisen unsers
Volkslebens, an welche vielfach dann die T. nur anzuknüpfen
brauchte (vgl. Gymnastik); so einmal als eine Art Nachklang jener
ritterlichen Zeit die Fechtkünste und das Voltigieren (s. d.)
am lebenden oder am nachgebildeten Pferd, wie besonders an
Universitäten und adligen Schulen; ferner die mehr allgemein
als Jugendspiele oder gelegentliche Volksbelustigungen auftretenden
Ballspiele (s. d.), das Ringen (s. d.), Wettlaufen, Klettern u. a.;
endlich besondere Fertigkeiten, wie Schwimmen, Schlittschuhlaufen
und die mancherlei Schießübungen mit Armbrust und
Feuergewehr. Der Leibesausbildung um ihrer selbst willen redeten
zuerst wieder Vertreter der in der Zeit vor der Reformation
erwachenden humanistischen Studien das Wort, die ja auch in dieser
Hinsicht auf das Vorbild des klassischen Altertums hinweisen
konnten; ein Zeugnis solcher Bestrebungen ist das Buch des
italienischen Arztes Hieron. Mercurialis: "De arte gymnastica" (2.
Aufl. 1573). Daß man seitdem besonders um der Erziehung
willen Leibesübungen befürwortete, ihre
Vernachlässigung beklagte, hier und da auch zu einem Versuch
leiblicher Schulung Hand anlegte, dafür sind Aussprüche
und Lehren von Männern wie Luther, Zwingli, Camerarius und
Comenius am bezeichnendsten. Auch von seiten der realistischen
philosophischen Betrachtung kam man wegen der Wirkung des
Sinnlichen auf das Geistige zu der Forderung einer geregelten
Leibeserziehung, wie besonders Locke in seinen "Gedanken über
Erziehung" (1693) als höchstes Ziel der Erziehung den gesunden
Geist im gesunden Körper hinstellte. Mit noch
größerm Nachdruck und weit allgemeinerer Wirkung
besonders auf das deutsche Erziehungswesen erhob dieselbe Forderung
J. J. Rousseau (s. d.) in seinem epochemachenden Erziehungsroman
"Émile" (1762), der ein Ideal naturgemäßer
Erziehung geben sollte gegenüber der unnaturlich
künstelnden Erziehung seiner Zeit. Zum Teil unter dem Eindruck
Rousseauscher Ideen und selbst wieder weitern Kreisen Anregung
gebend, machte in Deutschland Basedow in der 1774 zu Dessau ins
Leben gerufenen, Philanthropin genannten Erziehungsanstalt auch
zuerst den Versuch einer geregelten Leibesausbildung, zu der er den
Stoff teils aus den an den Ritterakademien dauernd in Pflege
erhaltenen Künsten des Tanzens, Fechtens, Reitens und
Pferdspringens, teils auf Anregung seines Gehilfen Joh. Friedr.
Simon der griechischen Gymnastik in den Übungen des Laufens,
Springens u. a., teils aus militärischen Bewegungsformen
entnahm. Von hier übertrug diese Übungen Salzmann in die
von ihm 1784 zu Schnepfenthal gegründete Erziehungsanstalt, in
welcher die Leibesübungen seit 1786 mit größter
Sorgfalt und nachhaltigster Wirkung J. Chr. Guts Muths (s. d.)
leitete, welchem außerdem das große Verdienst
gebührt, in seiner zuerst 1793 erschienenen "Gymnastik
für die Jugend" öffentlich nicht nur als ein begeisterter
Fürsprecher der Leibesübungen aufgetreten zu sein,
sondern auch besonders den von ihm in emsigem Nachforschen und
Prüfen stark erweiterten und geordneten Übungsstoff
weitern Kreisen erschlossen zu haben. Zu gleicher Zeit gab G. U. A.
Vieth in Dessau (1763-1836) in seinem "Versuch einer
Encyklopädie der Leibesübungen" (Tl. 1 u. 2, 1794-95; Tl.
3 mit Nachträgen, 1818) sowohl eine Übersicht der
Leibesübungen vieler Völker aus alter und neuer Zeit als
auch den ersten Versuch einer systematischen Einteilung der
Leibesübungen. Auch Pestalozzi stellte sich seit 1807 in der
Schweiz die Aufgabe, Leibesübungen nach einem der
Bewegungsfähigkeit der Körperteile folgenden
systematischen Plan zu erfinden und zu üben. Der sogen.
Tugendbund (s. d.) machte 1809 den ersten Versuch mit Einrichtung
eines öffentlichen Turnplatzes zu Braunsberg. Während
aber die bisher angegebenen Anregungen nur zu ganz vereinzelter
Einführung der Leibesübungen und meist an geschlossenen
Erziehungsanstalten geführt hatten, war es das Verdienst von
F. L. Jahn (s. d.), mit dem nach Deutschlands tiefer Erniedrigung
in den Napoleonischen Kriegen zumal in Preußen erwachenden
ernsten Streben nach einer Wiedergeburt unsers Volks- und
Staatslebens und unsrer Wehrkraft, wie es sich besonders in Arndts
"Geist der Zeit", in Fichtes "Reden an die deutsche Nation", in
Jahns "Volkstum", in Steins Reformen und in den
Gneisenau-Scharnhorstschen Plänen zur Einführung einer
allgemeinen Wehrpflicht zeigte, den lauten Ruf nach einer
"volkstümlichen" Leibeskunst zu verbinden und mit Einsetzung
seiner ganzen kraftvollen, jugendliche Begeisterung weckenden
Persönlichkeit in Berlin dieser "T." die erste
öffentliche Stätte zu bereiten. Im
944
Turnkunst (Bankanstalten, Unterricht).
Frühjahr 1811 wurde von ihm der Turnplatz in der Hasenheide
bei Berlin eröffnet, von dem aus durch seine Schüler die
Keime einer wirklich jugendfrischen, die Knaben in ihrer Vollkraft
packenden Leibeskunst bald auch nach andern Orten Deutschlands,
insbesondere an die Hochschulen Halle, Jena und Breslau, verpflanzt
wurden. Nachdem das Treiben auf dem Turnplatz natürlich durch
die Unruhe der folgenden Kriegsjahre beschränkt worden, auch
manche der eifrigsten Jünger der Turnsache, wie besonders
Friedr. Friesen (s. d.), im Feld geblieben waren, wurde die Sache
mit erneutem Eifer und größerer Vertiefung und Sichtung
des Übungsstoffes wieder aufgegriffen. Den letztern durch
Einführung von reicher Ausnutzung fähigen Geräten,
wie des Recks und des Barrens, erweitert und über das Gebiet
der einfachen volksüblichen Übungen noch mehr erhoben zu
haben, ist neben seiner Sorge für die sprachliche Bezeichnung
(s. unten) Jahns entscheidendes technisches Verdienst um die T. Die
Ergebnisse dieser Bemühungen sind von ihm in der 1816 mit
seinem Schüler E. Eiselen zusammen herausgegebenen "Deutschen
T." niedergelegt. Die in dieser Zelt im Gegensatz zu der erwarteten
freiheitlichen Gestaltung unsers Staatslebens eintretende Reaktion
glaubte natürlich gegen die mit freiheitlichen und nationalen
Ideen erfüllten, dazu allerdings hier und da auch ungebundenes
und ungeschlachtet, renommistisches Wesen zur Schau tragenden
Jahnschen Turnerscharen besonderes Mißtrauen hegen zu
müssen. Die Schattenseiten des turnerischen Treibens und das
unreife Gebaren von Mitgliedern der mit der Turnerei enge
Fühlung unterhaltenden Burschenschaften auf dem Wartburgsest
(18. Okt. 1817) veranlaßten zunächst die litterarische
Breslauer Turnfehde, die besonders durch Henrich Steffens (s. d.)
und K. A. Menzel auf gegnerischer Seite, auf turnerischer
geführt ward von Franz Passow, Chr. W. Harnisch (s. d.) und
dem Hauptmann W. v. Schmeling, dem Verfasser von "Die Landwehr,
gegründet auf die T." Nach Kotzebues Ermordung durch den
Burschenschafter und Turner Sand (1819) folgte die Schließung
sämtlicher (über 80) preußischen, bald auch der
meisten andern deutschen Turnplätze und Jahns Verhaftung. Nun
wurde zwar auch während dieser Zeit der sogen. Turnsperre an
nicht wenigen Orten fortgeturnt, und namentlich hatte Ernst Eiselen
(s. d.) Verdienste um die dauernde Pflege und innere Weiterbildung
der T., desgleichen Klumpp in Stuttgart, H. F. Maßmann (s.
d.) in München; der eigentliche Lebensnerv war aber der Sache
durch den Ausschluß der Öffentlichkeit und Jahns
erzwungene Fernhaltung unterbunden. Erst der durch Ignaz Lorinsers
(s. d.) Schrift "Zum Schutz der Gesundheit in den Schulen"
hervorgerufene Schulstreit über die körperliche
Schädigung der Jugend durch den Schulunterricht, ferner die
Erweckung des deutschen Nationalgefühls durch die
französischen Rheingrenzgelüste im J. 1840 und der
gleichzeitige Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. brachten
für die Turnsache wieder bessere Zeiten; durch die
Kabinettsorder vom 6. Juni 1842 wurden die Leibesübungen als
ein "notwendiger und unentbehrlicher Bestandteil der
männlichen Erziehung" anerkannt und 1843 Maßmann behufs
Einrichtung des Turnunterrichts im preußischen Staat nach
Berlin berufen. Während jedoch letzterer an die
Überlieferungen des Jahnschen, eine gemeinsame Beteiligung von
jung und alt auf den Turnplätzen voraussehenden, also Schul-
und Vereinsturnen noch nicht scheidenden Turnbetriebs enger
anknüpfte, als es sich mit der Aufgabe einer allgemeinen
Einführung des Turnens an den Schulen vertrug, war
mittlerweile durch Adolf Spieß (s. d.), welcher die Gebiete
der Frei- und Ordnungsübungen erschlossen, den turnerischen
Übungssteff systematisch gegliedert und mit Rücksicht auf
das Schulturnen beider Geschlechter reich entwickelt hatte, der T.
die nötige Ergänzung zu teil geworden, um als
Schulunterrichtsfach allgemein zur Einführung gelangen zu
können.
[Bilduugsanstalten. Unterricht.] Für die weitere
Entwickelung des Schulturnens und die methodische Verarbeitung des
Übungsstoffes war nicht ohne Bedeutung die Gründung von
Turnlehrerbildungsanstalten, wie der zu Dresden (1850) unter dem
auch als fruchtbarer Turnschriftsteller wirkenden Moritz Kloss
(gest. 1881, seitdem unter Bier) und der preußischen
Zentralturnanstalt zu Berlin. Die letztere, die 1851-77 die
Abteilungen für die Ausbildung von Militär- und
Zivilturnlehrern vereinigte, suchte unter Rothsteins (s. d.)
Oberleitung (bis 1863) die auf Lings (s. d.) System beruhende,
sogen. schwedische Gymnastik zur Einführung zu bringen, die
aber von seiten der deutschen T. entschieden und erfolgreich
bekämpft wurde und auch mehr und mehr dem deutschen Turnen
Platz machte, in der Zivilabteilung, die 1877 in eine
selbständige Turnlehrerbildungsanstalt umgewandelt wurde,
unter Karl Eulers (s. d.) Vermittelung. Für Württemberg
besteht eine Turnlehrerbildungsanstalt seit 1862 in Stuttgart unter
Otto Jäger (s. d.), der ein eignes Turnsystem eingeführt
hat, für Baden seit 1869 in Karlsruhe unter Maul (s. d.),
für Bayern in München seit 1872 unter Weber. Auch
für Turnlehrerinnen bieten die meisten der gedachten Anstalten
neuerdings entsprechende Ausbildungsgelegenheit. In einzelnen
kleinern deutschen Staaten werden Turnlehrerausbildungskurse von
Zeit zu Zeit durch geeignete Kräfte abgehalten. - Auch die
Turnlehrerversammlungen, deren seit 1861 an verschiedenen Orten
zehn stattgefunden, haben durch Vorträge, Verhandlungen und
Vorführungen zur Förderung des Turnunterrichts und
Klärung der für ihn geltenden Grundsätze
beigetragen.
Der Turnunterricht ist jetzt in Deutschland an den höhern
Schulen und den Seminaren so gut wie allgemein, wenn auch an vielen
Orten noch in unzulänglicher Form, eingeführt; auch
für die Knabenvolksschulen ist er in den meisten Staaten, in
Preußen seit 1862, in Baden seit 1868, in Sachsen seit 1873,
in Württemberg seit 1883, gesetzlich zur Pflicht gemacht,
läßt aber hier noch vieles, an den Landschulen
vielerorts noch so gut wie alles zu wünschen übrig. Mit
dem Turnunterricht an Mädchenschulen ist man bisher meist nur
in Städten vorgegangen. In der Regel beschränkt sich die
Einführung des Schulturnens auf zwei wöchentliche
Unterrichtsstunden, und selbst diese können wegen Mangels
geeigneter Winterturnräume noch nicht überall das ganze
Jahr hindurch fortgesetzt werden. Schulneubauten in Städten
erhalten jetzt in der Regel eigne Schulturnhallen. Außer dem
Schulturnen werden auch an nicht wenigen Orten noch Turnspiele
gepflegt, besonders seit dem dahin gehenden Erlaß des
preußischen Ministers v. Goßler vom Oktober 1882. Eine
Übersicht über die Entwickelung des Turnunterrichts und
seinen Stand um das Jahr 1870 gibt die "Statistik des Schulturnens
in Deutschland", hrsg. von I. K. Lion (Leipz. 1873); vgl. Pawel,
Kurzer Abriß der Entwickelungsgeschichte des deutschen
Schulturnens (Hof 1885). Vgl. auch Euler und Eckler, Verordnungen
und amtliche Bekanntmachungen, das Turnwesen in
945
Turnkunst (Vereine; das Turnen außerhalb
Deutschlands).
Preußen betreffend (Leipz. 1869); Rud. Lion, Verordnungen
und amtliche Bekanntmachungen, das Turnwesen in Bayern betreffend
(2. Aufl., Hof 1884). - In der preußischen Armee wurde das
Turnen durch die "Instruktion für den Betrieb der Gymnastik
und des Bajonettfechtens bei der Infanterie" von 1860 als den
übrigen Dienstzweigen gleichtrechtigt anerkannt und geregelt.
An die Stelle dieser seit 1871 für das ganze deutsche Heer
maßgebenden Instruktion traten 1876 die "Vorschriften
über das Turnen der Infanterie", die 1886 in veränderter
Form erschienen. Entsprechend traten an die Stelle der "Instruktion
für den Betrieb der Gymnastik bei den Truppen zu Pferde" vom
Jahr 1869 die "Vorschriften über das Turnen der Truppen zu
Pferde" vom Jahr 1878.
[Vereine.] Auch das Vereinsturnwesen hat seit den 40er Jahren
mehr und mehr an Boden gewonnen, am raschesten in Sachsen, am
Mittelrhein und in Württemberg; dasselbe ist auch auf die
Einführung des Jugendturnens wie auf die technische Gestaltung
des Turnbetriebs von großem Einfluß gewesen. Besondere
Anregung für die Vereinsbildung gab, nachdem auch hierin nach
1848 ein Rückschlag eingetreten, der Aufschwung unsers
Nationalgefühls im Jahr 1859; die deutschen Turnfeste zu
Koburg (1860), Berlin (1861) und Leipzig (1863) gaben unter
steigender Beteiligung und Begeisterung dem neuerwachten
turnerischen Leben Ausdruck und neue Anregung. Die Anzahl der
Vereine war von kaum 100, die sich bis 1859 erhalten hatten, bis
1864 auf 1934 mit gegen 200,000 Angehörigen gestiegen. Die
Kriege der nächstfolgenden Zeit wirkten auf die
Vereinsthätigkeit hemmend; doch war, während die
Statistik von 1869 nur noch gegen 1550 Vereine aufwies, deren
Anzahl schon 1876 wieder auf 1789 mit gegen 160,000 Mitgliedern
gestiegen und betrug nach stetigem Wachstum 1889 an etwa 3600 Orten
4300 mit gegen 370,000 Mitgliedern über 14 Jahre, darunter
50,000 Zöglinge. An Turnübungen nahmen teil 190,000 unter
18,600 Vorturnern und zwar auch im Winter aus 3400 Vereinen; eigne
Turnplätze besitzen 512, eigne Turnhallen 238 Vereine. (Vgl.
die "Statistischen Jahrbücher der Turnvereine Deutschlands"
von G. Hirth 1863 u. 1865, das dritte "Statistische Jahrbuch" von
Goetz und Böhme 1871 und "Turnzeitung" 1889, Nr. 27.) Die
große Masse dieser Vereine (zur Zeit 3850) bildet, nachdem
sie von 1860 an durch einen ständigen Ausschuß vertreten
war, seit 1868 die Deutsche Turnerschaft, deren Grundgesetz 1875
neugestaltet, 1883 und 1887 revidiert worden ist. Dieselbe ist in
17 Kreise geteilt: Kreis I umfaßt den Nordosten, II Schlesien
und Südposen, IIIa Pommern, IIIb die Mark, IIIc die Provinz
Sachsen, IV den Norden, V Niederweser und Ems, VI Hannover, VII
Oberweser, VIII Niederrhein und Westfalen, IX Mittelrhein, X
Oberrhein, XI Schwaben, XII Bayern, XIII Thüringen, XIV das
Königreich Sachsen, XV Deutsch-Österreich. Jeder dieser
Kreise ist in sich besonders organisiert, in Gaue gegliedert und
hat an seiner Spitze einen Kreisvertreter. Letztere bilden mit
fünf vom Turntag zu wählenden Mitgliedern den
Ausschuß der Deutschen Turnerschaft. An der Spitze des
letztern stand von 1861 bis 1887 Theodor Georgii (Rechtsanwalt in
Eßlingen, geb. 1826 daselbst u. wohlverdient besonders um das
schwäbische Turnwesen; vgl. seine "Aufsätze und
Gedichte", hrsg. von I. K. Lion, Hof 1885); ihm folgte A. Maul (s.
d.). Geschäftsführer der Deutschen Turnerschaft ist seit
1861 der um die deutsche Turnsache hochverdiente Dr. med. Ferd.
Goetz (geb. 1826 zu Leipzig, praktischer Arzt in Lindenau, seit
1887 Abgeordneter zum deutschen Reichstag; vgl. seine
"Aufsätze und Gedichte", Hof 1885). Aus den Abgeordneten der
Deutschen Turnerschaft (auf je 1500 Turner einer) werden die in der
Regel alle vier Jahre abgehaltenen Turntage gebildet. Die
Turnfestordnung enthält insbesondere die Bestimmungen der
Wettturnordnung (s. d.). Weiteres über die Organisation der
Deutschen Turnerschaft s. Goetz, Handbuch der Deutschen
Turnerschaft (3. Ausg., Hof 1888). Das vierte deutsche Turnfest hat
1872 in Bonn stattgefunden, das fünfte 1880 in Frankfurt, das
sechste 1885 in Dresden, die letztern beiden von 9800, resp. 18,000
Turnern besucht und große Fortschritte in den
vorgeführten Leistungen aufweisend. Das siebente, 1889 in
München abgehaltene war von 21,000 Turnern besucht.
Leibesübungen außerhalb Deutschlands.
Die Wiederbelebung der Gymnastik in der deutschen T. hat auch
den meisten Kulturländern außerhalb Deutschlands zu
geregelter Pflege der Leibesübungen die Anregung und vielfach
auch den Stoff gegeben; insbesondere sind der Aufschwung des
deutschen Vereins- und Schulturnens seit dem Jahr 1859 sowie
Deutschlands Kriegserfolge in den darauf folgenden Jahren, vielfach
auch die Gründung von Turnvereinen durch Deutsche im Ausland
die Veranlassung gewesen, sich in Förderung und Betrieb von
Leibesübungen mehr oder minder eng an das Vorbild des
deutschen Turnens anzuschließen. Schon die Wirksamkeit von
Guts Muths hat im Ausland kaum weniger Nachfolge gefunden als bei
uns. So haben vor allem in Dänemark die Leibesübungen
nach seinem Vorbild durch F. Nachtegall früh Eingang und
seitdem in Schule und Heer, weniger im Vereinsturnen, Verbreitung
gefunden. Schon 1827 wurde hier Turnunterricht für alle
Knabenschulen vorgeschrieben. Auf in Dänemark erhaltenen
Anregungen fußend, hat in Schweden P. H. Ling (s. d.) ein
eignes System der Gymnastik aufgestellt, das bei uns so genannte
schwedische Turnen, aber im Gegensatz zu der aus lebendiger Praxis
herausgewachsenen deutschen T. auf Grund von dürren,
scheinwissenschaftlichen anatomischen und physiologischen
Spekulationen. Dasselbe hat, abgesehen von seiner Verwendung als
Heilgymnastik (s. d.), außer Schweden vorübergehend
durch Rothstein (s. d. und oben) in Preußen Eingang gefunden.
An den Schulen Schwedens, wenigstens den höhern, werden jetzt
die Leibesübungen, und zwar nicht mehr in der vollen
Einseitigkeit des Lingschen Systems, in ausreichenderer Zeit
gepflegt als in Deutschland; auch werden sie hier und in Norwegen
durch Vereine (in Schweden i. J. 1885: 46 mit 2500 Mitgliedern)
betrieben. Am unmittelbarsten ist mit der Entwickelung der
deutschen T. außer den Erziehungsanstalten der deutschen
Ostseeprovinzen Rußlands das Turnwesen Österreichs und
der Schweiz Hand in Hand gegangen. In den deutschen Ländern
Österreichs, vor allen in Siebenbürgen, wurde das Turnen
nach den Befreiungskriegen vereinzelt in Schulen und Vereinen
gepflegt; das Mißtrauen der Behörden wich auch hier nach
1848 allmählich einer wohlwollenden Duldung, bis der
Turnunterricht seit 1869 an allen Knabenvolksschulen, fast
allgemein an den Realanstalten und zumeist an den Gymnasien
gesetzlich eingeführt wurde. Dies war auch hier wesentlich mit
eine Folge großer Verbreitung und rühriger
Thätigkeit der Turnvereine seit 1860. Letztere blieben mit der
deutschen Turnerschaft (als deren XV. Kreis, s. oben) dauernd
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl. XV. Bd.
60
946
Turnkunst (Turngeräte).
in Verbindung und beteiligen sich an ihren Festen. Auch ohne
solche Gemeinsamkeit der Vereinsorganisation hat das Turnwesen der
Schweiz schon durch Wirken von Männern wie Spieß und
Maul (s. d.) enge Fühlung mit dem deutschen behalten. Auch
hier liegen die Keime der spätern Entwickelung, abgesehen von
der Thätigkeit des durch Guts Muths angeregten Offiziers
Phokion Heinrich Clias (Käslin; geb. 1782, gest. 1854),
hauptsächlich im Vereinsturnen, besonders an den Hochschulen
deutschen Stammes, und schon 1832 wurde ein Eidgenössischer
Turnverein gebildet, der in "Sektionen" (1886: 122 mit 6000
Mitgliedern; außerdem noch viele freie Vereine) zerfällt
und seit 1873 alle zwei Jahre (früher alljährlich) das
eidgenössische Turnfest feiert, in dessen Wettkämpfe
schon 1855 auch die in der Schweiz seit langem volkstümlichen
Künste des Schwingens, Ringens (s. d.), Steinstoßens u.
a. mit aufgenommen wurden (vgl. Niggeler, Geschichte des
Eidgenössischen Turnvereins, Bern 1882). Auch das Schulturnen
der Schweiz ist infolge des Wirkens trefflicher Turnlehrer, wie
Iselin, Niggeler, Jenny, dem deutschen entsprechend
fortgeschritten. In einigen größern Städten gehen
neben ihm noch die auf unmittelbare militärische
Jugenderziehung abzielenden sogen. Kadettenkorps her (s.
Jugendwehren); auf dem Land ist es vor allem um der Vorbildung
für das Milizsystem willen nach der "Turnschule für den
militärischen Vorunterricht" zur Einführung gekommen. Aus
der Schweiz wurde die T., und zwar wesentlich auf Grund der
Betriebsweise von Spieß, nach Italien, wo schon vorher Guts
Muthssche Anregungen gefruchtet hatten, verpflanzt durch Rud.
Obermann, der (geb. 1812 zu Zürich, gest. 1869 in Turin) 1833
nach Turin berufen wurde zur Einführung der Gymnastik in das
sardinische Heer, doch auch den Anstoß gab zur Verbreitung
desselben in Schulen und Vereinen, hierbei insbesondere
unterstützt durch den Grafen Ernesto Ricardi di Netro. 1883
gab es 143 zu mehreren Bünden vereinigte Vereine mit 17,000
Mitgliedern. Für die höhern Schulen wurde das Turnen 1861
als freies, für fast alle Schulen 1878 als Pflichtfach
erklärt und kommt allmählich zur Durchführung. Seit
1863 gibt es eine Turnlehrerbildungsanstalt in Turin, seit 1888 in
Rom. In den Gymnasien Griechenlands ist teils gymnastischer, teils
militärischer Unterricht durch Verfügung von 1862 und
Gesetz von 1883 zur Einführung gekommen und in Athen eine
Turnlehrerbildungsanstalt errichtet worden. In Erneuerung der
Olympischen Spiele werden hier auch volkstümliche
Wettkämpfe abgehalten. In Belgien und Holland sind nach
schwachen Anfängen in den 30er Jahren seit 1860 sowohl
zahlreiche Vereine entstanden mit einer der deutschen T. entlehnten
Betriebsweise als auch ein entsprechendes Schulturnen. In Belgien
umfaßte die Fédération belge de gymnastique
1888: 70 Vereine mit etwa 7000 Angehörigen. In Holland gab es
in demselben Jahr 230 Vereine, von denen 120 dem Nederlandsch
Gymnastik Verbond angehörten. Hier sind auch Vereine für
allerlei Sport stark vertreten. Letzterer beherrscht in England
noch so sehr das Feld mit der Pflege von angewandten Fertigkeiten,
wie Rudern, Boxen, und von Ballspielen, daß die allgemeine
Gymnastik hier außer dem Heer, in das sie schon 1822-28 Clias
(s. oben) einführte, und den von Deutschen gegründeten
Vereinen noch nicht viel Boden gewonnen hat. Auch Sport und Spiele
werden fast nur von der wohlhabenden Minderheit gepflegt. In
Frankreich haben sich gymnastische Übungen, besonders durch
die Thätigkeit des von Pestalozzi und Guts Muths angeregten
Spaniers Amoros (1770-1847), in erster Linie in der Armee Eingang
verschafft und sind auch seitdem hauptsächlich als ein
wichtiger Zweig der militärischen Vorbildung in und
außer dem Heer gepflegt worden. Einen noch engern
Anschluß der leiblichen Jugendbildung an das Heerwesen
veranlaßten die Erfuhrungen von 1870/71 in Form der
Schülerbataillone, die aber auch hier mehr und mehr Gegner
finden und einer allgemeinen Gymnastik weichen. Seit 1880 ist der
gymnastische Unterricht an sämtlichen Knabenschulen gesetzlich
zur Pflicht gemacht. Die Militärturnschule zu Joinville le
Pont dient auch zur Ausbildung für Schulturnlehrer. Die von
der deutschen T. eingeführten Geräte, wie Reck und
Barren, sind auch hier in Benutzung. Vereine entstanden in
geringerer Zahl in den 60er Jahren, in größerer seit
1871, so daß im J. 1886 gegen 600 Vereine (mit 20,000
Mitgliedern) bestanden, von denen die Union fédérale
des sociétés de gymnastique de France 171
umfaßte. Die Gründung von Turnvereinen in
überseeischen Ländern ist in der Regel durch Deutsche
erfolgt. Am ausgebreiteten ist das Turnvereinswesen der Vereinigten
Staaten, wohin unter andern Schüler Jahns, wie Franz Lieber
und Karl Follen (s. d.), die T. übertrugen, und wo der
Nordamerikanische Turnerbund 1888 über 250 Vereine mit 30,000
Mitgliedern umfaßte und zeitweise ein Turnlehrerseminar,
zuletzt in Milwaukee unter Brosius, bestand.
Turngeräte. Übungsgebiet.
Während die hellenische Gymnastik (s. d.) zu ihren
Übungen außer dem Diskus, dem Wurfspeer, den Halteren
und Bällen fast kein Gerät brauchte, sehen wir die neuere
Kunst der Leibesübung von vornherein darauf bedacht, für
ihre Übungen, die planmäßig den Leib schulen, nicht
nur im Wettkampf gipfeln und auch in geschlossenen Räumen
betrieben werden sollen, Geräte in ihren Dienst zu nehmen oder
zu erfinden. So wurde das Springen und Schwingen (Voltigieren, s.
d.) am künstlichen Pferd (s. d.) schon von Basedow (im
Anschluß an den Reitunterricht der Zöglinge) und dann
auch von Guts Muths und Jahn aus den Fechtböden und
Reitschulen herübergenommen, Basedow verwendete außerdem
den Schwebebalken (Balancierbalken), einen Springel zur Messung von
Hochsprüngen, Stäbe zum Stangenspringen, Sandsäcke
zur Belastung u. a. Bei Guts Muths finden wir auch Vorrichtungen zu
Weit- und Tiefsprung und ferner vor allem ein Gerüst mit
Mastbaum, Leitern, Strickleitern, Kletterstangen, einen schräg
ansteigenden Querbalken und Seile zum Ziehen, Schwingen und
Springen u. a. Die der vielseitigsten Verwendung fähigen
Geräte Reck und Barren und außerdem den Pfahl zum
Gerwerfen fügte Jahn hinzu. Bei Clias findet sich um dieselbe
Zeit (1816) auch der Triangel (Trapez, Schaukelreck) und ein
Klettertau mit Sprossen in großen Abständen. Bei Eiselen
begegnen uns zuerst der Bock (Springbock), die sogen.
Streckschaukel (die sogen. römischen Ringe), der Rundlauf, das
Sturmlaufbrett, die wagerechte Leiter, die Wippe und die wohl schon
von Jahn eingeführten Hanteln. Den schon von Eiselen benutzten
kurzen Stab (Windestab) verwendete als Eisenstab (Wurfstab)
besonders Jäger. Lion verwendete zuerst den kurzen und den
dreiholmigen Barren und Gerätverbindungen, wie das Kreuzreck,
das Doppelreck (mit zwei Stangen untereinander), den hohen Barren
(mit zwei Stangen nebeneinander). Die Militärgymnastik
führte an Stelle des Recks den Querbaum ein, an
947
Turnkunst (Frei-, Ordnungs-, Gerätübungen; Vereins- u.
Schulturnen etc.).
Stelle des Pferdes den Kasten (s. Tisch), der seit 1881 wieder
abgeschafft ist, und die Hindernisbahn mit dem
Eskaladiergerüst. Über den seit Jahn vielfach
vervollkommten Bau der Turngeräte und die Einrichtung von
Turnräumen vgl. Lion, Werkzeichnungen von Turngeräten (3.
Aufl., Hof 1883); Euler und Kluge, Turngeräte und
Turneinrichtungen (Berl. 1872); W. Angerstein, Anleitung zur
Einrichtung von Turnanstalten (das. 1863).
Das Übungsgebiet der T. umfaßt Übungen ohne
Geräte und Übungen mit oder an solchen. Die erstern
beschränken sich aus die Ausnutzung der
Bewegungsfähigkeit des Leibes in sich oder mit andern, im
erstern Fall als sogen. Freiübungen (s. d.) die einfachen oder
miteinander verbundenen Gliederbewegungen im Stehen, Gehen, Laufen,
Hüpfen und Springen umfassend, im letztern Fall
Ordnungsübungen (s. d.) genannt, welche die Aufstellungen,
Gliederungen und Bewegungen einer Mehrzahl von Übenden lehren
und sich mit den militärischen (taktischen) Formen des
Exerzierens oder denen des Tanzes berühren. Beide,
insbesondere die letztern, können ihres rhythmischen Gehalts
wegen mit Gesang oder Musikbegleitung in Verbindung treten. Hier
reihen sich dann die Bewegungsspiele an, welche die T. mit in ihren
Bereich gezogen hat (vgl. Spiel), ferner das Ringen (s. d.) und
Boxen und auch die Turnfahrten genannten Dauermärsche. Die
Gerätübungen sind einmal solche, bei denen das Gerät
selbst bewegt wird, also die Übungen mit Hanteln (s. d.),
Stäben (s. Stabübungen), Keulen (s. d.) u. dgl., das
Ziehen und Schieben, das Werfen von Kugeln, Steinen, Stangen
(Gerwerfen), Scheiben (vgl. Diskos) und Bällen, endlich
verschiedene Arten des Fechtens. Die andern Gerätübungen
gliedern sich nach der Art der an ihnen vollzogenen
Leibesbewegungen in die sogen. Turnarten des Schwebens auf
beschränkter (Schwebepfähle, Schwebebaum, Kante) oder
beweglicher Unterlage (z. B. Stelzen, Schaukeldiele), des Springens
(Springbrett, Schwungbrett, Sturmspringel, Springen im Reifen und
im Seil), des Stützens auf den obern Gliedern (besonders am
Barren, Reck und Pferd), des Hangens (Leiter, Ringe, Rundlauf,
Reck). Aus abwechselndem Hangen der obern und Stemmen der untern
Glieder bildet sich das Klettern (Kletterstange, -Mast und -Seil);
das mit vorübergehendem Stützen verbundene Springen
ergibt die Übungen des gemischten Sprunges (besonders am Bock,
Pferd, Tisch, doch auch am Reck und Barren, dazu auch das
Stangenspringen). Die Verbindung von Hangen und Stützen
erlaubt am ausgiebigsten das Reck (vgl. Schaukelgeräte).
Daß das reiche Gebiet der Turnübungen auch eine
angemessene sprachliche Bezeichnung gefunden hat, ist wesentlich
das Verdienst F. L. Jahns, den sowohl in Aufnahme von im Volksmund
üblichen Worten für Übungen und Geräte als in
freier Gestaltung von neuen Bezeichnungen ein sicherer Blick
geleitet hat. Neuerdings hat sich um die Turnsprache besonders
Waßmannsdorff (s. d.) Verdienste erworben. - Die
Übungsauswahl und Betriebsweise richten sich natürlich
sowohl nach dem Zweck, der die Übenden auf den Turnplatz
geführt hat, als nach dem Alter und Geschlecht derselben.
Daher beim Turnen der Soldaten außer den Rücksichten auf
die besondere Verwendung der einzelnen Waffengattungen
(Übungen der Hindernisbahn) eine beschränktere Auswahl
von den der großen Masse erreichbaren Übungen in der
straffen Übungsform militärischer Disziplin; beim
Vereinsturnen, der freiwilligen Beteiligung und der Vereinigung der
verschiedensten Altersklasen entsprechend, ein Zurücktreten
der lehrhaften Form, größerer Einfluß der
Bewegungs- und Leistungslust auf Auswahl und Ausführung der
Übungen, also eine Bevorzugung des Kunstturnens an
Geräten; dabei größere Freiheit sowohl für das
Vortreten von Stammeseigentümlichkeiten als für
individuelle Ausbildung. Das Schulturnen zeigt je nach der Art der
Schule und dem Alter und der Menge der Übenden bald eine mehr
spielartige Form des Betriebs, bald eine Annäherung an die
straffe militärische Drillung, wie besonders in der Form der
Gemeinübungen mit und ohne Geräte, oder auch an die
freiere Betriebsart der Vereine in Riegen unter Schülern als
Vorturnern. Doch weicht die letztere Form wegen der für sie zu
oft mangelnden Vorbedingungen mehr und mehr dem Turnen der
geschlossenen Schulklassen unter einzelnen Lehrern. Speziell das
Mädchenturnen bevorzugt unter Beschränkung der
Übungen an Geräten die tanzähnlichen Hüpfarten
und reigenartigen Ordnungsübungen. (Über Zimmergymnastik
und Heilgymnastik s. d.) In allen diesen Betriebsformen hat das
frühere meist Übungen verschiedenster Art regellos
durcheinander werfende Verfahren in den letzten Jahrzehnten mehr
und mehr dem auf der systematischen Gliederung des Turnstoffs
fußenden, Gleichartiges zusammenstellenden, schwierigere
Übungen stufenweise aus ihren Elementen entwickelnden sogen.
Schuleturnen, bez. Gruppenturnen Platz gemacht.
[Litteratur.] Aus der schon stark angewachsenen Litteratur des
Turnwesens sind außer den oben und in den betreffenden
Artikeln aufgeführten Werken von Spieß,
Waßmannsdorff, Jäger, Lion, Euler und Maul noch zu
erwähnen: a) Allgemeines: G. Hirth, Das gesamte Turnwesen
(Leipz. 1865, eine Sammlung von 133 Aufsätzen verschiedener
Verfasser mit geschichtlicher Einleitung); F. A. Lange, Die
Leibesübungen (Gotha 1863); Ed. Angerstein, Theoretisches
Handbuch für Turner (Halle 1870); b) für die
Übungslehre: A. Ravenstein, Volksturnbuch (3. Aufl., Frankf.
1876); Kloss, Katechismus der T. (6. Aufl., Leipz. 1887); Puritz,
Merkbüchlein für Vorturner (8. Aufl., Hannov. 1887; auch
ins Französische, Englische und Holländische
übersetzt); Derselbe, Handbüchlein turnerischer
Ordnungs-, Frei-, Hantel- und Stabübungen (2. Aufl., Hof
1887); c) für das Schulturnen: Niggeler, Turnschule für
Knaben und Mädchen (2 Tle.; 8. u. 5. Aufl., Zürich 1888
und 1877); Kloss, Die weibliche T. (4. Aufl., Leipz. 1889); F.
Marx, Leitfaden für den Turnunterricht in Volksschulen (4.
Aufl., Bensh. 1886); Derselbe, Das Mädchenturnen in der Schule
(das. 1889); Hausmann, Das Turnen in der Volksschule (4. Aufl.,
Weim. 1882); Stöckl, Das Schulturnen (Graz 1885); Schettler,
Der Turnunterricht in gemischten Volksschulklassen (Hof 1881);
Schurig, Hilfsbuch für das Gerätturnen in der Volksschule
(das. 1883); Schettler, Turnschule für Mädchen (2 Tle.;
6. u. 5. Aufl., Plauen 1887); d) Geschichtliches: Iselin,
Geschichte der Leibesübungen (Leipz. 1886); Brendicke,
Grundriß zur Geschichte der Leibesübungen (Köthen
1882); e) Verschiedenes: Kohlrausch, Physik des Turnens (Hof 1881);
Bach und Fleischmann, Wanderungen, Turnfahrten und
Schülerreisen (2. Aufl., Leipz. 1885-87, 2 Tle.); f)
Zeitschriften: "Deutsche Turnzeitung" (Leipz., seit 1856, Organ der
deutschen Turnerschaft); "Jahrbücher verdeutschen T." (hrsg.
von Kloss, Dresd., seit 1855; neue Folge hrsg. von Bier, Leipz.,
seit 1882); "Monatsschrift für das Turnwesen" (hrsg. von
Euler
60*
948
Turn-out - Turretin.
und Eckler, Berl., seit 1883); g) Literaturnachweis: Lentz,
Zusammenstellung von Schriften über Leibesübungen (4.
Aufl., das. 1881); "Bücherverzeichnis des Archivs der
deutschen Turnerschaft" (2. Aufl., Leipz. 1885); Brendicke,
Verzeichnis einer Turnvereinsbibliothek (Eisl. 1885).
Turn-out (engl., spr. törn-aut, "Ausrücken,
Herausgehen"), in England die Einstellung der Arbeit durch
Fabrikarbeiter in Masse.
Turnpike (engl., spr. törnpeik), Drehkreuz, in
England an Straßen bei Mauthäusern angebracht zum Zweck
der Erhebung des Wegegeldes, daher Turnpike-roads, Straßen
mit solchen Drehkreuzen.
Turnu-Magurele, Hauptstadt des rumän. Kreises
Teleorman (Walachei), am Einfluß der Aluta in die Donau,
gegenüber dem bulgarischen Nikopoli, mit lebhaftem Hafen
für Getreideausfuhr und 5780 Einw.; nach einigen
römischen Ursprungs. Hier 1598 Schlacht zwischen Michael dem
Tapfern und den Türken, 1853 zwischen Türken und
Russen.
Turnus (neulat.), die wiederkehrende Reihenfolge
irgendwelcher Verrichtungen, zu denen verschiedene Personen
berechtigt oder verpflichtet sind.
Turnu-Severin, Hauptstadt des Kreises Mehedintzi in der
Walachei, bedeutender Donauhafen und Station der Eisenbahn Chitila-
(Bukarest-) Verciorova, ist Sitz des Präfekten und eines
Tribunals und hat 9 Kirchen, eine Gewerbeschule, 8000 Einw. (meist
Fremde, darunter viele Deutsche), welche einen lebhaften
Handelsverkehr (namentlich mit Wolle und Fellen) sowie die
Getreideausfuhr nach Österreich und Deutschland vermitteln.
Hier hat die Donaudampfschiffahrtsgesellschaft eine Agentur, eine
ansehnliche Schiffswerfte, Maschinenbauwerkstätte (300
Arbeiter) und ein Hospital. Dabei die Pfeilerüberreste der von
Kaiser Trajan 104-106 n. Chr. erbauten steinernen Donaubrücke
sowie die Ruinen einer vom Kaiser Alexander Severus erbauten Burg,
von welcher die Stadt ihren Namen hat.
Turócz (spr. tuhroz), ungar. Komitat am linken
Donauufer, von den Komitaten Trentschin, Árva, Liptau, Sohl,
Bars und Neutra begrenzt, 1150 qkm (20,9 QM.) groß, bildet
eine ringsum von Karpathenzweigen umgebene, wellenförmige,
flache und fruchtbare Ebene. Im NO. erhebt sich das bewaldete
Fátragebirge. Den nördlichen Teil durchströmt die
Waag, in die sich der Fluß T. ergießt. Hauptprodukte
sind: Kartoffeln, Hafer, Heidekorn, Flachs, Hanf u. Holz; Getreide
wird wenig gewonnen. Die üppigen Wiesen und Triften
begünstigen die Viehzucht (besonders Schafzucht). Unter den
Mineralquellen verdienen die Thermen in Stuben Erwähnung. Die
Einwohner, (1881) 45,933 an der Zahl, sind meist Slawen, teils
katholisch, teils evangelisch. Das Komitat wird von der
Kaschau-Oderberger Bahn durchschnitten, an welche sich bei Ruttka
die Ungarische Staatsbahn anschließt. Sitz des Komitats ist
T.-Szent-Márton, Station der Ungarischen Staatsbahn, mit
Untergymnasium, Handelsschule, Bezirksgericht und (1881) 2341
Einw.
Turon, s. Kreideformation, S. 183.
Turopolje (ungar. Túrmezö), privilegierter
Distrikt im kroatisch- slawon. Komitat Agram, südlich von
Agram, mit 24 Ortschaften, deren Einwohner vom König Bela IV.
geadelt wurden und besondere Vorrechte erhielten. In letzter Zeit
hatte T. nur noch das Recht der selbständigen Verwaltung und
war in der Komitatskongregation durch einem Comes (Zupan)
vertreten. Hauptort ist Gorica velika, Dorf an der Bahnlinie
Agram-Sissek, mit 672 Einw. und Bezirksgericht.
Turpethum minerale, s. v. w. basisch schwefelsaures
Quecksilberoxyd.
Turpin, Johann, Benediktinermönch im Kloster
St.-Denis, ward 753 Erzbischof von Reims, befand sich 769 auf dem
zu Rom wegen der Bilderverehrung abgehaltenen Konzil und starb 800.
Die Angabe, daß T. Karls d. Gr. Geheimschreiber, Freund und
Waffengefährte gewesen sei, gehört ins Gebiet der Sage.
Die unter Turpins Namen vorhandene lateinische Chronik über
Karls Zug nach Spanien, die seit 1160 in einer lateinischen
Handschrift im Kloster St.-Denis aufbewahrt wird und Anfang des 12.
Jahrh. auf Befehl des damaligen Erzbischofs Guido von Vienne, des
spätern Papstes Calixt II., der eine 1050 in Compostela
verfaßte Schrift aus Spanien mitgebracht hatte, auf Grund
derselben verfaßt worden ist, enthält Lieder und Sagen
aus dem karolingischen Sagenkreis, doch in kirchlichem Interesse
und legendenartig umgestaltet. Die besten Ausgaben lieferten Ciampi
(Flor. 1822) und Reiffenberg (in der "Chronique de Philippe
Mouskes", Brüssel 1836, 2 Bde.); ins Deutsche übersetzte
sie Hufnagel (im "Rheinischen Taschenbuch" 1822). Vgl. Gaston
Paris, De Pseudo-Turpino (Par. 1865).
Turpithwurzel, s. Ipomoea.
Türr, Stephan, ungar. Patriot, geb. 10. Aug. 1825 zu
Baja, trat als Leutnant in ein ungarisches Grenadierregiment,
welches 1848 in Italien focht, ging im Januar 1849 zu den
Piemontesen über und organisierte eine ungarische Legion,
focht nach der Schlacht bei Novara auf seiten der Insurgenten in
Baden, trat 1854 in englische Dienste, ward 1855 auf einer Reise
behufs Ankaufs von Pferden in Pest verhaftet, aber wieder
entlassen, kämpfte 1859 als Hauptmann der Alpenjäger
unter Garibaldi gegen die Österreicher, 1860 in Sizilien und
Neapel und erlangte den Rang eines Divisionsgenerals, nachdem er
als Gouverneur von Neapel viel zu dessen Vereinigung mit Italien
beigetragen. 1866 bereitete er eine Insurrektion in Ungarn von
Serbien aus vor. 1867 kehrte er nach Ungarn zurück, wo er, mit
Entwürfen von Kanalbauten und industriellen Unternehmungen
beschäftigt, lebt. Mitunter nahm er als vertrauter
Unterhändler zwischen Österreich, Italien und Frankreich
(so bei den Verhandlungen über ein Bündnis 1869-70) noch
an der Politik teil; seit 1881 leitet er den Bau des Kanals
über den Isthmus von Korinth. Vgl. Schwarz, Stephan T. (Wien
1868, 2 Bde.).
Turretin (Turretin), ein Genfer Theologengeschlecht,
abstammend von dem 1579 in die Schweiz eingewanderten Franz T. aus
Lucca. Sein Sohn Benedikt T., geb.1588 zu Zürich, ward in Genf
1612 Pfarrer und 1618 Professor der Theologie; er starb 1631.
Dessen Sohn Franz T., geb. 1623, bekleidete eine gleiche Stelle bis
1653 und starb 1687, nachdem er sich an der Herstellung des
Consensus helveticus (s. d.) beteiligt hatte, welcher dann 1706 auf
Bestreben seines Sohns wieder abgeschafft wurde. Dieser, Johann
Alfons T., geb. 1671, gebildet in Holland, England und Frankreich,
trat 1693 in geistlichen Dienst und lehrte seit 1697
Kirchengeschichte, daneben seit 1705 auch Dogmatik und übte
bis zu seinem 1. Mai 1737 erfolgten Tod einen großen und
wohlthuenden, durchaus ermäßigenden und auf Herstellung
der Union mit den Lutheranern gerichteten Einfluß auf die
reformierte Kirche in und außerhalb der Schweiz. Ebenso
erfreuten sich seiner Zeit seine dogmatischen und
kirchenpolitischen, exegetischen und kirchenhistorischen Werke
eines begründeten Ansehens. Vgl. die biographischen Schriften
von Budé über
949
Turris ambulatoria -- Tussilago.
Benedikt T. (Genf 1871), Franz T. (Laus. 1871) und Joh. Alfons
T. (das. 1880).
Turris ambulatoria, s. Wandelturm.
Türschmann, Richard, Recitator, geb. 26. Mai 1834 zu
Penig in Sachsen, besuchte die Thomasschule und die
Universität in Leipzig, ging dann zur Bühne und fand,
nachdem er an verschiedenen Orten aufgetreten war, am Hoftheater zu
Braunschweig als erster Charakterdarsteller Anstellung. Infolge
fast gänzlicher Erblindung warf er sich dann auf die Kunst der
dramatischen Recitation, die er seit 1872 mit großem und
verdientem Erfolg ausübte. Sein Repertoire umfaßt die
Meisterwerke Sophokles', Shakespeares, Goethes, Lessings etc., die
er alle frei aus dem Gedächtnis vorträgt. Seinen Wohnsitz
hat T. gegenwärtig in Blasewitz bei Dresden.
Tursellinus, s. Torsellino.
Tursi, Stadt in der ital. Provinz Potenza, Kreis
Lagonegro, Bischofsitz, mit Kathedrale, Baumwollbau und (1881) 3174
Einw.; wurde im 9. Jahrh. von den Arabern erbaut.
Turteltaube, s. Tauben, S. 535.
Turtle (engl., spr. törtl), Schildkröte;
Turteltaube.
Turtmanthal, linksseitiges Nebenthal des Rhône in
der Schweiz. Der Thalbach, als Abfluß des vom Weißhorn
herabsteigenden Turtmangletschers (s. Matterhorn),
durchfließt ein hohes, einsames Alpenthal und erreicht den
Rhône mit einem 24 m hohen Fall bei dem an der Bahnlinie
Bouveret-Brieg liegenden Orte Turtman (Tourtemagne).
Turtur (lat.), Turteltaube.
Turuchansk, Stadt im sibir. Gouvernement Jenisseisk, nahe
dem Polarkreis, an der Grenze, wo die Jagd- und Fischervölker
Ostjaken, Samojeden und Tungusen aneinanderstoßen, hat
hölzerne Befestigungen und (1886) 157 Einw., welche Pelzhandel
betreiben.
Turzovka, Dorf im ungar. Komitat Trencsin, an der
Kisucza, mit (1881) 6952 slawon. Einwohnern.
Tuscaloosa (spr. -lusa), Stadt im nordamerikan. Staat
Alabama, am schiffbaren Black Warrior River, ist Sitz der 1831
gegründeten Universität von Alabama und der
Staatsirrenanstalt und hat (1880) 2468 Einw. Bis 1847 war T.
Hauptstadt des Staats.
Tuscaróra, nordamerikan. Indianerstamm vom Volk
der Irokesen, früher am Tar und der Neuse in Nordcarolina
ansässig, wurde 1711 in einen Krieg mit den Kolonisten
verwickelt und zog sich infolge dessen ins Innere des Staats New
York zurück, wo die Reste des Stammes (1883: 434 Seelen) eine
Reservation bewohnen.
Tuscarora-Expedition, s. Maritime wissenschaftliche
Expeditionen, S. 257.
Tusch, das weder an Rhythmus noch Melodie gebundene, aber
innerhalb eines und desselben Akkords vor sich gehende
Durcheinanderblasen der Trompeter und Harmoniemusiker bei Toasten
etc. Burschikos (Touche) s. v. w. Beleidigung.
Tusche, Farben zum Kolorieren von Zeichnungen, stimmen in
den bessern Sorten mit den Ackermannschen und Le
France-Aquarellfarben überein, werden aber auch von sehr viel
geringerer Qualität dargestellt. Die Farbkörper werden
wenigstens für die bessern Sorten ebenso angerieben wie
für die Aquarellfarben und zwar mit einem in Wasser nicht zu
schwer löslichen Bindemittel (Leim, Gummi arabikum, Tragant,
auch wohl etwas Zucker), dann zum steifen Teia eingetrocknet,
geformt, gepreßt und völlig getrocknet. Für jede
einzelne Farbe ist Quantität und Beschaffenheit des
Bindemittels durch besondere Versuche zu ermitteln. Die chinesische
T. (chinesische Tinte), eine schwarze Wasserfarbe, wird in China
aus sehr sorgfältig bereitetem Ruß hergestellt, den man
aus vorher möglichst entharztem Nadelholz gewinnt und mit 1/10
Ruß aus Sesamöl, auch mit etwas Kampferruß
vermischt, mit tierischem Leim bindet und mit Moschus und Kampfer
parfümiert. Die im Handel vorkommenden Täfelchen sind mit
oft vergoldeten Handelszeichen versehen. Die T. soll um so besser
sein, je tiefer sie in Wasser einsinkt; am meisten schätzt man
solche, welche auf Papier mit zimtfarbenem Schimmer
glänzt.
Tuschen (Tuschmanier, franz. Dessin au lavis),
Mittelglied zwischen Zeichnen und Malen, besteht in dem Eintragen
der Schatten in eine bloß in den Umrissen angelegte Zeichnung
durch allmähliches Überarbeiten mit immer dunklern
Farben. Gewöhnlich werden Tuscharbeiten einfarbig
ausgeführt, meist schwarz mit chinesischer Tusche, oft auch
braun mit Sepia, hin und wieder aber auch bunt. Bei einer
getuschten Zeichnung ist hauptsächlich Gewicht auf zarte,
genaue Umrisse, weichen, saftigen Schatten, recht rein gehaltene
Lichter und markige Drucker in den dunkelsten Stellen zu legen. Die
Tuschzeichnung ist gegenwärtig durch die vielseitigere
Aquarellmalerei in den Hintergrund gedrängt worden. Vgl. auch
Schattierung.
Tusculum, im Altertum Stadt in Latium, im Albanergebirge
gelegen, schloß sich nach der Niederlage der Tarquinier am
See Regillus um 496 an die Römer an und erhielt 379
römisches Bürgerrecht. Am Latinerkrieg (340-338)
beteiligte sich T. gegen Rom, wurde aber nach seiner Besiegung mild
behandelt. In der Umgegend lagen seit der letzten Zeit der Republik
die Villen vornehmer Römer, z. B. des Lucullus, Jul.
Cäsar, Hortensius, Cato, Marius und namentlich Ciceros
berühmtes Tusculanum. Im Mittelalter geriet T. mit Rom in
heftige Feindschaft, indem es auf seiten der Kaiser stand. Als aber
1191 Papst Cölestin III. und Kaiser Heinrich VI. Frieden
schlossen, zerstörten die Römer die Stadt. Ihre
Trümmer (Amphitheater, Theater, Burg) liegen östlich
oberhalb Frascati. Vgl. Canini, Descrizione del antico T. (Rom
1841).
Tuscumbia, Stadt im nordamerikan. Staat Alabama, unfern
des Tennesseeflusses, mit (1880) 1369 Einw.; hier 13. Dez. 1864
Sieg der Unionsarmee über die Konföderierten.
Tuskar, Inselchen mit Leuchtturm im St. Georgskanal an
der Südostspitze von Irland, 10 km vom Carnsore Point.
Tusker (Tusci), die alten Bewohner Etruriens (s. d.);
daher Tuscia, s. v. w. Etrurien; Tuskisches Meer (Mare Tuscum), s.
v. w. Tyrrhenisches Meer.
Tuslü (Tusly), Salzsee im russ. Gouvernement
Taurien, Kreis Eupatoria, hat 15 km im Umfang, trocknet im Sommer
fast ganz aus und wird zu Salzgewinnung und Schlammbädern
benutzt.
Tusnád, Badeort im ungar. Komitat Csik
(Siebenbürgen), 656 m hoch, in einer Bergschlucht am
Altfluß, mit alkalisch-muriatischen Eisensäuerlingen. In
der Nähe der schieferhaltige Berg Büdös (Torjaer
Stinkberg) und der St. Annensee.
Tussackgras, s. Festuca.
Tussilago Tourn. (Huflattich), Gattung aus der Familie
der Kompositen, mit der einzigen Art T. Farfara L. (Brust-,
Eselslattich, Roßhuf, Quirinkraut), einer ausdauernden
Pflanze mit tief gehendem, kriechendem Wurzelstock,
grundständigen, langgestielten, herzförmigen, eckigen,
unten dicht- und weißfilzigen Blättern und einzeln
end-
950
Tussis - Tuzla.
ständigen, gelben, vor den Blättern sich entwickelnden
Blüten, wächst auf feuchten, thonigen Feldern in Europa
und dem gemäßigten Asien, auf Äckern ein schwer
auszurottendes Unkraut. Offizinell sind die geruchlosen
Blätter als bitterschleimiges und adstringierendes Mittel. T.
Petasites, s. Petasites.
Tussis (lat.), Husten.
Tussoo (Tössuh), ind. Längenmaß, = 1/16
Hath = 1/32 engl. Yard = 0,029 m.
Tutamen (lat.), Schutzmittel. Tutauiablech, s.
Britanniametall.
Tute, s. Blatttute. Tutel (lat.), s. Vormundschaft.
Tutela, bei den Römern Schutzgöttin eines Ortes
oder einer Person.
Tuten, in der Probierkunst benutzte Schmelztiegel mit
Fuß.
Tutenag, ordinäres chines. Neusilber.
Tutenmergel, s. Nagelkalk.
Tuthmofis, Name mehrerer ägypt. Könige, von
denen T. III. (1625-1565 v. Chr.) nach der Vertreibung der Hyksos
zahlreiche Feldzüge nach Syrien unternahm und die Küste
wie das Bergland bis Damaskus und Hamat unterjochte; ebenso
unterwarf er das untere Nubien; seine Siege verherrlichte er durch
Inschriften auf feinen prachtvollen Bauten in Theben und
anderwärts.
Tutikorin (Tutukudi), Hafenstadt an der
Südostküste der indobrit. Präsidentschaft Madras, am
Golf von Manaar, Endstation der Südindischen Eisenbahn, mit
katholischer Mission, einem Nonnenkloster und (1881) 16,281 Einw.
(ein Drittel Katholiken), welche bedeutenden Handel und
Perlenfischerei betreiben. T. ist Sitz eines deutschen
Konsulats.
Tutiliina , röm. Gött.n des
Getreideeinfahrens.
Tutor (lat.), Vormund, s. Vormundschaft. In England ist
T. (spr.tjuhter) Titel für gewisse Universitätslehrer,
und zwar unterscheidet man College tutors und Private tutors ; die
erstern, angestellte Professoren, fungieren in den einzelnen
Colleges als Aufseher und Studienleiter, während die letztern,
als Fellows (s.d.) der Universität attachiert, zu den
Studenten im Verhältnis bezahlter Privatlehrer stehen.
Tutowa, rumän. Kreis in der Moldau, mit der
Hauptstadt Berlad.
Tutti Frutti (ital."alle Früchte"), Gericht, aus
verschiedenen Gemüsen oder Früchten zusammengesetzt,
Allerlei (auch als Büchertitel gebraucht, z. B. von Fürst
Pückler).
Tutilingen, Oberamtsstadt im württembergischen
Schwarzwaldkreis, an der Donau, unweit der badischen Grenze,
Knotenpunkt der Linien Rottweil-Immendingen und T.-Sigmaringen der
Württembergischen Staatsbahn, 643 m ü. M., hat eine
evangelische und eine kath. Kirche, eine Kinderrettungs- und
Erziehungsanstalt, ein Denkmal des Dichters Schneckenburg er, ein
Amtsgericht, ein Kameralamt, ein neues Schlachthaus, bedeutende
Schuhfabrikation, Fabriken für chirurgische Instrumente,
Messer, Leder und Wollwaren, Bierbrauerei, einen Wollmarkt,
lebhaften Getreidehandel u. (1885) 8659 meist evang. Einwohner. In
der Nähe das königliche Eisenhammerwerk Luwigsthal.
Über der Stadt auf einem Berg liegen die schönen Ruinen
des Schlosses Honberg, das im
Krieg zerstört wurde. Südöstlich davon, meist auf
badischem Gebiet, die Tuttlinger Höhe (864 m) mit herrlicher
Aussicht nach den Alpen. Die Stadt T. stammt wohl schon aus der
Römerzeit; sie gehörte dann zur Grafschaft Baar und kam
im 15. Jahrh. an Württemberg. Hier 24. Nov. 1643 Sieg der
Österreicher und Bayern unter Johann v. Werth, Hatzfeld und
Mercy über die Franzosen unter dem Grafen Rantzau.
Tutto (ital.), ganz; Tutta la forza, musikal.
Vortragsbezeichnung, s. v. w. mit ganzer Kraft; Tutti, s.v.w. alle,
womit im Gegensatz zu Solo (s. d.) der Einsatz des Orchesters oder
Chors angezeigt wird.
Tutuila, eine der Samoainseln (s. d., S. 260).
Tütz, Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Marienwerder, Kreis Deutsch-Krone, zwischen drei Seen, hat eine
evangelische und eine kath. Kirche, ein Schloß und (1885)
2045 Einw.
Tutzing, Dorf im bayr. Regierungsbezirk Oberbayern,
Bezirksamt München II, am Starnberger See, Knotenpunkt der
Linien München -Peißenberg und T.-Penzberg der
Bayrischen Staatsbahn, ein beliebter Sommeraufenthalt der
Münchener, hat eine kath. Kirche, ein Schloß,
schöne Villen, Bierbrauerei und (1885) 800 Einw.
Tuwumba (engl. Toowoomba), Stadt in der britisch-austral.
Kolonie Queensland, Grafschaft Aubigny, an der Eisenbahnlinie
Brisbane-Roma, das Zentrum des reichen Weidedistrikts der Darling
Downs, mit Hospital, 5 Bankfilialen und (1881) 6270 Einw., darunter
über 1000 Deutsche, die hier 2 Kirchen und 2 Schulen
haben.
Tüxpam, Seehafen im mexikan. Staat Veracruz, an der
Mündung des gleichnamigen Flusses, hat ein Hospital, ein
Gefängnis und (1880) 5979 Einw. im Munizipium. In der
Nähe (bei Chapopote) ist eine Petroleumquelle. Ausfuhr
1883-84: 401,892 Pesos, bestehend aus Honig, Rohfellen, Kautschuk,
Ze-dernholz, Gelbholz, Sassaparille etc.
Tuxtla, thätiger Vulkan an der Küste von
Mexiko, südlich von Veracruz, 1560 m hoch.
Tuxtla Gutierrez, Stadt im mexikan. Staat Chiapas, am Rio
Mescalapa, 50 km westlich von San Cristobal, hat Kakao- und
Tabakshandel und (1880) 6963 Einw.
Tuy, Bezirksstadt und Festung in der span. Pro-vinz
Ponteveora, am Minho und an der Eisenbahn von Monforte nach Vigo,
gegenüber der portugiesischen Festung Valenca gelegen, mit
Leinwandfabriken, Bereitung von Konfitüren, starkem Obstbau,
Ausfuhr von Rindvieh und (1878) 11,710 Einw. T. ist ein Hauptsitz
des Schleichhandels nach Portugal. Es ist seit dem 6. Jahrh.
Bischofsitz. In der Nähe warme Schwefelquellen.
Tuzla (Unter-T., Doljnja-T.), Kreisstadt in Bosnien, an
beiden Ufern der Ialta, Station der Bahnlinie Doboj-T.-Siminhan,
Sitz eines griechischoriental. Bischofs, eines
Militär-Platzkommandos und eines Bezirksgerichts, hat 3
Brücken, zahlreiche Mo-
scheen, ein Nonnenkloster, (1885) 7189 Einw. (5171
Mohammedaner), lebhaften Handel, besonders mit Vieh und Pferden,
eine Volks- und Handelsschule, ein Spital, einen Park, reiche
Kohlenlager und berühmte Salzquellen, von welch letztern T.
seinen Namen hat (Tuz = Salz). Bei T., dessen Umgebung reich an
Bogumilengräbern ist, und das 1225 Hauptstadt der Provinz Soli
war, 1693 Sieg des kaiserlichen Feldherrn Percinlija über die
Türken und 9.bis 10. Aug. 1878 Gefechte zwischen
österreichischen
Truppen und den Insurgenten.
Twain - Twer.
951
Twain (spr. twähn), Mark, Pseudon., s. Clemens 2).
Twalch, s. v. w. Taumellolch, s. Lolium.
Twardowski, in der poln. Volkssage ein Edelmann im 16.
Jahrh., der, um sich übernatürliche Kenntnisse und
Genüsse zu verschaffen, sich auf dem Berge Krzemionki bei
Krakau dem Teufel verschrieb und eine Menge lustiger Abenteuer
bestand. Als ihn schließlich der Teufel durch die Luft
davonführte, rettete sich T. zwar durch Anstimmen eines
geistlichen Liedes, muß aber bis zum jüngsten Tag
zwischen Himmel und Erde in der Luft schweben. Das Ganze ist die
polnische Version der Faustsage und wurde von polnischen Dichtern
(z. B. von Kraszewski) vielfach bearbeitet. Vgl. Vogl, T., der
polnische Faust (Wien 1861).
Tweed (spr. twihd), Fluß im südöstlichen
Schottland, bildet in seinem untern Lauf die Grenze zwischen
Schottland und England und fällt bei Berwick nach einem Laufe
von 154 km in die Nordsee.
Tweed (spr. twihd), William Mercy, amerikan. Politiker,
geb. 3. April 1823 zu New York, ward Handwerker, wandte sich bald
den öffentlichen Angelegenheiten zu, wurde 1852 zum Alderman
von New York und 1853 in den Kongreß gewählt, dem er bis
1855 angehörte. Er verwaltete darauf die städtischen
Ämter eines Supervisors, eines Schulkommissars und eines
Kommissars für die Straßen, war auch 1867-71 Mitglied
des Senats des Staats New York und ward 1870 Kommissar des
Departements für die öffentlichen Arbeiten der Stadt New
York. Den großen Einfluß, den er im Tammany-Ring (f.
d.) erlangt hatte, benutzte er zu schamloser Bereicherung, die ihm
die Entfaltung eines ungeheuern Luxus gestattete. Mehrere Versuche,
diesem frechen Raubwesen ein Ende zu machen, blieben erfolglos; T.
ward im Oktober 1871 auf eine Anklage hin verhaftet, aber gegen
eine Bürgschaft von 1 Mill. Doll., die sofort beschafft wurde,
freigelassen und sogar wieder zum Staatssenator gewählt. Im
Januar 1873 ward er zum zweitenmal verhaftet und vor Gericht
gestellt, aber von den Geschwornen freigesprochen. Erst im November
1873 ward seine Verurteilung wegen Betrugs zu zwölf Jahren
Gefängnis erreicht, dieses Urteil aber als ungesetzlich vom
Appellhof umgestoßen und T. 1875 wieder freigelassen. Doch
war er zu gleicher Zeit wegen Wiedererstattung von 6 Mill. Doll.
nebst Zinsen angeklagt worden, und da er die Bürgschaft von 6
Mill., welche man verlangte, nicht leisten konnte, so ward er von
neuem in Haft genommen, aus der er im Dezember entsprang, um nach
Spanien zu gehen, dessen Regierung ihn aber 1876 wieder
auslieferte. T. starb 12. April 1878 im Gefängnis zu New
York.
Tweeddale (spr. twihdehl), s. Peeblesshire.
Tweedmouth (spr. twihdmoth), nördliche Vorstadt von
Berwick upon Tweed, in der engl. Grafschaft Northumberland, mit
Maschinenbau, einem Hafen und (1881) 4819 Einw.
Twehle, s. Zwehle.
Twelfth-cake (spr. -kehk), nach engl. Sitte am
Dreikönigstag verzehrter Kuchen; vgl. Bohnenfest.
Twenthe, eine den südöstlichen Teil der
niederländ. Provinz Overyssel bildende Landschaft, Hauptsitz
der niederländischen Baumwollindustrie, mit den Städten:
Ryssen, Almelo, Goor, Enschede u. a. Die T. führt ihren Namen
von dem alten Volk der Tubanten.
Twer, russ. Gouvernement, wird von den Gouvernements
Nowgorod, Jaroslaw, Wladimir, Moskau, Smolensk und Pskow
umschlossen, umfaßt 64,682 qkm
(nach Strelbitsky 65,329,7 qkm = 1186,46 QM.). Der
Wolchonskiwald, aus Kalksteinhügeln von 300 m Höhe
bestehend und mit undurchdringlichen Waldungen bedeckt, durchzieht
mit seinen Ausläufern zwischen Seen und Sümpfen fast das
ganze Gouvernement. Der Boden besteht aus bläulichrotem Lehm,
über welchem lehmiger Sand, häufig auch Kalkstein liegt;
außerdem ist das devonische System entwickelt und zwar in der
Form glimmerigen Sandsteins ohne Versteinerungen. Sieben
Mineralquellen sind im Gouvernement. Der wichtigste Fluß ist
die Wolga, welche innerhalb des Gouvernements eine Länge von
beinahe 530 km hat und von rechts die Shnkopa, Pesotschnja, Wasusa,
Dersha, Schoschtscha, Dubna, von links die Selicharowka, die
Große Koscha, Itomlja, Tma, Twerza, Medwjediza , Kaschinka
und Mologa aufnimmt. Die Düna hat im SW. ihren obern Lauf,
ferner die Flüsse Msta und Zna. Unter den Hunderten
flachuferiger Seen sind der Seliger, Ochwat-Shadenje, Steresh,
Wselug, Budbino, Mstino, Udomlja und Weristowo die
größten. Das Areal setzt sich zusammen aus 32,2 Proz.
Wald, 28,3 Wiese und Weide, nur 26,8 Acker- und 12,7 Proz. Unland.
Die großen Wälder bestehen im N. vorzugsweise aus Tannen
und Kiefern, im S. aus Birken und Erlen. Das kontinentale Klima
wird ein wenig durch die Seen und Sümpfe gemäßigt.
Die mittlere Jahrestemperatur beträgt +5,3° C.; die Hitze
des Sommers steigt bisweilen bis 35°, während im Winter
schon Kälte von -45 °C. herrschte. Unter den (1885)
1,681,790 Einw. des Gouvernements, 24 pro QKilometer (außer
Großrussen auch Deutsche, Polen und Juden), sind 100,000
Karelen, Überreste der finnischen Urbevölkerung des
Landes. Die Zahl der Eheschließungen war 1885: 11,199, der
Gebornen 76,142, der Gestorbenen 67,200. Die Landwirtschaft wird
bei der Unfruchtbarkeit des Bodens, der nur das zweite oder dritte
Korn liefert, schwach betrieben. Die Ernte besteht (1887)
vorzugsweise in Roggen (4,8 Mill. hl) und Hafer (5,7 Mill. hl), und
es müssen aus den andern Gouvernements beträchtliche
Zufuhren an Getreide stattfinden. Flachs wird in
größerer Ausdehnung gebaut. Auch die Viehzucht ist von
geringer Bedeutung. 1885 wurden 583,671 Stück Rindvieh,
351,632 Pferde, 373,779 grobwollige Schafe, 20,612 Schweine
gezählt. Ansehnlicher ist die Fischerei, namentlich im See
Seliger. Die Waldwirtschaft besteht einesteils im Aushauen und
Flößen der Baumstämme, welche wolgaabwärts
oder längs der Düna nach Riga geschafft werden,
andernteils in der Gewinnung von Teer, Pech und Terpentinöl.
Ein früherer Erwerbszweig, der Bau von Flußfahrzeugen,
sinkt seit der Eröffnung der Eisenbahnen fortwährend.
Sonst beschäftigen sich die Bauern mit dem Verfertigen von
Holzgegenständen und Hausgeräten oder mit
Schmiedearbeiten (Beile, Sensen, Nägel etc.). Torshok erfreut
sich eines trefflichen Rufs durch seine Saffianarbeiten. Die
Industrie wurde 1884 von 644 Anstalten mit 20,378 Arbeitern
betrieben und bringt für 22,386,000 Rubel Waren hervor.
Besonders entwickelt find: Baumwollspinnerei (10 Mill. Rub.),
Industrie in Hanf (1 1/2 Mill.), Leder (1 1/2 Mill.), Glas (1,2
Mill. Rub.). Außerdem sind bemerkenswert: die
Fayenceindustrie, Getreidemüllerei, Baumwollweberei,
Papierfabrikation, Ziegelei, Holzsägemühlen,
Branntweinbrennerei. Die Industrie wird wesentlich angetroffen in
den Städten Twer, Rshew, Wyschnij-Wolotschok, Ostaschkow und
Koljäsin. Der Handel konzentriert sich hauptsächlich in
Rshew, Torshok, Bjeshezk und Bologoje. Bildungszwecken oienen1885:
1095 Elementar-
952
Twerza - Tyana.
schulen mit 57,392 Schülern, 16 Mittelschulen mit 2720
Schülern und 4 Fachschulen mit 842 Schülern. T.
zerfällt in zwölf Kreise: Bjeshezk, Koljäsin,
Kaschin, Kortschewa, Nowotorshok, Ostaschkow, Rshew, Stariza,
Subzow, T., Wessegonsk, Wyschnij-Wolotschok. - Das Land war einst
vom finnischen Stamm der Wessen bewohnt; mit dem Erscheinen der
Slawen wurden die Finnen meistens nach N. gedrängt. Ob die
Kurgane (Grabhügel) an der Mologa finnischen oder slawischen
Stämmen angehörten, ist unentschieden. Nach der Teilung
Rußlands unter die Söhne Jaroslaws im 12. Jahrh. wurde
das Land unter die Fürsten von Nowgorod, Smolensk und Susdal
geteilt. Während der innern Fehden im 12. Jahrh. entstand das
Fürstentum T.; 1484 ward dasselbe mit dem Moskowiterreich
vereinigt. Die gleichnamige Hauptstadt liegt an der
Petersburg-Moskauer Eisenbahn, zu beiden Seiten der hier 213 m
breiten Wolga, welche hier die Twerza und Tmaka aufnimmt, und deren
Ufer durch eine Schiffbrücke verbunden sind, hat schöne
Plätze, Straßen und Anlagen, ein kaiserliches Palais,
eine Kathedrale und 33 andre Kirchen (darunter eine evangelische),
mehrere Klöster, ein geistliches Seminar, ein klassisches
Gymnasium, eine Realschule, eine Kavallerie-Junkerschule, ein
Lehrerseminar, weibliches Gymnasium, ein Theater, ein Denkmal
Katharinas II., eine Abteilung der Reichsbank, eine Stadtbank,
einen Bazar, 28 Fabriken (darunter 2 Baumwollspinnereien, 2
Baumwollwebereien und eine Zitzfabrik) und (1885) 39,280 Einw. Als
Eisenbahnstation und Wolgahafen hat T. sehr bedeutenden
Zwischenhandel, dessen wichtigste Gegenstände Getreide und
Metallfabrikate bilden. T. ist Sitz eines griechisch-orthodoxen
Erzbischofs. Unweit der Stadt befinden sich 2 eisenhaltige
Mineralquellen, das Sheltikow-Kloster und das Mönchskloster
des heil. Nikolaus. T. wurde 1182 als fester Platz gegen den
Freistaat Nowgorod angelegt; 1763 zerstörte eine Feuersbrunst
die ganze Stadt, die aber unter der Kaiserin Katharina II. bald
wieder aufgebaut wurde.
Twerza, schiffbarer linker Nebenfluß der Wolga im
russ. Gouvernement Twer, entspringt in der Nähe von
Wyschnij-Wolotschok, ist 185 km lang und 45-90 m breit,
stießt bis zur Stadt Torshok in südlicher Richtung,
später in südöstlicher und ergießt sich bei
der Stadt Twer in die Wolga. Die T. bildet einen Teil des
Wyschnij-Wolotschokschen Kanalsystems.
Twesten, 1) August Detlev Christian, protest. Theolog,
geb. 11. April 1789 zu Glückstadt, ward Gymnasiallehrer in
Berlin, 1814 außerordentlicher Professor der Theologie zu
Kiel, 1819 daselbst Ordinarius und 1835 Professor in Berlin an
Schleiermachers Stelle, dessen theologische Richtung er im Sinn der
lutherischen Rechtgläubigkeit umbildete. Von seinen Schriften
sind zu nennen: "Logik, insbesondere die Analytik" (Schlesw. 1825);
"Vorlesungen über die Dogmatik der evangelisch-lutherischen
Kirche" (Bd. 1, Hamb. 1826, 4. Aufl. 1838; Bd. 2, 1. Abt., 1837);
"Grundriß der analytischen Logik" (Kiel 1834); "Matthias
Flacius Illyricus" (Berl. 1844). Er starb 8. Jan. 1876 als
Oberkonsistorialrat und (bis 1874) Mitglied des evangelischen
Oberkirchenrats. Vgl. Heinrici, A. T. nach Tagebüchern und
Briefen (Berl. 1889).
2) Karl, Politiker, Sohn des vorigen, geb. 22. April 1820 zu
Kiel, studierte 1838-41 in Berlin und Heidelberg die Rechte, trat
1845 in den preußischen Justizdienst und ward
Stadtgerichtsrat in Berlin. Er schrieb 1861 eine Broschüre:
"Was uns retten kann", in welcher er den General Manteuffel als
Chef des Militärkabinetts verderblichen Einflusses
beschuldigte, und hatte deshalb mit diesem ein Duell, in welchem er
am Arm verwundet wurde. Er ward 1861 Mitglied des
Abgeordnetenhauses, in welchem er zu den hervorragendsten Rednern
der Fortschrittspartei gehörte, schied aber 1866 aus derselben
aus und wurde Mitbegründer der nationalliberalen Fraktion.
Außer im preußischen Abgeordnetenhaus, saß T.
auch in dem Reichstag des Norddeutschen Bundes. Wegen mehrerer
seiner Reden im Abgeordnetenhaus (namentlich 20. Mai 1865 über
die Justizpflege unter Lippes Leitung und 10. Febr. 1866 über
den bekannten Obertribunalsbeschluß) ward er in langwierige
gerichtliche und disziplinarische Untersuchungen verwickelt. War
auch der schließliche Ausgang derselben ein ziemlich
glimpflicher (T. erhielt 1868 eine Geldstrafe), so fand sich T.
doch 1868 veranlaßt, aus dem preußischen Justizdienst
auszuscheiden, um eine Stelle in der Berliner Stadtverwaltung zu
übernehmen. Er starb 14. Okt. 1870. T. schrieb noch: "Schiller
in seinem Verhältnis zur Wissenschaft" (Berl. 1863);
"Macchiavelli" (das. 1868) und "Die religiösen, politischen
und sozialen Ideen der asiatischen Kulturvölker und der
Agypter" (hrsg. von Lazarus, das. 1873, 2 Bde.).
Twickenham (spr. -häm), Dorf in der engl. Grafschaft
Middlesex, an der Themse, oberhalb London, Richmond gegenüber,
Lieblingsaufenthalt litterarischer Berühmtheiten (Essex,
Bacon, Hyde, Pope und Fielding), mit zahlreichen Landsitzen und
(1881) 12,479 Einw. Dabei Strawberry Hall, 1747 von Richard Walpole
erbaut, und Orleans-Haus, 1852-71 vom Herzog von Aumale bewohnt,
jetzt Klubhaus.
Twilled Sackings, s. Jute, S. 341.
Twiß, Sir Travers, engl. Rechtsgelehrter, geb. 1810
zu Westminster, studierte in Oxford, wirkte 1842-47 als Professor
der Nationalökonomie daselbst und ward 1852 zum Professor des
internationalen Rechts am King's College zu London ernannt, kehrte
aber 1855 als Professor des bürgerlichen Rechts nach Oxford
zurück. Er war außerdem 1852 Generalvikar des
Erzbischofs von Canterbury geworden und erhielt 1858 die Stelle
eines Kanzlers der Diözese London. Später wurde er zum
königlichen Rat, 1867 zum Generaladvokaten befördert und
zugleich geadelt. Unter seinen politischen, historischen und
rechtswissenschaftlichen Schriften sind zu nennen: "Epitome of
Niebuhr's History ofRome" (Oxf. 1837, 2 Bde.); "The Oregon question
examined" (Lond. 1846); "View of the progress of political economy
in Europe since the XVI. century" (das. I847); "On the relations of
the duchies of Schleswig and Holstein to the crown of Denmark"
(das. 1848; deutsch, Leipz. 1848); "The letters apostolic of pope
Pius IX. considered" (Lond. 1851); "Lectures on the science of
international law" (das. 1856); "The law of nations considered as
independent political communities" (Oxf. 1861-63, 2 Bde.; 3. Aufl.
1884); "The black book of the admiralty" (Lond. 1871-76, 4
Bde.).
Twist, s. v. w. Baumwollgarn, s. Garn, S. 911.
Tworog, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Oppeln,
Kreis Tost-Gleiwitz, zur Herrschaft des Prinzen zu
Hohenlohe-Ingelfingen gehörig, an der Stola und der Linie
Kreuzburg-Tarnowitz der Preußischen Staatsbahn, hat eine
kath. Kirche, ein Schloß, eine Oberförsterei und (1885)
1150 Einw.
Tyana, im Altertum Stadt im südlichen Kappadokien,
in der Nähe der Kilikischen Pässe, angeblich
Gründung der Assyrer, wurde unter Caracalla römische
Kolonie, dann, da sie zum Reich der Zenobia
953
Tyburn - Tyler.
gehörte, von Aurelianus 272 n. Chr. erobert. Valens machte
sie zur Hauptstadt von Cappadocia Secunda. Ruinen beim heutigen
Kilisse Hissar.
Tyburn (spr. teibörn), früher ein Bach und Dorf
auf der Nordseite des Hyde Park in London, bis 1783 der
öffentliche Richtplatz. 1839-50 wurde an derselben Stelle
einer der schönsten Stadtteile Londons erbaut, dessen Name
Tyburnia an die alte Zeit erinnert.
Tyche, in der griech. Mythologie ursprünglich die
Göttin des guten Glücks, Tochter des Okeanus oder des
Zeus, wurde namentlich als Beschirmerin und Erhalterin der
Städte verehrt und hatte als solche in vielen Städten
Griechenlands und Kleinasiens Tempel und Statuen. Allmählich
bildete sich dann die Vorstellung aus, daß T. sowohl
Glück als Unglück verleihe, worin sie der römischen
Fortuna (s. d.) gleichkommt. In den Kunstdenkmälern wird der
T. entweder ein Steuerruder als Sinnbild lenkender Gewalt oder ein
Rad, auf die Flüchtigkeit derselben anspielend, oder
Kopfaufsatz und Fruchthorn als Zeichen der Fruchtbarkeit
beigegeben. Eigenartig charakterisiert waren die Tychen der
Städte, meist mit der Mauerkrone geschmückt und mit
verschiedenen Symbolen ausgestattet (so die T. von Antiochia, ein
Werk des Eutychides, im Vatikan, s. Abbild.). Vgl. Lehrs,
Populäre Aufsätze, S. 175 ff. (2. Aufl.).
Tycho Brahe, s. Brahe 1).
Tychsen, 1) Olaus Gerhard, Orientalist, geb. 14. Dez.
1734 zu Tondern, studierte in Halle und ward Lehrer am dortigen
Waisenhaus, 1763 Professor der orientalischen Sprachen zu
Bützow und nach Aufhebung dieser Universität
Oberbibliothekar in Rostock, wo er 30. Dez. 1815 starb. Seine
Hauptschrift ist "Bützowsche Nebenstunden" (Bützow
1766-1769, 6 Bde.), ein reichhaltiges Magazin für Geschichte
und Wissenschaft des Judentums. T. gilt auch als Begründer der
arabischen Paläographie, und er beteiligte sich lebhaft und
mit Erfolg an den ersten Versuchen, die Keilschrift zu entziffern.
Seine Sammlung wertvoller Manuskripte über orientalische und
spanische Litteratur und andre Antiquitäten kaufte die
Rostocker Universität. Vgl. Hartmann, Olaf Gerhard T. (Brem.
1818-20, 5 Tle.).
2) Thomas Christian, Orientalist, geb. 8. Ma. 1758 zu Horsbyll
im Schlesischen, studierte in Kiel und Göttingen, machte dann
eine wissenschaftliche Reise durch Deutschland, Italien, Frankreich
und Spanien, ward 1784 Professor der Theologie zu Göttingen,
1797 Präsident der Göttinger Akademie der Wissenschaften
und starb 23. Okt. 1834. Von seinen Schriften sind zu nennen:
"Grundriß einer Archäologie der Hebräer"
(Götting. 1789); "Grammatik der arabischen Schriftsprache"
(das. 1823); die Ausgabe des Quintus Smyrnäus (Straßb.
1807) und verschiedene Essays über Numismatik,
Paläographie etc. - Seine durch Schönheit und Talente
ausgezeichnete Tochter Cäcilie (gest. 1812 im Alter von 18
Jahren) besang der Dichter Ernst Schulze (s. d. 4) in dem
gleichnamigen epischen Gedicht.
Tydeus, im griech. Mythus Sohn des Öneus,
flüchtete wegen eines begangenen Mordes nach Argos zu
Adrastos, der ihn sühnte und ihm seine Tochter Deipyle zum
Weib gab. T. zog mit ihm gegen Theben, wurde von Melanippos
verwundet und starb an den Folgen der Wunde.
Tyfon, Wirbelsturm, s. Teifun.
Tyl, Joseph Cajetan, tschech. Schriftsteller, geb. 4.
Febr. 1808 zu Kuttenberg, war Theaterregisseur in Prag und starb
daselbst 11. Juli 1856. Er schrieb ca. 50 Dramen, zum großen
Teil nach deutschen Vorbildern. Am gelungensten sind: "Der blinde
Jüngling", "Jan Hus", "Strakonicky Dudak" etc. Von 1834 bis
1847 redigierte T. die Zeitschrift "Kvety" und veröffentlichte
darin seine Erzählungen, unter denen zu erwähnen sind:
"Der letzte Tscheche", "Patriotische Liebe", "Das Kuttenberger
Dekret" etc. T. dichtete auch das böhmische Nationallied "Kde
domuv moj?" Sein Leben beschrieb Turnovsky (Prag 1881).
Tyldesley (spr. teilsli oder tillsli), Stadt in
Lancashire (England), 12 km westnordwestlich von Manchester, mit
Kohlengruben, Baumwollweberei und (1881) 9954 Einw.
Tyler (spr. teiler), 1) John, zehnter Präsident der
Vereinigten Staaten, geb. 29. März 1790 als der Sohn eines
Pflanzers in Virginia, studierte die Rechte, ward 1816 Mitglied des
Repräsentantenhauses zu Washington, dann Gouverneur von
Virginia und war 1827-36 Senator für diesen Staat. 1840 von
der Whigpartei als Kandidat aufgestellt und mit großer
Majorität zum Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten
gewählt, wurde er durch den Tod des Präsidenten Harrison
einige Wochen nach dessen Amtsantritt 4. April 1841 Präsident.
T. rechtfertigte in dieser Stellung die Erwartungen seiner Partei
nicht, indem er vielmehr auf die Seite der Demokraten neigte. Als
er der im Juli 1841 vom Kongreß beschlossenen Bill wegen
Errichtung einer Bank sein Veto entgegenstellte, reichte das
Ministerium seine Entlassung ein, und Tylers Bildnis ward an
mehreren Orten öffentlich verbrannt. Dennoch machte er noch
wiederholt von seinem Vetorecht Gebrauch, so daß er in
beständigem Hader mit der Volksvertretung lebte. Am 4.
März 1845 trat er von der Regierung ab und zog sich auf sein
Landgut in Virginia zurück. Er starb, nachdem er sich nach
einem fruchtlosen Friedensversuch bei Ausbruch des
Bürgerkriegs in den Senat der Sezessionisten hatte wählen
lassen, 18. Jan. 1862 in Richmond. Tylers Leben beschrieb sein Sohn
Lyon Gardiner T. (Richm. 1884, 2 Bde.).
954
Tyloma - Typha.
2) S. Wat Tyler.
Tyloma (grch.), Schwiele, Verhärtung der
Oberhaut.
Tylopoda (Schwielensohler, Kamele), Familie der
paarzehigen Huftiere.
Tylor (spr. teilor), Edward Burnett, Anthropolog, geb. 2.
Okt. 1832 zu Camberwell, wurde 1871 Fellow der Royal Society, 1883
Direktor des Universitätsmuseums in Oxford, wo er auch
Vorlesungen hält. Auch ist er Präsident der Englischen
Anthropologischen Gesellschaft. Er schrieb: "Anahuac or Mexico and
the Mexicans" (Lond. 1861); "Early history of mankind and of
civilisation" (3. Aufl., das. 1878; deutsch, Leipz. 1866);
"Primitive culture: researches into the development of mythology,
philosophy, religion, art and custom" (2. Aufl., Lond. 1873, 2
Bde.; deutsch, Leipz. 1873); "Anthropology" (Lond. 1881; deutsch,
Braunschw. 1883).
Tympanitis (griech.), s. Blähungen.
Tympanon (griech.), mit Pergament überzogene
beckenförmige Pauke, vorzugsweise beim Dienste der Rhea und
bei Bacchusfesten gebraucht (s. Abbildung); in der Anatomie s. v.
w. Trommelfell (s. Ohr, S. 349); in der Architektur jedes meist
halbrund vertiefte, zur Aufnahme von Reliefs dienende Feld von
Giebeln über Fenstern oder Thüren.
Tympanum (lat.), s. Trommelrad.
Tyndale (spr. tinndel), William, ein Vorkämpfer der
Reformation in England, geboren vor 1500 an der Grenze von Wales,
studierte in Oxford, schloß sich der Reformation an und
predigte die neue Lehre in London. Er mußte deshalb 1524 aus
England fliehen, ging nach Deutschland, wo er Luther kennen lernte,
und dann nach den Niederlanden. 1526 wurde seine Übersetzung
des Neuen Testaments gedruckt, welche von Sir Th. More
bekämpft wurde, jedoch in England große Verbreitung
fand. T. ward deshalb in Antwerpen auf englische Veranlassung
verhaftet und nach einer langen Gefangenschaft zu Vilvoord im
September 1536 erdrosselt und verbrannt. Die gewöhnliche
englische Bibelübersetzung hat sich eng an die Tyndales
gehalten. Seine Schriften erschienen gesammelt Oxford 1848-50, 3
Bde. Vgl. "W. T. a biography" (Lond. 1886).
Tyndall (spr. tinndel), John, Physiker, geb. 21. Aug.
1820 in Irland, arbeitete bei der trigonometrischen Aufnahme
Großbritanniens, studierte seit 1848 in Marburg und Berlin,
wurde Lehrer am Queenwod College und wirkt seit 1853 als Professor
der Physik an der Royal Institution. Er lieferte Untersuchungen
über Diamagnetismus, strahlende Wärme,
Schallfortpflanzung etc. und brachte in allen seinen Arbeiten die
Lehre von der Erhaltung der Energie zur Geltung. 1856 mit Huxley
und später allein machte er Studien und Beobachtungen
über die Gletscher, die er in dem Werk "The glaciers of the
Alps" (Lond. 1860) veröffentlichte. Auch hielt er musterhafte
populäre Vorträge über verschiedene Gebiete der
Physik, die große Verbreitung fanden und meist von Helmholtz
und Wiedemann ins Deutsche übersetzt wurden, so: "Der Schall"
(2. Aufl., Braunschw. 1874), "Das Licht" (6 Vorlesungen in Amerika,
das. 1876; daneben veröffentlichte er noch Vorlesungen in der
Royal Institution über denselben Gegenstand) und die
"Fragmente aus den Naturwissenschaften" (das. 1874). Von seinen
zahlreichen übrigen Schriften nennen wir: "Heat, a mode of
motion" (7. Aufl. 1887; deutsch, 3. Aufl., Braunschw. 1875); "Forms
of water in clouds and rivers, ice and glaciers" (6. Aufl. 1876;
deutsch, 2. Aufl., das. 1878); "On diamagnetism" (1856 u. 1870,
neue Ausg. 1888); "On radiation" (1865); "Hours of exercise in the
alps" (1871; deutsch, Braunschw. 1875); "Contributions to molecular
physics" (1872); "Notes on electricity" (1870) und "Lectures on
electricity" (1870; beide deutsch, Wien 1884); "Natural philosophy
in easy lessons" (1869); "Faraday as a discoverer" (4. Aufl. 1884;
deutsch, Braunschw. 1870) und den Vortrag über den
Materialismus in England (deutsch, Berl. 1875).
Tyndareos, mythischer König von Sparta, floh, von
seinem Halbbruder Hippokoon vertrieben, nach Ätolien zu
Thestios, dem er im Kriege gegen seine Nachbarn beistand, und mit
dessen Tochter Leda (s. d.) er sich vermählte. Herakles setzte
ihn wieder in die Herrschaft von Sparta ein. Leda gebar ihm die
Klytämnestra und den Kastor, dem Zeus die Helena und den
Polydeukes. Als Kastor uno Polydeutes (die Tyndariden) unsterblich
geworden waren, rief T. seinen Schwiegersohn Menelaos nach Sparta
und übergab ihm die Herrschaft.
Tyne (spr. tein), Fluß im nördlichen England,
entsteht in der Grafschaft Northumberland aus dem
Zusammenfluß des North- und South-T., fließt
östlich, bildet in seinem untern Lauf die Grenze zwischen den
Grafschaften Northumberland und Durham und fällt nach einem
Laufe von 117 km bei Tynemouth in die Nordsee. Zu den Häfen
Newcastle, Shields und Tynemouth, die an ihm liegen, gehörten
1887: 855 Seeschiffe (darunter 666 Dampfer) von 380,913 Ton.
Gehalt. Steinkohlen, Eisen u. Maschinen bilden die Hauptartikel der
Ausfuhr. Vgl. Guthrie, The river T., its history and resources
(Lond. 1880); Palmer, The T. and its tributaries (das. 1882).
Tynemouth (spr. teinmoth), Stadt und besuchtes Seebad in
der engl. Grafschaft Northumberland, an der Mündung des Tyne,
hat ein altes Schloß, Ruinen einer Abtei, ein
Matrosenhospital und mit dem oberhalb liegenden North Shields, mit
dem es Eine Gemeinde bildet, (1881) 43,863 Einw. (s. Shields).
Typen (griech., Mehrzahl von Typus, s. d.), in der Chemie
gewisse einfache Verbindungen, die als Vorbilder zahlreicher andrer
Verbindungen betrachtet werden können. Nach Gerhardts
Typentheorie waren die vier wichtigsten T.: Chlorwasserstoff H Cl
Wasser H H O Ammoniak H H H N Methan H H H H C Ein Körper ist
nach dem Typus Wasser, Methan etc. konstituiert, wenn seine Atome
in analoger Weise miteinander verbunden sind. Der Typus bleibt auch
erhalten, wenn in der Verbindung ein oder mehrere Atome durch andre
Atome oder Atomgruppen ersetzt werden. Aus Methan können die
Substitutionsprodukte Cl H H H C oder Cl Cl H H C etc. entstehen,
ebenso aus Ammoniak die Verbindungen CH3 H H N oder CH3 C2H5 C2H5
N. Über die Typentheorie s. Chemie, S. 985. - T. auch s. v. w.
Buchdruckschriften oder Lettern.
Typenschreiber (engl. Type-Writer, spr. teip-reiter), s.
Schreibmaschine.
Typha L. (Teichkolben, Rohrkolben), Gattung der
Typhaceen, Sumpfgewächse mit langen, grund-
955
Typhaceen - Typhus.
ständigen, linealen Blättern, einfachen, runden
Stengeln und sehr kleinen Blüten, welche in großer Zahl
(100,000) in walzigen oder länglichen, gelb- oder
braunschwarzen Kolben bei einander stehen; von den zwei Kolben
eines Stengels trägt der obere männliche, der untere
weibliche Blüten. Von zehn Arten, die in den Tropen und den
gemäßigten Zonen weit verbreitet sind, kommen T.
latifolia L. und T. angustifolia L. mit 2 m hohen Stengeln in
stehenden Gewässern Deutschlands vor. Man benutzt die
Blätter zu Matten und zum Verlieschen der Fässer, auch
mit den Stengeln als Packmaterial, die Blüten zum
Polstern.
Typhaceen, monokotyle Familie aus der Ordnung der
Spadicifloren, krautartige Sumpfpflanzen mit perennierendem,
kriechendem Rhizom, knotenlosen, cylindrischen, einfachen oder
ästigen Stengeln, wechselständigen, am Grunde des
Stengels zusammengedrängten, bescheideten, linealischen,
ganzen, parallelnervigen Blättern und unvollständigen,
einhäusigen Blüten, welche dichte, cylindrische oder
kugelige Kolben bilden, die mit abfallenden Blütenscheiden
versehen sind, und von denen die obern männliche, die untern
weibliche Blüten tragen. Die männlichen Blüten haben
statt des Perigons einfache Fäden oder häutige
Schüppchen, welche ordnungslos zwischen den zahlreichen dem
Kolben aufsitzenden Staubgefäßen stehen. Die weiblichen
Blüten haben an Stelle des Perigons zahlreiche Borsten oder je
drei hypogyne Schüppchen. Die Fruchtknoten sind sitzend oder
gestielt, einblätterig, einfächerig, mit einer einzigen
hängenden, anatropen Samenknospe und einem einfachen,
endständigen Griffel, welcher in eine einseitige,
zungenförmige Narbe endigt. Die Früchte sind durch
gegenseitigen Druck eckig, durch den Griffel spitz, nicht
aufspringend, fast steinfruchtartig wegen des häutigen oder
schwammigen Epi- und des leder- oder holzartigen Endokarps. Die
Samen haben eine häutige Schale und in der Achse eines
mehligen Endosperms einen geraden, fast ebenso langen Keimling.
Vgl. Schnizlein, Die natürliche Pflanzenfamilie der T.
(Nördling. 1845). Die T. zählen nur etwa 15 Arten in zwei
Gattungen, welche am häufigsten in den außertropischen
Zonen der nördlichen Halbkugel sind. Überreste fossiler
Gattungen, Aethophyllum und Echinostachys, kommen im Bunten
Sandstein, Arten der Gattungen Typha und Sparganium in
Tertiärschichten vor.
Typhlitis (griech.), Entzündung des Blinddarms, s.
Darmentzündung, S. 555.
Typhlosis (griech.), Blendung, Blindheit.
Typhlotypographie (griech.), s. v. w. Blindendruck (s.
d.).
Typhoid (griech., "typhusähnlich"), ein
Krankheitszustand, der wegen seines heftigen Fiebers und der
dadurch bedingten schweren Gehirnsymptome dem Typhus nahesteht,
ohne dessen anatomische Veränderungen zu zeigen. Namentlich
hat man zwei Krankheitsformen mit dem Namen des Typhoids belegt,
nämlich das biliöse T. und das Choleratyphoid. Ersteres
ist eine Infektionskrankheit, welche am nächsten dem Typhus
steht. Es wurde bisher beobachtet in Ägypten, in der Krim, in
Kleinasien; über seine Ätiologie ist man nicht mehr
unterrichtet als über die der typhösen Krankheiten
überhaupt. Während das biliöse T. mit dem letztern
die allgemeinen klinischen und anatomischen Erscheinungen teilt,
ist es symptomatologisch charakterisiert durch die frühzeitig
stark hervortretenden Erscheinungen seitens des Verdauungsapparats:
Schmerz im Unterleib, Erbrechen, Durchfälle dysenterischer
Art, Gelbsucht. Dem entspricht auch der anatomische Befund: starke
katarrhalische Entzündung des Magens und Darms, Schwellung und
gelbliche Verfärbung der Leber, in den spätern Stadien
ausgesprochene fettige Entartung dieses Organs. Die Milz ist
kolossal vergrößert, von Tausenden von kleinen
Abscessen, den vereiterten Malpighischen Bläschen, durchsetzt;
daneben in allen Stadien der Entfärbung und Schrumpfung
begriffene blutige Infarkte von zum Teil enormer Größe.
Das Choleratyphoid ist eine Nachkrankheit der eigentlichen Cholera
(s. d.).
Typhon, Wirbelsturm, s. Teifun.
Typhon (Typhoeus, Typhaon, Typhos), in der griech.
Mythologie ein Ungeheuer, Personifikation des wilden Sturms,
besonders des Glutwindes, der aus feuerspeienden Bergen
hervorbricht. Er liegt nach Homer im Arimerland (Kilikien?),
welches von Zeus mit Blitzen gegeißelt wird. Nach Hesiod sind
Typhaon und Typhoeus verschiedene Wesen. Ersterer ist der Sohn des
letztern und zeugt mit der Echidna den Hund Orthros, den Kerberos,
die lernäische Hydra und die Chimära; Typhoeus ist der
jüngste Sohn des Tartaros und der Gäa und hat 100
Drachenhäupter. Er sucht die Herrschaft über Götter
und Menschen zu gewinnen, aber Zeus bezwingt ihn mit dem Blitz.
Seine Söhne sind die Winde, mit Ausnahme der wohlthätigen
(Notos, Boreas, Zephyros etc.). Ebenso ist T. bei Äschylos und
Pindar ein 100köpfiger Sohn der Erde, der die kilikischen
Höhlen bewohnt. - In Ägypten war T. (Seth oder Set, auch
Tebha genannt) in alter Zeit ein hoch angesehener Gott, ein Sohn
des Seb (Kronos) und der Nut (Rhea). Hier war er der Gott des
Kriegs. Die Könige Seti der 19. Dynastie führten von ihm
den Namen. Eine besondere Kultusstätte des Set war die Stadt
Ombos; allgemeiner jedoch war seine Verehrung in Unterägypten,
namentlich unter den dort ansässigen Fremden. Am Ende der 21.
Dynastie wurde dieser Gott aus Oberägypten verstoßen; er
galt seitdem als Gott der Feinde Ägyptens und wurde
allmählich vollständig zum Prinzip alles Bösen
umgebildet. Nach der Sage hat er seinen Bruder Osiris umgebracht,
dessen Sohn Horos sich dann an ihm in siegreichen Schlachten
rächte. Er wird unter der Gestalt eines fabelhaften,
eselähnlichen Tiers dargestellt oder doch mit dem Kopf
desselben (vgl. Abbildung). Einigemal, wo er in menschlicher Form
erscheint, trägt er ein Hörnerpaar. Vgl. E. Meyer, Set-T.
(Leipz. 1875).
Typhus (griech.), eigentlich s. v. w. Betäubung,
gegenwärtig aber ausschließlich Bezeichnung für
verschiedene schwere und unter heftigem Fieber verlaufende
Krankheitszustände, bei welchen das Nervensystem in der
schwersten Weise ergriffen zu sein und der Kranke in einem
anhaltenden Zustand von Betäubung sich zu befinden pflegt
(Nervenfieber). Wir unterscheiden drei Formen des T., nämlich
den exanthematischen T., den Unterleibs- oder Darmtyphus (t.
abdominalis) und den Rückfalltyphus (t. recurrens).
1) Der exanthematische T. (Petechialtyphus,
956
Typhus (Fleck-, Lazarett-, Hunger-T.; Unterleibs-T.).
Fleckfieber) ist eine in ausgesprochenster Weise ansteckende
Krankheit. Der Ansteckungsstoff ist in der Atmosphäre des
Kranken enthalten und besitzt eine außerordentliche
Beständigkeit, so daß er sich in schlecht
gelüfteten Zimmern ein halbes Jahr lang halten kann, ohne
seine Wirksamkeit zu verlieren. Der Ausbruch der Krankheit scheint
7-14 Tage nach erfolgter Ansteckung stattzufinden. Er ist um so
ansteckender, in je größerer Zahl die Kranken in einem
Zimmer beisammenliegen, und tritt namentlich an solchen
Plätzen, an welchen eine große Anzahl von Menschen auf
einen engen Raum zusammengedrängt ist, wie auf Schiffen, in
Gefängnissen, in Lazaretten etc., auf (Schiffstyphus, Kerker-,
Lazarettfieber). Hier scheinen die Ausdünstungen und
Exkremente, die Beimischung ihrer Zersetzungsprodukte zu der
eingeatmeten Luft, den Nahrungsmitteln und Getränken den
wesentlichsten Faktor für die Entstehung des Typhusgifts
abzugeben. In Gegenden ferner, wo ein großer Teil der
Bevölkerung in Armut und Elend lebt, kommt der exanthematische
T. endemisch vor. Besonders nach Mißernten und Teurungen
steigert sich mit der Not auch die Häufigkeit der
Typhusfälle, und es treten die verheerenden Epidemien des
Hungertyphus auf. Ebenso sind belagerte Städte und schlecht
versorgte Feldlager häufig der Sitz verheerender
Typhusepidemien (Kriegstyphus). Das frühste Kindesalter und
das Greisenalter bleiben gewöhnlich vom exanthematischen T.
verschont, alle übrigen Lebensalter sind dafür gleich
empfänglich. Hat jemand den exanthematischen T. einmal
überstanden, so ist seine Disposition für eine neue
Erkrankung derselben Art bedeutend abgeschwächt, doch
keineswegs ganz getilgt. Der exanthematische T. war von Anfang des
16. bis zum Ende des 18. Jahrh. über alle Länder Europas
verbreitet. Während der Kriege im Anfang dieses Jahrhunderts
erreichte er seine größte Ausbreitung. Nach jener Zeit
schien er auf dem Kontinent ganz verschwunden zu sein, erst in den
40er Jahren zeigte er sich wieder epidemisch in Oberschlesien etc.
Gegenwärtig bildet er auf den britischen Inseln und in
einzelnen Gegenden Mitteleuropas (Oberschlesien, Polen, russische
Ostseeprovinzen) die endemische Form des T. Kleine Epidemien des
exanthematischen T. werden überall von Zeit zu Zeit beobachtet
und sind dann stets durch Einschleppung von andern Orten her
hervorgerufen. Vor dem Ausbruch der Krankheit, in der Zeit der
Inkubation, klagen die Kranken meist schon über leichtes
Frösteln, Kopfweh, gestörten Schlaf, Appetitlosigkeit
etc. Die eigentliche Krankheit beginnt mit einem einmaligen
Schüttelfrost und Fiebersymptomen von großer Heftigkeit.
Sofort fühlen sich die Kranken aufs äußerste matt
und kraftlos, klagen über Schwere und Benommenheit des Kopfes,
zuweilen auch über heftigen Kopfschmerz. Dazu gesellen sich
Schwindel, Flimmern vor den Augen, Ohrensausen,
Schwerhörigkeit, Schmerzen in den Gliedern, Zittern bei den
Bewegungen der Arme und Beine. Die Kranken liegen meist schon sehr
apathisch im Bett und haben leichte Delirien. Andre Patienten sind
aufgeregt und kaum im Bett zu erhalten. Am 3.-5. Tag der Krankheit
treten am Rumpf kaum linsengroße rote Flecke auf, welche sich
mit dem Finger leicht wegdrücken lassen, aber sofort
wiederkehren. Von diesem Exanthem, den Flecken, rührt der Name
Fleck-, exanthematischer T. her. Dieselben vermehren sich, breiten
sich gegen den Hals und die Gliedmaßen aus, bis endlich der
ganze Körper, mit Ausnahme des Gesichts, von ihnen bedeckt
ist. Sie verlieren sich erst gegen das Ende der zweiten
Krankheitswoche, wobei das Fieber und die tiefe Benommenheit des
Bewußtseins gleichzeitig abnehmen. Sie werden später
blau-rot, lassen sich dann nicht mehr vollständig
wegdrücken und gehen manchmal sogar in wirkliche Petechien, d.
h. in kleine Blutergüsse in die Haut, über. Trotz der
schweren Fieberbewegung ist der Ausgang in Genesung bei weitem der
häufigste. Tritt der Tod ein, so erliegen die Kranken entweder
in der zweiten Woche dem hohen Fieber, oder sie enden durch
hinzutretende Lungenentzündung. Die Sektion ist im Gegensatz
zu dem Unterleibstyphus ohne örtliche Befunde, nur Milz, Leber
und Nieren zeigen die allen Infektionskrankheiten gemeinsamen
Schwellungen.
2) Der Unterleibs- oder Darmtyphus (T. abdominalis) ist
ebenfalls eine Infektionskrankheit, aber nur selten von Person zu
Person ansteckend (kontagiös), während Übertragungen
des Giftes durch Dejektionen und Wäsche besonders auf
Krankenwärter, Wäscherinnen etc. in zahlreichen
Fällen außer allem Zweifel gesetzt sind. Eine wichtige
Rolle bei der Bildung des Typhusgifts spielen jedenfalls die
Zersetzungen tierischer Substanzen und die Beimengung der
Zersetzungsprodukte zu den Speisen, Getränken und zu der Luft.
Das häufige Vorkommen des T. in dicht bevölkerten
Städten, in welchen die Krankheit niemals vollständig
erlischt, wohl aber von Zeit zu Zeit eine epidemische Ausbreitung
erfährt, scheint meist auf der enormen Zersetzung und
Verwesung zu beruhen, in welcher sich der Boden großer
Städte wegen massenhafter Aufnahme von Auswurfstoffen
befindet. Die Erzeuger des Typhusgifts sind, wie Klebs 1881
nachgewiesen, kleine, stäbchenförmige Spaltpilze
(Bakterien), deren nähere Eigenschaften indes noch der
Aufklärung harren. - Typhusepidemien pflegen vorzugsweise in
feuchten Jahren während des Spätsommers, im Herbst und zu
Anfang des Winters zu herrschen. Das Auftreten des T. steht in
einer gewissen Wechselbeziehung zu den Schwankungen des
Grundwasserstandes (s. Grundwasser). Erreicht infolge
atmosphärischer Verhältnisse zu gewissen Zeiten das
Grundwasser einen relativ hohen Stand, um später zu seiner
normalen Tiefe zu fallen, oder fällt es anderseits einmal
absolut sehr tief, so werden relativ große und dicke
Schichten des mit organischen, in Zersetzung begriffenen Substanzen
durchtränkten Erdreichs trocken gelegt. Infolgedessen tritt
eine vermehrte Fäulnis dieser Stoffe ein; die
gesundheitsschädlichen Produkte dieser Zersetzung mischen sich
dem Trinkwasser bei und werden so als Typhusgift selbst den
menschlichen Wohnungen zugeführt. Säuglinge und Greise
erkranken sehr selten am T., das mittlere Lebensalter ist am
meisten dazu disponiert. Die Zahl der am T. erkrankten Männer
ist etwas größer als die der Frauen; kräftige und
wohlgenährte Individuen erkranken um vieles leichter als
schwächliche und schlecht genährte, und unter den
ärmern Klassen der Bevölkerung ist die Krankheit etwas
häufiger als unter den wohlhabenden. Schwangere und stillende
Frauen sind vor dem T. fast absolut sicher. Nach dem einmaligen
Überstehen der Krankheit erlischt mit seltenen Ausnahmen die
Disposition zu neuer Erkrankung. Der eigentliche Sitz des
Typhusprozesses ist der Darmkanal, besonders die untere Hälfte
des Dünndarms. Die Schleimhaut des Dünndarms befindet
sich in einem katarrhalischen Zustand. Die Drüsenapparate
schwellen durch eine reichliche Zellenwucherung zu markig weichen,
flachen Knoten an, in gleicher Weise beteiligen sich die
Gekrösdrüsen. Die Milz ist in allen Fällen
vergrößert bis
957
Typhus (Unterleibs- T.)
zu dem Fünf-, ja Zehnfachen des normalen Volumens; das
Gewebe derselben ist in eine äußerst blutreiche, weiche,
dabei sehr brüchige Substanz verwandelt. Regelmäßig
sind auch in geringerm Grade die Leber und Nieren geschwollen und
entzündlich verändert. Die Drüsenhaufen des untern
Dünndarms wandeln sich nach kurzem Bestehen an ihrer
Oberfläche in eine bräunliche oder gallig
durchtränkte, schorfartige Masse um, welche abgestoßen
wird. Auf der Schleimhaut zeigt sich dann ein typhöses
Geschwür, welches ohne Zurücklassung einer Narbe zu
heilen pflegt. In ungünstigen Fällen geht das
Geschwür in der Schleimhaut auf die darunterliegende
Muskelhaut über und kann sogar zur Durchbohrung der Darmwand,
damit zu allgemeiner Bauchfellentzündung und zum Tod
führen. Außer dem untern Dünndarm (Ileotyphus) wird
häufig auch der Anfangsteil des Dickdarms (Kolotyphus), selten
die Schleimhaut des obern Dünndarms und noch seltener die des
Magens (Gastrotyphus) der Sitz der typhösen Geschwüre. An
manchen Orten und in manchen Epidemien treten die
Typhusgeschwüre auch auf der Kehlkopfschleimhaut
(Laryngotyphus) auf. Stets trifft man bei T. auch einen
hochgradigen Katarrh der Schleimhaut der Luftwege an, welchem sich
Lungenentzündung, Pleuritis etc. anschließen
können. Der T. beginnt gewöhnlich mit einem allgemeinen
Krankheitsgefühl, psychischer Verstimmung, großer
Mattigkeit, Appetitlosigkeit, unruhigem Schlaf, Kopfschmerzen,
Schwindel, Schmerzen in den Gliedern und manchmal wiederholtem
Nasenbluten. Bald setzt dann mit einem Frostanfall das hohe Fieber
mit seinen oben beschriebenen nervösen Zufällen ein. Der
Unterleib ist gewöhnlich schon in den ersten Tagen etwas
aufgetrieben und gespannt; ein tiefer Druck auf denselben ist dem
Kranken empfindlich, namentlich wenn er in der rechten
Unterbauchgegend ausgeübt wird. An dieser Stelle pflegt man
bei Druck, sobald Durchfälle eingetreten sind, auch ein
eigentümliches gurrendes Geräusch
(Ileocökalgeräusch) wahrzunehmen. Auf der Haut des
Bauches und der Brust findet man jetzt auch vereinzelte rote,
linsengroße Flecke (roseolae), welche sich durch Fingerdruck
entfernen lassen, alsbald aber wieder zurückkehren. Die
Körpertemperatur erreicht in den ersten acht Tagen eine
Höhe bis zu 40° C. und ist am Abend um 1/2° höher
als am nächstfolgenden Morgen. Die Pulsfrequenz ist dabei
verhältnismäßig gering, 90-100 Schläge in der
Minute. Der Harn ist dunkel, in seiner Menge gewöhnlich
vermindert. In der zweiten Woche des T. hören die Kranken auf,
über Kopfschmerz und Gliederschmerzen zu klagen; der Schwindel
aber wird heftiger, zu dem Ohrenbrausen gesellt sich
Schwerhörigkeit. Der Gesichtsausdruck des Kranken wird
stupider, seine Teilnahmlosigkeit immer größer. Das
Bewußtsein wird umnebelt, und die Kranken verfallen
allmählich in einen Zustand von Schlafsucht und
Betäubung. Sie lassen jetzt Stuhl und Urin häufig unter
sich gehen, liegen fast regungslos in anhaltender Rückenlage,
sind im Bett herabgesunken und haben die Kniee gespreizt. Nur
zeitweilig verrät eine zitternde Bewegung der Lippen oder
einzelne unverständltche Worte, welche die Kranken murmeln,
daß die psychischen Funktionen nicht gänzlich ruhen.
Andre Kranke zeigen, daß sie gegen die sie umgebende
Außenwelt vollständig unempfindlich sind, werfen sich
fortwährend im Bett hin und her, versuchen das Bett zu
verlassen, sich zu entblößen; sie gestikulieren,
führen Gespräche oder bringen unzusammenhängende
Worte hervor. Fast immer erfolgen in der zweiten Woche täglich
mehrere (meist 3-4) Durchfälle von wässeriger
Beschaffenheit. Die Atmung ist beschleunigt und oberflächlich.
Die Wangen haben anstatt der hochroten Färbung eine mehr
bläuliche angenommen, die Augenlider sind halb geschlossen,
die Augenbindehaut gerötet, die Nasenlöcher erscheinen
(von eingetrocknetem Schleim) wie angeraucht, Zahnfleisch,
Zähne und Zunge sind mit einem schwärzlichen Belag
versehen, der Atem ist stinkend. Der Unterleib ist durch
größern Luftgehalt der Därme trommelartig
aufgetrieben, die Empfindlichkeit desselben gegen Druck und das
Ileocökalgeräusch bestehen fort. Die Milzanschwellung hat
zugenommen, die Roseolae auf dem Bauch haben sich manchmal noch
vermehrt, dazu ist die Haut mit zahllosen kleinen
Schwitzbläschen bedeckt. Die Körpertemperatur zeigt sich
in den Abendstunden auf 40-41,5° C. gesteigert, in den
Morgenstunden tritt nur ein schwacher Nachlaß derselben ein.
Der Puls macht 110-120 Schläge in der Minute. In der dritten
Woche des T. erreicht die Schwäche des Kranken ihren
höchsten Grad, die lauten Delirien hören auf, die
Aufregung und Unruhe weicht einer stets zunehmenden
Unempfindlichkeit für alles, was ringsumher vor sich geht. Die
Erscheinungen am Unterleib und an der Brust nehmen noch zu, auch
die Körpertemperatur und die Pulsfrequenz sind eher gesteigert
als vermindert. Die meisten Fälle eines tödlichen
Ausganges fallen in die dritte Woche. In günstigen Fällen
stellt sich etwa in der Mitte der dritten Woche eine Abnahme der
Krankheitserscheinungen ein. Die Körpertemperatur erreicht
zwar am Abend noch 40-41° C., pflegt aber des Morgens um 2°
niedriger zu sein. Nach mehreren Tagen gehen auch die
Abendtemperaturen ganz allmählich herab, mit der
Körpertemperatur sinkt auch die Pulsfrequenz. Diese allgemeine
Besserung, welche häufig auch erst in der vierten Woche
eintritt, geht entweder direkt in Genesung über, welche aber
stets sehr langsam verläuft, oder es schließen sich
Nachkrankheiten verschiedener Art oder neue Ablagerung von
Typhusmasse im Darm an (Typhusrecidiv), und der Kranke geht
darüber bald zu Grunde, bald wenigstens vergehen noch Wochen
bis zum Beginn der definitiven Genesung. Der bisher geschilderte
Verlauf des T. zeigt mannigfache Modifikationen. Unter
Abortivtyphus (Febricula, Febris typhoides) versteht man die
besonders leicht und schnell fast nach Art eines akuten
Magenkatarrhs verlaufenden Fälle von T. Eine andre
Modifikation ist der T. ambulatorius. leichte Typhusfälle, bei
welchen unter verhältnismäßig leichten anatomischen
und klinischen Erscheinungen die Kranken umhergehen und, wenn auch
mangelhaft und unter großer Selbstüberwindung, ihre
gewöhnlichen Geschäfte zu besorgen im stande sind. In
andern Fällen zeigt der T. einen höchst tumultuarischen
Verlauf, die Krankheitserscheinungen folgen schneller als
gewöhnlich auf einander, die Kranken gehen dann oft schon
frühzeitig (Ende der ersten, Anfang der zweiten Woche) zu
Grunde. Zwischen allen den genannten Typhusformen besteht jeder nur
denkbare Übergang. Unter den Zwischenfällen, welche den
normalen Verlauf des T. in den ersten Krankheitswochen
unterbrechen, sind die wesentlichsten die Verschwärungen von
Darmarterien, durch welche profuse und in nicht seltenen
Fällen tödliche Blutungen des Darms hervorgerufen werden.
Unter den zahlreichen Nachkrankheiten des T. sind zu nennen: die
Lungenentzündung, Pleuritis, die Parotitis, die
Nierenentzündung etc., Nachkrantheiten, welche in den meisten
Fällen den Tod des Patienten herbeiführen. Der
958
Typik - Typolithographie.
T. geht am häufigsten in Genesung über. Während
früher eine Sterblichkeit von etwa 25 Proz. bestand, ist
dieselbe heute auf durchschnittlich 10 Proz. herabgemindert, und
man bezeichnet eine Typhusepidemie mit höherer
Durchschnittssterblichkeit als "schwere", mit niedrigerer als
"leichte". Was die Behandlung des T. anbetrifft, so ist es
zuvörderst geraten, den Kranken zu isolieren. Das
Krankenzimmer muß groß sein und oft und gründlich
gelüftet werden. Die Zimmertemperatur darf 14° nicht
überschreiten. Der Körper des Kranken muß
ängstlich reinlich gehalten und vor dem Aufliegen
geschützt werden (durch sorgfältige Zubereitung des
Lagers). Der Mund muß mit einem reinen angefeuchteten
Leinwandläppchen regelmäßig gereinigt und der
stinkende Belag der Zähne etc. entfernt werden. Als
Getränk gibt man einfach Wasser und fordert zu fleißigem
Trinken auf. Von Medikamenten gibt es kein Spezifikum gegen T.
Vielfach wird, besonders im Anfang der Krankheit, Kalomel mit gutem
Erfolg verabreicht, von manchen eine Mischung von Jod und Jodkali
gerühmt, außerdem kommen unter Umständen
Antipyretika, wie Chinin, Salicylsäure etc., in Anwendung.
Viel wichtiger ist eine richtige Diät, die im Hinblick auf den
langwierigen und konsumierenden Verlauf des T. kräftigend und
leicht verdaulich sein muß. Deshalb wird Milch in reichlichen
Quantitäten, Kakao mit Milch, Bouillon mit Ei, bei Appetit auf
feste Speisen eingeweichtes Weißbrot und Wein gereicht. Die
Heftigkeit des Fiebers, von welcher im Anfang der Krankheit die
meiste Gefahr droht, bekämpft man durch energische
Wärmeentziehung, namentlich durch kalte Bäder. Diese
systematische, von E. Brand eingeführte Kaltwasserbehandlung
besteht in Vollbädern, die man von 24° C. auf 20°
abkühlt, und in welche man den Kranken, solange die
Körperwärme 39° C. übersteigt, von Anfang bis
Ende der Krankheit, bei Tag und bei Nacht alle 3 Stunden auf etwa
15 Minuten hineinträgt. Neben der Herabsetzung des Fiebers
erreicht man durch diese Bäderkur einmal eine Reinigung des
Körpers und ferner eine allgemeine Erfrischung und Ermunterung
besonders der unbesinnlichen Kranken. Nach dem Bad wird der Kranke
in wollenen Laken frottiert, abgetrocknet und durch Wein
gestärkt. Die schweren Typhusfälle werden hierdurch in
leichte umgewandelt, die Sterblichkeit auf ein Minimum
herabgesetzt. Während der Rekonvaleszenz muß die
Diät der Kranken mit ängstlicher Sorgfalt überwacht
werden. Die Genesenden pflegen einen außerordentlichen
Appetit zu entwickeln und müssen daher vor zu reichlichen
Mahlzeiten, schwerverdaulichen, groben Speisen sorgfältig
gehütet werden. Man wiederholt deshalb die Mahlzeiten lieber
häufiger, gibt aber nur kleine Portionen; anfangs ist nur
flüssige oder halbflüssige Nahrung (Milch, weiche Eier)
zu gewähren, allmählich geht man zu Fleischdiät und
zu Pflanzenkost über. Jeder Diätfehler bringt den
Genesenden wieder in Gefahr, und jede scheinbar geringfügige
Störung der Verdauung erfordert die sorgfältigste
Berücksichtigung.
3) Mehr mit dem Flecktyphus als dem Unterleibstyphus verwandt
ist der Rückfalltyphus (das rekurrierende Fieber, T.
recurrens, engl. Relapsing Fever). Auch diese Form des schweren
nervösen Fiebers ist ansteckend und tritt epidemisch auf,
namentlich wo eine dichte arme Bevölkerung in unreinlichen
Wohnungen und von kärglicher Nahrung lebt, so daß als
Hunger- oder Kriegstyphus bald die exanthematische, bald die
rekurrierende Krankheitsform im Vordergrund steht. Der
Rückfalltyphus ist dadurch ausgezeichnet, daß nach einem
mehrtägigen heftigen Fieber, das 40° C. und darüber
erreicht, plötzlich unter reichlichem Schweiß ein Abfall
bis zu 37 oder 36,5° C. einsetzt, an den sich eine
mehrtägige, völlig fieberfreie Pause anschließt.
Ebenso plötzlich kommt nun der Rückfall, er währt 3,
4 oder 5 Tage, und wieder sinkt er ebenso schnell wie das erste
Mal. Drei bis vier solcher Fieberperioden folgen einander, dann
tritt langsame Genesung ein. Der Tod ist so selten, daß
beinahe immer eine Lungenentzündung oder Ähnliches zu
vermuten ist, wenn ein Kranker im Fieberanfall zu Grunde geht. Die
Ursache des Rückfalltyphus ist besser gekannt als die der
andern Typhen: Obermeier hat gefunden, daß zur Fieberzeit das
Blut der Kranken zahllose mikroskopische Pilzfädchen
(Spirochäten, s. Spirillum) von geschlängelter Gestalt
enthält, welche in der fieberfreien Periode fehlen; nur das
pilzhaltige Blut vermag bei Impfungen das Krankheitsgift zu
übertragen, wie direkte Versuche an Menschen, in Odessa
ausgeführt, dargethan haben. Leider besitzen wir noch immer
keine Kunde von der Herkunft der Spirochäte und noch weniger
von einem Mittel, ihre Vegetation im lebenden Körper zu
bekämpfen. Die Behandlung besteht daher nur in Darreichung
kräftiger, anreizender Diät. Der Rückfalltyphus ist
schon im vorigen Jahrhundert in einzelnen Ländern vorgekommen;
doch hat man ihn erst genauer kennen gelernt in der von 1843 bis
1848 andauernden großen Epidemie, die Schottland und Irland
überzog, ferner bei Gelegenheit der ägyptischen Epidemie
und neuerdings 1864-1865, als die Seuche in Petersburg in
großer Ausbreitung herrschte. Seit dem Jahr 1871 ist der
Rückfalltyphus auch in einzelnen Gegenden Deutschlands in
epidemischer Verbreitung beobachtet worden. Er wurde aus Polen und
den russischen Ostseeprovinzen eingeschleppt und trat in den
östlichen Provinzen Preußens, vorzugsweise in Breslau,
1873 auch in Berlin, Leipzig, Dresden, Wien etc. auf. Vgl.
Griesinger, Infektionskrankheiten (2. Aufl., Erlang. 1864);
Girgensohn,Die Rekurrensepidemie in Riga 1865-75; Virchow,
Über den Hungertyphus und einige verwandte Krankheitsformen
(Berl. 1868); v. Pastau, Die Petechialtyphus-Epidemie in Breslau
1868/69 (Bresl. 1871); Murchison, Die typhoiden Krankheiten
(deutsch, Braunschw. 1867); Brunner, Die Infektionskrankheiten
(Stuttg. 1876); Seitz, Der Abdominaltyphus (das. 1888); Brand,
Über den heutigen Stand der Wasserbehandlung des Typhus (Berl.
1887).
Typik (griech., typische Theologie), s. Typus.
Typographie (griech.), Buchdruckerkunst.
Typolithographie (griech.), sowohl der Druck von hoch
geätzten Steinen auf der Buchdruckpresse
(Tissiérographie, s. d.) als auch der Druck von Umdrucken,
die vom Schriftsatz oder von Holzschnitten auf Stein gewonnen
wurden, deren Vervielfältigung alsdann auf der
Steindruckpresse allein oder mit lithographierten Zeichnungen
vereinigt erfolgt; letzteres geschieht meist in Fällen, wo ein
wortreicher Text, dessen Herstellung für den Lithographen
schwierig und zeitraubend sein würde, bildliche Darstellungen
zu begleiten hat. Der überdruck wird mit starker Farbe auf
glattes, festes Papier gemacht, dessen bedruckte Seite man auf den
vorgängig mit trocknem Bimsstein geschliffenen
lithographischen Stein legt, der nun durch die Presse gezogen wird.
Auch ältere Drucke lassen sich vermittelst chemischer
Behandlung auffrischen, auf Stein übertragen und
vervielfältigen (s. Anastatischer Druck und
Reproduktionsverfahren).
959
Typologie - Tyrone
Typologie (griech.), s. Typus.
Typometer (griech.), ein in der Schriftgießerei
gebrauchtes Meßinstrument zur mathematisch genauen
Feststellung der Kegelstärke der Schrift. Seit 1879 bildet das
von H. Berthold in Berlin auf wissenschaftlicher Basis
begründete T. die Norm für die Schriftgrößen
in den deutschen Gießereien.
Typometrie (griech.), das Verfahren, auf typographischem
Weg Landkarten, Pläne, geometrische Figuren herzustellen. Die
ersten Versuche von Haas in Basel (1770) und Breitkopf in Leipzig
wurden später von Didot in Paris und namentlich von
Raffelsberger in Wien vervollkommt. Die T. ist durch die Chemitypie
und die photomechanischen Reproduktionsverfahren vollständig
verdrängt.
Typoskop, s. Kaleidoskop.
Typus (griech., Mehrzahl: Typen), Vorbild, Urbild; die
mehreren Dingen einer und derselben Art oder Gattung gemeinsame
(ideelle) Grundform, z. B. T. einer Tier-, einer Pflanzengattung,
einer Krankheit etc. Typik und Typologie, in der ältern
Theologie die Wissenschaft von der vorbildlichen Beziehung, in
welcher gewisse Personen, Ereignisse, Einrichtungen und
Aussprüche des Alten Testaments mit ihren entsprechenden
Gegenbildern (Antitypen) im Christentum stehen sollten.
Tyr, in der nordischen Mythologie Sohn Odins und der
Frigg, der Gott des Kriegs und des Schwerts, einer der vornehmsten
Asen. Er allein besaß den Mut, den grimmigen Fenrirwolf, der
die Asen in Asgard bedrohte, zu bändigen, wobei er seine eine
Hand einbüßte. Beim Weltuntergang kämpft er mit dem
Höllenhund Garm, und beide töten sich wechselseitig. Nach
ihm wurde der Dienstag (s. d.) benannt. Bei den alten Sachsen
hieß T. Saxnot (angels. Saxneat), bei den Schwaben Ziu.
Tyralin, s. v. w. Fuchsin, s. Anilin, S. 591.
Tyrann (griech. Tyrannos), ursprünglich jeder
unbeschränkte Herrscher, dann insbesondere ein
Alleinherrscher, der nicht durch Erbschaft, sondern durch den
gewaltsamen Umsturz der bestehenden Verfassung an die Spitze des
Staats gekommen war, so daß man unter T. im geschichtlichen
Sinn den Inhaber einer angemaßten Alleinherrschaft (Tyrannis)
zu verstehen hat, während Äsymnet (s. d.) einen durch
friedliche Übereinkunft zur Neuordnung der Verfassung
eingesetzten Herrscher bezeichnet. Die Tyrannis ist im 7. und 6.
Jahrh. v. Chr. in vielen griechischen Staaten die Zwischenstufe
zwischen der oligarchischen oder aristokratischen Staatsform und
der Demokratie, indem sich ein ehrgeiziges Mitglied der
Aristokratie an die Spitze des unterdrückten Volkes stellte,
sich eine Leibwache geben ließ und mit dieser den Staat nach
unbeschränkter Willkür beherrschte; während der
reiche Adel unterdrückt wurde, hoben die Tyrannen das Volk
durch Erhaltung des Friedens, Begünstigung von Handel und
Gewerbe, Bauten u. dgl. Daher gab es unter den Tyrannen viele
treffliche Herrscher, wie Peisistratos in Athen, Gelon und Hieron
II. in Syrakus, Periandros in Korinth, Kleisthenes in Sikyon u. a.;
jedoch auch diese oder ihre Nachkommen wurden meist durch den
gewaltthätigen Ursprung ihrer Macht schließlich doch zu
neuen Gewalttaten getrieben. Als daher nach dem allgemeinen Sieg
der republikanischen Staatsform in Griechenland die Monarchie
überhaupt als eine unwürdige, sklavische Staatsform
angesehen wurde, verband man mit dem Namen eines Tyrannen den
Begriff eines grausamen, willkürlichen Herrschers, wie es
deren in der Zeit des Verfalls mehrere gab; in diesem Sinn
heißen auch die von Lysandros in Athen zur Einführung
einer neuen Verfassung eingesetzten 30 Männer, welche ihr Amt
zu grausamer Willkürherrschaft mißbrauchten, die
Dreißig Tyrannen. In der spätern römischen
Geschichte werden die Statthalter, die sich unter Gallienus in den
verschiedenen Provinzen des Reichs 260-268 n. Chr. zu Gegenkaisern
aufwarfen, aber bald wieder gestürzt wurden, auch als
dreißig Tyrannen bezeichnet. Vgl. Plaß, Die Tyrannis
bei den Griechen (Leipz. 1859, 2 Bde.).
Tyrann (Königswürger, Tyrannus intrepidus
Temm.), Vogel aus der artenreichen, nur in Amerika vertretenen
Familie der Tyrannen (Tyrannidae) und der Ordnung der
Sperlingsvögel, 21 cm lang, mit ziemlich langen, spitzen
Flügeln, ziemlich langem, breitem, abgerundetem Schwanz,
kräftigen, hochläufigen, starkzehigen Beinen und etwa
kopflangem, starkem, geradem, an der Spitze hakig herabgebogenem
Schnabel, ist oberseits dunkel blaugrau mit einer Haube aus
feuerfarbig gerandeten Federn, auf der Unterseite grauweiß,
an Hals und Kehle weiß, mit bräunlichschwarzen, an der
Spitze weißen Schwingen und Steuerfedern. Er lebt als
Zugvogel in Nordamerika, findet sich in Baumgärten, an
Waldrändern, Ufern und auf Feldern, nährt sich von
Kerbtieren und verfolgt mit dem größten Mut
Raubvögel, Krähen und Katzen, besonders während das
Weibchen brütet, zum Schutz des eignen Nestes. Das Gelege
besteht aus 4-6 rötlichweißen, braun getüpfelten
Eiern. Man jagt ihn seines zarten Fleisches halber.
Tyrannius, Kirchenschriftsteller, s. Rufinus 2).
Tyras, antiker Name des Dnjestr.
Tyraß, Deckgarn zum Fang von Rebhühnern etc.
von etwa 20 m Länge und 15 m Breite mit 4 cm. Maschenweite,
von starkem Garn spiegelig gestrickt. Zwei Jäger ziehen das
Garn an einer daran befestigten Leine über die Hühner,
vor welchen ein sicherer Hühnerhund feststeht, nach diesen zu
und bedecken sie mit dem Rock, wenn sie unter dem Netz
aufflattern.
Tyree (spr. tirríh), Insel, s. Tiree.
Tyres (engl., spr. teirs), s. v. w. Tires.
Tyrnau, s. Tirnau.
Tyrnavos, Hauptort der gleichnamigen Eparchie im
griechischen Nomos Larissa (Thessalien), am nördlichen Ufer
des Xerias (Europos), 3 km von der türkischen Grenze gelegen,
hat (1883) 4337 Einw., gute Schulen, eine Kaserne und Baumwoll- und
Seidenweberei.
Tyroglyphus, s. Milben; Tyroglyphidae (Käsemilben),
Familie aus der Ordnung der Milben (s. d., S. 606).
Tyrolienne (franz.), s. Ländler.
Tyrone (spr. tirróhn) , Binnengrafschaft in der
irischen Provinz Ulster, umfaßt 3264 qkm (59,3 QM.), wovon 42
Proz. auf Seen, Sümpfe und Moore kommen, ist, mit Ausnahme des
östlichen Teils am See Neagh, ein Hügelland und reich an
Naturschönheiten, weshalb sie vielfach von Touristen besucht
wird. Indes steigen die Hügel nur an der Nordgrenze (Slieve
Sawel 683 m) zu bedeutenderer Höhe an. Unter den zahlreichen
kleinen Flüssen sind der Foyle (Strule), mit seinen
Zuflüssen Moyle und Derg, und der Blackwater die wichtigsten.
Der Boden ist an einzelnen Stellen, besonders in den Sumpf- und
Moorgegenden, der Kultur ganz unzugänglich, an andern Stellen
dagegen höchst fruchtbar und erzeugt dort alle in Irland
überhaupt heimischen Produkte. Von Mineralien werden
Steinkohlen in geringer Menge gewonnen. Die Bevölkerung ist
sehr im Abnehmen begriffen (1851 : 251,865, dagegen 1881 nur noch
197,719 Seelen, worunter 56 Proz. Katholiken) und lebt in
960
Tyros - Tzetzes.
größter Dürftigkeit. Haupterwerbsquelle ist die
Viehzucht (1881: 23,823 Pferde, 155,116 Rinder, 45,933 Schafe,
28,417 Schweine), weniger der Ackerbau. Die Industrie
beschränkt sich auf Flachs- und Garnspinnerei; ebenso ist der
Handel ohne wesentliche Bedeutung. Hauptstadt ist Omagh.
Tyros (hebr. Sor, "Felsen"), eine der berühmtesten
Städte des Altertums, nebst Sidon die wichtigste und reichste
See- und Handelsstadt Phönikiens, 200 Stadien (38 km) von
Sidon, lag teils auf dem Festland, teils auf zwei kleinen, flachen,
aber felsigen Inseln und war weniger bedeutend, bis im 10. Jahrh.
v. Chr. König Hiram, der Freund Davids und Salomos, die beiden
Inseln durch Aufschüttung vereinigte und erweiterte, zwei
Häfen anlegte und die Stadt mit hohen Mauern umgab. Die
Doppelinsel, 1600 Schritt von der Festlandküste entfernt,
hatte nur 22 Stadien (5300 Schritt) im Umfang, weshalb man
genötigt war, die Häuser sehr hoch (5-6 Stockwerke) zu
bauen. Auf ihr befand sich ein uralter Tempel des Melkart, der von
den Kolonien jährlich mit Geschenken beschickt wurde. T.
überflügelte bald Sidon, beherrschte den Handel und die
Kolonisation im westlichen Mittelmeer (von hier ging 846 v. Chr.
die Gründung Karthagos aus) und brachte die ganze
südliche Küste bis zum Berg Karmel unter seine Gewalt.
Die assyrischen Könige Salmanassar und Sargon belagerten T.
fünf Jahre lang, 725-720, vergeblich, und Nebukadnezar konnte
es erst 573 nach 13jähriger Belagerung erobern. Als Alexander
nach dem Sieg bei Issos 333 Phönikien betrat, verweigerte T.
dem Sieger den Einzug, wurde von diesem belagert, aber erst nach
siebenmonatlicher schwerer Anstrengung der Flotte und Landarmee,
welch letztere auf einem vom Festland aus geführten Erddamm
vorging, erobert (332). Dieser Damm hat sich allmählich durch
Anspülung zu jenem Isthmus verbreitert, welcher die Insel
heute mit dem Festland verbindet. Die Stadt hatte dann noch einmal
eine 14monatliche Belagerung durch Antigonos auszuhalten. Unter der
römischen Herrschaft behielt sie ihre Freiheit und eigne
Verfassung, blühte durch Handel und Industrie (Metallwaren,
Weberei und Purpurfärberei) und ward vom Kaiser Severus zur
römischen Kolonie erhoben. In den Kreuzzügen galt sie
für einen festen Platz, der von den Kreuzfahrern bis 1191
standhaft behauptet wurde. Friedrich Barbarossa wurde 1190 dort
begraben. Unter der türkischen Regierung kam T. herab;
verheerende Erdbeben hatten das Versinken ganzer Stadtteile unter
den Meeresspiegel zur Folge. Das heutige Sur erfüllt kaum ein
Dritteil der ehemaligen Insel und ist ein Ort von einigen hundert
elenden Häusern mit ca. 5000 Einw. (zur Hälfte
Mohammedaner, zur Hälfte Christen, wenige Juden). Der Hafen
ist versandet. Das interessanteste Gebäude ist die aus dem 12.
Jahrh. stammende Kreuzfahrerkirche.
Tyrosin C9H11NO3 findet sich in einigen tierischen
Geweben, besonders in der Leber und Bauchspeicheldrüse,
entsteht neben Leucin bei der Fäulnis eiweißartiger
Stoffe (daher im alten Käse) und bei Behandlung derselben, der
Wolle und des Horns mit verdünnter Schwefelsäure oder
kaustischen Alkalien. Es bildet feine, farb- und geruchlose
Kristalle, löst fich in Wasser und Alkohol, nicht in
Äther und verbindet sich mit Säuren, Basen und Salzen,
gibt bei schnellem Erhitzen Phenol, mit schmelzendem Ätzkali
Paraoxybenzoesäure, Essigsäure und Ammoniak.
Tyrrhener (Tyrrheni,Tyrseni), pelasgischer Volksstamm,
der, vor dem Trojanischen Krieg aus Kleinasien verdrängt, sich
nach Attika gewendet, dann aber, auch von dort vertrieben, sich
zerstreut und namentlich auf Lemnos, Imbros und an der Küste
von Italien angesiedelt haben soll, wo er sich durch seine
Seeräubereien den Hellenen furchtbar machte. Von den Griechen
werden aber auch die Etrusker T. sowie deren Land Tyrrhenien
genannt, und es wird erzählt, daß Tyrrhenus, Sohn des
lydischen Königs Atys, dahin ausgewandert sei und dem Land und
Volk den Namen gegeben habe. S. Etrurien.
Tyrrhenisches Meer (Toscanisches Meer), der Teil des
Mittelländischen Meers, welcher zwischen der
Südwestküste Italiens und den Inseln Corsica, Sardinien
und Sizilien liegt und die Golfe von Gaeta, Neapel, Salerno, Sant'
Eufemia und Gioja bildet; hieß im Altertum Mare Tyrrhenum
oder Mare Tuscum (nach dem an seiner Küste herrschenden
tyrrhenischen Stamm der Etrusker oder Tusker), auch Mare inferum.
S. Karte "Mittelmeerländer".
Tyrtäos, griech. Elegiker des 7. Jahrh. v. Chr., aus
Athen oder aus Aphidnä in Attika, verpflanzte die ionische
Elegie nach dem dorischen Sparta. Nach der Sage erbaten die
Spartaner in der Bedrängnis des zweiten Messenischen Kriegs
auf die Weisung des delphischen Orakels einen Führer von den
Athenern, die ihnen den lahmen T. schickten; diesem gelang es,
durch seine Elegien die entzweiten Spartaner zur Eintracht
zurückzuführen und zu solcher Tapferkeit zu entflammen,
daß sie den Sieg gewannen. Gewiß ist, daß sich
T.' Gesänge bis auf die spätesten Zeiten im Munde der
spartanischen Jugend erhielten. Sie waren teils im elegischen
Versmaß und in episch-ionischer Mundart, teils im
anapästischen Marschmetrum abgefaßt. Außer
Bruchstücken einer "Eunomia" ("Gesetzmäßigkeit")
betitelten Elegie, durch welche er die Zwietracht der Spartaner
beschwichtigte, und eines Marschliedes besitzen wir von seinen
"Ermahnungen" ("Hypothekar") genannten Kriegselegien noch drei
vollständig, die zu den schönsten Überresten der
antiken Poesie gehören. Ausgaben von Schneidewin ("Delectus
poesis graecae elegiacae", Bd. 1, Götting. 1838) und Bergk
("Poetae lyrici graeci", Bd.2); Übersetzung von Weber("Die
elegischen Dichter der Hellenen", Frankf. 1826) u. a.
Tysmienica, Stadt in Galizien, Bezirkshauptmannschast
Tlumacz, an der Staatsbahnlinie Stanislau-Husiatyn, mit
Bezirksgericht, Schloß, Dominikanerkloster, Handel (Pferde)
und (1880) 7180 Einw.
Tyssaer Wände, s. Tetschen.
Tzako, s. v. w. Tschako.
Tzendalen (Tsendals), Indianerstamm, zum Mayastamm
gehörig, im mexikan. Staat Chiapas und im benachbarten
Guatemala, an den Quellen von Tabasco und Uzumazinta. Vgl. Stoll,
Zur Ethnographie der Republik Guatemala (Zürich 1884).
Tzetzes, Johannes, griech. Grammatiker und Dichter aus
der zweiten Hälfte des 12. Jahrh., lebte in Konstantinopel vom
Hof, namentlich von der Kaiserin Irene, begünstigt und war ein
für seine Zeit belesener, aber oberflächlicher und
dünkelhafter Gelehrter, wie seine zahlreichen Schriften
erkennen lassen. Außer Kommentaren zu Homer, Hesiod,
Aristophanes, Lykophron u.a., deren Wert in den benutzten Schriften
beruht, verfaßte er ein Epos in 1665 schlechten Hexametern:
"Iliaca", bestehend aus drei Abteilungen: "Antehomerica",
"Homerica" u. "Posthomerica" (hrsg. von Bekker, Berl. 18I6; von
Lehrs, Par. 1840), und ein "Geschichtenbuch" ("Biblos historike")
von 12,661 politischen Versen, gewöhnlich nach einer
unbegründeten Einteilung in 13 Abschnitte von ca. 1000 Versen
"Chiliades" genannt (hrsg. von Kießling,
961
Tzimisces - Ubbelohde.
Leipz. 1826), eine ebenso ungenießbare wie durch die
Fülle sonst verlorner Notizen wertvolle Sammlung mythischer
und historischer Erzählungen.
Tzimisces, Johannes, oström. Kaiser, geboren um 925
in Armenien, kämpfte siegreich gegen die Araber,
unterstützte Nikephoros Phokas 963 bei seiner Thronbesteigung,
ermordete ihn aber 11. Dez. 969 auf Anstiften der Kaiserin
Theophano, welche er darauf nach der Insel Prote verbannte, und
nahm selbst vom Thron Besitz. Obwohl zu Ausschweifungen geneigt,
regierte er mild und gerecht, besiegte den russischen Fürsten
Swätoslaw, welcher das zerrüttete Bulgarenreich zu
erobern suchte, in heftigen Kämpfen 970 und 971, machte selbst
die Bulgaren unterthänig und setzte ebenso glücklich die
Eroberungen seines Vorgängers in Syrien und Armenien fort. Mit
dem deutschen Kaiser Otto I. schloß er Frieden und sandte die
Prinzessin Theophano als Gattin für den Sohn desselben, Otto
II. (972). Er starb schon 976, wahrscheinlich vergiftet.
Tzschirner, Heinrich Gottlieb, protest. Theolog, geb. 14.
Nov. 1778 zu Mittweida in Sachsen, ward Diakonus in seiner
Vaterstadt, 1805 Professor der Theologie zu Wittenberg und 1809 in
Leipzig, 1815 auch Superintendent daselbst, 1818 Domherr des
Hochstifts Meißen; starb 17. Febr. 1828. Als akademischer
Lehrer übte T. großen Einfluß. Unter seinen
durchweg den rationalistischen Standpunkt vertretenden Schriften
nennen wir: "Der Fall des Heidentums" (Leipz. 1829); die
Fortsetzung der "Kirchengeschichte" Schröckhs (s. d.);
"Protestantismus und Katholizismus aus dem Standpunkt der Politik"
(4. Aufl., das. 1824); "Das Reaktionssystem" (2. Aufl., das. 1825).
Mit Stäudlin gab er das "Archiv für alte und neue
Kirchengeschichte", mit demselben und Vater das "Kirchenhistorische
Archiv", mit Keil und Rosenmüller die "Analekten" heraus und
redigierte seit 1822 das "Magazin für Prediger". Aus seinem
Nachlaß erschienen "Vorlesungen über die christliche
Glaubenslehre" (Leipz. 1829).
U
U, u, lat. U, u, der dumpfste und tiefste der Vokale,
entsteht dadurch, daß bei der Aussprache die ganze Zunge nach
hinten gezogen und in ihrem hintern Teil zum Gaumen emporgehoben
wird, während die Lippen sich bis auf eine kleine
kreisförmige Öffnung zusammenziehen und gleichzeitig
etwas vorgeschoben werden. Es bildet sich dadurch ein ziemlich
großer Resonanzraum mit kleiner runder
Ausflußöffnung von der Gestalt einer bauchigen Flasche
ohne Hals; solche Flaschen geben die tiefsten Töne. Daher ist
es bei musikalischen Kompositionen eine Regel, auf ein u keinen
hohen Ton zu setzen, weil derselbe nicht gesungen werden kann. In
der Sprachgeschichte zeigt das u vielfach die Tendenz, in das
hellere v, namentlich aber in das noch hellere ü
überzugehen. So wird das französische u schon im
Altfranzösischen wie ü gesprochen; hieraus ist das
englische u = ju, z. B. in hue (spr. hjuh), entstanden,
während das kurze englische u meist wie ö gesprochen
wird. Auch das griechische Zeichen &ny;, von dem unser u
abstammt, nahm früh die Bedeutung eines ü an,
während der einfache Laut u durch die zwei Buchstaben ou
ausgedrückt wurde. Als die Römer ihr Alphabet von den
unteritalischen Griechen übernahmen, hatte u oder v noch den
Lautwert eines u; sie gaben ihm aber die Doppelbedeutung eines u
und eines w. Erst im Mittelalter begann man zwischen u (u) und v
(v) auch in der Schrift den noch jetzt bestehenden Unterschied zu
machen; dazu kam dann ein neues Zeichen für w (s. W). Noch
jetzt ist das u Vertreter des w in der deutschen und englischen
Aussprache des qu, worin q für k steht. Das deutsche ü,
der Umlaut von u, tritt ebenso wie das u der Kurrentschrift mit
u-Häubchen (u-Strich) erst im spätern Mittelalter auf;
ersteres stammt von einem u mit darübergeschriebenem e,
letzteres von u mit darübergesetztem o ab.
Abkürzungen.
Als Abkürzung bezeichnet U bei den Römern unter anderm
Urbs ("Stadt", nämlich Rom), insbesondere u. c. bei
chronologischen Angaben urbis conditae (urbe condita). d. h. von
der Erbauung der Stadt (Rom) an gerechnet. In der Chemie ist U
Zeichen für Uran; in den Blaufarbenwerken für Kobaltblau
(s. d.).
u. = Ultimo (s. d.).
u. A. w. g. = um Antwort wird gebeten.
u. c., in der Musik = una corda (s. Corda).
u. i. = ut infra (lat.), wie unten
u. j. d. = utriusqae juris doctor (lat.), Doktor beider
Rechte.
U. K. = United Kingdom, Vereinigtes Königreich
(Großbritannien).
U. L. F. = Unsre Liebe Frau, d. h. die Jungfrau Maria.
ü. M. = über dem Meeresspiegel (bei
Höhenangaben).
u. s. = ut supra (lat.), wie oben.
U. S. oder U. S. A. (Am.) = United States (of America),
Vereinigte Staaten von (Nord-)Amerika; vgl. "Uncle Sam".
U. S. A. = United States Army, Armee der Verein. Staaten.
U. S. N. = United States Navy, Marine der Verein. Staat.
U. S. S. = United States Ship, Schiff der Ver.Staat.-Marine.
U. T. = Utah Territory.
Ü, ü, s. U
Ualan (Kusaie), Insel der Karolinen (s. d.).
Uapou, eine der Markesasinseln (s. d.).
Uba, Stadt im S. der brasil. Provinz Minas Geraes, hat
wichtige Kaffeekultur und steht mit Rio de Janeiro durch eine
Eisenbahn in Verbindung.
Ubaldo del Monte, Guido, Militär und Mathematiker,
geb. 1545 zu Pesaro, 1588 Generalinspektor der toscanischen
Festungen, starb 1607. In seinem "Mechanicorum liber" (Pesaro 1577)
kommt zuerst das mechanische Prinzip der virtuellen
Geschwindigkeiten in Anwendung; außerdem schrieb er:
"Planisphaericorum theorica" (das. 1579); "De perspectiva libri VI"
(das. 1600); "Problematorum astronomicorum libri VI" und "De
cochlea libri VI" (Vened. 1610).
Ubangi (Mobangi), großer Nebenfluß des Congo
von N. her, nach van Gele der Unterlauf des Uelle (s. d.).
Ubate, Stadt im Staat Cundinamarca der südamerikan.
Republik Kolumbien, 2562 m ü. M., am Sabia, der nördlich
davon durch den Alpensee Fuquera fließt, mit (1870) 7256
Einw.
Ubbelohde, August, namhafter Romanist, geb. 18. Nov. 1833
zu Hannover, wo sein Vater Wilhelm U., der sich auch als
Schriftsteller durch sein "Statistsches Repertorium über das
Königreich Hannover" (Hannov. 1823) und die Schrift "Über
die Finanzen des Königreichs Hannover" (das. 1834) bekannt
962
Übeda - Überfracht.
machte, vortragender Rat im Finanzministerium war, studierte in
Göttingen, Berlin und wieder in Göttingen die Rechte,
trat 1854 in den praktischen Justizdienst und habilitierte sich
1857 in Göttingen als Privatdozent für römisches
Recht. 1862 wurde er zum außerordentlichen Professor für
hannöversches Privatrecht und Landwirtschaftsrecht ernannt,
1863 Sekretär des Provinzial-Landwirtschaftsvereins für
Göttingen und Grubenhagen, 1865 geschäftsführender
Redakteur des "Journals für Landwirtschaft". Ostern 1865
folgte er einem Ruf als ordentlicher Professor des römischen
Rechts an die Universität Marburg, die er seit 1871 im
preußischen Herrenhaus vertritt. 1886 ward er zum Geheimen
Justizrat ernannt. Außer zahlreichen Abhandlungen in
verschiedenen Zeitschriften veröffentlichte er: "Über den
Satz 'ipso jure compensatur'" (Götting. 1858); "Die Lehre von
den unteilbaren Obligationen" (Hannover 1862); "Über die
rechtlichen Grundsätze des Viehhandels" (Götting. 1865);
"Erbrechtliche Kompetenzfragen" (das. 1868); "Zur Geschichte der
benannten Realkontrakte auf Rückgabe derselben Spezies" (Marb.
1870); "Über die Usucapio pro mancipato" (das. 1870);
"Grundriß zu Vorlesungen über die Geschichte des
römischen Privatrechts" (2. Aufl., das. 1881); "Über
Recht und Billigkeit" (Hamb. 1887).
Ubeda, Bezirksstadt in der span. Provinz Jaen, auf einem
Plateau (600 m ü. M.) zwischen dem Guadalquivir und Guadalimar
gelegen, hat ein großes Kastell, einige gotische Kirchen,
Fabrikation von Tuch, Leder und Seife, Wein- und Ölhandel und
(1878) 18,149 Einw. U. war zur Zeit der Mauren eine sehr
blühende Stadt. Hier 1210 Sieg der Könige von Navarra und
Kastilien über Abdallah Mohammed von Marokko.
Übelkeit (Übelsein, Nausea), s. Ekel.
Über Bank feuern Geschütze in Feldlafetten,
wenn sie hinter der Brustwehr auf einer Geschützbank (s. d.)
stehen, um nach allen Richtungen über die Brustwehr
hinwegfeuern zu können.
Überbaurecht, s. Baurecht, S. 526.
Überbein (griech., Ganglion), eine
eigentümliche harte Anschwellung in der Nähe gewisser
Gelenke, namentlich des Handgelenks, am Fußrücken etc.,
welche meist eine länglichrunde Gestalt und mäßige
Größe, etwa die einer Bohne, besitzt, nicht schmerzhaft
und von gesunder Haut bedeckt ist. Die Überbeine stehen immer
in einer nahen anatomischen Beziehung zu den Gelenkkapseln und
Sehnenscheiden, neben denen sie liegen, und erweisen sich bei
genauerer Untersuchung als cystenartige Bildungen, welche von einer
dünnen fibrösen Hülle umgeben und mit einer
dickflüssigen, gallertartigen oder erstarrten und glasig
durchsichtigen Masse erfüllt sind. Diese Inhaltsmasse ist
wahrscheinlich eingedickte Synovia oder Gelenkschmiere, der Sack
des Überbeins aber ist als Ausstülpung der innern
Auskleidungsmembran einer Sehnenscheide oder eines Kapselbandes zu
betrachten. Das Ü. entsteht bald ohne nachweisbare Ursache,
bald auch durch übermäßige Anstrengung, Dehnung und
Zerrung eines Gelenks. Die meisten Überbeine veranlassen keine
Beschwerden, zuweilen aber beeinträchtigen sie die Bewegungen
der Hand oder des Fußes mehr oder weniger erheblich.
Behandlung des Überbeins besteht am besten im Zerdrücken
der kleinen Geschwulst mit den Fingern. Geschieht dies nicht, so
reicht auch fortgesetztes Kneten aus. Gewaltsam kann man das
Ü. sprengen durch Ausschlagen mit einem Hammer, nachdem man
zuvor die Stelle durch Watte gut geschützt hat. Führt das
angegebene Verfahren nicht zum Ziel, so muß das Ü.
entweder angestochen und sein Inhalt ausgedrückt, oder die
ganze Geschwulst Mithilfe des Messers ausgeschält werden. Die
operative Behandlung ist jedoch nicht ganz unbedenklich, weil dabei
leicht eine Verletzung, ja selbst Eröffnung benachbarter
Gelenke stattfinden kann.
Überbildung, s. Viehzucht.
Überblasen heißt auf einem Blasinstrument anstatt
des Grundtons einen seiner höhern Naturtöne
hervorbringen. Bei sämtlichen Blasinstrumenten des Orchesters
ist das Ü. notwendig, und sind die Tonlöcher, Klappen,
Ventile etc. nur dazu da, die Lücken zwischen den
Naturtönen (s. Obertöne) auszufüllen. Man
unterscheidet Instrumente, bei denen beim Ü. nur die
geradzahligen Töne der harmonischen Reihe ansprechen, als
erster also die Duodezime, als quintierende von den oktavierenden,
bei denen auch die geradzahligen ansprechen; zu erstern gehört
die Klarinette und ihre Verwandten, zu letztern die Flöte,
Oboe, Fagott, Horn, Trompete, Posaune etc.
Überbrochenes Feld, im Bergbau ein Feld, welches
völlig abgebaut ist.
Überbürgschaft, s. Afterbürgschaft.
Überdruck (Umdruck), s. Lithographie, S. 837.
Überfahren, im Bergbau eine Lagerstätte mittels
eines bergmännischen Baues durchschneiden oder auch eine
Lagerstätte ihrem Streichen nach verfolgen; auch die Grenze
der Grubenfelder beim Abbau überschreiten.
Überfahrtsvertrag (Passagevertrag), der von dem
Verfrachter mit einem Reisenden zum Zweck der
Personenbeförderung zur See abgeschlossene Vertrag (s. Fracht,
S. 477). Wird das Schiff als Ganzem oder zu einem Teil oder
dergestalt verfrachtet (gechartert), daß eine bestimmte Zahl
von Reisenoen, z. B. von einer Auswanderungsagentur, befördert
werden soll, so kommen die Grundsätze des deutschen
Handelsgesetzbuchs (Art. 557 ff.) über den Frachtvertrag bei
Beförderung von Gütern zur See insoweit zur Anwendung,
als die Natur der Sache dieselbe nicht ausschließt (s.
Fracht). Vgl. Deutsches Handelsgesetzbuch, Art. 665 ff.
Überfall, auf Überraschung des Feindes
berechneter Angriff, besonders ein solcher, dem ein geheimer
Anmarsch gegen die feindliche Aufstellung vorhergeht, wie ihn die
Österreicher unter Daun 14. Okt. 1758 gegen die bei Hochkirch
lagernde Armee Friedrichs d. Gr. während der Nacht und vom
Nebel begünstigt ausführten. Nach einem mißlungenen
Ü. muß auf das Rückzugszeichen alles schnell dem
festgesetzten Sammelplatz zueilen, wo eine Reserve in vorteilhafter
Stellung die einzelnen Abteilungen aufnimmt oder wenigstens das
Sammeln und einen geordneten Rückzug erleichtert. Wegen
Ü. einer Festung s. Festungskrieg, S. 188.
Überfälliger Wechsel, schon verfallener
Wechsel.
Überfallsrecht, s. Überhangsrecht.
Überfangen, in der Glasfabrikation, s. Glas, S.
390.
Überflügeln, in taktischer Bedeutung: die
feindliche Fronte dergestalt angreifen, daß sie von der
diesseitigen an einem oder beiden Enden überragt, der Feind
also an den Flügeln auch in der Flanke und im Rücken
gefaßt wird. Zur Zeit der Lineartaktik überflügelte
man den Gegner direkt durch Ausdehnung der eignen Linie. Das kommt
heute nur noch bei Kavallerieangriffen vor; sonst schickt man
außer Sehweite und Schußbereich des Feindes besondere
Abteilungen gegen dessen Flügel und Flanke.
Überfracht, der über den bedungenen Betrag
hinausgehende Teil an Frachtkosten, welcher entsteht, wenn ein
Schiff durch Havarie genötigt wird, seine Güter
963
Überfruchtung - Überlieferung.
in ein andres Schiff umzuladen. Die Ü. ist eventuell durch
den Versicherer zu erstatten.
Überfruchtung (Superfoecundatio) und
Überschwängerung (Superfoetatio), die abermalige
Befruchtung und Schwängerung einer Person, welche bereits
empfangen hat. Beide unterscheiden sich nur durch die Zwischenzeit,
welche zwischen der ersten und zweiten Empfängnis liegt.
Erfolgt nämlich die zweite Befruchtung kurze Zeit nach der
ersten, wenn die hinfällige Haut (decidua) an der
Innenfläche der Gebärmutter noch nicht gebildet und das
zuerst befruchtete Ei noch nicht in die Gebärmutterhöhle
gelangt ist, so nennt man dies Ü. Dagegen versteht man unter
Überschwängerung denjenigen Vorgang, wo nach bereits
erfolgtem Eintritt des befruchteten Eies in die
Gebärmutterhöhle und nach bereits gebildeter Decidua
daselbst eine zweite Empfängnis statthaben soll. Ü. kommt
bei Tieren erwiesenermaßen vor; beim Menschen ist sie wohl
möglich und denkbar, aber noch nicht durch sichere Thatsachen
erwiesen. Das Faktum wenigstens, daß ein Weib Kinder von
verschiedener Rasse zur Welt bringt, nachdem sie mit Männern
der gleichen Rasse den Beischlaf vollzogen hat, ist auch auf anderm
Weg erklärbar. Überschwängerung ist aber beim
Menschen nur in den sehr seltenen Fällen denkbar, wenn eine
doppelte Gebärmutter vorhanden ist; doch ist auch für
diesen Fall das Vorkommen der Überschwängerung noch nicht
sicher beobachtet worden.
Übergabe, s. Tradition.
Übergangsformen, s. Darwinismus, S. 568.
Übergangsgebirge (Grauwackegruppe), in der
ältern Geologie Bezeichnung der ältesten
versteinerungführenden Sedimente unter dem Steinkohlengebirge,
weil nach Ansicht Werners ihre Gesteine, insbesondere die
Thonschiefer, ohne bestimmte Grenze in ihre kristallinische
Unterlage übergehen, sie also gleichsam einen Übergang
von seinem Urgebirge in die sekundären Sedimente bildeten.
Nach jetzt gebräuchlicher Nomenklatur entsprechen die
silurische und devonische Formation dem Ü.
Übergangssteuern (Übergangsabgaben) werden in
Deutschland von solchen, im allgemeinen Verbrauchssteuergebiet
anders als in den süddeutschen Staaten belasteten
Gegenständen (Branntwein, Bier, Malz) erhoben, welche die
Grenzen ihres Steuerbezirks überschreiten. Diejenigen Staaten,
welche Gegenstände des Verbrauchs besteuern, können den
gesetzlichen Betrag der Steuer bei der Einfuhr solcher
Gegenstände aus dem andern Staat voll erheben. Dagegen darf
das Erzeugnis eines andern Staats unter keinem Vorwand höher
oder in lästigerer Weise besteuert werden als dasjenige der
übrigen.
Übergangsstil, in der Geschichte der Baukunst
diejenige Periode, während welcher der spätromanische
Stil den Spitzbogen aufnahm und unter dem Einfluß desselben
sich allmählich zum gotischen Stil umwandelte. In Deutschland
herrschte der Ü. während des letzten Viertels des 12. und
der ersten Hälfte des 13. Jahrh. Näheres s. Baukunst, S.
495.
Übergründet nennt man eine Aktiengesellschaft,
wenn die Gründer die Vermögensstärke der
Gesellschaft zu hoch in Ansatz bringen. Gegen solche
Übergründungen sind die Vorschriften im deutschen
Aktiengesetz vom 18. Juli 1884, Art. 209b ff. gerichtet.
Überhaltbetrieb, forstliche Betriebsart, s.
Hochwald.
Überhangsrecht und Überfallsrecht, der
Grundsatz des deutschen Rechts, wonach dem Inhaber eines
Grundstücks das Recht zusteht, die von den Bäumen und
Gesträuchen des Nachbargrundstücks auf das seinige
herabhängenden und herabfallenden Früchte sich
anzueignen, wie das Rechtssprichwort sagt: "Wer den bösen
Tropfen genießt, genießt auch den guten"; auch im
Entwurf eines deutschen bürgerlichen Gesetzbuchs (§ 862)
anerkannt. Vgl. A. B. Schmidt, Das Recht des Überhangs und
Überfalls (Bresl. 1886).
Überhitzt, s. Dampf, S. 446.
Überkingen, Dorf im württemberg. Donaukreis,
Oberamt Geislingen, in einem tiefen Thal der Alb, an der Fils, hat
eine evang. Kirche, Elfenbeindreherei, Zementwarenfabrikation und
(1885) 550 Einw. Dazu das Stahlbad Ü. mit salinischem
Eisensäuerling.
Überlandbrennen, s. Hainen.
Überlandpost, die
Postbeförderungs-Einrichtungen der großen
internationalen Postkurse, auf denen ein regelmäßiger
Austausch bedeutender Korrespondenzmassen zwischen entfernten
Ländern über zwischenliegende Postgebiete auf dem Landweg
stattfindet, im engern Sinn die indische Ü., d. h. die
regelmäßige Vermittelung des Briefverkehrs zwischen
Großbritannien, Indien, Ostasien und Australien auf dem Weg
über Frankreich und Italien. Die Absendung der indischen
Ü. erfolgt jeden Freitag abends aus London über Dover,
Calais, den Mont Cenis und Brindisi (in Brindisi Montag Mittag),
von wo ab die Post durch Dampfer der Peninsular and Oriental
Steam-Ship Company durch den Suezkanal, Bombay und Ceylon
anlaufend, nach Kalkutta geführt wird. Jeden zweiten Freitag
schließt sich in Ceylon eine Linie nach Ostasien und
Australien an (große Ü.: Indian-Australian Mail). Die
englisch-indische Ü. umfaßt (1889) jährlich rund
60,000 geschlossene Postsäcke mit einem Gesamtgewicht von
900,000 kg, wovon ungefähr 45,000 Säcke auf die Richtung
aus Europa und 15,000 Säcke auf die Richtung aus Indien
entfallen. Einzelne größere Posten zählten bis zu
2000 Säcken, welche auf der Eisenbahn eine stattliche Zahl von
Packwagen anfüllen. Von den über Brindisi gehenden
Überlandposten hat neben der britischen zur Zeit die
größte Bedeutung die deutsche Ü. für Indien,
Ostasien und Ozeanien, welche zum Teil mit den britischen Dampfern,
zum Teil mit den jeden zweiten Freitag aus Brindisi abgehenden
deutschen Postdampfern Beförderung erhält. Jede vierte
Woche schließen die deutschen Dampfer nach Ostasien und
Australien an. In Amerika sind von großer Bedeutung die
Überlandposten über die Landenge von Panama (nach der
Westküste von Südamerika) und über die
verschiedenen, den Atlantischen und Stillen Ozean verbindenden
Eisenbahnlinien (für die Korrespondenz nach Kalifornien und
Ostasien über San Francisco). In Asien besteht schon seit
geraumer Zeit die russisch-chinesische Überlandroute über
Irkutsk-Kiachta. Mit dem Ausbau der russisch-zentralasiatischen
Eisenbahn beginnt auch der Austausch geschlossener Briefposten
über diesen neuen internationalen Verbindungsweg Bedeutung zu
gewinnen.
Überläufer (Deserteur), ein Soldat, der zum
Feind übergeht, macht sich der Fahnenflucht unter
erschwerenden Umständen schuldig und wird nach dem
Militärgesetz mit dem Tod bestraft. S. Desertion.
Überlebenswahrscheinlichkeit, s. Sterblichkeit.
Überlebsel, nach Tylor diejenigen Handlungen, Sitten
und Gebräuche, die aus einem abgeschafften Kultus oder aus
einer frühern Kulturepoche herstammen, weshalb sie meist ihrer
Bedeutung nach unverständlich geworden sind und als Aberglaube
gelten.
Überlieferung, s. Tradition.
964
Überliegezeit - Überschar.
Überliegezeit (Überliegetage), eine Frist,
deren Vereinbarung bei dem Seefrachtgeschäft üblich ist,
und innerhalb deren der Verfrachter das Fahrzeug gegen eine
Vergütung (Überliegegeld, Liegegeld) noch zur Einnahme
der Ladung über die eigentliche Ladezeit hinaus bereit halten
muß. Vgl. Deutsches Handelsgesetzbuch, Art. 568-580, 595-606,
623.
Überlingen, Bezirksamtsstadt im bad. Kreis Konstanz,
am Überlinger See, der nordwestlichen Bucht des Bodensees, in
schöner wein- und obstreicher Gegend, 410 m ü. M., hat 4
kath. Kirchen, darunter die herrliche fünfschiffige gotische
Münsterkirche mit bedeutenden Kunstwerken und der 88,5
Doppelzentner schweren Glocke Osanna, eine neue evang. Kirche, ein
altes Rathaus mit prächtigen Holzschnitzereien von 1494, eine
alte Stadtkanzlei (eine Perle deutscher Renaissance von 1598), die
sogen. Burg des Alemannenherzogs Gunzo mit dem Bild Gunzos und der
Jahreszahl 641, mehrere Patrizierhöfe, darunter besonders
derjenige der Herren Reichlin v. Meldegg (von 1462) mit der sogen.
Luciuskapelle und schönem, reichem Bankettsaal, alte
Festungstürme und Thore und in Felsen gehauene
Stadtgräben (jetzt in schöne Promenaden umgewandelt), ein
Denkmal des um die Stadt hochverdienten Pfarrers Wocheler, eine
über der Stadt gelegene Johanniter- und Malteserkommende St.
Johann, einen Hafen, eine erdig-salinische Mineralquelle von
14° C. mit Bad, Seebäder und (1885) 4006 meist kath.
Einwohner. In industrieller Beziehung sind zu nennen:
Eisengießerei, Glockengießerrei, Fabrikation von
Feuerspritzen und Brauereieinrichtungen, mechanische
Werkstätten, Orgelbau, Ateliers für kirchliche Kunst,
Mühlen etc.; sonst hat die Stadt Weinbau, große
Fruchtmärkte, Obsthandel und Dampfschiffahrt. N. ist Sitz
eines Amtsgerichts, eines Hauptzollamtes und einer Bezirksforstei,
auch befindet sich dort eine höhere Bürgerschule, ein
Waisenhaus, ein großes Hospital, eine Stadtbibliothek (30,000
Bände), ein ethnographisch-kunstgewerbliches Museum, ein
Naturalienkabinett etc. In der nächsten Umgebung der Stadt
zahlreiche Punkte mit herrlicher Aussicht. - Ü., im Altertum
Iburinga, wird schon 1155 urkundlich erwähnt und erhielt 1275
von Rudolf von Habsburg ausgedehnte Privilegien, wurde jedoch erst
1397 völlig reichsunmittelbar. Es trat dem Schwäbischen
Städtebund bei und nahm 1377 am Städtekrieg teil. Im
Dreißigjährigen Krieg wurde die Stadt 1632 von Bernhard
von Weimar erobert, 1634 von den Schweden unter Horn vergebens
belagert, 1643 von den Schweden geplündert, 20. Mai 1644 von
den Bayern nach viermonatlicher Belagerung genommen und 1647 an die
Schweden übergeben, die sie nach dem Westfälischen
Frieden wieder räumten. 1803 fiel Ü. an Baden.
Überlinger See, s. Bodensee.
Übermangansäure HMnO4 wird aus
übermangansaurem Baryt durch Schwefelsäure
abgeschieden. Die von dem entstandenen unlöslichen
schwefelsauren Baryt abgegossene Lösung von Ü. ist
tiefrot mit blauem Reflex, schmeckt süßlich herb,
metallisch, wirkt äußerst stark oxydierend, auch
bleichend, läßt sich nicht durch Papier filtrieren,
zerfällt schon bei gewöhnlicher Temperatur, schneller bei
30-40° in Mangansuperoxydhydrat und Sauerstoff und kann nicht
konzentriert werden. Im festen Zustand ist Ü. nicht bekannt.
Ihre Salze (Permanganate) sind purpurrot, in Wasser löslich,
wirken ebenfalls stark oxydierend, verpuffen zum Teil beim Reiben
mit brennbaren Körpern, geben beim Erhitzen Sauerstoff,
Mangansäuresalz und Mangansuperoxyd und entwickeln mit
Salzsäure Chlor. Am häufigsten wird das
übermangansaure Kali KMnO4 dargestellt und zur Bereitung von
Sauerstoff, als Desinfektions- und Bleichmittel, in der
Färberei und Zeugdruckerei, zum Beizen von Holz, in der
Maßanalyse, zum Reinigen des Ammoniaks und der
Kohlensäure von empyreumatischen Stoffen, als
Oxydationsmittel, zu galvanischen Elementen, in der Photographie
und arzneilich als Mundwasser, bei Behandlung von Wunden etc.
benutzt. Man verdampft Kalilauge mit chlorsaurem Kali und sehr
feinem Braunsteinpulver zur Trockne, erhitzt den Rückstand im
hessischen Tiegel, bis er halbflüssig geworden,
zerschlägt die aus mangansaurem Kali bestehende
schwarzgrüne Masse nach dem Erkalten, erhitzt sie in einem
Kessel mit Wasser, leitet in die grüne Lösung des
mangansauren Kalis einen kräftigen Strom Kohlensäure, bis
sie tiefrot geworden und das mangansaure Kali unter Ausscheidung
von Mangansuperoxydhydrat vollständig in übermangansaures
Kali übergeführt ist. Dann filtriert man durch
Schießbaumwolle, verdampft die Lösung und
läßt sie kristallisieren. Das Salz bildet dunkelrote,
fast schwarze, metallisch grün schimmernde Kristalle, schmeckt
anfangs süßlich, dann bitter herb, löst sich in 16
Teilen Wasser von 15° und färbt auch sehr große
Mengen Wasser intensiv violett. Die Lösung ist aber leicht
zersetzbar, weil sie energisch oxydierend wirkt, und muß
daher auch vor Staub geschützt aufbewahrt werden. Eine reine
konzentrierte Lösung erträgt Siedetemperatur.
Übergießt man das trockne Salz mit konzentrierter
Schwefelsäure, so entwickeln sich ozonhaltiger Sauerstoff und
purpurfarbene Dämpfe von Übermangansäureanhydrid
Mn2O7. Das übermangansaure Natron NaMnO4 wird wie das Kalisalz
dargestellt, auch aus den bei der Regeneration des Mangansuperoxyds
aus Chlorbereitungsrückständen gewonnenen Manganoxyden,
indem man diese mit Ätznatron oder Chilisalpeter an der Luft
auf 400° erhitzt. Bei Anwendung von Ätznatron wird die
Schmelze ausgelaugt, die verdünnte und gekochte Lösung
mit Schwefelsäure neutralisiert, verdampft, um das gebildete
schwefelsaure Natron durch Kristallisation abzuscheiden, und dann
weiter verdampft. Man kann auch die konzentrierte Lösung mit
schwefelsaurer Magnesia oder Chlormagnesium versetzen, wobei sich
unter Ausscheidung von Magnesia und Mangansuperoxydhydrat
übermangansaures Natron bildet. Es ist sehr leicht
löslich, schwer kristallisierbar, sonst dem Kalisalz sehr
ähnlich und wird wie dieses namentlich als Desinfektionsmittel
und zum Bleichen benutzt; die Lösung ist als Condys Liquid und
eine Mischung des Salzes mit schwefelsaurem Eisenoxyd als
Kühnes Desinfektionsmittel im Handel.
Übermäßig heißen in der Musik die
Intervalle, welche um einen chromatischen Halbton
größer sind als die großen oder reinen. Die
Umkehrung übermäßiger Intervalle ergibt
verminderte. Akkorde werden ü. genannt, wenn sie durch ein
übermäßiges Intervall begrenzt werden (im Sinn des
Generalbasses), nämlich der übermäßige
Dreiklang (mit übermäßiger Quinte) und die
verschiedenen Arten übermäßiger Sextakkorde.
Überpflanznug, s. Transplantation.
Überpflichtige Werke, s. Opera supererogationis.
Überproduktion, die Warenproduktion, welche den
Bedarf derart übersteigt, daß der Preis unter die
Herstellungskosten sinkt. Vgl. Handelskrisis.
Übersättigt, s. Lösung, S. 920.
Überschar, das zwischen zwei verliehenen Gruben
965
Überschießen - Überwallung.
(s. Bergrecht) befindliche freie Feld, welches sich wegen seiner
Kleinheit zu einer besondern Verleihung nicht eignet.
Überschießen, eine der Hauptursachen des
Kenterns von Schiffen mit beweglicher Ladung (Getreide, Kohlen,
lockern Erzen) oder mit beweglichem Ballast (Sand, Wasser) in nicht
gänzlich gefüllten Ballasträumen. Die Gefahr besteht
darin, daß dergleichen Ladungen bei der Neigung des Schiffs
um eine Längsachse, dieser Bewegung folgend, den Schwerpunkt
von Schiff und Ladung aus der Symmetrieebene des Schiffs
herausbringen.
Überschlagen, bei den Blasinstrumenten (auch
Orgelpfeifen) das Ansprechen eines höhern Naturtons als
desjenigen, den man hervorzubringen beabsichtigt (vgl.
Überblasen). Bei den Singstimmen ist Ü. soviel wie
Umschlagen, Versagen des Tons.
Überschmolzen, s. Schmelzen, S. 552.
Überschnitten sind zwei Bauglieder (ein wagerechtes
und ein senkrechtes), die so einander durchkreuzen , daß das
eine durch das andre hindurchgesteckt erscheint (s. Figur). In der
Gotik, welche Kröpfung und Gehrung vermeidet, müssen
Simsglieder überall, wo sie sich unter einem Winkel treffen,
überschnitten sein.
Überschreiben, s. v. w. das Fälligkeitsdatum
über den Text des Wechsels angeben; auch sagt man einen
"Auftrag überschreiben" ,d. h. erteilen.
Überschwängerung, s. Überfruchtung.
Überschwemmung, s. Hochwasser.
Übersegeln, mit einem Schiff ein zweites so treffen,
daß letzteres erheblich beschädigt, bez. Zerstört
wird^ '^in wirkliches Ü. findet nur dann statt, wenn zwei
Schiffe von sehr verschiedener Größe aufeinander
treffen. Im Sprachgebrauch gehören aber alle Fälle zum
Ü., wo ein Zusammenstoß zweier Schiffe den Verlust des
einen zur Folge hat.
Überse^uugsrecht, s. Urheberrecht, S. 8.
Überfichtigkeit (Hypermetropie), Fehler im
Refraktionszustand des Auges, wobei Lichtstrahlen, welche parallel
auf die Hornhaut auffallen, wegen zu flacher Bildung des Augapfels
erst hinter der Retina ihre Vereinigung finden, so daß auf
der Retina selbst kein scharfes Bild, sondern für jeden
Lichtpunkt ein Zerstreuungskreis zu stande kommt, der Kranke daher
alle Gegenstände nur verwaschen und undeutlich sieht. Absolute
Ü. ist vorhanden, wenn das Auge selbst bei der
größten Akkommodationsspannung parallele Lichtstrahlen
nicht auf der Retina zur Vereinigung zu bringen vermag, folglich
deutliches Sehen selbst für die Ferne ohne Konvexglas
unmöglich ist. Bei relativer Ü. kann das Auge zwar
für parallele (selbst schwach divergierende) Strahlen
eingestellt werden, aber es muß dabei die Akkommodation
unverhältnismäßig stark angespannt werden. Damit
dem zunehmenden Alter die Akkommodationsfähigkeit abnimmt, so
wird die in der Jugend meist relative Ü. mit den Jahren eine
absolute werden; das Übel wird sich also verschlimmern. Die
Augen zeigen bei äußerer Betrachtung nichts Abnormes.
Die Sehschärfe ist in der Regel vollkommen. Anfänglich
wird auch beim Lesen und Schreiben deutlich gesehen; bald aber,
zumal bei künstlichem Licht und mangelhafter Beleuchtung, wird
das Sehen undeutlich und verschwommen, es stellt sich ein
Gefühl von Ermüdung und Spannung ein, die Arbeit
muß für einige Zeit unterbrochen werden. Wird trotzdem
die Fortsetzung der Arbeit erzwungen, so geht das Gefühl der
Spannung oberhalb der Augen in wirklichen Schmerz über. Die
Augen röten sich und thränen stark. DieBehandlung der
Ü. besteht in der Benutzung konvexer Brillengläser,
welche auch schon von jugendlichen Individuen, zumal beim Lesen und
Schreiben, benutzt werden müssen, während sie beim Sehen
in die Ferne anfänglich entbehrt werden können und erst
im Alter auch hierzu unentbehrlich werden.
Überfiuulich, dasjenige, was über das in die
Sinne Fallende sich erhebt.
Überständig heißen Bäume oder
Bestände, die das Alter ihrer Haubarkeit
überschritten haben.
Überstauung, s. Bewässerung, S. 859.
Ubertas, bei den Römern Personifikation der
Erdfruchtbarkeit, dargestellt als schönes Weib mit umgekehrtem
Füllhorn; vgl. Abundantia.
Ubertät (lat.), Fruchtbarkeit, üppige
Fülle.
Übertragbar nennt man die budgetmäßig
für bestimmte Zwecke verwilligten Summen, welche, wenn und
soweit sie in der laufenden Finanzperiode nicht zur Verausgabung
gelangten, als Ausgabenreservate oder Reservate ohne neue
Bewilligung für den gleichen Zweck in der ^nächsten
Periode (Jahr) verwandt werden dürfen.
Überübertragbarkeit von Wertpapieren s.
Rektapapier.
Übertraguug, s. Zession.
Übertretung, s. Verbrechen.
Überversicherung, Versicherung zu Summen, welche den
Wert der versicherten Sachen oder den gesetzli^ zur Versicherung
zugelassenen Prozentsatz desselben übersteigen.^ Sie kann
entweder durch zu hohe Deklaration des Versicherungswerts oder
durch Versicherung eines und desselben Interesses bei verschiedenen
Anstalten zur Erlangung des mehrfachen Betrags des Schadens
(Doppelversicherung) herbeigeführt werden; sie ist verboten
und in der Regel als Betrug strafbar; zur Verhütung derselben
wird von manchen Staaten eine besondere Kontrolle der Versicherung,
namentlich der Feuerversicherung, ausgeübt. Nicht zu
verwechseln mit der n. ist diejenige Versicherung, welche dann in
Kraft tritt, wenn der erste Versicherer zahlungsunfähig wird.
Vgl. Versicherung.
Übervölkerung, s. Bevölkerung, S. 852.
Überwallung, ein Heilungsprozeß holziger
Pflanzenteile, insbesondere der Baumstämme, bei Verletzungen,
welche bis auf den Splint gehen. Das durch die Wunde
bloßgelegte Stück des Splints kann wegen des verloren
gegangenen Kambiums zunächst nicht weiter verdickt werden,
sondern bleibt in der Vertiefung der Wunde längere Zeit
sichtbar; an den Rändern der Wunde aber^ setzt die
Kambiumschicht ihre Thätigkeit fort, und da sie sich dabei
konvex gegen die Wundsläche zusammenzieht, so werden die neuen
Jahresringe von Holz, welche sie erzeugt, zugleich allmählich
in tangentialer Richtung über die Wunde hingeschoben. Auf
diese Weise verkleinert sich die letztere von Jahr zu Jahr und wird
endlich ganz verschlossen, wenn die Überwallungen
zusammentreffen.
tewöhnlich springen die obern Ränder einer durch .
sich schließenden Wunde wulstförmig vor, weil sie
966
Überwälzung der Steuern - Ubicini.
durch den absteigenden Nahrungssaft, der an dieser Stelle sich
aufstaut, stärker ernährt werden.
Überwälzung der Steuern, s. Steuern, S.
312.
Überweg, Friedrich, philosoph. Schriftsteller, geb.
22. Jan. 1826 zu Leichlingen in Rheinpreußen, studierte zu
Göttingen unter K. F. Hermann Philologie, in Berlin unter
Beneke Philosophie, wurde 1851 Lehrer zu Elberfeld, hierauf
Privatdozent zu Bonn, 1862 außerordentlicher, 1867
ordentlicher Professor der Philosophie zu Königsberg, wo er 9.
Juni 1871 starb. Als Philosoph gehörte Ü. der empirischen
Richtung an; als Schriftsteller hat er sich durch sein "System der
Logik" (Bonn 1857, 5. Aufl. 1882), das zugleich deren Geschichte
enthält, vornehmlich aber durch seinen weitverbreiteten
"Grundriß der Geschichte der Philosophie" (Berl. 1863-66, 3
Tle.; 7. Aufl., hrsg. von Heinze, 1886-88), der sich durch den
Reichtum literarhistorischer Nachweise auszeichnet, Verdienste
erworben. Beide Werke sind ins Englische übersetzt worden.
Seine Beantwortung der von der Akademie der Wissenschaften zu Wien
gestellten Preisfrage: "Über die Echtheit und Zeitfolge der
Platonischen Schriften" (Wien 1861), in welcher er unter anderm die
Echtheit des Dialogs "Parmenides" bestritt, ist von jener mit dem
Preis gekrönt worden. Aus seinem Nachlaß gab Brasch
heraus: "Schiller als Historiker und Philosoph" (Leipz. 1884). Vgl.
F. A. Lange, F. Ü. (Berl. 1871); Brasch, Die Welt- und
Lebensanschauung F. Überwegs in seinen gesammelten
Abhandlungen (Leipz. 1888).
Überweisung an die Landespolizeibehörde,
Nebenstrafe, auf welche nach dem deutschen Strafgesetzbuch (§
361, Nr. 3-8, S. 362) gegen Landstreicher, Bettler u. gegen
Frauenspersonen, welche gewerbsmäßig Unzucht treiben,
neben der verwirkten Haftstrafe erkannt werden kann. Diese
Überweisung kann auch gegen denjenigen ausgesprochen werden,
der sich dem Spiel, Trunk oder Müßiggang dergestalt
hingibt, daß er in einen Zustand gerät, in welchem zu
seinem Unterhalt oder zum Unterhalt derjenigen, zu deren
Ernährung er verpflichtet ist, durch Vermittelung der
Behörde fremde Hilfe in Anspruch genommen werden muß.
Auch wer, wenn er aus öffentlichen Armenmitteln eine
Unterstützung empfängt, sich aus Arbeitsscheu weigert,
die ihm von der Behörde angewiesene, seinen Kräften
angemessene Arbeit zu verrichten, und wer nach Verlust seines
bisherigen Unterkommens binnen der ihm von der zuständigen
Behörde bestimmten Frist sich kein anderweites Unterkommen
verschafft hat und auch nicht nachweisen kann, daß er
solches, der von ihm angewandten Bemühungen ungeachtet, nicht
vermocht habe, kann durch Richterspruch der
Landespolizeibehörde überwiesen werden. Letztere
erhält dadurch die Befugnis, die verurteilte Person entweder
bis zu zwei Jahren in ein Arbeitshaus unterzubringen, oder zu
gemeinnützigen Arbeiten zu verwenden.
Überwinterung der im Garten gebauten Gewächse
bezweckt Schutz vor niedriger Temperatur oder auch nur vor
schroffem Temperaturwechsel. Topf- und Kübelpflanzen sind im
Spätherbst weniger zu gießen, zu reinigen und unter Dach
(Gewächshaus, Zimmer, Keller, Schuppen u. a.) aufzustellen,
der Luft wird einige Tage freier Durchzug gestattet, den Pflanzen
ist aber nur dann Wasser zu geben, wenn die Oberfläche des
Ballens trocken geworden ist. Ausgetopfte Pflanzen sind im
September einzutopfen und einige Zeit von der Luft abgeschlossen zu
halten. Frostfrei zu überwinternde Zwiebeln und Knollen
werden, nachdem die oberirdischen Teile bei beginnendem Frost
abgeschnitten worden, von anhängender Erde gereinigt und in
trocknen Sand eingeschlagen, an trocknem, frostfreiem Ort
aufbewahrt; nur wenige Arten bedürfen zur Ü. einer
höhern Temperatur. Nicht ganz winterharte Gehölze werden
nach begonnenem Winter mit Rohr, Fichtenreisig u. dgl. eingebunden
oder durch Bedecken mit Brettern, Holzkasten oder Körben, die
mit trocknem Laub oder Nadelstreu ausgefüllt werden,
während die Wurzeln, nachdem der Boden gefroren, ebenso zu
bedecken sind; andre Gehölze werden umgelegt, durch Haken oder
kreuzweise gestellte Pflöcke festgehalten und mit Erde, Laub
oder Nadelstreu bedeckt. Pflanzen der arktischen (kalten) Zonen und
der Alpen müssen vor dem Temperaturwechsel mehr als andre
geschützt werden, entweder nach dem Einfrieren, durch Bedecken
mit Schnee, dieses mit Laub u. dgl., oder durch Ü. in einem
gegen N. gelegenen, gegen Sonnenstrahlen und Temperaturwechsel
überhaupt geschützten Raum. Frühblühende Obst-
und andre Gehölze sind gegen zu frühes Erwachen des
Wachstums zu schützen, indem durch Entfernen etwa gefallenen
Schnees das Einfrieren des Bodens befördert, das Auftauen aber
durch Bedecken desselben nachher mit Schnee und dieses mit trocken
gehaltener Laub- und Nadelstreu verhindert wird. Spalierbäume
sind mit Fichtenreisig, Weinreben mit Erde zu bedecken. Geerntetes
Gemüse, Wurzeln, Kraut u. a. wird von überflüssigem
Blattwerk befreit, auf ebener Erde aufgeschichtet und mit Erde
bedeckt, durch deren Aufnahme rund um die Gemüseschicht ein
Graben entsteht, der etwanige Niederschläge aufnimmt; nur
Gemüse für den Gebrauch der nächsten Zeit
dürfen im Keller überwintert werden oder im Freien noch
nicht ganz entwickelter Blumenkohl, der im frostfreien Raum
allmählich seine Blumenkäse austreibt. Erdbeerpflanzen
schützt man durch zwischen die Reihen gelegten kurzen Mist
gegen den Einfluß des Winters.
Überwinterungsknospen (Winterknospen), Knospen, die
bei Schluß einer Vegetationsperiode an sonst völlig
absterbenden Pflanzen, wie besonders einigen Wassergewächsen,
wie Ceratophyllum, Utricularia, Aldrovandia u. a., angelegt werden
und dann im nächsten Frühjahr zu neuen Sprossen
aufwachsen.
Überzeichnung liegt bei der Begebung einer Anleihe oder
bei der Ausgabe von Aktien und Anteilscheinen dann vor, wenn
der Betrag der zum Zweck der Übernahme gezeichneten Anteile
größer ist als die durch die eröffnete Subskription
aufzubringende Summe. Durch entsprechende und
verhältnismäßige Minderung (Reduktion) der
gezeichneten Beiträge pflegt man alsdann den Interessen des
Unternehmens wie denjenigen der beteiligten Kreise des Publikums
Rechnung zu tragen.
Überzeugungseid, s. Glaubenseid.
Ubi (lat.), wo. Ubietät, die Eigenschaft aller
Körper, einen Raum zu erfüllen.
Ubi bene, ibi patria (lat.), Sprichwort: wo es mir wohl
geht, da ist mein Vaterland.
Ubicini, Abdolonyme, franz. Publizist lombardischen
Ursprungs, geb. 20. Okt. 1818 zu Issoudun, war Professor der
Rhetorik in Joigny, bereiste 1846 den Orient und nahm 1848 an dem
Aufstand in der Walachei teil, kehrte aber beim Einrücken der
türkisch-russischen Truppen nach Frankreich zurück und
starb 1884 in Paris. Er schrieb: "Lettres sur la Turquie"
(1851-54); "La question d'Orient devant l'Europe" (1854);
"Provinces danubiennes et romaines" (mit Chopin, 1856); "La
question des principautes danubiennes devant l'Europe" (1858);
"Etudes histo-
967
Ubier - Ückermünde.
riques sur les populations chrétiennes de la Turquie
d'Europe" (1867); "Les constitutions de l'Europe orientale" (1872);
"Etat present de l'Empire ottoman" (1876); "La constitution
ottomane expliquée et annotée" (1877); "Les origines
de l'histoire roumaine" (1887) u. a.
Ubier, german. Volk, wohnte zu Cäsars Zeit auf dem
rechten Rheinufer, südlich von den Sigambern, von der Sieg bis
über die Lahn hinaus und schloß sich enger als irgend
ein andrer germanischer Stamm an die Römer an. Von ihren
Nachbarn im Osten und Süden, den Sueven, bedrängt,
ließen sich die U. unter Augustus durch Agrippa auf das linke
Rheinufer versetzen. Außer ihrer Hauptstadt Colonia Agrippina
gehörten ihnen noch: Bonna (Bonn), Antunnacum (Andernach),
Rigomagus (Remagen) und mehrere Kastelle. Sie gingen zuletzt in den
Franken auf.
Übigau, 1) Stadt im preuß. Regierungsbezirk
Merseburg, Kreis Liebenwerda, an der Schwarzen Elster, hat eine
evang. Kirche, Torfgräberei und (1885) 1482 Einw. - 2) Dorf in
der sächs. Kreishauptmannschaft Dresden, Amtshauptmannschaft
Dresden-Neustadt, rechts an der Elbe, hat Albumin-, Bleizucker-,
Farben- und chemische Fabriken, eine Schiffswerfte, Schiffahrt,
Obst- und Weinbau und (1885) 774 Einw.
Ubiquität (lat. Ubiquitas, "Allgegenwart"), von
Luther zur Bezeichnung derjenigen Eigenschaft des Leibes Christi
gebraucht, vermöge welcher derselbe, weil infolge
hypostatischer (persönlicher) Vereinigung der menschlichen und
göttlichen Natur überall, so auch im Abendmahl in der
Form des Brots gegenwärtig sein kann, daher die Lutheraner von
den Reformierten, die den Leib Christi im Himmel wissen und nur
eine durch den Glauben vermittelte Gegenwart annehmen, auch
Ubiquisten oder Ubiquitiner genannt wurden.
Ubstadt, Dorf im bad. Kreis Karlsruhe, am Kraichbach und
der Linie Mannheim-Konstanz der Badischen Staatsbahn, hat eine
kath. Kirche, eine Solquelle mit Bad, Tabaks- und Hopfenbau und
(1885) 1171 Einw. Hier 1849 Treffen gegen die Freischaren.
Ubuch (Ubuchen), s. Tscherkessen, S. 884.
Übungslager, s. Lager, S. 402.
Ucayali, einer der Hauptquellflüsse des
Amazonenstroms, entspringt unter dem Namen Apurimac in den Andes
westlich vom Nordende des Titicacasees, empfängt auf dem
Hochland den von SW. kommenden Rio Mantaro oder Mayo, durchbricht
die östlichen Ketten der Kordilleren und nimmt, nachdem er in
seinem mit tropischem Urwald erfüllten Thal sich mit dem von
SO. kommenden Urubamba (s. d.) vereinigt hat, den Namen U. an und
mündet nach viel gewundenem Lauf Nauta gegenüber (114 m
ü. M.) in den Maranon. Seine Länge beträgt 1960 km.
Seeschiffe befahren ihn aufwärts das ganze Jahr durch bis nach
Sarayacu (6° 30' südl. Br., 124 m ü. M.), kleinere
Schiffe den Nebenfluß Pachitea aufwärts bis nach Maira
(242 m) in der Nähe der Kolonie Pozuzu (s. d.).
Uccle (spr. ükl), Gemeinde in der belg. Provinz
Brabant, Arrondissement Brüssel, 5 km von dieser Stadt an der
Staatsbahnlinie Brüssel-Luttre gelegen, hat ein Irrenhaus,
Gemüsebau und (1888) 12,680 Einw.
Uchard (spr. üschar), Mario, franz. Schriftsteller,
geb. 28. Dez. 1824 zu Paris, war längere Zeit
Börsenagent, vermählte sich 1853 mit der Schauspielerin
Madeleine Brohan vom Théâtre-Francais und brachte 1857
das vieraktige Schauspiel "La Fiammina" auf dem genannten Theater
zur Aufführung, zu welchem ihm seine nicht glückliche Ehe
den Stoff geliefert hatte, und das bald die Runde über alle
Bühnen des In- und Auslandes machte. Von seinen spätern
Stücken hatte keins auch nur annähernd einen
ähnlichen Erfolg; dagegen erwarb er sich ein großes
Publikum und teilweise auch das Lob der Kenner mit den Romanen:
"Raymond" (1861), "Le mariage de Gertrude" (1862), "J'avais une
marraine" (1863), "La comtesse Diane" (1864), "Une derniere
passion" (1867), "Mon oncle Barbassou" (1876), "Ines Parker"
(1880), "Mademoiselle Blaisot" (1884), "Joconde Berthier"
(1886).
Uchatius, Franz, Freiherr von, Artillerieoffizier, geb.
20. Okt. 1811 zu Theresienfeld in Niederösterreich, trat 1829
in die österreichische Artillerie, erhielt seine
mathematisch-technische Ausbildung in der Schule des
Bombardierkorps, versah in der chemisch-physikalischen Lehranstalt
zwei Jahre lang die Dienste eines Laboranten, blieb dann vier Jahre
Adlatus des Professors, ward 1841 Feuerwerker in der
Geschützgießerei, 1842 Offizier, 1861 Major und
Vorsteher der Geschützgießerei, 1871 Kommandant der
Artilleriezeugfabrik, 1874 Generalmajor, 1879
Feldmarschallleutnant. Er erfand 1856 ein Stahlbereitungsverfahren,
konstruierte eine Pulverprobe und ballistische Apparate, eine
Vorrichtung zum Messen des Gasdrucks in Geschützen, ein
Sprengpulver aus nitrifiziertem Stärkemehl, das Verfahren zur
Herstellung der sogen. Stahlbronze- (Uchatiusmetall-)
Geschütze und 1875 die Ringgranaten. Wegen seiner Verdienste
um Neuschaffung des österreichischen Feldartilleriematerials
(1875) wurde er in den Freiherrenstand erhoben und von der k. k.
Akademie der Wissenschaften zum Mitglied erwählt. Mit der
Herstellung von 15 u. 18 cm Kanonen aus Stahlbronze
beschäftigt, erschoß er sich 4. Juni 1881.
Uchte, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Hannover,
Kreis Stolzenau, 33 m ü. M., hat eine evang. Kirche, ein
Amtsgericht, eine Oberförsterei und (1885) 1270 Einw.
Üchtland ("ödes Land"), s. Freiburg
(Kanton).
Üchtritz, Friedrich von, dramat. und
Romanschriftsteller, geb. 12. Sept. 1800 zu Görlitz, studierte
in Leipzig die Rechte, fand 1828 in Trier und 1829 in
Düsseldorf amtliche Anstellung und zog sich 1863 als
pensionierter Appellationsgerichtsrat in seine Vaterstadt
zurück, wo er 15. Febr. 1875 starb. Von seinen Dramen:
"Alexander und Darius" (Berl. 1827), "Das Ehrenschwert",
"Rosamunde" (Düsseld. 1833) und "Die Babylonier in Jerusalem"
(das. 1836) zeichnete sich besonders das letztere durch lyrisch
glänzende Sprache und gute Charakteristik aus. Von seinen
übrigen Werken sind zu nennen: "Blicke in das
Düsseldorfer Kunst- und Künstlerleben" (Düsseld.
1839-41, 2 Bde.); "Ehrenspiegel des deutschen Volkes und vermischte
Gedichte" (das. 1842); die Romane: "Albrecht Holm" (Berl. 1851-53,
7 Bde.), "Der Bruder der Braut" (Stuttg. 1860, 3 Bde.), "Eleazar"
(Jena 1867, 3 Bde.), in denen eine reiche Stofffülle nur
teilweise poetisch belebt erscheint. Vgl. "Erinnerungen an F. v.
Ü. in Briefen" (Leipz. 1884).
Ückendorf, Dorf im preuß. Regierungsbezirk
Arnsberg, Kreis Gelsenkirchen, Knotenpunkt der Linien
Ü.-Wattenscheid, Gelsenkirchen-Wattenscheid und Ü.-Wanne
der Preußischen Staatsbahn, hat Steinkohlenbergbau und (1885)
8878 meist kath. Einwohner.
Uckermark, s. Ukermark.
Ückermünde (Ukermünde), Kreisstadt im
preuß. Regierungsbezirk Stettin, an der Uker, die unweit
968
Uckie - Udschidschi.
davon in das Pommersche Haff mündet, und an der Linie
Jatznick-Ü. der Preußischen Staatsbahn, hat eine evang.
Kirche, ein altes Schloß, eine Irren-, eine Korrektions- und
Landarmenanstalt, ein Amtsgericht, bedeutende Ziegeleien,
Kalkbrennerei, Eisengießerei, Sägemühlen,
Holzhandel, Fischerei, Schifffahrt und (1885) 5458 meist evang.
Einwohner. - Ü. ist seit 1190 Stadt und war ehemals eine
wichtige Festung, die 1469 vom Kurfürsten Friedrich II. von
Brandenburg vergeblich belagert wurde.
Uckie, marokkan. Münze, = 1/10 Mitskal (s. d.).
Ucles, Stadt in der span. Provinz Cuenca, mit (1878) 1138
Einw.; hier 13. Jan. 1809 Sieg der Franzosen unter Victor über
die Spanier unter dem Herzog von Infantado.
Udaipur, s. Mewar.
Uddevalla, Hafenstadt im schwed. Län Gotenburg und
Bohus, am innersten Ende des Byfjords und an der Eisenbahn
Herrljunga-U., hat eine höhere Lehranstalt, Navigationsschule,
Gewerbeschule, Zoll- und Lotsenstation, ein Museum und (1885) 7354
Einw., welche Baumwollspinnerei und -Weberei, Fabrikation von
Möbeln, Zündhölzern, Branntwein und Tabak,
Schiffbau, Fischerei und lebhaften Handel betreiben.
Uden, Lucas van, niederl. Maler u. Radierer, geb. 18.
Okt. 1595 zu Antwerpen, war Schüler seines Vaters, trat 1627
in die dortige Lukasgilde und starb 4. Nov. 1672 daselbst. Er ist
vorzugsweise dadurch bekannt geworden, daß er für Rubens
und D. Teniers den jüngern Landschaften malte, welche jene mit
Figuren versahen. Doch hat er auch zahlreiche selbständige
Landschaften nach Motiven aus Brabant und Flandern gemalt, deren
Eigentümlichkeit in einer schlichten und treuen Auffassung
beruht. Unter Rubens' Einfluß wurde seine Färbung
wärmer und reicher. Landschaften von ihm besitzen die Galerien
zu Dresden, Petersburg, Brüssel, Frankfurt a. M.,
München, Antwerpen, Berlin, Wien u. a. Seine landschaftlichen
Radierungen (etwa 30) sind mit überaus feiner Naturbeobachtung
und zarter Nadel ausgeführt.
Udine, ital. Provinz in der Landschaft Venetien (s. Karte
"Italien, nördliche Hälfte"), grenzt nördlich und
östlich an Österreich, südlich an das Adriatische
Meer und die Provinz Venedig, westlich an die Provinzen Treviso und
Belluno und hat einen Flächenraum von 6431 qkm (nach
Strelbitsky 6619 qkm [120,21 QM.]) mit (1881) 501,745 Einw. Das
Land wird im N. bogenförmig von den Karnischen Alpen (Paralba
2690 m hoch) durchzogen, welchen die Friauler Alpen (Premaggiore
2471 m) und östlich die Julischen Alpen (Monte Canin 2582 m)
vorgelagert sind, von welchen sich zahlreiche Hügelgruppen
abzweigen, die sich schließlich zu der weiten und, soweit sie
nicht vom Gerölle der Flüsse überschüttet ist,
fruchtbaren friaulischen Ebene herabsenken. Gegen die Küste zu
geht die Ebene in lagunenartiges Land über. Die wichtigsten
Flüsse sind: Tagliamento, Livenza und Stella. Das verschiedene
Vegetationszonen umfassende Land erzeugt Weizen (1887: 243,300 hl),
Mais (857,000 hl), Reis (10,878 hl), Hülsenfrüchte,
Kartoffeln, Kastanien, Hanf, Wein (64,500 hl), Seide (1,5 Mill. kg
Kokons); ferner Vieh (1881 zählte man 180,523 Rinder, 81,444
Schafe und 34,966 Ziegen) und Fische. Die Einwohner suchen in
großer Anzahl für einen Teil des Jahrs
Beschäftigung außerhalb des Landes. Die Industrie der
Provinz erstreckt sich auf Seiden- und Baumwollmanufaktur,
Gerberei, Bierbrauerei, Holzschneiderei, Töpferei, Papier- und
Metallwarenfabrikation. Die Provinz zerfällt in 17 Distrikte.
- Die Hauptstadt U., in weinreicher Gegend an einem vom Torre
ausgehenden Kanal und an der Eisenbahn Venedig-Cormons gelegen, von
welcher hier die Linie nach Pontebba abzweigt, ist gut gebaut und
hat stattliche Mauern und Türme. Unter den Gebäuden sind
bemerkenswert: die romanische Domkirche und mehrere andre Kirchen
mit guten Gemälden, das Kastell (von 1517, einst Sitz des
Patriarchen, jetzt Kaserne), der erzbischöfliche Palast (mit
schöner, von Giovanni da Udine gemalter Decke und Fresken von
Tiepolo), der Palazzo pubblico (1457 erbaut, nach dem Brand von
1876 erneuert) und der Uhrturm (mit offener Säulenhalle),
beide auf dem Viktor Emanuel-Platz, das Theater und mehrere
Privatpaläste. Der Campo santo von U. gehört zu den
schönsten Friedhöfen Italiens. Die Stadt hat ein
technisches Institut, ein Lycealgymnasium, ein
erzbischöfliches Gymnasium und Seminar, ein städtisches
Museum und Bibliothek und (1881) 23,254 (als Gemeinde 32,020)
Einw., welche Industrie in Seide, dann in Leder, Hüten,
Metallwaren, Handschuhen etc. und Weinbau betreiben. U. ist Sitz
des Präfekten, eines Erzbischofs, eines Zivil- und
Korrektionstribunals, eines Hauptzollamts etc. In der Nähe
liegt das Dorf Passariano mit dem Schloß des letzten Dogen
von Venedig, welches Bonaparte während der
Friedensverhandlungen von Campo Formio bewohnte. - U. kommt unter
diesem Namen erst im 10. Jahrh. vor. Im 13. Jahrh. wählte der
Patriarch Bertold U. zu seiner Residenz; 1445 kam die Stadt unter
venezianische Herrschaft. Seit der Pest von 1515 und 1656 hat sie
sich nicht wieder erholt. U. fiel nach dem Aufstand in Venedig 1848
von Österreich ab, zwang 23. März die Besatzung zum
Abzug, mußte sich aber schon 23. April nach
mehrstündiger Beschießung Österreich wieder
unterwerfen. 1866 ward es mit Venetien dem Königreich Italien
einverleibt.
Udine, Giovanni da, ital. Maler, geb. 1487 zu Udine, war
anfangs Schüler von Giorgione in Venedig, führte daselbst
mehrere dekorative Malereien aus und ging später zu Raffael,
als dessen Gehilfe er die reizvollen Ornamente (sogen. Grottesken)
in den Loggien des Vatikans, in der Villa Farnesina u. a.
ausführte. Seit 1527 arbeitete er in Udine und Umgegend (unter
anderm im Schloß Colloredo). Auch fertigte er die
Entwürfe zu den Glasfenstern in der Biblioteca Laurenziana zu
Florenz. Er starb 1564.
Udometer (griech.), s. Regenmesser.
Udschain (Udschaiyini), Stadt im Tributärstaat
Gwalior (Britisch-Indien), am Siprafluß, Nebenfluß des
Tschambal, und an einer Zweiglinie der Malwaeisenbahn, mit 4
Moscheen, vielen Hindutempeln, einem Palast des Fürsten,
starker, mit Türmen gekrönter Umfassungsmauer und (1881)
32,932 Einw., welche bedeutenden Handel mit Opium treiben. Das
alte, jetzt in Ruinen liegende U. war bis 1000 n. Chr. Residenz des
mächtigsten Herrscherhauses in Zentralindien, dann
berühmt durch seine Sternwarte, welche den ersten Meridian der
Hindugeographen bezeichnete, wurde in spätern Kriegen hart
mitgenommen, war aber dann wieder bis 1810 Residenz der
Fürsten von Gwalior.
Udschidschi, Handelsplatz am Ostufer des Tanganjikasees
in Äquatorialafrika, unter 5° südl. Br., mit 8000
Einw., den Wadschidschi, und größere Warenmagazine
enthaltend. Stanley fand hier 1871 Livingstone. U. ist in neuerer
Zeit der Hauptausgangs- und Operationspunkt von
Forschungsexpeditionen gewesen. Ein Karawanenweg verbindet dasselbe
mit Sansibar.
969
Udschila - Uferbau.
Udschila, s. Audschila.
Udvard, Dorf im ungar. Komitat Komorn, Station der
Österreichisch-Ungarischen Staatsbahn, mit (1881) 4035 ungar.
Einwohnern.
Udvarhely (spr. -helj), ungar. Komitat in
Siebenbürgen, grenzt an die Komitate Maros-Torda, Csik,
Haromszek, Nagy- und Kis-Küküllö, umfaßt 3418
qkm (62 QM.), wird von den Zweigen des Hargittagebirges
erfüllt und vom Großen Küküllö
bewässert, hat (1881) 105,520 Einw. (Szekler) und ist nicht
besonders fruchtbar; es gedeihen jedoch alle Getreidearten und in
den Thälern auch Obst und Wein. Die Industrie erstreckt sich
hauptsächlich auf Spinnerei, Weberei, Strohhutflechterei und
die Verfertigung von Holzwaren. Im SW. durchkreuzt die Ungarische
Staatsbahn das Komitat, dessen Hauptort Szekely-Udvarhely ist.
Uea, 1) (Uvea, Wallis) polynes. Inselgruppe unter
französischem Protektorat, westlich von Samoa und nordwestlich
von den Fidschiinseln, besteht aus zwölf kleinen Inseln, die
von einem Barrierriff umgeben werden, und hat ein Areal von 96 qkm
(1,7 QM.) mit 3500 Einw. Die Inseln sind meist hoch, bergig und
vulkanischen Ursprungs, mit mehreren, jetzt von Seen
ausgefüllten Kratern und, wo der Boden verwittert ist, sehr
fruchtbar. Die Bewohner haben dieselben Sitten und Gebräuche
wie die Samoaner und Tonganer; früher war U. eine Dependenz
von Tonga. Die Gruppe wurde 1767 von Wallis entdeckt, 1837 kamen
katholische Missionäre hierher und bekehrten die Bewohner,
welche unter eignen Häuptlingen lebten, bis sie sich durch
einen 19. Nov. 1886 abgeschlossenen Vertrag in den Schutz
Frankreichs begaben. - 2) (Ouvea) s. Loyaltyinseln.
Ueba (Hueba), Getreidemaß in Tunis, à 4
Temen à 4 Orbah = 107,3 Liter.
Uelle (Welle), großer Fluß in
Äquatorialafrika, entspringt im Lande der Monbuttu und
verfolgt als Welle oder Makua, zahlreiche Zuflüsse von links
(Majo-Bomokandi mit Makongo, Mbelima) u. rechts (Moruole, Werre,
Mbomu mit Schinko und Mbili, Engi) aufnehmend, dem 4.°
nördl. Br. erst südlich, dann nördlich parallel
laufend, im allgemeinen eine westliche Richtung bis zum 19.°
östl. L. v. Gr., wo er sich südostwärts wendet und
als Ubangi oder Mobangi den Congo unter 17° 30' östl. L.
erreicht. Dies scheint die Lösung der vielumstrittenen
Uellefrage durch Kapitän van Gele zu sein, welcher auf dem
Dampfer En Avant 1887 die Zongostromschnellen des Ubangi forcierte
und den Oberlauf dieses Flusses unter 4-5° nördl. Br. bis
gegen 22° östl. L. v. Gr. verfolgte. Der U. wurde 19.
März 1870 von Schweinfurth entdeckt, der ihn nördlich von
Munsa im Monbuttuland unter 3° 40' nördl. Br. und 28°
40' östl. L. v. Gr. überschritt. Schweinfurth hielt
ebenso wie der später hierher gekommene Junker den U. für
den Oberlauf des in den Tsadsee mündenden Schari, während
Stanley in ihm den Oberlauf des Aruwimi sah, eine Ansicht, deren
Falschheit seine jüngste Reise ihm gezeigt hat.
Ufa, ein Gouvernement Ostrußlands, 1865 aus dem
nordwestlichen Teil des Gouvernements Orenburg gebildet und von
diesem durch den Hauptrücken des südlichen Urals
geschieden, umfaßt 122,006,8 qkm (nach Strelbitsky 122,015,7
qkm = 2215,92 QM.). Die Kama scheidet im NW. das Gouvernement von
Wjatka und nimmt die Nebenflüsse Bjelaja und Ik auf, von
welchen der erstere der schiffbare Hauptstrom des Landes ist und
den Tanym, die Ufa und den Sjun empfängt. In den westlichen
Teilen ist waldreiches Hügelland, das mit fruchtbaren
Thälern wechselt; aber auch Steppenland und einige Moore
kommen vor. Von den 290 kleinen Seen im W. sind die
größten: der Airkul, Kondrakul und Karatabyk,
sämtlich sehr fischreich. Die südwestliche Seite des
Gouvernements wird vom Obschtschij Syrt durchschnitten. Im O. zieht
sich der südliche Ural hin. Das Klima ist kontinental und in
den Gebirgsgegenden unfreundlich. Vom Areal entfallen 23 Proz. auf
Ackerland, 22,8 auf Wiesen und Weiden, 46,6 auf Wald und 7,6 Proz.
aus Unland. Der Wald weist im N. Nadelholz, im S. Linden und Eichen
auf. Im N. werden Roggen und Hafer, im S. Weizen, Gerste, Hirse und
Buchweizen angebaut. Die Ernte betrug 1887: 4 1/2 Mill. hl Roggen,
3,2 Mill. hl Hafer, 835,000 hl Weizen, 1 1/2 Mill. hl Buchweizen,
andre Getreidearten und Kartoffeln in geringerer Menge. Der
Viehstand bezifferte sich 1883 auf 398,597 Stück Rindvieh,
630,354 Pferde, 917,352 grobwollige Schafe, 111,017 Schweine und
200,630 Ziegen. Die Bevölkerung, (1885) 1,874,154 Einw., 15
pro QKilometer, besteht hauptsächlich aus Baschkiren und
Russen; außerdem wohnen hier Tataren, Tscheremissen,
Tschuwaschen, Teptjären, Meschtscherjäken und Wotjaken,
die zum Teil noch Heiden sind. Im übrigen übersteigt die
Zahl der Mohammedaner die der Christen. Die Zahl der
Eheschließungen war 1885: 19,989, der Gebornen 87,264, der
Gestorbenen 53,545. Hauptbeschäftigungen sind: Ackerbau
(betrieben von Russen und Teptjären), Viehzucht (von
Baschkiren und Tataren), Bienenzucht (von Baschkiren und
Meschtscherjäken), Bergbau, Holzgewinnung und Jagd. Die
Wälder liefern außer dem Schiffbauholz Bast, Pottasche,
Pech, Teer und Kohlen. Der Bergbau liefert Gold, Eisen, Kupfer.
Hervorragend ist das Eisenwerk zu Slatoust, ansehnlich die
Kupferhütte von Blagowetschenskoje im Kreis U. Der
Produktionswert der Hochöfen wird (1885) auf 3,7 Mill. Rubel
angegeben. Die übrige Industrie ist unbedeutend, geht in 147
Anstalten mit 2092 Arbeitern vor sich und produziert für 3 1/2
Mill. Rub. Bildungszwecken dienen 353 Elementarschulen mit 14,376
Schülern, 8 Mittelschulen mit 1326 Schülern und 7
Fachschulen mit 479 Schülern. Der Handel ist fast nur in den
Händen der Tataren und vertreibt Holzarbeiten, Tierfelle,
Häute, Honig und Sprit. U. zerfällt in sechs Kreise:
Belebej, Birsk, Menselinsk, Slatoust, Sterlitamak, U. - Die
gleichnamige Hauptstadt, am Ural und am Einfluß der Ufa in
die Bjelaja, hat mehrere Kirchen und Moscheen, ein Nonnenkloster,
ein Gymnasium, ein geistliches Seminar, ein tatarisches
Lehrerseminar, ein Mädchengymnasium, einen großen
Kaufhof, eine zehntägige Messe und (1886) 27,290 Einw. Die
Stadt ist Sitz eines Erzbischofs und eines mohammedanischen Mufti.
U., 1547 von dem Baschkirenhäuptling Iwan Nagin
gegründet, wurde 1759 und 1816 durch Brand zerstört, hat
sich aber, seit es Hauptstadt ist, sehr gehoben.
Ufenau, liebliches, dem Kloster Einsiedeln gehöriges
Eiland im Zürichsee, auf welchem Ulrich v. Hutten ein Asyl
fand und starb (1523).
Ufer, die äußerste Grenze des an ein
Gewässer stoßenden Landes; insbesondere der einen Bach,
Fluß, Teich, überhaupt ein kleineres Gewässer
einfassende Erdrand (lat. ripa), wogegen das U. des Meers, auch
großer Seen, gewöhnlich mit den besondern Namen
Küste, Strand (lat. litus) bezeichnet wird.
Uferaas, s. Eintagsfliegen.
Uferbau, jeder Bau, welcher an oder mit einem Ufer
ausgeführt wird, entweder um einen Fluß schiffbarer zu
machen (s. Wasserbau), oder das an-
970
Ufererdröschen - Uganda.
stoßende Land gegen Überschwemmungen (s. Deich) oder
das Ufer gegen den Abbruch des Wassers zu schützen. Letzteres
ist der eigentliche Gegenstand der Uferbaukunst, welche zwei Arten
von Uferbauten umfaßt, je nachdem die Gewässer, deren
Ufer zu schützen sind, stehende oder fließende sind. Bei
stehenden Gewässern kann eine Beschädigung der Ufer
entweder durch die periodische Veränderung des Wasserstandes
(Ebbe und Flut) oder durch die wellenförmige
(ästuarische) Bewegung des Wassers herbeigeführt werden.
Hierdurch wird nur die Oberfläche des Ufers angegriffen und
eine sogen. Abschälung bewirkt. Die Abschälung eines
Ufers wird nach Maßgabe der örtlichen Verhältnisse,
z. B. der Bodenbeschaffenheit und Stärke des Wellenschlags,
verhütet: 1) durch Schlickfänge, d. h. Dämme oder
Zäune, welche das Wasser verhindern, die Ufer anzugreifen,
oder selbst nötigen, seinen Schlamm (Schlick) aus denselben
abzulagern; 2) durch flache Böschungen, welche vom Wasser
nicht mehr angegriffen werden; 3) durch Uferbekleidungen: aus
Bohlen, wo Holz im Überfluß vorhanden ist, aus Pflaster
von hinreichend großen Steinen, aus Faschinen, d. h. mit
Steinen beschwerten, untereinander durch Weidenruten verbundenen
langen Reisbündeln. Bei leichtem Wellenschlag lassen sich die
Ufer oft schon durch Berasung oder Anpflanzung von Strauchwerk
schützen; wo die Ufer zugleich als Kais oder Lagerplätze
dienen sollen, sind dieselben provisorisch durch Bohlwerke oder
definitiv durch Futtermauern, welche man mehr oder weniger neigt
und, damit sie dem Wellenschlag besser widerstehen, an der
Vorderseite oft konkav anlegt, zu stützen. Bei
fließenden Gewässern kommt zum periodischen Wechsel des
Wasserstandes noch eine zweite Bewegung, die strömende
(progressivere), hinzu, durch welche das Ufer in der Tiefe
beschädigt und ein sogen. Grundbruch, Strom- oder Uferabbruch,
bewirkt werden kann. Gegen Grundbrüche schützt man die
Ufer am besten: 1) durch Korrektion der Ufer, indem man dem Strom
durch Parallel- oder Einbauten einen regelmäßigen Lauf
anweist, wodurch der Stromstrich mehr in die Mitte des Stroms
verlegt wird; 2) durch Uferschutzbauten, wie Erdüberbaue,
Packwerke, Buhnen (s. d.), wodurch die Strömung vermindert
wird. Wo die Ufer zugleich als Kais benutzt werden sollen, werden
sie, wie im stehenden Gewässer, durch Futtermauern
gestützt, welche man zur Vermeidung von Unterspülung noch
durch Spundwände (s. Grundbau) schützt.
Ufererdröschen, s. Geum.
Uferfliege (Perla Geoffr.), Gattung der
Afterfrühlingsfliegen (Perlidae), aus der Ordnung der
Falschnetzflügler, Insekten mit sehr kleinen, häutigen
Mandibeln und Kiefertastern mit dünnen Endgliedern, von denen
das letzte verkürzt ist. Die zweischwänzige U. (P.
bicaudata L., s. Tafel "Falschnetzflügler"), 22 mm lang,
braungelb, mit zwei Schwanzborsten (Reifen), lebt am Wasser im
größten Teil Europas. Das Weibchen legt die Eier
klümpchenweise ins Wasser, die Larven haben große
Ähnlichkeit mit der Fliege, sind aber flügellos und an
den Füßen mit Wimperhaaren besetzt; sie nähren sich
von Raub und leben besonders in Gebirgsbächen unter Steinen
oder an Holzwerk; die Metamorphose erfolgt nach etwa einem
Jahr.
Uferspecht, s. Eisvogel.
Uferspindelassel (Pycnogonum litorale O. Fr. Müll.),
ein den Milben nahestehendes Tier, repräsentiert die kleine
Gruppe der Pantopoden oder Pyknogoniden, welche früher zu den
Krebstieren, dann zwischen Milben und Spinnen gestellt wurde,
obwohl sie im männlichen Geschlecht mit dem Besitz eines
accessorischen, die Eier tragenden Beinpaars eine höhere
Gliedmaßenzahl ausbilden. Die sehr langen, vielgliederigen
Beine enthalten schlauchförmige Magenanhänge und die
Geschlechtsorgane, welche mithin in achtfacher Zahl vorhanden sind.
Die Eier werden an dem accessorischen Beinpaar an der Brust des
Männchens bis zum Ausschlüpfen der Larven getragen. Die
U. (s. Tafel "Spinnentiere") ist 13 mm lang, gelblich und lebt an
den Küsten der europäischen Meere, besonders auch der
Nordsee, unter Steinen, Tangen, auch auf Fischen.
Uffelmann, Julius, Mediziner, geb. 1837 zu Zeven in
Hannover, studierte zu Göttingen Theologie und Philologie,
dann Medizin, praktizierte in Hameln, habilitierte sich 1876 als
Privatdozent in Rostock und wurde 1879 zum außerordentlichen
Professor ernannt. Er schrieb: "Die Diät in den akut
fieberhaften Krankheiten" (Leipz. 1877); "Darstellung des auf dem
Gebiet der öffentlichen Gesundheitspflege in
außerdeutschen Ländern bis jetzt Geleisteten" (Berl.
1878); "Handbuch der Hygieine des Kindes" (Leipz. 1881); "Tisch
für Fieberkranke" (Karlsb. 1882); "Jahresberichte über
die Fortschritte und Leistungen auf dem Gebiet der Hygieine" (Berl.
1883 ff.); "Die Ernährung des gesunden und kranken Menschen.
Handbuch der Diätetik" (mit Munk, Wien 1887);. "Handbuch der
Hygieine" (das. 1889).
Uffenheim, Bezirksamtsstadt im bayr. Regierungsbezirk
Mittelfranken, an der Gollach und der Linie
Treuchtlingen-Würzburg-Aschaffenburg der Bayrischen
Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, ein Schloß, eine
Lateinschule, ein Amtsgericht, eine Oberförsterei, Gerberei,
Bierbrauerei, eine Dampfschneidemühle und Parkettfabrik und
(1885) 2314 meist evang. Einwohner. In der Nähe die
Bergschlösser Hohenlandsberg und Frankenberg.
Uffizien (Palazzo degli Uffizi), s. Florenz, S. 382.
Ufumbiro (Mfumbiro), isolierte Berggruppe im
äquatorialen Ostafrika, wird von der Grenze zwischen den
Landschaften Ankori und Ruanda mitten durchschnitten und hat zwei
Gipfel (über 3000 m hoch).
Ugaia (Kawirondo), Landschaft am Ostufer des Victoria
Nyanza, mit der großen Insel Ugingo.
Ugalachmiut, s. Ugalentsi.
Ugalentsi (Ugalenzen, Ugalachmiut), ein Stamm der Kenai
(s. d.), von einigen irrtümlich den Thlinkit zugerechnet, der
während des Winters an den Ufern der Bucht gegenüber der
Insel Kadyak (Alaska), im Sommer an den Mündungen des
Kupferflusses sich aufhält. Die Sprache der U. nimmt eine
selbständige Stellung innerhalb der Kenaivölker ein.
Uganda, großes Reich in Äquatorialafrika, das
sich nordwestlich und westlich vom Victoria Nyanza zwischen dem
Lohugati im S., dem 3.° östl. L. v. Gr. im W., dem 1.°
nördl. Br. im N. und dem Nil im O. erstreckt (s. Karte bei
"Congo"). Es umfaßt die Landschaften U. im engern Sinn
(zwischen Kivira und Katonga), Usoga, östlich vom Kivira,
Unjoro, Ankori (Usagara) und Karagwe; die drei letzten sind dem
Herrscher von U. tributpflichtig. Das Reich begreift drei
Provinzen: Uddu im S., zwischen Kagera und Katonga, Singo im W. und
Chagwe im O., welchen sich noch der Sesse-Archipel, eine Gruppe von
400 Inseln, am Nordostufer des Sees anschließt. Das Reich hat
einen Umfang von 123,000 qkm (2234 QM.), mit den tributären
Staaten über 181,706 qkm (3300 QM.); aber während Stanley
die Bevölkerungszahl auf 2,755,000 Seelen schätzt, glaubt
der Missionär
971
Ugijar - Uhde.
Wilson 5 Mill. annehmen zu können, wobei 3,5 weibliche
Bewohner auf 1 männlichen kommen, eine Folge der vielen Kriege
und der Einschleppung weiblicher Gefangener. Am Nyanza und eine
Strecke weit ins Land hinein ist das Land gebirgig, durchschnitten
von tiefen, sumpfigen Thälern, durch welche
trägfließende Flüsse ihren Lauf zum See nehmen. Die
Uferabhänge bedecken herrliche Wälder, belebt von Scharen
grauer Affen, von Papageien, Kolibris, Schmetterlingen. Ferner vom
See folgen weitere Thäler, niedrigere Hügel, an Stelle
der Waldbäume tritt die Dattelpalme, an der Nordgrenze wird
das Land zur Ebene, durchschnitten von Schilfflüssen und von
dichtem Wald bedeckt, in dem Löwen, Leoparden, Hyänen,
Elentiere, Antilopen, Elefanten, Büffel, Flußpferde und
Wildschweine sich aufhalten. Der öftliche, hügelige Teil
wird von Schluchten durchzogen, über denen sich prachtvolle,
von Schlingpflanzen umzogene Waldbäume wölben, ein Land
von wunderbarer Schönheit. Der Küstenstrich ist
äußerst fruchtbar, er gibt zwei Ernten im Jahr. Die
Dörfer sind von großen Bananenwäldern umgeben. Das
Klima ist außerordentlich mild und gleichmäßig,
eine Folge der hohen Lage des Landes (1500-2000 m); doch herrscht
das Fieber ziemlich stark. Es gibt zwei Regenzeiten (März bis
Mai und September bis November). Von Mineralien werden nur
Eisenerz, Talk, Porzellanerde gefunden. Die Bewohner teilen sich in
mehrere Stämme: Waganda, Wahuma, Wanyambo und Wasoga, von
denen die ersten in jeder Beziehung am wichtigsten sind. Sie sind
mehr als mittelgroß, schlank, kräftig und von
dunkelbrauner Farbe. Ungleich den umwohnenden Völkerschaften,
sind die Waganda, wenn sie auf der Straße erscheinen, von
Kopf bis Fuß bekleidet, auf eine Verletzung dieser Sitte
steht die Todesstrafe. Sie sind fleißige Landbauer (Bananen,
Durra, Mais, Bataten, Yams, Tabak, Rizinus, Sesam, Zuckerrohr,
Kaffee); aus den Bananen gewinnen sie ein berauschendes
Getränk (Muenge). Als Haustiere haben sie Rinder, Schafe mit
Fettschwanz, Ziegen, Hühner, Hunde, Katzen. Sie sind
geschickte Holzarbeiter und Schmiede, ihre Waffen sind Speer,
Schild, Bogen und Pfeil; Feuergewehre werden von Sansibar
importiert, der König besitzt auch vier kleine Schiffskanonen.
Außerdem werden Kleiderstoffe aus Baumrinde,
Töpferwaren, Körbe und Matten, Leder u. a. gefertigt. In
den Handel kommen Elsenbein, Gummi, Harze, Kaffee, Myrrhen,
Löwen-, Leoparden-, Ottern- und Ziegenfelle,
Öchsenhäute und weiße Affenhäute. Hauptstadt
ist Rubaga, nicht weit vom Nordufer des Victoria Nyanza. Von
Europäern ist U. wiederholt besucht worden, so von Speke
(1862), Long (1874), Stanley und Linant de Bellefonds (1875),
Felkin und Wilson (1879); sie wurden sämtlich gastfreundlich
vom König Mtesa aufgenommen, doch verbot der König schon
1879 den ins Land gezogenen englischen und französischen
Missionären das Lehren und bedrohte seine Unterthanen, die
sich von jenen unterweisen lassen würden, mit der Todesstrafe.
Zugleich wurde auch die mohammedanische Religion verboten. Nach
Mtesas Tod (10. Okt. 1884) begann sein Nachfolger Mwanga die
Christen heftig zu verfolgen, ließ 1885 mehrere Zöglinge
der englischen Mission lebendig verbrennen und 31. Okt. 1885 sogar
den englischen Bischof für Zentralafrika, Hannington, in Usoga
hinrichten, so daß die Lage der Missionäre eine sehr
gefährdete wurde. Vgl. Wilson und Felkin, U. und der
ägyptische Sudân (deutsch, Stuttg. 1883).
Ugijar (spr. ugichhar), Bezirkshauptort in der span.
Provinz Granada, in den Alpujarras, den Südabhängen der
Sierra Nevada, mit (1878) 2792 Einw.
Uglitsch, Kreisstadt im russ. Gouvernement Jaroslaw, an
der Wolga, hat einen alten verfallenen Kreml (in welchem der junge
Zarewitsch Dmitrij, Sohn Iwans des Schrecklichen, 1591 ermordet
wurde), 25 Kirchen, darunter eine Kathedrale, ein geistliches
Seminar, Fabrikation von Leder, Seife, Kupfer- und Zinnwaren,
Papier etc., lebhaften Handel und (1885) 11,183 Einw.
Ugocsa (spr. úgotscha), ungar. Komitat am linken
Theißufer, von den Komitaten Bereg, Mármaros und
Szatmár begrenzt, 1191 qkm (21,62 QM.) groß, wird von
der Theiß durchströmt, ist im O. gebirgig, waldreich,
wenig fruchtbar und hat (1881) 65,377 Einw. Hauptprodukte sind:
Getreide, Schweine, Schafe, Fische und Eisen (im Turtzer Gebirge).
Sitz des Komitats ist Nagy-Szölös (s. d.).
Ugogo, Landschaft in Ostafrika, zwischen dem 6. und
7.° südl. Br., grenzt an den nordwestlichen Teil von
Usagara, ein dürres, welliges Tafelland, das in seinem
südlichen Teil vom Kisigo, einem Nebenfluß des Rueha,
durchzogen und begrenzt wird und nur an den Ufern desselben und den
über die Oberfläche verstreuten Oasen bewohnbar ist. Die
Vegetation besteht in Akaziengestrüppen,
Balsamsträuchern, Aloe, Euphorbien, Kapernsträuchern,
hartem Gras; von Tieren finden sich Löwen, Schakale,
Großohrfüchse, Elefanten, Nashörner, Büffel,
Giraffen, Strauße, Perlhühner. Die Eingebornen, Wagogo,
wohnen in Lehmhäusern, Tembe, mit flachem Dach. Das Gebiet
zerfällt in zahlreiche unabhängige, aus mehreren
Dörfern bestehende Bezirke, deren jeder seine
Souveränität hauptsächlich in der Erpressung der
Wegsteuer von den Reisenden ausübt. S. Karte bei "Congo".
Ugolino, s. Gherardesca.
Ugomba, Landschaft in Ostafrika, zwischen dem 3. und
4.° südl. Br., an den Quellflüssen des in den
Tanganjika sich ergießenden Malagarasi.
Ugrische Völker, ein von Castrén gebrauchter
Sammelname für die Ostjaken am rechten Ufer des Ob, die
Wogulen am Ostabhang des nördlichen Urals und die Magyaren,
die sämtlich zur gliederreichen finnischen Völkergruppe
gehören. Die beiden ersten sind besonders deshalb interessant,
weil sie uns noch jetzt ein Gemälde gewähren, wie die
Zustände ihrer westlichen Geschwister in der Vorzeit
beschaffen waren.
Uhde, 1) Hermann, Schriftsteller, geb. 26. Dez. 1845 zu
Braunschweig, ging, nachdem er sich in Hannover längere Zeit
dem Journalismus gewidmet hatte, 1870 als Spezialkorrespondent der
"Hamburger Nachrichten" auf den französischen Kriegsschauplatz
und übernahm hierauf das Feuilleton der genannten Zeitung.
Seine Berichte veröffentlichte er in einem Sonderabdruck
(Hamb. 1871). Seit 1872 lebte er in Weimar, seit 1874 aber
privatisierend in Veytaux-Chillon am Genfer See, wo er 27. Mai 1879
starb. Seine Thätigkeit betraf meist die äußere
Geschichte der deutschen Litteratur und vorwiegend des deutschen
Theaters. Unter seinen Publikationen, die fast alle auf bisher
unveröffentlichten Aufzeichnungen und Briefen beruhen, sind zu
nennen: "Erinnerungen und Leben der Malerin Luise Seidler" (2.
Aufl., Berl. 1875); "Denkwürdigkeiten des Schauspielers,
Schauspieldichters und Schauspieldirektors F. L. Schmidt" (Hamb.
1875, 2 Bde.); "Goethes Briefe an Soret" (Stuttg. 1877); "Goethe,
J. G. v. Quandt und der Sächsische Kunstverein" (das. 1878);
"Das Stadttheater in Hamburg 1827-77" (das. 1879). Außerdem
gab er Karl Töpfers "Dra-
972
Uhehe - Uhland.
matische Werke" (Leipz. 1873) und H. A. O. Reichards
"Selbstbiographie" (Stuttg. 1877) heraus.
2) Fritz von, Maler, geb. 22. Mai 1848 zu Wolkenburg in Sachsen,
ging 1866 auf die Kunstakademie in Dresden, wendete sich aber, weil
ihn der damals auf der Akademie herrschende Geist nicht
befriedigte, 1867 der militärischen Laufbahn zu und diente bis
1877, zuletzt als Rittmeister im Gardereiterregiment. Dann
quittierte er seinen Dienst und begab sich nach München, um
sich der Malerei zu widmen, wobei er sich besonders an das Studium
der Niederländer hielt. Ein Zusammentreffen mit Munkacsy
veranlaßte ihn, sich im Herbst 1879 nach Paris zu begeben, wo
er einige Wochen im Atelier Munkacsys malte, im übrigen aber
seine Studien nach den Niederländern fortsetzte. Unter ihrem
Einfluß stehen seine ersten Bilder: die Sängerin und die
gelehrten Hunde, sowie die 1881 in München gemalten: das
Familienkonzert und die holländische Gaststube. Eine 1882 nach
Holland unternommene Reise bestärkte ihn in seinen
koloristischen Grundsätzen, in welche er inzwischen auch
diejenigen der Pariser Hellmaler aufgenommen hatte. Seine
nächsten Bilder: die Ankunft des Leierkastenmanns (Erinnerung
aus Zandvoort) und die Trommelübung bayrischer Soldaten, waren
jedoch nur die Vorbereitung zu denjenigen Aufgaben, welche er sich
als das Hauptziel seiner Kunst gestellt hatte. Auf Grund seiner
neuen koloristischen Anschauung und seiner naturalistischen
Formenbildung wollte er die Geschichte des Neuen Testaments in enge
Beziehungen zur Gegenwart setzen und mit starker Hervorhebung der
untern Volksklassen zu einer neuen, tief und schlicht empfundenen
Darstellung bringen. Seine zu diesem Zwecke geschaffenen
Hauptbilder, welche durch ihre Neigung für das
Gewöhnliche und Häßliche auf großen
Widerstand stießen, wegen ihres strengen Anschlusses an die
Natur und ihrer koloristischen, bisweilen an Rembrandt erinnernden
Haltung aber auch zahlreiche Bewunderer fanden, sind: Christus und
die Kinder (1884, im Museum zu Leipzig), Komm, Herr Jesu, sei unser
Gast (1884, in der Berliner Nationalgalerie), Christus und die
Jünger von Emmaus (1885), das Abendmahl (1886), die
Bergpredigt (1887) und die heilige Nacht (1888). Er lebt als
königlicher Professor in München. Vgl. Lücke, Fritz
v. U. (Leipz. 1887).
Uhehe, Landschaft im äquatorialen Ostafrika, wird
vom 9.° südl. Br. durchschnitten und vom Rueha
durchflossen, wurde von Graf Pfeil und Schlüter 29. Nov. 1885
durch Vertrag für die Deutsche Ostafrikanische Gesellschaft
erworben.
Uhha, Landschaft in Äquatorialafrika, am Nordostufer
des Tanganjika, wird vom Malagarasi, im südlichsten Teil von
einer vielbegangenen Straße durchzogen, ist sonst aber noch
wenig bekannt.
Uhl, Friedrich, Schriftsteller, geb. 14. Mai 1825 zu
Teschen, studierte in Wien und widmete sich nachmals der
litterarischen Laufbahn, welche er mit den "Märchen aus dem
Weichselthal" (Wien 1847) begann. Als Mitarbeiter und Redakteur
verschiedener größerer Wiener Zeitungen erwarb er in der
Wiener Publizistik eine hochgeachtete Stellung und fungiert
gegenwärtig als Chefredakteur der kaiserlichen "Wiener
Zeitung" und k. k. Wirklicher Regierungsrat. Seinen litterarischen
Ruf erwarb U. zuerst durch die vortrefflichen farbenvollen
Bücher: "Aus dem Banat; Landschaften und Staffagen" (Leipz.
1848); "An der Theiß; Stillleben" (das. 1851). Später
schrieb er die Romane: "Die Theaterprinzessin" (Wien 1863, 3 Bde.),
"Das Haus Fragstein" (2. Aufl., das. 1878), "Die Botschafterin"
(Berl. 1880, 2 Bde.) und "Farbenrausch" (das. 1886, 2 Bde.), welche
sich sämtlich durch scharfe Beobachtung moderner
Zustände, lebendige Charakteristik, feine Detaillierung und
klaren, künstlerisch durchgebildeten Stil auszeichnen. Auch
seine theaterkritischen Aufsätze verdienen Erwähnung.
Uhland, 1) Johann Ludwig, hervorragender Dichter und
Litteraturforscher, geb. 26. April 1787 zu Tübingen, besuchte
Gymnasium und Universität seiner Vaterstadt und studierte
1802-1808 die Rechte, neben diesem Studium das der
mittelalterlichen Litteratur, namentlich der deutschen und
französischen Poesie, pflegend. Seine eignen poetischen
Versuche und Regungen standen in dieser Zeit durchaus unter dem
Einfluß der Romantik, von der er freilich nur diejenigen
Elemente in sich aufnahm, welche einem tiefern Bedürfnis des
Gemüts entsprangen und zum Humanitätsideal unsrer
klassischen Dichtung eine Ergänzung, aber keinen Gegensatz
bildeten. Bereits während seiner Tübinger Studienzeit
begann er, einzelne Gedichte (zum Teil unter dem Pseudonym Volker)
in Zeitschriften und Musenalmanachen zu veröffentlichen. 1810
unternahm er eine mehrmonatliche Reise nach dem kaiserlichen Paris,
wo er auf der Bibliothek dem Studium altfranzösischer und
mittelhochdeutscher Manuskripte jedenfalls eifriger oblag als dem
des Code Napoléon, welches der ursprüngliche Zweck
seiner Reise war. Heimgekehrt widmete er sich dann, wenn auch halb
mit innerm Widerstreben, in Stuttgart der Advokatur. Sein
patriotischer Sinn jauchzte den Ereignissen der Befreiungskriege,
die er als rheinbündischer Württemberger nur mit
Wünschen und Hoffnungen begleiten konnte, freudig entgegen ;
im Vollgefühl der errungenen Befreiung veröffentlichte er
die erste Ausgabe der Sammlung feiner "Gedichte" (Stuttg. 1815, 60.
Aufl. 1875). Sie enthielt zwar viele Perlen seiner Lieder- und
Romanzendichtung, die in den spätern Auflagen hinzukamen, noch
nicht, trug aber im ganzen bereits das charakteristische
Gepräge der Uhlandschen Dichtung. "Die Eigentümlichkeit
seiner dichterischen Anschauung beruht wesentlich in seinem
lebendigen Sinn für die Natur. Diese wurde ihm zum Symbol der
sittlichen Welt, er lieh ihr das Leben seines eignen Gemüts
und machte die Landschaft, dem echten Maler gleich, zum Spiegel
seiner dichterischen Stimmung. Wie aber die beseelte Landschaft die
menschliche Gestalt als notwendige Ergänzung fordert, so
belebt und individualisiert auch U. das Bild der Natur durch den
Ausdruck menschlichen Seins und Handelns. Und hier macht sich nun
seine Vorliebe für die Erinnerungen deutscher Vorzeit geltend.
Die Empfindungen, welche ausgesprochen werden, die Situationen, die
Charaktere gehören nicht der Vergangenheit an, sie haben die
ewige, jugendfrische Wahrheit aller echten Poesie; aber der Dichter
sucht mit Recht diese einfachen Gestalten von allgemeiner Geltung
dem gewöhnlichen Kreis der täglichen Erfahrung zu
entheben und hüllt sie in den Duft mittelalterlicher
Reminiszenzen. Seine Kunst, die verschiedenen Elemente der
gemütlichen Stimmung, des landschaftlichen Bildes und der
mittelalterlichen Staffage zum Ganzen einer künstlerischen
Komposition im knappsten Rahmen mit den einfachsten Mitteln
zusammenzuschließen, ist bewunderungswürdig , und auf
ihr beruht wesentlich der Reiz seiner vollendetsten und
beliebtesten Gedichte. Auch ist sie seinen Liedern und Balladen
gleichmäßig eigen; die nahe Verwandtschaft beider ist
darin begründet, nur die Mischung der Elemente ist eine
973
Uhlenhorst - Uhlich.
etwas andre." (O. Jahn.) Während die "Gedichte"
anfänglich langsam, dann schneller und schneller ihren Weg ins
deutsche Publikum fanden, versuchte sich U. auch als Dramatiker.
Seine beiden dramatischen Werke: "Ernst, Herzog von Schwaben"
(Heidelb. 1818) und "Ludwig der Bayer" (Berl. 1819), denen bei
allen dichterischen Vorzügen die unerläßliche
Lebensfülle und die Energie spannender, vorwärts
drängender Leidenschaft abgehen, errangen nur einen
mäßigen Erfolg. Seit 1816 begannen die politischen
Kämpfe und die ausgebreiteten wissenschaftlichen Forschungen
den Dichter von größern Schöpfungen abzuziehen. U.
beteiligte sich an dem Ringen um die württembergische
Verfassung und gehörte später als Abgeordneter zur
Ständekammer der freisinnigen Partei an. Seine Schrift
über "Walther von der Vogelweide" (Stuttg. 1822) bekundete ihn
als so feinsinnigen Kenner und Forscher der mittelalterlichen
Litteratur, daß der Wunsch immer lebhafter erwachte, ihn auf
einem Lehrstuhl für seine Lieblingswissenschaften zu
erblicken. Mit seiner 1829 erfolgenden Ernennung zum Professor der
deutschen Litteratur an der Universität Tübingen ward
dieser Wunsch erfüllt. Uhlands Lehrthätigkeit erfreute
sich der reichsten Wirkung. Aber bereits 1832, als ihm die
Regierung den Urlaub zum Eintritt in die Ständekammer
verweigern wollte, legte er seine Professur nieder. Vor
äußern Lebenssorgen namentlich auch seit seiner sehr
glücklichen Ehe mit Emilie Vischer (der "Unbekannten" seiner
Gedichte) völlig gesichert, teilte er fortan seine Zeit
zwischen der ständischen Wirksamkeit und seinen
wissenschaftlichen Arbeiten. 1839 legte er sein Mandat als
Abgeordneter nieder, und erst die Bewegungen des Jahrs 1848 rissen
ihn wieder aus seiner frei erwählten Zurückgezogenheit.
Als Abgeordneter zur ersten deutschen Nationalversammlung der
Linken angehörig, stimmte er gegen das Erbkaisertum, hielt auf
seinem Posten bis zur Auflösung der Nationalversammlung aus
und begleitete noch das Rumpfparlament nach Stuttgart. Von 1850 an
zog er sich wieder ganz nach Tübingen zurück, eifrig mit
der Vollendung jener wissenschaftlichen sagen- und
litteraturgeschichtlichen Arbeiten beschäftigt, als deren
Zeugnisse zu verschiedenen Zeiten die Schriften: "Über den
Mythus von Thor" (Stuttg. 1836) und "Alte hoch- und niederdeutsche
Volkslieder" (das. 1844, 2 Bde.; 2.Aufl., das. 1881 ff.)
hervorgetreten waren. Alle äußern Ehrenbezeigungen
konsequent ablehnenden der schlichten Einfachheit seines Wesens und
der fleckenlosen Reinheit seines Charakters von allen Parteien
hochgeachtet, verlebte U. ein glückliches kräftiges Alter
und starb 13. Nov. 1862 in Tübingen. Seine poetischen Werke
wurden wiederholt als "Gedichte und Dramen" (Jubiläumsausgabe,
Stuttg. 1886), seine wissenschaftlichen, geordnet und revidiert von
Adalb. v. Keller, W. Holland und Franz Pfeiffer, als "Schriften zur
Geschichte der Dichtung und Sage" (das. 1866 bis 1869, 8 Bde.)
herausgegeben. Die letztern brachten zum erstenmal jene
vorzüglichen Tübinger Vorlesungen, welche U. zwischen
1829 und 1832 über die "Geschichte der altdeutschen Poesie",
die "Geschichte der deutschen Dichtung im 15. und 16. Jahrhundert"
und die "Sagengeschichte der germanischen und romanischen
Völker" gehalten hatte. Alle diese Arbeiten lassen beim
höchsten wissenschaftlichen Ernste den Dichter erkennen,
welcher neben der wissenschaftlichen Methode und dem Forschereifer
das künstlerische Verständnis und die feinste
Mitempfindung für Volks- und Kunstdichtung, für den
Zusammenhang von Dichtung und Mythe besaß. Eine Statue (von
G. Kietz) wurde U. 1873 in seiner Vaterstadt Tübingen
errichtet. Vgl. K. Mayer, L. U., seine Freunde und Zeitgenossen
(Stuttg. 1867, 2 Bde.); "Uhlands Leben", aus dessen Nachlaß
und eigner Erinnerung zusammengestellt von seiner Witwe (das.
1874); die biographischen Schriften von O. Jahn (Bonn 1863), Fr.
Pfeiffer (Wien 1862), Notter (Stuttg. 1863), Dederich (Gotha1886),
Holland (Tübing. 1886), H. Fischer (Stuttg. 1887), Hassenstein
(Leipz. 1887); Weismann, L. Uhlands dramatische Dichtungen
erläutert (Frankf. 1863); Düntzer, Uhlands Balladen und
Romanzen (Leipz. 1879); Keller, U. als Dramatiker, mit Benutzung
seines handschriftlichen Nachlasses (Stuttg. 1877).
2) Wilhelm Heinrich, Ingenieur, geb. 11. Jan. 1840 zu Nordheim
in Württemberg, begründete 1865 das Technikum Mittweida,
die erste Privatlehranstalt für Maschinentechniker, und 1868
das Technikum Frankenberg bei Chemnitz. Für die
Stärkefabrikation gab er wesentliche Verbesserungen an und
errichtete eine Versuchsstation mit vollständig
fabrikmäßigem Betrieb und Lehrkursus. Seit 1870 lebt er
in Leipzig. Er lieferte mehrere technische Kalender und schrieb
zahlreiche technische Werke, von denen besonders hervorzuheben
sind: "Handbuch für den praktischen Maschinenkonstrukteur"
(Leipz. 1883-86, 4 Bde. und Supplementband); "Die Corliß- und
Ventildampfmaschinen" (das. 1879); "Skizzenbuch für den
praktischen Maschinenkonstrukteur" (2. Aufl., das. 1886); auch
redigiert er die von ihm begründeten Zeitschriften: "Der
praktische Maschinenkonstrukteur" und "Wochenschrift für
Industrie und Technik" (Leipzig).
Uhlenhorst, Vorort von Hamburg, in anmutiger Lage an der
Außenalster, hat ein großes Waisenhaus, schöne
Villen und Gärten, Fabrikation von Maschinen, chemischen
Artikeln, Goldwaren und englischen Cakes, eine lithographische
Anstalt u. (1885) 11,167 Ew.
Uhles, warmer Eierpunsch.
Uhlhorn, Gerhard, luther. Theolog, geb. 17. Febr. 1826 zu
Osnabrück, wurde Repetent, 1852 Privatdozent in
Göttingen, 1855 Konsistorialrat und Hofprediger in Hannover,
1866 daselbst Mitglied des Landeskonsistoriums, Oberkonsistorialrat
und 1878 Abt von Lokkum. Unter seinen zahlreichen
Veröffentlichungen nennen wir, abgesehen von mehreren
Predigtsammlungen: "Die Homilien und Rekognitionen des Clemens
Romanus" (Götting. 1854); "Urbanus Rhegius" (Elberf. 1861);
"Der Kampf des Christentums mit dem Heidentum" (5. Aufl., Stuttg.
1889); "Vermischte Vorträge über kirchliches Leben der
Vergangenheit" (das. 1875); "Die christliche Liebesthätigkeit
in der alten Kirche" (das. 1882-84, 2 Bde.).
Uhlich, Leberecht, freigemeindlicher Theolog, geb. 27.
Febr. 1799 zu Köthen, ward 1824 Prediger in Diebzig bei Aken,
1827 zu Pömmelte bei Schönebeck und 1845 an der
Katharinengemeinde in Magdeburg. Er gab die Veranlassung zu den
Versammlungen der "protestantischen Freunde" (s. Freie Gemeinden)
seit 1841, geriet aber, da er das apostolische Symbol bei der Taufe
nicht nach Vorschrift der Agende anwendete, mit dem Konsistorium in
Konflikt und ward im September 1847 suspendiert, worauf er aus der
Landeskirche trat und Pfarrer der Freien Gemeinde zu Magdeburg
wurde. Als solcher hat er fortwährend in Konflikt mit den
Behörden und oft als Angeklagter vor Gericht gestanden; 1848
ward er in die preußische Nationalversammlung gewählt,
wo er dem linken Zentrum angehörte. Er starb 23. März
1872 in Magdeburg. Sein Hauptorgan war das "Sonntagsblatt"; von
seinen zahlreichen Schriften nennen wir:
974
Uhr (Taschen- und Pendeluhren).
"Bekenntnisse" (4. Aufl., Leipz. 1846); "Sendschreiben an das
deutsche Volk" (Dess. 1845); "Die Throne im Himmel und auf Erden"
(das. 1845); "Das Büchlein vom Reiche Gottes" (ein
Katechismus, Magdeb. 1845 u. öfter); "Sonntagsbuch" (Gotha
1858); "Handbüchlein der freien Religion" (7. Aufl., Berl.
1889). Sein Leben hat er selbst beschrieben (Gera 1872).
Uhr, mechan. Vorrichtung zum Messen der Zeit, speziell,
da Wasser-, Sand- und Sonnenuhren (s. d.) ihre Bedeutung im
wesentlichen verloren haben, ein Räderwerk, welches durch ein
fallendes Gewicht oder durch eine sich entspannende Feder getrieben
wird. Dieses Räderwerk, bestehend aus einer Anzahl ineinander
greifender Zahnräder, zählt gewissermaßen die
kleinen, aber sehr regelmäßigen Bewegungen, welche ein
andrer Teil der U., der Regulator, vollbringt, und registriert sie
durch den Zeiger auf dem Zifferblatt. Regulator und Räderwerk
sind durch die Hemmung miteinander verbunden. Ersterer ist ein
Pendel oder ein Schwungrad mit Spiralfeder, und je nach der
Kombination dieser Teile unterscheidet man nun Gewichtuhren, die
meist auch Pendeluhren sind, und Federuhren mit Pendel (Stutzuhren)
oder Unruhe (Taschenuhren). In dem Räderwerk befindet sich ein
Rad, welches sich genau in einer Stunde umdreht (das Minutenrad)
und den Minutenzeiger trägt, während ein besonderes
kleines Räderwerk (Zeiger- oder Vorlegewerk) mit zwölfmal
langsamerer Bewegung den Stundenzeiger treibt. Bei den Gewichtuhren
wirkt das fallende Gewicht, solange es überhaupt fällt,
mit stets gleichbleibender Kraft, die spiralförmig
aufgewundene Feder aber, welche, indem sie sich entspannt, das
Räderwerk treibt, wirkt weniger gleichmäßig, und es
bedarf zur Erzielung eines gleichförmigen Ganges der U. einer
vollkommen konstruierten Hemmung. Man benutzt zu diesem Zweck aber
auch die Kette, welche das die Feder enthaltende Federhaus mit der
Schnecke, einem abgestutzten Kegel, verbindet und, wenn die U.
aufgezogen ist, ganz um die Schnecke, vom dickern nach dem
dünnern Ende derselben gewunden ist. Indem nun die Feder das
Federhaus dreht, wickelt dieses die Kette von der Schnecke ab, und
die Kompensation der Ungleichheiten in der Zugkraft der Feder
erfolgt, weil die Kette zuerst an dem kleinsten und dann an immer
größerm Halbmesser der Schnecke thätig ist. Diese
in den ältern Taschenuhren (Spindeluhren) übliche
Einrichtung findet sich jetzt nur noch in Präzisionswerken. Da
die Schwingungsdauer eines Pendels nur dann konstant ist, wenn
seine Länge unverändert bleibt, diese aber durch die
Temperaturschwankungen sich verändert, so benutzt man für
genaue Uhren Kompensationspendel, bei denen durch die verschieden
große Ausdehnung zweier Metalle der Mittelpunkt der
Pendellinse in gleicher Entfernung vom Aufhängepunkt erhalten
wird. Sind in Fig. 1 eee drei Eisenstäbe, z z zwei
Zinkstäbe, so ist bei der eigentümlichen
Aufhängungsweise der Pendellinse die Aufgabe gelöst, wenn
die Summe der Längen eines äußern und des mittlern
Eisenstabes sich zu der eines Zinkstabes verhält wie die
Ausdehnungskoeffizienten von Zink und Eisen. Die Unruhe, ein
kleines Schwungrädchen mit Spiralfeder, welches um eine
Gleichgewichtslage schwingt, macht Schwingungen von konstanter
Dauer, solange Durchmesser, Schwingungsbogen und Spiralenlänge
unverändert bleiben, ist also auch von Temperaturschwankungen
abhängig und bedarf bei Chronometern wie das Pendel einer
Kompensation. Die Hemmung (échappement) hat dem Pendel oder
der Unruhe fort und fort mittels kleiner Impulse dasjenige an Kraft
zu ersetzen, was sie durch Reibung und Luftwiderstand bei jeder
Schwingung einbüßen. Bei der viel angewandten
Ankerhemmung von Graham (Fig. 2) ist A ein sogen. Steigrad, welches
durch Zahnräderübersetzung von der Gewichtstrommel aus
bewegt wird, während der Anker B an den Schwingungen des
Pendels teilnimmt u. so abwechselnd links u. rechts in die
Zähne des Steigrades eingreift. In der dargestellten Lage wird
im nächsten Moment der jetzt gesperrte Zahn k frei und
erteilt, an der schrägen Fläche g i entlang gleitend, dem
Pendel einen kleinen Impuls. Nachdem sich hierauf das Steigrad um
die halbe Entfernung zweier Zähne bewegt hat, stößt
rechts ein Zahn gegen den Arm m des Ankers, und das Rad bleibt so
lange gesperrt, bis das Pendel zurückkehrt. Auch hier erteilt
die Zahnspitze demselben einen Impuls, indem sie an der
Hebefläche m p entlang gleitet. Die Hemmung heißt
ruhende Hemmung, weil das Steigrad, während es gesperrt ist,
vollständig unbeweglich bleibt, was bei den ältern
Ankerhemmungen nicht der Fall war. Dem Anschein nach wesentlich, in
Wirklichkeit aber nur wenig verschieden von dieser Hemmung ist die
Cylinderhemmung der Taschenuhren, bei welcher statt vieler
Zähne nur ein einziger zwischen den beiden Armen des Ankers
sich befindet, der nun durch die hohle Achse der Unruhe gebildet
werden kann. Bei der Ankerhemmung neuerer Taschenuhren (Fig. 3) ist
A der sogen. Anker, B die Unruhachse mit der darauf sitzenden
Scheibe g und C das vom Uhrwerk in der Richtung des Pfeils
getriebene Steigrad; i ist der sogen. Hebestein, welcher an der
Scheibe g befestigt
975
Uhr (Remontoir-, selbstaufziehende Uhren etc., Schlagwerke,
Kontrolluhren etc.).
ist und den doppelten Zweck hat, den Anker in den extremen
Stellungen II und III zu halten, in denen das Steigrad gesperrt
wird, und anderseits in dem Moment, in welchem ein Zahn des
letztern an einer der beiden Hebeflächen mn oder pq entlang
gleitet, durch die Hörner t und r, zwischen denen er dann
liegt, den Impuls zur Erhaltung der Unruhbewegung zu empfangen. Der
letztere Moment ist in der Figur, Stellung I, gezeichnet. Der Zahn
k gleitet an der Hebefläche pq entlang und bewirkt dadurch
eine Bewegung des obern Teils des Ankers nach links; dadurch
drückt das Horn r auf den Hebestein und unterstützt die
Drehung, in welcher sich die Unruhe augenblicklich befindet, bis
die Stellung II eingetreten ist; in dieser sperrt der Zahn z, gegen
welchen sich der Zahn v legt, das Steigrad so lange, bis die Unruhe
umkehrt und den Hebestein gegen r trifft, wodurch der Anker den
Zahn v freigibt, welcher nun auf die Hebefläche mn wirkt und
einen Impuls nach der andern Richtung erteilt. Hierauf tritt die
Stellung III ein, und das Spiel wiederholt sich. Die Unruhe ist in
der Figur weggelassen, ebenso der sogen. Sicherheitsmesser, welcher
verhindert, daß bei Erschütterung fehlerhaftes Arbeiten
stattfindet. Bei diesen Hemmungen liegt noch ein gewisser Nachteil
in dem Umstand, daß der Anker während des
größten Teils der Pendelschwingung an den Zähnen
des Steigrades gleitet und dabei eine von der Größe der
Triebkraft abhängige Reibung erfährt, welche leicht
verzögernd auf den Gang der U. einwirken kann. Aus diesem
Grund hat man freie Hemmungen konstruiert, bei welchen Pendel oder
Unruhe, mit Ausnahme des vom Triebwerk aus erteilten Stoßes,
während der Schwingung möglichst frei von Druck und
Reibung bleiben. Noch vollkommener wirken die Hemmungen mit
konstanter Kraft, bei denen der Impuls dem Regulator nicht direkt
durch die Triebkraft, sondern vermittelt durch eine Feder oder ein
Gewicht erteilt wird, welche nach jeder Pendelschwingung
regelmäßig durch die treibende Hauptkraft wieder
aufgezogen werden. Dieses letztere Mittel ist in Anwendung
namentlich bei den Chronometern ("Zeitmessern"), welche auf
Schiffen zur Bestimmung der geographischen Länge benutzt
werden (deshalb Seeuhr, Längenuhr), indem man die von ihnen
angegebene Zeit mit der an Ort und Stelle sich aus Beobachtung der
Sonne oder der Sterne ergebenden Zeit vergleicht. Je 4 Minuten
Zeitunterschied entsprechen bekanntlich einem Grad
Längenunterschied. Der Gedanke stammt bereits aus dem Jahr
1530, wo ihn Gemma Frisius kurz nach Erfindung der Taschenuhr
aussprach. Huygens verfertigte eine solche U. mit gutem Erfolg
bereits 1665, eine vollkommnere Lösung der Aufgabe wurde 1728
durch Harrison erreicht, alles bisher Geleistete übertraf aber
Bréguet. Die Chronometer haben sehr kräftige
Kompensationsunruhen, häufig mit Spiralfedern von bedeutender
Länge aus stark gehämmertem Gold, um das Rosten zu
verhindern. Alle Räder müssen aufs vorzüglichste
gelagert und äquilibriert sein. Ein Chronometer muß auch
vorsichtig gebraucht werden, frei von heftigen Erschütterungen
bleiben und weder in zu trockner noch zu feuchter Atmosphäre
sich befinden. Ein mathematisch sicheres Resultat ist aber selbst
bei der ausgesuchtesten Behandlung nicht zu erwarten. Das Aufziehen
der Taschenuhren mit besonderm Uhrschlüssel wird bei den
Remontoiruhren vermieden, bei denen der äußere Griff der
U., wenn man ihn dreht, auf ein kleines Zahnradsystem wirkt,
welches das Aufziehen besorgt. Eine autodynamische oder selbst
aufziehende Taschenuhr von Löhr ist mit einem
Aufziehmechanismus versehen, der nach Art der Schrittmesser mit
schwingendem Hämmerchen arbeitet. Bei geringen
Erschütterungen, wie sie die U. beim Gehen, Reiten, Fahren
etc. erleidet, gerät ein Gewichtshebel in Schwingungen, und
diese werden auf ein Räderwerk übertragen, welches zum
Aufziehen der Uhrfeder dient. Lößls autodynamische
Gewichtsuhr befindet sich in einem allseitig geschlossenen
Gehäuse und geht, einmal aufgezogen, ohne weiteres Zuthun von
außen. Das Gehwerk wird durch ein hängendes Gewicht
betrieben, und man benutzt den stets schwankenden Barometer- oder
Thermometerstand, um das Gewicht stets in gleicher Höhe zu
erhalten. Die Gleichmäßigkeit des Ganges ist durch ein
genau adjustiertes Kompensationspendel gesichert. Eine sehr viel
längere Gangbarkeit, als die gewöhnlichen Pendeluhren
besitzen, erhielt Harder durch Anwendung eines rotierenden
Torsionspendels. Dieses Pendel besteht aus einer wagerechten
Scheibe, die in ihrem Mittelpunkt an einer dünnen, schmalen,
sehr geschmeidigen, senkrecht an einem festen Punkt
herabhängenden Stahlfeder befestigt ist und, ohne ihre Lage zu
ändern, wie die Unruhe einer Taschenuhr abwechselnd vor- und
rückwärts schwingt. Da diese Scheibe bei ihrer immer
gleichbleibenden Lage keine Luft verdrängt und nicht gehoben
wird, so kann sie mit demselben Kraftaufwand unter sonst
ähnlichen Verhältnissen sehr viel länger im Gang
erhalten werden als ein Pendel; ja, es gelingt, diese U. in der
Weise zu konstruieren, daß sie im Jahr nur einmal aufgezogen
zu werden braucht (daher Jahresuhr). Besondere Versuche haben
ergeben, daß die Schwingungen des Torsionspendels ebenso
isochron sind wie die eines gewöhnlichen Pendels, so daß
der regelmäßige Gang einer mit Torsionspendel versehenen
U. in dieser Hinsicht sichergestellt ist. Die Schlagwerke der Uhren
werden durch eine besondere Triebkraft, Gewicht oder Feder,
betrieben und in gewissen Momenten durch das Gehwerk
ausgelöst. Bei der eintretenden Bewegung wirkt meist ein
Windflügel, welcher schnell um seine Achse rotiert, als
Regulator, und der Hammer wird so lange ausgehoben und fallen
gelassen, bis die Bewegung wieder durch das Gehwerk gesperrt wird.
Bei den Repetieruhren wird das Schlagwerk nicht durch das Gehwerk,
sondern durch eine äußere Kraft, z. B. den Zug an einer
Schnur oder den Druck an einem Knopf, ausgelöst. Für
Uhren, welche eine selbst in den kleinsten Zeitteilen
gleichförmige Bewegung haben müssen, namentlich bei
solchen zum Bewegen astronomischer Fernröhre, die dem Lauf der
Sterne folgen sollen, wendet man ein Zentrifugalpendel an, welches
auch konstante Umdrehungszeiten besitzt. Eine Hemmung ist bei
diesen Uhren gar nicht nötig, da direkt eine schnell gehende
Achse als Pendelachse benutzt werden kann.
Wächterkontrolluhren zwingen den Wächter, zu
regelmäßigen Zeiten seine Rundgänge zu machen,
indem sie jede Abweichung von der Vorschrift sofort verraten. Bei
der U. von Bürk macht der Wächter mit verschiedenen, an
den einzelnen Stationen in besondern Kästchen eingeschlossenen
Schlüsseln auf einem in der U. sich bewegenden Papierstreifen
Eindrücke, aus deren Ort in der Längenrichtung des
Streifens auf den Moment der Einwirkung, aus deren Ort in der
Breite aber auf die Station geschlossen werden kann, an welcher sie
erfolgt, sofern jeder Schlüssel nur im stande ist, an einer
bestimmten Stelle in der Breitendimension zu wirken. Versäumt
der Wächter eine Station, so fehlt ein derselben
entsprechender Punkt auf dem Streifen.
976
Uhr (Geschichtliches, elektrische Uhren).
Die Zeit der Erfindung der U. ist nicht genau bekannt. Die Alten
hatten nur Sonnen-, Sand- und Wasseruhren (s. d.). Der Grundgedanke
der mechanischen Gewichtsuhr wurde schon von Aristoteles
ausgesprochen, und im frühen Mittelalter finden sich
mechanische Uhren in Deutschland. Im 12. Jahrh. benutzte man in
Klöstern Schlaguhren mit Räderwerk, und auch Dante
erwähnt solche. Da Sultan Saladin dem Kaiser Friedrich II.
eine Räderuhr zum Geschenk machte, so hat man die Sarazenen
für die Erfinder dieser Uhren gehalten, die erst durch die
Kreuzzüge nach Europa gekommen seien. Der Bau der Turmuhren
läßt sich bis ins 14. Jahrh. verfolgen. Die Benutzung
des Pendels regte Galilei an, und unter seiner Leitung arbeitete
Balcetri an einer Pendeluhr, allgemein wurde die Pendeluhr aber
erst bekannt, als Huygens, der eine solche 1656 konstruierte, sein
"Horologium oscillatorium" (1673) hatte erscheinen lassen. Als
Erfinder der Taschenuhren gilt Peter Henlein (Hele) in
Nürnberg (um 1500); die ersten hatten cylindrische Form, die
eiförmigen (Nürnberger Eier) kamen um 1550 auf. Barlow
erfand 1676 die Repetieruhren. Die Verfertigung der Uhren wird
jetzt fast durchweg fabrikmäßig betrieben, und zwar
nimmt die Schweiz hinsichtlich der Produktion und Beschaffenheit
ihrer Taschenuhren den ersten Rang ein. Genf (seit 1587), Locle und
Chaux de Fonds sind die Hauptsitze dieser Industrie. Hier, in Biel,
Solothurn und St.-Imier bestehen Uhrmacherschulen. Die englischen
Uhren besitzen zwar einen großen Ruf; doch sind ihnen
wirklich gute Schweizer Uhren gleichzustellen, ja hinsichtlich der
Konstruktion vorzuziehen. In Deutschland werden Taschenuhren seit
1845 in Glashütte in Sachsen (mit Uhrmacherschule) und in
Silberberg (Schlesien), hier auch Wächter-, Kontroll- und
Turmuhren gesertigt. Die vorzüglichsten Pendeluhren mit
zahlreichen Arten von Gehäusen, mit Weckern, Schlagwerken,
Spielwerken, Figuren, Kuckuck etc. liefert der Schwarzwald seit der
zweiten Hälfte des 17. Jahrh., besonders seit 1780. Für
diese Uhren, die auch in Freiburg (Schlesien) dargestellt werden,
besteht eine Uhrmacherschule in Furtwangen. Hauptsitze der
Schwarzwälder Uhrenindustrie sind im frühern Seekreis:
Hüfingen, Neustadt, Villingen und im frühern
Oberrheinkreis: Freiburg, Hornberg, Triberg und Waldkirch.
Frankreich hat bedeutende Taschenuhrenfabrikation in Besancon.
Stutzuhren werden besonders in Paris, Wien, Prag, Graz, Augsburg,
Berlin und Lähn in Schlesien gefertigt. Die Vereinigten
Staaten haben seit 1854 Pendel- und Taschenuhrenindustrie besonders
in Waltham (Massachusetts) und Elgin (Illinois); mit vortrefflichen
Arbeitsmaschinen liefert man Uhren, welche bei gleichem Preis den
schweizerischen mindestens gleichkommen und diesen selbst in Europa
erfolgreich Konkurrenz machen. Vgl. Jürgensen, Die höhere
Uhrmacherkunst (2. Aufl., Kopenh. 1842); Rösling u.Stoß,
Der Turmuhrenbau (Ulm 1843); Martens, Beschreibung der Hemmungen
der höhern Uhrmacherkunst (Furtwang. 1858);
Saunier-Großmann, Lehrbuch der Uhrmacherei (Glash. 1879, 3
Bde.); Derselbe, Das Regulieren der U. (das. 1880); Derselbe,
Taschenwörterbuch für Uhrmacher (das. 1880); Felsz, Der
Uhrmacher als Kaufmann (Berl. 1884); Rüffert, Katechismus der
Uhrmacherkunst (3. Aufl., Leipz. 1885); Sievert, Leitfaden für
Uhrmacherlehrlinge (4. Aufl., Berl. 1886); Horrmann, Repassage
einer viersteinigen Cylinderuhr (2. Aufl., Leipz. 1886);
Gelcich-Barfuß, Geschichte der Uhrmacherkunst (4. Aufl.,
Weimar 1886); Schilling-Baumann, Über Uhren, deren Geschichte
und Behandlung (Zürich 1875); Rambol, Enseignemen
théorique de l'horlogerie (Genf 1889 ff.); "Die Marfelssche
Uhrensammlung" (Frankf. a. M. 1889, 18 Tafeln); vier
Fachzeitschriften (in Leipzig, Berlin, Romanshorn und Wien).
Elektrische und pneumatische Uhren.
(Hierzu Tafel "Elektrische Uhren".) Elektrische Uhren wurden
zuerst von Steinheil 1839, von Wheatstone u. Bain 1840 konstruiert.
Man unterscheidet jetzt drei Systeme: sympathische Uhren
(elektrische Zeigerwerke), bei welchen die Angaben einer
gewöhnlichen Normaluhr durch elektromagnetische Vorrichtungen
auf eine größere Anzahl von Zifferblättern
übertragen werden; elektromagnetische Stundensteller, welche
mit Hilfe des elektrischen Stroms in bestimmten Zeiträumen die
Richtigstellung einer Anzahl von Uhren mit selbständigen
Gangwerken nach den Angaben der Normaluhr bewirken, und elektrische
Pendeluhren, welche ohne ein Laufwerk nur durch den elektrischen
Strom in Thätigkeit gesetzt und erhalten werden. Bei den
sympathischen Uhren sendet die Normaluhr mittels einer in das
Getriebe eingelegten einfachen Kontaktvorrichtung in jeder Minute
in die Leitung einen Strom, welcher die Fortbewegung des
Minutenzeigers der sympathischen U. um ein Feld veranlaßt.
Die sympathische U. von Siemens u.Halske (Fig. 1) besteht aus dem
Elektromagnet MM, der auf der Platte g und mit dieser auf der
Platte PP festgeschraubt ist. Den Polen pp ganz nahe gegenüber
steht fast vertikal der um h drehbare Anker aa; die
Abreißfeder f zieht ihn in die Ruhelage, wenn er von den
Polen pp nicht angezogen ist, bis zu dem Aufhaltestift i
zurück. An seinem verlängerten Ende befindet sich ein
stählerner Stößer c sowie etwas tiefer eine kleine
stählerne Schneide b. R ist ein Zahnrad mit 60
eigentümlich gekrümmten Zähnen, für dessen
Achse die Platte e das Lager bildet. Auf derselben Platte e ist ein
kleiner stählerner und leicht federnder Sperrhaken d
festgeschraubt. So oft ein galvanischer Strom
durch die Leitung LL..., also durch den Elektromagnet MM,
hindurchgeht, wird der Anker aa angezogen und durch den
Stößer c ein Zahn des Rades R fortgestoßen. Die
Schneide b fällt dabei sofort in eine Zahnlücke ein und
verhütet, daß durch den Stoß des
Stößers mehr als Ein Zahn fortgestoßen werde,
während zugleich der federnde Haken d über den schiefen
Rücken des zu feiner Rechten liegenden Zahns hinweggleitet und
in die nächste Zahnlücke einfällt, um beim
Rückgang des Stößers c bei Unterbrechung des Stroms
zu verhindern, daß das Rad R selbst wieder mit
zurückgeschleift werde. Es folgt hieraus, daß sich bei
jedem Durchgang des Stroms durch die Leitung LL das Rad R um eine
Zahnbreite bewegt und daher bei 60maliger Wiederherstellung und
Unterbrechung des Stroms eine volle Umdrehung erleidet. Die Achse
des Rades R trägt den Minutenzeiger, und eine einfache
Räderübersetzung führt zur Bewegung des
Stundenzeigers. Um nun die einmalige Umdrehung des Rades R in einer
Stunde zu erreichen, muß die Batterie in jeder Minute einmal
geschlossen und wieder geöffnet werden. Dies geschieht durch
die Normaluhr, die zu diesem Behuf ein Rad enthält welches in
jeder Minute eine Umdrehung macht. Fig. 2 zeigt dieses Rad bei w.
Der auf demselben festgelötete Zapfen z erreicht in jeder
Minute einmal seine tiefste Stellung, in welcher er die an der
Klemme a befestigte Metallfeder f
0976a
Elektrische Uhren.
Fig. 3. Vorderansicht.
Fig. 4. Seitenansicht.
Fig. 3. u. 4. Elektrische Zeigeruhr von Grau und
Wagner.
Fig. 5. Bohmeyers sympathische Wechselstromuhr.
Vorderansicht.
Vorderansicht.
Seitenansicht.
Fig. 8. Elektrische Pendeluhr nach Hipp.
Fig. 6. Elektrischer Stundensteller nach Hipp.
Fig. 7. Elektrische Pendeluhr nach Weare.
Fig. 1. Elektrische Zeigeruhr nach Siemens und
Halske.
Normal-Uhr
Fig. 2. Elektrische Uhrenverbindung.
977
Uhr (elektrische Uhren).
gegen einen auf die Metallfeder g gelöteten Kontaktstift
andrückt und dadurch die Batterie B schließt. Bald
darauf rückt z weiter, die Federn f und g trennen sich wieder,
und der Strom wird unterbrochen. Bei geschlossener Batterie
zirkuliert der Strom in Richtung B, a, f, g, b, L zur elektrischen
U. I, von da durch L... zur U. II etc., endlich von der letzten
eingeschalteten U. in die Erdplatte Pl, durch die Erde zurück
zu Pl und zur Batterie. - Ausgedehnte Verbreitung haben die
elektrischen Zeigerwerke von Hipp gefunden, deren Konstruktion
darauf berechnet ist, alle Störungen durch atmosphärische
Einflüsse, mangelhafte Kontakte und Erschütterungen
möglichst auszuschließen. Grau u. Wagner haben ein
Zeigerwerk für Wechselstrombetrieb mit rotierendem
polarisierten Anker konstruiert (Fig. 3 u. 4). E ist der
Elektromagnet mit den beiden Polschuhen l und k, ab ein
kräftiger permanenter Magnet, zwischen dessen Polen der
rotierende Anker auf einer Messingachse de befestigt ist. Der Anker
besteht aus zwei gleichen Teilen gi und hf aus weichem Eisen, die
rechts und links an die Messinghülse c angeschraubt und
gegeneinander um 90° verstellt sind. Beide Teile stehen den
Polen des Hufeisenmagnets ab gegenüber und werden von den
Polschuhen l und k des Elektromagnets überdeckt. Geht nun
durch letztern ein Strom, der den Polschuhen entgegengesetzte
Polarität verleiht, so findet durch die Einwirkung derselben
auf den polarisierten Anker eine Drehung des letztern um 90°
statt, in welcher Lage er durch eine Fangvorrichtung festgehalten
wird. Wenn nun in der nächsten Minute ein Strom von
entgegengesetzter Richtung den Elektromagnet durchfließt, so
erfolgt die Drehung des Ankers dennoch in gleichem Sinn, weil auch
dessen Stellung zu den Polschuhen sich bei der vorigen Bewegung
umgekehrt hat. Bei der sympathischen Wechselstromuhr von Bohmeyer
(Fig. 5), welche sich durch große Einfachheit und geringen
Kraftverbrauch auszeichnet, stehen zwei weiche Eisenkerne ab auf
dem Pol c des permanenten Hufeisenmagnets d, so daß sie
beständig magnetisch sind. In unmittelbarer Nähe des c
entgegengesetzten Pols befindet sich der weiche Eisenanker ef, der
den weichen Eisenkernen entgegengesetzt polarisiert ist, solange
kein Strom durch die Spulen geht. Die aus den Spulen hervorragenden
Enden sind nahezu halb gefeilt, und dicht vor den flachen Seiten
bewegen sich, ohne sie zu berühren, die Ankerschenkel ef. Bei
Stromschluß wird der eine Eisenkern südlich, der andre
nördlich magnetisch, so daß einer anziehend, der andre
abstoßend auf den Anker wirkt. In der Zeichnung ist e von a
angezogen, f von b abgestoßen. Die Hebel hi sitzen drehbar
auf der Minutenradwelle, in ihre obern gabelförmigen Enden
greifen die Führungsstifte kl, welche in einem mit der
Ankerachse verbundenen Querstück befestigt sind. Kommt der
Strom in umgekehrter Richtung, so zieht b den Anker f an, und h
bewegt sich nach rechts. Gleichzeitig hat sich i nach links bewegt
und der an i befindliche Sperrkegel m das 30zähnige Minutenrad
um einen halben Zahn vorgeschoben. In der nächsten Minute
wechselt der Strom, wobei Sperrkegel n das Minutenrad um einen
halben Zahn weiter schiebt. Damit sich das Rad nicht weiter bewegen
kann, treten wechselseitig n und m unter die Stifte o und p. Der
leichte Gang des Werkes ist dadurch erzielt, daß der
polarisierte Anker genau parallel gegen die Polschuhe schwingt, und
daß derselbe den Minutenzeiger vermittelst der Hebel i und h
im Trägheitsmittelpunkt desselben angreift und fortschiebt.
Der große Weg des Ankers bewirkt, daß der Zeiger nicht
geschnellt, sondern langsam fortbewegt wird. Ein Strom
atmosphärischer Elektrizität kann keine dauernde
Störung hervorbringen, denn hat er dieselbe Richtung wie der
Batteriestrom, so erzeugt er keine Bewegung; bei entgegengesetzter
Richtung rücken allerdings die Zeiger um eine Minute weiter,
der darauf folgende Batteriestrom findet nun aber seine Arbeit
schon verrichtet, und die U. zeigt wieder die richtige Zeit an. Die
elektrischen Stundensteller mit ihrem selbständigen Triebwerk
haben den großen Vorzug vor den sympathischen Uhren,
daß sie weitergehen, auch wenn aus irgend einem Grunde der
Korrektionsstrom ausbleibt. Man unterscheidet zwei Systeme. Bei dem
einen werden die Schwingungen eines Pendels durch einen unterhalb
desselben angebrachten Elektromagnet reguliert, während bei
dem andern die Richtigstellung der Uhren durch direkte Einwirkung
auf die Zeiger erfolgt. In Berlin sind sechs öffentliche
Normaluhren aufgestellt und in übereinstimmenden Gang mit
einem Regulator der Sternwarte gebracht worden. Letzterer
schließt alle zwei Sekunden mittels einer am Pendel
angebrachten Kontaktvorrichtung einen Strom. Am Pendel der
Normaluhren ist eine Drahtspirale so befestigt, daß ein
seitlich angebrachter permanenter Magnet während der
Pendelschwingungen in den Hohlraum der Spirale eintaucht. Die Achse
der letztern liegt daher rechtwinkelig zur Pendelachse. Infolge der
periodischen Stromwirkungen muß nun das Pendel der
Normaluhren gleichen Takt mit demjenigen des Regulators halten. Die
elektrischen Stundensteller von Siemens u. Halske berichtigen die
Zeigerstellung stündlich. Die mittels eines Elektromagnets
ausgeübte Kraft löst zunächst für einen kurzen
Moment ein kleines Werk aus, welches, durch Gewichts- und
Federkraft getrieben, die Zeiger faßt und richtig einstellt.
Man erhält so eine beliebige und auch für die Bewegung
sehr großer Zeiger ausreichende Kraftäußerung.
Außerdem kann man von der Zentralstation aus durch Entsendung
von Stromimpulsen mittels einer Taste unabhängig von der
Normaluhr die Zeiger der abhängigen U. aus falscher Stellung
auf die volle Stunde einstellen. Man kann dadurch die U. fast um
eine halbe Stunde vor- oder zurückstellen. Fig. 6 zeigt das
Korrektionssystem von Hipp. An der vordern Gestellwand einer
Hippschen elektrischen Pendeluhr ist der kleine Elektromagnet M
angebracht, dessen Anker A an einem Winkelhebel w befestigt ist.
Auf der Nase r des nach unten gerichteten Hebelarms ruht ein am
Hebel h sitzender Stift. Der um die Achse x drehbare Hebel h
trägt ferner einen $\bigwedge$-förmigen Klotz k, welcher
beim Fallen des Hebels den auf der Stirnfläche des Steigrades
R sitzenden Stift v faßt und so das Steigrad auf die volle
Stunde 12 oder 6 einstellt. Die Wiedereinlösung von h
geschieht durch einen der zwei auf der Stirnfläche des
Stundenrades Z angebrachten Stifte. Der eine oder andre derselben
hebt bei der Drehung von Z den Ansatz a in die Höhe, so
daß sich der Stift wieder am Auslösehaken v fängt.
Die Wirkung des Stroms erfolgt alle 6 Stunden. Der Stromkreis des
Elektromagnets M ist nämlich nur dann geschlossen, wenn einer
der Stifte y auf den Vorsprung c der Kontaktfeder d drückt,
wodurch diese mit der zweiten Kontaktfeder b in Berührung
gebracht und so eine Verbindung zwischen den Teilen L1 und L2 des
Stromkreises herbeigeführt wird. Von den minder einfachen
elektrischen Pendeluhren zeigt Fig. 7 eine Konstruktion von Weare,
welche bei Anwendung einer recht konstanten Batterie
978
Uhr (pneumatische Uhren).
gleichmäßig geht. Das Pendel A greift mit einem
Grahamschen Anker in das Räderwerk einer gewöhnlichen
Pendeluhr. NBS ist ein permanenter Stahlmagnet, N der Nordpol, S
der Südpol. Auf der Pendelstange sitzt als Linse ein
Elektromagnet E, der auf einer schmalen Messingplatte mit den
Vorsprüngen aa' ruht. Das eine Ende des Umwindungsdrahts ist
mit dieser Messingplatte, das andre mit einem Draht hinter der
Pendelstange verbunden. Letzterer ist an der Aufhängefeder des
Pendels befestigt und steht daher mit dem von dieser Feder
auslaufenden, außerhalb des Gehäuses bei dem Zinkpol z
mündenden Verbindungsdraht h in Kontakt. Der Stahlmagnet
trägt unter jedem der seitwärts vorgebogenen Polenden
eine kleine goldene Spiralfeder ff', welche beide mittels des
Magnets und des Drahts b mit dem +Pol K der Batterie verbunden
sind. Sobald nun das Pendel dem Pol N genähert wird, kommt der
Vorsprung in Berührung mit der Feder f, der Strom wird
geschlossen und zirkuliert über Kb fa durch die Windungen des
Elektromagnets und den hinter der Pendelstange befindlichen Draht
aufwärts zur Feder g und durch h nach z. Die Windungen des
Elektromagnets sind derart gewählt, daß sich bei dieser
Richtung des Stroms bei a ein Nordpol, bei a' ein Südpol
bildet. Es wird daher der nach der Linken gerichtete Elektromagnet,
sobald man ihn frei läßt, von dem Pol N
zurückgestoßen, und diese Abstoßung
überwindet wegen der größern Nähe die von S
nach a' gerichtete Abstoßung. Das Pendel schwingt daher nach
der Rechten zurück, wobei sich a von f trennt und der Strom
unterbrochen wird. Jene Abstoßung hört nun auf, das
Pendel aber geht vermöge der Trägheit über die
Ruhelage hinaus nach der Rechten und nähert sich dem
Südpol S. Kommt nun a' mit f' in Berührung, so wird der
Strom wieder geschlossen, es bildet sich wieder bei a' ein
Südpol, bei a ein Nordpol, welche beide von den gleichnamigen
Polen S und N abgestoßen werden. Aber nun überwiegt die
Abstoßung des Südpols S, und das Pendel schwingt nach
der Linken zurück etc. Die Hippsche Pendeluhr (Fig. 8) besitzt
ein Pendel P, welches in dem Punkt A mittels einer Stahlfeder
aufgehängt ist und die schwere Scheibe L mit dem Eisenanker e
trägt, der möglichst nahe über dem Elektromagnet m
schwingt. Die Pendelstange ist in halber Höhe gekröpft,
und auf der Linse sitzt ein Gleitstück a aus Achat, welches
mehrere von vorn nach rückwärts verlaufende Furchen
besitzt. An den isolierten Metallstücken bb' sind zwei
horizontale Stahlfedern ff' eingespannt, von denen die untere
für gewöhnlich an dem nicht leitenden Stift s, die obere
an dem leitenden Stift s' anliegt. Die untere Feder ist an ihrem
freien Ende mit einer aufwärts gerichteten Kontaktspitze m
versehen, außerdem trägt sie das um die Achse o leicht
bewegliche Stahlplättchen p, die Palette. Die von dem +Pol der
Batterie ausgehende Leitung umkreist den Elektromagnet, führt
dann zu f'k' und geht, sobald der Kontakt bei m geschlossen wird,
über diesen nach fbk zum -Pol zurück. Außerdem ist
noch die Zweigleitung dc' vorhanden, welche mit Ausschaltung der
Batterie eine Schließung der Drahtwindungen des
Elektromagnets herstellt, sobald der Kontakt s' geschlossen wird.
Beim Schwingen des Pendels schleift die Palette über a hinweg.
ohne daß die Achse o gehoben wird. Während dieser Zeit
bleibt der Strom unbenutzt, nimmt aber die Schwingungsamplitude so
weit ab, daß a nicht mehr vollständig unter p
weggeführt wird, so stemmt sich beim Rückgang des Pendels
die Palette in eine der Furchen a, und infolgedessen wird die Achse
o und die Feder f gehoben. Hierdurch wird der Kontakt m
geschlossen, der Strom magnetisiert den Elektromagnet, welcher nun
stark anziehend auf den Anker e wirkt, bis dieser die tiefste Lage
angenommen hat. In diesem Moment ist p wieder außer
Verbindung mit a gekommen und der Strom unterbrochen, das Pendel
aber hat einen so starken Antrieb erhalten, daß es wieder
längere Zeit mit größerer Amplitude schwingt. Die
Verbindung dc' verhindert, daß bei m ein Unterbrechungsfunke
entsteht, indem sich f' einen Moment auf s' legt, bevor der Kontakt
m geöffnet wird. Ein Pendel oder, wie bei den Taschenuhren,
eine Unruhe muß bei allen elektrischen Uhren vorhanden sein,
um ihren Gang zu regulieren; da aber die direkte Einwirkung des
Elektromagnetismus auf das Pendel dieses nur so lange vollkommen
isochronisch schwingen macht, als die Batterie ihre
ursprüngliche Stärke völlig konstant erhält, so
haben einige Erfinder das Auskunftsmittel ergriffen, den
Elektromagnetismus erst auf besondere Zwischenmechanismen einwirken
zu lassen, die nun erst ihrerseits das Pendel in seiner Bewegung
unterhalten. Dieselben bestehen entweder in einem ganz kleinen
Gewicht oder in einer Feder, welche durch den Anker eines
Elektromagnets bei jedem Stromschluß um ein Geringes gehoben,
alsdann von dem Pendel bei seiner Schwingung losgelöst werden
und in die Ruhelage zurücksinken, wobei sie jedesmal dem
Pendel denselben stets ganz gleichförmigen Impuls beibringen.
Der Strom mag nun stark oder schwach sein; solange die Kraft des
durch ihn erzeugten Elektromagnets nur hinreicht, das Gewichtchen
oder die Feder zu der vorgeschriebenen Höhe zu heben, wird das
Pendel unter der gleichmäßigen Einwirkung derselben
isochronisch schwingen und die U. richtig gehen. Was die
menschliche Kraft bei der gewöhnlichen Gewicht- oder Federuhr
alle 24 Stunden oder 8 Tage etc. nur einmal thut, das verrichtet
somit der elektrische Strom hier jeden Augenblick (Sekunde oder
halbe Sekunde). Daß durch diese für eine vollkommene
elektrische U. notwendige Einrichtung dieselbe sehr an Einfachheit
verlieren muß, ist einleuchtend. Gute Werke dieser Art sind
deshalb teuer. Vgl. Schellen, Elektromagnetischer Telegraph (6.
Aufl., Braunschw. 1882); Tobler, Elektrische Uhren (Wien 1883);
Merling, Die elektrischen Uhren (Braunschw. 1886); Favarger,
L'électricité et ses applications à la
chronometrie (Basel 1886). Pneumatische Uhren, von Mayrhofer
erfunden, dienen denselben Zwecken wie die elektrischen, erhalten
aber ihren Impuls durch komprimierte Luft mittels einer
Rohrleitung. Das ganze Gebiet einer Zentraluhrenregulierung wird
nach dem pneumatischen System in zahlreiche kleinere Bezirke
zerlegt, welche je einen durch Rohrleitung unter sich verbundenen
Komplex von Häusern umfassen. Sämtliche an die
Rohrleitung einer Unterabteilung angeschlossene Uhren werden von
einer Normaluhr aus in der Weise in dauerndem und richtigem Gang
erhalten, daß letztere den Zutritt zu der Rohrleitung
stündlich einmal der Kompressionsluft öffnet, welche
durch einen hydraulischen Apparat erzeugt und in einem Reservoir
aufbewahrt wird. Durch den eintretenden Luftdruck wird bei jeder
Sekundäruhr ein Blasebalg aufgeblasen und dabei mittels Hebel
etc. die U. aufgezogen und reguliert. Bei derselben Gelegenheit
werden auch die Normaluhren mittels Blasebalg aufgezogen. Letztere
selbst aber werden wieder von einer Zentraluhr alle 24 Stunden
richtig gestellt. Dies geschieht ebenfalls
979
Uhrdifferenz - Ujfalvy.
durch komprimierte Luft, der Antrieb dazu aber erfolgt durch
einen elektromagnetischen Apparat, der durch Herstellung eines
Kontakts von der Zentraluhr ausgelöst wird. Zentraluhr und
Normaluhr müssen zu diesem Zweck elektrisch verbunden werden,
doch kann man dazu bereits vorhandene Leitungen von Telegraphen,
Telephonen etc. ohne Beeinträchtigung ihres ursprunglichen
Zwecks benutzen und, da die Reichspost- und Telegraphenverwaltung
sich hinsichtlich der Benutzung der Telephonleitungen für
diesen Zweck entgegenkommend gezeigt hat, so bietet sich für
alle Orte mit Telephonbetrieb die Möglichkeit der
einheitlichen Zeitregulierung. Statt der komprimierten Luft kann
man auch das unter hinreichendem Druck stehende Wasser der
Wasserleitungen benutzen. - Über elektromagnetisch
registrierende Uhren s. Registrierapparate.
Uhrdifferenz, s. Zeitdifferenz.
Uhrich, Jean Jacques Alexis, franz. General, geb. 15.
Febr. 1802 zu Pfalzburg, trat 1820 als Leutnant in die Armee,
machte den spanischen Feldzug 1823 mit, diente seit 1834 in
Algerien, ward 1848 Oberst, 1852 Brigadegeneral, befehligte 1855
vor Sebastopol eine Gardebrigade, 1859 unter dem Prinzen Napoleon
eine Infanteriedivision, ward 1867 zur Reserve versetzt und 1870
Kommandant von Straßburg, das er sieben Wochen lang mit
Tapferkeit, doch ohne die erforderliche Umsicht verteidigte und 28.
Sept. übergab. Anfangs als Held gefeiert, erhielt er 1872 von
der militärischen Untersuchungskommission einen Tadel wegen
der Kapitulation von Straßburg. Er veröffentlichte
darauf: "Documents relatifs au siège de Strasbourg" (Par.
1872). U. starb 9. Okt. 1886 in Passy bei Paris.
Uhu, s. Eulen, S. 906.
Ui, Fluß in Rußland, entspringt am Ural im
Gouvernement Orenburg, fließt östlich und mündet an
der Grenze des orenburgischen und tobolskischen Gouvernements nach
einem Laufe von 400 km links in den Tobol. An seinen Ufern ist eine
aus acht Festungen bestehende Festungsreihe (die Uiskajische Linie)
gegen die Kirgisen angelegt.
Uiguren (Kaotsche), altes türk. Volk, welches in
Hochasien (Ostturkistan) wohnte und in der Kultur sehr weit
vorgeschritten war, denn es besaß bereits frühzeitig
eine eigne Schrift und Litteratur, welche von den Chinesen schon
478 erwähnt werden. Später nahmen die U. von
nestorianischen Missionären die syrische Schrift an. Nach den
Berichten der Chinesen waren am Hof des Uigurenchans eigne
Chronikenschreiber angestellt, und Buddhismus, der parsische
Zoroasterglaube sowie das nestorianische Christentum fanden bei
ihnen Eingang. Die U. haben sich lange Zeit hindurch als ein eigner
Stamm behauptet und standen wegen ihrer Bildung und Kultur in hohem
Ansehen. Später vermischten sie sich mit Mongolen, Chinesen,
Arabern und mohammedanischen Tataren, wodurch sie sowohl ihre
Bildung als ihre Nationalität verloren. Die einzige und
zuverlässige Nachricht über die U. erhalten wir aus einer
Handschrift der kaiserlichen Bibliothek in Wien, dem "Kudatku
Bilik", welche von 1069 stammt und das älteste in
türkischer Sprache abgefaßte Buch ist. Sie behandelt die
ethischen wie sozialpolitischen Verhältnisse der U. Vgl.
Vambéry, Uigurische Sprachmonumente und das Kudatku Bilik
(Innsbr. 1870); Schott, Zur Uigurenfrage (Berl. 1874-76, 2 Tle.).
Als entnationalisierte Nachkommen der U. werden von einigen die
Dunganen (s. d.) betrachtet.
Uintah Mountains (spr. uintah mauntins), Gebirge im
nordamerikan. Territorium Utah, scheidet in westöstlicher
Richtung das Becken des obern Green River von dem seines untern
Laufs und wird von dem Fluß in gewaltiger Schlucht
durchbrochen. Sein Gipfelpunkt ist Mount Emmons, 4175 m ü.
M.
Uist, zwei Inseln der äußern Hebriden, an der
Westküste Schottlands, die eine nördlich, die andre
südlich von Benbecula, North-U. mit (1881) 3371, South-U. mit
3810 meist kath. Einwohnern, welche Fischerei, Vogelfang, Viehzucht
und etwas Ackerbau treiben. Die Inseln haben steile Küsten,
zahlreiche gute Häfen und kleine Seen. Ben Eval auf North-U.
ist 345 m, Ben More auf South-U. 621 m hoch.
Uistiti, s. Seidenaffe.
Uj (magyar.), s. v. w. neu, in zusammengesetzten
Ortsnamen oft vorkommend.
Ujansi, Landschaft in Ostafrika, vom 6.° südl.
Br. mitten durchschnitten, westlich von Ugogo und wie dieses
wasserarm. Die große Karawanenstraße von Bagamoyo
über Tabora zum Tanganjika geht mitten durch das Land.
Ujejski, Cornel, poln. Dichter, geb. 1823 zu Beremniany
im Kreis Czortkow in Galizien, besuchte die Lemberger
Universität und begründete schon früh durch seine
schwungvollen und ergreifenden "Klagelieder des Jeremias" ("Skargi
Jeremiego", 1847), die er aus Anlaß des blutigen galizischen
Bauernaufstandes von 1846 schrieb, seinen dichterischen Ruf; aus
denselben wurde der Choral "Mit dem Rauch der Feuersbrünste"
("Z dymem pozarów") zum allgemeinen Volkslied. Nachdem U.
1847 in Paris zu dem ihm gesinnungsverwandten Dichter Slowacki in
nahe Beziehungen getreten, folgten seine "Biblischen Melodien"
("Melodye biblijne". Lemb. 1851), worin er in erhabener Sprache den
Schmerz des polnischen Volkes zum Ausdruck bringt, die
vortrefflichen Dichterworte zu Tonschöpfungen Chopins sowie
mehrere minderwertige Dichtungen. Während des 1863er
Aufstandes gehörte U. zu den eifrigsten Förderern der
Bewegung und entzog sich der Verhaftung durch die Flucht nach der
Schweiz. Seither wurde er wiederholt in den galizischen Landtag,
1876 auch in den Wiener Reichsrat gewählt, legte indessen sein
Mandat bald nieder. Er lebt auf dem Gut Zubrze bei Lemberg, das ihm
der dortige Magistrat als Nationalbelohnung überließ;
als Dichter ist er nur noch mit "Dramatischen Bildern" (1880)
aufgetreten, die ihn noch in der alten romantischen Frische
zeigen.
Ujesd (russ.), s. v. w. Kreis, d. h. Unterabteilung eines
Gouvernements in Rußland.
Ujest (poln. Viast), Stadt im preuß.
Regierungsbezirk Oppeln, Kreis Großstrehlitz, an der
Klodnitz, 208 m ü. M., hat 3 kath. Kirchen (darunter die sehr
besuchte Wallfahrtskirche Maria-Brunn), eine Synagoge, ein
Amtsgericht, Bierbrauerei, Gerberei, lebhafte Viehmärkte und
(1885) 2518 Einw. U. erhielt 1222 deutsches Stadtrecht. Von U.
führt der Fürst von Hohenlohe-Öhringen (sonst
Ingelfingen) den Herzogstitel (s. Hohenlohe).
Ujfalvy, Karl Eugen U. von Mezo Kovest, Sprachforscher
und Reisender, geb. 16. Mai 1842 zu Wien als Sprößling
einer alten ungarischen Adelsfamilie, besuchte die
Militärakademie in Wiener-Neustadt, trat 1861 als Leutnant in
ein österreichisches Kavallerieregiment, verließ aber
1864 die Armee und bezog die Universität in Bonn. 1866
siedelte er nach Paris über, wo er 1873 Professor an der
orientalischen Akademie wurde. Im Auftrag der Regierung machte U.
1876-82 drei Forschungsreisen durch Zentralasien, deren Ergebnisse
er in dem Werk "Expé-
980
Uj-Féjértó - Ukraine.
dition scientifique française en Russie, en Siberie et
dans le Turkestan" (Par. 1878-80, 6 Bde.) veröffentlichte. Von
seinen übrigen, vornehmlich ethnologischen und linguistischen
Arbeiten sind zu nennen: "La langue magyare, son origine, etc."
(1871); "La Hongrie, son histoire, etc." (1872); "Les migrations
des peuples et particulierement celle des Touraniens" (1873);
"L'ethnographie de l'Asie" (1874); "Mélanges altaïques"
(1874); "Étude comparée des langues ougro-finnoises"
(1875); "Grammaire finnoise" (mit R. Hertzberg, 1876);
"Éléments de grammaire magyare" (1875); "L'art des
cuivres en Cachemire" (1883); er redigierte die "Revue de
philologie et ethnographie" (Par. 1874-77, 3 Bde.). Auch
übersetzte er Petöfis Gedichte (1871) und mit
Desbordes-Valmore eine Auswahl magyarischer Dichtungen (1872), das
finnische Epos "Kalewala" (1876) ins Französische. Deutsch
schrieb er: "Alfred de Musset" (Leipz. 1870) und "Aus dem
westlichen Himalaja" (das. 1884). - Seine Gattin Marie, geborne
Bourdon, geb. 1845 zu Chartres, seine stete Begleiterin auf allen
seinen Reisen, schrieb: "De Paris à Samarkand, le Ferghanah,
etc." (1880); "Voyage d'une Parisienne dans l'Himaleya occidental"
(1887) u. a.
Uj-Fejértó, Markt im ungar. Komitat
Szabolcs, an der Debreczin-Miskolczer Bahnlinie, mit (1881) 6998
ungar. Einwohnern.
Ujhely, s. Sátoralja-Ujhely.
Uj-Szentanna (spr. -ßént-), Markt im ungar.
Komitat Arad, Station der Arad-Buttyiner Bahnlinie, mit (1881) 5193
deutschen und ungar. Einwohnern.
Uj-Verbász (spr. -wérbaß), Dorf im
ungar. Komitat Bács-Bodrog, Station der Budapest-Semliner
Bahn, liegt am Franzenskanal und hat (1881) 5090 deutsche
Einwohner, ein Untergymnasium und eine Sparkasse.
Ukami, deutsches Schutzgebiet in Ostafrika, zwischen
Usegua, Usagara und Khutu und von mehreren Zuflüssen des Rufu
durchzogen, wurde für die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft
von Peters und Pfeil durch Verträge im Dezember 1884 erworben
und 27. Febr. 1885 unter deutschen Schutz gestellt.
Ukara, Insel im Südteil des großen
afrikanischen Sees Ukerewe (s. d.).
Ukas (v. russ. ukasátj, "befehlen"), in
Rußland jeder direkt vom Kaiser oder vom dirigierenden Senat
ergehende legislative oder administrative Befehl oder Erlaß.
Die Veröffentlichung der kaiserlichen Ukase erfolgt durch den
Senat, doch hat letzterer auch das Recht, zur Ausführung
bestehender Gesetze Ukase (Verordnungen) zu erlassen. Gesetze und
Verordnungen, die vom Kaiser selbst ausgehen, heißen
"allerhöchste Ukase". Dabei wird zwischen dem eigenhändig
unterzeichneten (imennoj) und dem mündlichen U., dem vom
Kaiser auf erstatteten Vortrag erteilten Befehl, unterschieden.
Ministerielle Verordnungen werden nicht als U. bezeichnet. Kaiser
Nikolaus ließ 1827 eine Sammlung der Ukase in 48 Bänden
veranstalten, der sich die spätern von Jahr zu Jahr
anschließen. Sie bildet die Grundlage des russischen
Reichskodex (Swod sakonow).
Ukelei, s. Weißfisch.
Uker (Ucker, Ücker), Fluß in Preußen,
bildet sich beim Marktflecken Fredewalde in der Provinz Brandenburg
aus dem Abfluß mehrerer Seen, durchfließt den
Oberuker-, Strelower und Unterukersee, tritt oberhalb Pasewalk nach
Pommern über, empfängt hier die Randow und mündet
nach 103 km langem Lauf unterhalb Ückermünde in das
Kleine Haff.
Ukerewe (Victoria Nyanza), großer See in
Äquatorialafrika, zwischen 0° 45' nördl. bis 2°
50' südl. Br. und von 31° 30'-35' östl. L. v. Gr.,
liegt nach Speke 1140, nach Stanley 1160, nach Mackay 1005 m
ü. M. und hat einschließlich der zahlreichen in ihm
gelegenen Inseln ein Areal von 43,900 qkm (1525 QM.), ist sonach
größer als Bayern. Die Ufer des Sees werden meist
begleitet von Höhenzügen, sind aber stellenweise auch auf
große Ausdehnungen ganz flach; an der Westseite verlaufen
dieselben ziemlich gleichmäßig, im N., O. und S. werden
sie von zahlreichen Buchten zerschnitten (Ugoweh- und Kavirondobai,
Spekegolf), und zahlreiche Inseln und Inselgruppen (Sessearchipel,
Usuguru, Ugingo, Ukara, Ukerewe, Bumbire) sind ihnen vorgelagert.
Im N. hat er im Kiviro, der später Somerset-Nil heißt,
seinen Abfluß, dagegen gehen ihm von O. Guaso, Maroa, Rubuna,
von S. Simiu, Isanga, Lohugaci, von W. Kiwala mit Kagera
(Alexandra-Nil), Katonga u. a. zu. Der U. wurde 4. Aug. 1858 von
Speke entdeckt, dann von diesem in Verein mit Grant 1861-62 weiter
untersucht, namentlich seine nördliche Ausdehnung
festgestellt, von Stanley vom Januar bis Mai 1875 umfahren und
zuletzt von Mackay 1883 untersucht. S. Karte bei "Congo".
Ukermark (Uckermark), der nördlichste Teil der
preuß. Provinz Brandenburg, zwischen der Mittelmark,
Mecklenburg-Strelitz, Pommern und der Neumark, wird von der Uker
(von der sie den Namen hat), Oder, Welse, Randow und vielen Seen
bewässert und bildet eine nur von geringen Hügeln
durchzogene fruchtbare Ebene von 3700 qkm (67 QM.)
Flächeninhalt. Sie umfaßt im wesentlichen die Kreise
Prenzlau, Angermünde und Templin. - Die U. wurde im 6. Jahrh.
von einem wendischen Volksstamm, den Ukranern (Uchri, Wucri), dann
nach kurzer Abhängigkeit vom Deutschen Reiche gegen Ende des
10. Jahrh. von den Obotriten, um 1177 aber von den pommerschen
Herzögen in Besitz genommen. 1250 wurde sie von den
brandenburgischen Markgrafen Johann I. und Otto III. erworben, nach
dem Aussterben der Askanier aber von Pommern und Mecklenburg
besetzt. Letzteres blieb nur kurze Zeit im Besitz seines Anteils;
den Pommern hat jedoch erst Kurfürst Friedrich I. von
Brandenburg 1415 Prenzlau, Boitzenburg und Zehdenick entrissen, und
nach langwierigen Fehden hat Albrecht Achilles den Rest der U. 1472
wieder mit der Mark vereinigt.
Ukermünde, s. Ückermünde.
Ukert, Friedrich August, Gelehrter, geb. 28. Okt. 1780 zu
Eutin, studierte in Halle und wurde 1807 Erzieher der
nachgelassenen Söhne Schillers in Weimar, folgte aber schon im
folgenden Jahr einem Ruf nach Gotha, wo er zunächst Inspektor
am Gymnasium, dann Bibliothekar an der herzoglichen Bibliothek
wurde. Er starb 18. Mai 1851. Außer Übersetzungen
historischer und geographischer Werke veröffentlichte er:
"Geographie der Griechen und Römer" (Weim. 1816-46, 3 Bde.),
gab mit Heeren seit 1828 die "Geschichte der europäischen
Staaten", mit Jacobs 1834 die "Merkwürdigkeiten der
herzoglichen Bibliothek zu Gotha" (Leipz. 1835-38, 3 Bde.) heraus
und schrieb: "Über Dämonen, Heroen und Genien" (das.
1850).
Ukleisee, kleiner, sagenreicher, vielbesuchter See im
oldenburg. Fürstentum Lübeck, 5 km nördlich von
Eutin, 26 m ü. M. An seinen von niedrigen, schön
bewaldeten Hügeln umgebenen Ufern ein Wirtshaus.
Ukraine ("Grenzgebiet"), zur Zeit des alten polnischen
Reichs Benennung der äußersten südöstlichen
Grenzlande desselben, später eines ausgedehnten Landstrichs an
beiden Ufern des mittlern Dnjepr mit
981
Ula - Uleaborg.
Einschluß der Sitze der Kosaken, welcher jetzt den
größten Teil Kleinrußlands (s. d.) ausmacht. Durch
den Vertrag von Andrussow 1667 und den Frieden zu Moskau von 1686
trat Polen den östlich vom Dnjepr gelegenen Teil des Landes
(die sogen. russische U.) an Rußland ab, während der
westlich von diesem Fluß gelegene Teil (die polnische U.)
vorläufig noch unter polnischer Herrschaft blieb und erst 1793
durch die zweite Teilung Polens an Rußland kam. Die vom Donez
durchströmte slobodische U., in die sich zur Zeit der
polnischen Herrschaft viele Kleinrussen geflüchtet hatten,
bildet jetzt das Gouvernement Charkow. Über die ukrainische
Sprache und Litteratur, s. Kleinrussische Sprache und
Litteratur.
Ula, Rangklasse der türk. Zivilbeamten mit dem Titel
Exzellenz, besteht aus zwei Graden: U. sinfi ewwel und U. sinfi
sani.
Ulanen (Uhlanen), mit Lanzen bewaffnete Reiterei. Der
Name U., d. h. Wackere, Tapfere, ist tatarischen Ursprungs. Die
Polen legten ihn ihrer ähnlich bewaffneten Reiterei, mit der
sie die Tatareneinfälle abzuwehren suchten, ebenfalls bei, so
daß die polnischen U. die ersten in Europa waren und deshalb
als polnische Nationalwaffe galten. Von den Polen nahmen die
übrigen europäischen Heere die U. sogar mit ihrer
eigentümlichen Uniform, bestehend in einer viereckigen
polnischen Mütze, der Czapka, und einem
kurzschößigen Rock mit zwei Reihen Knöpfen und
polnischen Ärmelaufschlägen, der Ulanka, an. Die ersten
Ulanenregimenter nach den polnischen errichtete 1790 und 1791
Österreich; ihm folgte Preußen, welches bereits seit
1745 ein Regiment Lanzenreiter, die Bosniaken (Towarczy, s. d.),
hatte und daraus 1808 U. bildete, später Rußland und
andre Staaten. Deutschland hat 25, Österreich 11, England 5,
Rußland 2 (Garde-) Regimenter U. Frankreich hat keine U.
Während in Österreich die U. keine Lanze, sondern gleich
den übrigen Reitern nur Säbel und Karabiner führen,
begann man 1888 in Deutschland auch die Kürassiere und
Husaren, 1889 auch die Dragoner mit Lanzen auszurüsten.
Ulanga (Uranga), der Oberlauf des Lufidschi (s. d.) in
Ostafrika.
Ulanka, s. Ulanen.
Ulbach (spr. ülback), Louis, franz. Schriftsteller,
geb. 7. März 1822 zu Troyes, studierte in Paris und trat zum
erstenmal 1844 mit einer Sammlung lyrischer Poesien ("Gloriana") an
die Öffentlichkeit. Später nach und nach an den
verschiedensten Journalen beteiligt, machte er sich durch die im
"Figaro" erschienenen "Lettres de Ferragus" einen Namen als
Satiriker, zog sich aber auch durch seinen Freimut, den er
später noch entschiedener in dem wöchentlich
erscheinenden Pamphlet "La Cloche" bethätigte, gerichtliche
Verfolgung und Strafe zu. Während der Belagerung von Paris war
er, obgleich der friedfertigste Mann von der Welt, Mitglied der
Barrikadenkommission, und als er nach der Bewältigung des
Kommuneaufstandes von einem Kriegsgericht der Teilnahme an der
Insurrektion geziehen wurde, gab er in seiner "Cloche" eine so
indignierte Antwort, daß er dafür zu drei Jahren und in
zweiter Instanz immer noch zu drei Monaten Gefängnis und 3000
Frank Geldbuße verurteilt wurde. 1878 wurde er von seinen
inzwischen zur Regierung gelangten politischen Freunden mit dem
Posten eines Bibliothekars beim Arsenal entschädigt. U. hat
seit 1853 eine Reihe von Romanen erscheinen lassen, welche ihn zu
einem der gelesensten Schriftsteller machten. Wir nennen: "L'homme
au Louis d'or" (Par. 1854); "Les roués sans le savoir" (das.
1856); "La voix de sang" (1858); "Monsieur et Madame Fernel", seine
beste Arbeit, auch nicht ohne Erfolg auf die Bühne gebracht
(1860); "Françoise" (1862); "Le mari d'Antoinette" (1862);
"Louis Tardy" (1864); "Le parrain de Cendrillon" (1865-67, 2 Bde.);
"Histoire d'une mère et de ses enfants" (1874); "La
princesse Morani" (1875); "Magda" (1876); "La comtesse de Tyrnau"
(1876); "Le baron américain" (1877) ; "Les mémoires
d'un assassin" (1877); "Madame Gosselin" (1877); "Monsieur Paupe"
(1878); "Les buveurs de prison" (1879); "Les enfants de la morte"
(1879) etc. Auch im Drama hat sich U. versucht, wenn auch mit
weniger Glück. Er starb 16. April 1889 in Paris.
Ulceration (lat.), Verschwärung, s.
Geschwür.
Ulcus (lat.), s. v. w. Geschwür.
Ule, Otto, naturwissenschaftl. Schriftsteller, geb. 22.
Jan. 1820 zu Lossow bei Frankfurt a. O., studierte seit 1840 in
Halle und Berlin erst Theologie, sodann Naturwissenschaften, war
1845-48 Lehrer am Gymnasium in Frankfurt a. O., hielt daselbst im
Winter 1847 und 1848 Vorträge über die
Entwickelungsgeschichte des Weltalls und beteiligte sich lebhaft an
den politischen Kämpfen jener Jahre. Nachdem er einige Zeit
als Lehrer an der Fortbildungsschule zu Quetz bei Halle gewirkt
hatte, privatisierte er in Halle und starb hier 6. Aug. 1876. Von
seinen Schriften, die einerseits durch gemütvolles Eingehen
auf die Vorgänge, namentlich in der unbelebten Welt, zur
Naturerkenntnis zu führen, anderseits nicht bloß
Verstandes-, sondern auch Humanitätshildung zu fördern
suchen, sind hervorzuheben: "Das Weltall" (3. Aufl., Halle 1859, 3
Bde.); "Physikalische Bilder" (das. 1854-57, 2 Bde.); "Die neuesten
Entdeckungen in Afrika" (das. 1861); "Die Wunder der Sternenwelt"
(Leipz. 1861; 2. Aufl. von Klein, 1877); "Populäre Naturlehre"
(das. 1865 -1867); "Warum und Weil", Fragen und Antworten
physikalischen Inhalts (chemischer Teil, 3. Aufl., Berl. 1887;
physikalischer Teil, 6. Aufl. 1886); "Kleine naturwissenschaftliche
Schriften" (Leipz. 1865-68, 5 Bde.). Auch gab er eine Bearbeitung
von Réclus' "La terre" (Leipz. 1873-76, 2 Bde.). Mit Karl
Müller und Roßmäßler gründete er 1852
die Zeitschrift "Die Natur".
Uleåborg (sinn. Oulu), das nördlichste und
größte Gouvernement des Großfürstentums
Finnland, umfaßt das nördliche Österbotten und
Lappland und hat einen Flächenraum von 165,641 qkm (3008,2
QM.) mit (1886) 228,993 Einw. Das Land ist reich bewässert
durch mehrere Seen (Uleåträsk, Kitkajärvi,
Kemijärvi, Kiandosee, Enare u. a.) und große
Flüsse, z. B. Oulunjoki, Kemijoki, Uleåelf, Ijojoki,
Torneåelf. Im innern und östlichen Teil sind noch die
großen Wälder und Moräste überwiegend, und der
Boden ist meist unkultiviert; in der westlichen Küstengegend
aber ist der Ackerbau vorherrschend. Der Fischfang und der
Holzbetrieb sind bedeutend im ganzen Land. Im N. (Lappland) wohnen
noch etwa 600 nomadisierende Lappen, deren Hauptbeschäftigung
die Renntierzucht ist. - Die Stadt U., am Bottnischen Meerbusen und
an der Mündung des Uleåelf, brannte 1822
großenteils ab und ist seitdem freundlicher und
geräumiger wieder aufgebaut worden. Sie ist Sitz des
Gouverneurs und eines deutschen Konsuls, hat ein Lyceum, ein
Hospital, Schiffswerften, mehrere Fabriken und (1886) 11,578 Einw.,
welche Handel, besonders mit Teer, Pech und Holzwaren, treiben. U.
wurde 1605 gegründet. Während des Kriegs 1854 brannten
die Engländer im hiesigen Hafen mehrere Schiffe nebst dem
Teerhof nieder.
982
Ulemas - Ulibischew.
Ulemas (arab., "Wissende "), in der Türkei die
Rechts- und Gottesgelehrten, welche ihr Wissen
gleichmäßig aus dem Koran ziehen, werden in den
Medressen (s. d.) von den Muderris gebildet und zerfallen in
Kultusdiener oder Imame (s. d.), Gottesgelehrte oder Muftis (s. d.)
und Richter oder Kadis (s. d.). Auch die Gebetausrufer oder
Muezzins (s. d.) gehören zu den U. Das Oberhaupt der U. ist
der Scheich ul Islam.
Ulen, s. Neunauge.
Ulex L. (Stechginster, Heckensame), Gattung aus der
Familie der Papilionaceen, Sträucher mit in Dornen
auslaufenden, kantig gestreiften Ästen, einfachen, ebenfalls
zu Dornen verhärteten, linealen Blättern, meist einzeln
in den Winkeln der obern Blätter stehenden Blüten und
angeschwollener, wenigsamiger Hülse, die kaum länger als
der Kelch ist. Die Samen sind mit einem Wulst versehen. U.
europaeus L. (Heideginster), bis 1,6 m hoher, dem Wacholder
ähnlicher, aber schwach beblätterter Strauch mit gelben
Blüten, wächst im westlichen Mittel- und Südeuropa,
kommt auch noch auf sandigen Heiden des westlichen Norddeutschland
vor und wird als Heckenpflanze kultiviert. Die zerquetschten
Blätter liefern gesundes Pferdefutter, und eine Varietät
in der Normandie mit nicht dornig erhärtenden Blättern
wird auch als Schaffutter benutzt und nebst einigen andern Arten
als Zierpflanze kultiviert. Vgl. Riepenhausen-Crengen, Stechginster
(Leipz. 1889).
Ulfeldt (Uhlefeld), Korfiz (Cornifex), Graf, dän.
Edelmann, geb. 10. Juni 1606, lebte lange Zeit im Ausland, erlangte
1636 durch die Heirat mit der Gräfin Leonore Christine von
Schleswig-Holstein, einer Tochter König Christians IV. von
Dänemark von seiner Geliebten Christine Munk, großen
Einfluß, Reichtum und hohe Ämter, ward Reichshofmeister,
suchte nach Christians IV. Tod 1648 Friedrichs III. Thronbesteigung
zu hindern, um die Krone seinem Schwager zuzuwenden, ward dennoch
von Friedrich III. in seinen Ämtern belassen, verletzte aber
durch seine Anmaßung besonders die Königin Sophie Amalie
und entfloh, als er eines Mordanschlags gegen den König
beschuldigt wurde, 1651 erst nach Holland, dann nach Schweden, das
er zum Kriege gegen Dänemark aufreizte, ward nach dem Frieden
von Roeskilde 1658 in seine Würden wieder eingesetzt, entfloh
nach Einführung der absoluten Monarchie in Dänemark von
neuem und starb 20. Febr. 1664 bei Basel, nachdem er in
Dänemark zum Tod verurteilt worden war. Seine Gemahlin wurde
von Karl II. von England, bei dem sie Hilfe für U. erbat, 1663
an Dänemark ausgeliefert und von ihrer Feindin, der
Königin, im blauen Turm in Kopenhagen gefangen gesetzt, in dem
sie 22 Jahre bis nach dem Tode der Königin 1685 schmachtete.
Sie starb 1698. Vgl. I. Ziegler, Denkwürdigkeiten der
Gräfin zu Schleswig-Holstein, Leonora Christina,
vermählten Gräfin U. (2. Aufl., Wien 1879); Smith,
Leonora Cristina Grevinde Ulfeldts Historie (Kopenh. 1879-81, 2
Bde.).
Ulfilas (Ulfila, Wulfilas, "Wölfel"), der Apostel
der Goten, geb. 310 oder 311 von christlichen Eltern, die durch die
Goten aus Kappadokien in die Gefangenschaft geführt worden
waren. Im J. 341 wurde er von Eusebios von Nikomedia (s. d.) zum
Bischof geweiht, wirkte dann seit 348 unter den arianischen
Westgoten, flüchtete aus Anlaß einer Christenverfolgung
um 355 mit einem großen Teil derselben über die Donau in
das römische Reich und starb in Konstantinopel, wohin ihn
Kaiser Theodosius berufen hatte, 381. Von seinen
schriftstellerischen Arbeiten hat sich nur ein Teil seiner
gotischen Bibelübersetzung erhalten. Derselben legte er zu
Grunde für das Alte Testament die Septuaginta und für das
Neue auch einen griechischen Text, aber unter beständiger
Zurateziehung einer lateinischen Übersetzung (Itala!).
Daß er für seine Übersetzung ein gotisches Alphabet
erfunden habe, berichten mehrere Schriftsteller ausdrücklich;
dasselbe beruht im wesentlichen auf dem griechischen Alphabet.
Jedenfalls bleibt ihm der Ruhm, zuerst die Sprache seines Volkes in
zusammenhängender schriftlicher Darstellung angewandt und ihr
durch die Bibelübersetzung einen festen Halt gegeben zu haben.
Aus Italien kam ein um 500 geschriebener Prachtkodex der
Evangelien, mit silbernen Buchstaben auf purpurfarbenes Pergament
geschrieben, nach dem Kloster Werden an der Ruhr, dann nach Prag
und nach der Eroberung dieser Stadt durch den schwedischen General
Königsmark nach Schweden, wo er seit 1669 unter dem Namen des
"Codex argenteus" (faksimiliert hrsg. von Uppström, Ups. 1854)
in der Bibliothek der Universität Upsala aufbewahrt wird. Von
derselben Übersetzung ward auf Palimpsesten aus dem Kloster
Bobbio (jetzt in der Ambrosianischen Bibliothek zu Mailand) 1817
durch Angelo Mai und Castiglione ein Teil des Matthäus und der
Paulinischen Briefe entdeckt, nachdem schon 1758 der
Wolfenbüttler Geistliche Knittel einige Stücke des
Römerbriefs in einem Wolfenbüttler Palimpsest (Codex
Carolinus) aufgefunden hatte. Außerdem existieren noch einige
Stellen aus Esra und Nehemia. Gleichwohl reichen die genannten
Bruchstücke aus, um den ganzen Bau jenes altgermanischen
Dialekts zu erkennen. Nach U. und mit deutlicher Benutzung seiner
Evangelienübersetzung verfaßte später ein Gote,
vielleicht erst im 6. Jahrh., eine paraphrasierende Erklärung
des Evangeliums Johannis, deren ebenfalls aus Bobbio stammende
Bruchstücke zuerst von Maßmann herausgegeben worden sind
("Skeireins aivaggeljons thairch Johannen", Münch. 1834).
Derselbe Gelehrte entzifferte (in der "Germania" 1868) einige
weitere Bruchstücke von U.' Übersetzung der Paulinischen
Briefe, die Reifferscheid in einem Turiner Kodex gefunden hatte.
Gesamtausgaben der gotischen Sprachdenkmäler lieferten v. d.
Gabelentz und Löbe (Altenb. 1843-46, 2 Bde.), auch
Maßmann (Stuttg 1857), Stamm (8. Aufl. von Heyne, 1885) und
Bernhardt (Halle 1875, Textausg. 1884). Vgl. Waitz, Über das
Leben und die Lehre des U. (Hannov. 1840); Bessel, Über das
Leben des U. (Götting. 1860); Krafft in der
"Realencyklopädie der theologischen Wissenschaften" (2. Aufl.,
Bd. 16); Kauffmann, Untersuchungen zur Geschichte U.' ("Zeitschrift
für deutsches Altertum", Bd. 27).
Uliasserinseln, s. Amboina.
Uliassutai, Hauptstadt des gleichnamigen Kreises in der
nordwestlichen Mongolei, aus einer Zivil- und einer befestigten
Militärstadt bestehend, ist für den sibirischen Handel
wichtig und hat etwa 4000 Einw.
Ulibischew, Alexander, russ. Staatsrat und
Musikschriftsteller, geb. 1795 zu Dresden von russischen Eltern,
ward hier auch erzogen und erwarb sich im Violinspiel eine
ungewöhnliche Fertigkeit. Später widmete er sich der
Diplomatie, zog sich aber 1830 auf seine Güter bei Nishnij
Nowgorod zurück, wo er sich bis zu seinem 24. Jan. 1858 (a.
St.) erfolgten Tod als praktischer und theoretischer Musiker eifrig
beschäftigte. U. hat sich durch seine gründliche,
feinsinnige und begeistert geschriebene "Biographie de Mozart"
(deutsch von Gantter, 2. Aufl., Stuttg. 1859) einen verdienten
Namen gemacht; weniger Erfolg hatte ein zweites Werk: "Beethoven,
ses critiques et
983
Ulietea - Ulm.
ses glossateurs" (Leipz. 1857; deutsch von Bischoff, das. 1859),
da hier der Autor bei seiner einseitigen Verehrung Mozarts vielfach
zu schiefen und ungerechten Urteilen über Beethoven gelangt.
Zur Hebung und Läuterung des Musikgeschmacks in Rußland
hat U. jedenfalls viel beigetragen.
Ulietea, Insel, s. Raiatea.
Ulixes, s. Odysseus.
Ulkun, albanes. Name von Dulcigno (s. d.).
Uller, in der nord. Mythologie Sohn der Sonnengöttin
Sif (s. d.) und Stiefsohn des Thor, der schnelle Bogenschütze,
der mit seinem Bogen (dem Regenbogen) als Pfeile die Blitze
entsendet.
Ullersdorf, Dorf und Rittergut im preuß.
Regierungsbezirk Breslau, Kreis Glatz, an der Biele, hat eine kath.
Kirche, ein Schloß mit Park, einen 23 m hohen eisernen
Obelisken zu Ehren der Königin Luise, eine große
Flachsspinnerei und (1885) 2649 Einw.
Ulleswater (spr.ölleswater), See in England,
zwischen Cumberland und Westmoreland, eine Miniaturausgabe des
Vierwaldstätter Sees, 14 km lang. Durch den Eamont entleert er
sich in den Eden.
Ullmann, Karl, evangel. Theolog, geb. 15. März 1796
zu Epfenbach in der Pfalz, studierte zuHeidel- berg und
Tübingen Theologie, habilitierte sich 1819 an ersterer
Universität als Privatdozent und ward 1821 zum
außerordentlichen, 1826 zum ordentlichen Professor der
Theologie ernannt. 1829 folgte er einem Ruf als Professor nach
Halle, kehrte aber 1836 als Professor nach Heidelberg zurück,
ward 1853 zum evangelischen Prälaten und Mitglied des
Oberkirchenrats von Baden berufen und 1856 zum Direktor des
letztern in Karlsruhe ernannt, wo er, seit 1861 im Ruhestand, 12.
Jan. 1865 starb. Seit 1828 gab er mit Umbreit die "Theologischen
Studien und Kritiken" (Hamb. 1828) heraus. Von seinen Schriften,
die für die sogen. Vermittelungstheologie klassisch sind,
heben wir hervor: "Gregorius von Nazianz, der Theolog" (Darmst.
1825; 2. Aufl., Gotha 1867); "Johann Wessel, ein Vorgänger
Luthers" (Hamb. 1834), später unter dem Titel: "Reformatoren
vor der Reformation" (2. Aufl. 1866, 2 Bde.); "Historisch oder
mythisch?" (das. 1838); "Über den Kultus des Genius" (das.
1840); "Über die Sündlosigkeit Jesu" (das. 1841, 7. Aufl.
1863); "Die bürgerliche und politische Gleichberechtigung
aller Konfessionen" (Stuttg. l848); "Das Wesen des Christentums"
(Hamb. 1849; 5. Aufl., Gotha 1865). Vgl. Beyschlag, K. Ullmann
(Gotha 1867).
Ullmannia, s. Holz, fossiles.
Ullmannit, s. Nickelantimonkies.
Ulloa, Don Antonio d', einer der verdienstvollsten
Spanier im 18. Jahrh., geb. 12. Jan. 1716 zu Sevilla, widmete sich
dem Seedienst, ward schon 1733 Kapitän einer königlichen
Fregatte, begleitete 1734 einige Mitglieder der Pariser Akademie
nach Peru, um dieselben bei der Gradmessung am Äquator zu
unterstützen, durchforschte dann bis 1744 die spanischen
Besitzungen in Südamerika und setzte die von den Briten
bedrohten Küsten in Verteidigungszustand. Nach seiner
Rückkehr bereiste er noch fast alle Meere Europas und einen
großen Teil des Festlandes. Er beförderte in seinem
Vaterland den Aufschwung der königlichen Wollmanufakturen,
vollendete die großen Kanäle und Hafenbassins von
Cartagena und Ferrol und belebte die berühmten
Quecksilberminen von Almaden und Huancavelica in Peru, wohin er
1755 als Geschwaderchef gegangen war. Bald darauf erhielt er den
Oberbefehl über die Flotte in dem westindischen Meer, nahm
1762 Louisiana in Besitz und ward 1764 Gouverneur davon, kehrte
aber schon 1767 nach Spanien zurück, worauf er zum
Generalleutnant der königlichen Flotten und zum
Generaldirektor der ganzen spanischen Marine ernannt wurde. 1780 in
den Ruhestand versetzt, blieb er Direktor der Artillerie- und
Marineschule in Cadiz. Er starb 5. Juli 1795 auf seinem Landsitz
unweit Cadiz. Er schrieb: "Relacion historica del viage a la
America meridional" (Madr. 1748); "Noticias americanas sobre la
America meridional y la septentrional-oriental" (das. 1772;
deutsch, Leipz. 178l, 2 Bde.); "Noticias secretas di America"
(Lond. 1826).
Ullr., bei naturwissenschaftl. Namen Abkürzung
für Ullrich, Beamter in Linz. Entomolog.
Ulm, Hauptstadt des württemberg. Donaukreises, am
linken Ufer der Donau, die hier die Blau und Iller aufnimmt und
schiffbar wird, Knotenpunkt der Linien U.-München-Simbach und
U.-Kempten der Bayrischen und Bretten-Friedrichshafen, Aalen-U. und
U.-Sigmaringen der Württembergischen Staatsbahn, 590 m ü.
M., ist mit der gegenüber auf bayrischem Gebiet gelegenen
Stadt Neuulm (s. d.) eine Festung ersten Ranges (bis 1866 deutsche
Bundesfestung). Die Werke, 1842 bis 1866 angelegt und neuerdings
verstärkt, bilden einen kaum in fünf Stunden zu
umschreitenden Gürtel von Mauern, Gräben, Wällen u.
Türmen, um die sich wieder ein weiter Kranz von Vorwerken
lagert. Die merkwürdigsten Gebäude der nach
altreichsstädtischer Weise eng u. unregelmäßig
gebauten Stadt sind: das Rathaus (15. Jahrh.) mit dem Marktbrunnen
(sogen. "Fischkasten"), die ehemalige Komturei des Deutschen Ordens
(jetzt Kaserne), das sogen. Palais (jetzt Sitz der Kreisregierung),
das Zeughaus, Gouvernementsgebäude, mehrere Kasernen und unter
den Kirchen besonders das protestantische Münster, ein
großartiger gotischer Bau in den reinsten Verhältnissen,
an dessen Restauration seit Jahrzehnten gearbeitet wird, und der
demnächst seiner Vollendung entgegensieht. Er bedeckt einen
Flächenraum von 5100 qm und wird hinsichtlich seines Umfangs
in Deutschland nur von dem Kölner Dom übertroffen. Das
fünfschiffige, von mächtigen Säulen getragene Innere
ist 139 m lang, 57 m breit und durch edle Einfachheit von
erhebender Wirkung; es enthält ausgezeichnete
Holzschnitzereien (Chorstühle von Jörg Syrlin dem
ältern), Skulpturen, Ölgemälde und
Fensterglasmalereien und eine 1856 erbaute, 1888 veränderte
große Orgel mit 100 Registern und 6286 Pfeifen. Das
Mittelschiff erreicht eine Höhe von 41 m, die vier
Seitenschiffe von je 23 m, das Chor von 29 m. Der über dem
prachtvollen Hauptportal sich erhebende Turm, welcher (das
hölzerne Notdach nicht gerechnet) nur bis zur Höhe von 75
m fertig gebracht war, ist seit 1885 im Ausbau begriffen und wird,
nach dem Originalriß des Matthäus Böblinger
ausgeführt, eine Höhe von 151 m erreichen. Der Bau des
Münsters wurde 1377 begonnen und bis 1494 fortgeführt.
Die beiden andern Kirchen Ulms sind die Heilige
Dreifaltigkeitskirche und die katholische Kirche (mit sehenswerten
Skulpturen). Von neuern Bauwerken sind noch die 1832 vollendete
Donaubrücke (Wilhelm Ludwigs-Brücke), die
Eisenbahnbrücke, mehrere Schulhäuser, ein Schlachthaus
und der Bahnhof zu erwähnen. Die Bevölkerung betrug 1885
mit der Garnison (ein Grenadierreg. Nr. 123, ein Infanteriereg.
984
Ulmaceen - Ulpianus.
Nr. 124, 3 Eskadr. Dragoner Nr. 26, ein Feldartilleriereg. Nr.
13, ein Fußartilleriebat. Nr. 13 und ein Pionierbat. Nr. 13)
33,610 Seelen, darunter 24,295 Evangelische, 8488 Katholiken und
667 Juden. U. ist einer der wichtigsten Industrie- und
Handelsplätze Württembergs. Man findet hier starke Lein-
und Baumwollweberei, ferner Fabriken für Leder, Asphalt,
Feuerwehrrequisiten, Turmuhren, künstliche Blumen, Dachpappe,
Karten, Tabak, Zement, Maschinen, Gußstahl, eiserne
Möbel und Kochgeschirre, Nähmaschinen, mathematische,
physikalische, optische und musikalische Instrumente, Wagen,
chemische Produkte, Messing-, Korb- und Holzwaren (Ulmer
Pfeifenköpfe), Hüte, Malz etc. Außerdem hat U.
bedeutende Gerbereien, Bierbrauereien, Färbereien, Eisen- und
Kupferhämmer, eine Glockengießerei, große
Bleichen, Schiffbau etc., starken Obst- und Gemüsebau und
Blumenzucht. Der lebhafte Handel, unterstützt durch eine
Handels- und Gewerbekammer, durch eine Reichsbanknebenstelle und
mehrere Bankinstitute, ist besonders Holz-, Produkten- und
Speditionshandel. Unter den Messen und Märkten sind noch die
Tuch- und Ledermesse sowie die Fruchtmärkte von Bedeutung. An
Bildungs- und andern öffentlichen Anstalten befinden sich
dort: ein Gymnasium, ein Realgymnasium, eine Realanstalt, eine
Frauenarbeitsschule, eine landwirtschaftliche Winterschule, ein
Verein für Kunst und Altertum, eine Stadtbibliothek von 30,000
Bänden, ein Theater und ein Museum; ferner ein Witwen- und
Waisenhaus, ein großes Hospital, eine Badeanstalt etc. U. ist
Sitz der Kreisregierung, eines Oberamtes, eines Landgerichts, eines
Generalsuperintendenten, eines Hauptzollamtes, eines
Festungsgouverneurs und -Kommandanten, des Stabes der 27. Division
und der 53. und 54. Infanterie- wie der 27. Kavalleriebrigade. Die
städtischen Behörden zählen 19 Magistratsmitglieder
und 18 Stadtverordnete. Zum Landgerichtsbezirk U. gehören die
8 Amtsgerichte zu Blaubeuren, Ehingen, Geislingen, Göppingen,
Kirchheim, Laupheim, Münsingen und U.
Geschichte. U., in der Karolingerzeit ein königliches
Hofgut mit einer Pfalz, wird zuerst 854 erwähnt und wurde von
Ludwig dem Deutschen und seinen Nachfolgern mehrfach zur Abhaltung
von Reichsversammlungen benutzt. Seit 1027 ist es als Stadt
nachzuweisen und wurde bald Hauptstadt des Herzogtums Schwaben.
Wegen seiner Anhänglichkeit an die Hohenstaufen wurde U. 1134
von Heinrich dem Stolzen von Bayern niedergebrannt und
geplündert. Doch erhob sich die Stadt seit 1140 zu neuer
Blüte und erscheint schon 1155 als Reichsstadt. 1274 erhielt
sie dieselben Freiheiten wie Eßlingen. Sie stand unter der
Vogtei der Grafen von Dillingen, dann der von Württemberg.
1247 widerstand sie heldenmütig dem Gegenkönig Heinrich
Raspe. 1331 trat sie in den Schwäbischen Städtebund und
beteiligte sich auch 1376 an der Einigung der schwäbischen
Städte. Eine Belagerung durch Kaiser Karl IV. in demselben
Jahr blieb erfolglos. An dem Krieg von 1388 nahm U. als Vorort des
Städtebundes hervorragenden Anteil. Seine Blütezeit
fällt in die zweite Hälfte des 14. Jahrh., wo es jedoch
nur eine Bevölkerung von 20,000 Einw. und ein Gebiet von 926
qkm (17 QM.) hatte. Die Reformation fand früh in U. Eingang;
schon 1526 trat die Stadt dem Torgauer, 1530 dem Schmalkaldischen
Bund bei, mußte sich aber 1546 Karl V. unterwerfen und 1548
das Augsburger Interim annehmen. Der Vertrag von U. (3. Juli 1620)
stellte den Frieden zwischen der Union und Liga her; 14. März
1647 wurde daselbst ein Waffenstillstand zwischen Bayern,
Frankreich und Schweden abgeschlossen. Am 26. Sept. 1796 fand hier
ein Gefecht zwischen den Österreichern unter Latour und der
französischen Arrieregarde unter Moreau statt. Durch den
Reichsdeputationsrezeß von 1803 verlor U. die Reichsfreiheit
und ward Hauptstadt des bayrischen Oberdonaukreises, 1805 aber von
den Österreichern besetzt. Bald darauf wurde hier der
österreichische Feldzeugmeister General Mack durch die
Franzosen unter Napoleon I. eingeschlossen und mußte sich 17.
Okt. mit 23,300 Mann kriegsgefangen ergeben. Infolge des Wiener
Friedens 14. Okt. 1809 ward U. von Bayern an Württemberg
abgetreten, 1842 zur Bundesfestung ersten Ranges bestimmt und der
Bau der Befestigungen namentlich von dem preußischen General
v. Prittwitz geleitet. Seit 1871 ist es deutsche Reichsfestung.
Vgl. Jäger, Ulms Verfassung im Mittelalter (Heilbr. 1831);
Pressel, Ulmisches Urkundenbuch (Stuttg. 1873); Derselbe, U. und
sein Münster (Ulm 1878); Haßler, Ulms Kunstgeschichte im
Mittelalter (Stuttg. 1872); Fischer, Geschichte der Stadt U. (das.
1863); Schultes, Chronik von U. (das. 1881); v. Löffler,
Geschichte der Festung U. (das. 1881).
Ulmaceen, dikotyle Pflanzenfamilie aus der Ordnung der
Urticinen, Bäume und Sträucher mit
wechselbständigen, einfachen, gestielten, fiedernervigen,
gesägten, rauhen Blättern mit abfallenden
Nebenblättern und mit zwitterigen oder durch Fehlschlagen
eingeschlechtigen Blüten, welche in Büscheln stehen, die
aus besondern, an der Seite der Zweige stehenden Knospen
hervorkommen. Das Perigon ist krautartig oder etwas gefärbt,
fast glockenförmig, mit vier- oder fünf-, bisweilen
achtspaltigem Saum. Die meist in der gleichen Anzahl vorhandenen
Staubgefäße sind im Grunde des Perigons, den Abschnitten
desselben gegenüberstehend, inseriert. Der Fruchtknoten ist
oberständig, aus zwei Karpellen gebildet, zwei- oder
einfächerig, mit einer hängenden, anatropen Samenknospe
in jedem Fach. Die zwei abstehenden Griffel sind an der Innenseite
mit den Narbenpapillen besetzt. Die Frucht ist vom stehen
bleibenden Perigon umgeben, bald eine häutige
Flügelfrucht, bald ein lederartiges, glattes oder schuppiges
Nüßchen, durch Fehlschlagen stets einfächerig und
einsamig. Der Same hat eine häutige Schale, kein Endosperm und
einen geraden Embryo mit flachen Kotyledonen und kurzem, nach oben
gekehrtem Würzelchen. Vgl. Planchon, Ulmaceae, in De Candolles
"Prodromus", Bd. 17. Die aus ca. 140 Arten bestehenden U. sind
über die gemäßigte Zone der nördlichen
Halbkugel verbreitet; Vertreter der jetzt lebenden Gattungen Ulmus
und Planera kommen auch fossil in zahlreichen
Blätterabdrücken in Tertiärschichten vor. Manche
sind als Holzpflanzen und Zierbäume bemerkenswert
Ulme, s. Rüster.
Ulmen, im Bergbau die Seitenwände der Stollen; vgl.
Bergbau, S. 723.
Ulmin, Ulminsäure, s. Humus.
Ulna (lat.), Elle, Ellbogenknochen; Arteria ulnaris,
Ellenschlagader etc.
Ulothricheen, Familie der Algen aus der Ordnung der
Zoosporeen (s. Algen [3], S. 342).
Ulpianus, Domitius, berühmter röm.
Rechtsgelehrter, geboren um 170 n. Chr. zu Tyros, begann seine
öffentliche Thätigkeit in Rom unter Septimius Severus als
Assessor erst eines Prätors, dann Papinians, bekleidete unter
Alexander Severus, dessen Lehrer und Vormund er gewesen war, die
höchsten Ämter und ward 228 als Praefectus praetorio
von
985
Ulricehamn - Ulrich von Türheim.
den über seine Strenge erbitterten Prätorianern vor
den Augen des Kaisers ermordet. Als Jurist nimmt U. den ersten Rang
nach Papinian ein. Seine beiden Hauptwerke sind die dogmatischen
Darstellungen des prätorischen Rechts ("Ad edictum", in 83
Büchern) und des Zivilrechts ("Ad Sabinum", in 51
Büchern). Sie bilden die Grundlage der Pandekten und haben den
dritten Teil des in denselben angesammelten Stoffes geliefert.
Wertvoll ist auch die kleine Schrift "Tituli ex corpore Ulpiani",
gewöhnlich "Ulpiani fragmenta" genannt, herausgegeben von Hugo
(5. Aufl., Berl. 1834), Böcking (4. Aufl., mit Faksimile der
vatikanischen Handschrift, Leipz. 1855), Vahlen (Bonn 1856),
Huschke (5. Aufl., Leipz. 1886) und Krüger (Berl. 1878). Ein
Fragment von U.' Institutionen, welches 1835 in der Wiener
Hofbibliothek gefunden wurde, gab Endlicher (Wien 1835) heraus.
Vgl. Schilling, Dissertatio critica de Ulpiani fragmentis (Bresl.
1824); Heimbach, Über Ulpians Fragmente (Leipz. 1834). Der
sogen. "U. de edendo" ist eine mittelalterliche Prozeßschrift
aus der Zeit der Glossatoren (hrsg. von Hänel, Leipz.
1838).
Ulricehamn (früher Bogesund), Landstadt im schwed.
Län Elfsborg, am See Asunden und an der Eisenbahn U.-Wartofta,
hat ein Pädagogium, Gewerbeschule, Dampfsäge, Brauerei u.
(1885) 1134 Ew. Hier 18. Jan. 1520 Schlacht zwischen den Schweden
und Dänen, in welcher der schwedische Reichsvorsteher Sten
Sture der jüngere tödlich verwundet ward.
Ulrich, Herzog von Württemberg, geb. 1487, Sohn des
wahnsinnig gewordenen Grafen Heinrich IV., wurde bei seinem Vetter,
dem Herzog Eberhard I., mit dem Bart, erzogen und kam schon 1498,
nach der Absetzung des Herzogs Eberhard II., zur Regierung, die er
19. Juli 1503 selbständig übernahm. Er beteiligte sich
1504 am bayrisch-landshutischen Erbfolgekrieg, vollstreckte im
Verein mit Hessen die Acht gegen den Pfalzgrafen Philipp und
erlangte im Frieden eine bedeutende Gebietsvergrößerung.
Hierauf aber ergab er sich den rauschendsten Vergnügungen, in
denen er Ersatz für seine unglückliche Ehe mit der
Prinzessin Sabine von Bayern, einer Schwestertochter des Kaisers
Maximilian, suchte, während er die Regierung treulosen
Räten überließ. Die schon zuvor beträchtlichen
Schulden der Familie wuchsen bald bis zu 1 Mill. Gulden heran;
schwere Abgaben und unfruchtbare Jahre machten die Unterthanen
unzufrieden, und so erhob sich 1514 der Aufstand des "armen Konrad
, den U. nur dadurch dämpfen konnte, daß er im
Tübinger Vertrag, worin das Land die Bezahlung der
fürstlichen Schulden übernahm, dem Volk
außerordentliche Rechte und Freiheiten einräumte. Am 7.
Mai 1515 ermordete der Herzog auf der Jagd im Böblinger Wald
eigenhändig Hans v. Hutten, den er in dem Verdacht allzu
großer Vertraulichkeit mit seiner Gemahlin hatte, und reizte
dadurch auch den Kaiser, das bayrische Herzogshaus, bei welchem die
Herzogin Sabine Zuflucht gesucht, und den Adel, an dessen Spitze
sich die Huttens, vor allen Ulrich v. Hutten (s. d.), als
Rächer stellten, gegen sich auf. Er wurde daher 11. Okt. 1516
und zum zweitenmal im Juli 1518 in die Acht erklärt und,
nachdem er noch gegen seine Feinde grausam gewütet und die
Reichsstadt Reutlingen erobert und sie zu einer Landstadt gemacht
hatte, im April 1519 vom Schwäbischen Bund vertrieben und floh
nach einem mißlungenen Versuch der Wiedereroberung seines
Landes nach Mömpelgard. Das Land verkaufte der
Schwäbische Bund 1520 für den Ersatz der Kriegskosten an
Kaiser Karl V., der 1530 auf dem Reichstag zu Augsburg seinen
Bruder Ferdinand damit belehnte. U. begab sich nach längerm
Aufenthalt im Ausland zum Landgrafen Philipp von Hessen nach
Marburg, wo er für die Reformation gewonnen wurde. Nachdem
sich 1534 der Schwäbische Bund aufgelöst hatte,
führte Philipp von Hessen U. an der Spitze von 20,000 Mann
nach Württemberg zurück, wo der Sieg bei Lauffen am
Neckar 13. Mai ihm sein Herzogtum wieder verschaffte; doch
mußte U. dasselbe in dem am 29. Juni d. J. zu Kaaden in
Böhmen mit Ferdinand zu stande gekommenen Vergleich als
österreichisches Afterlehen anerkennen. Bald nachher
führte er in seinem Lande das Reformationswerk zu Ende. Als
Mitglied des Schmalkaldischen Bundes ließ er 1546 eine
beträchtliche Truppenzahl zum Heer der Verbündeten an die
Donau vorrücken; nach dem unglücklichen Ausgang des
Kriegs mußte er nach dem Vertrag von Heilbronn eine
ansehnliche Summe zahlen, dem Kaiser mehrere Schlösser
einräumen und in Ulm vor diesem einen Fußfall thun. Auch
dem Augsburger Interim unterwarf er sich, ward aber dennoch von
einem kaiserlichen Gericht mit Absetzung bedroht, als er 6. Nov.
1550 starb. Vgl. Heyd, Herzog U. von Württemberg (Tübing.
1841-43, 3 Bde.); Kugler, U., Herzog zu Württemberg (Stuttg.
1865); Ulmann, Fünf Jahre württembergischer Geschichte
unter Herzog U., 1515-19 (Leipz. 1867).
Ulrich, Pauline, Schauspielerin, geboren um 1835 zu
Berlin, wo ihr Vater am Hoftheater Orchestermitglied war, machte
auf dem Liebhabertheater Konkordia in großen, auf dem
Hoftheater in kleinen Rollen die ersten praktischen Versuche, wurde
1856 in Stettin engagiert, aber fünf Monate später an das
Hoftheater zu Hannover berufen, dem sie bis 1859 angehörte. In
ebendem Jahr gastierte sie, von der Frieb-Blumauer empfohlen, am
Dresdener Hoftheater und trat im Mai 1859 in den Verband dieses
Instituts, dem sie noch heute angehört. Gleich bedeutend im
Trauer- wie im Lustspiel, ist sie am vorzüglichsten in
Darstellung weiblich-vornehmer Rollen, worin sie ihr
würdevolles, dabei grazioses und anmutiges Äußere
sehr wesentlich unterstützt.
Ulrich von Lichtenstein, mittelhochdeutscher Dichter, aus
ritterlichem steirischen Geschlecht um 1200 geboren, starb 1276. In
seinem Gedicht "Frauendienst", das zuerst Tieck teils in
Bearbeitung, teils in Übersetzung (Stuttg. 1812) bekannt
machte, gibt er eine Darstellung seines alle Wunderlichkeiten und
Verirrungen des ritterlichen Minnedienstes offenbarenden Lebens in
Strophen, welchen auch seine Lieder, ein Leich und mehrere
"Büchlein" (Liebesbriefe) eingeflochten sind. Außerdem
besitzen wir von ihm ein kleineres Lehrgedicht: "Frauenbuch". Beide
sind herausgegeben von Lachmann, mit historischen Anmerkungen von
Karajan (Berl. 1841), der "Frauendienst" allein von Bechstein
(Leipz. 1888, 2 Bde.); die lyrischen Gedichte hat auch v. d. Hagen
in seine "Minnesinger" (Bd. 4) aufgenommen. Vgl. Falke, Geschichte
des fürstlichen Hauses Liechtenstein, Bd. 1 (Wien 1869);
Knorr, Über U. v. L. (Straßb. 1875); Becker, Wahrheit
und Dichtung in U. von Lichtensteins Frauendienst (Halle 1888).
Ulrich von Türheim, deutscher Dichter aus dem
Thurgau, der im zweiten Viertel des 13. Jahrh. dichtete. Er setzte
Wolframs von Eschenbach "Willehalm" in dem Gedicht "Der starke
Rennewart" fort und dichtete einen Schluß zu Gottfrieds von
Straßburg "Tristan und Isolde" (gedruckt in den Ausgaben des
letztern Werkes von v. d. Hagen, Berl. 1823; Maßmann, Leipz.
1843).
986
Ulrich von dem Türlein - Ultimatum.
Ulrich von dem Türlein, deutscher Dichter aus der
zweiten Hälfte des 13. Jahrh., wahrscheinlich aus Kärnten
stammend, bearbeitete, als Ergänzung des "Willehalm" Wolframs
von Eschenbach, denjenigen Teil der Sage, der dem von Wolfram
behandelten Stoffe vorausgeht: die Entführung Arabeles. Die
einfache und in sich wohl abgerundete Erzählung ist in
verschiedenen Handschriften erhalten, aber noch nicht
veröffentlicht.
Ulrich von Winterstetten, Schenk, Minnesänger, war
ein schwäbischer Ritter, der seit 1241 in Urkunden vorkommt
und von 1258 bis 1269 als Kanonikus in Augsburg begegnet. In seinen
Liedern und Weisen, die der Mehrzahl nach aus seiner Jugendzeit
stammen mögen, herrscht ausgelassene Fröhlichkeit; wie er
selbst sagt, wurden sie ihrer leichten Form wegen auf den Gassen
gesungen. Eine Ausgabe derselben besorgte Minor (Wien 1882).
Ulrich von Zatzikhofen, deutscher Dichter des 12. Jahrh.,
aus dem Thurgau (Schweiz), verfaßte um 1195 seinen "Lanzelet"
nach einem französischen Original, das er durch Hug von
Morville, eine der sieben von Richard Löwenherz dem Herzog
Leopold von Österreich gestellten Geiseln, erhalten hatte, das
aber noch nicht wieder aufgefunden ist (hrsg. von Hahn, Frankf. a.
M. 1845). Vgl. Bächtold, Der Lanzelet des U. v. Z. (Frauenf.
1870).
Ulrichs, Heinrich Nikolaus, Archäolog, geb. 8. Dez.
1807 zu Bremen, studierte in Leipzig, Bonn und München, ging
1833 als begeisterter Philhellene nach Griechenland und wirkte hier
ein Jahrzehnt erfolgreich lehrend und schreibend für
Einführung des Lateinunterrichts in Gymnasium und
Universität in Athen als Professor der lateinischen Litteratur
und Altertumskunde an der letztern. Mit dem Maler K. Rottmann
durchwanderte er Nordgriechenland und andre Teile des Landes und
sammelte überall wertvolle Beobachtungen, welche niedergelegt
sind in dem Werk "Reisen und Forschungen in Griechenland" (Bd. 1,
Brem. 1840; Bd. 2, hrsg. v. A. Passow, Berl. 1863). Er starb 10.
Okt. 1843 in Athen. Aus seinen Papieren veröffentlichte W.
Henzen italienisch "Viaggi ed investigazioni nella Grecia" in den
"Annali dell' Istituto archeologico", Bd. 18 und 20.
Ulrichstein, Stadt in der hess. Provinz Oberhessen, Kreis
Schotten, in rauher Gegend am Vogelsberg und am Ursprung der Ohm,
hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht und (1885) 873 Einw.
Ulrici, Hermann, Philosoph und Ästhetiker, geb. 23.
März 1806 zu Pförten in der Niederlausitz, studierte zu
Halle und zu Berlin die Rechte, war anfänglich Beamter, seit
1833 Privatdozent zu Berlin, seit 1834 Professor der Philosophie zu
Halle, wo er 11. Jan. 1884 starb. Als Philosoph gehört U. mit
Fichte dem jüngern, Wirth, Carriere u. v. a. zu der
Theistenschule, deren Organ, die "Zeitschrift für Philosophie
und philosophische Kritik", er seit seinem Bestehen mit redigierte;
als Ästhetiker hat er sich namentlich als Shakespearekenner
ausgezeichnet. Von seinen philosophisch-ästhetischen Schriften
erwähnen wir: "Geschichte der hellenischen Dichtkunst" (Berl.
1835, 2 Bde.); "Das Grundprinzip der Philosophie" (Halle 1845-46, 2
Bde.); "System der Logik" (das. 1852); "Gruben und Wissen" (Leipz.
1858); "Gott und die Natur" (das. 1862, 3. Aufl. 1875); "Leib und
Seele" (das. 1866; 2. Aufl. 1874, 2 Bde.); "Kompendium der Logik"
(das. 1860, 2. Aufl. 1872); "Grundzüge der praktischen
Philosophie" (das. 1873, Bd. 1); "Abhandlungen zur Kunstgeschichte
als angewandter Ästhetik" (das. 1876). Durch seine Abhandlung
"Der Spiritismus eine wissenschaftliche Frage" griff er in den
durch Zöllner veranlaßten Streit über die
angeblichen Thatsachen des Spiritismus ein und geriet darüber
mit Wundt (s. d.) in litterarische Fehde. Früchte seiner
Shakespeare-Studien sind: "Shakespeares dramatische Kunst" (Halle
1839; 3. Aufl., Leipz. 1868,. 3 Bde.), eine Ausgabe von
Shakespeares "Romeo und Julia" (das. 1853) und die "Geschichte
Shakespeares und seiner Dichtung" (im 1. Band der von ihm als
Präsidenten der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft besorgten
neuen Ausgabe der Schlegel-Tieckschen Übersetzung, 2. Aufl.,
Berl. 1876).
Ulrike Eleonore, Königin von Schweden, Tochter Karls
XI. und der dänischen Prinzessin Ulrike Eleonore, geb. 23.
Jan. 1688, stand während der Abwesenheit ihres Bruders Karl
XII. 1713 und 1714 der Regierung vor, wurde 1715 mit dem Erbprinzen
Friedrich, nachmaligem Landgrafen von Hessen-Kassel, vermählt,
wußte nach dem Tod ihres Bruders Karl (1718) durch Intrigen
mit der Adelspartei den Sohn ihrer ältern Schwester, Karl
Friedrich von Holstein-Gottorp, von der Thronfolge
auszuschließen, indem sie den Reichsständen das Recht
der Königswahl zugestand und die von diesen entworfene neue
aristokratische Regierungsform unterzeichnete. Hierauf wurde sie
21. Febr. 1719 zum "König" von Schweden erwählt und 17.
März gekrönt, trat aber 29. Febr. 1720 die Krone an ihren
Gemahl ab. Sie starb kinderlos an den Blattern 24. Nov. 1741 in
Stockholm.
Ulrike Luise, Königin von Schweden, s. Luise 4).
Ulster (spr. öllster), die nördlichste Provinz
Irlands, wird im W. und N. vom Atlantischen Ozean, im O. von dem
Nordkanal und der Irischen See bespült und hat einen
Flächenraum von 22,189 qkm (402,97 QM.) und (1881) 1,743,075
Einw. (1861 noch 2,386,372). Von der Oberfläche sind 26,9
Proz. Ackerland, 5,2 Wiesen, 40,3 Weiden, 42 Wald, 3,8 Proz.
Wasser. An Vieh zählte man 1881: 173,206 Pferde und Maultiere,
23,672 Esel, 1,028,486 Rinder, 378,915 Schafe und 249,298 Schweine.
U. ist die wohlhabendste Provinz Irlands und Hauptsitz der
Leinenindustrie. Die Bevölkerung ist großenteils
schottischer und englischer Abkunft; 47,8 Proz. sind Protestanten.
Irisch wird nur noch in den entlegenen Teilen Donegals gesprochen.
S. Karte "Großbritannien".
Ulster, linksseitiger Nebenfluß der Werra,
entspringt auf der Wasserkuppe in der Rhön, fließt nach
N. durch ein schönes Thal und mündet nach 45 km langem
Lauf unterhalb Vacha.
ult., Abkürzung für Ultimo (s. d.).
Ultenthal, Seitenthal des Etschthals unterhalb Meran,
zieht sich neun Stunden lang von den Gebirgen von Sulzberg und
Martell in südwestlicher Richtung herab, wird vom Falschauer
Bach durchströmt, der sich vor seiner Ausmündung durch
eine gewaltige Klamm Bahn bricht. Im U. liegt das Mitterbad mit
einer Quelle, welche schwefelsaures Eisen enthält, und guter
Badeeinrichtung (jährlich 300 Kurgäste).
Ultima ratio regum (lat.), "das letzte (Beweis-) Mittel
der Könige" , d. h. die Kanonen, ein gewöhnlich auf
Ludwig XIV. zurückgeführter Ausspruch, findet sich im 1.
Akt von Calderons Schauspiel "In diesem Leben ist alles wahr und
alles Lüge".
Ultimatum (neulat.), bei diplomatischen Verhandlungen die
Schlußerklärung des einen Teils, an welcher er
unwiderruflich festzuhalten gesonnen sei. Die Verwerfung des
Ultimatums hat daher in der Regel den unmittelbaren Abbruch der
diplomatischen Verhandlungen und unter Umständen die
Ergreifung von Gewaltmaßregeln (Kriegserklärung) zur
Folge.
987
Ultimo - Ulva.
Ultimo (ital., abgek. ult.), der Letzte, der
Schlußtag des Monats, im Börsenverkehr der übliche
Stichtag für die Abwickelung von Differenzgeschäften.
Daher per U. handeln und U.-Kurse, unter welchen zuweilen auch die
Liquidationskurse gemeint sind; U.-Regulierung, im
Börsenverkehr die Abwickelung der Ende eines bestimmten Monats
zu erfüllenden Lieferungsgeschäfte (vgl. Börse, S.
236 f.). Über U.-Wechsel s. Wechsel.
Ultimus (lat.), der Letzte (z. B. in einer Klasse).
Ultra (lat.), jenseit, darüber hinaus, bezeichnet
Überschreitung des rechten Maßes, namentlich die
Parteirichtung desjenigen, welcher in Gesinnung und Handlung das
von der Vernunft und den Umständen gebotene Maß
überschreitet. Daher nennt man Ultras die Anhänger aller
politischen Extreme, wie Ultraroyalisten, Ultrademokraten,
Ultrakonservative etc., und deren Richtung Ultraismus.
Ultramarin (Lasurblau, Azurblau), blauer Farbstoff, der
ursprünglich durch ein rein mechanisches Verfahren aus dem
Lasurstein gewonnen wurde und sehr hohen Wert besaß, jetzt
aber in gleicher Schönheit aus eisenfreiem Thon, Schwefel und
Soda (Sodaultramarin) oder Glaubersalz (Sulfatultramarin) und Kohle
künstlich dargestellt wird und sehr billig geworden ist. Man
unterscheidet kieselarmes U. von hellem, rein blauem Farbenton,
leicht zersetzbar durch Alaun, und kieselreiches U. mit
eigentümlich rötlichem Ton und widerstandsfähiger
gegen Alaun. Zur Darstellung des Ultramarins werden die
Materialien, der Thon nach dem Schlämmen und Glühen, sehr
fein gepulvert und innig gemischt. Für Sulfatultramarin
benutzt man ein Gemisch aus
Porzellanthon . .............................100 100
kalciniertem schwefelsauren Natron...........83-100 41
kalcinierter Soda............................ - 41
Kohle........................................ 17 17
Schwefel..................................... - 13
Dieser Satz wird im Schamottetiegel eingestampft und in einer
Art Muffelofen bei möglichst gehindertem Luftzutritt anhaltend
stark erhitzt. Hierbei entsteht eine gesinterte, poröse,
graue, oft gelbgrüne Masse, welche gewaschen, gemahlen,
abermals gewaschen, getrocknet und gesiebt wird. Das Produkt, das
grüne U., wird zum Teil als solches verwertet, zum bei weitem
größten Teil aber durch Erhitzen mit Schwefel bei
Luftzutritt in blaues U. verwandelt. Dies geschieht in liegenden
Cylindern, in welchen das U. während des Verbrennens des nach
und nach zugesetzten Schwefels durch eine Flügelwelle
umgerührt wird, um die Einwirkung der Luft zu befördern.
Die gebildete schweflige Säure entweicht durch die Esse. Das
Eintragen von Schwefel wird fortgesetzt, bis das U. rein blau
erscheint, dann wird dasselbe ausgewaschen, gemahlen,
geschlämmt, eventuell mit Kaolin oder Gips vermischt,
getrocknet und gesiebt. Die Waschwasser vom grünen und blauen
U. werden verdampft, um in ihnen enthaltene Natronsalze
wiederzugewinnen. Sodaultramarin wird in ähnlicher Weise aus
100 Thon, 100 Soda, 12 Kohle und 60 Schwefel erhalten und zeichnet
sich durch dunklere Färbung und größern
Farbenreichtum aus. Das kieselreiche U. ist ein Sodaultramarin mit
5-10 Proz. vom Gewicht des Kaolins fein zerteilter
Kieselsäure. Man erhält es in einer einzigen Operation,
doch macht die Neigung, zu sintern, Schwierigkeiten. Dies
Präparat wird mit steigendem Kieselsäuregehalt
rötlicher und alaunfester. Auch violette, rote und gelbe
Präparate hat man dargestellt, doch sind deren Beziehungen zu
dem blauen U. noch wenig aufgeklärt. Selbst die chemische
Konstitution des blauen Ultramarins ist bis jetzt nicht sicher
erkannt. Es enthält
kieselsäurearmes U. kieselsäurreiches U.
Durch- Durch
schnitt reinstes -schnitt reinstes
Thon.... 2,36 1,87 7,64 3,61
Kieselsäurean-
hydrid ... 37,90 38,55 34,86 40,77
Thonerde ... 29,30 29,89 24,06 23,74
Kali .... - 1,21 1,01 19,58
Natron... 22,60 21,89 0,83 18,54
Schwefel... 7,86 8,27 13,25 13,58
U. ist prächtig tiefblau geruch- und geschmacklos, sehr
hygroskopisch (lufttrocken 5 Proz. Feuchtigkeit), unlöslich in
den gewöhnlichen Lösungsmitteln, widersteht der Luft, dem
Licht und dem Wasser, auch Alkalien und dem Ammoniak, wird durch
Säuren und sauer reagierende Salze unter Entwickelung von
Schwefelwasserstoff zersetzt, erträgt bei Ausschluß der
Luft Rotglut, wird aber in höherer Temperatur und beim
Glühen an der Luft farblos. U. dient als Wasser-, Kalk- und
Ölfarbe, im Buntpapier-, Tapeten- und Zeugdruck, zum Blauen
von Wäsche, Papier, Zucker, Stärke, Barytweiß,
Stearin , Paraffin. Grünes U. kann nur als ordinäre
Tüncher- und Tapetenfarbe benutzt werden. Die gelegentliche
Bildung von U. im Sodaofen beobachtete Tessaert 1814, und Vauquelin
zeigte, daß die blaue Verbindung mit Lasurstein identisch
sei. Gmelin stellte 1828 künstliches U. dar, doch hatte es
schon 1826 Guimet in Lyon als Geheimnis fabriziert. Die ersten
deutschen Ultramarinfabriken wurden 1836 in Wermelskirchen von
Leverkus und 1837 in Nürnberg von Leykauf gegründet.
Gegenwärtig beträgt die europäische (zum bei weitem
größten Teil deutsche) Produktion jährlich 600,000
Ztr. Vgl. Lichtenberger, Ultramarinfabrikation (Weim. 1865);
Vogelsang, Natürliche Ultramarinverbindungen (Bonn 1873);
Heinze, Beitrag zur Ultramarinfabrikation (Dresd. 1879);
Fürstenau, Das U. und seine Bereitung (Wien 1880).
Ultramaringelb, s.v.w. Chromgelb, Zinkgelb
oderchromsaurer Baryt (s. Chromsäuresalze).
Ultramontanismus (lat.), diejenige Auffassung des
Katholizismus, welche dessen ganzen Schwerpunkt nach Rom, also
jenseit der Berge (ultra montes), verlegen möchte; ultramontan
ist somit das ganze Kurial- oder Papalsystem (s. d.).
Ultra posse nemo obligatur (lat.), Unmögliches zu
leisten, kann niemand verpflichtet werden.
Ultrarote und ultraviolette Strahlen, die schwächer
als die roten, resp. stärker als die violetten brechbaren
Strahlen, welche unsichtbar sind, aber die einen durch ihre
Wärmewirkung, die andern durch ihre chemische Wirkung
nachgewiesen werden. Vgl.Fluoreszenz, Licht,
Wärmestrahlung.
Ulua, Fluß im zentralamerikan. Staat Honduras, im
Oberlauf Humuya genannt, mündet in die Hondurasbai, ist
wasserreich und bietet mit seinen Nebenflüssen ausgedehnte
Wasserstraßen, wird aber an der Mündung durch eine
seichte Barre geschlossen.
Ulunda, afrikan. Reich, s. Lunda.
Ulungu, afrikan. Land, s. Urungu.
Ulva L., Algengattung aus der Familie der Ulvaceen,
charakterisiert durch einen häutig blattartigen, am Grund
festgewachsenen Thallus, in gegen zehn Arten in den
europäischen Meeren vertreten. U. lactuca L. (Meerlattich),
mit 5,5-16 cm großem, lebhaft grünem, wolligem,
geteiltem und zerschlitztem Thallus, wird (in England) wie Salat
gegessen.
988
Ulverston (spr. öllwerst'n), Hauptstadt des Bezirks
Furneß in Lancashire (England), durch einen Kanal mit der
Morecambebai verbunden, hat Eisenhütten, Papiermühlen und
(1881) 10,001 Einw.
Ulwar, britisch-ind. Staat, s. Alwar.
Ulysses (unlatein. statt Ulixes), s. Odysseus.
Ülzen, Kreisstadt im preuß. Regierungsbezirk
Lüneburg, in der Lüneburger Heide und an der Ilmenau,
Knotenpunkt der Linien Lehrte-Harburg und Stendal-Langwedel der
Preußischen Staatsbahn, 35 m ü. M., hat 4 Kirchen und
Kapellen, ein Realprogymnasium, ein Hospital, ein Amtsgericht, eine
Handelskammer,einen landwirtschaftlichen Verein,eine Zuckerfabrik,
Eisengießerei, Maschinen-, Feuerspritzen-, Leder-, Tabaks- u.
Zigarrenfabrikation, Bierbrauerei, Branntweinbrennerei, Flachsbau,
Handelsgärtnereien, ansehnliche Vieh- und Flachsmärkte
und (1885) mit der Garnison (eine Eskadron Dragoner Nr. 16) 7412
meist evang. Einwohner. In unmittelbarer Nähe ergiebige
Mergelgruben. U. entstand im 10. Jahrh. als Löwenwolde und war
im Mittelalter Hansestadt. In der Umgegend heidnische
Begräbnisstätten und das ehemalige Benediktinerkloster
Ullesheim. Vgl. Ringklib und Siburg, Geschichte der Stadt Ü.
(Hannov. 1859); Janicke, Desgleichen (das. 1889).
Uman, Kreisstadt im russ. Gouvernement Kiew, an der Umanka
(Nebenfluß des Bug), mit Schloß, 5 Kirchen, Synagoge,
Kloster, mehreren Fabriken, Handel und (1885) 15,976 Einw. In der
Nähe das prächtige kaiserliche Schloß Sofiowka.
Umbella (lat., "Sonnenschirm"), in der Botanik die Dolde, eine
Art des Blütenstandes (s. d., S. 80).
Umbelliferen (Umbellatae, Doldengewächse), dikotyle
Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Umbellifloren, einjährige
und perennierende Kräuter mit wechselständigen, meist
mehrfach fieder- oder handförmig eingeschnittenen oder
geteilten, seltener ganzen Blättern mit am Grund
verbreitertem, scheidigem Blattstiel, seltener mit blattförmig
entwickeltem Stiel ohne Blattfläche. Für die ganze
Familie ist der Blütenstand charakteristisch. Derselbe bildet
meist eine zusammengesetzte Dolde (umbella), welche aus wenigen bis
zahlreichen Döldchen (umbellula) besteht. Die Dolde ist
öfters von einer aus meist getrennten, schmalen
Hochblättern bestehenden Hülle (involucrum), jedes
Döldchen von einem ähnlichen Hüllchen (involucellum)
umgeben. Die Blüten sind zwitterig, bisweilen durch
Fehlschlagen eingeschlechtig, verhältnismäßig
klein, gelb oder weiß, seltener rötlich, im allgemeinen
regelmäßig, jedoch die äußern jedes
Döldchens bisweilen strahlend, d.h. die nach außen
gekehrten Blumenblätter größer. Der Kelch bildet
auf dem unterständigen Fruchtknoten einen aus fünf
kleinen Zähnen bestehenden oder fast ganz undeutlichen Saum.
Die fünf Blumenblätter sind außerhalb des den
Scheitel des Fruchtknotens krönenden, meist stark entwickelten
Diskus inseriert. Die fünf Staubgefäße stehen an
derselben Stelle wie die Blumenblätter und abwechselnd mit
ihnen. Der unterständige, zweifächerige Fruchtknoten hat
in jedem Fach eine einzige hängende, anatrope Samenknospe; die
beiden endständigen Griffel sind am Fuß in einen
Griffelfuß vereinigt, oben auseinander stehend und jeder an
der Spitze mit einer ungeteilten Narbe versehen. Die Frucht stellt
bei allen ein Doppelachenium dar, welches in zwei einsamige
Teilfrüchtchen oder Merikarpien (Fig. A, m m), den beiden
Fruchtknotenfächern entsprechend, zerfällt. Zwischen den
beiden Teilfrüchtchen bleibt der zentrale fadenförmige,
meist zweispaltige Fruchtträger (carpophorum, Fig. A, c)
stehen, an dessen beiden Schenkeln die Merikarpien aufgehängt
sind. Die Fläche, mit der die beiden Teilfrüchtchen
aneinander liegen, heißt Fugenfläche (Fig. B u. C, c),
die ihr entgegengesetzte, nach außen gewendete die
Rückenfläche. Letztere hat mehrere Längsrippen,
sogen. Joche, und zwar zunächst fünf Hauptrippen (juga
primaria, Fig. B, 1, 2, 3), von denen allemal eine in der Mitte,
zwei an den Seiten, der Fugenfläche zunächst, und je eine
zwischen diesen und der mittelsten Rippe stehen. Die Vertiefungen
zwischen je zwei Hauptrippen auf der Rückenfläche
heißen Thälchen (valleculae, Fig. B, t). In ihnen liegen
.in der Fruchtschale von oben nach unten gerichtete
Ölgänge, welche meist von außen als braune Striemen
(vittae) sichtbar sind, gewöhnlich bei den einzelnen Gattungen
in bestimmter Zahl vorkommen, seltener fehlen; auch in beiden
Seitenhälften der Fugenfläche pflegen Striemen
vorzukommen. Außer den Hauptrippen gibt es bei manchen
Gattungen auf der Rückenfläche jedes Teilfrüchtchens
noch 4 Nebenrippen (juga secundaria, Fig. C, 4, 5), welche zwischen
jenen aus der Mitte der Thälchen sich erheben; in diesem Fall
sind gewöhnlich die Hauptrippen kleiner oder fehlen. Der
einzige Same füllt das Merikarpium aus, ist mit seiner Schale
mit diesem verwachsen, seltener getrennt. Er enthält ein
reichliches fleischiges oder etwas horniges Endosperm und im obern
Teil desselben einen kurzen, geraden Embryo mit länglichen
Kotyledonen und nach oben gekehrtem Würzelchen. Vgl. A. P. de
Candolle, Mémoire sur la famille des Ombellifères
(Par. 1829). Die U. zählen über 1300 Arten, welche zum
größten Teil der gemäßigten und kältern
Zone der nördlichen Halbkugel angehören. Alle enthalten
ätherisches Öl oder Harz oder Gummiharz, welches in allen
Teilen der Pflanze in besondern Ölgängen vorkommt,
vorwiegend in den Wurzeln und Früchten. Wenige enthalten auch
narkotisch-scharfe Alkaloide. Manche sind überdies in ihren
Wurzeln oder den verdickten untern Stengelteilen reich an Schleim
und Zucker. Daher sind viele U. Gewürzpflanzen, mehrere
wichtige Arzneipflanzen; manche liefern Nahrungsmittel, andre
Futterstoffe; einige gehören zu den gefährlichsten
Giftpflanzen. Fossil sind nur sehr wenige Arten von U. aus den
Gattungen Peucedanites Heer und Dichaenites A. Br. in den
Tertiärschichten gefunden.
Umbelliflören, Ordnung im natürlichen Pflanzensystem
unter den Dikotyledonen, Choripetalen, charakterisiert durch
verhältnismäßig kleine, meist in Dolden stehende
und meist zwitterige Blüten mit vier- oder
fünfgliederigen Blütenkreisen, vier oder fünf
A Doppelachenium von Chaerophyllum; B Durchschnitt durch die
beiden Teilfrüchtchen von Aethusa, C durch eins von
Daucus.
989
Umber - Umgeld.
Staubgefäßen, unterständigem Fruchtknoten,
welcher meist aus zwei Karpellen zusammengesetzt, zweifächerig
ist und in jedem Fach eine Samenknospe enthält, und durch
Samen mit Endosperm und kleinem, geradem Keimling, umfaßt die
Familie der Korneen, Umbelliferen und Araliaceen.
Umber,s.Schaf,S.379.
Umbérto, König von Italien, s. Humbert.
Umbilicus (lat.), Nabel.
Umbra (lat.), Schatten.
Umbra, Mineral von sehr wechselnder Zusammensetzung, im
wesentlichen amorphes, undurchsichtiges, wasserhaltiges
Eisensilikat mit viel Mangan und wenig Aluminium, dient als braune
Öl- und Wasserfarbe in der Wachstuchfabrikation, als
Vergoldergrund, zum Braunbeizen des Holzes, zu Firnissen etc. Die
beste U. (türkische U.) stammt von der Insel Cypern, doch
kommen an vielen Orten sehr ähnliche und gleich verwendbare
Substanzen vor. Die kölnische U. (Kölner oder Kasseler,
Kesselbraun)ist erdige Braunkohle, liefert durch Lösen in
Kalilauge und Fällen mit Säure den braunen Karmin.
Cyprische U., s. Bolus.
Umbrechen, s. Buchdruckerkunst, S. 559.
Umbreit, Friedr. Wilhelm Karl, protest. Theolog, geb. 11.
April 1795 zu Sonneborn bei Gotha, studierte in Göttingen,
ward daselbst 1818 Dozent der orientalischen Sprachen und 1820
außerordentlicher Professor der Theologie und Philosophie;
1823 ging er als ordentlicher Professor der letztern nach
Heidelberg, wo er 1828 mit Ullmann die "Theologischen Studien und
Kritiken" begründete und 1829 Ordinarius in der theologischen
Fakultät wurde; starb als Geheimer Kirchenrat 26. April 1860.
Er veröffentlichte unter anderm: "Lied der Liebe"
(Übersetzung des Hohenliedes, 2. Aufl., Heidelb. 1828);
"Übersetzung und Auslegung des Buches Hiob" (2. Aufl., das.
1832); "Kommentar über die Sprüche Salomos" (das. 1826);
"Übersetzung und Erklärung auserlesener Psalmen" (2.
Aufl., Hamb. 1848); "Kommentar über die Propheten des Alten
Testaments" (das. 184146, 4 Bde.); "Die Sünde, Beitrag zur
Theologie des Alten Testaments" (das.1853); "Der Brief an die
Römer, auf dem Grunde des Alten Testaments ausgelegt" (Gotha
1856).
Ümbrer (Umbrier, Umbri), altitalisches, in
früherer Zeit sehr mächtiges und verbreitetes Volk,
welches in der ältesten Zeit alles Land östlich vom
Apennin bis zum Vorgebirge Gargano herab und außerdem auch
das später so genannte Etrurien innehatte, im Verlauf der Zeit
aber aus allen übrigen Landschaften bis auf Umbria selbst
verdrängt wurde und auch von diesem den an der Küste
liegenden Teil (ager gallicus) an die senonischen Gallier verlor,
so daß es nur noch am östlichen Ufer des Tiber und auf
dem östlien Abhang des Apennin wohnen blieb. Mit den
Römern kamen die U. 3(9 v. Chr. zuerst in Berührung, sie
wurden 308 bei Mevania völlig geschlagen; noch einmal
beteiligten sie sich 298 in Verbindung mit den Samnitern, Etruskern
und Galliern an dem Kriege gegen Rom, mußten aber nach der
Schlacht bei Sentinum wiederum die Waffen niederlegen; im
Bundesgenossenkrieg erhielten sie 90 mit den übrigen freien
Bewohnern Mittel und Unteritaliens das römische
Bürgerrecht. Ihre Sprache, deren wichtigstes Denkmal die
Eugubinischen Tafeln (s. d.) sind, gehört zu dem
indogermanischen Sprachstamm und ist mit der lateinischen nahe
verwandt. Vgl. Grotefend, Rudimenta linguae umbricae (Hannov.
183539, 8 Tle.); Aufrecht und Kirchhoff, Die umbrischen
Sprachdenkmäler (Berl. 1851, 2 Bde.); Savelsberg, Umbrische
Studien (das. 1873); Bücheler, Umbrica (Bonn 1883). Die
Grenzen der Landschaft Umbria waren unter Augustus: im N. der
Rubico (gegen das cispadanische Gallien), im W. der Tiberis (gegen
Etrurien), im S. der Äsis (gegen das Sabinerland), im O. das
Adriatische Meer. Das im W. durch die Apenninengebirgige und etwas
rauhe, im übrigen ebene und fruchtbare Land war reich an
starken Rindern und an Obst. Die Flüsse der Landschaft sind
sämtlich Küstenflüsse von kurzem Laufe, von denen
nur der Metaurus Erwähnung verdient, oder Nebenflüsse des
Tiberis, unter denen der Nar (Nera) der bedeutendste ist.
Städte waren im westlichen Teil: Iguvium, Asisium, Fulginium,
Nuceria, Camers oder Camerinum, Spoletium, Tuder, Ameria,
Interamna, Narnia und Ocriculi; im östlichen Teil: Sarsina,
Sestinum,Urbinum Hortende, UrbinumMetaurense, Sentinum; am Meer:
Ariminum, Pisaurum, Fanum Fortunae und das gaische Sena (s. Karte
bei "Italia").Vgl. Abeken, Mittelitalien (Stuttg. 1843).
Umbrien (Umbria), s. Umbrer. Auch Name der italienischen
Provinz Perugia (s. d.).
Umdrehung (Umwälzung, Rotation, Revolution),
diejenige Bewegung eines Körpers, bei welcher alle Teile
desselben um eine in Ruhe bleibende gerade Linie, die Rotations-
oder Drehungsachse, Kreise beschreiben, deren Mittelpunkte in
dieser Geraden liegen, und deren Ebenen senkrecht auf ihr stehen.
Diese Kreise heißen Parallel kreise, die Schnittpunkte der
Achse mit der Oberfläche Pole.
Umdrehzähler, s. Perambulator.
Umdruck (überdruck), s. Lithographie, S.837.
Umeå (spr. úhmeo), Hauptstadt des schwed.
Läns Westerbotten, an der Mündung des Umeelf, hat eine
höhere Lehranstalt, Lehrerinnenseminar, Gewerbeschule,
Industrieschule, einen Hafen, ansehnlichen Handel mit Holz, Butter,
Fischen, Teer, Pelzwerk etc. und (1885) 2930 Einw. U. ist Sitz
eines deutschen Konsuls.
Der Umeelf entspringt aus einem See an der norwegischen Grenze,
durchfließt, südöstlich gewendet, außer
andern den großen See Stor-Umeä, nimmt links auf der
untersten Strecke seines Laufs den fast ebenso langen Vindelelf auf
und mündet nach 470 km langem Lauf (wovon 250 für
kleinere Fahrzeuge schiffbar) in den Bosnischen Meerbusen. Etwas
oberhalb der Mündung bildet er zwei der schönsten
Wasserfälle, den Lina Link und Fällforsan.
Umfang bedeutet in der Logik nach einigen den Inbegriff aller
derjenigen Begriffe, in deren Inhalt derjenige, um dessen U. es
sich handelt, als Merkmal erscheint, nach andern die Summe
derjenigen Gegenstände, auf welche ein Begriff sich bezieht.
Die Angabe des Umfangs heißt Einteilung (s. d.); insofern der
Subjektsbegriff eines Urteils einen gewissen U. besitzt,
läßt sich auch dem Urteil ein solcher beilegen (s.
Quantität). - Über U. in der Mathematik s.
Peripherie.
Umgang, s. Zunftgebräuche.
Umgehung, in der Taktik jedes gegen die Flanken oder den
Rücken des Feindes gerichtete Unternehmen, welches entweder
einen umfassenden Angriff vorbereiten, oder die Verbindungen und
Rückzugslinien des Feindes bedrohen und ihn dadurch in seinen
Bewegungen stören und aufhalten oder selbst zum Rückzug
veranlassen soll. Zu erfolgreicher U. gehören hinreichende
Kräfte, so daß man die Fronte des Feindes gleichzeitig
festzuhalten vermag.
Umgeld, s. Weinsteuer.
990
Umgelt - Umlauf.
Umgelt , s.Ungelt.
Uminski, Jan Nepomucen, poln. General, geb. 1780 im
Großherzogtum Posen, focht schon 1794 im Befreiungskampf
Kosciuszkos mit, bildete 1806 zu Warschau eine Ehrengarde für
Napoleon I, focht als Leutnant in einem poln. Ulanenregiment vor
Danzig und Dirschau, fiel aber bei letzterer Stadt verwundet in die
Hände der Preußen. Wieder frei, befehligte er im Kriege
gegen Österreich (1809) die Vorhut des Generals Dombrowski und
errichtete Ende 1809 das 10. polnische Husarenregiment, welches er
1812 als Oberst in Rußland befehligte, bildete Ende 1812,zum
Brigadegeneral befördert, das Reiterregiment Krakusen und ward
1813 bei Leipzig verwundet. Wegen seiner Teilnahme an der Stiftung
des patriotischen Bundes der Sensenträger (kossiniery) Anfang
1826 zu sechsjähriger Festungsstrafe in Glogau verurteilt,
entfloh er beim Ausbruch der polnischen Revolution im Februar 1831
aus der Festung und ward in der Insurrektionsarmee sofort als
Divisionsgeneral angestellt. In der Schlacht von Grochow 25. Febr.
entriß er dem russischen Feldherrn Diebitsch den Sieg. Ebenso
erwarb er sich am Narew (im März), bei Pultusk, am Liwiec (9.
und 10. April), bei Kaluschin (im Mai) und beim Sturm auf Warschau
(6. und 7. Sept.) hohen Ruhm. Nach dem Fall Polens von
Preußen und Rußland geächtet und in Posen als
Deserteur im Bild gehenkt, flüchtete er nach Frankreich.
Später lebte er in London und dann zu Wiesbaden, wo er im Juni
1851 starb. Er gab außer mehreren polnischen Schriften
über die Revolution ein "Recit des evenements militaires de la
bataille d'Ostrolenka" (Par. 1832) heraus.
Umkehrung, eine Vertauschung des Verhältnisses von
Oben und Unten derart, daß, was oben war, unten wird, und was
unten war, oben. Die U. spielt in der Theorie des Tonsatzes
mehrfach eine Rolle. Man spricht von einer U. der Intervalle, die
nichts ist als eine Oktavversetzung des höhern Tons unter den
tiefern oder des tiefern über den höhern. Die U. eines
Intervalls ist immer dasjenige andre Intervall, mit welchem es sich
zur Oktave ergänzt; es stehen also im Verhältnis der U.:
1) Sekunde - Septime 2) Terz - Serte 3) Quarte - Quinte und zwar
ist die U. eines reinen Intervalls wieder ein reines, die eines
großen ein kleines und die eines verminderten ein
übermäßiges und vice versa. Unter U. der Akkorde
versteht man den Wechsel des Baßtons, d.h. man nennt alle
Akkorde Umkehrungen, welche nicht den natürlichen Baßton
haben; der natürliche Baßton ist aber nach der
üblichen Auffassung der, welcher der tiefste ist, wenn die
Töne des Akkords terzenweise übereinander aufgebaut
werden. Man unterscheidet daher z. B. für den Dreiklang c.e.g
dreierlei Lagen, d.h. zwei Umkehrungen (Umlagerungen): a)Grundlage
(Baßton c) b) 2. Lage, 1. U. (Baßton e) = Sextakkord
e.g.c c) 3. Lage 2. U. (Baßton g) = Quartsextakkord g.c.e Die
U. eines Motivs (Thema in der Gegenbewegung), eins der
interessantesten imitatorischen Wirtungsmittel, besteht darin,
daß alle Stimmschritte des Themas in umgekehrter Richtung
gemacht werden (steigend statt fallend , fallend statt
steigend).
Die U. kann wie jede andre Art der Imitation eine strenge oder
freie sein. In der Fugenkomposition wird die U. des Themas vielfach
verwendet, sei es, daß dieselbe als Antwort auftritt oder
aber, daß sie selbständig durchgeführt wird
(Gegenfuge). Vgl.Nachahmung. In der Logik versteht man unter U.
diejenige Veränderung, welche mit einem logischen Satz
vorgeht, wenn der Subjektbegriff zum Prädikatbegriff und
umgekehrt gemacht (Konversion, s.d.) oder derselbe aus einem
bejahenden in einen verneinenden (oder umgekehrt) verwandelt wird
(Kontraposition, s.d.).
Umladuugsrecht, s. Umschlag.
Umlagen werden vielfach wegen der Form ihrer Bemessung und
Veranlagung (Umlegung, Repartierung, Verteilung einer gegebenen
Summe auf die Pflichtigen) Gemeinde- und Kreissteuern im Gegensatz
zu Staatssteuern genannt.
Umlageverfahren, im Versicherungswesen
(Gegenseitigkeitsversicherung) dasjenige Verfahren, welches die
jeweilig zu zahlenden Summen (z. B. bei eingetretenen
Feuersbrünsten, Hagelschäden, Sterbefäl-len etc.)
auf die Gesamtheit der Versicherten als Prämien umlegt und von
denselben einhebt. Den Gegensatz zu demselben bildet das
Kapitaldeckungs- oder Anlageverfahren. Letzteres bemißt die
Prämie nach Maßgabe der Wahrscheinlichkeit des Eintritts
und der Höhe der Gefahr, bez. der zuzahlenden Summe und legt,
wenn diese Summe im Lauf der Zeit steigt, die Prämien als
Prämienreserve verzinslich an, um den erhöhten
Anforderungen der spätern Zeit genügen zu können und
die Lasten möglichst gleichmäßig zu verteilen. Bei
der Invalidenversicherung würden alle Mitglieder der
versicherten (gleichalterigen) Gesellschaft von vornherein
gleichviel zahlen, trotzdem die zu zahlenden Renten im Lauf der
Zeit steigen. Bei einem reinen U. würden nur die jeweilig
fälligen Renten eingehoben. Die Last würde im Anfang
gering sein, später aber so hoch werden, daß eine
Fortsetzung der Versicherung unmöglich würde. Um letztere
wirklich fortführen zu können, müßten immer
wieder jüngere beitragspflichtige Mitglieder neu herangezogen
werden. Bei Neueinführung einer Versicherung, welche nur die
fortab eintretenden, nicht auch die schon früher vorgekommenen
Fälle der Verunglückung und der Invalidität
berücksichtigt, würden die zu entrichtenden Prämien
im Lauf der Zeit steigen, bis endlich bei genügender
Ausdehnung der Versicherung ein Beharrungszustand erreicht wird.
Ist die Gefährdung für alle Versicherten immer die
gleiche, so hat das Kapitaldeckungsverfahren mit
Prämienanspeicherung keine Berechtigung. Demgemäß
ist das U. bei der Feuer-, bei der Hagelversicherung etc. anwendbar
und am Platz. Die Frage, ob U. oder Anlageverfahren, war
gelegentlich der Einführung der berufsgenossenschaftlichen
Unfallversicherung in Deutschland, dann vor Erlaß des
Gesetzes über die Alters- und Invaliditätsversicherung
der Arbeiter Gegenstand lebhafter Erörterungen. Für die
letztere Versicherung wurde ein Mittelweg eingeschlagen, indem
durch die in einem Zeitabschnitt gezahlten Beiträge die
Kapitalwerte der in dieser Zeit fällig werdenden Renten
gedeckt werden sollen. Vgl. Beutner, U. oder Kapitaldeckung (Berl.
1884); A. Wagner in Schönbergs "Handbuch der politischen
Ökonomie", Bd. 2, S.816 (2. Aufl., Tübing. 1886).
Umlauf (Umlauff), Ignaz, Komponist, geb. 1752 zu Wien,
begann seine musikalische Laufbahn als Violinist des Wiener
Hofoperntheater- Orchesters und wurde 1778 von Joseph H. zum
Musikdirektor der Deutschen Oper ernannt. Zur Eröffnung
derselben hatte der Kaiser selbst Umlaufs Oper "Die Bergknappen"
bestimmt, welche beim Publikum großen Anklang fand und als
der erste Waffengang im Kampf
991
Umlauf am Finger - Umtrieb.
gegen die Herrschaft der italienischen Oper in Deutschland
historische Bedeutung erlangt hat. Er starb um 1799 in Wien.- Sein
Sohn Michael, geb. 9. Aug. 1781 zu Wien, gest. 20. Juni 1842
daselbst, ebenfalls Musikdirektor der Deutschen Oper in Wien und
fruchtbarer Komponist, machte sich besonders verdient um die Werke
Beethovens, den er bei den Aufführungen des "Fidelio" (1822)
und der neunten Symphonie (1825), von deren Leitung Beethoven
selbst bei seiner völligen Taubheit abstehen mußte, als
Dirigent aufs wirksamste unterstützte.
Umlauf am Finger, s. Fingerentzündung.
Umlaufgetriebe, s. Getriebe.
Umlaut, eine vorzugsweise den jüngern germanischen
Sprachen eigentümliche Trübung derjenigen Vokale, auf die
eine den Vokal i oder den Halbvokal j enthaltende Beugungs- oder
Ableitungssilbe folgt oder einstmals folgte, welche Trübung
aber nur die Qualität, nicht zugleich auch die Quantität
derselben verändert. Der helle Vokal i übt nämlich
eine assimilierende Wirkung, indem er den Vokal der vorausgehenden
Silbe sich selbst ähnlich macht. Im Althochdeutschen tritt
diese Wirkung nur erst beim a ein, welches durch den Einfluß
eines i in der darauf folgenden Silbe zu dem hellern Vokale wird.
Im Mittelhochdeutschen dagegen beeinflußt ein folgendes i
alle Vokale der vorausgehenden Silbe, die nicht i-ähnlich
sind. So werden die kurzen Vokale a, u, o zu e, ü, ö, die
langen â, ô, û zu ae. oe, iu, die Diphthonge uo,
ou zu üe, öu. Der U. bleibt, auch wenn das i oder j
ausgefallen ist. So heißt es im Mittelhochdeutschen ich
valle, aber du vellest (fällst), weil die zweite Person
ursprünglich ein i hatte (althochd. vellis); von ruom (Ruhm)
wird gebildet rüemen (rühmen), weil es im
Althochdeutschen ruomjen hieß. Doch kommt es auch anderseits
nicht selten vor, daß mit dem Verlust des i oder j auch seine
Wirkung, der U., verschwindet, wie z.B. im Mittelhochdeutschen und
Neuhochdeutschen im Infinitiv für gotisch brannjan brennen
gesagt wird, aber im Imperfekt mittelhoch-deutsch brante (jetzt
brannte), obwohl die entsprechende gotische Form brannida lautet.
Im Neuhochdeutschen gelten als Umlautvokale und Diphthongen in der
Regel ä, ö, ü, äu; ä, äu werden im
allgemeinen da geschrieben, wo ein verwandtes Wort oder eine
verwandte Form mit a vorhanden oder auch ohne historische
Sprachkenntnis leicht zu vermuten ist, z.B. Mann, Männer,
Haus, Häuser, aber welsch von dem alten Wort walhisch,
"ausländisch", greulich neben grauem Der U.ist auch für
die deutsche Flexion von immer größerer Bedeutung
geworden; so dient er jetzt zur Bezeichnung der Mehrzahl, z.B.in
Männer, zum Ausdruck von Verkleinerungsformen, z.B. in
Häuschen. Übrigens ist er keineswegs konsequent
durchgeführt, und einzelne Mundarten haben ihn fast gar nicht,
vgl. z.B. die bayrisch-österreichische Form "ich war" für
"ich wäre". Der Name U. rührt von J. Grimm her, der auch
den Ausdruck "Brechung" (s. d.) erfand. In den skandinavischen
Sprachen hat auch das u die nämliche assimilierende Kraft.
Auch andre Sprachen haben dem U. verwandte Erscheinungen, dahin
gehört namentlich die im Griechischen u. der Zendsprache
häusige Epenthese (s.d.) des i.
Ummanz, Insel dicht an der Westseite von Rügen, 6 km
lang und 3 km breit; 7 Dörfer mit 360 Einw.
Ummerstadt, Stadt im sachsen-meining. Kreis
Hildburghausen, an der Rodach, hat eine evang. Kirche,
Töpferei, Gerberei und (1885) 825 Einw.
Umpfenbach, Karl, Nationalökonom, geb. 5. Juli 1832
zu Gießen als Sohn des Professors der Mathematik, Hermann U.,
studierte in Gießen, habilitierte sich daselbst 1856 als
Privatdo^ent und wurde 1864 ordentlicher Professor in Würzburg
und 1873 in Königsberg. Er schrieb: "Lehrbuch der
Finanzwissenschaft" (Erlang. 1859-60, 2 Bde.; 2. Aufl., Stuttg.
1887); "Die Volkswirtschaftslehre" (Würzb. 1867); "Des Volkes
Erbe" (Berl. 1874, Besprechung der sozialen Frage); "Das Kapital in
seiner Kulturbedeutung" (Würzb. 1879); "Die Altersversorgung
und der Staatssozialismus" (Stuttg. 1883).
Umpqua, Fluß im nordamerikan. Staat Oregon,
entspringt am Westabhang des Kaskadengebirges, durchfließt
ein fruchtbares Thal und ergießt sich nach 300 km langem Lauf
in 43° 42' nördl. Br. in den Stillen Ozean.
Umriß (franz. Contour, ital. Contorno), die
bloß in den äußersten Grenzlinien angedeutete
Gestalt einer Figur, daher die erste Anlage einer nachher weiter
auszuführenden Zeichnung.
Umsatz, der An- und Verkauf von Waren, auch die
Gesamtheit dieser Waren.
Umschalter, Vorrichtung zur Herstellung, Unterbrechung
oder Abzweigung einer elektrischen Leitung, findet mehrfach in der
Elektrotechnik, namentlich auch bei der elektrischen Beleuchtung,
Verwendung, um jede Lampe oder Lampengruppe unabhängig von den
übrigen anzuzünden oder auszulöschen. Bei
automatischen Umschaltern wird durch die Wirkung von
Elektromagneten, resp. durch Einschaltung künstlicher
Widerstände der Zweck erreicht.
Umschattige, s. v. w. Periscii, s. Amphiscii.
Umschlag, s. Bähung.
Umschlag (Umschlagsrecht, Umladungsrecht), ehemals das
Recht einzelner Ortschaften (Umschlagsplätze), die zu Wasser
oder auch zu Land angekommenen Waren nur durch eigne Fuhrleute oder
Schiffer weiter zu spedieren (vgl. Stapelgerechtigkeit). Die
heutigen Umschlagsplätze sind nicht Plätze, welche
Vorrechte genießen, sondern an denselben findet ein U. statt
infolge der zwischen Eisenbahn- und Schiffahrtsverkehr
eingetretenen Tarifkombinationen.
Umfchreibebanken, s. v. w. Girobanken.
Umschrieben (zirkumskript), deutlich begrenzt, im
Gegensatz zu verschwommen (z.B. von Geschwüren).
Umstadt, s. Großumstadt.
Umstandswort, s. Adverbium.
Umsteuerung, s. Steuerung.
Umtrieb (Umtriebszeit), in der Forstwirtschaft der
Zeitraum des mit einmaliger Abnutzung des Holzvorrats verbundenen
Hiebsumlaufs in einem derselben Bewirtschaftungsart
überwiesenen Wald. Bei regelmäßigem Alters- und
Bestockungszustand ist die Umtriebszeit gleich dem
Haubarkeitsalter, d.h. dem Abtriebsalter eines hiebreifen Bestandes
oder gleich dem Zeitraum von der Bestandsbegründung bis zum
Bestandsabtrieb. Wichtigste Umtriebsarten: 1) Technischer U., d.h.
derjenige Umtrieb, welcher Holz in einer für den technischen
Gebrauch am meisten geeigneten Beschaffenheit liefert. 2) U. des
größten Massenertrags, derjenige U., welcher die
größte Menge an Holz liefert. Für denselben ist der
zuletzt noch eingetretene Jahreszuwachs gleich dem
durchschnittlichen, d.h. gleich der Holzmenge des Bestandes,
dividiert durch dessen Alter. 3) U. des größten
Waldreinertrags, derjenige U., bei welchem für die
Flächeneinheit der durchschnittlich jährliche
Überschuß der Einnahmen über die Ausgaben für
Kulturen und Verwaltungen am größten ist. Bei Bestimmung
desselben wird keine Rücksicht auf die Zeitunterschiede in
Bezug der Einnahmen und in der Verausgabung
992
Una corda - Uneheliche Kinder.
der Kosten genommen. Ein späterer Eingang wird u der
gleichen Höhe verrechnet wie ein solcher, welcher früher
erfolgt, es werden also keine Zinsen unter die Kosten der
Wirtschaft gestellt. 4) Der finanzielle U., derjenige, für
welchen die diskontierte Summe der in Aussicht stehenden
Reinerträge oder der Walderwartungswert, bez. der
Bodenerwartungswert am größten ist. Bei demselben ist
ein Bestand dann finanziell abtriebsreif, wenn der in der
nächsten Zeit zu erwartende, im Sinken begriffene Wertzuwachs
gerade noch ausreicht, um die in dieser Zeit erwachsenden Kosten
mit Einschluß aller Kapitalzinsen zu decken. Könnte z.
B. ein 1oojähriger Bestand zu 4ooo Mk. verwertet werden, und
ist das Bodenkapital zu 200 Mk. oder, bei einem Zinssatz von 3
Proz., die Bodenrente zu 6 Mk. zu veranschlagen, so
müßte der Bestand, wenn er noch weiter stehen bleiben
soll, im nächsten Jahr einen Zuwachs haben, welcher die
lausenden Kosten, die Bodenrente mit 6 Mk. und die Zinsen des
Bestandkapitals mit 120 Mk. deckt. Die Bestimmung des Unitriebs ist
deswegen schwer, weil das zu erziehende Holz erst in späterer
Zeit nutzbar wird, also immer mit Bedürfnissen und Preisen der
Zukunft gerechnet werden muß. Im großen und ganzen wird
der U. sich in den Grenzen halten müssen, innerhalb deren
für die Dauer eine wirklich marktfähige Ware geliefert
werden kann. Vgl. Waldwertberechnung.
Una corda (ital.), f. Corda.
Uualaschka, s. Aleuten.
Unam sanctam (lat.), Anfangsworte der von Papst
Bonifacius VIII. (s. d.) im November 1302 erlassenen Bulle, in
welcher er dem päpstlichen Stuhl die unumschränkte
Weltherrschaft zusprach. Vgl. Berchtold, Die Bulle U. S.
(Münch. 1887).
Uuanïm (lat.), einmütig, einstimmig;
Unanimitat, Einstimmigkeit.
Unau, s. Faultier.
Unbefahren Volk, s. Befahren Volk.
Unbefleckte Empfängnis, s. Marienfeste.
Unbekannte Größen, in der Algebra Bezeichnung
der Größen, welche aus den bekannten durch
Auflösung der aus der Aufgabe sich ergebenden Gleichungen zu
berechnen sind. S. Gleichung.
Unbestimmte Zahl (abstrakte Zahl), der abstrakte Begriff
einer bestimmten Vielheit, ohne Rücksicht auf die
Beschaffenheit der einzelnen diese Vielheit konstituierenden
Einheiten, z. B. 6, im Gegensatz zur benannten oder konkreten Zahl,
welche das Vielfache einer bestimmten Einheit ist, z. B. 6 m.
Unbestrichener Raum, s. Bestreichen.
Unbewaffnet (unbewehrt), in der Heraldik ein Wappentier
ohne seine natürlichen Waffen, z. B. ein Adler ohne Krallen,
ein Löwe ohne Klauen, ein Eber ohne Hauer etc.
Unbewegliche Sachen, s. Sachen.
Unbotmäßigkeit, s. Widersetzlichkeit.
Uncaria Schreb. (Gambirstrauch), Gattung aus der Familie
der Rubiaceen, kletternde Sträucher mit kurzgestielten
Blättern, meist einzeln achselständigen, gestielten,
lockern, kugeligen Blütenständen, deren Stiel bei
verkümmerten Blüten bisweilen in eine Ranke umgewandelt
ist, mittelgroßen, gelblichen, rötlichen oder
weißlichen Blüten und großen, verlängerten
Kapseln. Etwa 30 Arten, meist im tropischen Asien und auf den
Malaiischen Inseln. U. Gamir Roxb. ist ein Strauch mit 9 cm langen,
ovallanzettförmigen, kurz zugespitzten, kahlen Blättern,
kurzgestielten Blütenköpfen und rosenroten Blüten.
Die ältern Blütenstiele sind in hakenförmige
Stacheln umgewandelt, mittels welcher der Strauch hoch klettert. Er
findet sich in Hinterindien und auf der indischen Inselwelt,
besonders auf Sumatra, und wird namentlich auf Bintang kultiviert,
wo man aus den Blättern und jüngern Trieben das
Gambirkatechu bereitet. Die Sträucher werden in Plantagen
gezogen und vom 3.-15. Jahr ausgenutzt, indem man die jungen
beblätterten Zweige zwei bis viermal im Jahr schneidet, mit
Wasser auskocht und die Flüssigkeit eindampft. Auch U. acida
Roxb., mit etwas größern, eiförmigen, länger
zugespitzten Blättern und weißen Blüten, in
Hinterindien und auf den Malaiischen Inseln, liefert Katechu.
Uncia (lat.), der 12. Teil des As (s. d.);
Apothekergewicht und Maß für Flüssigkeiten, s.
Unze.
Uncialbuchstaben, meist nur zu Inschriften verwendete
Charaktere, ihrer Größe wegen so genannt vom
lateinischen uncia (Zoll); doch finden sie sich auch in
lateinischen Manuskripten vom 3.-10. Jahrh., wo sie indes gegen
Ende dieses Zeitraums schon in die kleinern Semi-Uncialen oder
Litterae minutae übergehen, die sich von den eigentlichen U.
(litterae majusculae) auch dadurch unterscheiden, daß sie
nicht vereinzelt stehen, sondern sich aneinander anschließen.
In der Buchdruckerkunst nennt man U. große Anfangsbuchstaben
ohne Verzierung.
Uncle Sam (engl.), scherzhafte Bezeichnung der
Nordamerikaner, entstanden aus dem offiziellen U. S. Am.,
Abkürzung für United States of America.
Undation(lat.), Wellenschlag, wellenförmiger
Herzschlag.
Undezime (lat.), Intervall von elf Stufen, die Quarte der
Oktave des Grundtons (z. B. c-f).
Undinen (Undenen, v. lat. unda, Welle), im System der
Paracelsisten weibliche Elementargeister des Wassers, die sich mit
Vorliebe unter den Menschen einen Gatten suchen, weil sie mit aus
solcher Ehe gebornen Kindern zugleich eine Seele erhalten sollen.
Die Undinensagen sind vielfach dichterisch behandelt worden, z. B.
im alten Roman von der Melusine (s. d.) vom Ritter Staufenberg (neu
gedichtet von Fouque), und haben in neuerer Zeit auch den Stoff zu
mehreren Opern geliefert. Vgl. Nixen.
Undfee (Und ofero), See im russ. Gouvernement Olonez,
Kreis Pudosh, 83 qkm (1 1/2 QM.) groß, verliert in manchen
Jahren sein Wasser durch unterirdische Abflüsse fast
gänzlich.
Und sie bewegt sich doch, s. Eppur si muove.
Undulation (lat.), s. v. w. Wellenbewegung (s. d.);
Undulationstheorie, s. Licht.
Uudurchdringlichkeit, diejenige Eigenschaft aller
physischen Körper, vermöge welcher sie einen Raum so
erfüllen, daß in demselben zu gleicher Zeit kein andrer
sein kann.
Undurchsichtigkeit, s. Durchsichtigkeit.
Uneheliche Kinder (natürliche Kinder, Spurii),
diejenigen Kinder, die in einem Geschlechtsverhältnis, welches
die Weihe der Ehe nicht empfangen hat, erzeugt sind. Sie haben
juristisch keinen Vater und keine väterlichen Aszendenten,
teilen Rang, Stand und Gerichtsstand der Mutter und führen
deren Namen. Die neuere Gesetzgebung hat ihnen vielfach das Recht
beigelegt, von dem natürlichen Vater den unentbehrlichen
Unterhalt zu fordern; das französische Recht schneidet ihnen
dies mit dem Satz ab: "Toute recherche de paternité est
interdite" (s. Schwängerungsklage). Das deutsche Recht
betrachtete die unehelichen Kinder als mit einer sogen. levis notae
macula behaftet, d. h. sie unterlagen der "Anrüchigkeit" (s.
d.), infolge deren sie für unfähig gehalten
393
Unehrliche Gewerbe - Unfallversicherung.
wurden zum Eintritt in Zünfte, zur Ordination und zum
Lehnserwerb. Doch konnte dieser Makel durch wirkliche und durch die
jetzt unpraktische unvollkommene Legitimation (legitimatio ad
honores) gehoben werden (s. Legitimation). Vgl. Bender, Das
uneheliche Kind und seine Eltern in rechtlicher Beziehung (Kassel
1887).
Unehrliche Gewerbe, s. v. w. anrüchige Gewerbe (s.
Anrüchigkeit). Vgl. Beneke, Von unehrlichen Leuten (2. Aufl.,
Berl. 1888).
Unendlich, Prädikat eines Dinges, das entweder in
Ansehung seiner Ausdehnung (räumlich oder extensiv), oder in
Ansehung seiner Dauer (zeitlich oder protensiv), oder in Ansehung
seiner Wirksamkeit (dynamisch oder intensiv) keiner Begrenzung
unterworfen ist. Man unterscheidet unendlich groß (^) und
unendlich klein: einer Größe kommt die erstere Benennung
zu, wenn sie größer ist als jede angebbare
Größe, wie z. B. die Summe der unendlichen Reihe
1+1+1+... = ^; dagegen die zweite, wenn sie der Null näher
kommt als jede angebbare Größe, d. h. wenn sie in Null
übergeht. Die Rechnung mit solchen Größen ist
Gegenstand der Differential- und Integralrechnung (s. d.).
Uufähigkeitsprotest, s. Wechsel.
Uufallversicheruug, die Versicherung gegen die Folgen
persönlicher Unfälle, sowohl körperlicher
Verletzungen als auch des Todes. Diese Art der Versicherung hat
eine hohe Bedeutung für den Arbeiterstand gewonnen. Wie die
Besonderheiten des Arbeiterlebens überhaupt zu verschiedenen
Abweichungen von den allgemeinen Grundsätzen des privaten
Versicherungswesens zwingen (Zulässigkeit, Notwendigkeit des
Zwanges, Schwierigkeit allgemeiner Durchführung schon wegen
der Zahlungsunfähigkeit bei Erwerbslosigkeit; Beiziehung von
Arbeitgebern und zwar zum Teil schon aus dem Grund, weil der Lohn
für die Prämienzahlung nicht vollständig zureicht;
besondere Vorzüge der genossenschaftlichen, auf
Gegenseitigkeit beruhenden Kassen etc.), so sind solche
Abweichungen insbesondere auch bei der U. geboten. Ursache von
körperlichen Verletzungen und Tötungen, welche
während der Arbeit und in Verbindung mit derselben eintraten,
kann sein eine menschliche Verschuldung (eigne Schuld, Schuld
Dritter, insbesondere des Arbeitgebers, eines Beamten oder
Mitarbeiters), oft aber auch liegt eine solche Verschuldung nicht
vor, oder sie ist wenigstens nicht nachweisbar (Naturgefahren,
"Zufall", "höhere Gewalt"). Nach römischem Recht und dem
gemeinen Rechte der meisten Kulturländer erwächst bei
Unfällen ein Anspruch auf Entschädigung nur
gegenüber demjenigen, welcher den Schaden verschuldet hat. So
haftet der Arbeitgeber nur für eigne Schuld und für
diejenige seiner Leute, deren er sich bei dem Betrieb bedient, nur
insofern, als ihm eine Verschuldung bei Wahl oder Beibehaltung
derselben zur Last fällt. Hierbei ist der Begriff der
Verschuldung ganz bedingter Natur, insbesondere abhängig unter
anderm auch vom Stande der Technik, vom üblichen,
Herkömmlichen etc. Dem Verletzten liegt die Beweislast ob. Bei
den meisten Unfällen wird er nichts erhalten und selbst dann
leer ausgehen, wenn die Verschuldung eines Haftpflichtigen zwar
nachgewiesen werden kann, letzterer aber nicht zahlungsfähig
ist.
Strenger als in den gedachten Ländern wird die Haftpflicht
in Frankreich aufgefaßt. Hier wurde die römisch
rechtliche Verschuldung in der Auswahl und Überwachung der
Leute schon im 18. Jahrh. dahin gedeutet, eine solche Verschuldung
sei immer von vornherein zu vermuten. Denn es sei Pflicht des
Herrn, sich überhaupt nur guter Arbeiter zu bedienen. Diese
für den Beschädigten günstigere Rechtsauffassung
fand in erweitertem Umfang in der preußischen
Eisenbahngesetzgebung von 1838 Eingang. Eine weitere Besserung in
der Lage vieler Arbeiter in Deutschland wurde durch das
Haftpflichtgesetz von 1871 bewirkt, welches die Zahl der Fälle
vermehrte, in denen dem Arbeiter ein Ersatz zugestanden wird. Bei
Eisenbahnen haftet nach diesem Gesetz der Betriebsunternehmer, wenn
er nicht beweist, daß der Unfall durch höhere Gewalt
oder durch eignes Verschulden des Verletzten hervorgerufen wurde.
Da ein derartiger Nachweis meist gar nicht oder nur schwer zu
erbringen ist, so trugen die Eisenbahnen die Schäden selbst,
oder sie bildeten unter sich einen Unfallversicherung verband mit
Versicherung auf Gegenseitigkeit. Weniger günstig wurde die
Lage der Geschädigten bei Bergwerken, Steinbrüchen,
Gräbereien und Fabriken. Hier wurde die Haftpflicht nur in der
Art erweitert, daß der Unternehmer nicht allein für
eigne Schuld einstehen muß, sondern auch für diejenige
seiner Bevollmächtigen oder Vertreter, wie überhaupt der
Personen, welche er für Leitung und Beaufsichtigung des
Betriebs oder der Arbeiter angenommen hat. Für alle
übrigen Arbeiter kamen die Bestimmungen des gemeinen Rechts in
Anwendung. Das genannte Haftpflichtgesetz gab den Anstoß zur
Errichtung von Unfallversicherungsanstalten, welche sich
ausschließlich mit der U. als Kollektivversicherung
befaßten oder dieselbe neben andern Versicherungszweigen
betrieben, nachdem freilich schon vorher die Einzelversicherung
(insbesondere in der Form der Reiseunfallversicherung) als
Ergänzung der Lebensversicherung für Fälle
vorübergehender Erwerbsstörung und der Invalidität
vielfach vorgekommen war. In Deutschland und der Schweiz gab es
bald zwölf solcher Anstalten, darunter sechs
Aktiengesellschaften und sechs Gegenseitigkeitsanstalten. Von
erstern befassen sich mit der U. vorzüglich die Magdeburger
Allgemeine Versicherungsgesellschaft, die Kölnische
Unfallversicherungsgesellschaft und die Rhenania zu Köln, dann
die Magdeburger Lebensversicherungsgesellschaft, die Schlesische zu
Breslau und die Viktoria zu Berlin. An
Gegenseitigkeitsgesellschaften bestehen nur noch der Allgemeine
Deutsche Versicherungsverein zu Stuttgart und der Prometheus zu
Berlin. Österreich hat eine Erste Allgemeine
Unfallversicherungsaktiengesellschaft zu Wien, die Schweiz zwei
Gesellschaften zu Zürich und Winterthur, welche neben der
Baseler Lebensversicherungsgesellschaft und der Brüsseler
Royale Belge ihre Wirksamkeit auch auf Deutschland erstrecken. Die
U. war zum Teil eine Haftpflichtversicherung, indem sie nur solche
Schäden berücksichtigte, für welche Unternehmer auf
Grund des Haftpflichtgesetzes ihren Arbeitern gegenüber
haftbar waren, meist aber wurde im Interesse der Vereinfachung und
der Meidung von Prozessen die Ausdehnung auch auf die nicht
haftpflichtigen Unfälle vorgezogen. Da kein Zwang zur
Versicherung bestand und die U. eine ungleichmäßige war,
so wurde das Haftpflichtgesetz, welches überdies nur für
einen beschränkten Kreis von Arbeitern galt, bald als
ungenügend empfunden (vgl. hierüber Haftpflicht, S.
1004). Infolge hiervon wurde die U. der Arbeiter durch
Reichsgesetze einer öffentlichrechtlichen Regelung unterzogen,
nachdem die Reichsregierung vorher, um brauchbare statistische
Unterlagen zuschaffen, in den vier Monaten August bis November 1881
aus 93,554 gewerblichen Betrieben mit 1,615,253 63
Meyers Konv. Lexikon, 4. Aufl., XV. Bd.
63
994
Unfallversicherung (deutsche Reichsgesetze von 1884 bis
1887).
männlichen und 342,295 weiblichen Arbeitern statistische
Erhebungen veranstaltet und damit den Grund zu einer umfangreichen,
in Zukunft weiter auszubauenden Unfallstatistik gelegt hatte.
Zunächst erschien das (industrielle) Unfallversicherungsgesetz
vom 6. Juli 1884. Dasselbe erstreckt den Versicherungszwang auf
Arbeiter und Betriebsbeamte und zwar auf letztere, sofern ihr
Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt 2000 Mk. nicht
übersteigt, in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten,
Steinbrüchen, Gräbereien (Gruben), auf Werften und
Bauhöfen, in Fabriken und Hüttenwerken, ferner in
Unternehmungen, deren Gegenstand die Ausführung von Maurer,
Zimmer, Dachdecker, Steinhauer und Brunnenarbeiten ist, im
Schornsteinfegergewerbe sowie in allen sonstigen Unternehmungen, in
welchen Dampfkessel oder durch elementare Kraft bewegliche
Triebwerke zur Verwendung kommen. Durch Gesetz vom 25. Mai 1885
wurde die gesetzliche U. aus die großen Transportbetriebe des
Binnenlandes sowie die Betriebe des Heers und der Marine, der
Speicherei, Kellerei etc., durch Gesetz vom 15. März 1886 auf
Beamte und Personen des Soldatenstandes ausgedehnt. Das Gesetz vom
5. Mai 1886 regelte hierauf U. und Krankenversicherung für die
in land - und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten
Personen, das Gesetz vom 11. Juli 1887 die U. der bei Bauten
beschäftigten Personen und endlich das Gesetz vom 13. Juli d.
J. diejenige der Seeleute und andrer bei der Seeschiffahrt
beteiligter Personen.
Nach dem Gesetz von 1884 kann durch statutarische Bestimmung die
Versicherungspflicht auch auf Betriebsbeamte mit höherm
Jahresarbeitsverdienst ausgedehnt werden, dann kann durch Statut
bestimmt werden, daß und unter welchen Bedingungen
Unternehmer der versicherungspflichtigen Betriebe berechtigt sind,
sich selbst oder andre nicht versicherungspflichtige Personen gegen
die Folgen von Unfällen zu versichern (fakultative
Versicherung). Das Gesetz sieht von der Frage der Verschuldung
zunächst ab. Es schließt einen Anspruch des Verletzten
nur dann aus, wenn derselbe den Betriebsunfall vorsätzlich
herbeigeführt hat. Die Versicherung ist genossenschaftlich
organisiert und zwar derart, daß Unternehmer, welche einem
oder mehreren verwandten Berufen angehören, mit der
räumlichen Ausdehnung über das ganze Reich oder auch nur
über Teile desselben Berufsgenossenschaften bilden, welche
innerhalb des gesetzlichen Rahmens ihre Angelegenheiten durch ein
zu errichtendes Genossenschaftsstatut regeln und dieselben durch
Generalversammlung und selbstgewählten Vorstand verwalten.
Damit die Verwaltung nicht zu schwerfällig werde, können
die Genossenschaften, welche sich über größere
Bezirke ausdehnen, durch Statut die Einteilung in Sektionen sowie
die Einsetzung von Vertrauensmännern als örtliche
Genossenschaftsorgane vorschreiben, welche vorgekommene
Unfälle untersuchen, insbesondere auch bei Aufstellung von
Vorschriften zur Verhütung von Unfällen thätig sein
sollen. Die Gesamtzahl aller versicherten Personen bezifferte sich
1886 auf 3,725,313; es gab:
Berufsgenossenschaften Reichs- und Staatsbetriebe
Zahl der Betriebe 269174 -
Zahl der versicherten Personen:
a) Unternehmer 2686 -
b) Durchschnittlich beschäftigte
Betriebsbeamte u. Arbeiter 3467619 251878
c) Sonstige 3180 -
Im J. 1887 zählte man 62 Berufsgenossenschaften und 366
Sektionen mit 319,453 Betrieben und 3,861,560 versicherten
Personen; dazu kamen 47 Reichs- und Staatsbetriebe mit 259,977
Personen. An Entschädigungen wurden 1887 bezahlt von den
Berufsgenossenschaften: 5,373,496 Mk., von den Kassen der Reichs
und Staatsbetriebe: 559,434 Mk. Nach der Zahl der versicherten
Personen waren die größten Genossenschaften mit mehr als
100,000 Personen die Zur Wahrung ihrer Interessen haben die
Genossenschaften einen Verband gebildet, welcher 1887 den ersten
Genossenschaftstag in Frankfurt a. M. abhielt.
Zahl der
Betriebe versichert. Pers.
Knappschafts-Berufsgenossenschaft 1658 343707
Ziegelei-Berufsgenossenschaft 10135 174995
Zucker-Berufsgenossenschaft 455 127200
Sächsische Baugewerks-Berufsgenossensch. 7272 116987
" Textil-Berufsgenossenschaft 2721 116007
Norddeutsche Textil-Berufsgenossenschaft 2096 104942
Unter 14,000 Personen hatten die
Sächsische Holz- Berufsgenossenschaft 103l 13943
Bayrische Holzindustrie-Berufsgenossensch. 1855 13420
Westdeutsche Binnenschiffahrt-B. 2839 11935
Berufsgenossenschaft der
Schornsteinfegermeister des Deutschen Reichs 3044 5452
Die Genossenschaften stehen unter staatlicher Aufsicht,
und zwar wurde ein eignes Reichsversicherungsamt in Berlin
errichtet, welches aus dreiständigen, vom Kaiser ernannten
Beamten, vier Mitgliedern des Bundesrats und je zwei Vertretern der
Unternehmer und der versicherten Arbeiter zusammengesetzt ist.
Für Berufsgenossenschaften, deren Gebiet nicht über die
Grenze des Landes sich erstreckt, können besondere
Landesversicherungsämter errichtet werden. Von dieser Befugnis
haben Sachsen und Bayern, neuerdings auch Baden, Württemberg
und Mecklenburg Gebrauch gemacht.
Der gesetzliche Zwang kehrt sich nur gegen die Arbeitgeber,
welche die Kosten der Versicherung zu tragen haben, und in deren
Händen auch die Verwaltung liegt. Die Genossenschaften erheben
alljährlich postnumerando die nach Maßgabe der
Arbeiterzahl, der Lohnhöhe und der Gefahrenklasse bemessenen
Beiträge auf dem Weg des Umlageverfahrens. Die Post besorgt
die nötigen Zahlungen verlagsweise ohne Anrechnung von Kosten.
Außer dieser Beihilfe leistet das Reich eine solche noch
insofern, als leistungsunfähige Berufsgenossenschaften vom
Bundesrat aufgelöst werden können und ihre
Rechtsansprüche und Verpflichtungen auf das Reich
übergehen, bez. auf die Bundesstaaten, welche ein eignes
Landesversicherungsamt errichtet haben. Die versicherten Arbeiter
haben nur Rechte auf Entschädigung im Fall eintretender
Verunglückung. Solche Entschädigungen gewährt aber
die Kasse der Berufsgenossenschaft erst nach Verlauf von 13 Wochen
(Karenzzeit). In dieser Zeit haben die Krankenkassen einzutreten
mit der Maßgabe, daß das Krankengeld von der 5. Woche
ab auf Kosten des Unternehmers um 1/3 erhöht wird. Die
Leistungen der Genossenschaftskasse bestehen in Gewährung
einer Rente im Betrag von 3 des letzten Jahresverdienstes, welche
bei nur teilweise verminderter Erwerbsfähigkeit entsprechend
erniedrigt wird. Im Fall der Tötung ist Ersatz der
Beerdigungskosten, dann eine Rente an die Witwe im Betrag von 20
Proz. des Jahresverdienstes, an unerwachsene Kinder (im
Höchstbetrag von 60 Proz. an Witwen und Waisen zusammen), bez.
auch an Aszendenten, deren einziger Ernährer der
Verunglückte war, zu gewähren. Der zu leistende
Schadenersatz wird von den
995
Unfehlbarkeit - Ung.
Organen der Berufsgenossenschaft auf Grund vorausgegangener
polizeilicher Untersuchung des Unfalls festgestellt, gegen diese
Feststellung kann Berufung an ein Schiedsgericht, zu gleichen
Teilen aus Mitgliedern der Genossenschaft und Vertretern der
versicherten Arbeiter unter Vorsitz eines öffentlichen Beamten
bestehend, in schwereren Fällen noch Rekurs an das
Reichsversicherungsamt ergriffen werden. 1886 wurden an Verletzte
Entschädigungen gewährt:
bei Berufsgenossenschaften bei Staatsbetrieben
Erwachsene männlich 9104 814
" weiblich 332 3
Jugendliche unter 16 Jahren
" männlich 224 -
weiblich 43 -
Zusammen 9723 817
Das Haftpflichtgesetz ist zwar für die nach
Maßgabe des Unfallversicherungsgesetzes versicherten
Personen außer Kraft gesetzt, doch bleibt es für alle
übrigen Personen bestehen, dann für Betriebsbeamte mit
mehr als20o0Mk. Gehalt. Demgemäß hat denn auch die
Privatversicherung ihre Bedeutung nicht ganz eingebüßt.
Die U. für Arbeiter der Land- und Forst wirtschaft weicht von
derjenigen für industrielle Arbeiter mehrfach ab. Durch
Landesgesetzgebung kann die Versicherungspflicht auch auf
Unternehmer erstreckt werden. Die als Entschädigung zu
gewährende Rente wird nicht nach dem letzten Jahresverdienst
des Verletzten, sondern nach dem durchschnittlichen Verdienst land
u. forstwirtschaftlicher Arbeiter am Orte der Beschäftigung
bemessen. Die Rente kann, wenn der Lohn herkömmlich ganz oder
zum Teil in Naturalien entrichtet wurde, ebenfalls in dieser Form
gewährt werden. In den ersten 13 Wochen nach Eintritt eines
Unfalls hat die Gemeinde, sofern eine Krankenversicherung nicht
vorliegt, für die Kosten des Heilverfahrens aufzukommen. Die
Versicherung erfolgt durch Berufsgenossenschaften, welche für
örtliche Bezirke zu bilden sind. - Außer in Deutschland
besteht noch eine besondere Unfallgesetzgebung in England (Gesetz
vom 7. Sept. 1880), in der Schweiz (Gesetz vom 25. Juni 1881,
abgeändert durch Gesetz vom 26. April 1887) und in
Österreich (Gesetz vom 28. Dez. 1887). Nach dem
österreichischen Gesetz sind die versicherungspflichtigen
Betriebe nur annähernd die gleichen wie nach dem deutschen
Gesetz von 1884; im wesentlichen erstreckt es sich auf den
industriellen Gewerbebetrieb. Die Versicherungsbeiträge werden
nach einem von der Versicherungsanstalt aufzustellenden, staatlich
zu genehmigenden Tarif bemessen. 10 Proz. derselben fallen dem
Versicherten, 90 Proz. dem Unternehmer des versicherungspflichtigen
Betriebs zur Last. Mit Rücksicht auf die Beitragsleistung der
Arbeiter wurde die Karenzzeit auf nur vier Wochen festgesetzt. Die
Versicherung erfolgt durch territoriale, auf Gegenseitigkeit
beruhende Anstalten (Territorialsystem), neben welchen bei
Erfüllung bestimmter Bedingungen als gleichberechtigt auch
Privatanstalten und Berufsgenossenschaften zugelassen sind. Auf die
Verwaltung übt der Staat einen weiter gehenden Einfluß
aus als in Deutschland.
Vgl. Mucke, Die tödlichen Verunglückungen im
Königreich Preußen (Berl. 1880); Woedtke, Kommentar zum
Unfallversicherungsgesetz (3. Aufl., das. 1888); Derselbe, Die U.
der in land und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten
Personen (2. Aufl., das. 1888); Just, Desgleichen (das. 1888);
Nienhold, Die U. (Leipz. 1886); Döhl, Die U. (das. 1886);
Hahn, Haftpflicht und U. (das. 1882); Schloßmacher, Die
öffentlichrechtliche U. im Zusammenhang mit der Sozialreform
(Mind. 1886); Ertl, Das österreichische
Unfallversicherungsgesetz (Leipz. 1887); Becker, Anleitung zur
Bestimmung der Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit nach
Verletzungen (Berl. 1887); Stupp, Handbuch zur U. (Sammlung der
Verordnungen, Entscheidungen etc., 3. Jahrg., Münch. 1888);
Schmitz, Sammlung der Bescheide, Beschlüsse und
Rekursentscheidungen des Reichsversicherungsamtes (Berl. 1888);
Lutscher, Die Unfall-Statistik der Berufsgenossenschaften und ihr
Einfluß auf die Beiträge der Mitglieder (Düffeld.
1889); Platz, Die Unfallverhütungsvorschriften (Berl. 1889).
Zeitschrift: "Die Arbeiterversorgung" (hrsg. von Schmitz, das.,
seit 1884), in welcher auch die Entscheidungen der
Landesversicherungsämter veröffentlicht werden.
Unfehlbarkeit, s. Infallibilität.
Unform, Pflanzen, s. Amorpha.
Unfruchtbarkeit (Sterilität), die beim Weib
vorkommende Unfähigkeit, Kinder zu gebären. Die Ursachen
sind entweder in mangelhafter Bildung der Eier infolge fehlerhafter
Anlage, hohen Alters oder Erkrankung der Eierstöcke zu suchen,
oder in krankhafter Beschaffenheit der Eileiter, oder vor allem in
chronisch entzündlichen Veränderungen, Verlagerung oder
Knickungen der Gebärmutter (s. Zeugungsvermögen). Die
erste Gruppe von Fällen ist unheilbar, was besonders von
gerichtlichmedizinischer Bedeutung ist, die zweite Gruppe ist das
wesentliche Feld der Thätigkeit für die Frauenärzte
und bietet namentlich bei chirurgischer Behandlung oft
glänzende Erfolge. Vgl. Beigel, Pathologische Anatomie der
weiblichen U. (Braunschw. 1878); May rhofer, Sterilität etc.
(Stuttg. 187882); Duncan, Sterilität bei Frauen (deutsch von
Hahn, Berl. 1884); P. Müller, Die U. der Ehe (Stuttg. 1885);
Kisch, Die Sterilität des Weibes (Wien 1886).
Unfug, Störung der öffentlichen Ordnung;
ungebührliche Belästigung des Publikums. Das deutsche
Strafgesetzbuch (§ 360, Ziff. 11) bedroht groben U. mit
Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder mit Haft bis zu sechs Wochen. Die
Praxis der Gerichte faßt den Begriff dieser Übertretung
sehr weit und beschränkt ihn keineswegs nur auf eigentliche
Ruhestörungen. Beschimpfender U., an Zeichen der
öffentlichen Autorität, in Kirchen oder andern zu
religiösen Versammlungen bestimmten Orten oder an Gräbern
verübt, ist mit besondern Strafen bedroht. Vgl. Deutsches
Strafgesetzbuch, 103a, 135, 166, 168.
Unfundiert, Gegensatz zu fundiert (s. Fundieren).
Unfundierte Schuld, s. v. w. schwebende Schuld, s. Staatsschulden,
S. 203.
Uug (Ungh), ungar. Komitat am rechten Theißufer,
zwischen Galizien und den Komitaten Zemplin, Szabolcs und Bereg,
umfaßt 3053 qkm (55,4 QM.), ist im N. und O. gebirgig
(Vihorlatgebirge und Ostbieskiden) und teilweise (ein Drittel)
wildreiches Waldland, im S. dagegen eben und zum Teil auch sumpfig.
U., das von der Latorcza, der Laborcza, dem in letztere
mündenden Fluß U. und vielen Nebenflüssen desselben
bewässert wird, ist nur im S. und zum Teil auch in den
Thälern fruchtbar (Roggen, Hafer, Hanf und auch Wein) und hat
(1881) 126,707 meist ruthenische, ungarische und slowak. Einwohner
(griechischer, unierter und kath. Konfession). Sitz des Komitats
ist die Stadt Ungvár (ehemals Festung), Station der
Ungarischen Nordostbahn (Nyiregyhaza Ungvár), am Fluß
U., Sitz desunkacser griechisch-uniert-ruthenischen Bischofs- und
Domkapitels, mit prächtiger Hauptkirche, Nonnen-
63
996
Ungamabai - Ungarische Litteratur.
kloster, (1881) 11,373 Einw., Seminar, Lehrerpräparandie,
kath. Obergymnasium, Bibliothek, Waiseninstitut, Bezirksgericht,
Oberforstamt, Mineralquelle und Porzellanerdegruben.
Ungamabai (Formosabai), weite, offene Bucht an der
Küste Ostafrikas, am Nordende des Sansibar zugehörigen
Küstenstrichs, im N. von Witu begrenzt, in der Tiefe derselben
mündet der Tanafluß. Die U. bietet selbst für
größere Seeschiffe bis nahe am Land guten Ankergrund und
ist ein Stationspunkt der britischen gegen den Sklavenhandel in
Ostafrika kreuzenden Fahrzeuge; 1867 wurden die an ihr liegenden
Ortschaften von den Galla zerstört.
Uugarisch-Alteuburg (Magyar-Óvar), Markt im ungar.
Komitat Wieselburg, an der Leitha und der Kleinen Donau, Sitz des
Komitats und Hauptort einer Domäne des Erzherzogs Albrecht,
hat 2 Klöster, (1881) 3427 Einw. (meist Deutsche), eine
landwirtschaftliche Akademie, Musterlandwirtschaft, Bierbrauerei,
Dampfmühle und Bezirksgericht.
Uugarisch-Brod, Stadt in Mähren, an der Eisenbahn
Brünn-Vlarapaß, Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und
eines Bezirksgerichts, an der Ölsawa, mit Mauern und Graben
umgeben, hat einen Dominikanerkonvent, ein fürstlich
Kaunitzsches Schloß, eine Zuckerfabrik und (1880) 4435 Einw.
(646 Juden).
Ungarische Litteratur. Die Litteratur der Ungarn ist eine
verhältnismäßig sehr junge. Ihre
ununterbrochene Existenz und Entwickelung erstreckt sich kaum
über einen Zeitraum von 110 Jahren; sie datiert eigentlich
erst vom Jahr 1772, und ihre Geschichte bis zu diesem Jahr
läßt sich in wenige Bemerkungen zusammenfassen. Als die
Magyaren um 894 aus der südrussischen Ebene in Ungarn
einbrachen, waren sie ein barbarisches Nomadenvolk ohne jegliche
Litteratur, mit Ausnahme jener Lieder und Heldensagen, deren auch
der wildeste Stamm nicht völlig entbehrt. Allein auch als sie
in Ungarn seßhaft geworden waren, sich zum Christentum
bekehrt und aus Deutschland, Byzanz und Italien eine ziemlich
ansehnliche Kultur erhalten hatten, regte sich in ihnen noch wenig
schöpferische litterarische Neigung. Alles, was von dem
magyarischen Schrifttum bis zum 16. Jahrh., also binnen sieben
Jahrhunderten des europäischen Daseins der Magyaren, auf uns
gekommen ist, beschränkt sich auf eine "Grabrede" ("Halotti
beszed", das älteste Sprachdenkmal der Magyaren, aus dem Ende
des l2. oder dem Anfang des 13. Jahrh.), auf ein Marienlied, auf
ein Gebet aus dem 13. Jahrh., ein "Leben der heil. Margarete"
(Tochter des Arpadenkönigs Bela IV.), eine verifizierte
Biographie der heil. Katharina von Alexandria (mutmaßlich
eine Übersetzung) und einige fragmentarische
Bibelübersetzungen und Schriften theologischen Inhalts. Aus
dem Ende des 14. oder dem Anfang des l5. Jahrh. stammt das
älteste historische Lied über die "Geschichte der
Eroberung Pannoniens durch die Magyaren". Einen blühenden
Aufschwung nahm die magyarische Litteratur während der
Reformationszeit. Im 16. Jahrh. treten uns auch zum erstenmal zwei
etwas deutlicher individualisierte Poetenphysiognomien entgegen:
die des Sebastian Tinody (Geburtsjahr unsicher, starb um 1559),
eines fahrenden Sängers, dessen Lieder Reimchroniken der
Kämpfe Ungarns gegen die Türken bilden, und des Barons
Valent in Balassa (1551-94), der über den Verfall Ungarns
klagte, und dessen Gedichte, namentlich die jüngst entdeckten
lyrischen "Blumengedichte, Feuer und Leidenschaft, Reichtum an
Phantasie und Gewandtheit der Sprache bekunden. In demselben
Jahrhundert gelangte die romantische Dichtung, die im Westen
bereits ausgelebt hatte und gerade durch die unsterbliche Satire
des Cervantes für ewige Zeiten eingesargt worden war, nach
Ungarn, das so spät eine ganze Reihe von Romanen und Gedichten
entstehen sah, in welchen die alten Ritter und Abenteuergeschichten
des frühen Mittelalters zu einem wunderlich anachronistischen
verspäteten Dasein wiedererwachten. Diese Litteratur, teils
Nachahmung, teils Übersetzung ohne jeden Wert, ohne jede
Originalität und ohne das geringste nationale
Eigengepräge, war quantitativ nicht unansehnlich ("Geschichte
der Gismunda", von Georg Enyedi; "König Voltér und
Griseldis" von Peter Iftvánfi; "König Argirus und die
Feenjungfrau" von Albert Gergei; "Schöne Geschichte von der
Freundschaft zweier edler Jünglinge", von Kaspar Veres; "Die
schöne Magellone" und "Fortunatus", beide von Heltai [?] und
zahlreiche andre), und ihre einzelnen Werke erhielten sich zum Teil
bis in die Gegenwart als Volksbücher, die in schlechten,
billigen Drucken auf allen Jahrmärkten feilgeboten werden.
Bemerkenswert ist endlich die Originaldichtung des Peter Ilosway
über den halbhistorischen magyarischen Riesen und Volkhelden
"Niklas Toldi" (1574) und die "Geschichte von Szilagyi und Hajmasi"
(1571), der ebenfalls ein historisches Faktum zu Grunde liegt. Das
17. Jahrh. produzierte den ersten namhaften Kunstdichter Ungarns,
den Grafen Nikolaus Zrinyi (161664), den Enkel des
heldenmütigen Verteidigers von Szigetva, dessen Hauptwerk, ein
Epos in 15 Gesängen, "Obsidio Szigetiana" betitelt, die
Verherrlichung der Waffenthat seines Ahns zum Gegenstand hat. Das
Gedicht, das sich bemüht, Tassos "Befreites Jerusalem"
nachzuahmen, zeigt trotz seiner rohen, keiner Nüancierung
fähigen Sprache dennoch an vielen Stellen Kraft und Schwung.
Zeitgenossen Zrinyis waren Baron Ladislaus Liszti (geboren um 1630,
Todesjahr unbekannt), der ein Epos: "Cladis Mohachina", und Stephan
Gyöngyösi (1620-1700), der das Gedicht "Die Venus von
Murany" schrieb, beides Werke, welche (wie das ihnen zum Muster
dienende Heldengedicht Zrinyis) Episoden aus der ungarischen
Geschichte jener Zeit in oft banaler und
handwerksmäßiger Weise behandeln. Neben diesen
Dichtungen brachte das 17. Jahrh. zahlreiche theologische
Streitschriften hervor, unter welchen die Werke des
Gegenreformators Pazmany (s. d.) die weitaus bedeutendsten sind. So
gelangen wir ins 18.Jahrh. Damals war es um das Geistesleben des
magyarischen Stammes traurig bestellt; die Türkenherrschaft,
erst 1699 endgültig beseitigt, hatte das Land als Einöde
und in tiefster Barbarei zurückgelassen. Die wenigen Schulen,
die diesen Namen verdienten, waren ausschließlich in den
Händen der Geistlichkeit. Die Sprache der Verwaltung, der
Rechtspflege, des Unterrichts war die lateinische, die
Umgangssprache der höhern und mittlern Klassen die deutsche
oder französische. Das magyarische Idiom besaß weder
eine wissenschaftliche noch eine schöngeistige Litteratur;
dennoch gab es auch in dieser Zeit einige nennenswerte Dichter und
Schriftsteller in ungarischer Sprache. So den namhaften Lyriker
Franz Faludi (1704-79), den Kirchenliederdichter Paul v. Raday
(1677-1733), den Sänger weltlicher Lieder Baron Ladislaus
Amade (1703-64) u. a. Auch blühte in dieser Zeit das
magyarische Schuldrama. Allerdings übten diese litterarischen
Erzeugnisse nur geringen Einfluß auf die breitern Schichten
der Gesellschaft. Da erfolgte von andrer Seite ein kräftiger
Reformversuch. Die Kaiserin Maria Theresia gründete (1760) die
ungarische adlige Leibgarde, be-
997
Ungarische Litteratur (Belletristik).
gabte junge Magyaren kamen als Gardisten nach Wien und mit einer
höhern Kultur in Berührung, sie lernten die Bildung und
die Literaturen des Westens kennen und empfanden erst angesichts
dieser glänzenden Beispiele die tiefe geistige Erniedrigung,
in die ihr Volksstamm gesunken war. Sie schämten sich ihrer
Barbarei und beschlossen, die Regeneratoren ihres Volkes zu werden.
Die Gardisten thaten sich zusammen und schufen in klarer,
bestimmter Absicht eine magyarische Schriftsprache und eine
magyarische Nationallitteratur. Allerdings gab es unter diesen
Gardisten keine wahren poetischen Talente; sie schrieben nicht, um
einem dichterischen, sondern um einem patriotischpolitischen Drang
zu genügen, und sie beschränkten sich der Mehrzahl nach
darauf, die berühmtern Werke alter und neuerer fremder
Schriftsteller in magyarischer Sprache mehr oder minder
glücklich nachzuahmen. Die nennenswertesten unter diesen
verdienstvollen Gardisten, welche die Gründer der modernen
magyarischen Litteratur wurden, sind Georg Bessenyei (1752-1811),
Abraham Barcsay (1742-1806), Alexander Baróczy (1737-1809)
u. a. Früh teilten sich die Gardisten und ihre
Gesinnungsgenossen außer der Garde in drei Schulen. Die
französische (Bessenyei, Barcsay, Anyos, Graf Joseph Teleki,
Jos. Péczeli, Baróczy) ahmte Voltaire, Racine,
Wieland etc. nach; die klassische (David Baróti Szabo,
Nikolaus Révai, Joseph Rajnis, Ben. Virág) hielt sich
an das Muster der Alten, und nur die volkstümliche (A.
Dugonics, A. Paloci Horváth, Graf I. Gvadányi) machte
den schüchternen Versuch, national und selbständig zu
sein. Den ersten Bahnbrechern folgte eine Schriftstellergeneration,
deren Hervorbringungen bereits wesentlich höher stehen. Joseph
Kármán (1771-98) schrieb seinen sentimentalen Roman
"Fannys Hinterlassenschaft", der Aufsehen erregte; Michael Csokonai
(1773-1805) dichtete das komische Epos "Dorothea", die Satire
"Froschmäusekrieg", einige Lustspiele, die Anlauf zur
Selbständigkeit nahmen, besonders aber lyrische Verse, welche
im Munde des Volkes noch heute leben; endlich trat Alexander
Kisfaludy (1772-1844) auf, dessen Sammlung lyrischer Gedichte :
"Himfys Liebe", für Ungarn epochemachend wurde, insofern hier
zum erstenmal die pedantische konventionelle Schulpoesie verlassen
und neben vielem Schwulst und Unnatürlichkeit manchmal doch
der Ton wahren Gefühls angeschlagen wird. Von großem
Einfluß auf die weitere Entwickelung der ungarischen
Litteratur war Franz Kazinczy (1759-1831) und sein Kreis. Kazinczy,
wenig bedeutend als Poet, that sich als Reformator der noch wenig
ausgebildeten magyarischen Sprache hervor. Die gleiche Richtung
(Entwickelung, Veredelung und Bereicherung des magyarischen Idioms)
befolgten der Ödendichter Daniel Berzsenyi (1776-1836), der
Lyriker M. Vitkovics (1778-1829), der Dramenübersetzer G.
Döbrentei (1786-1851), der Dramendichter Karl Kisfaludy
(1788-1830), der eigentliche Begründer des magyarischen
Kunstdramas, und der Ependichter Andreas Horváth
(1778-1839). Was diese Schriftstellergruppe (den sogen.
Kazinczyschen Kreis) sowie deren Zeitgenossen Kölcsey, Andr.
Fáy, Joseph Katona u.a. charakterisiert, das ist der nahezu
ausschließlich patriotische Inhalt ihrer Werke; der einzige
Stoff, den sie in allen Dichtungsarten behandeln, ist ihr
Vaterland, dessen glorreiche Vergangenheit, dessen betrübende
Gegenwart und herrliche Zukunft. Noch heute hat sich die
magyarische Litteratur von diesem durch die politischen
Verhältnisse der Zeit erklärten und gerechtfertigten
engen Stoffkreis nicht gänzlich loszuringen vermocht, und noch
immer selten sind bis zu diesem Tag die magyarischen Werke
geblieben, die sich von beschränktem Nationalismus zu freier
allgemeiner Menschlichkeit emporheben.
Im 19. Jahrh. nimmt die u. L. einen kräftigen Aufschwung.
Zu den bedeutendsten Leistungen derselben gehört die
Tragödie "Bánk Bán" von Joseph Katona
(1792-180), welche bis heute noch als das hervorragendste
dramatische Kunstwerk der Magyaren gilt. Großen Ruhm erwarb
sich ferner Michael Vörösmarty (1800-1855), den manche
den größten Dichter Ungarns nennen, mit dem Epos
"Zaláns Flucht" (1824), während von seinen zahlreichen
Dramen, poetischen Erzählungen und lyrischen Gedichten nur die
letztern höhern Wert besitzen. Im allgemeinen ist
Vörösmarty mehr Rhetor als Dichter, seine Stärke ist
die Deklamation. Gregor Czuczor, Joseph Bajza, Johann Garay, Alex.
Vachott (1818-61) sind andere Epiker und Lyriker dieser Periode,
deren bedeutendster Dichter indes Alexander Petöfi ist
(1823-l849). Petöfi, dessen poetische Erzählung "Held
János", eine vortreffliche volkstümlich humoristische
Dichtung, dessen Roman "Der Strick des Henkers" und dessen Drama
"Tiger und Hyäne" wertlose, unreife Produkte sind, erhebt sich
als Lyriker weit über seine Vorgänger und ist der erste,
dessen Gedichte wahr, natürlich, einfach und menschlich sind.
Er ist neben Joseph Katona die erste Erscheinung in der
magyarischen Litteratur, die mit dem Maßstab der
Weltlitteraturen gemessen werden kann, und die neben den
großen Namen der letztern einen Platz beanspruchen darf. Noch
bedeutender als Petöfi ist Johann Arany (1817-82), der
bedeutendste ungarische Balladen und Ependichter dieses
Jahrhunderts. Vortreffliche Balladen dichteten auch P. Gyulai,
Joseph Kiß (geb. 1843) und Ludwig Tolnai (geb. 1837). Als
Lyriker verdienen Michael Tompa, Franz Csaszar, Paul Jambor
(Pseudonym Hiador), Kol. Lisznyay (1823-63), Johann Vajda (geb.
1827), Joseph Levay (geb. 1825), Karl Szasz, Emil Abrányi
(geb. 1851), Alex. Endrödy (geb. 1850) hervorgehoben zu
werden; als Dramatiker sind Szigligeti, Czakó, Obernyik,
Ludwig Dobsa (geb. 1824), Karl Hugo (Hugo Bernstein, 1817-77), Kol.
Tóth, Aloys Degre (geb. 1820), Joseph Szigeti (geb. 1822),
Eduard Tóth, Gregor Csiky), Eugen Rákosi (geb. 1842),
L. v. Dóczy, Ludwig Bartók (geb. 1851) zu
erwähnen. Auf dem Gebiet des Romans thaten sich hervor:
Freiherr Nik. Jósika (17941865), der "ungarische Walter
Scott" genannt, dessen Romane auch in Deutschland viel gelesen
wurden, ferner Ludwig Kuthy (1813-64; "Die Geheimnisse des
Vaterlands"), Baron Joseph Eötvös (1813-71; "Der
Kartäuser", unter dem Einfluß der Chateaubriandschen
christlich-romantischen Sentimentalität geschrieben;
"Dorfgeschichten", realistisch und voll Humor; "Der Dorfnotar" und
"Ungarn im Jahr 1514", satte, fleißige Gemälde
ungarischen Lebens zu bestimmten Perioden), Baron Siegmund
Kemény (1816-75), Moritz Jókai (geb. 1825), Paul
Gyulai (geb. 1826), Zoltan Beöthy (geb. 1848). Die letzten
zwei Jahrzehnte haben außer einigen bedeutenden Werken Johann
Aranys, einigen Dramen, die einen gewissen Tageserfolg errangen,
und einigen Romanen Jokais nur weniges hervorgebracht, was
besonderer Erwähnung verdiente und hoffen könnte,
außerhalb Ungarns zu interessieren. Hierher gehört vor
allem das philosophische Drama "Die Tragodie des Menschen" von
Emerich v. Madách (1823-1864), eine Dichtung, reich an
erhabenen Gedanken und
998
Ungarische Litteratur (wissenschaftliche).
poetischen Schönheiten. Ein hervorragendes Talent der
Gegenwart ist Koloman Mikszáth (geb. 1849), dessen
nordungarische Dorfgeschichten auch außerhalb Ungarns
großen Beifall gefunden haben. Die lebende
Schriftstellergeneration widmet sich fast ausschließlich der
Journalistik, und die Folge davon ist tiefer Verfall auf allen
Gebieten der schönwissenschaftlichen Litteratur. Diese hat
bisher nicht gehalten, was sie in den 40er Jahren dieses
Jahrhunderts zu versprechen schien; den Namen Eötvös,
Petösi, Arany, Jokai haben sich keine neuern von nur
annähernd gleichem Klang angefügt.
Die wissenschaftliche Litteratur Ungarns war bis ins
18.Jahrh.fast ausschließlich lateinisch, ja noch in der
ersten Halste unsers Jahrhunderts bedienten sich die Gelehrten in
der Litteratur wie in der Schule mit Vorliebe der Sprache Roms. Die
ersten magyarischen Geschichtswerke sind die chronikartigen
Aufzeichnungen aus dem 16. Jahrh. von Anton Verancsics, Franz Zay,
Valentin Homonnai, Franz Wathai und die Chroniken von Stephan
Szekely und Kaspar Heltai. Im 17. Jahrh. schrieb Emmerich
Tököly Memoiren über mehrere seiner Feldzüge;
Fürst Johann Kemeny und Niklas Bethlen verfaßten
Autobiographien; zahlreiche andre politische Persönlichkeiten
von bedeutenderer Stellung zeichneten die Ereignisse auf, deren
Zeugen sie waren; die Chronik von Gregor Petheö, später
von Nachfolgern fortgesetzt, blieb lange das einzige geschichtliche
Handbuch des ungarischen Publikums. Im 18. Jahrh. ragen hervor:
"Historie Siebenbürgens" von Mich. Cserey und "Metamorphose
Siebenbürgens", ein sittengeschichtliches Werk von Peter Apor;
"Briefe aus der Türkei" von Cl. Zagoni-Mikes, Sekretär
Franz Rakoczys II.; ferner Esaias Budais "Geschichte von Ungarn"
(erschienen 1805); Franz Budais "Bürgerliches Lexikon", die
Biographien ausgezeichneter Ungarn enthaltend. Unter dem
Einfluß der Göttinger historischen Schule, dann der
Arbeiten der ungarischen Historiker Georg Pray und Steph. Katona
sowie der Arbeiten von Gebhardi, Feßler und Engel erwachte im
ersten Viertel des 19. Jahrh. in der Geschichtschreibung ein neuer
Geist. Man begann mit großem Fleiß Daten zu sammeln,
Kritik und Quellenstudium wurden leitende Grundsätze. Georg
Feher, Nikolaus v. Jankovics, Baron Aloys Mednyanszky, Johann
Czech, Benedikt Virag, Stephan Horvath wirkten als Forscher oder
eröffneten durch ihre Schriften neue Gesichtskreise.
Später thaten sich hervor: Paul Jaszay, Graf Joseph Teleki
(Geschichte der Hunyadys), Ladislaus v.Szalay und Michael Horvath
mit bedeutenden Werken über die ganze Geschichte Ungarns und
Spezialwerken über einzelne Partien und Persönlichkeiten;
Arnold Ipolyi (früher Stummer), Anton Csengery, Karl Szabo,
Alexander Szilagyi, Franz Salamon (Geschichte Ungarns zur Zeit der
Türkenherrschaft u. a.), Koloman Thaly (Geschichte F. Rakoczys
und seiner Zeit), Wilhelm Fraknoi (früher Frankl; Biographie
Peter Pazmanys, Geschichte der ungarischen Landtage u. a.), Julius
Pauler, Wolfgang Deak, Max Falk (Biographien Szechenyis und
Ladislaus Szalays) u. a. Einen bedeutenden Aufschwung hat die
ungarische Einzel-Geschichtsforschung seit 1867 genommen,
insbesondere durch die Wirksamkeit der Ungarischen Historischen
Gesellschaft, deren Organ: "Századok" ("Jahrhunderte") eine
Fundgrube zahlreicher Spezialarbeiten und Daten ist. Die
Literaturgeschichte ist hauptsächlich durch Franz Toldy
(früher Schedel) und Zoltán Beöthy, die
Ästhetik durch A. Greguß, P. Gyulai, Z. Beöthy,
Eugen Péterffy, Friedr. Riedl u. a. vertreten. Der Beginn
der rechts-, der staatswissenschaftlichen und politischen
Litteratur fällt gleichfalls ins 16.Jahrh. Das Tripartitum
Verböczys erschien, von B. Veres ins Ungarische
übersetzt, zuerst 1565. Aus dem 17. Jahrh. sind zu
verzeichnen: P. Kitonich ("Leitfaden der Prozeßordnung"),
Paul Medgyesi (Werke über Kirchenverwaltung), I.
Fésüs ("Spiegel der Könige"), M. Teleki
("Fürstenseele"); im 18. Jahrh. erregten Sam. Balia und Georg
Aranka in Siebenbürgen mit ihren staatsrechtlichen Versuchen
Aufsehen; Elias Georch war der erste, der sämtliche ungarische
Gesetze in ungarischer Sprache bearbeitete. Im 19. Jahrh. gaben die
Reformbewegung und die staatsrechtlichen Bestrebungen, die erst zur
Gesetzgebung von 1848, dann zum Ausgleich von 1867 führten,
der rechts- und staatswissenschaftlichen Litteratur bedeutende
Impulse. Zu nennen sind: Alexander Kövy, Paul Szlemenics,
Ignaz Frank, Johann Fogarassy, Theodor Pauler, Ignaz Udvardy,
Stephan Szokolay, Franz Deak, Aurel und Emil Dessewffy, Joseph
Eötvös u. a. Deak, die Brüder Dessewffy und
Eötvös sind zugleich Größen auf dem Felde der
politischen Litteratur, deren epochemachender Schöpfer Stephan
Szechenyi ("Kredit", "Licht", "Stadium", "Ein Volk des Ostens" u.
a.) war. In dessen Fußstapfen trat Nikolaus Wesselenyi. Der
Schöpfer der ungarischen politischen Journalistik ist Ludw.
Kossuth. Auf diesem Feld sind zu nennen: Graf Aurel Dessewffy,
Siegmund Kemeny, Anton Csengery, Joseph Eötvös, Johann
Török. Als politische Redner ersten Ranges glänzen:
Stephan Szechenyi, Kossuth, Wesselenyi, Kölcsey, Franz Deak,
Joseph Lonovics, Aurel Dessewffy, Barth. Szemere, Gabriel Kazinczy,
Eötvös, Koloman Ghyczy, Paul Somssich, Balthasar Horvath,
Desidor Szilagyi, Graf Albert Apponyi u. a. Der erste, der eine
philosophische Doktrin in ungarischer Sprache bearbeitete, war
Johann Apáczai Cseri("Ungarische Logik", 1659). Vom Ende des
18. Jahrh. an ist eine große Zahl ungarischer Lehrbücher
über Philosophie und Geschichte der Philosophie zu
verzeichnen, die jedoch meist Kompilationen deutscher und
französischer Werke sind. Die Naturwissenschaft gelangte in
Ungarn erst in neuester Zeit, unterstützt durch die Mittel,
welche die Regierung unmittelbar und mittelbar diesem Zweig der
Wissenschaft zuwendet, zu bedeutenderer Pflege. Die geologische
Landesanstalt, das meteorologische, das chemische, das
physiologische und hygieinische Landesinstitut, die neue
chirurgische Klinik (sämtlich in Budapest), die
Naturwissenschaftliche und die Geologische Gesellschaft sind ebenso
viele Stätten wissenschaftlicher Thätigkeit. Die
Hervorragendsten, von denen zahlreiche Arbeiten vorliegen, sind:
Joseph Szabo, Joseph Krenner, Max v. Hantken (Geologie); A. Jedlik,
Roland Eötvös, Koloman Szily (Physik); Karl Than
(Chemie); Petzval, Veß, Hunyady (Mathematik); Konkoly
(Astronomie); Abt Krueß, Guido Schenzl (Meteorologie);
Lenhossek (Anatomie); Jendrassik (Physiologie); Semmelweis
(Geburtshilfe); Balafsa und Joseph Kovacs (Chirurgie) u. a. Die
Naturwissenschaftliche Gesellschaft gibt eine reichhaltige
Zeitschrift und die bedeutendsten naturwissenschaftlichen Werke der
europäischen Litteratur in Übersetzungen heraus. Ein
gleicher Aufschwung ist auf dem Felde der Nationalökonomie (I.
Kautz, M. Lonyay, A. György u. a.), der Statistik (A. Konek,
Keleti, I. Körösi, Johann Hunfalvy), der Geographie und
Reiselitteratur (Johann und Paul Hunfalvy, Ladislaus Magyar, Joh.
Xantus u. a.), der Altertums-
LÄNDER DER
UNGARISCHEN KRONE,
(UNGÄRN-SlEBENBÜRGEN U. KROATIEN-SLOWENIEN)
GALIZIEN UND BUKOWINA.
Maßstab1:3,300,000.
999
Ungarisches Erzgebirge - Ungarn.
kunde (E. Henßlmann, A. Ipolyi, F. Romer, Eugen
Nyáry, Franz Pulszky u. a.) zu verzeichnen. Überhaupt
hat die geistige Arbeit Ungarns seit den letzten zehn Jahren sich
vielfach der wissenschaftlichen Thätigkeit zugewendet, wenn
auch die ungarischen Männer der exakten Wissenschaften sich
bisher hauptsächlich auf Übersetzung oder Bearbeitung
ausländischer Werke verlegten und mit Ausnahme der um die
Erforschung ihres Landes sehr verdienten Geologen und
Archäologen noch keine selbständigen Entdeckungen
aufzuweisen haben, welche ihnen einen Platz in der Geschichte des
Fortschritts der Wissenschaft sichern würden. Vgl. Toldy,
Geschichte der ungarischen Dichtung (deutsch, Pest 1863); Dux, Aus
Ungarn (Leipz. 1880); Schwicker, Geschichte der ungarischen
Litteratur (das. 1889); Beöthy, Handbuch der ungarischen
Literaturgeschichte (in ungar. Sprache, 4. Aufl., Budap. 1884);
"Ungarische Revue" (seit 1881 hrsg. von Hunfalvy und Heinrich,
Budapest).
Ungarisches Erzgebirge, s. Karpathen, S. 557.
Ungarische Sprache. Die Sprache der Magyaren gehört zu
der finnisch-ugrischen Abteilung der großen
uralaltaischen Sprachenfamilie (s. d.). Die Verwandtschaft
derselben mit dem Ostjakischen und Wogulischen am Uralgebirge sowie
auch mit der zweitbedeutendsten Sprache dieser ganzen Gruppe, dem
Finnischen, ist so unverkennbar, daß sie schon vor dem
Aufblühen der modernen Sprachwissenschaft in frühern
Jahrhunderten von einzelnen Gelehrten bemerkt wurde;
wissenschaftlich nachgewiesen ward aber dieser Zusammenhang und die
entferntere Verwandtschaft des Ungarischen oder Magyarischen mit
dem Türkischen und den übrigen Gruppen des uralaltaischen
Sprachstammes erst in den letzten Dezennien. Die wichtigsten
Eigentümlichkeiten, die das Ungarische mit den uralaltaischen
und speziell mit den finnisch-ugrischen Sprachen teilt, sind die
Vokalharmonie (s. d.) und das Prinzip der Agglutination. Die
Agglutination, d. h. die lose Anfügung einer beliebig
großen Menge von Beugungssilben an den Wortstamm, der
unverändert an der Spitze des Wortes stehen bleibt, bewirkt,
daß die magyarische Sprache wie das Finnische, Türkische
etc. einen ungeheuern Reichtum an grammatischen Formen besitzt.
Weit geringer ist dagegen ihr Wortreichtum, teils deshalb, weil
neben ihr noch zu viele andre Sprachen im Land sich geltend machen,
teils und vorzüglich, weil sie viele Jahrhunderte hindurch aus
den Geschäftsverhandlungen der Behörden, aus Kirche und
Schule durch das Lateinische, aus der gebildeten Konversation durch
das Französische und Deutsche verdrängt war. Erst seit
dem Tod Josephs II. nahm sie einen höhern Aufschwung, auch ist
sie seit Wiederherstellung der selbständigen ungarischen
Regierung (1867) mit der Terminologie für sämtliche
Zweige des modernen Kulturlebens ausgestattet. Die Schrift ist die
lateinische. Lange Vokale werden durch Accente (á, é
etc.) bezeichnet. Für die konsonantischen Laute reichen die
Buchstaben des lateinischen Alphabets nicht aus, weshalb man zu
Zusammensetzungen seine Zuflucht genommen hat. q, w und x hat man
überhaupt nicht mit verwendet und auch c und y nur in
Zusammensetzungen mit andern zur Bezeichnung der Laute, für
welche dem lateinischen Alphabet eigne Buchstaben fehlen; doch
vertritt y in ältern Familiennamen häufig die Stelle des
i. Im ganzen hat die Sprache 24 konsonantische Laute, welche in
folgender Weise bezeichnet werden: b, cs, cz, d, f, g, gy, h. j, k,
l, ly, m, n, ny, p, r, s (spr. sch), sz (spr. ss), t. ty, v, z
(spr. s), zs (weiches sch, wie franz. j). In den Lauten gy, ny, ly,
ty ist das y keineswegs mit i identisch, sondern wird als ein mit
dem vorhergehenden Konsonanten innig verschmolzenes j gehört;
gy ist ungefähr wie dj zu sprechen. Im Anfang einer Silbe
verträgt die u. S. in der Regel nie mehr als einen
Konsonanten; in Wörtern mit zwei Anfangskonsonanten, die sie
aus fremden Sprachen aufgenommen hat, hilft sie sich daher durch
Vorsetzung oder Einschiebung eines Vokals, z. B. astal (slaw.
stol), der Tisch, kiraly (slaw. kral), der König. Die
älteste ungarische Grammatik ist die von Joannes Silvester
Pannonius (Sarvár-Ujszigeth 1539). Neuere Werke für den
ersten Unterricht sind die (deutsch verfaßten) Grammatiken
von Mailath (2. Aufl., Pest 1832), Kis (Wien 1834), Töpler (7.
Aufl., Budap. 1882), M. Ballagi (magyarisierte Namensform) oder
Bloch (8. Aufl., das. 1871), Franz Ney (24. Aufl., das. 1888); eine
wissenschaftliche Grammatik, obgleich im einzelnen bereits
veraltet, ist diejenige von M. Riedl (Wien 1858).
Wörterbücher lieferten Richter (Wien 1836, 2 Bde.),
Fogarassy (Pest 1836, 2 Bde.), I. T. Schuster (Wien 1838), Ballagi
(5. Aufl., das. 1882; Supplement zum deutsch ungar. Teil 1874). Den
ganzen ungarischen Wortschatz streng wissenschaftlich darzustellen,
ist das unablässige Bestreben der Ungarischen Gelehrten
Gesellschaft, deren großes ungarisches Wörterbuch, von
G. Czuczor und I. Fogarassy redigiert (186274, 6 Bde.), nun
vollendet vorliegt. Außerdem ist die Ausarbeitung eines
sprachgeschichtlichen Wörterbuchs unter Aufsicht der
linguistischen Kommission der Akademie im Gang. Die
Hauptstützen der sprachvergleichenden Durchforschung des
Magyarischen sind Paul Hunfalvy (s. d.) und Joseph Budenz (s. d.)
mit ihren zahlreichen durch die ungarische Akademie
veröffentlichten Studien über die mit dem Magyarischen
verwandten Sprachen.
Ungarisch-Hradisch, s. Hradisch.
Ungarisch-Ostra, s. Ostra.
Ungarn (ungar. Magyarország, türk.
Magyaristan, slawon.V engria, lat. Hungaria, franz. Hongrie, engl.
Hungary), Königreich, die östliche Hälfte der
österreichisch ungarischen Monarchie, erstreckt sich von
44°9'-49°33' nördl. Br. und von 14°24'-26°36',
östl. L. v. Gr., besteht aus dem eigentlichen U., dem
ehemaligen Siebenbürgen, Fiume samt Gebiet, Kroatien,
Slawonien und der frühern Militärgrenze und grenzt im N.
an Mähren, Österreichisch-Schlesien und Galizien, im O.
an die Bukowina und Rumänien, im S. an letzteres, Serbien,
Bosnien und Dalmatien und im W. an Istrien, Krain, Kärnten,
Steiermark, Niederösterreich und Mähren. Vgl. beifolgende
Karte "Länder der ungarischen Krone".
Physische Beschaffenheit.
Die Gebirge gehören den Karpathen und den Alpen an,
zwischen denen die Donau mit den von ihr durchschnittenen weiten
Ebenen die natürliche Grenze bildet. Die Karpathen (s. d.),
das Hauptgebirge des Landes, beginnen an der Donau neben der
Marchmündung und umgeben das Land von NW. nach SO. in einem
mächtigen Halbbogen, dessen Wölbung gegen NO. fällt;
die Ausläufer der Norischen und Karnischen Alpen hingegen
schließen das an dem rechten Donauufer gelegene westliche
Berg und Hügelland ein und treffen mit ihren Vorbergen an der
Donau bei Hainburg (Leithagebirge) und Gran (Vértesgebirge)
mit den Karpathen zusammen. Am südöstlichen Ende, bei
Orsova, wird die Donau abermals von den Ausläufern der
siebenbürgischen Karpathen und des Balkangebirges eingeengt
(die berühmte Klissura mit dem Eisernen Thor). Die weite
Tief-
1000
Ungarn (Bodenbeschreibung, Bewässerung, Klima, Areal).
ebene des Landes wird durch die Alpenausläufer in zwei
Hälften geteilt, deren kleinere sich gegen W., die
größere gegen O. erstreckt. Die kleine oder
oberungarische Tiefebene (Preßburger Becken), zu beiden
Seiten der Donau zwischen Preßburg und Komorn, etwa 12,000
qkm (220 QM.) groß, breitet sich in Eiform aus, liegt 130 m
ü. M., ist meist von Bergen umschlossen und sehr fruchtbar,
besonders der nördliche Teil und die Donauinsel Schutt (s.
d.). Im N. und S. breiten sich auf bald flachem, bald
hügeligem Boden die gesegnetsten Gefilde aus mit Ackern,
Gärten, Wald, Obsthainen und Weinpflanzungen und dringen
zungenförmig an den Flußthälern in die
Vorkarpathen, Voralpen und den Bakonyer Wald ein. Die östliche
große oder niederungarische Tiefebene (Alföld oder
Pester Becken) wird im N. und O. von den Karpathen, im W. von den
Voralpen, im S. von den alpinen Vorhöhen und dem Balkan
umsäumt, erstreckt sich an der Donau von Budapest und an der
Theiß von Szatmar bis zum Strompaß von Orsova und
nimmt, einununterbrochenes Flachland bildend, im ganzen 96,910 qkm
(1760 QM.) ein. Ausgedehnte Sumpfstrecken, Torf und Moorgründe
an der Donau und Theiß, unabsehbare Sandflächen, hier
und da mit niedrigen Flugsandhügeln, wasser-, baum- und
schattenlose Heideflächen, unterbrochen von Grasangern und
fruchtbarem Ackerboden, weit auseinander liegende Meierhöfe
auf den Pußten (s. d.), wenige, aber weitläufige und
volkreiche Ortschaften bilden den Charakter der eigentlichen
Heidelandschaft. Der nördliche Landstrich wischen Donau und
Theiß führt den Namen Kecskemeter Heide; südlich
davon, in der sogen. Bacska, liegt das 169 m hohe Plateau von
Telecska und südöstlich an der Theißmündung
das Titler Plateau; ferner im NO. unterhalb des Theißbogens
der Nyir und südlich hiervon die Debrecziner Heide oder
Hortobagyer Pußta. Über 600 Flüsse und Bäche
durchkreuzen U. nach allen Richtungen und gehören mit Ausnahme
von Poprad und Dunajec, welche der Weichsel zufließen,
sämtlich zum Gebiet der Donau, die bei Theben das Land
betritt, sich bei Waitzen südwärts bis zur slawonischen
Grenze wendet und das ungarische Gebiet bei Orsova
verläßt. Sie nimmt rechts die Leitha, Raab, den
Sárviz, die Drau mit der Mur und die Save, links die March,
Waag, Neutra, Gran, Eipel, die mächtige Theiß, die Temes
und die Aluta auf. In die Theiß münden rechts der
Bodrog, Sajó mit dem Hernád und die Zagyva, links die
Szamos, die dreifache Körös und die Maros. Alle
Flüsse, insbesondere aber die Theiß mit ihren
Nebenflüssen, verursachen durch Überschwemmungen fast
jährlich bedeutenden Schaden; um diesen zu verhindern und zur
Erleichterung der Schiffahrt wurden seit 1771, besonders aber seit
1845, umfassende Regulierungen vorgenommen und zahlreiche
Kanäle erbaut, unter denen der Franzenskanal (zwischen der
Donau und Theiß), der Begakanal (zwischen der Bega und
Theiß), der Sarviz- oder Palatinkanal (zwischen
Stuhlweißenburg und Szegszard), der Albrechtskanal zur
Entsumpfung des Bodens im Baranyaer Komitat, der Kapos oder
Zichykanal im Tolnaer Komitat und der Siokanal (zwischen Plattensee
und Donau) die bedeutendsten sind. In den Karpathen finden sich
viele kleine Seen (Meeraugen), darunter in der Hohen Tatra allein
58 meist sehr romantisch 1260-1990 m ü. M. gelegene Seen.
Größere Seen in der Ebene sind der Plattensee, der
größte Südeuropas, und der Neusiedler See. Von den
zahlreichen Morästen und Sümpfen sind zu nennen: der mit
dem Neusiedler See in Verbindung stehende Hanság, der
Ecseder Sumpf bei Szatmár, der Sárrét am
Berettyó, der Alibunarer, Hoßzuréter Sumpf etc.
Die Sümpfe an der Theiß und Donau sind durch
Abzugskanäle meist trocken gelegt worden. Überhaupt ist
sowohl von seiten der Regierung als der einzelnen sehr vieles zur
Trockenlegung oder doch Einschränkung der Sümpfe
geschehen. Für die Theißregulierung allein, um welche
sich Graf Szechenyi große Verdienste erworben hat, wurden
seit 1845 mehr als 26 Mill. Guld. verwendet. Das Ackerland der
großen ungarischen Tiefebene besteht zumeist aus schwarzem
Thonboden mit mehr oder weniger Humus und ist in manchen Gegenden
auch ohne Dünger ebenso fruchtbar wie die zwischen hohen
Bergen liegenden lieblichen Thäler (z. B. das
äußerst romantische Waagthal). Dagegen gibt es aber auch
große unfruchtbare Sandflächen; in der westlichen Ebene
erstrecken sie sich nur von Raab und Komorn bis zum Komitat Zala;
in der östlichen Ebene jedoch bilden sie, von Waitzen
ausgehend, zwischen der Donau und Theiß bis nahe an den
Franzenskanal ein wahres Sandmeer.
[Klima.] Schon die geographische Lage Ungarns, noch mehr aber
die Gestalt seiner Oberfläche machen es zu einem klimatisch
milden Land. Mit Ausnahme des nach N. geöffneten Poprader
Thals ist es vor rauhen Nordwinden durch hohe Gebirge
geschützt; im S. aber öffnet es sich den warmen
Südwinden, deren oft heftigen Andrang die zahlreichen
Gewässer mäßigen. Am Fuß der hohen Karpathen
und des Königsbergs (in Gömör), in der Ärva,
Liptau und Zips reift selbst die Pflaume kaum, und oft bedeckt
schon im September Schnee den noch stehenden Hafer, während 60
km südlicher der edelste Wein gedeiht. Mitten im ehemaligen
Pannonien, das einem fortlaufenden Obst- und Weingarten gleicht,
reift in der rauhen Bakony auch die Traube nicht. In Syrmien
blüht oft schon im Februar der Haselstrauch, im April
überall das Obst, Anfang Mai Roggen und Gerste, in den ersten
Junitagen der Weinstock, und frisches Grün schmückt acht
Monate lang die Wälder, während weiter nach S. zu wieder
die rauhe Karpathengegend auftritt. Charakteristisch ist der starke
Temperaturwechsel, namentlich der Unterschied zwischen Tages und
Nachtwärme, so im Alföld, wo die Temperatur im Sommer des
Morgens nur 45° C. beträgt und mittags auf mehr als
30° steigt; noch größer aber ist der Unterschied der
von den Sonnenstrahlen erzeugten Bodenwärme; daher treten dort
auch häufig Wechselfieber und andre Krankheiten auf. Im
allgemeinen ist aber das Klima in U. gesund. Die mittlere
Jahrestemperatur bewegt sich zwischen +5,9° und +14° C. und
beträgt in Schemnitz 6°, Preßburg 9,6°, Budapest
11°, Klausenburg 9,12°, Semlin 11,6°, Fiume 14,1°.
Eine gewöhnliche Erscheinung ist im Alföld die Fata
Morgana, hier Delibab ("Mittagszauber") genannt.
Areal und Bevölkerung.
Das Areal von U. samt Nebenländern beträgt 322,940 qkm
(5865 QM.), wovon auf das eigentlich U. samt Siebenbürgen
280,387 qkm (5092 QM.), auf Fiume samt Gebiet 20 qkm (0,36 QM.) und
auf Kroatien und Slawonien 42,533 qkm (772 QM.) entfallen. Das
eigentliche U. wurde früher in administrativer Beziehung in
vier Kreise eingeteilt und zwar in den Kreis a) diesseit und b)
jenseit der Donau, c) diesseit und d) jenseit der Theiß. Seit
der 1876 erfolgten Einverleibung Siebenbürgens und der
Regelung der Munizipalgebiete jedoch teilt man U. in nachstehende
sieben Gebiete ein:
1001
Ungarn (Komitate, Bevölkerung).
A. Ungarn mit Siebenbürgen.
Gebiet und Komitat Areal QKil. Einwohner 1881
I. Am linken Donauufer
Árva 2077 81643
Bars 2673 142691
Gran 1123 72166
Hont 2650 116080
Liptau 2258 74758
Neograd 4355 191678
Neutra 5726 370099
Preßburg 4311 314173
Sohl 2730 102500
Trentschin 4620 244919
Turócz 1150 45933
Zusammen: 33674 1756640
II. Am rechten Donauufer:
Baranya 5133 293414
Eisenburg 5035 360590
Komorn 2944 151699
Ödenburg 3307 245787
Raab 1381 109493
Somogy 6531 307448
Tolna 3643 234643
Veszprim 4166 208487
Weißenburg 4156 209440
Wieselburg 1944 81370
Zala 5122 359984
Zusammen: 43363 2562355
III. Zwischen der Donau und Theiß
Bács-Bodrog 11079 638063
Csongrád 4314 228413
Heves 3802 208420
Jazygien etc. 5374 278443
Pest-Pilis etc. 12605 988532
Zusammen: 37173 2341871
IV. Am rechten Theißufer:
Abauj-Torna 3331 180344
Bereg 3724 153377
Borsod 3527 195980
Gömör und Kis-Hont 4275 169064
Sáros 3822 168013
Ung 3053 126707
Zentplin 6208 275175
Zips 3605 172881
Zusammen: 31546 1441541
V. Am linken Theißufer:
Békés 3558 229757
Bihar 10919 446777
Hajdu 3353 173329
Marmaros 0355 227436
Szabolcs 14917 214008
Szatmár 6491 29309
Szilágy 3671 171079
Ugocsa 1191 65377
Zusammen: 44456 1820855
VI. Längs der Flüsse Maros und Theiß
Arad 6443 303964
Csanád 1618 109011
Krassó-Szörény 9751 381304
Temes 7136 396045
Torontál 9495 530988
Zusammen: 34444 1721312
VII. Siebenbürgen:
Bistritz-Naszód 4014 95017
Csik 4493 110940
Fogaras 1875 84571
Großkokelb. 3116 132454
Háromszék 3556 125277
Hermannstadt 3314 141627
Hunyad 6932 248464
Klausenburg 5149 196307
Kleinkokelb. 1646 92214
Kronstadt 1797 83929
Maros-Torda 4324 158999
Szolnok-Doboka 5150 193677
Torda-Aranyos 3370 137031
Udvarhely 3418 105520
Unterweißenb. 3577 178021
Zusammen: 55731 2084048
Ungarn: 280387 13728622
B. Fiume samt Gebiet
C. Kroatien und Slawonien (mit ehem. Militärgrenze).
Komitate:
Lyka-Krbava 6211 174239
Modrus-Fiume 4879 203173
Agram 7211 419879
Warasdin 2521 229063
Belovar-Kreutz 5048 219529
Pozega 4942 166512
Virovititz 4851 183226
Syrmien 6870 296878
Zusammen: 42533 1892499
Länder der ungar. Krone: 322940 15642102
In Bezug auf die Bevölkerung nimmt U. unter den
europäischen Staaten die achte Stelle ein. Nach der letzten
Volkszählung (1880/81) betrug die Zivilbevölkerung
15,642,102 Seelen (gegen 15,417,324 Seelen im J. 1870). Die Zahl
der aktiven Soldaten und Honveds (Landwehr) belief sich auf 97,157
Mann, daher ergibt sich eine Gesamtbevölkerung von 15,739,259
Seelen. Von 1870 bis 1881 hat dieselbe nur um 1,44 Proz. zugenommen
und zwar zumeist nur im W. und in der Mitte des Landes. Bei den
frühern Erhebungen zählte man: 1850: 13,1, 1857: 13,7,
1869: 15,4 Mill. Einw. Ursachen dieser geringen Zunahme waren
anfangs die Nachwehen der Freiheitskriege und wiederholte
Choleraepidemien, zuletzt jedoch Seuchen, Mißwachs,
Auswanderung und enorme Sterblichkeit der Kinder (bis zu 55 Proz.).
Die Dichtigkeit der Bevölkerung ist eine mittlere, denn es
entfallen auf 1 qkm durchschnittlich 48 Einw. Am dichtesten
bevölkert sind die fruchtbaren und minder gebirgigen
Landstriche im W. und NW., am gleichmäßigsten das Innere
des Landes, am dünnsten der Nordosten, Osten und
Südosten. Von der Zivilbevölkerung entfallen auf die
beiden Geschlechter:
Männer Frauen
in Ungarn (samt Siebenbürgen) 6749646 6978976
- Fiume samt Gebiet 9598 11383
- Kroatien-Slawonien 589615 604800
- der ehemaligen Militärgrenze 354051 344033
Zusammen: 7702910 7939192
In U., wo auf je 1000 Einw. 10 Ehen, 45 Geburten und 37
Sterbefälle entfallen, gibt es 163 Städte, 1872
Märkte, 15,394 Dörfer und 4152 Pußten, wovon auf U.
allein (mit Siebenbürgen) 143 Städte, 1822 Märkte,
10,873 Dörfer und 3917 Pußten entfallen. Die
volkreichsten Städte (mit über 20,000 Einw.) sind:
Budapest, Szegedin, Maria-Theresiopel, Debreczin,
Hódmezö-Vásárhely, Preßburg,
Kecskemét, Arad, Temesvár, Großwardein, Mako,
Klausenburg, Kronstadt, Szentes, Fünfkirchen, Agram, Kaschau,
Stuhlweißenburg, Czegléd, Zombor, Miskolcz,
Nyiregyháza, Kiskun-Félegyháza, Ödenburg,
Nagy-Körös, Werschetz, Jászberény, Neusatz,
Mezötur, Zenta, Raab und Fiume. Die schönsten Dörfer
sind jene der Deutschen, der Ungarn und Slowaken; am schlechtesten
wohnt der Rumäne und Ruthene.
Rationalität. Religionsverhältnisse. Unter den
verschiedenen Nationalitäten nehmen die Ungarn (Magyaren, s.
d.) als die herrschende Nation die erste Stelle ein. Das
Übergewicht verdanken sie nicht nur ihrer größern
Anzahl (45 Proz.: 6,445,487 Einw.), sondern auch dem Umstand,
daß sie die Mitte und zwar den fruchtbarsten Teil des Landes
in ungeteilter Masse bewohnen. Der magyarische Volksstamm wohnt
dicht zwischen der Donau und Theiß im Alföld (70,9 Proz.
der dortigen Bevölkerung), am rechten Donauufer und in den
übrigen ebenen Landstrichen im eigentlichen U.; in den
siebenbürgischen Komitaten dagegen bewohnen die Magyaren (dort
Szekler genannt) die höchst gelegenen Teile in den
östlichen Komitaten. Am schwächsten sind sie am linken
Donauufer (25,7 Proz.), im Theiß-Maroswinkel (15,6 Proz.) und
in Kroatien-Slawonien (3,9 Proz.) vertreten. Von den übrigen
Nationalitäten sind die Slawen am zahlreichsten. Von den
Serbokroaten (2,352,339 Einw.) wohnen die Serben zur Hälfte im
SO. von U., zur Hälfte in Kroatien-Slawonien und der
ehemaligen Militärgrenze, die Kroaten aber meist in Kroatien;
die Slowaken (1,864,529 Einw.) bilden eine kompakte
Bevölkerung im N. und NW., mit einzelnen Ausläufern bis
tief nach dem Süden (Békés und Csanád);
in den östlichen Karpathen von Marmaros bis nach Sáros
und bis in die Zips haben sich die Ruthenen (356,062 Einw.)
niedergelassen. Die Rumänen (2,405,085 Einw.), gleichfalls ein
kompakter Volksstamm, bewohnen den Osten, Nordosten und
Siebenbürgen. Die Deutschen (1,953,911 Einw.) sind fast
über das ganze Land zerstreut und meist in den westlichen
Komitaten unterhalb der Donau (Wieselburg, Ödenburg,
Eisenburg), in den südlichen Landstrichen (Tolna, Baranya,
Bács-Bodrog, Torontál, Temes) sowie im südlichen
Siebenbürgen (Hermannstadt, Groß-Kokelburg, Kronstadt)
und in den Komitaten Zips und Bistritz-Naszód ansässig.
In den Komitaten Wieselburg, Ödenburg, Eisen-
1002
Ungarn (Nationalcharakter, Religionsverhältnisse, geistige
Kultur).
burg, zum Teil auch in Preßburg, haben sie sich schon seit
Karl d. Gr. angesiedelt; in die übrigen Landstriche sind
deutsche Kolonisten teils in ganzen Stämmen, zuerst unter
Geisa II., aus Köln und Flandern nach der Zips und in die
Bergstädte (s. Gründner, Krikerhäuer), teils in
kleinern Scharen aus Schwaben und Franken etc. (meist im 17. und
18. Jahrh.) eingewandert. Der Rest der Bevölkerung Ungarns
(264,639 Einw.) sind Albanesen, Armenier, Bulgaren, Griechen,
Italiener und Makedowalachen oder Zinzaren, welche im SO. und im S.
wohnen; die Armenier und Griechen leben meist in
Handelsstädten. Die Zigeuner (75,911, Magyaren und
Rumänen) sind im Land zerstreut und halten sich meist in der
Nähe kleinerer Orte, am zahlreichsten im Gömörer
Komitat und in Siebenbürgen, auf. Unter den mannigfaltigen
Nationaltrachten ist die ungarische die schönste. Sie besteht
aus eng anliegenden Beinkleidern, verschnürtem Wams oder
Attila (Rock), einer Pelzmütze oder einem Kalpak. Über
der Schulter hängt ein Pelz oder Dolmán. Als
Fußbekleidung dienen hohe, oft mit Schnüren verzierte
Stiefel (Zischmen) oder kurze Schnürstiefel (Topanken). Der
slawische Bauer trägt gewöhnlich ein weißes Kamisol
von grobem Tuch, blautuchene Beinkleider und große, hohe
Stiefel, im Sommer ein kurzes, mit einem Gürtel befestigtes
Hemd, ein leinenes Unterbeinkleid (Gatye) und einen großen
Hut. Die Alltagstracht des ungarischen Landmanns ist hier und da
von jener des Slawen nicht wesentlich verschieden. Als
Fußbekleidung trägt der Slawe Bundschuhe (krpec), der
Gebirgsbewohner hohe Filzstiefel. Bei kaltem Wetter wirft der
slawische Bauer ein mantelartiges Kleid aus grobem weißen
Tuch (szurowicza) um, während der Ungar sich in ein
grobtuchenes braunes Oberkleid (guba) oder in einen Schafpelz
(ungar. ködmön, slaw. kozuch) hüllt.
Hauptstücke der Kleidung sind noch die Pelzmütze und ein
großer, weiter, mit Ziegenfellen ausgeschlagener Schafpelz
(juhászbunda). Das weibliche Geschlecht kleidet sich fast
allgemein in Rock und Jacke von blauem oder grünem Halbtuch,
die ungarischen Mädchen tragen überdies blaue, bis unter
die Kniee reichende, reich mit Schnüren besetzte Pelze. Eine
beliebte Speise des Karpathenbauers ist Hirsebrei (kasa), der
Ungarn Gulyás (mit Zwiebeln und Paprika gewürztes, nach
Hirtenweise gekochtes Fleisch). Der Ungar ist meist
mittelgroß, muskulös, ebenmäßig gebaut, hat
eine scharf geschnittene Gesichtsbildung, ein dunkles, feuriges
Auge und schwarzes Haar. Die Frauen entwickeln sich frühzeitig
und haben regelmäßige Züge. Der Ungar ist
gutmütig und sehr gastfreundlich, besitzt ein feuriges, leicht
erregbares Temperament, viel rednerische Begabung und große
Vaterlandsliebe, ist als Soldat äußerst tapfer und dient
am liebsten zu Pferd (als Husar). Fröhlichkeit und Liebe
für Musik und Tanz sind das Erbteil fast aller ungarischen
Völkerschaften. Sehr schön und ungemein charakteristisch
sind die ungarischen Nationaltänze (Csárdás) und
Volksweisen, erstere bald sehr ernst, bald ungemein heiter und
lebhaft (Lassu und Friss), letztere meist düster und
schwermütig. Eigentümlich sind die Nationalgesänge
der Slowaken und Serben. Die Magyaren beschäftigen sich meist
mit Ackerbau, Viehzucht und Fischfang oder sind selbständige
Handwerker. Die Slowaken treiben Ackerbau oder leben als
nomadisierende Hirten, Arbeiter in den Berg- und Hüttenwerken,
Flößer, Fuhrleute, Hausierer oder Drahtbinder. Als
sogen. Rastelbinder durchziehen sie ganz Europa, ja selbst Amerika.
Die Ruthenen liegen dem Viehhandel ob, sind Fuhrleute oder handeln
mit Eisenwaren. Die Slawonier und Kroaten treiben Ackerbau und
Handel, die Deutschen Gewerbe, Handel, Landwirtschaft, Bergbau etc.
Die Armenier sind meist Kaufleute, Pachter und Viehhändler;
die Griechen und Juden beschäftigen sich fast
ausschließlich mit Handel; die Zigeuner sind Musikanten und
Schmiede. Der Religion nach sind in U. die Römisch-Katholiken
überwiegend (7,849,692) und haben am rechten Donauufer sowie
im NW. die absolute Majorität; die Kroaten sind fast
ausschließlich römisch-katholisch. Griechisch-katholisch
sind Ruthenen und Rumänen (1,497,268), griechisch-orientalisch
die Serben und ein Teil der Rumänen (2,434,890). Der
evangelischen Kirche Augsburgischer Konfession gehören meist
Slowaken und Deutsche im N. und W. an (1,122,849) sowie die
siebenbürgischen Sachsen; die Evangelischen Helvetischer
Konfession (2,031,803) haben ihren Hauptsitz in vorzugsweise
ungarischen Gebieten; die Unitarier (55,792) leben fast nur in
Siebenbürgen. Die Juden endlich (638,314) sind mit Ausnahme
des Südwestens und Südostens überall verbreitet und
bewohnen am dichtesten die an Galizien grenzenden
nordöstlichen Komitate sowie die Handelsplätze. Bis 1848
waren sie aus den Berg- und einigen königlichen
Freistädten ausgeschlossen, genießen aber seit 1868
volle Gleichberechtigung.
Bildung und Unterricht.
Die geistige Kultur des Landes ist in erfreulichem Fortschritt
begriffen, und die Volksbildung der Deutschen und Ungarn steht
jener in Österreich nicht nach. In U. (samt Siebenbürgen)
ohne Kroatien-Slawonien gab es im J. 1887 unter 13,749,603 Einw.
2,377,558 schulpflichtige Kinder (17,29 Proz.), von diesen
besuchten thatsächlich 1,929,377 die Schule (gegen 1,152,115
im J. 1869). Die Anzahl der Volksschulen betrug 16,538 (gegen
13,798 im J. 1869), jene der Lehrer 24,148 (gegen 17,792 im J.
1869). Letztere werden in 71 Lehrer- und
Lehrerinnen-Präparandien (1869 bestanden nur 46)
herangebildet, an denen 683 Professoren thätig sind (1869 nur
271). Die Kinderbewahranstalten, deren man 532 (gegen 215 im J.
1876) zählte, besuchten 49,051 Kinder (1876 nur 18,624). Von
den bestehenden 179 Mittelschulen sind 151 Gymnasien (darunter 89
Obergymnasien) mit 2356 Professoren und 35,803 Schülern und 28
Realschulen (darunter 21 Oberrealschulen) mit 557 Professoren und
6816 Schülern. Theologische Lehranstalten gibt es 53,
Rechtsakademien 11. U. besitzt gegenwärtig 2
Universitäten und zwar in Budapest mit 173 Professoren und
3679 Hörern und in Klausenburg mit 65 Professoren und 535
Hörern (eine dritte Universität soll demnächst
errichtet werden). Außerdem hat auch Kroatien-Slawonien eine
Universität in Agram. In Budapest befindet sich auch das
königliche Josephs-Polytechnikum, mit 47 Professoren und
über 600 Hörern sowie ein Rabbinerseminar. Besondere
Bildungsanstalten sind: das Ludoviceum (militärische
Hochschule für Honvédoffiziere), die Landestheater- und
Musikakademie, die Meisterschulen für Malerei und Bildhauerei,
die Landes-Musterzeichenschule samt dem Zeichenlehrerseminar, die
Kunstgewerbeschule und die Handelsakademie in Budapest; ferner die
Berg- und Forstakademie in Schemnitz, die nautische Akademie in
Fiume, die landwirtschaftliche Akademie in Ungarisch- Altenburg, 6
Hebammenschulen sowie mehrere Handels-, landwirtschaftliche,
Ackerbau-, Weinbau-, Berg-, Kunstschnitzerei- und
Hausindustrieschulen in verschiedenen Orten. An philanthropischen
Anstal-
Ungarn (Ackerbau und Viehzucht).
1003
ten bestehen 3 Taubstummenanstalten, eine Blindenanstalt, eine
Idiotenanstalt, 67 Waisen- und Rettungshäuser etc. Unter den
wissenschaftlichen und Kunstinstituten sind zu erwähnen: die
1830 errichtete ungarische Akademie der Wissenschaften, die
Kisfaludy-, die Petösi-, die Geographische, die Geologische
und die Historische Gesellschaft, jene der Naturforscher und
Ärzte, das geologische und das meteorologische Institut, das
königlich ungarische statistische Landesbüreau und das
Budapester statistische Büreau, das Nationalmuseum mit seinen
Sammlungen und Galerien, das Landesgewerbemuseum, das Handelsmuseum
(im Industriepalast), das Landesarchiv, die
Landesgemäldegalerie, die historische Porträtgalerie, der
Landesrat für bildende Kunst, das Künstlerhaus und die
Landeskommission zur Erhaltung der Baudenkmäler (sämtlich
in Budapest); ferner das Bruckenthal-Museum in Hermannstadt, das
städtische Museum in Preßburg, das südungarische
Museum in Temesvar, das kroatisch-slawonische Nationalmuseum in
Agram, die Museen in Deva, Klausenburg, Maros Vasarhely etc. und
zahlreiche wissenschaftliche Vereine, Sammlungen, Bibliotheken und
Archive in fast allen, selbst in kleinern Städten. Unter den
Theatern steht obenan das ungarische Nationaltheater und die
königliche Oper in Budapest; ferner bestehen daselbst noch
vier ungarische Theater (Volks-, Festungs- und zwei Sommertheater)
und ein deutsches Theater und außerdem viele ständige
Theater in den größern Provinzstädten Arad,
Hermannstadt, Kaschau, Klausenburg, Ödenburg, Preßburg,
Raab, Stuhlweißenburg, Szegedin, Temesvar etc. (In
Hermannstadt, Ödenburg, Preßburg und Temesvar wird auch
deutsch gespielt.) In U. erscheinen 760 periodische, darunter 94
politische, Zeitschriften (525 ungarische, 133 deutsche, 34
kroatische, 11 slawische, 11 serbische, 15 rumänische
etc.).
Land- und Forstwirtschaft.
U., dessen agrarische Verhältnisse durch verschiedene
Grundentlastungsgesetze in den Jahren 1847/48, 1853, 1868, 1871 und
1873 geregelt wurden, ist vorzugsweise ein Agrikulturstaat. Der
Grund ist zumeist entweder Eigentum von Großgrundbesitzern
oder aber kleiner bäuerlicher Besitz. In U. und
Siebenbürgen ist das Pachtsystem oder die Verwaltung durch
Ökonomiebeamte sehr entwickelt, in den Nebenländern fast
ganz fremd. In neuerer Zeit haben sowohl Staat als auch
Herrschaften vielfach das englische "Farmersystem" eingeführt.
Auf großen Gütern wird die Landwirtschaft rationell
betrieben, weniger von den Bauern, bei welchen insbesondere die
"Dreifelderwirtschaft" gebräuchlich ist. Seit Aufhebung des
Unterthanenverbandes wird der Mangel an ländlichen Arbeitern
stets fühlbarer, und dies fördert auf großen
Gütern die Anwendung von Maschinen. Zur Hebung der
Landwirtschaft hat der Landes-Agrikulturverein, von den Komitats-
und vielen sonstigen landwirtschaftlichen Vereinen
unterstützt, Bedeutendes beigetragen. Für einzelne Zweige
sind auch Wanderlehrer bestellt. Die produktive Bodenfläche
des ganzen Landes beträgt 53,3 Mill. Katastraljoch
(früher nur 47,1) oder 30,7 Mill. Hektar (95,1 Proz.); hiervon
entfallen auf Ackerland 22,4, auf Weinland 0,7, auf Gärten
0,7, auf Wiesen 6,0, auf Weide 7,5, auf Röhricht 0,1 und auf
Waldland 15,8 Mill. Katastraljoch. Unproduktiv sind 3,1 Mill.
Katastraljoch. U., wo seit 1877 der bestehende, vielfach
mangelhafte provisorische Kataster reguliert wurde, ist ein so
reiches Getreideland, daß es nicht nur sein eignes
Bedürfnis an Cerealien vollkommen deckt, sondern auch dem
Ausland bedeutende Quantitäten ablassen kann. Man baut Weizen,
Roggen, Gerste, Hafer, Mais, Hirse, Heidekorn, ferner Kartoffeln,
Spargel, Kohl, Rüben, Runkelrüben zur Zuckerfabrikation,
Mohn, Wasser- und Zuckermelonen, Kürbisse, Gurken.
Hülsenfrüchte aller Art. Obstkultur wird in vielen
Gegenden fleißig betrieben; das Ödenburger Obst bildet
gedörrt undeingemacht einen bedeutenden Handelsartikel. Im W.
gibt es ganze Kastanien-, im S., wo auch Feigen und Mandeln gezogen
werden, Pflaumenwälder. Besonders zahlreich sind
Walnußbäume. Hinsichtlich des Weinbaues, eines der
wichtigsten Produktionszweige Ungarns, nimmt es nach Frankreich die
erste Stelle in Europa ein (s. Ungarweine). Der Ertrag beläuft
sich auf ca. 9, in guten Jahren auf 16 Mill. hl. Die Pflege des
Maulbeerbaums zur Seidenzucht, für welche in Szegszard ein
königliches Seidenbauinspektorat besteht (in Pancsova und
Neusatzstaatliche Seiden- und Lehrspinnereien), wird besonders in
Ödenburg, Eisenburg, Tolna, Bacs-Bodrog und in der
frühern Militärgrenze betrieben. Von Manufaktur- und
Handelspflanzen baut man Hanf, besonders in Bacs-Bodrog, Flachs, am
meisten in der Zips und in Saros, Safflor, Waid, Wau, Krapp und
andre Farbepflanzen, etwas Safran, von Ölgewächsen
außer Lein besonders Raps und Rübsen; ferner Hopfen,
einige Gewürzpflanzen, wie Kümmel, Fenchel, Senf, Anis,
roten türkischen Pfeffer (Paprika) und Süßholz. Der
ungarische Tabak ist der Menge und Güte nach ein
Haupterzeugnis, dessen jährlicher Ertrag 1/2 - 2/3 Mill. metr.
Ztr. beträgt. Die berühmtesten Tabaksorten liefern die
Orte: Vitnyed (Komitat Ödenburg), Veg (Komorn), Verpelet und
Debrö (Heves), Glogovacz (Arad), Pereszleny (Hont), Nagysalu
(Eisenburg), Csetnek (Gömör), Szendrö (Borsod) etc.
In den ausgedehnten Waldungen gewinnt man große
Quantitäten Eicheln zur Schweinemast, Galläpfel,
Knoppern, Rinden, Harze, Kohlen, Pottasche etc. In den ebenen
holzarmen Gegenden brennt man Schilf, Rohr, Stroh und getrockneten
Kuhmist. Die große Ausdehnung der Wiesen und Weiden,
besonders im N., machen U. für die Viehzucht be-sonders
geeignet. In letzter Zeit hat sich die seit Jahrhunderten
hervorragende Pferdezucht bedeutend gehoben, wozu die
berühmten Staatsgestüte zu Mezöhegyes (im Csanader),
Kisber und Babolna (Komorner Komitat) und Fogaras (in
Siebenbürgen) mit 2800 arabischen und englischen Pferden, 4
Hengstedepots und 858 Beschälstationen mit 3968 Pferden im
Gesamtwert von 16,8 Mill. Gulden, über 100 große
Privatgestüte sowie die Wettrennen in Budapest,
Preßburg, Ödenburg, Kaschau, Arad, Debreczin und
Klausenburg mit Staatspreisen und Staatsprämien für
Pferdezüchter nicht wenig beitragen. Die meiste Pferdezucht
findet man im Landstrich von Bekes über Csanad und Torontal
bis an die südliche Grenze, im Komitat Bacs-Bodrog, in
Syrmien, im ehemaligen Haidukendistrikt und in Siebenbürgen.
Die Gesamtzahl der Pferde betrug 1881: 1,8 Mill. (darunter 96,600
Hengste). Das ungarische Hornvieh (weißhaarig, mit langen,
gekrümmten Hörnern) ist in Bezug auf Arbeitskraft,
Schnelligkeit, Mastfähigkeit, Fleischreichtum vorzüglich;
dagegen ist die Ergiebigkeit und Güte der Milch geringer. Am
stärksten ist die Rindviehzucht in den Komitaten am rechten
Donauufer und in den nördlichen wiesenreichen Komitaten;
dagegen sind die früher so reichen Landstriche zwischen Donau
und Theiß jetzt vieharm. In den Thälern und auf
Gebirgsabhängen findet sich das kleinhörnige und
kurzfüßige Rind, im Komitat So-
1004
Ungarn (Forstwesen, Bergbau, Industrie).
mogy und in Siebenbürgen auch der Büffel. 1881 betrug
der Hornviehbestand 4,6 Mill. Stück (darunter 39,000 Stiere
und 93,000 Büffel). U. gehört zu den an Schafen reichsten
Ländern Europas; es wird nicht nur das grobwollige Zigaiaschaf
im Tiefland und das krauswollige im Gebirge gezüchtet, sondern
seit mehr als 100 Jahren auch die edle Schafzucht betrieben (1881:
9,2 Mill. Schafe, darunter 6 Mill. veredelte). Der jährliche
Export an Wolle beträgt über 1¼ Mill. metr. Ztr.
Die Schweinezucht ist ausgedehnter als irgendwo in Mitteleuropa, am
bedeutendsten in der ehemaligen kroatischen Militärgrenze, in
den Komitaten Csanád, Zala, Somogy, Tolna, Baranya,
Békés, Bihar, in Siebenbürgen und in einigen
kroatisch-slawonischen Komitaten (Schweine 4½ Mill.
Stück, jährliche Ausfuhr fast 700,000 Stück). Die
Geflügelzucht (Hühner, Gänse, Enten,
Truthühner) ist sehr verbreitet; an Federn werden gegen 15,000
metr. Ztr. nach Deutschland, Holland und in die Schweiz
ausgeführt. Groß ist der Reichtum an Fischen, besonders
in der Theiß, Donau und den Seen. Man fängt
vorzüglich Karpfen, Barben, Hausen, Störe, Lachsforellen,
den Fogas etc. U. hat noch die reichsten Jagdreviere. Auf den
Felsen der Tátra hausen selbst Gemsen, in den Wäldern
der Marmaros Bären, und Wölfe werden in Menge erlegt. Die
Waldungen sind reich an Rotwild, das auch gehegt wird. Ebenso gibt
es schöne Fasanerien. Unzählbare Scharen von Vögeln,
namentlich Sumpf- und Wasservögel, bevölkern die
sumpfigen Schilfwälder längs der Donauufer. Trappen
finden sich in Menge in den Ebenen, Adler in den Felsgebirgen. In
Bezug auf Holzreichtum nimmt U. die vierte Stelle in Europa ein.
Die Waldbestände (im N. meist Fichten und Tannen, im O.
daneben auch viel Buchen, im Tiefland nur Akazien, Pappeln,
Götterbäume und wenig Eichen, im S. vorzugsweise Eichen
und Buchen) sind meist ärarische oder Eigentum der
Herrschaften und Städte. Die Staatswälder werden in
neuster Zeit sorgfältig kultiviert, im kleinern Waldbesitz
dagegen wird viel Raubwirtschaft getrieben. Um die Hebung des
Forstwesens, zu dessen Regelung ein neues Forstgesetz erlassen
wurde, hat sich der Ungarische Landesforstverein verdient gemacht.
Die Ausbildung der Forstleute erfolgt an der Schemnitzer Montan-
und Forstakademie.
Bergbau und Industrie.
Hinsichtlich seiner mineralischen Schätze gehört U. zu
den reichsten Ländern Europas: es besitzt unerschöpfliche
Salz-, Eisen- und Kohlenlager und ungemein reiche Kupfer-, Silber-,
Gold- und andre Erzgänge. In Bezug auf edle Metalle nimmt es
nach Rußland die nächste Stelle ein. Hauptsitz der
Goldproduktion ist Siebenbürgen, dessen Bergwerke
(Abrudbánya, Böröspatak, Almás,
Offenbánya etc.) schon den Römern bekannt waren. Im
eigentlichen U. sind reiche Gold- und Silberbergwerke in Kremnitz,
Schemnitz, Nagy- und Felsöbánya etc.; außerdem
wird in den Flüssen Aranyos, Maros, Szamos etc. Fluß-
und Waschgold, Silber in großer Menge zu Schmöllnitz und
Oravicza gewonnen. Die reichsten und ältesten Kupferbergwerke,
deren Ertrag sich jedoch mindert, sind in Margitfalva,
Szepes-Igló, Schmöllnitz, Libethen, Nagybánya
etc. in der Zips. Reiche Eisenerze finden sich in den Komitaten
Zips, Gömör und Abauj-Torna. Das meiste Blei wird im
Schemnitzer Bergdistrikt, viel Nickel und Kobalt in Dobschau und
Libethen, Antimon und Quecksilber bei Rosenau, Magurka und
Schmöllnitz gewonnen. Von Edelsteinen verdient eine besondere
Erwähnung der Edelopal, dessen einzige Heimat U.
(Staats-Opalgruben zu Vörösvágás im
Sároser und Nagy-Mihály im Zempliner Komitat) ist.
Der größte dort gefundene Opal (im kaiserlichen
Naturalienkabinett zu Wien) wird auf 2 Mill. Gulden geschätzt.
Außerdem findet man Chalcedone, Granate, Hyacinthe,
Amethyste, Karneole, Achate, Bergkristalle (Marmaroser Diamanten),
Turmalin, Quarze und Quarzsand, Flußspat, Hornstein,
Töpferthon und treffliche Porzellanerde an vielen Orten,
Dachschiefer im Borsoder Komitat und in Marienthal bei
Preßburg. Die besten Mühlsteine liefert Geletnek im
Barser Komitat. Marmor wird in den Komitaten Zips, Komorn, Baranya,
Veszprim, Abauj-Torna, Liptau etc. gebrochen. Außerdem
gewinnt man Granit, Gneis, Porphyr, Basalt, Sand- und Kalkstein,
Kreide, Gips, Talk, Serpentin, Asbest und Walkererde. Braunkohlen
finden sich in zahlreichen und mächtigen Lagern
hauptsächlich im Brennberg bei Ödenburg; Steinkohlen bei
Fünfkirchen, in Anina-Steierdorf, Szekul und in Reschitza im
Krasso-Szörényer Komitat, im Schylthal, in
Siebenbürgen etc. Die ergiebigsten Salzbergwerke sind zu
Szlatina, Rónaszek und Sugatag in der Marmaros sowie zu
Deésakna, Torda, Parajd, Maros-Ujvar und Vizakna in
Siebenbürgen. In Sóvár wird nur Sudsalz erzeugt.
Die Salzproduktion, die in U. als Staatsmonopol betrieben wird,
belief sich 1887 auf 1,598,983 metr. Ztr. Salpeter und Pottasche
finden sich an vielen Orten im natürlichen Zustand, am meisten
zwischen der Theiß und dem Berettyó. Alaunstein
erzeugt man bei Nuczaly im Bereger Komitat. Torf wird in
Sumpfgegenden, besonders im Hanság, aber auch in der Zips
gestochen. Bergöl gibt es in der Marmaros, im Komitat Bihar,
in Siebenbürgen, Kroatien etc., jedoch nur in geringer Menge.
Bernstein findet sich auf der Magura in der Zips. Die Produktion
der Bergwerke und Hütten in den Ländern der ungarischen
Krone betrug 1887:
Menge Wert
Gold . . . 1862 kg 2597377 Guld.
Silber . . 17665 - 1588184 "
Kupfer . . 5394 metr. Ztr. 184370 "
Blei . . . 17792 " " 220384 "
Roheisen . 1927532 " " 6563599 "
Steinkohle . 7864081 " " 3788041 "
Braunkohle . 17234396 " " 4998150 "
dazu Antimon, Nickel und Kobalt, Bleiglätte in
geringern Mengen. Der Gesamtwert der Montanprodukte Ungarns
repräsentierte 1887 einen Wert von 21 Mill. Guld., jener der
Salzproduktion von 14 Mill. Guld. Mineralquellen zählt man in
U. über 900, darunter berühmte Thermen und
Mineralwässer; hervorzuheben sind außer den unter
"Karpathen" (S. 558) bereits angeführten Kurorten noch die
Schwefelquellen in Hárkány (Komitat Baranya),
Tapolcza (Zala), Töplitz (Kroatien), Warasdin, die Thermen in
Krapina (Kroatien) und die Jodquellen in Lippik (Slawonien). Die
Industrie Ungarns deckt bei allem Überfluß an Rohstoffen
noch nicht den inländischen Bedarf, weil die
Gewerbthätigkeit sich früher meist auf die
gewöhnlichen Lebensbedürfnisse beschränkte und das
Fabrikwesen sich erst seit kurzem eines Aufschwungs erfreut. In
Metallen arbeiten zahlreiche Eisen- und Stahlhämmer,
Eisengießereien (Budapest, Krompach, Rhonitz,
Salgó-Tarján, Munkács, Anina-Steierdorf,
Resitza und Dernö), Blech- und Drahtwerke, Armaturfabriken
etc.; den besten Stahl liefert Diós-Györ (Borsoder
Komitat). Auch an Kupferschmieden, Gold- und Silberarbeitern ist
kein Mangel. Die Maschinenfabrikation ist besonders in Budapest
ent-
l005
Ungarn (Handel und Verkehr).
wickelt, wo es zahlreiche große Etablissements gibt. Von
beträchtlicher Ausdehnung ist die Töpferei; man fertigt
schönes Fayencegeschirr; Schemnitz, Kremnitz, Debreczin
liefern irdene Pfeifenköpfe; große Porzellan- und
Majolikafabriken bestehen in Budapest, Fünfkirchen, Herend.
Etwa 70 Glashütten (meist in Oberungarn) erzeugen geringere
und feinere Glaswaren. Die chemische Industrie liefert vorzugsweise
Salpeter, Alaun, künstliche Farben, Soda, Pottasche,
Stearinkerzen (Budapest und Hermannstadt), Glycerin, Seife,
Zündwaren, Stärke, Leim, Tinte, Siegellack, Parfüme,
Lacke, Teerprodukte, Schwefelsäure. Von besonderer Wichtigkeit
sind die großen Petroleumraffinerien in Fiume,
Siebenbürgen und Südungarn (Oravicza, Orsova). Der
Waldreichtum des Landes hat überall eine lebhafte
Holzindustrie hervorgerufen. Bauhölzer werden
fabrikmäßig, Hausgeräte von der sehr ausgebreiteten
Hausindustrie geliefert, welche auch Korbflechterei und in neuester
Zeit auch Schnitzerei betreibt. Besonders entwickelt ist die
Wagenfabrikation, ebenso auch Tischlerei, Stroh- und Rohrflechterei
und der Schiffbau. Unter den Handwerkern zeichnen sich die
Zischmen- (Stiefel aus Korduan) und Schnürmacher,
Kürschner, Riemer und Gerber aus. Spinnerei und Weberei sind
im N. Hauptgegenstand der Hausindustrie; grobes Wolltuch erzeugen
unzählige Tuchmacher, feinere Tuche einige größere
Fabriken; Erzeugnisse der Textilindustrie sind ferner: grobe
Decken, Teppiche, Halinatücher für sogen. Halinas
(Bauernmäntel) etc. Bedeutend ist die Lederfabrikation. Papier
liefern über 70 Mühlen und einige große Fabriken
(die größte in Fiume). Von größter Bedeutung
ist die Mühlenindustrie, deren Mittelpunkt Budapest ist. Im
ganzen Land gibt es über 25,000 Mühlen, darunter 500
Dampf- und Kunstmühlen. Die Rübenzuckerfabrikation hat
abgenommen, gegenwärtig bestehen in U. bloß 14 Fabriken
(1871: 26), neue sind jedoch im Entstehen. Nagy-Surány und
Diószeg (bei Neutra) verarbeiten jährlich 308,000, bez.
454,000 metr. Ztr. Rüben. Von Wichtigkeit sind zahlreiche
große Spiritusfabriken (94), Branntweinbrennereien (95,366)
mit einer jährlichen Gesamtproduktion (1887) von 90 Mill.
Hektolitergraden, Rosoglio- und Likörfabriken und die
Bierbrauereien (110) mit einer jährlichen Produktion von
631,098 hl Bier, die größten in Steinbruch bei Budapest.
Die Tabaksfabrikation ist Staatsmonopol.
Handel und Verkehr.
Der Handel, sowohl im Innern als nach außen, ist sehr
lebhaft. Letzterer erfolgt von Fiume (s. d.) aus und den
übrigen kroatisch-ungarischen Häfen an dem Adriatischen
Meer, ferner auf der Donau und mittels der Eisenbahnen.
Hauptgegenstände der Ausfuhr sind landwirtschaftliche
Produkte, Hilfsstoffe und Halbfabrikate, namentlich: Getreide,
Mehl, Schweine, Schafwolle, Bau- und Werkholz, Wein, Weintrauben,
Obst, Spirituosen, Kleidungsstücke, Putz- und Modewaren,
Leder-, Eisen- und Zeugwaren, Möbel, Hausgeräte etc., und
bei der Einfuhr: Industrieartikel, Kleider, Putz- und Seidenwaren,
Kurz- und Schmuckwaren, Eisen- und andre Fabrikate, Leder und
Lederwaren, Kolonialartikel, Tabaksfabrikate etc. Die
volkswirtschaftlichen Interessen Ungarns weichen mehrfach von denen
der cisleithanischen Länder ab. U. ist als Agrikulturstaat
naturgemäß für den Freihandel gestimmt;
Österreich dagegen möchte seine bedeutende Industrie
durch Zölle schützen. Hohe Schutzzölle hätten
für U. nur dann einen Zweck, wenn es ein eignes Zollgebiet
bilden und dadurch seine eigne Industrie schützen könnte.
Die Handelspolitik Österreich-Ungarns verteuert für
letzteres jene Fabrikate, die es importiert, und beschränkt
den Export seiner Rohprodukte. Deshalb sucht U. sich auch in
volkswirtschaftlicher Beziehung, in Bezug auf den Handel, Verkehr
und Kredit von Österreich zu emanzipieren und hat insbesondere
die Entwickelung der eignen Industriezweige in letzter Zeit durch
Errichtung neuer Unterrichtsanstalten, Museen, Gewerbeschulen und
Lehrwerkstätten sowie durch Gewährung von
Steuerfreiheiten und sonstigen staatlichen Begünstigungen zu
fördern getrachtet. Die ersten Handelsplätze sind:
Budapest, Arad, Debreczin, Kaschau, Raab, Temesvar, Klausenburg,
Kronstadt, Hermannstadt, Sissek, Essek etc. Bei dem Mangel guter
Landstraßen in Mittelungarn haben die Eisenbahnen und
Flüsse eine erhöhte Bedeutung; die Donau wird ganz, Drau,
Save, Temes, Theiß werden teilweiset mit Dampfschiffen
befahren. Seit 1867 wurde der Eisenbahnbau sehr eifrig fortgesetzt,
und jetzt sind Bahnen nach allen Richtungen hin im Betrieb, wovon
infolge der bereits durchgeführten Verstaatlichung, mit
Ausnahme der Österreichisch-Ungarischen Staatsbahn, der
Südbahn u. der Kaschau-Oderberger Bahnlinien sowie außer
einigen kleinern Lokal- und Vizinalbahnen, mehr als die Hälfte
(1888: 5184km) Staatseigentum ist. Die Hauptlinien sind: die
ungarischen Staatsbahnen (von Budapest nach Bruck, Ruttka, Kaschau,
Predeal, Arad-Tövis, Semlin-Belgrad, Fünfkirchen, sowie
die Linien Stuhlweißenburg-Graz, die Alföld-Fiumaner und
zahlreiche andre Nebenlinien), die Kaschau-Oderberger Bahn, die
Österreichisch-Ungarische Staatsbahn (Wien-Budapest-Orsova,
Temesvar-Bazias, Preßburg-Sillein, Trentschin-Vlarapaß
etc.), die Südbahn (Wiener-Neustadt-Kanizsa-Barcs,
Budapest-Pragerhof, Komorn -Stuhlweißenburg,
Steinbrück-Agram-Sissek etc.), die Arad-Csanáder
Bahnen, die Arad-Temesvárer Bahn, die Nordostbahn
(Szerencs-Marmaros-Sziget, Debreczin- Királyháza,
Nyiregyháza-Ungvár, Sátoralja-Ujhely-Kaschau
etc.), die Raab-Ödenburg-Ebenfurter Bahn und verschiedene
Vizinal- und Lokalbahnen im ganzen Land. An der Spitze des
gegenwärtig vereinigten Post- und Telegraphendienstes stehen 9
Post- und Telegraphendirektionen, denen 3998 Postämter
(darunter 241 ärarische) mit 21,910 Beamten und 1509
Telegraphenstationen (680 Staats- und 829 Bahnstationen)
unterstehen. Mit der Briefpost wurden 1886: 97 Mill. Briefe, 50,5
Mill. Zeitungen und 41 Mill. sonstige Sendungen, mit der Fahrpost
9,7 Mill. Pakete befördert. Der Postanweisungsverkehr betrug
237 Mill. Gulden. Den seit 1886 eingeführten
Postsparkassendienst besorgen 2990 Postämter (jährliche
Einlage 3 Mill. Guld.). Die Länge der Telegraphenlinien
beträgt 19,000 km (1867: 6,7), auf denen jährlich 6 Mill.
Telegramme befördert werden (1867: 0,6). Außer der
Hauptanstalt der Österreichisch- Ungarischen Bank in Budapest
bestehen in U. noch 19 Filialen und 62 Nebenstellen, Geldinstitute
in allen Städten und bedeutenden Orten, zusammen 127 Bank- und
Kreditinstitute, 397 Sparkassen und 454 Genossenschaften
(Volksbanken, Vorschußvereine etc.). Gewerbe- u.
Handelskammern in 12 größern Städten; Münzen,
Maße und Gewichte sind die nämlichen wie in
Österreich; seit 1876 sind die Metermaße und -Gewichte
eingeführt.
Staatsverfassung und -Verwaltung.
Nach seinem frühern Umfang bestand U. aus den S. 1000
bereits erwähnten vier Kreisen und den Nebenländern
Kroatien und Slawonien. 1849 wurden beide letztere nebst dem
kroatischen Litorale und Fiume
1006
Ungarn (Staatsverfassung und Verwaltung, Rechtspflege,
Finanzen).
sowie die Murinsel als eignes Kronland abgelöst, ferner die
Komitate Bács-Bodrog, Torontál, Temes und
Krasó als Woiwodschaft Serbien und Temeser Banat
ausgeschieden und die 1835 zu U. geschlagenen Komitate Kraszna,
Mittel-Szolnok und Zarand, der Distrikt Kövar und die Stadt
Zilah wieder mit Siebenbürgen vereinigt. Seit 1867 ist
indessen U. nicht nur in seinem frühern Umfang
wiederhergestellt, sondern demselben auch Siebenbürgen und die
Serbisch-Banater Militärgrenze einverleibt. Kroatien-Slawonien
behielt für die innere Verwaltung feine Autonomie mit eigner
Gesetzgebung und Landesregierung, an deren Spitze der Ban steht; in
Bezug auf Finanzen, Handel, Verkehr und Militärangelegenheiten
aber wurde es mit U. unter Wiederherstellung der frühern
administrativen Einteilung vereinigt. 1876 erhielten die Gemeinden
in U. eine neue Organisation, und auch die administrative
Einteilung wurde abgeändert; namentlich wurde
Siebenbürgen (s. d.) in 15 neugebildete Komitate eingeteilt
und das Gebiet mehrerer ungarischer Komitate geregelt. In U.
bestehen seitdem die S. 1001 angeführten 63 Komitate. In
kirchlicher Beziehung zerfällt U. in vier
römisch-katholische Erzbistümer. Dem Erzbischof von Gran
(Fürst-Primas von U.) sind die Bistümer
Stuhlweißenburg, Fünfkirchen, Veszprim, Steinamanger,
Raab, Neutra, Neusohl und Waitzen, die Erzabtei Martinsberg sowie
die griechischkatholischen Bistümer Munkacs und Eperies, dem
Erzbischof zu Erlau die Bistümer Rosenan, Ztps, Kaschau und
Szatmar, dem in Kalocs a die Bistümer Großwardein,
Csanad und Siebenbürgen, dem von A gram die Bistümer
Bosnien-Syrmien und Zengg-Modrus sowie das griechischkatholische
Bistum Kreutz untergeordnet. Die katholische Kirche des
griechischen Ritus hat ein Erzbistum zu Karlsburg mit dem Sitz in
Blasendorf; diesem unterstehen die Bistümer Großwardein,
Lugos und Szamos-Ujvar. Überdies erteilt der König von U.
noch 34 Bischofstitel, mit welchen Sitz und Stimme im Öberhaus
verbunden sind. In U. gibt es 8600 geistliche Personen und 283
Klöster der römisch-katholischen Kirche sowie über
2600 geistliche Personen und Klöster der
griechisch-katholischen Kirche. Die griechisch-orientalische Kirche
serbischer Nationalität hat ein Erzbistum in Karlowitz, mit
Bistümern in Ofen, Neusatz, Temesvár, Werschetz,
Pakratz und Karlstadt, die griechisch-orientalische Kirche
rumänischer Nationalität hingegen ein Erzbistum in
Hermannstadt mit Bistümern in Arad und Karansebes. Zu beiden
Erzbistümern gehören 3600 geistliche Personen. Die
evangelische Kirche Helvetischer Konfession zählt vier
Superintendenzen in U. und einein Siebenbürgen; die
evangelische Kirche Augsburgischer Konfession ebenfalls vier in U.
und eine in Siebenbürgen. Die Unitarier haben einen Bischof in
Siebenbürgen.
U. bildet feit 1867 mit Österreich die
österreichischungarische Monarchie, welche aus zwei
unabhängigen und gleichberechtigten Staaten besteht. Jeder der
beiden Staaten besitzt seine besondere Verfassung, Legislative und
Verwaltung. Beide sind jedoch nicht bloß durch die Person des
Monarchen verkünden, sondern haben auch gemeinsame
Angelegenheiten. Solche sind: die auswärtigen Angelegenheiten
mit Einschluß der diplomatischen und kommerziellen Vertretung
im Ausland; das Kriegswesen und die Kriegsmarine, jedoch mit
Ausschluß der Rekrutenbewilligung sowie der Dislozierung und
Verpflegung der Armee; das Finanzwesen rücksichtlich der
gemeinsamen Auslagen; schließlich die Gesetzgebung über
Zollwesen und indirekte Steuern sowie die Feststellung des
Münzwesens und des Geldfußes. Die gesetzgebende Gewalt
hinsichtlich der gemeinsamen Angelegenheiten wird von zwei, vom
österreichischen Reichsrat und ungarischen Reichstag auf ein
Jahr gewählten Delegationen ausgeübt, die aus je 60
Mitgliedern bestehen (40 Abgeordneten und 20 Oberhausmitglieder).
Der ungarische Reichstag besteht aus der Magnatentafel (Oberhaus)
und aus dem Abgeordnetenhaus. Mitglieder des Oberhauses sind: die
in U. begüterten großjährigen Erzherzöge, die
Erzbischöfe, Bischöfe und einige Äbte und
Pröpste, die Reichswürdenträger und Kronhüter,
die Öbergespäne, der Gouverneur von Fiume und die
ungarischen Fürsten, Grafen und Barone, endlich zwei
kroatisch-slawonische Landtagsdeputierte und 50 vom König auf
Lebenszeit ernannte Mitglieder. Das Abgeordnetenhaus zählt 458
Abgeordnete, wovon einer auf Fiume und 40 auf Kroatien-Slawonien
entfallen. Die Munizipien (Komitate und königliche
Freistädte) sind in Wahlkreise eingeteilt, deren jeder einen
Abgeordneten auf fünf Jahre wählt. Das aktive Wahlrecht
beginnt mit dem 20., das passive mit dem 24. Lebensjahr. Der
Reichstag wird in Budapest abgehalten. Der Präsident und
Vizepräsident der Magnatentafel werden vom König ernannt,
den Präsidenten und die beiden Vizepräsidenten des
Abgeordnetenhauses dagegen wählt dieses selbst auf die
fünfjährige Dauer einer Legislatur. Die Abgeordneten
bekommen Diäten und Quartiergeld, die Mitglieder der
Magnatentafel erhalten keine Diäten. Für Kroatien
Slawonien (s. d., S. 240) besteht ein besonderer Landtag. Die
Komitate und größern königlichen Freistädte
bilden sogen. Munizipien, an deren Spitze vom König ernannte
Qbergespäne sowie von den Munizipalausschüssen
gewählte Vizegespäne in den Komitaten und
Bürgermeisterin den Städten stehen. Vertreter der
Munizipien sind die Munizipalausschüsse, welch e zur
Hälfte aus den Höchstbesteuerten (Viritisten), zur
Hälfte aus gewählten Mitgliedern bestehen; sie üben
das Selbstverwaltungsrecht aus und wählen ihre
Administrativbeamten. Seit 1876 besteht in jedem Munizipium zur
Leitung und Überwachung der ganzen Verwaltung ein
Verwaltungsausschuß aus 20 teils ernannten, teils
gewählten Mitgliedern. Die übrigen Städte und
Gemeinden (Städte mit geregeltem Magistrat, Großund
Kleingemeinden) stehen unter der Aufsicht der Komitate. Jedes
Komitat ist in mehrere Stuhlrichteramtsbezirke geteilt. Die
Regierung des Landes besteht aus zehn Ministern:
Ministerpräsident, Minister des Innern, Finanzminister,
Justizminister, Ackerbauminister, Handelsminister,
Honvédminister, Minister für Kultus und Unterricht,
für Kroatien und Slawonien und Minister bei Sr. Majestät
dem König.
Die Rechtspflege ist seit 1867 von den Munizipien und der
Administration getrennt, und in den letzten Jahrzehnten sind viele
neue Gesetze geschaffen (Wechsel-, Handels- und Strafrecht, Zivil-
und Strafprozeß, Konkurs-, Notariats- u. Advokatenordnung
etc.). In U. mit Siebenbürgen und Fiume bestehen 380 Bezirks
(Einzel-) Gerichte und 65 königliche Gerichtshöfe als
Gerichte erster Instanz. In zweiter Instanz fungieren die
königlichen Tafeln in Budapest und Maros-Vasarhely; oberste
Behörde ist die königliche Kurie (oberster Kassations-
und Gerichtshof) in Budapest. Die Finanzen sind seit 1868 in das
Stadium fast völliger Selbständigkeit getreten. Zu den
gemeinsamen Ausgaben trägt U. 30, seit Einverleibung
1007
Ungarn (Wappen etc.; Geschichte bis 1061).
(Provinzialisierung) der Militärgrenze 32, Österreich
aber 70 (68) Proz. bei. Zur Verzinsung und Amortisation der
österreichischen Staatsschuld zahlt U. jährlich eine
Summe von 30,312,000 Gulden. Trotz der steten Eröffnung neuer
Einnahmequellen ist es nicht gelungen, das Defizit zu beseitigen.
Einen Überblick über die Finanzen Ungarns gewährt
folgende Zusammenstellung (in Millionen Gulden):
Jahr Einnahmen Ausgaben Überschuß +
Defizit -
1869 233,7 184,1 +49,6
1874 203,0 247,3 -44,3
1879 222,2 256,4 -34,2
1884 311,9 329,0 -17,1
1885 326,0 337,9 -11,9
1886 329,6 343,6 -14,0
1887 328,2 350,2 -22,0
1888 332,6 345,0 -12,4
1889 350,7 356,8 - 6,1
Im J. 1889 entfallen von den Einnahmen auf:
Mill. Guld.
direkte Steuern 99,40
Indirekte 39,68
Zölle 0,48
Stempel u. Gebühren 27,64
Tabaksmonopol 46,25
Lotto 2,51
Salzmonopol 15,91
Staatsgüter 2,46
Staatswälder 6,54
Montan u. Münzwesen 15,28
Post und Telegraphen 2,35
Ungar. Staatsbahnen 39,90
Von den Ausgaben dagegen auf:
Mill. Guld.
den königl. Hofstaat 4,65
Reichstagsauslagen 1,25
gemeinsame Auslagen 23,02
Staatsschuldenquote 132,77
Grundentlastung 19,40
Auslagen der Gefälle 56,70
Post und Telegraphen. 9,23
Unterrichtswesen 6,70
Justiz 12,09
Honveds (Landwehr) 9,81
In U. bestehen 14 Finanz-, 3 Berg- und 6
Staatsgüterdirektionen, ferner eine Lottodirektion. Die
Staatsschuld beläuft sich (1889) auf 1130, das
Staatsvermögen auf 1273 Mill. Guld. Über das Heerwesen
vgl. Österreichisch-Ungarische Monarchie, S. 501 f. - Das
Wappen Ungarns ist ein mit der (vom Papst Silvester um 1000 dem
König Stephan [s. d. 4)] geschenkten) Stephanskrone bedeckter,
der Länge nach geteilter Schild, rechts mit vier roten und
vier weißen Streifen, links im roten Feld mit silbernem
Patriarchenkreuz, das aus einer auf dreifachem grünen
Hügel ruhenden Krone hervorgeht (s. Tafel
"Österreichisch-Ungarische Länderwappen"). Die
Nationalfarben sind Grün, Weiß, Rot (s. Tafel "Flaggen
I"). Der einzige ungarische Orden ist der Stephansorden (s. d.
1).
[Litteratur.] Vgl. außer den ältern Werken von
Chaplovics (Pest 1829) und Fenyes (s. d.): Palugyai,
Geschichtliche, geographische und statistische Beschreibungen von
U. (ungar., das. 1855, 4 Bde.); I. Hunfalvy, Physikalische
Geographie des ungarischen Reichs (ungar., das. 186365, 3 Bde.);
"U. und Siebenbürgen in malerischen Originalansichten"
(Stahlstiche von Rohbock, Text von Hunfalvy, Darmst. 1864, 3 Bde.);
Keleti, Unser Land und sein Volk (ungar., Pest 1871); Grassauer,
Landeskunde von Öfterreich-U. (Wien 1875); Schwicker, Das
Königreich U. (das. 1886); Kronprinz Rudolf,
Österreich-U. in Wort und Bild (das. 1887 ff.); für die
ethnographischen Verhältnisse: Czoernig, Ethnographie (das.
1855, 3 Bde.); P. Hunfalvy, Ethnographie Ungarns (deutsch von
Schwicker, Budapest 1876); die betreffenden Teile des Sammelwerks
"Die Völker Österreich-Ungarns" (Teschen 1881-86) und
zwar Bd. 3 (Die Deutschen in U. und Siebenbürgen, von
Schwicker), Bd. 5 (Magyaren, von Hunfalvy), Bd. 6 (Rumänen,
von Slavici), Bd. 10 (Slowenen, von Suman; Kroaten, von Stare), Bd.
11 (Serben, von Stefanovics), Bd. 12 (Zigeuner, von Schwicker);
Vambéry, Der Ursprung der Magyaren (Leipz. 1882);
Löher, Die Magyaren und andre Ungarn (das. 1874); ferner
Ulbrich, Staatsrecht der österreichisch-ungarischen Monarchie
(Freiburg 1884); Schwicker, Statistik von U. (Stuttg. 1876), und
die Veröffentlichungen des königlichen ungarischen
Statistischen Büreaus; Ditz, Die ungarische Landwirtschaft
(Leipz. 1867); Bedö, Wirtschaftliche Beschreibung der
ungarischen Staatsforsten (Pest 1878); Gutmann, Ungarisches
Montanhandbuch (Wien 1881); M. Wirth, U. und seine
Bodenschätze (Frankf. a. M. 1884); über Kurorte und
Heilquellen die Werke von Wachtel (Ödenb. 1859) und Chyzer
(Stuttg. 1887); Heksch, Führer durch U. und seine
Nebenländer (Wien 1882). Karten: Spezialkarte des
Königreichs U. (1:144,000 in 140 Blättern, seit 1869);
Steinhauser, Orts- und Straßenkarte des Königreichs U.
(l:1,296,000, 1882). Vgl. auch die bei Österreich, S. 498
angegebenen allgemeinen Werke und Karten.
Gechichte.
U., das in der Römerzeit die Provinz Pannonien und einen
Teil von Dacien bildete, war seit dem Verfall des römischen
Reichs das Ziel von Einfällen und dauernden Niederlassungen
zahlreicher Völker (Germanen, Hunnen, Slawen, Avaren u. a.),
von denen noch beträchtliche Trümmer vorhanden waren, als
um 890 die Magyar en (bei den Slawen Ugri, Ungri, bei den Deutschen
Ungarn benannt), aus ihren bisherigen Wohnsitzen zwischen Donau und
Don von den Petschenegen verdrängt, in U. einfielen und es
unter ihrem Herzog Almus und dessen Sohn Arpad 890-898 eroberten.
Die Anfänge christlicher Kultur wurden von dem rohen Volk
zerstört, das sein Nomadenleben auch in U. fortsetzte und nach
Vernichtung des großmährischen Reichs und nach
Zurückdrängung der bayrischen Herrschaft bis an die Enns
mit seinen schnellen Reiterscharen auf weiten Raubzügen die
Nachbarlande, namentlich Italien und Deutschland, verwüstete.
Erst ihre beiden Niederlagen durch die Deutschen bei Riade (933)
und bei Augsburg (955) bändigten ihre zügellose
Kriegslust und zwangen sie, hinter den Grenzen der ihnen
entrissenen Ostmark sich zu einem seßhaften Leben zu
bequemen. Arpads Urenkel Geisa (972-997) und dessen Sohn Stephan
der Heilige (997 bis 1038) rotteten das Heidentum mit Feuer und
Schwert aus und organisierten die christliche Kirche; Stephan nahm
den Königstitel an, ließ sich mit der vom Papst
geschenkten Krone krönen (1001) und gab dem Reich eine
Verfassung, durch welche die Krone im Geschlecht Arpads für
erblich erklärt und mit der höchsten richterlichen und
vollziehenden Gewalt ausgerüstet, ferner Prälaten,
Magnaten (hoher Adel) und niederer Adel als die privilegierten
Stände anerkannt, aus den beiden ersten der Reichssenat
gebildet und das Land in 72 Komitate (Gespanschaften) geteilt
wurde. Unter Stephans Neffen, dem Sohn seiner Schwester Maria und
des venezianischen Dogen Otto Orseolo, König Peter, bewirkte
der nationale Haß gegen die Fremdherrschaft des Italieners
und gegen das Christentum eine Reaktion des rohen Heidentums; Peter
wurde 1041 und nachdem er von Kaiser Heinrich III., der den an
seiner Stelle gewählten heidnischen König Aba 1044
besiegte, wieder zurückgeführt und 1045 in
Stuhlweißenburg mit U. belehnt worden war, 1046 von neuem
vertrieben. Ihm folgte der Arpade Andreas, der das halb vertilgte
Christentum aufrichtete und die deutsche Lehnshoheit wieder
abschüttelte, aber 1061 von seinem Bruder Bela gestürzt
wurde, welcher die aufrührerischen Großen
unterdrückte und das Christentum mit blu-
1008
Ungarn (Geschichte 1063-1527)
tiger Strenge befestigte. Nach seinem Tod (1063) erhielt mit
deutscher Hilfe Andreas' Sohn Salomo die Krone, wurde aber 1074 von
Belas Sohn Geisa vertrieben. Derselbe ließ sich 1075
krönen, starb jedoch schon 1077 und hatte seinen Bruder
Wladislaw zum Nachfolger, welcher 1088 Nordkroatien unter warf. Ihm
folgte fein Neffe Koloman (1095-1114), welcher 1102-12 Dalmatien
eroberte, mit dem Papst 1106 ein Konkordat abschloß und
treffliche Gesetze über das Grundeigentum, die Finanzen und
das Gerichtswesen erließ. Die Regierungen Stephans II.
(1114-31),Belas II., des Blinden (1131-41),und Geisas (1141-61)
waren durch äußere Kriege und innere Unruhen bewegt.
Nach des letztern Tod folgten durch die Einmischung des
griechischen Kaisers Manuel in die stets streitige
Thronfolgeordnung längere Wirren, während deren neben
Geisas ältestem Sohn, Stephan III. (1161-73), noch zwei
Könige existierten, bis endlich Geisas zweiter Sohn, Bela II:
(1173 bis 1196), den Thron bestieg, der dem griechischen
Kaiserreich den Lehnseid leisten mußte; derselbe unterwarf
Kroatien und Dalmatien wieder und eroberte Bulgarien und Galizien,
das fortan der Zankapfel zwischen U., Polen und Rußland
blieb. Sein Nachfolger war sein Sohn Emmerich (1196 - 1204), dann
dessen unmündiger Sohn Wladislaw (1204l205), der aber von
Belas III. jüngerm Bruder, Andreas II. (1205-35),
verdrängt wurde. Unter diesem, der 1217 einen erfolglosen
Kreuzzug unternahm, erzwangen sich der Reichsadel 1222 in der
Goldenen Bulle und 1231 auch der Klerus ausgedehnte Rechte und
Freiheiten. Unter Bela IV. (1235-70) wurde U. 1241 von den Mongolen
furchtbar verwüstet und entvölkert. Daher wurden
zahlreiche deutsche und italienische Ansiedler in das Land gezogen
und der Bürgerstand durch Vermehrung der Freistädte
gehoben. 1244 wurde Bosnien der ungarischen Herrschaft gesichert,
und nach andern Seiten hin wurden die Grenzen Ungarns erwettert.
Nach Stephans V. (1270-72) frühem Tod folgte sein
unmündiger Sohn, Wladislaw IV., der Kumane, nach dessen
Ermordung (1290) Andreas' II. Enkel Andreas III. auf den Thron
erhoben wurde. Mit ihm erlosch 14. Jan. 1301 der Mannsstamm der
Arpaden.
Zwar begünstigte ein Teil der ungarischen Stände den
Sohn von Andreas' Tochter, Wenzel III. von Böhmen, der als
Wladislaw V. gekrönt wurde, aber die unhaltbare Krone dem
Herzog Otto von Bayern überließ. Die Mehrheit wurde aber
schließlich für den vom Papst und vom deutschen
König begünstigten Karl Robert von Neapel aus dem Haus
Anjou, der mütterlicherseits mit den Arpaden verwandt war,
gewonnen, welcher, wiederholt von seinen Anhängern ausgerufen
und gekrönt, 1308 allgemeine Anerkennung fand. Karl I. Robert
(1308-42) führte die abendländischen höfischen
Sitten, Pflege der Wissenschaften, geregeltes Gerichtsverfahren u.
dgl., aber auch Luxus und Prachtliebe beim Adel ein; auch eroberte
er 1314 das venezianische Dalmatien. Nach ihm bestieg sein
ältester Sohn, Ludwig I., der Große (1342-82), den
Thron, der vorübergehend auch über Neapel herrschte und
1370 zum König von Polen gewählt wurde. Derselbe
behauptete und erweiterte in glücklichen Kriegen die
äußere Macht des Reichs, vollendete die Bekehrung der
Kumann zum Christentum, regelte das Erbrecht der adligen
Güter, gab den Städten eigne Gerichtsbarkeit und
Handelsfreiheit und gründete 1367 eine Universität in
Fünfkirchen sowie zahlreiche Schulen. Er hatte zu seiner
Nachfolgerin in U. seine Tochter Maria ernannt, welche sich mit dem
Luxemburger Siegmund vermählte. Die Großen riefen jedoch
ihren Vetter, Karl den Kleinen von Neapel, als König aus. Erst
nach dessen Ermordung (1386) erlangte Siegmund mehr und mehr
Anerkennung und behauptete sich auch nach Marias Tod (1392). Als er
aber auf dem Kreuzzug gegen die Türken 1396 bei Nikopolis
besiegt wurde, empörten sich die Großen gegen ihn und
nahmen ihn 1401 sogar in Ofen gefangen. Da sie sich jedoch
über die Wahl eines andern Königs nicht verständigen
konnten, ward Siegmund 1404 allgemein als König wieder
anerkannt, gab dem Land zur Verteidigung gegen die Türken eine
bessere Heeresorganisation und berief 1405 einen Nationalkonvent,
zu dem er zum erstenmal Abgeordnete der Städte heranzog, die
sich mit dem niedern Adel zur Ständetafel (neben der
Magnatentafel der Prälaten und des hohen. Adels)vereinigten;
er erwarb Kroatien und Dalmatien wieder und brachte auch Bosnien
unter ungarische Oberhoheit. Siegmund, seit 1410 auch Kaiser, starb
1437 ohne männliche Erben und hinterließ seine Reiche U.
und Böhmen seinem Schwiegersohn Albrecht von Österreich
(als deutscher König Albrecht II.), der aber schon 1439 starb.
Die ungarischen Stände erkannten nun nicht dessen nachgebornen
Sohn Wladislaw Posthumus als König an, sondern beriefen wegen
der wachsenden Türkengefahr den polnischen König
Wladislaw III. (V.) auf den Thron, der aber schon 10. Nov. 1444 in
der großen Schlacht bei Warna gegen die Türken Sieg und
Leben verlor. Nun wurde Wladislaw (VI.) Posthumus zum König
erklärt und der Nationalheld Johann Hunyades, welcher die
Türken glänzend besiegt hatte, 1446 zum Gubernator
Hungariae oder Reichsverweser ernannt, der zwar 17.-20 Okt. 1448
gegen die Türken die Schlacht auf dem Amselfeld verlor, aber
14. Juli 1456 an der Spitze eines Kreuzheers bei Belgrad
glänzend siegte. Nach Wladislaws Tod (November 1457)
wählte der Reichstag zu Pest 1458 Hunyades' Sohn Matthias
Corvinus zum König; nur ein kleiner Teil der Großen
stellte den Kaiser Friedrich III. als Gegenkönig auf. Matthias
beförderte im Innern Bildung und Wohlstand und focht nicht nur
glücklich gegen die Türken, sondern auch gegen den
König Georg Podiebrad, an dessen Stelle er sich 1469 in
Olmütz zum König von Böhmen krönen ließ,
und entriß Friedrich IIL sein Erbland Niederösterreich.
Er starb 6. April 1490 in Wien, worauf der Reichstag die Krone
Wladislaw V.(VI:) von Böhmen, aus dem Haus der Jagellonen,
übertrug, welcher mit Kaiser Maximilian I. 1415 eine
Doppelheirat seiner Kinder Ludwig und Anna mit dessen Enkeln Maria
und Ferdinand sowie eine Erbverbrüderung abschloß. Auf
seinen Befehl ward 1512 das erste umfassende Gesetzbuch Ungarns,
das Tripartitum, zusammengestellt, das, 1517 von Verböczy
vollendet, bis auf die neueste Zeit als Corpus juris hungaricum in
Geltung war. Ein Bauernaufstand (der "Kuruzzenkrieg") wurde 1514
von Johann Zapolya unterdrückt. Wladislaws Sohn Ludwig II.
(1516-1526) fiel 29. Aug. 1526 in der unglücklichen Schlacht
bei Mohacs gegen Sultan Suleiman H., welcher darauf ganz U. mit
seinen Heerscharen überschwemmte.
Ungarn unter den Habsburgern.
Da Ludwig II. keine Nachkommen hinterließ, entstand ein
verderblicher Zwist über die Thronfolge. Auf Grund der mit dem
Haus Habsburg geschlossenen Erbverbrüderung wählte der
Reichstag zu Preßburg 16. Dez. 1526 den Erzherzog Ferdinand
von Österreich zum König; Ferdinand wurde, nachdem er
1527 die Verfassung beschworen, zu Stuhlweißenburg
1009
Ungarn (Geschichte 1527-1848).
gekrönt. Ein Teil der Großen rief aber Johann Zapolya
zum König aus, welcher sich den Türken in die Arme warf.
Im Vertrag von Großwardein (25. Febr. 1538) ward U. so
geteilt, daß Zapolya Siebenbürgen und U. jenseit der
Theiß, Ferdinand den Nordwesten erhielt, während der
mittlere größte Teil des Landes nebst Ofen, wo ein
Pascha residierte, im Besitz der Türken verblieb; ja, diese
versuchten, von Zapolya und seinem Sohn und Nachfolger
unterstützt, immer wieder, ganz U. sich zu unterwerfen; dazu
kamen unter Ferdinands Nachfolgern Marimilian II. (1564-76), Rudolf
II. (1576-1608), Matthias (1608-19), Ferdinand II. (1619-37) und
Ferdinand III. (1637-57) religiöse Streitigkeiten, indem die
seit 1561 eingewanderten Jesuiten die trotz aller Bedrückungen
zahlreichen Protestanten auszurotten suchten und sie dadurch zu
Aufständen reizten. 1604 erhoben sich die Protestanten unter
Stephan Bocskay und erzwangen 1606 einen Frieden, in dem die
Religionsfreiheit in beschränktem Maß gewährleistet
und Bocskay als Fürst von Siebenbürgen anerkannt wurde.
Siebenbürgen behauptete seine Unabhängigst auch unter
Bethlen Gabor und den Raköczys und blieb neben der Furcht vor
den Türken eine Stütze der Protestanten. Leopold L
(1657-1705) erließ, sowie er einen Vorteil über die
Türken errungen hatte, sofort die strengsten Maßregeln
gegen die Ketzer in U. Dies veranlaßte 1665 eine große
Magnatenverschwörung gegen die habsburgische Herrschaft, die
erst 1671 grausam unterdrückt wurde. Ein neuer Aufstand
Emmerich Tökölys wurde von einem Einfall der Türken
unter Kara Mustafa unterstützt, der 1683 bis vor Wien vordrang
und es belagerte. Seine Niederlage (12. Sept.) entschied das
Schicksal Ungarns: die kaiserlichen Heere drangen siegreich in U.
ein, erstürmten 1686 Ofen und machten nach 145jähriger
Dauer der Türkenherrschaft daselbst ein Ende. Durch das
Blutgericht von Eperies (1687), durch welches Leopold die Siege
seiner Feldherren schändete, wurden Hunderte vom
protestantischen Adel dem Henker überliefert und dessen
Widerstandskraft gebrochen. Hierauf erlangte der Kaiser für
sein Haus auf dem Preßburger Reichstag 1687 die Erblichkeit
der ungarischen Krone und beseitigte aus der Goldenen Bulle die
Klausel wegen des Widerstandsrechts, bestätigte aber im
übrigen die alte ungarische Verfassung. Im Frieden von
Karlowitz (1699) gaben die Türken ganz U. mit Ausnahme des
Banats sowie Siebenbürgen heraus, und nachdem ein neuer
Kuruzzenaufstand unter Franz Rakocz von Joseph I. (1605-11) durch
den Szatmarer Frieden beendigt worden, erlangte Karl VI. (1711-40)
infolge der Siege des Prinzen Eugen im Passarowitzer Frieden 1718
auch das Banat sowie die Kleine Walachei und einen Teil Serbiens
mit Belgrad. Letztere Lande gingen allerdings nach einem neuen
unbesonnen unternommenen und ungeschickt geführten
Türkenkrieg (1737-39) wieder verloren, und die Grenzen Ungarns
wurden so festgestellt, wie sie noch heute sind.
Nach Karls Tod bestieg 20. Okt. 1740 kraft der vom ungarischen
Reichstag anerkannten Pragmatischen Sanktion von 1723 seine Tochter
Maria Theresia (1740-80) den Thron. In dem Kampf um ihr Erbe
erhoben sich die Ungarn begeistert für ihren "König"
Maria Theresia und verhalfen ihr zum Sieg. Die Kaiserin widmete
daher U. ihre besondere Fürsorge, beschützte die
Protestanten, regelte 1765 die Unterthanenverhältnisse durch
das Urbarium u. dgl. Joseph II. (1780-90) hob die Leibeigenschaft
auf, erließ ein Toleranzedikt, zog die Klöster ein,
beseitigte die Vorrechte des Adels, beschränkte den
Zunftzwang, vernichtete die Komitatseinteilung, führte das
Deutsche als Geschäftssprache ein etc. und erbitterte durch
rücksichtslose Verletzung der nationalen und Standesvorurteile
alle Stände so sehr, daß er, um einem allgemeinen
Aufstand vorzubeugen, 28. Jan. 190 mit Ausnahme der beiden ersten
Reformen alle Maßregeln zurücknehmen mußte. Auch
der neue Türkenkrieg, den er 1788 im Bund mit Rußland
unternahm, war erfolglos und verschaffte U. im Frieden von Sistowa
(4. Aug. 1791) nur den Besitz von Alt-Orsova. Josephs Nachfolger
Leopold II. (1790-92) berief sofort zur Versöhnung der
Gemüter einen Reichstag (den ersten seit 25 Jahren) nach Ofen.
Franz I. (1792-1835) lenkte dagegen wieder ganz in die
absolutistischen Bahnen ein und berief Reichstage nur, um sich Geld
und Mannschaften für die fortwährenden Kriege gegen
Frankreich, welche U. zwar nur vorübergehend berührten,
ihm aber große Opfer auflegten, bewilligen zu lassen. Nach
wiederhergestelltem Frieden wurde lange kein Reichstag berufen und
1820 eigenmächtig eine neue Rekrutierung angeordnet und die
Steuern auf mehr als das Doppelte erhöht. Erst 1825 trat
wieder ein Reichstag zusammen, weil die Ausführung jener
Maßregeln auf Widerstand stieß. Der Reichstag
bewilligte sofort das geforderte Truppenkontingent und die
Erhöhung der Steuern, verlangte aber, daß der König
sich verpflichte, ohne Mitwirkung des Reichstags keine Steuern zu
erheben und denselben alle drei Jahre einzuberufen. Die Opposition
des Reichstags, geführt von Männern wie Szechenyi,
erstrebte neben einer modernen, wirklich konstitutionellen
Verfassung auch nationale Ziele, namentlich offizielle Anerkennung
der magyarischen Sprache. Zu diesem Zweck ward 1825 eine ungarische
Akademie errichtet und das Magyarische von den höhern
Ständen als Umgangssprache gewählt. Die Regierung
betrachtete diese Bestrebungen als unschädlich und ließ
die Zulassung des Magyarischen als Geschäftssprache zu,
widersetzte sich aber entschieden der Forderung liberaler Reformen
und beantwortete die liberalen Regungen in der Litteratur und
Presse mit Einsperrung der Unruhstifter; sie stützte sich
hierbei auf eine ziemlich starke konservative Partei unter Graf
Aurel Dessewffy, welche für ihre Standesvorrechte und
Interessen eintrat. Aus dem Gegensatz dieser konservativen zu der
liberalkonservativen Partei unter Szechenyi und der eigentlichen
Oppositionspartei unter Ludwig Batthyányi und Kossuth
entwickelte sich, namentlich seit der Thronbesteigung Ferdinands I.
(1835-48), ein lebhafter Parteikampf auf den Reichstagen, durch
welchen das Volk politisch aufgeklärt und geschult und der
vaterländische Sinn bedeutend gehoben wurde. Die Liberalen
errangen Sieg auf Sieg: 1840 den Erlaß einer Amnestie, 1843
die Zulassung Nichtadliger zu den bisher dem Adel vorbehaltenen
Ämtern. Den Reichstag von I847 eröffnete König
Ferdinand 12. Nov. mit einer Rede in magyarischer Sprache.
Die ungarische Insurrektion und ihre Folgen.
Als die Februarrevolution von 1848 der liberalen Bewegung in
ganz Europa einen mächtigen Anstoß gab, trat die
Opposition offen mit dem Endziel ihrer Wünsche, einer neuen
freisinnigen Konstitution und einem selbständigen ungarischen
Ministerium, hervor. Diese Forderungen wurden auf Antrag Kossuths
16. März in einer Adresse an den Kaiser ausgesprochen und nach
Überreichung derselben sofort bewilligt. Der Palatin Erzherzog
Stephan ward zum Stellvertreter des Kaisers für U.,
Batthyányi zum
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl., XV. Bd
64
1010
Ungarn (Geschichte 1848-1849).
Ministerpräsidenten ernannt. Die Roboten wurden
abgeschafft, der Zehnte durch Verzicht des Klerus beseitigt,
gleiche Besteuerung, die Bildung einer Nationalgarde,
Preßfreiheit und Schwurgerichte, endlich Umgestaltung des
Reichstags zu einer wirklichen Volksvertretung beschlossen. Der
Kaiser genehmigte alle diese Beschlüsse, als er den Reichstag
11. April schloß, und das Ministerium, welches seinen Sitz
nach Pest verlegte, begann sofort die Ausführung derselben
sowie eine straffere Einigung aller Länder der Stephanskrone.
Die Unduldsamkeit der herrschsüchtigen Magyaren rief aber
beiden nichtmagyarischen Völkern Widerstand hervor. Namentlich
die Kroaten sagten sich völlig von U. los und wählten
Jellachich zum Banus. Der neugewählte ungarische Reichstag,
welcher 5. Juli 1848 in Pest durch den Palatin eröffnet wurde,
bewilligte dem Ministerium sofort 200,000 Mann Landwehr und 42
Mill. Gulden zur Unterdrückung der slawischen
Lostrennungsgelüste. Aber der Hof, ermutigt durch die Siege in
Italien, verweigerte die Genehmigung dieser Beschlüsse; 14.
Aug. wurde dem Erzherzog Stephan die Vollmacht der Stellvertretung
entzogen, und als der Reichstag auf Kossuths Antrag eine Deputation
von l20 Mitgliedern nach Wien schickte, welche energisches
Einschreiten gegen den kroatischen Ausstand, Verlegung des
Hoflagers nach Pest und Rücksendung aller ungarischen
Regimenter in die Heimat verlangte, wurden diese Forderungen 9.
Sept. abgelehnt und der bisher verleugnete Jellachich in seine
Ehren und Würden wieder eingesetzt. Der geheimen Zustimmung
des Wiener Hofs sicher, rückte Jellachich 11. Sept. mit dem
kroatischen Heer über die ungarische Grenze, indem er in einer
Proklamation die Errichtung eines österreichischen
Gesamtstaats als sein Ziel verkündete. Die Pester
Nationalversammlung ernannte den Erzherzog Stephan zum
Oberbefehlshaber der ungarischen Armee und übertrug, als
dieser 25. Sept. auf Verlangen des Hofs sein Amt niederlegte, die
Leitung der Verteidigung einem Ausschuß unter Kossuths
Vorsitz. Der vom Kaiser zum Oberkommandanten von U. ernannte Graf
Lamberg wurde von der Nationalversammlung nicht anerkannt und 28.
Sept. vom Pöbel auf der Brücke zwischen Ofen und Pest
ermordet. Damit war der offene Krieg erklärt; 29. Sept. kam es
bei Velencze zum ersten Treffen zwischen Kroaten und Ungarn.
Während die Ungarn sich mit der revolutionären Opposition
im Wiener Reichsrat in Verbindung setzten, hob ein kaiserliches
Manifest vom 3. Okt. die ungarische Nationalersammlung und ihre
Beschlüsse auf und ernannte Jellachich zum Alter ego des
Kaisers in U. Der Wiener Oktoberaufstand (s. Österreichisch
Ungarische Monarchie, Geschichte, S. 518) verzögerte die
kriegerischen Maßregeln gegen U.; aber da die Ungarn Wien zu
spät und bloß mit 18,000 Mann zu Hilfe kamen, welche 30.
Okt. bei Schwechat zum Rückzug gezwungen wurden, fiel die
Hauptstadt 3l. Okt. in die Gewalt Windischgrätz, welcher der
ungarischen Armee eine 14tägige Frist zur Niederlegung der
Waffen stellte und nach deren erfolglosem Ablauf Mitte Dezember die
Kriegsoperationen gegen U. begann; um dieselbe Zeit
verschärfte der ungarische Reichstag den Konflikt, indem er
15. Dez. 1848 die Abdankung Kaiser Ferdinands für
ungültig erklärte und gegen die Thronbesteigung Franz
Josephs Protest erhob. Windischgrätz rückte 18. Dez. in
Preßburg ein; Jellachich drang nach einem Gefecht mit
Görgei bis Wieselburg vor und schlug Perczel 29. Dez. bei
Mór; nur in Siebenbürgen kämpfte der Pole Bem mit
Glück und behauptete das untere Theißgebiet. Die
Hauptstadt Ofen Pest wurde 5. Jan. 1849 von den Ungarn
geräumt, und der Reichstag und der
Landesverteidigungsausschuß schlugen ihren Sitz in Debreczin
auf. Nur die Unfähigkeit Windischgrätz', der in dem ihm
unerwarteten und unverständlichen Rückzug der Ungarn
einen tief angelegten Plan argwöhnte und daher Bedenken trug,
kühn vorzudringen, gab den Ungarn Zeit, ihre Streitkräfte
zu vermehren und zu sammeln. Görgei, der sich in die Karpathen
zurückgezogen hatte, nötigte den aus Galizien bis Kaschau
vorgedrungenen General Schlik zum Rückzug und stellte die
Verbindung der ungarischen Armeen untereinander und mit der
Regierung in Debreczin her. Den Oberbefehl über die gesamte
ungarische Armee erhielt der Pole Dembinski, der aber im Kriegsrat
mit einer starken Opposition unter Görgei zu kämpfen
hatte. Dembinski verlor 27. Febr. die Schlacht von Kapolna gegen
Windischgrätz, dem es gelang, sich mit Schlik zu vereinigen,
und mußte sich hinter die Theiß zurückziehen.
Wiederum erlaubte Windischgrätz' Unthätigkeit der
ungarischen Regierung, ihre Rüstungen zu vollenden und
insgesamt 112 Infanteriebataillone und 6 Husarenregimenter neu
aufzustellen. Mit dem reorganisierten und verstärkten Heer
errang der neue Oberbefehlshaber Görgei eine Reihe von
glänzenden und erfolgreichen Siegen bei Gödöllo (6.
April), Waitzen (9. April), Nagy-Sarlo (19. April) und Mocsa (27.
April) über Windischgrätz und nach dessen Abberufung
über Welden. Die Österreicher räumten 24. April Pest
und zogen sich in Unordnung auf Preßburg zurück. Auch
aus Siebenbürgen und demBanat wurden die österreichischen
Truppen durch Bem und Perczel vertrieben.
Durch diese Siege verleitet, beschloß der Reichstag in
Debreczin 14. April auf Kossuths Antrag die Absetzung der
habsburg-lothringischen Dynastie und die völlige
Selbständigkeit des alle Nebenländer umfassenden
ungarischen Staats. Dieser Beschluß, welcher nebst der
Ernennung Kossuths zum Gubernator (Kormanyzo) 15. April in einem
besondern Manifest der Nation verkündet wurde, entzog den
Ungarn den sichern Rechtsboden und störte die bisherige
Einmütigkeit der Nation; Görgei mißbiligte ihn
entschieden und hielt sich auch in der Kriegführung streng an
die Verteidigung der ungarischen Verfassung und Gesetze,
unterließ es daher auch, mit seinem siegreichen Heer nach
Mähren und Österreich vorzudringen und sich mit den
dortigen unzufriedenen Elementen zu vereinigen. Er unternahm
vielmehr die Belagerung Ofens, das 21. Mai erstürmt wurde,
worauf Regierung und Reichstag nach Pest zurückkehrten, dessen
Besitz für den eigentlichen Gang des Kriegs nutzlos war. Die
österreichische Regierung hatte aber jetzt einen berechtigten
Grund, die Ungarn für Revolutionäre zu erklären und
die Hilfe Rußlands für die Sache der Legitimität
anzurufen. Der Zar Nikolaus leistete dieselbe bereitwilligst, und
sofort rückten russische Truppen in Siebenbürgen ein; die
Hauptarmee unter Paskewitsch, 100,000 Mann stark, überschritt
von Galizien aus die Karpathen. Auch Öfterreich
verstärkte seine Streitkräfte und stellte an deren Spitze
den General Haynau, einen rücksichtslos harten, aber
energischen Mann. Die ganze gegen U. verfügbare reguläre
Streitmacht belief sich auf 275,000 Mann mit 600 Geschützen,
welchen die Ungarn nur 135,000 Mann entgegenstellen konnten.
Während Bem in Siebenbürgen der Übermacht erlag,
Jellachich 7. Juni Perczel besiegte und Peterwardein
einschloß, Haynau 28. Juni Raab erstürmte, blieb
Gör-
1011
Ungarn (Geschichte 1849-1865).
gei hartnäckig bei Komorn stehen, lieferte daselbst noch 2.
Juli eine unentschiedene Schlacht und verließ es erst 12.
Juli, nachdem 9. Juli die Regierung zum zweitenmal Pest hatte
verlassen müssen und nach Szegedin geflohen war. Am 14. Juli
zogen die Österreicher wieder in Pest ein. Die Siege Vetters
über Jellachich bei Hegyes (14. Juli) und Görgeis
über die Russen bei Waitzen (17. Juli) konnten gegen die
Übermacht nichts mehr nützen. Haynau rückte gegen
Szegedin vor, welches die Ungarn aufgeben mußten, und schlug
Dembinski 5. Aug. bei Szöreg, Bem 9. Aug. bei Temesvar.
Kossuth legte darauf 11. Aug. in Arad die Leitung der Regierung
nieder und übertrug Görgei, der inzwischen mit seiner
Armee, das linke Theißufer abwärts marschierend, in Arad
angelangt war, die Diktatur. An der Möglichkeit fernern
Widerstandes verzweifelnd, faßte der neue Diktator,
übrigens mit Vorwissen und Zustimmung der Regierung, den
Beschluß, sich nicht den verhaßten Österreichern,
sondern den Russen zu ergeben, und streckte 13. Aug. mit 22,000
Mann bei Vilagos vor General Rüdiger bedingungslos die Waffen.
Ihm folgten 16. Aug. Oberst Kazinczy mit 10,000 Mann, 17. Aug.
Damjanich in Arad u. a.; nur Komorn wurde von Klapka
hartnäckig verteidigt, bis es 2. Okt. eine ehrenvolle
Kapitulation erlangte. "U. liegt zu den Füßen Ew.
Majestät!" schrieb Paskewitsch an den Zaren.
Daß die Ungarn die Unterwerfung unter den hochmütigen
Zaren der direkten Verständigung mit der österreichischen
Regierung, welcher sie übrigens von Rußland auf Gnade
oder Ungnade überliefert wurden, vorzogen, war für die
Österreicher beleidigend und reizte ihren Zorn aufs
äußerste. Von den gefangenen Häuptern der
Insurrektion (mehreren, wie Kofsuth u.a., war die Flucht nach der
Türkei geglückt) wurde nur Görgei auf russische
Intervention verschont; 13 Generale und Obersten wurden auf Haynaus
Befehl 6. Okt. in Arad teils erschossen, teils gehenkt, Ludwig
Batthyanyi und andre vornehme politische Führer in Pest zum
Tode durch den Strang verurteilt. Den Hinrichtungen folgten
zahllose Verurteilungen zu mehrjähriger Kerkerhaft. Erst im
Juli wurde Haynau, der das Standrecht mit blutiger Strenge
handhabte, abberufen. Nachdem der Kaiser im Herbst 1851 den
Erzherzog Albrecht zum Gouverneur von U. ernannt und 1852 selbst
das Land besucht hatte, wurde den kriegsgerichtlichen Prozessen ein
Ende gemacht und eine teilweise Amnestie erlassen. Die ungarische
Verfassung wurde für verwirkt erklärt und U. zu einem
bloßen Kronland des neuen österreichischen Gesamtstaats
umgewandelt, die Nebenländer Siebenbürgen, Kroatien und
Slawonien und das Temeser Banat von der ungarischen Krone getrennt
und zu selbständigen Kronländern erhoben. Über U.
ergoß sich ein Strom meist slawischer Beamten, welche das
Land in den zentralisierten Staat einfügen und die Reaktion
gegen die liberalen Neuerungen durchführen sollten. 1853
wurden österreichische Justiz und Verwaltung boktroyiert.
Für die Regelung des Verhältnisses zwischen den
Grundbesitzern und den frühern Grundholden, des sogen.
Urbarialverbandes, wurden zweckmäßige Einrichtungen
getroffen; für die materielle Entwickelung des Landes zeigte
sich die Regierung bemüht; auch wurden nach einem längern
Besuch des Kaisers 1857 die konfiszierten Güter der
kriegsrechtlich Verurteilten zurückgegeben und die ungarische
Sprache in Schule und Gericht zugelassen. Die Nation, durch die
fehlgeschlagene Insurrektion niedergedruckt und erschöpft,
setzte der Regierung ihren oft erprobten passiven Widerstand
entgegen und beharrte auf dem Verlangen nach Wiederherstellung der
Verfassung. Selbst fegensreiche kaiserliche Verordnungen, wie das
Protestantenpatent vom 1. Sept. 1859, welches für die
evangelische Kirche in U. eine auf dem Gemeindeprinzip beruhende
vortreffliche Verfassung einführte, wurden von den Ungarn als
verfassungswidrig zurückgewiesen.
Wiederherstellung des ungarischen Staats.
Die Notlage der Monarchie nach dem italienischen Krieg von 1859
zwang die Regierung zur Nachgiebigkeit: nachdem Erzherzog Albrecht
durch den Ungarn Benedek ersetzt worden, wurde durch das
Oktoberdiplom vom 20. Okt. 1866 die alte Verfassung Ungarns vor
1848 im wesentlichen wiederhergestellt und der Landtag zur Beratung
eines neuen Wahlgesetzes berufen, welches eine Vertretung aller
Stände ermöglichen sollte. Die ungarische Hofkanzlei, die
Komitatsverwaltung, die ungarische Justiz mit der Curia regia und
dem Judex cnriae in Pest, das Amt eines Tavernicus, die ungarische
Sprache als Amtssprache wurden wiederhergestellt. Die fremden
Beamten mußten das Feld räumen, die deutschen Gesetze
wurden für aufgehoben erklärt. Alle diese
Zugeständnisse wurden von den Ungarn aber nur als
Abschlagszahlung angenommen, als Preis der Versöhnung die
völlige Wiederherstellung des alten Rechtszustandes mit
Einschluß der Gesetze von 1848 und eine Amnestie gefordert.
Im Februar 1861 berief die Regierung gleichzeitig mit der
Verkündigung einer neuen Verfassung für den Gesamtstaat
den Landtag nach dem Wahlgesetz von 1848 ein; derselbe wurde 6.
April eröffnet. Das Unterhaus, in welchem der Schwerpunkt der
Verhandlungen lag, spaltete sich in zwei Parteien, die
Adreßpartei unter Deák, welche den Standpunkt der
Nation der Februarverfassung gegenüber in einer Adresse an den
Monarchen darlegen und damit den Weg der Verhandlungen betreten
wollte, und die Beschlußpartei unter Koloman Tisza, welche
die Rechtsgültigkeit der 48er Gesetze durch einfachen
Beschluß erklären wollte. Nach langen Debatten siegte 5.
Juni die Adreßpartei mit 155 gegen 152 Stimmen, aber ihre
Adresse, welche Personalunion mit Österreich verlangte, wurde
8. Juli vom Kaiser mit der Forderung einer vorherigen Revision der
48er Gesetze beantwortet. Als der Landtag darauf in einer zweiten
Adresse die Pragmatische Sanktion und die Gesetze von 1848 als die
allein annehmbare Grundlage bezeichnete, die Krönung Franz
Josephs von der Wiedervereinigung der Nebenländer mit U.
abhängig machte, die Beschickung des Wiener Reichsrats
ablehnte und gegen jeden Beschluß desselben protestierte,
brach die Wiener Regierung alle weitern Verhandlungen ab;
"Österreich kann warten", erklärte Schmerling in der
Hoffnung, daß U. sich schließlich der Februarverfassung
fügen werde. Bis dahin wurde, nachdem der Landtag 21. Aug.
1861 aufgelöst worden, wieder absolutistisch regiert;
gleichzeitig suchte man die öffentliche Meinung durch eine
Amnestie der politischen Sträflinge und Flüchtlinge sowie
durch eine Spende von 20 Mill. zur Linderung einer entsetzlichen
Hungersnot (1863) zu gewinnen. Aber schon 1865 wurde in Wien das
Regierungssystem wieder geändert: von dem liberalen
Zentralismus Schmerlings ging man zum altkonservativen
Föderalismus Belcredis über. Nach einem neuen Besuch des
Kaisers in Pest wurden die Führer der altkonservativen Partei
in U., Graf Mailath und Baron Sennyey, an die Spitze der
ungarischen Regierung gestellt und 14. Dez. 1865 der Landtag von
neuem
64
1012
Ungarn (Geschichte 1865-1878).
eröffnet. Die Thronrede versprach die Wiederherstellung der
Integrität der ungarischen Krone, erkannte die
Rechtskontinuität und die formelle Gültigkeit der Gesetze
von 1848 an, forderte aber deren Revision vor der Einführung.
Die Verhandlungen hierüber und über die Feststellung der
gemeinsamen Angelegenheiten der Gesamtmonarchie waren noch nicht
zum Abschluß gediehen, als wegen des Kriegs mit Preußen
der Landtag 26. Juni 1866 geschlossen wurde. In dem Streite, der
nach dem Frieden von Prag in Österreich über die
Neugestaltung des Reichs ausbrach (s.
Österreichisch-Ungarische Monarchie, S. 522), nahmen die
Ungarn unter Führung Deáks von Anfang an eine klare,
bestimmte Stellung ein und errangen dadurch einen glänzenden
Sieg. Um einer Auflösung der Monarchie in fünf
Königreiche und der Herrschaft der Slawen vorzubeugen,
entschied sich der leitende Minister v. Beust mit Zustimmung der
Deutschliberalen für den Dualismus, für die Teilung des
Reichs in eine westliche Hälfte, wo die Deutschen, und eine
östliche Hälfte, wo die Magyaren das Übergewicht
haben sollten. Beust verständigte sich in persönlichen
Verhandlungen mit den Führern der Deákpartei über
die Bedingungen des Ausgleichs zwischen Österreich und U. Dem
Reichstag, wie der Landtag nun wieder hieß, ward 18. Febr.
1867 die Wiederherstellung der Verfassung von 1848, für welche
nur wenige Modifikationen ausbedungen wurden, sowie die Einsetzung
eines besondern verantwortlichen Ministeriums unter dem Vorsitz von
Julius Andrássy angezeigt. Siebenbürgen und das Banat
wurden sofort mit U. wieder verschmolzen, mit Kroatien ward ein
Ausgleich vorbehalten, der am 20. Sept. 1868 zu stande kam. U. ward
als selbständiger Staat anerkannt, der mit Österreich
durch gewisse gemeinsame Angelegenheiten verbunden war und
zunächst auf zehn Jahre ein Zoll- und Handelsbündnis mit
ihm schloß. Von den anerkannten Staatsschulden und von den
gemeinsamen Ausgaben für das Auswärtige, Heer und Marine
übernahm U. bloß 30 Proz., stand aber in den
Delegationen der österreichischen Reichshälfte
ebenbürtig zur Seite. Mit allem Pomp früherer
Jahrhunderte erfolgte 8. Juni 1867 in Budapest die feierliche
Krönung des Königs, und damit war die Versöhnung der
Magyaren mit der Dynastie besiegelt. Die heimgekehrten
Flüchtlinge schlossen sich ehrlich der neuen Ordnung der Dinge
an, das Volk bethätigte bei jeder Gelegenheit seine
Loyalität, und der Reichstag, in welchem die
gemäßigte Deákpartei zunächst noch die
entschiedene Mehrheit hatte, nahm 1868 bereitwilligst das
Wehrgesetz in der Fassung der Regierung an; nicht nur das stehende
Heer, sondern auch die Landwehr wurde unter den Befehl des
Reichskriegsministeriums gestellt, die letztere jedoch als
Honvédarmee unter dem Kommando des Erzherzogs Joseph
besonders organisiert. Das Bewußtsein des durch Ausdauer und
Klugheit errungenen Siegs trieb die Magyaren an, den freiheitlichen
Ausbau des Nationalstaats möglichst rasch zu vollenden. Die
politische Gleichstellung der Juden, die fakultative Zivilehe, ein
Volksschulgesetz u. a. wurden beschlossen. Das
Nationalitätengesetz vom 29. Nov. 1868 bestimmte, daß
alle Bewohner Ungarns die einheitliche und unteilbare ungarische
Nation bilden, die ungarische Sprache Staatssprache sein sollte.
Das Übergewicht der Magyaren bei den Wahlen wurde durch
Verteilung der Wahlbezirke und des Stimmrechts aufrecht erhalten.
Vor allem wollte man die materielle Entwickelung des Landes durch
Eisenbahnen fördern, und durch Anleihen für den Bau von
Staatseisenbahnen und durch Zinsgarantien für
Privateisenbahnen belastete das Ministerium Lónyay, welches
November 1871 an Stelle des Andrássyschen getreten war, den
Staatshaushalt so sehr, daß, als noch schlechte Ernten,
Überschwemmungen u. dgl. hinzukamen, bald ein bedenkliches
Defizit in den Einnahmen (1874: 31 Mill.) eintrat und man schon
1873 zu neuen Steuern schreiten mußte; der geträumte
ungeheure Aufschwung des Landes erwies sich als eine Illusion. Auch
die Ministerien der Deákpartei, welche nach Lónyays
Rücktritt (November 1872) die Regierung übernahmen,
Szlávy und Bittó, vermochten selbst durch Anleihen
der Finanznot nicht abzuhelfen, und dies bewirkte die
Auflösung der Deákpartei, an deren Stelle jetzt als
herrschende Partei im Reichstag die aus einem Teil der
Deákpartei und dem gemäßigten Teil der bisherigen
Radikalen gebildete liberale Partei trat. Das Haupt der neuen
Partei war Koloman Tisza, welcher im Februar 1875 zunächst
unter Wenckheim als Minister des Innern, seit 16. Okt. aber als
Ministerpräsident die Seele der Regierung wurde. Das Defizit
wurde zunächst vom Finanzminister Szell durch eine Reform der
Steuererhebung bedeutend gemindert; dann erlangte Tisza bei den
Verhandlungen mit Österreich über die Erneuerung des
Handelsvertrags und des finanziellen Ausgleichs für U. eine
günstigere finanzielle Stellung durch Erhöhung der
Zölle und Anteil an der Nationalbank. Schwierig schien sich
die Lage Ungarns zu gestalten beim Ausbruch der orientalischen
Krisis 1875. Die Magyaren waren der slawischen Bewegung, welche
sich im Aufstand der Herzegowina, in der bulgarischen Empörung
und im serbisch-türkischen Krieg kundgab, durchaus abgeneigt
und gaben ihre Sympathien für die Türken bei
verschiedenen Gelegenheiten geräuschvoll zu erkennen. Das
Einschreiten Rußlands auf der Balkanhalbinsel, seine
glänzenden Erfolge im Winter 1877/78 und die Neutralität
der Reichsregierung diesen Ereignissen gegenüber erweckten in
U. die größten Besorgnisse. In dieser Zeit bewiesen
Tisza und die von ihm geleitete Mehrheit des Reichstags eine
wirklich staatsmännische Klugheit. Sie bereiteten der
auswärtigen Politik des Reichs keine Schwierigkeiten, ja als
die Okkupation Bosniens und der Herzegowina 1878 große
Verluste und Kosten verursachte und die Entrüstung über
die unpopuläre Unternehmung in U. aufs höchste stieg,
gelang es Tisza, den Sturm zu beschwichtigen und sich und die
liberale Partei in der Herrschaft zu behaupten. In den Delegationen
konnte die Reichsregierung auf die Unterstützung der Ungarn
und damit auf die Annahme ihrer Anträge auch gegen die
deutschliberale Partei in Osterreich rechnen: die Kosten der
Okkupation und die Organisation der neuen Provinzen wurden von
ihnen bewilligt, das Wehrgesetz auf neue zehn Jahre genehmigt.
Dafür thaten der Hof und die Reichsregierung alles, um Tisza
und die liberale Partei zu unterstützen. Die nicht seltenen
Beispiele von Bestechlichkeit von Beamten und Mitgliedern der
herrschenden Partei und von Beteiligung derselben an
Geldgeschäften, die zu Skandalen und Duellen führten,
schadeten der ungarischen Regierung nicht ernstlich. In der
rücksichtslosen Magyarisierung Ungarns, in der
Unterdrückung der Deutschen, namentlich der Siebenbürger
Sachsen, wurde dem Ministerium von Wien aus völlig freie Hand
gelassen, während gleichzeitig in Österreich die
deutschliberale
1013
Ungarweine - Ungehorsam.
Verfassungspartei wegen ihrer kurzsichtigen Opposition gegen die
auswärtige Politik der Krone ihre maßgebende Stelle
einbüßte. Indem Tisza entschieden dafür eintrat,
daß der Staat vor allem ungarisch sein, gleichzeitig aber in
der Gesamtmonarchie seine Interessen nachdrücklich zur Geltung
bringen müsse, gelang es ihm immer wieder, die Opposition im
Parlament zu besiegen und bei den Wahlen die Mehrheit zu behalten.
In der That war das Programm der äußersten Linken,
Losreißung von Österreich, unausführbar und, wenn
es ausgeführt worden wäre, von den schädlichsten
Folgen für U. Die Finanzverhältnisse nahmen immer noch
die besondere Aufmerksamkeit in Anspruch, da das Desizit aus dem
Staatshaushalt nicht zu beseitigen war. Es wurden daher
frühere Anleihen zu einem geringern Zinsfuß konvertiert
und neue Steuern eingeführt, andre erhöht. Die
Magyarisierung der Schulen wurde 1883 durch ein Gesetz über
die Mittelschulen, welches die Kenntnis des Magyarischen für
alle Prüfungen vorschrieb, fortgesetzt. Die Ablehnung eines
Gesetzes über die Eheschließung zwischen Christen und
Juden durch das Oberhaus (1884) brachte die lange beabsichtigte
Reform desselben in Gang. Dieselbe wurde 1886 zum Gesetz erhoben,
beseitigte die alte Magnatentafel, die nahezu 900 zu zwei Dritteln
gänzlich verarmte Mitglieder zählte, und bestimmte,
daß fortan außer 50 von der bisherigen Tafel zu
wählenden Magnaten, 30 von der Regierung zu ernennenden
Mitgliedern, den katholischen Prälaten und den
protestantischen Kirchenhäuptern das Magnatenhaus aus
denjenigen Magnaten bestehen solle, welche 3000 Gulden Grundsteuer
zahlten. Die Opposition versuchte vergeblich, Tisza zu
stürzen; selbst ein Anfang 1889 mit Volksaufläufen
verbundener heftiger Ansturm gegen das neue Wehrgesetz, welches die
Pflichten der Einjährig-Freiwilligen verschärfte und die
Kenntnis der deutschen Sprache von allen Reserve und
Landwehroffizieren verlangte, vermochte die Stellung des gewandten
Mannes nicht zu erschüttern.
[Litteratur.] Schwandtner, Scriptores rerum hungaricarum (Wien
1746-48, 3 Bde.); Endlicher, Rerum hungar. monumenta Arpadiana (St.
Gallen 1849); Katona, Historia critica regum Hungariae (Pest
1779-97, 42 Bde.); Pray, Annales regum Hungariae (Wien 176470, 5
Bde.); Engel, Geschichte des ungarischen Reichs und seiner
Nebenländer (Halle 17971804, 4 Bde.); Derselbe, Geschichte des
Königreichs U. (Wien 181415, 5 Bde.); Feßler, Geschichte
der Ungarn und ihrer Landsassen (neue Bearbeitung von Klein, Leipz.
1867 bis 1883, 5 Bde.); Mailáth, Geschichte der Magyaren (2.
Aufl., Regensb. 1852-53, 5 Bde.); Szalay, Geschichte Ungarns
(deutsch von Wögerer, Pest 1870 bis 1875, 3 Bde.);
Horváth, Geschichte Ungarns (deutsch, das. 1863, 2 Bde.),
und desselben größeres Werk in ungarischer Sprache (3.
Aufl., das. 1873, 8 Bde.); Krajner, Die ursprüngliche
Staatsverfassung Ungarns (Wien 1872); Büdinger, Ein Buch
ungarischer Geschichte, 10581100 (Leipz. 1866); Marczali, Ungarns
Geschichtsquellen im Zeitalter der Arpaden (Berl. 1882); Salamon,
U. im Zeitalter der Türkenherrschaft (deutsch, Leipz. 1887);
Horvath, Fünfundzwanzig Jahre aus der Geschichte Ungarns,
182348 (deutsch, das. 1867, 2 Bde.); Szemere, Hungary from 1848 to
1860 (Lond. 1860); Vargyas, Geschichte des ungarischen
Freiheitskampfes (Preßb. 1869); Springer, Geschichte
Österreichs seit dem Wiener Frieden 1809, Bd. 1 u. 2 (Leipz.
1863-65); Rogge, Österreich von Vuagos bis zur Gegenwart (das.
1872-73, 3 Bde.); Ujfalvy, La Hongrie, son histoire, sa langue, sa
litterature (Par. 1872); Léger, La Hongrie politique et
religieuse (Brüssel 1860); Derselbe, La Hongrie et les Slaves
(das. 1860); Sayous, His toiregenerale des Hongrois (Par. 1876, 2
Bde.); "Ungarische Reichstagsakten"; "Historisches Archiv",
herausgegeben von der Ungarischen Historischen Gesellschaft.
Uugarweine, die in Ungarn und seinen ehemaligen
Nebenländern erzeugten Weine, zeigen eine
außerordentliche Mannigfaltigkeit, aber sämtlich einen
südlichen Charakter. Der edelste Ungarwein, welcher eine ganz
exzeptionelle Stellung einnimmt, ist der Tokayer (s. Tokay); ihm am
nächsten steht der Menes-Magyarat aus dem Arader Komitat,
weiße und rote starke Ausbruch- und Tafelweine, dann der
Ruster aus dem Ödenburger Komitat, weiße, starke,
süße, aromatische Ausbruch- und Tafelweine, von denen
die Ausbrüche besonders im Ausland, vor allem in England,
beliebt sind. Alle diese Hauptgewächse stufen sich nach Lage,
Mostung und Kellerbehandlung von den edelsten Dessertweinen bis zu
gewöhnlichen Tischweinen ab. Ausgezeichnete rote Tafelweine
kommen von Erlau, Vifonta, Szegszard, Villany, dem Baranyaer
Komitat, Ofen und Umgebung, Vajujhely, Krassoer Komitat. Die
Szegszarder Weine, etwas schwer und öfters erdig, zeichnen
sich besonders durch ihre reiche Farbe aus und werden vielfach
exportiert, um auf Medoc verarbeitet zu werden. Die besten
Plätze für weiße Weine sind: Magyarat, Somlo, das
Veszprimer Komitat, Badacson, die Plattenseegegend, Naszmely,
Ermellak, PestSteinbruch, Szerednye, die Komitate Neograd, Hont,
Preßburg, Weißenburg, Somogy und Eisenburg. Die besten
Somlauer Weine, entsprechend behandelt, stehen dem besten Sauterne
nicht nach. Als ungarische Rheinweine kommen verschiedene aus
Riesling und Traminer gewonnene Weine in den Handel. Die Weine des
Banats und der Woiwodina sind im Durchschnitt den kleinen
Ungarweinen gleich und überschreiten nur in seltenen Ausnahmen
die dritte Rangklasse. Man bereitet in ganz Ungarn und seinen
Nebenländern auch "gekochte Weine aus eingedampftem Most,
welche unter den Namen "Wermut" und "Senf" in den Handel kommen.
Derartige Senfweine liefert besonders Werschetz. Schaumwein wird in
Preßburg und Pest in großem Maßstab
dargestellt.
Ungedeckte Noten, die Banknoten, für welche nicht
Barvorräte zur Einlösung vorhanden sind (s. Banken, S.
325).
Ungehorsam (Kontumaz), in der Rechtssprache das
Nichtbefolgen einer richterlichen Auflage, sei es einer Ladung oder
einer richterlichen Anweisung zur Vornahme oder Unterlassung einer
Handlung. Die Folgen, welche der U. im Strafprozeß nach sich
zieht, sind von denjenigen verschieden, welchen der Ungehorsame
(Kontumax) im bürgerlichen Rechtsstreit ausgesetzt ist. Denn
der moderne Strafprozeß wird von dem Grundsatz der
Mündlichkeit des Verfahrens beherrscht, und diesem entspricht
die Regel, daß die Anwesenheit des Angeklagten in der
Hauptverhandlung notwendig ist. Nur ausnahmsweise kann bei U. des
Angeklagten in dessen Abwesenheit verhandelt und entschieden
werden. Die deutsche Strafprozeßordnung unterscheidet dabei
zwischen dem abwesenden und dem ausgebliebenen (flüchtigen)
Angeklagten. Als abwesend gilt der Angeklagte, wenn sein Aufenthalt
unbekannt ist, oder wenn er sich im Ausland aufhält und seine
Gestellung vor das zuständige Ge-
1014
Ungelt - Unger.
richt nicht ausführbar oder nicht angemessen erscheint.
Gegen den abwesenden Angeklagten ist eine Haupt-Verhandlung nur
dann statthaft, wenn die strafbare Handlung mit Geldstrafe oder
Einziehung bedroht ist, oder wenn es sich um eine Person handelt,
die sich der Wehrpflicht entzogen hat. In solchen Fällen ist
eine öffentliche Ladung notwendig. Gegen den abwesenden
Angeklagten kann eine Beschlagnahme einzelner
Vermögensstücke oder des ganzen Vermögens
verfügt werden. Gegen einen ohne Entschuldigung ausgebliebenen
Angeklagten wird ein Vorführungs- oder ein Haftbefehl
erlassen. In seiner Abwesenheit darf nur dann verhandelt werden,
wenn seine That mit Haft, Geldstrafe oder Einziehung bedroht ist,
oder wenn sich der Angeklagte nach seiner Vernehmung aus der
Hauptverhandlung entfernte, endlich auch in leichtern Fällen,
wenn das Gericht ihn wegen allzu großer Entfernung seines
Aufenthaltsorts vom Erscheinen entbunden hat. Im bürgerlichen
Rechtsstreit besteht dagegen das System, daß von einer
Partei, welche innerhalb der dazu gesetzten Frist oder in dem dazu
bestimmten Termin eine Rechtshandlung nicht vornimmt, angenommen
wird, sie verzichte auf ebendiese Rechtshandlung. Bei den
gesetzlich bestimmten Notfristen, z. B. bei der Frist zur Einlegung
der Berufung, tritt der Verlust des Rechtsmittels mit dem Ablauf
der Frist von selbst ein. Außerdem ist ein besonderes
Ungehorsams- (Kontumazial-, Versäumnis-) Verfahren und ein
ausdrücklicher Antrag (Ungehorsamsbeschuldigung, Accusatio
contumaciae) des Gegners erforderlich, um ein Versäumnisurteil
(Verurteilung in contumaciam) gegen den Ungehorsamen
herbeizuführen (s. Versäumnis). U. gegenüber einem
rechtskräftigen Urteil hat die Einleitung der
Zwangsvollstreckung (s. d.) zur Folge. Vgl. Deutsche
Strafprozeßordnung, § 318 ff., 470 ff., 229 ff.;
Zivilprozeßordnung, § 209 ff., 295 ff.
Ungelt (später Umgelt), auch Unrecht, eine
frühere Bezeichnung für Aufwandsteuern (insbesondere
Steuer vom Kleinverkehr als Vorläufer der spätern
Accise), bedeutet nach Lang ("Teutsche Steuerverfassung", 1795)
eine außerordentliche Abgabe; von Hüllmann wird dieser
Ausdruck auf die Unzufriedenheit der Steuerpflichtigen
zurückgeführt.
Unger, 1)Johann Georg, Formschneider, geb. 1715 zu Goos
bei Pirna, erlernte in letzterer Stadt die Buchdruckerkunst und
trieb zugleich als Autodidakt die Holzschneidekunst. Seit 1740 in
Berlin, befaßte er sich von 1757 an ausschließlich mit
dem Formschnitt. Unter seinen Arbeiten ist eine Folge von fünf
Landschaften hervorzuheben. U. erfand auch eine Druckpresse sowie
eine Rammmaschine. Er starb 1788.
2) Johann Friedrich, Buchdrucker, Form und Stempelschneider,
Sohn des vorigen, geb. 1750 zu Berlin, trat in die Fußstapfen
seines Vaters und bildete sich zu einem der ausgezeichnetsten
Männer seines Faches. Die von ihm erfundene Frakturschrift
(Ungersche Schrift) hatte Ähnlichkeit mit der Schwabacher
Schrift, war aber geschmackvoller. U. wurde 1800 Professor der
Holzschneidekunst an der Berliner. Akademie und wirkte in dieser
Stellung für die künstlerische Wiederbelebung derselben.
Er starb 1804.
3) Franz, Botaniker und Paläontolog, geb. 30. Nov. 1800 auf
dem Gut Amthof bei Leutschach in Steiermark, studierte zu Graz,
Wien und Prag zuerst die Rechte, dann Medizin, praktizierte seit
1827 als Arzt in Stockerau bei Wien, seit 1830 als
Landesgerichtsarzt zu Kitzbühel in Tirol, ward 1836 Professor
der Botanik an der Universität Graz, 1850 Professor der
Pflanzenphysiologie in Wien, bereiste 1852 Nordeuropa, später
den Orient und lebte seit 1866 im Ruhestand auf seinem Landgut bei
Graz, wo er 13. Febr. 1870 starb. Er erwarb sich zuerst wesentliche
Verdienste um die Paläontologie, wandte sich aber später
mehr der Physiologie und Phytotomie zu und förderte namentlich
die Lehre von den Zellen und dem Protoplasma. Er schrieb:
"Über den Einfluß des Bodens auf die Verteilung der
Gewächse" (Wien 1836); "Über den Bau und das Wachstum des
Dikotyledonenstamms" (Petersb. 1840); "Über Kristallbildungen
in den Pflanzenzellen" (das. 1840); "Grundzüge der Anatomie
und Physiologie der Pflanzen"(das. 1846); "Anatomie und Physiologie
der Pflanzen" (Wien 1855); "Grundlinien der Anatomie und
Physiologie der Pflanzen" (das. 1866); "Synopsis plan tarum
fossilium" (Leipz. 1845); "Chloris protogaea, Beiträge zur
Flora der Vorwelt" (das. 1841-1847); "Genera et species plantarum
fossilium (Wien 1850); "Iconographia plantarum fossilium" (das.
I852); "Sylloge plantarum fossilium" (das. 1860); "Die Urwelt in
ihren verschiedenen Bildungsperioden" (das. 1851, 3. Aufl. 1864);
"Versuch einer Geschichte der Pflanzenwelt (das. 1852); "Geologie
der europäischen Waldbäume" (Graz 1870). Außerdem
veröffentlichte er: "Wissenschaftliche Ergebnisse einer Reise
in Griechenland und den Ionischen Inseln" (Wien 1862); "Die Insel
Cypern" (mit Kotschy, das. 1865); "Botanische Briefe" (das. 1852);
"Botanische Streifzüge auf dem Gebiet der Kulturgeschichte"
(das. 1857-67, 7 Tle.). Vgl. Reyer, Leben und Wirken des
Naturhistorikers Franz U. (Graz 1871); Leitgeb, Franz U.,
Gedächtnisrede (das. 1870).
4)Friedrich-Wilhelm, Jurist und Kunsthistoriker, geb. 8. April
1810 zu Hannover, studierte in Göttingen die Rechte, trat dann
bei dem Amt Hannover in den praktischen Justizdienst und ward 1838
als Amtsassessor nach Göttingen versetzt, worauf er sich 1840
als Privatdozent in der juristischen Fakultät habilitierte.
Seine Anstellung als Sekretär der Universitätsbibliothek
(1845) war die Veranlassung, daß er seine Lehrthätigkeit
aufgeben mußte. Erst 1858 begann er wi der Vorlesungen und
zwar über Kunstgeschichte in der philosophischen
Fakultät, was 1862 seine Ernennung zum außerordentlichen
Professor und Direktor der akademischen Gemäldesammlung zur
Folge hatte. Er starb 22. Dez. 1876 in Göttingen. Als
juristischer Schriftsteller hat er auf dem Gebiet der deutschen
Rechtsgeschichte Hervorragendes geleistet. Sein bedeutendstes Werk
ist die "Geschichte der deutschen Landstände" (Hannov. 1844, 2
Tle.). Außerdem sind zu nennen: "Die altdeutsche
Gerichtsverfassung" (Götting. 1842); "Des Richtes Stig" (das.
1847); "Römisches und nationales Recht" (das. 1848). Von
seinen kunstgeschichtlichen Schriften sind hervorzuheben: "Die
Perspektive" (Götting. 1856); "Die bildende Kunst" (das.
1858); "Übersicht der Bildhauerund Malerschulen seit
Konstantin d. Gr." (das. 1860); "Die Bauten Konstantins d. Gr. am
Heiligen Grab zu Jerusalem" (das. 1863); "Correggio in seinen
Beziehungen zum Humanismus" (Leipz. 1863).
5) Joseph, hervorragender österreich. Jurist und
Staatsmann, geb. 2. Juli 1828 zu Wien, studierte daselbst und
habilitierte sich 1852 als Privatdozent, ging 1853 als
außerordentlicher Professor des Zivilrechts nach Prag, von wo
er 1857 wieder nach Wien berufen ward. Lebenslängliches
Mitglied des Herrenhauses, gehörte er vom November 1871 bis
Februar 1879 zum Kabinett Adolf Auersperg als Minister ohne
Portefeuille, in welcher Eigenschaft er durch sein ausgezeichnetes
Rednertalent die Regierung so geschickt
1015
Ungerade Zahl - Unguentum
vertrat, daß er sich den Namen des "Sprechministers"
erwarb. Im Januar 1881 wurde er zum Präsidenten des
Reichsgerichts ernannt. Seinen juristischen Ruf begründete er
durch das "System des österreichischen allgemeinen
Privatrechts" (Bd. 1 u. 2,Leipz. 1856-59, 4. Aufl. 1876; Bd. 6,
1864, 3. Aufl. 1879), ein Werk, welches zu den bedeutendsten
Erscheinungen der juristischen Litteratur zählt und in der
Entwickelung der österreichischen Jurisprudenz Epoche gemacht
hat. Außerdem nennen wir von ihm: "Die Ehe in ihrer
welthistorischen Entwickelung" (Wien 1850); "Über die
wissenschaftliche Behandlung des österreichischen gemeinen
Privatrechts" (das. 1853); "Entwurf eines bürgerlichen
Gesetzbuchs für das Königreich Sachsen" (das. 1853); "Die
rechtliche Natur der Inhaberpapiere" (Leipz. 1857); "Die
Verlassenschaftsabhandlung in Österreich" (Wien 1862); "Zur
Reform der Wiener Universität" (das. 1869); "Die Verträge
zu gunsten Dritter" (Jena 1869). Mit seinem Ministerkollegen Glaser
begründete er die "Sammlung von zivilrechtlichen
Entscheidungen des k. k. obersten Gerichtshofs" (Wien 1859 ff., 2.
Aufl. 1873 ff.).
6) William, Kupferstecher, Sohn von U. 4), geb. 11. Sept. 1837
zu Hannover, bildete sich seit 1854 auf der Akademie zu
Düsseldorf unter Keller, arbeitete seit 1857 bei Thäter
zu München, kehrte 1860 nach Düsseldorf zurück und
ging 1865 nach Leipzig, sodann nach Weimar. Auf Anregung des
Verlegers der "Zeitschrift für bildende Kunst" begann er 1866,
Gemälde alter, besonders niederländischer, Meister im
Museum zu Braunschweig zu radieren, denen 1869 eine zweite Reihe
von Blättern nach Gemälden der Kasseler Galerie folgte.
Durch diese Vorarbeiten eignete er sich eine so große
Gewandtheit in der Handhabung der Radiernadel an, daß er die
Kunst der Radierung in Deutschland neu belebte und zahlreiche
Nachfolger und Schüler fand. Den Winter von 1871 bis 1872
brachte er in Holland zu, wo die Blätter zur "Frans
Hals-Galerie" (mit Text von Vosmaer) entstanden. Von da ab
entfaltete er eine sehr umfangreiche Thätigkeit, welche sich
auch auf Nachbildungen von Gemälden moderner Künstler
erstreckte. Sein Hauptwerk ist die "Galerie des Wiener Belvedere"
(mit Text von K. v. Lützow). Von einzelnen Blättern ist
besonders die Radierung nach dem Ildefonsoaltar von Rubens (im
Auftrag der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst in
Wien) hervorzuheben. Seine künstlerische Eigenart
befähigte ihn vorzugsweise zur Wiedergabe der Gemälde der
Niederländer (Rubens, van Dyck, Fr. Hals, Rembrandt), der
Venezianer (Tizian, Veronese) und der Spanier (Murillo, Velazquez)
der Blütezeit, deren koloristische Wirkungen er mit feinem
Verständnis nachzubilden vermag. Er lebt als Professor in
Wien.
Ungerade Zahl, eine solche, welche durch 2 nicht teilbar
ist, z. B. 1, 3, 5 etc.
Ungericht (altd.), s. v. w. Missethat oder
Verbrechen.
Ungern-Sternberg, Alexander, Freiherr von,
Romanschriftsteller, geb. 22. April 1806 auf dem väterlichen
Gut Noistfer bei Reval, sollte sich dem Studium der Rechte widmen,
folgte aber seiner Neigung zur Poesie und lebte seit 1830 in
Deutschland, wo er sich nach wechselndem Aufenthalt später
bleibend in Dresden niederließ. Er starb 24. Aug. 1868 zu
Dannenwalde in Mecklenburg Strelitz. U. hat in einer langen Reihe
von Romanen und Novellen, immer aber mit hervorstechender
Frivolität, die verschiedenartigsten Stoffe behandelt. Die
Rokokozeit ist die eigentliche Domäne seines Talents. Der
romanhafte Inhalt dieser Novellen (z. B. "St. Sylvan", Frankf.
1839; "Die gelbe Gräfin", Berl. 180) ist dürftig, die
künstlerische Komposition schwach, die. Charakteristik oft
oberflächlich; aber der kulturhistorische Hintergrund ist treu
und sicher gezeichnet so namentlich in "Berühmte deutsche
Frauen des 18. Jahrhunderts" (das. 1848). Zu dem Besten, was U.
schrieb, gehören die Erzählungen: "Galathee (Stuttg.
1836) und "Psyche" (Frankf. 1838, 2 Bde.) Als der soziale
Tendenzroman Mode wurde, trat er mit "Diane" (Berl. 1842, 3 Bde.)
und "Paul" (Hannover 1845, 3 Bde.) hervor, ohne es freilich zur
rechten ethischen und psychologischen Tiefe zu bringen. Letzteres
Werk hatte zugleich die Absicht, für eine Reorganisation des
Adels Propaganda zu machen, und diese Tendenz bewirkte 1848 des
Verfassers Anstellung als Mitarbeiter am Feuilleton der
"Kreuzzeitung". Da aber seine "Neupreußischen Zeitbilder"
(Brem. 1848-49, 2 Bde.) wenig Beifall fanden, ließ er die
Politik fallen und suchte durch die Erfindung von Pikantem auf
frivolem Gebiet zu gefallen, so namentlich in den "Braunen
Märchen" (das. 1850, 4. Aufl. 1875) und in den "Rittern von
Marienburg" (Leipz. 1853, 3 Bde.). Die "Erinnerungsblätter"
(Leipz. 185560, 6 Bde.) erzählen des Verfassers
Lebensgeschichte. Viel Fesselndes enthält die "Dresdener
Galerie" (Leipz. 185758, 2 Bde.), eine Reihe von Kunstnovellen und
biographischen Skizzen. Die historischen Romane: " Dorothea von
Kurland " (Leipz. 1859, 3 Bde.), " Elisabeth Charlotte" (das. 1861,
3 Bde.), "Peter Paul Rubens" (das. 1862) u. a. verfielen schon
völlig dem Ton der Leihbibliothek. Kleinere Erzählungen
erschienen gesammelt als "Novellen" (Stuttg. 18323, 5 Bde.),
"Erzählungen und Novellen" (Dess. 1844, 4 Bde.) und "Kleine
Romane und Erzählungen" (Jena 1862, 3 Bde.).
Unger-Sabatier (spr. -ssabatjeh, in Italien Ungher
genannt), Karoline, Opernsängerin, geb. 1800 zu Wien, wurde
von Ronconi in Mailand ausgebildet und debütierte 1819 in Wien
als Cherubin in Mozarts "Figaro". Dort engagierte sie der
Unternehmer Barbaja für Italien, wo sie in allen großen
Städten weniger durch die Kunst als durch die dramatische
Kraft ihres Gesanges Begeisterung erregte. Im Dezember 1833 errang
sie auch am italienischen Theater in Paris einen glänzenden
Erfolg. 1840 verließ sie die Bühne, nachdem sie sich mit
Sabatier verheiratet hatte, und zog sich auf eine Villa bei Florenz
zurück, wo sie 23. März 1877 starb.
Unglückshafte, s. Termiten.
Unglückstage, s. Tagewählerei.
Ungnad, Hans, Freiherr zu Sonegg, Förderer der
Reformation unter der südslawischen Bevölkerung
Österreichs. Geb. 1493 als Sohn eines Kaiserlichen
Kammermeisters, nahm er ruhmvollen Anteil an den Feldzügen
gegen die Türken, wandte sich in spätern Lebensjahren der
Sache der Reformation zu, ging 1554 nach Wittenberg, legte 1557
seine Stelle als Statthalter von Steiermark nieder, weil den
Evangelischen freie Religionsübung verweigert ward, und ging
zu Herzog Ulrich von Württemberg, der ihm ein früheres
Stift zu Urach als Wohnsitz überwies. Dort bewirkte er die
Berufung des um die reformatorische Bewegung in Krain verdienten
Truder nach Württemberg. Beide Männer errichteten jetzt
eine Druckerei, durch welche lange Zeit die südlichen
Länder Österreichs mit reformatorischen Schriften
versehen wurden, bis der Kaiser sie im Dreißigjährigen
Krieg aufhob und der Propaganda in Rom schenkte. U. starb 27. Dez.
1564 zu Wietritz in Böhmen.
Unguéntum (lat.), Salbe (s. d.).
1016
Ungulata - Union.
Ungulata, Huftiere.
Ungvar, Stadt, s. Ung.
Uniamiembe, Landschaft im S. von Uniamvesi in
Äquatorialafrika, unter 5° südl. Br. Hauptort und
Missionsstation ist Tabora (Kase), Knotenpunkt der
Karawanenstraßen zum Tanganjika und zum Ukerewe, mit
großen Warenlagern der arabischen Händler.
Uniamvesi ("Mondland"), große Landschaft in
Äquatorialafrika, südlich vom Ukerewe, östlich vom
Tanganjika, vom 4.° südl. Br. durchzogen, nach Speke nicht
viel kleiner als England, liegt zum großen Teil auf dem
1000-1200 m hohen Tafelland, welches die Wasserscheide zwischen
Ukerewe, Tanganjika und Lufidschi bildet. Nach N. dacht es sich zum
Ukerewe ab, dessen Südrand noch in seine Grenzen fällt;
hier umschließt es die ungemein fruchtbaren Landschaften von
Usabi und Uhindi. Dieser nördliche Teil wird von den Bewohnern
Usukuma (Mitternachtsland) nannt, im Gegensatz zu dem
südlichen Utakama (Mittagsland). Das Land ist im allgemeinen
eins der fruchtbarsten und bevölkertsten im äquatorialen
Osten. Zugleich ist es durch die Kreuzung der nach dem Tanganjika
und dem Ukerewe führenden und bei der Missionsstation Tabora
sich spaltenden Karawanenwege das belebteste und wichtigste
Handelsland im Innern Ostafrikas. Das Land stand früher unter
einem Herrscher, ist aber im Lauf seiner neuesten Geschichte in
eine Anzahl von Kleinstaaten zerfallen. Die Bewohner, die
Waniamwesi, sind dunkler von Farbe als ihre Nachbarn, schlagen die
untern Schneidezähne aus und splittern eine dreieckige
Lücke zwischen die zwei innern Schneidezähne der obern
Reihe, tragen schwere Kupferringe um die Arme, rauchen und trinken
stark, bauen aber ihr Land gut an, weben auf eignen
Webstühlen, schmelzen Eisen und sind als Händler oder
Träger überall zwischen Sansibar und Udschidschi
anzutreffen. Seitdem sich Araber zahlreich unter ihnen
niedergelassen haben, sind sie verarmt, einzelne haben sich aber,
wie jene, eifrig dem Sklaven und Elfenbeinhandel gewidmet und es
teilweise zu großem Wohlstand gebracht. S. Karte bei Artikel
"Congo".
Ünîe (im Altertum Önoe), Stadt im
türk. Wilajet Trapezunt in Kleinasien, am Schwarzen Meer,
beliebter Aufenthalt reicher Mohammedaner, hat einen Hafen,
Baumwollweberei, Schiffbau, Handel mit Holz, Korn, Flachs etc. und
6000 Einw. (Mohammedaner und Griechen). Die Umgegend ist reich an
Eisen.
Unieren (lat.), vereinigen; uniert, vereinigt, besonders
von früher getrennten Religionsgenossenschaften (s.
Union).
Unierte Griechen, diejenigen griech. Christen, welche
sich mit Beibehaltung ihrer alten Kirchenverfassung, ihrer Sprache
beim Gottesdienst, ihrer Fasten und des Abendmahls unter beiderlei
Gestalt, aber mit Annahme der Lehre, daß der Heilige Geist
auch vom Sohn ausgehe, der Lehren vom Fegfeuer und vom Primat des
Papstes mit der römischen Kirche wieder vereinigt haben. Im
ganzen gibt es ihrer jetzt gegen 5 Mill., welche vorzüglich in
Italien, Polen, Siebenbürgen, Ungarn, Kroatien, Dalmatien und
in der Türkei leben. S. Union.
Unifizieren (lat.), in eine Einheit, Gesamtheit
verschmelzen, z. B. Staatsschulden, Anleihen.
Unifórm (lat.), die "gleichförmige"
Bekleidung der Militärpersonen sowie gewisser Klassen von
Zivilbeamten. Die Einführung derselben fällt in das 17.
Jahrh. und kann als gleichzeitig mit der Errichtung der stehenden
Heere angenommen werden. Farbe, Schnitt und Stoff der U.
unterscheiden hauptsächlich die Soldaten verschiedener
Länder und verschiedener Waffengattungen; die daran
befindlichen Abzeichen dagegen dienen zur Unterscheidung der
einzelnen Truppenkörper sowie der verschiedenen Grade.
Uniformitätsakte, s. Presbyterianer.
Unigenitus Dei fllius (lat.), Anfangsworte der vom Papst
Clemens XI. im September I713 erlassenen Bulle, worin 101
Sätze aus Quesnels "Réflexions morales" verdammt wurden
(s. Jansen). Vgl. Schill, Die Konstitution U. (Freiburg 1876).
Unikum (lat.), das Einzige in seiner Art, nur einmal
Vorhandene, besonders von Münzen, alten Kunstwerken,
Holzschnitten etc. gebraucht.
Unimak, s. Aleuten.
Unio, Flußmuschel.
Uniõn (lat.), Vereinigung, Verbindung, namentlich
der Bund mehrerer Staaten. Geschichtlich merkwürdig sind
namentlich die Kalmarische U. vom. 20. Juli 1397 (s. Kalmar), die
Utrechter U. vom 23. Jan. 1579 (s. Niederlande, Geschichte, S. 149)
und die U. protestantischer Fürsten und Städte von 1608
zum Schutz ihrer gemeinsamen Religionsinteressen (s.
Dreißigjähriger Krieg, S. 132). In Deutschland versuchte
ferner Preußen 1850 eine U. der Klein und Mittelstaaten unter
preußischer Führung, zu welchem Zweck das Erfurter
Unionsparlament berufen ward (s. Preußen, S. 374). Im
staatsrechtlichen Sinn versteht man unter U. die Verbindung zweier
Staaten, welche unter einem und dem selben Souverän stehen (s.
Staat, S. 196).
Auf kirchlichem Gebiet bezeichnet U. die Vereinigung
verschiedener Religions- oder Konfessionsparteien zu Einer Gemeinde
oder Kirche. Der Trieb nach Beseitigung der kirchlichen Spaltungen
zieht sich (unter stetiger Berufung auf Joh. 10, 16; 17, 21-23;
Eph. 4, 3-6) durch die ganze Geschichte der Kirche hindurch.
Während aber die katholische Kirche bei ihren Attributen der
Einheit, Allgemeinheit und Untrüglichkeit eine U. nur durch
das Aufgehen aller andern Kirchenparteien in ihrer Gemeinschaft
erstreben kann, erlaubt die evangelische Kirche bei ihrer
prinzipiell freiern Stellung zum Dogma, zu der kirchlichen
Verfassung und zu den gottesdienstlichen Einrichtungen eine
Vereinigung zweier oder mehrerer Kirchenparteien innerhalb eines
gewissen gemeinsamen Rahmens von Glaubensanschauungen und
Kultuseinrichtungen unter einheitlichem Kirchenregiment. Die
ältesten Unionsversuche bezweckten Vereinigung der griechisch-
und römisch-katholischen Kirchen und sind meist von den
griechischen Kaisern aus politischen Rücksichten ausgegangen.
Schon die Verhandlungen auf der Synode zu Lyon 1274 führten
dazu, daß die Griechen den Primat des römischen Bischofs
anerkannten; die Kirchenversammlung von Konstantinopel 1285 nahm
aber alle Konzessionen wieder zurück. Denselben
Mißerfolg erntete seit 1439 das Florentiner Konzil (s. d.),
so daß die Zahl der "unierten Griechen" (s. d.) eine sehr
geringe blieb. Dagegen gelang die U. Der Katholiken mit den
Maroniten(s.d.) und einem Teil der armenischen Kirche (s. d.).
Neuerdings haben die sogen. Altkatholiken (s. d.) wieder den
Gedanken einer U. der christlichen Kirchen, zunächst der
beiden großen katholischen, ins Auge gefaßt, und
etliche Gelehrte vereinigten sich im August 1875 zu Bonn über
das Dogma vom Ausgang des Heiligen Geistes. - Noch entschiedener
scheiterten die Unionsversuche mit den Protestanten zunächst
auf allen Reichstagen im Reformationszeitalter, dann bei
verschiedenen Religionsgesprächen (s. d.) zwischen den
Katholiken und Evangelischen. Ebenso erfolglos blieben auch die
Unionsvorschläge von Staphylus, Wicel
1017
Union (kirchliche) - Union (Stadt).
und Cassander unter Kaiser Ferdinand I., wiewohl auch
protestantische Gelehrte, wie Hugo Grotius (s.d.) und Georg
Calixtus (s. d.), den Gedanken aufnahmen. Was 1660 der
Kurfürst von Mainz, Johann Philipp von Schönborn,
mehreren evangelischen Fürsten als Unionsgrundlage anbot, lief
aus Akkommodation an die katholischen Unterscheidungslehren hinaus.
Ernstlicher waren die Vorschläge des von den Höfen
begünstigten Rojas de Spinola (s. d.) gemeint, welchem
lutherischerseits Molanus (s. d.) und Leibniz (s. d.)
entgegenkamen. Diese verhandelten mit Bossuet (s. d.), welcher aber
gleichfalls nur auf Nachgiebigkeit der Protestanten rechnete. Das
Thorner Blutbad, die Bedrängung der Protestanten in Frankreich
und in der Pfalz, welche Friedrich Wilhelm I. von Preußen und
andre evangelische Reichsstände zu Repressalien
veranlaßten, und die Salzburger Protestantenverfolgung
zerstörten vollends jede Hoffnung auf das Gelingen
künftiger Versuche. - Im Jahrhundert der Reformation
versuchten Wittenberger und Tübinger Theologen vergeblich eine
U. mit der griechischkatholischen Kirche; nicht minder erfolglos
waren im folgenden Jahrhundert die Bemühungen des Patriarchen
Cyrillus Lukaris (s. d.) um eine U. mit der reformierten
Kirche.
Aussichten auf Erfolg hatten von Anfang an nur die Versuche
einer U. zwischen Lutheranern und Reformierten, da diese zwar
über nicht wenige dogmatische Punkte, namentlich über den
Sinn der Einsetzungsworte des Abendmahls und über die
Gnadenwahl, voneinander abwichen, dafür aber durch die
Gemeinsamkeit des über allen Dogmatismus hinausgreifenden
protestantischen Prinzips verbunden waren. Schon 1529 veranstaltete
der Landgraf Philipp der Großmütige von Hessen das
Religionsgespräch zu Marburg (s. Luther). Aber die von Zwingli
dargereichte Bruderhand stieß Luther von sich, und als
nachher Melanchthon und seine Schüler an der Vereinigung
fortarbeiteten, unterlagen sie dem Vorwurf des Kryptocalvinismus
(s. d.). Nur vorübergehend hielt der 1570 geschlossene Vertrag
von Sendomir vor (s. Dissidenten). Das zwischen sächsischen,
hessischen und brandenburgischen Theologen 1631zuLeipzig gehaltene
Religionsgespräch sowie auch das zu Kassel 1661, welches der
Landgraf Wilhelm V. zwischen den reformierten Theologen der
Universität Marburg und den lutherischen zu Rinteln angeordnet
hatte, bewiesen zwar die Möglichkeit einer Ausgleichung, und
hervorragende Theologen, wie lutherischerseits Calixtus und
reformierterseits Duräus, setzten die ganze Arbeit ihres
Lebens für eine solche ein. Aber der dogmatische Zelotismus
zerstörte beständig die gemachten Ansätze. Aus
Gründen der Politik sahen sich die reformierten, aber
über ein lutherisches Volk herrschenden Hohenzollern auf den
Gedanken der U. der beiden evangelischen Konfessionen hingewiesen.
Friedrich I. von Preußen veranstaltete 1703 eine Unterredung
lutherischer und reformierter Theologen in Berlin (Collegium
caritativum), allein die Errichtung einiger Unionskirchen und der
Waisenhäuser zu Berlin und Königsberg, in welchen sowohl
ein lutherischer als auch ein reformierter Geistlicher unterrichten
und das Abendmahl zugleich austeilen mußten, hatte
ebensowenig den Fortgang der Vereinigung zur Folge als der zur
Einführung der englischen Liturgie 1706 promulgierte Entwurf.
Als später König Friedrich Wilhelm I. sich bemühte,
durch das Corpus Evangelicorum 1719 eine U. zu stande zu bringen,
fanden die von den Tübinger Theologen Klemm und Pfaff
proponierten 15 Unionsartikel so wenig Beifall, daß die
Konsistorien zu Dresden und Gotha bei dem Reichstag zu Regensburg
nachdrücklich dagegen protestierten. Zwar wurde hierauf von
Friedrich Wilhelm I. die U. wenigstens in seinem Reich realisiert,
indem er selbst der calvinistischen Prädestinationslehre
entsagte, dagegen die Annahme des reformierten Kultus forderte;
aber schon Friedrich IL gab 1740 seinem Lande die alte Freiheit mit
dem alten Kultus wieder zurück. Das Reformationsjubiläum
von 1817 gab der U. einen neuen Anlaß. In Preußen, wo
Konsistorien und Universitäten schon seit Jahren beiden
Konfessionen gemein waren, konnte die kirchenregimentliche U. ohne
Schwierigkeiten vollzogen werden. Der König erließ 27.
Sept. 1817 eine die Übereinstimmung der Lutheraner und
Reformierten im wesentlichen der Lehre voraus setzende Ausforderung
an die Geistlichkeit, die U. zu fördern. Dieselbe wurde
nunmehr auch 30. und 3l. Okt. zu Berlin und Potsdam durch
gemeinschaftliche Abendmahlsfeier vollzogen. Ferner wurde die U. zu
stande gebracht 1817 in Nassau, 1818 in Rheinbayern, 1819 in
Anhalt-Bernburg, 1821 in Waldeck-Pyrmont und Baden, 1822 in Rhein-
und Oberhessen, 1823 auch in Darmstadt, 1824 in Hildburghausen,
1825 in Lichtenberg, 1827 in Anhalt-Dessau. Eine mächtige
Reaktion erhob sich dagegen besonders in Preußen, als
Friedrich Wilhelm III. 1822 eine neue Kirchenagende (s.
Agendenstreit) den Widerstrebenden aufdringen wollte. Es entstand
unter der Führung des Professors Scheibel (s. d.) zu Breslau
eine Partei, welche den Kampf gegen den Rationalismus in der
Landeskirche einem Kampf gegen U. und Agende steigerte und die
Annahme beider als Verrat betrachtete (s. Lutherische Kirche).
Friedrich Wilhelm IV. gestattete nicht bloß diesen
Altlutheranern, selbständige Gemeinden zu bilden, sondern
machte auch den lutherischen Sonderbestrebungen innerhalb der
Landeskirche die weitgehendsten Zugeständnisse. Ein
Erlaß von 1852 stellte die Zusammensetzung des
Oberkirchenrats zu Berlin aus lutherischen, reformierten und
unierten Mitgliedern fest sowie den Modus der Entscheidung durch
Separation der Mitglieder (itio in partes) bei rein konfessionellen
Fragen. Gleichwohl lehnte ein Erlaß von 1853
ausdrücklich jede Absicht einer Störung der U. ab und
ordnete zugleich an, daß der altlutherische Ritus beim
Abendmahl nur auf gemeinschaftlichen Antrag des Geistlichen und der
Gemeinde gestattet sein sollte; 1857 ward derselbe noch von der
Genehmigung der Konsistorien abhängig gemacht. Eine 1856 auf
Befehl des Königs zusammen tretende, aus 40
Vertrauensmännern bestehende Konferenz sprach sich gegen eine
bekenntnislose U. aus. Der Name der U. selbst aber ward durch einen
königlichen Erlaß vom 3. Nov. 1867 für die alten
Provinzen Preußens festgehalten. Vgl. Hering, Geschichte der
kirchlichen Unionsversuche (Leipz. 1836-1838, 2 Bde.); Nitzsch,
Urkundenbuch der evangelischen U. (Bonn 1853); Julius Müller,
Die evangelische U. (Halle 1854); Schenkel, Der Unionsberuf des
evangelischen Protestantismus (Heidelb. 1855); Wangemann, Sieben
Bücher preußischer Kirchengeschichte (Berl.1859-60, 3
Bde.); Nagel, Die Kämpfe der evangelisch - lutherischen Kirche
in Preußen seit Einführung der U. (Stuttg. 1869);
Brandes, Ge schichte der evangelischen U. in Preußen (Gotha
1872 bis 1873, 2 Bde.); Finscher, U. und Konfession (Kassel 1873, 2
Bde.); Mücke, Preußens landeskirchliche
Unionsentwickelung (Brandenb. 1879).
Union (San Carlos de la U.), Hafenstadt des
mittelamerikan. Staats Salvador, an der Fonseca-
1018
Union der Zweiundzwanziger - Universalwissenschaft.
bai und am Fuß des Vulkans von Conchaqua, in bewaldeter
Gegend, mit vorzüglichem Hafen, lebhaftem Handel und (1878)
2112 Einw.
Union der Zweinndzwanziger, s. Deutsche Union.
Unioninseln (Tokelau), eine nördlich von den
Samoainseln, zu beiden Seiten des 10. Breitengrades liegende Gruppe
von vier Inseln: Oatafu, Nukunono, Fakaafo und Olosenga, zusammen
14 qkm (0,25 QM.) mit 514 Einw. Wegen ihrer Guanolager sind sie von
den Nordamerikanern besetzt.
Unionisten, die Anhänger der 1817 zu stande
gebrachten Union (s. d., S. 1017) zwischen Lutheranern und
Reformierten; die, welche eine allgemeine Vereinigung aller
christlichen Religionsparteien zu Einer Kirche erstreben; indem
1862 entbrannten nordamerikanischen Bürgerkrieg die
Anhänger der Union, im Gegensatz zu den
Konföderierten.
Union Jack (spr. júhnien dschäck), in
Nordamerika vulgäre Bezeichnung der "kleinen" Unionsflagge
(Union tlag); s. die Textbeilage zur Tafel "Flaggen I".
Union Line (spr. júhnien lein), engl.
Postdampferlinie nach Afrika; s. Dampfschiffahrt, S. 49I.
Unio prolium (lat.), Einkindschaft (s. d.).
Unisono(ital.), das Zusammenklingen zweier Töne von
gleicher Tonhöhe oder das Verhältnis der reinen Prime
(Intervall), wenn es von zwei verschiedenen Stimmen ausgeführt
wird; all' u., im Einklang.
Unitarier (lat.), neuere Bezeichnung für diejenigen
protestantischen Richtungen, welche die Trinität (s. d.)
verwerfen. Solche gibt es seit dem 16. Jahrhundert in Ungarn und
Polen (s. Socinianer). Insonderheit aber heißen so die 1774
von Lindsay in London, Christin in Montrose und später von
Priestley in Birmingham gestifteten Gemeinden. Aber dieser auch als
Chemiker berühmte Theolog konnte 1789 kaum sein Leben vor der
Volkswut retten, siedelte 1791 nach Amerika über, wo er 1804
starb, aber in Channing (s. d.) und Th. Parker (s. d.) bedeutende
Nachfolger fand. In England wurde erst 18l 3 das Gesetz aufgehoben,
welches den Unitarismus mit dem Tod bedrohte; seitdem breitete sich
dieser als eine das Christentum überhaupt mehr ethisch als
dogmatisch fassende Richtung auch in Großbritannien aus, wo
ihr teils Theisten, wie Francis Newman, teils aber auch
Anhänger von Strauß und Spencer huldigen (Verehrung des
Universums, Kosmismus, Evolutionstheorie etc.). In Nordamerika
heißen U. besonders die übrigens streng theistischen
Anhänger der antitrinitarischen Lehre, die sich 1815 aus den
Kongregationalisten und Puritanern herausbildeten und im Besitz der
Kirche und Universität zu Cambridge in Massachusetts blieben.
In diesem Staat sind sie heute noch am verbreiterten. In Boston
erscheint die Zeitschrift "Unitarian Review" und ein Jahrbuch der
unitarischen Gemeinden. Vgl. Bonet-Maury, Des origines du
christianisme unitaire chez les Anglais (Par. 1881).
Unität (lat.), die Einzigheit, das nur einmalige
Vorhandensein einer Sache, z. B. Gott; das Nicht geteiltsein, die
Einheit; Brüderunität, s. v. w. Brü dergemeinde (s.
d.).
United States (engl., spr. juneited stehts;
abgekürzt: U. S.), die Vereinigten Staaten (von
Nordamerika).
Univers, l' (spr. lüniwähr), ultramontane
Pariser Zeitung, 1833 von den Abbés Migne und Gerbert
begründet, 1860-67 unterdrückt, hat seit dem Tod Louis
Veuillots (s. d.), der das Blatt seit 1843 leitete, seinen
frühern Einfluß fast gänzlich verloren.
Universal (universell, lat.), das Ganze betreffend,
allumfassend, allgemein (daher Universalerbe, Universalgeschichte,
Universallexikon, Universalmonarchie etc.); Universale,
landesherrliches Manifest.
Universalalphabet, s. Weltsprache und Pasigraphie.
Universal-efenfivpstaster, s. Bleipflaster.
Univerfalelixir, s. Lebenselixir.
Universalen (Universalisten, lat.), Sekte in Nordamerika,
besonders in New York, welche die Ewigkeit der Höllenstrafen
leugnet, eine natürliche Religion bekennt, die Befolgung der
Sitten und Staatsgesetze als höchste Pflicht aufstellt und
daher durch Unsittlichkeit gebrandmarkte Mitglieder
ausschließt. Sie zählt gegen 900 Gemeinden.
Universalerbe (Heres ex asse), derjenige Erbe, welcher in
die vermögensrechtliche Persönlichkeit des Erblassers
ganz oder zu einem Quoteteil eintritt. Den Gegensatz zur
Universalerbfolge bildet der erbrechtliche Übergang einzelner
Vermögensstücke (f. Erbfolge). Im gewöhnlichen Leben
versteht man unter einem Universalerben den alleinigen und
ausschließlichen Erben einer Person.
Universalfideikommiß (lat.,
Universal-Erbschaftsvermächtnis), Vermächtnis, dessen
Gegenstand eine ganze Erbschaft oder doch ein Quoteteil derselben
ist. Der Vermächtnisnehmer heißt in diesem Fall
Universalfideikommissar (s. Fideikommiß).
Universalgelenk, s. Kuppelungen.
Universalia (lat.), in der Sprache der Scholastik die
Gattungsbegriffe, welche entweder nach Art der Platonischen Ideen
als vor den Dingen seiend (U. ante res), oder nach Art der
Aristotelischen Entelechien als den Dingen innewohnend (U. in
rebus), oder nach Art der von der Sprache ausgehenden Benennungen
als nach den Dingen kommend (U. post res) aufgefaßt wurden,
woraus der Streit der sogen. Realisten und Nominalisten
(Konzeptualisten) entsprang. Vgl. Scholastiker und
Nominalismus.
Universalinstrument (astronomisches), s. Altazimut.
Universalismus (lat.), das Streben oder die Kraft, alles zu
umfassen; in der Dogmatik Gegensatz zum Partikularismus (s.
d.).
Universalkontrollapparat, s. Lärmapparate.
Universalmonarchie, ein monarchisches (von einem
Einzelherrscher regiertes) Staatswesen, welches die ganze
zivilisierte Welt unter seinem Oberhaupt vereinigen sollte, wie
dies unter den römischen Kaisern der Fall war. Seit Karl d.
Gr. tritt der Gedanke der U. auch bei den Germanen hervor, indem
der Kaiser als Herr der gesamten Christenheit gedacht wurde. Karl
V. nahm zuletzt zur Begründung einer U. einen nicht
unerheblichen Anlauf.
Universalsprache, s. Pasilalie u. Weltsprache.
Universalsuccession, s. Rechtsnachfolge und Erbrecht.
Universaltischler, Holzbearbeitungsmaschine, an welcher
sich mehrere Werkzeuge (Bandsäge, Hobelmaschine, Bohrmaschine
etc.) mit mechanischem Antrieb befinden.
Universalwissenschaft (Scientia generalis s. universalis)
nannte Leibniz seinen auf die Kombinations- und Variationsrechnung
gegründeten wissenschaftlichen Kalkül, mit dessen Hilfe
es nach Art der "Lullischen Kunst" (s. Lullus 2) möglich sein
sollte, aus gewissen Stammbegriffen alle denkbaren Begriffe und dem
entsprechend aus deren Laut- und Schriftzeichen eine
Universalsprache (Pasilalie) und Universalschrift (Pasigraphie) zu
konstruieren. Vgl. Exner, über Leibnizens U. (Prag 1843).
1019
Universalzeit - Universitäten.
Universalzeit (Weltzeit), Gegensatz zur lokalen Zeit oder
Ortszeit, eine für die ganze Erde gemeinsame Zeitbestimmung.
Nachdem die im Oktober 1883 in Rom abgehaltene siebente
Generalversammlung der Internationalen Geodätischen
Association die Zweckmäßigkeit einer U. für gewisse
wissenschaftliche Bedürfnisse und für den internen Dienst
der obern Verwaltungen der Verkehrsmittel, wie Eisenbahnen,
Dampferlinien, Telegraphen und Posten, anerkannt und als
Anfangsmoment des Welttags den Mittag von Greenwich in Vorschlag
gebracht hatte, trat im Oktober 1884 in Washington eine Konferenz
von diplomatischen Vertretern und Gelehrten aus 25 verschiedenen
Staaten zusammen, um über die Fragen des ersten Meridians und
der Weltzeit zu beschließen. Als erster Meridian
(Nullmeridian) wurde der von Greenwich festgesetzt; der Welttag
soll der mittlere Sonnentag sein, sein Anfang soll aber nicht, der
astronomischen Rechnung entsprechend, auf den Mittag des Meridians
von Greenwich fallen, sondern, dem Gebrauch des bürgerlichen
Lebens entsprechend, auf die Mitternacht. Derselbe soll in 24
gleiche Stunden zerfallen, die von 0 bis 24 zu zählen sind.
Diese Universalzeit ist nicht für das bürgerliche Leben
bestimmt, für welche vielmehr die Ortszeit im Gebrauch bleibt.
Vgl. Zeitdifferenz.
Universitas personarum (lat.), eine juristische
Persönlichkeit, welche an eine Mehrheit physischer Individuen
geknüpft ist; s. Juristische Person.
Universitäten (lat., "Gesamtheiten", d. h.
wissenschaftliche Hochschulen), diejenigen öffentlichen
Anstalten, auf denen die Wissenschaften vollständig und in
systematischer Ordnung gelehrt, auch die höchsten
wissenschaftlichen (akademischen) Würden (Grade) erteilt
werden. Der lateinische Name Universitas bezeichnete
ursprünglich nur die mit gewissen Rechten ausgestattete
Körperschaft der Lehrer und Schüler (u. magistrorum et
scholarium); erst allmählich wurden auch die Lehranstalten als
solche (sonst: studium, studium generale) U. genannt und
nachträglich dieser Name auf den die Gesamtheit der
Wissenschaften umfassenden Lehrplan der Hochschulen gedeutet.
Die abendländischen U. sind Erzeugnisse des spätern
Mittelalters, doch haben ältere Vorbilder auf ihre Entstehung
mehr oder weniger eingewirkt. Als solche sind zunächst die
großen Lehranstalten des spätern Altertums zu nennen:
das von Ptolemäos Philadelphos um 280 v. Chr. gegründete
Museion zu Alexandria, die Philosophenschule zu Athen, anstaltlich
verfaßt namentlich durch Kaiser Hadrian und Herodes Attikus
(130 n. Chr.), und die nach diesen Mustern gebildeten Athenäen
zu Rom (135), Lugdunum (Lyon), Nemausus (Nimes), Konstantinopel
(424). Ferner kommen in Betracht die arabischen Medressen (s. d.),
unter denen im frühern Mittelalter die zu Cordova, Toledo,
Syrakus, Bagdad, Damaskus hohen Ruf genossen. Unmittelbarer
schlossen die ersten U. sich an die alten Kloster- und Domschulen
an, unter denen schon seit dem 8. und 9. Jahrh. einzelne, wie z. B.
Tours, St. Gallen, Fulda, Lüttich, Paris, als scholae publicae
von auswärts zahlreiche Schüler an sich gezogen hatten.
Demgemäß erscheinen die U. bis ins 15. Jahrh.
ausschließlich als kirchliche Anstalten, die sich an ein
Domkapitel, Kollegiatstift u. dgl. anzuschließen und auf
Ausstattung mit kirchlichen Pfründen zu stützen pflegen.
Die ersten U., welche nach heutigem Sprachgebrauch jedoch nur
einzelne Fakultäten waren, finden wir im 11. Jahrh. in
Italien; es waren die Rechtsschulen zu Ravenna, Bologna (Bononia)
und Padua und die medizinische Schule zu Salerno. Festere
korporative Verfassung als Hochschule, obwohl immer noch klerikaler
Art, errang zuerst die Universität zu Paris, die seit dem 12.
Jahrh. die Führung auf dem Gebiet der Theologie und
Philosophie übernahm und als die eigentliche Heimat der
Scholastik bezeichnet werden muß. Die Universität zu
Paris wurde Ausgangspunkt und Muster für fast alle
abendländischen U., besonders die englischen, unter denen
Oxford durch eine Auswanderung aus Paris unter der Königin
Blanka von Kastilien (1226-36) mindestens erst zu höherer
Bedeutung gelangte, und die deutschen. Eine mit besondern
staatlichen und kirchlichen Privilegien ausgestattete
Körperschaft bildeten freilich schon früher die Juristen
in Bologna. Als die Bedeutung derartiger gelehrter
Körperschaften für das geistige Leben der Völker
wuchs, nahmen die Päpste die Schutzherrschaft über die
neuen Anstalten in Anspruch und dehnten den besondern
Gerichtsstand, welchen die Kirche für ihre Angehörigen
besaß, auch auf die weltlichen Universitätsgenossen aus.
- Die innere Organisation der U. war auf die Verschiedenheit der
Nationalitäten gegründet, wobei sich die kleinern an eine
der größern anschlossen. So entstand in Paris die
Einteilung in vier Nationen: Gallikaner (zu denen sich auch
Italiener, Spanier, Griechen und Morgenländer hielten),
Picarden, Normannen und Engländer (welche auch die Deutschen
und übrigen Nordländer zu sich zählten). Diese
Einteilung wird jedoch erst 1249 erwähnt. Zu den Nationen
gehörten sowohl Schüler als Lehrer. Jede hatte ihre
besondern Statuten, besondere Beamten und einen Vorsteher
(Prokurator). Die Prokuratoren wählten den Rektor der
Universität. Papst Honorius verordnete 1219, daß nur
diejenigen Gelehrten zu Lehrern wählbar wären, welche vom
Bischof oder vom Scholastikus des zuständigen Stifts die
Lizenz dazu erhalten hätten. Allmählich entstanden jedoch
zunftartige Verbände unter den Lehrern (magistri, Meistern)
der Theologie, der Jurisprudenz und der Medizin, die als
geschlossene Kollegien zuerst 1231 von Gregor IX. in Paris
anerkannt und ordines oder facultates, Fakultäten, genannt
wurden. Gegen die Einteilung in Fakultäten trat
allmählich die ältere in Nationen zurück. Etwas
später nahm auch das Kollegium der Artisten, d. h. der Lehrer
der sieben "freien Künste", die Verfassung einer vierten
Fakultät an. Die Aufgabe dieser Fakultät, der jetzigen
philosophischen, bestund jedoch bis tief in die neuere Zeit hinein
nur in der Vorbildung für das Studium in einer der höhern
Fachwissenschaften. Ihre Lehrer waren nicht selten Scholaren in
einer der obern Fakultäten. - Vorrecht der Fakultäten
ward bald die Verleihung akademischer Grade. In Paris waren drei
Hauptgrade, die der Bakkalarien (Bakkalaureen), Lizentiaten und
Magister (Meister). Die Bakkalarien wurden von den einzelnen
Magistern ernannt; der Grad eines Lizentiaten wurde nach einer
Prüfung durch die Fakultätsmeister von seiten der Kanzler
oder Bischöfe erteilt, die aber zuletzt bloß ihre
Bestätigung gaben. Nur die Magister hatten das
uneingeschränkte Recht, als Lehrer ihrer Fakultät
aufzutreten. Sie hießen auch oft Doktoren. In Deutschland
ernannten (promovierten, kreierten) die drei alten oder obern
Fakultäten Doktoren, die der freien Künste Magister. Die
Promotionen fanden meistens unter festlichem Gepränge statt;
als Zeichen der Würde wurde dem Promotus der Doktorhut
überreicht. - Ein drittes für die mittelalterliche
Verfassung der U. wichtiges Institut waren die Kolle-
1020
Universitäten (geschichtliche Entwickelung).
gien oder Kollegiaturen, ursprünglich kirchliche Anstalten,
in welchen Studierende freien Unterhalt, Lehre und Beaufsichtigung
fanden. Eins der ersten Universitätskollegien war die
berühmte Pariser Sorbonne (s. d.), gegründet um 1250 von
Robert de Sorbon, Kaplan Ludwigs IX. Den öffentlichen
Kollegien traten, wo sie dem Bedürfnis nicht genügten,
auch private Unternehmen ähnlicher Art zur Seite, die auf
Beiträge der Insassen begründet und von einzelnen
Universitätslehrern geleitet waren. Solche Bursen (bursae,
davon Burschen) waren vorzugsweise in Deutschland verbreitet. Das
Kollegienwesen entwickelte sich am reichsten in Frankreich und
England, wo auch der Unterricht zumeist in die Kollegien sich
zurückzog. Gegenwärtig bezeichnet man an deutschen U. die
Vorlesungen der Lehrer als Kollegien, ohne dabei an die
geschichtliche Herkunft dieser Bezeichnung zu denken. - Neben dem
festern Kern jener Bursen und Kollegien bevölkerten die U. des
Mittelalters die sogen. fahrenden Schüler, eine bunt
gemischte, wandernde Gesellschaft, in welcher die verschiedensten
Alters- und Bildungsstufen zusammentrafen (s. Vaganten). In ihrem
Schoß bildeten sich zuerst in rohen Umrissen die Anfänge
der studentischen Sitten heraus, die sich teilweise bis heute
erhalten haben; so die Gewalt der ältern Studenten
(Bacchanten) über die jüngern (Schützen,
Füchse).
Nach Deutschland übertrug das Universitätswesen Karl
IV. durch die Gründung der Universität Prag 1348 (vier
Nationen: Böhmen, Polen, Bayern, Sachsen). Bis zum Anfang der
Reformation folgten mit päpstlicher und kaiserlicher
Genehmigung: Wien (1365), Heidelberg (1386), Köln (1388),
Erfurt (1392), Leipzig (1409), Rostock (1419, 1432), Löwen
(1426), Greifswald (1456), Freiburg i. Br. (1456), Basel (1456),
Ingolstadt (1472), Trier (1473), Mainz (1476), Tübingen
(1477), Wittenberg (1502) und Frankfurt a. O. (1506). Die
kräftigere Entwickelung des Landesfürstentums im 15.
Jahrh. und die humanistische Bewegung halfen die Bande lockern,
durch welche die Hochschulen an die kirchlichen Autoritäten
geknüpft waren. Das Reformationsjahrhundert brachte eine Reihe
neuer U., welche bestimmungsgemäß evangelischen
(lutherischen oder calvinischen) Charakter hatten, so: Marburg
(1527), Königsberg (1544), Jena (1558), Helmstädt (1575),
Gießen (1607), Rinteln (1619), Straßburg (1621). Eine
eigentümliche Mittelform zwischen U. und sogen. lateinischen
Schulen (Gymnasien) bildeten in jener Zeit die akademischen
Gymnasien oder gymnasia illustria, die von Freien Städten
(Straßburg 1537, Hamburg 1610, Altdorf-Nürnberg 1578)
und kleinern Landesfürsten (Herborn 1584 etc.) begründet
wurden, um dem Auswandern der Landeskinder vorzubeugen. Mehrere
dieser akademischen Gymnasien, wie Straßburg (1621), Altdorf
(1623), Herborn (1654), entwickelten sich später zu wirklichen
Hochschulen. Während im protestantischen Norden die U. im
allmählichen Übergang Staatsanstalten mit einer gewissen
korporativen Selbständigkeit wurden, blieben die neuen
jesuitischen U., wie Würzburg (1582), Graz (1586), Salzburg
(1623), Bamberg (1648), Innsbruck (1672), Breslau (1702), nach
deren Muster auch mehrere der schon bestehenden katholischen U.
umgestaltet wurden, dem ältern Typus im wesentlichen treu. -
Auf den protestantischen U. beginnt in dieser Periode die
eigentliche Geschichte des deutschen Burschentums. Thätige
Teilnahme der Studierenden an der Verwaltung der U. fand nicht mehr
statt; die Wahl junger studierender Fürsten zu Rektoren war
bloße Form, da die wirklichen Geschäfte von Prorektoren,
die aus der Zahl der Professoren erwählt waren, geführt
wurden. Statt dessen bildete die Studentenschaft für sich eine
Art von Verfassung heraus, die ihre Grundzüge teils aus dem
mittelalterlichen Herkommen, teils aus den öffentlichen
Zuständen der Zeit entnahm. Das Landsknechtwesen, die
fortwährenden Feldzüge, namentlich der
Dreißigjährige Krieg, nährten auf den Hochschulen
einen Geist der Ungebundenheit, welcher das in seinen letzten
Ausläufern noch an die Gegenwart heranreichende Unwesen des
Pennalismus (s. d.) erzeugte. Auch kam damals an den deutschen U.
das Duell auf, indem die Studierenden sich mehr und mehr als
geschlossener Stand fühlten, in dem der Begriff der
Standesehre Geltung gewann. Auf manchen U. gab es daneben noch
Nationalkollegia als eine von den akademischen Behörden
angeordnete oder geduldete Einteilung der Studentenschaft. Zum Teil
in Verbindung hiermit, zum Teil aber auch selbständig
entwickelten sich nun die Landsmannschaften, welche zu Ende des 17.
und das ganze 18. Jahrh. hindurch das studentische Leben der
deutschen U. beherrschten. Als förmliche Verbindungen mit
besondern Statuten, Vorstehern (Senioren) und Kassen erlangten sie
bald das Übergewicht über die keiner Verbindung
angehörigen Studierenden (Finken, Kamele, Wilde, Obskuranten
etc.), maßten sich die öffentliche Vertretung der
Studierenden und damit zugleich eine gewisse Gerichtsbarkeit
über dieselben an. Über die Ehrensachen wie über die
studentischen Gelage etc. wurden feste Regeln aufgestellt, welche
man unter dem Namen Komment zusammenfaßte. Der Druck, den die
Landsmannschaften auf die Nichtverbindungsstudenten ausübten,
war oft sehr hart. Viele der Wilden schlossen sich den Verbindungen
als sogen. Renoncen (Konkneipanten) an, welche sich bloß
unter den Schutz der Verbindung stellten, eine Abgabe zahlten und
den Komment anerkannten. Die höchste Instanz für jede
Universität bildete der Seniorenkonvent, der namentlich den
Verruf gegen Philister, d. h. Bürger, oder auch gegen
Studenten auszusprechen und das öffentliche Auftreten der
Studentenschaft zu ordnen hatte. - Ebenso fällt in diese Zeit
(von 1500 bis 1650) die Entwickelung des akademischen
Lehrkörpers zu der im wesentlichen noch heute geltenden
Verfassung. Danach bilden die ordentlichen Professoren (professores
publici ordinarii) als vollberechtigte Mitglieder der vier
Fakultäten den akademischen (großen) Senat. Aus ihrer
Mitte wählen im jährlichen Wechsel die ordentlichen
Professoren der einzelnen Fakultäten (ordines) die vier Dekane
und sämtliche ordentliche Professoren den Rector magnificus,
der an einigen U. auch Prorektor heißt, indem der Landesherr
oder ein andrer Fürst als Rector magnificentissimus gilt.
Außerhalb des Senats stehen die außerordentlichen
Professoren (professores publici extraordinarii), welche meist
kleinere Gehalte vom Staat beziehen, und die Privatdozenten
(privatim docentes), welche nur die Erlaubnis (veniam docendi),
nicht aber die amtliche Pflicht, zu lehren, haben. Der Senat, dem
der Staat einen ständigen juristischen Beamten als
Universitätsrichter (Universitätsrat) oder Syndikus
beigibt, ist Verwaltungs- und Disziplinarbehörde der
Universität und übt seine Rechte, abgesehen von den
Plenarsitzungen, entweder durch den Rektor und die Dekane oder auch
durch einzelne Ausschüsse aus. Der Rektor und die Dekane
bilden, meist mit einigen gewählten Beisitzern, den engern
oder kleinern Senat.
1021
Universitäten (die deutschen U. seit dem 17.
Jahrhundert).
Ehedem hatten die U. auch durchweg eignen Gerichtsstand; die
darauf begründeten besondern Universitätsgerichte sind
völlig erst durch die neue Gerichtsverfassung von 1879 im
Gebiet des Deutschen Reichs verschwunden. - Von der allgemeinen
Erschlaffung des geistigen Lebens, welche in Deutschland nach dem
frischen Aufschwung des Humanismus und der Reformation eintrat,
namentlich aber durch die Leiden des Dreißigjährigen
Kriegs befördert wurde, blieben auch die U. nicht verschont.
Sie machte sich in ihnen durch die Herrschaft einer geistlosen
Pedanterie und starren Gelehrsamkeit neben großer Roheit der
Lebensformen und leidenschaftlicher Rechthaberei namentlich in den
theologischen Fakultäten geltend (rabies theologorum,
Melanchthon). Unter den Männern, die gegen Ende des 17. Jahrh.
diesen Übelstand zu bekämpfen suchten, sind namentlich
Erhard Weigel in Jena, G. W. Leibniz und vor allen andern Chr.
Thomasius (s. d.) hervorzuheben. Durch Thomasius ward Halle (1694)
gleich von der Gründung an die Heimat der akademischen
Neuerer, wo, wenigstens im Gegensatz gegen die starre Orthodoxie
und Gelehrsamkeit der ältern U., die Pietisten der
theologischen Fakultät mit ihm zusammentrafen. Hier wurden von
Thomasius zuerst Vorlesungen in deutscher Sprache gehalten, auch
erschien unter seiner Leitung in Halle die erste kritische
akademische Zeitschrift. Unter den ältern U. hatte sich
Helmstädt am freiesten von den Gebrechen der Zeit erhalten,
dem aber im folgenden Jahrhundert in der Universität
Göttingen (1734 gegründet, 1737 eingeweiht) eine
siegreiche Nebenbuhlerin erwuchs. Göttingen schwang sich durch
reiche Ausstattung und verständige, zeitgemäße
Einrichtung bald zur ersten Stelle unter den deutschen U. auf; hier
wurde zuerst eine Akademie (Societät) der Wissenschaften, wie
sie nach Leibniz Angaben bereits in Berlin (1700) gegründet
worden, mit der Universität verbunden (1752 durch den
verdienten Stifter der Universität Göttingen, Gerlach
Adolf v. Münchhausen, und Albrecht v. Haller). Diesem Zeitraum
verdanken ferner noch Herborn (1654), Duisburg (1655), Kiel (1665)
und Erlangen (1743) ihre Gründung.
Unter den Studenten entstanden im Lauf des vorigen Jahrhunderts
neben den Landsmannschaften andere Verbindungen, sogen. Orden,
welche sich im philanthropischen Geschmack der Zeit auf die
Freundschaft gründeten und die Beglückung der Menschheit
als ihr Ziel aufstellten. Da sie von den Freimaurern und andern
damals emporblühenden geheimen Gesellschaftten allerlei
heimliche Symbolik entlehnten und im Geist Rousseaus für die
Freiheit schwärmten, erschienen sie bald der Staatsgewalt
gefährlich. Besonders ist hier der 1746 in Jena
begründete Moselbund zu nennen, der sich 1771 mit der
Landsmannschaft der Oberrheiner zum Amicistenorden verschmolz. Die
strengen Verbote, die zumal infolge des Rechtsgutachtens von 1793,
das der Reichstag zu Regensburg erließ, die Orden trafen,
bewirkten deren allmähliche Vereinigung mit den
Landsmannschaften, bei denen nach und nach der landsmannschaftliche
Charakter hinter dem einer auf Freundschaft und Gemeinsamkeit der
Grundsätze begründeten Gesellschaft zurücktrat.
Die Stürme der Napoleonischen Kriege und die Zeit der
Wiedergeburt brachten mannigfache Veränderungen im Bestand der
deutschen U. Die Universität zu Ingolstadt siedelte 1802 nach
Landshut über, um 1826 nach München verlegt und mit der
dort seit 1759 bestehenden Akademie der Wissenschaften vereinigt zu
werden; die U. zu Mainz (1798), Bonn (Köln, verlegt 1777,
aufgehoben 1801), Duisburg (1802), Bamberg (1804), Rinteln und
Helmstädt (1809), Salzburg (1810), Erfurt (1816), Herborn
(1817) gingen ein; Altdorf ward mit Erlangen (1807), Frankfurt a.
O. mit Breslau (1809), Wittenberg mit Halle (1815) vereinigt.
Dagegen traten neu die bedeutenden U. zu Berlin (1810) und Bonn
(1818) ins Leben. - Das Menschenalter von 1815 bis 1848 war
für die deutschen U. kein günstiges, indem sie bald nach
der Befreiung des Vaterlandes, für welche Lehrer und
Schüler namentlich der preußischen U. die hingebendste
Begeisterung gezeigt hatten, bei den Regierungen in den Geruch des
Liberalismus kamen und unter diesem Mißtrauen sehr zu leiden
hatten. Den Anstoß dazu gaben die von F. L. Jahn angeregte
Gründung der deutschen Burschenschaft (s. d.) 12. Juni 1815
und besonders die bekannte Wartburgfeier der Burschenschaft 18.
Okt. 1817 sowie die der letztern zur Last gelegte Ermordung
Kotzebues durch Sand, auf welche die unter Metternichs Leitung
stehenden deutschen Regierungen durch die Karlsbader
Beschlüsse über die in Ansehung der U. zu ergreifenden
Maßregeln (26. Sept. 1819) antworteten. Zwar löste sich
die deutsche Burschenschaft 26. Nov. 1819 förmlich auf; sie
bestand aber im stillen fort und trat in verschiedenen Gestalten
(z. B. als Allgemeinheit in Erlangen etc.) immer wieder hervor, bis
sie sich 1830 in die beiden Richtungen der harmlosern,
idealistischen Arminen und der revolutionär-patriotischen
Germanen spaltete. Dem entsprechend, blieb auch das Mißtrauen
der Regierungen gegen den Stand der Universitätslehrer ein
dauerndes, und gerade solche Männer, deren Namen eng und
ehrenvoll mit der Geschichte der Befreiung des Vaterlandes
verknüpft waren, wie namentlich E. M. Arndt in Bonn, hatten
kränkende Zurücksetzung und Verfolgung aller Art zu
erleiden. Jede Universität wurde von einem besondern
Regierungsbevollmächtigten in politischer Hinsicht
überwacht. Wenn das unruhige Jahr 1830 vorübergehend die
Fesseln lockerte, so hatten die Ausschreitungen, mit denen der
verhaltene Groll sich Luft machte (Göttinger Revolution und
Stuttgarter Burschentag 1831, Hambacher Fest 1832, Frankfurter
Attentat 1833), nur um so strengere Beschlüsse gegen die U.
beim Bundestag (5. Juli 1832) und auf den Ministerkonferenzen in
Wien 1833 bis 1834 zur Folge. Großes Aufsehen erregte 1837
die Entlassung und Vertreibung von sieben der bedeutendsten
Professoren der stets für konservativ und aristokratisch
angesehenen Universität Göttingen (s.d.). Unter der
Ungunst der Zeit zerfiel nach und nach die Burschenschaft in
einzelne Verbindungen, welche sich der ursprünglichen Gestalt
derselben mehr oder weniger annäherten. Unter diesen traten in
den 40er Jahren vorzüglich die sogen.
Progreßverbindungen hervor, welche Modernisierung der
akademischen Einrichtungen und Sitten, Abschaffung oder doch
Beschränkung der Zweikämpfe, der akademischen
Gerichtsbarkeit etc. erstrebten. Als besondere Abart entstanden
auch in jener Zeit eigne "christliche" Burschenschaften, wie der
Wingolf in Erlangen (1836) und Halle (1844). Den Progressisten
standen am schroffsten gegenüber die aus den Landsmannschaften
durch genauere Ausbildung des Komments, festern
Zusammenschluß nach innen und aristokratische
Abschließung nach außen sich entwickelnden Corps,
welche durch ihren Seniorenkonvent ("S. C.") an der einzelnen
Universität, durch Kartellverhältnisse und später
durch den im Bad Kösen und auf der Rudelsburg tagenden
Seniorenkongreß in ganz
1022
Universitäten (die deutschen U. in der Gegenwart).
Deutschland zu einer in ihrem Kreis einflußreichen Einheit
sich herausbildeten.
Das Jahr 1848 weckte auch auf den U. das Verlangen nach einer
zeitgemäßen Reform zu neuem Leben, und sowohl von seiten
der Lehrenden als der Lernenden wurden Schritte gethan, ihnen
Geltung zu verschaffen. Zunächst erging von Jena aus die
Einladung zu einem Universitätskongreß, welcher in Jena
vom 21.-24. Sept. 1848 unter dem Vorsitz des damaligen Kanzlers v.
Wächter abgehalten wurde, u. an welchem sich, mit Ausnahme von
Berlin, Königsberg und den österreichischen Hochschulen
außer Wien, Abgeordnete sämtlicher deutscher U.
beteiligten. Die Hauptgegenstände der Beratung waren die Lehr-
und Lernfreiheit, das Prüfungswesen und die Verfassung der U.
Eine Reihe weiterer Punkte wurde einer Kommission zur Beratung
überwiesen, welche diese auch in Heidelberg unter dem Vorsitz
Vangerows zu Ostern vornahm, aber die ganze Angelegenheit auf einen
nach Heidelberg zu berufenden Kongreß der U. verschob, der
nicht zu stande kam. Noch unerheblicher waren die Resultate einer
12. und 13. Juni 1848 auf der Wartburg tagenden
Studentenversammlung. Preußen berief eine Konferenz von
Abgeordneten der Lehrer seiner U. zur Beratung über die vorher
geforderten schriftlichen Gutachten der letztern hinsichtlich der
künftigen Verfassung und Verwaltung der U., welche 27. Sept.
1849 in Berlin abgehalten ward. In Österreich traten durch
eine Reihe von Verordnungen, zunächst vom 1. Okt. 1850,
durchgreifende Veränderungen in der Organisation der U. Wien,
Prag, Lemberg, Krakau, Olmütz, Graz und Innsbruck ein, durch
welche diese den übrigen deutschen U. näher gebracht
wurden. Im ganzen haben die deutschen U. durch allen Wechsel der
Zeiten sich unversehrt erhalten und im wiedererstandenen Deutschen
Reich seit 1870 einen neuen, kräftigen Aufschwung genommen. -
Unter dem Eindruck des Kriegsjahrs 1870/71 erwachte in den letzten
Jahren eine neue Reformbewegung unter der studierenden Jugend,
welche durch Gründung freier studentischer Vereinigungen auf
den meisten deutschen U. zum Ausdruck gelangte. Es ist jedoch
diesen Vereinen, unter denen die sogen. Vereine Deutscher Studenten
seit 1880 in den Vordergrund traten, nicht gelungen, dem
studentischen Leben auf den deutschen U. eine wesentlich
veränderte Gestalt zu geben. In der überreichen
Entwickelung des Vereinswesens (Turn-, Gesangvereine,
wissenschaftliche, landsmannschaftliche Vereine etc.) liegt sogar
die vermehrte Gefahr der Zerstreuung und Vielgeschäftigkeit.
Aber im ganzen ist doch anzuerkennen, daß der frische Hauch,
der die deutsche Geschichte seit 1866 und 1870 durchweht, auch in
den Kreisen der studierenden Jugend seine belebende Kraft geltend
macht und dem Studentenleben einen reichern idealen, namentlich
patriotischen, Gehalt gegeben hat. - Mit begeisterter Teilnahme
ward überall in Deutschland die glänzende
Wiederherstellung der deutschen Universität zu Straßburg
(1. Mai 1872 eröffnet) begrüßt.
In Bezug auf die Verfassung der U. kann man gegenwärtig die
Gruppierung und Abgrenzung der Fakultäten als offene Frage
bezeichnen. Die philosophische Fakultät ist an den
schweizerischen U. und in Würzburg in zwei für die
Beratung getrennte Abteilungen, in Dorpat, Tübingen und
Straßburg dagegen in zwei Fakultäten, die philosophische
(philosophisch - historische) und die naturwissenschaftliche
(mathematisch - naturwissenschaftliche), zerlegt. In Tübingen
ist überdies die Gruppe der Staatswissenschaften
(Nationalökonomie, Statistik, Finanzwissenschaft etc.) zu
einer besondern Fakultät erhoben, so daß dort (bei zwei
nach dem Bekenntnis getrennten theologischen) im ganzen sieben
Fakultäten bestehen. In München ist die philosophische
Fakultät nicht geteilt, aber aus ihr und aus der juristischen
eine neue staatswirtschaftliche Fakultät ausgeschieden. In
Österreich, teilweise in der Schweiz, in Würzburg und
neuerdings in Straßburg ist wenigstens die
staatswissenschaftliche Gruppe aus der philosophischen in die
juristische Fakultät verlegt und diese dadurch zu einer
rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät erweitert. - Die
einzige akademische Würde, die gegenwärtig, abgesehen von
der des Lizentiaten in der Theologie, an deutschen U. noch
verliehen wird, ist das Doktorat (s. Doktor, S. 30). -
Die Zahl der Lehrstühle an den deutschen U. und
insbesondere an den philosophischen Fakultäten hat sich
infolge der stets wachsenden Ausbreitung und der im gleichen
Maß zunehmenden Teilung der Wissenschaften in den letzten
Jahrzehnten außerordentlich vermehrt. Eine in unserm
Jahrhundert mit Vorliebe gepflegte Gestalt des
Universitätsstudiums sind die sogen. akademischen Seminare, d.
h. Gesellschaften, in welchen die Studierenden unter Leitung ihrer
Lehrer praktische Übungen anstellen. Es gibt gegenwärtig:
homiletische, liturgische, philologische, pädagogische,
archäologische, historische, statistische Seminare etc. Dem
entsprechend sind die Laboratorien, Observatorien, Kliniken etc.
für die naturwissenschaftlichen und medizinischen Fächer
zu einer großen Mannigfaltigkeit und sich noch immer
steigernden Vollkommenheit entwickelt. - Sehr ausgedehnt haben sich
bei dem Mangel fester Vorschriften in den letzten Menschenaltern
die Ferien an den U., im Frühjahr oft bis zu 1 1/2-2, im
Nachsommer bis zu 3 Monaten. Die Sommersemester schrumpfen
infolgedessen bisweilen sehr zusammen. Auf Abhilfe wenigstens gegen
weitere Willkür ist oft gesonnen, aber etwas allgemein
Durchführbares noch nicht gefunden worden.
Die erhebliche Erweiterung der deutschen U. im letzten
Menschenalter zeigt folgende Tabelle:[s. Bildansicht]
1853 1888
Lehrer Hörer Lehrer Hörer
Universitäten. ; Ordentl. Professoren ; Lehrer
überhaupt ; immatrikuliert ; überhaupt
Berlin 52 160 1491 2166 78 300 4767 6244
Bonn 47 84 862 896 62 134 1313 1343
Breslau 39 78 806 837 61 128 1343 1374
Göttingen 46 95 669 669 67 116 1016 1033
Greifswald 25 50 204 208 43 76 1066 1087
Halle 35 64 616 661 52 110 1489 1532
Kiel 17 37 132 132 43 83 560 579
Königsberg 30 54 347 347 45 89 844 862
Marburg 29 55 227 247 47 79 928 965
Münster 10 17 328 328 22 35 457 463
Preußen 330 694 5682 6491 520 1150 13777 15482
München 50 90 1893 1893 72 163 3809 3833
Erlangen 26 42 431 431 37 53 926 926
Würzburg 30 41 705 705 39 75 1547 1580
Leipzig 44 105 794 794 66 174 3208 3273
Tübingen 37 73 743 743 52 83 1449 1470
Freiburg 26 34 327 356 39 84 1125 1161
Heidelberg 34 80 719 752 41 101 984 1127
Gießen 31 56 402 402 35 55 546 565
Rostock 21 31 108 108 29 41 347 347
Jena 24 60 420 432 39 88 634 663
Straßburg - - - - 63 110 828 862
Deutschland 653 1306 12224 13107 1032 2177 29180 31289
1023
Universitäten (außerdeutsche).
Von den preußischen U. folge hier noch die Verteilung der
Studierenden auf die einzelnen Fakultäten. Sie betrug nach
Prozenten etwa:
Fakultäten 1853 1867 1878 1888
Evangelische Theologie 16 18 8 20,5
Katholische Theologie 11 9 3 4,5
Rechtswissenschaft 33 17,5 29 17
Medizin 18 22 16 25,5
Philosophische Fakultät 22 33,5 44 32,5
Die Gesamtzahl der deutschen Studierenden in den vier
Fakultäten, wenn man die naturwissenschaftlich-mathematischen
und historisch-philosophischen Fakultäten zusammennimmt,
belief sich auf:
Winter 1887/88 Sommer 1888 Winter 1888/89
Theologen 5815 6024 5824
Juristen 6166 6472 6577
Mediziner 8269 8750 8668
Philosophen 8221 7944 7860
Diese Zahlen beweisen, daß in Deutschland ein recht hoher
Prozentsatz der Bevölkerung gelehrten Studien nachgeht. Folge
davon ist die augenblickliche Überfüllung der meisten
Berufsfächer, für welche die U. vorbilden (Rechtsstudium,
Arzneikunde, höheres Schulfach).
Die Universitäten des Auslandes.
Verwandtschaftlich und im geistigen Austausch zunächst
stehen den deutschen U. die deutsch-österreichischen, die der
deutschen Schweiz, der drei nordischen Königreiche, die
livländische zu Dorpat, die finnische zu Helsingfors und die
niederländischen. Österreich (Cisleithanien) zählte
an 8 U. im Winter 1888/89:
Universitäten Ordentl. Professoren Lehrer überhaupt
Hörer
Wien (mit der evang.-theol. Fakultät und der Hochschule
für Bodenkultur) 94 234 5218
Prag, deutsche Universität 56 100 1470
Prag, tschechische Universität (ohne theolog.
Fakultät) 49 91 2361
Graz 48 107 1296
Krakau 45 90 1206
Lemberg (ohne mediz. Fak.) 30 64 1129
Innsbruck 45 80 862
Czernowitz 28 40 259
Zusammen: 395 806 13801
Von den 13801 Studierenden kommen auf die theologische
Fakultät: 1363, die rechts- und staatswissenschaftliche: 5125,
die ärztliche: 5666, die philosophische: 1647. Ungarn
unterhält die U. Budapest (1885: 3375 Studierende) und
Klausenburg (534), wozu noch die kroatische Universität Agram
(gegen 500 Hörer) kommt. Die U. und Akademien der Schweiz
wiesen im Sommer 1888 folgenden Bestand auf:
Universitäten Ordentl. Professoren Lehrer Hörer
Basel (1460) 36 82 407
Bern (1834) 44 90 528
Genf 45 85 537
Lausanne 23 45 250
Neuenburg 25 42 86
Zürich (1838) 37 102 579
Zusammen: 210 446 2387
Unter den russischen U. gehören in diese Gruppe die
livländische, bisher noch ihrem Grundcharakter nach deutsche
zu Dorpat (1632 von Gustav Adolf begründet, 1802 von Alexander
I. erneuert; 1884: 1522 Hörer) und die finnländische zu
Helsingfors (1640 zu °Abo von der Königin Christine
begründet, 1826 nach Helsingfors verlegt; 1886: 700
Studenten); sodann die skandinavischen: in Schweden Upsala (1476;
1885: 1821 Hörer) und Lund (1666; 1885: 1350 Studenten) ; in
Norwegen Christiania (1811; 1885: 2400 Hörer); in
Dänemark Kopenhagen (1475; um 1300 Hörer); ferner die
holländischen: Leiden (1575), Groningen (1614), Utrecht
(1636), neben denen bis 1816 noch Franeker (1585) und Harderwijk
(1600) bestanden, und die städtische Universität zu
Amsterdam (1875). Wesentlich abweichend haben sich die beiden
hochkirchlichen U. in England, Oxford und Cambridge, entwickelt, an
denen das Kollegienwesen, auf alte Stiftungen von großartigem
Reichtum begründet, noch immer vorwaltet. Durch diese
Stiftungen werden sie immer eng mit der bischöflichen
Landeskirche verbunden bleiben, wenn auch seit 1871 die
nichtgeistlichen Stellen unabhängig vom anglikanischen
Bekenntnis besetzt werden sollen. Die 1845 gegründete
Universität zu Durham ist von nur geringem Umfang. Die 1836
öffentlich anerkannte London University ist eigentlich eine
Prüfungsbehörde, nach dem Muster der
neufranzösischen U. eingerichtet, mit der später
Colleges, so das liberale University College, das kirchliche King's
College, inner- und außerhalb Londons verbunden worden sind.
Näher den deutschen U. stehen die schottischen zu St. Andrews
(1412), Glasgow (1454), Aberdeen (1506) und Edinburg (1582),
während in Irland die Universität zu Dublin mit Trinity
College (1591) den ältern englischen U., Queen's University
(1849) mit verschiedenen auswärtigen Colleges der London
University entspricht und die römisch-katholische
Universität (1874) den belgischen und französischen
Mustern, von denen noch zu reden sein wird, nachgeahmt ist. In
Belgien sind neben den Staatsuniversitäten zu Gent und
Lüttich zwei sogen. freie U. zu Brüssel (1834, liberal)
und zu Löwen (1835, klerikal; ältere Universität:
1426-1793) von Privatvereinen gegründet worden. Ähnlich
steht gegenwärtig die Sache in Frankreich. Dort hat die
Revolution mit den 23 alten, mehr oder weniger kirchlichen U.
völlig aufgeräumt und Napoleon I. an ihre Stelle ein von
Paris aus über alle Departements sich erstreckendes Netz von
Unterrichtsbehörden und -Anstalten gesetzt, dessen Mittelpunkt
Universität genannt wird, während das ganze Land in eine
Anzahl von Bezirken (jetzt 16) geteilt ward, in denen je eine
Akademie, d. h. ebenfalls eine Aufsichts- und
Prüfungsbehörde, mit den ordentlichen
Verwaltungsbehörden zusammen das Unterrichtswesen leitet.
Daneben blieben nur einzelne Fakultäten und Kollegien
(Sorbonne, Collège de France, Collège de Louis le
Saint etc.) bestehen. Nach langen Kämpfen hatte die klerikale
Partei endlich 1875 durchgesetzt, daß unter gewissen sehr
allgemein gehaltenen Bedingungen Körperschaften, Vereine etc.
freie U. gründen dürften, deren Prüfungen denen der
Staatsbehörden gleich gelten, und dann sofort von diesem
Rechte durch Gründung von sechs katholischen U. (Paris, Lille,
Angers, Lyon, Poitiers, Toulouse) Gebrauch gemacht. Die
Entwickelung dieser Anstalten ist seitdem rüstig
vorgeschritten, und namentlich sind neben der Universität zu
Paris auch die zu Lille und Angers bereits völlig organisiert,
obwohl das Recht der Prüfung diesen Anstalten inzwischen
wieder entzogen ist, so daß deren Studenten die
wissenschaftlichen Grade erst vor staatlichen Behörden
erwerben müssen. Dieser Vorgang hat auf dem Gebiet des
staatlichen höhern
1024
Universum - Unkräuter.
Unterrichts in Frankreich regen Wetteifer geweckt. Doch bestehen
rechtlich noch immer nur 58 vereinzelte Fakultäten neben einer
größern Zahl von fachlichen Hochschulen. Der Lehrstand
an den Staatsfakultäten zählte 1882 gegen 1200, die
Hörerschaft etwa 16,000 Köpfe. In Italien, wo neben 17
staatlichen U. 4 freie U. und mehrere einzelne Fakultäten,
Akademien verschiedener Art bestehen, hatte 1875 der
deutschfreundliche Herbartianer R. Bonghi als Unterrichtsminister
neue Anordnungen erlassen und durch dieselben die italienischen U.,
welche halb Lehrkörper, halb Unterrichts- und
Prüfungsbehörden nach französischer Weise geworden
waren, den deutschen wesentlich angenähert. Sein Nachfolger
Coppino hat dieselben 1876 in wichtigen Punkten verändert und
namentlich die Staatsprüfungen den Fakultäten
zurückgegeben. Spanien hat 10 U., von denen manche schon im
Mittelalter hohen Ruf genossen, wie Valencia (1209), Salamanca
(1250), Alcalá de Henares (1499). Gegenwärtig behauptet
nur die Universität Madrid (1836 von Alcalá hierher
verlegt; 5000 Studenten) einen höhern Rang. Portugal hat seine
Universität zu Coimbra (1290 in Lissabon gegründet, 1307
verlegt). Im slawischen Osten Europas hatte Polen schon seit 1400
seine Universität in Krakau, wozu 1578 Wilna trat; sonst aber
sind erst in unserm Jahrhundert von Österreich (Lemberg,
Agram, Czernowitz 1875) und Rußland dort eigentliche U.
(Moskau, Wilna 1803; Kasan, Charkow 1804; Warschau 1816; Petersburg
1819; Kiew 1834; Odessa 1865; Tiflis, Tobolsk) gegründet
worden. Auch Rumänien (Bukarest und Jassy), Serbien (Belgrad),
Griechenland (Athen und Korfu) besitzen heute ihre U.
Außerhalb Europas finden sich die U. am zahlreichsten in
Amerika, wo im Süden die spanisch-portugiesische Form aus dem
Zeitalter der Jesuiten herrscht und im Norden bei großer
Mannigfaltigkeit die englische Anlage vorwaltet. Berühmt sind
unter den ältern, noch unter den Engländern
begründeten U. des Unionsgebiets Harvard University zu
Cambridge in Massachusetts (1638) und Yale College zu Newhaven in
Connecticut (1701). In Asien haben die vier britischen U.
Ostindiens hohe Bedeutung für die Zivilisation dieses weiten
Gebiets und für die vergleichende Sprachforschung. In Japan
strebt die Regierung eifrig, das europäische
Universitätswesen einzubürgern, wobei als Muster die
Universität zu Tokio dient, die vorwiegend mit
europäischen Lehrern besetzt wird.
Vgl. Meiners, Geschichte der Entstehung und Entwickelung der
hohen Schulen unsers Erdteils (Götting. 1802-1805, 4 Bde.);
Tholuck, Das akademische Leben des 17. Jahrhunderts (Halle
1853-1854, 2 Tle.); Raumer, Geschichte der Pädagogik, Bd. 4
(5. Aufl., Gütersl. 1878); Zarncke, Die deutschen U. im
Mittelalter (Leipz. 1857); Dolch, Geschichte des deutschen
Studententums (das. 1858); Keil, Geschichte des jenaischen
Studentenlebens (das. 1858); Muther, Aus dem Universitäts- und
Gelehrtenleben im Zeitalter der Reformation (Erlang. 1866); Sybel,
Die deutschen U. (2. Aufl., Bonn 1874); J. B. Meyer, Deutsche
Universitätsentwickelung (Berl. 1875); "Société
de l'enseignement supérieur, Études de 1878" (Par.
1879); Paulsen, Gründung der deutschen U. im Mittelalter
("Sybels Historische Zeitschrift" 1881); Derselbe, Geschichte des
gelehrten Unterrichts (Leipz. 1885); Denisle, Die U. des
Mittelalters (Berl. 1886, Bd. 1); Kaufmann, Geschichte der
deutschen U. (Stuttg. 1888, Bd. 1); "Deutsches akademisches
Jahrbuch" (Leipz. 1875 u. 1878, mit Angabe der Speziallitteratur).
Fortlaufende Statistik der U. Deutschlands, Österreichs, der
Schweiz etc. gibt Aschersons "Deutscher Universitätskalender"
(Berl., seit 1873).
Universum (lat.), das Ganze, der Inbegriff aller Dinge;
s. v. w. Welt.
Unke, s. Frösche, S. 752, und Nattern.
Unkel, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Koblenz,
Kreis Neuwied, am Rhein und an der Linie Friedrich
Wilhelmshütte-Niederlahnstein, hat eine gotische kath. Kirche,
ein Bergrevier, Basaltbrüche, Zementwarenfabrikation, Weinbau
und (1885) 687 Einwohner.
Unken, Dorf und Luftkurort im österreich. Herzogtum
Salzburg, Bezirkshauptmannschaft Zell am See, an der Saalach, 552 m
ü. M., nahe der bayrischen Grenze (Reichenhall), mit (1880)
229 (als Gemeinde 1046) Einw. Vgl. Strauß, Der Alpenkurort U.
(Salzb. 1879).
Unkräuter, Pflanzen, welche entgegen dem Kulturzweck
zwischen angebauten Pflanzen erscheinen, im allgemeinen nur als
schädlich in Betracht kommen, zum Teil aber nutzbar sind (als
Grünfutter etc.), ja sogar für sich angebaut werden, wie
denn auch manche Kulturpflanzen, wenn sie am unrichtigen Ort
erscheinen, zu den Unkräutern gezählt werden müssen.
Die U. sind schädlich, insofern sie den angebauten
Gewächsen Raum fortnehmen, denn zu eng gestellte Pflanzen
beeinträchtigen sich gegenseitig in der Entwickelung, und oft
zeigen U. stärkeres Entwicklungsvermögen als die
Kulturpflanzen, zwischen denen sie wachsen. Enthält 1 kg
Rotkleesamen nur 10,000 Körner Wegerich (Plantago media) oder
6000 Körner Disteln, so nimmt das Unkraut nahezu die
Hälfte des Areals für sich in Anspruch. Manche
Schlingpflanzen (Convolvulus arvensis und sepium, Polygonum
convolvulus und dumetorum, Lathyrus tuberosus und Vicia-Arten)
verflechten sich mit Halmfrüchten zu einer unentwirrbaren
Masse, ziehen sie nieder und bringen sie zur Lagerung. Die U.
beeinträchtigen die Kulturpflanzen, indem sie Luft- und
Lichtzutritt verringern und dem Boden erhebliche Mengen von Kali,
Stickstoff und Phosphorsäure entziehen. Manche U. sind
Parasiten und zwar Wurzelparasiten (Orobanche, Lathraea, Monotropa,
Thesium, Melampyrum, Euphrasia, Alectorolophus, Odontites) oder auf
oberirdischen Organen (Cuscuta, Viscum), andre sind schädlich,
indem sie parasitische Pilze übertragen. So lebt das
Äcidium des Fleckenrostes auf Berberitze, das des Kronenrostes
auf Faulbaum und Kreuzdorn, das des Streifenrostes auf
Ranunculus-Arten, Urtica dioica auf verschiedenen Borragineen, auch
überwintert die Uredoform des Kronenrostes auf Holcus lanatus.
Auch die Brandpilze werden durch U. verbreitet (Convolvulus
arvensis, Rumex acetosella, Phleum pratense), und der
Mutterkornpilz entwickelt sich vielleicht auf allen Gräsern.
Viele U. sind Giftpflanzen, welche, dem Grünfutter beigemengt,
oft sehr schädlich werden, oder deren Samen in das
Getreidemehl übergehen. Hauptsächlich kommen hierin
Betracht: Bromus secalinus, Lolium temulentum, Colchicum autumnale,
Polygonum hydropiper und minus, viele Solaneen, Gratiola
officinalis, Alectorolophus hirsutus, Cicuta virosa, Aethusa
Cynapium, Conium maculatum, mehrere Ranunkulaceen, Papaver Argemone
und dubium, Agrostemma Githago, die Euphorbiaceen etc. Manche U.
sind insofern nützlich, als sie ohne große
Ansprüche an den Boden diesen bedecken und vor zu schnellem
Austrocknen schützen.
1025
Unktion - Unruhstadt.
Das massenhafte Auftreten der U. erklärt sich aus der
enormen Samenproduktion vieler Arten. Eine einzige Pflanze von
Senecio vernalis besaß 273 Blütenköpfchen, jedes
mit 145, zusammen 39,585, Früchten, ein Exemplar von Erigeron
canadense mit 2263 Köpfchen lieferte 110,000 Samen, und wenn
es sich hier um sehr kräftige Pflanzen handelte, so werden
doch auch von andrer Seite angegeben: für Agrostemma Githago
2590, Papaver-Rhoeas 50,000, Sinapis arvensis 4000, Sonchus
arvensis 19,000 Samen. Von diesen Samen geht wohl der bei weitem
größte Teil zu Grunde, immerhin erhalten sich sehr viele
und erwarten im Boden die günstige Gelegenheit zur
Entwickelung. Aus einer Bodenprobe vom Rand eines Teiches, die kaum
eine gewöhnliche Kaffeetasse füllte, erzielte Darwin 537
Keimlinge, und Putensen ermittelte auf einem Acker pro Q-Meter auf
37,5 cm Tiefe 42,556 Unkrautsamen. Zur Bekämpfung der U.
genügen bei ein und zweijährigen Pflanzen (etwa 80 Proz.)
Jäten, Abweiden, Untergraben, Unterpflügen vor der
Samenreife; von perennierenden Unkräutern müssen die
Wurzelstöcke nach tiefem Pflügen ausgeeggt werden. Bei
manchen Unkräutern wird aber auf diese Weise nichts zu
erreichen sein, und dann sind durch Drainieren, Mergeln etc. die
physikalischen und chemischen Eigenschaften des Bodens so zu
ändern, daß die U. weniger gut oder gar nicht mehr
gedeihen. Auch durch die Art der Kultur lassen sich manche U.
beseitigen. Schlingpflanzen und andre im Getreide wachsende U.
verschwinden, wenn einige Jahre hindurch vorwiegend
Hackfrüchte gebaut werden. Equisetum arvense verträgt
nicht eine geschlossene Grasnarbe. Von größter Bedeutung
ist die Reinheit des Saatguts, und in der That ist seit allgemeiner
Anwendung der Getreidereinigungsmaschinen das Unkraut auf dem Acker
bedeutend zurückgedrängt worden. Diese Reinigung
muß möglichst weit getrieben werden, denn 1 Proz.
Verunreinigung bedeutet bei Lein 1950, bei Rotklee 5500, bei
französischem Raigras 8000 Körner fremder Samen in 1 kg.
Überall, wo die Unkrautsamen erreichbar sind, sollte ihre
Keimfähigkeit durch geeignete Behandlung zerstört werden,
denn wo dies nicht geschieht, gelangen sehr viele keimfähige
Samen durch den Mist zurück auf den Acker. Dabei ist die
große Widerstandskraft mancher Unkrautsamen zu
berücksichtigen, von denen einige die Temperatur des sich
erhitzenden Düngers und wochenlanges Liegen in Jauche
ertragen. Bei der großen Verbreitungsfähigkeit vieler
Unkrautsamen durch Federkronen etc. ist der Einzelne im Kampf gegen
die U. oft machtlos, nur gemeinsames Vorgehen kann Erfolge
erzielen, und daher haben sich in Bayern, Württemberg und
Baden obligatorische Flurgenossenschaften gebildet, welche im Juni
die Grundstücke auf das Vorhandensein von Unkraut besichtigen
und für Ausrottung desselben Sorge tragen. In ähnlicher
Weise sind mehrfach Polizeiverordnungen erschienen, um
übermäßige Verbreitung von Chrysanthemum segetum,
Senecio vernalis und Galinsoga parviflora zu verhindern. Vgl.
Ratzeburg, Die Standortsgewächse und U. Deutschlands und der
Schweiz (Berl. 1859); Nobbe, Handbuch der Samenkunde (das. 1876);
Thaer, Die landwirtschaftlichen U.(das. 1881); Danger, U. und
pflanzliche Schmarotzer (Hannov. 1887).
Unktion (lat.), Salbung (s.d.).
Unmittelbar, s. Immediat.
Unmündige (Impuberes), s. Alter, S. 419.
Unna, Fluß in Bosnien, entspringt nordwestlich von
Glamotsch, fließt erst nordwestlich, dann von Bihatsch an
nordöstlich, bildet im untern Lauf die Grenze gegen
Österreichisch-Kroatien, nimmt bei Nowi die Sanna auf und
fällt bei Jasenovatz rechts in die Save; die U. ist 260 km
lang und nur für kleine Fahrzeuge schiffbar.
Unna, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Arnsberg,
Kreis Hamm, am Fuß der Haar, Knotenpunkt der Linien
Schwelm-Soest, U.-Hamm und Welver-Dortmund der Preußischen
Staatsbahn, 96 m ü. M., hat eine evangelische und eine kath.
Kirche, ein Amtsgericht, Eisengießerei und
Maschinenfabrikation, eine chemische Fabrik, Bierbrauerei,
Ziegelbrennerei und (1885) 8904 meist evang. Einwohner. Dabei die
Saline Königsborn (s. d.). U. gehörte zunächst zu
Kurköln, dann zur Grafschaft Mark; es war Mitglied der
Hansa.
Unorganisch, s. v. w. anorganisch (s. d.)
Uno tenore (lat.), in einem fort; s. Tenor.
Unpaarzeher (Perissodactyla), Säugetiere, deren
Füße nur mit der dritten Zehe den Boden berühren;
s. Huftiere.
Unruh, Hans Viktor von, namhafter Techniker und
Politiker, geb. 28. März 1806 zu Tilsit, bezog die Bauakademie
in Berlin, wurde 1828 Straßenbauinspektor in Breslau, 1839
Regierungs- und Baurat in Gumbinnen, 1843 nach Potsdam versetzt und
1844 beurlaubt, um die Leitung des Baues der Eisenbahn von Potsdam
nach Magdeburg zu übernehmen; von 1846 bis 1851 baute er dann
die Magdeburg-Wittenberger Bahn. Später baute er die
Gasanstalt in Magdeburg, gründete die Deutsche
Kontinentalgasgesellschaft zu Dessau und stand 1857-74 an der
Spitze der Fabrik für Eisenbahnbedarf in Berlin. Infolge
seiner Schrift "Skizzen aus Preußens neuerer Geschichte"
(1848) für Magdeburg in die preußische
Nationalversammlung gewählt, schloß er sich erst dem
linken, dann dem rechten Zentrum an. Kurz vor der Auflösung
der Versammlung im November ward er zum Präsidenten
gewählt, 1849 wurde er Mitglied der Zweiten Kammer, zog sich
aber 1850 vom politischen Leben zurück. Seine 1851 erschienene
Broschüre "Erfahrungen aus den letzten drei Jahren enthielt
eine scharfe Kritik des konstitutionellen Systems. Bei
Begründung des Nationalvereins 1859 ward er in dessen
Ausschuß und 1863 von Magdeburg in das Abgeordnetenhaus
gewählt, welchem er als eins der hervorragendsten Mitglieder
der Fortschrittspartei, dann der nationalliberalen Partei
angehörte, und dessen Vizepräsident er 1863-67 war. Im
Februar 1867 vom Wahlbezirk Magdeburg in den Reichstag
gewählt, zählte er hier zu den Führern der
nationalliberalen Fraktion; doch legte er 1879 auch sein
Reichstagsmandat nieder und starb 4. Febr. 1886 in Dessau. Noch ist
sein "Volkswirtschaftlicher Katechismus" (Berl. 1876) zu
erwähnen. Unruhe, s. Uhr, S. 974.
Unruhe, Pflanze, s. Eryngium und Lycopodium.
Unruhe-Bomst, Hans Wilhelm Stanislaus, Freiherr von,
Politiker, geb. 26. Aug. 1825 zu Berlin, studierte daselbst, in
Heidelberg und Halle die Rechte, trat 1851 in den
Staatsverwaltungsdienst und wurde 1853 Landrat des Kreises Bomst;
er ist Besitzer der Herrschaft Bomst und des Rittergut
Langheinersdorf sowie Landtagsmarschall u. Schloßhauptmann
von Posen; 185558 und 186667 Mitglied des Abgeordnetenhauses, ward
er 1867 in den Reichstag gewählt, in dem er sich der
freikonservativen Partei anschloß, und 1887 zweiter
Vizepräsident desselben.
Uuruhstadt (poln. Kargowo, fälschlich Karge), Stadt
im preuß. Regierungsbezirk Posen, Kreis
Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl., XV. Bd.
65
41026
Unrund - Unsichere Dienstpflichtige.
Bomst, unweit der Faulen Obra, hat eine evang. Kirche, eine
Synagoge, ein Amtsgericht, viele Windmühlen, Weinbau,
Schweinehandel u. (1885) 1604 Ew. Unrund, im Maschinenbau
Bezeichnung für verschiedene Körper, welche von der
kreisrunden Form abweichen, z. B. unrunde Räder, Scheiben
etc.
Unschattige (Ascii), s. Amphiscii.
Unschlitt, s. v. w. Talg.
Unschuldig Angeklagte und unschuldig Verurteilte für die
Nachteile zu entschädigen, welche ihnen durch die
Untersuchungshaft oder durch die Vollstreckung eines irrigen
Richterspruchs erwachsen sind, wird als eine Forderung der
ausgleichenden Gerechtigkeit nach der jetzt herrschenden Ansicht
bezeichnet. Doch ist die gesetzgeberische Formulierung dieses
Entschädigung Anspruchs sehr schwierig. In Frankreich wurde
die Frage schon im vorigen Jahrhundert vielfach erörtert, und
in Preußen bestimmte schon 1776 eine Kabinettsorder
Friedrichs d. Gr., daß der nachgewiesenen Unschuld das
erlittene Ungemach vergütet werden solle. Im englischen
Parlament trat Bentham für die Entschädigung unschuldig
Verurteilter ein, und die Erörterungen der italienischen
Jurisprudenz über diese Entschädigungsfrage führten
zur Aufnahme diesbezüglicher Bestimmungen in das
Strafgesetzbuch von Toscana und in die Strafgesetzgebung des
Königreichs beider Sizilien. In 18 Schweizer Kantonen ist
unschuldig Verurteilten eine Entschädigung für die
erlittene Haft gesetzlich zugebilligt. Auch die frühere
württembergische Strafprozeßordnung anerkannte den
Entschädigungsanspruch unschuldig verurteilter Personen. In
Deutschland wurde die Sache neuerdings zunächst mit
Anknüpfung an die Untersuchung hast wieder aufgenommen. Der
Kriminalist Heinze trat in einer Abhandlung über die
Untersuchung haft (1865) für eine Entschädigung
unschuldig Verfolgter bezüglich des durch die
Untersuchungshaft erlittenen Nachteils ein, und der deutsche
Juristentag nahm 1876 einen Antrag von Jaques und Stenglein dahin
gehend an: "Im Fall der Freisprechung oder der Zurückziehung
der Anklage ist für die erlittene Untersuchungshaft eine
angemessene Entschädigung zu leisten; es sei denn, daß
der Angeklagte durch sein Verschulden während des Verfahrens
die Untersuchungshast oder die Verlängerung derselben
verursacht hat". In Ergänzung dieses Beschlusses wurde ans
einem weitern Juristentag (1882) beschlossen, daß auch
für die Strafverbüßung Genugthuung und Ersatz der
durch dieselbe entstandenen vermögensrechtlichen Nachteile vom
Staat verlangt werden könne, wenn infolge einer Wiederaufnahme
des Verfahrens (s. d.) auf Freisprechung oder auf eine geringere
als die verbüßte Strafe erkannt worden sei. In
Österreich ergriff 1882 der Abgeordnete Roser die Initiative
zum Zweck einer gesetzgeberischen Lösung der Frage, und im
deutschen Reichstag brachten in demselben Jahr die
fortschrittlichen Abgeordneten Phillips und Lenzmann einen
Gesetzentwurf ein, über welchen v. Schwarze 25. April 1883
namens der eingesetzten Kommission ausführlichen Bericht
erstattete. Man entschied sich damals in der Kommission für
eine Entschädigung sowohl für unschuldig
verbüßte Strafhaft als für unschuldig erlittene
Untersuchungshaft. Später wurde die Sache wiederholt
aufgenommen und im Plenum des Reichstags, aber auch kommissarisch
beraten. Ein Antrag "Munkel", welcher 7. März 1888 vom
Reichstag angenommen wurde, bezieht sich nur auf den
Vermögensschaden, welchen unschuldig Verurteilte durch die
Strafvollstreckung erlitten haben, wofern sie nachmals im
Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen wurden. Hat der Angeklagte
seine Verurteilung durch Vorsatz oder grobes Verschulden
herbeigeführt, so ist nach dem Munkelschen Antrag ein Anspruch
auf Entschädigung ausgeschlossen. Gegen eine
Entschädigung wegen unschuldigerweise verbüßter
Untersuchungshast wird namentlich geltend gemacht, daß es
sich bei der Verhängung derselben um ein allgemeines
staatliches Interesse handle, welchem sich der Einzelne unterordnen
müsse; daß der Richter, welcher von der ihm zustehenden
Befugnis, die Untersuchungshaft zu verhängen,
rechtmäßigen Gebrauch mache, niemand verletze; daß
die Energie der strafrechtlichen Verfolgung durch die Aussicht,
vielleicht für die Nachteile der Untersuchungshaft einstehen
zu müssen, beeinträchtigt werde; daß man durch
betrügerische Manipulationen sich durch die Untersuchungshaft
und durch die Entschädigung für diese Vorteile
verschaffen könne; daß auch der Schuldige für die
erlittene Untersuchungshaft entschädigt werden müsse,
wenn seine Freisprechung wegen mangelnden Beweises erfolgt. Auf der
andern Seite macht man geltend, daß die erlittene
Untersuchungshaft bei der Verurteilung angerechnet werden darf, und
daß daher folgeweise bei der Freisprechung auch eine
Entschädigung am Platz sei. Man weist ferner auf die
Zwangsenteignung hin, die ebenfalls im allgemeinen Interesse, aber
gegen volle Entschädigung erfolge. Endlich wird die
menschliche Unvollkommenheit und die damit zusammenhängende
Möglichkeit, daß Untersuchungshaft
unbegründeterweise verhängt werde, zur Begründung
des Entschädigungsanspruchs wegen unschuldig erlittener
Untersuchungshaft mit angeführt.
Die deutschen Regierungen haben sich bisher nach beiden
Richtungen hin ablehnend verhalten, auch gegenüber dem
Entschädigungsanspruch wegen unschuldig erlittener Strafhaft,
und. zwar namentlich aus dem Grund, weil auch die
nachträgliche Freisprechung im Wiederaufnahmeverfahren keine
Garantie dafür biete, daß man es mit einem wirklich
Unschuldigen zu thun habe, da dieselbe häufig nur aus dem
Grund erfolge, weil das ursprünglich vorhanden gewesene
Beweismaterial infolge der natürlichen Wirkung des Zeitablaufs
an Kraft verloren habe. Der Bundesrat hat daher bis jetzt seine
Zustimmung zu dem vom Reichstag wiederholt beschlossenen
Entschädigungsgesetz nicht erteilt, dagegen 17. März 1887
das Vertrauen ausgesprochen, daß in den Bundesstaaten
überall in ausreichender Weise für die Beschaffung der
Geldmittel Sorge getragen werde, welche erforderlich, um den bei
der Handhabung der Strafrechtspflege nachweisbar unschuldig
Verurteilten eine billige Entschädigung zu gewähren.
Dieser Anregung ist auch von mehreren deutschen Staaten bei der
Etatsaufstellung entsprochen worden. Vgl. Jacobi,
Wahrheitsermittelung im Strafverfahren und Entschädigung
unschuldig Verfolgter (Berl. 1883); Kronecker, Die
Entschädigung unschuldig Verhafteter (das. 1883); v. Schwarze,
Die Entschädigung für unschuldig erlittene Untersuchung
und Strafhast (Leipz. 1883).
Unschuldigen Kindlein, Tag der (Festum innocentium), der
kirchliche Festtag zur Erinnerung an den bethlehemitischen
Kindermord durch Herodes, 28. Dez.
Unsichere Dienstpflichtige (unsichere Kantonisten), junge
Leute, welche sich der Gestellung entziehen, ohne sich der
Fahnenflucht schuldig zu machen; verlieren das Losungsrecht und
können außerterminlich eingestellt werden, wobei ihre
Dienstzeit vom nächsten Einstellungstermin an rechnet.
1027
Unsre liebe Frau - Unterbrechung des Verfahrens.
Unsre liebe Frau (franz. Notre Dame), f. v. w. Maria, die
Mutter Jesu.
Unst (spr. onst), die nördlichste der Shetlandinseln
(s. d.), mit meteorologischer Station und (1881) 2173
Einwohnern.
Unsterblichkeit (U. der Seele), die Fortdauer der
Persönlichkeit nach dem Tode des Leibes, auf der Stufe der
Naturreligion fast überall in Gestalt des Geister und
Gespensterglaubens, in den Religionen des Altertums entweder in der
Form der Seelenwanderung (Indien), oder in derjenigen eines
Schattenlebens im Hades (Griechen) oder im Scheol (Hebräer) u.
dgl. auftretend, dagegen im spätern Judentum, im Christentum
und Islam fast unablösbar verbunden mit der Vorstellung der
Auferstehung (s. d.). In schulmäßiger Form wurde der
Begriff der U. zuerst entwickelt und begründet von Platon,
Cicero und andern Philosophen des Altertums. Im Anschluß an
ihre Methode hat die spätere Metaphysik die U. auf
verschiedene Art zu beweisen gesucht. Der ontologische
(metaphysische) Beweis leitet sie ab von dem Begriff der
Immaterialität, Einfachheit und Unteilbarkeit der Seele, der
teleologische dagegen aus der Bestimmung des Menschen, sich von den
äußerlichen, räumlich zeitlichen Bedingungen seines
Geisteslebens immer unabhängiger zu machen und sämtliche
Anlagen zur Entwickelung zu bringen, eine Aufgabe, zu deren
Lösung die Verhältnisse dieser Erde unzulänglich
befunden werden. Der theologische Beweis stützt sich auf die
Weisheit, Gerechtigkeit und Güte Gottes, die es mit sich
bringen, daß den Absichten, mit welchen er persönliche
Geschöpfe ins Dasein gerufen, auch ihre Realisierung
verbürgt sein müsse, was auf dieser Erde keineswegs der
Fall. Der moralische Beweis kommt auf das in diesem Leben niemals
befriedigte, aber mit unverjährbaren Rechten ausgestattete
Bedürfnis nach einer Ausgleichung von innerm Wert und
äußerm Befinden zurück. Der analogische Beweis ist
aus den Erscheinungen der irdischen Natur entnommen, indem sich
hier aus dem Tod immer wieder neues Leben entwickele. Der kosmische
Beweis nimmt seine Gründe aus dem Vorhandensein unendlich
vieler Welten, welche miteinander in Verbindung stehen und zahllose
Übungsplätze für die fortgehende Entwickelung der
Weltwesen darbieten. Der historische Beweis rekurriert auf die
Allgemeinheit des Glaubens an U., sucht zugleich nach Thatsachen
der Erfahrung für die Gewißheit der U. (Auferstehung
Christi) und beruft sich zumeist auf die Aussprüche der
Offenbarung. Zuletzt gehen alle diese Beweise auf das echt
menschliche Bewußtsein zurück, als sittliche
Persönlichkeit der materiellen Natur überlegen zusein, in
einer Welt der Freiheit höhern Gesetzen des Daseins zu folgen
als die materielle Natur. Der diesen Anspruch als eine
Täuschung der Eigenliebe bekämpfende Materialismus ist
daher in alter und neuer Zeit der erfolgreichste Gegner auch
jeglichen Glaubens an U. gewesen. Aber auch vom idealistischen
Standpunkt aus ist derselbe bekämpft worden. Als ein
Lieblingskind der Aufklärungszeit und des Rationalismus fand
er besonders innerhalb der Schule Hegels Beanstandung, indem die
pantheistische Richtung derselben die Fortdauer des Individuums
aufheben zu müssen und nur für eine Rückkehr des
individuellen Geistes in das Allgemeine Platz zu haben schien.
Ausdrücklich wurde diese Meinung ausgesprochen von Richter
("Lehre von den letzten Dingen", Berl. 1833). Dagegen suchte
Göschel in den Schriften: "Von den Beweisen für die U.
der menschlichen Seele im Lichte der spekulativen Philosophie"
(Berl. 1835) und "Die siebenfältige Osterfrage" (das. 1836)
die Hegelsche Philosophie gegen diesen Vorwurf zu verteidigen. Eine
tiefere Begründung fand die Idee der U. bei den Anhängern
des sogen. spekulativen Theismus, insonderheit bei Weiße
("Die philosophische Geheimlehre von der U. des Individuums",
Dresd. 1834) und I. H. Fichte ("Die Idee der Persönlichkeit
und der individuellen Fortdauer", Elberf. 1834; 2. Aufl., Leipz.
1855; "Die Seelenfortdauer und die Weltstellung des Menschen", das.
1867). Vom naturwissenschaftlichen Standpunkt aus besprach die
Sache Fechner in seinem "Büchlein vom Leben nach dem Tod"
(Leipz. 1836, 2. Aufl. 1866) und im 3. Teil seines "Zendavesta"
(das. 1851). Vgl. ferner Ritter, Unsterblichkeit (2. Aufl., Leipz.
1866);Arnold Die U. der Seele, betrachtet nach den
vorzüglichsten Ansichten des Altertums (Landsh. 1870);
Teichmüller, Über die U. der Seele (Leipz. 1874);
Spieß, Entwicklungsgeschichte der Vorstellungen vom Zustand
nach dem Tod (Jena 1877); Henne-Am Rhyn, Das Jenseits (Leipz.
1880).
Uustrut, Fluß in der preuß. Provinz Sachsen,
entspringt auf dem Eichsfeld bei Kefferhausen unweit Dingelstedt,
fließt in mehreren Bogen von W. nach O. und mündet nach
einem Laufe von 172 km unterhalb Freiburg in die Saale. Sie
durchfließt meist schöne Wiesengründe und hat nur
steile und felsige Thalseiten von Klofter-Roßleben bis zur
Mündung. Von Bretleben ab ist sie auf 72 km durch zwölf
Schleusen für kleine Fahrzeuge schiffbar gemacht. Ihre
Nebenflüsse sind rechts: die Gera, Gramme, Lossa, links: die
Helbe, Wipper, Kleine Wipper, Helme.
Unterbilanz, s. Defizit.
Unterbinduug (Ligatur), chirurg. Operation, bei welcher
man zu einem bestimmten Heilzweck ein Blutgefäß durch
Umschnüren mit einem Faden verschließ Es geschieht, um
eine bestehende Blutung zu stillen, einer zu befürchtenden
Hämorrhagie vorzubeugen, oder um die Blutzirkulation bei
Beseitigung von Aneurysmen zu hemmen; auch behufs Herabsetzung der
Blutzufuhr bei Geschwülsten, um dadurch ihr Wachstum zu hemmen
oder ihre Verkleinerung herbeizuführen, bei der sogen.
Elefantiasis und andern Leiden. Auch zu unblutigen Trennungen wird
die U. benutzt, indem man die in der Trennungslinie liegenden Teile
fest umschnürt. Bleibt die U. stets gespannt, so
durchschneidet sie das von ihr Umfaßte in einigen Tagen. Als
Material zur U. dient Seide oder Catgut, zur Umschnürung von
Geschwulststielen und zur Durchtrennung von Teilen auch Drähte
und Gummistränge.
Unterblätter, s. Amphigastrien.
Unterbrechuug des Verfahrens, im Zivilprozeß einer
der beiden Fälle des notwendigen Stillstandes eines Prozesses
im Gegensatz zu dem durch den Willen der Parteien bewirkten "Ruhen"
des Verfahrens und zwar der kraft Gesetzes unmittelbar mit dem
Moment des bezüglichen Ereignisses eintretende Stillstand im
Gegensatz zur "Aussetzung" des Verfahrens (s. d.). Die U. tritt ein
durch vom Willen der Parteien unabhängige Umstände,
nämlich: 1) Tod einer Partei; 2) Eröffnung des Konkurses
über das Vermögen einer Partei, soweit der Prozeß
die Konkursmasse betrifft; 3) Verlust der
Prozeßfähigkeit einer Partei oder Wegfall des
gesetzlichen Vertreters einer nicht prozeßfähigen
Partei; 4) Wegfall des Anwalts einer Partei im Anwaltsprozeß;
5) Aufhören der Thätigkeit des Gerichts infolge eines
Kriegs oder eines andern Ereignisses. In den Fällen
65
1028
Untercharente - Unterfranken.
1 und 3 tritt eine Unterbrechung nicht ein, wenn eine Vertretung
durch einen Prozeßbevollmächtigten stattfindet. Bei der
U. hört der Lauf einer jeden Frist auf; nach Beendigung der U.
(durch "Aufnahme" des Verfahrens, s. d.) beginnt die volle Frist
von neuem zu laufen. U. durch Kabinettsjustiz ist unzulässig.
Vgl. Deutsche Zivilprozeßordnung, § 217 ff.
Untercharente (Niedercharente), franz. Departement, s.
Charente, S. 946.
Unterchlorige Säure HClO entsteht, wenn man
Chlorwasser mit Quecksilberoxyd schüttelt und die
Flüssigkeit zur Abscheidung des gleichzeitig gebildeten
Quecksilberchlorids destilliert. Bei Einwirkung von Chlor auf
kalte, verdünnte Kalilauge, Chlorkalium und unterchlorigsaures
Kali und bei vorsichtiger Destillation eines
Unterchlorigsäuresalzes mit verdünnter Salpetersäure
destilliert u. S. Diese ist eine so schwache Säure, daß
ihre Salze durch Kohlensäure zersetzt werden; leitet man daher
Chlor in eine Lösung von kohlensaurem Natron, so entsteht kein
Unterchlorigsäuresalz, sondern Chlornatrium und freie u. S.
Mäßig konzentrierte Lösungen der Säure lassen
sich destillieren und durch Fraktionierung konzentrieren,
während sehr schwache oder sehr starke Säure sich bei der
Destillation zersetzt. Konzentrierte u. S. ist orangegelb,
verdünnte fast farblos, riecht eigentümlich, schmeckt
ätzend, zersetzt sich sehr leicht in Chlor und Chlorsäure
und wirkt doppelt so stark oxydierend und bleichend als das in ihr
enthaltene Chlor. Ihre Salze (Hypochlorite) sind im reinen Zustand
wenig bekannt und im festen gar nicht; sie sind sehr
unbeständig, ihre verdünnten Lösungen geben beim
Kochen Chlorsäuresalz und Chloride, die konzentrierten
Chloride und Sauerstoff; sie entwickeln beim Erhitzen mit
verschiedenen Metalloxyden, wie Kobaltoxyd oder Kupferoxyd,
Sauerstoff; sie bleichen sehr langsam, nach Zusatz einer Säure
aber sehr energisch, auch schon bei Einwirkung der Kohlensäure
der Luft. Die unterchlorigsauren Alkalien sind in den
Bleichflüssigkeiten (Eau de Javelle und Eau de Labarraque)
enthalten, unterchlorigsaure Magnesia in Ramsays oder Grouvelles,
das Zinksalz in Varrentrapps Bleichflüssigkeit. Über das
Kalksalz s. Chlorkalk. Berthollet beobachtete 1785, daß Chlor
sich mit einem Alkali verbinden kann, ohne seine bleichenden
Eigenschaften einzubüßen. Er führte die
Lösung, welche er durch Einleiten von Chlor in Kalilauge
erhielt (Eau de Javelle), in die Färberei ein, und Balard
erkannte 1834 die Zusammensetzung des Präparats.
Unterchlorigsaures Natron, s. Eau de Javelle.
Unterdominante, s. Dominante.
Unterelsaß, Bezirk im deutschen Reichsland
Elsaß-Lothringen, umfaßt 4778 qkm (86,78 QM.) mit
(1885) 6l2,077 Einw. (darunter 211,955 Evangelische, 379,844
Katholische und 18,891 Juden) und besteht aus den acht Kreisen:
Kreise QKilometer QMeilen Einw. 1885 Einw. auf 1 QKil.
Erstein 498 9,05 61719 124
Hagenau 659 11,97 73316 111
Molsheim 740 13,44 69328 94
Schlettstadt 635 11,53 71378 112
Straßburg (Stadt) 78 1,42 111987 -
Straßburg (Land) 561 10,19 79521 142
Weißenburg 603 10,95 58270 97
Zabern 1004 18,24 86558 86
Unterfahrung, die Anlage eines neuen Fundaments oder
neuer Fundamentteile bei einem Gebände mit ungenügender
oder schadhaft gewordener Gründung, größerer
Belastung des Baugrundes, tieferer Gründung des Nachbarhauses
etc.
Unterfranken, ein Regierungsbezirk des Königreichs
Bayern, grenzt im NW. an die preußische Provinz
Hessen-Nassau, im N. an Sachsen-Weimar, im NO. an
Sachsen-Meiningen, im O. an Ober- und Mittelfranken, im S. an
Württemberg und Baden, im W. an das Großherzogtum
Hessen, besteht aus dem ehemaligen Bistum Würzburg, dem
kurmainzischen Fürstentum Aschaffenburg, der vormals freien
Reichsstadt Schweinfurt und aus Teilen des Bistums Fulda, des
Fürstentums Ansbach, der Grafschaft Schwarzenberg etc. und
umfaßt 8401 qkm (152,58 QM.) mit (1885) 619,436 Einw.
(darunter 106,302 Evangelische, 484,406 Katholiken und 14,398
Juden). Gebirge sind: im N. die Rhön mit dem Kreuzberg, im W.
der reichbewaldete Spessart, im O. der Steigerwald und die
Haßberge. Hauptfluß ist der Main, welcher den
Regierungsbezirk, zwei große Bogen nach S. abgerechnet, von
O. nach W. in einem meist breiten und fruchtbaren Thal durchzieht.
Ihm fließen hier zu die Fränkische Saale und Sinn auf
der rechten Seite, während auf der linken Seite nur kleine
Bäche einmünden. Der Boden ist meist sehr fruchtbar und
liefert Holz in großer Menge, treffliche Weine, Getreide,
Flachs, Hanf, Obst etc. Von Mineralien werden Alabaster, Gips, Thon
und Eisen gewonnen. Unter den Mineralquellen sind besonders die von
Kissingen berühmt. Haupterwerbszweige sind: Land- und
Forstwirtschaft, Wein- und Obstbau, Viehzucht etc., aber auch die
Industrie ist bedeutend und besteht vorzugsweise in
Baumwollspinnerei, Lein-, Baumwoll- und Wollweberei, Fabrikation
von Tapeten, Papier, Holz- und Eisenwaren, Maschinen, Glas,
Bierbrauer rei etc. Der Handel ist besonders namhaft in Holz,
Landesprodukten und Wein. Als Hauptverkehrslinie durchzieht den
Regierungsbezirk die Eisenbahnlinie Bamberg-Aschaffenburg,
zahlreiche andre Linien münden von N. und S. her in diese ein.
Die Schiffahrt auf dem Main ist in stetem Aufschwung begriffen. In
administrativer Hinsicht wird U. in vier unmittelbare Städte
(Aschaffenburg, Kitzingen, Schweinfurt und Würzburg) und 20
Bezirksämter geteil. Hauptstadt ist Würzburg.
Bezirksämter QKilom. QMeilen Einwohner Einw. auf 1 qkm
Alzenau 262 4,76 19286 73
Aschaffenburg (Stadt) 15 0,27 12393 -
Aschaffenburg (Land) 400 7,26 31102 78
Brückenau 329 5,97 13385 41
Ebern 367 6,67 19849 54
Gerolzhofen 478 8,68 32212 67
Hammelburg 351 6,37 20529 59
Haßfurt 427 7,76 27544 64
Karlstadt 485 8,81 29879 62
Kissingen 468 8,50 32940 70
Kitzingen (Stadt) 24 0,44 7177 -
Kitzingen (Land) 347 6,30 31803 53
Königshofen 559 10,15 29831 53
Lohr 726 13,19 33999 47
Marktheidenfeld 492 8,94 30496 62
Mellrichstadt 268 4,87 13815 51
Miltenberg 322 5,85 20783 65
Neustadt a. S. 377 6,85 20810 55
Obernburg 312 5,67 25666 82
Ochsenfurt 373 6,77 26190 70
Schweinfurt (Stadt) 25 0,45 12502 -
Schweinfurt (Land) 496 9,01 32902 66
Würzburg (Stadt) 32 0,58 55010 -
Würzburg (Land) 464 8,43 39366 85
1029
Unterführung - Unternehmergewinn.
Unterführung, die Anlage einer Straße unter
einer andern, welche sich mit ersterer kreuzt; besonders bei
Eisenbahnen.
Untergang der Gestirne, das infolge der täglichen
allgemeinen Himmelsbewegung von Morgen gegen Abend erfolgende
Hinabsinken der Gestirne unter den Horizont. Die Stunde des
Unterganges eines Gestirns und für einen bestimmten
Beobachtungsort findet man, wenn man den halben Tagbogen, in Zeit
ausgedrückt, zur Zeit der Kulmination hinzurechnet. Die so
gefundene Zeit des wahren Unterganges ist etwas verschieden von der
Zeit, zu welcher man den Untergang wirklich beobachtet, der Zeit
des scheinbaren Unterganges, weil wir wegen der
atmosphärischen Strahlenbrechung ein Gestirn noch sehen, wenn
es bereits gegen 35 Bogenminuten unter dem Horizont steht. Bei
Sonne, Mond und Planeten muß man bei Berechnung des Auf und
Unterganges noch auf die Bewegung dieser Körper am
Fixsternhimmel Rücksicht nehmen, bei Sonne und Mond auch noch
auf ihren scheinbaren Halbmesser. Wie beim Aufgang, unterschieden
die Alten auch beim Untergang 1) den heliakischen Untergang oder
den zum letztenmal nach Sonnenuntergang stattfindenden, 2) den
kosmischen Untergang oder den mit Sonnenuntergang gleichzeitig
stattfindenden, daher unsichtbaren, und 3) den akronyktischen
Untergang oder den bei Sonnenaufgang stattfindenden. Vgl. Aufgang
d. G.
Untergärung, s. Bier, S. 916 f.
Uutergrund, f. Boden, S. 106.
Untergrundpflug, s. Pflug, S. 975.
Unterhändler, s. Makler.
Unterhaus, das Haus der Gemeinen (House of Commons) im
englischen Parlament; s. Großbritannien, S. 776 f.
Unterhautzellgewebe, s. Haut, S. 231.
Unterkiefer, s. Kiefer.
Unterkochen, Dorf im württemberg. Jagstkreis,
Oberamt Aalen, in einem Thal zwischen Aalbuch und Härdtfeld,
am Schwarzen und Weißen Kocher und an der Linie Aalen-Ulm der
Württembergischen Staatsbahn, 450 m ü. M., hat eine kath.
Kirche, 5 Papierfabriken, eine Zellstofffabrik, 2 Kettenfabriken,
eine Kunstmühle und (1885) 1979 Einw.
Unterkohlrabi, s. Raps.
Unterkühlt, s. Schmelzen, S. 552.
Unterleib, s. Bauch.
Unterleibsbruch, Eingeweidebruch, s. Bruch, S. 484.
Unterleibskrankheiten, im allgemeinen alle Krankheiten,
welche die dem Unterleib angehörigen Organe betreffen.
Unterleibsentzündung bedeutet im gewöhnlichen
Sprachgebrauch s. v. w. Bauchfellentzündung (s.d.), doch
gebraucht man den Ausdruck auch zuweilen, um eine Affektion der
Beckenorgane oder eine Blinddarmentzündung zu bezeichnen. Als
Unterleibstyphus benennt man diejenige Form des Typhus, welche
durch Lokalisation im Dünndarm als sogen. Ileotyphus vor den
beiden andern typhösen Infektionskrankheiten, dem
exanthematischen und dem Rückfalltyphus, ausgezeichnet ist.
Unterleibsschwindsucht soll meistens so viel sagen wie
Darmschwindsucht (s. d.), doch wird darunter auch zuweilen
tuberkulöse Zerstörung der weiblichen Beckenorgane
verstanden. Unterleibsbrüche (Hernien) sind Vorfälle von
Darm oder Netzstücken durch abnorm erweiterte normale oder
widernatürlich entstandene Öffnungen des Bauchfells (s.
Bruch, S.484 f.). Wegen der U., welche hypochondrischen oder
hysterischen Seelenstörungen zu Grunde liegen sollen, vgl. die
Artikel über die betreffenden Krankheiten und
Darmentzündung.
Unterleibsskrofeln, chronische Schwellung der
Mesenterialdrüsen (s. d. und Darmschwindsucht).
Unterleibstyphus, s. Typhus, S. 956.
Unterleuniugen, Dorf im württemberg. Donaukreis,
Oberamt Kirchheim u. T., an der Lauter, hat eine evang. Kirche,
Baumwollspinnerei, Holzdreherei, mechanische Werkstätten,
Metalldrückerei, eine Ölmühle, Wein und Kirschenbau,
eine Schwefelquelle und (1885) 672 Einw.
Unterloire (Niederloire), franz. Departement, s. Loire,
S. 878.
Untermalung, die erste Vorbereitung zur Anfertigung eines
Gemäldes, welche von besonderer Wichtigkeit ist, weil sie die
Grundlage für Zeichnung, Modellierung und Beleuchtung liefert.
Der Hauptgrundsatz für die U. ist, daß sie in allen
Teilen heller gehalten werden muß als das auszuführende
Gemälde oder doch so, daß der spätern
Übermalung freie Hand gelassen wird. Während die U. in
der neuern Malerei von den persönlichen Erfahrungen der
einzelnen Maler abhängt und im wesentlichen Sache des
Experiments ist, gab es in frühern Zeiten bestimmte Rezepte
für einzelne Schulen. So untermalten die altdeutschen und
niederländischen Meister gewöhnlich hellbraun, die
Venezianer grau, die Bologneser und Römer braun und die
Mailänder, besonders Leonardo da Vinci, fast schwarz. Die U.
richtet sich im allgemeinen nach der Weise der Ausführung, d.
h. sie ist sorgsam oder flüchtig, je nachdem der Maler sein
Bild mehr oder weniger ausführen will.
Untermaßfeld, Dorf im Herzogtum Sachsen-Meiningen,
Kreis Meiningen, an der Werra und der Linie Eisenach Lichtenfels
der Werra Eisenbahn, hat eine evang. Kirche, ein altes Schloß
mit Strafanstalt und (1885) 1058 Einw.
Untermast, s. Brechen.
Untermhaus, Dorf bei Gera (s. d.).
Uutermiete, s. Aftermiete.
Uuteruährer, Anton, s. Antonianer.
Unternehmergewinn ist der Überschuß, welchen
der Unternehmer (s. Unternehmung) über sämtliche Kapital
und Arbeitsaufwendungen mit Einschluß der in Anrechnung zu
bringenden Verzinsung erzielt. Wären Befähigung und Trieb
zu allen möglichen Unternehmungen bei allen Menschen gleich
groß, wären bei vollständig freier Konkurrenz alle
Kapitalien vollkommen frei und leicht übertragbar,
könnten Umfang und Zahl der Unternehmungen beliebig ausgedehnt
und eingeschränkt werden, so würde es einen U. nicht
geben und, unter der Voraussetzung, daß Kapitalisten den
Lohnarbeitern gegenüberstehen, den erstern das Kapital einen
gleichen Gewinn (im weitern Sinn) oder Zinssatz abwerfen. Nun
treffen aber jene Annahmen in Wirklichkeit nicht zu. Zunächst
sind die Unternehmungen nicht beliebig ausdehnungsfähig, die
Kapitalien nicht gleich beweglich und übertragbar und von
verschiedener Qualität. Infolgedessen werden bei Änderung
der Konjunkturen, Steigen oder Sinken der Preise und Kosten auch
ohne Zuthun des Unternehmers im einen Fall Verluste unvermeidlich
sein, im andern Überschüsse erzielt werden. Zu den
genannten Ursachen von Gewinn und Einbuße kommen nun noch die
Wirkungen der Eigenschaften und Fähigkeiten der verschiedenen
Unternehmer sowie Gunst und Ungunst ihrer individuellen Stellung.
Werden an den ganzen Stand der Unternehmer höhere
Anforderungen gestellt, so wird dies im allgemeinen zur Folge
haben, daß dem Unternehmer eine höhere Vergeltung
für seine Thätigkeit zufließt als dem Lohnarbeiter
(durchschnittlicher "Gewerbsverdienst").
1030
Unternehmung - Unteroffizierschulen.
Durch besondere Tüchtigkeit kann der einzelne seine
Einnahmen unter Umständen weit über diesen Satz hinaus
vermehren. Weiter können dieselben gesteigert werden durch die
Gunst äußerer Verhältnisse, möge dieselbe auf
formeller rechtlicher Ausschließung (Monopol, Patent) beruhen
oder dem freien Verkehr entwachsen (großer Besitz, Ansehen
bei dem Publikum, Gewohnheiten des letztern, günstige
Gestaltung der Marktverhältnisse, Möglichkeit, leicht
Kenntnis von bessern Betriebsweisen zu erlangen, etc.).
Die Wirksamkeit des Unternehmers wird oft über-, sehr
häufig aber auch unterschätzt. Zu hoch wird dieselbe von
denjenigen beurteilt, welche von der Ansicht ausgehen, der U. sei
lediglich eine Folge vorzüglicher Thätigkeit, nicht auch
von günstigen äußern Verhältnissen, und die
daher mit Vorliebe von einem Unternehmerlohn sprechen. Viel zu
gering wird die Unternehmerthätigkeit von denjenigen geachtet,
welche jeden Gewinn als mühelosen Raub an der Arbeit ansehen
und glauben, es könne die Thätigkeit des
selbständigen Unternehmers durch diejenige eines besoldeten
Beamten ersetzt werden. Jedenfalls ist die Aussicht, durch
tüchtige, den Anforderungen der Gesellschaft entsprechende
Unternehmungen einen mehr oder minder großen Gewinn zu
erzielen, ein durch andere Mittel nicht zu ersetzender Reiz zu
besserer, billigerer Versorgung der Gesamtheit und zu
wirtschaftlichem Fortschritt. Das Streben nach
Überschüssen treibt zu Ersparungen, zur Einführung
besserer Produktionsmethoden, Verwendung wirksamerer Kapitalien und
vorteilhafterer Verwertung der erzeugten Produkte dadurch,
daß jeweilig den relativ dringendern Bedürfnissen
entgegengekommen wird. Natürlich sind hierbei Ausbeutung der
Unklugheit, des Ungeschicks und der Schwachheit wie Gewinne. welche
nicht gerade der bessern Thätigkeit zu verdanken sind, nicht
ausgeschlossen. Doch lassen sich die Anteile, welche der Gunst der
Konjunkturen, und solche, welche der Thatkraft und tüchtigen
Leitung zu verdanken sind, nicht oder nur innerhalb bescheidener
Grenzen voneinander trennen, wenn die segensreiche Wirksamkeit der
Unternehmertätigkeit nicht untergraben oder Ungerechtigkeiten
vermieden werden sollen. Mißstände, wie sie bei freier
Konkurrenz und bei von der Volksmeinung als illegitim betrachtetem
Erwerb eintreten können, lassen sich teils beseitigen, teils
mindern durch Arbeiterschutz, gut organisiertes Kassen- und
Versicherungswesen, Konzessionierung, Patent, Musterschutz, durch
Überweisung wirtschaftlicher Gebiete, auf welchen die
Spekulation leicht schädlich wirkt oder nur durch
tatsächliche Monopole großer Kapitalien Gewinne zu
erzielen sind, an Staat und Kommunalverbände u. dgl. Vgl.
außer den Lehrbüchern der Nationalökonomie:
Mangoldt, Der U. (Freiburg 1855); Böhmert, Die
Gewinnbeteiligung (Leipz. 1.877); Pierstorff, Die Lehre vom U.
(Berl. 1875); Groß, Die Lehre vom U. (Leipz. 1884).
Unternehmung ist im weitern Sinn jede mit einem gewissen
Risiko verbundene Handlung. In der Nationalökonomie
bezeichnet man als U. spekulative Verkehrsgeschäfte, darauf
berechnet, ihrem selbständigen Inhaber durch Herstellung von
Produkten und Leistungen und Verkauf derselben an Dritte einen
Gewinn abzuwerfen. Als charakteristische Merkmale der Begriffe U.
und Unternehmer gelten, daß letzterer allein die Unsicherheit
des Erfolgs trägt, nach freier Wahl Art, Umfang und Gang der
U. bestimmt, und daß seine Thätigkeit nicht durch einen
besoldeten Dritten als Stellvertreter versehen werden kann. et
einer U. können Arbeiter, Kapitalist und Unternehmer in einer
Person vereinigt sein (viele Kleingewerbe und reine
Genossenschaften ohne Leihkapital und Lohnarbeiter), oder sie sind
voneinander getrennt sowohl bei Einzel- (Meister mit Gesellen,
Fabrikant) als auch bei Kollektivbetrieb. Mischungen zwischen
diesen beiden Formen sind die industrielle Partnerschaft und die
Genossenschaft, welche sich auch fremder Arbeiter und Kapitalien
bedient. Jede der verschiedenen Unternehmungsformen hat ihre
besondern Eigentümlichkeiten hinsichtlich der Gründung,
der Sicherung fremder Interessenten, der Leichtigkeit und
Beweglichkeit des Betriebs, der Fähigkeit weiterer Ausdehnung
etc. Je nach der Art der gewerblichen Thätigkeit, der
wirtschaftlichen Entwickelung, den Anforderungen, welche an den
Betrieb und seine Leistungen gestellt werden, ist bald die eine,
bald die andre mehr am Platz. Bei der Einzelunternehmung trägt
der Unternehmer das Risiko ausschließlich und ungeteilt und
muß darum auch volle Freiheit der Disposition haben. Weil
sein Interesse eng mit der U. verwachsen ist, wird er der letztern
je nach Bedarf Erübrigungen aus dem Haushalt zuführen,
eine gewisse Garantie für Sorgfalt des Betriebs bieten etc.
Dagegen ist die Einzelkraft vielen Unternehmungen nicht gewachsen.
Vorzüglich ist die Einzelunternehmung am Platz, wo freie
Verfügung, Anschmiegung an die jeweilig veränderlichen
Verhältnisse notwendig und insbesondere hohe Ansprüche an
die persönliche Arbeitsfähigkeit gestellt werden. Durch
Kollektivunternehmungen werden Kapital und Arbeitskräfte
für einen Zweck vereinigt, und zwar gestattet die Gesetzgebung
Verbindungen von verschiedener Innigkeit, Haftpflicht und
Beteiligung von Mitgliedern an Gewinn und Leitung des
Geschäfts. Zu erwähnen sind: die offene, die stille
Gesellschaft, die Kommanditgesellschaft, Kommanditgesellschaft auf
Aktien, Aktiengesellschaft und die verschiedenen Genossenschaften
(s. d.). Auch Staat und Kommunalverbände können hierher
gerechnet werden.
Unteroffiziere, militärische Befehlshaber vom
Feldwebel abwärts, welche aus den Reihen der Soldaten
hervorgehen. In Deutschland unterscheidet man die U. mit Portepee:
Oberfeuerwerker, Feldwebel, Wachtmeister, Vizefeldwebel,
Vizewachtmeister, Wallmeister, Zeugfeldwebel, Depotvizefeldwebel,
Roßärzte, Unterroßärzte, Fähnriche, in
der Marine die Stabswachtmeister und Feldwebel; U. ohne Portepee:
Feuerwerker, Sergeanten, Oberlazarettgehilfen, U. Oberjäger,
Lazarettgehilfen; in der Marine die Maat (s. d.). Im innern Dienste
der Truppe sind sie di. nächsten Aufseher der Soldaten und
versehen wirtschaftliche Dienste, wie der Kammerunteroffizier die
Aufsicht über die Bekleidungsgegenstände, der
Schießunteroffizier die über Waffen und Munition, der
Furier die über die Wohnungen, Möbel und Wäsche i
den Kasernenstuben führt. Im äußern (taktischen
Dienst sind sie Führer der kleinsten Unterabteilungen, in
welche die Truppe zerlegt werden kann.
Unteroffizierschulen haben den Zweck, junge Leute zu
Unteroffizieren der Infanterie des steh enden Heers heranzubilden.
Die Anmeldung geschieht persönlich bei dem
Landwehrbezirkskommando der Heimat, wozu Taufschein,
Führungsattest der Ortsbehörde und Einwilligungsschein
des Vaters mitzubringen sind. Der sich Meldende muß zwischen
17 und 20 Jahre alt, 1,57 m groß und frei von
körperlichen Gebrechen sein, sich gut geführt haben,
lesen, schreiben und die vier Species rechnen können. Es
bestehen gegenwärtig U. zu Potsdam, Jülich, Biebrich,
Weißenfels, Marienwerder (Preußen), Ettlingen (Baden),
Marienberg mit Unter-
1031
Unterpacht - Unterschrift.
offiziervorschule (Sachsen), Neubreisach (Elsaß). In
Bayern vertreten die Unteroffizieraspirantenschulen bei den Truppen
die Stelle der U. Nach dreijähriger Dienstzeit in den U.
werden die Zöglinge, die vorzüglichsten als
Unteroffiziere, die andern als Gefreite oder Gemeine, in die Armee
entlassen und müssen hier für jedes Jahr auf der
Unteroffizierschule zwei Jahre dienen. Die Zöglinge der U.
sind Soldaten. Die 1. Okt. 1877 zu Weilburg errichtete Anstalt ist
eine Unteroffiziervorschule, welche ihre Zöglinge (die nicht
Soldaten sind) nach zweijährigem Kursus an eine
Unteroffizierschule überweist. Die Aufzunehmenden dürfen
nicht unter 15 und nicht über 16 Jahre alt sein.
Unterpacht, s. Afterpacht.
Unterricht, im allgemeinsten Sinn der Inbegriff der
Thätigkeiten, welche auf Aneignung von Kenntnissen und
Fertigkeiten abzielen, in welchem Sinn der Begriff U. auch den
Selbstunterricht, d. h. diejenige Geistesbildung umfaßt,
welche ohne unmittelbare Mitwirkung eines andern (durch Lesen etc.)
sich vollzieht; im gewöhnlichen Sinn die Thätigkeit des
Lehrers, welche die Entwickelung der geistigen Anlagen oder
Kräfte des Schülers und dessen planmäßige
Anleitung zu Kenntnissen und Fertigkeiten bezweckt. Man
unterscheidet zwischen formellem und materiellem U., wovon der
erstere vorzüglich die Entwickelung, Übung und
Vervollkommnung der geistigen Anlagen, der letztere mehr die
Aneignung bestimmter Kenntnisse und Fertigkeiten zum Zweck hat;
ferner zwischen idealem und realem, wovon jener auf Herausbildung
von Ideen oder auf Vernunftbildung im engern und höhern Sinn,
dieser aber auf Bildung für die praktischen Zwecke des Lebens
sich richtet. Der Inbegriff der theoretischen Regeln und
Grundsätze für den U. ist die Unterrichtslehre oder
Didaktik (s.d.). Das ganze öffentliche Unterrichtswesen, auch
Schulwesen, von dem sich der Privatunterricht abscheidet, bildet im
modernen Staat ein besonderes Verwaltungsdepartement, mit einem
Ministerium des öffentlichen Unterrichts an der Spitze und mit
Provinzialschulkollegien, Schulinspektionen etc. als
Mittelbehörden. Vielfach ist jedoch, namentlich in
Deutschland, der geschichtlichen Entwickelung gemäß das
Schulwesen mit dem Kirchenwesen, soweit dieses der Staatshoheit
unterliegt, unter einem Ministerium (Kultusministerium)
zusammengefaßt. Vgl. Schulwesen.
Unterrichtsbriefe, s. Sprachunterricht, S. 185.
Untersalpetersäure, s. Stickstoffperoxyd.
Untersberg, Gebirgsstock der Salzburger Alpen,
südwestlich von Salzburg, mit drei Gipfeln: Geiereck (1801m),
Salzburger Hohethron (1851 m), Berchtesgadner Hohethron (1975 m),
und zahlreichen Klüften und Höhlen, worunter eine
prächtige Marmorgrotte und die 1845 entdeckte
Kolowratshöhle mit grotesken Eisformationen. Der Berg ist
durch das 1883 erbaute, bewirtschaftete Untersberghaus leichter
zugänglich gemacht worden; er liefert vorzüglichen
Marnior, der hier auch geschliffen wird. Er ist nach der Sage Sitz
Karls d. Gr. (s. Kaisersagen).
Unterscheidungszoll, s. Zuschlagszölle.
Unterschiebung, s. Kindesunterschiebung.
Unterschlächtig nennt man Wasserräder, bei
denen das Wasser aus einem Gerinne in die zuunterst stehenden
Schaufeln einfließt (s. Wasserrad); dann auch Feuerungen
für Siedepfannen, bei denen die Flamme unterhalb des
Pfannenbodens hinzieht.
Unterschlagen, s. Segel.
Unterschlagung (Unterschleif, Interversio), die
wissentliche rechtswidrige Zueignung einer fremden, beweglichen
Sache, welche sich im Besitz oder im Gewahrsam des Thäters
befindet. Der Thatbestand der U. fällt insofern mit dem des
Diebstahls zusammen, als hier wie dort eine Sache den Gegenstand
des Verbrechens bildet, welche eine bewegliche und eine fremde, d.
h. einem andern gehörige, ist. Ebenso ist der subjektive
Thatbestand bei beiden Verbrechen derselbe, indem für beide
Vorsätzlichkeit der Handlung, ferner das Bewußtsein,
daß die Sache eine fremde, und endlich die Absicht, sich die
Sache zuzueignen, erforderlich sind. Verschieden sind die beiden
Delikte aber insofern, als es sich bei dem Diebstahl um die
Wegnahme einer Sache aus dem Gewahrsam eines andern, bei der U.
dagegen um die Zueignung einer solchen Sache handelt, welche sich
bereits im Gewahrsam des Thäters befindet. So fällt z. B.
der sogen. Funddiebstahl, d. h. die widerrechtliche Zueignung einer
gefundenen Sache, nicht unter den Begriff des Diebstahls, sondern
unter den der U., weshalb auch dafür die Bezeichnung
"Fundunterschlagung" richtiger wäre. Als schwerer Fall der U.
erscheint es nach dem deutschen Strafgesetzbuch, wenn dem
Thäter die unterschlagene Sache anvertraut war (sogen.
Veruntreuung). Das Reichsstrafgesetzbuch läßt hier
Gefängnisstrafe bis zu fünf Jahren eintreten,
während es die einfache U. nur mit Gefängnis bis zu drei
Jahren bedroht. Beim Vorhandensein mildernder Umstände kann
auf Geldstrafe bis zu 900 Mk. erkannt werden. Wie beim Diebstahl,
wird auch beider U. der Versuch bestraft. Ebenso haben beide
Verbrechen es miteinander gemein, daß die That nur auf Antrag
des Verletzten strafrechtlich verfolgt wird, wenn der Betrag des
Verbrechensgegenstandes nur ein geringer ist und der Verletzte mit
dem Thäter in Familiengenossenschaft oder häuslicher
Gemeinschaft lebte. Diebstahl und U., welche von Verwandten
aufsteigender Linie gegen Verwandte absteigender Linie oder von
einem Ehegatten gegen den andern begangen worden, bleiben straflos.
Wird eine U. von einem Beamten an Geldern oder andern Sachen
verübt, welche er in amtlicher Eigenschaft empfangen oder im
Gewahrsam hat, so wird die That als besonderes Amtsverbrechen (s.
d.) bestraft. Das österreichische Strafgesetzbuch (§ 181
ff., 461 ff.) kennt als selbständiges Delikt nur die
rechtswidrige Zueignung anvertrauten Gutes (Veruntreuung). Vgl.
Deutsches Reichsstrafgesetzbuch, § 246 ff., 350 f.; v.
Stemann, Das Vergehen der U. und der Untreue (Kiel 1870).
Unterschnitten heißt ein horizontales Bauglied,
dessen untere Seite ausgehöhlt ist.
Unterschrift, der unter eine Urkunde (s. d.) gesetzte
Name des Ausstellers derselben. Bei Personen, welche nicht
schreiben können, vertritt ein Handzeichen, gewöhnlich
drei Kreuze, die Stelle der U. (s. Analphabeten).
Wechselerklärungen, welche mittels Handzeichens vollzogen
sind, haben nur dann Wechselkraft, wenn das Handzeichen gerichtlich
oder notariell beglaubigt ist. Der Name, unter welchem ein Kaufmann
seine U. abgibt, heißt Firma (s. d.); daher "Firma" oder "U.
geben" s. v. w. Prokura (s. d.) erteilen. Nach der deutschen
Zivilprozeßordnung (§ 381) begründet eine von dem
Aussteller unterschriebene oder mittels gerichtlich oder notariell
beglaubigten Handzeichens unterzeichnete Urkunde vollen Beweis
dafür, daß die in derselben enthaltenen Erklärungen
von dem Aussteller abgegeben sind. Was das Beweisverfahren
anbetrifft, so ist nach der Zivilprozeßordnung (§ 404
f.) bei unterschriebenen Privaturkunden die Erklärung des
Beweisgegners auf die Echtheit der U. zu richten. Ist die U.
anerkannt, oder
1032
Unterschweflige Säure - Unterseeische Fahrzeuge.
ist das ihre Stelle vertretende Handzeichen gerichtlich oder
notariell beglaubigt, so hat die über der U. oder dem
Handzeichen stehende Schrift die Vermutung der Echtheit für
sich. Soll also trotz der echten U. die Unechtheit oder eine
Veränderung der Urkunde behauptet werden, so muß der
Beweisgegner, welcher diese Behauptung aufstellt, den Beweis
derselben übernehmen und erbringen, wenn anders die Urkunde
ihre Beweiskraft verlieren soll.
Unterschweflige Säure (hydroschweflige Säure)
H2SO2 entsteht, wenn man Eisen oder Zink in einem verschlossenen
Gefäß in wässeriger schwefliger Säure
löst. Der dabei frei werdende Wasserstoff reduziert im
Entstehungsmoment die schweflige Säure. Die tiefgelbe
Lösung wirkt sehr kräftig reduzierend und fällt aus
Silber- und Quecksilbersalzen die Metalle. Das Natronsalz entsteht,
wenn man eine konzentrierte Lösung von saurem schwefligsaurem
Natron in einer verschlossenen Flasche mit Zink versetzt und gut
abkühlt; es kristallisiert in Nadeln, absorbiert begierig
Sauerstoff, wirkt reduzierend, wie die Säure, und dient daher
in der Färberei und Zeugdruckerei zur Reduktion des Indigos.
Bis zur Entdeckung dieser Säure durch Schützenberger
nannte man u. S. (dithionige Säure, Thioschwefelsäure)
eine Säure H2S2O3, welche im freien Zustand nicht bekannt ist,
aber eine Reihe beständiger Salze (Thiosulfate, Hyposulfite)
bildet, deren Lösung auf Zusatz von Säuren Schwefel
abscheidet und dann schweflige Säure enthält. Diese Salze
entstehen auf verschiedene Weise. So bildet sich
unterschwefligsaures Natron, wenn man schweflige Säure in eine
Lösung von Schwefelnatrium leitet oder schwefligsaures Natron
mit Schwefel kocht; die meisten Thiosulfate kristallisieren gut,
enthalten Kristallwasser und werden gewöhnlich erst bei der
Zersetzungstemperatur wasserfrei. Sie bilden auch gern Doppelsalze,
und daher lösen sich die unlöslichen Thiosulfate in einer
Lösung des Natriumsalzes, welches auch Chlor-, Brom-,
Jodsilber, Jodblei, schwefelsaures Blei und Gips löst. Man
gewinnt das unterschwefligsaure Natron (Natriumthiosulfat) Na2S2O3
in der oben angegebenen Weise, häufiger aus
Sodarückständen, indem man dieselben an der Luft sich
oxydieren läßt, auslaugt und die Lösung, welche
neben unterschwefligsaurem Kalk viel Schwefelcalcium enthält,
in einem Koksturm einem erwärmten Luftstrom entgegenlaufen
läßt, um das Schwefelcalcium zu unterschwefligsaurem
Kalk zu oxydieren. Diese Oxydation kann auch durch Einblasen von
Luft oder schwefliger Säure erreicht werden. Man konzentriert
dann die Lösung durch Verdampfen und versetzt sie mit
schwefelsaurem Natron, wodurch schwefelsaurer Kalk gefällt
wird, während unterschwefligsaures Natron in Lösung
bleibt, welches durch Kristallisation gewonnen und durch
Umkristallisieren gereinigt wird. Es bildet große, farblose,
luftbeständige Kristalle mit 5 Molekülen Kristallwasser
vom spez. Gew. 1,73, schmeckt kühlend, bitter schweflig,
löst sich leicht in Wasser, nicht in Alkohol, verwittert bei
33°, schmilzt bei 45-50°, wird bei 215° wasserfrei und
zersetzt sich bei 220°. Die Lösung ist wenig
beständig und zersetzt sich namentlich beim Kochen. Man
benutzt das Salz als Antichlor in der Papierfabrikation und
Zeugbleicherei, zum Bleichen von Wolle, Stroh, Elfenbein, Knochen,
Haar etc. (da es beim Versetzen der Lösung mit Salzsäure
reichlich schweflige Säure entwickelt), als bequemes Mittel
zur Darstellung von schwefliger Säure im allgemeinen, als
Beize in der Zeugdruckerei, als gärungswidriges Mittel in der
Zuckerfabrikation, zum Fixieren der Photographien, zur Darstellung
von Zinnober, Antimonzinnober und verschiedenen kunstlichen
Farbstoffen, zur Bereitung von Indigküpen, zum Extrahieren von
Silbererzen, zur Bereitung von Vergoldungs- und
Versilberungsflüssigkeiten etc. Es wurde 1799 von Chaussier
zuerst dargestellt und von Vauquelin genauer untersucht.
Unterschwefligsaures Bleioxyd PbS2O3 wird aus der Lösung eines
Bleisalzes durch unterschwefligsaures Natron gefällt, ist
farblos, wenig löslich, zersetzt sich in höherer
Temperatur bei Abschluß der Luft in Schwefelblei und
schweflige Säure, verglimmt an der Luft und dient zum
Vulkanisieren von Kautschuk und Guttapercha. Unterschwefligsaures
Goldoxydnatron wird erhalten, indem man Goldchloridlösung mit
Kalkmilch digeriert und den ausgewaschenen Niederschlag in
unterschwefligsaurem Natron löst. Es wird unter dem Namen Sel
d'or in der Photographie benutzt. Unterschwefligsaurer Kalk CaS2O3
entsteht in großer Menge bei der Verwertung der
Sodarückstände, wird aber meist auf unterschwefligsaures
Natron verarbeitet. Es bildet farblose, beständige Kristalle,
löst sich leicht in Wasser, nicht in Alkohol und wird wie das
Natronsalz benutzt.
Untersee, s. Bodensee.
Unterseeische Fahrzeuge (Taucherschiffe), Fahrzeuge,
welche sich in vertikaler und in horizontaler Richtung unter Wasser
bewegen lassen und ihrer Besatzung das Atmen in dem von jeder
Kommunikation mit der Atmosphäre abgeschnittenen Raum
gestatten. Als das zur Zeit vollkommenste unterseeische Eahrzeug
gilt das nach seinem Erfinder benannte, in England erbaute und von
der türkischen Regierung käuflich erworbene
Nordenfeltboot, welches als Torpedoboot eingerichtet und auch
über Wasser als solches verwendbar ist. Das Boot enthält
über 150cbm Luft und ermöglicht dadurch 6-7 Personen
während 5-6 Stunden den Aufenthalt unter Wasser. Nach dieser
Zeit muß das Boot an die Oberfläche des Wassers kommen,
um durch Öffnen seiner wasserdichten Luken frische Luft zu
schöpfen. Das Senken und Heben des Fahrzeugs geschieht,
nachdem durch gleichzeitiges Einlassen oder Auspumpen von Wasser
aus besondern Abteilungen desselben sein Gewicht entsprechend
vergrößert, resp. vermindert worden, durch Rotation
zweier Schraubenpropeller, welche an den Enden des Boots mit
vertikal stehenden Achsen und von innen bewegbar angebracht sind.
Eine gleimäßige Rotation dieser Propeller in der einen
oder andern Richtung bewirkt ein gleichmäßiges Senken,
resp. Heben des Boots, während eine schnellere Rotation des
einen von beiden eine schnellere vertikale Bewegung des
betreffenden Endes des Boots zur folge hat. Hierdurch hat man es in
der Gewalt, den Kiel des Boots stets, besonders auch dann in
horizontaler Lage zu erhalten, wenn es seine unterseeische Fahrt in
horizontaler Ebene beginnen soll. Zur Ausführung einer
Expedition unter Wasser ist zunächst erforderlich, den
Dampfdruck im Kessel auf sein Maximum zu steigern. Dadurch wird
eine Aufspeicherung von Wärme im Kesselwasser bedingt, welche
ausreicht, der Hauptmaschine während 5-6 Stunden den zur
Erzielung einer Geschwindigkeit von 6-7 Knoten erforderlichen Dampf
zu liefern. Alsdann werden die Kesselfeuerungen ausgelöscht,
der Schornstein abgenommen, die Luken wasserdicht geschlossen, ein
gewisses Quantum Wasser in die dazu bestimmten Räume
eingelassen und die beiden oben erwähnten Schrauben an den
Enden des Schiffs, auf Senken wirkend, in Rotation gesetzt, bis das
Schiff sich in der gewünschten
1033
Unterstaatssekretär - Unterstützungswohnsitz.
Tiefe befindet, und nun die Hauptmaschine auf Vorwärtsgang
angelassen. Soll das Boot wieder an die Oberfläche kommen, so
genügt es, nach Arretierung der Hauptmaschine jene beiden
Schrauben auf Heben in Gang zu setzen, während gleichzeitig
das vorher eingelassene Wasser wieder ausgepumpt wird, welche
Operationen übrigens sämtlich durch kleine Dampfmaschinen
bewirkt werden, die ihren Dampf ebenfalls dem Hauptkessel
entnehmen, und unter denen sich auch eine solche für den
Betrieb der elektrischen Beleuchtung befindet. Zur Kontrolle der
Bewegung sind zwei Ruder vorhanden, von denen das eine mit
vertikalem Ruderblatt wie ein gewöhnliches Schiffsruder wirkt
und Abweichungen nach rechts und links reguliert, während das
andre mit horizontalem Ruderblatt die Bewegung in horizontaler Bahn
sicherstellt. Der Führer des unterseeischen Fahrzeugs befindet
sich auf erhöhtem Stand mit dem Kopf in einer am höchsten
Punkte des Boots aus diesem hervorragenden, wasserdicht
aufgesetzten Glasglocke, so da ihm, solange die Bewegung noch dicht
unter der Oberfläche oder mit jener Glocke noch über
Wasser vor sich geht, eine gewisse Orientierung gestattet ist. Im
übrigen ist derselbe bezüglich der einzuschlagenden
Richtung nur auf seinen Kompaß angewiesen. Er handhabt das
vertikale und horizontale Ruder und gegebenen Falls die
Abzugsvorrichtung zum Lancieren des Torpedos. Je tiefer ein
unterseeisches Fahrzeug unter Wasser gelassen werden soll, um so
sicherer muß dasselbe gegen die Möglichkeit
geschützt sein, durch den Wasserdruck zusammengepreßt zu
werden. Um dies zu erreichen, werden die Nordenfeltboote aus Stahl
mit besonders soliden innern Verbandteilen aus demselben Material
erbaut. Das bereits 1850 von Bauer erbaute und im Kieler Hafen
probierte Boot verdankte seinen Mißerfolg vorzugsweise dem
Umstand, daß es, dem Wasserdruck nachgebend, seitlich
eingedrückt wurde und nicht mehr vermochte, an die
Oberfläche zu kommen, während die drei Insassen mit der
durch die Einsteigeluke entweichenden Luft wieder ans Tageslicht
gelangten. In neuester Zeit hat man in Frankreich den naheliegenden
Ge danken zur Ausführung gebracht, die Elektrizität als
Betriebskraft für unterseeische Fahrzeuge zu benutzen. Die mit
dem Fahrzeug Gymnote erzielten Resultate sollen sehr günstige
gewesen sein, so daß es in Frankreich als Konkurrenztyp gegen
die Nordenfeltboote angesehen wird.
Unterstaatssekretär, s. Staatssekretär.
Unterstützuugswohnsitz, derjenige Gemeindeverband,
welcher im einzelnen Fall zur öffentlichen Unterstützung
einer hilfsbedürftigen Person verpflichtet ist; auch das Recht
einer solchen Person, von einem Gemeindeverband (Armenverband)
Unterstützung verlangen zu können. Im Gegensatz zu dem in
Deutschland früher herrschenden Heimatssystem, wonach ein
Unterstützungsanspruch mit der Gemeindeangehörigkeit (s.
Heimat) verknüpft war, brachte die preußische
Gesetzgebung diesen Anspruch mit der thatsächlichen
Wohnsitznahme in Verbindung und schuf so einen mit dem Heimatsrecht
oder der Gemeindeangehörigkeit nicht zusammenfallenden U.
Während ferner das Heimatssystem zu einer Beschränkung
der Aufnahme Neuanziehender führte, nahm Preußen das
System der Freizügigkeit (s. d.) an, welch letzteres dann in
die Verfassung und Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes und sodann
des Deutschen Reichs übergegangen ist. Auch das Recht des
Unterstützungswohnsitzes wurde durch Gesetz vom 6. Juni 1870
für den Norddeutschen Bund eingeführt Dies Gesetz ist
dann auf Baden, Südhessen und Württemberg, aber nicht auf
Bayern und Elsaß Lothringen ausgedehnt worden. Nach dem
Gesetz vom 6. Juni 187o wird die öffentliche
Unterstützung durch die Ortsarmenverbände und die
Landarmenverbände gewährt, und zwar können die
Ortsarmenverbände aus einer oder mehreren Gemeinden oder
Gutsbezirken zusammengesetzt sein, während die
Landarmenverbände entweder mit dem Staatsgebiet des
betreffenden Bundesstaats (Kleinstaats), welcher die Funktionen des
Landarmenverbandes selbst übernimmt, zusammenfallen, oder
besonders konstituiert und dann in der Regel aus mehreren
Ortsarmenverbänden zusammengesetzt sind. In Preußen
bildet der Provinzialverband in der Regel auch den
Landarmenverband. Die innere Organisation der Orts und
Landarmenverbände, die Art und das Maß der im Fall der
Hilfsbedürftigkeit zu gewährenden öffentlichen
Unterstützung und die Beschaffung der erforderlichen Mittel
werden durch die Landesgesetzgebung geregelt, welche auch
darüber Bestimmungen zu treffen hat, in welchen Fällen
und in welcher Weise den Ortsarmenverbänden von den
Landarmenverbänden oder von andern Stellen eine Beihilfe zu
gewähren ist, sowie darüber, ob und inwiefern sich die
Landarmen verbände der Ortsarmenverbände als ihrer Organe
behufs der öffentlichen Unterstützung
Hilfsbedürftiger bedienen dürfen. Die
Ausführungsgesetze der Einzelstaaten sind vielfach dem
preußischen Ausführunggesetz vom 8. März 1871
nachgebildet (vgl. sächsische Gesetze vom 6. Juni 1871 und 15.
Juni 1876, württembergisches Gesetz vom 17. April 1873,
badisches vom 14. März 1872, hessisches vom 14. Juli1871
etc.). Was die Unterstützung selbst anbelangt, so wird nach
dem preußischen Aussührungsgesetz dem
Hilfsbedürftigen Obdach, der unentbehrliche Lebensunterhalt,
die erforderliche Pflege in Krankheitsfällen und im Fall des
Ablebens ein angemessenes Begräbnis gewährt. Das
Unterstützungswohnsitzgesetz unterscheidet ferner 1) zwischen
der sich vorläufig und momentan nötig machenden und 2)
zwischen der dauernden und endgültigen Unterstützung. Zu
ersterer ist derjenige Ortsverband verpflichtet, in dessen Bezirk
sich der hilfsbedürftige Deutsche bei dem Eintritt der
Hilfsbedürftigkeit befindet, vorbehaltlich des Anspruchs auf
Erstattung der Kosten und der Übernahme des
Hilfsbedürftigen gegen den hierzu verpflichteten Armenverband.
Hierzu ist, wenn der Hilfsbedürftige einen U. hat, der
Ortsarmenverband dieses Unterstützungswohnsitzes,
außerdem aber, wenn kein U. begründet ist, derjenige
Landarmenverband verpflichtet, in dessen Bezirk sich jener bei
Eintritt der Hilfsbedürftigkeit befand, oder, falls er in
hilfsbedürftigem Zustand aus einer Straf-, Kranken-, Bewahr-
oder Heilanstalt entlassen wurde, derjenige Landarmenverband, aus
welchem seine Einlieferung in die Anstalt erfolgte. Der U. wird
begründet 1) durch Aufenthalt, 2) durch Verehelichung, 3)
durch Abstammung. Durch Aufenthalt erwirbt derjenige, welcher
innerhalb eines Ortsarmenverbandes nach zurückgelegtem 24.
Lebensjahr zwei Jahre lang ununterbrochen seinen gewöhnlichen
Aufenthalt gehabt hat, in demselben den U. Ferner teilt die Ehefrau
vom Zeitpunkt der Eheschließung ab den U. des Mannes; endlich
teilen die ehelichen Kinder den U. des Vaters, uneheliche den ihrer
Mutter. Verloren wird der U. durch den Erwerb eines anderweiten
Unterstützungswohnsitzes und durch zweijährige
ununterbrochene Abwesenheit nach zurückgelegtem 24.
Lebensjahr. Wer sich seitdem in den letzten Jahren an keinem Ort
zwei Jahre
1034
Untersuchungshaft - Unterthan.
lang ununterbrochen aufgehalten hat, fällt im Fall der
Unterstützungsbedürftigkeit als landarm dem
Landarmenverband seines Aufenthaltsorts zur Last. Die
zweijährige Erwerbs und Verlustfrist führt freilich nicht
selten Ortsarmenverbände dazu, durch "Abschiebung" von
Hilfsbedürftigen vor Ablauf der zwei Jahre den Erwerb des
Unterstützungswohnsitzes zu verhüten. Der
Hilfsbedürftige, welcher innerhalb eines Ortsarmenverbandes
den U. hat, wird als ortsarm bezeichnet. Entstehen über die
Verpflichtung zur Unterstützung hilfsbedürftiger Personen
zwischen verschiedenen Ärmenverbänden Streitigkeiten, so
kommt es, was das Verfahren anbetrifft, darauf an, ob die
streitenden Teile einem und demselben Bundesstaat oder
verschiedenen Staaten angehören. Im erstern Fall sind die
Landesgesetze des betreffenden Staats maßgebend, während
für Differenzen zwischen den Armenverbänden verschiedener
Staaten in dem Gesetz vom 6. Juni 1870 besondere Vorschriften
gegeben sind. Auch in diesem Fall wird nämlich zunächst
von den nach Maßgabe der Landesgesetzgebung kompetenten
Behörden, in Preußen von den Verwaltungsgerichten, in
andern Staaten von den hierzu besonders eingesetzten Deputationen
oder von den sonst zuständigen Verwaltungsbehörden,
verhandelt und entschieden. Diese Behörden können
Untersuchungen an Ort und Stelle veranlassen, Zeugen und
Sachverständige laden und eidlich vernehmen und überhaupt
den angetretenen Beweis in vollem Umfang erheben. Gegen die durch
schriftlichen, mit Gründen zu versehenden Beschluß zu
gebende Entscheidung findet Berufung an das Bundesamt für das
Heimatswesen statt. Letzteres ist eine ständige und kollegiale
Behörde mit dem Sitz in Berlin, bestehend aus einem
Vorsitzenden und mindestens vier Mitgliedern, welche auf Vorschlag
des Bundesrats vom Kaiser auf Lebenszeit ernannt werden. Zu der
Beschlußfassung sind mindestens drei Mitglieder zuzuziehen.
Die Berufung ist binnen einer Präklusivfrist von 14 Tagen, von
der Behändigung der angefochtenen Entscheidung an gerechnet,
bei derjenigen Behörde, gegen deren Entscheidung sie gerichtet
ist, schriftlich anzumelden. Der Gegenpartei steht das Recht zu
einer binnen vier Wochen nach der Behändigung einzureichenden
schriftlichen Gegenausführung zu. Die Entscheidung des
Bundesamtes erfolgt gebührenfrei in öffentlicher Sitzung
nach erfolgter Ladung und Anhörung der Parteien; gegen die
Entscheidung ist ein weiteres Rechtsmittel nicht zulässig. Das
Bundesamt ist aber von verschiedenen Staaten und namentlich von
Preußen auch für die im eignen Gebiet vorkommenden
Streitsachen als letzte Instanz anerkannt. In Bayern gilt noch das
partikulare Heimatsrecht (s. Heimat, S. 302). In
Süddeutschland ist vielfach der Wunsch nach Rückkehr zu
dem frühern Heimatssystem laut geworden. Vgl. Eger, Das
Reichsgesetz über den U. vom 6. Juni 1870 (2. Aufl., Bresl.
1884); Arnold, Die Freizügigkeit und der U. (Berl. 1872);
Rocholl, System des deutschen Armenpflegerechts (das. 1873);
Wohlers, Das Reichsgesetz über den U. (4. Aufl., das. 1887).
Die Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimatswesen werden
gesammelt und herausgegeben von Wohlers (Berl. 1873 ff.).
Untersuchuugshaft (Untersuchungsarrest), Verhaftung des
einer verbrecherischen That Verdächtigen, um die Erreichung
der Zwecke der strafrechtlichen Untersuchung zu sichern. Im
Gegensatz zur Strafhaft ist der Zweck der U. ein vorbereitender,
die Vollstreckung des künftigen Strafurteils sichernder. Die
U. ist ein Eingriff in die persönliche Freiheit lediglich aus
Zweckmäßigkeitsgründen. Die moderne
Strafprozeßgesetzgebung ist daher darauf bedacht, die
Voraussetzungen der U. genau festzusetzen, um ein
willkürliches Verhängen der U. möglichst zu
vermeiden (s. Haft). Jedenfalls müssen gegen den
Angeschuldigten dringende Verdachtsgründe vorliegen. Die U.
darf nicht den Charakter einer Strafe haben. Deshalb ist die
Behandlung des Untersuchungsgefangenen von derjenigen des
Strafgefangenen wesentlich verschieden. Nach der deutschen
Strafprozeßordnung (§ 116) muß der in U.
Genommene, soweit möglich, einzeln und namentlich nicht mit
Strafgefangenen zusammen verwahr werden. Mit Zustimmung des
Verhafteten kann jedoch von dieser Vorschrift abgesehen werden.
Demselben sollen ferner nur solche Beschränkungen auferlegt
werden, welche zur Sicherung des Zweckes der Hast oder zur
Aufrechthaltung der Ordnung im Gefängnis notwendig sind.
Bequemlichkeiten und Beschäftigungen, die dem Stand und den
Vermögensverhältnissen des Verhafteten entsprechen, darf
sich derselbe auf seine Kosten verschaffen, soweit sie mit dem
Zweck der Haft vereinbar sind und weder die Ordnung im
Gefängnis stören noch die Sicherheit gefährden.
Fesseln dürfen dem Verhafteten im Gefängnis nur dann
angelegt werden, wenn es wegen besonderer Gefährlichkeit
seiner Person, namentlich zur Sicherung andrer, erforderlich
erscheint, oder wenn er einen Selbstentleibungs- oder
Entweichungsversuch gemacht oder vorbereitet hat. Bei der
Hauptverhandlung soll er ungefesselt sein. Gleichwohl erleidet der
nachmals verurteilte Angeschuldigte durch die vorgängige U.
tatsächlich ein Mehr an Strafe, und ebendeshalb entspricht es
der Billigkeit, die erlittene U. auf die erkannte Strafe in
Anrechnung zu bringen. Das deutsche Strafgesetzbuch (§ 60)
bestimmt, daß eine erlittene U. bei Fällung des Urteils
auf die erkannte Strafe ganz oder teilweise angerechnet werden
kann. Sie muß nach der deutschen Strafprozeßordnung
(§ 482) auf die zu vollstreckende Freiheitsstrafe insoweit
angerechnet werden, als sie für den verurteilten
Angeschuldigten noch fortbestand, nachdem er auf die Einlegung
eines Rechtsmittels verzichtet oder das eingelegte Rechtsmittel
zurückgenommen hat, oder seitdem die Einlegungsfrist
abgelaufen ist, ohne daß er eine Erklärung abgegeben.
Nach der österreichischen Strafprozeßordnung (§
400) ist die U. anzurechnen, welche der zu einer Freiheitsstrafe
Verurteilte seit der Verkündigung des Urteils erster Instanz
erlitten hat, insofern der Antritt der Strafe durch von dem Willen
des Verurteilten unabhängige Umstände verzögert
wurde. Außerdem findet die Einrechnung auch dann statt, wenn
ein zugunsten des Verurteilten ergriffenes Rechtsmittel auch nur
einen teilweisen Erfolg hatte. Für den durch eine U.
betroffenen, nachträglich aberfreigesprochen en
Angeschuldigten wird neuerdings vielfach die Gewährung einer
Entschädigung als ein Gebot der Billigkeit bezeichnet(s.
Unschuldig Angeklagte und unschuldig Verurteilte). Vgl. Deutsche
Strafprozeßordnung, § 112 ff.; Österreichische,
§ 184 ff.
Untersuchungsprozeß, s. v. w. Strafprozeß;
auch s. v. w. Inquisitionsprozeß (s. Strafprozeß).
Uutersuchungsrecht, s. Durchsuchungsrecht.
Untersuchungsrichter, s. Richter.
Untersuchungsverfahren (Inquisitionsverfahren), s.
Anklageprozeß.
Unterthan (Subditus), jeder, welcher einer Staatsgewalt
unterworfen ist. Die Unterthanenschaft ist entweder ein bleibendes
persönliches Rechtsver-
1035
Unterthaneneid - Unterwalden.
hältnis, gegründet auf die Staatsangehörigkeit
des Unterthanen (subditus personalis), oder ein nur
vorübergehendes Verhältnis, indem auch Fremde als
Unterthanen (subditi temporarii) behandelt werden, solange sie im
Staat weilen, diejenigen ausgenommen, welchen nach
völkerrechtlichem Gebrauch die Exterritorialität zukommt,
z. B. Gesandte. Gründet sich die Unterthanenschaft lediglich
auf den Besitz unbeweglicher Güter, so heißen die
Unterthanen Landsassen (subditi reales, Forensen), wenn sie
nämlich Grundstücke im Land besitzen, aber im Ausland
wohnen. Letztere sind in dem Land, worin ihre Grundstücke
liegen, nur den Gesetzen unterworfen, welche die Grundstücke
betreffen oder ausdrücklich auf die Forensen mit ausgedehnt
sind. Im engern und eigentlichen Sinn versteht man aber unter
Unterthanen im Gegensatz zu den Fremden nur die Angehörigen
des Staats, welche als Inländer (Staatsangehörige,
Volksgenossen, Regierte) zu der Staatsgewalt in dem dauernden
Verhältnis persönlicher Unterordnung stehen. Die
Unterthanenschaft in diesem Sinn ist gleichbedeutend mit
Heimatsrecht oder Staatsangehörigkeit (s. d.). Die politisch
vollberechtigten Unterthanen werden Staatsbürger (s. d.)
genannt.
Unterthaneneid, s. Huldigung.
Untertibet, früherer Name von Ladak (s. d.).
Untertöne, in der Musik diejenige Reihe von
Tönen, welche sich im umgekehrten Verhältnis der
Obertonreihe nach der Tiefe erstreckt und ebenso für die
Erklärung der Konsonanz des Mollakkords herangezogen werden
muß, wie die Obertonreihe für die des Durakkords.
Unterwalden, einer der drei Urkantone der Schweiz, grenzt
im N. an Schwyz und Luzern (durch den Vierwaldstätter See
davon getrennt), im W. an Luzern, im S. an Bern, im O. an Uri und
umfaßt 765 qkm (13,9 QM.). Der Kanton wird durch den Kernwald
in zwei seit dem 12. Jahrh. getrennte Staatswesen (Halbkantone)
geschieden: Nidwalden (290 qkm mit 12,520 Einw.) und Obwalden (475
qkm mit 15,030 Einw.), von denen ersteres den untern Teil des
Engelberger Thals und das Seegestade umfaßt, während das
höher gelegene Obwalden wesentlich durch das Thal der Sarner
Aa und das obere Engelberger Thal gebildet wird. Die die
Thäler einrahmenden Gebirge lassen sich teils als Flügel
der Berner Alpen (Titlis 3239 m, Uri-Rotstock 2932 m etc.)
betrachten, welche nach dem See hin voralpinen Charakter annehmen
und mit dem Buochser Horn (1809 m) und Stanser Horn (1900 m)
abschließen, teils als ein wesentlicher Teil der Luzerner
Alpen, welche in den voralpinen Massen des Brienzer Rothorns (2351
m) und Pilatus (2133 m) ihre Häupter haben. In der fahrbaren
Paßlücke des Brünig (1004 m) nähern sich die
beiden Systeme, während aus dem Engelberg nur ungebahnte
Bergpfade führen: die Surenen (2305 m) nach Uri und das Joch
(2208 m) nach dem Haslethal. Das Klima ist am Seegestade mild, im
Hochgebirge rauh. Der Kanton zählt (1888) 27,550 Einw. Die
Nidwaldner sind ein "rüstiger, intelligenter Volksschlag",
dessen Verhältnisse in einfachen, altertümlichen Formen
sich fortbewegen, gutmütig und abgeschlossen, gleich den
Obwaldnern, welch letztere übrigens an intellektueller
Befähigung zurückzustehen scheinen. Die Bevölkerung
ist fast ganz katholisch und gehört zur Diözese Chur. Es
gibt noch sechs Klöster, unter denen das Benediktinerstift
Engelberg (s. d.) das angesehenste ist. U. ist ein Hirtenland. Die
Rinder (17,853 Stück) gehören größtenteils zur
Schwyzer Rasse und sind meist Kühe; Butter und Käse sind
Ausfuhrprodukte. Stark ist auch der Bestand an Ziegen (8308
Stück), geringer der an Schweinen und Schafen. Die Matten und
Gärten Unterwaldens sind mit zahllosen Obstbäumen
besetzt; Obst, Obstwein und Branntwein bilden Ausfuhrartikel, so
auch die Nüsse. An den Waldungen (191 qkm) besäße
U. eine unversiegliche Quelle des Wohlstandes, wenn die
Holzproduktion durch eine bessere Bewirtschaftung gesteigert
würde. Das Melchthal und Alpnach haben schönen Marmor.
Schwendi-Kaltbad hat eine geschätzte Eisenquelle von 4,7°
C. Die Seidenspinnerei und Kämmlerei von Buochs ist eine
Filiale der Gersauer Industrie; in Hergiswyl arbeitet eine
Glashütte, im Rotzloch eine Papierfabrik. Für den Transit
ist U. nicht günstig gelegen, sein Markt ist Luzern; es
berührt bloß die große Verkehrsstraße,
welche der See als Zugang des St. Gotthard bildet. Hingegen liegt
es im Bereich des allsommerlichen Touristenzugs. Am See liegen die
Dampferstationen Beckenried, Stansstad und Alpnach; belebte Kurorte
sind: Engelberg, Schöneck, Bürgistock, Melchseealp etc.,
und von Alpnach führt durch das Sarner Thal hinauf und
über den Brünig eine der belebtesten Touristenrouten, der
seit 1888 die Brünigbahn dient. Im Juni 1889 wurde die
Pilatusbahn eröffnet. In den beiden Hauptorten, Stans und
Sarnen, bestehen gymnasiale Anstalten, auch im Stift Engelberg. Die
Stiftsbibliothek zählt 20,000 Bände, fast die Hälfte
aller in öffentlichen Bibliotheken befindlichen Bücher.
Die beiden Staatswesen sind rein demokratischer Einrichtung. Die
jetzt gültige Verfassung Obwaldens wurde vom Volk 27. Okt.
1867 angenommen. Die Landsgemeinde hat die gesetzgebende Gewalt;
ihr müssen auch alle Staatsanleihen, die Landsteuer sowie alle
10,000 Frank übersteigenden Ausgaben zur Entscheidung
vorgelegt werden, und jedem einzelnen Bürger ist die
Gesetzesinitiative eingeräumt. Die Landsgemeinde wählt
auch die oberste Exekutivbehörde, den Regierungsrat, der aus
sieben Mitgliedern besteht, und das Obergericht von neun
Mitgliedern, beide auf je vier Jahre. Der Präsident des
Regierungsrats führt den Titel Landammann. Daneben besteht,
gleichsam als legislatorisches Organ des Volkes, ein Kantonsrat,
der in den Gemeinden gewählt wird. Eine Bezirkseinteilung
besteht nicht; die Zahl der Gemeinden beträgt sieben: Hauptort
ist Sarnen. Eine ähnliche Verfassung, vom 2. April 1877, hat
Nidwalden, nur daß der Landrat, entsprechend dem Obwaldner
Kantonsrat, auf sechs Jahre gewählt wird und Regierungsrat und
Obergericht je aus elf Mitgliedern bestehen und auf je drei Jahre
gewählt werden. Die Zahl der Gemeinden beträgt elf;
Hauptort ist Stans. Für den 1. Mai 1888 berechnet sich der
Vermögensbestand Obwaldens auf 496,961 Frank Aktiva, 99,150
Frank Passiva, also netto 397,811 Fr. Die Rechnung für das
Betriebsjahr 1887/88 ergab 151,663 Fr. Einnahmen, 143,683 Fr.
Ausgaben, demnach einen Überschuß der erstern von nahezu
8000 Fr. In Nidwalden zeigt die Rechnung für 1887: an
Einnahmen 177,944 Fr., an Ausgaben 161,660, also einen Saldo von
16,284 Fr., auf Ende 1887 ein reines Vermögen von 124,934 Fr.
Geschichte. Über U. (intra montem), welcher Name übrigens
erst um 1300 auftaucht, herrschten die Habsburger teils als Grafen
des Aar- und Zürichgaus, teils als Kastvögte mehrerer
Klöster, die daselbst Grundbesitz hatten. Im 13. Jahrh.
bildeten das Thal Sarnen "ob dem Kernwald" und das Thal Stans "nid
dem Kernwald" zwei gesonderte Gemeinwesen.
1036
Unterweißenburg - Unze.
Nachdem sich beide schon 1245 vorübergehend mit Schwyz zu
einer Erhebung gegen die Habsburger verbunden hatten, schlossen sie
1291 mit Uri und Schwyz das ewige Bündnis der drei
Waldstätte und vereinigten sich zugleich untereinander zu dem
Gemeinwesen U., welches 1309 mit Schwyz u. Uri von Heinrich VIII.
reichsfrei erklärt wurde. Zur Zeit der Schlacht von Morgarten
hatten sich die Unterwaldner gegen die über den Brünig
eingedrungenen Österreicher zu verteidigen. Um 1350 trennten
sich Nid- und Obwalden wieder; doch fanden noch spät im 15.
Jahrh. gemeinsame Landsgemeinden beider Länder statt, und in
der Eidgenossenschaft zählten sie nur als Ein Bundesglied.
Daneben bildete das Thal Engelberg unter der Herrschaft des
dortigen Klosters einbesonderes Gebiet, welches seit 1465 im Schirm
von Luzern, Schwyz und U. stand und erst 1815 mit Obwalden
vereinigt wurde. Zur Zeit der Reformation gehörte U. zu den
fünf ihr entschieden feindlichen Orten. Der helvetischen
Verfassung von 1798 fügte sich Obwalden ohne Kampf, Nidwalden
aber erst, nachdem infolge des verzweifeltsten Widerstandes das
Land von den Franzosen in eine Wüste verwandelt worden war
(7.-9. Sept. 1798). Im J. 1802 stellte U. im Aufstand gegen die
helvetische Regierung seine Landsgemeinden wieder her, welche durch
die Mediationsakte 1803 garantiert wurden. Beide Landesteile nahmen
teil am Sarner Bund (1832) sowie am Sonderbund 1846 und
kapitulierten 25. Nov. 1847. Nachdem sie sich 1850 zum erstenmal
Verfassungen gegeben, unterwarf Obwalden die seinige 2. Okt. 1867
einer Revision, ohne jedoch ihren Grundlagen nahezutreten, welchem
Beispiel Nidwalden 2. April 1877 folgte. 1875 hat Obwalden in
anerkennenswerter Weise sein Schulwesen verbessert, dagegen im
April 1880 die Wiedereinführung der Todesstrafe beschlossen.
Vgl. Businger, Die Geschichten des Volkes von U. (Luzern 182728, 2
Bde.); Derselbe, Der Kanton U. (St. Gallen 1836); Gut, Der
Überfall von Nidwalden im J. 1798 (Stans 1862); Christ, Ob dem
Kernwald (Basel 1869).
Uuterweißenburg (ungar. Alsó-Fehér),
ungar. Komitat in Siebenbürgen, wird von den Komitaten Hunyad,
Torda-Aranyos, Groß und Kleinkokelburg und Hermannstadt
umschlossen, hat 3576,50 qkm (64,9 QM.), ist im W. gebirgig und
wird von der Maros und dem Kokel (Küküllö)
bewässert. Es hat (1881) 178,021 Einw. (meist Rumänen,
die der griechisch-orientalischen und griechisch-katholischen
Kirche angehören). Es ist sehr waldreich und fruchtbar und
liefert Weizen, Korn, Mais, sehr gutes Obst, Kartoffeln etc. Im
südlichen Teil bei Nagy-Enyed, in der sogen.
Siebenbürgischen Hegyalja, gedeiht vorzüglicher Wein
(Ezelnaer und Csomborder Riesling). Die Viehzucht ist bedeutend. Im
S. finden sich viele mineralische Schätze, insbesondere die
reichsten siebenbürgischen Goldgruben. Bergbau ist daher die
Haupterwerbsquelle der Einwohner. Sitz des Komitats, das von der
Ungarischen Staatsbahn durchschnitten wird, ist Nagy-Enyed.
Unterwelt, nach dem Glauben der Alten der Aufenthaltsort
der Gestorbenen, insbesondere der Ort der Strafe für
dieselben. Schon nach der indischen Mythe ist die Tiefe der
Finsternis der Strafort für die gefallenen Geister. Bei den
Ägyptern wird die U. zum Toten oder Schattenreich, in welchem
Osiris und Isis, später Serapis herrschen und Gericht halten.
Die Juden nannten die U. Scheol (s. d.). Die Griechen sollen nach
Diodor von Sizilien die Begriffe von Hades, Elysion und Tartaros
von den Ägyptern entlehnt haben. Unter Tartaros oder Orkus
verstanden sie ursprünglich die U., d. h. den dunkeln Raum,
welchen man sich unter der Erdscheibe dachte. Bald ist ihnen der
Tartaros, auf dem die Erde ruht, ein Sohn des Chaos, d. h. der
unendlichen Leere überhaupt, bald als Kerker der Titanen und
der Verdammten der tiefste Teil der U., aber noch nicht
Totenreich.
Ebenso wird das Reich des Hades (eigentlich Aïdes,
"Unsichtbaren, Unterirdischen") später zum Aufenthaltsort der
Verstorbenen, nur daß der Aufenthalt der Seligen nach andern
Vorstellungen auch an das Ende der Welt, auf die Inseln der
Seligen, wie bei Hesiod, oder auf eine elysische Flur, wie bei
Homer, verlegt wird. Nach noch späterer Vorstellung befand
sich das Totenreich in der Mitte der Erde; es war rings vom Styx
umflossen und der Eingang zu demselben nur möglich durch den
schlammigen Kokytos; Charon fuhr die von Hermes geleiteten Toten
hinüber. Am jenseitigen Ufer lag in einer Höhle der
schreckliche Kerberos. Dann kam man auf einen geräumigen
Platz, wo Minos als Richter saß und entschied, welchen Weg
die Seele wandeln solle. Der Weg teilte sich nun zum Elysion,
welches zur rechten Seite des Einganges lag, und zum Tartaros zur
Linken, als Ort der Strafe für die Verdammten.
Uuterwiesenthal, Stadt, s. Oberwiesenthal.
Untiefe, eine seichte Stelle im Meer oder
Binnengewässer, an welcher Sandbänke oder Felsriffe der
Wasseroberfläche so nahe kommen, daß die Schiffahrt
gefährdet wird; poetisch auch eine ungemessene, ungeheure
Tiefe.
Untreue, im allgemeinen s. v. v. Treubruch,
Unredlichkeit; im strafrechtlichen Sinn die absichtliche Verletzung
einer Rechtsverbindlichkeit, welche sich zugleich als Verletzung
besondern Vertrauens darstellt. In diesem Sinn straft das deutsche
Reichsstrafgesetzbuch (§ 266) die von Bevollmächtigten,
Vormündern, obrigkeitlich oder letztwillig bestellten
Verwaltern fremden Vermögens, Feldmessern, Maklern,
Güterbestätigern und andern im Dienste des
öffentlichen Vertrauens stehenden Personen verübte U. mit
Gefängnis bis zu fünf Jahren und nach Befinden mit
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. Daneben kann, wenn die
U. begangen wurde, um sich oder einem an dern einen
Vermögensvorteil zu verschaffen, auch noch auf Geldstrafe bis
zu 3000 Mk. erkannt werden. Die von einem öffentlichen Beamten
verschuldete U. wird als Amtsverbrechen (s.d.) bestraft. Vgl. v.
Stemann, Das Vergehen der Unterschlagung u. der U.(Kiel 1870).
Unvermögen (Impotenz), s. Zeugungsvermögen.
Unverritzt, ein Gebirge oder eine Lagerstätte
(unverritztes Feld), die durch Bergbau noch nicht angegriffen
ist.
Unvordenkliche Verjährung, s. Verjährung.
Unyoro, Landschaft im äquatorialen Ostafrika,
westlich und nördlich von Uganda, dem es tributpflichtig ist,
reicht an das linke Ufer des Nils und an das rechte des Mwutan
Nzige, etwa 82,590 qkm (1500 QM.) groß. Im S. ist das Land
hügelig, im N. gegen den Nil zu durchaus eben, von ungeheuern
Schilfflüssen durchschnitten und mit lichtem Wald bedeckt. Der
Anbau ist minder sorgfältig, die Verwaltung, Ordnung, Anlage
der Wege minder geregelt als in Uganda. Die Bewohner, die Wanyoro,
gehen, wie die Waganda, ganz bekleidet, treiben Ackerbau und halten
Zebus, Ziegen, Hühner, sind dabei aber kriegerisch.
Unze, s. v. w. Jaguar, s. Pantherkatzen.
Unze (lat. uncia), ursprünglich der 12. Teil des
römischen As (s. d.), in vielen Ländern sowohl eine
Gewichts- als eine Münz-, zum Teil auch eine Maß-
1037
Unzelmann - Unzuchtsverbrechen.
einheit von sehr verschiedenem Wert. Als Gewicht war die U. in
Deutschland = 2 Lot oder 1/16 Pfd. (1/8 köln. Mark), in
Italien (oncia) der 12. Teil eines Pfundes; in England hat das
Handespfund 16 Ounces, das Troypfund (für edle Metalle etc.)
aber 12 schwerere Ounces. Als Apothekergewicht ist die U.
überall der 12. Teil des Medizinalpfundes und wird durch das
Zeichen ^|Pfund| bezeichnet. Als Münze diente die U. entweder
bloß als Rechnungsmünze, oder kam auch wirklich
geprägt vor, so die Goldunze (oncetta) in Sizilien, die Onza
de oro in Spanien, Mexiko und den südamerikanischen Staaten,
wo sie 16 bisherige spanische Piaster im Wert von 65-66 Mk. galt.
Als Längenmaß war die U. in Italien s. v. w. 1 Zoll.
Unzelmann, 1) namhafte Schauspielerfamilie. Karl Wilhelm
Ferdinand, geb. 1. Juli 1753 zu Braunschweig, wirkte an
verschiedenen Theatern Deutschlands als ausgezeichneter Komiker,
seit 1788 in Berlin, wo er von 1814 bis 1823 Regisseur des Schau
und Lustspiels war, dann pensioniert 21. April 1832 starb. Seine
besten Rollen waren: der Wachtmeister in "Minna von Barnhelm",
Vansen im "Egmont", der Bürgermeister in den "Deutschen
Kleinstädtern", Martin in "Fanchon". Seine Gemahlin war die
nachmalige berühmte Bethmann (s. d. 2). Sein Sohn Karl
Wolfgang, geb. 6. Dez. 1786 zu Mainz, wurde von Goethe der
Bühne zugeführt, die er 1802 in Weimar zuerst betrat, und
übertraf bald seinen Vater an Gewandtheit und Vielseitigkeit.
Er wirkte mit größter Auszeichnung in der Posse wie im
Lustspiel und war seiner Zeit der beste Bonvivant der deutschen
Bühne. 1821 verließ U. Weimar und nahm in Dresden, 1823
in Wien, 1824 in Berlin, dann in rascher Folge bei verschiedenen
andern Bühnen Engagement. Seine ungeregelte Lebensweise
führte ihn endlich zum Selbstmord. Er ertränkte sich 21.
März 1843 im Tiergarten bei Berlin. Bertha, Nichte des
vorigen, geb. 19. Dez. 1822 zu Berlin, betrat 1842 als Luise
("Kabale und Liebe") die Bühne in Stettin, war von 1842 bis
1843 beim Königsstädter Theater in Berlin, dann in
Neustrelitz, Bremen und Leipzig angestellt und folgte 1847 einem
Ruf an das Hoftheater nach Berlin, wo sie sich mit dem
Heldenspieler Joseph Wagner aus Wien verheiratete. Beide wurden
1850 beim Burgtheater in Wien lebenslänglich angestellt. Sie
starb daselbst 7. März 1858, nachdem sie, von unheilvoller
Krankheit befallen, schon seit 1854 der Bühne fern gewesen
war. Von hoher Bildung, war sie ausgezeichnet in der Auffassung und
Darstellung weicher, gefühlvoller Charaktere u. gehörte
zu den berühmtesten Darstellerinnen des Gretchen.
2) Friedrich Ludwig, Holzschneider, Bruder von Karl Wolfgang U.,
geb. 1797 zu Berlin, machte seine Studien an der Akademie und
bildete sich unter der Leitung von Gubitz aus. Sein Bestreben, die
Holzschneidekunst aus dem Verfall zu neuer Blüte zu erheben,
fand Unterstützung durch A. Menzel, mit welchem U. um 1835 in
Verbindung trat. Unter Menzels Einfluß bildete er den
Faksimileschnitt aus und gelangte darin zu einer vollkommenen
Meisterschaft. Nach Menzel schnitt er unter anderm den Tod des
Franz von Sickingen, das Blatt zum Jubiläum der Erfindung der
Buchdruckerkunst (Gutenberg und Schöffer), einen Teil der
Illustrationen zur Geschichte Friedrichs d. Gr. von Kugler und zur
Prachtausgabe der Werke Friedrichs d. Gr. (neue Ausg., Berl. 1886)
und das Porträt Shakespeares, sein Hauptwerk (1851). Er wurde
1843 Mitglied der Berliner Kunstakademie und 1845 Professor der
Holzschneidekunst an derselben. Er starb auf einer Reise 29. Aug.
1854 in Wien.
Unzertrennliche, s. Papageien, S. 669.
Unzuchtsverbrechen (Sittlichkeitsverbrechen
Unzuchtsdelikte, Fleischesverbrechen, Delicta carnis), strafbare
Handlungen, welche in einer gesetzwidrigen Befriedigung des
Geschlechtstriebs bestehen. Das ältere Recht betrachtete den
außerehelichen Geschlechtsverkehr überhaupt als
strafbar, wenigstens insofern er mit einer sonst ehrbaren
Frauensperson gepflogen wurde, daher denn auch die freiwillig,
außereheliche Schwächung (stuprum voluntarium) nach dem
römischen Recht nicht nur an der Geschwächten, sondern
auch an dem Stuprator gestraft und im Mittelalter, nachdem die
Geistlichkeit dies Delikt vor ihr Forum gezogen hatte, an der
gefallenen Frauensperson durch die Strafe der öffentlichen
Kirchenbuße geahndet wurde. Das moderne Strafrecht erachtet
den außerehelichen Geschlechtsverkehr an und für sich
nicht mehr als strafbar. Das deutsche Reichsstrafgesetzbuch
insbesondere bestraft Weibspersonen, die gewerbsmäßig
Unzucht treiben, nur dann mit Strafe (Haft bis zu sechs Wochen),
wenn sie unter polizeiliche Aufsicht gestellt sind und den in
dieser Hinsicht zur Sicherung der Gesundheit, der öffentlichen
Ordnung und des öffentlichen Anstandes erlassenen
polizeilichen Vorschriften zuwiderhandeln, oder wenn sie
gewerbsmäßige Unzucht treiben, ohne einer solchen
Aufsicht unterstellt zu sein. Dagegen werden im deutschen
Strafgesetzbuch folgende unsittliche Handlungen als U. behandelt
und bestraft: Blutschande, d. h. der Beischlaf zwischen Verwandten
auf- und absteigender Linie, zwischen Geschwistern und zwischen
Verschwägerten auf- und absteigender Linie (s. Inzest);
Notzucht (stuprum violetum), d. h. die Nötigung einer
Frauensperson zur Duldung des außerehelichen Beischlafs durch
Gewalt oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für
Leib oder Leben (das frühere Erfordernis eines Strafantrags
bei diesem Verbrechen ist durch die Novelle zum Strafgesetzbuch vom
26. Febr. 1876 beseitigt); Schändung (stuprum non voluntarium
nec violentum), d. h. der außereheliche Beischlaf mit einer
geisteskranken oder einer in willen- oder bewußtlosem Zustand
befindlichen Frauensperson, wobei es als Notzucht bestraft wird,
wenn der Thäter die Frauensperson absichtlich in diesen
Zustand versetzt hat. Ferner gehören hierher; unzüchtige
Handlungen, welche Vormünder mit ihren Pflegebefohlenen,
Eltern mit ihren Kindern, Geistliche, Lehrer und Erzieher mit ihren
minderjährigen Schülern oder Zöglingen, Beamte mit
Personen, gegen die sie eine Untersuchung zu führen haben,
oder welche ihrer Obhut anvertraut sind, Beamte, Ärzte und
andre Medizinalpersonen, welche in Gefängnissen oder in
öffentlichen, zur Pflege von Kranken, Armen oder andern
Hilflosen bestimmten Anstalten beschäftigt oder angestellt
sind, mit den hier aufgenommenen Personen vornehmen;
unzüchtige Handlungen, welche mit Gewalt an einer
Frauensperson vorgenommen werden, oder zu deren Duldung dieselbe
durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder
Leben genötigt wird; endlich unzüchtige Handlungen mit
Personen unter 14 Jahren. In allen diesen Fällen tritt die
strafrechtliche Verfolgung von Amts wegen ein. Dagegen wird die
Verleitung einer Frauensperson zur Gestattung des Beischlafs durch
Vorspiegelung einer Trauung oder durch Erregung oder Benutzung
eines andern Irrtums, in welchem sie den Beischlaf für einen
ehelichen hielt, nur auf Antrag bestraft. Außerdem
gehören zu den U. des Reichsstrafgesetzbuchs: die
widernatürliche Unzucht, welche entweder zwischen Personen
männlichen Geschlechts (Pä-
1038
Unzurechnungsfähigkeit - Ur.
derastie), oder von Menschen mit Tieren (Sodomie) begangen wird;
die Mädchenschändung, d. h. die Verführung eines
unbescholtenen Mädchens, welches das 16. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat, zum Beischlaf (Antragsdelikt); die Verletzung der
Schamhaftigkeit durch unzüchtige Handlungen, durch welche ein
öffentliches Ärgernis gegeben wird, oder durch
unzüchtige Schriften, Abbildungen oder Darstellungen, welche
verkauft, verteilt oder sonst verbreitet oder an Orten, welche dem
Publikum zugänglich sind, ausgestellt oder angeschlagen
werden. Auch die Kuppelei (s. d.) wird von dem deutschen
Strafgesetzbuch unter den U. mit aufgeführt, ebenso die
Doppelehe oder Bigamie (s. d.) und der Ehebruch (s. d.). Vgl.
Deutsches Strafgesetzbuch, § 171-184, 361, Nr. 6;
Österreichisches, 125 ff., 500 ff.
Uuzurechnungsfähigkeit, s. Zurechnung.
Upanischad ("Vortrag"), s. Weda.
Upas, s. Pfeilgift.
Upasstrauch, s. Strychnos.
Upernavik, nördlichster Ort im dän.
Grönland, unter 72°48' nördl. Br., mit 761 Einw. im
Bezirk.
Upholland (spr. öp-), alte Stadt, 5 km westlich von
Wigan, in Lancashire (England), mit Kornmühlen,
Steinbrüchen, Kohlengruben und (1881) 4435 Einw.
Upiugtouia, Burenrepublik unter deutschem Schutz in
Südwestafrika, begrenzt im W. vom 16.° östl. L. v.
Gr., im S. vom 20.° südl. Br., Nord und Ostgrenze sind
unbestimmt. Es ist ein an starken perennierenden Quellen reiches
Land, das sich zu Ackerbau und Viehzucht eignet, von
nomadisierenden Bergdamara und Buschmännern bewohnt, deren
einzige Beschäftigung im Honigsuchen und Wurzelgraben und
Diebstählen an den Herden der Buren besteht. Die 15 Familien
starken Buren wanderten infolge von Differenzen mit der
portugiesischen Regierung aus Mossamedes Anfang 1884 aus u.
erwarben vom Häuptling des Oddongastammes, Kambondo, ein
Landstück südlich der Etosapfanne, nur reservierte
Kambondo die Bergwerksrechte. Die jetzt einzige Niederlassung der
Buren heißt Grootfontein.
Upland, Landschaft im mittlern Schweden, im O. von der
Ostsee, im S. vom Mälar begrenzt, ist im Innern fruchtbar und
reich an Getreide und Wald, auch an Eisen, während die
Küstenstriche die felsige Schärennatur mit zahlreichen
vorgelagerten Inseln und Schären darbieten. In administrativer
Hinsicht ist U. unter die Läns Stockholm, Upsala und
Westmanland verteilt.
Upolu, die zweitgrößte, aber bei weitem die
wichtigste der Samoainseln (s. d.), durch eine schmale
Meeresstraße von dem westlich gelegenen Savaii, durch eine
breitere von dem östlichern Tutuila getrennt, 881 qkm (16 QM.)
groß mit 19,000 Einw., worunter 2500 Fremde (300
Europäer und Amerikaner, der Rest als Arbeiter
eingeführte Melanesien und Polynesier). Die
außerordentlich schöne Insel wird von einer
vulkanischen, 900 m kaum übersteigenden Bergkette mit vielen
erloschenen Kratern durchzogen, welche nach S. steiler, nach N.
sanfter abfällt, die Bewässerung ist reichlich, der Boden
sehr fruchtbar, indes mit Lavablöcken übersäet,
welche die Anwendung des Pflugs oft unmöglich machen.
Korallenriffe besäumen an mehreren Stellen die Küste,
welche einige gute Häfen aufweist. Der besuchteste ist der von
Apia an der Nordküste. Die östlich davon gelegene Bai von
Saluafata mit einem Ankerplatz für kleinere Schiffe, zu dem
ein breiter Kanal durch das Küstenriff führt, wurde 1879
an Deutschland als Kohlenstation abgetreten. Die an der
Südküste gelegene flache Bucht von Falealili ist von
geringer Bedeutung, dagegen liegt Apia gerade gegenüber die
gute Bai von Safata. Von der Oberfläche gehören der
Deutschen Handels- und Plantagengesellschaft der Südsee 28,800
Hektar, den Amerikanern 3600, den Engländern 3200 Hektar.
Unter Kultur haben die Deutschen 3200, die Engländer 200
Hektar, die Amerikaner gar nichts. Der volkreichste Ort der Insel
ist Falealili an der Südküste, der wichtigste aber Apia
(s. d.) an der Nordküste, wo ein deutsches, ein englisches und
ein amerikanisches Konsulat sich befinden und die europäischen
Geschäftshäuser ihren Sitz haben. Hierher kommen die
Reichspostdampfer des Nord deutschen Lloyd, auch eine englische
Dampferlinie geht von Sydney nach Apia. S. Karte "Samoainseln".
Upsala, schwed. Län, am Bosnischen Meerbusen, von
den Läns Gefleborg, Stockholm und Westmanland begrenzt,
umfaßt den westlichen Teil von Upland (s. d.) mit einem Areal
von 531.3,8 qkm (96,5 QM.) und ist im Innern eine weite und
fruchtbare Ebene, während die Uferlandschaften die felsige
Schärennatur der schwedischen Küste haben. An
Flüssen sind außer dem Dalelf, welcher an der
nördlichen Grenze des Läns den großen
Elfkarlebyfall bildet, nur kleinere vorhanden. Die Bevölkerung
zählte 1888: 120,084 Seelen. Haupterwerbszweige sind:
Ackerbau, Viehzucht und Waldwirtschaft. Vom Areal entfallen 27,5
Proz. auf Ackerland und Gärten, 10,4 Proz. auf Wiesen, 55,3
Proz. auf Wald. 1884 zählte man 20,325 Pferde, 87,182
Stück Rindvieh, 32,209 Schafe und 12,021 Schweine. Auch der
Bergbau (besonders auf Eisen) und der Hüttenbetrieb sind
ansehnlich. - Die gleichnamige Hauptstadt, in einer fruchtbaren
Ebene an der Fyriså, die in den Mälarsee mündet,
Knotenpunkt der Eisenbahnen Stockholm-Sala, U.-Gefle und U.-Lenna,
hat ein Schloß und 2 Kirchen (darunter die 1289-1435 erbaute
Domkirche mit den Grabmälern mehrerer Könige, Linnes
u.a., die größte und schönste Kirche Schwedens,
leider aber nach dem Brand 1702 nur unvollkommen hergestellt), eine
1477 gestiftete Universität mit der größten
Bibliothek Schwedens (über 250,000 Bände und 7000
Manuskripte) und andern wissenschaftlichen Sammlungen, botanischem
Garten (berühmt durch Linne), Sternwarte etc. (1886 mit 1877
Studierenden); zwischen dem Dom und dem neuen
Universitätsgebäude befindet sich ein schöner Park,
Odinslund. Die Einwohnerzahl. beträgt (1888) 21,249. Die
Industrie ist nicht unbedeutend; außer einigen chemischen
Fabriken gibt es mehrere Mühlen, Brauereien, Ziegeleien etc.
U. ist Sitz eines Erzbischofs, eines Konsistoriums und des
Landeshauptmanns. Die ziemlich einförmige Umgegend, Fyrisvall
genannt, ist der klassische Boden der ältesten Geschichte
Schwedens. Hier verlor 983 Styrbjörn der Starke Schlacht und
Leben; hier liegt 4km entfernt an der Bahn U.-Gefle das alte
(Gamla) U., jetzt ein Bauerndorf, in dessen Nähe die drei
großen Königshügel und viele kleinere
Grabhügel sich befinden; 7. km von U. entfernt die Morawiese
(s. d.). Das Gut Hammarby der ehemalige Wohnsitz Linnés.
Upstallsboom, s. Aurich.
Upupa, Wiedehopf; Upupidae (Hopfe), Familie aus der
Ordnung der Klettervögel (s. d.).
Ur..., Vorsilbe zur Bezeichnung der Beziehung auf den
ersten Anfang von etwas, z. B. Urahn, Ursprung, Urkunde etc.
(altdeutsch s. v. w. hervor, aus).
Ur, s. v. w. Auerochs.
Ur, eine der ältesten Städte Chaldäas,
südlich vom untern Euphrat, Orchoe (jetzt Warka)
gegenüber, bekannt als Wohnort von Abraham und Sara, ehe
sie
1039
Uraba - Ural.
nach Haran und Kanaan zogen. Hier gefundene Inschriften zeigen
die ältesten hieroglyphenartigen Formen der Keilschrift.
Urabá (Golf von U., früher auch Darien del
Norte genannt, im Gegensatz zum Golfo del Darien del Sur, dem
jetzigen Golf San Miguel), ein Meerbusen des Karibischen Meers, an
der Nordküste von
Kolumbien, dringt 60 km weit ins Land ein, ist 52 km breit und
von flachen Ufern begrenzt. In ihn mündet in 15 Armen der Rio
Atrato (s. d.), dessen fortschreitende Deltabildung den hintern
Teil des Golfs vom Meer abzuschneiden droht. Entdeckt wurde der
Golf von U. 1502 von Rodrigo Bastidas.
Urach, Oberamtsstadt und Luftkurort im württemberg.
Schwarzwaldkreis, am Einfluß der Elsach in die Erms und an
der Ermsthalbahn, 466 m ü. M., hat eine schöne
evangelische (1479-99) und eine kath. Kirche, ein Schloß,
eine Lateinschule, ein niederes evangelisch-theologisches Seminar,
ein Amtsgericht, ein Forstamt, Flachs- und Baumwollspinnerei,
Baumwollweberei, Gerberei, Holzdreherei, Wagenfabrikation, eine
mechanische Werkstätte und (1885) 3962 Einw. In der Nähe
ein Wasserfall im Brühl, die Ruinen der Feste Hohenurach und
der königliche Fohlenhof Güterstein. - U. war einst Sitz
eines Grafengeschlechts, als dessen Begründer Egino I. im
Anfang des 12. Jahrh. erscheint. Egino IV. erwarb 1218 bei dem
Aussterben der Zähringer Freiburg i. Br. und viele Besitzungen
im Schwarzwald. Einer seiner Enkel, Konrad, erhielt im 13. Jahrh.
Freiburg; ein andrer, Heinrich, Graf von Fürstenberg, der
Stammvater der gleichnamigen Fürsten, verkaufte 1265 die Burg
U. und den größten Teil der Besitzungen an den Grafen
Ulrich von Württemberg. Von U. führte eine Linie des
Hauses Württemberg, die 1441 gestiftet wurde, aber mit dem
Sohn des Stifters, Eberhard V. (I.), mit dem Bart, 1495 wieder
ausstarb, den Namen Württemberg-U. Jetzt führt den Titel
eines Herzogs von U. der Graf Wilhelm von Württemberg (geb. 3.
März 1864) aus einer katholischen Seitenlinie des
Königshauses. Vgl. "Führer durch das Uracher Gebiet"
(Urach 1876).
Urachus (Harnstrang),beim Embryo derSäugetiere der
in der Bauchhöhle verbleibende Abschnitt des
Stiels der Allantois (s. d.), aus dessen hinterm Teil
später die Harnblase hervorgeht, während der vordere zum
sog. mittlern Aufhängeband der Harnblase wird.
Uraeginthus, s. Astrilds.
Ural (Jaik), Grenzfluß zwischen Europa und Asien,
entspringt unter 54° 30' nordl. Br. und nimmt in seinem von N.
nach S. gerichteten Lauf zwischen den beiden östlichen Ketten
des Uralgebirges von O. her die unbedeutenden Nebenflüsse
Gambei, Sarum-Saklü, Swunduk, von W. her den Ak-Dschar,
Kutebai, Allas-Nessai und Kutan-Taß auf. Am südlichen
Ende der Hauptmasse des Uralgebirges sich nach W. wendend,
empfängt er in seiner Kniebeugung den Orr, weiterhin den Ilek
und die Utwa von S. her und auf europäischem Boden von N. her
die Sakmara. In seinem untern, wieder von N. nach S. gerichteten
Lauf hat er keinen bedeutendern Zufluß. Er mündet, ein
sumpfiges Delta bildend, in mehreren Armen in das Kaspische Meer
und hat im ganzen eine Länge von etwa 1500 km. Sein
Stromgebiet wird auf 249,500 qkm (4531 QM.) berechnet. An der
Mündung liegt neben unermeßlichen Schilfwaldungen die
Stadt Gurjew (s. d.). In der Steppe auf dem rechten Ufer des Urals
bis an das Kaspische Meer wohnen die Uralischen Kosaken, deren
Gebiet gegenwärtig unter der Oberverwaltung des Landes der
Kirgiskosaken steht und unter dem Namen Uralsk eins der fünf
Gebiete jenes bis zum Irtisch und zum Aralsee reichenden Landes
ist; das linke Ufer bewohnen die Kirgisen. Nach Dämpfung des
Pugatschewschen Aufstandes, der auch am Jaik wild tobte, befahl
Katharina II., um die beim Namen Jaik auftauchenden Erinnerungen zu
bannen, den Fluß künftig "U." zu nennen.
Ural (die Montes Riphaei der Alten), das längste
Meridiangebirge der Alten Welt, dessen südlichster niedriger
Ausläufer, der Mugodschar, zwischen der Salzsteppe an der Emba
und der Kirgisensteppe, fast bis zum Aralsee (48° nördl.
Br.) reicht, während der nördlichste jenseit der
Waigatschstraße über die Waigatschinsel durch Nowaja
Semlja fortsetzt und unter 76 1/2° nördl. Br. endet (s.
Karte "Rußland"). So sind die beiden Endpunkte um mehr als 28
Breitengrade, also um 3168 km, voneinander entfernt. Die Breite des
Gebirges beträgt meist nicht über 75 km und
übersteigt kaum 190 (so im äußersten Süden);
auch seine Kammhöhe beträgt kaum 600 m und erreicht nur
im SW. und N. 1.200 m, eine Höhe, die nur einzelne Gipfel
überragen. Vorzüglich in der Mitte schwillt es so
allmählich an, daß man auf der großen Straße
von Perm nach Jekaterinenburg kaum den Übergang über ein
Gebirge merkt, das Europa und Asien scheidet. Während
nördlich von Jekaterinenburg die höchsten Punkte der
Ostseite angehören, liegen sie südlich im
äußersten Westen. Der östliche Abfall des Gebirges
ist etwas schroffer als der westliche, welcher sich
terrassenförmig gegen die Kama und Wolga abstuft. Man kann den
U. in den arktischen der nördlichen Inseln, den
nördlichen samojedischen oder wogulischen, den mittlern oder
werchoturischen und den südlichen oder baschkirischen U.
einteilen. Im arktischen U. erheben sich auf Nowaja Semlja einzelne
Gipfel (mit Gletschern) über 1200 m. Der nördliche U.,
welcher vom Karischen Meer bis zum 61.° nördl. Br. oder
bis zu den Quellen der Petschora reicht, ist wald- und erzloses
Gebirge. Vom Karischen Golf südlich bis zum 63.° reicht
der sogen. wogulische U., ein Gebirge mit schroffen, felsenreichen
Höhenzügen und trümmerbedeckten Gipfeln, von denen
der Paijar 1413 m, südlicher der Koibp 1041 m, Pure-Mongit
1100 m, Galsory 990 m, Ischerim 983 m hoch sind, aber ohne die
Gletscher des arktischen; drei Pässe über ihn
ermöglichen den Verkehr zwischen Archangel und Sibirien.
Dagegen zeigt der sogen. samojedische U. (Pae-Choiberge), der
nord-westlich zur Waigatschstraße zieht, gerundete Formen,
mit Moos- und Flechtenbedeckung seiner Höhen, von denen die
bedeutendsten Idshed-Karlem (1390 m, Choste-Nier (1510 m) und
Töll-Pos (1687 m) sind. Nordöstlich zweigen sich vom
nördlichen U. die zur Obmündung verlaufenden niedrigern
Berge von Obdorsk ab. Die höchsten Gipfel dieses kahlen und
unwirtlichen Gebirges tragen ewigen Schnee. An der Petschoraquelle
zweigt sich vom U. unter dem Namen Timangebirge ein niedriger
Höhenzug ab, welcher bis Kanin-Nos zieht. Der mittlere oder
werchoturische U., der sich von 61°nördl. Br. bis an die
Quellen der Ufa (55°) fortsetzt, bildet ein breites
waldigsumpfiges Tafelland von mäßiger Erhebung (im
Mittel 650 m), das von einzelnen Felsbergen überragt wird, und
ist der einförmigste Teil des Gebirges; nur im NO. zeigt sich
eine alpinere Natur. Hier erheben sich als die höchsten
Gipfel: der Kontschakow-Kamen (1462 m), Suchegorski-Kamen (1195 m),
Pawdinski-Kamen (938 m), Katschkanar (887 m) und Deneschkin-Kamen
(1532 m). Über den mittlern U
1040
Ural (Gebirge).
führen die leichtesten Übergänge, deren
niedrigstem (380 m) die oben erwähnte sibirische Straße
und neuerdings die Eisenbahn von Perm nach Jekaterinenburg folgt.
Südlich von der Ufaquelle folgt der dreigeteilte südliche
U., im O. mit dem niedrigen, aus Granit und Gneis zusammengesetzten
Ilmengebirge bei Mijask, in der Mitte mit dem Uraltau im engern
Sinn (auch Urengai genannt), der mit der Irendikkette im S. endet,
in seinen höchsten Höhen (Jurma, Taganai, Urenga) 1200 m
wenig überschreitet und nur im Iremel 1536 m Höhe
erreicht. Der U. gibt zahlreichen Flüssen ihren Ursprung; dazu
finden sich an der Ost- und Westseite zahlreiche kleine und
größere Landseen, am dichtesten am Ilmengebirge und zur
Seite des mittlern Urals. Dort, wo mittlerer und südlicher U.
zusammenstoßen, drängen sich vor allem die Quellen
zahlreicher Flüsse zusammen, die dem Tobol, Ural und der Kama
zuströmen. Nur im äußersten Süden versiegen im
Sommer die Bäche und kleinen Flüsse meist ganz.
Der U. besteht seiner geognostischen Zusammensetzung nach aus
einer Achse kristallinischer Schiefergesteine, aus Gneis,
Glimmerschiefer, im mittlern Teil vornehmlich aus Chlorit- und
Talkschiefern, auch kristallinischen Kalken, im N. mit Kalk und
Kalkschiefer. Zu ihnen gesellen sich an den Seiten silurisches und
devonisches Übergangsgebirge, am westlichen Fuß
Kohlenkalkstein, auf beiden Seiten Kohlengebirge. Um die ganze
Südwestseite schlingt sich die permische Formation mit ihrem
Rotliegenden, mit Süßwasserkalk, mächtigem Gips,
Kupfersandstein und echtem Zechstein. Dem Jura gehört nur der
nördliche Fuß an. Von massigen Gesteinen treten auf
Granit, Syenit, Diorit, Serpentin, Augit-, zum Teil Uralitporphyre
und Mandelsteine, die bis Nowaja Semlja reichen. Jüngere
Eruptivgesteine fehlen gänzlich. Wohl kommen Erze auf
Gängen vor, so die Golderze von Beresow, ebenda
Bleiglanzgänge mit dem Rotbleierz; wichtiger sind aber die
sekundären Lagerstätten im Übergangsgebirge, im
Kupfersandstein und besonders im Schuttland. Dem silurischen
Gebirge gehören die reichen Magneteisensteinberge an, ebenso
die wichtigen Kupferlagerstätten. So liegen bei Nishne-Tagilsk
die Kupfergruben, welche die mächtigen Malachitstöcke
liefern, ebenso der mächtige Magneteisensteinberg Wisokaya
Gora; andre sind der Blagodat bei Kuschwinsk und der Katschkanor,
westlich von Werchoturie. Aus der Zerstörung
goldführender Quarzgänge, insbesondere im Talkschiefer,
und von platinführenden Serpentinen stammen die gold- und
platinführenden Seifengebirge, aus denen diese Metalle
ausgewaschen werden. Das Gold ist stets von Magnet-, das Platin von
Chromeisenstein aus dem zerstörten Muttergestein begleitet.
Die Fläche, auf welcher Goldseifen vorkommen, berechnet man
auf 40,500 qkm (735 QM.). Während die goldreichen Seifenwerke
auf der asiatischen Seite liegen, finden sich die Platinseifen mehr
auf der europäischen. 1884 wurden auf einer Fläche von
4591 qkm mit 42,690 Arbeitern aus goldhaltigem Sand 7960 kg Rohgold
und im Laboratorium zu Jekaterinenburg 7093 kg Gold, 900 kg Platina
und 560 kg Silber gewonnen; außerdem wurden 1167 kg Quarzgold
und in zwölf Bergwerken 1339 kg Platina ausgegraben. An
Kupfer, welches vorzugsweise gediegen, als Rotkupfererz und
Malachit (z.B. bei Nishne-Tagilsk), und in kalkigen Kiesen (bei
Bogoslowsk) etc. vorkommt, liefert der U. in acht Bergwerken mit
5309 Arbeitern 3600 Ton. Silber und Blei sind von geringerer
Wichtigkeit, von um so größerer die Eisenerze,
vorzüglich der bis in den südlichen U. verbreitete
Magneteisenstein. Von dem Gesamtertrag aller Eisenhütten in
ganz Rußland kommen auf das Gouvernement Perm allein 8/13 und
auf die Demidowschen und Jakowlewschen Hütten 1/4. 1884 wurden
in 59 Hüttenwerken 343,000 T. Roheisen, und in 7
Bessemerwerken 31,000 T. Stahl produziert; in der Eisenindustrie
waren 133,493 Arbeiter thätig. Der größte Teil des
Eisens kommt auf der Messe zu Nishnij Nowgorod in den Handel. An
Manganerzen wurden 14,463 Doppelzentner gewonnen. Seit einigen
Iahren wird am Westabhang auch Bergbau auf Steinkohlen betrieben
(ca. 21,000 T.). Außerdem liefert der U. mannigfache
schöne Gesteine und interessante Mineralien, welche zum Teil
auch am U. für architektonische Zwecke und als Schmucksteine
geschliffen werden, z. B. Porphyr, Jaspis, Kieselmangan, Achat,
Bergkristall, Malachit u. a. Vor allem reich ist das kleine
Ilmengebirge bei Mijask an Mineralien (Eläolith,
Amazonenstein, großblätteriger sibirischer Glimmer,
Pyrochlor, Äschynit, Titanit, Zirkon, prachtvolle Topase,
Korund u. a.), ferner die Gegend von Slatoust im südlichen und
die von Mursinsk im mittlern U. (mit mächtigen Topas-, Beryll-
und Rauchtopaskristallen). In den Seifen von Bissersk hat man vor
Jahrzehnten auch kleine Diamanten gefunden.
Während im arktischen U. die Kälte, im
äußersten Süden die Trockenheit den Baumwuchs
verhindern und im nördlichen U. nur in den Thälern die
sibirische Lärche vorkommt, sind doch zwei Drittel des Urals
mit dichtem Urwald, wo die Hüttenwerke ihn nicht aufgezehrt
haben, bedeckt. Im N. unterbricht nur die Birke den Ernst der
vorherrschenden Nadelwälder, während im südlichen
U., dem lieblichsten Teil des Gebirges, alle Berghöhen mit
gemischtem Laubwald (Kiefern, Linden, Birken, auch Eichen) bedeckt
sind. Hier weidet der Baschkire seine Herden in den wasserreichen
Thalgründen, während im höchsten Norden der Samojede
mit seinen Renntierherden umherzieht. Der Wald ist reich an
jagdbaren Tieren, darunter auch Pelztieren (Eichhörnchen,
Füchse, Wölfe), an Wald- und Schneehühnern,
Schnepfen und Wachteln, aber auch an Bären, die den vielen
Beeren (Himbeeren, Vaccinien) nachgehen. Pflanzen- und Tierwelt
schließen sich, den tiefen Süden ausgenommen, zu beiden
Seiten des Gebirges ganz an die europäischen an. In der Mitte
und im SO. liegen zahlreiche wohlhabende Städte mit
vorherrschend russischer Bevölkerung, die sich hier in der
Nähe der aufblühenden zahlreichen Berg- und
Hüttenwerke (Sawody) angesiedelt hat. Jekaterinenburg im
mittlern, Mijask und Slatoust, das uralische Birmingham, im
südlichen U. sind die Mittelpunkte großartiger
Thätigkeit. Die erste Eisenbahn über den U. ist 3.
März 1878 von Perm nach Iekaterinenburg eröffnet worden.
Vgl. Hofmann und Helmersen, Geognostische Untersuchung des
Süduralgebirges (Berl. 1831); Humboldt, Fragments de
géologie et de climatologie asiatique (deutsch, das. 1832);
Rose, Mineralogisch-geognostische Reise nach dem U. (das. 1837-42,
2 Bde.); Murchison, Geology of Russia in Europe and the U.
mountains (Lond. 1846; deutsch von Leonhard, Stuttg. 1847-48);
Schrenk, Orographisch-geognostische Übersicht des Uralgebirges
im hohen Norden (Dorp. 1849); Kowalki u. E. Hofmann, Der
nördliche U. (Petersb. 1853, 2 Bde.); Ludwig, Überblick
der geologischen Beobachtungen im U. (Leipz. 1862); Derselbe,
Geognostische Studien (Darmst. 1862); Hochstetter, über den U.
(Berl. 1873); Hiekisch, Das System des Urals (Dorp. 1882).
1041
Uralaltaische Sprachen - Uralit.
Uralaltaische Sprachen, weitverzweigte Sprachenfamilie,
die auch als turanische oder finnisch-tatarische oder skythische
oder altaische bezeichnet wird und sich von Ungarn und Finnland bis
Nordostasien erstreckt. Sie wird gewöhnlich in fünf
Hauptgruppen zerlegt:
1) Die finnisch-ugrische Gruppe, in Rußland und Ungarn,
umfaßt das Finnische oder Suomi, das in Finnland von etwa 2
Mill. Menschen gesprochen wird, die altertümlichste Sprache
dieser Gruppe, nebst dem Esthnischen in Esthland, dem im Aussterben
begriffenen Livischen in Livland und einigen minder wichtigen
Dialekten; das Lappische, in Lappland; dann östlich und
südöstlich von den vorigen die immer mehr verschwindenden
Nationalsprachen verschiedener kleinerer Stämme, der
Tscheremissen zwischen Kasan und Nishnij Nowgorod, der Mordwinen an
der mittlern Wolga, bis zum südlichen Ural hin, der
Syrjänen, Wotjaken und Permier, nordöstlich von den
vorigen, endlich die Sprachen der Ostjaken und Wogulen, am Ob
über weite, aber sehr dünn bevölkerte Strecken sich
ausdehnend, nahe verwandt mit der wichtigsten Sprache dieser
Gruppe, dem Magyarischen der Ungarn. Das Magyarische, durch eine
verhältnismäßig alte und bedeutende Litteratur
ausgezeichnet, umfaßt ein größeres Gebiet im W.
von Ungarn, von Preßburg an, wo das deutsche Sprachgebiet
beginnt, und ein kleineres, von dem vorigen getrenntes im SO., wo
es ringsum von Rumänen umgeben ist.
2) Die samojedische Gruppe, nördlich von der vorigen, am
Eismeer hin weit nach Sibirien hinein reichend, zerfällt in
vier Dialekte, die aber zusammen nur von ungefähr 20,000
Individuen gesprochen werden.
3) Die türkisch-tatarische Gruppe, die verbreitetste von
allen, reicht von der europäischen Türkei mit geringen
Unterbrechungen bis zur Lena und begreift folgende Sprachen in
sich: Jakutisch, die Sprache der Jakuten, an der Lena im
nordöstlichen Sibirien, welche ringsum von Tungusen (s. unten)
umgeben sind; Kirgisisch, in dem an China angrenzenden Teil von
Turkistan; Uigurisch, mit einem besondern, aus den syrischen
Buchstaben zurechtgemachten Alphabet, nebst Turkmenisch,
Tschagataisch und Uzbekisch, im übrigen Turkistan;
Kumükisch, im nordöstlichen Kaukasus, und Nogaisch,
nördlich vom Schwarzen Meer und in der Krim; Osmanli oder
Türkisch, die wichtigste Sprache dieser Gruppe, in
Konstantinopel, Philippopel und einigen andern Enklaven in der
europäischen Türkei sowie im Innern von Kleinasien
herrschend; verwandt damit ist das isolierte Tschuwaschisch, das
von dem Tscheremissischen und Mordwinischen umschlossen wird.
4) Die mongolische Gruppe zerfällt in das eigentliche
Mongolisch im nördlichen China, das Burätische am
Baikalsee und das Kalmückische westlich davon, mit
Ausläufern, die bis nach Südrußland reichen.
5) Die tungusische Gruppe, in Nordostasien, reicht vom Jenissei
bis an das Ochotskische Meer, im NO. bis an das Eismeer, im S. bis
weit nach China hinein. Die wichtigste der dazu gehörigen
Sprachen ist das Mandschu, in der chinesischen Mandschurei, mit
einer mehrere Jahrhunderte alten Litteratur und einem besondern
Alphabet. Von einigen wird auch die Sprache der ältesten
Gattung der Keilschrift, das Akkadische oder Sumerische, zu dem
uralaltaischen Sprachstamm gezählt; doch ist die
Verwandtschaft, wenn sie besteht, jedenfalls nur eine sehr
entfernte. Ebenso zweifelhaft ist die von Ewald, Schott, Hofmann u.
a. angenommene Verwandtschaft des Japanischen mit den
uralaltaischen Sprachen. Auch die fünf oben genannten Gruppen
stehen keineswegs in nahen Beziehungen zu einander und haben keine
oder wenige Wörter und Wurzeln, vielmehr nur den grammatischen
Bau miteinander gemein. Sie gehören nämlich alle der
sogen. agglutinierenden Stufe des Sprachbaues (s.
Sprachwissenschaft, S. 181) an, und zwar ist die Art der
Agglutination bei ihnen eine ganz besondere, indem sie Wurzel und
Flexionsendungen dadurch in eine feste Wechselbeziehung zu einander
setzen, daß in den Endungen immer dieselbe Art von Vokalen
erscheinen muß wie in der Wurzel. So heißt im
Türkischen "von unsern Vätern" babalarumdan; aber der
entsprechende Kasus von dedeh, "Großvater", lautet
dede-lerinden, weil auf die "leichten" Vokale e der Wurzel auch in
der Endung nur leichte Vokale folgen dürfen. In
sämtlichen uralaltaischen Sprachen sind so die Vokale in
leichte und schwere eingeteilt; doch gibt es daneben in vielen
Sprachen auch neutrale Vokale. Andre allen fünf Gruppen
gemeinsame Eigentümlichkeiten sind: die
Aufeinanderhäufung einer fast unbegrenzten Anzahl von Endungen
an die Wurzel, welche stets unverändert bleibt, die
Anhängung des besitzanzeigenden Fürwortes an das
Hauptwort und die Scheidung der Konjugation in eine bestimmte und
unbestimmte. Die Sprachen jeder Gruppe sind meistens unter sich
sehr nahe verwandt; namentlich ist es wichtig, zu bemerken,
daß z. B. das Türkische sich vom Nogaischen in
Südrußland nicht stärker unterscheidet als das
Hochdeutsche vom Niederdeutschen und selbst von dem weit entfernten
und isolierten Jakutischen an der Lena nicht mehr absteht als das
Deutsche vom Skandinavischen. Stärker gehen die Sprachen der
finnisch-ugrischen Gruppe auseinander und lassen sich insofern etwa
den einzelnen Sprachenfamilien des indogermanischen Sprachstammes
vergleichen. Über ihre Gruppierung gehen die Ansichten
auseinander; die obige Aufzählung gründet sich auf die
neuesten Untersuchungen von Budenz (s. d.), der sieben
Unterabteilungen der finnisch-ugrischen Gruppe annimmt,
während andre sie in vier Hauptzweige einteilen, den
finnischen, permischen, ugrischen und wolga-bulgarischen Zweig. Die
erste vollständige Nachweisung des Zusammenhanges der
uralaltaischen Sprachen, welche eine der wichtigsten Entdeckungen
der modernen Sprachwissenschaft ist, findet sich in den zahlreichen
grammatischen Arbeiten des finnischen Sprachforschers Castren (s.
d.). Vgl. auch Böhtlingk, Über die Sprache der Jakuten
(Petersburg 1851); Boller, Die finnischen Sprachen (Berichte der
Wiener Akademie 1853 -57); Ahlquist, Forschungen auf dem Gebiet der
uralaltaischen Sprachen (Petersb. 1861); Vambéry,
Tschagataische Sprachstudien (Leipz. 1867); Schott, Altaische
Studien (Berl. 1860-72, 5 Hefte); Weske, Untersuchungen zur
vergleichenden Grammatik des finnischen Sprachstammes (Leipz.
1873); Budenz, Über ugrische Sprachvergleichung (Verhandlungen
der Innsbrucker Philologenversammlung 1874); Derselbe, Über
die Verzweigung der ugrischen Sprachen (in den "Beiträgen zur
Kunde der indogermanischen Sprachen", 4. Bd., Götting.1878);
Donner, Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen
Sprachen (Helsingfors 1874-76, 2 Tle.); Prinz L. Bonaparte,
Remarques sur la classification des langues ouraliques (in der
"Revue de Philologie", Par. 1876); Winkler, Uralaltaische
Völker und Sprachen (Berl. 1884); Derselbe, Das Uralaltaische
und seine Gruppen (das. 1885).
Uralit, s. Hornblende.
Meyers Konv.- Lexikon, 4. Aufl , XV. Bd. 66
1042
Verzeichnis der Illustrationen im XV. Band.
Seite
Sonne, Tafel 28
Spanien und Portugal, Karte 63
Spektralanalyse, Tafel 117
Sperlingsvögel, Tafel I u. II 126
Spinnmaschinen, Tafel 148
Spinnentiere, Tafel 153
Spinnfaserpflanzen, Tafel 155
Spiritusfabrikation, Tafel 163
Sprachenkarte, mit Textblatt 181
Steiermark, Karte 256
Steinkohlenformation, Tafel I u. II 272
Steinkohlenformation, Tafel III: Profil des Zwickauer
Kohlenfeldes 272
Steinzeit, Kultur der, Tafel 280
Stenographie, Schrifttafel 290
Sternwarte, Tafel, mit Textblatt 306
Stettin, Stadtplan 307
Stockholm, Stadtplan, mit Karte der Umgebung 339
Straßburg, Stadtplan 371
Straußvögel, Tafel 383
Stubenvögel, ausländische, Tafel 401
Stuttgart, Stadtplan 408
Takelung, Tafel 495
Tanne, Tafel 510
Tauben, Tafel 536
Telegraph, Tafel I u. II 564
Terrakotten, antike, Tafel 598
Tertiärformation, Doppeltafel 601
Theaterbau, Tafel, mit illustriertem Textblatt 624
Thonwarenfabrikation, Tafel 663
Thüringer Wald, geologische Karte 683
Tintenschnecken, Tafel 716
Tirol, Karte 721
Tongting, Karte 751
Torfgewinnung, Tafel 760
Torpedos, Tafel 764
Triasformation, Doppeltafel 827
Türkisches Reich, Übersichtskarte 917
Türkisches Reich, Karte der Balkanhalbinsel 917
Türkisches Reich, Geschichtskarte 925
Uhren, elektrische, Tafel 976
Ungarn: Länder der ungarischen Krone, Karte 999
Abbildungen im Text.
Seite
Soest, Stadtwappen 2
Solferino, Kärtchen zur Schlacht bei 10
Sondershausen, Stadtwappen 26
Sonnenfinsternis, 4 Figuren 32
Sonnenmikroskop 35
Sonnenscheibe, geflügelte (ägyptisches Qrnament)
35
Sonnenuhr 36
Spandau, Stadtwappen 62
Spandrille 62
Spechter (Trinkglas) 112
Speier, Stadtwappen 115
Spektralanalyse, Fig. 1-6 118-119
Spektrometer 121
Sperrgetriebe, Fig. 1 u. 128
Spezia, Situationskärtchen 129
Spezifisches Gewicht (Apparate), Fig. 1-5 130-132
Spezifische Wärme: Kalorimeter, Fig. 1-3 132-133
Sphinx (im Berliner Museum) 135
Spiegel, antike, Fig. 1-4 136-137
Spiegelung, Fig. 1-9 139-141
Spinnen (Werkzeuge), 6 Figuren 147-149
Spinnerin, griechische (Vasenbild) 152
Spinnentiere (Pentastomum taenioides und denticulatum), 2
Figuren 154
Spiralpumpe 159
Spiritus: Apparate, Fig. 1-4 164-167
Spitzzahnornament 172
Sponton (Waffe) 175
Sprache: Mundstellung bei Vokalen, Fig. 1-3 177
Spremberg, Stadtwappen 186
Sprengen: Zündelektrisiermaschine, Fig. 1 u. 2 187
Sprengwerk (Bauwesen), Fig. 1-6 189
Stab (Baukunst) 207
Stade, Stadtwappen 210
Standfähigkeit 225
Stargard i. P., Stadtwappen 234
Stärke: Formen von Stärkemehlkörnern, Fig. 1 u. 2
236
Staubgefäße der Pflanzen, Fig. 1-8 246-247
Stechheber 252
Steinbrechmaschine 263
Steinverband (Bauwesen), Fig. 1-10 279
Stele (Grabstein) 283
Stelzenschuhe, 2 Figuren 284
Stendal, Stadtwappen 286
Stengel verschiedener Pflanzen etc., Fig 1-6 287-288
Stereometer 298
Stereoskop, Fig. 1 u. 2 299
Stettin, Stadtwappen 307
Stickmaschine, Fig. 1-3 317-318
Stockholm, Stadtwappen 339
Stolp, Stadtwappen 347
Stopfbüchse 349
Storchschnabel (Zeicheninstrument) 351
Strahlapparate, Fig. 1-5 366-367
Stralsund, Stadtwappen 368
Straßburg, Stadtwappen 372
Straßeneisenbahnen: Schienen, Fig. 1 u. 2 376
Streitäxte, Fig. 1 u. 2 385
Streithammer, Luzerner 386
Streitwagen, griechischer 386
Strickmaschine: Nadelbewegung, Fig. 1-6
Stromwender von Pohl u. Rühmkorff, Fig. 1 u. 2 393
Stuttgart, Stadtwappen 408
Stuttgart, Karte der Umgebung von 409
Südliches Kreuz (Sternbild) 422
Sydney, Situationskärtchen 454
Tahiti und Eimeo, Spezialkarte 493
Taktierbewegungen, 7 Figuren 497
Tangentenbussole 508
Tantalos (Vasenbild in München) 513
Telegraph: Stromleitungen, Fig. 1 u. 2 567
Tellereisen (Fangeisen), Fig. 1-3 577
Tempel, 6 Grundrisse 581
Tertiärformation: Nummulitenkalk 602
Testudo (Schilddach, Relief in Rom) 609
Theater, Grundriß eines griechischen 623
Thermoelektrizität: Elemente, Fig. 1-4 643
Thermometer, Fig. 1-8 644-646
Thonwaren: Töpferscheibe 663
Thorn, Stadtwappen 669
Thoth (ägyptischer Gott) 672
Thron (Zeus auf dem Thronos, Münze) 676
Thürklopfer 684
Thyrsos (Stab) 686
Tiara (Papstkrone) 687
Tiefenmessung: Bathometer, Fig. 1-3 695-696
Tilsit, Stadtwappen 711
Toga (Nationalkleid der Römer) 738
Tokio, Situationskärtchen 740
Torf, Fig. 1 u. 2 760 u.762
Torgau, Stadtwappen 763
Toulon, Situationskärtchen 781
Tourniquet (chirurgisches Instrument) 785
Tracheen der Eintagsfliege und der Wasserjungfer (Agrion), Fig.
1 u. 2 789
Träger (Bauwesen), Fig. 1-15 792
1043
Korrespondenzblatt zum fünfzehnten Band.
Trapez und Trapezoid 802
Trapezkapitäl 802
Treppe: Grundrisse, Fig. 1-8 820
Triangulation, Fig. l-6 824-827
Triasformation: Krinoidenkalk 828
Trier, Stadtwappen 837
Triest, Stadtwappen 839
Triest, Kärtchen der Umgebung von 839
Triforium (Baukunst) 842
Triglyph (Baukunst) 842
Trigonometrie, Fig. 1-3 842-843
Triklinium 843
Trinkhörner, griechische, Fig. 1 u. 2 848
Triquetrum (parallaktisches Lineal) 852
Triremen, Fig. 1 u. 2 852
Trisetum pratense (kleiner Wiesenhafer) 852
Triton (Statuen in Rom und Neapel), Fig. 1 u. 2 853
Troja, Kärtchen der Ebene von T. 859
Troja, Plan von Schliemanns Ausgrabungen 859
Trokar (chirurgisches Instrument), 5 Figuren 861
Trompe (Baukunst) 863
Trophäe (Tropäon, Münze) 865
Troppau, Stadtwappen 866
Tuba, antike (Kriegstrompete) 894
Tübingen, Stadtwappen 895
Tudorblatt (Baukunst) 898
Tum (ägyptischer Gott) 901
Tummler (Trinkgefäß) 901
Tunis, Kärtchen der Umgebung von 904
Tunnel, 3 Pläne (Unterwassertunnels) 907
Turbane, 3 Figuren 909
Turin, Stadtwappen 912
Tuttlingen, Stadtwappen 950
Tyche von Antiochia (Statue im Vatikan) 953
Tympanon (Pauke) 954
Typhon-Seth (ägyptische Mythologie) 955
Überschnittene Bauglieder 965
Uhr, Fig. 1-3 974
Ulm, Stadtwappen 983
Umbelliseren 988
Korrespondenzblatt zum fünfzehnten Band.
Ausgegeben am 24. Oktober 1889.
H. Hengsten in Wien. Sie finden die vermißte Biographie
im Supplementband des Konversations-Lexikons, der auch das
Register enthalten und die wichtigsten Artikel des Hauptwerks bis
zur Gegenwart fortführen wird.
H. Hoffmann in W. Die Frage, ob der inländische
Besitzer ausländischer Staatspapiere sich der Kouponsteuer des
fremden Staats zu unterwerfen habe, wird von mehreren
Nationalökonomen, so von A. Wagner, Roscher, Vocke u. a.,
bejaht. Die genannten Schriftsteller begründen ihre Ansicht
damit, daß der Inländer, welcher sein Vermögen in
russischen, englischen oder italienischen Staatspapieren
fruchtbringend anlegt, auch seinerseits zur Befriedigung der
Bedürfnisse des Staats, dessen Existenz und Einrichtung er
seinen Zinsertrag verdankt, beitragen müsse. Auch die
Handelswelt rechnete bisher mit der Kouponsteuer als einem
gegebenen Faktor. Der Bankier, welchem Koupons ausländischer
Papiere an Zahlungs Statt gegeben oder verkauft werden, zieht
seinen Kunden die betreffende Steuer ab, da ihm selbst wiederum bei
der Einlösungsstelle diese Summe gekürzt wird.
Gleichwohl hat das deutsche Reichsgericht neuerdings im
entgegengesetzten Sinn erkannt. Nach der Ansicht unsers obersten
Gerichtshofs ist der inländische Besitzer eines
ausländischen Staatspapiers nicht verpflichtet, die von dem
auswärtigen Staat auferlegte Kouponsteuer zu tragen, es sei
denn, daß dieselbe gleichzeitig mit der Emission verfügt
wurde. In dem letztern Fall hat nämlich der Gläubiger
durch den Kauf des Papiers in den Zinsabzug gewilligt. Er hat in
dem Kaufvertrag die Kouponsteuer (als eine Vertragsbedingung)
genehmigt. Anders dagegen liege die Sache, wenn der auswärtige
Staat erst geraume Zeit nach erfolgter Emission die Kouponsteuer
anordne. Hier könne er die Besitzer seiner Papiere in fremden
Staaten nicht zwingen, die Kouponsteuer nachträglich
anzuerkennen. Eine dahin gehende Verordnung habe allerdings
für die eignen Unterthanen, nicht aber für Ausläuder
bindende Kraft. Hielte man an der bisherigen Auffassung der
Nationalökonomen und der Handelswelt fest, so müßte
man dem ausländischen
Schuldner ein Recht zugestehen, das dem Inländer
zugehörige Eigentum einzuziehen. Dies wäre aber um so
bedenklicher, als in geldarmen Ländern die Anleihen gerade auf
das Kapital des Auslandes gerichtet sind.
A. Z. in B. Mambour (richtiger Mambours) ist der Titel
des Stadtvogts oder Schutzherrn, den sich die Stadt Lüttich
zum Schutz ihrer Freiheiten gegen den Bischof zuerst 1465 aus den
benachbarten weltlichen Fürsten wählte.
J. Moser in Mannheim. Der Orden pour le mérite ist
so, wie er auf unsrer Tafel abgebildet wurde, durchaus richtig.
Das Bildnis Friedrichs II. in der Mitte ist eine ganz
außerordentliche Verleihung, und soweit unsre Erkundigungen
reichen, kam eine solche Ausschmückung nur dreimal vor: Kaiser
Wilhelm I. (das Exemplar Friedrich Wilhelms III.), Kronprinz
Friedrich Wilhelm, später Kaiser Friedrich III., und Graf
Moltke. Jedenfalls ist diese Verleihung höchst selten und
gehört nicht zur Regel, und nur letztere war für unsre
Tafel maßgebend.
S. M. in München. Der Name Georg Dannenberg als Inhaber
des durch zahlreiche Romane bekannten Pseudonyms "Golo Raimund"
war nicht der richtige Name des Verfassers, sondern eine Erfindung
des Verlegers Karl Rümpler in Hannover, der auf diese Weise
die Aufmerksamkeit des Publikums von der wirklichen Verfasserin
ablenkte. Als solche hat sich die vor einiger Zeit verstorbene Frau
Bertha Frederich, geborne Heyn, in Hannover, Witwe des ehemaligen
hannöverschen Hofmalers Dr. med. Frederich, herausgestellt.
Einen kurzen Artikel über Golo Raimund wird der schon
erwähnte Register- und Supplementband bringen.
K. M. in Mannheim, und viele andre. Auf eine Anfrage, ob
die Besitzer des Eisernen Kreuzes als "Inhaber" oder als "Ritter"
zu bezeichnen seien, hat die Generalordenskommission erwidert,
daß bezüglich der Frage, inwieweit den Besitzern des
Eisernen Kreuzes das Prädikat "Ritter" gebührt, eine
Allerhöchste Entscheidung nicht ergangen ist. Es stehe
hiernach in dem Belieben der beteiligten Personen, sich "Ritter"
oder "Inhaber" dieser Auszeichnung zu nennen.
1044
Korrespondenzblatt zum fünfzehnten Band.
L.R. in Prag. Allerdings wird das Wort "Investition" auch im
Sinn von "Kapitalanlage" gebraucht. Vielleicht dient es Ihnen, wenn
wir eine Definition anführen, die in der "Zeitschrift für
Eisenbahnen und Dampfschiffahrt der Österreichisch-Ungarischen
Monarchie", 1. Jahrg., 47. Heft, enthalten und vermutlich auf
Professor Dr. L. v. Stein zurückzuführen ist. "Ihrem
Begriff nach ist eine Investition nicht eine Kapitalanlage im
allgemeinen, sondern die Vermehrung der produktiven Kraft irgend
eines Unternehmens durch eine neue, dem alten Kapital
hinzugefügte und mit ihm zur geschäftlichen Einheit
erwachsende neue Kapitalanlage."
v. W. in Berlin. Die Stadt Rom hat erst seit kurzem
(1888) die Wölfin mit den beiden Säuglingen aus ihrem
Wappen entfernt, statt dessen den Wappenschild bekrönt und den
Stern Italiens links neben die Inschrift S. P. Q. R. gesetzt, wie
es unsre Abbildung auch bereits darstellt.
Otto Born, Neumühle-Düben. Das Sultanat Obbi
oder Obbia an der ostafrikanischen Küste liegt im Somalland
nördlich von der Mündung des Flusses Dschuba (Juba) oder
Webi. Nach den italienischen Berichten hat der Landesherr die
Schutzherrschaft Italiens nachgesucht, und dieselbe ist ihm denn
auch nach Prüfung der Verhältnisse zugestanden, die
Thatsache aber in Gemäßheit der Berliner Kolonialakte
den Vertragsmächten mitgeteilt worden. Die Küste wurde
bekanntlich schon früher von der Deutschen Ostafrikanischen
Gesellschaft beansprucht, doch hat das Deutsche Reich den Schutz
über dieselbe nicht übernommen. Die Italiener
beabsichtigen in Obbi eine Kohlenstation anzulegen und von hier
Handelsverbindungen mit dem Innern anzuknüpfen. Eine
Spezialkarte von "Sansibar und dem benachbarten Teil von
Deutsch-Ostafrika" finden Sie im 14. Band.
S. K. in Gotha. Neuere, bei Gelegenheit des hundertsten
Geburtstags angestellte Untersuchungen haben ergeben, daß
August Neander nicht am 16., sondern am 17. Jan. 1789 geboren
ist.
Julius Koch in Breslau; E. Waldeyer in P. Der Kardinal
Charles Martial Allemand Lavigerie wurde 31. Okt. 1825 als Sohn
eines Zolleinnehmers zu Bayonne geboren, wurde im Seminar
St.-Sulpice in Paris zum Geistlichen gebildet und bekleidete
später die Lehrkanzel für Kirchengeschichte an der
Sorbonne. Infolge der Blutthaten in Syrien (1860) ward Lavigerie
mit einer Mission in dieses Land betraut und dadurch allgemein
bekannt, namentlich kam er in nahe Verbindungen mit dem
französischen Kaiserhof. Dann ging Lavigerie nach Rom, wo ihn
Papst Pius IX. zum Hausprälaten ernannte, 1863 wurde er auf
den Bischofsstuhl von Nancy erhoben und 1867 auf den Vorschlag
Napoleons III. zum Erzbischof von Algier ernannt. Hier war er
unermüdlich thätig, er gründete neue Kirchen,
Waisenhäuser für verlassene arabische Kinder und
entwickelte einen außerordentlichen propagandistischen
Missionseifer, so daß er sehr bald in Konflikt mit dem
damaligen Militärgouverneur von Algerien, Mac Mahon, geriet.
Doch wuchs sein Einfluß derart, daß Lavigerie vom Papst
zum Primas des afrikanischen Erdteils ernannt wurde und in der
Folge die Würden eines apostolischen Delegaten für den
Sudân, die Sahara und Äquatorialafrika bekleidete. Auf
dem römischen Konzil (1869) war Lavigerie einer der eifrigsten
Anhänger des Unfehlbarkeitsdogmas, ohne jedoch eine besondere
Rolle zu spielen. LeoXIII. ernannte ihn zum Kardinal und erhob ihn
auf den wiederhergestellten erzbischöflichen Stuhl von
Karthago, doch behielt Lavigerie seine frühere Residenz Algier
bei. Seine Versuche, in die französische Nationalversammlung
gewählt zu werden, schlugen zweimal (1870 und 1871) fehl.
Lavigerie arbeitete seitdem unablässig an seinem großen
religiös-humanitären Werk, der Abschaffung der Sklaverei
in Afrika in Verbindung mit der katholischen Mission. Mit seinen
Predigten und Vorträgen in der St.-Sulpicekirche zu Paris, in
St.-Gudule zu Brüssel und in London hatte er beispiellosen
Erfolg; auch Italien, wo er in Rom, Neapel, Mailand Vorträge
hielt, sucht er für sein Werk zu gewinnen. Schriftstellerisch
bethätigte sich der Kardinal durch Herausgabe von
Lehrbüchern; auch seine akadem. Vorträge über die
"Irrlehren des Jansenismus" erschienen im Druck (1858).
Karl Buchwald in Wien. Ihre Militärangelegenheiten hier
im Korrespondenzblatt zu besprechen, müssen wir aus
Rücksicht für unsre übrigen Leser ablehnen. Wenden
Sie sich an eine deutsche Behörde.
v. W. in Königsberg. Sie finden "Hydrokarbongas" unter
dem Stichwort Wassergas.
v. M. in R. Ruy Blas, der Held des Schauspiels von Victor
Hugo, ist lediglich eine Erfindung des Dichters, der sich selbst
darüber in dem Vorwort ausgesprochen hat. Die Königin ist
zwar dem Namen, aber nicht dem Wesen nach historisch. Die Sache
finden Sie besprochen bei Morel-Fatio, "Études sur
l'Espagne", 5. Serie (Par. 1888), und in einem kürzlich
erschienenen Aufsatz von K. Heigel: "Maria Anna von Neuburg,
Königin von Spanien" (im 7. Hefte der Zeitschrift "Vom Fels
zum Meer" 1888/89).
Karl Zehnder in M. Die Schachspieler zweiten und dritten
Ranges, über welche von verschiedenen Zeitschriften teils
aus Pietät, teils aus besonderer Gunst biographische Notizen
gebracht werden, und die sich auf Hunderte belaufen, können im
Konversations-Lexikon nicht berücksichtigt werden. Einen
Artikel über die "Problemkunst" finden Sie im Register- und
Supplementband, der sich unmittelbar an das Hauptwerk
anschließen und neben dem "Register" der nicht als
selbständige Artikel vorkommenden Schlagworte auch die
notwendig gewordenen Nachträge und Ergänzungen bringen
wird.
H. G. in Charkow. Die Stadt Magdeburg, d.h. der alte Kern
derselben, hat jetzt nur noch eine katholische Kirche; eine zweite
befindet sich in Sudenburg, eine dritte in Neustadt. Die
Liebfrauenkirche steht jetzt als Kirche unbenutzt.
Krauß in Budapest. König Alfons XII. von Spanien
ist erst nach dem Druck des Artikels gestorben, weshalb sein
Todestag nicht erwähnt sein kann. Übrigens ist letzterer
am Schluß des 7. Bandes, der doch wohl längst in Ihrem
Besitz ist, im "Nekrolog" verzeichnet.
Abonnent. Sie müssen unter Skrofeln suchen!
Dr. Rose in M. Das sogen. Baptisterium zu Winland, eins
der im Art. "Baukunst" (S. 496) erwähnten Rundgebäude in
Grönland, soll nach Palfreys "History of New England" eine von
dem Gouverneur Arnold um 1670 erbaute Windmühle sein. Vgl.
Gust. Storm in den "Jahrbüchern der königlichen
Gesellschaft für nordische Altertumskunde in Kopenhagen" 1887,
S. 296.
*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 10223 ***

Excerpt
Dies ist ein Zwischenstand (Oktober 2003) der Digitalisierung von
"Meyers Konversationslexikon" (4. Aufl., 1888-1890). Die
Digitalisierung wird unter
erarbeitet; dort kann man auch den jeweils aktuellen Stand einsehen und
selbst an der Arbeit teilnehmen.
Wenn Korrekturen vornehmen wollen, melden Sie sich bitte entweder bei
http://www.meyers-konversationslexikon.de an oder senden Sie jeweils
ein korrigierten Eintrag an Karl Eichwalder <[email protected]> zur
Einarbeitung. Beachten Sie...
Read the Full Text
— End of Meyers Konversationslexikon Band 15 —
Book Information
- Title
- Meyers Konversationslexikon Band 15
- Author(s)
- Various
- Language
- German
- Type
- Text
- Release Date
- November 1, 2003
- Word Count
- 1,036,538 words
- Library of Congress Classification
- AE
- Bookshelves
- DE Sachbuch, Browsing: Encyclopedias/Dictionaries/Reference, Browsing: Other
- Rights
- Public domain in the USA.
Related Books

Blackwood's Edinburgh Magazine, Vol. 67, No. 415, May, 1850
by Various
English
1403h 23m read

Blackwood's Edinburgh Magazine, Vol. 67, No. 413, March, 1850
by Various
English
1544h 52m read

Chambers's Journal of Popular Literature, Science, and Art, fifth series, no. 149, vol. III, November 6, 1886
by Various
English
285h 2m read
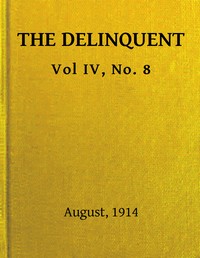
The Delinquent, Vol. IV, No. 8, August, 1914
by Various
English
233h 1m read

Chambers's Journal of Popular Literature, Science, and Art, Fifth Series, No. 148, Vol. III, October 30, 1886
by Various
English
287h 25m read
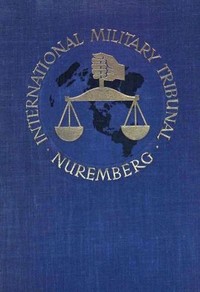
Trial of the major war criminals before the International Military Tribunal, Nuremburg, 14 November 1945-1 October 1946, volume 18
by Various
English
3940h 53m read