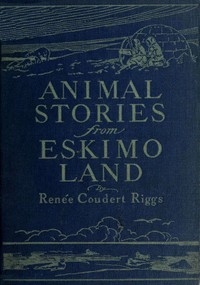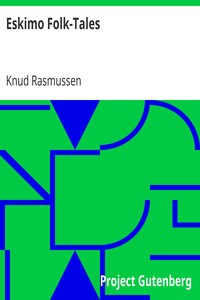The Project Gutenberg EBook of Eskimomärchen, by Paul Sock
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Eskimomärchen
Translator: Paul Sock
Release Date: February 24, 2012 [EBook #38972]
Language: German
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ESKIMOMÄRCHEN ***
Produced by Jana Srna, Wolfgang Menges and the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Passagen, die im Originaltext kursiv gedruckt waren, sind hier _so_,
gesperrt gedruckte Passagen +so+ gekennzeichnet. Weitere Anmerkungen
befinden sich am Ende des Textes.
[Illustration: Signet]
ESKIMOMÄRCHEN
ÜBERSETZT
VON
_PAUL SOCK_
1.-3. Tausend
AXEL JUNCKER VERLAG
BERLIN W15
_FÜR OLGA K._
Flutlegende von St. Michael
(Aljaska)
In den ersten Tagen war die ganze Erdoberfläche mit Ausnahme eines sehr
hohen Berges in ihrer Mitte überflutet. Vom Meer her stieg das Wasser und
bedeckte alles Land, mit Ausnahme dieses Berges; nur ein paar Tiere wurden
gerettet und entkamen dadurch, daß sie die Berghänge hinanstiegen. Einige
wenige Leute entkamen, indem sie ein Familienboot bestiegen. Ihr Leben
fristeten sie mit Fischen, die sie bei Ebbe fingen. Als schließlich das
Wasser zurückging, gingen die Leute, die gerettet waren, auf die Berge und
lebten da; gelegentlich stiegen sie dann zur Küste herab. Auch die Tiere
kamen wieder herab und belebten die Erde mit ihrem Geschlecht. Während der
Flut schnitten Wogen und Ströme in die Oberfläche des Landes Furchen und
Risse und als dann das Wasser zurückging und immer weiter zum Meer abfloß,
waren die heutigen Berge und Täler entstanden.
Die große Flut
(Von den Zentral-Eskimos)
Vor langer Zeit begann einmal der Ozean plötzlich zu steigen, bis er das
ganze Land bedeckt hatte. Das Wasser floß über die Gipfel der Berge und das
Eis trieb über sie hinweg. Als die Flut sich dann zurückzog, strandete das
Eis und bildete überall auf den Gipfeln der Berge eine Eishaube. Viele
Schaltiere, Fische, Seehunde und Wale blieben hoch oben am Trocknen zurück
und da sind ihre Schalen und Knochen noch bis zum heutigen Tage sichtbar.
Eine große Anzahl Inuit starben während dieses Zeitraumes, aber viele
andere, die, als das Wasser zu steigen begann, ihre Kajaks bestiegen
hatten, wurden gerettet.
Die Schöpfung
(Geschichten vom Raben Tu-lu-kau-guk I.)
Es gab eine Zeit da auf der Erdoberfläche noch keine Menschen waren. Die
ersten vier Tage war der erste Mensch noch eingehüllt in der Schote einer
Stranderbse. Am fünften Tag streckte er seine Füße heraus, zersprengte die
Schote und fiel als völlig ausgewachsener Mann auf den Boden und stand auf.
Er sah sich um, bewegte seine Hände und Arme, seinen Hals und seine Beine
und untersuchte sich selbst ganz neugierig. Als er sich umsah, erblickte er
die Schote, aus der er herausgefallen war, noch an der Ranke hängend und an
ihrem unteren Ende das Loch, aus dem er gekommen war. Dann sah er sich
wieder um und bemerkte, daß er sich von seinem Ausgangspunkt entfernt hatte
und der Boden unter seinem Tritt nachgab und ganz weich war. Nach einiger
Zeit spürte er im Magen ein unangenehmes Gefühl und bückte sich, um aus
einer kleinen Pfütze vor seinen Füßen Wasser in den Mund zu schöpfen. Das
Wasser lief in seinen Magen hinunter und er fühlte sich wieder wohler. Als
er wieder aufsah, bemerkte er ein schwarzes Ding mit flatternden Bewegungen
geradewegs auf sich zukommen. Wenn es anhielt und am Boden stand, sah es
ihn an. Das war der +Rabe+, und als er stehen blieb hob er einen Flügel und
schob seinen Schnabel, wie eine Maske, auf den Kopf hinauf und verwandelte
sich im selben Augenblick in einen Mann. Schon bevor er seine Maske
hochgehoben, hatte er den Menschen angestarrt und nachdem er sie
aufgehoben, glotzte er noch mehr und bewegte sich, um genauer sehen zu
können, hin und her. Endlich sagte er: »Was bist du? Von wo bist du
gekommen? So etwas wie dich habe ich noch nie gesehen!« Der Rabe blickte
den Menschen an und war immer mehr darüber verwundert, daß dieses fremde
Wesen ihm an Gestalt so ähnlich war.
Dann ließ er den Menschen ein paar Schritte gehen und rief wieder erstaunt:
»Von wo bist du gekommen? Ich habe früher nie so etwas, wie dich, gesehen!«
Darauf antwortete der Mensch: »Ich komme aus dieser Erbsenschote«, und
zeigte auf die Pflanze, aus der er gekommen war. »Ah«, rief der Rabe, »ich
habe zwar diese Pflanze geschaffen, aber niemals geglaubt, es könnte so
etwas, wie du daraus hervorkommen. Komm mit mir auf jene Anhöhe dort; ich
habe sie zwar erst ein wenig später gemacht und sie ist noch weich und
nachgiebig, aber es ist dort doch fester und härterer Grund als hier.«
Sie gewannen bald das höher gelegene Land und hatten nun festeren Boden
unter ihren Füßen. Der Rabe fragte den Menschen, ob er etwas gegessen
hätte. Dieser antwortete, daß er aus einer Pfütze irgend ein feuchtes Zeug
zu sich genommen. »Ah«, sagte der Rabe, »du hast Wasser getrunken. Warte
jetzt hier auf mich.«
Er zog die Maske wieder vors Gesicht, verwandelte sich so in einen Vogel
und flog hoch in den Himmel, wo er verschwand. Der Mensch wartete wo er
geblieben war, bis der Rabe am vierten Tag zurückkam. In seinen Klauen
brachte er vier Beeren. Er schob seine Maske hinauf und wurde wieder ein
Mann, der ihm zwei Brombeeren und zwei schwarze Rauschbeeren entgegen hielt
und sagte: »Das habe ich für dich zum essen gebracht. Ich will auch, daß
diese Beeren auf Erden häufig vorkommen; jetzt iß sie aber!« Der Mensch
nahm die Beeren und steckte sie nacheinander in den Mund und sie stillten
seinen Hunger, den er schon unangenehm gespürt hatte. Dann führte der Rabe
den Menschen zu einem kleinen Bach in der Nähe; dort ließ er ihn stehen,
ging zum Rand des Wassers und formte aus ein paar Lehmpatzen ein Paar
Bergschafe und behielt sie in der Hand. Als sie getrocknet waren, forderte
er den Menschen auf, sich anzusehen, was er gemacht habe. Der Mensch fand
sie sehr schön und der Rabe befahl ihm nun, seine Augen zu schließen. Sowie
er die Augen geschlossen hatte, nahm der Rabe wieder seine Maske vor und
machte über den Bildwerken vier Flügelschläge, womit ihnen das Leben
eingehaucht war und als vollausgewachsene Schafe sprangen sie davon. Nun
hob er wieder seine Maske hoch und befahl dem Menschen zu sehen. Wie der
Mensch die Schafe sich so voll Leben bewegen sah, schrie er vor Freude auf,
und der Rabe sagte: »Wenn diese Tiere zahlreich geworden sein werden,
werden die Menschen sehr danach trachten, sie zu bekommen.« Darauf sagte
der Mensch, er hoffe, sie würden zahlreich werden. »Gut«, sagte der Rabe,
»es wird aber für sie besser sein, in den hohen Felsen zu hausen, sodaß sie
nicht jeder töten kann, und man soll sie nur dort finden.«
Dann schuf der Rabe aus Lehm noch zwei weitere Tiere, denen er wie früher
Leben einhauchte, aber da sie nur stellenweise trocken waren, als sie
belebt wurden, blieben sie braun und weiß gefleckt und so entstand das
zahme Renntier mit seinem fleckigen Fell. Sie gefielen dem Mensch gut, und
der Rabe belehrte ihn, daß sie sehr wertvoll werden würden. Auf die gleiche
Weise wurde dann ein Paar wilder Renntiere geschaffen, die der Rabe nur am
Bauch trocknen und weiß werden ließ, bevor er sie belebte; daher kommt es,
daß der Bauch der einzige weiße Teil der wilden Renntiere ist. Der Rabe
verriet nun dem Menschen, daß diese Tiere sehr gewöhnlich sein werden und
die Menschen würden viele von ihnen töten.
»So allein wirst du dich einsam fühlen«, sagte dann der Rabe, »ich will dir
einen Gefährten schaffen.« Er ging nun zu einer Lacke, die etwas von der,
wo er die Tiere geschaffen hatte, entlegen war und schuf, indem er ab und
zu auf den Menschen sah, ein ihm sehr ähnliches Bildwerk. Dann befestigte
er als Haar ein Büschel feinen Wassergrases an seinem Kopf, und nachdem er
in seinen Händen das Bild getrocknet hatte, schwang er wie früher seine
Fittige über ihm und ein wunderschönes Weib entstand neben dem Mann. »Da
ist ein Gefährte für dich!« sagte der Rabe und führte sie zu einem kleinen
Hügel in der Nähe weg.
In diesen Tagen gab es weit und breit keine Berge und es war ewig heller
Sonnenschein. Kein Regen fiel und keine Winde wehten. Als sie zu dem Hügel
kamen, zeigte ihnen der Rabe, wie man aus trockenem Moos ein Bett macht und
sie schliefen da gut und warm; der Rabe zog seine Maske herab und schlief
als Vogel in der Nähe. Er erhob sich vor den andern, ging wieder an den
Bach und schuf je ein Paar Äschen, Stichlinge und Lippfische. Als die im
Wasser herumschwammen, rief er die Menschen, sie anzusehen. Der Mensch sah
hin und wie die Stichlinge mit wirbelnden Bewegungen gegen die Strömungen
schwammen, streckte er überrascht die Hände nach einem aus, aber der Fisch
entkam ihm. Nun zeigte ihm der Rabe die Äschen und belehrte ihn, daß sie in
den klaren Bergflüssen zu finden seien, während die Stichlinge an der
Meeresküste leben würden, und daß diese beiden Arten gut zu essen seien.
Danach wurde die Spitzmaus geschaffen, von der der Rabe sagte, daß man sie
zwar nicht essen könne, daß sie aber den Boden belebe und das Land davor
bewahre, freudlos und unfruchtbar auszusehen.
So schuf der Rabe noch einige Tage lang Vögel, Fische und Säugetiere,
zeigte sie den Menschen und erklärte ihren Nutzen.
Dann flog er in den Himmel und blieb vier Tage lang weg. Als er zurückkam,
brachte er dem Menschen einen Lachs. Er sah sich um und bemerkte, daß die
Pfützen und Seen still und einsam waren, und so schuf er viele
Wasserinsekten für ihre Oberflächen, und aus dem gleichen Material machte
er den Biber und die Bisamratte, um die Ufer zu beleben. Dann wurden noch
Fliegen, Mücken und andere Land- und Wasserinsekten geschaffen, und der
Mensch dessen belehrt, daß sie nur geschaffen seien, um die Erde zu beleben
und fröhlich zu machen. Zu jener Zeit waren alle Mücken wie die Hausfliegen
und stachen nicht, wie heutzutage.
Er zeigte dem Menschen dann die Bisamratte und riet ihm, ihr Fell als
Kleidung zu verwenden. Er erzählte ihm auch, daß der Biber an den Flüssen
hausen und starke Baue errichten werde, und daß er diesem Beispiel folgen
müsse und auch so schlau sein, denn ihn könnten nur gute Jäger erwischen.
Um diese Zeit gebar die Frau ein Kind und der Rabe gab dem Menschen
Anleitungen, wie es zu ernähren sei und erklärte, daß es auch zu so einem
Menschen, wie er sei, heranwachsen werde. Kaum war das Kind geboren, da
brachte es der Rabe mit dem Menschen an einen Bach, rieb es mit Schlamm ab
und sie kehrten dann wieder zu ihrem Aufenthaltsort am Hügel zurück. Am
anderen Morgen lief das Kind schon herum und riß Gras und andere Pflanzen
aus, die der Rabe in der Nähe wachsen ließ. Am dritten Tag war es schon ein
erwachsener Mann.
Nun fiel es dem Raben ein, daß die Menschen alles was er geschaffen,
zerstören würden, wenn er nicht etwas schüfe, um sie zu schrecken. Er ging
also an einen Bach in der Nähe und formte einen Bären; er belebte ihn dann
und wie der Bär grimmig dreinschauend dastand, sprang er rasch zur Seite.
Dann holte er den Menschen und belehrte ihn, daß der Bär ganz schrecklich
sei, und wenn er ihn störe, ihn in Stücke reißen werde. Dann wurden die
verschiedenen Robbenarten geschaffen und ihre Namen und Gewohnheiten dem
Menschen erklärt. Der Rabe lehrte den Menschen noch, wie man aus
Seehundsfellen ungegerbte Schnüre und Schlingen für Rotwild mache, aber er
warnte ihn davor mit dem Rotwildfang früher zu beginnen, als bis es
zahlreich genug sei.
Um diese Zeit war das Weib wieder in der Hoffnung und der Rabe erklärte, es
werde diesmal ein Mädchen werden und sobald es geboren sei, müßten sie es
mit Schlamm abreiben, und wenn es erwachsen sei, müsse es den Bruder
ehelichen. Dann ging der Rabe weg, zu dem Platz, wo er in der Erbsenranke
den ersten Menschen gefunden hatte. In seiner Abwesenheit wurde ein Mädchen
geboren und das Paar tat wie ihm befohlen war; am nächsten Tag lief das
Mädchen schon herum. Am dritten war es eine erwachsene Frau und wurde, wie
der Rabe befohlen hatte, dem jungen Mann vermählt, auf daß die Erde rascher
bevölkert werde.
Als der Rabe zur Erbsenschote kam, fand er drei andere Männer, die gerade
aus der Schote, die den ersten hervorgebracht hatte, gefallen waren. Diese
Männer sahen sich, wie der erste, verwundert um, und der Rabe führte sie
in einer Richtung, die jener, in der er den ersten mitgenommen hatte,
entgegengesetzt war, weg und brachte sie hart am Meer aufs Festland. Hier
blieben sie und der Rabe blieb lange Zeit bei ihnen und lehrte sie, wie sie
leben sollten. Er lehrte sie Feuerbohrer und Bogen aus einem trockenen
Holzstück und einer Saite anzufertigen; das Holz nahm er von Sträuchern und
kleinen Bäumen, die er an geschützten Orten in Rinnen an den Abhängen
wachsen ließ. Er schuf für jeden der Männer ein Weib und viele Pflanzen und
Vögel, die die Seeküste bewohnen; es waren aber weniger Arten, als er im
Land, wo der erste Mensch lebte, gemacht hatte. Er lehrte die Menschen
Bogen, Pfeile, Netze und alle anderen Jagdgeräte machen und auch ihren
Gebrauch, besonders, wie man die Robben fängt, die jetzt im Meer massenhaft
vorkamen. Er lehrte sie Kajaks machen und zeigte ihnen, wie man aus
angeschwemmten Balken, Ästen und Erde gutgedeckte Häuser baue. Jetzt wurden
auch die drei Frauen der Männer schwanger und der Rabe ging wieder zum
ersten Menschen zurück, wo er die Kinder verheiratet fand. Er erzählte dem
Menschen dann alles, was er für die Leute an der Küste getan hatte; sah
sich dann um und fand, daß die Erde kahl aussehe. Er ließ also, als die
anderen schliefen, an geschützt gelegenen Stellen Birken, Rottannen und
kanadische Pappeln wachsen und weckte dann die Leute, die sich über den
Anblick der Bäume sehr freuten. Dann lernten sie mit dem Feuerbohrer Feuer
machen, wie man den Zunderfunken in ein Bündel trockenen Grases legt und
herumfächelt bis es aufflammt und dann trockenes Holz nachlegt. Er zeigte
ihnen, wie man Fische auf einem Stock braten kann, aus Weidenrinde und
Spänen Fischfallen macht, Lachse für den Winter trocknet und Häuser baut.
Dann ging der Rabe wieder zurück zu den Küstenbewohnern. Als er weggegangen
war, ging der Mensch mit seinem Sohn hinunter zum Meer und der Sohn fing
einen Seehund, den sie dann mit den Händen umbringen wollten; es gelang
nicht, aber schließlich tötete ihn der Sohn mit einem Faustschlag. Dann zog
ihm der Vater allein mit den Händen das Fell ab und sie machten Riemen
daraus und trockneten sie. Aus diesen Riemen machten sie in den Wäldern
Schlingen für die Renntiere. Als sie am nächsten Morgen diese nachsehen
gingen, fanden sie die Stricke durchgebissen und die Schlingen weg, denn
damals hatten die Renntiere noch scharfe Zähne, wie die Hunde. Der Sohn
dachte eine Zeitlang nach und machte dann am Weg der Tiere ein tiefes Loch
und hängte, an der Schlinge befestigt, einen schweren Stein hinein und zwar
so, daß der Stein, wenn sich ein Tier in der Schlinge fing, ins Loch
hinunterrutschen, seinen Nacken herunterziehen und es so festhalten mußte.
Als sie am andern Morgen zurückkamen, fanden sie ein Renntier in der
Schlinge verwickelt. Sie nahmen es heraus, töteten es und zogen ihm das
Fell ab, das sie für ein Bett nach Hause nahmen. Etwas von dem Fleisch
brieten sie am Feuer und fanden es ganz genießbar. --
Eines Tages ging der Mensch hinaus, um an der Küste Robben zu jagen. Er sah
sehr viele, aber jedesmal, wenn er sich vorsichtig herangeschlichen hatte,
krochen sie ins Wasser, bevor er ganz an sie heran konnte. Schließlich war
nur noch ein Tier am Strand. Der Mensch schlich sich noch vorsichtiger
heran als früher, aber auch dies entkam ihm. Nun stand er auf und ein
seltsames Gefühl bewegte seine Brust und Tränen tropften aus seinen Augen
ins Gesicht. Er hob seine Hände und fing einige Tropfen auf, um sie
anzusehen und er entdeckte, daß sie wie Wasser waren. Ohne daß er es
wollte, entrangen sich ihm laute Schreie und Tränen fielen in sein Gesicht,
als er heim ging. Als sein Sohn ihn kommen sah, machte er seine Frau und
seine Mutter darauf aufmerksam, mit welch seltsamem Lärm der Mensch
daherkomme. Als er sie erreicht hatte, waren sie noch mehr erstaunt, Wasser
aus seinen Augen rinnen zu sehen. Nachdem er ihnen die Geschichte seiner
Enttäuschung erzählt hatte, wurden sie alle vom gleichen fremden Schmerz
ergriffen und klagten mit ihm, und so lernten die Menschen zum erstenmal
das Weinen. Danach fing dann der Sohn einen anderen Seehund und sie machten
noch weitere Renntierfallen aus seiner Haut.
Als diesmal das gefangene Renntier nachhause gebracht wurde, trug der
Mensch seinen Leuten auf, einen Knochensplitter von seinem Vorderfuß zu
nehmen und in das breite Ende ein Loch zu bohren. In dies steckten sie
Renntiersehnen und nähten Felle über ihren Körper, um sich für den Winter
warm zu halten. Der Rabe hatte ihnen befohlen, das so zu machen, damit die
frischen Renntierfelle auf ihnen trockneten. Dann zeigte der Mensch, wie
man Bogen und Pfeile mache und letztere mit Hornspitzen versehe, um damit
Renntiere zu erlegen. Hiermit brachte der Sohn auch sein erstes Renntier
zur Strecke. Er schnitt es dann auf und legte seinen Speck auf ein Gebüsch
und schlief daneben ein. Als er erwachte, hatten die Mücken den Speck ganz
aufgefressen. Das ärgerte ihn sehr. Bis dahin hatten die Mücken nie die
Menschen gestochen, aber dieser Mensch beschimpfte sie wegen dessen, was
sie getan hatten und sagte: »Nie mehr sollt ihr Speck fressen, freßt lieber
noch die Menschen.« Und von da an haben die Mücken immer die Menschen
gestochen.
Dort wo der erste Mensch gelebt hatte, war jetzt ein großes Dorf
entstanden, denn die Menschen taten alles, was der Rabe ihnen gezeigt
hatte, und sobald ein Kind geboren war, wurde es mit Schlamm abgerieben und
so bewirkt, daß es in drei Tagen erwachsen war. Eines Tages kam nun der
Rabe zurück, setzte sich zum Menschen und sie sprachen von vielen Dingen.
Der Mensch erkundigte sich beim Raben nach dem Land, das er im Himmel
geschaffen. Der Rabe sagte, er habe dort ein sehr gutes Land gemacht und
der Mensch bat ihn, er möchte ihn dorthin mitnehmen, damit er es sehe. Der
war damit einverstanden und sie machten sich nach dem Himmel auf den Weg
und kamen dort auch in kurzer Zeit an. Da war der Mensch in einem
wunderbaren Land mit einem viel besseren Klima, als auf Erden. Die Leute,
die dort lebten, waren aber sehr klein; wenn sie neben ihm standen,
reichten ihre Köpfe ihm nur bis zum Oberschenkel. Während sie hier
herumzogen, erblickte der Mensch viel fremde Tiere; auch der Boden war viel
besser als der, den er verlassen hatte. Der Rabe erzählte, daß dies Land
mit seinen Tieren und Menschen das erste gewesen sei, das er erschaffen
habe.
Die Leute, die da lebten, machten schöne Pelzkleider mit eingearbeiteten
Mustern, wie sie die Menschen jetzt auch auf Erden tragen, denn der Mensch
hat nach seiner Rückkehr den Leuten gezeigt solche Kleider zu machen und
die Muster haben sich allenthalben erhalten. Nach einiger Zeit kamen sie an
ein großes Haus und traten ein. Ein uralter Mann, der erste, den der Rabe
im Himmel geschaffen hatte, kam von seinem Ehrenplatz gegenüber der Haustür
herab und bewillkommte sie; er beauftragte jetzt seine Leute, den Gästen
aus dem unteren Land, die seine Freunde seien, Speisen zu bringen. Es wurde
dann eine Art gesottenen Fleisches, wie es der Mensch vorher nie gesehen
hatte, gebracht. Der Rabe belehrte ihn, daß es von Bergschafen und zahmen
Renntieren sei. Nachdem der Mensch gegessen hatte, wollte ihm der Rabe noch
andere Dinge, die er gemacht hatte, zeigen, warnte ihn aber davor, aus den
Seen, an denen sie vorüberkommen würden, zu trinken, denn er habe in sie
Tiere gesetzt, die ihn umbringen und zerfleischen würden, wenn er
näherkäme.
Auf ihrem Weg kamen sie an ein ausgetrocknetes Teichbett, das dicht mit
hohen Gräsern bewachsen war. Auf den Grasspitzen, die sich unter der Last
aber gar nicht bogen, lag ein großes, seltsames, sechsbeiniges Tier mit
einem langen Kopf. Die beiden Hinterbeine waren ungewöhnlich lang, die
vorderen waren kurz und aus dem Bauch ragte ein ganz kurzes Beinpaar
hervor. Der ganze Körper des Tieres war mit feinem, dünnem Haar bewachsen,
wie die Spitzmaus, nur war es an den Füßen länger. Am Kopf standen zwei
kurze, dicke nach rückwärts gebogene Hörner hervor. Die Augen waren klein
und die Farbe des Tieres dunkel, schwärzlich.
Danach kamen sie zu einer runden Öffnung im Himmel, um deren Rand kurzes
Gras wuchs, das wie Feuer glimmte. Dies war, so sagte der Rabe, ein Stern,
Mondhund genannt. Die Spitzen des die Öffnung umrahmenden Grases fehlten
und der Rabe erzählte, daß seine Mutter einmal einige, und er den Rest, um
auf Erden das erste Feuer zu machen, weggenommen habe. Er fügte noch hinzu,
daß er zwar versucht habe diese Grasart auch auf Erden zu schaffen, es sei
ihm aber nicht gelungen.
Nun befahl er dem Menschen die Augen zu schließen, er werde dann an einen
anderen Ort versetzt werden. Der Rabe nahm ihn auf seine Flügel und ließ
sich durch die Öffnung hindurch. Lange glitten sie dahin, bis sie an etwas
stießen, das sie in ihrer Bewegung aufhielt. Sie blieben stehen und der
Rabe sagte, sie seien jetzt am Meeresgrund. Der Mensch atmete ganz leicht
und der Rabe erklärte ihm, daß der Nebelschleier ringsum durch das Wasser
hervorgerufen sei; dann sagte er: »Ich werde hier einige neue Tierarten
schaffen; du darfst aber nicht herumgehen, leg dich nieder und wenn du müde
bist, so dreh dich auf die andere Seite.«
Der Rabe ließ den Menschen nun lange auf einer Seite liegen. Endlich
erwachte er dann, fühlte sich sehr müde und wollte sich umdrehen; es gelang
ihm aber nicht. Da dachte der Mensch bei sich: »Wenn ich mich doch nur
umdrehen könnte!« und im selben Augenblick drehte er sich auch schon ohne
Schwierigkeit herum. Wie er das tat, bemerkte er voll Erstaunen, daß sein
ganzer Körper mit langen weißen Haaren bedeckt war und seine Finger lange
Krallen bekommen hatten; er fiel aber sofort wieder in Schlaf. Noch dreimal
erwachte er und schlief dreimal wieder ein. Als er zum viertenmal erwachte,
stand der Rabe neben ihm und sagte: »Ich habe dich in einen Eisbär
verwandelt; wie gefällt dir das?« Der Mensch wollte antworten, konnte aber
keinen Laut von sich geben; da schwang der Rabe seine Zauberflügel über ihm
und er antwortete nun, daß es ihm nicht gefalle, denn so müsse er am Meer
leben, während sein Sohn am Land leben könne und er werde sich hierbei
unglücklich fühlen. Da tat der Rabe einen Flügelschlag und das Bärenfell
fiel vom Menschen und blieb leer am Boden liegen, während dieser in seiner
natürlichen Gestalt wieder aufstand. Nun nahm der Rabe eine seiner
Schwanzfedern und steckte sie als Rückgrat ins Bärenfell, machte einige
Flügelschläge darüber und ein Eisbär stand da. Sie gingen dann weiter; seit
dieser Zeit aber findet man am zugefrorenen Meer Bären.
Der Rabe fragte den Menschen nun, wie oft er sich umgedreht habe und er
antwortete: »Viermal.« »Das waren vier Jahre«, sagte der Rabe, »denn du
hast genau vier Jahre lang dort geschlafen.« Sie waren noch nicht weit
gegangen, als sie ein kleines Tier sahen, das einer Spitzmaus ähnelte. Das
war ein Wi-lu-gho-yuk. Es gleicht der am Land lebenden Spitzmaus, lebt aber
am Meereis. Wenn es einen Menschen sieht, fährt es auf ihn los, kriecht ihm
zu den Schuhen hinein und krallt über seinen ganzen Körper. Wenn der Mann
ganz still hält, verläßt es ihn wieder und er wird dann ein erfolgreicher
Jäger werden. Wenn aber der Mensch, so lang das Tier auf ihm ist, auch nur
einen Finger rührt, beißt es sich durch sein Fleisch geradewegs aufs Herz
los und tötet ihn so.
Dann schuf der Rabe den A-mi-kuk, ein großes, schleimiges Tier mit
lederartiger Haut und vier langen, weitausgreifenden Armen. Dieses wilde
Tier lebt im Meer, schlingt seine Arme um Männer und Kajaks und zieht sie
unters Wasser. Sucht ihm der Mensch dadurch zu entrinnen, daß er den Kajak
verläßt und aufs Eis steigt, so taucht es unter, bricht das Eis unter
seinen Füßen und es verfolgt ihn auch noch an der Küste, wo es sich unter
der Erde, genau so leicht, wie es im Wasser schwimmt, weitergräbt, sodaß
ihm niemand, der einmal von ihm verfolgt wird, entkommen kann.
Danach sahen sie dann zwei große, schwarze Tiere, die um ein kleineres
herumschwammen. Der Rabe eilte voraus und setzte sich auf den Kopf des
kleineren Tieres, das nun ruhig blieb. Als der Mensch herankam, zeigte ihm
der Rabe die zwei Walrosse und sagte, das kleine, auf dessen Kopf er säße,
sei ein »Walroßhund«. Dies Tier, sagte er noch, wird immer mit den großen
Walrossen ziehen und die Leute umbringen. Es war lang, ziemlich schlank und
mit schwarzen Schuppen bedeckt, die aber nicht so hart waren, als daß man
sie mit einem Speer nicht hätte durchstechen können. Sein Kopf und seine
Zähne hatten eine gewisse Ähnlichkeit mit denen eines Hundes. Er hatte vier
Beine und einen langen, runden Schwanz, der, wie der Körper, mit Schuppen
bedeckt war. Durch einen einzigen Schlag mit diesem Schwanz kann es einen
Mann töten.
Sie sahen nun viele Wale und allerlei Raubtiere. Der Rabe erklärte dem
Menschen, daß nur gute Jäger die Wale töten könnten, wenn aber einer erlegt
sei, könne ein ganzes Dorf daran essen. Dann sahen sie den
I-mum-ka-boi-a-ga oder »Seefuchs«, ein Tier, das dem roten Fuchs sehr
ähnlich sieht, nur im Meer lebt und so wild ist, daß es den Menschen
tötet. In der Nähe waren auch zwei Seeottern, die auch den Landottern
gleichen, aber ein viel feineres Fell haben. Sie sind weiß gesprenkelt,
sehr selten und nur die besten Jäger sind imstande, sie zu fangen. An
vielen Fischarten kamen sie noch vorüber und dann erhob sich vor ihnen die
Küste und oben konnte man das Gekräusel der Wasseroberfläche sehen.
»Schließ deine Augen und halte dich an mir fest«, sagte der Rabe. Kaum
hatte der Mensch das getan, da stand er auch schon am Strand, in der Nähe
seines Hauses und war sehr erstaunt, da, wo er ein paar Hütten verlassen
hatte, ein großes Dorf zu sehen. Seine Frau war sehr alt geworden und sein
Sohn war auch schon ein alter Mann. Als ihn die Leute sahen, bewillkommten
sie ihn und machten ihn zu ihrem Häuptling. Im Festhaus wurde ihm der
Ehrenplatz eingeräumt und er erzählte dort den Leuten was er alles gesehen
hatte und lehrte die jungen Leute viele Sachen. Die Dorfbewohner wollten
dem Raben einen Sitz neben dem Alten am Ehrenplatz einräumen; er schlug es
aber aus und wählte sich seinen Platz beim gewöhnlichen Volk, in der Nähe
des Eingangs.
Nach einiger Zeit wollte der erste Mensch das schöne Himmelsland wieder
sehen, aber seine Leute wollten lieber, er bliebe bei ihnen. Er ermahnte
seine Kinder, in seiner Abwesenheit nicht unglücklich zu sein und kehrte
dann in Begleitung des Raben ins Himmelsland zurück. Die Zwerge nahmen sie
freundlich auf und die beiden lebten dort lange Zeit; indessen waren die
Erdbewohner sehr zahlreich geworden und töteten sehr viele Tiere. Das
ärgerte den Menschen und den Raben sehr. Eines Nachts nahmen sie also ein
langes Seil und einen Korb und stiegen zur Erde herab. Der Rabe fing da
zehn Renntiere und steckte sie mit dem Menschen in den Korb. Dann
befestigte er ein Ende des Seils am Korb und erhob sich, das Ganze hinter
sich ziehend, wieder in den Himmel. Am nächsten Abend stiegen sie in der
Nähe des Menschen-Dorfes mit den Renntieren wieder herab. Den Renntieren
wurde aufgetragen, das nächste Haus, zu dem sie kämen, niederzubrechen und
die Bewohner zu vernichten, weil die Menschen zu zahlreich geworden seien.
Die Renntiere taten, wie ihnen befohlen war, fraßen mit ihren scharfen
Wolfszähnen die Leute auf und kehrten dann wieder in den Himmel zurück. In
der nächsten Nacht kamen sie wieder und vernichteten in gleicher Weise ein
anderes Haus samt seinen Bewohnern. Nun waren die Dorfbewohner sehr
erschrocken und beschmierten das nächste Haus mit einer Mischung von
Renntierfett und Beeren. Als die Renntiere dieses Haus zerstören wollten,
bekamen sie die Mäuler voll Fett und sauere Beeren, worauf sie herumlaufen
und die Köpfe so schütteln mußten, daß ihnen alle Zähne ausfielen. Später
wuchsen ihnen nur kleine Zähne, wie sie die Renntiere heute haben, nach und
diese Tiere sind seither harmlos.
Nachdem die Renntiere weggelaufen waren, gingen der Mensch und der Rabe
zurück in den Himmel und der Mensch sagte: »Wenn nicht etwas geschieht, was
die Leute hindert, so viel Tiere umzubringen, werden sie es so lange
treiben, bis sie alle Wesen, die du geschaffen hast, umgebracht haben. Es
wäre besser, ihnen die Sonne wegzunehmen, sodaß sie im Dunkeln leben und
sterben.«
Darauf antwortete der Rabe: »Bleib du hier, ich werde gehen und die Sonne
wegnehmen.« Er ging dann fort, nahm die Sonne, steckte sie in seinen
Fellsack und trug sie weit weg, in jene Gegenden des Himmelslandes, wo
seine Eltern lebten, und es wurde sehr finster auf Erden. In dem Dorf
seines Vaters nahm er sich dann aus den Jungfern eine Frau und lebte dort;
die Sonne hielt er sorgfältig in dem Sack versteckt.
Die Erdbewohner hatten große Angst, seit ihnen die Sonne genommen war und
suchten sie zurückzubekommen, indem sie dem Raben reichliche Spenden an
Speise und Wild anboten; das war aber ohne Erfolg. Nach langen Versuchen
versöhnten sie den Raben so weit, daß er ihnen für kurze Zeit Licht
gewährte. Er holte die Sonne heraus und hielt sie zwei Tage lang in einer
Hand, sodaß die Leute jagen und sich Nahrung verschaffen konnten. Dann nahm
er sie wieder weg und es war wieder ganz dunkel. Nun verstrich eine lange
Zeit und es bedurfte vieler Opfer, bevor er den Menschen wieder Licht
gewährte. Das wiederholte sich so einige Zeit.
In dem Dorf lebte ein älterer Bruder des Raben, der Mitleid mit den
Erdenkindern zu fühlen begann und der dachte nach, wie er die Sonne
bekommen und auf ihren alten Platz zurückbringen könnte. Nachdem er lange
nachgedacht hatte, stellte er sich tot und wurde in eine Grabkiste gelegt,
wie es der Brauch war. Sobald die Trauernden sein Grab verlassen hatten,
erhob er sich und ging in die Nähe des Dorfes. Hier nahm er seine
Rabenmaske vor und versteckte sich in einem Baum bei der Quelle, wo die
Dorfbewohner ihr Wasser holten, und wartete. Bald kam seines Bruders Frau,
um Wasser zu holen und füllte einen Eimer an; dann nahm sie einen
Schöpflöffel voll Wasser und wollte trinken. Mit Hilfe seiner Zauberkraft
verwandelte sich nun der Bruder-Rabe in ein kleines Blatt, fiel in den
Löffel und wurde mit dem Wasser verschluckt. Die Frau hustete etwas und
eilte dann nachhause, wo sie ihrem Gatten erzählte, sie habe, als sie aus
der Quelle trank, irgend einen Fremdkörper verschluckt. Er legte dem aber
keine Bedeutung bei und sagte, es werde ein Blatt gewesen sein.
Bald darauf wurde die Frau schwanger und gebar in ein paar Tagen einen
Knaben, der sehr aufgeweckt war und gleich herumkroch; einige Tage darauf
konnte er schon laufen. Er schrie immer nach der Sonne, und da sein Vater
ganz in ihn vernarrt war, gab er sie dem Kind oft als Spielzeug, achtete
aber immer streng darauf, sie wieder zurückzunehmen. Als der Sohn dann
schon vor dem Haus zu spielen begann, schrie und bettelte er mehr denn je
um die Sonne. Lange Zeit schlug ihm der Vater seine Bitte ab, dann aber
erlaubte er ihm doch, die Sonne zu nehmen, und der Knabe spielte damit im
Haus. Als einen Augenblick niemand zusah, warf er sie hinaus, lief rasch
zum Baum, legte Rabenmaske und Gewand an und flog weit fort. Er war vom
Himmel schon weit weg, da hörte er seinen Vater hinter sich schreien:
»Versteck die Sonne nicht! Gib sie aus dem Sack, damit wieder etwas Licht
ist; laß es nicht immer dunkel sein!« Er glaubte nämlich, sein Sohn habe
sie gestohlen, um sie für sich zu behalten.
Der Rabe ging ins Haus und der Rabenknabe flog dorthin, wo die Sonne lag.
Dort schnitt er die Fellhülle herunter und brachte die Sonne an ihren alten
Platz. Von da führte ein breiter Pfad weg und er folgte ihm. Er gelangte an
eine Öffnung, die von kurzem, glimmendem Gras umgeben war und er pflückte
etwas davon. Dann erinnerte er sich der Mahnung seines Vaters, es nicht
immer dunkel sein zu lassen, sondern einmal hell und dann wieder dunkel.
Dessen eingedenk verursachte er nun, daß sich der Himmel um die Erde drehe,
Sonne und Sterne mit sich bewege und so Tag und Nacht einander folgen.
Als er da, gerade vor Sonnenaufgang, ganz nah am Erdrand stand, steckte er
ein Büschel des glimmenden Grases, das er in der Hand hatte, in den Himmel
und seither ist es dort geblieben und erscheint als glänzender Morgenstern.
Er ging dann weiter auf die Erde und kam schließlich zu dem Dorf, wo die
erstgeschaffenen Menschen lebten. Dort bewillkommten ihn die Leute und er
erzählte ihnen, daß der Rabe auf sie bös geworden sei und die Sonne
weggenommen, daß er sie aber wieder zurückgebracht habe, und daß sie nie
mehr verschwinden werde.
Unter den Leuten, die ihn empfingen, war auch der Häuptling der
Himmelszwerge, der mit einigen der Seinen herabgekommen war, um auf Erden
zu leben. Ihn befragten die Leute, was aus dem ersten Menschen geworden
sei, der mit dem Raben in den Himmel hinaufgegangen war. Damals hörte der
Rabenknabe zum erstenmal von jenem Menschen und er wollte in den Himmel
hinauffliegen, um ihn zu sehen; dabei bemerkte er aber, daß er sich nur
wenig über die Erdoberfläche erheben konnte. Als er gewahr wurde, daß er
nie mehr in den Himmel zurückgelangen könnte, wanderte er fort, bis er an
ein Dorf kam, wo die Nachkommen jener Männer lebten, die zuletzt aus der
Erbsenschote geboren worden waren. Da nahm er ein Weib und lebte lange
Zeit; er hatte viele Kinder, die alle Raben-Menschen waren, wie er selbst,
und über die Erde fliegen konnten. Aber sie verloren immer mehr ihre
Zauberkräfte, bis sie ganz gewöhnliche Raben wurden, genau wie jene Vögel,
die wir noch heute in der Tundra sehen. --
Der Ursprung von Land und Menschen
Ursprünglich war Wasser über der ganzen Erde und es war sehr kalt. Das
Wasser war vom Eis bedeckt und es gab keine Menschen. Dann zog sich das Eis
zusammen und bildete lange Risse und Buckeln. Zu dieser Zeit kam ein Mann
von der anderen Seite des großen Wassers, blieb bei den Eishügeln, nahe dem
Ort, wo jetzt Pikmiktalik liegt und nahm eine Wölfin zum Weib. Nach und
nach bekam er viele Kinder, die immer paarweise geboren wurden -- ein Bub
und ein Mädchen. Jedes dieser Paare sprach seine eigene Sprache, die
verschieden von der seiner Eltern und auch verschieden von jeder jener
Sprachen war, die seine Brüder und Schwestern sprachen. Sobald sie groß
genug waren, wurde jedes Paar in anderer Richtung ausgeschickt, und so
verstreute sich die Familie weit und nah von den Hügeln, die jetzt
schneebedeckte Berge waren. Als der Schnee schmolz, floß er die Hänge
herunter, Rinnen und Flußbette ausschürfend, und so entstand das Land mit
seinen Strömen.
Die Zwillinge bevölkerten die Erde mit ihren Kindern, und da jedes Paar mit
seinen Kindern eine von den anderen verschiedene Sprache sprach, wurden die
verschiedenen Sprachen über die Erde verteilt und blieben so bis zum
heutigen Tag.
Ursprung der Lebewesen
Vor langer Zeit, als das Wasser noch die Erde bedeckte, lebten die Menschen
von der Nahrung, die sie in Überfluß fanden. Nichts wußten sie zu jener
Zeit von Tieren am Land oder im Wasser. Schließlich ging aber das Wasser
zurück und aus den Seegräsern wurden Bäume, Büsche, Sträucher und Gras. Die
langen Seegräser wurden Bäume, die kleineren Arten Buschwerk und Gras. Das
Gras wurde auf allerlei Art durch das Walroß an die verschiedenen Orte
gebracht und erst später kamen die Bäume zum Vorschein.
Eine Frau, die ihren Mann verloren hatte, lebte bei Fremden. Als diese
ihren Wohnort verlegen wollten, entschlossen sie sich, nach einer
Landspitze in einiger Entfernung zu reisen. Die Frau, die von ihrer
Mildtätigkeit abhängig war, wurde ihnen zur Last und sie wollten sie los
werden. Sie schafften nun alle ihre Habe ins Familienboot und als sie
unterwegs waren, ergriffen sie die Frau und warfen sie über Bord. Die
strengte sich nun an, wieder ins Boot zu kommen und wie sie es ergriff,
schnitten die anderen ihr die Finger ab. Die fielen ins Wasser und
verwandelten sich in Seehunde, Walrosse, Walfische und Eisbären. Die Frau
verschrie in ihrer Verzweiflung deren Los, um sich für die an ihr begangene
Grausamkeit zu rächen. Der Daumen wurde ein Walroß, der Zeigefinger ein
Seehund und der Mittelfinger ein Eisbär. Wenn die ersten zwei dieser Tiere
einen Mann sehen, so suchen sie zu entfliehen, damit ihnen nicht geschehe
wie der Frau.
Der Eisbär lebt sowohl an Land, wie im Wasser, aber wenn er einen Mann
bemerkt, fällt ihn die Rachsucht an und er sucht ihn umzubringen, denn er
glaubt, daß jener die Frau, aus deren Finger er entstanden, verstümmelt
hat.
Sonne, Mond und Sterne
Als die Erde noch in Dunkel gehüllt war, wurde ein Mädchen allnächtlich von
jemandem, den sie nicht erkennen konnte, besucht. Sie bemühte sich
festzustellen, wer das gewesen sein könnte; dazu mischte sie Ruß und Tran
und bemalte damit ihre Brust. Darauf entdeckte sie zu ihrem Schreck, daß
ihr Bruder einen Rußkreis um seinen Mund hatte. Sie machte ihm Vorwürfe, er
leugnete aber alles ab. Vater und Mutter wurden aber sehr zornig und
schimpften so heftig, daß der Bruder in den Himmel rannte, um der Schwester
zu entkommen; die aber lief ihm nach. Der Bruder wurde in den Mond
verwandelt, das Mädchen aber, das sonst das Feuer bohrte, wurde die Sonne.
Die Funken, die vom Feuer stoben, wurden die Sterne. Die Sonne verfolgt
immer den Mond, der sich im Dunkeln hält, um nicht entdeckt zu werden. Bei
einer gegenseitigen Verfinsterung haben sie sich scheinbar getroffen.
Sonne und Mond
In einem Dorf lebte eine Frau ganz allein in einer Hütte. Eines Abends, als
die Leute im Tanzhaus versammelt waren, ging ein Mann zu der Frau und
löschte ihre Lampen aus. Nachher kam er jede Nacht, zur Zeit als die Leute
im Tanzhaus waren. Die Frau wollte erfahren, wer er sei. Sie fragte ihn
oft, aber er nannte seinen Namen nicht, noch gab er einen Laut von sich. Da
sie ihn nicht zum Sprechen bringen konnte, nahm sie zu einer List ihre
Zuflucht. Eines Tages, nachdem er gekommen war, rieb sie ihre Finger auf
dem Boden einer ihrer Töpfe und dann über die linke Seite seines Gesichts.
Nach einer Weile verließ er sie. Sie folgte ihm gleich und als sie aus dem
Hause kam, hörte sie ein großes Gelächter im Tanzhaus. Sie ging hinein und
sah dort, daß die Leute über ihren eigenen Bruder lachten, der die Spuren
ihrer Finger in seiner linken Gesichtshälfte trug. Da nahm sie ein Messer,
schnitt ihre linke Brust ab und bot sie ihm an mit den Worten: »Iß das!«.
Sie hob ein Stück Holz auf, wie man es braucht, um Lampen zu putzen und
zündete es an. Er nahm auch einen Kienspan in seine Linke und folgte ihr.
Sie ging aus dem Haus, und lief, von ihrem Bruder verfolgt, darum herum.
Schließlich fiel letzterer. Die Flamme seines Spans ging aus, während ihrer
hell weiter brannte. Sie wurde in den Himmel erhoben und in die Sonne
verwandelt. Er wurde der Mond. --
Der Mond, die Sonne und der Böse
In einem Küstenort lebte einst ein Mann mit seiner Frau. Sie hatten zwei
Kinder, einen Knaben und ein Mädchen. Als diese Kinder so groß waren, daß
der Knabe schon die Strandblöcke umwälzen konnte, verliebte er sich in
seine Schwester. Die Schwester schwamm schließlich, um den Knaben, der sie
immer belästigte, los zu werden, weg bis in den Himmel und wurde der Mond.
Der Knabe, der sie immer verfolgte, wurde die Sonne und manchmal umarmt und
verdeckt er sie und verursacht so eine Mondfinsternis.
Nachdem seine Kinder nun weg waren, wurde der Vater sehr traurig und haßte
sein Geschlecht; er ging herum, Krankheit und Tod unter den Menschen
verbreitend. Die Opfer der Krankheiten wurden seine Nahrung und davon wurde
er so böse, daß er, wenn sein Verlangen auf diese Weise nicht mehr gestillt
wurde, auch Leute tötete und verzehrte, die ganz gesund waren.
Aus Furcht vor ihm trugen die Menschen ihre Toten vor das Dorf hinaus,
damit er sich ernähren möge, ohne die Lebenden zu belästigen. Sooft einer
dorthin kam, waren die Leichen über Nacht verschwunden. Schließlich wurde
er so gräßlich, daß die mächtigsten Zauberer zusammenkamen, ihn mit Hilfe
ihrer Zauberkräfte fesselten, ihm Hände und Füße zusammenbanden, so daß er
keinen weiteren Unfug stiften konnte. Und obwohl er gefesselt war und sich
nicht bewegen konnte, hatte er doch noch immer die Kraft Krankheit zu
verbreiten und die Menschen unglücklich zu machen.
Um böse Geister am Wandern zu hindern und daran, aus böser Absicht sich
toter Körper zu bemächtigen und sie so scheinbar zu beseelen und eingedenk
der Fesselung dieses einen Bösen, werden seither die Toten nicht mehr
ausgestreckt, sondern mit Hand und Fuß, in der gleichen Stellung wie der
Böse, gefesselt und so in die Grabkästen gelegt.
Das Sternbild Udlegdjun
Drei Männer gingen mit einem Schlitten auf die Bärenjagd und nahmen einen
kleinen Jungen mit. Als sie an den Rand der See kamen, sahen sie einen
Bären und wandten sich zur Verfolgung. Obwohl die Hunde sehr schnell
liefen, konnten sie ihm doch nicht näher kommen und plötzlich bemerkten
sie, daß der Bär sich in die Luft hob und ihr Schlitten ihm folgte. In
diesem Augenblick verlor der Knabe einen seiner Fäustlinge, und wie er ihn
aufheben wollte, fiel er vom Schlitten. Da sah er die Männer höher und
immer höher steigen, und schließlich wurden sie in Sterne verwandelt. Der
Bär wurde der Stern Nanugdjung (Beteigeuze), die Verfolger die Sterne
Udlegdjun (der Gürtel des Orion) und der Schlitten die Sterne Kamutigdjung
(das Schwert des Orion). Bis zum heutigen Tag verfolgen die Männer noch den
Bären. Der Knabe ist jedenfalls ins Dorf zurückgekehrt und hat erzählt, wie
die Männer verloren gegangen sind.
Herkunft der Inuit
Ein Mann wurde geschaffen aus nichts. Im Sommer wanderte er, bis er in
einem anderen Land ein Weib fand. Die beiden wurden Mann und Frau, und von
ihnen stammt all das Volk, das hier wohnt, ab.
Die Abstammung der Indianer und Europäer
Savirgong, ein alter Mann, lebte allein mit seiner Tochter. Sie hieß
Niviarsiang (das Mädchen), aber weil sie keinen Mann nehmen wollte, wurde
sie auch Uinigumisuitung (die keinen Mann nehmen will) genannt. Alle ihre
Liebhaber wies sie ab, aber zuletzt gewann doch ein weiß und rot gefleckter
Hund, der Jjirgang gerufen wurde, ihre Neigung und sie nahm ihn zum Gemahl.
Sie hatten zehn Kinder; fünf davon waren Adlets (Indianer) und fünf waren
Hunde. Der untere Teil des Körpers der Adlets war der eines Hundes und mit
Ausnahme der Sohlen ganz behaart; der Oberkörper glich aber dem eines
Mannes. Als die Kinder heranwuchsen, wurden sie sehr gefräßig, und da der
Hund Jjirgang überhaupt nicht ausging zu jagen, sondern seinen
Schwiegervater für die ganze Familie sorgen ließ, wurde es für Savirgong
schwierig alle zu füttern. Überdies waren die Kinder sehr unruhig und
lärmend, so daß der Großvater ihrer schließlich überdrüssig wurde und die
ganze Familie in ein Boot steckte und auf eine Insel führte. Dem Hund
Jjirgang trug er auf, jeden Tag die Nahrung holen zu kommen.
Niviarsiang hing ihm ein Paar Stiefel über den Nacken, und er schwamm dann
über den schmalen Kanal. Aber Savirgong füllte, statt ihm Essen zu geben,
die Stiefel mit schweren Steinen, die Jjirgang ertränkten, als er versuchte
zurückzukehren.
Die Tochter sann auf Rache für den Tod ihres Mannes. Sie schickte die
jungen Hunde zur Hütte ihres Vaters und hieß sie seine Füße und Hände
annagen. Dafür warf wieder Savirgong Niviarsiang, als sie einmal zufällig
in seinem Boot war, über Bord und schnitt ihr, als sie sich an den Planken
hielt, die Finger ab; wie die ins Wasser fielen, wurden sie in Seehunde und
Wale verwandelt. Schließlich erlaubte er ihr aber doch ins Boot zu steigen.
Da sie befürchtete, ihr Vater werde ihre Kinder töten, oder verstümmeln,
schickte sie die Adlet ins Binnenland, wo sie dann die Vorfahren eines
zahlreichen Volkes wurden. Für die jungen Hunde machte sie ein Boot,
steckte zwei Stangen als Maste in die Sohlen ihrer Schuhe und schickte sie
über den Ozean. Sie sang dazu: »Angnaija, wenn ihr drüben über dem Ozean
ankommt, werdet ihr viele Dinge machen, die euch Freude bereiten,
Angnaija!« Sie erreichten das Land jenseits der See und wurden die Ahnen
der Europäer.
Sednamythe
Auf einer Insel lebte einst ein Eskimo mit seiner Tochter Sedna. Seine Frau
war schon vor geraumer Zeit gestorben und die beiden führten ein
beschauliches Leben. Sedna wuchs zu einem hübschen Mädchen heran und von
überall her kamen Freier, die um ihre Hand anhielten, keiner aber konnte
ihr stolzes Herz rühren. Als dann im Frühling das Eis aufbrach, kam ein
Eissturmvogel übers Eis geflogen und freite um Sedna, indem er sang: »Komm
zu mir! Komm ins Land der Vögel, wo nie Hungersnot herrscht, wo mein Zelt
aus den allerschönsten Fellen errichtet ist. Auf weichen Bärenfellen wirst
du ruhen, was dein Herz nur begehren mag, werden meine Gefährten, die
Eissturmvögel, herbeibringen; ihre Väter werden dich kleiden, deine Lampe
wird immer mit Fett gefüllt sein, deine Schüsseln immer mit Speisen!«
Solchem Werben konnte Sedna nicht lange widerstehen und sie zogen zusammen
über das weite Meer.
Als sie schließlich nach langer, beschwerlicher Reise ins Land der
Eissturmvögel kamen, entdeckte Sedna bald, daß ihre Hoffnungen schmerzlich
getäuscht worden. Ihr neues Heim war nicht aus schönen Fellen, sondern mit
erbärmlichen Fischhäuten, voll von Löchern, die Wind und Schnee freien
Eintritt ließen, gedeckt. Statt aus weichen Fellen, bestand ihr Lager aus
harter Walroßhaut, und sie mußte von schlechten Fischen, die ihr die Vögel
brachten, leben. Zu bald nur erkannte sie, daß sie mit ihren Eskimofreiern
ihr Glück abgewiesen hatte. In ihrem Kummer sang sie: »Aja! O Vater, wenn
du wüßtest, wie unglücklich ich bin, würdest du in deinem Boot übers Wasser
herbeieilen. Unfreundlich sehen die Vögel auf mich, die Fremde, herab;
kalte Winde rütteln an meinem Bett; nur schlechte Nahrung gibt man mir. O
komm und nimm mich in die Heimat zurück, Aja!«
Nachdem ein Jahr verstrichen war und die warmen Winde wieder das Meer
bewegten, verließ der Vater seine Heimat, um Sedna zu besuchen. Voll Freude
begrüßte ihn seine Tochter und beschwor ihn, sie doch wieder nach Hause zu
nehmen. Als der Vater von der Schmach, die seiner Tochter angetan worden
war, hörte, sann er auf Rache. Er tötete den Eissturmvogel, nahm Sedna in
sein Boot und sie verließen rasch das Land, das Sedna so viel schmerzliche
Enttäuschung gebracht hatte. Als die anderen Eissturmvögel zurückkamen und
ihren Genossen tot fanden und sahen, daß sein Weib entflohen war, flogen
sie alle auf, um die Flüchtige zu suchen. Aus Trauer über den Tod ihres
armen ermordeten Kameraden, klagten und schrien sie den ganzen Tag.
Nachdem sie eine kurze Strecke geflogen waren, entdeckten sie das Boot und
beschworen einen schweren Sturm herauf. Die See erhob sich zu gewaltigen
Wogen und Untergang drohte den beiden. In dieser Todesgefahr beschloß der
Vater Sedna den Vögeln zu opfern und warf sie über Bord. Mit schwachem
Griff klammerte sie sich an den Bootsrand an. Da nahm der grausame Vater
ein Messer und schnitt ihr die Fingerspitzen ab; als die ins Meer fielen,
verwandelten sie sich in Wale, und die Fingernägel wurden die Knochen der
Wale. Da hielt sich Sedna noch fester am Boot an und auch die zweiten
Fingerglieder fielen unter dem scharfen Messer und schwammen als Seehunde
weg, und als der Vater die letzten Fingerstümpfe abschnitt, wurden Robben
daraus. Inzwischen hatte sich der Sturm gelegt, denn die Eissturmvögel
glaubten, Sedna wäre ertrunken. Jetzt erlaubte der Vater ihr wieder ins
Boot zu kommen. Von dieser Zeit an hegte sie einen tödlichen Haß gegen ihn
und schwor bittere Rache.
Nachdem sie gelandet, rief sie ihre Hunde und ließ sie des Vaters Füße und
Hände, als er schlief, abfressen. Da verfolgte er sie selbst und ihre
Hunde, die ihn verstümmelt hatten, worauf sich die Erde auftat und die
Hütte, den Vater, die Tochter und die Hunde verschlang. Seither lebt Sedna
im Lande Adlivun als dessen Beherrscherin.
Das Land des Todes
In einem Dorf am unteren Yukon lebte eine junge Frau; sie wurde krank und
starb. Als der Tod über sie kam, verlor sie für einige Zeit das Bewußtsein.
Dann schüttelte sie jemand, daß sie erwachte und sprach zu ihr: »Steh auf,
schlafe nicht; du bist tot!« Sie schlug die Augen auf, bemerkte, daß sie in
einem Grabkasten lag und der Schatten ihres verstorbenen Großvaters neben
ihr stand. Er streckte die Hand aus, um ihr zu helfen, sich aus dem Grab zu
erheben und gebot ihr, sich umzusehen. Sie tat so und sah viel Leute, die
sie alle erkannte, sich im Dorf herumtreiben. Dann drehte sie der alte Mann
herum, mit dem Rücken gegen das Dorf und sie sah, daß die ihr so
wohlbekannte Gegend verschwunden war; an ihrer Stelle lag ein unbekanntes
Dorf da, das sich so weit, als ihr Blick nur reichte, erstreckte. Sie
gingen in dieses Dorf und der alte Mann hieß sie in eines der Häuser
eintreten. Als sie eintrat, hob eine alte Frau, die da saß, ein Holzscheit,
um sie zu schlagen und fragte ärgerlich: »Was willst du hier?« Schreiend
lief sie hinaus und erzählte dem alten Mann von der Frau. Er erzählte:
»Dies hier ist das Dorf der Hundeschatten und du hast nun gesehen, wie es
den lebenden Hunden zumute ist, wenn sie von den Leuten geprügelt werden.«
Sie gingen von da weiter und kamen an ein anderes Dorf, in dem ein großes
Haus stand. Ganz in der Nähe dieses Dorfes sahen sie einen Mann am Boden
liegen; aus allen seinen Gelenken wuchs Gras hervor und er konnte sich zwar
bewegen, aber nicht aufstehen. Der Großvater erzählte, dieser Mann sei so
bestraft worden, weil er Gras ausgerissen und Grasstengel gekaut hatte, als
er noch auf Erden war. Nachdem sie einige Zeitlang diesen Schatten
neugierig betrachtet hatte, wandte sie sich, um etwas zu sagen, nach ihrem
Großvater. Er war aber verschwunden. Vor ihr lag ein Weg, der zu einem
weiter entfernten Dorf führte. Sie folgte ihm und kam bald an einen
reißenden Fluß, der ihren Weg versperrte. Dieser Fluß waren die Tränen der
Leute, welche auf Erden die Toten beweinen. Als das Mädchen sah, daß sie
nicht hinüber konnte, setzte sie sich ans Ufer und begann zu weinen. Wie
sie ihre Augen trocknete, sah sie eine Menge Kehricht und Abfall, wie er
aus den Häusern geworfen wird, den Fluß herabschwimmen und sich gerade vor
ihr zusammenstauen. Wie auf einer Brücke überschritt sie darauf den Fluß.
Kaum war sie am anderen Ufer, da verschwand das Zeug und sie ging ihren Weg
weiter. Bevor sie noch das Dorf erreichte, hatten die Schatten sie bemerkt
und riefen: »Es ist jemand angekommen.« Als sie hin kam, umdrängten sie die
Schatten und fragten: »Wer ist sie? Von wo kommt sie?« Sie besahen ihre
Kleider und fanden die Totemzeichen, die ihre Stammeszugehörigkeit
anzeigten; in alten Zeiten hatten nämlich die Leute ihre Totemzeichen an
ihren Kleidern und anderen Gegenständen, so daß man daran die Mitglieder
eines jeden Dorfes und jeder Familie erkennen konnte.
Da rief jemand: »Wo ist sie, wo ist sie denn?« und sie sah den Schatten
ihres Großvaters auf sich zukommen. Er nahm sie bei der Hand und führte sie
in der Nähe in ein Haus. An der Rückwand saß eine alte Frau, die etwas
murmelte und dann sagte: »Komm und setze dich zu mir!« Es war ihre
Großmutter und sie fragte das Mädchen, ob es nicht etwas trinken wolle und
fing gleichzeitig an zu weinen. Das Mädchen wurde ganz traurig, sah sich um
und bemerkte einige ganz merkwürdige Wassereimer, von denen nur ein
einziger, der fast leer war, so wie die in ihrem Dorf aussah.
Die Großmutter riet ihr, nur aus diesem zu trinken, denn darin sei ihr
gewohntes Yukonwasser, während die anderen alle mit dem Wasser des
Totendorfes gefüllt seien. Als sie dann hungrig wurde, gab ihr die
Großmutter ein Stück Renntierfleisch, das ihr Sohn, der Vater des Mädchens,
ihr einst bei einem Totenfest zugleich mit dem Wassereimer, aus dem sie
eben getrunken habe, gegeben.
Die Großmutter erzählte dem Mädchen noch, daß ihr Großvater ihr Führer
geworden sei, weil sie im Sterben an ihn gedacht hatte. Wenn ein Sterbender
nämlich an seine verstorbenen Verwandten denkt, vernimmt man das im
Schattenreich und derjenige, dessen der Sterbende gedenkt, beeilt sich, dem
neuen Schatten den Weg zu weisen.
Als für das Heimatdorf des toten Mädchens die Zeit des Totenfestes kam,
wurden, wie gewöhnlich, zwei Boten ausgesandt, um die Bewohner der
Nachbardörfer einzuladen. Nach einem der Dörfer gingen die Boten lange
Zeit, und bevor sie es noch erreichten, überraschte sie die Dunkelheit;
endlich hörten sie aber vom Festhaus her Tanzlärm und Trommelschlag. Sie
traten ein und überbrachten den Leuten ihre Einladung zum Totenfest.
Hier saßen die Schatten des Großvaters und der Großmutter und zwischen
ihnen der des Mädchens unsichtbar bei den Leuten und als am nächsten Tag
die Boten in ihr Heimatdorf zurückkehrten, folgten ihnen, immer unsichtbar,
die Schatten. Als da das Fest schon fast zu Ende war, wurde der Mutter des
toten Mädchens Wasser gereicht und sie trank davon. Dann gingen die
Schatten aus dem Festhaus, um zu warten, bis bei der Zeremonie, bei welcher
die Namensvetter der Toten ihre Kleider annehmen, ihre Namen aufgerufen
würden.
Wie die Schatten dazu also aus dem Haus gingen, gab der alte Mann dem
Mädchen im Eingang einen Stoß, sodaß sie umfiel und ihr Bewußtsein verlor.
Als sie wieder erwachte, sah sie sich um und fand sich allein. Sie erhob
sich, stellte sich im Eingang unter die Lampe und wartete auf die anderen
beiden Schatten, um sich ihnen anzuschließen. Sie wartete da, bis alle
Lebenden in den schönen neuen Kleidern herauskamen, aber von ihren
Schattengefährten sah sie keinen.
Bald darauf kam ein alter Mann mit einem Stock hereingehumpelt, und als er
aufsah, bemerkte er den Schatten, dessen Füße mehr als eine Spanne hoch
über dem Boden schwebten. Er fragte, ob das eine Lebende oder ein Schatten
sei, bekam aber keine Antwort und ging rasch ins Haus hinein. Hier sagte er
den Männern, sie sollten rasch hinauslaufen und das fremde Wesen im
Eingang, dessen Füße den Boden nicht berühren, und das nicht aus dem Dorf
sei, ansehen. Alle liefen hinaus und als sie sie sahen, stellten einige
ihre Lampen nieder und in ihrem Schein wurde sie erkannt und lief nun ins
Haus ihrer Eltern.
Wie man sie da eintreten sah, glich sie in Gestalt und Farbe völlig einer
Lebenden, aber sowie sie sich niedersetzte, erblaßte ihre Farbe und sie
schwand dahin, bis sie nichts war als Haut und Knochen und zu schwach war,
um sprechen zu können.
Frühmorgens des nächsten Tages starb ihre Namensvetterin, eine Frau aus
demselben Dorf und ihr Schatten ging anstelle des Mädchens, welches wieder
zu Kräften kam und noch viele Jahre lebte, ins Land des Todes.
Die Entstehung der Winde
In einem Dorf am unteren Yukon lebte ein Mann mit seiner Frau; sie hatten
aber keine Kinder. Nach langer Zeit sprach eines Tages die Frau zu ihrem
Mann: »Ich kann nicht verstehen, wieso wir keine Kinder haben. Kannst du
es?« Darauf antwortete der Mann, er könne es nicht verstehen. Sie bat dann
ihren Mann in die Tundra zu gehen und ein Stück vom Stamm eines einsamen
Baumes, der dort stehe, zu bringen und daraus eine Puppe zu machen. Der
Mann ging aus dem Haus und sah einen langen Lichtstreifen, wie Mondschein
am Schnee, über die Tundra in der Richtung, die er einschlagen mußte,
scheinen. Diesem Lichtschein folgend wanderte er lange, bis er vor sich in
hellem Licht einen glänzenden Gegenstand sah. Als er auf ihn zuging,
bemerkte er, daß es der Baum war, nach dem er ausgegangen war. Da der Baum
dünn war, nahm er sein Jagdmesser, schnitt ein Stück seines Stammes ab und
brachte es nach Hause.
Nachhause gekommen, setzte er sich nieder und schnitzte aus dem Holz einen
kleinen Knaben; seine Frau machte für ihn Pelzkleider und kleidete damit
die Puppe an. Auf Geheiß seiner Frau schnitzte der Mann dann noch eine
Anzahl ganz kleiner Schüsseln aus dem Holz, sagte aber, er könne in all dem
keinen Nutzen sehen, denn es werde sie nicht glücklicher machen, als sie es
früher gewesen. Darauf erwiderte die Frau, daß die Puppe sie zerstreuen
und ihnen Gesprächsstoff geben werde, wenn sie einmal von nichts anderem,
als sich selbst, zu reden wüßten. Dann setzte sie die Puppe auf den
Ehrenplatz, gegenüber dem Eingang und stellte die Spielzeugschüsseln voll
Essen davor.
Als das Paar diese Nacht zu Bett gegangen und es im Raum ganz finster war,
hörten sie verschiedene leise pfeifende Laute. Die Frau rüttelte ihren Mann
auf und sagte: »Hörst du das? Das war die Puppe!« und er stimmte dem bei.
Sie standen sofort auf, machten Licht und sahen, daß die Puppe die Speisen
gegessen und das Wasser getrunken hatte und konnten noch bemerken, daß sie
die Augen bewegte. Die Frau nahm sie zärtlich auf, liebkoste sie und
spielte lange Zeit mit ihr. Als sie dessen überdrüssig wurde, setzte sie
sie wieder zurück auf die Bank und sie gingen wieder zu Bett.
Wie das Paar am Morgen erwachte, bemerkten sie, daß die Puppe weg war. Sie
suchten sie im ganzen Haus, konnten aber keine Spur von ihr finden, und als
sie hinausgingen, sahen sie Spuren, die von der Tür wegführten. Von der Tür
gingen diese Spuren den Strand einer kleinen Bucht entlang, bis etwas
außerhalb des Dorfes, wo sie aufhörten, da die Puppe von dieser Stelle aus
dem Lichtschein entlang gegangen war, dem der Mann gefolgt war, um den Baum
zu finden.
Der Mann und die Frau verfolgten die Puppe nicht weiter, sondern gingen
nach Hause. Die Puppe war den glänzenden Pfad entlanggegangen, bis dorthin,
wo der Himmel zur Erde herabreicht und das Licht einschließt. Hart an der
Stelle, wo sie war -- im Osten -- sah sie eine Öffnung in der Himmelswand,
dicht verschlossen mit einer Haut, die, augenscheinlich infolge irgend
einer starken Kraft, von der anderen Seite her, hervorgewölbt war. Die
Puppe blieb stehen und sagte: »Es ist hier sehr ruhig. Ich glaube, ein
kleiner Wind wird gut sein.« Darauf zog sie ein Messer und schnitt den
Verschluß der Öffnung auf und ein starker Wind blies durch, allerlei mit
sich führend, unter anderem auch ein lebendes Renntier. Als die Puppe durch
das Loch sah, erblickte sie dahinter eine andere Welt, genau so wie die
Erde. Sie zog dann den Deckel wieder über die Öffnung und bat den Wind,
nicht zu stark zu blasen und sagte ihm: »Manchmal blase stark, manchmal
schwach und manchmal gar nicht.«
Dann wanderte sie den Himmelsrand entlang, bis sie im Südosten zu einer
anderen Öffnung kam, die auch verschlossen war und deren Deckel ausgebaucht
war, wie bei der ersten. Als sie diesen Verschluß löste, strich ein starker
Wind herein, der Renntiere und Sträucher und Bäume hereinwirbelte. Sie
schloß dann die Öffnung wieder und bat den Wind so zu tun, wie sie dem
ersten gesagt, und ging weiter. Bald kam sie zu einer Öffnung im Süden. Als
da der Verschluß geöffnet war, strich ein warmer Wind herein, der Regen
und Spritzwasser vom Meer, das auf dieser Seite hinter dem Himmel liegt,
hereinführte.
Die Puppe schloß diese Öffnung und trug ihr auf wie früher und ging weiter
nach Westen. Dort war wieder eine Öffnung, durch die, sobald sie geöffnet
war, der Wind einen starken Regensturm und Gischt vom Meer hereinpeitschte.
Auch diese Öffnung wurde mit den gleichen Anweisungen geschlossen und die
Puppe ging weiter nach Nordwesten, wo sie eine andere Öffnung fand. Als der
Verschluß von dieser aufgeschnitten war, kam ein kalter Windstoß, der
Schnee und Eis mit sich führte, herein, so daß die Puppe bis aufs Bein
erstarrt und halberfroren sich beeilte, auch diese Öffnung, wie die
anderen, zu schließen.
Weiter ging sie am Himmelsrand entlang nach Norden. Die Kälte wurde so arg,
daß sie ihn verlassen und einen Umweg machen mußte, um erst wieder dort, wo
sie die Öffnung sah, zu ihm zurückzugehen. Dort war die Kälte so streng,
daß sie einige Zeit zögerte, aber schließlich doch auch diesen Verschluß
aufschnitt. Sofort blies ein fürchterlicher, große Schnee-und Eismassen mit
sich führender Sturm herein und wehte diese über die Erdoberfläche hin. Die
Puppe schloß sehr bald die Öffnung, und nachdem sie den Wind wie früher
ermahnt hatte, wanderte sie weiter bis zum Mittelpunkt der Erdoberfläche.
Dort angekommen, sah sie auf und der Himmel wölbte sich oben, gestützt von
langen, schlanken Stützen, die, wie die eines kegelförmigen Zeltes
angeordnet, aber aus einem unbekannten schönen Material gemacht waren. Die
Puppe wandte sich dann wieder von hier weg und wanderte weit, bis sie das
Dorf erreichte, von dem sie ausgegangen. Dort ging sie zuerst um den ganzen
Ort herum und dann in ein Haus nach dem anderen, zuletzt in ihr eigenes.
Das tat sie, damit die Leute ihre Freunde werden sollten, und für den Fall,
daß ihre Eltern stürben, für sie sorgten.
Dann lebte die Puppe lange Zeit in dem Ort. Nachdem ihre Pflegeeltern
gestorben waren, wurde sie von anderen Leuten aufgenommen und lebte so
durch viele Generationen, bis sie schließlich selbst starb. Von ihr lernten
die Leute den Gebrauch von Kleidermasken, und seit ihrem Tod haben die
Eltern die Gewohnheit, ihren Kindern Puppen zu machen, nach dem Vorbild der
Leute, die diese, von der ich erzählt habe, angefertigt hatten.
Von Einem, der nichts finden konnte
Es war einmal ein kleiner häßlicher junger Mann, der niemals das finden
konnte, was er ausfindig machen wollte. Sooft er mit einem Schlitten nach
Holz ging, kam er ohne solches zurück, denn es gelang ihm nie, etwas zu
finden, nicht das kleinste Stückchen. Dann ging er in sein Haus und setzte
sich auf seinen Platz beim Eingang, und wenn er da saß, blieb er lange Zeit
ruhig. Sein Nebenmann gab ihm manchmal Wasser zu trinken und dann wurde er
wieder ganz still.
Wenn man ihn drängte auszufahren, setzte er sein Boot aus und fuhr fort,
kam aber sehr bald wieder zurück und saß dann wie früher da. Als er einmal
durstig war, ging er hinaus, um Wasser zu holen, aber wie er zu dem Platz
kam, konnte er das Wasser nicht finden, es schien einfach verschwunden.
Dann ging er, ohne getrunken zu haben, zurück ins Haus und setzte sich auf
seinen Platz und sein Nachbar gab ihm Wasser.
Eines Nachts konnte er vor Durst nicht schlafen und ging hinaus, um das
Haus seines Bruders zu suchen. Nach langem Suchen konnte er aber die Stelle
nicht finden; so kehrte er zurück und legte sich nieder. Als er am Morgen
erwachte, nahm er einiges Fischgerät und ging fischen. Wie er ans Wasser
kam, konnte er es aber nicht finden und nachdem er vergebens nach ihm
ausgesehen hatte, kehrte er, ohne gefischt zu haben, zurück. So kam er
jedesmal ohne irgend etwas heim und war hungrig, wenn er, wie gewöhnlich,
auf seinem Platz saß.
Dann dachte er: »Wenn ich jetzt Beeren klauben gehe, bin ich sicherlich
nicht imstand, welche zu finden.« Er nahm einen Holzkübel und ging um
Beeren. Nachdem er gesucht hatte, es aber nicht gelungen war, irgendwelche
zu finden, kehrte er auf seinen Platz im Haus zurück. Den nächsten Morgen
war er hungrig, nahm seine Pfeile und ging auf die Jagd nach Wildgänsen. Da
er keine fand, und sonst nichts sah, kehrte er wieder zurück. Andere Leute
brachten Seehunde, die sie erlegt hatten. Der Nichtsfinder nahm ein Kajak,
setzte ihn ins Wasser und fuhr hinaus, Seehunde zu jagen. Er jagte lange
nach Seehunden, aber es schien, als wären keine da. Und da er nichts sah,
kehrte er wieder heim auf seinen Platz.
Der Winter kam und er dachte: »Ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen
soll.« Am nächsten Tag nahm er sein elendes Bett, rollte es mit seinem
schäbigen Gerätesack zusammen, nahm das Bündel auf den Rücken und ging
landeinwärts aus dem Dorf, über die Häuser hinaus und setzte sich nieder.
Sitzend nahm er sein Bündel vom Rücken, öffnete es und band den Gerätesack
auf. Nachdem das getan war, verstreute er die Geräte um sich und warf den
Sack weg. Dann breitete er sein Bett aus, setzte sich darauf, legte sich
zurück und sagte: »Hier will ich sterben.«
Nächte lag er hier, ohne sich zu rühren. Als die Sonne hoch kam, hörte er
zuerst einen Raben krächzen und dann dessen Genossen. Er blieb still und
der Rabe ließ sich mit seiner Schar nahe bei ihm herab. Der ihm nächste
Rabe sprach: »Schaut! Hier ist etwas zu essen. Wir haben noch nichts
gefressen und warten lieber nicht; machen wir uns über seine Augen her.«
Der entfernteste antwortete: »Nein, er ist nicht tot.« »Wieso liegt er dann
da, als ob er tot wäre?« sagte der erste Rabe. »Nein, er ist nicht tot,
schau, es ist keine Asche vom Leichenfeuer bei ihm«, erwiderte der zweite.
Da wurde der erste Rabe wütend, blies sich auf und sagte: »Warum ist er
dann vertrieben? Schau, seine Sachen sind um ihn verstreut.« »Ich will
nichts davon«, antwortete die ganze Rotte, »es ist keine Asche bei ihm, wir
lassen dich da«, und flog weg. »Gut, du kannst weg fliegen«, sagte der
erste Rabe, »aber ich will seine Augen haben.«
Da öffnete der Mann seine Augen etwas und blickte seitwärts nach dem Raben.
Dieser kam näher an den kleinen häßlichen jungen Mann und stand da und
hatte in seinem Schnabel ein gutes, scharfes Messer. Er kam näher, und
zwischen seinen Augenwimpern hindurch sah der Mann, am Griff gehalten, das
scharfe Messer. Er dachte: »Ich hatte doch kein Messer.« Dann kam die
Spitze hart an ihn. Er dachte wieder: »Ich hatte kein Messer.« Da erfaßte
er es plötzlich und zog es dem Raben weg.
Der Rabe sprang zurück und der Mann setzte sich auf. »Gib mir das Messer«,
sagte der Rabe. Der Mann antwortete: »Ich habe kein Messer und das soll
jetzt mein Messer sein.« Der Rabe erwiderte: »Ich will dich dafür mit
allerlei Wildpret bezahlen.«
»Nein«, sagte der Mann, »ich will es nicht zurückgeben, ich gehe immer
jagen und kann nichts finden.« »Dann«, erwiderte der Rabe, »sollst du, wenn
du zum Dorf zurück willst, es nicht erreichen, wenn du's auch versuchst.«
»Ich hatte kein Messer«, antwortete der Mann. Da hüstelte der Rabe und
sagte: »Du willst es also so, behalte mein Messer, wenn du es so schätzt«,
und flog davon.
Der Mann setzte sich auf und hielt noch immer das Messer. Dann brach er
auf, um ins Dorf zurückzukehren. Wie er ging, schnürte sich seine Kehle
zusammen, sein Rücken krümmte sich und er stützte seine Hände auf die Knie.
Plötzlich war er ein alter Mann geworden und konnte nicht gehen. Er fiel
aufs Gesicht. Er konnte nicht aufstehen. Er war tot.
Wie der Rabe das Licht brachte
In den ersten Tagen spendeten, wie jetzt, Sonne und Mond das Licht. Dann
aber wurden Sonne und Mond weggenommen und die Menschen blieben auf Erden
lange Zeit ohne jedes andere Licht, als den Schimmer der Sterne. Ohne jeden
Erfolg machten die Zauberer ihre größten Kunststücke, die Finsternis hielt
an.
In einem Dorf am unteren Yukon lebte ein Waisenknabe, der immer mit den
Dienstleuten auf der Bank beim Hauseingang saß. Die anderen Leute hielten
ihn für närrisch und jedermann verachtete und mißhandelte ihn. Nachdem sich
die Zauberer furchtbar, aber ohne Erfolg, angestrengt hatten, Sonne und
Mond zurückzuschaffen, verspottete sie der Knabe und sagte: »Was für feine
Zauberer müßt ihr doch sein, da ihr nicht einmal imstande seid, das Licht
wieder herbeizuschaffen, wenn sogar ich das tun kann.«
Darauf wurden die Zauberer sehr ärgerlich, prügelten ihn und warfen ihn aus
dem Haus heraus. Dieser arme Waisenknabe war nun wie jeder andere Knabe,
aber wenn er ein schwarzes Kleid, das er hatte, anzog, wurde er in einen
Raben verwandelt und blieb ein solcher, bis er das Kleid wieder auszog.
Nachdem die Zauberer den Knaben aus dem Haus geworfen hatten, ging er im
selben Dorf ins Haus seiner Tante und erzählte ihr, was er ihnen gesagt und
wie sie ihn geschlagen und hinausgeworfen. Dann bat er sie, ihm doch zu
sagen, wo die Sonne und der Mond hingekommen seien, denn er wolle ihnen
nachgehen.
Sie behauptete, nicht zu wissen, wo sie versteckt wären, aber der Knabe
sagte: »Nach deinem feingenähten Kleid zu schließen, weißt du sicher, wo
sie sind, denn du hättest nie genug sehen können, es so zu nähen, wenn du
nicht wußtest, wo das Licht ist.« Nach langem überredete er endlich seine
Tante und sie sagte ihm: »Gut, wenn du das Licht finden willst, mußt du
deine Schneeschuhe nehmen und weit nach Süden gehen zu einem Platz, den du
schon erkennen wirst, wenn du dort bist.«
Der Rabenknabe nahm sofort seine Schneeschuhe und brach nach Süden auf.
Viele Tage wanderte er und die Finsternis blieb immer gleich. Nachdem er
schon einen weiten Weg zurückgelegt hatte, sah er weit vor sich einen
Lichtblitz, was ihn sehr ermutigte. Als er weitereilte, leuchtete das Licht
wieder heller auf als vorher, und dann verschwand und erschien es
abwechselnd. Schließlich kam er an einen großen Hügel, dessen eine Seite in
vollem Licht stand, während die andere in finstere Nacht getaucht schien.
Vor sich, hart am Hügel, bemerkte der Knabe eine Hütte und in ihrer Nähe
einen Mann, der von ihrer Vorderseite Schnee wegschaufelte.
Der Mann warf den Schnee hoch in die Luft und so oft er das tat,
verdunkelte sich das Licht, so entstand der Wechsel von Licht und
Dunkelheit, den der Knabe beim Herannahen gesehen hatte. Dicht hinter dem
Haus sah er das Licht, das zu suchen er ausgegangen war, wie einen großen
Feuerball. Dann blieb der Knabe stehen und überlegte, wie er das Licht und
des Mannes Schaufel erlangen könnte.
Nach einiger Zeit ging er dann zu dem Mann hin und sagte: »Warum wirfst du
den Schnee in die Luft und entziehst unserem Dorf das Licht?« Der Mann
hielt inne, sah auf und sagte: »Ich räume nur den Schnee vor meiner Türe
weg und ich entziehe kein Licht. Aber wer bist du und von wo kommst du?«
»Es ist so finster in unserem Dorf, daß ich dort nicht leben will, und so
bin ich gekommen, um bei dir zu bleiben«, sagte der Knabe. »Was? Für
immer?« fragte der Mann. »Ja!« antwortete der Knabe. Darauf der Mann: »Also
gut; komme mit mir ins Haus.« Und er steckte die Schaufel in den Boden und
gebückt ging er durch den unterirdischen Eingang voran ins Haus und ließ,
nachdem er hindurchgegangen war, in der Meinung, der Knabe sei hinter ihm,
den Vorhang vor der Tür herunterfallen.
Im Augenblick, als hinter dem Mann, der eingetreten war, die Türklappe
herunterfiel, packte der Knabe den Feuerball und steckte ihn in die
Außenfalte seines Pelzes; dann nahm er noch die Schaufel in die Hand und
lief nach Norden weg und rannte so lange, bis seine Füße müde waren. Dann
erinnerte er sich seines Zaubergewandes, verwandelte sich in einen Raben
und flog, so rasch ihn seine Flügel nur trugen, davon. Hinter sich hörte
er das entsetzliche Gekeif und Geschrei des Mannes, der ihm rasch folgte.
Als der alte Mann merkte, daß er den Raben nicht einholen konnte, schrie
er: »Zum Donnerwetter! behalte meinetwegen das Licht, aber gib mir meine
Schaufel wieder!«
Darauf antwortete der Knabe: »Nein, du hast unser Dorf ganz verfinstert und
sollst daher auch deine Schaufel nicht haben.« Und der Rabe flog weiter und
ließ ihn zurück. Auf seinem Heimweg brach der Rabe ein Stück vom Licht ab
und warf es aus, und so wurde es wieder Tag. Dann zog er wieder lange Zeit
im Dunkeln weiter, warf dann wieder ein Stück Licht weg, es wurde wieder
Tag. So tat er abwechselnd, bis er in seinem Heimatdorf vor dem Haus
anlangte, wo er das letzte Stück wegwarf. Dann betrat er das Haus und
sagte: »Also, ihr unnützen Zauberer, ihr seht jetzt, daß ich das Licht
zurückgebracht habe und es wird von nun an hell sein und dann wieder
dunkel: Tag und Nacht.« Und die Zauberer konnten ihm nichts antworten.
Daraufhin ging er hinaus aufs Eis, denn sein Haus lag an der Küste und ein
großer Wind kam auf und trieb ihn mit dem Eis über die See zum Land an der
jenseitigen Küste. Dort fand er ein Dorf, nahm aus seiner Bewohnerschaft
eine Frau und lebte mit ihren Leuten, bis er drei Töchter und vier Söhne
hatte. Mit der Zeit wurde er sehr alt und erzählte seinen Kindern, wie er
ins Land gekommen und, nachdem er ihnen aufgetragen, wieder in jenes Land
zu ziehen, woher er gekommen, starb er.
Die Kinder des Raben zogen dann fort, wie er ihnen aufgetragen und
gelangten schließlich in ihres Vaters Land. Dort wurden sie in Raben
verwandelt und ihre Nachkömmlinge verlernten, wie sie sich in Menschen
verwandeln könnten, und so gibt es bis zum heutigen Tag Raben.
Im Dorf des Raben folgen Tag und Nacht einander, wie er gesagt hatte, daß
es geschehen werde und die Länge der einzelnen blieb ungleich, da der Rabe
manchmal lange Zeit ohne Licht auszuwerfen gewandert war und dann wieder in
kürzeren Zwischenräumen das Licht ausgeworfen hatte, so daß die Nächte sehr
kurz waren und dementsprechend ist es auch geblieben.
Der Kanibale Igimarasugdjuqdjuaq
Igimarasugdjuqdjuaq war ein sehr großer, schlechter Mann, der viele Morde
begangen und seine Opfer, nachdem er sie aufgeschlitzt hatte, verspeiste.
Einmal kam seine Schwägerin, um seine Frau zu besuchen, aber kaum hatte sie
die Hütte betreten, als Igimarasugdjuqdjuaq sie tötete und seiner Frau
befahl, sie zu kochen.
Seine Frau war sehr erschrocken, befürchtete, daß sie selbst das nächste
Opfer sein werde und beschloß zu fliehen. Als Igimarasugdjuqdjuaq auf die
Jagd ging, sammelte sie Heidekraut, stopfte damit ihre Jacke aus und setzte
die Figur aufs Bett. Dann lief sie, so rasch sie konnte, weg, bis sie ein
Dorf erreichte. Als ihr Gemahl nachhause kam und den Rock sah, glaubte er,
es sei ein Fremder zu ihm auf Besuch gekommen und erstach ihn. Wie er aber
bemerkte, daß seine Frau ihn betrogen und verlassen hatte, wurde er wütend
und verfolgte sie.
Er kam ins Dorf und sagte: »Habt ihr nicht meine Frau gesehen? Sie ist mir
weggelaufen.« Die Inuit sagten ihm nicht, daß sie sich bei ihnen aufhielt,
sondern verbargen sie vor seiner Wut. Schließlich gab sie
Igimarasugdjuqdjuaq als verloren auf und kehrte heim.
Die Inuit beschlossen, die vielen Beleidigungen, die er ihnen angetan
hatte, zu rächen. Sie suchten ihn auf und begegneten ihm auf dem Eis,
gerade unterhalb seiner Hütte. Als er ihnen sagte, er ginge auf die
Bärenjagd, sagten sie: »Laß uns deinen Speer ansehen.« Dieser Speer hatte
einen sehr starken, scharfen Walroßzahn als Spitze. »Ah!« sagten sie, »der
ist sehr gut, um Bären zu töten; wie scharf er ist! Du mußt ihn gerade in
diese Richtung stoßen.« Und wie sie das sagten, stießen sie ihn ihm in die
Stirne. Die Spitze des Speeres drang ihm ins Gehirn und dann schlitzten sie
ihm mit ihren Messern den Leib auf.
Der Geist des Festhauses
Eine Frau ging einmal, als es schon ganz dunkel war, ins Festhaus. Immer
schon wollte sie den Geist dieses Hauses sehen und obwohl die Inuit sie
davor gewarnt hatten, bestand sie doch auf ihrem Vorhaben.
Mit diesen Worten rief sie den Geist an: »Wenn du im Haus bist, so
erscheine!« Und als sie nichts von ihm sehen konnte, schrie sie: »Hier ist
ja gar kein Geist, er will nicht kommen.«
Da sagte der noch immer unsichtbare Geist: »Hier bin ich, dort bin ich!«
Da fragte die Frau: »Wo sind deine Füße, wo sind deine Schienbeine, wo sind
deine Schenkel, wo sind deine Hüften, wo sind deine Lenden?« Und jedesmal
antwortete der Geist: »Hier sind sie, dort sind sie!«
Die Frau fragte weiter: »Wo ist dein Bauch?« »Hier ist er«, antwortete der
Geist. »Wo ist deine Brust, wo sind deine Schultern, wo ist dein Nacken, wo
ist dein Kopf?« »Hier, da ist er.«
Wie aber die Frau den Kopf berührte, fiel sie plötzlich tot um: er war
knochenlos und kahl.
Die Bärengeschichte
Vor langer Zeit fand einmal eine Frau einen zwei bis drei Tage alten Bären.
Da sie so einen Liebling schon lange vermißt hatte, widmete sie ihm ihre
innigste Fürsorge, als ob es ihr eigener Sohn wäre, hätschelte ihn, machte
ihm neben ihrem eigenen ein weiches, warmes Bett zurecht und sprach mit
ihm, wie eine Mutter mit ihrem Kind. Sie hatte keine lebenden Anverwandten
mehr und bewohnte mit dem Bären allein das Haus. Als Kunikdjuaq
herangewachsen war, bewies er der Frau, daß sie ihn nicht umsonst erzogen
hatte, denn er begann bald Seehunde und Lachse zu jagen, die er, bevor er
selbst davon aß, seiner Mutter brachte und erst aus ihren Händen empfing er
seinen Anteil davon. Auf einer Hügelspitze wartete sie immer auf seine
Rückkehr und wenn sie sah, daß er kein Glück gehabt hatte, bettelte sie bei
den Nachbarn um Walfischspeck für ihn. Sie konnte das von ihrem Ausguck aus
beobachten, denn wenn er Erfolg gehabt, kam er in derselben Spur zurück,
die er beim Auszug gemacht hatte, wenn er aber keinen Erfolg gehabt hatte
-- immer auf einer anderen. Da er die Inuit auf der Jagd zu übertreffen
wußte, erregte er ihren Neid und so wurde nach langen Jahren treuen
Dienstes sein Tod beschlossen. Als die alte Frau das hörte, erbot sie sich,
von Gram überwältigt, ihr eigenes Leben herzugeben, wenn dafür nur der
verschont wurde, der sie so lange erhalten hatte. Ihr Angebot wurde
kurzweg abgewiesen. Als sich alle seine Feinde in ihre Hütten zurückgezogen
hatten, hielt die Frau mit ihrem Sohn, der jetzt schon zu Jahren gekommen
war, ein langes Gespräch und sagte ihm, daß böse Männer darauf aus wären
ihn umzubringen, und daß es für ihn nur eine Möglichkeit gebe, sein und ihr
Leben zu retten, nämlich auf und davonzugehen und nicht mehr zurück zu
kommen. Zugleich bat sie ihn aber sich nicht weiter zu entfernen, als daß
sie weggehen und ihn treffen könnte, um einen Seehund und sonst
dergleichen, was sie brauche, zu bekommen. Nachdem der Bär auf das gehört,
was sie ihm unter Tränen, die auf ihre runzeligen Wangen fielen, gesagt
hatte, legte er freundlich seine großen Tatzen auf ihren Kopf, umschlang
dann ihren Nacken und sagte: »Gute Mutter, Kunikdjuaq wird immer auf
Ausschau sein nach dir und dir so gut er kann dienen.« Nachdem er das
gesagt, befolgte er ihren Rat und ging zum Kummer der Dorfkinder und der
Mutter fort.
Nicht lang danach ging diese, da sie Mangel an Nahrung hatte, hinaus aufs
Meereis um zu sehen, ob sie nicht ihren Sohn treffen könnte und sie
erkannte ihn auch bald als den einen von zwei Bären, die miteinander
dalagen. Er lief zu ihr und sie patschte ihm in ihrer altgewohnten
traulichen Art auf den Kopf, verriet ihm ihre Wünsche und bat ihn
wegzueilen und etwas für sie zu bringen. Der Bär lief davon und wenige
Augenblicke darauf sah die Frau einen fürchterlichen Kampf zwischen ihm
und seinem früheren Gefährten, der zu ihrer großen Beruhigung bald damit
endete, daß ihr Sohn einen leblosen Körper vor ihre Füße zerrte. Mit ihrem
Messer häutete sie rasch den toten Bären ab, gab ihrem Sohn große
Speckscheiben und sagte ihm, sie werde bald zurückkommen, um das Fleisch,
das sie nicht auf einmal nach Hause bringen könne, zu holen und wenn es ihr
wieder an Nahrung mangle, werde sie wieder kommen. Das tat sie denn auch
noch lange, lange Zeit. Der treue Bär half ihr immer und genoß der gleichen
Liebe, wie in seiner Jugend.
Der rote Bär Ta-ku-ka
An der Küste, dort ungefähr, wo heute Pikmiktalik liegt, lebte ein
Eskimojäger namens Pi-tikh-cho-lik mit seiner Frau Ta-ku-ka. Damals waren
die Berge von großen Renntierherden bevölkert und die See war voll von
Seehunden und Fischen, so daß Pi-tikh-cho-lik eine Menge Nahrung und Felle
nach Hause brachte.
Eines schönen Sommerabends stand Ta-ku-ka an der Küste und wartete auf die
Rückkehr ihres Gatten. Obwohl er ihr auseinandergesetzt hatte, daß sich die
Renntiere weiter in die Berge zurückgezogen hatten und die Seehunde nur
noch weit draußen im Meer zu finden seien, war sie doch besorgt und
unruhig, da er länger als bei seinen sonstigen Jagdausflügen fortblieb.
Nach einiger Zeit ging Ta-ku-ka ins Haus, um nach ihren Kindern zu sehen;
als sie dann wieder herauskam, war ihr Mann gerade dabei, seinen Kajak auf
das Gestell neben dem Haus zu stellen.
Sie stellte an ihn, wegen seines langen Ausbleibens, eine Menge Fragen, er
antwortete aber verdrießlich, daß er weit aufs Meer hinausgefahren und so
lange ausgeblieben sei, weil er ohne Beute nicht zurückkommen wollte. Sie
gingen ins Haus und Ta-ku-ka setzte ihm verschiedene Lieblingsgerichte vor,
aber er aß nur wenig und war überhaupt traurig und mißmutig. Seine Frau
drang in ihn, ihr doch den Grund seiner üblen Laune zu sagen; schließlich
sagte er: »Wenn du durchaus den Grund meiner Kümmernisse wissen willst, so
höre ihn also: ich fühle, daß ich sterben muß und der dritte Tag von heute
an wird mein Todestag sein.«
Darauf fing Ta-ku-ka bitterlich zu weinen an, er tröstete sie aber und
sagte: »Weine nicht und mach mich nicht noch unglücklich, solange ich noch
bei dir bin, sondern höre meine letzten Wünsche. Wenn ich gestorben bin,
mußt du meinen Kajak ins Wasser stellen und an der Küste verankern; dann
lege mein Ruder, meine Speere und Schnüre auf ihren gehörigen Platz hinein.
Kleide dann meinen Körper in die wasserdichte Jacke und setz mich in den
Kajak und binde die Jacke am Rand des Mannloches fest, wie ich es immer
getan, wenn ich aufs Meer hinausfuhr. Stelle dann noch drei Tage hindurch
jeden Abend Fische, Renntierspeck und Beeren vor mich, damit mein Schatten
zufrieden gestellt wird. Versprichst du mir das?« Ta-ku-ka versprach es und
weinte still. Pi-tikh-cho-lik verließ das Haus nicht mehr und starb am
dritten Tage. Da weinte Ta-ku-ka sehr, tat aber, wie ihr befohlen war.
Jeden Morgen sah sie, daß der Schatten gegessen hatte, denn alle Speisen
vor dem Körper waren weg. Als sie am vierten Tag an den Strand ging, um wie
gewöhnlich ihren Toten zu beklagen, war der Kajak mit all seinem Inhalt
verschwunden. Da warf sie sich zu Boden und blieb in ihrem Schmerz lange so
liegen, schließlich erinnerte sie sich aber ihrer Kinder und ging wieder
ins Haus, um nach ihnen zu sehen. Nun arbeitete Ta-ku-ka viel, sie
sammelte Beeren, fing Fische und trocknete sie, um für den Winter einen
Vorrat anzulegen.
Als sie so eines Tages Beeren klauben ging, entfernte sie sich weit vom
Haus und kam auf den Gipfel eines Hügels. Sie überschaute von da die Gegend
und sah noch weit entfernt Rauchwolken vom Boden aufsteigen. Es war das
erste Zeichen, das sie je von anderen Leuten gesehen und sie beschloß
hinzugehen, um zu sehen, was für Menschen dort seien. Nach einiger Zeit kam
sie näher an die Stelle heran und kroch vorsichtig auf den Kamm eines zum
Meer steil abfallenden, landeinwärts aber sanft geneigten Hügels. Hart am
Wasser lagen drei Häuser und aus dem einen stieg der Rauch, den sie gesehen
hatte.
Hier wartete Ta-ku-ka ruhig, um zu sehen was für Leute da wären; bald kam
eine Frau heraus, hob eine Hand vor die Augen und blickte hinaus aufs Meer.
Dann lief sie zurück ins Haus und rief irgend jemanden drinnen etwas zu.
Nun kamen noch zwei andere Frauen heraus und alle gingen hinunter an den
Rand des Wassers; dort stimmten sie ein Liebeslied an und tanzten am
Sandstrand. Ta-ku-ka hatte die Frauen und ihre schönen Fellkleider so
aufmerksam betrachtet, das sie nichts anderes bemerkte; jetzt aber traf
leise der angenehme Ton einer singenden Männerstimme ihr Ohr und ihr Herz
schlug höher. Über die Frauen hinweg sah sie einen Mann in seinem Kajak
langsam der Küste zusteuern. Er sang und warf spielend seinen
Seehundsspeer vor sich und hob ihn, wenn er daran vorbei kam, wieder auf.
Wie er näher kam, erkannte Ta-ku-ka in seinem Gesang ein Lied, das in
früheren Tagen Pi-tikh-cho-lik ihr vorzusingen pflegte. Der Kajakmann
landete nun und die Frauen empfingen ihn mit Freudenrufen. Ta-ku-ka wollte
kaum ihren Augen traun, als sie sah, daß der Mann wirklich ihr Gatte war,
den sie für tot gehalten. Er ging mit den Frauen ins Haus und da empfand
Ta-ku-ka ein früher nie gekanntes, merkwürdig grimmes Gefühl im Herzen. Sie
stand am Hügelrand und lauschte bis tief in die Nacht hinein dem Gesang und
Gelächter, das aus dem Haus zu ihr drang.
Es wurde Morgen, Pi-tikh-cho-lik kam heraus und brachte am Kajak sein
Jagdgerät in Ordnung. Nachdem er den Frauen an der Küste »guten Tag«
gesagt, ruderte er lustig singend aufs Meer hinaus. Als er außer Sicht war,
stieg Ta-ku-ka vom Hügel herab und folgte den Frauen in eines der Häuser.
Die waren erstaunt, sie zu sehen, bewillkommten sie aber trotzdem und
stellten viele Fragen an sie. Sie bewunderten ihr Gesicht und ihre
Hautfarbe, die heller als ihre war und verschiedene tätowierte Linien in
ihrem Gesicht: eine auf- und abführende zwischen den Augen und drei von der
Unterlippe übers Kinn herunter, die auch anders waren, als die ihrigen. Im
Laufe des Gesprächs sagte eine der Frauen: »Diese Gesichtslinien stehen dir
sehr gut; ich würde viel dafür geben, wenn du mich lehrtest, mein Gesicht
wie deins zu machen.« Ta-ku-ka antwortete: »Ich will dir zeigen, wie das
gemacht wird, wenn ich dir damit einen Gefallen erweisen kann, aber ich
werde dir dabei weh tun und du wirst den Schmerz vielleicht nicht
aushalten.« »Ich werde den Schmerz nicht beachten und bin bereit, ihn
auszuhalten, wenn ich nur so schön werde, wie du.« »Wie du willst!« sagte
Ta-ku-ka, »geh ins Haus, zünde ein Feuer an und setze einen großen irdenen
Topf mit Fett auf; wenn das Fett kocht, rufe mich, ich werde dann dein
Gesicht so schön, wie das meine, machen.« Nachdem ihr die Frau gedankt
hatte, ging sie, alles fertig zu machen und nun stellten die anderen Frauen
noch eine Menge Fragen, wie: »Wird es sehr weh tun?« und »Wird sie wirklich
so schön werden, wie du bist?« und noch andere mehr. Ta-ku-ka entgegnete
darauf: »Es wird ihr nicht sehr weh tun und sie wird noch schöner werden,
als ich.«
Die Frau kam bald zurück und meldete, das Fett sei fertig. Ta-ku-ka ging
dann mit ihr ins Haus und befahl ihr, sich vor den Topf mit dem siedenden
Fett zu knien und den Kopf darüber zu beugen. So wie das geschehen war,
packte Ta-ku-ka sie bei den Haaren und stieß ihren Kopf ins heiße Fett und
hielt ihn drin, bis die Frau tot war; dabei sagte sie: »Da! Jetzt wirst du
immer schön sein!« Dann legte sie ihren Körper auf die Bettstatt, deckte
das Gesicht zu und ging hinaus zu den anderen Frauen. In ihrer Abwesenheit
hatten die beiden anderen miteinander geschwätzt und als sie zurückkam,
fragten sie, ob es ihr gelungen sei, ihre Gefährtin zu verschönern, und
Ta-ku-ka nickte mit dem Kopf.
Daraufhin sagten die beiden Frauen: »Wir wollen dir auch Geschenke geben,
wenn du uns schön machen willst.« Sie war damit einverstanden. Dann gingen
sie alle zum Haus der toten Frau und Ta-ku-ka sagte zu ihren
Begleiterinnen: »Stört eure Freundin nicht, sie schläft jetzt, und damit
nichts ihre Schönheit beeinträchtigt, ist ihr Gesicht zugedeckt. Wenn sie
aufwacht, wird sie sehr schön sein.« Darauf brachte sie dann die beiden
anderen Frauen, wie die erste um und sagte, wie sie sie niederhielt: »Ihr
werdet auch sehr schön sein.« Sie fertigte nun aus Stäben drei Gestelle an
und stellte sie, wo die Frauen am Abend vorher an der Küste getanzt hatten,
aufrecht in den Sand und legte die Kleider der Toten darüber, sodaß man auf
die Entfernung glauben konnte, sie stünden dort. Dann nahm sie das Fell
eines roten Bären und ging zu ihrem Versteck in den Felsen zurück. Es wurde
Abend und der Jäger kam, wie in der vorigen Nacht, singend zurück. Es drang
zwar keine Antwort zu ihm, aber er glaubte doch, seine Weiber an der Küste
stehen zu sehen, obwohl auf sein Loblied keine Antwort kam. Er wurde
ärgerlich und hielt mit seinem Gesang inne. Dann begann er sie zu schelten
und beschimpfen, aber noch immer blieben sie stumm. Nachdem er gelandet,
lief er auf die schweigenden Gestalten zu und dann ins nächste Haus. Dort
und im nächsten fand er nichts, aber im dritten sah er seine Weiber tot
daliegen und Ta-ku-ka hörte die Schmerzensschreie, die er ausstieß, als er
das sah.
Rasend stürzte Pi-tikh-cho-lik aus dem Haus; vor Trauer klagend und aus
Ärger schrie er: »Wenn irgendwelche böse Geister das getan haben, so
fürchte ich mich gar nicht vor ihnen; sie sollen nur kommen und versuchen
auch an mir Rache zu nehmen; ich hasse und verachte sie!« Alles blieb
ruhig. »Wenn irgend ein Rachegeist, Mensch oder Tier, das getan hat, so
soll er nur aus seinem Versteck herauskommen und«, so brüllte er, »es
wagen, einem Mann Trotz zu bieten, der ihm das Herz herausreißen und sein
Blut trinken wird! Oh, elendiger Nichtsnutz!«
Wie zur Antwort darauf hörte er vom Hügel her ein tiefes Gebrumm und sah
dort einen roten Bären aufrecht auf seinen Hinterfüßen stehen und seinen
Körper vor- und zurückneigen. Das war Ta-ku-ka, die sich ins Bärenfell
eingewickelt, und um sich vor Pfeil-oder Speerwunden zu schützen, darunter
an jede Körperseite flache Steine gelegt hatte.
Pi-tikh-cho-lik sah sie und glaubte, es sei wirklich ein Bär und begann
alle Schimpfnamen, die er sich nur ausdenken konnte, zu rufen, während er
rasch einen Pfeil auf den Bogen legte und ihn losschoß. Der Pfeil traf auf
einen der Steine und fiel unschädlich herab; der Bär wandte ihm die andere
Seite zu. Wieder schoß er einen gutgezielten Pfeil ab und wieder war er
wirkungslos. Da rutschte der Bär den Abhang zu ihm herunter und als
Pi-tikh-cho-lik dem Bären den Speer in die Flanke stieß, zerbrach er ihm
in der Hand. In ein paar Augenblicken hatte der Bär ihn leblos
niedergeworfen, ihm das Herz herausgerissen und es aufgefressen. Daraufhin
schien die Raserei, die Ta-ku-ka ergriffen hatte, sie zu verlassen und ihre
besseren Gefühle kamen wieder zurück. Sie versuchte das Bärenfell
abzustreifen, aber es saß so fest an ihr, daß es ihr nicht gelang.
Auf einmal erinnerte sich Ta-ku-ka ihrer Kinder zuhause; sie nahm von der
Hügelspitze ihren Korb mit den Beeren und machte sich nach ihrer Wohnung
auf den Weg. Als sie so dahinging, bekam sie plötzlich Angst vor ihrem
merkwürdigen Blutdurst, in den sich Gedanken an ihre Kinder mischten. Sie
lief weiter, kam endlich zum Haus und lief hinein. Die beiden Kinder
schliefen, und als sie Ta-ku-ka sah, überkam sie wieder unbezähmbare
Blutgier und sie riß sie augenblicklich in Stücke. Dann ging sie hinaus und
schweifte im Land umher, voll Gier, einen jeden, der ihr entgegenkam,
umzubringen.
Bis dahin waren die roten Bären harmlos gewesen, aber Ta-ku-ka pflanzte
ihnen ihre eigene Leidenschaft ein, sodaß sie seither ganz wild geworden
sind. Zuletzt kam sie an den Kuskokwimfluß und wurde von einem Jäger
getötet, dessen Pfeil doch einen Weg durch einen Sprung in einem der Steine
an ihrer Seite gefunden hatte.
Der rote Bär
In der Tundra südlich der Yukonmündung lebte einst ein Waisenknabe mit
seiner Tante. Sie waren ganz allein und eines Sommertags nahm der Knabe
seinen Kajak und fuhr weg, um zu sehen, wo die Leute am Yukon lebten, von
denen er gehört hatte. Als er an den Fluß kam, fuhr er ihn hinauf, bis er
ein großes Dorf erreichte. Dort legte er an und die Bewohner liefen
hinunter zur Küste, packten ihn, brachen sein Kajak in Stücke, rissen ihm
die Kleider vom Leib und schlugen ihn fürchterlich.
Bis zum Ende des Sommers wurde der Knabe dortbehalten, als Zielpunkt
ständiger Prügel und schlechter Behandlung. Im Herbst faßte einer der
Männer Mitleid zu ihm, baute ihm einen Kajak und sandte ihn nachhause, wo
er dann nach langer Abwesenheit eintraf. Als er zu Hause ankam, sah er, daß
um das Haus seiner Tante ein großes Dorf entstanden war. Nachdem er
gelandet, ging er zum Haus seiner Tante, trat ein und erschreckte sie sehr,
da er wie ein Skelett aussah, weil er so lange gehungert hatte und so viel
geschlagen worden war.
Als seine Tante ihn endlich wiedererkannte, erzählte er seine Geschichte
mit wehleidigen Worten, statt mit solchen des Ärgers über die grausamen
Dorfbewohner. Nachdem er die Erzählung seiner Leiden beendet, sagte sie
ihm, er solle ihr ein Stück Holz bringen. Das tat er auch. Daraus
schnitzten sie ein kleines Tier mit langen Zähnen und scharfen Klauen und
bemalten es an den Seiten rot und weiß an der Kehle; dann trugen sie das
Tier ans Ufer der Bucht und setzten es ins Wasser. Dann beschwor es die
Tante zu gehen und in dem Dorf, wo ihr Knabe gewesen, jeden, den es finde,
zu töten.
Das Schnitzwerk bewegte sich aber nicht und die Frau nahm es aus dem
Wasser, beschimpfte es, ließ ihre Tränen auf es herunterfallen und setzte
es dann wieder ins Wasser mit den Worten: »Jetzt geh und bring die
schlechten Leute um, die meinen Buben geschlagen haben.« Darauf schwamm das
Tier über die Bucht und kroch am anderen Ufer hinauf, wo es zu wachsen
begann und bald ein roter Bär von ziemlicher Größe wurde. Er wandte sich um
und sah die alte Frau an, bis sie ihm zurief zu gehen und ja niemanden zu
schonen.
Dann ging der Bär fort, bis er zum Dorf am großen Fluß kam. Er traf da
einen Mann, der gerade um Wasser ging und zerriß ihn sogleich in Stücke;
dann blieb der Bär in der Nähe des Dorfes, bis er mehr als die Hälfte aller
Leute getötet hatte und die anderen sich vorbereiteten, es zu verlassen, um
dem Verderben zu entgehen. Der Bär schwamm darauf über den Yukon zum weiter
entfernten Kuskokwimfluß und tötete jeden, den er sah, denn selbst das
geringste Lebenszeichen versetzte ihn in Raserei, bis es vernichtet war.
Vom Kuskokwimfluß kehrte der Bär wieder zurück und stand eines Tags wieder
am anderen Ufer der Bucht, wo er einst belebt worden war. Als er am
drüberen Ufer die Leute sah, wurde er wieder wild, riß mit seinen Krallen
den Boden auf, knurrte und begann dann über die Bucht zu setzen. Als die
Dorfbewohner dies sahen, erschraken sie sehr, liefen herum und sagten: »Der
Hund der alten Frau ist da; wir werden alle getötet werden; sagt der Frau,
sie soll ihren Hund aufhalten!« Sie schickten sie, den Bären zu empfangen.
Der Bär versuchte nicht sie zu verletzen, sondern ging vorbei, um die
anderen Leute zu erwischen, sie hielt ihn aber an seinen Nackenhaaren und
sagte: »Laß diese Leute in Ruhe, die waren zu mir freundlich und gaben mir
Essen, wenn ich hungrig war.«
Danach führte sie den Bären in ihr Haus, setzte sich, sagte ihm, daß er
ihren Auftrag gut ausgeführt und sie zufriedengestellt habe; er solle jetzt
aber die Leute nicht mehr angreifen, außer, wenn sie versuchten, ihn zu
mißhandeln. Nachdem sie ihm das gesagt, führte sie ihn zur Tür und schickte
ihn weg in die Tundra. Seit dieser Zeit gibt es rote Bären.
Der Feuerball
Vor langer Zeit lebte in dem Dorf Kin-i-gim ein armer Waisenknabe, der
niemanden hatte, der für ihn sorgte, von jedermann schlecht behandelt
wurde, und auf Geheiß der Dorfbewohner immer dahin und dorthin laufen
mußte. Eines Abends wurde er aus dem Haus geschickt um zu sehen, wie das
Wetter sei. Er hatte keine Fellschuhe und da es Winter war wollte er nicht
gehen, wurde aber doch hinausgejagt. Er kam gleich wieder zurück und sagte
das Wetter habe sich nicht geändert. Daraufhin sandten ihn die Leute wieder
mit demselben Auftrag hinaus, bis er schließlich zurückkam und erzählte, er
habe einen großen Feuerball, wie den Mond, über einem nahen Hügel
aufsteigen gesehen. Die Leute lachten ihn aus und schickten ihn wieder
hinaus und da sah er, daß das Feuer herangekommen und schon ganz in der
Nähe war. Da lief der Waisenknabe hinein, erzählte, was er gesehen und
versteckte sich, denn er hatte Angst.
Bald darauf sahen die Leute eine Feuergestalt vor der Haut, die die
Dachluke verschloß, herumtanzen und gleich darauf schlich auf den Knien und
Ellbogen ein Menschengerippe durch den Eingang in den Raum.
Wie das Gerippe herankam, machte es eine Bewegung gegen die Leute, wodurch
sie gezwungen waren, in der gleichen Stellung, wie das Gerippe, auf Knie
und Ellbogen zu fallen. Es wandte sich nun um und kroch, wie es gekommen
war, von den Leuten, die ihm nachgehen mußten, gefolgt, hinaus. Draußen
kroch es weiter zum Dorf hinaus, noch immer gefolgt von den Leuten: bald
darauf verschwand es und alle waren tot. Einige Dorfbewohner waren nicht
dagewesen, als das Gerippe, der Tunghak, gekommen war und als sie
zurückkamen, sahen sie überall Leichen herumliegen. Als sie ins Haus
gingen, fanden sie den Waisenknaben und der erzählte, wie die anderen
umgekommen waren. Sie verfolgten dann die Spuren des Tunghak und kamen
jenseits des Hügels an ein uraltes Grab, bei dem die Spuren endeten.
Einige Tage darauf ging der Bruder eines der toten Männer aufs Meereis
hinaus, ziemlich weit weg vom Dorf, um zu fischen. Er blieb lange und die
Dunkelheit überraschte ihn, als er noch weit draußen war. Als er so
dahinging, erschien plötzlich der Tunghak vor ihm und lief immer auf seinem
Weg hin und her. Der junge Mann versuchte an ihm vorüberzukommen und zu
entfliehen, konnte es aber nicht, denn der Tunghak blieb immer vor ihm und
tat immer dasselbe wie er. Als ihm nichts mehr einfiel, nahm er plötzlich
einen Fisch aus seinem Korb und warf ihn auf den Tunghak. Als er den Fisch
herauszog war er steif gefroren, aber als er in die Nähe des Tunghak kam,
kehrte er plötzlich um und fiel über die Schultern des Jünglings zurück in
den Korb und schlug darin herum, denn er war wieder lebendig geworden.
Jetzt zog der Fischer einen seiner Hundsfellfäustlinge aus und warf ihn
hin. Wie der nun in der Nähe des Tunghak niederfiel, wurde er ein Hund, der
das Gespenst anbrummte und anknurrte und so seine Aufmerksamkeit auf sich
lenkte, so daß der Mann vorbei und so schnell er nur konnte zum Dorf lief.
Als er ein Stück Wegs zurückgelegt hatte, wurde er wieder vom Tunghak
aufgehalten und gleichzeitig sprach eine Stimme von oben: »Bind ihm doch
seine Füße auseinander, sie sind mit einer Schnur zusammengebunden.« Er
hatte aber zu große Angst, um das auszuführen. Er warf also lieber noch
einen anderen Fäustling und auch der verwandelte sich in einen Hund, der
wie der erste den Tunghak aufhielt.
Der Jüngling lief so rasch er konnte davon und fiel erschöpft bei der
Haustür nieder, als auch schon der Tunghak kam. Der ging, ohne ihn zu
bemerken, knapp an ihm vorüber ins Haus hinein, fand aber niemand drin und
kam wieder heraus. Der junge Mann stand nun auf und ging hinein; er wagte
es aber nicht, was er gesehen hatte seiner Mutter zu erzählen. Am folgenden
Tag ging er wieder fischen und stieß unterwegs auf einen Mann, der am Weg
lag. Seine Hände und sein Gesicht waren ganz schwarz. Als er näher kam,
forderte ihn der schwarze Mann auf, ihm auf den Rücken zu steigen und die
Augen zu schließen. Er folgte und bald darauf durfte er die Augen wieder
öffnen. Als der Jüngling dies tat, sah er gerade vor sich ein Haus und in
dessen Nähe ein schönes junges Weib. Sie sprach zu ihm: »Warum hast du
vorige Nacht nicht getan, wie ich dir geraten, als der Tunghak dich
verfolgte?« Er antwortete, daß er sich gefürchtet habe. Das Weib gab ihm
dann einen zauberkräftigen Stein als Talisman, der ihn in Hinkunft vor den
Tunghak schützen sollte und dann nahm ihn der schwarze Mann wieder auf den
Rücken und als er die Augen öffnete, war er zu Hause.
Seit dieser Zeit wollte der junge Mann als Zauberer angesehen werden,
dachte aber immer nur an das schöne Weib, das er gesehen hatte, so daß er
nicht viel Kräfte besaß. Schließlich sagte sein Vater zu ihm: »Du bist gar
kein Zauberer! Du machst mir nur Schande; geh wo anders hin!« Am nächsten
Morgen verließ der Jüngling bei Tagesanbruch das Dorf und man hat nie
wieder etwas von ihm gehört. --
Die Auswanderung der Sagdlirmiut
In der Gegend von Ussualung gibt es zwei Orte: Qerniqdjuaq und
Echaluqdjuaq. In jedem dieser Orte war ein großes Haus, in dem viele
Familien zusammenlebten. Wenn sie im Sommer Renntiere jagten, so pflegten
sie sich zusammenzugesellen, im Herbst aber kehrten sie in ihre Häuser
zurück.
Einmal hatten die Leute von Qerniqdjuaq viel Erfolg, während die von
Echaluqdjuaq kaum ein Tier gefangen hatten. Daher waren die letzteren sehr
ärgerlich und beschlossen, die andere Partei zu töten, wollten damit aber
noch bis zum Winter warten. In ziemlich vorgerückter Jahreszeit wurden dann
noch viele Renntiere erlegt und aufgespeichert; mit Schlitten sollten sie
dann in die Winterlager gebracht werden.
Eines Tags bereiteten sich beide Parteien zu einer Ausfahrt nach diesen
Vorräten vor und die Echaluqdjuaq-Männer beschlossen, bei dieser
Gelegenheit ihre Feinde umzubringen. Sie zogen mit ihren Hunden und
Schlitten ab und als sie schon ziemlich über Land waren, griffen sie ihre
nichtsahnenden Genossen an und töteten sie. Aus Furcht, die Frauen und
Kinder der Ermordeten könnten Verdacht schöpfen, wenn die Hunde ohne ihre
Herren zurückkehrten, töteten sie diese auch noch. Bald darauf kehrten sie
heim und sagten sie hätten die andere Partei verloren und wüßten nicht was
mit ihr geschehen sei.
Ein junger Echaluqdjuaq war der Liebhaber eines Mädchens der Qerniqdjuaq
und pflegte sie allnächtlich zu besuchen. Auch jetzt stellte er seine
Besuche nicht ein. Er wurde von ihr freundlich aufgenommen und legte sich
mit ihr schlafen.
Unter der Bank war ein kleiner Bub, der den Echaluqdjuaq kommen sah. Als
alles schlief, hörte er jemand sprechen und erkannte bald, daß es die
Geister der Ermordeten waren, welche ihm erzählten, was sich zugetragen und
ihn baten, zur Rache den jungen Mann zu töten. Der Knabe kroch unter dem
Bett hervor, nahm ein Messer und stach es dem jungen Mann in die Brust.
Obwohl er ein kleiner Knabe und noch schwach war, glitt das Messer von den
Rippen ab, drang tief ins Herz und tötete so den jungen Mann.
Dann weckte er die anderen Hausgenossen und erzählte ihnen, daß die Geister
der Toten zu ihm gekommen, von ihrer Ermordung erzählt und ihm aufgetragen,
den jungen Mann zu töten. Die Frauen und Kinder waren sehr erschrocken und
wußten nicht was sie tun sollten. Schließlich beschlossen sie den Rat einer
alten Frau zu befolgen und vor ihren grausamen Nachbarn zu fliehen. Da ihre
Hunde getötet waren, konnten sie die Schlitten nicht verwenden. Zufällig
war aber eine Hündin mit jungen Hunden im Haus und das alte Weib, welches
eine große Zauberin war, befahl ihnen die jungen Hunde zu schlagen, dann
würden sie schnell wachsen. So geschah es auch und in kurzer Zeit waren
die Hunde groß und stark. Sie schirrten sie an und brachen so rasch als nur
möglich auf. Um ihre Nachbarn zu täuschen, ließen sie alles zurück und
löschten nicht einmal ihre Lichter aus, damit jene gar keinen Verdacht
schöpften.
Den nächsten Tag wunderten sich die Echaluqdjuaq, daß ihr Kamerad nicht
zurückgekommen und gingen zur Hütte nach Qerniqdjuaq. Sie guckten durch den
Fensterspalt, sahen die Lampen brennen aber niemand darin. Schließlich
fanden sie den Körper des jungen Mannes, fanden die Schlittenspuren,
brachten schleunigst ihre Schlitten in Ordnung und verfolgten die
Flüchtlinge.
Obwohl diese sehr rasch vorwärts kamen, folgten ihnen die Verfolger noch
schneller und es schien, als würden sie sie in kurzer Zeit einholen. Da sie
die Rache der Verfolger fürchteten, bekamen die Flüchtigen große Angst.
Als der Schlitten der Männer näher kam und die Frauen sahen, daß es
unmöglich sei zu entkommen, fragte eine junge Frau die Zauberin: »Weißt du
nicht, wie man das Eis zerschneiden kann?« Die Alte bejahte und zog langsam
mit ihrem Zeigefinger einen Strich über das Eis, quer über den Weg der
Verfolger. Das Eis gab einen lauten Krach. Noch einmal zog sie den Strich,
ein Spalt öffnete sich und erweiterte sich so rasch als sie weiterzogen.
Die Flut hob sich und als die Männer herankamen, konnten sie nicht über den
breiten Spalt offenen Wassers. So war die eine Partei durch die Kunst
ihrer Zauberin gerettet worden.
Viele Tage zogen sie noch hin und her und landeten endlich auf der Inseln
Sagdlirn, wo sie blieben und die Stammütter der Sagdlirmiut wurden.
Die Rivalen
Zwischen zwei Männern bestand scharfe Rivalität. Jeder behauptete der
Stärkere zu sein und bemühte sich, dem anderen das zu beweisen. Der eine
behauptete, er könne eine Insel machen, etwas nie dagewesenes. Er hob einen
ungeheuer großen Felsen auf und schleuderte ihn ins Meer, wo er als Insel
liegen blieb. Da gab der andere dieser Insel einen solchen Fußtritt, daß
sie auf der Spitze einer anderen landete, die sehr weit weg war. Die Folgen
dieses Fußtrittes kann man bis zum heutigen Tage sehen: der Platz heißt
Tu-kik-tok.
Die Geschichte von den drei Brüdern
Vor langer Zeit lebten drei Brüder. Zwei von ihnen waren erwachsen, der
dritte war aber noch jung; er hieß Qaudjaqdjuq. Die älteren Brüder hatten
ihre Heimat verlassen und zogen jahrelang herum, indes der Jüngste mit
seiner Mutter in seinem Geburtsort lebte. Da er keinen Vater mehr hatte,
wurde der arme Junge von allen Männern des Dorfes mißhandelt und niemand
war da, ihn zu beschützen.
Schließlich hatten die älteren Brüder es satt herumzustreifen und kehrten
heim; als sie hörten, daß der Knabe von allen Inuits schlecht behandelt
worden sei, wurden sie ärgerlich und sannen auf Rache. Zuerst taten sie so
als sähen sie nichts, bauten aber ein Boot, in welchem sie entfliehen
wollten, sobald sie ihre Pläne ausgeführt hatten. Sie waren geschickte
Bootsbauer und vollendeten ihr Werk sehr bald. Als sie das Boot ausprobten,
glitt es so rasch wie eine Eiderente fliegt übers Wasser. Sie waren aber
noch nicht zufrieden mit ihrem Werk, zerstörten es wieder und bauten ein
neues Boot; das war bei der Probe so schnell, wie eine Eisente. Immer noch
waren sie unzufrieden, zerstörten auch dieses Boot und bauten ein drittes
und das war gut. Nachdem sie das Boot fertiggestellt hatten, lebten sie
friedlich mit den anderen Männern. Im Dorf war ein großes Festhaus, das zu
allen Festen benutzt wurde. Eines Tages gingen die drei Burschen hin,
schlossen es auf, und fingen an drin zu tanzen und zu singen, bis sie
erschöpft waren. Da keine Sitzbank in dem Haus war, baten sie ihre Mutter,
eine zu bringen und als sie die Türe öffneten, um sie hereinzulassen,
entschlüpfte ein Hermelin, der im Haus versteckt gewesen war.
In der Nähe des Festhauses spielten die anderen Inuit des Dorfes. Als sie
den Hermelin sahen, der mitten durchs Gedränge lief, bemühten sie sich, ihn
zu fangen. Im Eifer der Verfolgung stolperte ein Mann, der das kleine Tier
schon fast gefangen hatte, so unglücklich über einen Kieselstein, daß er
augenblicklich tot war. Der Hermelin war, besonders ums Maul herum, ganz
mit Blut bespritzt; bei der Verwirrung, die nun ausbrach, entwischte er ins
Festhaus, wo er sich in seiner früheren Ecke versteckte.
Drinnen hatten die Brüder wieder angefangen zu singen und zu tanzen. Als
sie erschöpft waren, riefen sie nach ihrer Mutter, sie sollte etwas zum
Essen bringen. Wie sie nun die Tür öffnete, entwischte der Hermelin wieder
und rannte zwischen den Inuit, die noch immer draußen spielten, herum.
Als sie ihn bemerkten, glaubten sie jetzt, die Brüder wollten sie dadurch
veranlassen, ihn zu verfolgen, um so nacheinander umzukommen. Der ganze
Haufen stürmte daher das Festhaus, mit der Absicht die Brüder zu töten. Da
die Tür geschlossen war, krochen sie aufs Dach und rissen es auf, aber als
sie ihre Speere nahmen, um die drei Männer zu durchbohren, öffneten die
die Tür und liefen hinunter an den Strand. Ihr Boot war ganz in der Nähe
und zur Abfahrt bereit, während die der anderen Inuit ziemlich weit weg
lagen.
Sie schifften sich mit ihrer Mutter ein und als sie ein wenig draußen waren
und sahen, daß die anderen Männer ihre Boote noch nicht erreicht hatten,
bildeten sie sich ein, daß die nie imstande wären, sie einzuholen, selbst
wenn sie mit äußerster Anstrengung ruderten. Sie spielten also nur mit den
Rudern am Wasser. Einige junge Frauen und Mädchen waren am Strand und sahen
auf die Männer, die sich mit äußerster Kraft anzustrengen schienen. Der
älteste Bruder rief den Weibern zu: »Wollt ihr uns helfen? Wir können
allein nicht weiter kommen.« Zwei Mädchen sagten zu, aber sowie sie ins
Boot gekommen waren, fingen die Brüder an so hart zu rudern, als sie nur
konnten. Das Boot flog dahin, schneller als eine Ente und die Mädchen
schrien vor Angst. Die anderen Inuits beeilten sich, begierig, die
Flüchtigen einzuholen und bald waren ihre Boote bemannt.
Die Brüder hatten nicht die mindeste Angst, da ihr Boot ja das bei weitem
schnellste war. Als die Verfolger fast außer Sehweite gekommen waren,
wurden sie plötzlich von einem hohen, steilen Landrücken aufgehalten, der
sich vor dem Boot erhob und ihren Weg versperrte. Sie wurden ganz verwirrt,
denn sie mußten ein langes Stück zurück und fürchteten, von den anderen
Booten überholt zu werden. Einer der Brüder aber war ein großer Zauberer
und rettete sie durch seine Kunst. Er befahl ihnen:
»Macht eure Augen zu und öffnet sie nicht, bevor ich es euch erlaube; dann
rudert los!« Sie taten wie er befohlen und als er sie wieder aufschauen
hieß, sahen sie, daß sie mitten durchs Land gefahren waren, das sich nun
hinter ihnen genau so hoch und furchtbar erhob, wie es ihnen vorhin den Weg
versperrt hatte. Es hatte sich geöffnet und sie waren durchgefahren.
Nachdem sie einige Zeit weiter gerudert, sahen sie einen langen schwarzen
Strich im Meer. Als sie näher kamen, erkannten sie, daß es eine
undurchdringliche Masse von Seegras war; sie war so fest, daß sie aus dem
Boot steigen und darauf stehen konnten. Es war ausgeschlossen das Boot
durchzubringen, obwohl es schneller als eine Ente war. Der älteste Bruder
erinnerte sich aber seiner Zauberkunst und sagte zu seiner Mutter: »Nimm
deine Haarenden und peitsche das Seegras.« Kaum tat sie so, da versank es
auch und gab den Weg frei.
Nachdem sie über dieses Hindernis hinaus waren, wurden sie nicht mehr
aufgehalten und vollendeten ihre Reise in Sicherheit. Als sie ihr Ziel
erreicht hatten, gingen sie an Land und errichteten eine Hütte. Die beiden
Frauen, die sie ihren Feinden entführt hatten, gaben die Brüder
Qaudjaqdjuq.
Sie wollten ihn nun ebenso stark machen, wie sie selbst waren. Dazu führten
sie ihn zu einem ungeheuren Stein und sagten: »Versuch' diesen Stein zu
heben!« Da Qaudjaqdjuq das nicht konnte, schlugen sie ihn und sagten:
»Versuch' es noch einmal!« Diesmal konnte ihn Qaudjaqdjuq ein wenig von der
Stelle rücken. Die Brüder waren noch nicht zufrieden und schlugen ihn
nochmals. Von den letzten Schlägen wurde er sehr stark, hob den Stein auf
und warf ihn über die Hütte.
Die Brüder gaben ihm dann die Rute und sagten ihm, er solle damit die
Frauen schlagen, wenn sie ihm ungehorsam wären.
Qaudjaqdjuq
Vor langer Zeit lebte ein armer Waisenknabe, der keinen Beschützer hatte
und von allen Dorfbewohnern mißhandelt wurde. Er durfte nicht einmal in der
Hütte schlafen, sondern mußte draußen im kalten Eingang liegen, bei den
Hunden, die ihm Kissen und Decke waren. Er bekam auch kein Essen, sondern
man warf ihm alten zähen Walroßspeck vor, den er ohne Messer verzehren
mußte. Ein junges Mädchen war die einzige, die ihn bemitleidete; sie gab
ihm ein kleines Stück Eisen als Messer, bat ihn aber, es ja gut zu
verbergen, sonst würden die Männer es ihm wegnehmen. Er tat so und steckte
es in sein Gewand. So führte er ein elendes Leben und wuchs nicht einmal,
sondern blieb der arme, kleine Qaudjaqdjuq. Nicht einmal mit den anderen
Kindern konnte er spielen, da sie ihn wegen seiner Schwäche ebenso quälten
und mißhandelten, wie alle anderen.
Wenn die Dorfbewohner sich im Festhaus versammelten, pflegte Qaudjaqdjuq im
Eingangsflur zu liegen und über die Schwelle zu gucken. Hie und da zog ihn
ein Mann an der Nase in die Hütte und gab ihm das große Uringefäß, um es
auszuschütten. Das war so groß und schwer, daß er es mit beiden Händen und
den Zähnen halten mußte. Da er immer an den Nasenflügeln gezogen wurde,
waren sie sehr groß, obwohl er selbst klein und schwach blieb.
Schließlich kam der Mann im Mond, der gesehen hatte, wie schlecht sich die
Leute gegen Qaudjaqdjuq benahmen, herunter, um ihm zu helfen. Er spannte
seinen Hund Terii-tiaq vor einen Schlitten und fuhr herunter. In der Nähe
der Hütte machte er Halt und schrie: »Qaudjaqdjuq, komm heraus!« Der
antwortete: »Ich will nicht herauskommen, geh weg!« Als er ihn aber ein
zweites und drittesmal herauskommen hieß, gehorchte er, obwohl er große
Angst hatte. Dann ging der Mann vom Mond mit ihm zu einem Platz, wo einige
große Steine herumlagen und nachdem er ihn geschlagen hatte, fragte er:
»Fühlst du dich jetzt stärker?« »Ja, ich fühl' mich stärker.« »Dann heb
diesen Stein.« Da Qaudjaqdjuq ihn noch nicht heben konnte schlug er ihn
wieder und jetzt begann er plötzlich zu wachsen; zuerst wurden seine Füße
ganz außerordentlich groß. Wieder fragte ihn der Mann im Mond: »Fühlst du
dich jetzt stärker?« Qaudjaqdjuq antwortete: »Ja, ich fühle mich schon
stärker.« Da er aber den Stein noch immer nicht heben konnte, wurde er
nochmals geschlagen. Daraufhin bekam er riesige Kräfte und hob den Stein,
als ob es ein kleiner Kiesel wäre. Der Mondmann sagte: »Das wird langen;
morgen werde ich drei Bären schicken, dann magst du deine Kraft beweisen.«
Er kehrte in den Mond zurück; Qaudjaqdjuq, der jetzt der große Qaudjaqdjuq
geworden war, ging nach Hause und schleuderte mit den Füßen die Steine nach
rechts und links, daß sie nur so flogen. Nachts legte er sich wieder zu
den Hunden. Am nächsten Morgen erwartete er die Bären und wirklich
erschienen bald drei große Tiere und erschreckten alle Männer so, daß sie
sich nicht aus den Hütten wagten.
Da zog Qaudjaqdjuq seine Stiefel an und lief hinunter aufs Eis. Ein Mann,
der aus dem Fensterspalt guckte, sagte: »Schaut her, ist das nicht
Qaudjaqdjuq? Die Bären werden bald mit ihm sich auf den Weg machen.« Er
aber packte den ersten bei den Hinterbeinen und schlug seinen Kopf gegen
einen Eisberg, in dessen Nähe er gerade stand. Dem anderen ergings nicht
besser. Den dritten aber trug er zum Dorf hinauf und erschlug einige seiner
Feinde mit ihm. Andere würgte er mit den Händen zu Tode, oder er spaltete
ihre Köpfe und schrie: »Das ist dafür, daß ihr mich mißhandelt habt; das
ist für eure Quälereien!« Die er nicht umbrachte, liefen weg, um niemals
wiederzukehren. Nur einige, welche zum kleinen, armen Qaudjaqdjuq
freundlich gewesen waren, darunter auch das Mädchen, welches ihm das Messer
geschenkt hatte, verschonte er. Qaudjaqdjuq lebte dann als großer Jäger
weiter und zog, viel Heldentaten vollbringend, durchs Land. --
Der Mann im Monde
Vor langer Zeit lebte einmal ein Mann, der seine Frau wenig gut behandelte.
Eines Tags schlug er sie wieder, obwohl sie schwanger war. Spät am Tag ging
er dann Seehunde jagen. Es war eine klare Nacht, Sterne und Mond schienen
hell. Da rief die Frau den Mann im Mond an und bat ihn herunterzukommen.
Gegen Morgen hörte sie jemand mit Hunden sprechen und sah einen von zwei
Hunden gezogenen Schlitten. Es war der Mann vom Mond und seine beiden Hunde
Terii-tiaq und Kanageak. Der Mann vom Mond rief ihr zu: »Komm heraus!« Sie
folgte und er hieß sie sich auf seinen Schlitten setzen. Dann befahl er ihr
die Augen zu schließen und sie nicht früher zu öffnen, als bis sie an ihrem
Bestimmungsort angekommen wären. Sie schloß die Augen und dann schwebten
sie aufwärts durch die Luft. Nach geraumer Zeit sagte der Mann vom Mond:
»Mach jetzt deine Augen auf!« Sie antwortete: »Ich glaube, wir sind
angekommen.« Sie sah sich um und bemerkte ein Schneehaus. Die beiden traten
ein. Innen war alles sehr hübsch. Der Mann lud sie ein bei ihm zu bleiben
und sagte: »Du sollst auf der linken Seite gegenüber der Haustüre sitzen.«
Er selbst setzte sich auf die rechte Seite, der Lampe gegenüber. Nach
einiger Zeit bat er sie, zu ihm herüber zu kommen und zeigte ihr dicht bei
seinem Sitzplatz ein Loch, durch welches sie auf die Erde hinunter sehen
konnte. Sie konnte ihren Mann in Kleidern voll Schnee und Eis vor seiner
Haustür sitzen sehen. Er war gerade vom Seehundsfang zurückgekehrt und
hatte die Abwesenheit seiner Frau entdeckt. Sie war sehr erstaunt, trotz
der großen Entfernung, alles so klar zu sehen.
Da sagte der Mann im Mond zu ihr: »Es wird jetzt bald eine Frau namens
Ululiernang hereinkommen. Lache über nichts, was sie tun wird, sonst
schneidet sie dir die Eingeweide heraus; sie ist ganz versessen auf solche
Speise. Wenn du merkst, daß du dir das Lachen nicht verbeißen kannst, steck
deine linke Hand unters Knie und streck sie dann aus mit allen Fingern, vom
zweiten Glied an abgebogen, nur den Mittelfinger mußt du ausstrecken.« Kaum
hatte er das gesagt, als auch schon Ululiernang herein kam. Sie trug eine
flache Schüssel und ein Frauenmesser. Sie stellte beides hin und fing eine
Menge Possen an. Sie nahm den Vorderlatz ihrer Jacke, rollte ihn zusammen
und hielt ihn vor, als wollte sie sagen: »Weiche ja nicht von diesem Weg
ab!« Und sie machte viele Luftsprünge, um die Frau zum Lachen zu bringen.
Als die Besucherin sich schon nah daran fühlte, herauszulachen, zog sie die
Hand unter dem Knie hervor und streckte sie gegen Ululiernang. Da sagte
diese: »Ich habe große Angst vor diesem Bären.« Sie glaubte die Hand der
Frau sehe genau wie eine Bärenpratze aus. Dann aßen der Mann und die Frau
zu Mittag. Nach einiger Zeit sagte der Mann im Mond zur Frau, es wäre jetzt
Zeit, auf die Erde zurückzugehen, »und sobald dein Kind geboren sein wird,
wirst du ein Geräusch hören, als ob etwas heruntergefallen wäre. Du mußt
dann hinausgehen und nachsehen, was es ist.« Dann brachte er sie zurück auf
die Erde; zur Hütte ihres Mannes.
Ihr Mann erzählte ihr, wie unglücklich er sich gefühlt, als er bemerkt
hatte, daß sie weggegangen war. Er hatte sie schon tot geglaubt. Dann
erzählte sie ihrem Mann, was sich alles zugetragen hatte.
Nach einiger Zeit gebar sie das Kind. Es war ein Knabe. Ihr Gatte war
wieder beim Seehundsfang und sie war allein. Da hörte sie etwas fallen und
ging hinaus, um zu sehen, was es sei. Sie fand einen Renntier-Schinken, den
sie in die Hütte nahm. Am Abend kam ihr Gatte zurück und als er das
Renntierfleisch sah, fragte er, woher sie das bekommen hätte. Sie erzählte,
daß es vom Himmel gefallen sei: »Es ist vom Mann im Mond, der versprochen
hat, mir etwas zu schicken.« Als nach einiger Zeit alles Fleisch
aufgegessen war, ging der Mann wieder auf Seehunde aus. Die Frau hatte kein
Fett für ihre Lampe. Auf einmal sah sie Fett heruntertropfen, zuerst in die
eine, dann in die andere Lampe. Als die Lampen voll waren, rief sie: »Das
ist genug!« Sie wußte, daß auch das ein Geschenk vom Mann im Mond war.
Abends kam ihr Mann zurück. Er war erstaunt, als er das Öl sah und fragte,
woher es komme. Sie erzählte: »Die Lampen haben sich selbst gefüllt und wie
ich sah, daß genug Fett da war, sagte ich >halt<!«
Den nächsten Tag ging der Gatte wieder hinaus Seehunde jagen. In seiner
Abwesenheit hörte die Frau wieder etwas fallen und als sie hinausging, fand
sie wieder einen Renntierschinken. Am Abend kam der Mann zurück und hatte
einen Seehund erlegt. Er fragte: »Hast du noch Renntierfleisch?« »Ja!«
erwiderte sie, »der Mann im Mond hat mir wieder welches gegeben.« Abends
sah dann der Mann, wie sich die Lampen mit Öl füllten.
Als er am nächsten Tag wieder auf der Seehundsjagd war, erbeutete er einen
anderen Seehund und brachte ihn nach Hause. Während er ihn zerlegte, sagte
er zu seiner Frau: »Hier ist doch genug Seehundsfleisch, warum ißt du nicht
davon? Ich selbst habs ja erlegt.« Die Frau hatte bisher nur
Renntierfleisch gegessen, das ihr der Mann vom Mond gegeben hatte; jetzt
verzehrte sie etwas vom Seehund ihres Mannes. Von dieser Zeit an fiel nie
mehr Renntierfleisch vom Himmel und ihre Lampen füllten sich nicht mehr mit
Fett. Bald wurde sie krank. Das Renntierfleisch war aus und sie starb. Auch
ihr Kind starb. Der Übergang von Renntierfleisch zu Seehundsfleisch,
während das Kind noch so klein war, war so schädlich gewesen, daß er den
Tod des Kindes verursacht hatte.
Der Riese
In einer dunklen Winternacht lief eine Frau durch das Dorf Nikh-tua und
hinaus in die verschneite Tundra. Sie floh vor ihrem Mann, dessen
Grausamkeit ihr unerträglich geworden war. Die ganze Nacht hindurch und
noch viele Tage wanderte sie nordwärts und machte um die Dörfer, in deren
Nähe sie kam, einen Bogen, aus Furcht, entdeckt zu werden. Schließlich
hatte sie schon alle Anzeichen menschlichen Lebens hinter sich und die
Kälte wurde ärger und ärger. Ihr geringer Mundvorrat war verbraucht und um
den Hunger zu stillen, begann sie Schnee zu essen. Eines Tags, als es schon
Nacht wurde, war sie an einen so windigen Ort gekommen, daß sie gezwungen
war, weiterzugehen. Schließlich sah sie etwas wie einen Hügel mit fünf
Buckeln auf seinem Rücken vor sich, als sie näherkam, sah sie, daß er einem
sehr großen Menschenfuß ähnelte. Nachdem sie den Schnee zwischen zwei
Erhöhungen, die wie ungeheure Zehen aussahen, weggefegt, fand sie es warm
und bequem da und schlief bis zum Morgen, wo sie dann aufbrach und bis zu
einer vereinzelten Erhebung, die in der verschneiten Ebene erschien,
weiterging. Diese erreichte sie bei Einbruch der Nacht und bemerkte, daß
sie wie ein großes Knie geformt war. Sie fand einen geschützten Platz und
blieb da, bis sie Morgens weiterging. Diesen Abend schützte sie für die
Nacht ein Hügel, der einem großen Schenkel glich. Die nächste Nacht fand
sie in einer runden, grubenartigen Vertiefung, um die herum verstreut
Sträucher wuchsen, Schutz; als sie Morgens diesen Ort verließ, erschien er
ihr wie ein großer Nabel.
Die nächste Nacht schlief sie in der Nähe zweier, wie enorme Brustmuskeln
aussehender Hügel; die folgende Nacht fand sie eine geschützte, geräumige
Höhlung, in der sie schlief. Als sie morgens gerade daran war von hier
aufzubrechen, glaubte sie aus der Gegend, wo sie ihre Füße hatte, eine
mächtige Stimme zu vernehmen: »Wer bist du? Was hat dich zu mir getrieben,
zu dem menschliche Wesen niemals kommen?« Sie war sehr erschrocken, brachte
es aber doch zustande, ihre traurige Geschichte zu erzählen und daraufhin
sprach die Stimme wieder: »Gut, du kannst hier bleiben, aber du darfst
nicht mehr in der Nähe meines Mundes oder meiner Lippen schlafen, denn wenn
ich dich anhauchte, so würde ich dich wegblasen. Du mußt hungrig sein. Ich
will dir etwas zu Essen verschaffen.«
Während sie wartete, fiel ihr plötzlich ein, daß sie fünf Tage über den
Körper des Riesen Kin-äk gewandert war. Nun wurde der Himmel plötzlich
finster und eine große schwarze Wolke kam langsam auf sie zu; wie sie näher
war, sah sie, daß es die Hand des Riesen war, welche sich öffnete und ein
frisch getötetes Renntier fallen ließ und die Stimme sagte ihr, sie solle
davon essen. Rasch brach sie einiges Strauchholz, das überall herumwuchs,
machte Feuer und aß gierig das gebratene Fleisch. Der Riese sagte wieder:
»Ich weiß, du willst einen Platz, wo du bleiben kannst und da ist es am
besten für dich, in meinen Bart zu gehen, dort, wo er am dichtesten wächst,
maßen ich jetzt Atem holen will, um den angesammelten Reif, der mich quält,
aus meinen Lungen zu bringen; geh also schnell!«
Sie hatte gerade noch Zeit in den Bart des Riesen hinunterzusteigen, als
ein fürchterlicher Sturmwind über ihren Kopf dahinbrauste, begleitet von
einem blendenden Schneesturm, der aber, nachdem er sich über die Tundra
ausgebreitet, so rasch aufhörte, als er begonnen und mit einemmal wurde der
Himmel wieder hell.
Den andern Tag sagte ihr Kin-äk, sie solle sich einen guten Platz suchen
und aus seinen Barthaaren eine Hütte bauen. Sie sah sich um und wählte
unweit seines Nasenloches, auf der linken Seite der Nase, eine Stelle und
baute aus seinen Schnurrbarthaaren ihre Hütte. Hier lebte sie lange Zeit;
der Riese half ihren Nöten ab, indem er seine große Hand ausstreckte und
Renntiere und Seehunde oder was sie sonst immer zur Nahrung wollte,
erbeutete. Aus Wolfsfellen, Fellen von braunen Vielfraßen und anderen
befellten Tieren, die er für sie fing, machte sie sich selbst nette Kleider
und bald hatte sie einen großen Vorrat von Fellen und Pelzen zurückgelegt.
Kin-äk fand mit der Zeit, daß sein Schnurrbart schütter werde, da sie die
Haare als Feuerholz verwandte und er verbot ihr fürder, welche zu nehmen,
aber er sagte, sie könne von den Haaren nehmen, die an der Seite des
Gesichts wuchsen, wenn sie noch welche brauche. Lange Zeit verging so.
Eines Tages fragte sie Kin-äk, ob sie nicht nach Hause gehen wolle. »Ja«,
sagte sie, »nur fürchte ich, mein Mann wird mich wieder schlagen und ich
werde niemand haben, der mich beschützen wird.«
»Ich will dich beschützen«, sagte er. »Geh, schneide die Ohrspitzen von
allen Fellen, die du hast, ab und gib sie in einen Korb. Dann setz dich
selbst vor meinen Mund und wenn du einmal in Gefahr sein solltest, vergiß
nicht zu rufen: »Kin-äk, Kin-äk, komm zu mir« und ich werde dich
beschützen. Geh jetzt und tu, wie ich dir gesagt habe. Es ist Zeit. Ich bin
schon müde, so lange an einem Platz zu liegen und will mich umdrehen, und
wenn du dann hier wärest, würdest du zerquetscht werden.« Dann tat die
Frau, wie ihr gesagt worden und kauerte sich vor seinen Mund.
Auf einmal erhob sich ein Wind und Schneewehen und die Frau fühlte sich
davongehoben bis sie schläfrig wurde und die Augen schloß; als sie
erwachte, war sie in der Gegend der Häuser von Nikh-tua, konnte aber nicht
glauben, daß dem so sei, bis sie das gewohnte Geheul der Hunde hörte. Sie
wartete den Abend ab und ging dann, nachdem sie den Korb mit den Ohrspitzen
ins Vorhaus gestellt, in das Haus des Gatten. Der hatte sie schon lange als
tot betrauert und seine Freude über ihre Rückkehr war sehr groß. Dann
erzählte sie ihre Geschichte und ihr Mann versprach, sie nie mehr schlecht
zu behandeln. Als er den nächsten Tag durch sein Vorhaus ging, war er sehr
erstaunt, es mit wertvollen Pelzen angefüllt zu finden; es hatte sich jede
Ohrspitze, die seine Frau gebracht, über Nacht in ein ganzes Fell
verwandelt.
Diese Felle machten ihn sehr reich und er wurde infolgedessen einer der
Häuptlinge des Dorfes. Nach einiger Zeit aber fühlte er sich unglücklich,
denn er hatte keine Kinder und sprach daher zu seiner Frau: »Was wird mit
uns sein, wenn wir alt und schwach sind und niemand haben, der für uns
sorgt? Ja, wenn wir nur einen Sohn hätten!« Eines Tages hieß er seine Frau
sich sorgfältig zu baden; dann tauchte er eine Feder in Öl und zeichnete
damit die Gestalt eines Knaben auf ihren Bauch. Nach der bestimmten Zeit
gebar sie einen Sohn und sie waren sehr glücklich. Der Knabe wuchs rasch
auf und zeichnete sich vor allen Kameraden durch Stärke, Gewandtheit und
als guter Schütze aus. Zur Erinnerung an den Riesen wurde er Kin-äk
genannt. Schließlich wurde der Gatte dann aber doch wieder unfreundlich und
mürrisch wie früher und eines Tages gar so aufgebracht, daß er einen Stock
nahm, um seine Frau zu schlagen. Sie lief aus Angst aus dem Haus, glitt
aber draußen aus und fiel; und wie ihr Mann dicht an ihr war, erinnerte sie
sich des Riesen und rief: »Kin-äk! Kin-äk! komm zu mir.« Sie hatte diese
Worte kaum gesprochen, als ein fürchterlicher Windstoß über sie wegblies
und den Mann wegfegte, daß er nie mehr gesehen wurde.
Jahre vergingen und Jung-Kin-äk wuchs zu einem schönen, starken jungen Mann
heran, wurde ein sehr erfolgreicher Jäger, hatte aber ein wildes und
grausames Temperament. Eines Abends kam er nach Hause und erzählte seiner
Mutter, daß er mit zweien seiner Gefährten Streit gehabt und beide getötet
habe. Seine Mutter machte ihm Vorwürfe, indem sie ihn an die Gefahren der
Blutrache seitens der Verwandten der Ermordeten erinnerte. Eine Zeit
verstrich und die Sache schien vergessen.
Wieder einmal kam Kin-äk damit nach Hause, daß er einen Genossen getötet
habe. Seither hatte er alle paar Tage mit jemand Streit, was immer damit
endete, daß er ihn erschlug. Schließlich hatte er so viel Leute erschlagen,
daß seine Mutter ihm nicht länger erlauben wollte, mit ihr zu leben. Er
schien aber darüber sehr erstaunt und sagte: »Bist du denn nicht meine
Mutter? Wie kannst du mich so behandeln?«
»Ja«, sagte sie, »ich bin deine Mutter, aber dein Ungestüm hat es so weit
gebracht alle unsere Freunde umzubringen, oder zu vertreiben. Jeder haßt
und fürchtet dich und bald wird niemand, außer alten Weibern und Kindern im
Dorf leben. Geh weg! Verlaß diesen Ort, das wird für uns alle besser sein.«
Kin-äk sagte nichts, sondern jagte eine Zeitlang unausgesetzt, bis er
seiner Mutter Vorhaus mit Fleisch und Pelzen angefüllt hatte. Dann ging er
zu ihr und sagte: »Jetzt habe ich dich mit Nahrung und Pelzen versehen,
wie meine Pflicht war, ich bin bereit, dich zu verlassen« und ging weg.
Zufällig schlug er die gleiche Richtung ein, die seine Mutter auf ihrer
Flucht gegangen war und kam schließlich zum Kopf des Riesen. Als der Riese
erfuhr, daß er der Sohn jener Frau sei, die bei ihm gewesen, erlaubte er
dem jungen Mann dazubleiben, sagte ihm aber, er solle ja nie an seine
Lippen kommen, denn wenn er das wage, werde ihm etwas Böses zustoßen.
Einige Zeit lebte Kin-äk da ganz ruhig, aber zuletzt fiel ihm doch ein zu
den Lippen des Riesen zu gehen und zu sehen, was denn dort wäre. Nach einem
guten Stück harter Arbeit durch das Bartdickicht auf des Riesen Kinn,
erreichte er den Mund. Im Augenblick, da er über die Lippen schritt und zur
Öffnung zwischen ihnen gelangte, blies ein mächtiger Windstoß heraus,
wirbelte ihn in die Luft und er ward nicht mehr gesehen.
Der Riese lebt noch immer im Norden, obwohl bis auf den heutigen Tag seit
jener Zeit niemand dort war. Aber wenn er atmet, geben die wilden,
schneeigen Nordstürme des Winters von seinem Dasein Kunde.
Der seltsame Knabe
In einem Dorf, weit im Norden, lebte ein Mann mit Frau und Kind; das war
ein Sohn. Dieser Knabe war ganz anders als die anderen: wenn die Dorfkinder
herumliefen, schrien und miteinander spielten, saß er still und
gedankenvoll am Dach des Hauses und niemals aß er oder trank er etwas
anderes, als was seine Mutter ihm gab.
Die Jahre verstrichen und er wurde mannbar, aber seine Gewohnheiten waren
noch immer die gleichen geblieben. Seine Mutter nähte ihm nun ein Paar
Fellschuhe mit sehr dicken Sohlen, einen doppelten wasserdichten Anzug, und
noch einen aus den Fellen einjähriger Renntiere. Täglich saß er am
Hausdach, ging am Abend hinein essen und schlief bis zum nächsten frühen
Morgen, ging dann wieder aufs Dach zurück und erwartete den Tagesanbruch.
Eines Tages aber ging er, nachdem die Sonne aufgegangen war, wieder nach
Hause und fand seine neuen Kleider fertig. Er versah sich mit
Lebensmitteln, zog die neuen Kleider an und erklärte dann seiner Mutter,
daß er auf eine Reise nach Norden gehe. Seine Mutter weinte bitterlich und
bat ihn, doch nicht dorthin zu gehen, denn keiner von denen, die nach dem
hohen Norden gegangen, sei jemals zurückgekehrt. Er beachtete das aber
nicht, sondern nahm seinen Bärenspieß, verabschiedete sich und ging fort;
die Eltern ließ er weinend und ohne alle Hoffnung auf seine jemalige
Heimkehr zurück, obwohl sie ihn sehr liebten und seine Mutter ihm
ausdrücklich gesagt hatte, daß noch keiner ihres Dorfes, der nach Norden
gegangen, je wiedergekommen wäre.
Der junge Mann wanderte weit und erreichte, als es Abend wurde, eine Hütte,
aus deren Dachluke Rauch aufstieg. Er zog nun den wasserdichten Anzug aus,
legte ihn vor den Eingang und kroch dann behutsam aufs Dach und blickte
durch den Rauchabzug. In der Mitte des Raumes brannte ein Feuer und eine
alte Frau saß am Platz des Hausvaters, während ein alter Mann, der gerade
vor ihr saß, Pfeile schnitzte. Während der junge Mann noch am Dach lag,
rief der Alte ohne seinen Kopf emporzuheben: »Warum liegst du da draußen?
Komm doch herein!« Der Junge glaubte sich entdeckt, obwohl der Alte gar
nicht aufgesehen hatte, erhob sich und ging hinein. Als er eintrat begrüßte
ihn der Mann und fragte, warum er nach Norden auf die Suche nach einem Weib
gehe und fuhr dann fort: »Es sind dort viele Gefahren, du tätest besser
daran, umzukehren; ich bin der Bruder deines Vaters und meine es gut mit
dir. Weiter hinaus zu sind die Leute sehr schlecht und wenn du weitergehst,
wirst du nie zurückkommen.«
Der junge Mann war sehr erstaunt, den Zweck seiner Reise zu hören, da er
ihn nicht einmal seinen Eltern verraten hatte. Nachdem er hier etwas
gegessen, schlief er bis zum nächsten Morgen und schickte sich dann an,
weiter zu gehen. Der alte Mann gab ihm ein kleines schwarzes Ding, das mit
etwas gelbem, wie ein Eidotter, gefüllt war und sagte dabei: »Wenn du
unterwegs wenig zu essen haben wirst, soll dich das stärken.« Der junge
Mann schlang es mit einem Schluck hinunter, fand es sehr schmackhaft,
schöpfte tief Atem und sagte: »Ah, jetzt fühle ich mich stark.« Dann nahm
er seinen Speer und zog los. Knapp vor Einbruch der Nacht kam er zu einer
anderen einsamen Hütte und als er hineinsah, bemerkte er wieder ein Feuer,
eine alte Frau an der einen Seite sitzend und gerade unter sich einen Mann,
der Pfeile schnitzte. Wieder rief der alte Mann, ohne den Kopf zu heben
hinaus und fragte, warum er nicht hereinkomme, sondern draußen stehe.
Wieder war er erstaunt den Zweck seiner Reise zu vernehmen und abermals
wurde er gewarnt weiterzuziehen. Auf all das aber achtete der Jüngling
nicht, sondern aß und schlief da, wie tags zuvor. Als er am Morgen bereit
war aufzubrechen, sah der alte Mann ein, daß er ihn nicht zurückhalten
könne und so gab er ihm ein kleines, rein-weißes Ding und bedeutete dem
Wanderer, er werde unterwegs nicht viel zu essen bekommen und dies werde
ihm helfen. Auch dies Ding schluckte der Jüngling auf einmal hinunter, fand
es aber nicht so kräftigend, wie das Ding, das er am vorigen Morgen
genossen hatte. Der alte Mann gab ihm noch den Rat, wenn er unterwegs etwas
hören sollte, was ihn erschrecke, das zu tun, was ihm zuerst einfalle.
»Niemand würde, wenn mir etwas zustößt, um mich weinen«, sagte der
Wanderer und zog, den Speer in der Hand, davon. Ungefähr um die Mittagszeit
gelangte er in der Nähe der Küste an einen großen Teich und umging ihn auf
der Landseite. Als er schon ein Stück dieses Umwegs hinter sich hatte,
hörte er ein entsetzliches Gebrüll, wie Donnerschläge; aber so laut war es,
daß ihm ganz schwindlig wurde und er für einen Augenblick gar nichts von
seiner Umgebung bemerkte. Er lief vorwärts, aber der fürchterliche Lärm
wiederholte sich alle Augenblicke, so daß er jedesmal stolperte, schwindlig
wurde und ganz nahe der Ohnmacht war; er hielt es aber doch aus. Der Lärm
nahm zu und schien mit jedem Schrei näher zu kommen, bis er dicht an seiner
Seite ertönte. Er sah in die Richtung, aus der er herkam und bemerkte einen
großen Korb aus Weidenruten durch die Luft auf sich zufliegen; von dem
rührte der entsetzliche Lärm her.
Der Wanderer sprang in eine nahgelegene Erdhöhle, als ein fürchterlicher
Krach die Erde erschütterte und er bewußtlos wurde. Einige Zeit, während
der Korb sich herum bewegte, als suche er ihn und fürchterliche Laute von
sich gab, lag er wie tot da. Als der Jüngling dann wieder zu sich kam,
horchte er erst einige Zeit auf und da alles ruhig war, stieg er aus seinem
Versteck und sah sich um. Ganz in der Nähe lag der Korb am Boden und eines
Mannes Kopf und Schultern sahen oben heraus. Wie der Jüngling das sah,
schrie er: »Auf was wartest du? Geh, sei nicht langweilig und mach mir
einen anständigen Lärm, du!« Dann sprang er zurück in die Höhle und wurde
von dem fürchterlichen Gebrüll aus dem Korb sofort wieder bewußtlos. Als er
wieder genugsam zu sich gekommen war, stieg er heraus, konnte den Korb aber
nirgends sehen. Da hob er beide Hände auf und rief Donner und Blitz an, ihm
zu Hilfe zu kommen. Da kam auch der Korb gerade wieder heran, aber oben sah
nur der Kopf des Mannes heraus. Nun hieß er Donner und Blitz auf den Korb
losfahren und die machten ein derartiges Gekrach, daß dem Korb-Zauberer
Angst und bange wurde und er zu Boden fiel.
Sobald der Donner aufhörte, begann der Korb sich zurückzuziehen; der
Zauberer war schon fast tot vor Angst. Da rief der junge Mann: »Donner,
verfolg ihn! Geh vor ihm und hinter ihm und erschrick ihn!« Der Donner tat
so und der Korb flog davon, von Zeit zu Zeit zu Boden fallend. Dann ging
der Wanderer weiter und erreichte in der Dämmerung ein Dorf. Wie er näher
kam, lief ihm ein Knabe entgegen und sagte: »Wieso kommst du aus dieser
Richtung hierher! Von der Seite ist noch nie jemand hergekommen, denn der
Korbzauberer läßt kein lebendes Wesen am See vorbei, gar keins, nicht
einmal eine Maus. Er bemerkt es immer, wenn irgend etwas diesen Weg daher
kommt und geht ihm entgegen, um es umzubringen.«
»Ich habe nichts gesehen«, sagte der Wanderer. »Gut«, sagte der Knabe, »du
bist ihm noch nicht entronnen, denn der Korbmann ist jetzt da und wird
dich umbringen, wenn du nicht umkehrst.« Und als der Jüngling sich umsah,
erhob sich ein großer Adler und flog auf ihn zu; der Knabe lief weg. Der
Adler kam näher, erhob sich noch ein wenig und schoß dann auf ihn herab, um
ihn mit seinen Klauen zu zerreißen. Wie er so herabkam, schlug sich der
Jüngling mit der Hand auf die Brust und aus seinem Mund flog ein Geierfalke
schnurstracks auf den Adler los, ihm zum Hinterleib hinein und beim
Schnabel heraus und davon.
Dieser Geierfalke entstammte dem Stärkungsmittel, das der erste alte Mann
dem Jüngling unterwegs gegeben hatte. Während der Geierfalke aus dem Adler
herausflog, schloß dieser die Augen und schnappte nach Luft; diese
Gelegenheit benutzte der Jüngling, um zur Seite zu springen, so daß dort,
wo er gerade gestanden, des Adlers Klauen in den Boden griffen. Wieder
erhob sich der Adler und stieß herab und wieder schlug sich der junge Mann
mit der Hand auf die Brust und ein Hermelin sprang aus seinem Mund, fuhr
wie ein Blitz dem Adler unter die Flügel und fast im gleichen Augenblick
hatte er sich schon zweimal durch den Leib des Vogels hin und her
hindurchgefressen, so daß dieser tot niederfiel, worauf der Hermelin
verschwand. Dieser Hermelin entstammte dem Geschenk des anderen alten
Mannes, bei dem der Wanderer gerastet hatte.
Nachdem nun der Adler gefallen war, begab sich der Jüngling zum Haus des
Zauberers und der Knabe schrie ihn an: »Geh nicht dorthin, du wirst
umgebracht werden!« Daraufhin entgegnete ihm der Wanderer: »Ich habe keine
Angst, ich will das Weib dort drinnen sehen und ich muß jetzt hingehen,
denn ich bin wütend und wenn ich bis morgen warte, wird mein Ärger
verflogen sein und ich werde nicht so stark sein wie jetzt.« »Du tätest
besser daran, bis morgen zu warten«, sagte der Knabe, »denn es bewachen
zwei Bären den Eingang und die werden dich sicherlich umbringen. Aber wenn
du durchaus willst, so geh und laß dich umbringen. Ich wollte dich nur
retten und will nun nichts mehr mit dir zu tun haben.« Und ärgerlich ging
der Knabe ins Haus zurück. Der Jüngling ging nun zum Haus und bemerkte, als
er in den Eingangsflur hineinsah, dort einen großen weißen Bären schlafend
liegen. Er schrie ihn an: »Ah, Weißbär!« worauf dieser aufsprang und auf
ihn zulief. Der junge Mann sprang nun auf die Decke des Eingangsflurs und
als der Bär hinter ihm herauslief, stieß er ihm seinen Speer ins Hirn, daß
er tot zusammenbrach. Den Körper wälzte er nun beiseite, sah wieder hinein
und erblickte einen roten Bären dort liegen. Wieder rief er: »Ah, Rotbär!«
Der rote Bär rannte ihm nach und er sprang wieder auf seinen vorigen Platz.
Als der rote Bär draußen war, schlug er mit seiner Vorderpratze nach ihm;
da packte der Jüngling die Pratze mit der Hand und schwang den Bären über
seinem Kopf und schlug ihn gegen den Boden, bis nichts mehr von ihm übrig
war, als die linke Pratze. Die warf er weg und ging nun ohne weitere
Schwierigkeiten ins Haus. An der einen Hauswand saß ein alter Mann und eine
alte Frau und an der gegenüberliegenden, ein schönes junges Weib, dessen
Antlitz er in seinen Träumen gesehen hatte und die der Anlaß zu seiner
langen Fahrt gewesen war. Sie weinte, als er hereinkam; er ging auf sie zu,
setzte sich neben sie und sagte: »Warum weinst du? Was hast du verloren,
daß du danach weinst?« Sie antwortete: »Du hast meinen Mann umgebracht,
aber deswegen bin ich nicht traurig, denn er war ein schlechter Mann. Aber
du hast auch die beiden Bären getötet, die meine Brüder waren und um die
traure und weine ich.« »Weine nicht«, sagte er, »denn ich will dein Gatte
sein.« Er blieb nun eine Zeitlang da, nahm dieses Weib zu seiner Frau und
lebte in dem Haus zusammen mit ihren Eltern. Jede vierte Nacht schlief er
im Festhaus und die übrige Zeit zu Hause.
Nachdem er einige Zeit hier gelebt hatte, fiel ihm auf, daß seine Frau und
ihre Eltern immer trauriger wurden und sehr oft weinten. Dann sah er Dinge
vor sich gehen, die ihn glauben machten, sie sännen darauf ihm etwas
anzutun. Als er sich hierüber Gewißheit verschafft hatte, ging er eines
Tags nach Hause, legte seiner Frau die Hand auf die Stirne, drehte ihr
Gesicht zu sich herum und sagte: »Ihr wollt mich umbringen, du treuloses
Weib; zur Strafe sollst du sterben!« Dann nahm er sein Messer und schnitt
ihr den Hals durch. Traurig ging er nun zurück in sein Heimatsdorf, wo er
nachdem die Erinnerung an sein treuloses Weib verblaßt war, wie früher, bei
seinen Eltern lebte. Er nahm aus den Jungfrauen des Dorfes eine zur Frau
und verlebte mit ihr glücklich den Rest seiner Tage.
Das Land der Finsternis
Vor langer Zeit lebte auf der Insel Aziak ein Mann mit seiner Frau und
seinem kleinen Sohn. Der Mann liebte seine Frau sehr, war aber so
eifersüchtig auf sie, daß er sie sehr oft ohne Grund schlecht behandelte.
Nach einiger Zeit wurde die Frau so unglücklich, daß sie lieber sterben,
als noch länger mit ihm zusammenleben wollte. Sie ging zu ihrer Mutter, die
in der Nähe lebte und trug ihr ihren ganzen Kummer vor. Die alte Frau hörte
die Klagen an und gab dann der Tochter den Rat, ein Seehundsfell zu nehmen
und es mit der Losung von drei Schneehühnern und drei Füchsen einzureiben;
dann sollte sie eine Holzschüssel mit Speisen füllen, das Kind auf den
Rücken nehmen und zu ihrem Mann zurückgehen; es werde vielleicht alles
wieder gut werden.
Sie tat, wie ihr geraten war und ging dann an die Küste hinunter, ihrem
Mann entgegen. Als er in Rufweite kam, fing er wieder, wie gewöhnlich, an,
sie zu schmähen und zu beschimpfen und befahl ihr, sofort nach Hause zu
gehen; sowie er heimkomme, werde er sie prügeln. Als das arme Weib das
hörte, lief sie an den steilen Rand des überhängenden Ufers und warf ihr
Seehundsfell ins Wasser, gerade als ihr Mann seinen Kajak an den Strand
zog, und sprang ihm nach. Der Mann sah dem erschrocken zu und lief schnell
auf einen Hügel, um zu sehen, was mit seiner Frau geschehen sei. Er sah
sie auf dem ausgebreiteten Seehundsfell, das an jeder Ecke von einer Blase
getragen wurde, sitzen und rasch von der Küste wegtreiben. Als die Frau ins
Meer gesprungen war, hatte sich das Seehundsfell ausgebreitet und an jedem
Ende war ein Schwimmer erschienen; es fing sie auf und hielt sie unversehrt
an der Oberfläche. Gleich darauf begann sie fortzutreiben, ein Sturm erhob
sich und die Nacht brachte sie ihrem Mann außer Sicht. Der ging schimpfend
nach Hause und machte alle, nur nicht sich selbst, für seinen Verlust
verantwortlich.
Weiter und weiter trieb die Frau auf dem Zauberfell und mehrere Tage
hindurch war kein Land zu sehen. Sie hatte schon ihren ganzen Mundvorrat
verbraucht und trieb noch immer weiter, bis sie in ununterbrochene Nacht
hineinkam. Nach einiger Zeit war sie dann so erschöpft, daß sie einschlief.
Dann weckten sie einige heftige Stöße und sie konnte die Brandung an einer
steinigen Küste hören. Sie vergegenwärtigte sich ihre Lage und fing an,
ihre Rettung zu bedenken. Sie stieg von ihrem Seehundsfell herunter und
bemerkte mit Freuden, daß sie auf einem Grund aus lauter kleinen, runden
Dingern stand, in dem ihr Fuß bei jedem Schritt tiefer sank. Die runden
Dinger machten sie stutzig, sodaß sie stehen blieb und zwei Hände voll
davon aufhob und in ihre Eßschüssel legte; dann ging sie in tiefer
Finsternis langsam weiter. Sie war noch nicht weit gegangen, da stieß sie
auf ein Haus. Sie tastete sich die Wände entlang, fand den Eingang und
trat ein. Der Eingangsflur war von einer Fettlampe matt erhellt, sodaß man
an der einen Wand viele aufgestapelte Renntierfelle erkennen konnte; an der
anderen lagen Fleischstücke und Schläuche mit Wal- und Seehundsfett. Als
sie den Innenraum betrat, brannten da zwei Lampen, je eine an einer Seite
des Raumes; es war aber niemand drinnen. Über einer der Lampen hing ein
Stück Seehundsspeck und über der anderen ein Stück Renntierspeck; von
diesen tropfte das Fett herab und unterhielt die Flammen. In einer Ecke war
eine Bettstatt aus Renntierfellen.
Sie ging also da hinein, setzte sich nieder und wartete, was nun geschehen
werde. Endlich hörte sie ein Geräusch im Eingang und ein Mann sagte: »Ich
wittere fremde Menschen.« Dann kam er herein und die Frau erschrak sehr,
denn seine Hände und sein Gesicht waren kohlschwarz. Er sagte nichts,
sondern ging durch den Raum, geradewegs auf sein Bett zu; dort entblößte er
seinen Oberkörper, nahm einen Wassereimer und wusch sich. Als die Frau sah,
daß seine Brust so weiß wie ihre eigene war, atmete sie erleichtert auf.
Als sie so dasaß, sah sie, wie von einer unsichtbaren Person plötzlich eine
Schüssel mit gekochtem Fleisch hereingestellt wurde; der Mann legte zuerst
seinem Gast vor und nahm dann selbst sein Mahl ein. Als sie gegessen
hatten, fragte er, wie sie hergekommen und sie erzählte ihm ihre
Geschichte. Er sagte, sie solle sich nicht unglücklich fühlen, ging hinaus
und brachte einige Renntierfelle herein, damit sie daraus für sich und ihr
Kind, das sie die ganze Zeit über unversehrt am Rücken getragen hatte,
Kleider mache. Als sie einwandte, sie habe keine Nadel, brachte er ihr eine
kupferne, die ihr sehr gut gefiel, denn bis dahin hatte sie nur beinerne
gesehen.
Einige Zeit lebten sie nun so dahin, bis ihr der Mann erklärte, daß es doch
besser für sie wäre, statt so allein weiterzuleben, seine Frau zu werden.
Sie willigte ein. Der Gemahl verbot ihr dann noch, aus dem Haus zu gehen
und sie lebten beschaulich zusammen.
Als ihr kleiner Bub eines Tages herumspielte, schrie er plötzlich vor
Vergnügen auf, und wie sie sich nach ihm umwandte, bemerkte sie, daß er die
Dinger ausgestreut hatte, die sie in ihre Schüssel getan, als sie die Küste
betreten hatte. Es waren große schöne, blaue Perlen.
Nach einiger Zeit gebar sie einen hübschen Knaben, in den ihr Mann ganz
vernarrt war und er versicherte ihr, er werde zu ihm sehr zärtlich sein. So
lebten sie mehrere Jahre und mit der Zeit wuchs der Knabe, den sie
mitgebracht hatte, zum Jüngling heran. Sein Pflegevater machte ihm Bogen
und Pfeile und nachdem der Junge einige Vögel damit getötet hatte, erlaubte
er ihm, ihn bei der Jagd zu begleiten. Eines Tages tötete der Junge zwei
Hasen und brachte sie nach Hause; sie waren wie alle Vögel und Tiere dieses
Landes ganz schwarz. Sie wurden abgezogen, ausgenommen und kurz darauf
frisch gekocht, noch dampfend, wie es immer mit den Speisen geschah, in
einer Holzschüssel zur Tür hereingestellt. Diesmal bemerkte die Frau zum
erstenmal, daß zwei Hände die Schüssel hereinstellten.
Das ging ihr im Kopf herum, bis sie Verdacht schöpfte, ihr Gemahl sei ihr
nicht ganz treu; sie bemerkte, daß irgend etwas sie beunruhige und fragte
den Mann, was das sei. Er setzte sich nieder und dachte kurz nach; dann
fragte er, ob sie nicht zu ihren Freunden zurück wollte. Sie entgegnete, es
sei unnütz, etwas zu wünschen, was sie nicht tun könne. Darauf sagte er:
»Gut, höre also meine Geschichte: Ich bin aus Unalaklit, wo ich eine schöne
Frau hatte, die ich sehr liebte. Sie war aber von schlimmer Gemütsart und
plagte mich so, daß ich mutlos und verzweifelt wurde. Ich war früher ein
guter und erfolgreicher Jäger und konnte nun nichts mehr erreichen. Eines
Tages paddelte ich in meinem Kajak weit aufs Meer hinaus, voll trüber
Gedanken. Da überraschte mich ein Sturm und ich konnte die Küste nicht mehr
erreichen. Der starke Wind trieb mein Kajak so fürchterlich durchs Wasser,
daß ich schließlich die Besinnung verlor und mich nun an nichts mehr
erinnern kann, als daß ich mich schließlich zerschlagen und lahm an der
Küste fand, wo auch du angeworfen wurdest. Neben mir war eine Schüssel mit
Speisen, die irgend jemand dahin gestellt haben muß und ich machte mich auf
den Weg, um die Leute zu suchen, konnte aber niemand finden. So oft ich
hungrig war, wurden Speisen hingestellt und meine Wünsche befriedigt, aber
undurchdringliches Dunkel verbarg mir alles. Ich konnte keine Menschen
finden. Als sich meine Augen an die ewige Finsternis gewöhnt hatten, so daß
ich ein wenig sehen konnte, baute ich dies Haus und lebte von da an hier
und der Geist, den du gesehen, bringt mir Nahrung und sorgt für mich.
Dieser Geist hat für gewöhnlich die Gestalt eines großen Galertfisches und
so oft ich auf die Jagd gehe, sichert mir dieses Wesen meine Beute. Ich
gewöhnte mich mit der Zeit an die Finsternis, aber weil ich ihr immer
ausgesetzt bin, sind meine Hände und mein Gesicht so schwarz geworden, wie
du siehst und das ist auch der Grund, warum ich dir befohlen habe, das Haus
nicht zu verlassen.«
Dann befahl ihr der Gatte, ihm zu folgen und er führte sie in den
Eingangsflur des Speichers, der voll von Fellen war, und öffnete dann eine
andere Tür zu einem Raum, der mit schönen Pelzen seltenster Art angefüllt
war. Er trug ihr nun auf, die Ohrspitzen dieser Felle zu nehmen und sie
zusammen mit den Perlen, die sie an der Küste gefunden, in die Schüssel zu
legen; sie tat das alles. Dann sagte der Mann: »Du willst dein altes Heim
sehen und ich will auch meine alten Freunde sehen und so wollen wir uns
also trennen. Nimm deinen Buben auf den Rücken, schließ die Augen und mach
vier Schritte!« Sie tat so, wie er ihr befohlen und als sie die Augen
öffnete, mußte sie sie gleich wieder schließen, denn sie war vom hellen
Sonnenschein ganz geblendet. Als sich ihre Augen an das Licht gewöhnt
hatten, blickte sie herum und war sehr erstaunt, ganz in der Nähe ihr
altes Heim zu sehen. Sie ging gleich zur Vorratskammer ihrer Mutter und
stellte dort die Schüssel mit den Ohrspitzen und den Perlen, die sie
mitgebracht hatte, nieder. Dann trat sie ins Haus und wurde freudig
empfangen. Die Neuigkeit ihrer Ankunft verbreitete sich rasch im ganzen
Dorf. Bald kam auch ihr früherer Gatte und voll Mitleid sah sie, daß seine
Augen vom vielen Weinen, um sie, ganz rot waren. Er bat sie, ihm doch zu
verzeihen, daß er früher gegen sie so mürrisch gewesen war und versprach,
wenn sie wieder als seine Frau zu ihm zurückkehre, sie freundlich zu
behandeln. Sie dachte lange darüber nach, willigte dann schließlich ein und
lebte eine Zeitlang ganz zufrieden mit ihm. Mit der Zeit aber kamen seine
alten Gewohnheiten wieder zum Vorschein und die Frau wurde unglücklich.
Ihr Sohn wurde ein junger Mann und die Mutter zeigte ihm die Perlen, die
sie aus dem Land der Finsternis mitgebracht hatte und einen großen Haufen
wertvolle Felle, denn jede Ohrspitze, die sie heimgebracht hatte, war
inzwischen ein vollständiges Fell geworden. Das alles schenkte sie ihrem
Sohn, ging dann fort und wurde von den ihrigen nie mehr gesehen. Ihr Sohn
wurde später wegen seiner Erfolge als Jäger und seines Reichtums an Perlen
und Pelzen, die ihm seine Mutter geschenkt hatte, der Häuptling des
Dorfes. --
Die entflohenen Weiber
Vor langer Zeit zankten sich zwei schwangere Frauen mit ihren Männern und
verließen ihre Familien und Freunde, um allein zu leben. Nachdem sie weit
gewandert waren, kamen sie an einen Platz, Igdluqdjuaq genannt, wo sie zu
bleiben beschlossen. Es war Sommer als sie ankamen. Sie fanden viel Rasen
und Torf und große Walrippen, die am Strande bleichten. Sie errichteten ein
festes Gerüst aus Knochen und füllten die Zwischenräume mit Rasen und
Torfstücken aus. So hatten sie bald ein gutes Haus, in dem sie leben
konnten. Um Felle zu bekommen, machten sie Fallen, in denen sie genug
Füchse fingen, um sich daraus Kleider zu machen. Manchmal fanden sie die
Leichen gestrandeter Seehunde oder Wale, die an die Küste gespült waren;
von diesen aßen sie das Fleisch und verbrannten den Speck. In der Nähe der
Hütte war auch ein tiefer, schmaler Renntiersteig; über diesen spannten sie
einen Strick, und wenn die Tiere vorübereilten, verwickelten sie sich darin
und erwürgten sich selbst. Außerdem war noch ein Bach mit Fischen in der
Nähe des Hauses und so waren sie mit reichlicher Nahrung versehen.
Im Winter kamen die Väter der Frauen auf der Suche nach den verlorenen
Töchtern. Als diese den Schlitten herankommen sahen, fingen sie an zu
schreien, daß sie durchaus nicht gesonnen seien zu ihren Gatten
zurückzukehren. Die Männer waren froh sie wohlauf zu finden und nachdem sie
zwei Nächte im Haus ihrer Töchter geblieben waren, kehrten sie heim, wo sie
die ganz merkwürdige Geschichte erzählten, daß zwei Frauen, ohne jegliche
männliche Gesellschaft allein leben und nie Mangel leiden.
Obwohl das schon vor langer Zeit geschehen, kann man das Haus noch sehen
und daher ist der Ort auch Igdluqdjuaq -- das reiche Haus -- benannt.
Kiviung
Eine alte Frau lebte mit ihrem Enkel in einer kleinen Hütte. Sie war sehr
arm, hatte weder einen Gatten noch einen Sohn, der für sie gesorgt hätte.
Die Kleider des Knaben waren aus den Bälgen von Vögeln, die sie in
Schlingen fingen. Wenn der Knabe aus der Hütte kam, lachten ihn die Männer
aus und zupften an seinem Gewand herum. Nur ein Mann, der Kiviung hieß, war
freundlich zu dem kleinen Knaben; aber vor den anderen konnte er ihn nicht
schützen. Der Knabe kam oft schreiend und weinend zu seiner Großmutter, die
ihn dann immer tröstete und ihm ein neues Gewand machte. Sie bat die Männer
doch aufzuhören, den Knaben zu quälen und seine Gewänder zu zerreißen, aber
die wollten nicht auf ihre Bitten hören. Schließlich wurde sie ärgerlich
und schwur an seinen Lästerern Rache zu nehmen, was sie leicht tun könne,
da sie eine große Zauberin sei.
Sie befahl ihrem Enkel in eine Pfütze, die am Boden der Hütte war,
hineinzusteigen und erklärte ihm, was dann geschehen werde und wie er sich
benehmen sollte. Sobald der Knabe im Wasser stand, öffnete sich die Erde
und er verschwand; im nächsten Augenblick aber stieg er nahe der Küste als
ein einjähriger Seehund mit einem schönen Fell auf und schwamm munter
herum.
Kaum hatten die Männer den Seehund gesehen, als sie auch schon ihre Kajaks
bestiegen, um auf das schöne Tier Jagd zu machen. Der verwandelte Knabe
aber schwamm, wie seine Großmutter ihm gesagt hatte, rasch weg und die
Männer verfolgten ihn weiter. So oft er auftauchen mußte um zu atmen,
suchte er hinter den Kajaks hervorzukommen, wo ihm die Männer mit ihren
Harpunen nicht beikommen konnten. Dort spritzte und platschte er dann
herum, um ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Bevor aber einer seinen
Kajak wenden konnte, war er wieder getaucht und schwamm davon. Die Männer
waren so eifrig an der Verfolgung, daß sie gar nicht bemerkten, daß sie
sich weit von der Küste entfernt hatten und das Land schon gar nicht mehr
zu sehen war.
Plötzlich erhob sich ein Sturm; die See schäumte und brauste und die Wellen
zerschlugen die schwachen Fahrzeuge oder warfen sie um. Nachdem alle
ertrunken zu sein schienen, wurde der Seehund wieder in den Knaben
zurückverwandelt, der, ohne seine Füße zu benetzen, nach Hause ging. Es war
jetzt niemand mehr, der seine Kleider zerreißen konnte, alle seine Peiniger
waren tot.
Nur Kiviung, der ein großer Zauberer war und den Knaben niemals mißhandelt
hatte, war Wind und Wogen entkommen. Tapfer kämpfte er gegen die wilde See
an, aber der Sturm nahm nicht ab. Nachdem er viele Tage auf der weiten See
herumgetrieben, schien eine dunkle Masse durch den Nebel. Seine Hoffnung
lebte wieder auf und er arbeitete hart um das vermutete Land zu erreichen.
Je näher er kam, desto aufgeregter wurde aber die See und er sah jetzt, daß
er ein wildes, schwarzes Meer mit rasenden Wirbeln für Land gehalten hatte.
Er entkam gerade noch und trieb wieder viele Tage, aber der Sturm flaute
nicht ab und er sah kein Land. Noch einmal sah er eine dunkle Masse durch
den Nebel scheinen und hatte sich wieder getäuscht, denn es war ein anderer
Wirbel, der die See zu riesenhaften Wogen aufpeitschte.
Schließlich beruhigte sich der Sturm, der Seegang legte sich und in großer
Entfernung sah er das Land. Allmählich kam er näher und der Küste folgend,
erspähte er endlich ein Steinhaus, aus dem ein Licht schimmerte. Er landete
und betrat das Haus. Es war niemand darin, als eine alte Frau, die
Arnaitiang hieß. Sie nahm ihn freundlich auf und auf seine Bitte hin zog
sie ihm die Stiefel, Pantoffel und Strümpfe aus und trocknete sie auf dem
Gestell, das über der Lampe hing. Dann ging sie hinaus, um Feuer anzufachen
und ein gutes Mahl zu kochen.
Als die Strümpfe trocken waren, reckte sich Kiviung, um sie vom Gestell zu
nehmen und anzuziehen, aber sowie er seine Hand danach ausstreckte, wich
das Gestell seinem Griff aus. Nachdem er so mehrere Male ins Leere
gegriffen, rief er Arnaitiang und bat sie ihm die Strümpfe zurückzugeben.
Sie antwortete aber: »Nimm sie selbst; dort sind sie, sie sind ja dort!«
und ging wieder hinaus. In Wirklichkeit war sie ein sehr böses Weib und
wollte Kiviung verspeisen.
Er griff nochmals nach seinen Strümpfen, aber ohne besseren Erfolg. Er
rief also wieder nach der Arnaitiang und bat sie ihm seine Stiefel und
Strümpfe zu geben, worauf sie sagte: »Setz dich dorthin wo ich saß, als du
in mein Haus tratst, dann kannst du sie erreichen.« Danach ging sie wieder
hinaus. Kiviung griff nochmals, aber das Gestell hob sich wie früher und er
konnte sie nicht erlangen.
Jetzt sah er ein, daß Arnaitiang auf Unheil sann; er rief also seinen
Schutzgeist an, einen ungeheuren weißen Bären, der sich brüllend von unten
her zum Boden des Hauses erhob. Zuerst hörte Arnaitiang nichts; als aber
Kiviung fortfuhr ihn zu beschwören, kam der Geist näher und näher an die
Oberfläche und als sie jetzt sein lautes Gebrüll hörte, bekam sie Angst und
gab Kiviung was er verlangte. »Hier sind deine Stiefel«, schrie sie, »hier
deine Pantoffel, hier deine Strümpfe; ich will dir helfen, zieh dich an.«
Kiviung wollte aber nicht länger bei dieser schrecklichen Hexe bleiben, zog
nicht einmal seine Stiefel an, sondern nahm sie nur von Arnaitiang und
stürzte aus der Tür. Er war kaum draußen, als sie heftig zuschlug und
seinen Rockzipfel einklemmte. Er eilte, ohne sich umzusehen, zu seinem
Kajak und ruderte weg. Er war noch nicht weg, als Arnaitiang, die sich von
ihrer Angst erholt hatte, ein blankes Frauenmesser schwingend, herauskam,
um ihn zu töten. Er hätte fast Angst bekommen und beinahe wäre sein Kajak
gekentert. Er arbeitete, um ihn wieder ins Gleichgewicht zu bringen, hob
dabei seinen Speer und schrie: »Ich werde dich mit meinem Speer
umbringen!« Als Arnaitiang diese Worte hörte, fiel sie vor Schreck nieder
und zerbrach dabei ihr Messer. Kiviung bemerkte, daß es aus einer ganz
dünnen Eisplatte bestand.
Er reiste, der Küste folgend, viele Tage und Nächte weiter. Schließlich kam
er an eine Hütte, aus der wieder eine Lampe schien. Da seine Kleider naß
waren und er selbst hungrig, landete er und betrat das Haus. Hier fand er
eine Frau, die mit ihrer Tochter ganz allein lebte. Ihr Schwiegersohn war
ein Treibholzklotz mit vier Ästen. Jeden Tag brachten sie ihn zur Ebbezeit
an den Strand und wenn die Flut kam, schwamm er weg. In der Nacht kam er
dann zurück mit acht großen Seehunden, immer zwei auf einen Ast gespießt.
So versorgte der Baumstamm seine Frau, ihre Mutter und Kiviung reichlich
mit Nahrung. Eines Tages aber, nachdem sie ihn wie gewöhnlich vom Stapel
gelassen, verschwand er und kam nie mehr zurück.
Bald darauf heiratete Kiviung die junge Witwe. Jetzt ging er selbst jeden
Tag Seehunde jagen und hatte viel Erfolg. Als er einmal einige Tage
auszubleiben gedachte, war er besorgt einen genügenden Vorrat von
Fäustlingen zu bekommen. Er gab also jeden Abend, wenn er von der Jagd
heimkam, vor, seine Fäustlinge verloren zu haben. In Wirklichkeit hatte er
sie in der Kapuze seines Mantels versteckt.
Nach einiger Zeit wurde die alte Frau auf ihre Tochter eifersüchtig, denn
der neue Gatte war ein glänzender Jäger und sie wollte ihn selbst
heiraten. Als er eines Tages auf der Jagd war, ermordete sie ihre Tochter
und um ihn zu täuschen, zog sie sich die Pelze der Tochter selbst an, um
sich in ein junges Weib zu verwandeln. Als Kiviung zurückkam, ging sie ihm,
wie die Tochter zu tun pflegte, entgegen, ohne in ihm irgend einen Verdacht
zu erregen. Als er aber in die Hütte trat und die Gebeine seiner Frau sah,
bemerkte er auf einmal ihren grausamen Tod und den Betrug und floh davon.
Viele Tage und Nächte reiste er, immer der Küste folgend, weiter.
Schließlich kam er wieder zu einer Hütte, wo ein Licht brannte. Da seine
Kleider naß und er selbst hungrig war, landete er und ging hinauf zum Haus.
Bevor er eintrat fiel ihm aber ein, daß es am besten wäre zuerst
auszuforschen, wer drinnen sei. Er klomm zum Fenster hinauf und sah durch
den Spalt. Am Bett saß drinnen eine alte Frau, die Aissiwang (Spinne). Als
diese die dunkle Gestalt vor dem Fenster sah, glaubte sie, es wäre eine
Wolke, die an der Sonne vorüberziehe und da die Beleuchtung für ihre Arbeit
ungenügend war, wurde sie wütend, schnitt sich mit ihrem Messer die
Augenbrauen ab und aß sie und achtete nicht einmal auf das tropfende Blut,
sondern ließ es antrocknen. Als Kiviung das sah, war er überzeugt, daß sie
ein sehr böses Weib sein müsse und zog fort.
Wieder reiste er Tage und Nächte. Endlich kam er in eine Gegend, die ihm
bekannt schien und bald erkannte er seine Heimat. Er war sehr froh, als er
einige Boote ihm entgegenkommen sah. Die waren auf einer Waljagd gewesen
und zogen einen großen Leichnam zum Dorf. Am Bug des einen Bootes stand ein
kräftiger junger Mann, der den Wal getötet hatte. Es war Kiviungs Sohn, den
er als kleinen Jungen zurückgelassen hatte und der jetzt erwachsen und ein
großer Jäger war. Seine Frau hatte einen anderen Mann genommen, kehrte
jetzt aber zu Kiviung zurück.
Die einzige Frau
Vor langer Zeit lebten viele Leute im Nordland, aber es gab keine Frau
unter ihnen. Man wußte nur von einem einzigen Weib, das weit im Süden
lebte. Schließlich machte sich einer der jungen Männer im Norden auf und
reiste gen Süden, bis er zum Haus der Frau kam, wo er blieb und bald ihr
Mann wurde. Eines Tages saß er im Haus, dachte an die Heimat und sagte:
»Ah, ich hab eine Frau und der Sohn des Häuptlings im Norden hat keine!«
Und er gefiel sich sehr in Gedanken an sein gutes Geschick.
Indessen hatte sich der Häuptlingssohn auch daran gemacht, nach dem Süden
zu reisen und während der Gatte gerade so zu sich sprach, stand der
Häuptlingssohn am Hauseingang und belauschte ihn. Er wartete am Eingang,
bis drinnen alle eingeschlafen, kroch dann ins Haus, packte die Frau bei
den Schultern und wollte sie wegschleppen.
Wie er den Ausgang erreichte, bemerkte ihn der Gatte, der die Frau noch an
den Füßen erwischte. Es kam zu einer Rauferei, welche damit endete, daß die
Frau auseinandergerissen wurde. Der Dieb trug die obere Körperhälfte nach
Hause ins Nordland, während der Gatte mit der unteren Hälfte seiner Frau
zurückblieb. Jeder Mann saß nun und arbeitete, um die fehlenden Teile aus
Holz zu schnitzen. Nachdem sie ergänzt waren, wurde ihnen Leben eingehaucht
und so waren aus den Hälften einer Frau zwei Frauen gemacht.
Die Frau im Süden war allerdings eine schlechte Näherin, was sie der
Plumpheit ihrer Holzfinger verdankte; dafür war sie eine gute Tänzerin. Die
Frau im Norden war zwar in Näharbeiten gewandt, aber ihre hölzernen Beine
machten sie zu einer sehr schwachen Tänzerin. Jede der Frauen vererbte an
ihre Töchter diese Merkmale, sodaß noch heute dieser Unterschied zwischen
den Frauen des Nordens und denen des Südens besteht -- was beweist, daß die
Geschichte wahr ist.
Die Geschichte vom Mann und seiner Fuchs-Frau
Ein Jäger, der ganz allein lebte, fand, als er nach einiger Abwesenheit zu
seinem Lager zurückkam, daß ihn jemand besucht hatte und alles in Ordnung
gebracht, wie es ein pflichtgetreues Weib tun soll. Das geschah so oft und
ohne irgendwelche sichtbare Spuren, daß der Mann beschloß, dem nachzugehen,
um zu sehen, wer denn eigentlich seine Kleider reinschabe, seine Stiefel
zum Trocknen aushänge und gutes, warmes Essen koche, bevor er zurückkam.
Eines Tags ging er weg, als ob er auf die Jagd ginge, versteckte sich aber
so, daß er den Eingang des Hauses beobachten konnte. Nach einer Weile sah
er einen Fuchs hineinschlüpfen. Er glaubte, der Fuchs sei auf
Nahrungssuche. Er schlich sich zur Hütte und als er eintrat, sah er ein
sehr schönes Weib in Fellkleidern von wunderbarer Arbeit. In der Hütte hing
an einer Leine ein Fuchsbalg. Der Mann fragte, ob sie es gewesen wäre, die
das alles gemacht habe. Sie sagte, sie wäre seine Frau und es sei nur ihre
Pflicht, das zu tun und sie hoffe nur, ihre Arbeit zu seiner Zufriedenheit
getan zu haben.
Nachdem sie kurze Zeit zusammengelebt, bemerkte der Mann einen
Moschusgeruch im Haus und fragte, ob der von ihr wäre. Sie antwortete, daß
sie es sei, die so rieche und wenn er darin einen Fehler sehe, so werde
sie ihn verlassen. Sie streifte ihre Kleider ab, nahm wieder das Fuchsfell
um und schlich davon. Und seit dieser Zeit war sie nie wieder dazu
aufgelegt, einen Mann zu besuchen.
Der Waisenknabe und der alte Mann
Outakalawaping war ein alter Mann. Ein Waisenknabe namens Elaakjewwakjew
pflegte ihn zu besuchen; sobald ihn der alte Mann sah, rief er aus: »Warum
ißt du den Rockschoß deiner Mutter?« Daraufhin lief der Waisenknabe weg.
Einmal ging er in ein anderes Haus; einer der Knaben, der wußte, was der
alte Mann zu sagen pflegte, verleitete ihn, dem alten Mann, wenn er wieder
sagen würde: »Warum ißt du den Rockschoß deiner Mutter?« zu antworten:
»Warum hast du deine erste Frau in die Eisspalte gesteckt? Warum hast du
sie in die Meereisspalte gesteckt?« --
Der Knabe ging zurück in des alten Mannes Haus und als Outakalawaping
wieder sagte: »Warum ißt du den Rockschoß deiner Mutter?« erwiderte er:
»Warum hast du deine erste Frau in die Eisspalte gesteckt? Warum hast du
sie in die Meereisspalte gesteckt?« Da sprang der alte Mann auf und wollte
den Knaben fangen; der lief aber weg. Die beiden liefen lange Zeit, bis sie
sich in den Himmel erhoben und zwei Sterne wurden; aber der Waisenknabe
wird auch da noch immer vom alten Mann verfolgt.
Die Eule und der Rabe
Die Eule und der Rabe waren dicke Freunde. Eines Tags machte der Rabe für
die Eule ein neues, schwarz und weiß gesprenkeltes Kleid. Diese aber machte
dafür dem Raben ein Paar Schuhe aus Walknochen und begann dann auch noch
ein weißes Kleid für ihn zu machen. Als sie aber daran war, es
anzuprobieren, fing der Rabe an herumzuhüpfen und wollte nicht stillhalten.
Die Eule wurde ärgerlich und sagte: »Jetzt sitz still, oder ich werde die
Lampe über dich gießen!« Da der Rabe aber fortfuhr, herumzuhüpfen, wurde
die Eule wütend und goß den Tran über ihn. Da schrie der Rabe »Yaq! Yaq!«
und seit diesem Tag ist er ganz schwarz.
Der Rabe nimmt ein Weib
(Geschichten vom Raben Tu-lu-kau-guk II.)
Lange Zeit lebte der Rabe allein, aber schließlich hatte er doch genug
davon und beschloß ein Weib zu nehmen. Er sah sich also um und bemerkte,
daß es schon spät im Herbst war und die Vögel schon in großen Scharen
südwärts zogen. Der Rabe flog weg und hielt an auf dem Weg, den die Gänse
und anderes Wildgeflügel auf ihrem Zug nach dem Sommerland eingeschlagen
hatten. Er beugte sein Gesicht, sah auf die Füße herab und rief aus: »Wer
will mich zum Gatten? Ich bin ein schöner Mann!« Ohne ihn zu beachten,
flogen die Gänse weiter und der Rabe sah ihnen nach und seufzte. Bald
danach flog eine schwarze Brandgans vorbei und der Rabe rief wie vorhin --
und mit dem gleichen Erfolg. Er blickte ihr nach und rief: »Ah, was sind
das für Leute! Die warten nicht einmal, um mir zuzuhören.« Er wartete
weiter und eine Ente flog in der Nähe vorbei; als der Rabe sie anrief, sah
sie sich ein wenig nach ihm um, flog dann aber weiter. Einen Augenblick
schlug sein Herz voll Hoffnung etwas rascher, aber als auch die Ente vorbei
war, rief er: »Ah, dann werde also ich näher kommen; vielleicht, daß das
nützt.« Er blieb gesenkten Hauptes stehen und wartete weiter.
Bald darauf kam eine ganze Schneegänsefamilie, die Eltern, vier Brüder und
eine Schwester, und der Rabe rief hinauf: »Wer will mich zum Gatten? Ich
bin ein guter Jäger, jung und geschickt.« Als er das gesagt, ließen sich
die Schneegänse knapp neben ihm herab und er dachte sich: »Jetzt werde ich
eine Frau bekommen!« Nun sah er sich um und bemerkte einen schönen, weißen
durchlochten Stein. Er hob ihn auf, band ihn an einen Grashalm und hängte
ihn um den Hals. Nachdem er das getan, schob er den Schnabel hoch, wie eine
Maske, daß er auf den Scheitel des Kopfes rutschte und verwandelte sich so
in einen schwarzen jungen Mann, und schritt auf die Gänse zu. Zugleich
hatten auch die Gänse ihre Schnäbel hinaufgeschoben und waren in gut
aussehende Leute verwandelt worden. Dem Raben gefiel der Blick des Mädchens
sehr und er ging auf sie zu, gab ihr den Stein und erwählte sie so zu
seiner Frau und sie hängte ihn sich um den Hals. Dann schoben alle ihre
Schnäbel herunter, wurden wieder Vögel und flogen nach Süden weiter.
Die Gänse schlugen langsam ihre Flügel und arbeiteten sich gemächlich
weiter. Der Rabe aber glitt mit seinen weitausgebreiteten Schwingen
schneller als seine Gefährten dahin und die Gänse sahen ihm nach und riefen
voll Bewunderung: »Wie leicht und anmutig ist er doch!« Mit der Zeit wurde
der Rabe müde und sagte: »Es wäre besser, wir machten zeitig halt und sähen
uns nach einem Schlafplatz um.« Die anderen waren damit einverstanden und
so machten sie halt und schliefen bald ein.
Am nächsten Morgen waren die Gänse schon früh in Bewegung und wollten
aufbrechen, aber der Rabe schlief noch so fest, daß sie ihn aufwecken
mußten. Der Gänsevater drängte: »Wir müssen uns beeilen, denn es wird bald
schnein. Halten wir uns nicht auf!« Sowie der Rabe erwacht war, drängte er
darauf fortzukommen und wie am Tag vorher führte er die anderen und wurde
von seinen jungen Kameraden sehr bewundert. Er zog bald über, bald vor
seinen Genossen dahin; diese machten anerkennende Bemerkungen, wie: »Ah,
sieh, wie leicht und gewandt er ist!« So zog die Schar dahin, bis sie eines
Abends an der Meeresküste halt machten; hier taten sie sich an Beeren
gütlich, die in Menge herumwuchsen und legten sich dann schlafen.
Am nächsten Morgen schickten sich die Gänse in aller Frühe an, ohne
Frühstücksrast, weiterzuziehen. Der Magen des Raben aber schrie nach den
guten Beeren, die so zahlreich vorhanden waren, aber die Gänse wollten
nicht warten und er wagte es daher nicht, sich dem Aufbruch zu widersetzen.
Als sie die Küste verließen, sagte der Gänsevater, daß sie unterwegs nur
einmal rasten würden und der nächste Weg werde sie dann an die andere Küste
bringen. Dem Raben schien es sehr zweifelhaft, ob er imstande sein werde,
die andere Küste zu erreichen, aber er schämte sich das einzugestehen und
beschloß, den Versuch zu wagen. So flogen sie alle auf. Die Gänse flogen
standhaft darauf los; nach einiger Zeit aber begann der Rabe
zurückzubleiben; seine Flügel schmerzten ihn, während die Gänse gemächlich
und noch unermüdet weiterflogen. Mühsam flog der Rabe weiter, glitt dann
wieder eine Zeitlang mit ausgebreiteten Schwingen, um die müden Flügel
auszuruhen, aber vergebens: er blieb immer mehr zurück. Schließlich sahen
sich die Gänse um und der Gänsevater sagte: »Ich dachte, er wäre geübt und
kräftig, aber er muß doch müd geworden sein; warten wir auf ihn.« Dann
ließen sich die Gänse ganz nah nebeneinander aufs Wasser nieder und der
Rabe, der mühsam herankam, sank auf ihren Rücken herab und schnappte nach
Luft. Bald hatte er sich etwas erholt und sagte, indem er dabei die Hand
auf die Brust legte: »Ich habe hier eine Pfeilspitze von einem alten Kampf
her und die plagt mich sehr. Das ist der Grund, warum ich zurück blieb.«
Nachdem sie gerastet hatten, zogen sie weiter, aber die anderen mußten bald
wieder auf den Raben warten und er wiederholte wieder die Geschichte von
der Pfeilspitze, von der er behauptete, sie hätte sein Herz durchbohrt.
Dann nahm er die Hand seiner Frau und legte sie auf seine Brust, damit sie
fühle, wie es springe. Sie tat so, konnte aber nur spüren, daß sein Herz
wie ein Steinhammer klopfte, aber nicht die mindeste Spur von einer
Pfeilspitze; sie sagte aber trotzdem nichts. Sie zogen also weiter und
mußten bald wieder auf den Raben warten. Jetzt fingen aber die Brüder schon
an über ihn zu sprechen und sagten sich: »Ich glaub an diese Geschichte mit
der Pfeilspitze nicht; wie kann er denn mit einer Pfeilspitze im Herz
leben?«
Als sie rasteten, sahen sie vor sich in der Ferne die Küste. Der Gänsevater
eröffnete nun dem Raben, daß sie, bevor das Land erreicht sei, nicht mehr
auf ihn warten würden. Dann erhoben sich alle und flogen los. Der Rabe
bewegte seine Flügel nur langsam und selbst das fiel ihm schon schwer.
Ausdauernd flogen die Gänse der Küste zu, während der Rabe tiefer und
tiefer sank und dem gefürchteten Wasser näher und näher kam. Als er hart an
die Wellen kam, rief er nach seiner Frau: »Gib mir den weißen Stein! Gib
ihn mir zurück!« Der war nämlich zauberkräftig. So schrie er bis seine
Flügel sanken und fiel hilflos ins Wasser als die Gänse gerade das Land
erreichten. Er versuchte sich vom Wasser zu erheben, aber sein Gewicht zog
ihm die Flügel herunter und er trieb der Küste entlang, vor und zurück. Die
Wellen wurden stärker und bald begannen die weißen Kämme über ihn zu gehen;
er sank unter und konnte nur mit äußerster Anstrengung seinen Schnabel über
die Oberfläche herausstrecken, um zwischen den Wellen nach Luft zu
schnappen. Endlich schwemmte ihn eine große Welle ans Land. Als sie dann
zurückflutete, grub er seine Krallen in die Strandkiesel und rettete sich
nur mit schwerer Mühe davor, wieder ins Meer gespült zu werden. Sobald er
konnte, kämpfte er sich an den Strand hinauf -- ein übelzugerichteter
Patron. Das Wasser lief in Strömen von seinen durchweichten Federn und die
Flügel hingen zu Boden. Mehrmals fiel er um, bevor er endlich mit
weitaufgesperrtem Mund einige Sträucher erreichte, wo er die Maske und sein
Rabenkleid ablegte und ein kleiner, dunkler Mann wurde. Dann hob er Gewand
und Maske auf, hängte sie an einen Strauch und machte sich aus einigen
Holzstücken einen Feuerbohrer; bald hatte er ein Feuer entfacht und
trocknete sich davor.
Der Rabe, der Wal und der Nörz
(Geschichten vom Raben Tu-lu-kau-guk III.)
Nachdem der Rabe sein Kleid am Feuer getrocknet hatte, sah er zufällig aufs
Meer hinaus, bemerkte einen großen Wal die Küste entlang ziehen und sagte:
»Wenn du wieder emporkommst, mach deine Augen zu und das Maul weit auf.«
Dann legte er rasch sein Rabengewand an, zog die Maske vor, nahm seinen
Feuerbohrer unter einen Flügel und flog hinaus übers Wasser. Der Wal kam
bald wieder an die Oberfläche, und tat, wie ihm befohlen worden war und
sobald der Rabe das offene Maul sah, flog er stracks hinein und in den
Bauch des Wals. Der Wal schloß sein Maul und tauchte unter, während der
Rabe sich umsah und bemerkte, daß er am Eingang eines schönen Raumes war,
an dessen einem Ende eine Lampe brannte. Er trat ein und war erstaunt da
ein schönes junges Weib sitzen zu sehen. Der Raum war rein und trocken;
seine Decke wurde vom Rückgrat des Wals getragen und seine Rippen formten
die Wände. Aus einer Röhre, die sich die Wirbelsäule des Wals entlang zog,
tropfte langsam Tran in die Lampe. Als der Rabe eintrat, sprang das Weib
auf und schrie: »Wie kommst du daher? Du bist der erste Mann der je
hierherkam!« Der Rabe erzählte nun, wie er hereingekommen und sie lud ihn
ein, sich auf die andere Seite des Raumes zu setzen. Diese Frau war der
Geist des Wals, der ein weibliches Tier war. Dann bereitete sie ein Essen,
gab ihm Beeren und Tran und erzählte zugleich, daß sie die Beeren vor einem
Jahr gesammelt habe. Der Rabe blieb vier Tage lang als Gast des Geistes da
und wunderte sich nur immer, was denn das für eine Röhre sei, die die Decke
entlang führte. So oft die Frau den Raum verließ, befahl sie ihm, sie ja
nicht anzurühren. Als sie wieder einmal hinausgegangen war, ging er zur
Lampe, steckte seine Pfote aus und fing einen großen Trantropfen auf und
leckte mit der Zunge daran. Das schmeckte so süß, daß er noch mehrere
Tropfen auffing und sie verschluckte, wie sie herabfielen. Es wurde ihm
aber bald zu langweilig und so kroch er hinauf, riß ein Stück von der
Rohrwand los und verzehrte es. Kaum war das geschehen, so floß auch schon
ein ganzer Sturzbach von Tran in den Raum und löschte die Lampe aus,
während der ganze Raum selbst wild hin und herzurollen begann. Das dauerte
fast vier Tage lang und der Rabe war halbtot vor Müdigkeit und den
Quetschungen die er erhalten hatte. Dann stand der Raum still und der Wal
war tot, denn der Rabe hatte eines seiner Herzgefäße aufgerissen. Der Geist
kam nie in den Raum zurück und der Wal trieb an die Küste.
Der Rabe merkte nun, daß er gefangen war und während er darüber nachdachte,
wie er entkommen könnte, hörte er, wie sich oben auf dem Wal zwei Leute
unterhielten und den Vorschlag machten, alle ihre Dorfgenossen
herzuführen. Das war rasch geschehen und bald hatten die Leute in den
oberen Teil des Wals ein Loch gemacht. Dies Loch wurde dann erweitert, bis
der Rabe, als alle gerade eine Fleischladung an die Küste trugen,
entschlüpfen und sich unbemerkt auf der Spitze eines nahen Hügels
niederlassen konnte; da fiel ihm ein, daß er seinen Feuerbohrer vergessen
hatte und er rief aus: »Oh, ich hab meinen guten Feuerbohrer vergessen!«
Schnell streifte er die Rabenmaske und die Rabenkleider ab, wurde wieder
ein junger Mann und ging die Küste entlang auf den Wal zu. Die Leute beim
Wal sahen bald den kleinen, in ein seltsam zusammengenähtes, dunkles
Renntierfell gekleideten Mann auf sich zukommen und starrten ihn verdutzt
an. Der Rabe trat näher und sagte: »Ho, ihr habt einen schönen großen Wal
gefunden, ich will euch helfen ihn zu zerlegen!« Er streifte seine Ärmel
hoch und ging ans Werk. Bald darauf schrie ein Mann, der drinnen im
Walkörper arbeitete, herauf: »Ah, seht was ich gefunden habe, einen
Feuerbohrer im Walfisch.« Sofort streifte der Rabe seine Ärmel herunter und
sagte: »Das ist sehr schlimm, denn meine Tochter hat mir gesagt, daß wenn
die Leute in einem Walfisch einen Feuerbohrer finden und ihn noch weiter
aufschneiden, die meisten von ihnen sterben werden; ich lauf weg!« Und er
lief weg.
Als der Rabe weg war, sahen die Leute einander an und sagten: »Vielleicht
hat er doch recht«, und sie liefen alle weg und beim Weggehen suchte ein
jeder den Tran von seinen Händen abzustreifen. Der Rabe guckte aus seinem
Versteck in der Nähe zu und lachte, wie die Leute so wegliefen. Dann ging
er um seine Maske und sein Gewand. Nachdem er sie gefunden, ging er zum Wal
zurück, fing an ihn aufzuschneiden und holte das Fleisch am Strand
zusammen. Als er an den Schmaus, den dieser Vorrat für ihn abgeben würde,
dachte, sagte er: »Danke!« zu den Geistern.
Nachdem er nun Fleisch auf die Seite gebracht, wollte er auch einigen Tran
aufbewahren, aber er hatte kein Gefäß, um ihn hineinzutun und so ging er an
der Küste auf und ab und suchte einen Seehund. Er war noch nicht weit
gegangen, da sah er einen Nörz geschwind herumlaufen und schrie ihn an:
»Wem rennst du so schnell nach? Suchst du etwas zu essen?«
Der Nörz blieb stehen und schob, wie es der Rabe mit seinem Schnabel getan
hatte, seine Nase wie eine Maske hoch und verwandelte sich in einen kleinen
dunkeln Mann. Da rief der Rabe: »Ah, du willst mein Freund sein? Ich habe
Nahrung im Überfluß, aber ich bin allein und habe niemanden mit mir.« Dem
Nörz wars recht und sie gingen nun beide zum Wal zurück und machten sich an
die Arbeit. Der Nörz aber mußte das meiste schaffen, denn der Rabe war sehr
faul.
Sie machten Graskörbe und Matten für das Fleisch und den Walfischspeck und
versorgten große Mengen davon in Bodenlöchern. Nachdem das getan war,
bauten sie ein gutes Haus. Als auch das fertig war sagte der Rabe: »Es ist
langweilig, geben wir ein Fest!« Und er trug dem Nörz auf, Seevolk
einzuladen, das sie unterhalten sollte.
Dem Nörz wars recht und so brach er am nächsten Morgen auf; der Rabe
verfertigte indessen einen kurzen, runden Stab und bemalte ihn an dem einen
Ende mit zwei Ringen. Nachdem das getan war, sammelte er einen großen
Ballen klebriges Rottannen-Harz und legte das mit dem Stab zusammen ins
Haus.
Der Nörz kam bald zurück und meldete dem Raben, daß morgen sehr viele
Seebewohner zum Fest kommen würden. Der Rabe sagte: »Danke!« Früh am
nächsten Morgen rief der Nörz den Raben heraus und zeigte aufs Meer, dessen
Oberfläche ganz voll von den verschiedensten Seehundsarten, die alle zum
Fest kamen, war. Der Rabe ging ins Haus zurück, während der Nörz hinunter
ans Wasser ging, um die Gäste zu empfangen und sie zum Haus zu führen.
Sowie jeder Seehund ans Land kam, hob er seine Maske und wurde ein kleiner
Mann und alle gingen ins Haus, bis es voll war. Der Rabe sah die Gäste und
rief: »Was für eine Menge Leute? Wie soll ich denn euch allen ein Fest
geben können? Ausgeschlossen; gestattet aber erst, daß ich einigen von euch
mit diesem Zeug die Augen einschmiere, damit ihr besser sehen könnt, denn
es ist hier etwas finster.«
Mit dem Harz verschloß er nun allen Seehunden die Augen, nur einen
kleinen, der in der Nähe der Türe stand, übersah er. Der letzte Seehund,
dessen Augen verschlossen wurde, war auch ein kleiner und sowie seine Augen
verklebt waren, wollte er sie öffnen und fing an zu schreien. Der Kleine
bei der Tür rief nun den anderen zu: »Der Rabe hat euch allen die Augen
zugeklebt und ihr könnt sie nicht öffnen.« Nun versuchten alle Seehunde die
Augen zu öffnen, aber sie konnten es nicht. Mit dem Stock, den der Rabe
Tags zuvor vorbereitet hatte, tötete er nun alle Gäste, indem er sie auf
den Kopf schlug und jeder Seehundsmann verwandelte sich, nachdem er getötet
war, in einen Seehund. Als der Kleine bei der Tür sah, daß der Rabe seine
Genossen tötete, lief er hinaus und entkam als einziger ins Meer.
Nachdem er damit fertig war, wandte sich der Rabe zum Nörz und sagte: »Sieh
wie viele Seehunde ich getötet habe; jetzt werden wir genug Behälter für
den Tran haben.« Dann machten sie Säcke aus den Seehundsfellen und füllten
sie mit Tran für den Winter. Seit dieser Zeit sind Rabe und Nörz immer
Freunde geblieben und darum will, bis auf den heutigen Tag, kein Rabe das
Fleisch eines Nörzes fressen und wäre er noch so hungrig. Den Nörz und den
Raben findet man oft in der Tundra ganz nahe beieinander.
Der Rabe und das Murmeltier
Einst flog der Rabe in der Nähe der Küste über ein Felsenriff; einige
Seevögel, die auf dem Felsen saßen, sahen ihn und verspotteten ihn mit den
Worten: »Oh, du Abfallfresser! Oh, du Aasfresser! Du Schwarzer!« bis der
Rabe sich umwandte und im Wegfliegen rief: »Gnak, Gnak, Gnak! Warum
verspotten mich die?« Und dann flog er weit weg übers Wasser, bis er drüben
zu einem Berg kam, wo er blieb.
Er blickte sich um und bemerkte gerade vor sich die Höhle eines
Murmeltiers. Der Rabe blieb vor der Höhle auf der Lauer stehen und bald kam
das Murmeltier mit etwas Nahrung zurück. Da es den Raben gerade vor seiner
Tür stehen sah, forderte es ihn auf, Platz zu machen; der Rabe wollte aber
nicht und sagte: »Man schimpft mich Aasfresser und ich werde beweisen, daß
ich das nicht bin und jetzt dich fressen.« Darauf antwortete das
Murmeltier: »Gut; ich habe aber gehört, daß du ein sehr guter Tänzer seist;
tanze jetzt, wenn du willst, ich werde dazu singen und dann magst du mich
verspeisen. Bevor ich aber sterbe, will ich dich tanzen sehen.« Das gefiel
dem Raben so sehr, daß er einwilligte zu tanzen und das Murmeltier sang
also: »O Rabe, Rabe, Rabe, wie gut du tanzt! O Rabe, Rabe, Rabe, wie gut du
tanzt!« Dann hörten sie auf, um auszuruhen und das Murmeltier sagte: »Dein
Tanz gefällt mir so gut, ich will noch eins singen, du mach aber deine
Augen zu und tanze deinen besten Tanz.« Der Rabe schloß seine Augen und
hüpfte ungeschickt herum, während das Murmeltier sang: »O Rabe, Rabe, Rabe,
was für ein reizender Tänzer bist du! O Rabe, Rabe, Rabe, was für ein
reizender Tänzer bist du!« Dann huschte das Murmeltier rasch zwischen den
Beinen des Raben durch und war in seiner Höhle geborgen. Sowie das
Murmeltier aber in Sicherheit war, steckte es die Nasenspitze heraus und
sagte spöttisch lachend: »Chi-kik-kik, Chi-kik-kik, Chi-kik-kik: du bist
doch der größte Dummkopf, den ich je gesehen habe; was du für eine komische
Figur beim tanzen machst; ich konnte mich kaum halten vor Lachen; schau
mich nur an, schau, wie fett ich bin! Möchtest du mich nicht gern
auffressen?« und es hänselte den Raben so lang, bis er aus lauter Wut weit
wegflog.
Entstehung des Raben
Der Rabe war ein Mann, der, als die Leute sich vorbereiteten eine andere
Gegend aufzusuchen und dazu die Habseligkeiten ihres Haushaltes
zusammenkramten, zu diesen sagte, sie hätten die Unterdecken aus
Hirschfellen, die man zum Bett braucht, vergessen. So ein Fell heißt in der
Eskimosprache »Kak«. Der Mann brauchte das Wort nun so oft, daß sie ihm
sagten, er werde das noch selbst werden. Er machte solchen Lärm, daß er in
einen Raben verwandelt wurde und nun gebraucht er diesen Laut, um sich
bemerkbar zu machen. Gerade an dem Tag, als das Lager abgebrochen wurde,
flog der Rabe auf und krächzte »Kak! Kak!« oder mit anderen Worten:
»Vergeßt nicht die Bettdecken!«
Der Rabe und die Möve
Vor langer Zeit kam einmal ein Jäger zum Haus des Raben. Als er eintrat,
sah er da einen alten Mann; der sagte zu ihm: »Kak! sicherlich bist du
hungrig. Wir sind alle hungrig, wenn wir von zu Hause wegwandern.« Dann
befahl er einem Knaben etwas Menschenfleisch hereinzubringen. Der Knabe
brachte es. Der Alte schnitt ein Stück ab und gab es dem Jäger. Der sagte
aber: »Ich mag diese Art von Fleisch nicht« worauf der alte Mann erwiderte:
»Gib es mir, ich kann es schon essen.« Nachdem er es aufgegessen, sagte er
zum Knaben: »Bring etwas Walhaut herein.« Was der brachte, war aber in
Wirklichkeit Vogelmist. Er gab es dem Eskimo, der erklärte, das könne er
nicht essen. »Gib es mir«, sagte der Alte, »ich kann es essen.« Dann hieß
er den Knaben Walbeine bringen. Er bot das dem Eskimo an, der wieder
erklärte, er könne das nicht essen. Der Alte sagte wieder: »Ich kann es
essen, gib es mir.« Nachdem er es aber verzehrt hatte, sagte er: »Mein
Magen tut mir weh« und spie alles, was er gegessen hatte, aus.
Nicht weit von da war das Haus einer Möve. Der Jäger wurde eingeladen,
einzutreten. Er ging hinein und die Möve gab ihm getrocknete Fische, die er
sehr zufrieden verzehrte. Dann verließ er sie, ging nach Hause und
erzählte, wie ihn die Vögel bewirtet hatten.
Entstehung der Möven
Einige Leute in einem Boot wollten um eine Landspitze, die weit ins Wasser
ragte, herumkommen. Da das Wasser unter dem Ende der Landzunge, die in
einer hohen Klippe endete, immer sehr stark bewegt war, baten einige
Frauen, man sollte doch über den Landrücken gehen. Eine von ihnen stieg
auch mit ihren Kindern aus, um das Boot zu erleichtern. Sie sollte über
jene Stelle gehen und die anderen versprachen, drüben auf sie zu warten.
Die Leute im Boot waren so weit gekommen, daß die Rufe, welche die Richtung
angeben sollten, undeutlich wurden. Die arme Frau wurde ängstlich und hatte
die anderen im Verdacht, sie wollten sie verlassen. Sie blieb bei der
Klippe und schrie unausgesetzt die letzten Worte, die sie gehört hatte.
Schließlich wurde sie in eine Möve verwandelt und über den ganzen Sund
ertönt jetzt ein: »Geh' rüber, g-rüber, güber, über, üb!« und so fort.
Der Ursprung der Mücken
Ein Mann hatte eine nachlässige Frau, die nie seine Fellkleider
reinschabte, wenn er von seinen Ausflügen zurückkam. Er bemühte sich sehr,
sie zu besserem zu überreden und sich aufzuführen, wie einer Frau geziemt.
Wieder einmal sollte sie die angehäufte Schmutzschicht von den Kleidern des
Mannes entfernen. Sie nahm verdrießlich das Gewand und reinigte es aber so
nachlässig, daß der Mann, wie er das Aussehen der Kleider bemerkte, etwas
von dem Dreck, der noch daran klebte, nahm und ihr nachwarf. Die Teilchen
verwandelten sich in Mücken und jetzt im Frühling, wenn die warmen Tage
kommen und die Frauen Arbeit haben, die Kleider zu putzen, sammeln sie sich
um sie und so werden die Frauen an das schlampige Weib erinnert und was ihr
geschehen war.
Entstehung der Schwalben
Einige kleine Kinder, die sehr gescheit waren, spielten am Ende einer hohen
Klippe, nah bei den Zelten, wo sie wohnten, indem sie Spielhäuser machten.
Sie wurden bewundert wegen ihrer Klugheit und bekamen den Namen
»zuluganak«, wie jener Rabe, von dem man annahm, daß er alle Vergangenheit
und Zukunft wisse. Während diese Kinder also sich vergnügten, wurden sie in
kleine Vögel verwandelt und sie vergaßen ihre letzte Beschäftigung nicht
und bis zum heutigen Tag kommen sie zu den Klippen, nah bei dem Lager der
Leute, und machen Häuser aus Lehm, die sie an einer Seite des Felsens
befestigen. Die Eskimokinder beobachten gerne die Schwalben, wie sie, wenn
der Rabe sie dabei nicht stört, ihre Iglu aus Lehm bauen.
Die Entstehung der Lummen
Einige Kinder spielten auf dem ebenen Gipfel einer ins Meer hineinragenden
Klippe und die älteren Kinder gaben auf die jüngeren acht, damit sie nicht
über den Rand fielen. Unten war die See mit Eis bedeckt und entlang der
Küste hatte sich noch kein Streifen gelockert, auf dem die Seehunde hätten
aufsteigen können. Bald öffnete aber ein entferntes Krachen das Meer und es
war voll von Seehunden, aber die Kinder achteten nicht darauf. Der Wind war
kalt und die Kinder tobten sehr ausgelassen herum, eiferten sich bei ihren
Spielen an und schrien so laut sie nur konnten. Die Männer sahen jetzt die
Robben und liefen zur Küste, um ihre Kajaks ins Wasser zu setzen und sie zu
verfolgen.
Daraufhin schrien die Kinder noch mehr und erschreckten die Robben so, daß
sie untertauchten. Einer der Männer wurde ärgerlich und rief den anderen
zu: »Ich wünschte, das Riff stürzte um und begrübe diese lärmenden Kinder,
die die Robben verjagt haben.« Im selben Moment stürzte die Klippe ein und
die armen Kinder fielen mitten zwischen Felsen und Steinen herunter. Da
wurden sie in Lummen oder Seetauben mit roten Füßen verwandelt und hausen
so bis zum heutigen Tag mitten zwischen den Steinen, hart am Wasser unter
den Riffen.
Der Hase
Der Hase war ein Kind, das von den Leuten so schlecht behandelt und
mißbraucht wurde, weil es lange Ohren hatte, daß es sich aufmachte, um
allein zu leben. Wenn er jemand sieht, läßt er die Ohren auf den Rücken
hängen; wenn er aber das Geschrei von jemandem hört, glaubt er, man spricht
von seinen langen Ohren. Er hat keinen Schwanz, weil er früher auch keinen
hatte.
Herkunft der viereckigen Flecken am Rücken der Tauchente
Ein Mann hatte zwei Kinder, von denen er wollte, sie sollten einander
völlig gleichsehen. Er zeichnete das eine (die Tauchente) mit einer weißen
Brust und viereckigen Flecken am Rücken. Das andere (der Rabe) sah, wie
komisch die Tauchente aussah, und lachte soviel, daß die Tauchente sich
schämte und ins Wasser floh, wo sie immer die weiße Brust zeigt, um die
Flecken am Rücken, die zum Lachen reizen, zu verbergen. Der Rabe entging
der Aussicht in gleicher Weise angemalt zu werden, indem er sich hartnäckig
weigerte, näher zu kommen.
Wie der Habicht entstand
Unter den Leuten einer Siedlung war eine Frau, die wegen der Kürze ihres
Nackens auffiel. Sie wurde deswegen unausgesetzt geneckt und gequält, sodaß
sie oft stundenlang allein am Rand hoher Felsen saß. Sie wurde in einen
Habicht verwandelt und schreit jetzt, wenn sie jemand sieht, sofort: »Kea,
kea, kea, wer, wer, wer wars, der >Kurznack< rief?«
Die letzten Donnervögel
Vor langer Zeit lebten in den Bergen viele Adler oder Donnervögel. Die
waren aber schon alle verschwunden bis auf ein Paar, das auf dem Berggipfel
der bei S. den Yukon überragt, hauste. Auf der runden Kuppe dieses Berges
hatten die Adler eine Vertiefung ausgehöhlt, die ihnen als Nest diente; um
den Rand herum war ein Felswall, von dem sie auf das große Dorf am Fluß
sehen konnten.
Vom Rand dieses Felswalls erhoben sich die großen Vögel auf ihren breiten
Schwingen, wie ein Wolke am Himmel, um manchmal aus vorüberziehenden Herden
ein Renntier zu reißen und es ihren Jungen zu bringen. Dann wieder kreisten
sie herum, mit donnerartigem Flügelschlag, ließen sich zu einem Fischer in
seinem Kanoe auf dem Fluß herab und schleppten Mann und Boot zum
Berggipfel. Dort fraßen die jungen Donnervögel den Mann und das Kanoe blieb
zwischen Knochen und anderem Abfall am Nestrand liegen und ging zugrund.
Jeden Herbst flogen die jungen Vögel ins Nordland weg, während die alten
zurückblieben. Dann kam wieder eine Zeit, wo viele Jäger von den Vögeln
verschleppt wurden, sodaß sich nur die allerverwegensten auf den Fluß
wagten. Eines Sommertags fuhr ein beherzter junger Mann hinaus, um nach
seinen Fischfallen im Fluß zu sehen; bevor er aber wegging, sagte er
seiner Frau, sie solle vorsichtig sein und das Haus der Vogelgefahr wegen
ja nicht verlassen. Nachdem ihr Mann weggegangen war, bemerkte die junge
Frau, daß ihr Wasserkübel leer war und nahm daher einen Eimer und ging nach
dem Fluß um Wasser. Als sie zurückkehren wollte, erfüllte ein rollendes
Geräusch, wie Donner, die Luft, einer der Vögel stieß herab und packte sie
mit seinen Krallen. Als die Dorfleute sahen, wie sie zum Berggipfel geführt
wurde, schrien sie vor Schmerz und Verzweiflung auf.
Als der Jäger nach Hause kam, beeilten sich die Leute, ihm von seines
Weibes Tod zu erzählen, er sagte aber nichts. Er ging in sein leeres Haus,
nahm seinen Bogen und einen Köcher voll Kriegspfeile und brach, nachdem er
sie sorgfältig geprüft hatte, nach dem Adlerberg auf. Seine Freunde hielten
ihm vor, daß ihn die Vögel sicherlich umbringen würden, aber vergebens. Er
wollte sich davon nicht überzeugen lassen, sondern eilte weiter. Mit festen
Schritten erklomm er den Rand des großen Nestes und sah hinein. Die Alten
waren weg, aber die Jungen empfingen ihn mit gellenden Schreien und
fürchterlich funkelnden Augen. Des Jägers Herz war voll Zorn, er spannte
rasch seinen Bogen und schoß einen Pfeil nach dem anderen ab, bis der
letzte der verhaßten Vögel tot im Nest lag.
Noch immer voll Rachedurst verbarg sich der Jäger hinter einem großen
Felsen in der Nähe des Nestes und wartete auf die alten Vögel. Diese kamen.
Als sie ihre Jungen tot und blutig im Nest liegen sahen, erhoben sie
solche Racheschreie, daß der ganze Sund von der anderen Seite des großen
Flusses her widerhallte, während sie sich erhoben, um nach dem Mörder ihrer
Jungen auszusehen. Bald erblickten sie den jungen Jäger hinter dem großen
Stein und der Muttervogel stieß auf ihn herab und seine Schwingen rauschten
dabei, wie ein Sturm im Tannenwald. Der Jäger legte rasch einen Pfeil auf
seine Sehne und als der Adler herunterkam, jagte er ihn ihm tief in die
Kehle. Mit einem rauhen Schrei wandte er sich um und flog weit über die
Hügel nach Norden weg.
Jetzt kreiste der Vogelvater über ihm und kam schreiend auf den Jäger
herunter, der sich im richtigen Augenblick hinter den Stein drückte, sodaß
des Adlers scharfe Klauen nur den harten Fels faßten. Als der Vogel sich
erhob, um wieder herabzustoßen, sprang der Jäger aus seinem Schlupfwinkel
und jagte ihm mit aller Kraft zwei schwere Pfeile tief unter seine
Schwingen. Wie eine Wolke über den Himmel flog der Donnervogel, seine
Flügel weit ausbreitend und Racheschreie ausstoßend, weit ins Nordland und
ward nie mehr gesehen.
Nachdem er so blutige Rache genommen, fühlte sich der Jäger erleichtert und
stieg ins Nest hinab, wo er noch einige Reste seiner Frau fand. Er trug sie
zum Ufer, machte dort ein Feuer und brachte ihrem Schatten Speise- und
Trankopfer dar.
Die Kraniche
Es ist schon lange her, daß sich eines Herbsttages die Kraniche darauf
vorbereiteten, südwärts zu ziehen. Als sie sich in großer Schar
zusammengefunden hatten, sahen sie in der Nähe des Dorfes ein wunderschönes
junges Weib ganz allein. Sie bewunderten sie, scharten sich um sie, hoben
sie auf ihre ausgebreiteten Flügel, trugen sie hoch in die Luft und flogen
mit ihr fort. Während die einen sie aufhoben, kreisten die anderen unter
ihnen so dicht, daß sie nicht herunterfallen konnte und ihr lautes heiseres
Geschrei übertönte alle Hilferufe, so ward das Weib fortgetragen und wurde
nie mehr gesehen. Seit dieser Zeit kreisen die Kraniche im Herbst immer
herum und während sie sich zum Flug nach Süden vorbereiten, schreien sie
laut herum, wie sie damals taten.
Das Echo
Ein junges Mädchen wollte keinen Mann nehmen. Schließlich wurden ihre Leute
ärgerlich, brachen das Zelt ab und verließen sie. Am Tag, nachdem sie
verlassen worden war, sah das Mädchen die Männer in ihren Kajaks Seehunde
jagen. Sie hatte eine steile Klippe erstiegen, auf der sie die Männer
stehen sahen. Jetzt rief sie einem der Männer zu: »Komm und hole mich! Ich
will dich heiraten!« Die Männer glaubten ihr aber nicht. Dann hörten sie
das Mädchen sagen: »Ich wollte, meine Füße würden in Stein verwandelt!« und
sie verwandelten sich in Steine; »ich wollte, meine Hüften verwandelten
sich in Steine!« und auch die verwandelten sich in Steine; »ich will, daß
sich meine Arme in Stein verwandeln!« und beide wurden zu Stein; »ich will,
daß sich meine Brust in Stein verwandelt!« und sie wurde zu Stein. »Ich
will, daß auch mein Kopf zu Stein wird!« und auch der versteinerte. Jetzt
war sie ganz in einen Stein verwandelt und so ist sie auch noch jetzt. Wenn
die Leute in ihren Booten vorüberkommen, so können sie sie hören.
Die unzufriedene Graspflanze
In der Nähe des Dorfes Pastolik, an der Yukonmündung, wächst eine hohe,
dünne Grasart. Die Frauen dieses Dorfes gehen im Herbst, knapp vor
Wintersbeginn, hinaus und sammeln eine Menge von diesem Gras ein; sie
reißen es aus oder schneiden es aus dem Boden, machen große Bündel daraus
und tragen sie am Rücken nach Hause. Das Gras wird dann getrocknet und zu
Matten, Körben oder Sitzpölstern für die Fellboote verarbeitet.
Einer dieser Grasstengel, der von einer Frau schon fast ausgerissen worden
wäre, begann darüber nachzudenken, wie unvorteilhaft es eigentlich sei,
nicht etwas anderes zu sein und sah sich um. Fast auf den ersten Blick sah
er ein in der Nähe wachsendes Pflanzenbüschel, das so ruhig und ungestört
aussah, daß der Grashalm sich wünschte, auch so eines zu sein. Kaum hatte
er diesen Wunsch, als er auch schon in so eine Pflanze verwandelt wurde,
wie die, welche er beneidet hatte, eine war und für kurze Zeit hatte er nun
Ruhe.
Eines Tags aber sah er die Frauen mit scharfen Spitzhacken wiederkommen und
die Pflanzen mit diesen ausjäten, einige Wurzeln essen und die anderen in
Körben nach Hause bringen. Als die Frauen abends nach Hause gingen, blieb
die Verwandelte übrig und wünschte, da sie das Schicksal der Gefährten
gesehen hatte, doch eine andere Gestalt angenommen zu haben. Sie sah sich
also wieder um und bemerkte eine andere unscheinbare Kriechpflanze, die ihr
gefiel, weil sie so winzig und versteckt war. Sofort wünschte sie so eine
zu werden und das geschah auch; wieder verstrich einige Zeit ganz ruhig,
dann aber kamen die Frauen wieder und rissen die Gefährten aus; die
Verwandelte übersahen sie. Das nächste Mal bekam sie aber Angst und wollte
in eine kleine Knollenfrucht, wie solche in der Nähe wuchsen, verwandelt
werden. Die Verwandlung war kaum geschehen, als eine Feldmaus durchs Gras
geschlichen kam, die Knolle einer ähnlichen Pflanze in der Nähe auszugraben
begann, sie zwischen den Vorderpfoten hielt und daran knabberte und dann
weglief. »Um in Sicherheit zu sein, muß ich eine Maus werden!« dachte sich
die Wandelbare und sofort wurde sie eine Maus und lief ganz glücklich über
die neue Verwandlung herum. Hin und wieder blieb sie stehen, um eine Knolle
auszugraben und zu verzehren, wie es die andere getan hatte, oder sie
setzte sich auf die Hinterbeine und sah sich die wechselnden Aussichten an.
Während die Maus so herumwanderte, sah sie plötzlich ein fremdes, weißes
Ding auf sich zukommen, das am Boden herumpickte und nachdem es um irgend
etwas zu fressen stehengeblieben war, wieder aufflog. Wie es näherkam,
erkannte es die Maus als eine große, weiße Eule. In diesem Augenblick
bemerkte auch die Eule die Maus und stürzte auf sie los. Während sie aber
noch im Flug war, gelang es der Maus glücklicherweise in ein Loch, das
eine andere gemacht hatte, zu entschlüpfen, worauf die Eule wegflog.
Nach einer Weile wagte sich die Maus aus ihrem Versteck heraus, obwohl ihr
Herz noch von der letzten Angst zitterte. »Ich will eine Eule sein«, dachte
die Maus, »auf die Art werde ich gerettet sein.« Mit diesem Wunsch
verwandelte sie sich nun wieder in eine schöne weiße Eule und brach mit
langsamem, geräuschlosem Flügelschlag nach Norden auf; hie und da rastete
sie, um eine Maus zu fangen. Nach einem langen Flug kam ihr die
Sledge-Insel in Sicht; ihre Flügel waren schon so müde, daß sie nur mit
äußerster Anstrengung die Küste erreichen konnte, wo sie sich auf ein im
Sande steckendes Stück Treibholz setzte. Bald darauf sah sie zwei stramme
Männer die Küste entlang gehen und ihr altes Unzufriedenheitsgefühl
erwachte wieder. »Ich will ein Mensch sein«, dachte sie; mit einem
Flügelschlag war sie am Boden und wurde da in einen schönen jungen Mann
verwandelt; der war nun nackt. Bald darauf wurde es Nacht und er setzte
sich mit dem Rücken gegen das Holzstück, auf dem er kurz vorher als Eule
gesessen hatte und schlief dort bis zum Morgen. Der warme Sonnenschein
weckte ihn auf und Chun-uh-luk, so nannte er sich selbst, war, als er
aufstand, ganz steif und lahm vom Sitzen in der kalten Nachtluft.
Er sah sich um und fand einiges Gras, aus dem er sich etwas, wie einen
leichten Mantel, zum Schutz gegen die Kälte, wob. Dann sah er in der Nähe
einige Renntiere weiden und bekam Lust, eines davon zu töten und zu
verzehren. Er schlich sich auf den Händen und Knien heran, sprang auf das
nächste zu, faßte es bei den Hörnern und brach ihm mit einem Ruck das
Genick; dann nahm er es auf seine Schultern, ging zurück und warf es in der
Nähe seines Schlafplatzes hin. Er griff nun den Renntierkörper ab und fand
dabei, daß das Fell eine so gute Schutzdecke war, daß er es mit seinen
Fingern nicht aufreißen konnte. Lange dachte er nach, wie er das Fell
herunterbringen könnte; schließlich fand er einen scharfkantigen Stein, hob
ihn auf und entdeckte, daß man damit das Fell durchschneiden kann. Das Tier
war rasch gehäutet, aber nun fehlte ihm ein Feuer, um das Fleisch zu
kochen. Er suchte herum und fand an der Küste zwei weiße Steine, die viel
Funken gaben, wenn er sie aneinander schlug. Mit ihnen und etwas trockenem
Zeug, das er an der Küste fand, gelang es ihm, ein Feuer anzufachen, über
dem er ein Stück vom Fleisch rösten konnte. So wie er als Eule die Mäuse
gefressen hatte, versuchte er nun ein großes Stück herunterzuschlucken,
aber es ging nicht; er schnitt also einige kleine Stücke ab und aß sie.
Noch eine Nacht verging und am Morgen fing er ein anderes Renntier und am
folgenden Tag zwei weitere; diese beiden nahm er zugleich auf die Schultern
und trug sie zugleich zu seinem Lagerplatz an der Küste. Da Chun-uh-luk in
den Nächten sehr fror, häutete er die beiden letzten Renntiere ab und
hüllte sich vom Kopf bis zu den Füßen in ihre Felle; sie trockneten rasch
auf ihm und saßen wie angewachsen. Die Nächte wurden aber immer kälter; da
sammelte Chun-uh-luk an der Küste einen Stoß Treibholz zusammen und machte
sich daraus eine rohe Hütte, die für ihn schon sehr bequem war.
Nachdem er sein Haus fertiggestellt hatte, ging er eines Tages über die
Hügel und sah ein fremdartiges schwarzes Tier bei einigen Blaubeerbüschen
Beeren fressen. Chun-uh-luk wußte zuerst nicht, ob er sich mit diesem
unbekannten Tier einlassen sollte oder nicht; schließlich fing er es aber
doch bei einem seiner Hinterbeine. Mit wütendem Geknurr wandte es sich um,
sah ihn an und fletschte seine weißen Zähne. Da packte Chun-uh-luk den
Bären plötzlich bei seinen starken Backenhaaren, schwang ihn über seinen
Kopf und schlug ihn mit solcher Gewalt gegen den Boden, daß er tot dalag;
dann schulterte er ihn und ging nach Hause.
Als er den Bären abhäutete, fand Chun-uh-luk, daß er sehr fett war und er
nun Licht in seinem Haus haben könnte, wenn er nur etwas fände, um das Fett
hineinzutun, denn in seinem Haus war es dunkel, so daß er sich nur mühsam
zurechtfinden konnte. Er ging an der Küste herum und fand einen langen
flachen Stein mit etwas ausgehöhlter Oberfläche; hierin hielt sich das Fett
sehr gut und nachdem er noch einen Docht aus Moos hineingegeben hatte, war
sein Haus so gut, als er sich nur wünschen konnte, beleuchtet.
Vor den Eingang hängte er das Bärenfell, um den kalten Wind, der manchmal
hereinblies und ihn in der Nacht ganz starr machte, abzuhalten. So lebte er
nun viele Tage, bis er sich einsam zu fühlen begann, wenn er an die beiden
Männer zurückdachte, die er gesehen hatte, als er noch als Eule an der
Küste gestanden. Er dachte sich: »Ich habe einmal zwei Männer vorübergehen
gesehen, es können also andere Leute nicht gar zu weit weg wohnen. Ich will
sie suchen gehen, denn es ist hier doch sehr einsam.« Er ging also aus auf
die Suche nach Leuten. Er wanderte eine ziemliche Strecke die Küste entlang
und kam schließlich zu zwei schönen Kajaks, die am Fuß eines Hügels lagen
und auf ihnen lagen Speere, Schnüre, Schwimmer und anderes Jagdgerät.
Nachdem er diese Merkwürdigkeiten untersucht hatte, sah er in der Nähe
Spuren, die zum Gipfel des Hügels führten und folgte ihnen. Auf der Kuppe
des Hügels war ein Haus und in der Nähe zwei Speicher und davor lagen
mehrere frisch getötete weiße Wale und die Schädel von vielen anderen lagen
herum. Er wollte nun, bevor er sich ihnen selbst zeigte, die Bewohner des
Hauses sehen und kroch daher leise in den Eingang und an die Tür heran.
Vorsichtig hob er einen Zipfel des Fells, das im Torweg hing und sah
hinein. Der Tür gegenüber saß ein junger Mann und arbeitete an einigen
Pfeilen; ein Bogen lag neben ihm. Chun-uh-luk ließ den Vorhang fallen und
rührte sich eine Zeitlang nicht, denn er befürchtete, der junge Mann werde
mit den Pfeilen nach ihm schießen, wenn er eintrete, noch bevor er ihm
seine friedlichen Absichten bezeugen könne. Schließlich dachte er sich:
»Wenn ich hineingehe und sage: >Ich bin gekommen, Bruder<, wird er mir
nichts tun.« Er hob rasch den Vorhang und trat ein. Da spannte der Hausherr
sofort den Bogen, legte einen Pfeil an, bereit gegen seinen Kopf
loszuschießen als Chun-uh-luk gerade sagte: »Ich bin gekommen, Bruder!« Da
senkte der junge Mann Bogen und Pfeile und sagte freudig: »Bist du mein
Bruder? Komm und setz dich neben mich.« Chun-uh-luk tat so und war ganz
glücklich. Der Hausherr zeigte sich sehr erfreut und sagte: »Ich freue mich
sehr, dich zu sehen, Bruder, denn immer habe ich geglaubt, ich hätte
irgendwo einen Bruder, konnte ihn aber nie finden. Wo hast du gelebt? Hast
du die Eltern gekannt? Wie bist du aufgewachsen?« Und so stellte er noch
viele Fragen, auf die Chun-uh-luk erwiderte, daß er seine Eltern nie
gekannt habe und er beschrieb ihm sein Leben an der Küste bis zu dem
Zeitpunkt, wo er auf diese Suche ausgegangen war. Der Hausherr erzählte
dann, daß auch er die Eltern nie gekannt habe und seine erste Erinnerung
sei, daß er sich ganz allein in diesem Haus gefunden habe und hier habe er
nun gelebt, indem er Wild zu seiner Nahrung erlegte.
Der Hausherr lud nun Chun-uh-luk ein, ihm zu einem der Vorratsspeicher zu
folgen; dort war eine große Menge wertvoller Pelze, Seehundsspeck und
andere Speisen in Überfluß. Dann öffnete er die Türe des anderen Speichers
und zeigte dem Ankömmling eine Menge erschlagener Leute. Der Hausherr
erzählte nun, er habe sie aus Rache für den Tod seiner Eltern umgebracht,
denn für ihn stände es fest, daß sie von diesen Leuten umgebracht worden
waren und so habe er keinen lebend vorüberziehen lassen.
Als die Brüder zum Haus zurückkehrten, waren sie schläfrig und schliefen
bis zum Morgen. Bei Tagesanbruch standen sie auf und nach dem Frühstück
sagte der Hausherr zu Chun-uh-luk, er solle, da er weder Bogen noch Pfeile
habe, zu Hause bleiben und für sie beide kochen, während er selbst auf die
Jagd gehe. Er ging dann weg und kam in der Nacht zurück und brachte
Renntierfleisch mit. Chun-uh-luk hatte das Essen fertig und nachdem sie
gegessen, legten sie sich schlafen und schliefen gut. So lebten sie mehrere
Tage, bis Chun-uh-luk dessen schon überdrüssig war, immer zu Hause zu
bleiben und zu kochen.
Eines Morgens bat er seinen Bruder, er möchte doch gestatten, daß er mit
auf die Jagd gehe; der schlug es aber ab und ging allein. Als er bald
darauf einige Renntiere zu beschleichen begann, kam Chun-uh-luk heimlich
nachgekrochen und packte ihn beim Fuß, damit sein Bruder, ohne daß das Wild
aufgescheucht werde, wissen sollte, daß er da sei. Der Jäger wandte sich
aber um und sagte ärgerlich: »Was willst du denn, daß du mir folgst? Du
kannst doch ohne Pfeil und Bogen nichts erlegen.« »Mit meinen Händen allein
kann ich das Wild umbringen«, sagte Chun-uh-luk; sein Bruder aber sagte
spöttisch: »Geh nach Hause und besorge deine Kocherei!« Chun-uh-luk ging
weg, aber statt nach Hause zu gehen, schlich er sich an eine Renntierherde
heran und brachte zwei mit den Händen um, wie er es getan hatte, als er
noch allein lebte. Dann stellte er sich auf und winkte seinem Bruder mit
den Händen, er solle herbeikommen. Der kam und war sehr erstaunt, die
beiden Renntiere zu sehen, denn er hatte mit seinen Pfeilen keines erlegt.
Chun-uh-luk schulterte die beiden Tiere und trug sie nach Hause.
Mit finsterer Miene und Rachegedanken im Herzen folgte ihm sein Bruder, bis
Eifersucht und Ärger alle freundschaftlichen Gefühle, die er für
Chun-uh-luk hegte, verdrängt hatten; aber er hatte auch etwas Furcht, da er
seinen Bruder so große Stärke beweisen gesehen hatte. Alle Abende saß er
still und ärgerlich, rührte die ihm vorgesetzten Speisen kaum an, bis
schließlich sein Argwohn und seine Rachegedanken in Chun-uh-luk die
gleichen Gefühle erregten. So saßen sie die Nacht hindurch einander
auflauernd und irgend einen Verrat fürchtend.
Der nächste Tag war ruhig und klar und der Hausherr fragte Chun-uh-luk, ob
er einen Kajak rudern könne, worauf dieser entgegnete, er glaube, er werde
es schon zustande bringen. Der Hausherr führte ihn nun zu den Kajaks an
die Küste, bestieg den einen und sagte Chun-uh-luk, er möchte ihm in dem
anderen folgen. Anfangs hatte Chun-uh-luk ziemliche Mühe, seinen Kajak
aufrecht zu erhalten, aber bald hatte er es weg, ihn zu beherrschen und sie
fuhren weit ins Meer hinaus. Als die Küste schon weit hinter ihnen lag,
kehrten sie um und der Hausherr sagte: »Laß uns jetzt sehen, wer die Küste
zuerst erreichen kann!« Leicht flogen die Kajaks dahin und zuerst schien
der eine, dann der andere einen Vorsprung zu haben, bis sie schließlich mit
einer letzten Anstrengung landeten und beide Wettkämpfer im selben
Augenblick ans Land sprangen. Der Hausherr machte ein finsteres Gesicht und
sagte zu Chun-uh-luk: »Du bist nicht mehr länger mein Bruder. Du, geh
dorthin, ich werde dahin gehen.« Sie wandten einander den Rücken zu und
trennten sich verärgert. Wie sie auseinandergingen, wurde Chun-uh-luk in
einen braunen Vielfraß und sein Bruder in einen Grauwolf verwandelt und als
solche wandern sie bis zum heutigen Tag im Land herum, aber niemals
zusammen.
Der Wurm-Mensch
Vor sehr langer Zeit lebte ein großer Wurm, den eine Frau heiratete und
beide hatten einen Sohn, der auch ein Wurm war. Als der Sohn erwachsen war,
sagte ihm der Vater, er solle nach dem Mittelpunkt der Erdfläche gehen und
dort werde er in einer kleinen Hütte ein Weib finden. Der Sohn machte sich
mit Hilfe seiner Zauberkräfte klein, damit er rascher vorwärts komme und
zog weg. Als er in die Nähe der Hütte, von der sein Vater ihm erzählt
hatte, kam, fühlte er unter seinen Füßen die Erde wanken und zittern und
fürchtete schon, er werde umkommen. Das wiederholte sich mehrmals, bis er
das Haus erreichte. Da fand er, daß das Sprechen eines alten Weibes, das
mit seiner Tochter im Haus wohnte, die Ursache der Erderschütterung war.
Die Leute nahmen ihn gastfreundlich auf und da das Mädchen sehr hübsch war,
heiratete er sie.
Nachdem er hier vier Jahre gelebt hatte, erinnerte er sich seiner Eltern
und machte sich auf, sie zu besuchen. Unterwegs wurde er aber von einem
anderen Wurm-Menschen, der ein Zauberer war, getötet.
Bald darauf fühlte auch sein Vater starke Sehnsucht nach seinem Sohn und
brach auf, um ihn zu besuchen. Unterwegs fand er den Körper seines Sohnes
und als er sich umsah, gewahrte er in der Nähe ein großes Dorf. Er ging zur
Quelle, wo die Dorfbewohner ihr Wasser holten, machte sich klein und
verbarg sich darin und vermittels seiner Zauberkünste brachte er aus Rache
für den Tod seines Sohnes fast alle Bewohner um.
Als nur noch ein paar Leute übrig waren, bewirkte eine alte Frau aus dem
Dorf, die wußte, daß irgend eine Zauberei gegen sie im Gange war, einen
großen Zauber, demzufolge die See stieg, daß das Eis der Oberfläche
zerbrach und es übers Land schwemmte, bis die Quelle zugedeckt war; dann
zerschellten die Eisblöcke aneinander bis der Wurm-Mensch in Stücke
zerrieben und vernichtet war, so daß die Leute von seinem Zauber erlöst
waren.
Inhalt
Seite
1. Flutlegende von St. Michael (Aljaska) 7
2. Die große Flut (Von den Zentral-Eskimos) 8
3. Die Schöpfung (Geschichten vom Raben Tu-lu-kau-guk I.) 9
4. Der Ursprung von Land und Menschen 31
5. Ursprung der Lebewesen 32
6. Sonne, Mond und Sterne 34
7. Sonne und Mond 35
8. Der Mond, die Sonne und der Böse 36
9. Das Sternbild Udlegdjun 38
10. Herkunft der Inuit 39
11. Die Abstammung der Indianer und Europäer 40
12. Sednamythe 42
13. Das Land des Todes 45
14. Die Entstehung der Winde 50
15. Von Einem, der nichts finden konnte 55
16. Wie der Rabe das Licht brachte 59
17. Der Kanibale Igimarasugdjuqdjuaq 64
18. Der Geist des Festhauses 66
19. Die Bärengeschichte 67
20. Der rote Bär Ta-ku-ka 70
21. Der rote Bär 78
22. Der Feuerball 81
23. Die Auswanderung der Sagdlirmiut 85
24. Die Rivalen 89
25. Die Geschichte von den drei Brüdern 90
26. Qaudjaqdjuq 95
27. Der Mann im Monde 98
28. Der Riese 102
29. Der seltsame Knabe 109
30. Das Land der Finsternis 118
31. Die entflohenen Weiber 125
32. Kiviung 127
33. Die einzige Frau 134
34. Die Geschichte vom Mann und seiner Fuchs-Frau 136
35. Der Waisenknabe und der alte Mann 138
36. Die Eule und der Rabe 139
37. Der Rabe nimmt ein Weib
(Geschichten vom Raben Tu-lu-kau-guk II.) 140
38. Der Rabe, der Wal und der Nörz
(Geschichten vom Raben Tu-lu-kau-guk III.) 146
39. Der Rabe und das Murmeltier 152
40. Entstehung des Raben 154
41. Der Rabe und die Möve 155
42. Entstehung der Möven 156
43. Der Ursprung der Mücken 157
44. Entstehung der Schwalben 158
45. Die Entstehung der Lummen 159
46. Der Hase 160
47. Herkunft der viereckigen Flecken am Rücken der Tauchente 161
48. Wie der Habicht entstand 162
49. Die letzten Donnervögel 163
50. Die Kraniche 166
51. Das Echo 167
52. Die unzufriedene Graspflanze 168
53. Der Wurm-Mensch 178
Inhalt 180
Anmerkung 183
Anmerkung
Ich habe diese Märchen der Eskimo zwischen der Beringstraße und der
Hudsonbai aus nachstehenden Veröffentlichungen übertragen und ausgewählt:
Aus F. Boas: Central Eskimo (Annual Report of American Ethnology, Vol VI.
Washington 1888) stammen Nr. 2, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 31, 32,
36. Aus einer Veröffentlichung desselben Autors im Bulletin of the American
Museum of natural history (Vol XV, New-York 1907) sind Nr. 7, 27, 35, 41,
51.
Aus E. W. Nelson: The Eskimo about Beringstrait (Annual Report of American
Ethnology, Vol XVIII/1, Washington 1896/97) sind die Nr. 1, 3, 4, 8, 13,
14, 15, 16, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 49, 50, 52, 53
ausgewählt. Aus L. Turner: Ethnology of the Ungawa district. Hudsonbay
territory (Annual Report of American Ethnology, Vol VII. Washington
1889/90) sind die übrigen Märchen: Nr. 5, 6, 10, 24, 34, 40, 41, 43, 44,
45, 46, 47, 48.
DIESES WERK WURDE IM JAHRE 1921 IN DER HOF-BUCH- UND -STEINDRUCKEREI VON
DIETSCH & BRÜCKNER / WEIMAR IN DER NORDISCHEN ANTIQUA GEDRUCKT
DEN EINBAND ENTWARF BERNHARD KLEIN
Im Verlag Axel Juncker erschienen ferner:
Sagen und Märchen Altindiens
Nachgedichtet von _Alois Essigmann_
2 Bände, pro Band in Pappe gebunden M. 18.--, in Halbldr. M. 30.--,
Doppelb. in Halbldr. M. 50.--
Isländische Märchen
Übertragen von _Aage Avenstrup_ und _Elisabeth Treitel_
in Pappe M. 18.--, in Halbleder M. 30.--
Sijawusch
Persische Sagen
Übertragen von _Alois Essigmann_
in Pappe M. 15.--, in Halbleder M. 25.--
Sawitri
Eine altindische Legende, erzählt von _Alois Essigmann_ mit Bildern von
_Bernhard Klein_
in Pappe M. 4.50, in Halbleder M. 16.--
Königinnen
Legenden von _Wilhelmine Mohr_
in Seide M. 60.--
H. Chr. Andersen
Gesammelte Märchen
Mit farbigen Aquarellen von _Alfred Thon_
in Halblein. M. 50.--, in Halbled. M. 85.--, in Ganzled. M. 400.--
H. Chr. Andersen
Der Glückspeter
Mit Scherenschnitten von _Alfred Thon_
gebunden M. 16.--
Eduard Mörike
Das Stuttgarter Hutzelmännlein
Mit Scherenschnitten von _Alfred Thon_
in Ganzleder M. 250.--, in Halbleder M. 40.--, in Pappe M. 20.--
Charles Baudelaire
Gedichte in Prosa
Übertragen von _Dieter Bassermann_
in Ganzled. M. 220.--, in Halbled. M. 60.--, in Pappband M. 32.--
Gottfried Keller
Das Tanzlegendchen
Auf den Stein gezeichnet und mit Bildern versehen von _Hannes M. Avenarius_
Einmalige Aufl. v. 500 numer. Exempl. vom Künstler signiert in Ganzled. und
Ganzseide vergriffen, in Halbled. M. 110.--
Einfache Ausgabe als Orplid-Buch in Pappe M. 4.50, in Halbled. M. 16.--, in
Wildled. geb. M. 40.--
Die Juncker-Bücher
Eine neue Reihe illustrierter Bücher in Pappe M. 12.--, in Halbleder M.
20.--
1. EICHENDORFF, JOS., FREIHERR VON. Aus dem Leben eines Taugenichts.
Novelle. Mit Scherenschnitten von _Alfred Thon_.
2. SIMON, ERICH M. Das Abenteuer des Herrn Balthasar Dienegott Sieversen.
Erzählung. Mit Bildern des Verfassers.
3. MANN, FRANZISKA. Der Schäfer. Eine Geschichte aus der Stille. Mit
Scherenschnitten von _Alfr. Thon_.
4. HAUFF, WILHELM. Phantasien aus dem Bremer Ratskeller. Novelle. Mit
Bildern von _Paul Scheurich_.
5. CLAUREN, H. Mimili. Novelle. Mit Bildern von _Hugo Steiner-Prag_.
6. LUCIAN. Göttergespräche. Übersetzt von _Chr. Wieland_. Mit Bildern von
_Paul Scheurich_.
7. SCHLEGEL, FRIEDR. Lucinde. Mit Radierungen von _Mart. E. Philipp_.
8. BRENTANO, CLEMENS. Das Märchen vom Kommanditchen. Mit Bildern von _Hugo
Steiner-Prag_. In Vorbereitung.
9. MONNIER, HENRY. Die Naturgeschichte des Spießbürgers. Übersetzt von
_Hans Pfeifer_. Mit Bildern nach alten Kupfern von _Monnier_.
10. HOFFMANN, E. T. A. Aus dem Leben dreier Freunde. Mit Zeichnungen von
_Felix Müller_.
11. PUSCHKIN, A. Die Reise nach Erzerum. Eine Novelle. Mit Bildern von
_Benno Wulfsohn_.
12. HENNINGSEN, AGNES. Das Glück. Eine spanische Liebesgeschichte. Mit
Zeichnungen von _Fritz Albrecht_.
Die Sammlung wird fortgesetzt
Von den Bänden 4 bis 12 sind je 300 Exemplare auf feinstem Velin gedruckt,
numeriert und in Ganzseide gebunden Preis M. 60.--
Die Orplid-Bücher
[Illustration: Signet]
Bisher erschienen 47 Bände in Pappband 4.50 Mark, in Halbleder 16.-- Mark.
Literarisch wertvoll, entzückend ausgestattet, handlich im Format, billig
im Preis
All diese Vorzüge machen sie zu dem reizendsten Geschenk für Freunde
schöner Bücher
Bisher sind erschienen:
1. J. P. JACOBSEN. Kormak und Stengerde. In Übertragung von _Toni Schwabe_.
2. LIEBESLIEDER. Kleine Anthologie. Gedichte von _Anton Wildgans_, _Max
Mell_, _Max Brod_, _F. Th. Csokor_, _P. Asam_.
3. KURT TUCHOLSKY. Rheinsberg. Ein Bilderbuch für Verliebte. Mit Bildern
von _Kurt Szafranski_.
4. MAX BROD. Der Bräutigam. Eine Erzählung.
5. RENÉ SCHICKELE. Das Glück. Eine Erzählung. Mit Zeichnungen von _Wilhelm
Wagner_.
6. SCHALOM ASCH. Erde. Eine Erzählung.
7. ANDREAS HAUKLAND. Orms Söhne. Neue Ansiedlergeschichten.
8. LUDWIG KAINER. Kunst und Mode. Eine Mappe mit 24 handkolorierten
Zeichnungen.
9. FRITZ WOLFF. Malerbummel. Eine Mappe mit 25 teils handkolorierten
Zeichnungen.
10. KURT MÜNZER. Casanovas letzte Liebe.
11. SOLDATENLIEDER. Neu gedruckt im Kriegsjahr 1914. Mit handkolorierten
Zeichnungen.
12. NEUE KRIEGSLIEDER. Mit Beiträgen von _Richard Dehmel_, _Herb.
Eulenberg_, _Carl und Gerhard Hauptmann_, _Herm. Hesse_, _Alfred Kerr_,
_René Schickele_ u. a. Mit handkolorierten Zeichnungen von _Willi Geiger_.
13. KURT MÜNZER. Taten und Kränze. Lieder zum Kriege 1914. Mit
handkolorierten Zeichnungen von _B. Mendelssohn_.
14. KASERNE UND SCHÜTZENGRABEN. Neue Kriegslieder zweiter Band. Mit
Beiträgen von _Hans Brennert_, _Gustav Hochstädter_, _Carl Ettlinger_,
_Hermann Kienzl_, _Karl Rosner_ u. a. Mit handkolorierten Zeichnungen von
_Oskar Nerlinger_.
15. LANDSTURM. Lieder von der Front. Zeichnungen von _Wilhelm Wagner_.
16. WILHELM WAGNER. Gefangenenlager. Eine Mappe mit Zeichnungen.
17. HANS BOHN. Das Orplid-A-B-C. Eine Mappe mit handkolorierten
Zeichnungen.
18. FRITZ WOLFF. Aus dem Dunkel der Großstadt. Eine Mappe mit Zeichnungen.
19. EMIL PIRCHAN. Das Teufelselixier. Mit kolorierten Zeichnungen des
Verfassers.
20. PIO BAROJA. Spanische Miniaturen. Mit Zeichnungen von _Bernhard Klein_.
21. FRIEDRICH SCHLEGEL. Lucinde. Mit Radierungen von _Martin E. Philipp_.
22. GUSTAV ERICH HOLSTEN. Ninon de Lenclos. Mit Zeichnungen von _Erich M.
Simon_.
23. DIETER BASSERMANN. Pierrot Dandy und der Mond. Mit Bildern von _Hilde
Widmann_.
24. FIONA MACLEOD. Das ferne Land. Zwei keltische Sagen.
25. ALOIS ESSIGMANN. Gott, Mensch u. Menschheit. Aphorismen.
26. OSC. WILDE. Ballade des Zuchthauses zu Reading. Nachdichtung von _Arth.
Holitscher_. Zeichnungen von _Otto Schmalhausen_.
27. SAWITRI. Eine Sage Alt-Indiens. Erzählt von _Alois Essigmann_. Mit
Zeichnungen von _Bernh. Klein_.
28. MAX HOCHDORF. Ju Hei Tschu. Die Entensauce und der Mops. Erzählungen.
Mit Bildern von _Hans Bohn_.
29. GEORG BÜCHNER. Wozzeck. Mit Holzschnitten von _Wilhelm Plünnecke_.
30. GOETHE. Das Tagebuch. Luxusdruck. Preis: Pappe M. 8.--; Halbleder M.
12.--; Ganzleder M. 25.--.
31. MAX HOCHDORF. Die letzte Tat des Jean Jaurès. Der Wanderungen und
Gedanken I. Teil.
32. MEYER AARON GOLDSCHMIDT. Maser. Eine Novelle. Mit Zeichnungen von
_Benno Wulfsohn_.
33. W. HEINSE. Die Kirschen. Romanze. Mit Zeichnungen von _Helmuth
Stockmann_.
34. CHR. M. WIELAND. Diana und Endymion. Ein Schäferlied. Mit Zeichnungen
von _Elisabeth von Sydow_.
35. MAURICE BARRÈS. Eine Liebe in Thule. Eine Novelle.
36. DENIS DIDEROT. Eine wahre Geschichte. Eine Novelle. Mit Zeichnungen von
_Helmuth Stockmann_.
37. VIKTOR HADWIGER. Blanche. Fünf Kapitel einer Liebesgeschichte.
38. ALEXEY TOLSTOI. Im Nebel. Eine Novelle. Mit Holzschnitten von _Peter
List_.
39. OTTO RUNG. Die Gefängnissonate. Übersetzt von _Emilie Stein_. Mit
Bildern von _Mark Kallin_.
40. BORIS SSADOWSKIJ. Der Apfelkönig. Übersetzt von _Alexander Eliasberg_.
Mit Bildern von _Walter Gramatté_.
41. GOTTFRIED KELLER. Das Tanzlegendchen. Mit Bildern von _Hannes M.
Avenarius_.
42. E. T. A. HOFFMANN. Das öde Haus. Mit Bildern von _Karl Hutloff_.
43. VIKTOR HADWIGER. Des tragischen Affen Jogu Liebe und Hochzeit. Eine
tragikomische Geschichte. Mit Zeichnungen von _Lothar Homeyer_.
44. AAGE AVENSTRUP und ELISABETH TREITEL. Wie es Jons Seele erging.
Isländische Sagen. Mit Einbandzeichnung und Initialen des Herausgebers.
45. MAX HOCHDORF. Comte und die Göttin Clotilde. Der Wanderungen und
Gedanken II. Teil.
46. KÄTHE GRIESE. Kinderschuhe. Eine Rokokonovelle. Mit Zeichnungen von
_German v. Schmidt_.
47. G. E. LESSING. Der Eremit. Eine Dichtung mit Kupfern von _Chodowiecki_.
Die Sammlung wird fortgesetzt
Anmerkungen zur Transkription
Rechtschreibung und Zeichensetzung des Originaltextes wurden beibehalten,
offensichtliche Druckfehler wurden korrigiert.
Seite 7: »bebedeckte alles Land« wurde geändert in »bedeckte alles Land«
Seite 11: »Der Mensch nahm die Beeren und stekte sie« wurde geändert in
»Der Mensch nahm die Beeren und steckte sie«
Seite 14: »und der Mensch, dessen belehrt« wurde geändert in
»und der Mensch dessen belehrt«
Seite 25: »ins Himmelland zurück« wurde vereinheitlicht in
»ins Himmelsland zurück«
Seite 31: »Pikmitalik« wurde geändert in »Pikmiktalik«
Seite 34: »wurde die Sterne« wurde geändert in »wurden die Sterne«
Seite 35: »als die Leute im Tanzhaus versammelt war« wurde geändert in
»als die Leute im Tanzhaus versammelt waren«
Seite 35: »Kienspahn« wurde geändert in »Kienspan«
Seite 38: »die Verfolger der Sterne« wurde geändert in
»die Verfolger die Sterne«
Seite 39: »Herkunft der Innuit« wurde geändert in »Herkunft der Inuit«
Seite 40: »mit Ausnahme der Sohlen ganz beharrt« wurde geändert in
»mit Ausnahme der Sohlen ganz behaart«
Seite 42: »übers Eis gepflogen« wurde geändert in »übers Eis geflogen«
Seite 42: »die Wind und Schnee freiem Eintritt ließen« wurde geändert in
»die Wind und Schnee freien Eintritt ließen«
Seite 52: »Die Puppe blieb stehen nnd sagte« wurde geändert in
»Die Puppe blieb stehen und sagte«
Seite 55: »Sein Nebenmann gab ihn manchmal Wasser« wurde geändert in
»Sein Nebenmann gab ihm manchmal Wasser«
Seite 59: »In einem Dorf am unteren Yuson« wurde geändert in
»In einem Dorf am unteren Yukon«
Seite 62: »Darauf antworte der Knabe« wurde geändert in
»Darauf antwortete der Knabe«
Seite 65: »gerade in dieser Richtung stoßen« wurde geändert in
»gerade in diese Richtung stoßen«
Seite 67: »Sie hatte keine lebenden Anverwandte mehr« wurde geändert in
»Sie hatte keine lebenden Anverwandten mehr«
Seite 76: »vor Pfeil oder Speerwunden« wurde geändert in
»vor Pfeil- oder Speerwunden«
Seite 84: »vor den Tunghät schützen sollte« wurde geändert in
»vor den Tunghak schützen sollte«
Seite 87: »Weist du nicht« wurde geändert in »Weißt du nicht«
Seite 90: In dieser und der folgenden Geschichte wurde »Qaudjaqdjug«
jeweils in »Qaudjaqdjuq« geändert, gemäß der Schreibweise im
Inhaltsverzeichnis
Seite 99: »Sie trug ein flache Schüssel« wurde geändert in
»Sie trug eine flache Schüssel«
Seite 100: »Dann erzälte sie ihrem Mann« wurde geändert in
»Dann erzählte sie ihrem Mann«
Seite 102: »Nach dem sie den Schnee« wurde geändert in
»Nachdem sie den Schnee«
Seite 104: »Den andern Tag sagte ihr Kun-äk« wurde geändert in
»Den andern Tag sagte ihr Kin-äk«
Seite 107: »Eine Zeit verstich« wurde geändert in »Eine Zeit verstrich«
Seite 113: »nicht ninmal eine Maus« wurde geändert in
»nicht einmal eine Maus«
Seite 116: »die mein Brüder waren« wurde geändert in
»die meine Brüder waren«
Seite 120: »daß seine Brust so weis« wurde geändert in
»daß seine Brust so weiß«
Seite 120: »und nahm dann selbst sein Mal ein« wurde geändert in
»und nahm dann selbst sein Mahl ein«
Seite 122: »das zwei Hände« wurde geändert in »daß zwei Hände«
Seite 124: »die Schüssel mit den Ohrspitzeln« wurde geändert in
»die Schüssel mit den Ohrspitzen«
Seite 127: »zupften an seinen Gewand herum« wurde geändert in
»zupften an seinem Gewand herum«
Seite 129: »ein gutes Mal zu kochen« wurde geändert in
»ein gutes Mahl zu kochen«
Seite 135: »Jede der Frau« wurde geändert in »Jede der Frauen«
Seite 141: »wir machten zeitlich halt« wurde geändert in
»wir machten zeitig halt«
Seite 145: »Mehrmals viel er um« wurde geändert in »Mehrmals fiel er um«
Seite 164: »und packte sie mit ihren Krallen« wurde geändert in
»und packte sie mit seinen Krallen«
Seite 169: »Hin und wider blieb sie stehen« wurde geändert in
»Hin und wieder blieb sie stehen«
Seite 169: »und, zu verzehren« wurde geändert in »und zu verzehren«
Seite 179: »das das Eis der Oberfläche« wurde geändert in
»daß das Eis der Oberfläche«
Seite 183: »american Museum of natural history« wurde geändert in
»American Museum of natural history«
End of the Project Gutenberg EBook of Eskimomärchen, by Paul Sock
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ESKIMOMÄRCHEN ***
***** This file should be named 38972-8.txt or 38972-8.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/3/8/9/7/38972/
Produced by Jana Srna, Wolfgang Menges and the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
[email protected]. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
[email protected]
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.

Eskimomärchen
Subjects:
Download Formats:
Excerpt
The Project Gutenberg EBook of Eskimomärchen, by Paul Sock
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
Read the Full Text
— End of Eskimomärchen —
Book Information
- Title
- Eskimomärchen
- Language
- German
- Type
- Text
- Release Date
- February 24, 2012
- Word Count
- 43,454 words
- Library of Congress Classification
- E011; PM
- Bookshelves
- DE Kinderbuch, Browsing: Children & Young Adult Reading, Browsing: Culture/Civilization/Society, Browsing: History - American
- Rights
- Public domain in the USA.