*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 35339 ***
F. M. Dostojewski: Sämtliche Werke
Unter Mitarbeiterschaft von Dmitri Mereschkowski,
herausgegeben von Moeller van den Bruck
Übertragen von E. K. Rahsin
Zweite Abteilung: Vierzehnter Band
F. M. Dostojewski
Arme Leute
Der Doppelgänger
Zwei Romane
R. Piper & Co. Verlag, München
R. Piper & Co. Verlag, München, 1920
Sechstes bis zehntes Tausend
Copyright 1920 by R. Piper & Co., G. m. b. H.
Verlag in München
Buchdruckerei Otto Regel, G. m. b. H., Leipzig.
Inhalt
Vorbemerkung V
Arme Leute 1
Der Doppelgänger 237
Vorbemerkung
Der Band bringt die ersten Dichtungen Dostojewskis: den Briefroman der
„Armen Leute“ und die Petersburger Geschichte, wie Dostojewski sie
ausdrücklich nannte, vom „Doppelgänger“. Die eine ist in der Reihenfolge
der Werke Dostojewskis mit dem Jahre 1845, die andere mit dem Jahre 1846
verbunden.
Die „Armen Leute“ waren zu ihrer Zeit ein Ereignis: sie wirkten, trotz
Gogol, der vorhergegangen war, wie der Einbruch einer neuen
Literaturrichtung, der naturalistischen, die auf die romantische folgte,
und lenkten mit einem Male die Aufmerksamkeit von ganz Jung-Rußland auf
den neuen Dichter. Heute lesen wir das Werk nicht wegen seines
zeitlichen und literarischen Wertes, den wir in seiner Tragweite kaum
noch verstehen, sondern um des Ewigen und Lyrisch-Mächtigen willen, von
dem es in seiner rührenden Frische und scheuen Menschlichkeit voll ist.
Der „Doppelgänger“, mit den dunklen, unheimlichen und unberechenbaren
Mächten, die wie ein nächtiges Schattenspiel in dem Dichter lebten,
kündete den späteren Dostojewski an: nicht Dostojewski den Idylliker,
der nur selten mehr durchbrechen sollte, sondern Dostojewski den
Fatalisten und Tragiker. Schon in den „Armen Leuten“ war die ungemeine
Psychologie in der Menschenschilderung aufgefallen, aber es war eine
Psychologie der Nähe und Innigkeit gewesen. Jetzt, in dem
„Doppelgänger“, wurde eine Psychologie des Abgrundes und der
Erschütterung daraus, und man ahnte bereits, daß sie zu einer ganzen
Weltanschauung und russischen Menschenanschauung auswachsen konnte. –
Das Doppelgängerproblem selbst lag in der Zeit. Poe hatte ihm im William
Wilson den romantischen Helden gegeben, E. Th. A. Hoffmann in den
Elixieren des Teufels aus ihm eine romantische Aventüre gezogen.
Dostojewski dagegen – und eben dies kennzeichnete ihn so – brachte
dasselbe Problem mit der irren Phantastik zusammen, die das Wirkliche,
das Graue, der Alltag besitzen kann, und ließ es in Wahngebilden aus dem
kranken Hirn eines Menschen steigen, der äußerlich zunächst nicht anders
ist wie Tausende um ihn.
M. v. d. B.
Arme Leute
„Nein, ich danke für diese Märchendichter! Anstatt
etwas Nützliches, Angenehmes, Erquickendes zu
schreiben, kratzen sie da die kleinsten
Kleinigkeiten aus der Erde hervor und schnüffeln
überall herum! ... Ich würde Ihnen einfach
verbieten, zu schreiben! Zum Beispiel, was soll
das: man liest ... unwillkürlich denkt man doch
nach, – aber ... aber ... es kommen einem nur alle
möglichen Ungereimtheiten in den Kopf. Nein,
wirklich, ich würde ihnen verbieten, zu schreiben,
ganz einfach und unter allen Umständen: schlankweg
verbieten!“
Fürst W. F. Odojewskij.
8. April.
Meine unschätzbare Warwara Alexejewna!
Gestern war ich glücklich, über alle Maßen glücklich, wie man
glücklicher gar nicht sein kann! So haben Sie Eigensinnige doch
wenigstens einmal im Leben auf mich gehört! Als ich am Abend, so gegen
acht Uhr, erwachte (Sie wissen doch, meine Liebe, daß ich mich nach dem
Dienst ein bis zwei Stündchen etwas auszustrecken liebe), da holte ich
mir meine Kerze – und wie ich nun gerade mein Papier zurechtgelegt habe
und nur noch meine Feder spitze, schaue ich plötzlich ganz unversehens
auf – da: wirklich, mein Herz begann zu hüpfen! So haben Sie doch
erraten, was ich wollte! Ein Eckchen des Vorhanges an Ihrem Fenster war
zurückgeschlagen und an einem Blumentopf mit Balsaminen angesteckt,
genau so, wie ich es Ihnen damals anzudeuten versuchte. Dabei schien es
mir noch, daß auch Ihr liebes Gesichtchen am Fenster flüchtig
auftauchte, daß auch Sie aus Ihrem Zimmerchen nach mir ausschauten, daß
Sie gleichfalls an mich dachten! Und wie es mich verdroß, mein Täubchen,
daß ich Ihr liebes, reizendes Gesichtchen nicht deutlich sehen konnte!
Es hat einmal eine Zeit gegeben, wo auch wir mit klaren Augen sahen,
mein Kind. Das Alter ist keine Freude, meine Liebe. Auch jetzt ist es
wieder so, als flimmerte mir alles vor den Augen. Arbeitet man abends
noch ein bißchen, schreibt man noch etwas, so sind die Augen am nächsten
Morgen gleich rot und tränen so, daß man sich vor fremden Leuten fast
schämen muß. Aber doch sah ich im Geiste gleich Ihr Lächeln, mein Kind,
Ihr gutes, freundliches Lächeln, und in meinem Herzen hatte ich ganz
dieselbe Empfindung, wie damals, als ich Sie einmal küßte, Warinka –
erinnern Sie sich noch, Engelchen? Wissen Sie, mein Täubchen, es schien
mir sogar, als ob Sie mir mit dem Finger drohten. War es so, Sie Unart?
Das müssen Sie mir unbedingt ausführlich erzählen, wenn Sie mir wieder
einmal schreiben.
Nun, wie finden Sie denn unseren Einfall, ich meine, das mit Ihrem
Fenstervorhang, Warinka? Gar zu nett, nicht wahr? Sitze ich an der
Arbeit, oder lege ich mich schlafen, oder stehe ich auf – immer weiß ich
dann, daß auch Sie dort an mich denken, sich meiner erinnern, und auch
selbst gesund und heiter sind. Lassen Sie den Vorhang herab, so heißt
das: „Gute Nacht, Makar Alexejewitsch, es ist Zeit, schlafen zu gehen!“
Heben Sie ihn wieder auf, so heißt das: „Guten Morgen, Makar
Alexejewitsch, wie haben Sie geschlafen, und wie steht es mit Ihrer
Gesundheit, Makar Alexejewitsch? Ich selbst bin, Gott sei Dank, gesund
und wohlgemut!“
Sehen Sie nun, mein Seelchen, wie fein das ersonnen ist. So sind gar
keine Briefe nötig! Schlau, nicht wahr? Und diese kniffliche Erfindung
stammt von mir! Nun was – bin ich nicht erfinderisch, Warwara
Alexejewna?
Ich muß Ihnen doch noch berichten, mein Kind, daß ich diese Nacht recht
gut geschlafen habe, eigentlich gegen alle Erwartung gut, womit ich denn
auch sehr zufrieden bin; zumal man in einer neuen Wohnung, schon aus
Ungewohntheit, sonst niemals gut zu schlafen pflegt; es ist eben doch
immer nicht alles so, wie es sein muß. Als ich heute aufstand, war es
mir ganz wie – wie – nun, wie so einem lichten Falken ums Herz – froh
und sorgenfrei! Was ist das doch heute für ein schöner Morgen, mein
Kind! Unser Fenster wurde aufgemacht: die Sonne scheint herein, die
Vögel zwitschern, die Luft ist erfüllt von Frühlingsdüften und die ganze
Natur lebt auf, – nun, und auch alles andere war genau so, wie es sich
gehört, genau wie es sein muß, wenn es Frühling wird. Ich versank sogar
ein Weilchen in Träumerei und dabei dachte ich nur an Sie, Warinka. Ich
verglich Sie in Gedanken mit einem Himmelsvögelchen, das so recht zur
Freude der Menschen und zur Verschönerung der Natur erschaffen ist.
Dabei dachte ich auch, daß wir, Warinka, wir Menschen, die wir in Sorgen
und Ängsten leben, die kleinen Himmelsvöglein um ihr sorgenloses und
unschuldiges Glück beneiden könnten, – nun und Ähnliches mehr, alles von
der Art, dachte ich. Das heißt, ich machte nur so entfernte Vergleiche
... Ich habe da ein Büchelchen, Warinka, in dem ist von solchen Dingen
die Rede, und alles ist ganz ausführlich beschrieben. Ich schreibe das
deshalb, weil ich nur sagen will, daß es doch sonst immer verschiedene
Auffassungen gibt, nicht wahr, meine Liebe? Jetzt aber ist es Frühling,
und da kommen einem gleich so angenehme Gedanken, so geistreiche und
erfinderische obendrein, und sogar zärtliche Träumereien kommen einem.
Die ganze Welt erscheint einem in rosigem Licht. Deshalb habe ich auch
dies alles geschrieben. Übrigens habe ich es meist dem Büchelchen
entnommen. Dort äußert der Verfasser ganz denselben Wunsch, nur in
Versen:
„Ein Vogel, ein Raubvogel möchte ich sein!“
Und so weiter. Dort kommen auch noch verschiedene andere Gedanken vor,
aber – nun, Gott mit Ihnen! Doch sagen Sie, wohin gingen Sie denn heute
morgen, Warwara Alexejewna? Ich hatte mich noch nicht zum Dienst
aufgemacht, da gingen Sie bereits fröhlich über den Hof, hatten schon
wie ein Frühlingsvöglein Ihr Zimmerchen verlassen. Und wie mein Herz
sich freute, als ich Sie sah! Ach, Warinka, Warinka! Grämen Sie sich
doch nicht! Mit Tränen hilft man keinem Kummer, glauben Sie mir, ich
weiß es, weiß es aus eigener Erfahrung. Jetzt leben Sie doch so ruhig
und sorgenlos, und auch mit Ihrer Gesundheit geht es besser. – Nun, was
macht Ihre Fedora? Ach, was ist das für ein guter Mensch! Sie müssen mir
alles ganz genau beschreiben, Warinka, wie Sie mit ihr leben und ob Sie
auch mit allem zufrieden sind? Fedora ist mitunter etwas brummig, aber
Sie müssen das nicht weiter beachten, Warinka. Gott mit ihr! Sie ist
doch eine gute Seele.
Ich habe Ihnen schon früher von unserer Theresa geschrieben – sie ist
gleichfalls eine gute und treue Person. Was hab’ ich mir doch um unsere
Briefe für Sorgen gemacht! Wie sollte man sie befördern? Da kam uns denn
zu unserem Glück diese Theresa, kam wie von Gott gesandt. Sie ist eine
gute, bescheidene, stille Person. Aber unsere Wirtin ist wahrhaft
erbarmungslos, so versteht sie es, sie auszunutzen. Die Arme wird mit
Arbeit ganz überhäuft.
Doch in was für eine Wildnis bin ich hier geraten, Warwara Alexejewna!
Das ist mir mal eine Wohnung, das muß ich sagen! Früher lebte ich doch
in einer solchen Einsamkeit, Sie wissen ja: friedlich, still, wenn
einmal eine Fliege flog, hörte man es. Hier aber – Lärm, Geschrei,
Gezeter! Aber Sie wissen ja noch gar nicht, wie das hier eigentlich
alles ist. Denken Sie sich ungefähr einen langen Korridor, einen ganz
dunklen und unsauberen. Rechts ist die Brandmauer, ohne Fenster, ohne
Türen; links aber ist Tür an Tür, ganz wie in einem Hotel, so eine lange
Reihe Türen. Und hinter jeder Tür ist nur ein Zimmer, Nummer
Soundsoviel, und in jeder dieser Nummern wohnen zwei bis drei zusammen,
je nachdem, und die zahlen gemeinsam die Miete. Ordnung dürfen Sie nicht
verlangen – das ist hier wie in der Arche Noah! Doch sind es, glaube
ich, trotzdem gute Menschen, alle sind sie so gebildet, sogar gelehrt.
Unter anderen wohnt hier ein Beamter – ein sehr belesener Mann: er
spricht von Homer, und noch von verschiedenen anderen Schriftstellern,
von allem spricht er, – ein kluger Mensch! Dann wohnen hier noch zwei
ehemalige Offiziere, die immer nur Karten spielen. Dann ein Seemann, der
englische Stunden gibt. – Warten Sie mal, ich werde Sie einmal zum
Lachen bringen, mein Kind: ich werde in meinem nächsten Brief alle die
Leute satirisch beschreiben, das heißt, wie sie hier hausen, und zwar
ganz ausführlich!
Unsere Wirtin ist ein sehr kleines und unsauberes altes Weib, geht den
ganzen Tag in Pantoffeln und in einem Schlafrock umher und schimpft
ununterbrochen die Theresa. Ich wohne in der Küche, oder richtiger
gesagt – Sie müssen sich das so denken: hier neben der Küche ist noch
ein Zimmer (unsere Küche ist, muß ich Ihnen sagen, rein und hell und
sehr anständig), ein ganz kleines Zimmerchen, so ein bescheidenes
Winkelchen eigentlich nur ... oder noch richtiger wird es so sein: die
Küche ist groß und hat drei Fenster, und bei mir ist nun parallel der
Querwand eine Scheidewand angebracht, so daß es sozusagen noch ein
Zimmerchen gibt, eine Nummer „über den Etat“, wie man sagt. Alles ist
geräumig und bequem, und sogar ein Fenster habe ich und überhaupt alles,
– mit einem Wort nochmals, es ist alles gut und bequem. Das ist also
mein Winkelchen. Aber nun müssen Sie nicht etwa denken, Kind, daß irgend
etwas dabei sei und ich einen Hintergedanken habe: weil das immerhin nur
eine Küche ist! Das heißt, genau genommen lebe ich ja in demselben Raum,
nur hinter einer Scheidewand, aber das hat nichts zu sagen! Ich lebe
hier ganz heimlich und mäuschenstill, ganz bescheiden und ruhig. Habe
hier mein Bett aufgestellt, einen Tisch, eine Kommode, zwei Stühle,
jawohl, genau ein Paar, und habe das Heiligenbild aufgehängt. Es gibt
gewiß bessere Wohnungen, sogar viel bessere, aber die Hauptsache ist
doch die Bequemlichkeit; ich wohne ja hier nur deshalb, weil ich es so
am bequemsten habe – Sie brauchen nicht zu denken, daß ich es aus
irgendeinem anderen Grunde tue. Ihr Fensterchen liegt mir gerade
gegenüber, über den Hof, und der Hof ist auch nur so ein kleines
Höfchen, da sieht man Sie denn ganz deutlich hin und wieder im
Vorübergehen, – das ist doch immer etwas geselliger für mich Armen, und
auch billiger.
Bei uns hier kostet selbst das kleinste Zimmer mit der Beköstigung
zusammen fünfunddreißig Rubel monatlich. Das ist nichts für meinen
Beutel! Mein Winkelchen aber kostet nur sieben Rubel, und für die
Beköstigung zahle ich fünf, während ich früher für alles in allem runde
dreißig Rubel zahlte, dafür aber auf vieles verzichten mußte: so konnte
ich nicht immer Tee trinken, jetzt dagegen, oh, da bleibt mir noch genug
für Tee und Zucker. Es ist, wissen Sie, doch so – tatsächlich: man
schämt sich irgendwie, wenn man keinen Tee trinken kann, Warinka. Hier
wohnen nur Leute, die ihr Auskommen haben, und da geniert man sich eben.
Und eigentlich: nur wegen der anderen trinkt man ihn, den Tee, Warinka,
nur des Ansehens wegen, weil es hier zum guten Ton gehört. Mir wäre es
ja sonst ganz gleich, ich bin nicht einer, der viel auf Genüsse gibt.
Und dann, was man so noch als Taschengeld braucht – denn irgend etwas
hat man doch immer nötig – nun, sei es ein Paar Stiefel, ein
Kleidungsstück – wieviel bleibt denn da übrig? So geht denn mein ganzes
Gehalt auf. Ich klage ja nicht, ich bin ganz zufrieden. Für mich genügt
es. Hat es doch schon viele Jahre genügt! Hin und wieder gibt es auch
noch Gratifikationen.
Nun, leben Sie wohl, mein Engelchen. Ich habe da ein paar Blumen
gekauft, zwei Töpfchen, eines mit Balsaminen und eines mit Geranium –
nicht teuer. Vielleicht lieben Sie auch Reseda? Auch Reseda ist zu
haben, schreiben Sie nur. Aber alles recht ausführlich, ja? Übrigens
müssen Sie da nicht irgendwie etwas argwöhnen, Kind, ich meine – was
mich betrifft, und daß ich jetzt so ein Zimmer gemietet habe. Nein, nur
die Bequemlichkeit veranlaßte mich dazu, nur, daß es in allem so bequem
war, das verleitete mich. – Ich habe doch, das muß ich Ihnen noch sagen,
Kind, ich habe doch Geld gespart, ich habe etwas beiseite gelegt: oh ja:
ich besitze schon etwas! Achten Sie nicht darauf, daß ich so still und
zaghaft bin, daß es aussieht, als könne mich eine Fliege mit den Flügeln
umstoßen. Nein, mein Kind, ich bin gar nicht so schwach und habe gerade
den Charakter, den ein Mensch mit ruhigem Gewissen und in der
Festigkeit, die uns unsere Anständigkeit gibt, haben muß. Leben Sie
wohl, mein Engelchen. Da habe ich schon ganze zwei Bogen vollgeschrieben
und es ist bereits höchste Zeit zum Dienst. Ich küsse Ihre Fingerchen,
Warinka, und verbleibe
Ihr ergebenster Diener und treuester Freund
Makar Djewuschkin.
P. S. Um eines bitte ich Sie noch: antworten Sie mir recht ausführlich,
mein Engelchen. Ich sende Ihnen hier eine Düte Konfekt, Warinka;
verschmausen Sie es mit Behagen und machen Sie sich um Gottes willen
keine Sorgen um mich und nehmen Sie mir nur nicht irgend etwas übel. Und
nun leben Sie wohl, mein Kind.
8. April.
Sehr geehrter Makar Alexejewitsch!
Wissen Sie, daß man Ihnen endlich einmal die Freundschaft wird kündigen
müssen? Ich schwöre Ihnen, guter Makar Alexejewitsch, es fällt mir
furchtbar schwer, Ihre Geschenke anzunehmen. Ich weiß doch, wieviel sie
kosten und was das für Ihren Beutel ausmacht, zu wieviel Entbehrungen
Sie sich deshalb zwingen, wie Sie sich das Notwendigste selbst
verweigern. Wie oft habe ich Ihnen schon gesagt, daß ich nichts nötig
habe, ganz und gar nichts, daß es nicht in meinen Kräften steht, die
Wohltaten, mit denen Sie mich überschütten, zu erwidern. Und wozu diese
Blumen? Die Balsaminen, nun, das ginge noch an, aber wozu nun noch
Geranium? Es braucht einem nur ein unbedachtes Wort zu entschlüpfen, wie
zum Beispiel meine Bemerkung über Geranium, da müssen Sie auch schon
sofort Geranium kaufen. So etwas ist doch bestimmt teuer? Wie wundervoll
die Blüten sind! So leuchtend rot, und Stern steht an Stern. Wo haben
Sie nur ein so schönes Exemplar aufgetrieben? Ich habe den Blumentopf
auf das Fensterbrett gestellt, an die sichtbarste Stelle. Auf das
Bänkchen vor dem Fenster werde ich noch andere Blumen stellen, lassen
Sie mich nur erst reich werden! Fedora kann sich nicht genug freuen –
unser Zimmer ist jetzt ein richtiges Paradies, so sauber und hell und
freundlich. Aber wozu war denn das Konfekt nötig? Übrigens: ich erriet
es sogleich aus Ihrem Brief, daß irgend etwas nicht richtig ist:
Frühling und Wohlgerüche und Vogelgezwitscher – nein, dachte ich, sollte
nicht gar noch ein Gedicht folgen? Denn wirklich, es fehlen nur noch
Verse in Ihrem Brief, Makar Alexejewitsch. Und die Gefühle sind zärtlich
und die Gedanken rosafarben – alles, wie es sich gehört! An den Vorhang
habe ich überhaupt nicht gedacht. Der Zipfel muß an einem Zweige hängen
geblieben sein, als ich die Blumentöpfe umstellte. Da haben Sie es!
Ach, Makar Alexejewitsch, was reden Sie da und rechnen mir Ihre
Einnahmen und Ausgaben vor, um mich zu beruhigen und glauben zu machen,
daß Sie alles nur für sich allein ausgeben! Mich können Sie damit doch
nicht betrügen. Ich weiß doch, daß Sie sich des Notwendigsten um
meinetwillen berauben. Was ist Ihnen denn eingefallen, daß Sie sich ein
solches Zimmer gemietet haben, sagen Sie doch, bitte! Man beunruhigt Sie
doch, man belästigt Sie dort, das Zimmer wird gewiß eng und unbequem und
ungemütlich sein. Sie lieben Stille und Einsamkeit, hier aber – was wird
denn das für ein Leben sein? Und bei Ihrem Gehalt könnten Sie doch viel
besser wohnen. Fedora sagt, daß Sie früher unvergleichlich besser gelebt
hätten als jetzt. Haben Sie wirklich Ihr ganzes Leben so verbracht,
immer einsam, immer mit Entbehrungen, ohne Freude, ohne ein gutes,
liebes Wort zu hören, immer in einem bei fremden Menschen gemieteten
Winkel? Ach Sie, mein guter Freund, wie Sie mir leid tun! So schonen Sie
doch wenigstens Ihre Gesundheit, Makar Alexejewitsch! Sie erwähnen, daß
Ihre Augen angegriffen seien, – so schreiben Sie doch nicht bei
Kerzenlicht! Was und wozu schreiben Sie denn noch? Ihr Diensteifer wird
Ihren Vorgesetzten doch wohl ohnehin schon bekannt sein.
Ich bitte Sie nochmals inständig, verschwenden Sie nicht soviel Geld für
mich. Ich weiß, daß Sie mich lieben, aber Sie sind doch selbst nicht
reich ... Heute war ich ebenso froh, wie Sie, als ich erwachte. Es war
mir so leicht zumut. Fedora war schon lange an der Arbeit und hatte auch
mir Arbeit verschafft. Darüber freute ich mich sehr. Ich ging nur noch
aus, um Seide zu kaufen, und dann setzte ich mich gleichfalls an die
Arbeit. Und den ganzen Morgen und Vormittag war ich so heiter! Jetzt
aber – wieder trübe Gedanken, alles so traurig, das Herz tut mir weh.
Mein Gott, was wird aus mir werden, was wird mein Schicksal sein! Das
Schwerste ist, daß man so nichts, nichts davon weiß, was einem
bevorsteht, daß man so gar keine Zukunft hat, und daß man nicht einmal
erraten kann, was aus einem werden wird. Und zurückzuschauen, davor
graut mir einfach! Dort liegt soviel Leid und Qual, daß das Herz mir
schon bei der bloßen Erinnerung brechen will. Mein Leben lang werde ich
unter Tränen die Menschen anklagen, die mich zugrunde gerichtet haben.
Diese schrecklichen Menschen!
Es dunkelt schon. Es ist Zeit, daß ich mich wieder an die Arbeit mache.
Ich würde Ihnen gern noch vieles schreiben, doch diesmal geht es nicht:
die Arbeit muß zu einem bestimmten Tage fertig werden. Da muß ich mich
beeilen. Briefe zu erhalten ist natürlich immer angenehm: es ist dann
doch nicht so langweilig. Aber weshalb kommen Sie nicht selbst zu uns?
Wirklich, warum nicht, Makar Alexejewitsch? Wir wohnen ja jetzt so nahe,
und soviel freie Zeit werden Sie doch wohl haben. Also bitte, besuchen
Sie uns! Ich sah heute Ihre Theresa. Sie sieht ganz krank aus. Sie hat
mir so leid getan, daß ich ihr zwanzig Kopeken gab.
Ja, fast hätte ich es vergessen: schreiben Sie mir unbedingt alles
möglichst ausführlichst – wie Sie leben, was um Sie herum vorgeht –
alles! – Was es für Leute sind, die dort wohnen, und ob Sie auch in
Frieden mit ihnen auskommen? Ich möchte das alles sehr gern wissen. Also
vergessen Sie es nicht, schreiben Sie es unbedingt! Heute werde ich
unabsichtlich ganz gewiß keinen Zipfel des Vorhanges anstecken. Gehen
Sie früher schlafen. Gestern sah ich noch um Mitternacht Licht bei
Ihnen. Und nun leben Sie wohl. Heute ist wieder alles da: Trauer und
Trübsal und Langeweile! Es ist nun einmal so ein Tag! Leben Sie wohl.
Ihre
Warwara Dobrosseloff.
8. April.
Sehr geehrte Warwara Alexejewna!
Ja, mein Kind, ja, meine Liebe, es muß wohl wieder einmal so ein Tag
sein, wie er einem vom Schicksal öfter beschieden ist! Da haben Sie sich
nun über mich Alten lustig gemacht, Warwara Alexejewna! Übrigens bin ich
selbst daran schuld, ich ganz allein! Wer hieß mich auch, in meinem
Alter, mit meinem spärlichen Haarrest auf dem Schädel, auf Abenteuer
ausgehen ... Und noch eins muß ich sagen, mein Kind: der Mensch ist
bisweilen doch sonderbar, sehr sonderbar. Oh du lieber Gott! auf was er
mitunter nicht zu sprechen kommt! Was aber folgt daraus, was kommt dabei
schließlich heraus? Ja, folgen tut daraus nichts, aber heraus kommt
dabei ein solcher Unsinn, daß Gott uns behüte und bewahre! Ich, mein
Kind, ich ärgere mich ja nicht, aber es ist mir sehr unangenehm, jetzt
daran zurückzudenken, was ich Ihnen da alles so glücklich und dumm
geschrieben habe. Und auch zum Dienst ging ich heute so stolz und
stutzerhaft: es war solch ein Leuchten in meinem Herzen, war so wie ein
Feiertag in der Seele, und doch ganz ohne allen Grund, – so frohgemut
war ich! Mit förmlicher Schaffensgier machte ich mich an die Arbeit, an
die Papiere – und was wurde schließlich daraus? Als ich mich dann umsah,
war wieder alles so wie früher – grau und nüchtern. Überall dieselben
Tintenflecke, wie immer dieselben Tische und Papiere, und auch ich ganz
derselbe: wie ich war, genau so bin ich auch geblieben, – was war da für
ein Grund vorhanden, den Pegasus zu reiten? Und woher war denn alles
gekommen? Daher, daß die Sonne einmal durch die Wolken geschaut und der
Himmel sich heller gefärbt hatte. Nur deshalb – dies alles? Und was
können das für Frühlingsdüfte sein, wenn man auf einen Hof hinaussieht,
auf dem aller Unrat der Welt zu finden ist! Da muß ich mir also nur so
aus Albernheit alles eingebildet haben. Aber es kommt doch bisweilen
vor, daß ein Mensch sich in seinen eigenen Gefühlen verwirrt und in die
Weite schweift und Unsinn redet. Das kommt von nichts anderem, als von
alberner Hitzigkeit, in der das Herz eine Rolle spielt. Nach Hause kam
ich nicht mehr wie andere Menschen, sondern schleppte mich heim: der
Kopf schmerzte. Das kommt dann schon so: eins zum anderen. Ich muß wohl
meinen Rücken erkältet haben. Ich hatte mich, recht wie ein alter Esel,
über den Frühling gefreut und war im leichten Mantel ausgegangen. Auch
das noch! In meinen Gefühlen aber haben Sie sich getäuscht, meine Liebe!
Sie haben meine Äußerungen in einem ganz anderen Sinn aufgefaßt. Nur um
väterliche Zuneigung handelt es sich, Warinka, denn ich nehme bei Ihnen,
in Ihrer bitteren Verwaistheit, die Stelle Ihres Vaters ein, das sage
ich aus reiner Seele und aus reinem Herzen. Wie es auch sei: ich bin
doch immerhin Ihr Verwandter, wenn auch nur ein ganz entfernter
Verwandter, vielleicht wie das Sprichwort sagt: das siebente Wasser in
der Suppe, aber immerhin: Ihr Verwandter bleibe ich dennoch, und jetzt
bin ich sogar Ihr bester Verwandter und einziger Beschützer. Denn dort,
wo es am nächsten lag, daß Sie Schutz und Beistand suchten, dort fanden
Sie nur Verrat und Schmach. Was aber die Gedichte betrifft, so muß ich
Ihnen sagen, mein Kind, daß es sich für mich nicht schickt, mich auf
meine alten Tage noch im Dichten zu üben. Gedichte sind Unsinn! Heute
werden in den Schulen die Kinder geprügelt, wenn sie dichten ... da
sehen Sie, was Dichten ist, meine Liebe.
Was schreiben Sie mir da, Warwara Alexejewna, von Bequemlichkeit, Ruhe
und was nicht noch alles? Mein Kind, ich bin nicht anspruchsvoll, ich
habe niemals besser gelebt, als jetzt: weshalb sollte ich jetzt anfangen
zu mäkeln? Ich habe zu essen, habe Kleider und Schuh – was will man
mehr? Nicht uns steht es zu, Gott weiß was für Sprünge zu machen! – bin
nicht von vornehmer Herkunft! Mein Vater war kein Adliger und bezog mit
seiner ganzen Familie ein geringeres Gehalt, als ich. Ich bin nicht
verwöhnt. Übrigens, wenn man ganz aufrichtig die Wahrheit sagen soll, so
war ja wirklich in meiner früheren Wohnung alles unvergleichlich besser.
Man war freier, unabhängiger, gewiß, mein Kind. Natürlich ist auch meine
jetzige Wohnung gut, ja sie hat in gewisser Hinsicht sogar ihre Vorzüge:
es ist hier lustiger, wenn Sie wollen, es gibt mehr Abwechslung und
Zerstreuung. Dagegen will ich nichts sagen, aber es tut mir doch leid um
die alte. So sind wir nun einmal, wir alten Leute, das heißt, wenn wir
Menschen schon anfangen, älter zu werden. Die alten Sachen, an die wir
uns gewöhnt haben, sind uns schließlich wie verwandt. Die Wohnung war,
wissen Sie, ganz klein und gemütlich. Ich hatte ein Zimmerchen für mich.
Die Wände waren ... ach nun, was soll man da reden! – Die Wände waren
wie alle Wände sind, nicht um die Wände handelt es sich, aber die
Erinnerungen an all das Frühere, die machen mich etwas wehmütig ...
Sonderbar – sie bedrücken, aber dennoch ist es, als wären sie angenehm,
als dächte man selbst doch gern an all das Alte zurück. Sogar das
Unangenehme, worüber ich mich bisweilen geärgert habe, sogar das
erscheint jetzt in der Erinnerung wie von allem Schlechten gesäubert und
ich sehe es im Geiste nur noch als etwas Trautes, Gutes. Wir lebten ganz
still und friedlich, Warinka, ich und meine Wirtin, die selige Alte. Ja,
auch an die Gute denke ich jetzt mit traurigen Gefühlen zurück. Sie war
eine brave Frau und nahm nicht viel für das Zimmerchen. Sie strickte
immer aus alten Zeugstücken, die sie in schmale Bänder zerschnitt, mit
ellenlangen Stricknadeln Bettdecken, damit allein beschäftigte sie sich.
Das Licht benutzten wir gemeinschaftlich, deshalb arbeiteten wir abends
an demselben Tisch. Ein Enkelkindchen lebte bei ihr, Mascha, ich
erinnere mich ihrer noch, wie sie ganz klein war – jetzt wird sie
dreizehn sein, schon ein großes Mädchen. Und so unartig war sie, so
ausgelassen, immer brachte sie uns zum Lachen. So lebten wir denn zu
dreien, saßen an langen Winterabenden am runden Tisch, tranken unseren
Tee, und dann machten wir uns wieder an die Arbeit. Die Alte begann oft
Märchen zu erzählen, damit Mascha sich nicht langweile oder auch, damit
sie nicht unartig sei. Und was das für Märchen waren! Da konnte nicht
nur ein Kind, nein, auch ein erwachsener, vernünftiger Mensch konnte da
zuhören. Und wie! Ich selbst habe oft, wenn ich mein Pfeifchen
angeraucht hatte, aufgehorcht, habe mit Spannung zugehört und die ganze
Arbeit darüber vergessen. Das Kindchen aber, unser Wildfang, wurde ganz
nachdenklich, stützte das rosige Bäckchen in die Hand, öffnete seinen
kleinen Kindermund und horchte mit großen Augen; und wenn es ein Märchen
zum Fürchten war, dann schmiegte es sich immer näher, immer angstvoller
an die Alte an. Uns aber war es eine Lust, das Kindchen zu betrachten.
Und so saß man oft und bemerkte gar nicht, wie die Zeit verging, und
vergaß ganz, daß draußen der Schneesturm wütete. –
Ja, das war ein gutes Leben, Warinka, und so haben wir fast ganze
zwanzig Jahre gemeinsam verlebt. – Doch wovon rede ich da wieder! Ihnen
werden solche Geschichten vielleicht gar nicht gefallen und mir sind
diese Erinnerungen auch nicht so leicht, – namentlich jetzt in der
Dämmerung. Theresa klappert dort mit dem Geschirr – ich habe
Kopfschmerzen, auch mein Rücken schmerzt ein wenig, und die Gedanken
sind alle so seltsam, als schmerzten sie gleichfalls: ich bin heute
traurig gestimmt, Warinka!
Was schreiben Sie da von besuchen, meine Gute? Wie soll ich denn zu
Ihnen kommen? Mein Täubchen, was werden die Leute dazu sagen? Da müßte
ich doch über den Hof gehen, das würde man bemerken und dann fragen, –
da gäbe es denn ein Gerede und daraus entstünden Klatschgeschichten und
man würde die Sache anders deuten. Nein, mein Engelchen, es ist schon
besser, wenn ich Sie morgen bei der Abendmesse sehe; das wird
vernünftiger sein und für uns beide unschädlicher. Seien Sie mir nicht
böse, mein Kind, weil ich Ihnen einen solchen Brief geschrieben habe.
Beim Durchlesen sehe ich jetzt, daß alles ganz zusammenhanglos ist. Ich
bin ein alter ungelehrter Mensch, Warinka; in der Jugend habe ich nichts
zu Ende gelernt, jetzt aber würde nichts mehr in den Kopf gehen, wenn
man von neuem mit dem Lernen anfangen wollte. Ich muß schon gestehen,
mein Kind, ich bin kein Meister der Feder und weiß, auch ohne fremde
Hinweise und spöttische Bemerkungen, daß ich, wenn ich einmal etwas
Spaßigeres schreiben will, nur Unsinn zusammenschwatze. – Ich sah Sie
heute am Fenster, ich sah, wie Sie den Vorhang herabließen. Leben Sie
wohl, Gott schütze Sie! Leben Sie wohl, Warwara Alexejewna.
Ihr Freund, der ganz uneigennützig Ihr Freund sein will,
Makar Djewuschkin.
P. S. Ich werde, meine Liebe, über niemanden mehr Satiren schreiben. Ich
bin zu alt geworden, Kind, um müßigerweise noch Scherze zu machen. Man
würde dann auch über mich lachen, denn es ist schon so, wie unser
Sprichwort sagt: Wer einem anderen eine Grube gräbt, der – fällt selbst
hinein.
9. April.
Makar Alexejewitsch!
Schämen Sie sich denn nicht, mein Freund und Wohltäter, sich so etwas in
den Kopf zu setzen! Haben Sie sich denn wirklich beleidigt gefühlt? Ach,
ich bin oft so unvorsichtig in meinen Äußerungen, aber diesmal hätte ich
doch nicht gedacht, daß Sie meinen harmlos scherzhaften Ton für Spott
halten könnten. Seien Sie überzeugt, daß ich es niemals wagen werde,
über Ihre Jahre oder Ihren Charakter zu scherzen. Ich habe es nur – wie
soll ich sagen –: aus Leichtsinn geschrieben, aus Gedankenlosigkeit,
oder vielleicht auch nur deshalb, weil es gerade furchtbar langweilig
war ... was aber tut man mitunter nicht alles aus Langeweile? Außerdem
glaubte ich, daß Sie sich selbst in Ihrem Brief ein wenig lustig hätten
machen wollen. Nun macht es mich sehr traurig, daß Sie unzufrieden mit
mir sind. Nein, mein treuer Freund und Beschützer, Sie täuschen sich,
wenn Sie mich der Gefühllosigkeit und Undankbarkeit verdächtigen. In
meinem Herzen weiß ich alles, was Sie für mich taten, als sie mich gegen
den Haß und die Verfolgungen schändlicher Menschen verteidigten, nach
seinem wahren Wert zu schätzen. Ewig werde ich für Sie beten, und wenn
mein Gebet bis hin zu Gott dringt und er mich erhört, dann werden Sie
glücklich sein.
Ich fühle mich heute ganz krank. Schüttelfrost und Fieber wechseln
ununterbrochen. Fedora beunruhigt sich sehr. Es ist übrigens ganz
grundlos, was Sie da schreiben – und weswegen Sie sich fürchten, uns zu
besuchen. Was geht das die Leute an? Sie sind mit uns bekannt und damit
Basta!
Leben Sie wohl, Makar Alexejewitsch. Zu schreiben weiß ich nichts mehr,
und ich kann auch nicht: fühle mich wirklich ganz krank. Ich bitte Sie
nochmals, mir nicht zu zürnen und von meiner steten Verehrung und
Anhänglichkeit überzeugt zu sein, womit ich die Ehre habe zu verbleiben
Ihre dankbare und ergebene
Warwara Dobrosseloff.
12. April.
Sehr geehrte Warwara Alexejewna!
Ach, mein Liebes, was ist das nun wieder mit Ihnen! Jedesmal erschrecken
Sie mich! Ich schreibe Ihnen in jedem Brief, daß Sie sich schonen
sollen, sich warm ankleiden, nicht bei schlechtem Wetter ausgehen, daß
Sie in allem vorsichtig sein sollen, – Sie aber, mein Engelchen, hören
gar nicht darauf, was ich sage! Ach, mein Täubchen, Sie sind doch
wirklich noch ganz wie ein kleines Kindchen! Sie sind so zart, wie so
ein Strohhälmchen, das weiß ich doch. Es braucht nur ein Windchen zu
wehen und gleich sind Sie krank. Deshalb müssen Sie sich auch in acht
nehmen, müssen Sie selbst darauf bedacht sein, sich nicht der Gefahr
auszusetzen und Ihren Freunden nicht Kummer, Sorge und Trübsal zu
bereiten.
Sie äußerten im vorletzten Brief den Wunsch, mein Kind, über meine
Lebensweise und alles, was mich umgibt und angeht, Genaueres zu
erfahren. Gern will ich Ihren Wunsch erfüllen. Ich beginne also –
beginne mit dem Anfang, mein Kind, dann ist gleich mehr Ordnung in der
Sache.
Also erstens: die Treppen in unserem Hause sind ziemlich mittelmäßig;
die Paradetreppe ist noch ganz gut, sogar sehr gut, wenn Sie wollen:
rein, hell, breit, alles Gußeisen und wie Mahagoni poliertes
Holzgeländer. Dafür ist aber die Hintertreppe so, daß ich lieber gar
nicht von ihr reden will: feucht, schmutzig, mit zerbrochenen Stufen,
und die Wände sind so fettig, daß die Hand kleben bleibt, wenn man sich
an sie stützen will. Auf jedem Treppenabsatz stehen Kisten, alte Stühle
und Schränke, alles schief und wackelig, Lappen sind zum Trocknen
aufgehängt, die Fensterscheiben eingeschlagen; Waschkübel stehen da mit
allem möglichen Schmutz, mit Unrat und Kehricht, mit Eierschalen und
Tischresten; der Geruch ist schlecht ... mit einem Wort, es ist nicht
schön.
Die Lage der Zimmer habe ich Ihnen schon beschrieben; sie ist – dagegen
läßt sich nichts sagen – wirklich bequem, das ist wahr, aber es ist auch
in ihnen eine etwas dumpfe Luft, das heißt, ich will nicht geradezu
sagen, daß es in den Zimmern schlecht riecht, aber so – es ist nur ein
etwas fauliger Geruch, wenn man sich so ausdrücken darf, in den Zimmern,
irgend so ein süßlich scharfer Modergeruch, oder so ungefähr. Der erste
Eindruck ist zum mindesten nicht vorteilhaft, doch das hat nichts zu
sagen, man braucht nur ein paar Minuten bei uns zu sein, so vergeht das,
und man merkt nicht einmal, wie es vergeht, denn man fängt selbst an, so
zu riechen, die Kleider und die Hände und alles riecht bald ebenso, –
nun, und da gewöhnt man sich eben daran. Aber alle Zeisige krepieren bei
uns. Der Seemann hat schon den fünften gekauft, aber sie können nun
einmal nicht leben in unserer Luft, dagegen ist nichts zu machen. Unsere
Küche ist groß, geräumig und hell. Morgens ist es allerdings etwas
dunstig in ihr, wenn man Fisch oder Fleisch brät und es riecht dann nach
Rauch und Fett, da immer etwas übergegossen wird, und auch der Fußboden
ist morgens meist naß, aber abends ist man dafür wie im Paradies. In der
Küche hängt bei uns gewöhnlich Wäsche zum Trocknen auf Schnüren, und da
mein Zimmer nicht weit ist, das heißt, fast unmittelbar an die Küche
stößt, so stört mich dieser Wäschegeruch zuweilen ein wenig. Aber das
hat nichts zu sagen: hat man hier erst etwas länger gelebt, wird man
sich auch daran gewöhnen.
Vom frühesten Morgen an, Warinka, beginnt bei uns das Leben, da steht
man auf, geht, lärmt, poltert, – dann stehen nämlich _alle_ auf, die
einen, um in den Dienst zu gehen oder sonst wohin, manche nur so aus
eigenem Antriebe: und dann beginnt das Teetrinken. Die Ssamoware gehören
fast alle der Wirtin, es sind ihrer aber nur wenige, deshalb muß ein
jeder aufpassen, wann die Reihe an ihn kommt; wer aus der Reihe fällt
und mit seinem Teekännchen früher geht, als er darf, dem wird sogleich,
und zwar tüchtig, der Kopf zurecht gerückt. Das geschah mit mir auch
einmal, gleich am ersten Tage ... doch was soll man davon reden! Bei der
Gelegenheit wurde ich dann auch mit allen bekannt. Näher bekannt wurde
ich zunächst mit dem Seemann. Der ist so ein Offenherziger, hat mir
alles gleich erzählt: von seinem Vater und seiner Mutter, von der
Schwester, die an einen Assessor in Tula verheiratet ist und von
Kronstadt, wo er längere Zeit gelebt hat. Er versprach mir auch seinen
Beistand, wenn ich seiner bedürfen sollte, und lud mich gleich zu sich
zum Abendtee ein. Ich suchte ihn dann auch auf – er war in demselben
Zimmer, in dem man bei uns gewöhnlich Karten spielt. Dort wurde ich mit
Tee bewirtet und dann verlangte man von mir, daß ich an ihrem
Hazardspiel teilnehmen sollte. Wollten sie sich nun über mich lustig
machen oder was sonst, das weiß ich nicht, jedenfalls spielten sie
selbst die ganze Nacht, auch als ich eintrat, spielten sie. Überall
Kreide, Karten, und ein Rauch war im Zimmer, daß es einen förmlich in
die Augen biß. Nun, spielen wollte ich natürlich nicht, und da sagten
sie mir, ich sei wohl ein Philosoph. Darauf beachtete mich weiter
niemand und man sprach auch die ganze Zeit kein Wort mehr mit mir. Doch
darüber war ich, wenn ich aufrichtig sein soll, nur sehr froh. Jetzt
gehe ich nicht mehr zu ihnen: bei denen ist nichts als Hazard, der reine
Hazard! Aber bei dem Beamten, der nebenbei so etwas wie ein Literat ist,
kommt man abends gleichfalls zusammen. Und bei dem geht es anders her,
dort ist alles bescheiden, harmlos und anständig, – ein behaglich
tüchtiges Leben.
Nun, Warinka, will ich Ihnen noch beiläufig anvertrauen, daß unsere
Wirtin eine sehr schlechte Person ist, eine richtige Hexe. Sie haben
doch Theresa gesehen, – also sagen Sie selbst: was ist denn an ihr noch
dran? Mager ist sie wie eine Schwindsüchtige, wie ein gerupftes
Hühnchen. Und dabei hält die Wirtin nur zwei Dienstboten: diese Theresa
und den Faldoni. Ich weiß nicht, wie er eigentlich heißt, vielleicht hat
er auch noch einen anderen Namen, jedenfalls kommt er, wenn man ihn so
ruft, und deshalb rufen ihn denn alle so. Er ist rothaarig, irgendein
Finne, ein schielender Grobian mit einer aufgestülpten Nase: auf die
Theresa schimpft er ununterbrochen, und viel fehlt nicht, so würde er
sie einfach prügeln. Überhaupt muß ich sagen, daß das Leben hier nicht
ganz so ist, daß man es gerade gut nennen könnte ... Daß sich zum
Beispiel abends alle zu gleicher Zeit hinlegen und einschlafen – das
kommt hier überhaupt nicht vor. Ewig wird irgendwo noch gesessen und
gespielt, manchmal wird aber sogar so etwas getrieben, daß man sich
schämt, es auch nur anzudeuten. Jetzt habe ich mich schon eingelebt und
an vieles gewöhnt, aber ich wundere mich doch, wie sogar verheiratete
Leute in einem solchen Sodom leben können. Da ist eine ganze arme
Familie, die hier in einem Zimmer wohnt, aber nicht in einer Reihe mit
den anderen Nummern, sondern auf der anderen Seite in einem Eckzimmer,
also etwas weiter ab. Stille Leutchen! Niemand hört von ihnen was. Und
sie leben alle in dem einen Zimmerchen, in dem sie nur eine kleine
Scheidewand haben. Er soll ein stellenloser Beamter sein – vor etwa
sieben Jahren aus dem Dienst entlassen, man weiß nicht, weshalb. Sein
Familienname ist Gorschkoff. Er ist ein kleines, graues Männchen, geht
in alten, abgetragenen Kleidern, daß es ordentlich weh tut, ihn
anzusehen – viel schlechter als ich! So ein armseliges, kränkliches
Kerlchen – ich begegne ihm bisweilen auf dem Korridor. Die Kniee zittern
ihm immer, auch die Hände zittern und der Kopf zittert, von einer
Krankheit vielleicht, oder Gott mag wissen, wovon. Schüchtern ist er,
alle fürchtet er, geht jedem scheu aus dem Wege und drückt sich ganz
still und leise längs der Wand an den Menschen vorüber. Auch ich bin ja
mitunter etwas schüchtern, aber mit dem ist das gar kein Vergleich!
Seine Familie besteht aus seiner Frau und drei Kindern. Der älteste
Knabe ist ganz nach dem Vater geraten, auch so ein kränkliches Kerlchen.
Seine Frau muß einmal gut ausgesehen haben, das sieht man jetzt noch ...
sie geht aber in so alten, armseligen Kleidern – oh, so alten!! Wie ich
hörte, schulden sie der Wirtin bereits die Miete; wenigstens behandelt
sie sie nicht gar zu freundlich. Auch hörte ich, daß Gorschkoff selbst
irgendwelche Unannehmlichkeiten gehabt haben soll, weshalb er
verabschiedet worden sei, – war es nun ein Prozeß oder etwas anderes,
vielleicht eine Anklage, oder ist eine Untersuchung eingeleitet worden,
das weiß ich Ihnen nicht zu sagen. Arm sind sie, furchtbar arm, Gott im
Himmel! Immer ist es still in ihrem Zimmer, so still, als wohnte dort
keine Seele. Nicht einmal die Kinder hört man. Und daß sie mal unartig
wären oder ein Spielchen spielten – das kommt gar nicht vor, und ein
schlimmeres Zeichen gibt es nicht. Einmal kam ich abends an ihrer Tür
vorüber – es war gerade ganz ungewöhnlich still bei uns – da hörte ich
ganz leises Schluchzen, dann ein Flüstern, dann wieder Schluchzen, ganz
als weine dort jemand, aber so still, so hoffnungslos verzweifelt, so
traurig, daß es mir das Herz zerreißen wollte – und dann wurde ich die
halbe Nacht die Gedanken an diese armen Menschen nicht los, so daß ich
lange nicht einschlafen konnte.
Nun leben Sie wohl, Warinka, mein Freundchen! Da habe ich Ihnen jetzt
alles beschrieben, so, wie ich es verstand. Heute habe ich den ganzen
Tag nur an Sie gedacht. Mein Herz hat sich um Sie ganz müde gegrämt.
Denn sehen Sie, mein Seelchen, ich weiß doch, daß Sie kein warmes
Mäntelchen haben. Und ich kenne doch dieses Petersburger
Frühlingswetter, diese Frühjahrswinde und den Regen, der dazwischen noch
Schnee bringt, – das ist doch der Tod, Warinka! Da gibt es doch solche
Wetterumschläge, daß Gott uns behüte und bewahre! Nehmen Sie mir,
Herzchen, mein Geschreibsel nicht übel; ich habe keinen Stil, Warinka,
ganz und gar keinen Stil. Wenn ich doch nur irgendeinen hätte! Ich
schreibe, was mir gerade einfällt, damit Sie eine kleine Zerstreuung
haben, also nur so, um Sie etwas zu erheitern. Ja, wenn ich was gelernt
hätte, dann wäre es etwas anderes; aber so – was habe ich denn gelernt?
Meine Erziehung hat wenig gekostet!
Ihr ewiger und treuer Freund
Makar Djewuschkin.
25. April.
Sehr geehrter Makar Alexejewitsch!
Heute bin ich meiner Kusine Ssascha begegnet! Entsetzlich! Auch sie wird
zugrunde gehen, die Ärmste! Auch habe ich zufällig auf Umwegen erfahren,
daß Anna Fedorowna sich überall nach mir erkundigt und natürlich alles
ausforschen will. Sie wird wohl niemals aufhören, mich zu verfolgen. Sie
soll gesagt haben, daß sie mir alles _verzeihen_ wolle! Sie wolle alles
Vorgefallene vergessen und werde mich unbedingt besuchen. Von Ihnen hat
sie gesagt, Sie seien gar nicht mein Verwandter, nur sie selbst sei
meine nächste und einzige Verwandte, und Sie hätten kein Recht, sich in
unsere Angelegenheiten einzumischen. Es sei eine Schande für mich und
ich müsse mich schämen, mich von Ihnen ernähren zu lassen und auf Ihre
Kosten zu leben ... Sie sagt, ich hätte das Gnadenbrot, das sie uns
gegeben, vergessen – hätte vergessen, daß sie meine Mutter und mich vor
dem Hungertode bewahrt, daß sie uns ernährt und gepflegt und fast
zweieinhalb Jahre lang nur Unkosten durch uns gehabt, und daß sie uns
außerdem eine alte Schuld geschenkt habe. Nicht einmal Mama will sie in
ihrem Grabe in Ruhe lassen! Wenn meine Mutter wüßte, was sie mir angetan
haben! Gott sieht es! ...
Anna Fedorowna hat auch noch gesagt, daß ich nur aus Dummheit nicht
verstanden habe, mein Glück festzuhalten, daß sie selbst mir das Glück
zugeführt und sonst an nichts schuld sei, ich aber hätte es nur nicht
verstanden – oder vielleicht auch nicht gewollt – für meine Ehre
einzutreten. Aber wessen Schuld war es denn, großer Gott! Sie sagt, Herr
Bükoff sei durchaus im Recht, man könne doch wirklich nicht eine jede
heiraten, die ... doch wozu das alles schreiben!
Es ist zu grausam, solche Unwahrheiten hören zu müssen, Makar
Alexejewitsch!
Ich weiß nicht, was es heute mit mir ist. Ich zittere, ich weine, ich
schluchze. An diesem Brief schreibe ich schon seit zwei Stunden. Und ich
war schon in dem Glauben, sie werde doch wenigstens ihre Schuld
eingesehen haben, das Unrecht, das sie mir zugefügt hat, – und da redet
sie so!
Bitte, regen Sie sich meinetwegen nicht auf, mein Freund, um Gottes
willen nicht, mein einziger guter Freund! Fedora übertreibt ja doch
immer: ich bin gar nicht krank. Ich habe mich nur gestern auf dem
Wolkoff-Friedhof ein wenig erkältet, als ich die Seelenmesse für mein
totes Mütterchen hörte. Warum kamen Sie nicht mit mir? – ich hatte Sie
doch so darum gebeten. Ach, meine arme, arme Mutter, wenn du aus dem
Grabe stiegest, wenn du wüßtest, wenn du wüßtest, was sie mit mir getan
haben! ...
W. D.
20. Mai.
Mein Täubchen Warinka!
Ich sende Ihnen ein paar Weintrauben, mein Herzchen, die sind gut für
Genesende, sagt man, und auch der Arzt hat sie empfohlen, gegen den
Durst, – also dann essen Sie mal die Träubchen, Warinka, wenn Sie
durstig sind. Sie wollten auch gern ein Rosenstöckchen besitzen, Kind,
da schicke ich Ihnen denn jetzt welche. Haben Sie aber auch Appetit,
Herzchen? – Das ist doch die Hauptsache. Gott sei Dank, daß nun alles
vorüber und überstanden ist, und daß auch unser Unglück bald ein Ende
nehmen wird. Danken wir dafür dem Schöpfer! Was aber nun die Bücher
betrifft, so kann ich vorläufig nirgendwo welche auftreiben. Es soll
hier jemand ein sehr gutes Buch haben, hörte ich, eines, das in sehr
hohem Stil geschrieben sei; man sagt, es sei wirklich ein gutes Buch,
ich habe es selbst nicht gelesen, aber es wird hier sehr gelobt. Ich
habe gebeten, man möge es mir geben, und man wollte es mir auch
verschaffen. Nur – werden Sie es wirklich lesen? Sie sind ja so
wählerisch in solchen Sachen, daß es schwer hält, für Ihren Geschmack
gerade das Richtige zu finden, ich kenne Sie doch, mein Täubchen, ich
weiß schon, wie Sie sind! Sie wollen wohl nur Poesie haben, die von
Liebe und Sehnsucht handelt, – deshalb werde ich Ihnen auch Gedichte
verschaffen, alles, alles, was Sie nur haben wollen. Hier gibt es ein
ganzes Heft mit abgeschriebenen Gedichten.
Ich lebe sehr gut. Sie müssen sich über mich beruhigen, Kind. Was Ihnen
die Fedora wieder erzählt hat, ist alles gar nicht wahr, sie soll nicht
immer lügen, sagen Sie ihr das. Ja, sagen Sie es ihr wirklich, der
Klatschbase! ... Ich habe meinen neuen Uniformrock gar nicht verkauft,
ist mir nicht eingefallen! Und weshalb sollte ich ihn verkaufen, sagen
Sie doch selbst? Ich habe noch vor kurzem gehört, wie man davon sprach,
daß man mir eine Gratifikation von vierzig Rubeln zusprechen werde,
weshalb sollte ich da verkaufen? Nein, Kind, Sie sollen sich wirklich
nicht beunruhigen. Sie ist argwöhnisch, die Fedora, und mißtrauisch, das
ist gar nicht gut von ihr. Warten Sie nur, auch wir werden noch mal gut
leben, mein Täubchen! Nur müssen Sie erst gesund werden, mein Engelchen,
das müssen Sie um Christi willen: das ist doch mein größter Kummer,
damit betrüben Sie mich Alten doch am meisten. Wer hat Ihnen gesagt, daß
ich abgemagert sei? Das ist auch eine Verleumdung! Ich bin ganz gesund
und munter und habe sogar so zugenommen, daß ich mich schon selbst zu
schämen anfange. Bin satt und zufrieden und mir fehlt nichts, – wenn nur
Sie wieder gesund wären! Nun, und jetzt leben Sie wohl, mein Engelchen;
ich küsse alle Ihre Fingerchen und verbleibe
Ihr ewig treuer, unwandelbarer Freund
Makar Djewuschkin.
P. S. Ach, Herzchen, was haben Sie da nur wieder geschrieben! Daß Sie
sich doch immer etwas ins Köpfchen setzen müssen! Wie soll ich denn so
oft zu Ihnen kommen, Kind – das frage ich Sie, – wie? Etwa im Schutze
der nächtlichen Dunkelheit? Aber wo die Nächte hernehmen, jetzt gibt es
ja gar keine, in dieser Jahreszeit. Ich habe Sie aber auch so,
Engelchen, während Ihrer Krankheit fast gar nicht verlassen, als Sie
bewußtlos im Fieber lagen. Doch eigentlich weiß ich es selbst nicht
mehr, wie ich meine Zeit einteilte und mit allem doch noch fertig wurde.
Aber dann stellte ich meine Besuche ein, denn die Leute wurden neugierig
und begannen zu fragen. Und es sind ohnehin schon Klatschgeschichten
entstanden. Ich verlasse mich aber ganz auf Theresa, sie ist zum Glück
nicht schwatzhaft. Aber immerhin müssen Sie es sich doch selbst sagen,
Kind, wie wird denn das sein, wenn alle über uns schwatzen? Was werden
sie denn von uns denken und was sagen? Deshalb beißen Sie mal die
Zähnchen zusammen, Herzchen, und warten Sie, bis Sie ganz gesund
geworden sind: dann werden wir uns schon irgendwo außerhalb des Hauses
treffen können.
1. Juni.
Bester Makar Alexejewitsch!
Ich möchte Ihnen so gern etwas zu Liebe tun, um Ihnen meinen Dank für
Ihre Mühen und die Opfer, die Sie mir gebracht, zu bezeigen, darum habe
ich mich entschlossen, aus meiner Kommode mein altes Heft
hervorzusuchen, das ich Ihnen hiermit zusende. Ich begann diese
Aufzeichnungen noch in der glücklichen Zeit meines Lebens. Sie haben
mich so oft mit Anteil nach meinem früheren Leben gefragt und mich
gebeten, Ihnen von meiner Mutter, von Pokrowskij, von meinem Aufenthalt
bei Anna Fedorowna und schließlich von meinen letzten Erlebnissen zu
erzählen, und Sie äußerten so lebhaft den Wunsch, dieses Heft einmal zu
lesen, in dem ich – Gott weiß wozu – einiges aus meinem Leben erzählt
habe, daß ich glaube, Ihnen mit der Zusendung dieses Heftes eine Freude
zu bereiten. Mich aber hat es traurig gemacht, als ich es jetzt
durchlas. Es scheint mir, daß ich seit dem Augenblick, in dem ich die
letzte Zeile dieser Aufzeichnungen schrieb, noch einmal so alt geworden
bin, als ich war, zweimal so alt! Ich habe das Ganze zu verschiedenen
Zeiten niedergeschrieben. Leben Sie wohl, Makar Alexejewitsch! Ich habe
jetzt oft schreckliche Langeweile und nachts quält mich meine
Schlaflosigkeit. Ein höchst langweiliges Genesen!
W. D.
I.
Ich war erst vierzehn Jahre alt, als mein Vater starb. Meine Kindheit
war die glücklichste Zeit meines Lebens. Ich verbrachte sie nicht hier,
sondern fern in der Provinz, auf dem Lande. Mein Vater war der Verwalter
eines großen Gutes, das dem Fürsten P. gehörte. Und dort lebten wir –
still, einsam und glücklich ... Ich war ein richtiger Wildfang: oft tat
ich den ganzen Tag nichts anderes, als in Feld und Wald umherzustreifen,
überall wo ich nur wollte, denn niemand kümmerte sich um mich. Mein
Vater war immer beschäftigt und meine Mutter hatte in der Wirtschaft zu
tun. Ich wurde nicht unterrichtet – und darüber war ich sehr froh. So
lief ich schon frühmorgens zum großen Teich oder in den Wald, oder auf
die Wiese zu den Schnittern – je nachdem –: was machte es mir aus, daß
die Sonne brannte, daß ich selbst nicht mehr wußte, wo ich war und wie
ich mich zurechtfinden sollte, daß das Gestrüpp mich kratzte und mein
Kleid zerriß: zu Hause würde man schelten, aber was ging das mich an!
Und ich glaube, ich wäre ewig so glücklich geblieben, wenn wir auch das
ganze Leben dort auf dem Lande verbracht hätten. Doch leider mußte ich
schon als Kind von diesem freien Landleben Abschied nehmen und mich von
all den trauten Stellen trennen. Ich war erst zwölf Jahre alt, als wir
nach Petersburg übersiedelten. Ach, wie traurig war unser Aufbruch! Wie
weinte ich, als ich alles, was ich so lieb hatte, verlassen mußte! Ich
weiß noch, wie krampfhaft ich meinen Vater umarmte und ihn unter Tränen
bat, er möge doch wenigstens noch ein Weilchen auf dem Gute bleiben, und
wie mein Vater böse wurde und wie meine Mutter auch weinte. Sie sagte,
es sei notwendig, es seien geschäftliche Angelegenheiten, die es
verlangten. Der alte Fürst P. war nämlich gestorben und seine Erben
hatten meinen Vater entlassen. So fuhren wir nach Petersburg, wo einige
Privatleute lebten, denen mein Vater Geld geliehen hatte – und da wollte
er denn persönlich seine Geldangelegenheiten regeln. Das erfuhr ich
alles von meiner Mutter. Hier mieteten wir auf der Petersburger Seite[1]
eine Wohnung, in der wir dann bis zum Tode des Vaters blieben.
Wie schwer es mir war, mich an das neue Leben zu gewöhnen! Wir kamen im
Herbst nach Petersburg. Als wir das Gut verließen, war es ein sonnig
heller, klarer, warmer Tag. Auf den Feldern wurden die letzten Arbeiten
beendet. Auf den Tennen lag schon das Getreide in hohen Haufen, um die
ganze Scharen lebhaft zwitschernder Vögel flatterten. Alles war so hell
und fröhlich!
Hier aber, als wir in der Stadt anlangten, war statt dessen nichts als
Regen, Herbstkälte, Unwetter, Schmutz, und viele fremde Menschen, die
alle unfreundlich, unzufrieden und böse aussahen! Wir richteten uns ein,
so gut es eben ging. Wieviel Schererei das gab, bis man den Haushalt
endlich eingerichtet hatte! Mein Vater war fast den ganzen Tag nicht zu
Hause und meine Mutter war immer beschäftigt, – mich vergaß man ganz. Es
war ein trauriges Aufstehen am nächsten Morgen – nach der ersten Nacht
in der neuen Wohnung. Vor unseren Fenstern war ein gelber Zaun. Auf der
Straße sah man nichts als Schmutz! Nur wenige Menschen gingen vorüber,
und alle waren so vermummt in Kleider und Tücher, und alle schienen sie
zu frieren.
Bei uns zu Hause herrschten ganze Tage lang nur Kummer und entsetzliche
Langeweile. Verwandte oder nahe Bekannte hatten wir hier nicht. Mit Anna
Fedorowna hatte sich der Vater entzweit. (Er schuldete ihr etwas.) Es
kamen aber ziemlich oft Leute zu uns, die mit dem Vater Geschäftliches
zu besprechen hatten. Gewöhnlich wurde dann gestritten, gelärmt und
geschrien. Und wenn sie wieder fortgegangen waren, war Papa immer so
unzufrieden und böse. Stundenlang ging er dann im Zimmer auf und ab, mit
gerunzelter Stirn, ohne ein Wort zu sprechen. Auch Mama wagte dann
nichts zu sagen und schwieg. Und ich zog mich mit einem Buch still in
einen Winkel zurück und wagte mich nicht zu rühren.
Im dritten Monat nach unserer Ankunft in Petersburg wurde ich in eine
Pension gegeben. War das eine traurige Zeit, anfangs, unter den vielen
fremden Menschen! Alles war so trocken, so kurz angebunden, so
unfreundlich und so gar nicht anziehend: die Lehrerinnen schalten und
die Mädchen spotteten, und ich war so verschüchtert – wie ein Wildling
kam ich mir vor. Diese pedantische Strenge! Alles mußte pünktlich zur
bestimmten Stunde geschehen. Die Mahlzeiten an der gemeinsamen Tafel,
die langweiligen Lehrer – das machte mich anfangs haltlos! Ich konnte
dort nicht einmal schlafen. So manche lange, langweilige, kalte Nacht
habe ich bis zum Morgen geweint. Abends, wenn die anderen alle ihre
Lektionen lernten oder wiederholten, saß ich über meinem Buch oder dem
Vokabelheft und wagte nicht, mich zu rühren, doch mit meinen Gedanken
war ich wieder zu Hause, dachte an den Vater und die Mutter und an meine
alte gute Kinderfrau und an deren Märchen ... ach, was für ein Heimweh
mich da erfaßte! Jedes kleinsten Gegenstandes im Hause erinnert man
sich, und selbst an den noch denkt man mit einem so eigentümlichen,
wehmütigen Vergnügen. Und so denkt man und denkt man denn, – wie gut,
wie schön es doch jetzt zu Hause wäre! Da würde ich in unserem kleinen
Eßzimmer am Tisch sitzen, auf dem der Ssamowar summt, und mit am Tisch
säßen die Eltern: wie warm wäre es, wie traut, wie behaglich. Wie würde
ich, denkt man, jetzt Mütterchen umarmen, fest, ganz fest, o, so mit
aller Inbrunst umarmen! – Und so denkt man weiter, bis man vor Heimweh
leise zu weinen anfängt, und immer wieder die Tränen schluckt – die
Vokabeln aber gehen einem nicht in den Kopf. Wieder kann man die Aufgabe
für den nächsten Tag nicht: die ganze Nacht sieht man nichts anderes im
Traum, als den Lehrer, die Madame und die Mitschülerinnen; die ganze
Nacht träumt man, daß man die Aufgaben lerne, am nächsten Tage aber weiß
man natürlich nichts. Da muß man wieder im Winkel knien und erhält nur
eine Speise. Ich war so unlustig, so wortkarg. Die Mädchen lachten über
mich, neckten mich und lenkten meine Aufmerksamkeit ab, wenn ich die
Aufgabe hersagte, oder sie kniffen mich, wenn wir in langer Reihe
paarweis zu Tisch gingen, oder sie beklagten sich bei der Lehrerin über
mich. Doch welche Seligkeit, wenn dann am Sonnabendabend meine alte gute
Wärterin kam, um mich abzuholen! Wie ich sie umarmte – ich wußte mich
kaum zu lassen vor Freude – mein gutes Altchen! Und dann kleidete sie
mich an, immer „hübsch warm“, wie sie sagte, wenn sie mir die Tücher um
den Kopf band. Unterwegs aber konnte sie mir nie schnell genug folgen
und ich – konnte doch nicht so langsam gehen wie sie! Und die ganze Zeit
erzählte ich und schwatzte ich ohne Unterlaß. Ganz ausgelassen vor
Freude, lief ich ins Haus und warf mich den Eltern um den Hals, als
hätten wir uns seit neun Jahren nicht gesehen. Und dann begann das
Erzählen und Fragen, und ich lachte und lief umher und feierte mit allem
und allem Wiedersehen. Papa begann alsbald ernstere Gespräche: über die
Lehrer, über Mathematik, über die französische Sprache und die Grammatik
von L’Homond, – und alle waren wir so guter Dinge und zufrieden und
gesprächig. Auch jetzt noch ist mir die bloße Erinnerung an jene Stunden
ein Vergnügen.
Ich gab mir die größte Mühe, gut zu lernen, um meinen Vater damit zu
erfreuen. Ich sah doch, daß er das Letzte für mich ausgab, während ihm
selbst die Sorgen über den Kopf wuchsen. Mit jedem Tage wurde er
finsterer, unzufriedener, jähzorniger; sein Charakter veränderte sich
sehr zu seinem Nachteil. Nichts gelang ihm, alles schlug fehl und die
Schulden wuchsen ins Ungeheuerliche.
Die Mutter fürchtete sich, zu weinen oder auch nur ein Wort der Klage zu
sagen, da der Vater sich dann nur noch mehr ärgerte. Sie wurde kränklich
und schwächlich und ein böser Husten stellte sich ein. Kam ich aus der
Pension, so sah ich nur traurige Gesichter: die Mutter wischte sich
heimlich die Tränen aus den Augen und der Vater ärgerte sich. Und dann
kamen wieder Vorwürfe und Klagen: er erlebe an mir keine Freude, ich
brächte ihm auch keinen Trost, und doch gebe er für mich das Letzte hin,
ich aber verstände noch immer nicht, Französisch zu sprechen. Mit einem
Wort, ich war an allem schuld; alles Unglück, alle Mißerfolge, alles
hatten wir zu verantworten, ich und die arme Mama. Wie war es aber nur
möglich, die arme Mama noch mehr zu quälen! Wenn man sie ansah, konnte
einem das Herz brechen! Ihre Wangen waren eingefallen, die Augen lagen
tief in den Höhlen – wie eine Schwindsüchtige sah sie aus.
Die größten Vorwürfe wurden mir gemacht. Gewöhnlich begann es mit
irgendeiner kleinen Nebensächlichkeit und dann kam oft Gott weiß was
alles zur Sprache, – oft begriff ich nicht einmal, wovon Papa sprach.
Was er da nicht alles vorbrachte! ... Zuerst die französische Sprache,
daß ich ein großer Dummkopf und unsere Pensionsvorsteherin eine
fahrlässige, dumme Person sei, sie sorge nicht im geringsten für unsere
sittliche Entwickelung; dann – daß er noch immer keine Anstellung finden
könne und daß die Grammatik von L’Homond nichts tauge, die von Sapolskij
sei bedeutend besser; daß man für mich viel Geld verschwendet habe, ohne
Sinn und Nutzen, daß ich ein gefühlloses, hartherziges Mädchen sei, –
kurz, ich Arme, die ich mir die größte Mühe gab, französische Vokabeln
und Gespräche auswendig zu lernen, war an allem schuld und mußte alle
Vorwürfe hinnehmen. Aber er tat es ja nicht etwa deshalb, weil er uns
nicht liebte: im Gegenteil, er liebte uns über alle Maßen! Es war nun
einmal sein Charakter ...
Oder nein: es waren die Sorgen, die Enttäuschungen und Mißerfolge, die
seinen ursprünglich guten Charakter so verändert hatten: er wurde
mißtrauisch, war oft ganz verbittert und der Verzweiflung nahe, begann
seine Gesundheit zu vernachlässigen, erkältete sich und – starb dann
auch nach kurzem Krankenlager, so plötzlich, so unerwartet, daß wir es
noch tagelang nicht fassen konnten! Wir waren wie betäubt von diesem
Schlage. Mama war wie erstarrt, ich fürchtete anfänglich für ihren
Verstand. Kaum aber war er gestorben, da kamen schon die Gläubiger in
Scharen zu uns. Alles, was wir hatten, gaben wir ihnen hin. Unser
Häuschen auf der Petersburger Seite, das Papa ein halbes Jahr nach
unserer Ankunft in Petersburg gekauft hatte, mußte gleichfalls verkauft
werden. Ich weiß nicht, wie es mit dem Übrigen wurde, wir blieben
jedenfalls ohne Obdach, ohne Geld, schutzlos, mittellos ... Mama war
krank – es war ein schleichendes Fieber, das nicht weichen wollte –
verdienen konnten wir nichts, so waren wir dem Verderben preisgegeben.
Ich war erst vierzehn Jahre alt.
Da besuchte uns zum erstenmal Anna Fedorowna. Sie gibt sich immer für
eine Gutsbesitzerin aus und versichert, sie sei mit uns nahe verwandt.
Mama aber sagte, sie sei allerdings verwandt mit uns, nur sei diese
Verwandtschaft eine sehr weitläufige. Als Papa noch lebte, war sie nie
zu uns gekommen. Sie erschien mit Tränen in den Augen und beteuerte, daß
sie an unserem Unglück großen Anteil nehme. Sie bemitleidete uns
lebhaft, äußerte sich dann aber dahin, daß Papa an unserem ganzen
Mißgeschick schuld sei: er habe gar zu hoch hinaus gewollt und gar zu
sehr auf seine eigene Kraft gebaut. Ferner äußerte sie als „einzige
Verwandte“ den Wunsch, uns näher zu treten, und machte den Vorschlag,
Gewesenes zu vergessen. Als Mama darauf erwiderte, daß sie nie
irgendwelchen Groll gegen sie gehegt habe, weinte sie sogar vor lauter
Rührung, führte Mama in die Kirche und bestellte eine Seelenmesse für
den „toten Liebling“, wie sie den Entschlafenen plötzlich nannte. Darauf
versöhnte sie sich in aller Feierlichkeit mit Mama.
Dann, nach langen Vorreden und Randbemerkungen und nachdem sie uns in
grellen Farben unsere ganze hoffnungslose Lage klargemacht, von unserer
Mittel-, Schutz- und Hilflosigkeit gesprochen hatte, forderte sie uns
auf, ihr Obdach mit ihr zu teilen, wie sie sich ausdrückte. Mama dankte
für ihre Freundlichkeit, konnte sich aber lange nicht entschließen, der
Aufforderung Folge zu leisten, doch da uns nichts anderes übrig blieb,
so sah sie sich zu guter Letzt gezwungen, Anna Fedorowna mitzuteilen,
daß sie ihr Anerbieten dankbar annehmen wolle.
Wie deutlich erinnere ich mich noch jenes Morgens, an dem wir von der
Petersburger Seite nach dem anderen Stadtteil, dem Wassilij Ostroff,
übersiedelten! Es war ein klarer, trockener, kalter Herbstmorgen. Mama
weinte. Und ich war so traurig: es war mir, als schnüre mir eine
unerklärliche Angst die Brust zusammen ... Es war eine schwere Zeit ...
* * * * *
II.
Anfangs, so lange wir uns noch nicht eingelebt hatten, empfanden wir
beide, Mama und ich, eine gewisse Bangigkeit in der Wohnung Anna
Fedorownas, wie man sie zu empfinden pflegt, wenn einem etwas nicht ganz
geheuer erscheint. Anna Fedorowna lebte in ihrem eigenen Hause an der
Sechsten Linie[2]. Im ganzen Hause waren nur fünf bewohnbare Zimmer. In
dreien von ihnen wohnte Anna Fedorowna mit meiner Kusine Ssascha, die
als armes Waisenkind von ihr angenommen war und erzogen wurde. Im
vierten Zimmer wohnten wir, und im letzten Zimmer, das neben dem
unsrigen lag, wohnte ein armer Student, Pokrowskij, der einzige Mieter
im Hause.
Anna Fedorowna lebte sehr gut, viel besser, als man es für möglich
gehalten hätte, doch ihre Geldquelle war ebenso rätselhaft wie ihre
Beschäftigung. Und dabei hatte sie immer irgend etwas zu tun und lief
besorgt umher, und jeden Tag fuhr und ging sie mehrmals aus. Doch wohin
sie ging, mit was sie sich draußen beschäftigte und was sie zu tun
hatte, das vermochte ich nicht zu erraten. Sie war mit sehr vielen und
sehr verschiedenen Leuten bekannt. Ewig kamen welche zu ihr gefahren und
immer in Geschäften und nur auf ein paar Minuten. Mama führte mich
jedesmal in unser Zimmer, sobald es klingelte. Darüber ärgerte sich Anna
Fedorowna sehr und machte meiner Mutter beständig den Vorwurf, daß wir
gar zu stolz seien: sie wollte ja nichts sagen, wenn wir irgendeinen
Grund, wenn wir wirklich Ursache hätten, stolz zu sein, aber so! ... und
stundenlang fuhr sie dann in diesem Tone fort. Damals begriff ich diese
Vorwürfe nicht, und ebenso habe ich erst jetzt erfahren, oder richtiger,
erraten, weshalb Mama sich anfangs nicht entschließen konnte, Anna
Fedorownas Gastfreundschaft anzunehmen.
Sie ist ein schlechter Mensch, diese Anna Fedorowna. Ewig quälte sie
uns. Aber eins ist mir auch jetzt noch ein Rätsel: wozu lud sie uns
überhaupt zu sich ein? Anfangs war sie noch ganz freundlich zu uns, dann
aber kam bald ihr wahrer Charakter zum Vorschein, als sie sah, daß wir
vollständig hilflos und nur auf ihre Gnade angewiesen waren. Später
wurde sie zu mir wieder freundlicher, vielleicht zu freundlich: sie
sagte mir dann sogar plumpe Schmeicheleien, doch vorher hatte ich
ebensoviel auszustehen wie Mama. Ewig machte sie uns Vorwürfe und sprach
zu uns von nichts anderem, als von den Wohltaten, die sie uns erwies.
Und allen fremden Leuten stellte sie uns als ihre armen Verwandten vor,
als mittellose, schutzlose Witwe und Waise, die sie nur aus Mitleid und
christlicher Nächstenliebe bei sich aufgenommen habe und nun ernähre.
Bei Tisch verfolgte sie jeden Bissen, den wir zu nehmen wagten, mit den
Augen, wenn wir aber nichts aßen, oder gar zu wenig, so war ihr das auch
wieder nicht recht: dann hieß es, ihr Essen sei uns wohl nicht gut
genug, wir mäkelten, sie gebe eben, was sie habe und begnüge sich selbst
damit – vielleicht könnten wir uns selbst etwas Besseres leisten, das
könne sie ja nicht wissen, usw., usw. Über Papa mußte sie jeden
Augenblick etwas Schlechtes sagen, anders ging es nicht. Sie behauptete,
er habe immer nobler sein wollen, als alle anderen, und das habe man nun
davon: Frau und Tochter könnten nun zusehen, wo sie blieben, und wenn
sich nicht unter ihren Verwandten eine christlich liebevolle Seele – das
war sie selbst – gefunden hätte, so hätten wir gar noch auf der Straße
Hungers sterben können. Und was sie da nicht noch alles vorbrachte! Es
war nicht einmal so bitter, wie es widerlich war, sie anzuhören.
Mama weinte jeden Augenblick. Ihr Gesundheitszustand verschlimmerte sich
mit jedem Tage, sie welkte sichtbar hin, doch trotzdem arbeiteten wir
vom Morgen bis zum Abend. Wir nähten auf Bestellung, was Anna Fedorowna
sehr mißfiel. Sie sagte, ihr Haus sei kein Putzgeschäft. Wir aber mußten
uns doch Kleider anfertigen und mußten doch etwas verdienen, um auf alle
Fälle wenigstens etwas eigenes Geld zu haben. Und so arbeiteten und
sparten wir denn immer in der Hoffnung, uns bald irgendwo ein Zimmerchen
mieten zu können. Doch die anstrengende Arbeit verschlimmerte den
Zustand der Mutter sehr: mit jedem Tage wurde sie schwächer. Die
Krankheit untergrub ihr Leben und brachte sie unaufhaltsam dem Grabe
näher. Ich sah es, ich fühlte es und konnte doch nicht helfen!
Die Tage vergingen und jeder neue Tag glich dem vorhergegangenen. Wir
lebten still für uns, als wären wir gar nicht in der Stadt. Anna
Fedorowna beruhigte sich mit der Zeit – beruhigte sich, je mehr sie ihre
unbegrenzte Übermacht einsah und nichts mehr für sie zu fürchten
brauchte. Übrigens hatten wir ihr noch nie in irgend etwas
widersprochen. Unser Zimmer war von den drei anderen, die sie bewohnte,
durch einen Korridor getrennt, und neben unserem lag nur noch das Zimmer
Pokrowskijs, wie ich schon erwähnte. Er unterrichtete Ssascha, lehrte
sie Französisch und Deutsch, Geschichte und Geographie – d. h. „alle
Wissenschaften“, wie Anna Fedorowna zu sagen pflegte, und dafür brauchte
er für Kost und Logis nichts zu zahlen.
Ssascha war ein sehr begabtes Mädchen, doch entsetzlich unartig und
lebhaft. Sie war damals erst dreizehn Jahre alt. Schließlich sagte Anna
Fedorowna zu Mama, daß es vielleicht ganz gut wäre, wenn ich mit ihr
zusammen lernen würde, da ich ja in der Pension den Kursus sowieso nicht
beendet hatte. Mama war natürlich sehr froh über diesen Vorschlag, und
so wurden wir beide gemeinsam ein ganzes Jahr von Pokrowskij
unterrichtet.
Pokrowskij war ein armer, sehr armer Mensch. Seine Gesundheit erlaubte
es ihm nicht, regelmäßig die Universität zu besuchen, und so war er
eigentlich gar kein richtiger „Student“, wie er aus Gewohnheit noch
genannt wurde. Er lebte so still und ruhig in seinem Zimmer, daß wir im
Nebenzimmer nichts von ihm hörten. Er sah auch recht eigentümlich aus,
bewegte und verbeugte sich so linkisch und sprach so seltsam, daß ich
ihn anfangs nicht einmal ansehen konnte, ohne über ihn lachen zu müssen.
Ssascha machte immer ihre unartigen Streiche, und das besonders während
des Unterrichts. Er aber war zum Überfluß auch noch heftig, ärgerte sich
beständig, jede Kleinigkeit brachte ihn aus der Haut: er schalt uns,
schrie uns an, und sehr oft stand er wütend auf und ging fort, noch
bevor die Stunde zu Ende war, und schloß sich wieder in seinem Zimmer
ein. Dort aber, in seinem Zimmer, saß er tagelang über den Büchern. Er
hatte viele Bücher, und alles so schöne, seltene Exemplare. Er gab noch
an ein paar anderen Stellen Stunden und erhielt dafür Geld, doch kaum
hatte er welches erhalten, so ging er sogleich hin und kaufte sich
wieder Bücher.
Mit der Zeit lernte ich ihn näher kennen. Er war der beste und
ehrenwerteste Mensch, der beste von allen, die mir bis dahin im Leben
begegnet waren. Mama achtete ihn ebenfalls sehr. Und dann wurde er auch
mein treuer Freund und stand mir am nächsten von allen, – natürlich nach
Mama.
In der ersten Zeit beteiligte ich mich – obwohl ich doch schon ein
großes Mädchen war – an allen Streichen, die Ssascha gegen ihn
ausheckte, und bisweilen überlegten wir stundenlang, wie wir ihn wieder
necken und seine Geduld auf eine Probe stellen könnten. Es war furchtbar
spaßig, wenn er sich ärgerte – und wir wollten unser Vergnügen haben.
(Noch jetzt schäme ich mich, wenn ich daran zurückdenke.) Einmal hatten
wir ihn so gereizt, daß ihm Tränen in die Augen traten, und da hörte ich
deutlich, wie er zwischen den Zähnen halblaut hervorstieß: „Nichts
grausamer als Kinder!“ Das verwirrte mich: zum erstenmal regte sich in
mir so etwas wie Scham und Reue und Mitleid. Ich errötete bis über die
Ohren und bat ihn fast unter Tränen, sich zu beruhigen und sich durch
unsere dummen Streiche nicht kränken zu lassen, doch er klappte das Buch
zu und ging in sein Zimmer, ohne den Unterricht fortzusetzen.
Den ganzen Tag quälte mich die Reue. Der Gedanke, daß wir Kinder ihn
durch unsere boshaften Dummheiten bis zu Tränen geärgert hatten, war mir
unerträglich. So hatten wir es nur auf seine Tränen abgesehen! So
verlangte es uns, uns an seiner sicher krankhaften Gereiztheit auch noch
zu weiden! So war es uns nun also doch gelungen, ihn um den Rest von
Geduld zu bringen! So hatten wir ihn, diesen unglücklichen, armen
Menschen, gezwungen, unter seinem grausamen Los noch mehr zu leiden!
Die ganze Nacht konnte ich nicht schlafen – wie mich die Reue quälte!
Man sagt, Reue erleichtere das Herz. Im Gegenteil! Ich weiß nicht, wie
es kam, daß sich in meinen Kummer auch Ehrgeiz mischte. Ich wollte
nicht, daß er mich für ein Kind halte. Ich war damals bereits fünfzehn
Jahre alt.
Von diesem Tage an lebte ich beständig in Plänen, wie ich Pokrowskij
veranlassen könnte, seine Meinung über mich zu ändern. Doch an der
Ausführung dieser meiner tausend Pläne hinderte mich meine
Schüchternheit: ich konnte mich zu nichts entschließen, und so blieb es
denn bei den Plänen und Träumereien (und was man nicht alles so
zusammenträumt, mein Gott!). Nur beteiligte ich mich hinfort nicht mehr
an Ssaschas unartigen Späßen, und auch sie wurde langsam artiger. Das
hatte zur Folge, daß er sich nicht mehr über uns ärgerte. Doch das war
zu wenig für meinen Ehrgeiz.
Nun einige Worte über den seltsamsten und bemitleidenswertesten
Menschen, den ich jemals im Leben kennen gelernt habe. Ich will es
deshalb an dieser Stelle tun, weil ich mich mit ihm, den ich bis dahin
so gut wie gar nicht beachtet hatte, von jenem Tage an aufs lebhafteste
in meinen Gedanken zu beschäftigen begann.
Von Zeit zu Zeit erschien bei uns im Hause ein schlecht und unsauber
gekleideter, kleiner, grauer Mann, der in seinen Bewegungen unsagbar
plump und linkisch war und überhaupt sehr eigentümlich aussah. Auf den
ersten Blick konnte man glauben, daß er sich gewissermaßen seiner selbst
schäme, daß er für seine Existenz selbst um Entschuldigung bäte.
Wenigstens duckte er sich immer irgendwie, oder er versuchte wenigstens
immer irgendwie sich zu drücken, sich gleichsam in nichts zu verwandeln,
und diese ängstlichen, verschämten, unsicheren Bewegungen und Gebärden
erweckten in jedem den Verdacht, daß er nicht ganz bei vollem Verstande
sei. Wenn er zu uns kam, blieb er gewöhnlich im Flur hinter der Glastür
stehen und wagte nicht, einzutreten. Ging zufällig jemand von uns – ich
oder Ssascha – oder jemand von den Dienstboten, die ihm freundlicher
gesinnt waren – durch den Korridor und erblickte man ihn dort hinter der
Tür, so begann er zu winken und mit Gesten zu sich zu rufen und
verschiedene Zeichen zu machen: nickte man ihm dann zu – damit erteilte
man ihm die Erlaubnis, und gab ihm zu verstehen, daß keine fremden Leute
im Hause waren – oder rief man ihn, dann erst wagte er endlich, leise
die Tür zu öffnen und lächelnd einzutreten, worauf er sich froh die
Hände rieb und sogleich auf den Zehenspitzen zum Zimmer Pokrowskijs
schlich. Dieser Alte war sein Vater.
Später erfuhr ich die Lebensgeschichte dieses Armen. Er war einmal
irgendwo Beamter gewesen, hatte aus Mangel an Fähigkeiten eine ganz
untergeordnete Stellung bekleidet. Als seine erste Frau (die Mutter des
Studenten Pokrowskij) gestorben war, hatte er zum zweitenmal geheiratet,
und zwar eine halbe Bäuerin. Von dem Augenblick an war im Hause kein
Friede mehr gewesen: die zweite Frau hatte das erste Wort geführt und
war mit jedem womöglich handgemein geworden. Ihr Stiefsohn – der Student
Pokrowskij, damals noch ein etwa zehnjähriger Knabe – hatte unter ihrem
Haß viel zu leiden gehabt, doch zum Glück war es anders gekommen. Der
Gutsbesitzer Bükoff, der den Vater, den Beamten Pokrowskij, früher
gekannt und ihm einmal so etwas wie eine Wohltat erwiesen hatte, nahm
sich des Jungen an und steckte ihn in irgendeine Schule. Er
interessierte sich für den Knaben nur aus dem Grunde, weil er seine
verstorbene Mutter gekannt hatte, als diese noch als Mädchen von Anna
Fedorowna „Wohltaten“ erfahren und von ihr an den Beamten Pokrowskij
verheiratet worden war. Damals hatte Herr Bükoff, als guter Bekannter
und Freund Anna Fedorownas, der Braut aus Großmut eine Mitgift von
fünftausend Rubeln gegeben. Wo aber dieses Geld geblieben war – ist
unbekannt. So erzählte es mir Anna Fedorowna. Der Student Pokrowskij
selbst sprach nie von seinen Familienverhältnissen und liebte es nicht,
wenn man ihn nach seinen Eltern fragte. Man sagt, seine Mutter sei sehr
schön gewesen, deshalb wundert es mich, daß sie so unvorteilhaft und
noch dazu einen so unansehnlichen Menschen geheiratet hat. – Sie ist
schon früh gestorben, etwa im vierten Jahre nach der Heirat.
Von der Schule kam der junge Pokrowskij auf ein Gymnasium und von dort
auf die Universität. Herr Bükoff, der sehr oft nach Petersburg zu kommen
pflegte, ließ ihn auch dort nicht im Stich und unterstützte ihn. Leider
konnte Pokrowskij wegen seiner angegriffenen Gesundheit sein Studium
nicht fortsetzen, und da machte ihn Herr Bükoff mit Anna Fedorowna
bekannt, stellte ihn ihr persönlich vor, und so zog denn Pokrowskij zu
ihr, um für Kost und Logis Ssascha in „allen Wissenschaften“ zu
unterrichten.
Der alte Pokrowskij ergab sich aber aus Kummer über die rohe Behandlung,
die ihm seine zweite Frau zuteil werden ließ, dem schlimmsten aller
Laster: er begann zu trinken und war fast nie ganz nüchtern. Seine Frau
prügelte ihn, ließ ihn in der Küche schlafen und brachte es mit der Zeit
so weit, daß er sich alles widerspruchslos gefallen ließ und sich auch
an die Schläge gewöhnte. Er war noch gar nicht so alt, aber infolge
seiner schlechten Lebensweise war er, wie ich bereits erwähnte,
tatsächlich nicht mehr ganz bei vollem Verstande.
Der einzige Rest edlerer Gefühle war in diesem Menschen seine
grenzenlose Liebe zu seinem Sohne. Man sagte mir, der junge Pokrowskij
sei seiner Mutter so ähnlich, wie ein Tropfen Wasser dem anderen. War es
dann vielleicht die Erinnerung an die erste, gute Frau, die im Herzen
dieses heruntergekommenen Alten eine so grenzenlose Liebe zu seinem
Sohne erweckt hatte? Der Alte sprach überhaupt von nichts anderem, als
von diesem Sohn. In jeder Woche besuchte er ihn zweimal. Öfter zu
kommen, wagte er nicht, denn der Sohn selbst konnte diese väterlichen
Besuche nicht ausstehen. Diese Nichtachtung des Vaters war gewiß sein
größter Fehler. Übrigens konnte der Alte mitunter auch mehr als
unerträglich sein. Erstens war er furchtbar neugierig, zweitens störte
er den Sohn durch seine müßigen Gespräche und nichtigen, sinnlosen
Fragen beim Arbeiten, und drittens erschien er nicht immer ganz
nüchtern. Der Sohn gewöhnte dem Alten mit der Zeit seine schlechten
Angewohnheiten, seine Neugier und seine Schwatzhaftigkeit ab, und zu
guter Letzt gehorchte ihm der Vater wie einem Gott und wagte ohne seine
Erlaubnis nicht einmal mehr, den Mund aufzutun.
Der arme Alte konnte sich über seinen Petinka[3] – so nannte er den Sohn
– nicht genug wundern und freuen. Wenn er zu ihm kam, sah er immer
bedrückt, besorgt, sogar ängstlich aus – wahrscheinlich deshalb, weil er
noch nicht wußte, wie der Sohn ihn empfangen werde. Gewöhnlich konnte er
sich lange nicht entschließen, einzutreten, und wenn er mich dann
erblickte, winkte er mich schnell zu sich heran, um mich oft eine ganze
halbe Stunde lang auszufragen, wie es dem Petinka gehe, was er mache, ob
er gesund sei und in welcher Stimmung, und ob er sich nicht mit etwas
Wichtigem beschäftige. Vielleicht schreibe er? oder studiere wieder ein
philosophisches Werk? Und wenn ich ihn dann genügend beruhigt und
ermutigt hatte, entschloß er sich endlich, ganz, ganz leise und
vorsichtig die Tür zu öffnen und den Kopf ins Zimmer zu stecken: sah er,
daß der Sohn nicht böse war, daß er ihm vielleicht sogar zum Gruß
zunickte, dann trat er ganz behutsam ein, nahm den Mantel und den Hut ab
– letzterer war ewig verbeult und durchlöchert, wenn nicht gar mit
abgerissener Krempe – und hängte beides an einen Haken. Alles tat er so
vorsichtig und lautlos wie nur möglich. Dann setzte er sich vorsichtig
auf einen Stuhl und verwandte keinen Blick mehr von seinem Sohn,
verfolgte jede seiner Bewegungen, jeden Blick, um nur ja die Stimmung
seines Petinka zu erraten. Sah er, daß der Sohn verstimmt und schlechter
Laune war, so erhob er sich sogleich wieder von seinem Platz und sagte,
daß er eben „nur so, Petinka, nur auf ein Weilchen“ zu ihm gekommen sei.
„Ich bin, sieh mal, ja, ich bin weit gegangen, kam zufällig hier
vorüber, und da trat ich eben auf ein Weilchen ein, um mich etwas
auszuruhen. Jetzt will ich wieder gehen.“ Und dann nahm er still und
ergeben seinen alten dünnen Mantel und den alten, abgetragenen Hut,
klinkte vorsichtig wieder die Tür auf und ging – indem er sich noch zu
einem Lächeln zwang, um das aufwallende Leid im Herzen zu unterdrücken
und den Sohn nichts merken zu lassen.
Doch wenn der Sohn ihn freundlich empfing, dann wußte er sich vor Freude
kaum zu lassen. Sein Gesicht, seine Bewegungen, seine Hände – alles
sprach dann von seinem Glück. Und wenn der Sohn mit ihm gar zu sprechen
begann, erhob sich der Alte stets ein wenig vom Stuhle, antwortete leise
und gleichsam untertänig, fast sogar ehrfürchtig, und immer bestrebt,
sich der gewähltesten Ausdrücke zu bedienen, die in diesem Fall
natürlich nur komisch wirkten. Hinzu kam, daß er entschieden nicht zu
sprechen verstand: nach jeden paar Worten verwickelte er sich im Satz,
wurde verlegen, wußte nicht, wo er die Hände, wo er sich selbst lassen
sollte – und nachher flüsterte er dann noch mehrmals die Antwort vor
sich hin, wie um das Gesagte zu verbessern. War es ihm aber gelungen,
gut zu antworten, so war er ganz stolz, zog die Weste glatt, rückte an
der Krawatte, zupfte den Rock an den Aufschlägen, und seine Miene nahm
sogar den Ausdruck eines gewissen Selbstbewußtseins an. Bisweilen aber
fühlte er sich dermaßen ermutigt, daß er geradezu kühn wurde: er stand
vom Stuhl auf, ging zum Bücherregal, nahm irgendein Buch und begann zu
lesen, gleichviel was für ein Buch es war. Und alles das tat er mit
einer Miene, die größte Gleichmut und Kaltblütigkeit vortäuschen sollte,
als habe er von jeher das Recht, mit den Büchern des Sohnes nach
Belieben umzugehen, und als sei ihm dessen Freundlichkeit nichts
Ungewohntes. Einmal aber sah ich zufällig, wie der Alte erschrak, als
der Sohn ihn bat, die Bücher nicht anzurühren: er verlor vollständig den
Kopf, beeilte sich, sein Vergehen wieder gut zu machen, wollte das Buch
zwischen die anderen wieder hineinzwängen, verdrehte es aber, schob es
mit dem Kopf nach unten hinein, zog es dann schnell wieder hervor,
drehte es um und dann nochmals um und schob es von neuem falsch hinein,
diesmal mit dem Rücken voran und dem Schnitt nach außen, lächelte dabei
hilflos, wurde rot und wußte entschieden nicht, wie er sein Verbrechen
sühnen sollte.
Nach und nach gelang es dem Sohn, den Vater durch Vorhaltungen und gutes
Zureden von seinen schlechten Gewohnheiten abzubringen, und wenn der
Alte etwa dreimal nach der Reihe nüchtern erschienen war, gab er ihm das
nächste Mal fünfundzwanzig oder fünfzig Kopeken, oder noch mehr.
Bisweilen kaufte er ihm Stiefel, oder eine Weste, oder eine Krawatte,
und wenn der Alte dann in seinem neuen Kleidungsstück erschien, war er
stolz wie ein Hahn. Mitunter kam er auch zu uns und brachte Ssascha und
mir Pfefferkuchen oder Äpfel und sprach dann natürlich nur von seinem
Petinka. Er bat uns, während des Unterrichts aufmerksam und fleißig zu
sein, und unserem Lehrer zu gehorchen, denn Petinka sei ein guter Sohn,
sei der beste Sohn, den es überhaupt geben könnte, und obendrein, „ein
so gelehrter Sohn“. Wenn er das sagte, zwinkerte er uns ganz komisch mit
dem linken Auge zu, und sah uns so wichtig und bedeutsam an, daß wir uns
gewöhnlich nicht bezwingen konnten und herzlich über ihn lachten. Mama
hatte den Alten sehr gern. Anna Fedorowna wurde von ihm gehaßt, obschon
er vor ihr „niedriger als Gras und stiller als Wasser“ war.
Bald hörte ich auf, mich an dem Unterricht zu beteiligen. Pokrowskij
hielt mich nach wie vor nur für ein Kind, für ein unartiges kleines
Mädchen, wie Ssascha. Das kränkte mich sehr, denn ich hatte mich doch
nach Kräften bemüht, mein früheres Benehmen wieder gut zu machen. Aber
vergeblich: ich wurde überhaupt nicht beachtet. Das reizte und kränkte
mich noch mehr. Ich sprach ja fast gar nicht mit ihm, außer während des
Unterrichts, – ich konnte einfach nicht sprechen. Ich wurde rot und
nachher weinte ich irgendwo in einem Winkel – vor Ärger über mich
selbst.
Ich weiß nicht, zu was das noch geführt haben würde, wenn uns nicht ein
Zufall einander näher gebracht hätte. Das geschah folgendermaßen:
Eines Abends, als Mama bei Anna Fedorowna saß, schlich ich mich heimlich
in Pokrowskijs Zimmer. Ich wußte, daß er nicht zu Hause war, doch vermag
ich wirklich nicht zu sagen, wie ich auf diesen Gedanken kam, in das
Zimmer eines fremden Menschen zu gehen. Ich tat es zum erstenmal,
obschon wir über ein Jahr Tür an Tür gewohnt hatten. Mein Herz klopfte
so stark, als wollte es zerspringen. Ich sah mich mit einer
eigentümlichen Neugier im Zimmer um: es war ganz einfach, sogar ärmlich
eingerichtet, von Ordnung war nicht viel zu sehen. Auf dem Tisch und auf
den Stühlen lagen Papiere, beschriebene Blätter. Überall nichts als
Bücher und Papiere! Ein seltsamer Gedanke überkam mich plötzlich: es
schien mir, daß meine Freundschaft, selbst meine Liebe wenig für ihn
bedeuten könnten. Er war so gelehrt und ich so dumm, ich wußte nichts,
las nichts, besaß kein einziges Buch ... Mit einem gewissen Neid blickte
ich nach den langen Bücherregalen, die fast zu brechen drohten unter der
schweren Last. Ärger erfaßte mich, und Groll und Sehnsucht und Wut! –
Ich wollte gleichfalls Bücher lesen, seine Bücher, und alle ausnahmslos,
und das so schnell als möglich! Ich weiß nicht, vielleicht dachte ich,
daß ich, wenn ich alles wüßte, was er wußte, eher seine Freundschaft
erwerben könnte, als so, da ich nichts wußte. Ich ging entschlossen zum
ersten Bücherregal und nahm, ohne zu zögern, ohne auch nur nachzudenken,
den ersten besten Band heraus – zufällig ein ganz altes, bestaubtes Buch
– und brachte es, zitternd vor Aufregung und Angst, in unser Zimmer, um
es in der Nacht, wenn Mama schlief, beim Schein des Nachtlämpchens zu
lesen.
Wie groß aber war mein Verdruß, als ich, in unserem Zimmer glücklich
angelangt, das geraubte Buch aufschlug und sah, daß es ein uraltes,
vergilbtes und von Würmern halb zerfressenes lateinisches Werk war. Ich
besann mich nicht lange und kehrte schnell in sein Zimmer zurück. Doch
gerade wie ich im Begriff war, das Buch wieder auf seinen alten Platz
zurückzulegen, hörte ich plötzlich die Glastür zum Korridor öffnen und
schließen und dann Schritte: jemand kam! Ich wollte mich beeilen, doch
das abscheuliche Buch war so eng in der Reihe eingepreßt gewesen, daß
die anderen Bücher, als ich dieses herausgenommen, unter dem
verringerten Druck sogleich wieder dicker geworden waren, weshalb der
frühere Schicksalsgenosse nicht mehr hineinpaßte. Mir fehlte die Kraft,
um das Buch hineinzuzwängen. Die Schritte kamen näher: ich stieß mit
aller Kraft die Bücher zur Seite, und – der verrostete Nagel, der das
eine Ende des Bücherregals hielt und wohl nur auf diesen Augenblick
gewartet hatte, um zu brechen, – brach. Das Brett stürzte krachend mit
dem einen Ende zu Boden und die Bücher fielen mit Geräusch herab. Da
ging die Tür auf und Pokrowskij trat ins Zimmer.
Ich muß vorausschicken, daß er es nicht ausstehen konnte, wenn jemand in
seinem Zimmer sich zu tun machte. Wehe dem, der gar seine Bücher
anzurühren wagte! Wie groß war daher mein Entsetzen, als alle die großen
und kleinen Bücher, die dicken und dünnen, eingebundenen und
uneingebundenen herabstürzten, übereinander kollerten und unter dem
Tisch und unter Stühlen und an der Wand in einem ganzen Haufen lagen.
Ich wollte fortlaufen, doch dazu war es zu spät. „Jetzt ist es aus,“
dachte ich, „für immer aus! Ich bin verloren! Ich bin unartig, wie eine
Zehnjährige, wie ein kleines dummes Mädchen! Ich bin kindisch und
albern!“
Pokrowskij ärgerte sich entsetzlich.
„Das fehlte gerade noch!“ rief er zornig. „Schämen Sie sich denn nicht!
Werden Sie denn niemals Vernunft annehmen und die Kindertollheiten
lassen?“ Und er machte sich daran, die Bücher aufzuheben.
Ich bückte mich gleichfalls, um ihm zu helfen, doch er verbot es mir
barsch:
„Nicht nötig, nicht nötig, lassen Sie das jetzt! Sie täten besser, sich
nicht da einzufinden, wohin man Sie nicht gerufen!“
Meine stille Hilfsbereitschaft, die vielleicht mein Schuldbewußtsein
verriet, mochten ihn etwas besänftigen, wenigstens fuhr er in milderem,
ermahnendem Tone fort, so wie er noch vor kurzer Zeit als Lehrer zu mir
gesprochen:
„Wann werden Sie endlich Ihre Unbesonnenheiten aufgeben, wann endlich
etwas vernünftiger werden? So sehen Sie sich doch selbst an, Sie sind
doch kein Kind, kein kleines Mädchen mehr, – Sie sind doch schon
fünfzehn Jahre alt!“
Und da – wahrscheinlich um sich zu überzeugen, ob ich auch wirklich
nicht mehr ein kleines Mädchen sei – sah er mich an und plötzlich
errötete er bis über die Ohren. Ich begriff nicht, weshalb er errötete:
ich stand vor ihm und sah ihn mit großen Augen verwundert an. Er wußte
nicht, was tun, trat verlegen ein paar Schritte auf mich zu, geriet in
noch größere Verwirrung, murmelte irgend etwas, als wolle er sich
entschuldigen – vielleicht deswegen, weil er es erst jetzt bemerkt
hatte, daß ich schon ein so großes Mädchen sei! Endlich begriff ich. Ich
weiß nicht, was dann in mir vorging: ich sah gleichfalls verwirrt zu
Boden, errötete noch mehr als Pokrowskij, bedeckte das Gesicht mit den
Händen und lief aus dem Zimmer.
Ich wußte nicht, was ich mit mir anfangen, wo ich mich vor Scham
verstecken sollte. Schon das allein, daß er mich in seinem Zimmer
vorgefunden hatte! Ganze drei Tage konnte ich ihn nicht ansehen. Ich
errötete bis zu Tränen. Die schrecklichsten und lächerlichsten Gedanken
jagten mir durch den Kopf. Einer der verrücktesten war wohl der, daß ich
zu ihm gehen, ihm alles erklären, alles gestehen und offen alles
erzählen wollte, um ihm dann zu versichern, daß ich nicht wie ein dummes
Mädchen gehandelt habe, sondern in guter Absicht. Ich hatte mich sogar
schon fest dazu entschlossen, doch zum Glück sank mein Mut und ich wagte
es nicht, meinen Vorsatz auszuführen. Ich kann mir denken, was ich damit
angestiftet hätte! Wirklich, ich schäme mich auch jetzt noch, überhaupt
nur daran zu denken.
Einige Tage darauf erkrankte Mama – ganz plötzlich und sogar sehr
gefährlich. In der dritten Nacht stieg das Fieber und sie phantasierte
heftig. Ich hatte schon eine Nacht nicht geschlafen und saß wieder an
ihrem Bett, gab ihr zu trinken und zu bestimmten Stunden die vom Doktor
verschriebene Arznei. In der folgenden Nacht versagte meine
Widerstandskraft, ich war vollständig erschöpft. Von Zeit zu Zeit fielen
mir die Augen zu, ich sah grüne Punkte tanzen, im Kopf drehte sich alles
und jeden Augenblick wollte mich die Bewußtlosigkeit überwältigen, doch
dann weckte mich wieder ein leises Stöhnen der Kranken: ich fuhr auf und
erwachte für einen Augenblick, um von neuem, übermannt von der
Mattigkeit, einzuschlummern. Ich quälte mich. Ich kann mich des Traumes,
den ich damals hatte, nicht mehr genau entsinnen, es war aber irgendein
schrecklicher Spuk, der mich während meines Kampfes gegen die mich immer
wieder überwältigende Müdigkeit mit wirren Traumbildern ängstigte.
Entsetzt wachte ich auf. Das Zimmer war dunkel, das Nachtlicht im
Erlöschen: bald schlug die Flamme flackernd auf und heller Lichtschein
erfüllte das Zimmer, bald zuckte nur ein kleines blaues Flämmchen und an
den Wänden zitterten Schatten, um für Augenblicke fast vollständiger
Dunkelheit zu weichen. Ich begann mich zu fürchten, ein seltsames
Entsetzen erfaßte mich: meine Empfindungen und meine Phantasie standen
noch unter dem Eindruck des grauenvollen Traumes und die Angst schnürte
mir das Herz zusammen ... Ich sprang taumelnd vom Stuhl und schrie leise
auf, unter dem quälenden Druck des unbestimmten Angstgefühls. In
demselben Augenblick ging die Tür auf und Pokrowskij trat zu uns ins
Zimmer.
Ich weiß nur noch, daß ich in seinen Armen aus der Bewußtlosigkeit
erwachte. Behutsam setzte er mich auf einen Stuhl, gab mir zu trinken
und fragte mich besorgt irgend etwas, das ich nicht verstand. Ich
erinnere mich nicht, was ich ihm antwortete.
„Sie sind krank, Sie sind selbst sehr krank,“ sagte er, indem er meine
Hand erfaßte. „Sie fiebern, Sie setzen Ihre eigene Gesundheit aufs
Spiel, wenn Sie sich so wenig schonen. Beruhigen Sie sich, legen Sie
sich hin, schlafen Sie. Ich werde Sie in zwei Stunden wecken, beruhigen
Sie sich nur ... Legen Sie sich hin, schlafen Sie ganz ruhig!“ redete er
mir zu, ohne mich ein Wort des Widerspruchs sagen zu lassen. Die
Erschöpfung hatte meine letzten Kräfte besiegt. Die Augen fielen mir vor
Schwäche zu. Ich legte mich hin, um, wie ich mir fest vornahm, nur eine
halbe Stunde zu schlafen, schlief aber bis zum Morgen: Pokrowskij weckte
mich auf, als es Zeit war, Mama die Arznei einzugeben.
Als ich mich am nächsten Tage nach einer kurzen Erholung wieder zur
Nachtwache anschickte, entschlossen, diesmal nicht wieder einzuschlafen,
wurde etwa gegen elf Uhr an unsere Tür geklopft: ich öffnete – es war
Pokrowskij.
„Es wird Sie langweilen, denke ich, so allein zu sitzen,“ sagte er,
„hier, nehmen Sie dieses Buch, es wird Sie immerhin etwas zerstreuen.“
Ich nahm das Buch – ich habe vergessen, was für eines es war –, doch
obschon ich die ganze Nacht nicht schlief, sah ich kaum einmal hinein.
Es war eine eigentümliche innere Aufregung, die mir keine Ruhe ließ: ich
konnte nicht schlafen, ich konnte nicht einmal längere Zeit ruhig im
Lehnstuhl sitzen, – mehrmals stand ich auf, um eine Weile im Zimmer
umherzugehen. Eine gewisse innere Zufriedenheit durchströmte mein ganzes
Wesen. Ich war so froh über die Aufmerksamkeit Pokrowskijs. Ich war
stolz auf seine Sorge, auf seine Bemühungen um mich. Die ganze Nacht
dachte ich nur daran und träumte mit offenen Augen. Er kam nicht wieder
und ich wußte, daß er in dieser Nacht nicht wieder kommen würde, aber
ich malte mir dafür die nächste Begegnung aus.
Am folgenden Abend, als die anderen alle schon zu Bett gegangen waren,
öffnete Pokrowskij seine Tür und begann mit mir eine Unterhaltung, indem
er auf der Schwelle seines Zimmers stehen blieb. Ich entsinne mich
keines Wortes mehr von dem, was wir damals sprachen; ich weiß nur noch,
daß ich schüchtern und verwirrt war, weshalb ich mich entsetzlich über
mich ärgerte, und daß ich mit Ungeduld das Ende der Unterhaltung
erwartete, obschon ich mit allen Fibern an ihr hing und den ganzen Tag
an nichts anderes gedacht und mir sogar schon Fragen und Antworten
zurecht gelegt hatte ...
Mit diesem Gespräch begann unsere Freundschaft. Während der ganzen Dauer
von Mamas Krankheit verbrachten wir jeden Abend einige Stunden zusammen.
Allmählich überwand ich meine Schüchternheit, wenn ich auch nach jedem
Gespräch immer noch Ursache hatte, über mich selbst ungehalten zu sein.
Übrigens erfüllte es mich mit geheimer Freude und stolzer Genugtuung,
als ich sah, daß er um meinetwillen seine unausstehlichen Bücher vergaß.
Einmal kamen wir zufällig darauf zu sprechen, wie sie damals vom
Bücherbrett gefallen waren – natürlich im Scherz. Es war ein seltsamer
Augenblick: ich glaube, ich war _gar_ zu aufrichtig und naiv. Eine
seltsame Begeisterung riß mich mit sich fort und ich gestand ihm alles
... gestand ihm, daß ich lernen wollte, um etwas zu wissen, wie es mich
geärgert, daß man mich für ein kleines Mädchen gehalten ... Wie gesagt,
ich befand mich in einer sehr sonderbaren Stimmung: mein Herz war weich
und in meinen Augen standen Tränen, – ich verheimlichte ihm nichts, ich
sagte ihm alles, alles, erzählte ihm von meiner Freundschaft zu ihm, von
meinem Wunsch, ihn zu lieben, seinem Herzen nahe zu sein, ihn zu
trösten, zu beruhigen ...
Er sah mich eigentümlich an, er schien verwirrt und erstaunt zugleich zu
sein und sagte kein Wort. Das tat mir plötzlich sehr weh und machte mich
traurig. Ich glaubte, er verstehe mich nicht und mache sich in Gedanken
vielleicht sogar über mich lustig. Und plötzlich brach ich in Tränen aus
und weinte wie ein Kind: es war mir unmöglich, mich zu beherrschen, wie
ein Krampf hatte es mich erfaßt. Er ergriff meine Hände, küßte sie,
drückte sie an die Brust, redete mir zu, tröstete mich. Es mußte ihm
sehr nahe gegangen sein, denn er war tief gerührt. Ich erinnere mich
nicht mehr, was er zu mir sprach, ich weinte und lachte und errötete und
weinte wieder vor lauter Seligkeit, und konnte selbst kein Wort
hervorbringen. Dennoch entging mir nicht, daß in Pokrowskij eine gewisse
Verwirrung und Gezwungenheit zurückblieb. Offenbar konnte er sich über
meinen Gefühlsausbruch, über eine so plötzliche, glühende Freundschaft
nicht genug wundern. Vielleicht war zu Anfang nur sein Interesse
geweckt, doch späterhin verlor sich seine Zurückhaltung und er erwiderte
meine Anhänglichkeit, meine freundlichen Worte, meine Aufmerksamkeit mit
ebenso aufrichtigen, ehrlichen Gefühlen, wie ich sie ihm
entgegenbrachte, und war so aufmerksam und freundlich zu mir, wie ein
aufrichtiger Freund, wie mein leiblicher Bruder. In meinem Herzen war es
so warm, so gut ... Ich verheimlichte nichts und verstellte mich nicht:
was ich fühlte, das sah er, und mit jedem Tage trat er mir näher, wurde
seine Freundschaft zu mir größer.
Wirklich, ich vermag es nicht zu sagen, wovon wir in jenen qualvollen
und doch süßen Stunden unseres nächtlichen Beisammenseins beim
zitternden Licht des Lämpchens vor dem Heiligenbilde und fast dicht am
Bett meiner armen, kranken Mutter sprachen ... Wir sprachen von allem,
was uns einfiel, wovon das Herz voll war – und wir waren fast glücklich
... Ach, es war eine traurige und doch frohe Zeit, beides zugleich. Auch
jetzt noch bin ich traurig und froh, wenn ich an sie zurückdenke.
Erinnerungen sind immer quälend, gleichviel ob es traurige oder frohe
sind. Wenigstens ist es bei mir so – freilich liegt in dieser Qual
zugleich auch eine gewisse Süße. Aber wenn es einem schwer wird ums Herz
und weh, und wenn man sich quält und traurig ist, dann sind Erinnerungen
erfrischend und belebend wie nach einem heißen Tage kühler Tau, der am
feuchten Abend die arme, in der Sonnenglut des Tages welk gewordene
Blume erfrischt und wieder belebt.
Mama war bereits auf dem Wege der Besserung – trotzdem fuhr ich fort,
die Nächte an ihrem Bett zu verbringen. Pokrowskij gab mir Bücher:
anfangs las ich sie nur, um nicht einzuschlafen, dann aufmerksamer und
zuletzt mit wahrer Gier. Es war mir, als täte sich eine ganze Welt
neuer, mir bis dahin unbekannter, ungeahnter Dinge auf. Neue Gedanken,
neue Eindrücke stürmten in Überfülle auf mich ein. Und je mehr
Aufregung, je mehr Arbeit und Kampf mich die Aufnahme dieser neuen
Eindrücke kostete, um so lieber waren sie mir, um so freudvoller
erschütterten sie meine ganze Seele. Mit einem Schlage, ganz plötzlich
drängten sie sich in mein Herz und ließen es keine Ruhe mehr finden. Es
war ein eigentümliches Chaos, das mein ganzes Wesen aufzuregen begann.
Nur konnte mich diese geistige Vergewaltigung doch nicht vernichten. Ich
war gar zu verschwärmt und träumerisch, und das rettete mich.
Als meine Mutter die Krankheit glücklich überstanden hatte, hörten
unsere abendlichen Zusammenkünfte und langen Gespräche auf. Nur hin und
wieder fanden wir Gelegenheit, ein paar bedeutungslose, ganz
gleichgültige Worte mit einander zu wechseln, doch tröstete ich mich
damit, daß ich jedem nichtssagenden Wort eine besondere Bedeutung
verlieh und ihm einen geheimen Sinn unterschob. Mein Leben war voll
Inhalt, ich war glücklich, war still und ruhig glücklich. Und so
vergingen mehrere Wochen ...
Da trat einmal, wie zufällig, der alte Pokrowskij zu uns ins Zimmer. Er
schwatzte wieder alles mögliche, war bei auffallend guter Laune,
scherzte und war sogar witzig, so in seiner Art witzig, – bis er endlich
mit der großen Neuigkeit, die zugleich die Lösung des Rätsels seiner
guten Laune war, herauskam, und uns mitteilte, daß genau eine Woche
später Petinkas Geburtstag sei und daß er an jenem Tage unbedingt zu
seinem Sohne kommen werde. Er wolle dann die neue Weste anlegen, und
seine Frau, sagte er, habe versprochen, ihm neue Stiefel zu kaufen.
Kurz, der Alte war mehr als glücklich und schwatzte unermüdlich.
Sein Geburtstag also! Dieser Geburtstag ließ mir Tag und Nacht keine
Ruhe. Ich beschloß sogleich, ihm zum Beweis meiner Freundschaft
unbedingt etwas zu schenken. Aber was? Endlich kam mir ein guter
Gedanke: ich wollte ihm Bücher schenken. Ich wußte, daß er gern die
neueste Gesamtausgabe der Werke Puschkins besessen hätte und so beschloß
ich, ihm dieselbe zu kaufen. Ich besaß an eigenem Gelde etwa dreißig
Rubel, die ich mir mit Handarbeiten verdient hatte. Dieses Geld war
eigentlich für ein neues Kleid bestimmt, das ich mir anschaffen sollte.
Doch ich schickte sogleich unsere Küchenmagd, die alte Matrjona, zum
nächsten Buchhändler, um sich zu erkundigen, wieviel die neueste Ausgabe
der Werke Puschkins koste. O, das Unglück! Der Preis aller elf Bände
war, wenn man sie in gebundenen Exemplaren wollte, etwa sechzig Rubel.
Woher das Geld nehmen? Ich sann und grübelte und wußte nicht, was tun.
Mama um Geld bitten, das wollte ich nicht. Sie würde es mir natürlich
sofort gegeben haben, doch dann hätten alle erfahren, daß wir ihm ein
Geschenk machten. Und außerdem wäre es dann kein Geschenk mehr gewesen,
sondern gewissermaßen eine Entschädigung für seine Mühe, die er das
ganze Jahr mit mir gehabt. Ich aber wollte ihm die Bücher ganz allein,
ganz heimlich schenken. Für die Mühe aber, die er beim Unterricht mit
mir gehabt, wollte ich ihm ewig zu Dank verpflichtet sein, ohne ein
anderes Entgelt dafür, als meine Freundschaft. Endlich verfiel ich auf
einen Ausweg.
Ich wußte, daß man bei den Antiquaren im Gostinnyj Dworr[4] die neuesten
Bücher für den halben Preis erstehen konnte, wenn man nur zu handeln
verstand. Oft waren es nur wenig mitgenommene, oft sogar fast ganz neue
Bücher. Dabei blieb es: ich nahm mir vor, bei nächster Gelegenheit nach
dem Gostinnyj Dworr zu gehen. Diese Gelegenheit fand sich schon am
folgenden Tage: Mama hatte irgend etwas nötig, das aus einer Handlung
besorgt werden sollte, und Anna Fedorowna gleichfalls, doch Mama fühlte
sich nicht ganz wohl und Anna Fedorowna hatte zum Glück gerade keine
Lust zum Ausgehen. So kam es, daß ich mit Matrjona alles besorgen mußte.
Ich fand sehr bald die betreffende Ausgabe, und zwar in einem hübschen
und gut erhaltenen Einbande. Ich fragte nach dem Preise. Zuerst
verlangte der Mann mehr, als die Ausgabe in der Buchhandlung kostete,
doch nach und nach brachte ich ihn so weit – was übrigens gar nicht so
leicht war – daß er, nachdem ich mehrmals fortgegangen und so getan
hatte, als wolle ich mich an einen anderen wenden, nach und nach vom
Preise abließ und seine Forderung schließlich auf fünfunddreißig Rubel
festsetzte. Welch ein Vergnügen es mir war, zu handeln! Die arme
Matrjona konnte gar nicht begreifen, was in mich gefahren war und wozu
in aller Welt ich soviel Bücher kaufen wollte. Doch wer beschreibt
schließlich meinen Ärger: ich besaß im ganzen nur meine dreißig Rubel,
und der Kaufmann wollte mir die Bücher unter keinen Umständen billiger
abtreten. Ich bat aber und flehte und beredete ihn so lange, bis er sich
zu guter Letzt doch erweichen ließ: er ließ noch etwas ab, aber nur
zweieinhalb Rubel, mehr, sagte er, könne er bei allen Heiligen nicht
ablassen, und er schwor und beteuerte immer wieder, daß er es nur für
mich tue, weil ich ein so nettes Fräulein sei, und daß er einem anderen
Käufer nie und nimmer so viel abgelassen hätte. Zweieinhalb Rubel
fehlten mir! Ich war nahe daran, vor Verdruß in Tränen auszubrechen.
Doch da rettete mich etwas ganz Unvorhergesehenes.
Nicht weit von mir erblickte ich plötzlich den alten Pokrowskij, der an
einem der anderen Büchertische stand. Vier oder fünf der Antiquare
umringten ihn und schienen ihn durch ihre lebhaften Anpreisungen bereits
ganz eingeschüchtert zu haben. Ein jeder bot ihm einige seiner Bücher
an, die verschiedensten, die man sich nur denken kann: mein Gott, was er
nicht alles kaufen wollte! Der arme Alte war ganz hilf- und ratlos und
wußte nicht, für welches der vielen Bücher, die ihm von allen Seiten
empfohlen wurden, er sich nun eigentlich entscheiden sollte. Ich trat
auf ihn zu und fragte, was er denn hier suche. Der Alte war sehr froh
über mein Erscheinen; er liebte mich sehr, vielleicht gar nicht so viel
weniger als seinen Petinka.
„Ja, eben, sehen Sie, ich kaufe da eben Büchelchen, Warwara Alexejewna,“
antwortete er, „für Petinka kaufe ich ein paar Büchelchen. Sein
Geburtstag ist bald und er liebt doch am meisten Bücher, und da kaufe
ich sie denn eben für ihn ...“
Der Alte drückte sich immer sehr sonderbar aus, diesmal aber war er noch
dazu völlig verwirrt. Was er auch kaufen wollte, immer kostete es über
einen Rubel, zwei oder gar drei Rubel. An die großen Bände wagte er sich
schon gar nicht heran, blickte nur so von der Seite mit verlangendem
Lächeln nach ihnen hin, blätterte etwas in ihnen – ganz zaghaft und
ehrfurchtsvoll langsam – besah wohl auch das eine oder andere Buch von
allen Seiten, drehte es in der Hand und stellte es wieder an seinen
Platz zurück.
„Nein, nein, das ist zu teuer,“ sagte er dann halblaut, „aber von hier
vielleicht etwas ...“ Und er begann, unter den dünnen Broschüren und
Heftchen, unter Liederbüchern und alten Kalendern zu suchen: die waren
natürlich billig.
„Aber weshalb wollen Sie denn so etwas kaufen,“ fragte ich ihn, „diese
Heftchen sind doch nichts wert!“
„Ach nein,“ versetzte er, „nein, sehen Sie nur, was für hübsche
Büchelchen hier unter diesen sind, sehen Sie, wie hübsch!“ – Die letzten
Worte sprach er so wehmütig und gleichsam zögernd in stockendem Tone,
daß ich schon befürchtete, er werde sogleich zu weinen anfangen – vor
lauter Kummer darüber, daß die hübschen Bücher so teuer waren – und daß
sogleich ein Tränlein über seine bleiche Wange an der roten Nase
vorüberrollen werde.
Ich fragte ihn schnell, wieviel Geld er habe.
„Da, hier,“ – damit zog der Arme sein ganzes Vermögen hervor, das in ein
schmutziges Stückchen Zeitungspapier eingewickelt war – „hier, sehen
Sie, ein halbes Rubelchen, ein Zwanzigkopekenstück, hier Kupfer, auch so
zwanzig Kopeken ...“
Ich zog ihn sogleich zu meinem Antiquar.
„Hier, sehen Sie, sind ganze elf Bände, die alle zusammen zweiunddreißig
Rubel und fünfzig Kopeken kosten. Ich habe dreißig, legen Sie jetzt
zweieinhalb hinzu und wir kaufen alle diese elf Bücher und schenken sie
ihm gemeinsam!“
Der Alte verlor fast den Kopf vor Freude, schüttelte mit zitternden
Händen all sein Geld aus der Tasche, worauf ihm dann der Antiquar unsere
ganze neuerstandene Bibliothek auflud. Mein Alterchen steckte die Bücher
in alle Taschen, belud mit dem Rest Arme und Hände, und trug sie dann
alle zu sich nach Haus, nachdem er mir sein Wort gegeben, daß er sie am
nächsten Tage ganz heimlich zu uns bringen werde.
Richtig, am nächsten Tage kam er zu dem Sohn, saß wie gewöhnlich ein
Stündchen bei ihm, kam dann zu uns und setzte sich mit einer unsagbar
komischen und geheimnisvollen Miene zu mir. Lächelnd und die Hände
reibend, stolz im Bewußtsein, daß er ein Geheimnis besaß, teilte er mir
heimlich mit, daß er die Bücher alle ganz unbemerkt zu uns gebracht und
in der Küche versteckt habe, woselbst sie unter Matrjonas Schutz bis zum
Geburtstage unbemerkt verbleiben konnten.
Dann kam das Gespräch natürlich auf das bevorstehende große „Fest“. Der
Alte begann sehr weitschweifig darüber zu reden, wie die Überreichung
des Geschenkes vor sich gehen sollte, und je mehr er sich in dieses
Thema vertiefte, je mehr und je unklarer er darüber sprach, um so
deutlicher merkte ich, daß er etwas auf dem Herzen hatte, was er nicht
sagen wollte oder nicht zu sagen verstand, vielleicht aber auch nicht
recht zu sagen wagte. Ich schwieg und wartete. Seine geheime Freude und
seine groteske Vergnügtheit, die sich anfangs in seinen Gebärden, in
seinem ganzen Mienenspiel, in seinem Schmunzeln und einem gewissen
Zwinkern mit dem linken Auge verraten hatten, waren allmählich
verschwunden. Er war sichtlich von innerer Unruhe geplagt und schaute
immer bekümmerter drein. Endlich hielt er es nicht länger aus und begann
zaghaft:
„Hören Sie, wie wäre es, sehen Sie mal, Warwara Alexejewna ... wissen
Sie was, Warwara Alexejewna? ...“ Der Alte war ganz konfus. „Ja, sehen
Sie: wenn nun jetzt sein Geburtstag kommt, dann nehmen Sie zehn Bücher
und schenken ihm diese selbst, das heißt also von sich aus, von Ihrer
Seite sozusagen ... ich aber werde dann den letzten Band nehmen und ihn
ganz allein von mir aus überreichen, also sozusagen ausdrücklich von
meiner Seite. Sehen Sie, dann haben Sie etwas zu schenken, und auch ich
habe etwas zu schenken, wir werden dann eben sozusagen beide etwas zu
schenken haben ...“
Hier geriet der Alte ins Stocken und wußte nicht, wie er fortfahren
sollte. Ich sah von meiner Arbeit auf: er saß ganz still und erwartete
schüchtern, was ich wohl dazu sagen werde.
„Aber weshalb wollen Sie denn nicht gemeinsam mit mir schenken, Sachar
Petrowitsch?“ fragte ich.
„Ja so, Warwara Alexejewna, das ist schon so, wie gesagt ... – ich meine
ja nur eben sozusagen ...“
Kurz, der Alte verstand sich nicht auszudrücken, blieb wieder stecken
und kam nicht weiter.
„Sehen Sie,“ hub er dann nach kurzem Schweigen von neuem an, „ich habe
nämlich, müssen Sie wissen, den Fehler, daß ich mitunter nicht ganz so
bin, wie man sein muß ... das heißt, ich will Ihnen gestehen, Warwara
Alexejewna, daß ich eigentlich immer dumme Streiche mache ... das ist
nun schon einmal so mit mir ... und ist gewiß sehr schlecht von mir ...
Das kommt, sehen Sie, ganz verschiedentlich ... es ist draußen mitunter
so eine Kälte, auch gibt es da Unannehmlichkeiten, oder man ist eben
einmal wehmütig gestimmt, oder es geschieht sonst irgend etwas nicht
Gutes, und da halte ich es denn mitunter nicht aus und schlage eben über
die Schnur und trinke ein überflüssiges Gläschen. Dem Petruscha aber ist
das sehr unangenehm. Denn er, sehen Sie, er ärgert sich darüber und
schilt mich und erklärt mir, was Moral ist. Also deshalb, sehen Sie,
würde ich ihm jetzt gern mit meinem Geschenk beweisen, daß ich anfange,
mich gut aufzuführen, seine Lehren zu beherzigen und überhaupt mich zu
bessern. Daß ich also, mit anderen Worten, gespart habe, um das Buch zu
kaufen, lange gespart, denn ich habe doch selbst gar kein Geld, sehen
Sie, es sei denn, daß Petinka mir hin und wieder welches gibt. Das weiß
er. Also wird er dann sehen, wozu ich sein Geld benutzt habe: daß ich
alles nur für ihn tue.“
Er tat mir so leid, der Alte! Ich dachte nicht lange nach. Der Alte sah
mich in erwartungsvoller Unruhe an.
„Hören Sie, Sachar Petrowitsch,“ sagte ich, „schenken Sie sie ihm alle.“
„Wie alle? Alle Bände?“
„Nun ja, alle Bände.“
„Und das von mir, von meiner Seite?“
„Ja, von Ihrer Seite.“
„Ganz allein von mir? Das heißt, in meinem Namen?“
„Nun ja doch, versteht sich, in Ihrem Namen.“
Ich glaube, daß ich mich deutlich genug ausdrückte, doch es dauerte eine
Zeitlang, bis der Alte mich begriff.
„Na ja,“ sagte er schließlich nachdenklich, „ja! – das würde sehr gut
sein, wirklich sehr gut, aber wie bleibt es dann mit Ihnen, Warwara
Alexejewna?“
„Ich werde dann einfach nichts schenken.“
„Wie!“ rief der Alte fast erschrocken, „Sie werden Petinka nichts
schenken? Sie wollen ihm kein Geschenk machen?“
Ich bin überzeugt, daß der Alte in diesem Augenblick im Begriff war, das
Angebot zurückzuweisen, nur damit auch ich seinem Sohne etwas schenken
könne. Er war doch ein herzensguter Mensch, dieser Alte!
Ich versicherte ihm zugleich, daß ich ja sehr gern schenken würde, nur
wolle ich ihm die Freude nicht schmälern.
„Und wenn Ihr Sohn mit dem Geschenk zufrieden sein wird,“ fuhr ich fort,
„und Sie sich freuen werden, dann werde auch ich mich freuen.“
Damit gelang es mir, den Alten zu beruhigen. Er blieb noch ganze zwei
Stunden bei uns, vermochte aber in dieser Zeit keine Minute lang ruhig
zu sitzen: er erhob sich, ging umher, sprach lauter als je, tollte mit
Ssascha umher, küßte heimlich meine Hand, und schnitt Gesichter hinter
Anna Fedorownas Stuhl, bis diese ihn endlich nach Hause schickte. Kurz,
der Alte war rein aus Rand und Band vor lauter Freude, wie er es bis
dahin vielleicht in seinem ganzen Leben noch nicht gewesen war.
Am Morgen des feierlichen Tages erschien er pünktlich um elf Uhr, gleich
von der Frühmesse aus, erschien in anständigem, ausgebessertem Rock und
tatsächlich in neuen Stiefeln und mit neuer Weste. In jeder Hand trug er
ein Bündel Bücher – Matrjona hatte ihm dazu zwei Servietten geliehen.
Wir saßen gerade alle bei Anna Fedorowna und tranken Kaffee (es war ein
Sonntag). Der Alte begann, glaube ich, damit, daß Puschkin ein sehr
guter Dichter gewesen sei; davon ging er, übrigens nicht ohne gewisse
Unsicherheit und Verlegenheit und mehr als einmal stockend, aber doch
ziemlich plötzlich, auf ein anderes Thema über, nämlich darauf, daß man
sich gut aufführen müsse: wenn der Mensch das nicht tue, so sei das ein
Zeichen, daß er „dumme Streiche mache“. Schlechte Neigungen hätten eben
von jeher den Menschen herabgezogen und verdorben. Ja, er zählte sogar
mehrere abschreckende Beispiele von Unenthaltsamkeit auf, und schloß
damit, daß er selbst sich seit einiger Zeit vollkommen gebessert habe
und sich jetzt musterhaft aufführe. Er habe auch früher schon die
Richtigkeit der Lehren seines Sohnes erkannt und sie schon lange
innerlich beherzigt, jetzt aber habe er begonnen, sich auch in der Tat
aller schlechten Dinge zu enthalten und so zu leben, wie er es seiner
Erkenntnis gemäß für richtig halte. Zum Beweis aber schenke er hiermit
die Bücher, für die er sich im Laufe einer langen Zeit das nötige Geld
zusammengespart habe.
Ich hatte Mühe, mir die Tränen und das Lachen zu verbeißen, während der
arme Alte redete. So hatte er es doch verstanden, zu lügen, sobald es
nötig war!
Die Bücher wurden sogleich feierlich in Pokrowskijs Zimmer gebracht und
auf dem Bücherbrett aufgestellt. Pokrowskij selbst hatte natürlich
sofort die Wahrheit erraten.
Der Alte wurde aufgefordert, zum Mittagessen zu bleiben. Wir waren an
diesem Tage alle recht lustig. Nach dem Essen spielten wir ein
Pfänderspiel und dann Karten. Ssascha tollte und war so ausgelassen wie
nur je, und ich stand ihr in nichts nach. Pokrowskij war sehr aufmerksam
gegen mich und suchte immer nach einer Gelegenheit, mich unter vier
Augen zu sprechen, doch ließ ich mich nicht einfangen. Das war der
schönste Tag in diesen vier Jahren meines Lebens!
Jetzt, von ihm ab, kommen nur noch traurige, schwere Erinnerungen, jetzt
beginnt die Geschichte meiner dunklen Tage. Wohl deshalb will es mir
scheinen, als ob meine Feder langsamer schreibe, als beginne sie, müde
zu werden und als wolle es nicht gut weiter gehen mit dem Erzählen.
Deshalb habe ich wohl auch so ausführlich und mit so viel Liebe alle
Einzelheiten meiner Erlebnisse in jenen glücklichen Tagen meines Lebens
beschrieben. Sie waren ja so kurz, diese Tage. So bald wurden sie von
Kummer, von schwerem Kummer verdrängt, und nur Gott allein mag wissen,
wann der einmal ein Ende nehmen wird.
Mein Unglück begann mit der Krankheit und dem Tode Pokrowskijs.
Es waren etwa zwei Monate seit seinem Geburtstage vergangen, als er
erkrankte. In diesen zwei Monaten hatte er sich unermüdlich um eine
Anstellung, die ihm eine Existenzmöglichkeit gewährt hätte, bemüht, denn
bis dahin hatte er ja noch nichts. Wie alle Schwindsüchtigen, gab auch
er die Hoffnung, noch lange zu leben, bis zum letzten Augenblick nicht
auf. Einmal sollte er irgendwo als Lehrer angestellt werden, doch hatte
er einen unüberwindlichen Widerwillen gegen diesen Beruf. In den
Staatsdienst zu treten, verbot ihm seine angegriffene Gesundheit.
Außerdem hätte er dort lange auf das erste etatsmäßige Gehalt warten
müssen. Kurz, Pokrowskij sah überall nichts als Mißerfolge. Das war
natürlich von schlechtem Einfluß auf ihn. Er rieb sich auf. Er opferte
seine Gesundheit. Freilich beachtete er es nicht. Der Herbst kam. Jeden
Tag ging er in seinem leichten Mantel aus, um wieder irgendwo um eine
Anstellung zu bitten, – was ihm dabei eine Qual war. Und so kam er dann
immer müde, hungrig, vom Regen durchnäßt und mit nassen Füßen nach Haus,
bis er endlich so weit war, daß er sich zu Bett legen mußte – um nicht
wieder aufzustehen ... Er starb im Spätherbst, Ende Oktober.
Ich pflegte ihn. Während der ganzen Dauer seiner Krankheit verließ ich
nur selten sein Zimmer. Oft schlief ich ganze Nächte nicht. Meist lag er
bewußtlos im Fieber und phantasierte; dann sprach er Gott weiß wovon,
zuweilen auch von der Anstellung, die er in Aussicht hatte, von seinen
Büchern, von mir, vom Vater ... und da erst hörte ich vieles von seinen
Verhältnissen, was ich noch gar nicht gewußt und nicht einmal geahnt
hatte.
In der ersten Zeit seiner Krankheit und meiner Pflege sahen mich alle im
Hause etwas sonderbar an, und Anna Fedorowna schüttelte den Kopf. Doch
ich blickte allen offen in die Augen, und da hörte man denn auf, meine
Teilnahme für den Kranken zu verurteilen – wenigstens Mama tat es nicht
mehr.
Hin und wieder erkannte mich Pokrowskij, doch geschah das
verhältnismäßig selten. Er war fast die ganze Zeit nicht bei Besinnung.
Bisweilen sprach er lange, lange, oft ganze Nächte lang in unklaren,
dunklen Worten zu irgend jemand, und seine heisere Stimme klang in dem
engen Zimmer so dumpf wie in einem Sarge. Dann fürchtete ich mich.
Namentlich in der letzten Nacht war er wie rasend: er litt entsetzlich
und quälte sich, und sein Stöhnen zerriß mir das Herz. Alle im Hause
waren erschüttert. Anna Fedorowna betete die ganze Zeit, Gott möge ihn
schneller erlösen. Der Arzt wurde gerufen. Er sagte, daß der Kranke wohl
nur noch bis zum nächsten Morgen leben werde.
Der alte Pokrowskij verbrachte die ganze Nacht im Korridor, dicht an der
Tür zum Zimmer seines Sohnes: dort hatte man ihm ein Lager zurecht
gemacht, irgendeine Matte als Unterlage auf den Fußboden gelegt. Jeden
Augenblick kam er ins Zimmer, – es war schrecklich, ihn anzusehen. Der
Schmerz hatte ihn so gebrochen, daß er fast vollkommen teilnahmslos,
ganz gefühllos und gedankenlos erschien. Sein Kopf zitterte. Sein ganzer
Körper zitterte und sein Mund flüsterte mechanisch irgend etwas vor sich
hin. Es schien mir, daß er vor Schmerz den Verstand verlieren werde.
Vor Tagesanbruch sank der Alte auf seiner Matte im Korridor endlich in
Schlaf. Gegen acht Uhr begann der Sohn zu sterben. Ich weckte den Vater.
Pokrowskij war bei vollem Bewußtsein und nahm von uns allen Abschied.
Seltsam! Ich konnte nicht weinen, aber ich glaubte es körperlich zu
fühlen, wie mein Herz in Stücke zerriß.
Doch das Qualvollste waren für mich seine letzten Augenblicke. Er bat
lange, lange um irgend etwas, doch konnte ich seine Worte nicht mehr
verstehen, da seine Zunge bereits steif war. Mein Herz krampfte sich
zusammen. Eine ganze Stunde war er unruhig, und immer wieder bat er um
irgend etwas, bemühte er sich, mit seiner bereits steif gewordenen Hand
ein Zeichen zu machen, um dann wieder mit trauriger, dumpf-heiserer
Stimme um etwas zu bitten – doch die Worte waren nur zusammenhanglose
Laute, und wieder konnte ich nichts verstehen. Ich führte alle einzeln
an sein Bett, reichte ihm zu trinken, er aber schüttelte immer nur
langsam den Kopf und sah mich so traurig an. Endlich erriet ich, was er
wollte: er bat, den Fenstervorhang aufzuziehen und die Läden zu öffnen.
Er wollte wohl noch einmal den Tag sehen, das Gotteslicht, die Sonne.
Ich zog den Vorhang fort und stieß die Läden auf, doch der anbrechende
Tag war trübe und traurig, wie das erlöschende arme Leben des
Sterbenden. Von der Sonne war nichts zu sehen. Wolken verhüllten den
Himmel mit einer dicken Nebelschicht, so regnerisch, düster und
schwermütig war es. Ein feiner Regen schlug leise an die Fensterscheiben
und rann in klaren, kalten Wasserstreifen an ihnen herab. Es war trüb
und dunkel. Das bleiche Tageslicht drang nur spärlich ins Zimmer, wo es
das zitternde Licht des Lämpchens vor dem Heiligenbilde kaum merklich
verdrängte. Der Sterbende sah mich traurig, so traurig an und bewegte
dann leise, wie zu einem müden Schütteln, den Kopf. Nach einer Minute
starb er.
Für die Beerdigung sorgte Anna Fedorowna. Es wurde ein ganz, ganz
einfacher Sarg gekauft und ein Lastwagen gemietet. Zur Deckung der
Unkosten aber wurden alle Bücher und Sachen des Verstorbenen von Anna
Fedorowna beschlagnahmt. Der Alte wollte ihr die Hinterlassenschaft
seines Sohnes nicht abtreten, stritt mit ihr, lärmte, nahm ihr die
Bücher fort, stopfte sie in alle Taschen, in den Hut, wo immer er sie
nur unterbringen konnte, schleppte sie drei Tage mit sich herum und
trennte sich auch dann nicht von ihnen, als wir zur Kirche gehen mußten.
Alle diese Tage war er ganz wie ein Geistesgestörter. Mit einer
seltsamen Geschäftigkeit machte er sich ewig etwas am Sarge zu schaffen:
bald zupfte er ein wenig die grünen Blätter zurecht, bald zündete er die
Kerzen an, um sie wieder auszulöschen und dann wieder anzuzünden. Man
sah es, daß seine Gedanken nicht länger als einen Augenblick bei etwas
Bestimmtem verweilen konnten.
Der Totenmesse in der Kirche wohnten weder Mama noch Anna Fedorowna bei.
Mama war krank, Anna Fedorowna aber, die sich bereits angekleidet hatte,
geriet wieder mit dem alten Pokrowskij in Streit, ärgerte sich und blieb
zu Haus. So waren nur ich und der Alte in der Kirche. Während des
Gottesdienstes ergriff mich plötzlich eine unsagbare Angst – wie eine
dunkle Ahnung dessen, was mir bevorstand. Ich konnte mich kaum auf den
Füßen halten.
Endlich wurde der Sarg geschlossen, auf den Lastwagen gehoben und
fortgeführt. Ich begleitete ihn nur bis zum Ende der Straße. Dann fuhr
der Fuhrmann im Trab weiter. Der Alte lief hinter ihm her und weinte
laut, und sein Weinen zitterte und brach oft ab, da das Laufen ihn
erschütterte. Der Arme verlor seinen Hut, blieb aber nicht stehen, um
ihn aufzuheben, sondern lief weiter. Sein Kopf wurde naß vom Regen. Ein
scharfer, kalter Wind erhob sich und schnitt ins Gesicht. Doch der Alte
schien nichts davon zu spüren und lief weinend weiter, bald an der
einen, bald an der anderen Seite des Wagens. Die langen Schöße seines
fadenscheinigen alten Überrocks flatterten wie Flügel im Winde. Aus
allen Taschen sahen Bücher hervor und im Arm trug er irgendein großes
schweres Buch, das er krampfhaft umklammerte und an die Brust drückte.
Die Vorübergehenden nahmen die Mützen ab und bekreuzten sich. Einige
blieben stehen und schauten verwundert dem armen Alten nach. Alle
Augenblicke fiel ihm aus einer Tasche ein Buch in den Straßenschmutz.
Dann rief man ihn an, hielt ihn zurück und machte ihn auf seinen Verlust
aufmerksam. Und er hob das Buch auf und lief wieder weiter, dem Sarge
nach. Kurz vor der Straßenecke schloß sich ihm eine alte Bettlerin an
und folgte gleichfalls dem Sarge. Endlich bog der Wagen um die
Straßenecke und verschwand.
Ich ging nach Hause. Zitternd vor Weh warf ich mich meiner Mutter an die
Brust. Ich umschlang sie fest mit meinen Armen und küßte sie und
plötzlich brach ich in Tränen aus. Und ich schmiegte mich angstvoll an
die einzige, die mir als mein letzter Freund noch geblieben war, als
hätte ich sie für immer festhalten wollen, damit der Tod mir nicht auch
sie noch entreiße ...
Doch der Tod schwebte damals schon über meiner armen Mutter ...
* * * * *
11. Juni.
Wie dankbar bin ich Ihnen, Makar Alexejewitsch, für den gestrigen
Spaziergang nach den Inseln! Wie schön es dort war, wie wundervoll grün,
und die Luft wie köstlich! – Ich hatte so lange keinen Rasen und keine
Bäume gesehen, – als ich krank war, dachte ich doch, daß ich sterben
müsse, daß ich bestimmt sterben werde – nun können Sie sich denken, was
ich gestern fühlen mußte, und was empfinden!
Seien Sie mir nicht böse, daß ich so traurig war. Ich fühlte mich sehr
wohl und leicht, aber gerade in meinen besten Stunden werde ich aus
irgendeinem Grunde traurig; so geht es mir immer. Und daß ich weinte,
das hatte auch nichts auf sich, ich weiß selbst nicht, weshalb ich immer
weinen muß. Ich bin, das fühle ich, krankhaft überreizt, alle Eindrücke,
die ich empfange, sind krankhaft – krankhaft heftig. Der wolkenlose
blasse Himmel, der Sonnenuntergang, die Abendstille – alles das – ich
weiß wirklich nicht, – ich war gestern jedenfalls in der Stimmung, alle
Eindrücke schwer und qualvoll zu nehmen, so daß das Herz bald übervoll
war und die Seele nach Tränen verlangte. Doch wozu schreibe ich Ihnen
das alles? Das Herz wird sich nur so schwer über alles dies klar, um wie
viel schwerer ist es da noch, alles wiederzugeben! Aber vielleicht
verstehen Sie mich doch.
Leid und Freude! Wie gut Sie doch sind, Makar Alexejewitsch! Gestern
blickten Sie mir so in die Augen, als wollten Sie in ihnen lesen, was
ich empfand, und Sie waren glücklich über meine Freude. War es ein
Strauch, eine Allee oder ein Wasserstreifen – immer standen Sie da vor
mir und fühlten sich ganz stolz und schauten mir immer wieder in die
Augen, als wäre alles, was Sie mir da zeigten, Ihr Eigentum gewesen. Das
beweist, daß Sie ein gutes Herz haben, Makar Alexejewitsch. Deshalb
liebe ich Sie ja auch.
Nun leben Sie wohl. Ich bin heute wieder krank: gestern bekam ich nasse
Füße und habe mich infolgedessen erkältet. Fedora ist noch nicht ganz
gesund – ich weiß nicht, was ihr fehlt. So sind wir jetzt beide krank.
Vergessen Sie mich nicht, kommen Sie öfter zu uns.
Ihre
W. D.
12. Juni.
Mein Täubchen Warwara Alexejewna!
Ich dachte, mein Kind, Sie würden mir den gestrigen Ausflug in lauter
Gedichten beschreiben, und da erhalte ich nun von Ihnen so ein einziges
kleines Blättchen! Doch will ich damit nicht tadeln, daß Sie mir nur
wenig geschrieben haben: dafür haben Sie alles ungewöhnlich gut und
schön beschrieben. Die Natur, die verschiedenen Landschaftsstimmungen,
was Sie selber empfanden – das haben Sie mit einem Worte kurz, aber ganz
wunderbar geschildert. Ich habe dagegen ganz und gar kein Talent, irgend
etwas zu beschreiben: wenn ich auch zehn Seiten vollkritzele, es kommt
dabei doch nichts heraus und nichts ist wirklich beschrieben. Das weiß
ich selbst nur zu genau.
Sie schreiben mir, meine Liebe, daß ich ein guter Mensch sei,
sanftmütig, voll Wohlwollen für alle, unfähig, dem Nächsten etwas Böses
zuzufügen, und daß ich die Güte des himmlischen Schöpfers, wie sie in
der Natur zum Ausdruck kommt, wohl verstehe, und Sie beehren mich noch
mit verschiedenen anderen Lobsprüchen. – Das ist gewiß alles wahr, mein
Kind, nichts als die reine Wahrheit, denn ich bin wirklich so, wie Sie
sagen, ich weiß das selbst: und es freut einen auch, wenn man von
anderen so etwas geschrieben sieht, wie das, was Sie mir da geschrieben
haben: es wird einem unwillkürlich froh und leicht zumut – aber
schließlich kommen einem doch wieder allerlei schwere Gedanken. Nun
hören Sie mich mal an, mein Kind, ich will Ihnen jetzt mal etwas
erzählen.
Ich beginne damit, daß ich auf die Zeit zurückgreife, als ich erst
siebzehn Lenze zählte und in den Staatsdienst trat: nun werden es bald
runde dreißig Jahre sein, daß ich als Beamter tätig bin! Ich habe in der
Zeit, was soll ich sagen, genug Uniformröcke abgetragen, bin darüber
Mann geworden, auch vernünftiger und klüger, habe Menschen gesehen und
kennen gelernt, habe auch gelebt, ja, warum nicht – ich kann schon
sagen, daß ich gelebt habe –, und einmal wollte man mich sogar zur
Auszeichnung vorschlagen: man wollte mir nämlich für meine Dienste ein
Kreuz verleihen. Sie werden mir das letztere vielleicht nicht glauben,
aber es war wirklich so, ich lüge Ihnen nichts vor. Nun, was kam dabei
heraus, mein Kind? Ja, sehen Sie, es finden sich immer und überall
schlechte Menschen. Aber wissen Sie, was ich Ihnen sagen werde, meine
Liebe: ich bin zwar ein ungebildeter Mensch, meinetwegen sogar ein
dummer Mensch, aber das Herz, das in mir schlägt, ist genau so, wie das
Herz anderer Menschen. Also wissen Sie, Warinka, was ein böser Mensch
mir antat? Man schämt sich ordentlich, es zu sagen. Sie fragen, warum er
es tat? Einfach darum, weil ich so ein Stiller bin, weil ich bescheiden
bin, weil ich ein guter Kerl bin. Ich war ihnen nicht nach ihrem
Geschmack, und so wurde denn alles mir, und immer mir, in die Schuhe
geschoben. Anfangs hieß es, wenn jemand etwas schlecht gemacht hatte:
„Eh, Sie da, Makar Alexejewitsch, dies und das!“ – Daraus wurde mit der
Zeit:
„Ach, natürlich Makar Alexejewitsch, wer denn sonst!“
Jetzt aber heißt es ganz einfach:
„Na, selbstverständlich doch Makar Alexejewitsch, was fragen Sie noch!“
Sehen Sie, Kind, so kam die ganze Geschichte. An allem war Makar
Alexejewitsch schuld. Sie verstanden weiter nichts, als „Makar
Alexejewitsch“ sozusagen zum Schlagwort im ganzen Departement zu machen.
Und noch nicht genug damit, daß sie in dieser Weise aus mir ein
geflügeltes Wort, fast sogar einen geflügelten Tadel, wenn nicht gar ein
Schmähwort machten – nein, sie hatten auch noch an meinen Stiefeln,
meinem Rock, meinen Haaren und Ohren, kurz, an allem, was an mir war,
etwas auszusetzen: alles war ihnen nicht recht, alles mußte anders
gemacht werden! Und das wiederholt sich nun schon seit undenklichen
Zeiten jeden Tag! Ich habe mich daran gewöhnt, weil ich mich an alles
gewöhne, weil ich ein stiller Mensch bin, weil ich ein kleiner Mensch
bin. Aber, fragt man sich schließlich, womit habe ich denn das alles
verdient? Wem habe ich je etwas Schlechtes getan? Habe ich etwa jemandem
den Rang abgelaufen? Oder jemanden bei den Vorgesetzten angeschwärzt, um
dafür belohnt zu werden? Oder habe ich sonst eine Kabale gegen jemanden
angestiftet? Sie würden sündigen, Kind, wenn Sie so etwas auch nur
denken wollten! Bin ich denn einer, der so etwas überhaupt fertig
brächte? So betrachten Sie mich doch nur genauer, meine Liebe, und dann
sagen Sie selbst, ob ich auch nur die Fähigkeit zu Intrigen und zum
Strebertum habe? Also wofür treffen mich dann diese Heimsuchungen? Doch
vergib, Herr! Sie, Warinka, halten mich für einen ehrenwerten Menschen,
Sie aber sind auch unvergleichlich besser, als alle die anderen, jawohl
Warinka!
Was ist die größte bürgerliche Tugend? Über diese Frage äußerte sich
noch vor ein paar Tagen Jewstafij Iwanowitsch in einem Privatgespräch.
Er sagte: Die größte bürgerliche Tugend sei – Geld zu schaffen. Er sagte
es natürlich im Scherz (ich weiß, daß er es nur im Scherz sagte), was
aber in dem Worte für eine Moral lag (die er eigentlich im Sinne hatte),
das war, daß man mit seiner Person niemandem zur Last fallen solle. Ich
aber falle niemandem zur Last! Ich habe mein eigenes Stück Brot. Es ist
ja wohl nur ein einfaches Stück Brot, mitunter sogar altes, trockenes
Brot, aber _ich_ habe es doch, es ist _mein_ Brot, durch _meine_ Arbeit
rechtlich und redlich erworben!
Nun ja, was ist da zu machen! Ich weiß es ja selbst, daß ich nichts
sonderlich Großes vollbringe, wenn ich in meinem Bureau sitze und
Schriftstücke abschreibe. Trotzdem bin ich stolz darauf: ich arbeite
doch, leiste doch etwas, tue es durch meiner Hände Arbeit. Nun, und was
ist denn dabei, daß ich nur abschreibe? Ist denn das etwa eine Sünde?
„Na ja, doch eben immer nur ein Schreiber!“ – Aber was ist denn dabei
Unehrenhaftes? Meine Handschrift ist so eingeschrieben, so leserlich,
jeder Buchstabe wie gestochen, daß es eine Freude ist, so einen ganzen
Bogen zu sehen, und – Se. Exzellenz sind zufrieden mit mir. Ich muß die
wichtigsten Papiere für Se. Exzellenz abschreiben. Ja, aber ich habe
keinen Stil! Das weiß ich selbst, daß ich ihn nicht habe, den
verwünschten Stil! Mir fehlen die Redewendungen! Ich weiß es, und
deshalb habe ich es auch im Dienst zu nichts gebracht ... Auch an Sie,
mein Kind, schreibe ich jetzt, wie es gerade so kommt, ohne alle Kunst
und Feinheit, wie es mir aus dem Herzen in den Sinn strömt ... Das weiß
ich selbst ganz genau: aber schließlich: wenn alle nur Selbstverfaßtes
schreiben wollten, wer würde dann – abschreiben?
Das ist die Frage. Sehen Sie, und nun, bitte, beantworten Sie sie mir,
meine Liebe.
So sehe ich denn jetzt selbst ein, daß man mich braucht, daß ich
notwendig, daß ich unentbehrlich bin, und daß kein Grund vorliegt, sich
durch müßiges Geschwätz irre machen zu lassen. Nun schön, meinetwegen
bin ich eine Ratte, wenn sie glauben, eine Ähnlichkeit mit ihr
herausfinden zu können. Aber diese Ratte ist nützlich, ohne diese Ratte
käme man nicht aus, diese Ratte ist sogar ein Faktor, mit dem man
rechnet, und dieser Ratte wird man bald sogar eine Gratifikation
zusprechen, – da sehen Sie, was das für eine Ratte ist!
Doch jetzt habe ich genug davon geredet. Ich wollte ja eigentlich gar
nicht davon sprechen, aber nun – es kam mal so zur Sprache, und da hat’s
mich denn hingerissen. Es ist doch immer ganz gut, von Zeit zu Zeit sich
selbst etwas Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
Leben Sie wohl, mein Täubchen, meine gute kleine Trösterin! Ich werde
schon kommen, gewiß werde ich kommen und Sie besuchen, mein Sternchen,
um zu sehen, wie es Ihnen geht und was Sie machen. Grämen Sie sich bis
dahin nicht gar zu sehr. Ich werde Ihnen ein Buch mitbringen. Also leben
Sie wohl bis dahin, Warinka.
Wünsche Ihnen von Herzen alles Gute!
Ihr
Makar Djewuschkin.
20. Juni.
Sehr geehrter Makar Alexejewitsch!
Schreibe Ihnen in aller Eile, denn ich habe sehr wenig Zeit, – muß eine
Arbeit zu einem bestimmten Termin beenden.
Hören Sie, um was es sich handelt: es bietet sich ein guter
Gelegenheitskauf. Fedora sagt, ein Bekannter von ihr habe einen fast
neuen Uniformrock, sowie Beinkleider, Weste und Mütze zu verkaufen, und
alles, wie sie sagt, sehr billig. Wenn Sie sich das nun kaufen wollten!
Sie haben doch jetzt Geld und sind nicht mehr in Verlegenheit, – Sie
sagten mir ja selbst, daß Sie Geld haben. Also seien Sie vernünftig und
schaffen Sie sich die Sachen an. Sie haben sie doch so nötig. Sehen Sie
sich doch nur selbst an, in was für alten Kleidern Sie umhergehen. Eine
wahre Schande! Alles ist geflickt. Und neue Kleider haben Sie nicht, das
weiß ich, obschon Sie versichern, Sie hätten sie. Gott weiß, was Sie mit
Ihrem neuen Anzug angefangen haben. So hören Sie doch diesmal auf mich
und kaufen Sie die Kleider, bitte, tun Sie’s! Tun Sie es für mich, wenn
Sie mich lieb haben!
Sie haben mir Wäsche geschenkt. Hören Sie, Makar Alexejewitsch, das geht
wirklich nicht so weiter! Sie richten sich zugrunde, denn das ist doch
kein Spaß, was Sie schon für mich ausgegeben haben, – entsetzlich,
wieviel Geld! Wie Sie verschwenden können! Ich habe ja nichts nötig, das
war ja alles ganz, ganz überflüssig! Ich weiß, glauben Sie mir, ich
weiß, daß Sie mich lieben, deshalb ist es ganz überflüssig von Ihnen,
mich noch durch Geschenke immer wieder dieser Liebe vergewissern zu
wollen. Wenn Sie wüßten, wie schwer es mir fällt, sie anzunehmen! Ich
weiß doch, was sie Sie kosten. Deshalb ein für allemal: Lassen Sie es
gut sein, schicken Sie mir nichts mehr! Hören Sie? Ich bitte Sie, ich
flehe Sie an!
Sie bitten mich, Ihnen die Fortsetzung meiner Aufzeichnungen zuzusenden,
Sie wollen, daß ich sie beende. Gott, ich weiß selbst nicht, wie ich das
fertig gebracht habe, soviel zu schreiben, wie dort geschrieben ist!
Nein, ich habe nicht die Kraft, jetzt von meiner Vergangenheit zu
sprechen. Ich will an sie nicht einmal zurückdenken. Ich fürchte mich
vor diesen Erinnerungen. Und gar von meiner armen Mutter zu sprechen,
deren einziges Kind nach ihrem Tode diesen Ungeheuern preisgegeben war:
das wäre mir ganz unmöglich! Mein Herz blutet, wenn meine Gedanken auch
nur von ferne diese Erinnerungen streifen. Die Wunden sind noch zu
frisch! Ich habe noch keine Ruhe, um zu denken, habe mich selbst noch
lange nicht beruhigen können, obschon bereits ein ganzes Jahr vergangen
ist. Doch Sie wissen das ja alles!
Ich habe Ihnen auch Anna Fedorownas jetzige Ansichten mitgeteilt. Sie
wirft mir Undankbarkeit vor und leugnet es, mit Herrn Bükoff im
Einverständnis gewesen zu sein! Sie fordert mich auf, zu ihr
zurückzukehren. Sie sagt, ich lebe von Almosen und sei auf einen
schlechten Weg geraten. Wenn ich zu ihr zurückkehren würde, so wolle sie
es übernehmen, die ganze Geschichte mit Herrn Bükoff beizulegen und ihn
zu veranlassen, seine Schuld mir gegenüber wieder gutzumachen. Sie hat
sogar gesagt, daß Herr Bükoff mir eine Aussteuer geben wolle. Gott mit
ihnen! Ich habe es auch hier gut, unter Ihrem Schutz und bei meiner
guten Fedora, die mich mit ihrer Anhänglichkeit an meine alte selige
Kinderfrau erinnert. Sie aber sind zwar nur ein entfernter Verwandter
von mir, trotzdem beschützen Sie mich und treten mit Ihrem Namen und Ruf
für mich ein. Ich kenne jene anderen nicht, ich werde sie vergessen! –
wenn ich es nur vermag?! Was wollen sie denn noch von mir? Fedora sagt,
das sei alles nur Klatsch und sie würden mich zu guter Letzt doch in
Ruhe lassen. Gott gebe es!
W. D.
21. Juni.
Mein Täubchen, mein Liebling!
Ich will Ihnen schreiben, weiß aber nicht – womit beginnen?
Ist das nicht sonderbar, wie wir beide jetzt hier so miteinander leben!
Ich sage das nur deshalb, müssen Sie wissen, weil ich meine Tage noch
nie so froh verbracht habe. Ganz als hätte mich Gott der Herr mit einem
Häuschen und einer Familie gesegnet! Mein Kindchen sind Sie, mein
kleines reizendes!
Was reden Sie da von den vier Hemdchen, die ich Ihnen geschickt habe!
Sie hatten sie doch nötig – Fedora sagte es mir. Und mich, liebes Kind,
mich macht es doch glücklich, für Sie sorgen zu können: das ist nun
einmal mein größtes Vergnügen – also lassen Sie mich nur gewähren, Kind,
und widersprechen Sie mir nicht! Noch niemals habe ich so etwas erlebt,
Herzchen. Jetzt lebe ich doch ein ganz anderes Leben. Erstens
gewissermaßen zu zweien, wenn man so sagen darf, denn Sie leben doch
jetzt in meiner nächsten Nähe, was mir ein großer Trost und eine große
Freude ist. Und zweitens hat mich heute mein Zimmernachbar, Ratasäjeff –
jener Beamte, wissen Sie, bei dem literarische Abende stattfinden –,
also der hat mich heute zum Tee eingeladen. Heute findet bei ihm nämlich
wieder so eine Versammlung statt: es soll etwas Literarisches vorgelesen
werden. Da sehen Sie, wie wir jetzt leben, Kindchen – was?!
Nun, leben Sie wohl. Ich habe das alles ja nur so geschrieben, ohne
besonderen Zweck, nur um Sie von meinem Wohlbefinden zu unterrichten.
Sie haben mir durch Theresa sagen lassen, daß Sie farbige Nähseide zur
Stickerei benötigen: ich werde sie kaufen, Kindchen, ich werde sie Ihnen
besorgen, gleich morgen werde ich sie Ihnen besorgen. Ich weiß auch
schon, wo ich sie am besten kaufen kann. Inzwischen verbleibe ich
Ihr aufrichtiger Freund
Makar Djewuschkin.
22. Juni.
Liebe Warwara Alexejewna!
Ich will Ihnen nur mitteilen, meine Gute, daß bei uns im Hause etwas
sehr Trauriges geschehen ist, etwas, das jedes Menschen Mitleid erwecken
muß. Heute um fünf Uhr morgens starb Gorschkoffs kleiner Sohn. Ich weiß
nicht recht, woran, – an den Masern oder, Gott weiß, vielleicht war es
auch Scharlach. Da besuchte ich sie denn heute, diese Gorschkoffs. Ach,
Liebe, was das für eine Armut bei ihnen ist! Und was für eine Unordnung!
Aber das ist ja schließlich kein Wunder: die ganze Familie lebt doch nur
in diesem einen Zimmer, das sie nur anstandshalber durch einen
Bettschirm so ein wenig abgeteilt haben.
Jetzt steht bei ihnen schon der kleine Sarg, – ein ganz einfacher,
billiger, aber er sieht doch ganz nett aus, sie haben ihn gleich fertig
gekauft. Der Knabe war neun Jahre alt und soll, wie man hört, zu schönen
Hoffnungen berechtigt haben. Es tut weh, weh vor Mitleid, sie anzusehen,
Warinka. Die Mutter weint nicht, aber sie ist so traurig, die Arme. Es
ist für sie ja vielleicht eine Erleichterung, daß ihnen ein Kindchen
abgenommen ist: es bleiben ihnen noch zwei, die sie zu ernähren haben:
ein Brustkind und ein kleines Töchterchen so von etwa sechs Jahren, viel
älter kann das zarte Ding noch nicht sein.
Wie muß einem doch zumute sein, wenn man sieht, wie ein Kindchen leidet,
und noch dazu das eigene, leibliche Kindchen, und man hat nichts, womit
man ihm helfen könnte! Der Vater sitzt dort in einem alten, schmutzigen
und fadenscheinigen Rock auf einem halb zerbrochenen Stuhl. Die Tränen
laufen ihm über die Wangen, aber vielleicht gar nicht vor Leid, sondern
nur so, aus Gewohnheit – die Augen tränen eben. Er ist so ein
Sonderling! Immer wird er rot, wenn man mit ihm spricht, und niemals
weiß er, was er antworten soll. Das kleine Mädchen stand dort an den
Sarg gelehnt, stand ganz still und ernst und ganz nachdenklich. Ich
liebe es nicht, Warinka, wenn ein Kindchen nachdenklich ist: es
beunruhigt einen. Eine Puppe aus alten Zeugstücken lag auf dem Fußboden,
– sie spielte aber nicht mit ihr. Das Fingerchen im Mund: so stand sie,
– stand und rührte sich nicht. Die Wirtin gab ihr ein Bonbonchen: sie
nahm es, aß es aber nicht. Traurig das alles – nicht wahr, Warinka?
Ihr
Makar Djewuschkin.
25. Juni.
Bester Makar Alexejewitsch!
Ich sende Ihnen Ihr Buch zurück. Das ist ja ein ganz elendes Ding! – man
kann es überhaupt nicht in die Hand nehmen. Wo haben Sie denn diese
Kostbarkeit aufgetrieben? Scherz beiseite – gefallen Ihnen denn wirklich
solche Bücher, Makar Alexejewitsch? Sie versprachen mir doch vor ein
paar Tagen, mir etwas zum Lesen zu verschaffen. Ich kann ja auch mit
Ihnen teilen, wenn Sie wollen. Doch jetzt Schluß und auf Wiedersehen!
Ich habe wirklich keine Zeit, weiter zu schreiben.
W. D.
26. Juni.
Liebe Warinka!
Die Sache ist nämlich die, Kind, daß ich das Büchlein selbst gar nicht
gelesen habe. Es ist wahr, ich las ein wenig, sah, daß es irgendein
Unsinn war, nur so zum Lachen geschrieben, und um die Leute zu
unterhalten. Da dachte ich, nun, dann wird es was Lustiges sein und
vielleicht auch Warinka gefallen. Und so nahm ich es und schickte es
Ihnen.
Aber nun hat mir Ratasäjeff versprochen, mir etwas wirklich
Literarisches zum Lesen zu verschaffen. Da werden Sie also wieder gute
Bücher erhalten, mein Kind. Ratasäjeff – der versteht sich darauf! Er
schreibt doch selbst, und wie er schreibt! Gewandt schreibt er, und
einen Stil hat er, ich sage Ihnen: einfach großartig! In jedem Wort ist
ein Etwas – sogar im allergewöhnlichsten, alltäglichsten Wort, in jedem
einfachen Satz, in der Art, wie ich zum Beispiel manchmal Faldoni oder
Theresa etwas sage, – selbst da versteht er noch, sich stilvoll
auszudrücken. Ich wohne jetzt seinen literarischen Abenden regelmäßig
bei. Wir rauchen Tabak und er liest uns vor, liest bis fünf Stunden in
einem durch, wir aber hören zu, die ganze Zeit. Das sind nun einfach
Perlen, nicht Literatur! Einfach Blumen, duftende Blumen – auf jeder
Seite so viel Blumen, daß man einen Strauß draus winden kann! Und im
Umgang ist er so freundlich, so liebenswürdig. Was bin ich im Vergleich
mit ihm, nun was? – Nichts! Er ist ein angesehener Mann, ein Mann von
Ruf – was aber bin ich? – Nichts! So gut wie nichts, bin neben ihm
überhaupt nichts! Er aber beehrt auch mich mit seinem Wohlwollen. Ich
habe für ihn mal das eine oder andere abgeschrieben. Nur denken Sie
deshalb nicht, Warinka, daß das irgend etwas auf sich habe, ich meine,
daß er mir deshalb wohlgesinnt sei, weil ich für ihn abschreibe! Hören
Sie nicht auf solche Klatschgeschichten, Kind, glauben Sie ihnen nicht,
beachten Sie sie gar nicht weiter! Nein, ich tue es ganz aus freien
Stücken, um ihm damit etwas Angenehmes zu erweisen. Und daß er mir sein
Wohlwollen schenkt, das tut er auch nur aus freien Stücken, tut’s, um
mir eine Freude zu bereiten. Ich bin gar nicht so dumm, um das nicht zu
verstehen: man muß nur wissen, welch ein Zartgefühl sich dahinter birgt.
Er ist ein guter, ein sehr guter Mensch und außerdem ein ganz
unvergleichlicher Schriftsteller.
Es ist eine schöne Sache um die Literatur, Warinka, eine sehr schöne,
das habe ich vorgestern bei ihnen erfahren. Und zugleich eine tiefe
Sache! Sie stärkt und festigt und belehrt die Menschen – und noch
verschiedenes andere tut sie, was alles in ihrem Buch aufgezeichnet
steht. Es ist wirklich gut geschrieben! Die Literatur – das ist ein
Bild, das heißt in gewissem Sinne, versteht sich; ein Bild und ein
Spiegel; ein Spiegel der Leidenschaften und aller inneren Dinge; sie ist
Belehrung und Erbauung zugleich, ist Kritik und ein großes menschliches
Dokument. Das habe ich mir alles von ihnen sagen lassen und aus ihren
Reden gemerkt. Ich will aufrichtig gestehen, mein Liebling, wenn man so
unter ihnen sitzt und zuhört – und man raucht dabei sein Pfeifchen, ganz
wie sie – und wenn sie dann anfangen, sich gegenseitig zu messen und
über die verschiedensten Dinge zu disputieren, da muß ich denn einfach
wie im Kartenspiel sagen: – ich passe. Denn wenn die erst mal loslegen,
Kind, dann bleibt unsereinem nichts anderes übrig, dann müssen wir beide
passen, Warinka. Ich sitze dann wie ein alter Erzschafskopf und schäme
mich vor mir selber. Und wenn man sich auch den ganzen Abend die größte
Mühe gibt, irgendwo ein halbes Wörtchen in das allgemeine Gespräch mit
einzuflechten, so ist man doch nicht einmal dazu fähig. Man kann und
kann dieses halbe Wörtchen nicht finden! Man verfällt aber auch auf rein
gar nichts – man mag’s anstellen wie man will! Das ist wie verhext,
Warinka, und man tut sich schließlich selber leid, daß man so ist, wie
man nun einmal ist, und daß man das Sprichwort auf sich anwenden kann:
dumm geboren und im Leben nichts dazugelernt.
Was tue ich denn jetzt in meiner freien Zeit? – Schlafe, schlafe wie ein
alter Esel. An Stelle dieses unnützen Schlafens aber könnte man sich
doch auch mit etwas Angenehmem oder Nützlichem beschäftigen, so zum
Beispiel sich hinsetzen und dies und jenes schreiben, so ganz frei von
sich aus, – was? Sich selbst zu Nutz und Frommen und anderen zum
Vergnügen. Und hören Sie nur, Kind, wieviel sie für ihre Sachen
bekommen, Gott verzeihe ihnen! Da zum Beispiel gleich dieser Ratasäjeff,
was der Mann einnimmt! Was ist es für ihn, einen Bogen vollzuschreiben?
An manchen Tagen hat er sogar ganze fünf geschrieben, und dabei erhält
er, wie er sagt, volle dreihundert Rubel für jeden Bogen! Da hat er
irgend so eine kleine Geschichte oder Humoreske, oder auch nur irgendein
Anekdotchen oder sonst etwas für die Leute – fünfhundert, gib oder gib
nicht, aber darunter kriegst du es für keinen Preis. Häng dich auf, wenn
du willst. Willst du nicht – nun gut, dann gibt ein anderer tausend! Was
sagen Sie dazu, Warwara Alexejewna?
Aber was, das ist noch gar nichts! Da hat er zum Beispiel ein Heftchen
Gedichte, alles solche kleinen Dingerchen – paar Zeilen nur, ganz kurz,
– siebentausend, Kind, siebentausend will er dafür haben, denken Sie
sich! Das ist doch ein Vermögen, groß wie ein ganzes Besitztum, das sind
ja die Prozente eines Hauses von fünf Stockwerken! Fünftausend, sagt er,
biete man ihm: er geht aber darauf nicht ein. Ich habe ihm zugeredet und
vernünftig auf ihn eingesprochen, – nehmen Sie doch, Bester, die
fünftausend, nehmen Sie sie nur, und dann können Sie ihnen ja den Rücken
kehren und ausspeien, wenn Sie wollen, denn fünftausend – das ist doch
Geld! Aber nein, er sagt, sie werden auch sieben geben, die Schufte.
Solch ein Schlaukopf ist er, wirklich!
Ich werde Ihnen, mein Kind, da nun einmal davon die Rede ist, eine
Stelle aus den „Italienischen Leidenschaften“ abschreiben. So heißt
nämlich eines seiner Werke. Nun lesen Sie, Warinka, und dann urteilen
Sie selbst:
– ... Wladimir fuhr zusammen: die Leidenschaften brausten wild in ihm
auf und sein Blut geriet in Wallung ...
„Gräfin,“ rief er, „Gräfin! Wissen Sie, wie schrecklich diese
Leidenschaft, wie grenzenlos dieser Wahnsinn ist? Nein, meine Sinne
täuschen mich nicht! Ich liebe, ich liebe mit aller Begeisterung, liebe
rasend, wahnsinnig! Das ganze Blut deines Mannes würde nicht ausreichen,
die wallende Leidenschaft meiner Seele zu ersticken! Diese kleinen
Hindernisse sind unfähig, das allesvernichtende, höllische Feuer, das in
meiner erschöpften Brust loht, in seinem Flammenstrom aufzuhalten. O
Sinaida, Sinaida! ...“
„Wladimir!“ ... flüsterte die Gräfin fassungslos und schmiegte ihr Haupt
an seine Schulter.
„Sinaida!“ rief Ssmelskij berauscht.
Seiner Brust entrang sich ein Seufzer. Auf dem Altar der Liebe schlug
die Lohe hellflammend auf und umfing mit ihrer Glut die Seelen der
Liebenden.
„Wladimir!“ flüsterte die Gräfin trunken. Ihr Busen wogte, ihre Wangen
röteten sich, ihre Augen glühten ...
Der neue, schreckliche Bund ward geschlossen!
* * * * *
Nach einer halben Stunde trat der alte Graf in das Boudoir seiner Frau.
„Wie wäre es, mein Herzchen, soll man nicht für unseren teuren Gast den
Ssamowar aufstellen lassen?“ fragte er, seiner Frau die Wange
tätschelnd. –
Nun sehen Sie, Kind, wie finden Sie das? Es ist ja wahr, – es ist ein
wenig frei, das läßt sich nicht leugnen, aber dafür doch schwungvoll und
gut geschrieben. Was gut ist, ist gut! Aber nein, ich muß Ihnen doch
noch ein Stückchen aus der Novelle „Jermak und Suleika“ abschreiben.
Stellen Sie sich vor, Kind, daß der Kosak Jermak, der tollkühne Eroberer
Sibiriens, in Suleika, die Tochter des sibirischen Herrschers Kutschum,
die er gefangen genommen, verliebt ist. Die Sache spielt also gerade in
der Zeit, da Iwan der Schreckliche herrschte – wie Sie sehen. Hier
schreibe ich Ihnen nun ein Gespräch zwischen Jermak und Suleika ab:
– „Du liebst mich, Suleika? O, wiederhole, wiederhole es! ...“
„Ich liebe dich, Jermak!“ flüsterte Suleika.
„Himmel und Erde, habt Dank! Ich bin glücklich! Ihr habt mir alles
gegeben, alles, wonach mein wilder Geist seit meinen Jünglingsjahren
strebte! Also hierher hast du mich geführt, mein Leitstern, über den
steinernen Gürtel des Ural! Der ganzen Welt werde ich meine Suleika
zeigen, und die Menschen, diese wilden Ungeheuer, werden es nicht wagen,
mich zu beschuldigen! O, wenn sie doch diese geheimen Leiden ihrer
zärtlichen Seele verständen, wenn sie, wie ich, in einer Träne meiner
Suleika eine ganze Welt von Poesie zu erblicken wüßten! O, laß mich mit
Küssen diese Träne trinken, diesen himmlischen Tautropfen ... du
himmlisches Wesen!“
„Jermak,“ sagte Suleika, „die Welt ist böse, die Menschen sind
ungerecht! Sie werden uns verfolgen und verurteilen, mein Liebster! Was
soll das arme Mädchen, das auf den heimatlichen Schneefeldern Sibiriens
in der Jurte des Vaters aufgewachsen ist, dort in eurer kalten, eisigen,
seelenlosen, eigennützigen Welt anfangen? Die Menschen werden mich nicht
verstehen, mein Geliebter, mein Ersehnter!“
„Dann sollen sie Kosakensäbel kennen lernen!“ rief Jermak, wild die
Augen rollend. –
Und nun, Warinka, denken Sie sich diesen Jermak, wie er erfährt, daß
seine Suleika ermordet ist. Der verblendete Greis Kutschum hat sich im
Schutz der nächtlichen Dunkelheit während der Abwesenheit Jermaks in
dessen Zelt geschlichen und seine Tochter Suleika ermordet, um sich an
Jermak, der ihn um Zepter und Krone gebracht hat, zu rächen.
„Welch eine Lust, die Klinge zu schleifen!“ rief Jermak in wilder
Rachgier, und er wetzte den Stahl am Schamanenstein. „Ich muß Blut
sehen, Blut! Rächen, rächen, rächen muß ich sie!!!“
Aber nach alledem kann Jermak seine Suleika doch nicht überleben, er
wirft sich in den Irtysch und ertrinkt, und damit ist dann alles zu
Ende.
Jetzt noch ein kleiner Auszug, eine Probe: es ist humoristisch, was nun
kommt, und nur so zum Lachen geschrieben:
– „Kennen Sie denn nicht Iwan Prokofjewitsch Sheltopus? Na, das ist doch
derselbe, der den Prokofij Iwanowitsch ins Bein gebissen hat! Iwan
Prokofjewitsch ist ein schroffer Charakter, dafür aber ein selten
tugendhafter Mensch. Prokofij Iwanowitsch dagegen liebt außerordentlich
Rettich mit Honig. Als er aber noch mit Pelageja Antonowna bekannt war
... Sie kennen doch Pelageja Antonowna? Na, das ist doch dieselbe, die
ihren Rock immer mit dem Futter nach außen anzieht, um das Oberzeug zu
schonen.“ –
Ist das nicht Humor, Warinka, einfach Humor! Wir wälzten uns vor Lachen,
als er uns dies vorlas. Solch ein Mensch, wahrhaftig, Gott verzeihe ihm!
Übrigens, Kind, ist das zwar recht originell und komisch, aber im Grunde
doch ganz unschuldig, ganz ohne die geringste Freidenkerei und ohne alle
liberalen Verirrungen. Ich muß Ihnen auch noch sagen, daß Ratasäjeff
vortreffliche Umgangsformen besitzt, und vielleicht liegt hier mit ein
Grund, warum er ein so ausgezeichneter Schriftsteller ist, und mehr als
das, was die anderen sind.
Aber wie wär’s – in der Tat, es kommt einem mitunter der Gedanke in den
Kopf – wie wär’s, wenn auch ich einmal etwas schriebe: was würde dann
wohl geschehen? Nun, sagen wir zum Beispiel, und nehmen wir an, daß
plötzlich mir nichts dir nichts ein Buch in der Welt erschiene und auf
dem Deckel stände: „_Gedichte von Makar Djewuschkin._“ Was?! Ja, was
würden Sie dann wohl sagen, mein Engelchen? Wie würde Ihnen das
vorkommen, was würden Sie dabei denken? Von mir aus kann ich Ihnen
freilich sagen, mein Kind, daß ich mich, sobald mein Buch erschienen
wäre, entschieden nicht mehr auf dem Newskij zu zeigen wagte. Wie wäre
denn das, wenn ein jeder sagen könnte: „Sieh, dort geht der Dichter
Djewuschkin!“ und ich selbst dieser Djewuschkin wäre!?
Was würde ich dann zum Beispiel bloß mit meinen Stiefeln machen? Die
sind ja doch bei mir, nebenbei bemerkt, Kind, fast immer geflickt, und
auch die Sohlen sind, wenn man die Wahrheit sagen soll, oft recht weit
vom wünschenswerten Zustande entfernt. Nun, wie wäre denn das, wenn alle
wüßten, daß der Schriftsteller Djewuschkin geflickte Stiefel hat! Wenn
das nun gar irgendeine Komtesse oder Duchesse erführe, was würde sie
dazu sagen, mein Seelchen? Selbst würde sie es ja vielleicht nicht
bemerken, denn Komtessen und Duchessen beschäftigen sich nicht mit
Stiefeln, und nun gar mit Beamtenstiefeln (aber schließlich bleiben ja
Stiefel immer Stiefel), – nur würde man ihr alles erzählen, meine
eigenen Freunde würden es womöglich tun! Ratasäjeff zum Beispiel wäre
der erste, der es fertig brächte! Er ist oft bei der Gräfin B., besucht
sie, wie er sagt, sogar ohne besondere Einladung, wann es ihm gerade
paßt. Eine gute Seele, sagt er, soll sie sein, so eine literarisch
gebildete Dame. Ja, dieser Ratasäjeff ist ein Schlaukopf!
Doch übrigens – genug davon! Ich schreibe das ja alles nur so, mein
Engelchen, um Sie zu zerstreuen, also nur zum Scherz. Leben Sie wohl,
mein Täubchen. Viel habe ich Ihnen hier zusammengeschrieben, aber das
eigentlich nur deshalb, weil ich heute ganz besonders froh gestimmt bin.
Wir speisten nämlich heute alle bei Ratasäjeff, und da (es sind ja doch
Schlingel, mein Kind!) holten sie schließlich solch einen besonderen
Likör hervor ... na – was soll man Ihnen noch viel davon schreiben! Nur
sehen Sie zu, daß Sie jetzt nicht gleich etwas Schlechtes von mir
denken, Warinka. Es war nicht so schlimm! Büchelchen werde ich Ihnen
schicken. Hier geht ein Roman von Paul de Kock von Hand zu Hand, nur
werden Sie diesen Paul de Kock nicht in die Fingerchen bekommen, mein
Kind ... Nein, nein, Gott behüte! Solch ein Paul de Kock ist nichts für
Sie, Warinka. Man sagt von ihm, daß er bei allen anständigen
Petersburger Kritikern ehrliche Entrüstung hervorgerufen habe.
Ich sende Ihnen noch ein Pfündchen Konfekt – habe es speziell für Sie
gekauft. Und hören Sie, mein Herzchen, bei jedem Konfektchen denken Sie
an mich. Nur dürfen Sie die Bonbons nicht gleich zerbeißen! Lutschen Sie
sie nur so, sonst könnten Ihnen noch die Zähnchen nachher wehtun. Aber
vielleicht lieben Sie auch Schokolade? Dann schreiben Sie nur!
Nun, leben Sie wohl, leben Sie wohl. Christus sei mit Ihnen, mein
Täubchen. Ich aber verbleibe nach wie vor
Ihr treuester Freund
Makar Djewuschkin.
27. Juni.
Lieber Makar Alexejewitsch!
Fedora sagt, sie kenne Leute, die mir in meiner Lage herzlich gern
helfen und, wenn ich nur wolle, eine sehr gute Stelle als Gouvernante in
einem Hause verschaffen würden. Was meinen Sie, mein Freund, soll ich
darauf eingehen? Ich würde Ihnen dann nicht mehr zur Last fallen – und
die Stelle scheint gut zu sein. Aber anderseits – der Gedanke ist doch
etwas beängstigend, in einem fremden Hause dienen zu müssen. Es soll
eine Gutsbesitzersfamilie sein. Da werden sie über mich Erkundigungen
einziehen, werden mich ausfragen, was soll ich ihnen dann sagen? Und
überdies bin ich so menschenscheu und liebe die Einsamkeit. Am liebsten
lebe ich dort, wo ich mich einmal eingelebt habe. Es ist nun einmal
gemütlicher und trauter in dem Winkel, an den man sich schon gewöhnt
hat, – und wenn man vielleicht auch in Sorgen dort lebt, es ist dennoch
besser. Außerdem müßte ich da noch reisen, und Gott weiß, was sie alles
von mir verlangen werden: vielleicht lassen sie mich einfach die Kinder
warten! Und was mögen das für Leute sein, wenn sie jetzt binnen zwei
Jahren schon zum dritten Male die Gouvernante wechseln? Raten Sie mir,
Makar Alexejewitsch, um Gottes willen, soll ich darauf eingehen oder
soll ich nicht?
Weshalb kommen Sie jetzt gar nicht mehr zu uns? Sie zeigen sich so
selten! Außer Sonntags in der Kirche sehen wir uns ja fast überhaupt
nicht mehr. Wie menschenscheu Sie doch sind! Sie sind ganz wie ich! Aber
wir sind ja auch so gut wie verwandt. Oder lieben Sie mich nicht mehr,
Makar Alexejewitsch? Ich bin, wenn ich mich allein weiß, oft sehr
traurig. Zuweilen, namentlich in der Dämmerung, sitzt man ganz
mutterseelenallein: Fedora ist fortgegangen, um irgend etwas zu
besorgen, und da sitzt man denn und denkt und denkt – man erinnert sich
an alles was einst gewesen ist, an Frohes und Trauriges, alles zieht wie
ein Nebel an einem vorüber. Bekannte Gesichter tauchen wieder vor meinen
Augen auf (ich glaube sie fast schon im Wachen zu sehen, wie man sonst
nur im Traum etwas sieht), – doch am häufigsten sehe ich Mama ... Und
was für Träume ich habe! Ich fühle es, daß meine Gesundheit untergraben
ist. Ich bin so schwach. Als ich heute morgen aufstand, wurde mir übel,
und zum Überfluß habe ich auch noch diesen schlimmen Husten! Ich fühle,
ich weiß, daß ich bald sterben werde. Wer wird mich wohl beerdigen? Wer
wird wohl meinem Sarge folgen? Wer wird um mich trauern? ... Und da
müßte ich vielleicht an einem fremden Ort, in einem fremden Hause, bei
fremden Menschen sterben! ... Mein Gott, wie traurig ist es, zu leben,
Makar Alexejewitsch!
Lieber Freund, warum schicken Sie mir immer Konfekt? Ich begreife
wirklich nicht, woher Sie soviel Geld nehmen. Ach, mein guter Freund,
sparen Sie doch das Geld, um Gottes willen, sparen Sie es! Fedora hat
einen Käufer gefunden für den Teppich, den ich genäht habe. Man will für
ihn fünfzehn Rubel geben. Das wäre sehr gut bezahlt: ich dachte, man
würde weniger geben. Fedora wird drei Rubel bekommen, und für mich werde
ich einen Stoff zu einem einfachen Kleide kaufen, irgendeinen billigeren
und wärmeren Kleiderstoff. Für Sie aber werde ich eine Weste machen, ein
schöne Weste: ich werde guten Stoff dazu aussuchen und sie selbst nähen.
Fedora hat mir ein Buch verschafft – Bjelkins Erzählungen –, das ich
Ihnen hiermit zusende, damit auch Sie es lesen. Nur, bitte, schonen Sie
es und behalten Sie es nicht zu lange: es gehört nicht mir. Es ist ein
Werk von Puschkin. Vor zwei Jahren las ich es mit Mama – da hat es denn
in mir traurige Erinnerungen wachgerufen, als ich es jetzt zum zweiten
Male las. Sollten Sie irgendein Buch haben, so schicken Sie es mir, –
aber nur in dem Fall, wenn Sie es nicht von Ratasäjeff erhalten haben.
Er wird gewiß eines seiner eigenen Werke geben, wenn überhaupt schon
etwas von ihm gedruckt sein sollte. Wie können Ihnen nur seine Romane
gefallen, Makar Alexejewitsch? Solche Dummheiten! ...
Nun, leben Sie wohl! Wie viel ich diesmal geschwätzt habe! Wenn ich mich
bedrückt fühle, dann bin ich immer froh, sprechen zu können. Das ist die
beste Arznei: ich fühle mich sogleich erleichtert, namentlich wenn ich
alles sagen kann, was ich auf dem Herzen habe.
Leben Sie wohl, leben Sie wohl, mein Freund!
Ihre
W. D.
28. Juni.
Warwara Alexejewna, meine Liebe!
Nun ist’s genug mit dem Grämen! Schämen Sie sich denn nicht? So machen
Sie doch ein Ende, mein Kind! Wie können Sie sich nur mit solchen
Gedanken abgeben? Sie sind ja gar nicht mehr krank, Herzchen, ganz und
gar nicht! Sie blühen einfach, wirklich, glauben Sie mir: nur ein wenig
bleich sind Sie noch, aber trotzdem blühen Sie. Und was sind denn das
für Träume und Gespenster, die Sie da sehen! Pfui, schämen Sie sich,
mein Liebling, lassen Sie es sein, wie es ist! Kümmern Sie sich nicht
weiter um diese dummen Träume – so etwas schüttelt man ab. Ganz einfach!
Wie kommt es denn, daß ich gut schlafe? Warum fehlt mir denn nichts?
Sehen Sie mich einmal an, mein Kind. Lebe froh und zufrieden, schlafe
ruhig, bin gesund – mit einem Wort, ein Teufelskerl: und man hat seine
wahre Freude daran, es zu sein! Also hören Sie auf, mein Seelchen,
schämen Sie sich und bessern Sie sich. Ich kenne doch Ihr Köpfchen,
Kind: kaum hat es etwas gefunden, da fängt es gleich wieder an mit dem
Grübeln und Grämen, und Sie machen sich von neuem allerlei Gedanken.
Schon allein mir zuliebe sollten Sie doch wirklich einmal damit
aufhören, Warinka!
Bei fremden Menschen dienen? – Niemals! Nein und nein und nochmals nein!
Was ist Ihnen eingefallen, daß Sie überhaupt auf solche Gedanken kommen?
Und noch dazu wegreisen! Nein, Kind da kennen Sie mich schlecht: das
lasse ich nie und nimmermehr zu, einen solchen Plan bekämpfe ich mit
allen Kräften. Und wenn ich auch meinen letzten alten Rock vom Leibe
verkaufen – wenn mir nur noch das Hemd bleiben würde, aber Not leiden,
das sollen und werden Sie bei uns niemals. Nein, Warinka, nein, ich
kenne Sie ja! Das sind Torheiten, nichts als Torheiten! Was aber wahr
ist, das ist: daß an allem Fedora ganz allein die Schuld trägt – nur
sie, dies dumme Frauenzimmer, hat Ihnen diese Gedanken in den Kopf
gesetzt. Sie aber, Kind, müssen gar nicht darauf hören, was sie sagt.
Sie wissen wahrscheinlich noch nicht alles, mein Seelchen? ... Wissen
nicht, daß sie eine dumme, schwatzhafte, unzurechnungsfähige Person ist,
die auch ihrem verstorbenen Mann schon das Leben weidlich sauer gemacht
hat. Überlegen Sie sich: hat sie Sie nicht geärgert, irgendwie gekränkt?
Nein, nein, mein Kind, aus all dem, was Sie da schrieben, wird nichts!
Und was sollte denn aus mir werden, wo bliebe ich dann? Nein, Warinka,
mein Herzchen, das müssen Sie sich aus dem Köpfchen schlagen. Was fehlt
Ihnen denn bei uns? Wir können uns nicht genug über Sie freuen und auch
Sie haben uns gern, also bleiben Sie und leben Sie hier friedlich
weiter. Nähen Sie oder lesen Sie, oder nähen Sie auch nicht – ganz wie
Sie wollen, nur bleiben Sie bei uns! Denn sonst, sagen Sie doch selbst:
wie würde das denn aussehen? Ich werde Ihnen Bücher verschaffen – und
dann können wir ja auch wieder einmal einen Spaziergang unternehmen. Nur
müssen Sie, mein Kind, mit diesen Gedanken jetzt wirklich ein Ende
machen und vernünftig werden und sich nicht grundlos um alles
Alltägliche sorgen und grämen! Ich werde zu Ihnen kommen, und zwar sehr
bald, inzwischen aber nehmen Sie es als mein gerades und offenes
Bekenntnis: das war nicht schön von Ihnen, Herzchen, gar nicht schön!
Ich bin natürlich kein gelehrter Mensch und ich weiß es selbst, daß ich
nichts gelernt habe, daß ich kaum unterrichtet worden bin, aber darum
handelt es sich jetzt nicht und das war es auch nicht, was ich sagen
wollte – doch für den Ratasäjeff stehe ich ein, da machen Sie, was Sie
wollen! Er ist mein Freund, deshalb muß ich ihn verteidigen. Er schreibt
gut, schreibt sehr, sehr und nochmals sehr gut. Ich kann Ihnen unter
keinen Umständen beistimmen. Er schreibt farbenreich und gewählt, es
sind auch Gedanken darin, kurz, es ist sehr schön! Sie haben es
vielleicht ohne Anteil gelesen, Warinka, vielleicht waren Sie gerade
nicht bei Laune, als Sie lasen, vielleicht hatten Sie sich gerade über
Fedora wegen irgend etwas geärgert, oder es ist vielleicht sonst
irgendwie ein Unglückstag für Sie gewesen.
Nein, Sie müssen das einmal mit Gefühl lesen und aufmerksam, wenn Sie
froh und zufrieden und bei guter Laune sind, zum Beispiel wenn Sie
gerade ein Konfektchen im Munde haben – dann lesen Sie es noch einmal.
Ich will ja nicht sagen (wer hat denn das behauptet?), daß es nicht noch
bessere Schriftsteller gibt als Ratasäjeff, ganz gewiß, es gibt bessere,
aber deshalb braucht doch Ratasäjeff noch lange nicht schlecht zu sein:
sie sind eben alle gut; er schreibt gut und die anderen schreiben
meinetwegen auch gut. Außerdem schreibt er, vergessen wir das nicht, nur
für sich – tut es, sagen wir, bloß so in seinen Mußestunden – und das
merkt man ihm dann an, daß er es tut, und zwar zu seinem Vorteil!
Nun leben Sie wohl, mein Kind, schreiben werde ich heute nicht mehr: ich
habe da noch etwas abzuschreiben und muß mich beeilen. Also sehen Sie
zu, mein Liebling, mein Herzchen, daß Sie sich beruhigen. Möge Gott der
Herr Sie behüten, ich aber bin und bleibe
Ihr treuer Freund
Makar Djewuschkin.
P. S. Danke für das Buch, meine Gute, also lesen wir Puschkin. Heute
aber komme ich gegen Abend ganz bestimmt zu Ihnen.
Mein teurer Makar Alexejewitsch!
Nein, mein Freund, nein, es geht nicht, daß ich noch länger hier lebe.
Ich habe nachgedacht und eingesehen, daß es sehr falsch von mir ist,
eine so vorteilhafte Stelle von der Hand zu weisen. Dort werde ich mir
doch wenigstens mein sicheres Stück Brot verdienen. Ich werde mir Mühe
geben, ich werde versuchen, mir die Neigung der fremden Menschen zu
erwerben, und, wenn es nötig sein sollte, auch meinen Charakter zu
ändern. Es ist natürlich schwer und bitter, bei fremden Menschen zu
leben, sich ihnen in allem anzupassen, sich selbst zu verleugnen und von
ihnen abhängig zu sein, aber Gott wird mir sicher helfen. Man kann doch
nicht sein Leben lang menschenfern bleiben! Und ich habe ja auch früher
schon Ähnliches erlebt. Zum Beispiel als ich noch in der Pension war.
Den ganzen Sonntag spielte ich und sprang munter wie ein echter Wildfang
umher, und wenn Mama bisweilen auch schalt – was tat das, ich war doch
froh, und im Herzen war es so hell und warm. Kam aber dann der Abend, da
fühlte ich mich wieder über alle Maßen unglücklich: um neun Uhr hieß es
– nach der Pension zurückkehren! Dort war alles fremd, kalt, streng, die
Lehrerinnen waren Montags immer so mürrisch, und ich fühlte mich so
bedrückt, so elend, daß die Tränen sich nicht mehr zurückdrängen ließen.
Da schlich ich denn leise in einen Winkel und weinte vor lauter
Einsamkeit und Verlassenheit. Natürlich hieß es dann, ich sei faul und
wolle nicht lernen. Und doch war das gar nicht der Grund, weshalb ich
weinte.
Dann aber – womit endete es? Ich gewöhnte mich schließlich an alles, und
als ich die Pension verlassen mußte, weinte ich gar beim Abschied von
den Freundinnen.
Nein, es ist nicht gut, daß ich Ihnen und Fedora hier zur Last bin. Der
Gedanke ist mir eine Qual. Ich sage Ihnen alles ganz offen, weil ich
gewohnt bin, Ihnen nichts zu verhehlen. Sehe ich denn nicht, wie Fedora
jeden Morgen schon in aller Frühe aufsteht und sich ans Waschen macht,
und dann bis in die späte Nacht hinein arbeitet? – Alte Knochen aber
bedürfen der Ruhe. Und sehe ich denn nicht, wie Sie alles für mich
opfern, wie Sie sich selbst das Notwendigste versagen, um Ihr ganzes
Geld nur für mich auszugeben? Ich weiß doch, daß das über Ihre
Verhältnisse geht, mein Freund. Sie schreiben mir, daß Sie eher das
Letzte verkaufen würden, als daß Sie mich Not leiden ließen. Ich glaube
es Ihnen, mein Freund, ich weiß, daß Sie ein gutes Herz haben, – doch
das sagen Sie jetzt nur so. Jetzt haben Sie zufällig überflüssiges Geld,
haben ganz unerwartet eine Gratifikation erhalten. Aber dann? Sie wissen
doch – ich bin immer krank. Ich kann nicht so arbeiten, wie Sie, obschon
ich froh wäre, wenn ich’s könnte, und überdies habe ich auch nicht immer
Arbeit. Was soll ich tun? Mich grämen und quälen, indem ich Sie und
Fedora für mich sorgen lasse und selbst müßig zusehen muß? Wie könnte
ich Ihnen jemals auch nur das Geringste entgelten, wie Ihnen auch nur im
geringsten nützlich sein? Inwiefern bin ich Ihnen denn so unentbehrlich,
mein Freund? Was habe ich Ihnen Gutes getan? Ich bin Ihnen nur von
ganzem Herzen zugetan, ich liebe Sie aufrichtig und von ganzem Herzen,
doch das ist auch alles, was ich tun kann. So ist es nun einmal mein
bitteres Geschick! Zu lieben verstehe ich – aber Gutes tun, Ihre
Wohltaten durch meine Taten erwidern, das kann ich nicht. Also halten
Sie mich nicht mehr zurück, überlegen Sie sich meinen Plan nochmals
gründlich und sagen Sie mir dann Ihre aufrichtige Meinung.
In Erwartung derselben verbleibe ich
Ihre
W. D.
1. Juli.
Unsinn, Warinka, das ist ja alles nichts als Unsinn, reiner Unsinn!
Wollte man Sie so sich selbst überlassen, was würden Sie sich da nicht
alles ins Köpfchen setzen! Bald bilden Sie sich dieses ein, bald jenes!
Ich sehe doch, daß das nichts als Unsinn ist. Was fehlt Ihnen denn bei
uns, so sagen Sie doch bloß? Wir lieben Sie und Sie lieben uns, wir sind
alle zufrieden und glücklich, – was will man denn noch mehr? Was aber
wollen Sie wohl unter fremden Menschen anfangen? Sie wissen noch nicht,
was das heißt: fremde Menschen! ... Nein, da müssen Sie mich fragen,
denn ich – ich kenne den fremden Menschen und kann Ihnen sagen, wie er
ist. Ich kenne ihn, Kind, kenne ihn nur zu gut. Ich habe sein Brot
gegessen. Bös ist er, Warinka, sehr böse, so böse, daß das kleine Herz,
das man hat, nicht mehr standhalten kann, so versteht er es, einen mit
Vorwürfen und Zurechtweisungen und unzufriedenen Blicken zu martern. –
Bei uns haben Sie es wenigstens warm und gut, wie in einem Nestchen
haben Sie sich hier eingelebt. Wie können Sie uns nun mit einem Male so
etwas antun wollen? Was werde ich denn ohne Sie anfangen? Sie sollten
mir nicht unentbehrlich sein? Nicht nützlich? Wieso denn nicht nützlich?
Nein, Kind, denken Sie mal selbst etwas nach und dann urteilen Sie,
inwiefern Sie mir nicht nützlich sein sollten! Sie sind mir sehr, sogar
sehr nützlich, Warinka. Sie haben, wissen Sie, solch einen wohltuenden
Einfluß auf mich ... Da denke ich jetzt zum Beispiel an Sie und bin ohne
weiteres froh gestimmt ... Ich schreibe Ihnen hin und wieder einen
Brief, in dem ich alle meine Gefühle ausdrücke, und erhalte darauf eine
ausführliche Antwort von Ihnen. Kleiderchen und ein Hütchen habe ich für
Sie gekauft, manchmal haben Sie auch einen kleinen Auftrag für mich, na,
und dann besorge ich Ihnen eben das Nötige ... Nein, wie sollten Sie
denn nicht nützlich sein? Und was soll ich wohl ohne Sie anfangen in
meinen Jahren, wozu würde ich allein denn noch taugen? Sie haben
vielleicht noch nicht darüber nachgedacht, Warinka, aber denken Sie mal
wirklich darüber nach und fragen Sie sich, zu was ich denn noch taugen
könnte ohne Sie. Ich habe mich an Sie gewöhnt, Warinka. Und was käme
denn dabei heraus, was wäre das Ende vom Liede? – Ich würde in die Newa
gehen und damit wäre die Geschichte erledigt. Nein, wirklich, Warinka,
was bliebe mir denn ohne Sie noch zu tun übrig?!
Ach, Herzchen, Warinka! Da sieht man’s, Sie wollen wohl, daß mich ein
Lastwagen nach dem Wolkoff-Friedhof führt, daß irgendeine alte
Herumtreiberin meinem Sarge folgt und daß man mich dort in der Gruft mit
Erde zuschüttet und dann fortgeht und mich allein zurückläßt. Das ist
sündhaft von Ihnen, sündhaft, mein Kind! Wirklich sündhaft, bei Gott,
sündhaft!
Ich sende Ihnen Ihr Büchelchen zurück, meine kleine Freundin, und wenn
Sie, Warinka, meine Meinung über dasselbe wissen wollen, so kann ich
Ihnen nur sagen, daß ich mein Lebtag noch kein einziges so gutes Buch zu
lesen bekommen habe. Ich frage mich jetzt selbst, mein Kind, wie ich
denn bisher so habe leben können, ein wahrer Tölpel, Gott verzeihe mir!
Was habe ich denn getan, mein Leben lang? Aus welchem Walde komme ich
eigentlich? Ich weiß ja doch nichts, mein Kind, rein gar nichts! Ich
gestehe es Ihnen ganz offen, Warinka: ich bin kein gelehrter Mensch. Ich
habe bisher nur wenig gelesen, sehr wenig, fast nichts. „Das Bild des
Menschen“ – ein sehr kluges Buch, das habe ich gelesen, dann noch ein
anderes: „Vom Knaben, der mit Glöckchen verschiedene Stücke spielt“, und
dann „Die Kraniche des Ibykus“. Das ist alles, weiter habe ich nichts
gelesen. Jetzt aber habe ich hier, in Ihrem Büchlein, den
„Stationsaufseher“ gelesen, und da kann ich Ihnen nur sagen, mein Kind,
es kommt doch vor, daß man so lebt und nicht weiß, daß da neben einem
ein Buch liegt, in dem ein ganzes Leben dargestellt ist, wie an den
Fingern hergezählt, und noch mancherlei, worauf man früher selbst gar
nicht verfallen ist. Das findet man nun hier, wenn man solch ein
Büchlein zu lesen anfängt, und da fällt einem denn nach und nach vieles
ein, und allmählich begreift man so manches und wird sich über die Dinge
klar. Und dann, sehen Sie, warum ich Ihr Büchlein noch lieb gewonnen
habe: manches Werk, was für eines es auch immer sein mag, das liest man
und liest – aber lies meinetwegen, bis dein Schädel platzt, bloß das
Verstehen, daran fehlt’s leider! Es ist eben so vertrackt geschrieben
und mit soviel Klugheit, daß man es nicht recht begreifen kann. Ich zum
Beispiel, – ich bin dumm, ich bin von Natur stumpf, bin schon so
geboren, also kann ich auch keine allzu hohen Werke lesen. Dies aber –
ja dies liest man und es ist einem fast, als hätte man es selber
geschrieben, ganz als stamme es aus dem eigenen Herzen ... Ja, und so
mag es auch sein: das Herz, das ist einfach festgenommen und vor allen
Menschen umgekehrt, das Inwendige nach außen, und dann ausführlich
beschrieben – sehen Sie, so ist es! Und dabei ist es doch so einfach,
mein Gott! Ja was! Ich könnte das ja gleichfalls schreiben, wirklich,
warum denn nicht? Fühle ich doch ganz dasselbe und genau so, wie es in
diesem Büchelchen steht! Habe ich mich doch auch mitunter in ganz
derselben Lage befunden, wie beispielsweise dieser Ssamsson Wyrin,
dieser Arme! Und wie viele solcher Ssamsson Wyrins gibt es nicht unter
uns, ganz genau so arme, herzensgute Menschen! Und wie richtig alles
beschrieben ist! Mir kamen fast die Tränen, mein Kind, während ich das
las: wie er sich bis zur Bewußtlosigkeit betrank, als das Unglück ihn
heimgesucht hatte, und wie er dann den ganzen Tag unter seinem
Schafspelz schlief und das Leid mit einem Pünschchen vertreiben wollte
und doch herzbrechend weinen mußte, wobei er sich mit dem schmierigen
Pelzaufschlag die Tränen von den Wangen wischte, wenn er an sein
verirrtes Lämmlein dachte, an sein liebes Töchterchen Dunjäscha!
Nein, das ist naturgetreu! Lesen Sie es mal, dann werden Sie sehen: das
ist so wahr wie das Leben selbst. Das lebt! Ich habe es selbst erfahren,
– das lebt alles, lebt überall rings um mich herum! Da finden wir gleich
die Theresa – wozu so weit suchen! – da ist auch unser armer Beamter, –
denn der ist doch vielleicht ganz genau so ein Ssamsson Wyrin, nur daß
er einen anderen Namen hat und eben zufällig Gorschkoff heißt. Das ist
etwas, was ein jeder von uns erleben kann, ich ebenso gut wie Sie, mein
Kind. Und selbst der Graf, der am Newskij oder am Newakai wohnt, selbst
der kann dasselbe erleben, nur daß er sich äußerlich anders verhalten
wird – denn dort bei ihm ist nun einmal äußerlich alles anders, aber
auch ihm kann es ebenso gut widerfahren, wie mir.
Da sehen Sie, mein Kind, was das heißt, Leben. Sie aber wollen noch
wegreisen und uns im Stich lassen! Sie wissen ja gar nicht, was Sie mir
damit antun würden, Warinka! Sie würden doch nur sich und mich damit
zugrunde richten. Ach, mein Sternchen, so treiben Sie doch um Gottes
willen diese wilden Gedanken aus Ihrem Köpfchen und ängstigen Sie mich
nicht unnütz! Und wie überhaupt – sagen Sie doch selbst, Sie mein
kleines, schwaches Vögelchen, das noch nicht einmal flügge geworden ist
–: wie könnten Sie sich denn selbst ernähren, sich vor dem Verderben
bewahren und gegen jeden ersten besten Bösewicht verteidigen! Nein,
lassen Sie es jetzt gut und genug sein, Warinka, und bessern Sie sich!
Hören Sie nicht auf die dummen Ratschläge der anderen und lesen Sie Ihr
Büchlein noch einmal durch: das wird Ihnen Nutzen bringen.
Ich habe auch mit Ratasäjeff über den „Stationsaufseher“ gesprochen. Der
sagte, das sei alles altes Zeug und jetzt erschienen nur Bücher mit
Bildern und solche mit Beschreibungen – oder was er da sagte, ich habe
es nicht ganz begriffen, wie er es eigentlich meinte. Er schloß aber
doch damit, daß Puschkin gut sei und daß er das heilige Rußland besungen
habe, und noch verschiedenes andere sagte er mir über ihn. Ja, es ist
gut, Warinka, sehr gut: lesen Sie es noch einmal aufmerksam, folgen Sie
meinem Rat und machen Sie mich alten Knaben durch Ihren Gehorsam
glücklich. Gott der Herr wird Sie dafür belohnen, meine Gute, wird Sie
bestimmt belohnen!
Ihr treuer Freund
Makar Djewuschkin.
Mein lieber Makar Alexejewitsch!
Fedora hat mir heute die fünfzehn Rubel für den Teppich gebracht. Wie
froh sie war, die Arme, als ich ihr drei Rubel gab! Ich schreibe Ihnen
in größter Eile. Ich habe soeben die Weste für Sie zugeschnitten, – der
Stoff ist entzückend – gelb, mit Blümchen.
Ich sende Ihnen ein Buch: es sind darin verschiedene Geschichten, von
denen ich einige schon gelesen habe. Lesen Sie unbedingt die mit dem
Titel „Der Mantel“.[5]
Sie reden mir zu, mit Ihnen ins Theater zu gehen. Wird es aber nicht zu
teuer sein? Vielleicht auf die Galerie, das ginge noch. Ich bin schon
lange nicht mehr im Theater gewesen, wann zuletzt? Ich fürchte immer nur
eines: wird uns der Spaß nicht zu viel kosten? Fedora schüttelt den Kopf
und meint, daß Sie anfangen, über Ihre Verhältnisse zu leben. Das sehe
auch ich ein. Wieviel haben Sie nicht allein schon für mich ausgegeben!
Nehmen Sie sich in acht, mein Freund, daß es kein Unglück gibt. Fedora
hat mir da etwas gesagt: daß Sie, wenn ich nicht irre, mit Ihrer Wirtin
in Streit geraten seien, weil Sie irgend etwas nicht bezahlt hätten. Ich
sorge mich sehr um Sie.
Nun, leben Sie wohl. Ich habe eine kleine Arbeit: ich garniere nämlich
meinen Hut mit Band.
P. S. Wissen Sie, wenn wir ins Theater gehen, werde ich meinen neuen Hut
aufsetzen und die schwarze Mantille umnehmen. Werde ich Ihnen so
gefallen?
7. Juli.
Meine liebe Warwara Alexejewna!
Ich komme wieder auf unser gestriges Gespräch zurück. – Ja, mein Kind,
auch wir haben seinerzeit dumme Streiche gemacht! So hatte ich mich
einstmals wirklich und wahrhaftig in eine Schauspielerin verliebt,
sterblich verliebt, jawohl! Und das wäre noch nichts gewesen, das
Wunderliche aber war dabei, daß ich sie im Leben überhaupt nicht gesehen
und auch im Theater nur ein einziges Mal gewesen war – dennoch verliebte
ich mich in sie.
Damals wohnten wir, fünf junge, übermütige Leute, alle Wand an Wand und
Tür an Tür. Ich geriet in ihren Kreis, geriet ganz von selbst hinein,
obschon ich mich zunächst zurückhaltend zu ihnen gestellt hatte. Dann
aber, verstehen Sie, um ihnen nicht nachzustehen, ging ich auf alles
ein. Und was sie mir nicht von dieser Schauspielerin erzählten! Jeden
Abend, so oft Theater gespielt wurde, schob die ganze Kumpanei – für
Notwendiges hatten sie nie einen Heller – schob die ganze Kumpanei ins
Theater auf die Galerie und klatschte und klatschte und rief immer nur
diese eine Schauspielerin hervor – einfach wie die Besessenen gebärdeten
sie sich! Und dann ließen sie einen natürlich nicht einschlafen: die
ganze Nacht wurde nur von ihr gesprochen, ein jeder nannte sie seine
Glascha[6], alle waren sie in sie verliebt, alle hatten sie nur den
einen Kanarienvogel im Herzen: Sie! Da regten sie denn schließlich auch
mich auf. Ich war ja damals noch ganz jung!
Ich weiß selbst nicht mehr, wie es kam, daß ich mit ihnen im Theater
saß, oben auf der Galerie. Sehen konnte ich nur ein Eckchen vom Vorhang,
dafür aber hörte ich alles. Sie hatte solch ein hübsches Stimmchen –
hell, süß, wie eine Nachtigall. Wir klatschten uns die Hände rot und
blau, schrien, schrien – mit einem Wort, man hätte uns beinahe am Kragen
genommen, ja, einer wurde wirklich hinausgeführt.
Ich kam nach Hause, – wie im Nebel ging ich! In der Tasche hatte ich nur
noch einen Rubel, bis zum Ersten aber waren es noch gute zehn Tage. Ja,
und was glauben Sie, Kind? Am nächsten Tage, auf dem Wege zum Dienst,
trat ich in einen Parfümerieladen ein und kaufte für mein ganzes Kapital
Parfüm und wohlriechende Seifen – ich vermag selbst nicht mehr zu sagen,
wozu ich dies alles damals kaufte. Und dann speiste ich nicht einmal zu
Mittag, sondern ging vor ihren Fenstern auf und ab. Sie wohnte am
Newskij, im vierten Stock. Ich kam nach Haus, saß ein Weilchen, erholte
mich, und dann ging ich wieder auf den Newskij, um ihr von neuem
Fensterpromenaden zu machen.
So trieb ich’s anderthalb Monate; jeden Augenblick nahm ich Droschken,
immer Lichatschi[7], und fuhr hin und her vor ihren Fenstern: kurz, ich
brachte all mein Geld durch, geriet obendrein in Schulden, bis ich dann
schließlich und von selbst aufhörte, sie zu lieben, und das Ganze mir
langweilig wurde.
Da sehen Sie, was eine Schauspielerin aus einem ordentlichen Menschen zu
machen imstande ist! Doch ich war damals wirklich noch jung, Warinka,
noch ganz, ganz jung! ...
M. D.
8. Juli.
Meine liebe Warwara Alexejewna!
Ihr Büchlein, das ich am 6. dieses Monats erhalten habe, beeile ich
mich, Ihnen zurückzusenden. Gleichzeitig will ich versuchen, mich mit
Ihnen in diesem Briefe zu verständigen. Es ist nicht gut, mein Kind,
wirklich nicht gut, daß Sie mich in solch eine Zwangslage gebracht
haben.
Erlauben Sie, mein Kind: jedem Menschen ist sein Stand von dem Höchsten
zugeteilt. Dem einen ist es bestimmt, Generalsepauletten zu tragen, dem
anderen, als Schreiber sein Leben zuzubringen – jenem, zu befehlen,
diesem, widerspruchslos und in Furcht zu gehorchen. Das ist nun einmal
so, ist genau nach den menschlichen Fähigkeiten so eingerichtet: der
eine hat die Fähigkeit zu diesem, der andere zu jenem, die Fähigkeiten
selbst aber, die stammen von Gott.
Ich bin schon an die dreißig Jahre im Dienst. Ich erfülle meine Pflicht
mit Peinlichkeit, pflege stets nüchtern zu sein, und habe mir noch nie
etwas zuschulden kommen lassen. Als Bürger und Mensch halte ich mich
nach eigener Erkenntnis für einen Mann, der sowohl seine Fehler, wie
auch seine Tugenden besitzt. Die Vorgesetzten achten mich und selbst
Seine Exzellenz sind mit mir zufrieden – wenn sie mir bisher auch noch
keinen Beweis ihrer Zufriedenheit gegeben haben, so weiß ich doch auch
so, daß sie mit mir zufrieden sind. Meine Handschrift ist gefällig,
nicht allzu groß, aber auch nicht allzu klein, läßt sich am besten mit
Kursivschrift bezeichnen, jedenfalls aber befriedigt sie! Bei uns kann
allerhöchstens Iwan Prokofjewitsch so gut schreiben wie ich, das heißt,
auch der nur annähernd so gut. Mein Haar ist im Dienst allgemach grau
geworden. Eine große Sünde wüßte ich nicht begangen zu haben. Natürlich,
wer sündigt denn nicht im kleinen? Ein jeder sündigt, und sogar Sie
sündigen, mein Kind! Doch ein großes Vergehen oder auch nur eine bewußte
Unbotmäßigkeit habe ich nicht auf dem Gewissen – etwa daß ich die
öffentliche Ruhe gestört hätte oder so etwas – nein, so etwas habe ich
mir nicht vorzuwerfen, nie hat man mich bei so etwas betroffen. Sogar
ein Kreuzchen habe ich erhalten – doch was soll man davon reden! Das
müßten Sie ja alles wissen, und auch er hätte es wissen müssen, denn
wenn er sich schon einmal an das Beschreiben machte, dann hätte er sich
eben vorher nach allem erkundigen sollen! Nein, das hätte ich nicht von
Ihnen erwartet, mein Kind! Nein, gerade von Ihnen nicht, Warinka![8]
Wie! So kann man denn nicht mehr ruhig in seinem Winkelchen leben –
gleichviel wie und wo es auch sein möge – ganz still für sich, ohne ein
Wässerchen zu trüben, ohne jemanden anzurühren, gottesfürchtig und
zurückgezogen, damit auch die anderen einen nicht anrühren, ihre Nasen
nicht in deine Hütte stecken und alles durchschnüffeln: wie sieht es
denn bei dir aus, hast du zum Beispiel auch eine gute Weste, hast du
auch alles Nötige an Leibwäsche, hast du auch Stiefel und wie sind sie
besohlt, was ißt du, was trinkst du, was schreibst du ab? Was ist denn
dabei, mein Kind, daß ich, wo das Pflaster schlecht ist, mitunter auf
den Fußspitzen gehe, um die Stiefel zu schonen? Warum muß man gleich von
einem anderen geschwätzig schreiben, daß er mitunter in Geldverlegenheit
sei und dann keinen Tee trinke? Ganz als ob alle Menschen unbedingt Tee
trinken müßten! Sehe ich denn einem jeden in den Mund, um nachzusehen,
was für ein Stück der Betreffende gerade kaut? Wen habe ich denn schon
so beleidigt? Nein, mein Kind, weshalb andere beleidigen, die einem
nichts Böses getan haben?
Nun, und da haben Sie jetzt ein Beispiel, Warwara Alexejewna, da sehen
Sie, was das heißt: dienen, dienen, gewissenhaft und mit Eifer seine
Pflicht erfüllen – ja, und sogar die Vorgesetzten achten dich (was man
da auch immer reden wird, aber sie achten dich doch), – und da setzt
sich nun plötzlich jemand dicht vor deine Nase hin und macht sich ohne
alle Veranlassung mir nichts dir nichts daran, eine Schmähschrift über
dich zu verfassen, ein Pasquill, so eines, wie es dort in dem Buche
steht!
Es ist ja wahr, hat man sich einmal etwas Neues angeschafft, so freut
man sich darüber, schläft womöglich vor lauter Freude nicht, wie sonst:
hat man zum Beispiel neue Stiefel – mit welch einer Wonne zieht man sie
an. Das ist wahr, das habe auch ich schon empfunden, denn es ist
angenehm, seinen Fuß in einem feinen Stiefel zu sehen: es ist ganz
richtig beschrieben! Aber trotzdem wundert es mich aufrichtig, daß Fedor
Fedorowitsch das Buch so hat durchgehen lassen und nicht für sich selbst
eingetreten ist.
Freilich, er ist noch ein junger Vorgesetzter und schreit manchmal ganz
gern seine Untergebenen an. Aber weshalb soll er denn das nicht dürfen?
Warum soll er ihnen nicht die Leviten lesen, da man mit unsereinem
anders doch nicht auskommt? Nun ja, sagen wir, er tut es nur um des
Tones willen, – nun, aber auch das ist nötig. Man muß die Zügel stramm
halten, muß Strenge zeigen, denn sonst – unter uns gesagt, Warinka –
ohne Strenge, ohne Zwang tut unsereiner nichts, ein jeder will doch nur
seine Stelle haben, um sagen zu können: „Ich diene dort und dort,“ doch
um die Arbeit sucht sich ein jeder, so gut es eben geht, herumzudrücken.
Da es aber verschiedene Ränge gibt und jeder Rang den verdienten Rüffel
in einer seiner Höhe entsprechend abgestuften Tonart verlangt, so ergibt
das naturgemäß verschiedene Tonarten, wenn der Vorgesetzte mal alle
durchnimmt, – das liegt nun schon in der Ordnung der Dinge! Darauf ruht
doch die Welt, mein Kind, daß immer einer den anderen beherrscht und im
Zaum hält, – ohne diese Vorsichtsmaßregel könnte ja die Welt gar nicht
bestehen, wo bliebe denn sonst die Ordnung? Nein, ich wundere mich
wirklich, wie Fedor Fedorowitsch eine solche Beleidigung unbeachtet hat
durchlassen können!
Und wozu so etwas schreiben? Zu was ist das nötig? Wird denn jemand von
den Lesern auch nur einen Mantel dafür kaufen? Oder ein neues Paar
Stiefel? – Nein, Warinka, der Leser liest es und verlangt noch obendrein
eine Fortsetzung!
Man versteckt sich ja schon sowieso, versteckt sich und verkriecht sich,
man fürchtet sich, auch nur seine Nase zu zeigen, weil man davor
zittert, bespöttelt zu werden, weil man weiß, daß alles, was es in der
Welt gibt, zu einem Pasquill verarbeitet wird. Jetzt, siehst du, zieht
dein ganzes bürgerliches wie häusliches Leben durch die Literatur, alles
ist gedruckt, gelesen, belacht, verspottet! Man kann sich ja nicht
einmal mehr auf der Straße zeigen! Hier ist doch nun alles so genau
beschrieben, daß man allein schon am Gange erkannt werden muß! Wenn er
sich doch wenigstens zum Schluß geändert und, sagen wir, irgend etwas
wieder gemildert hätte, wenn er zum Beispiel nach jener Stelle, an der
man seinem Helden die Papierschnitzel auf den Kopf streut, gesagt hätte,
daß er bei alledem ein tugendhafter und ehrenhafter Bürger gewesen und
eine solche Behandlung von seinen Kollegen nicht verdient hätte, daß er
den Vorgesetzten gehorchte und gewissenhaft seine Pflicht erfüllt (hier
hätte er dann noch ein Beispielchen hineinflechten können), daß er
niemandem Böses gewünscht, daß er an Gott geglaubt und, als er gestorben
(wenn er ihn nun einmal unbedingt sterben lassen wollte), von allen
beweint worden sei.
Am besten aber wäre es gewesen, wenn er ihn, den Armen, gar nicht hätte
sterben lassen, sondern wenn er es so gemacht hätte, daß sein Mantel
wieder aufgefunden worden wäre, und daß Fedor Fedorowitsch – nein, was
sage ich! – daß jener hohe Vorgesetzte Näheres über seine Tugenden
erfahren und ihn in seine Kanzlei aufgenommen, ihn auf einen höheren
Posten gestellt und ihm noch eine gute Zulage zu seiner bisherigen
gegeben hätte, so daß es dann, sehen Sie, so herausgekommen wäre, daß
das Böse bestraft wird und die Tugend triumphiert – die anderen
Kanzleibeamten dagegen, seine Kollegen, hätten dann alle das Nachsehen
gehabt!
Ja, ich zum Beispiel hätte es so gemacht: denn so wie er es geschrieben
hat – was ist denn dabei Besonderes, was ist dabei Schönes? Das ist ja
doch einfach nur irgend so ein Beispiel aus dem alltäglichen niedrigen
Leben! Und wie haben _Sie_ sich nur entschließen können, mir ein solches
Buch zu senden, meine Gute? Das ist doch ein böswilliges, ein
vorsätzlich Schaden bringendes Buch, Warinka. Das ist doch einfach nicht
wahrheitsgetreu, denn es ist doch ganz ausgeschlossen, daß es einen
solchen Beamten irgendwo geben könnte! Nein, ich werde mich beklagen,
Warinka, werde mich ganz einfach und ausdrücklich beklagen!
Ihr gehorsamster Diener
Makar Djewuschkin.
27. Juli.
Mein lieber Makar Alexejewitsch!
Ihre Briefe und die letzten Ereignisse haben mich recht erschreckt, und
zwar um so mehr, als ich mir anfangs nichts zu erklären wußte – bis
Fedora mir dann alles erzählte. Aber weshalb mußten Sie denn gleich so
verzweifeln und in einen solchen Abgrund stürzen, Makar Alexejewitsch?
Ihre Erklärungen haben mich durchaus nicht befriedigt. Sehen Sie jetzt,
daß ich recht hatte, als ich darauf bestand, jene vorteilhafte Stelle
anzunehmen? Überdies ängstigt mich mein letztes Abenteuer sehr.
Sie sagen, Ihre Liebe zu mir habe Sie veranlaßt, mir manches zu
verheimlichen. Ich habe es ja schon damals gewußt, wie sehr ich Ihnen zu
Dank verpflichtet war, als Sie mir noch versicherten, daß Sie für mich
nur Ihr erspartes Geld ausgäben, welches Sie, wie Sie sagten, auf der
Kasse liegen hätten. Jetzt aber, nachdem ich erfahren habe, daß Sie
überhaupt kein erspartes Geld besitzen, daß Sie, als Sie zufällig von
meiner traurigen Lage erfuhren, nur aus Mitleid beschlossen, Ihr Gehalt,
das Sie sich noch dazu vorauszahlen ließen, für mich auszugeben, und daß
Sie während meiner Krankheit sogar Ihre Kleider verkauft haben – jetzt
sehe ich mich in eine so qualvolle Lage versetzt, daß ich gar nicht
weiß, wie ich alles das auffassen und was ich überhaupt denken soll!
Ach, Makar Alexejewitsch! Sie hätten es bei der notwendigsten Hilfe, die
Sie mir aus Mitleid und verwandtschaftlicher Liebe leisteten, bewenden
lassen und nicht unausgesetzt soviel Geld für ganz Unnötiges
verschwenden sollen! Sie haben mich hintergangen, Makar Alexejewitsch,
Sie haben mein Vertrauen mißbraucht, und jetzt, wo ich hören muß, daß
Sie Ihr letztes Geld für meine Kleider, für Konfekt, Ausflüge,
Theaterbesuch und Bücher hingegeben haben – jetzt bezahle ich das teuer
mit Selbstvorwürfen und der bitteren Reue ob meines unverzeihlichen
Leichtsinns, denn ich habe doch alles von Ihnen angenommen, ohne nach
Ihrem Auskommen zu fragen. Auf diese Weise verwandelt sich jetzt alles,
womit Sie mir einst Freude machen wollten, in eine drückende Last, und
alles Gute wird in der Erinnerung von Bedauern verdrängt.
Es ist mir in der letzten Zeit natürlich nicht entgangen, daß Sie
bedrückt waren, aber obschon ich selbst ahnungsvoll irgendein Unheil
erwartete, konnte ich doch das, was jetzt geschehen ist, einfach nicht
fassen. Wie! So haben Sie schon in einem solchen Maße den Mut verlieren
können, Makar Alexejewitsch! Was werden jetzt diejenigen, die Sie
kennen, von Ihnen sagen? Sie, den ich wie alle anderen wegen Ihrer
Herzensgüte, Anspruchslosigkeit und Anständigkeit geachtet habe, Sie
haben sich plötzlich einem so widerlichen Laster ergeben können, dem Sie
doch, soviel mir scheint, früher noch nie gefrönt haben.
Ich weiß nicht mehr, was mit mir geschah, als Fedora mir erzählte, daß
man Sie in berauschtem Zustande auf der Straße gefunden und die Polizei
Sie nach Haus geschafft habe! Ich erstarrte, – obschon ich mich auf
etwas Außergewöhnliches gefaßt gemacht hatte, da Sie ja doch schon seit
ganzen vier Tagen verschwunden waren. Haben Sie denn nicht daran
gedacht, Makar Alexejewitsch, was Ihre Vorgesetzten dazu sagen werden,
wenn sie die wirkliche Ursache Ihres Ausbleibens vernehmen? Sie sagen,
daß alle über Sie lachen und von unseren Beziehungen erfahren haben, und
daß Ihre Nachbarn in ihren Spottreden auch meiner Erwähnung tun.
Beachten Sie das nicht, Makar Alexejewitsch und beruhigen Sie sich um
Gottes willen!
Ferner beunruhigt mich auch noch Ihre Geschichte mit jenen Offizieren, –
ich habe nichts Genaueres erfahren können, nur so ein Gerücht. Erklären
Sie mir, bitte, was für eine Bewandtnis es damit hat.
Sie schreiben, daß Sie sich gefürchtet, mir die Wahrheit mitzuteilen,
weil Sie dann vielleicht meine Freundschaft verloren haben würden, daß
Sie während meiner Krankheit in der Verzweiflung nur deshalb alles
verkauft hätten, um die Kosten bestreiten und somit verhindern zu
können, daß man mich ins Hospital brachte, daß Sie soviel Schulden
gemacht, wie es Ihnen gerade noch möglich war, und Ihre Wirtin Ihnen
jetzt täglich unangenehme Szenen bereite, – aber indem Sie mir alles
dies verheimlichten, wählten Sie das Schlechtere. Jetzt habe ich ja doch
alles erfahren! Sie wollten mir die Erkenntnis ersparen, daß ich die
Ursache Ihrer unglücklichen Lage war, haben mir aber nun durch Ihre
Aufführung doppelten Kummer bereitet. Alles das hat mich fast gebrochen,
Makar Alexejewitsch. Ach, mein Freund! Unglück ist eine ansteckende
Krankheit. Arme und Unglückliche müßten sich fernhalten voneinander, um
sich gegenseitig nicht noch mehr ins Elend zu bringen. Ich habe Ihnen
solches Unglück gebracht, wie Sie es früher in Ihrem bescheidenen
stillen Leben gewiß noch nie erfahren haben. Das quält mich entsetzlich
und nimmt mir jede Kraft.
Schreiben Sie mir jetzt alles aufrichtig, was dort mit Ihnen geschehen
ist und wie Sie sich so weit haben vergessen können. Beruhigen Sie mich,
wenn es Ihnen möglich ist. Ich sage das nicht aus Egoismus, sondern nur
aus Freundschaft und Liebe zu Ihnen, die nichts aus meinem Herzen tilgen
könnte.
Leben Sie wohl. Ich erwarte Ihre Antwort mit Ungeduld. Sie haben
schlecht von mir gedacht, Makar Alexejewitsch.
Ihre Sie von Herzen liebende
Warwara Dobrosseloff.
28. Juli.
Meine unschätzbare Warwara Alexejewna!
Ja: jetzt, wo alles schon vorüber und überstanden ist und alles
allmählich wieder ins alte Geleise kommt, kann ich ja zu Ihnen ganz
aufrichtig sein, mein Kind. Also: es beunruhigt Sie, was man von mir
denken und was man von mir sagen wird. Darauf beeile ich mich, Ihnen
mitzuteilen, daß mein Ansehen im Amte mir höher steht, als alles andere.
Und da kann ich Ihnen denn, nachdem ich Ihnen von diesen meinen
Unglücksfällen und Mißgeschicken berichtet habe, nunmehr mitteilen, daß
von meinen Vorgesetzten noch niemand etwas erfahren hat, so daß sie mich
alle nach wie vor achten werden. Nur eines fürchte ich: nämlich
Klatschgeschichten. Hier zu Haus schrie die Wirtin, aber nachdem ich ihr
jetzt mittels Ihrer zehn Rubel einen Teil meiner Schuld bezahlt habe,
brummt sie nur noch. Und was die anderen betrifft, so ist es nicht so
schlimm: man muß sie nur nicht um Geld bitten, dann sind sie ganz gut.
Zum Schluß aber dieser meiner Erklärungen sage ich Ihnen noch, mein
Kind, daß Ihre Achtung mir über alles geht, über alles und jedes in der
Welt, und damit, daß ich diese nicht eingebüßt habe, tröste ich mich nun
in der Zeit meiner Bedrängnis. Gott sei Dank, daß der erste Schlag und
die ersten Unannehmlichkeiten vorüber sind, und daß Sie es so milde
auffassen, daß Sie mich deshalb nicht für einen treulosen Freund und
selbstsüchtigen Menschen halten, weil ich Sie hier bei uns zurückhielt
und Sie betrog, Sie liebte und doch nicht die Kraft hatte, mich von
Ihnen zu trennen, mein Engel. Ich habe mich mit Eifer von neuem an meine
Arbeit gemacht und bin bemüht, durch treue Pflichterfüllung im Dienst
mein Vergehen wieder gut zu machen. Jewstafij Iwanowitsch sagte kein
Wort, als ich gestern an ihm vorüberging.
Ich will Ihnen auch nicht verheimlichen, mein Kind, daß meine Schulden
und der schlechte Zustand meiner Kleidung schwer auf mir lasten, aber
darauf kommt es ja wieder gar nicht an, und ich bitte Sie nur inständig,
sich wegen dieser Nebensachen keine Sorgen zu machen. Sie senden mir
noch ein halbes Rubelchen. Warinka, dieses halbe Rubelchen hat mir mein
Herz durchbohrt. Also so steht es jetzt, so hat sich das Blatt gewandt!
Nicht ich, der alte Dummkopf, helfe Ihnen, mein Engelchen, sondern Sie,
mein armes Waisenkindchen, helfen noch mir! Das war sehr gut von Fedora,
daß sie Geld verschafft hat. Ich habe vorläufig gar keine Aussichten,
irgendwo welches auftreiben zu können, mein Kind, doch sobald sich
irgendeine Aussicht auf eine Möglichkeit einstellen sollte, werde ich
Ihnen darüber ausführlich näheres schreiben. Nur der Klatsch, der
Klatsch beunruhigt mich!
Leben Sie wohl, mein Engelchen. Ich küsse Ihr Händchen und bitte Sie
flehentlich, nur ja wieder gesund zu werden. Ich schreibe deshalb so
kurz, weil ich zum Dienst eilen muß, denn durch Eifer und Fleiß will ich
alle meine Versäumnisse nachholen und so mein Gewissen langsam
beruhigen. Die ausführlichere Wiedergabe meiner Erlebnisse sowie jener
Geschichte mit den Offizieren verschiebe ich auf den Abend. Dann habe
ich mehr Zeit.
Ihr Sie hoch verehrender und herzlich liebender
Makar Djewuschkin.
28. Juli.
Warinka, mein Liebes!
Ach, Warinka, Warinka! Jetzt ist aber die Schuld auf Ihrer Seite und
wird auf Ihrem Gewissen lasten bleiben. Mit Ihrem Brief hatten Sie mich
um den Rest von Überlegungskraft gebracht, den ich noch besaß, und mich
ganz und gar vor den Kopf gestoßen: erst jetzt, nachdem ich in Muße
nachgedacht und mir bis ins innerste Herz hineingeblickt habe, sehe ich
und weiß ich wieder, daß ich doch im Recht war, vollkommen im Recht. Ich
rede jetzt nicht von meinen drei wüsten Tagen (lassen wir das gut sein,
Kind, reden wir nicht mehr davon!), sondern sage nur immer wieder, daß
ich Sie liebe und daß es keineswegs unvernünftig von mir war, Sie zu
lieben, nein, durchaus nicht unvernünftig! Sie, mein Kind, wissen ja
doch noch nichts: aber wenn Sie wüßten, wie das alles kam, warum ich Sie
lieben muß, so würden Sie ganz anders reden. Sie sagen ja dies alles nur
so, und ich bin überzeugt, daß Sie in Ihrem Herzen ganz anders denken.
Mein Kind, ich weiß es ja selbst nicht mehr ganz genau, was ich mit
jenen Offizieren eigentlich hatte. Ich muß Ihnen nämlich gestehen, mein
Engelchen, daß ich mich bis dahin in der schrecklichsten Lage befand.
Stellen Sie sich vor, mein Kind, daß ich mich schon einen ganzen Monat
sozusagen nur noch an einem Fädchen hielt. Meine Bedrängnis war so groß,
daß ich gar nicht mehr wußte, wo ich mich lassen sollte. Vor Ihnen
versteckte ich mich, und hier zu Haus versteckte ich mich gleichfalls,
aber meine Wirtin schrie trotzdem allen Menschen die Ohren voll. Ich
hätte mir nicht viel daraus gemacht, ich hätte sie ja schreien lassen,
die schändliche Person, so viel sie wollte, aber erstens war es doch
eine Schande, und zweitens kam hinzu, daß sie Gott weiß woher von
unserer Freundschaft erfahren hatte, und da schrie sie denn im ganzen
Hause solche Sachen über uns aus, daß mir Hören und Sehen verging und
ich mir die Ohren zuhielt. Die anderen aber hielten sich ihre Ohren
nicht zu, sondern rissen sie ganz im Gegenteil sperrangelweit auf. Auch
jetzt noch weiß ich nicht, mein Kind, wo ich mich vor ihnen verbergen
soll ...
Und nun, sehen Sie mein Engelchen, diesem Ansturm von Unglück in allen
seinen Arten war ich eben nicht gewachsen. Und da hörte ich nun
plötzlich von Fedora, daß ein Nichtswürdiger zu Ihnen gekommen sei und
Sie mit unverschämten Anträgen beleidigt habe. Daß er Sie tief und
grausam beleidigt haben mußte, das konnte ich schon nach mir selbst
beurteilen, mein Kind, denn auch ich fühlte mich dadurch tief beleidigt.
Ja – und da, mein Engelchen, da verlor ich eben den Verstand, verlor den
Kopf und verlor mich selbst vollständig dazu. Ich lief in einer solchen
Wut fort, Warinka, wie ich sie mein Lebtag noch nicht empfunden. Ich
wollte sogleich zu ihm, zu diesem Verführer, dem nichts mehr heilig war!
Doch ich weiß selbst nicht, was ich wollte. Ich wollte jedenfalls, mein
Engelchen, daß man Sie nicht beleidigte! Nun, traurig war es! Regen und
Schmutz draußen und Weh und Kummer im Herzen! ... Ich gedachte schon
zurückzukehren ... Aber da kam das Verhängnis, mein Kind. Ich begegnete
dem Jemeljä, dem Jemeljan Iljitsch, – er ist ein Beamter, d. h. er war
Beamter, jetzt aber ist er es nicht mehr, denn er wurde aus irgendeinem
Grunde davongejagt. – Ich weiß eigentlich nicht, womit er sich jetzt
beschäftigt – irgendwie wird er sich wohl schon durchzuschlagen wissen
und so gingen wir denn beide. Gingen. – Und dann, – ja, was soll man da
reden, Warinka, es ist für Sie doch keine Freude, von den Verirrungen
und Prüfungen Ihres Freundes zu lesen – und den Bericht von all dem
Unglück mit anzuhören, das er gehabt hat. Am dritten Tage, gegen Abend –
der Jemeljä, Gott verzeih ihm, hatte mich aufgehetzt – ging ich
schließlich hin zu dem Leutnant. Seine Adresse hatte ich von unserem
Hausknecht erfahren. Ich hatte ja doch – da nun einmal die Rede davon
ist – schon lange diesen jungen Helden ins Auge gefaßt, hatte ihn schon
lange beobachtet, als er noch in unserem Hause wohnte. Jetzt sehe ich ja
ein, daß ich mich nicht richtig benommen habe, denn ich war nicht in
einem klaren Zustande, als ich mich bei ihm melden ließ, Warinka. Und
dann mein Kind, ja dann, offengestanden, davon weiß ich nichts mehr, was
dann noch geschah. Ich erinnere mich nur noch, daß sehr viele Offiziere
bei ihm waren, oder vielleicht auch, Gott weiß es, sahen meine Augen
alles doppelt. Auch weiß ich nicht mehr, was ich dort eigentlich tat,
ich weiß nur, daß ich viel sprach, und zwar in ehrlicher Entrüstung. Nun
und da wurde ich denn schließlich hinausbefördert und die Treppe
hinabgeworfen, d. h. nicht gerade, daß sie mich wortwörtlich
hinabgeworfen hätten, aber immerhin: ich wurde hinausbefördert. Wie ich
wieder nach Hause kam, das wissen Sie ja schon. Nun und das ist alles,
Warinka. Ich habe mir natürlich viel vergeben und meine Ehre hat
darunter gelitten, aber von dem ganzen weiß ja doch niemand, von fremden
Menschen niemand, außer Ihnen kein Mensch, nun und das ist doch ebenso
gut, als wäre überhaupt nichts gewesen. Ja, vielleicht ist es auch
wirklich so, Warinka, was meinen Sie? Was ich nämlich ganz genau weiß,
das ist, daß im vorigen Jahr Akssentij Ossipowitsch sich bei uns ganz
ebenso an Pjotr Petrowitsch vergriff, aber er tat es nicht öffentlich,
tat es unter vier Augen. Er ließ ihn in die Wachtstube bitten, ich aber
sah alles zufällig mit an: dort nun verfuhr er dann mit ihm, wie er es
für richtig befand, jedoch unter voller Wahrung von Ehre und Haltung:
denn wie gesagt, es sah niemand etwas davon – außer mir. Ich aber – nun,
ich bin doch nichts, d. h. ich will damit nur sagen, daß ich nichts
davon habe verlauten lassen, es ist also ganz so, als hätte auch ich
nichts gewußt. Nun und nachher haben Pjotr Petrowitsch und Akssentij
Ossipowitsch immer so zueinander gestanden, als wäre nie etwas zwischen
ihnen vorgefallen. Pjotr Petrowitsch ist, wissen Sie, solch ein
Ehrgeiziger, daher hat er denn auch niemand etwas gesagt, und jetzt
grüßen sie sich, als ob nichts vorgefallen wäre, und reichen sich sogar
die Hand.
Ich widerspreche ja nicht, Warinka, ich wage ja gar nicht, Ihnen zu
widersprechen, ich sehe es selbst ein, daß ich tief gesunken bin und ich
habe sogar, was am schrecklichsten ist, an Selbstachtung viel, ach, sehr
viel verloren. Doch das wird mir wahrscheinlich schon von Geburt an so
bestimmt gewesen sein: das war eben mein Schicksal, – dem Schicksal aber
entgeht man nicht, wie Sie wissen.
So, das wäre jetzt die ausführliche Erzählung alles dessen, was mich in
meiner Not und meinem Elend noch heimgesucht hat, Warinka. Wie Sie
sehen, ist es von der Art, daß es besser wäre, gar nicht daran zu
denken. Ich bin krank, mein Kind, und da sind mir alle bessern Gefühle
abhanden gekommen. Ich schließe, indem ich Sie, verehrte Warwara
Alexejewna, meiner Anhänglichkeit, Liebe und Hochachtung versichere, und
verbleibe
Ihr ergebenster Diener
Makar Djewuschkin.
29. Juni.
Mein lieber Makar Alexejewitsch!
Ich habe Ihre beiden Briefe gelesen und die Hände zusammengeschlagen!
Mein Gott, mein Gott! Hören Sie, mein Freund, entweder verheimlichen Sie
mir etwas oder Sie haben mir überhaupt nur einen Teil Ihrer
Unannehmlichkeiten geschrieben, oder ... wirklich, Makar Alexejewitsch,
aus Ihren Briefen lese ich noch immer eine gewisse Verstörtheit heraus
... Kommen Sie heute zu mir, um Gottes willen kommen Sie! Und hören Sie:
kommen Sie einfach zum Mittagessen zu uns. Ich weiß nicht, wie Sie dort
leben und wie Sie jetzt mit Ihrer Wirtin stehen. Sie schreiben davon
nichts, und zwar scheinbar absichtlich, als wollten Sie wieder etwas
verschweigen.
Also auf Wiedersehen, mein Freund, kommen Sie unbedingt heute zu uns.
Überhaupt wäre es besser, wenn Sie immer bei uns essen würden. Fedora
kocht sehr gut. Leben Sie wohl.
Ihre
Warwara Dobrosseloff.
1. August.
Warwara Alexejewna, meine Liebe!
Sie freuen sich, mein Kind, daß Gott der Herr Ihnen jetzt Gelegenheit
gegeben hat, Gutes mit Gutem zu vergelten und mir Ihre Dankbarkeit zu
beweisen. Ich glaube daran, Warinka, und glaube an die Engelsgüte Ihres
Herzchens, und will Ihnen keinen Vorwurf machen, nur müssen auch Sie mir
nicht wie damals vorwerfen, daß ich auf meine alten Tage ein
Verschwender geworden sei. Nun, ich habe eben mal gesündigt, was ist da
zu machen! – wenn Sie durchaus wollen, daß es eine Sünde sei. Nur sehen
Sie, Warinka, gerade von Ihnen das zu hören, das tut weh!
Aber seien Sie mir deshalb nicht böse, daß ich Ihnen das sage. In meinem
Herzen ist alles krank, mein Kind. Arme sind eigensinnig: – das ist von
der Natur selbst so eingerichtet. Ich habe es auch früher schon
beobachtet und selbst gefühlt. Der arme Mensch ist empfindlich: Gottes
Welt sieht er anders an, auf jeden Vorübergehenden sieht er mißtrauisch
von der Seite, und schaut sich überall argwöhnisch und verwirrt um, und
horcht auf jedes Wort – ob da nicht etwa von ihm gesprochen wird? Ob man
sich nicht gerade zuflüstert, wie unansehnlich und abgerissen er
ausschaue? Ob man sich nicht frage, was er gerade in diesem Augenblick
wohl empfinde? Vielleicht auch, wie er denn eigentlich von dieser, und
wie er wohl von jener Seite sich ausnehme? Das weiß doch ein jeder,
Warinka, daß ein armer Mensch schlechter als ein alter Lappen ist und
keinerlei Achtung von anderen Menschen verlangen kann, was man da auch
immer schreiben mag! Denn was diese Buchmenschen da schreiben: es bleibt
am armen Menschen doch alles so, wie es war. Und weshalb bleibt es so,
wie es war? Nun, weil bei einem armen Menschen alles sozusagen mit der
linken Seite nach außen sein muß, er darf da nichts tiefinnerlich
Verborgenes besitzen, keinen Ehrgeiz beispielsweise oder sonst sowas,
das duldet man einfach nicht. Noch neulich sagte mir der Jemeljä, daß
man einmal irgendwo eine Kollekte für ihn gemacht habe, und daß er dabei
für jeden Heller gewissermaßen einer Besichtigung unterzogen worden sei.
Die Menschen waren der Meinung, daß sie ihm ihre Almosen nicht umsonst
geben müßten – oh nein: sie zahlten dafür, daß man ihnen einen armen
Menschen zeigte. Heutzutage, Kind, werden auch die Wohltaten ganz
eigenartig erwiesen ... vielleicht auch, daß sie immer so erwiesen
worden sind, wer kann das wissen! Entweder verstehen es die Leute nicht
oder sie sind schon gar zu große Meister darin – eins von beiden.
Sie haben das vielleicht noch nicht gewußt? Dann merken Sie es sich!
Glauben Sie mir, Warinka, wenn ich auch über manches nicht mitreden kann
– hierüber weiß ich besser Bescheid, als so mancher andere! Woher aber
weiß ein armer Mensch alles dies? Und warum denkt er überhaupt so etwas?
Ja, woher weiß er es? – Nun, eben so – aus Erfahrung! Ebensogut wie er
weiß, daß dort der feine Herr, der neben ihm geht und sogleich in ein
Restaurant treten wird, bei sich selbst denkt: „Was wird wohl dieser
arme Beamte da heute zu Mittag speisen? Ich werde mir jedenfalls _sauté
aux papillotes_ bestellen, er aber wird vielleicht einen Brei ohne
Butter essen!“ – Aber was geht es denn ihn an, daß ich Brei ohne Butter
essen werde? Ja, es gibt nun einmal solche Menschen, Warinka, es gibt
wirklich solche Menschen, die nur an so etwas denken. Und die gehen dann
noch umher, diese nichtsnutzigen Pasquillanten, und schnüffeln überall
und sehen nach, ob einer mit dem ganzen Fuß auftritt, oder nur mit der
Fußspitze, und notieren es sich noch, daß der und der Beamte in dem und
dem Ressort Stiefel trägt, aus denen die nackten Zehen hervorgucken, daß
die Ärmel seiner Uniform an den Ellenbogen durchgescheuert sind und
Löcher aufweisen – und das beschreiben sie dann alles ganz genau, und
obendrein wird’s gedruckt ... Was geht das dich an, daß meine Ellenbogen
zerrissen sind? Ja, wenn Sie mir das grobe Wort verzeihen, Warinka, so
sage ich Ihnen, daß ein armer Mensch in dieser Beziehung ganz dieselbe
Scham empfindet, wie Sie beispielsweise Ihre Mädchenscham empfinden. Sie
werden sich doch auch nicht vor allen Leuten – verzeihen Sie mir das
grobe Beispiel – auskleiden. Nun, und sehen Sie, genau so ungern sieht
es der arme Mensch, daß man in seine Hundehütte hineinblickt, etwa um zu
sehen, wie denn da seine Familienverhältnisse sind. Was lag aber für ein
Grund vor, mich, Warinka, zusammen mit meinen Feinden, die es auf die
Ehre und den guten Ruf eines ehrlichen Menschen abgesehen haben, so zu
beleidigen?
Nun, und heute saß ich in meinem Bureau ganz mäuschenstill und geduckt,
und kam mir selbst wie ein gerupfter Sperling vor, so daß ich vor Scham
fast vergehen wollte. Ich schämte mich, Warinka! Man verliert ja
unwillkürlich den Mut, wenn man weiß, daß durch das durchgescheuerte
Ärmelzeug die Ellenbogen schimmern und die Knöpfe nur noch an einem
Fädchen baumeln. Und bei mir war doch alles wie behext, alles
buchstäblich wie behext, und in der größten Verwahrlosung! Da verliert
man denn ganz unwillkürlich seinen Mut. Ja, wie auch nicht! Selbst
Stepan Karlowitsch sagte, als er heute über Dienstliches mit mir zu
sprechen begann: er sprach nämlich und sprach, und dann plötzlich
entfuhr es ihm ganz unversehens: „Ach ja, Makar Alexejewitsch!“ sprach
aber das andere nicht aus, nicht das, was er dachte, nur erriet ich es
durch alle seine Gedanken hindurch und errötete so, daß sogar meine
Glatze rot wurde. Es hat ja im Grunde nichts zu bedeuten, aber es ist
doch immer irgendwie beunruhigend und bringt einen auf ganz schwermütige
Gedanken. Sollten Sie vielleicht schon etwas erfahren haben? Gott
behüte, wenn Sie nun doch etwas erfahren haben sollten! Ja, wirklich,
aufrichtig gesagt, ich habe einen gewissen Menschen stark im Verdacht.
Diesen Räubern macht es doch nichts aus! Die verraten einen ohne
weiteres! Sie sind fähig, dein ganzes Privatleben für nichts und wieder
nichts zu verkaufen! Denen ist gar nichts mehr heilig!
Ich weiß jetzt, wessen Streich das ist: Ratasäjeff hat’s getan! Er muß
mit jemandem aus unserem Ressort bekannt sein, und da hat er dem
Betreffenden so gesprächsweise etwas gesagt, vielleicht auch noch seine
Erzählung ganz besonders ausgeschmückt. Oder er hat’s vielleicht in
seinem Bureau erzählt, und von dort ist es dann hinausgetragen worden
und auch zu uns gekommen. Bei uns zu Hause sind alle ganz genau
unterrichtet: sie weisen gar mit dem Finger nach Ihrem Fenster. Ich weiß
schon, daß sie’s tun. Und als ich gestern zum Mittagessen zu Ihnen ging,
steckten sie aus allen Fenstern die Köpfe hinaus, und die Wirtin sagte,
da habe nun der Teufel mit einem Säugling einen Bund geschlossen, und
dann drückte sie sich außerdem noch unanständig über Sie aus.
Aber alles dies ist noch nichts gegen die schändliche Absicht
Ratasäjeffs, uns beide in seine Schriften hineinzubringen und uns in
einer pikanten Satire zu schildern. Das hat er selbst gesagt, und mir
deuteten es einige gute Freunde im Bureau an. Ich kann jetzt an nichts
mehr denken, mein Kind, und weiß nicht einmal, wozu ich mich
entschließen muß. Ja, – soll man da noch länger seine Sünde in Abrede
stellen, wir haben doch wohl beide Gott den Herrn erzürnt, mein
Engelchen!
Sie wollten mir, mein Kind, ein Buch schicken, damit ich mich nicht
langweile. Lassen Sie es gut sein, Liebling, was mach ich damit! Und was
ist denn solch ein Buch? Das ist doch alles nichts Wirkliches! Und auch
Satiren und Romane sind Unsinn, nur so um des Unsinns willen
geschrieben, nur so, damit müßige Leute etwas zu lesen haben. Glauben
Sie mir, mein Kind, was ich Ihnen sage, glauben Sie meiner langjährigen
Erfahrung. Und wenn sie Ihnen da von Shakespeare anfangen – in der
Literatur, siehst du, gibt es einen Shakespeare! – so ist ja doch auch
ihr ganzer Shakespeare Unsinn, nichts als barer Unsinn, und nichts
weiter als ein Spott- und Schmähgeschreibe und nur zu solchem Zweck von
diesem Pasquillanten verfaßt!
Ihr
Makar Djewuschkin.
2. August.
Mein lieber Makar Alexejewitsch!
Ich bitte Sie, beunruhigen Sie sich jetzt nicht mehr! Gott wird uns
schon helfen und alles wird wieder gut werden. Fedora hat für sich und
mich eine Menge Arbeit verschafft und wir haben uns sehr vergnügt
sogleich daran gemacht. Vielleicht werden wir dadurch alles wieder
gutmachen können. Fedora sagte mir, sie glaube, daß Anna Fedorowna über
alle meine Unannehmlichkeiten in der letzten Zeit genau unterrichtet
sei, doch mir ist jetzt alles gleichgültig. Ich bin heute ganz besonders
froh gestimmt.
Sie wollen Geld borgen – Gott bewahre Sie davor! Damit würden Sie sich
noch mehr Unglück auf den Hals laden, denn Sie müssen es zurückzahlen,
und Sie wissen doch wohl, wie schwer das ist. Leben Sie jetzt lieber
noch etwas sparsamer, kommen Sie öfter zu uns und achten Sie nicht
darauf, was Ihre Wirtin da schreit. Was aber Ihre übrigen Feinde und
alle Ihnen mißgünstig Gesinnten betrifft, so bin ich überzeugt, daß Sie
sich mit ganz grundlosen Befürchtungen quälen, Makar Alexejewitsch!
Sie könnten auch etwas mehr auf Ihren Stil achten, ich habe Ihnen schon
das vorige Mal gesagt, daß Sie sehr unausgeglichen schreiben. Nun, also
leben Sie wohl bis zum Wiedersehen. Ich erwarte Sie unter allen
Umständen.
Ihre
W. D.
3. August.
Mein Engelchen Warwara Alexejewna!
Ich beeile mich, Ihnen mitzuteilen, mein Seelchen, daß ich jetzt doch
wieder eine kleine Aussicht habe und damit auch wieder Hoffnung. Aber
zunächst erlauben Sie mir eines, mein Kind: Sie schreiben, ich solle
keine Anleihe machen? Mein Täubchen, es geht nicht ohne sie. Mir geht es
schon schlecht, aber wie wird das erst mit Ihnen sein, es kann Ihnen
doch plötzlich etwas zustoßen! Sie sind doch solch ein schwächliches
Dingelchen. Also sehen Sie, deshalb sage ich denn auch, daß man sich
unbedingt Geld verschaffen muß. Und nun hören Sie weiter.
Also zunächst muß ich vorausschicken, daß ich im Bureau neben Jemeljan
Iwanowitsch sitze. Das ist nicht jener Jemeljan, von dem ich Ihnen schon
erzählt habe. Er ist vielmehr, ganz wie ich, ein Staatsschreiber. Wir
beide sind so ziemlich die Ältesten im ganzen Departement, die
Alteingesessenen, wie man uns zu nennen pflegt. Er ist ein guter Mensch,
ein uneigennütziger Mensch, aber nicht gerade sehr gesprächig, wissen
Sie, und eigentlich sieht er immer wie so ein richtiger Brummbär aus.
Dafür arbeitet er gut, hat eine sogenannte englische Handschrift, und
wenn man die Wahrheit sagen soll, schreibt er nicht schlechter als ich.
Er ist dabei ein wirklich ehrenwerter Mensch! Sehr intim sind wir beide
nie gewesen, nur so auf „Guten Tag!“ und „Leben Sie wohl!“ haben wir
gestanden, doch, was mitunter vorkam, wenn ich sein Federmesser nötig
hatte, nun, dann sagte ich eben: „Bitte, Jemeljan Iwanowitsch, Ihr
Messerchen, auf einen Augenblick!“ Also eine richtige Unterhaltung gab’s
zwischen uns nicht, aber es wurde doch das gesprochen, was man sich so
gelegentlich zu sagen hat, wenn man nebeneinander sitzt. Nun aber, sehen
Sie, da sagte dieser Mensch heute ganz plötzlich zu mir: „Makar
Alexejewitsch, warum sind Sie denn jetzt so nachdenklich?“
Ich sah, der Mensch meinte es gut mit mir – und da vertraute ich mich
ihm denn an. So und so, sagte ich, Jemeljan Iwanowitsch, d. h. alles
erzählte ich ihm nicht – und natürlich, Gott behüte, werde ich das auch
nie tun, denn dazu fehlt mir der Mut, Warinka, aber so dies und jenes
habe ich ihm doch anvertraut, mit anderen Worten: ich gestand ihm, daß
ich „etwas in Geldverlegenheit“ sei, nun, und so weiter.
„Aber Sie könnten doch, Väterchen,“ sagte darauf Jemeljan Iwanowitsch,
„könnten sich doch von jemandem Geld leihen, sagen wir zum Beispiel von
Pjotr Petrowitsch, der leiht auf Prozente. Ich habe auch von ihm
geliehen. Und er nimmt nicht einmal gar so hohe Prozente, wirklich,
nicht gar so hohe.“
Nun, Warinka, mein Herz schlug gleich ganz anders vor lauter Freude – es
hüpfte nur so! Ich dachte und dachte hin und her und setzte mein
Vertrauen auf Gott, der, was kann man wissen, dem Pjotr Petrowitsch
vielleicht doch eingibt, daß er mir Geld leiht. Und ich begann schon,
alles auszurechnen: wie ich dann meine Wirtin bezahlen und Ihnen helfen
und auch mir selbst ein einigermaßen menschliches Aussehen verleihen
würde – denn so ist es doch eine wahre Schande, man schämt sich
ordentlich, auf seinem Platz zu sitzen, ganz abgesehen davon, daß die
Jungen ewig über einen lachen – nun, Gott verzeih’ ihnen! Aber auch
Seine Exzellenz gehen mitunter an unserem Tisch vorüber: nun, sagen wir,
wenn sie einmal – wovor Gott uns behüte und bewahre! – wenn sie einmal
im Vorübergehen einen Blick auf mich zu werfen geruhten und bemerken
sollten, daß ich, sagen wir, ungehörig gekleidet bin! Bei Seiner
Exzellenz aber sind Sauberkeit und Ordnung die Hauptsache. Sie würden ja
wahrscheinlich nichts sagen, aber ich, Warinka, ich würde auf der Stelle
sterben vor Scham, – sehen Sie, so würde es sein. Daher nahm ich denn
all meinen Mut zusammen, verbarg meine Scheu so gut es ging, und begab
mich zu Pjotr Petrowitsch, einerseits voll Hoffnung und andererseits
weder tot noch lebendig vor Erwartung – beides zugleich.
Nun, was soll ich Ihnen denn sagen, Warinka, es endete mit – nichts. Er
war da sehr beschäftigt und sprach gerade mit Fedossei Iwanowitsch. Ich
trat von der Seite an ihn heran und zupfte ihn ein wenig am Ärmel:
bedeutete ihm, daß ich mit ihm sprechen wolle, mit Pjotr Petrowitsch. Er
sah sich nach mir um – und da begann ich denn und sagte ungefähr: „So
und so, Pjotr Petrowitsch, wenn möglich, sagen wir etwa dreißig Rubel
usw.“ – Er schien mich zuerst nicht ganz zu verstehen, als ich ihm aber
dann nochmals alles erklärt hatte, da begann er zu lachen, sagte aber
nichts und schwieg wieder. Ich begann von neuem, er aber fragte
plötzlich: „Haben Sie ein Pfand?“ – selbst jedoch vertiefte er sich
wieder ganz in seine Papiere und schrieb weiter, ohne sich nach mir
umzusehen. Das machte mich ein wenig befangen.
„Nein,“ sagte ich, „ein Pfand habe ich nicht, Pjotr Petrowitsch“ – und
ich erklärte ihm: „So und so, ich werde Ihnen das Geld zurückzahlen,
sobald ich meine Monatsgage erhalte, werde es unbedingt tun, werde es
für meine erste Pflicht erachten.“ In diesem Augenblick rief ihn jemand
und er ging fort, ich blieb aber und erwartete ihn. Er kam denn auch
bald wieder zurück, setzte sich, spitzte seine Feder – mich aber
bemerkte er gleichsam überhaupt nicht. Ich kam jedoch wieder darauf zu
sprechen, „also so und so, Pjotr Petrowitsch, ginge es denn nicht doch
irgendwie?“
Er schwieg und schien mich wieder gar nicht zu hören, ich aber stand,
stand. – Nun, dachte ich, ich will es doch noch einmal, zum letztenmal,
versuchen, und zupfte ihn wieder ein wenig am Ärmel. Er sagte aber
keinen Ton, Warinka, entfernte nur ein Härchen von seiner Federspitze
und schrieb weiter. Da ging ich denn.
Sehen Sie, mein Kind, es sind das ja vielleicht sehr ehrenwerte
Menschen, nur stolz sind sie, sehr stolz, – nichts für unsereinen! Wo
reichen wir an diese hinan, Warinka! Deshalb, damit Sie es wissen, habe
ich Ihnen auch alles das geschrieben.
Jemeljan Iwanowitsch begann gleichfalls zu lachen und schüttelte den
Kopf, aber er machte mir doch wieder Hoffnung, der Gute. Jemeljan
Iwanowitsch ist wirklich ein edler Mensch. Er versprach mir, mich einem
gewissen Mann zu empfehlen, und dieser Mann, Warinka, der auf der
Wiborger Seite[9] wohnt, leiht gleichfalls Geld auf Prozente. Jemeljan
Iwanowitsch sagt, der werde zweifellos geben, dieser ganz bestimmt. Ich
werde morgen, mein Engelchen, gleich morgen werde ich zu ihm gehen. Was
meinen Sie dazu? Es geht doch nicht ohne Geld! Meine Wirtin droht schon,
mich hinauszujagen, und will mir nichts mehr zu essen geben. Und meine
Stiefel sind schrecklich schlecht, mein Kind, und Knöpfe fehlen mir
überall, und was mir nicht sonst noch alles fehlt! Wenn nun einer der
Vorgesetzten eine Bemerkung darüber macht? Es ist ein Unglück, Warinka,
wirklich ein Unglück!
Makar Djewuschkin.
4. August.
Lieber Makar Alexejewitsch!
Um Gottes willen, Makar Alexejewitsch, verschaffen Sie so bald als
möglich Geld! Ich würde Sie unter den jetzigen Umständen natürlich für
keinen Preis um Hilfe bitten, aber wenn Sie wüßten, in welcher Lage ich
mich befinde! Ich kann nicht mehr in dieser Wohnung bleiben, ich muß
fort! Ich habe die schrecklichsten Unannehmlichkeiten gehabt, Sie können
es sich nicht vorstellen, wie aufgeregt und verzweifelt ich bin!
Stellen Sie sich vor, mein Freund: heute morgen erscheint bei uns
plötzlich ein fremder Herr, ein schon bejahrter Mann, nahezu ein Greis,
mit Orden auf der Brust. Ich wunderte mich und begriff nicht, was er von
uns wollte. Fedora war gerade ausgegangen, um noch etwas zu kaufen. Er
begann mich auszufragen: wie ich lebe, womit ich mich beschäftige, und
darauf erklärte er mir – ohne meine Antwort abzuwarten, – er sei der
Onkel jenes Offiziers und habe sich über das flegelhafte Betragen seines
Neffen sehr geärgert: er sei sehr aufgebracht darüber, daß jener mich in
einen schlechten Ruf gebracht habe – sein Neffe sei ein leichtsinniger
Bengel, der zu nichts tauge, er aber fühle sich als Onkel verpflichtet,
die Schuld seines Neffen zu sühnen und mich unter seinen Schutz zu
nehmen. Ferner riet er mir noch, nicht auf die jungen Leute zu hören, er
dagegen habe wie ein Vater Mitleid mit mir, empfinde überhaupt
väterliche Liebe für mich und sei bereit, mir in jeder Beziehung zu
helfen.
Ich errötete, wußte aber noch immer nicht, was ich denken sollte,
weshalb ich ihm natürlich auch nicht dankte. Er nahm meine Hand und
hielt sie fest, obschon ich sie ihm zu entziehen suchte, tätschelte
meine Wange, sagte mir, ich sei gar zu reizend, und ganz besonders
gefalle es ihm, daß ich in den Wangen Grübchen habe. – Gott weiß, was er
da noch sprach! – und zu guter Letzt wollte er mich auch noch küssen: er
sei ja schon ein Greis, wie er sagte. Er war so ekelhaft! – Da trat
Fedora ins Zimmer. Er wurde ein wenig verlegen und begann wieder damit,
daß er mich wegen meiner Bescheidenheit und Wohlerzogenheit überaus
achte: er würde es sehr gern sehen, daß ich meine Scheu vor ihm verlöre.
Dann rief er Fedora beiseite und wollte ihr unter einem seltsamen
Vorwand Geld in die Hand drücken. Doch Fedora nahm es natürlich nicht
an. Da brach er denn endlich auf, wiederholte nochmals alle seine
Beteuerungen, versprach, mich nächstens wieder zu besuchen und mir dann
Ohrringe mitzubringen (ich glaube, er war zum Schluß selbst etwas
verlegen). Er riet mir außerdem, in eine andere Wohnung überzusiedeln,
und empfahl mir sogar eine, die sehr schön sei und mich nichts kosten
würde. Er sagte, daß er mich namentlich deshalb sehr liebgewonnen habe,
weil ich ein ehrenwertes und vernünftiges Mädchen sei. Darauf riet er
mir nochmals, mich vor der verderbten Jugend in acht zu nehmen, und zum
Schluß erklärte er, daß er mit Anna Fedorowna bekannt sei und sie ihn
beauftragt habe, mir zu sagen, daß sie mich besuchen werde. Da begriff
ich denn alles! Ich weiß nicht mehr, was mit mir geschah – ich habe das
zum erstenmal gefühlt und mich zum erstenmal in einer solchen Lage
befunden: ich war außer mir! Ich beschämte ihn tüchtig – und Fedora
stand mir bei und jagte ihn förmlich aus dem Zimmer. Das ist natürlich
Anna Fedorownas Machwerk – woher hätte er sonst etwas von uns erfahren
können?
Ich aber wende mich an Sie, Makar Alexejewitsch, und flehe Sie an, mir
beizustehen. Helfen Sie mir, um Gottes willen, lassen Sie mich jetzt
nicht im Stich! Bitte, bitte, verschaffen Sie uns Geld, wenn auch nur
ein wenig, wir haben nichts, womit wir die Kosten eines Umzuges
bestreiten könnten, hierbleiben aber können wir unter keinen Umständen,
das ist ganz ausgeschlossen. Auch Fedora ist der Meinung. Wir brauchen
wenigstens fünfundzwanzig Rubel. Ich werde Ihnen dieses Geld
zurückgeben, ich werde es mir schon verdienen! Fedora wird mir in den
nächsten Tagen noch Arbeit verschaffen, lassen Sie sich daher nicht
durch hohe Prozente abschrecken, sehen Sie nicht darauf, gehen Sie auf
jede Bedingung ein! Ich werde Ihnen alles zurückzahlen, nur verlassen
Sie mich jetzt nicht, um Gottes willen! Es kostet mich viel, Ihnen unter
den jetzigen Umständen mit einer solchen Bitte zu kommen, aber Sie sind
doch meine einzige Stütze, meine einzige Hoffnung!
Leben Sie wohl, Makar Alexejewitsch, denken Sie an mich, und Gott gebe
Ihnen Erfolg!
W. D.
4. August.
Mein Täubchen Warwara Alexejewna!
Sehen Sie, gerade alle diese unerwarteten Schläge sind es, die mich
erschüttern! Gerade diese schrecklichen Heimsuchungen schlagen mich zu
Boden! Dieses Lumpenpack von faden Schmarotzern und nichtswürdigen
Greisen will nicht nur Sie, mein Engelchen, auf das Krankenlager
bringen, durch alle die Aufregungen, die sie Ihnen bereiten, sondern
auch mir wollen sie, diese Schurken, den Garaus machen. Und das werden
sie, ich schwöre es, das werden sie! Ich wäre doch jetzt eher zu sterben
bereit, als Ihnen nicht zu helfen! Und wenn ich Ihnen nicht helfen
könnte, so wäre das mein Tod, Warinka, wirklich mein Tod. Helfe ich
Ihnen aber, so fliegen Sie mir schließlich wie ein Vöglein fort, und
dann werden Sie von diesen Nachteulen, diesen Raubvögeln, die Sie jetzt
aus dem Nestchen locken wollen, einfach umgebracht. Das jedoch ist es,
was mich am meisten quält, mein Kind. Aber auch Ihnen, Warinka, trage
ich eines nach: warum müssen Sie denn gleich so grausam sein? Wie können
Sie nur! Sie werden gequält, Sie werden beleidigt, Sie, mein Vögelchen,
mein kleines, armes Herzchen, haben nur zu leiden, und da – da machen
Sie sich noch deshalb Sorgen, daß Sie mich beunruhigen müssen, und
versprechen, das Geld zurückzuzahlen, und es zu erarbeiten: das aber
heißt doch in Wirklichkeit, daß Sie sich bei Ihrer schwachen Gesundheit
zuschanden arbeiten wollen, um für mich zum richtigen Termin das Geld zu
beschaffen! So bedenken Sie doch bloß, Warinka, was Sie da sprechen!
Wozu sollen Sie denn nähen und arbeiten und Ihr armes Köpfchen mit
Sorgen quälen und Ihre Gesundheit untergraben? Ach, Warinka, Warinka!
Sehen Sie, mein Täubchen, ich tauge zu nichts, zu gar nichts, und ich
weiß es selbst, daß ich zu nichts tauge, aber ich werde dafür sorgen,
daß ich doch noch zu etwas tauge! Ich werde alles überwinden, ich werde
mir noch Privatarbeit verschaffen, ich werde für unsere Schriftsteller
Abschriften machen, ich werde zu ihnen gehen, werde selbst zu ihnen
gehen und mir Arbeit von ihnen ausbitten, denn sie suchen doch gute
Abschreiber, ich weiß es, daß sie sie suchen! Sie aber sollen sich nicht
krank arbeiten: nie und nimmer lasse ich das zu!
Ich werde, mein Engelchen, ich werde unbedingt Geld auftreiben, ich
sterbe eher, als daß ich es nicht tue. Sie schreiben, mein Täubchen, ich
solle vor hohen Prozenten nicht zurückschrecken: – das werde ich gewiß
nicht, mein Kind, ich werde bestimmt nicht zurückschrecken, jetzt vor
nichts mehr! Ich werde vierzig Rubel erbitten, mein Kind. Das ist doch
nicht zu viel, Warinka, was meinen Sie? Kann man mir vierzig Rubel auf
mein Wort ohne weiteres anvertrauen? Das heißt, ich will nur wissen, ob
Sie mich für fähig halten, jemandem auf den ersten Blick hin Zutrauen
einzuflößen? So nach dem Gesichtsausdruck, meine ich, und überhaupt –
kann man mich da auf den ersten Blick hin günstig beurteilen? Denken Sie
zurück, mein Engelchen, denken Sie nach, kann ich wohl einen guten
Eindruck auf jemanden machen, der mich zum erstenmal sieht? Bin ich wohl
der Mann dazu? Was meinen Sie? Wissen Sie, man fühlt doch solch eine
Angst – krankhaft geradezu, wirklich krankhaft!
Von den vierzig Rubeln gebe ich fünfundzwanzig Ihnen, Warinka, zwei der
Wirtin und den Rest behalte ich für mich, für meine Ausgaben.
Zwar sehen Sie: der Wirtin müßte ich eigentlich mehr geben, sogar
unbedingt mehr, aber überlegen Sie es sich reiflich, mein Kind, rechnen
Sie mal zusammen, was ich nur fürs Allernotwendigste brauche: Sie werden
einsehen, daß ich ihr unter keinen Umständen mehr geben kann – folglich
lohnt es sich gar nicht, noch weiter darüber zu reden, und man kann die
Frage einfach ausschalten. Für fünf Rubel kaufe ich mir ein Paar
Stiefel. Ich weiß wirklich nicht, ob ich morgen noch mit den alten in
den Dienst gehen kann. Eine Halsbinde wäre wohl auch sehr nötig, da die
jetzige schon bald ein Jahr alt ist, doch da Sie mir aus einem alten
Schürzchen nicht nur ein Vorhemdchen, sondern auch eine Halsbinde zu
verfertigen versprachen, so will ich daran nicht weiter denken. Somit
hätten wir Stiefel und Halsbinde. Jetzt noch Knöpfe, mein Liebes! Sie
werden doch zugeben, Kindchen, daß ich ohne Knöpfe nicht auskommen kann,
von meinem Uniformrock ist aber die Hälfte der Garnitur schon
abgefallen. Ich zittere, wenn ich daran denke, daß Seine Exzellenz eine
solche Nachlässigkeit bemerken und sagen könnten – ja, was!? Das würde
ich ja doch nicht mehr hören, denn ich würde dort sterben, auf der
Stelle sterben, tot hinfallen, einfach vor Schande bei dem bloßen
Gedanken den Geist aufgeben! Ach ja, mein Kind, das würde ich! – Ja, und
dann blieben mir noch nach allen Anschaffungen drei Rubel, die blieben
mir dann zum Leben und für ein halbes Pfündchen Tabak, denn sehen Sie,
mein Engelchen, ich kann ohne Tabak nicht leben, heute aber ist es schon
der neunte Tag, daß ich mein Pfeifchen nicht mehr angerührt habe. Ich
hätte ja, offen gestanden, auch so Tabak gekauft, ohne es Ihnen vorher
zu sagen, aber man schämt sich vor seinem Gewissen. Sie dort sind
unglücklich, Sie entbehren alles, ich aber sollte mir hier gar
Vergnügungen leisten? Also deshalb sage ich es Ihnen, daß ich mich nicht
mit Gewissensbissen zu quälen brauche. Ich gestehe Ihnen ganz offen,
Warinka, daß ich mich jetzt in einer äußerst verzweifelten Lage befinde,
das heißt, bisher habe ich in meinem Leben noch nichts Ähnliches
durchgemacht. Die Wirtin verachtet mich: von Achtung oder Schätzung –
davon kann keine Rede sein. Überall Mangel, überall Schulden, im Dienst
aber, wo mich die Kollegen auch früher schon nicht auf Rosen gebettet
haben, im Dienst – nun, schweigen wir lieber davon. Ich verberge alles,
ich suche es vor allen sorgfältig zu verbergen, und auch mich selbst
verberge ich: wenn ich in den Dienst gehe, drücke ich mich nach
Möglichkeit unbemerkt und seitlich an allen vorüber. Ich habe gerade nur
noch so viel Mut, daß ich Ihnen dies offen eingestehen kann ...
Aber wie, wenn er nichts gibt?
Nein, es ist besser, Warinka, man denkt gar nicht daran und quält sich
nicht unnütz mit solchen Vorstellungen, die einem schon im voraus jeden
Mut rauben. Ich schreibe das nur deshalb, um Sie zu warnen und davor zu
bewahren, daß Sie nicht im voraus daran denken und sich mit bösen
Gedanken quälen. Tun Sie es nicht! Aber, mein Gott, was würde aus Ihnen
werden! Freilich würden Sie dann die Wohnung nicht wechseln, vielmehr
hier in meiner Nähe bleiben – aber nein, ich käme dann überhaupt nicht
mehr zurück, ich würde einfach untergehen, verschwinden, verderben!
Da habe ich Ihnen nun wieder eine lange Epistel geschrieben, und hätte
mich doch statt dessen rasieren können, denn rasiert sieht man stets
etwas sauberer und anständiger aus, das aber hat viel zu sagen und hilft
einem immer, wenn man etwas sucht. Nun, Gott gebe es! Ich werde beten
und dann – mich auf den Weg machen!
M. Djewuschkin.
5. August.
Liebster Makar Alexejewitsch!
Wenn Sie doch wenigstens nicht verzweifeln würden! Es gibt ohnehin schon
Sorgen genug! – Ich sende Ihnen dreißig Kopeken, mehr kann ich nicht.
Kaufen Sie sich dafür, was Sie da gerade am notwendigsten brauchen, um
sich wenigstens noch bis morgen irgendwie durchzuschlagen. Wir haben
selbst fast nichts mehr, was morgen aus uns werden wird – ich weiß es
nicht. Es ist traurig, Makar Alexejewitsch! Übrigens sollen Sie deshalb
den Kopf nicht hängen lassen: nun, er hat Ihnen nichts gegeben, was ist
denn schließlich dabei! Fedora sagt, noch sei es nicht so schlimm, wir
könnten noch ganz gut eine Weile hierbleiben – und selbst wenn wir in
eine andere Wohnung übergesiedelt wären, hätten wir damit doch nur wenig
gewonnen, denn wer es wolle, der könne uns überall finden. Freilich ist
es deshalb noch immer nicht schön, jetzt hierzubleiben. Wenn nicht alles
so traurig wäre, würde ich Ihnen noch mancherlei schreiben.
Was Sie doch für einen sonderbaren Charakter haben, Makar Alexejewitsch!
Sie nehmen sich alles viel zu sehr zu Herzen: deshalb werden Sie auch
immer der unglücklichste Mensch sein. Ich lese Ihre Briefe sehr
aufmerksam und sehe, daß Sie sich in einem jeden dermaßen um mich sorgen
und quälen, wie Sie sich um sich selbst noch nie gesorgt und gequält
haben. Man wird natürlich sagen, daß Sie ein gutes Herz haben. Ich aber
sage, daß Ihr Herz viel zu gut ist. Ich möchte Ihnen einen
freundschaftlichen Rat geben, Makar Alexejewitsch. Ich bin Ihnen
dankbar, sehr dankbar für alles, was Sie für mich getan haben, ich
empfinde es tief, glauben Sie mir. Also urteilen Sie jetzt selbst, wie
mir zumute ist, wenn ich sehen muß, daß Sie nach all Ihrem Unglück und
Ihren Sorgen, deren unfreiwillige Ursache ich gewesen bin, – daß Sie
auch jetzt noch nur für mich leben, gewissermaßen sogar nur um
meinetwillen leben: meine Freuden sind Ihre Freuden, mein Leid ist Ihr
Leid, und meine Gefühle sind Ihnen wichtiger, als Ihre eigenen! Wenn man
sich aber den Kummer Fremder so zu Herzen nimmt und mit allen so viel
Mitleid empfindet, dann hat man allerdings Ursache, der unglücklichste
Mensch zu sein. Als Sie heute nach dem Dienst bei uns eintraten,
erschrak ich förmlich bei Ihrem Anblick. Sie sahen so bleich, so
abgehärmt und mitgenommen, so zerstört und verzweifelt aus: Sie waren
kaum wiederzuerkennen, – und das alles nur deshalb, weil Sie sich
fürchteten, mir Ihren Mißerfolg mitzuteilen, mich zu betrüben und zu
erschrecken. Als Sie aber sahen, daß ich ob dieses kleinen Unglücks zu
lachen begann, da atmeten Sie geradezu befreit auf. Makar Alexejewitsch!
So grämen Sie sich doch nicht so, verzweifeln Sie doch nicht, seien Sie
doch vernünftig! Ich bitte Sie darum, ich beschwöre Sie! Sie werden
sehen, es wird alles gut werden, alles wird sich zum Besseren wenden.
Sie machen sich das Leben ganz unnötigerweise schwer, indem Sie sich
ewig um andere grämen und sorgen.
Leben Sie wohl, mein Freund! Ich bitte Sie nochmals, sorgen Sie sich
nicht um mich!
W. D.
Mein Täubchen Warinka!
Nun gut, mein Engelchen, also gut! Sie sind zu der Überzeugung gelangt,
daß es noch kein Unglück ist, daß ich das Geld nicht erhalten habe. Nun
gut, ich bin also beruhigt und glücklich. Ich bin sogar froh, weil Sie
mich Alten nicht verlassen und jetzt in dieser Wohnung bleiben. Ja und
wenn man schon alles sagen soll, so muß ich gestehen, daß mein Herz voll
Freude war, als ich las, wie Sie in Ihrem Briefchen so schön über mich
schrieben und sich über meine Gefühle so lobend äußerten. Ich sage das
nicht aus Stolz, sondern weil ich sehe, daß Sie mich gern haben müssen,
wenn Sie sich gerade um mein Herz so beunruhigen. Gut: doch was soll man
jetzt noch viel von meinem Herzen reden! Das Herz ist eine Sache für
sich, – aber Sie sagen da, Kindchen, daß ich nicht kleinmütig sein soll.
Ja, mein Engelchen, Sie haben recht, daß es überflüssig ist, daß man ihn
wirklich nicht braucht – den Kleinmut, meine ich. Aber, bei alledem:
sagen Sie mir jetzt bloß, mein Liebling, in welchen Stiefeln ich mich
morgen in den Dienst begeben soll? – Da sehen Sie, mein Kind, wo der
Haken sitzt. Dieser Gedanke kann doch einen Menschen zugrunde richten,
kann ihn einfach vernichten. Die Hauptursache, meine Gute, ist freilich,
daß ich mich nicht um meinetwillen so sorge, daß ich nicht um
meinetwillen darunter leide. Mir persönlich ist das doch ganz gleich,
und müßte ich auch in der größten Kälte ohne Mantel und Stiefel gehen:
ich würde schon alles aushalten, mir macht es nichts aus, ich bin doch
ein einfacher, ein geringer Mensch. Aber was werden die Leute dazu
sagen? – was werden meine Feinde sagen, und alle diese boshaften Zungen,
wenn ich ohne Mantel komme? Man trägt ihn ja doch nur um der Leute
willen, und auch die Stiefel trägt man nur ihretwegen. Die Stiefel sind
in diesem Falle, mein Kindchen, mein Herzchen, nur zur Aufrechterhaltung
der Ehre und des guten Rufes nötig. In zerrissenen Stiefeln aber geht
die eine wie der andere verloren – glauben Sie mir, was ich Ihnen sage,
mein Kind, verlassen Sie sich auf meine langjährige Erfahrung, hören Sie
auf mich Alten, der die Menschen kennt, und nicht auf irgend solche
Sudler.
Aber ich habe Ihnen ja noch gar nicht ausführlich erzählt, Kind, wie das
heute alles in Wirklichkeit war. Ich habe an diesem einen Morgen so viel
ausgestanden, so viele Seelenqualen durchgemacht, wie manch einer
vielleicht in einem ganzen Jahr nicht. Also nun hören Sie, wie es war:
Ich ging ganz, ganz früh von Hause fort, um ihn anzutreffen und dann
selbst noch rechtzeitig in den Dienst kommen zu können. Es war solch ein
Regenwetter heute, solch ein Schmutz! Nun, ich wickelte mich in meinen
Mantel, mein Herzchen, und ging und ging, und dabei dachte ich die ganze
Zeit: Lieber Gott! Vergib mir alle meine Übertretungen deiner Gebote und
laß meinen Wunsch in Erfüllung gehen! Wie ich an der –schen Kirche
vorüberging, bekreuzte ich mich, bereute alle meine Sünden, besann mich
aber darauf, daß es mir nicht zusteht, mit Gott dem Herrn so zu
unterhandeln. Da versenkte ich mich denn in meine eigenen Gedanken und
wollte nichts mehr ansehen. Und so ging ich denn, ohne auf den Weg zu
achten, immer weiter. Die Straßen waren leer, und die Menschen, denen
man von Zeit zu Zeit begegnete, sahen besorgt und gehetzt aus – freilich
war das auch kein Wunder: wer wird denn um diese Zeit und bei diesem
Wetter spazieren gehen? Ein Trupp schmutziger Arbeiter kam mir entgegen:
die stießen mich roh zur Seite, die Kerle. Da überfiel mich wieder
Schüchternheit, mir wurde bange, und an das Geld, um die Wahrheit zu
sagen, wollte ich überhaupt nicht mehr denken – geht man auf gut Glück,
nun, dann eben auf gut Glück!
Gerade bei der Wosnessenskij-Brücke blieb eine meiner Stiefelsohlen
liegen, so daß ich selbst nicht mehr weiß, auf was ich eigentlich
weiterging. Und gerade dort kam mir unser Schreiber Jermolajeff
entgegen, stand still und folgte mir mit den Blicken, fast so, als wolle
er mich um ein Trinkgeld bitten. Ach Gott ja, Bruderherz, dachte ich,
ein Trinkgeld, was ist ein Trinkgeld!
Ich war furchtbar müde, blieb stehen, erholte mich ein bißchen, und dann
schleppte ich mich wieder weiter. Jetzt sah ich absichtlich überall hin,
um irgendwo was zu entdecken, an das ich die Gedanken hätte heften
können, so um mich etwas zu zerstreuen, mich etwas aufzumuntern, aber
ich fand nichts: kein einziger Gedanke wollte haften bleiben, und zum
Überfluß war ich auch noch so schmutzig geworden, daß ich mich vor mir
selber schämte. Endlich erblickte ich in der Ferne ein gelbes hölzernes
Haus mit einem Giebelausbau, eine Art Villa: nun, da ist es, dachte ich
gleich, so hat es mir auch Jemeljan Iwanowitsch beschrieben – das Haus
Markoffs. (Markoff heißt er nämlich, der Mann, der Geld auf Prozente
leiht.) Nun, und da gingen mir denn die Gedanken alle ganz
durcheinander: ich wußte, daß es Markoffs Haus war, fragte aber trotzdem
den Schutzmann im Wächterhäuschen, wessen Haus denn dies dort eigentlich
sei, das heißt also, wer darin wohne. Der Schutzmann aber, solch ein
Grobian, antwortete mißmutig, ganz als ärgere er sich über mich, und
brummte nur so vor sich hin: jenes Haus gehöre einem gewissen Markoff.
Diese Polizeibeamten sind alle so gefühllose Menschen – doch was gehen
sie mich schließlich an? Immerhin war es ein schlechter und unangenehmer
Eindruck. Mit einem Wort: eins kam zum andern. In allem findet man
etwas, was gerade der eigenen Lage entspricht oder was man als
gewissermaßen zu ihr in Beziehung stehend empfindet: das ist immer so. –
An dem Hause ging ich dreimal vorüber, aber je mehr ich ging, um so
schlimmer wurde es: nein, denke ich, er wird mir nichts geben, wird mir
bestimmt kein Geld geben, ganz gewiß nicht! Ich bin doch ein fremder,
ihm völlig unbekannter Mensch, es ist eine heikle Sache, und auch mein
Äußeres ist nicht gerade einnehmend. Nun, denke ich, wie es das
Schicksal will, dann bereue ich es nachher wenigstens nicht, daß ich es
überhaupt nicht versucht habe, der Versuch wird mich ja auch nicht
gleich den Kopf kosten! Und so öffnete ich denn leise das Hofpförtchen.
Aber nun kam schon das andere Unglück: kaum war ich eingetreten, da
stürzte solch ein dummer kleiner Hofhund, so ein richtiger Hackenbeißer,
auf mich los und kläffte und kläffte, daß einem die Ohren klangen. Und
sehen Sie, immer sind es gerade derartige nichtswürdige kleine
Zwischenfälle, mein Kind, die einen aus dem Gleichgewicht bringen und
von neuem schüchtern machen, und die ganze Entschlossenheit, zu der man
sich schon zusammengerafft hat, wieder vernichten. Ich gelangte halb tot
halb lebendig ins Haus – dort aber stieß ich gleich auf ein neues
Unglück: ich sah nicht, wohin ich trat und was im halbdunklen Flur neben
der Schwelle stand – plötzlich stolperte ich über irgendein hockendes
Weib, das gerade Milch aus dem Melkgefäß in Kannen goß, und da
verschüttete sie denn die ganze Milch. Das dumme Weib schrie natürlich
und keifte sogleich und zeterte: „Siehst du denn nicht, wohin du rennst,
mach doch die Augen auf, was suchst du hier?“ und so ging es weiter ohne
Unterlaß. Ich schreibe Ihnen das alles, mein Kind, schreibe es nur
deshalb, weil mir in solchen Fällen regelmäßig etwas zustößt: das muß
mir wohl vom Schicksal schon so bestimmt sein. Ewig gerate ich mit etwas
anderem, ganz Nebensächlichem zusammen und durcheinander.
Auf das Geschrei hin kam eine alte Hexe zum Vorschein, eine
Finnländerin. Ich wandte mich sogleich an sie: ob hier Herr Markoff
wohne? Nein, sagte sie zunächst barsch, blieb dann aber stehen und
musterte mich eingehend.
„Was wollen Sie denn von ihm?“ fragte sie.
Nun, ich erklärte ihr alles: „So und so, Jemeljan Iwanowitsch ...“ –
erzählte auch alles übrige – kurz: ich käme in Geschäften! Darauf rief
die Alte ihre Tochter herbei – die kam: ein erwachsenes Mädchen, und
barfuß.
„Ruf den Vater. Er ist oben bei den Mietern. Bitte, treten Sie näher.“
Ich trat ein. Das Zimmer war – nun, wie so gewöhnlich diese Zimmer sind:
an den Wänden Bilder, größtenteils Porträts von Generälen, ein Sofa, ein
runder Tisch, Reseda und Balsaminen in Blumentöpfen – ich denke und
denke: soll ich mich nicht lieber drücken, solange es noch Zeit ist? Und
bei Gott, mein Kind, ich war wirklich schon im Begriff, fortzulaufen!
Ich dachte: ich werde lieber morgen kommen, nächstens, dann wird auch
das Wetter besser sein, ich werde noch bis dahin warten! Heute aber ist
sowieso die Milch verschüttet, die Generale sehen mich alle so böse an
... Und ich wandte mich, ich gesteh’s wirklich, schon zur Tür, Warinka,
da kam auch schon Er: – so, nichts Besonderes, ein kleines, graues
Kerlchen, mit solchen, wissen Sie, etwas heimtückischen Äuglein, dabei
in einem schmierigen Schlafrock, mit einer Schnur um den Leib.
Er erkundigte sich, welches mein Wunsch sei und womit er mir dienen
könne, worauf ich ihm sagte: „So und so, Jemeljan Iwanowitsch – etwa
vierzig Rubel,“ sagte ich, „die habe ich nötig –.“ Aber ich sprach nicht
zu Ende. An seinen Augen schon sah ich, daß ich verspielt hatte.
„Nein,“ sagte er, „tut mir leid, ich habe kein Geld. Oder haben Sie ein
Pfand?“
Ich begann, ihm zu erklären, daß ich ein Pfand zwar nicht habe,
„Jemeljan Iwanowitsch aber – und so weiter,“ mit einem Wort, ich
erklärte ihm alles, was da zu erklären war. Er hörte mich ruhig an.
„Ja, was,“ sagte er, „Jemeljan Iwanowitsch kann mir nichts helfen, ich
habe kein Geld.“
Nun, dachte ich, das sah ich ja schon kommen, das wußte ich, das habe
ich vorausgeahnt. Wirklich, Warinka, es wäre besser gewesen, die Erde
hätte sich unter mir aufgetan, meine Füße wurden kalt, Frösteln lief mir
über den Rücken. Ich sah ihn an und er sah mich an, fast als wolle er
sagen: „Nun, geh mal jetzt, mein Bester, du hast hier nichts mehr zu
suchen,“ – so daß ich mich unter anderen Umständen zu Tode geschämt
hätte.
„Wozu brauchen Sie denn das Geld?“ – (das hat er mich wirklich gefragt,
mein Kind!).
Ich tat schon den Mund auf, nur um nicht so müßig dazustehen, aber er
wollte mich gar nicht mehr anhören.
„Nein,“ sagte er, „ich habe kein Geld, sonst,“ sagte er, „sonst würde
ich mit dem größten Vergnügen ...“
Ich machte ihm wieder und immer wieder Vorstellungen, sagte ihm, daß ich
ja nicht viel brauche, daß ich ihm alles wieder zurückgeben würde, genau
zum Termin, ja sogar noch vor dem Termin, daß er so hohe Prozente nehmen
könne, wie er nur wolle, und daß ich ihm, noch einmal, bei Gott alles
zurückzahlen werde. Ich dachte in dem Augenblick an Sie, mein
Kind, an Ihr Unglück und an Ihre Not, und dachte auch an Ihr
Fünfzigkopekenstückchen.
„Nein,“ sagte er, „wer redet hier von Prozenten, aber wenn Sie ein Pfand
hätten ... Ich habe im Augenblick kein Geld, bei Gott, ich habe keines,
sonst natürlich mit dem größten Vergnügen ...“
Ja, er schwor noch bei Gott, der Räuber!
Nun und da, meine Liebe, – ich weiß selbst nicht mehr, wie ich das Haus
verließ und wieder auf die Wosnessenskij-Brücke kam. Ich war nur
furchtbar müde, kalt war es auch und ich war ganz steifgefroren und kam
erst gegen zehn Uhr zum Dienst. Ich wollte meine Kleider etwas
abbürsten, vom Schmutz reinigen, aber der Amtsdiener sagte, das gehe
nicht an, ich würde die Bürste verderben, die Bürste sei aber
Kronseigentum. Da sehen Sie nun, mein Kind, wie ich jetzt von diesen
Leuten angesehen werde: als wäre ich noch nicht einmal eine alte Matte,
an der man die Füße abwischen kann. Was ist es denn, Warinka, was mich
so niederdrückt? – Doch nicht das Geld, das ich nicht habe, sondern alle
diese Aufregungen, und daß man mit Menschen in Berührung kommt: all
dieses Geflüster, dieses Lächeln, diese Scherzchen! Und Seine Exzellenz
kann sich doch auch einmal zufällig an mich wenden oder über mein
Äußeres eine Bemerkung machen! Ach, Kind, meine goldenen Zeiten sind
jetzt vorüber! Heute habe ich alle Ihre Briefchen nochmals durchgelesen,
– traurig, Kind! Leben Sie wohl, mein Täubchen, Gott schütze Sie!
M. Djewuschkin.
P. S. Ich wollte Ihnen, Warinka, mein Unglück halb scherzhaft
beschreiben, Warinka, aber man sieht, daß es mir nicht mehr gelingen
will, das Scherzen nämlich. Ich wollte Sie etwas zerstreuen. Ich werde
zu Ihnen kommen, ich werde zu Ihnen kommen.
11. August.
Warwara Alexejewna! Mein Täubchen! Verloren bin ich, beide sind wir
verloren, unrettbar verloren! Mein Ruf, meine Ehre – alles ist verloren!
Und ich bin es, der Sie ins Verderben gebracht hat! Ich werde geschmäht,
mein Kind, verachtet, verspottet, und die Wirtin beschimpft mich schon
laut und vor allen Menschen. Heute hat sie wieder geschrien, geschrien
und mich mit Vorwürfen überhäuft, als wäre ich ein Nichts und ein Dreck!
Und am Abend begann dann jemand von ihnen bei Ratasäjeff einen meiner
Briefe an Sie laut vorzulesen: einen Brief, den ich nicht beendet und in
die Tasche gesteckt hatte, und den ich dann irgendwie aus der Tasche
verloren haben muß. Mein liebes, liebes Kind, wie haben sie da gelacht!
Wie sie uns betitelt haben und wie sie höhnten, wie sie höhnten, die
Verräter! Ich hielt es nicht aus und ging zu ihnen und beschuldigte
Ratasäjeff des Treubruchs und sagte ihm, daß er ein Falscher sei!
Ratasäjeff aber erwiderte mir darauf, ich sei selbst ein Falscher und
beschäftige mich nur mit Eroberungen. Ich hätte sie alle getäuscht,
sagte er, im Grunde aber sei ich ja sozusagen ein Lovelace! Und jetzt,
mein Kind, werde ich nun von allen hier nur noch Lovelace genannt, einen
anderen Namen habe ich überhaupt nicht mehr! Hören Sie, mein Engelchen,
hören Sie – die wissen doch jetzt alles von uns, sind von allem
unterrichtet, und auch von Ihnen, meine Gute, wissen sie alles, alles
ist ihnen bekannt, alles, was Sie, mein Engelchen, betrifft! Und auch
der Faldoni ist jetzt mit ihnen im Bunde. Ich wollte ihn heute hier in
den kleinen Laden schicken, damit er mir ein Stückchen Wurst kaufe, aber
nein, er geht nicht, er habe zu tun, sagt er. – Du mußt doch, es ist
doch deine Pflicht, sage ich.
„Auch was Gutes – meine Pflicht!“ höhnte er, „Sie zahlen doch meiner
Herrin kein Geld, folglich gibt’s da nichts von Pflicht.“
Das ertrug ich nicht, Kind, von diesem ungebildeten, frechen Menschen
eine solche Beleidigung, und so schalt ich ihn denn einen „Dummkopf!“,
er aber sagte mir darauf bloß kurz: „Das sagt mir nun so einer!“ – Ich
dachte erst, daß er betrunken sei, hielt es ihm denn auch vor: „Hör
mal,“ sagte ich, „du bist wohl betrunken?“ – Er aber grobte mich an:
„Haben Sie mir denn was zu trinken gegeben? Sie haben doch nicht einmal
so viel, daß Sie sich selber betrinken könnten!“ und dann brummte er
noch: „Das soll nun ein Herr sein!“
Da sehen Sie jetzt, wie weit es mit uns gekommen ist, mein Kind! Man
schämt sich, zu leben, Warinka! Ganz wie ein Verrufener kommt man sich
vor, schlimmer noch als irgendein Landstreicher. Schwer ist es, Warinka!
Verloren bin ich, einfach verloren! Unrettbar verloren!
M. D.
13. August.
Lieber Makar Alexejewitsch!
Uns sucht jetzt ein Unglück nach dem anderen heim, auch ich weiß nicht
mehr, was man noch tun soll! Was wird nun aus Ihnen werden, auf meine
Arbeit können wir uns auch nicht mehr verlassen. Ich habe mir heute mit
dem Bügeleisen die linke Hand verbrannt: ich ließ es versehentlich
fallen und beschädigte und verbrannte mich, gleich beides zusammen.
Arbeiten kann ich nun nicht, und Fedora ist auch schon den dritten Tag
krank. Oh, diese Sorge und Angst!
Hier sende ich Ihnen dreißig Kopeken: das ist fast das Letzte, was wir
haben, Gott weiß, wie gern ich Ihnen jetzt in Ihrer Not helfen würde. Es
ist zum Weinen!
Leben Sie wohl, mein Freund! Sie würden mich sehr beruhigen, wenn Sie
heute zu uns kämen.
W. D.
14. August.
Makar Alexejewitsch!
Was ist das mit Ihnen? Sie fürchten wohl Gott nicht mehr? Und mich
bringen Sie um meinen Verstand. Schämen Sie sich denn nicht!? Sie
richten sich zugrunde. So denken Sie doch an Ihren Ruf! Sie sind ein
ehrlicher, ehrenwerter, strebsamer Mensch – was werden die Menschen
sagen, wenn sie das erfahren? Und Sie selbst, Makar Alexejewitsch, Sie
werden doch vergehen vor Scham! Oder tut es Ihnen nicht mehr leid um
Ihre grauen Haare? So fürchten Sie doch wenigstens Gott!
Fedora sagt, daß sie Ihnen jetzt nicht mehr helfen werde, und auch ich
kann Ihnen unter diesen Umständen kein Geld mehr schicken. Was haben Sie
aus mir gemacht, Makar Alexejewitsch! Sie denken wohl, es sei mir ganz
gleichgültig, daß Sie sich so schlecht aufführen. Sie wissen noch nicht,
was ich Ihretwegen auszustehen habe! Ich kann mich gar nicht mehr auf
unserer Treppe zeigen: alle sehen mir nach, alle weisen mit dem Finger
auf mich und sagen solche Schändlichkeiten, – ja, sie sagen geradezu,
daß ich mit einem _Trunkenbold ein Verhältnis habe_. Wie glauben Sie,
daß mir zumute ist, wenn ich so etwas hören muß! Und wenn man Sie nach
Hause bringt, sagt alles mit Verachtung von Ihnen: „Da wird der Beamte
wieder gebracht.“ Ich aber – ich schäme mich zu Tode für Sie. Ich
schwöre Ihnen, daß ich diese Wohnung hier verlassen werde. Und sollte
ich auch Stubenmagd oder Wäscherin werden – hier bleibe ich auf keinen
Fall!
Ich schrieb Ihnen, daß ich Sie erwarte, Sie sind aber nicht gekommen.
Meine Tränen und Bitten sind Ihnen also schon gleichgültig, Makar
Alexejewitsch? Aber sagen Sie doch, wo haben Sie denn nur das Geld dazu
aufgetrieben? Um Gottes willen, nehmen Sie sich in acht! Sie werden doch
sonst verkommen, ganz sicher verkommen! Und diese Schande, diese
Schmach! Gestern hat die Wirtin Sie nicht mehr hineingelassen, da haben
Sie auf der Treppe die Nacht verbracht – ich weiß alles. Wenn Sie
wüßten, wie weh es mir tat, als ich das von Ihnen hören mußte!
Kommen Sie zu uns, hier wird es Ihnen leichter werden: wir können
zusammen lesen, können von früheren Zeiten reden. Fedora kann uns von
ihren Erlebnissen erzählen. Makar Alexejewitsch, tun Sie es mir nicht
an, daß Sie sich zugrunde richten, Sie richten damit auch mich zugrunde,
glauben Sie es mir! Ich lebe doch nur noch für Sie allein, nur
Ihretwegen bleibe ich hier. Und Sie sind jetzt so! Seien Sie doch ein
anständiger Mensch, seien Sie doch charakterfest und standhaft, auch im
Unglück. Sie wissen doch: Armut ist keine Schande. Und weshalb denn
verzweifeln? Das ist doch alles nur vorübergehend. Gott wird uns schon
helfen und alles wird wieder gut werden, wenn Sie sich nur jetzt noch
etwas zusammennehmen!
Ich sende Ihnen zwanzig Kopeken, kaufen Sie sich dafür Tabak, oder was
Sie da wollen, nur geben Sie sie um Gottes willen nicht für Schlechtes
aus. Kommen Sie zu uns, kommen Sie unbedingt zu uns! Sie werden sich
vielleicht wieder schämen, wie neulich – aber lassen Sie das, das wäre
ja bloß falsche Scham. Wenn Sie nur aufrichtig bereuen wollten!
Vertrauen Sie auf Gott. Er wird alles zum besten wenden.
W. D.
19. August.
Warwara Alexejewna, mein Kindchen!
Ich schäme mich, mein Sternchen, ich schäme mich. Doch übrigens,
Liebling, was ist denn dabei so Besonderes? Warum soll man nicht sein
Herz etwas erleichtern? Sieh: ich denke dann nicht mehr an meine
Stiefelsohlen – eine Sohle ist doch nichts und bleibt ewig nur eine
einfache, gemeine, schmutzige Stiefelsohle. Und auch Stiefel sind
nichts! Sind doch die griechischen Weisen ohne Stiefel gegangen, wozu
also soll sich unsereiner mit einem so nichtswürdigen Gegenstande
abgeben? Warum mich deshalb gleich beleidigen und verachten? Ach, Kind,
mein Kind, da haben Sie nun etwas gefunden, das Sie mir schreiben
können! – Der Fedora aber sagen Sie, daß sie ein närrisches,
unzurechnungsfähiges Weib ist, mit allerlei Schrullen im Kopf, und zum
Überfluß auch noch dumm, unsagbar dumm! Was aber meine grauen Haare
betrifft, so täuschen Sie sich auch darin, meine Gute, denn ich bin noch
lange nicht so ein Alter, wie Sie denken.
Jemeljä läßt Sie grüßen. Sie schreiben, Sie hätten sich gegrämt und
hätten geweint, und ich schreibe Ihnen, daß auch ich mich gegrämt habe
und weine. Zum Schluß aber wünsche ich Ihnen Gesundheit und Wohlergehen,
und was mich betrifft, so bin ich gleichfalls gesund und wohl und
verbleibe mit besten Grüßen, mein Engelchen, Ihr Freund
Makar Djewuschkin.
21. August.
Sehr geehrtes Fräulein und liebe Freundin, Warwara Alexejewna!
Ich fühle es, daß ich schuldig bin, ich fühle es, daß Sie mir viel zu
verzeihen haben, aber meiner Meinung nach ist damit nichts gewonnen,
Kind, daß ich alles dies fühle. Ich habe das alles auch schon vor meinem
Vergehen gefühlt, bin aber dann doch gefallen, im vollen Bewußtsein
meiner Schuld.
Kind, mein Kind, ich bin nicht hartherzig und böse. Um aber Ihr
Herzchen, mein Täubchen, zerfleischen zu können, müßte man gar ein
blutdürstiger Tiger sein. Nun, ich habe ein Lämmerherz und, wie Ihnen
bekannt sein dürfte, keine Veranlagung zu blutdürstiger
Raubtierwildheit. Folglich bin ich, mein Engelchen, nicht eigentlich
schuld an meinem Vergehen, ganz wie mein Herz und meine Gedanken nicht
schuldig sind. Das ist nun einmal so, und ich weiß es selbst nicht, was
oder wer eigentlich die Schuld trägt. Das ist nun schon so eine dunkle
Sache mit uns, mein Kind!
Dreißig Kopeken haben Sie mir geschickt und dann noch zwanzig Kopeken:
mein Herz weinte, als ich Ihre Waisengeldchen in Händen hielt. Sie haben
sich das Händchen verbrannt und verletzt und bald werden Sie hungern
müssen. Trotzdem schreiben Sie, ich soll mir noch Tabak kaufen. Nun
sagen Sie selbst: was sollte ich denn tun? Einfach und ohne alle
Gewissensbisse, recht wie ein Räuber Sie armes Waisenkindchen zu
berauben anfangen?! Es sank mir eben der Mut, mein Kind, das heißt,
zuerst fühlte ich nur unwillkürlich, daß ich zu nichts tauge und daß ich
selbst höchstens nur um ein Geringes besser sei, als meine Stiefelsohle.
Ja, ich hielt es sogar für unanständig, mich für irgend etwas von
Bedeutung, und wärs etwas noch so Geringes, zu halten, sondern fing an,
in mir etwas Unwürdiges und bis zu einem gewissen Grade geradezu
Gemeines und Niederes zu sehen. Nun, und als ich so die rechte
Selbstachtung verloren hatte und mich der Verneinung der eigenen guten
Eigenschaften und der Verleugnung meiner Menschenwürde überließ, da war
denn schon so gut wie alles verloren, und er konnte kommen, der Sturz,
der unvermeidliche! Das war mir offenbar so vom Schicksal bestimmt. Ich
aber bin nicht schuld daran.
Ich ging nur hinaus, um etwas frische Luft einzuatmen. Doch da kam
gleich eins zum anderen: auch die Natur war so regnerisch, verweint und
kalt. Und dann kam mir plötzlich noch der Jemeljä entgegen. Er hatte
bereits alles versetzt, Warinka, alles, was er besaß, und schon seit
zwei Tagen hatte er kein Gotteskorn mehr im Munde gehabt, so daß er
bereits solche Sachen versetzen wollte, die man überhaupt nicht
versetzen kann, weil doch niemand so etwas als Pfand annimmt.
Nun ja, Warinka, da gab ich ihm denn nach, und zwar mehr aus Mitleid mit
der Menschheit als aus eigenem Verlangen. So kam es zu jener Sünde, mein
Kind! Wir weinten beide, Warinka! – sprachen auch von Ihnen! Er ist ein
sehr guter, ein herzensguter Mensch, und ein sehr gefühlvoller Mensch.
Das fühlte ich alles, mein Kind, und deshalb ist es denn auch so
gekommen, eben weil ich das alles fühlte.
Ich weiß, wieviel Dank, mein Täubchen, ich Ihnen schuldig bin! Als ich
Sie kennen lernte, begann ich, auch mich selbst besser kennen zu lernen
und Sie zu lieben. Bis dahin aber, mein Engelchen, war ich immer einsam
gewesen und hatte eigentlich nur so mein Leben verdämmert und gar nicht
wirklich auf der Erde gelebt, wie die anderen! Die bösen Menschen, die
da ewig sagten, daß meine Erscheinung einfach ruppig sei, und sich
schämten, mit mir zu gehen, brachten mich so weit, daß auch ich mich
schließlich ruppig fand und mich meiner selbst zu schämen begann. Sie
sagten, ich sei stumpfsinnig, und ich dachte auch wirklich, daß ich
stumpfsinnig sei. Seitdem Sie aber in mein Leben getreten sind, haben
Sie es mir hell gemacht, so daß es in meinem Herzen wie in meiner Seele
licht geworden ist. Ich lernte endlich so etwas wie Seelenfrieden kennen
und erfuhr, daß ich nicht schlechter war als die anderen. Daß ich dabei
bin, wie ich bin, daß ich durch nichts glänze, keinen Schliff besitze,
keine Umgangsformen: das ist nun einmal so. Trotzdem bin ich immer noch
ein Mensch, ja, bin mit dem Herzen und den Gedanken ein ganzer Mensch!
Nun, und dann, als ich fühlte, daß das Schicksal mich verfolgte, als
ich, durch das Schicksal erniedrigt, zuließ, daß ich meine Menschenwürde
selber vernichtete, als ich unter der Last meiner Anfechtungen
zusammenbrach, da habe ich eben den Mut verloren: und das war das
Unglück!
Doch da Sie jetzt alles wissen, mein Kind, bitte ich Sie unter Tränen,
mich nie mehr über diesen Zwischenfall auszufragen oder auch nur davon
zu reden, denn mein Herz ist schon ohnehin zerrissen und das Leben wird
mir schwer und bitter.
Ich bezeuge Ihnen, mein Kind, meine Ehrerbietung und verbleibe Ihr
treuer
Makar Djewuschkin.
3. September.
Ich habe meinen letzten Brief nicht beendet, Makar Alexejewitsch, es
fiel mir zu schwer, zu schreiben. Bisweilen habe ich Augenblicke, wo es
mich freut, allein zu sein, allein meinem Kummer nachhängen zu können,
allein, ganz allein die Qual auszukosten, und solche Stimmungen
überfallen mich jetzt immer häufiger. In meinen Erinnerungen liegt etwas
mir Unerklärliches, das mich unwiderstehlich gefangen nimmt, und zwar in
einem solchen Maße, daß ich oft stundenlang für alles mich Umgebende
vollständig unempfindlich bin und die Gegenwart, alles Gegenwärtige,
vergesse. Ja, es gibt in meinem jetzigen Leben keinen Eindruck,
gleichviel welcher Art, der mich nicht an etwas Ähnliches aus meinem
früheren Leben erinnerte, am häufigsten an meine Kindheit, meine goldene
Kindheit! Doch nach solchen Augenblicken wird mir immer unsäglich schwer
zumute. Ich fühle mich ganz entkräftet, meine Schwärmerei erschöpft mich
und meine Gesundheit wird sowieso schon immer schwächer.
Doch dieser frische, helle, glänzende Herbstmorgen, wie wir ihn jetzt
selten haben, hat mich heute neu belebt und mit Freude erfüllt. So haben
wir schon Herbst! O, wie liebte ich den Herbst auf dem Lande! Ich war ja
damals noch ein Kind, aber doch fühlte und empfand ich schon alles in
gesteigertem Maße. Den Abend liebte ich im Herbst eigentlich mehr als
den Morgen. Ich erinnere mich noch – nur ein paar Schritte weit von
unserem Hause, am Berge, lag der See. Dieser See – es ist mir, als sehe
ich ihn jetzt wirklich vor mir – so hell und rein, wie Kristall! War der
Abend ruhig, dann spiegelte sich alles im See. Kein Blatt rührte sich in
den Bäumen am Ufer, der See lag blank und regungslos wie ein großer
Spiegel. Frisch und kühl! Im Grase blinkt der Tau. In einer Hütte fern
am Ufer brennt schon das Herdfeuer, die Herden werden heimgetrieben – da
schleiche ich denn heimlich aus dem Hause zum See und schaue und schaue
und vergesse ganz, daß ich bin. Ein Bündel Reisig brennt bei den
Fischern dicht am Ufer und der Feuerschein fließt in einem langen
Streifen auf dem Wasserspiegel zu mir hin. Der Himmel ist blaßblau und
kalt und im Westen über dem Horizont ziehen sich rote feurige Streifen,
die nach und nach bleicher werden und schließlich ganz blaß vergehen.
Der Mond geht auf. Die Luft ist so klar, so regungslos still – bald
fliegt ein Vogel auf oder rauscht das Schilf leise unter einem Windhauch
– alles, selbst das leiseste Geräusch ist deutlich zu hören. Über dem
blauen Wasser erhebt sich langsam weißer Nebel, so leicht und
durchsichtig. In der Ferne dunkelt es, es ist, als versinke dort alles
im Nebel, in der Nähe aber ist alles so scharf umrissen – das Boot, das
Ufer, die Insel – eine alte Tonne, die im Schilf vergessen ist,
schaukelt kaum-kaum merklich auf dem Wasser, ein Weidenzweig mit
vertrockneten Blättern liegt nicht weit von ihr im Schilf. Eine
verspätete Möve fliegt auf, taucht ins Wasser, fliegt wieder auf und
verschwindet im Nebel, – und ich schaute und horchte, – wundervoll, so
wundervoll war mir zumut! Und doch war ich noch ein Kind! ...
Ich liebte den Herbst, namentlich den Spätherbst, wenn das Korn schon
eingeerntet ist, die Feldarbeiten beendet sind, man des Abends in den
Hütten zusammenkommt und alle sich auf den Winter vorbereiten. Dann
werden die Tage dunkler, der Himmel bewölkt sich, die Wälder werden
gelb, das Laub fällt von den Bäumen und die Bäume stehen kahl und
schwarz, – namentlich abends, wenn sich noch feuchter Nebel erhebt, dann
erscheinen sie wie dunkle, unförmige Riesen, wie schreckliche
Gespenster. Und wenn man sich auf dem Spaziergang etwas verspätet und
hinter den anderen zurückbleibt – wie eilt man ihnen dann nach, und wie
groß wird die Bangigkeit! Man zittert wie ein Espenblatt, auf einmal –
hinter jenem Baumstamm – hat sich dort nicht etwas Schreckliches
versteckt, das gleich hervorlugen wird? Und da fährt der Wind durch den
Wald und es braust und rauscht und dazwischen scheinen Stimmen zu heulen
und zu klagen, und Blätter fliegen durch die Luft und wirbeln im Winde,
und plötzlich zieht rauschend mit gellem Geschrei eine ganze Wolke
Zugvögel vorüber. Die Angst wächst ins Riesenhafte, und da ist es – als
hörte man jemand, eine fremde Stimme raunen: „Laufe, laufe, Kind,
verspäte dich nicht, hier wird alles gleich voll Grauen sein, laufe,
Kind!“ – und Entsetzen erfaßt das Herz und man läuft und läuft, bis man
außer Atem zu Hause anlangt. Im Hause aber ist Leben und Fröhlichkeit:
uns Kindern wird eine Arbeit gegeben, Erbsen auszuhülsen oder
Mohnkörnchen aus den Kapseln zu schütteln. Im Ofen prasselt das Feuer,
Mama beaufsichtigt lächelnd unsere fröhliche Arbeit und die alte
Kinderfrau Uljana erzählt uns schreckliche Märchen von Zauberern und
Räubern. Und wir Kinder rücken ängstlich einander näher, aber das
Lächeln will doch nicht von den Lippen weichen. Und plötzlich ist alles
still ... Hu! da, ein Surren und Klopfen – pocht jemand an der Tür? –
Nein, es ist nur das Spinnrad der alten Frolowna! Und wie wir lachen!
Dann aber kommt die Nacht, und man kann vor Angst nicht schlafen,
Schreckbilder und Träume verscheuchen die Müdigkeit. Und wacht man auf,
so wagt man nicht sich zu rühren und liegt zitternd bis zum Morgengrauen
unter der Decke. Wenn aber dann die Sonne in das Zimmer scheint, steht
man doch wieder frisch und munter auf und schaut neugierig durch das
Fenster: auf dem Stoppelfelde liegt silbriger Herbstreif und alle Bäume
und Büsche sind bereift. Wie eine dünne Glasscheibe hat sich Eis auf dem
See gebildet, und die Vögel zwitschern lustig. Und Sonne, überall Sonne,
wie Glas bricht das dünne Eis unter den warmen Strahlen. So hell ist es,
so klar, so ... so wonnig!
Im Ofen prasselt wieder das Feuer, wir setzen uns an den Tisch, auf dem
schon der Ssamowar summt, und durch das Fenster sieht unser schwarzer
Hofhund Polkan und wedelt schmeichelnd mit dem Schwanz. Ein Bäuerlein
fährt am Hause vorüber, in den Wald, nach Holz. Alle sind so zufrieden,
so frohgemut! ... In den Scheunen sind ganze Berge von Korn aufgehäuft,
in der Sonne glänzt goldgelb die Strohdeckung der großen, großen
Heuschober – es ist eine wahre Lust, das alles anzusehen! Und alle sind
ruhig, alle sind froh: alle fühlen den Segen Gottes, der ihnen in der
Ernte zuteil wurde, alle wissen, daß sie im Winter nicht darben werden,
und der Bauer weiß, daß er seinen Kindern Brot zu geben hat und sie satt
sein werden. Deshalb hört man abends die Lieder der Mädchen, die
fröhlich ihren Reigen tanzen, deshalb sieht man sie alle am Feiertage
ihr Dankgebet im Gotteshause sprechen ... Ach wie wundervoll, wie
wundervoll war meine Kindheit! ...
Da habe ich jetzt wie ein Kind geweint. Daran sind natürlich nur diese
Erinnerungen schuld. Ich habe so lebhaft, so deutlich alles vor mir
gesehen, die ganze Vergangenheit lebte auf, und die Gegenwart erscheint
mir jetzt doppelt trüb und dunkel! ... Wie wird das enden, was wird aus
uns werden? Wissen Sie, ich habe das seltsame Vorgefühl oder sogar die
Überzeugung, daß ich in diesem Herbst sterben werde. Ich fühle mich
sehr, sehr krank. Ich denke oft an meinen Tod, aber eigentlich möchte
ich doch nicht so sterben – würde nicht in dieser Erde ruhen wollen ...
Vielleicht werde ich wieder krank, wie im Frühling, denn ich habe mich
von jener Krankheit noch nicht erholt.
Fedora ist heute für den ganzen Tag ausgegangen und ich bin allein. Seit
einiger Zeit fürchte ich mich, wenn ich allein bin: es scheint mir dann
immer, daß noch jemand mit mir im Zimmer ist, daß jemand zu mir spricht,
und zwar besonders dann, wenn ich aus meinen Träumereien, die mich mit
ihren Erinnerungen ganz gefangen nehmen und die Wirklichkeit vergessen
lassen, plötzlich erwache und mich umsehe. Es ist mir dann, als habe
sich etwas Unheimliches im Zimmer versteckt. Sehen Sie, deshalb habe ich
Ihnen auch einen so langen Brief geschrieben: wenn ich schreibe, vergeht
es wieder – Leben Sie wohl. Ich schließe meinen Brief, ich habe weder
Papier noch Zeit, um weiterzuschreiben. Von dem Gelde für meine
verkauften Kleider und den Hut habe ich nur noch einen Rubel. Sie haben
Ihrer Wirtin zwei Rubel gegeben, das ist gut: jetzt wird sie hoffentlich
eine Weile schweigen. – Versuchen Sie doch, Ihre Kleider irgendwie ein
wenig auszubessern. Leben Sie wohl, ich bin so müde. Ich begreife nicht,
wovon ich so schwach geworden bin. Die geringste Beschäftigung ermüdet
mich. Wenn Fedora mir eine Arbeit verschafft – wie soll ich dann
arbeiten? Das ist es, was mir den Mut raubt.
W. D.
5. September.
Mein Täubchen Warinka!
Heute, mein Engelchen, habe ich viele Eindrücke empfangen. Mein Kopf tat
mir den ganzen Tag über weh. Um die Kopfschmerzen zu vertreiben, ging
ich schließlich hinaus: ich wollte längs der Fontanka wenigstens etwas
frische Luft schöpfen. Der Abend war düster und feucht. Jetzt dunkelt es
doch schon um sechs! Es regnete nicht, aber es war neblig, was noch
unangenehmer zu sein pflegt, als ein richtiger Regen. Am Himmel zogen
die Wolken in langen, breiten Streifen dahin. Viel Volk ging auf dem
Kai. Es waren lauter schreckliche Gesichter, die ich sah, Gesichter, wie
sie einen geradezu schwermütig machen können, betrunkene Kerle,
stumpfnäsige finnländische Weiber in Männerstiefeln und mit strähnigem
Haar, Handwerker und Kutscher, Herumtreiber jeden Alters, Bengel:
irgendein Schlosserlehrling in einem gestreiften Arbeitskittel, so ein
ausgemergelter, blutarmer Junge mit schwarzem, rußglänzendem Gesicht,
ein Schloß in der Hand, oder irgendein ausgedienter Soldat von
Riesengröße, der Federmesserchen und billige unechte Ringe feilbietet –
das war das Publikum. Es muß wohl gerade die Stunde gewesen sein, in der
sich ein anderes dort gar nicht zeigt!
Die Fontanka ist ein breiter und tiefer Kanal, sogar Schiffe können ihn
passieren. Frachtkähne lagen da, in einer solchen Menge, daß man gar
nicht begriff, wie ihrer nur so viele Platz hatten – denn die Fontanka
ist doch immerhin nur ein Kanal und kein Fluß. Auf den Brücken saßen
Hökerweiber mit nassen Pfefferkuchen und verfaulten Äpfeln, so
schmutzige, garstige Weiber! Es ist nichts, an der Fontanka spazieren zu
gehen! Der feuchte Granit, die hohen, dunklen Häuser: unten die Füße im
Nebel, über dem Kopf gleichfalls Nebel ... So ein trauriger, so ein
dunkler, lichtloser Abend war es heute.
Als ich in die nächste Straße, in die Gorochowaja, einbog, war es schon
ganz dunkel geworden. Man zündete gerade das Gas an. Ich war lange nicht
mehr auf der Gorochowaja gewesen – es hatte sich nicht so gemacht. Eine
belebte, großartige Straße! Was für Läden, was für Schaufenster! – alles
glänzt nur so und leuchtet ... Stoffe und Seidenzeuge und Blumen unter
Glas ... und was für Hüte mit Bändern und Schleifen! Man denkt, das sei
alles nur so zur Verschönerung der Straße ausgestellt, aber nein: es
gibt doch Menschen, die diese Sachen kaufen und ihren Frauen schenken!
Ja, eine reiche Straße! Viele deutsche Bäcker haben dort ihre Läden –
das müssen auch wohlhabende Leute sein. Und wieviel Equipagen fahren
alle Augenblicke vorüber – wie das Pflaster das nur aushält! Und alles
so feine Kutschen, die Fenster wie Spiegel, inwendig alles nur Samt und
Seide, und die Kutscher und Diener so stolz, mit Tressen und Schnüren
und Degen an der Seite! Ich blickte in alle Wagen hinein und sah dort
immer Damen sitzen, alle so geputzt und großartig. Vielleicht waren es
lauter Fürstinnen und Gräfinnen? Es war wohl gerade die Zeit, in der sie
auf Bälle fahren, zu Diners oder Soupers. Es muß doch sehr eigen sein,
eine Fürstin oder überhaupt eine vornehme Dame einmal in der Nähe zu
sehen. Ja, das muß sehr schön sein. Ich habe noch niemals eine in der
Nähe gesehen: höchstens so in einer Kutsche und im Vorüberfahren. Da
mußte ich denn heute immer an Sie denken. – Ach, mein Täubchen, meine
Gute! Während ich jetzt wieder an Sie denke, da will mir mein Herz
brechen! Warum müssen Sie denn so unglücklich sein, Warinka? Mein
Engelchen! Sind Sie denn schlechter, als jene? Sie sind gut, sind schön,
sind gebildet, weshalb ist Ihnen da ein solches Los beschieden? Warum
ist es so eingerichtet, daß ein guter Mensch in Armut und Elend leben
muß, während einem anderen sich das Glück von selbst aufdrängt? Ich
weiß, ich weiß, mein Kind, es ist nicht gut, so zu denken: das ist
Freidenkerei! Aber offen und aufrichtig, wenn man so über die
Gerechtigkeit der Dinge nachdenkt – weshalb, ja, weshalb wird nur dem
einen Menschen schon im Mutterschoß das Glück fürs ganze Leben bereitet,
während der andere aus dem Findelhaus in die Welt Gottes hinaustritt?
Und es ist doch wirklich so, daß das Glück öfter einem Närrchen
Iwanuschka zufällt.
„Du Närrchen Iwanuschka, wühle nach Herzenslust in den Goldsäcken deiner
Väter, iß, trink, freue dich! Du aber, der und der, leck dir bloß die
Lippen, mehr hast du nicht verdient, da siehst du, was du für einer
bist!“
Es ist sündhaft, mein Kind, ich weiß, es ist sündhaft, so zu denken,
aber wenn man nachdenkt, dann drängt sich einem nun einmal ganz
unwillkürlich die Sünde in die Gedanken. Ja, dann könnten auch wir in so
einer Kutsche fahren, mein Engelchen, mein Sternchen! Hohe Generäle und
Staatsbeamte würden nach einem Blick des Wohlwollens von Ihnen haschen –
und nicht unsereiner. Sie würden dann nicht in einem alten
Kattunkleidchen umhergehen, sondern in Seide und mit funkelnden
Edelsteinen geschmückt. Sie würden auch nicht so mager und kränklich
sein, wie jetzt, sondern wie ein Zuckerpüppchen, frisch und rosig und
gesund aussehen. Ich aber würde schon glücklich sein, wenn ich
wenigstens von der Straße zu Ihren hellerleuchteten Fenstern
hinaufschauen und vielleicht einmal Ihren Schatten erblicken könnte.
Allein schon der Gedanke, daß Sie dort glücklich und fröhlich sind, mein
Vögelchen, Sie, mein reizendes Vögelchen, würde mich gleichfalls
fröhlich und glücklich machen. Aber jetzt! ... Nicht genug, daß böse
Menschen Sie ins Unglück gebracht haben, nun muß auch noch ein Wüstling
Sie beleidigen! Doch bloß weil sein Rock elegant ist und er Sie durch
eine goldgefaßte Lorgnette betrachten kann, der Schamlose, bloß deshalb
ist ihm alles erlaubt, bloß deshalb muß man seine schamlosen Reden noch
untertänig anhören! Ist denn darin aber Gerechtigkeit? Und weshalb darf
man das? Weil Sie eine Waise sind, Warinka, weil Sie schutzlos sind,
weil Sie keinen starken Freund haben, der für Sie eintreten und Ihnen
Schutz und Schirm gewähren könnte!
Doch was ist das für ein Mensch, was sind das für Menschen, denen es
nichts ausmacht, eine schutzlose Waise zu beleidigen? – Das sind eben
nicht Menschen, das ist Gesindel, einfach Gesindel, ein irgendetwas, das
bloß als Summe zählt, als Begriff, ein trübes Etwas, das es in
Wirklichkeit und als Einzelwesen überhaupt nicht gibt – davon bin ich
überzeugt. Sehen Sie, _das_ sind sie, diese Leute! Und meiner Ansicht
nach, meine Liebe, verdient jener Leiermann, dem ich heute auf der
Gorochowaja begegnet bin, viel eher die Achtung der Menschen, als diese.
Er schleppt sich zwar nur kläglich umher und sammelt die wenigen
Kopeken, um seinen Unterhalt zu bestreiten, dafür aber ist er sein
eigener Herr und ernährt sich selbst. Er will nicht umsonst um Almosen
bitten, er dreht zur Freude der Menschen seine Orgel, dreht und dreht
wie eine aufgezogene Maschine – also mit anderen Worten: womit er eben
kann, damit bringt er Nutzen, auch er! Er ist arm, ist bettelarm, das
ist wahr, und er bleibt arm, dafür ist er ein ehrenwerter Armer: er ist
müde und hinfällig, und es ist kalt draußen, aber er müht sich doch, und
wenn seine Mühe auch nicht von der Art ist, wie die der anderen, er müht
sich trotzdem. Und von der Art gibt es viele ehrliche Menschen, mein
Kind, solche, die im Verhältnis zu ihrer Arbeitsleistung nur wenig
verdienen, doch dafür sich vor niemandem zu beugen brauchen, die keinen
untertänig grüßen müssen und niemand um Gnadenbrot bitten. Und so einer,
wie dieser Leiermann, bin auch ich, das heißt, ich bin natürlich etwas
ganz anderes. Aber im übertragenen Sinne, und zwar in einem ehrenwerten
Sinne, bin ich ganz so wie er, denn auch ich leiste das, was in meinen
Kräften steht. Viel ist es ja nicht, aber doch immer mehr als gar
nichts.
Ich bin nur deshalb auf diesen Leiermann zu sprechen gekommen, mein
Kind, weil ich durch die Begegnung mit ihm heute meine Armut doppelt
empfand. Ich war nämlich stehen geblieben, um dem Leiermann zuzusehen.
Es waren mir gerade so besondere Gedanken durch den Kopf gegangen – da
blieb ich denn stehen und sah ihm zu, um mich von diesen Gedanken
abzulenken. Und so stand ich denn da, auch einige Kutscher standen da,
auch ein erwachsenes Mädchen blieb stehen, und noch ein anderes, ein
ganz kleines Mädchen, das schrecklich schmutzig war. Der Leiermann hatte
sich dort vor jemandes Fenster aufgestellt. Da bemerkte ich einen
kleinen Knaben, so von etwa zehn Jahren: es wäre ein netter Junge
gewesen, wenn er nicht so kränklich, so mager und verhungert ausgesehen
hätte. Er hatte nur so etwas wie ein Hemdchen an, und ein dünnes
Höschen. So stand er, barfuß wie er war, und hörte mit offenem Mäulchen
der Musik zu – Kinder sind eben Kinder! – Augenscheinlich vergaß er sich
ganz in kindlichem Entzücken über die Puppen, die auf dem Leierkasten
tanzten, seine Händchen und Füßchen aber waren schon blau vor Kälte und
dabei zitterte er am ganzen Körper und kaute an einem Ärmelzipfelchen,
das er zwischen den Zähnen hielt – in der anderen Hand hatte er ein
Papier. Ein Herr ging vorüber und warf dem Leiermann eine kleine Münze
zu, die gerade auf das Brett fiel, auf dem die Puppen tanzten. Kaum
hörte mein Jungchen die Münze klappern, da fuhr er plötzlich aus seiner
Versonnenheit auf, sah sich schüchtern um und glaubte wohl, daß ich das
Geld geworfen habe. Und er kam zu mir gelaufen, das ganze Kerlchen
zitterte, das Stimmchen zitterte, und er streckte mir das Papier
entgegen und sagte: „Bitte, Herr!“
Ich nahm das Papier, entfaltete es und las – nun, man kennt das ja
schon: Wohltäter ... und so weiter, drei Kinder hungern, die Mutter
liegt im Sterben, habt Erbarmen mit uns! „Wenn ich vor dem Throne Gottes
stehen werde, will ich in meiner Fürbitte diejenigen nicht vergessen,
die hienieden meinen armen Kindern geholfen haben.“
Was soll man da viel reden, die Sache ist doch klar und oft genug
erlebt. Was aber – ja, was sollte ich ihm wohl geben? Nun, so gab ich
ihm denn nichts. Dabei tat er mir so leid! So ein armer kleiner Knabe,
ganz blau war er vor Kälte, und so hungrig sah er aus, und er log doch
nicht, bei Gott, er log nicht! – ich weiß, wie das ist! Schlecht ist
nur, daß diese Mütter ihre Kinder nicht schonen und sie halbnackt und
bei dieser Kälte hinausschicken. Dessen Mutter ist vielleicht so ein
dummes Weib, das nicht weiß, was zu tun seine Pflicht wäre, vielleicht
kümmert sich niemand um sie und da sitzt sie denn müßig zu Hause und tut
nichts! Vielleicht ist sie aber auch wirklich krank? Nun ja, immerhin
könnte sie sich dann an einen Wohltätigkeitsverein wenden, oder sich bei
der Polizei melden, wie es sich gehört. Aber vielleicht ist sie einfach
eine Betrügerin, die ein hungriges, krankes Kind auf die Straße
hinausschickt, um die Leute zu beschwindeln, bis das Kindchen
schließlich an irgendeiner Krankheit stirbt? Und was lernt denn der
Knabe bei diesem Betteln? Sein Herz wird hart und grausam. Er geht vom
Morgen bis zum Abend umher und bettelt. Viele Menschen gehen an ihm
vorüber, doch niemand hat Zeit für ihn. Ihre Herzen sind hart, ihre
Worte grausam.
„Fort! Pack dich! Straßenjunge!“ – das ist alles, was er an Worten zu
hören bekommt, und das Herz des Kindes krampft sich zusammen, und
vergeblich zittert der arme, verschüchterte Knabe in der Kälte. Seine
Hände und Füße erstarren. Wie lange noch, und da – er hustet ja schon –
kriecht ihm die Krankheit wie ein schmutziger, scheußlicher Wurm in die
Brust, und ehe man sich dessen versieht, beugt sich schon der Tod über
ihn, und der Knabe liegt sterbenskrank in irgendeinem feuchten,
schmutzigen, stinkenden Winkel, ohne Pflege, ohne Hilfe – das aber ist
dann sein ganzes Leben gewesen! Ja, so ist es oft – ein Menschenleben!
Ach, Warinka, es ist qualvoll, ein „um Christi willen“ zu hören und
vorübergehen zu müssen, ohne etwas geben zu können, und dem Hungrigen
sagen zu müssen: „Gott wird dir geben.“
Gewiß, manch ein „um Christi willen“ braucht einen nicht zu berühren.
(Es gibt ja doch verschiedene „um Christi willen“, mein Kind.) Manch
eines ist gewohnheitsmäßig bettlerhaft, so ein Ton, langgezogen,
eingeleiert, gleichgültig. An einem solchen Bettler ohne Gabe
vorüberzugehen, ist noch nicht so schlimm, man denkt: der ist Bettler
von Beruf, der wird es verwinden, der weiß schon, wie man es verwindet.
Aber manch ein „um Christi willen“, das von einer ungeübten, gequälten,
heiseren Stimme hervorgestoßen wird, das geht einem wie etwas
Unheimliches durch Mark und Bein, – so wie heute, gerade als ich von dem
kleinen Jungen das Papier genommen hatte, da sagte einer, der dort am
Zaun stand – er wandte sich nicht an jeden –: „Ein Almosen, Herr, um
Christi willen!“ – sagte es mit einer so stockenden, hohlen Stimme, daß
ich unwillkürlich zusammenfuhr ... unter dem Eindruck einer
schrecklichen Empfindung. Ich gab ihm aber kein Almosen: denn ich hatte
nichts. Und dabei gibt es reiche Leute, die es nicht lieben, daß die
Armen über ihr schweres Los klagen – sie seien „ein öffentliches
Ärgernis“, sagen sie, „sie seien lästig“! nichts als „lästig“: – Das
Gestöhn der Hungrigen läßt diese Satten wohl nicht schlafen?!
Ich will Ihnen gestehen, meine Liebe, ich habe alles dies zum Teil
deshalb zu schreiben angefangen, um mein Herz zu erleichtern, zum Teil
aber auch deshalb, und zwar zum größten Teil, um Ihnen eine Probe meines
guten Stils zu geben. Denn Sie werden es doch sicher schon bemerkt
haben, mein Kind, daß mein Stil sich in letzter Zeit bedeutend gebessert
hat? Doch jetzt habe ich mich, anstatt mein Herz zu erleichtern, nur in
einen solchen Kummer hineingeredet, daß ich ordentlich anfange, selbst
von Herzensgrund mit meinen Gedanken Mitgefühl zu empfinden, obschon ich
sehr wohl weiß, mein Kind, daß man mit diesem Mitgefühl nichts erreicht
... aber man läßt sich damit wenigstens in einer gewissen Weise
Gerechtigkeit widerfahren!
Ja, in der Tat, meine Liebe, oft erniedrigt man sich selbst ganz
grundlos, hält sich nicht einmal für eine Kopeke wert, schätzt sich für
weniger als ein Holzspänchen ein. Das aber kommt, bildlich gesprochen,
vielleicht nur daher, daß man selbst verschüchtert und verängstigt ist,
ganz so wie jener kleine Junge, der mich heute um ein Almosen bat.
Jetzt werde ich, mein Kind, einmal bildlich zu Ihnen reden, in einem
Gleichnis, sozusagen. Also hören Sie mich an.
Es kommt vor, meine Liebe, daß ich, wenn ich früh am Morgen auf dem Wege
zum Dienst bin, mich ganz vergesse beim Anblick der Stadt, wie sie da
erwacht und mählich aufsteht, langsam zu rauchen, zu wogen, zu brodeln,
zu rasseln und zu lärmen beginnt: so daß man sich vor diesem Schauspiel
schließlich ganz klein und gering vorkommt, als hätte man auf seine
neugierige Nase von irgend jemand einen Nasenstüber bekommen – und da
schleppt man sich denn ganz klein und still weiter, und wagt überhaupt
nicht mehr, etwas zu denken! Aber nun betrachten Sie mal, was in diesen
schwarzen, verräucherten großen Häusern vorgeht, versuchen Sie, sich das
einmal vorzustellen, und dann urteilen Sie selbst, ob es richtig war,
sich so ohne Sinn und Verstand so gering einzuschätzen und sich so
unwürdigerweise einschüchtern zu lassen. – Vergessen Sie nicht, Warinka,
daß ich bloß bildlich spreche, nur so im Gleichnis.
Nun, lassen Sie uns also mal nachsehen, was denn dort in diesen Häusern
vorgeht.
Dort in dem muffigen Winkel eines feuchten Kellerraumes, den nur die Not
zu einer Menschenwohnung machen konnte, ist gerade irgendein Handwerker
aufgewacht. Im Schlaf hat ihm, sagen wir, die ganze Zeit über nur von
einem Paar Stiefel geträumt, das er gestern versehentlich falsch
zugeschnitten – ganz als müsse einem Menschen gerade nur von solchen
Nichtigkeiten träumen! Nun, – er ist ja Handwerker, ist ein Schuster:
bei ihm ist es also noch erklärlich. Er hat kleine Kinder und eine
hungrige Frau. Übrigens, nicht Schuster allein stehen mitunter so auf,
meine Liebe. Das wäre ja noch nichts und es verlohnte sich auch nicht,
sich darüber zu verbreiten, doch nun sehen Sie, mein Kind, was hierbei
bemerkenswert ist. In demselben Hause, nur in einem anderen, höher
gelegenen Stockwerk, und in einem allerprunkvollsten Schlafgemach hat in
derselben Nacht einem vornehmen Herrn vielleicht von ganz denselben
Stiefeln geträumt, das heißt, versteht sich, von Stiefeln etwas anderer
Art, von einer anderen Fasson, sagen wir, aber doch immerhin Stiefeln
... denn in dem Sinne meines Gleichnisses sind wir schließlich alle ein
wenig und irgendwie Schuster. Aber auch das hätte wohl noch nichts auf
sich, das Schlimme jedoch ist, daß es keinen Menschen neben jenem
Reichen gibt, keinen einzigen, der ihm ins Ohr flüstern könnte: „Laß das
doch, denk nicht daran, denk nicht nur an dich allein, du bist doch kein
armer Schuster, deine Kinder sind gesund, deine Frau klagt nicht über
Hunger, so sieh dich doch um, ob du denn nicht etwas anderes, etwas
Edleres und Höheres für deine Sorgen findest, als deine Stiefel!“
Sehen Sie, das ist es, was ich Ihnen durch ein Gleichnis klar machen
wollte, Warinka. Es ist das vielleicht ein zu freier Gedanke, aber er
kommt einem mitunter, und dann drängt er sich unwillkürlich in einem
heißen Wort aus dem Herzen hervor. Und deshalb sage ich denn auch, daß
man sich ganz grundlos so gering eingeschätzt, da einen doch nur das
Geräusch und Gerassel erschreckt hat! Ich schließe damit, daß Sie, mein
Kind, nicht denken sollen, daß es eine böswillige Verdrehung sei, was
ich Ihnen hier erzähle, oder daß ich Grillen fange, oder daß ich es aus
einem Buch abgeschrieben habe. Nein, mein Kind, das ist es nicht,
beruhigen Sie sich: ich verstehe gar nicht, etwas zu verdrehen und
schlecht zu machen, auch Grillen fange ich nicht, und abgeschrieben habe
ich das erst recht nicht – damit Sie’s wissen!
Ich kam recht traurig gestimmt nach Haus, setzte mich an meinen Tisch,
machte mir etwas heißes Wasser und schickte mich dann an, ein Gläschen
Tee zu trinken. Plötzlich, was sehe ich: Gorschkoff tritt zu mir ins
Zimmer, unser armer Wohngenosse. Es war mir eigentlich schon am Morgen
aufgefallen, daß er im Korridor immer an den anderen Zimmertüren
vorüberstrich und einmal sich scheinbar an mich wenden wollte. Nebenbei
bemerkt, mein Kind, ist seine Lage noch viel, viel schlechter, als
meine. Gar keinen Vergleich kann man machen! Er hat doch eine Frau und
Kinder zu ernähren ... so daß ich, wenn ich Gorschkoff wäre, – ja, ich
weiß nicht, was ich an seiner Stelle tun würde! Also, mein Gorschkoff
kommt zu mir herein, grüßt – hat wie gewöhnlich ein Tränchen im Auge –,
macht so etwas wie einen Kratzfuß, kann aber kein Wort hervorbringen.
Ich bot ihm einen Stuhl an, allerdings einen zerbrochenen, denn einen
anderen habe ich nicht. Ich bot ihm ferner Tee an. Er entschuldigte
sich, entschuldigte sich sehr lange, endlich nahm er doch das Glas. Dann
wollte er es unbedingt ohne Zucker trinken, er entschuldigte sich wieder
und wieder, als ich ihm versicherte, daß er im Gegenteil unbedingt
Zucker dazu nehmen müsse – lange weigerte er sich so, dankte,
entschuldigte sich von neuem – schließlich legte er das kleinste
Stückchen in sein Glas und versicherte, der Tee sei ungewöhnlich süß.
Ja, Warinka, da sehen Sie, wohin die Armut den Menschen zu bringen
vermag!
„Nun, was gibt es Gutes, Väterchen?“ fragte ich ihn.
Ja, so und so, und so weiter, – „seien Sie mein Wohltäter, Makar
Alexejewitsch, stehen Sie mir bei, helfen Sie einer armen Familie! Meine
Kinder und meine Frau – wir haben nichts zu essen ... ich aber, als
Vater – was stellen Sie sich vor, was ich dabei empfinde ...“
Ich wollte ihm etwas entgegnen, er aber unterbrach mich:
„Ich fürchte hier alle, Makar Alexejewitsch, das heißt, nicht gerade,
daß ich sie fürchte, aber so, wissen Sie, man schämt sich, sie sind alle
so stolz und hochmütig. Ich würde Sie, Väterchen, gewiß nicht
belästigen,“ sagte er, „ich weiß, Sie haben selbst Unannehmlichkeiten
gehabt, ich weiß auch, daß Sie mir nicht viel geben können, aber
vielleicht werden Sie mir doch wenigstens etwas – leihen? Ich wage es
nur deshalb, Sie zu bitten, weil ich Ihr gutes Herz kenne, weil ich
weiß, daß Sie selbst Not gelitten haben, daß Sie selbst arm sind – da
wird Ihr Herz eher mitfühlen.“ Und zum Schluß bat er mich noch
ausdrücklich, ihm seine „Dreistigkeit und Unverschämtheit“ zu verzeihen.
Ich antwortete ihm, daß ich ihm von Herzen gern helfen würde, daß ich
aber selbst nichts hätte, oder doch so gut wie nichts.
„Väterchen, Makar Alexejewitsch,“ sagte er, „ich will Sie ja nicht um
viel bitten,“ – dabei errötete er bis über die Stirn – „aber meine Frau
... meine Kinder hungern ... vielleicht nur zehn Kopeken, Makar
Alexejewitsch!“
Was soll ich sagen, Warinka? Mein Herz blutete, als ich seine Bitte um
„nur zehn Kopeken“ hörte. Da war ich doch noch reich im Vergleich zu
ihm! In Wirklichkeit besaß ich allerdings nur zwanzig Kopeken, mit denen
ich für die nächsten Tage rechnete, um mich noch irgendwie bis zum
Zahltage durchzuschlagen. Und so sagte ich ihm denn auch, ich könne
wirklich nicht ... und ich erklärte ihm die Sache.
„Nur ... nur zehn Kopeken, Väterchen, wir hungern doch, Makar
Alexejewitsch ...“
Da nahm ich denn mein Geld aus dem Kästchen und gab ihm meine letzten
zwanzig Kopeken, mein Kind, – es war immerhin ein gutes Werk. Ja, die
Armut, wer die kennt! Es kam noch zu einer kleinen Unterhaltung zwischen
uns, und da fragte ich ihn denn so bei Gelegenheit, wie er eigentlich in
solche Armut geraten und wie es komme, daß er dabei doch noch in einem
Zimmer wohne, für das er im Monat ganze fünf Silberrubel zahlen müsse.
Darauf erklärte er mir denn die Sachlage. Er habe das Zimmer vor einem
halben Jahr gemietet und die Miete für drei Monate im voraus bezahlt.
Dann aber hätten sich seine Verhältnisse so verschlimmert, daß er die
weitere Miete schuldig bleiben mußte und auch nicht die Mittel zu einem
Umzuge hatte. Inzwischen erwartete er vergeblich das Ende seines
Rechtsstreites. Das aber ist so eine verzwickte Sache, Warinka. Er ist
nämlich, müssen Sie wissen, in einer gewissen Angelegenheit mit
angeklagt, und zwar handelt es sich da um die Schurkereien eines
gewissen Kaufmanns, der bei Lieferungen an die Krone irgendwie betrogen
hat. Der Betrug wurde aufgedeckt und der Kaufmann in Haft genommen,
worauf dieser letztere nun aber auch ihn, den Gorschkoff, in diese
Angelegenheit hineinzog. Zwar kann man den Gorschkoff nur einer gewissen
Fahrlässigkeit beschuldigen und ihm höchstens den Vorwurf machen, daß er
nicht umsichtig genug gewesen sei und den Vorteil der Krone außer Acht
gelassen habe. Trotzdem zieht sich die Sache schon ein paar Jahre so
hin: es herrscht immer noch nicht volle Klarheit in der Angelegenheit,
so daß auch Gorschkoff nicht freigesprochen werden kann, – „der
Ehrlosigkeit aber, die man mir vorwirft,“ sagt Gorschkoff, „des Betruges
und der Hehlerei bin ich nicht schuldig, nicht im geringsten!“ Das
ändert jedoch nichts daran, daß er wegen dieser Sache aus dem Dienst
entlassen worden ist, obschon man ihm, wie gesagt, ein eigentliches
Verschulden nicht hat nachweisen können. Auch hat er eine nicht
unbedeutende Geldsumme, die ihm gehört, und die ihm der Kaufmann nun vor
Gericht streitig macht, noch immer nicht durch den Prozeß herausbekommen
können, was um so trauriger ist, als damit gleichzeitig, wie er sagte,
noch seine Rechtfertigung zusammenhängt.
Ich glaube ihm aufs Wort, Warinka, das Gericht aber denkt anders. Es
ist, wie gesagt, eine so verzwickte Sache, daß man sie selbst in hundert
Jahren nicht entwirren könnte. Kaum hat man sie ein wenig aufgeklärt, da
bringt der Kaufmann wieder eine neue Unklarheit hinein und ändert die
Lage der Sache abermals. Ich nehme herzlichen Anteil an Gorschkoffs
Mißgeschick, meine Liebe, ich kann ihm alles so nachfühlen. Ein Mensch
ohne Stellung, niemand will ihn annehmen, da er nun einmal in dem Ruf
der Unzuverlässigkeit steht. Was sie erspart hatten, haben sie
aufgezehrt. Die Sache kann sich noch lange hinziehen – sie aber müssen
doch leben. Und da kam dann noch plötzlich zu so ungelegener Zeit ein
Kindchen zur Welt – das verursachte natürlich erst recht Ausgaben. Dann
erkrankte der Sohn – wieder Ausgaben. Und der Sohn starb – und das hat
neue Ausgaben verlangt. Auch die Frau ist krank und auch er leidet an
irgendeiner schleichenden Krankheit. Mit einem Wort, so ein Los ist
schwer, sehr schwer! Übrigens, sagte er, die Sache werde sich in einigen
Tagen nun doch entscheiden, und zwar sicher günstig für ihn, daran könne
man jetzt nicht mehr zweifeln. Ja, er tut mir leid, sehr leid, mein
Kind! Ich habe ihn denn auch recht freundlich behandelt. Er ist ja doch
ein ganz eingeschüchterter, ängstlich gewordener Mensch, er hat
Bedürfnis nach einem aufmunternden Wort, nach etwas Güte und Wohlwollen.
Da habe ich ihn denn, wie gesagt, freundlich behandelt.
Nun, leben Sie wohl, mein Kind, Christus sei mit Ihnen, bleiben Sie
gesund. Mein Täubchen Sie! Wenn ich an Sie denke, ist es mir, als lege
sich Balsam auf meine kranke Seele, und wenn ich mich auch um Sie sorge,
so sind mir doch auch diese Sorgen eine Lust.
Ihr aufrichtiger Freund
Makar Djewuschkin.
9. September.
Warwara Alexejewna, Sie mein liebes Kind!
Ich schreibe Ihnen, ganz außer mir, wie ich bin. Durch diesen Vorfall
bin ich so aufgeregt, bis zur Fassungslosigkeit aufgeregt! In meinem
Kopf dreht sich noch alles im Kreise. Ich fühle es förmlich, wie sich
ringsum alles dreht. Ach, meine Gute, meine Liebe, wie soll ich Ihnen
das nun erzählen! Das haben wir uns ja nicht mal träumen lassen! Oder
doch – ich glaube, ich habe alles vorausgeahnt, alles vorausgeahnt! Mein
Herz hat das schon vorher gewußt, hat gefühlt, wie es kam ... Und
wirklich, ich habe neulich etwas Ähnliches im Traume gesehen!
Nun hören Sie, was geschehen ist! – Ich werde Ihnen alles erzählen, ohne
diesmal auf den Stil Sorgfalt zu verwenden, ganz einfach, wie Gott es
mir eingibt.
Ich ging heute, wie gewöhnlich, frühmorgens in den Dienst. Komme hin,
setze mich, schreibe weiter. Sie müssen nämlich wissen, mein Kind, daß
ich gestern gleichfalls geschrieben habe. Nämlich gestern, da kam
Timofei Iwanowitsch zu mir und sagte: „Hier ist ein wichtiges Dokument,
das schnell abgeschrieben werden muß. Also machen Sie sich sogleich
daran – sauber und sorgfältig ... Exzellenz müssen es heute noch
unterschreiben.“ Ich muß vorausschicken, mein Engelchen, daß ich gestern
gar nicht so war, wie man eigentlich sein muß – will sagen, daß ich
eigentlich überhaupt nichts ansehen wollte. Kummer und Gram bedrückten
mich. Im Herzen war es kalt, in der Seele dunkel. Meine Gedanken aber
waren alle bei Ihnen, mein Sternchen. Nun, und da machte ich mich denn
daran, abzuschreiben ... schrieb sauber, gewissenhaft, nur – ich weiß
wirklich nicht, wie ich Ihnen das genauer erklären soll, ob mich der
leibhaftige Gottseibeiuns selber dazu verleitete oder ob da sonst welche
geheimen Kräfte mit im Spiel waren, oder ob es einfach so und nicht
anders kommen mußte: – nur ließ ich beim Abschreiben eine ganze Zeile
aus! So daß denn Gott weiß was für ein Sinn herauskam, wahrscheinlich
überhaupt kein Sinn. Das Papier wurde aber gestern zu spät fertig und
erst heute Seiner Exzellenz zur Unterschrift vorgelegt.
Nun und heute morgen – ich komme wie gewöhnlich hin, und nehme meinen
Platz neben Jemeljan Iwanowitsch ein. Ich muß Ihnen bemerken, meine
Liebe, daß ich mich seit einiger Zeit noch viel mehr schämte und noch
mehr zu verstecken suchte, als früher. Ja, in der letzten Zeit hatte ich
überhaupt niemanden mehr anzusehen gewagt. Kaum höre ich irgendwo einen
Stuhl rücken, da bin ich schon mehr tot als lebendig. Nun, und heute war
alles ebenso: ich duckte mich und saß ganz still, wie ein Igel, so daß
Jefim Akimowitsch (der spottlustigste Mensch, den es je auf Gottes
Erdboden gegeben hat) plötzlich laut zu mir sagte, so daß alle es
hörten:
„Na, Makar Alexejewitsch, was sitzen Sie denn da wie solch ein U–u–u?“ –
und dabei schnitt er eine Grimasse, daß alle, die dort ringsum saßen,
sich die Seiten hielten vor Lachen, und natürlich über mich allein
lachten, nicht über ihn. Nun, und da ging es denn los! – Ich klappte
meine Ohren zu und kniff auch die Augen zu und rührte mich nicht. So tue
ich immer, wenn sie anfangen: dann lassen sie einen eher wieder in Ruhe.
Plötzlich höre ich erregte Stimmen, hastige Schritte, ein Laufen, Rufen.
Ich höre – täuschen mich nicht meine Ohren? Man ruft mich, ruft meinen
Namen, ruft Djewuschkin! Mein Herz erzitterte, ich weiß selbst nicht,
wie es kam, daß mir der Schreck so in die Glieder fuhr, wie noch nie
zuvor in meinem Leben. Ich saß wie angewachsen auf meinem Stuhl, – ich
rührte mich nicht, ich war gleichsam gar nicht mehr ich. Aber da rief
man schon wieder, immer näher kam es, schon in nächster Nähe:
„Djewuschkin! Djewuschkin! Wo ist Djewuschkin!“ – Ich schlage die Augen
auf: vor mir steht Jewstafij Iwanowitsch – und ich höre noch, wie er
sagt:
„Makar Alexejewitsch, zu Seiner Exzellenz, schnell! Sie haben mit Ihrer
Abschrift ein schönes Unheil angerichtet!“ Das war alles, was er sagte,
aber es war auch schon genug gesagt, nicht wahr, mein Kind, es war schon
genug? Ich erstarrte, ich starb einfach, ich empfand überhaupt nichts
mehr, ich ging – das heißt, meine Füße gingen, ich selbst war weder tot
noch lebendig. Ich wurde durch ein Zimmer geführt, durch noch eines und
noch ein drittes – ins Kabinett – jedenfalls sah ich dann, daß ich dort
stand. Rechenschaft darüber, was ich dabei dachte, vermag ich Ihnen
nicht zu geben. Ich sah nur, dort standen Seine Exzellenz und um sie
herum alle die anderen. Ich glaube, ich habe nicht einmal eine
Verbeugung gemacht: ich vergaß sie! Ich war ja so bestürzt, daß meine
Lippen und meine Knie zitterten. Aber es war auch Grund dazu vorhanden,
mein Kind! Erstens schämte ich mich, und dann, als ich noch zufällig
nach rechts in einen Spiegel sah, hätte ich wohl alle Ursache gehabt, in
die Erde zu versinken. Hinzu kam: ich hatte mich doch immer so zu
verhalten gesucht, als wäre ich überhaupt nicht vorhanden, so daß es
kaum anzunehmen war, daß Seine Exzellenz überhaupt etwas von mir wußten.
Vielleicht hatten Exzellenz einmal flüchtig gehört, daß dort im vierten
Zimmer ein Beamter Djewuschkin sitzt, aber in nähere Beziehungen waren
Exzellenz nie zu ihm getreten.
Zuerst sagten Exzellenz ganz aufgebracht:
„Was haben Sie hier für einen Unsinn geschrieben, Herr! Wo haben Sie
Ihre Augen gehabt! Ein so wichtiges Dokument, das dringend abgesandt
werden muß! Und da schreiben Sie etwas so Sinnloses zusammen! Was haben
Sie sich dabei eigentlich gedacht, –“ und zugleich wandten sich seine
Exzellenz an Jewstafij Iwanowitsch. Ich hörte nur einzelne Worte wie aus
dem Jenseits: „Unachtsamkeit! Nachlässigkeit! ... nur Unannehmlichkeiten
zu bereiten ...“
Ich tat meinen Mund auf, sagte aber nichts. Ich wollte mich
entschuldigen, wollte um Verzeihung bitten, ich konnte aber nicht.
Fortlaufen – daran war nicht zu denken, nun aber ... nun geschah
plötzlich noch etwas – geschah so etwas, mein Kind, daß ich auch jetzt
noch kaum die Feder halten kann vor Scham! – Mein Knopf nämlich – nun,
hol’ ihn der Teufel! – mein Knopf, der nur noch an einem Fädchen
gebaumelt hatte, fiel plötzlich ab (ich muß ihn irgendwie berührt
haben), fiel ab, fiel klingend zu Boden und rollte, rollte – und rollte
ausgerechnet zu den Füßen Seiner Exzellenz, fiel und rollte mitten in
dieser Grabesstille, die herrschte! Das war also meine ganze
Rechtfertigung, meine ganze Entschuldigung, alles was ich Seiner
Exzellenz zu sagen hatte! Die Folgen waren auch danach! Seine Exzellenz
wurde sogleich auf mein Aussehen und meine Kleider aufmerksam. Ich
dachte daran, was ich im Spiegel erblickt hatte – das sagt wohl alles –
und plötzlich lief ich meinem Knopf nach und bückte mich, um den
Ausreißer wieder einzufangen! Ich hatte eben ganz und gar den Verstand
verloren! Ich hockte und haschte nach dem Knopf, der aber rollte und
rollte wie ein Kreisel immer in die Runde, ich jedoch tapse umher und
kriege und kriege ihn nicht – so daß ich mich also auch noch in bezug
auf meine Gewandtheit recht auszeichnete! Da fühlte ich denn, wie mich
die letzten Kräfte verließen und alles, alles verloren war! Das ganze
Ansehen war hin, der Mensch in mir vernichtet! Obendrein begann es auch
noch in meinen beiden Ohren zu summen und dazwischen war es mir, als
hörte ich irgendwo hinter der Wand Theresa und Faldoni schimpfen, wie
ich sie immer in der Küche schimpfen höre. Endlich hatte ich den Knopf,
erhob mich, richtete mich auf – doch anstatt nun die Dummheit
einigermaßen gutzumachen und stramm zu stehen, Hände an der Hosennaht –
statt dessen drücke ich den Knopf immer wieder an die Stelle, wo er
früher angenäht war und wo jetzt nur noch ein paar Fädchen hingen, ganz
als müsse das den Knopf dort ankleben, dazu aber lächelte ich noch, ja,
bei Gott, ich lächelte noch!
Exzellenz wandten sich zunächst ab, dann sahen sie mich wieder an – ich
hörte sie nur noch zu Jewstafij Iwanowitsch sagen:
„Ich bitte Sie ... sehen Sie doch, wie er aussieht! ... In welchem
Zustande! ... Was ist das mit ihm?“
Ach, meine Liebe, was war da noch zu wollen! Hatte mich ausgezeichnet,
wie man’s besser nicht machen kann! Ich höre, Jewstafij Iwanowitsch
antwortet ihm:
„... nichts zuschulden kommen lassen, nichts, Exzellenz, hat sich bisher
musterhaft aufgeführt ... gut angeschrieben ... etatsmäßiges Gehalt ...“
„Nun, dann helfen Sie ihm irgendwie,“ sagte Seine Exzellenz, „geben Sie
ihm Vorschuß ...“
„Ja, leider hat er schon soviel Vorschuß genommen, schon für
soundsoviele Monate. Offenbar sind seine Verhältnisse im Augenblick
derart ... seine Aufführung ist sonst, wie gesagt, musterhaft, tadellos
...“
Ich war, mein Engelchen, ich war wie von einem höllischen Feuer umgeben,
das mich bei lebendigem Leibe versengte und verbrannte! Ich – ich gab
einfach meinen Geist auf, ja, ich starb und war tot.
„Nun,“ sagte plötzlich Seine Exzellenz laut, „das muß also nochmals
abgeschrieben werden. Djewuschkin, kommen Sie mal her: also schreiben
Sie mir das nochmals fehlerlos ab, und Sie, meine Herren ...“ hier
wandten sich Seine Exzellenz an die übrigen und erteilten verschiedene
Aufträge, so daß sie alle einer nach dem anderen fortgingen. Kaum aber
war der letzte gegangen, da zogen Exzellenz schnell die Brieftasche
hervor und entnahmen ihr einen Hundertrubelschein. –
„Hier ... soviel ich kann, nehmen Sie – lassen Sie’s gut sein ...“ und
damit drückten sie mir den Schein in die Hand.
Ich, mein Engelchen, ich zuckte zusammen, meine ganze Seele erbebte: ich
weiß nicht mehr, wie mir geschah! Ich wollte seine Hand ergreifen, um
sie zu küssen, er aber errötete, mein Täubchen, und – ich weiche hier
nicht um Haaresbreite von der Wahrheit ab, mein Kind – und er nahm diese
meine unwürdige Hand und schüttelte sie, nahm sie ganz einfach und
schüttelte sie, ganz als wäre das die Hand eines ihm völlig
Gleichstehenden, etwa eines ebensolchen hochgestellten Mannes, wie er
selbst einer ist.
„Nun, gehen Sie,“ sagte er, „womit ich helfen kann ... Schreiben Sie das
nochmals ab, aber machen Sie keine Fehler. Und dies hier, das kann man
zerreißen ...“
Jetzt, mein Kind, hören Sie an, was ich beschlossen habe: Sie und Fedora
bitte ich, und wenn ich Kinder hätte, würde ich ihnen befehlen, daß sie
zu Gott beten sollten, und zwar so: daß sie für den eigenen leiblichen
Vater nicht beten, für Seine Exzellenz aber tagtäglich und bis an ihr
Lebensende beten sollten! Und ich will Ihnen noch etwas sagen, und das
sage ich feierlichst – also passen Sie auf, mein Kind: ich schwöre es,
daß ich – so groß auch meine Not war und wie sehr ich auch unter unserem
Geldmangel gelitten habe, zumal, wenn ich an Ihre Not und Ihr Ungemach
dachte und desgleichen an meine Erniedrigung und Unfähigkeit – also
ungeachtet alles dessen schwöre ich Ihnen, daß diese hundert Rubel mir
nicht soviel wert sind, wie diese eine Tatsache, daß Seine Exzellenz
selbst und leibhaftig mir, dem Trunkenbold, dem Geringsten unter den
Geringen, die Hand, diese meine unwürdige Hand zu drücken geruhten!
Damit haben sie mich mir selbst zurückgegeben. Damit haben sie meinen
Geist von den Toten auferweckt, mir das Leben für ewig versüßt, und ich
bin fest überzeugt, daß – so sündig ich auch vor dem Allerhöchsten sein
mag – mein Gebet für das Glück und Wohlergehen Seiner Exzellenz doch bis
zum Throne Gottes dringen und von ihm erhört werden wird! –
Mein Liebes, mein Kind! Ich bin jetzt in einer Gemütserregung, wie ich
sie noch nie erlebt habe. Mein Herz klopft zum Zerspringen und ich fühle
mich so erschöpft, als wäre mir alle Kraft abhanden gekommen.
Ich sende Ihnen hiermit 45 Rubel. 20 Rubel gebe ich der Wirtin und den
Rest von 35 behalte ich für mich: davon will ich mir für 20
Kleidungsstücke anschaffen, und 15 bleiben dann zum Leben. Nur haben
mich alle diese Eindrücke heute morgen so erschüttert, daß ich mich ganz
schwach fühle. Ich werde mich etwas hinlegen. Ich bin jetzt übrigens
ganz ruhig, vollständig ruhig. Es ist nur noch so wie ein Druck auf dem
Herzen und irgendwo dort in der Tiefe spüre ich, wie meine Seele bebt
und zittert.
Ich werde zu Ihnen kommen. Noch bin ich wie betäubt von all diesen
Empfindungen ... Gott sieht alles, mein Kind, alles!
Ihr würdiger Freund
Makar Djewuschkin.
10. September.
Mein bester Makar Alexejewitsch!
Ich freue mich unendlich über Ihr Glück und weiß die Hilfe Ihres
Vorgesetzten in ihrer ganzen Güte zu würdigen. So können Sie jetzt
endlich aufatmen und sich von Ihren Sorgen erholen! Aber nur um eines
bitte ich Sie: geben Sie das Geld um Gottes willen nicht wieder für
unnütze Sachen aus! Leben Sie ruhig und still, leben Sie möglichst
sparsam, und bitte, fangen Sie jetzt an, jeden Tag etwas Geld beiseite
zu legen, damit Sie nicht wieder so in Not geraten! Um uns brauchen Sie
sich wirklich nicht mehr zu sorgen. Werden uns schon durchschlagen. Wozu
haben Sie uns soviel Geld geschickt, Makar Alexejewitsch? Wir brauchen
es doch gar nicht ... Wir sind zufrieden mit dem, was wir uns verdienen.
Es ist wahr, wir werden bald zum Umzuge Geld nötig haben, aber Fedora
hofft, daß man ihr jetzt endlich eine alte Schuld abtragen wird. Ich
behalte also für alle Fälle zwanzig Rubel, den Rest sende ich Ihnen
zurück. Geben Sie das Geld nur nicht für Unnötiges aus, Makar
Alexejewitsch!
Leben Sie wohl! Leben Sie jetzt ganz ruhig, werden Sie gesund und
fröhlich. Ich würde Ihnen mehr schreiben, fühle mich aber schrecklich
müde. Gestern lag ich den ganzen Tag im Bett. Das ist gut, daß Sie mich
besuchen wollen. Tun Sie es doch, bitte, recht bald, Makar
Alexejewitsch. Ich erwarte Sie.
Ihre
W. D.
Meine liebe Warwara Alexejewna!
Ich flehe Sie an, meine Liebe, verlassen Sie mich jetzt nicht, jetzt, wo
ich vollkommen glücklich und mit allem zufrieden bin! Mein Täubchen!
Hören Sie nicht auf Fedora! Ich verspreche Ihnen, alles zu tun, was Sie
nur wollen. Ich werde mich gut aufführen, allein schon aus Hochachtung
für Seine Exzellenz werde ich mich ehrenhaft und anständig aufführen.
Wir werden einander wieder selige Briefe schreiben, werden uns
gegenseitig unsere Gedanken mitteilen, und unsere Freuden und Sorgen –
wenn es wieder einmal Sorgen geben sollte – miteinander teilen: und so
werden wir denn wieder einträchtig und glücklich miteinander leben. Wir
werden uns mit der Literatur beschäftigen ... Mein Engelchen! In meinem
Leben hat sich doch jetzt alles zum besseren gewendet. Meine Wirtin läßt
wieder mit sich reden. Theresa ist bedeutend klüger geworden und sogar
Faldoni wird diensteifrig. Mit Ratasäjeff habe ich mich ausgesöhnt. Ich
ging in meiner Freude selbst zu ihm. Er ist wirklich ein guter Kerl,
mein Kind, und was man von ihm Schlechtes gesagt hat, beruht auf Unsinn
und Irrtum: jetzt habe ich erfahren, daß alles nur eine häßliche
Verleumdung gewesen ist. Er hat gar nicht daran gedacht, eine Satire auf
uns zu machen. Er hat es mir selbst gesagt. Er las mir sein neuestes
Werk vor. Und was das betrifft, daß er mich damals Lovelace benannt hat:
nun – so ist das ja gar nichts Schlechtes oder gar eine unanständige
Bezeichnung. Er hat mir nämlich jetzt die Bedeutung erklärt. Lovelace
ist ein Fremdwort und bedeutet ungefähr „ein gewandter Bursche“, oder
wenn man es hübscher, sozusagen literarischer ausdrücken will: „ein
schneidiger Kavalier“. Sehen Sie, das bedeutet es, nicht aber irgend so
etwas – anderes! Es war also ein ganz unschuldiger Scherz von ihm, mein
Engelchen. Ich ungebildeter Dummkopf habe es nur gleich für eine
Beleidigung gehalten. Nun, und da habe ich mich denn auch deswegen heute
bei ihm entschuldigt ...
Das Wetter ist heute so schön, Warinka. Am Morgen hatten wir zwar
leichten Frost, aber das tut nichts: dafür ist die Luft jetzt etwas
frischer. Ich ging und kaufte mir ein Paar Stiefel – es sind wirklich
tadellos schöne Stiefel, die ich gekauft habe. Dann ging ich noch etwas
auf dem Newskij spazieren. Habe dann die Zeitung gelesen. Ja, richtig!
und das Wichtigste habe ich vergessen, Ihnen zu erzählen!
Also hören Sie jetzt, wie es war:
Heute morgen knüpfte ich mit Jemeljan Iwanowitsch und mit Akssentij
Michailowitsch ein Gespräch an: wir sprachen von Seiner Exzellenz. Ja,
Warinka, Seine Exzellenz sind nicht nur gegen mich so gütig gewesen. Sie
haben schon vielen Gutes erwiesen und die Herzensgüte Seiner Exzellenz
ist aller Welt bekannt. Viele, viele Menschen rühmen diese Güte und
vergießen Tränen der Dankbarkeit, wenn sie der ihnen erwiesenen Hilfe
gedenken. Exzellenz haben unter anderem eine arme Waise bei sich im
Hause erzogen, und die ist dann verheiratet worden, an einen angesehenen
Beamten, der zu den nächsten Untergebenen Seiner Exzellenz gehört, und
Exzellenz haben ihr dann auch noch eine Aussteuer mitgegeben. Ferner
haben Exzellenz auch noch den Sohn einer armen Witwe in einer Kanzlei
untergebracht, und noch viel, viel Gutes haben Exzellenz den Menschen
erwiesen. Ich hielt es für meine Pflicht, mein Kind, auch mein
Scherflein beizusteuern und erzählte allen laut, was Exzellenz an mir
getan: ich erzählte ihnen alles, ich verheimlichte nichts. Meine
Verlegenheit steckte ich dabei in die Tasche. Was Verlegenheit, was
Ansehen, wenn es sich um so etwas handelt! Ganz laut erzählte ich es, so
daß alle es hören konnten, ja, ganz laut, um die edelmütigen Taten
Seiner Exzellenz allen kundzutun! Ich sprach mit Eifer und Begeisterung
und errötete nicht: im Gegenteil, ich war stolz, daß ich so etwas
erzählen konnte. Und ich erzählte alles (nur von Ihnen, mein Kind,
erzählte ich zum Glück nichts, über Sie ging ich vernünftigerweise mit
Stillschweigen hinweg), aber von meiner Wirtin und Faldoni, und von
Ratasäjeff und Markoff und von meinen Stiefeln – alles das erzählte ich
rückhaltlos. Manche spotteten wohl ein bißchen, oder eigentlich
spotteten alle – alle lachten wenigstens! Wahrscheinlich haben sie an
meiner Erscheinung etwas Lächerliches gefunden. Vielleicht haben sie
auch nur über meine Stiefel gelacht – ja, ganz sicher nur über meine
Stiefel! Aber in irgendeiner schlechten Absicht haben sie gewiß nicht
gelacht, das hätten sie nie und nimmer tun können. Es kam eben nur so,
es war ihre Jugend – oder weil sie wohlhabende Leute sind. In einer
schlechten, einer häßlichen Absicht jedenfalls – da hätten sie mich und
meine Worte bestimmt nicht verspottet. Das heißt, ich meine: etwa über
Seine Exzellenz lachen – das hätten sie unter keinen Umständen getan.
Hab’ ich nicht recht, Warinka?
Ich kann eigentlich noch immer nicht ganz zur Besinnung kommen, mein
Kind. Alle diese Geschehnisse haben mich so verwirrt! Haben Sie auch
Holz zum Heizen? Sehen Sie nur zu, daß Sie sich nicht erkälten, Warinka,
wie leicht ist das geschehen! Ich bete zu Gott, mein Kind, er möge Sie
behüten und beschützen. Haben Sie zum Beispiel wollene Strümpfchen oder
was da sonst von warmen Kleidungsstücken für den Winter nötig ist? Seien
Sie nur vorsichtig, mein Täubchen. Wenn Ihnen von solchen Sachen etwas
fehlen sollte, dann kränken Sie mich Alten nicht, dann wenden Sie sich
sogleich an mich. Jetzt sind ja die schlechten Zeiten vorüber und vor
uns liegt das Leben so hell und so schön!
Aber es war doch eine traurige Zeit, Warinka! Nun ja, was soll man da
noch reden, jetzt, da sie überstanden ist! Wenn erst Jahre darüber
vergangen sein werden, dann werden wir auch an diese Zeit lächelnd
zurückdenken. Nicht wahr, wie wenn man heute so an seine Jugendjahre
zurückdenkt! Was man da nicht alles durchgemacht hat! Wie oft hatte man
nicht einen einzigen Kopeken in der Tasche. Kalt war man, hungrig war
man, aber dabei doch immer lustig. Morgens ging man über den Newskij,
begegnete einem netten Gesichtchen – und da wurde man denn für den
ganzen Tag glücklich. Eine schöne, eine wunderschöne Zeit war es doch,
mein Kind! Es ist schön, in der Welt zu leben, Warinka! Namentlich in
Petersburg. Ich habe gestern mit Tränen in den Augen vor Gott dem Herrn
meine Sünden bereut, damit er mir alle meine Sünden, die ich in dieser
traurigen Zeit begangen habe, verzeihen möge, als da sind: Freidenkerei,
Leichtsinn und Spiel. Und Ihrer, mein Kind, habe ich in meinem Gebet mit
Rührung gedacht. Sie allein, mein Engelchen, haben mich getröstet und
gestärkt, haben mir guten Rat erteilt und mir mit Ihrem Beistand über
alles Schwere hinweggeholfen. Das werde ich, mein Kind, Ihnen niemals
vergessen. Ihre Briefchen habe ich heute alle einzeln abgeküßt, mein
Täubchen, mein Engelchen! Nun, und jetzt – leben Sie wohl!
Ich habe gehört, daß hier in der Nähe jemand eine Uniform zu verkaufen
hat. Nun werde ich mich auch äußerlich wieder etwas instand setzen.
Leben Sie wohl, mein Engelchen, leben Sie wohl, auf Wiedersehen!
Ihr Ihnen innig zugetaner
Makar Djewuschkin.
15. September.
Mein lieber Makar Alexejewitsch!
Ich bin in schrecklicher Aufregung. Hören Sie, was geschehen ist. Ich
ahne etwas Verhängnisvolles. Urteilen Sie selbst, mein bester Freund:
Herr Bükoff ist in Petersburg!
Fedora ist ihm begegnet. Er ist in einem Wagen an ihr vorübergefahren,
hat sie erkannt, hat sogleich befohlen, anzuhalten, ist dann selbst auf
sie zugegangen und hat sie gefragt, wo ich wohne. Sie hat es natürlich
nicht gesagt. Darauf hat er lachend die Bemerkung hingeworfen – na, er
wisse ja schon, wer bei ihr sei. (Offenbar hat ihm Anna Fedorowna alles
erzählt.) Da ist Fedora zornig geworden und hat ihm gleich dort auf der
Straße Vorwürfe gemacht, ihm gesagt, daß er ein sittenloser Mensch sei
und ganz allein die Schuld an meinem Unglück trage. Darauf hat er
erwidert, wenn man keinen Kopeken habe, müsse man allerdings unglücklich
sein!
Fedora sagt, sie habe ihm darauf erklärt, daß ich mich sehr wohl mit
meiner Hände Arbeit ernähren, daß ich heiraten oder schlimmstenfalls
eine Stelle hätte annehmen können, jetzt aber sei mein Glück für immer
vernichtet: ich sei außerdem krank und werde wohl bald sterben.
Darauf hat er erwidert, ich sei noch gar zu jung, in meinem Kopfe gäre
es noch, und er hat hinzugefügt, unsere Tugenden seien wohl ein bißchen
trüb geworden (das sind genau seine Worte).
Wir dachten schon, Fedora und ich, daß er nicht wisse, wo wir wohnen,
doch plötzlich, gestern – kaum war ich ausgegangen, um im Gostinnyj
Dworr einige Zutaten zu kaufen – da taucht er ganz unerwartet hier auf!
Wahrscheinlich hat er mich nicht zu Hause antreffen wollen. Zunächst hat
er Fedora lange über unser Leben ausgefragt und alles bei uns genau
betrachtet, auch meine Handarbeit. Und dann hat er plötzlich gefragt:
„Was ist denn das für ein Beamter, der mit euch bekannt ist?“
In diesem Augenblick sind Sie gerade über den Hof gegangen und da hat
Fedora auf Sie hingewiesen: er hat lebhaft zum Fenster hinausgesehen und
dann gelacht. Auf Fedoras Bitte, fortzugehen, da ich von all dem Kummer
ohnehin schon krank sei und es mir sehr unangenehm wäre, ihn hier zu
sehen, hat er nichts geantwortet und eine Weile geschwiegen: dann hat er
gesagt, daß er „nur so“ gekommen sei, er habe gerade nichts zu tun
gehabt, und schließlich hat er Fedora 25 Rubel geben wollen, die sie
natürlich nicht angenommen hat.
Was könnte das alles zu bedeuten haben? Weshalb, wozu ist er zu uns
gekommen? Ich begreife nicht, woher er alles über uns erfahren haben
kann? Ich verliere mich in allen möglichen Mutmaßungen. Fedora sagt,
Axinja, ihre Schwägerin, die bisweilen zu uns kommt, sei gut bekannt mit
der Wäscherin Nastassja, ein Vetter von dieser Nastassja aber sei
Amtsdiener in dem Bureau, in dem einer der besten Freunde des Neffen von
Anna Fedorowna angestellt ist. Sollte der Klatsch nicht auf diesem
Umwege zu ihm gedrungen sein? Wir wissen selbst nicht, was wir denken
sollen. Könnte er wirklich noch einmal zu uns kommen? Der bloße Gedanke
daran entsetzt mich! Als Fedora mir gestern das alles erzählte, erschrak
ich so, daß ich fast ohnmächtig wurde – vor Angst. Was wollen diese
Menschen von mir? Ich will nichts mehr von ihnen wissen! Was gehe ich
sie an? Ach, wenn Sie wüßten, in welcher Angst ich jetzt lebe: jeden
Augenblick fürchte ich, Bükoff werde sogleich ins Zimmer treten. Was
wird aus mir werden! Was erwartet mich? Um Christi willen, kommen Sie
sogleich zu mir, Makar Alexejewitsch! Ich flehe Sie an, kommen Sie!
18. September.
Meine liebe Warwara Alexejewna!
Heute ist in unserem Hause etwas unendlich Trauriges, Unerklärliches und
ganz Unerwartetes geschehen. Doch ich will Ihnen alles der Reihenfolge
nach erzählen.
Also das Erste war, daß unser armer Gorschkoff freigesprochen wurde. Das
Urteil war wohl schon lange eine beschlossene Sache, aber erst für heute
hatte man die Verkündung des Endspruches festgesetzt. Die Sache endete
für ihn sehr günstig. All der Dinge, deren man ihn beschuldigt hatte –
der Unachtsamkeit, Nachlässigkeit usw. – wurde er freigesprochen. Das
Gericht stellte in vollem Umfange seine Ehre wieder her und verurteilte
den Kaufmann zur Auszahlung jener bedeutenden Geldsumme an Gorschkoff,
so daß sich jetzt auch seine äußere Lage mit einem Schlage gebessert
hat, da das Geld ganz sicher ist und vom Kaufmann auf gerichtlichem Wege
eingezogen werden wird. Das Wichtigste aber war natürlich, daß der
Schandfleck entfernt wurde, der mit dieser Anklage auf seiner Ehre lag.
Mit einem Wort, alle seine Wünsche gingen in Erfüllung.
Gegen drei Uhr kam er nach Hause. Er war kaum wiederzuerkennen. Sein
Gesicht war bleich wie Kreide. Die Lippen zitterten, und dabei lächelte
er in einem fort – so umarmte er seine Frau und die Kinder. Wir gingen
alle, eine ganze Schar, zu ihm, um ihn zu beglückwünschen. Ich glaube,
unsere Handlungsweise rührte ihn sehr, er dankte nach allen Seiten und
drückte einem jeden mehrmals die Hand. Ja, es schien sogar, als ob er
ordentlich gewachsen sei, wenigstens hielt er sich weit strammer, als
sonst, und auch die Augen tränten nicht mehr, sondern glänzten förmlich.
Er war so erregt, der Arme. Keine zwei Minuten hielt er es auf ein und
derselben Stelle aus: alles nahm er in die Hand, um es sogleich wieder
zurückzulegen, bald faßte er die Stuhllehnen an, lächelte, dankte, dann
setzte er sich, stand jedoch gleich wieder auf, setzte sich von neuem
und sprach Gott weiß was alles zusammen. Einmal sagte er: „Meine Ehre,
ja, meine Ehre – ein guter Name, der bleibt jetzt meinen Kindern ...“
und Sie hätten hören müssen, wie er das sagte! Die Augen standen ihm
voll Tränen, und auch wir waren den Tränen nahe. Ratasäjeff wollte wohl
ablenken und sagte deshalb:
„I, was, Väterchen, was macht man mit der Ehre, wenn man nichts zu essen
hat! Geld, Väterchen, Geld ist die Hauptsache. Für das Geld, ja dafür
können Sie Gott danken!“ – und dabei klopfte er ihm auf die Schulter.
Mir schien es, als ob Gorschkoff sich dadurch irgendwie gekränkt fühlte.
Nicht gerade, daß er den Beleidigten gespielt hätte, aber er sah doch
den Ratasäjeff so eigentümlich an und nahm zur Antwort dessen Hand von
seiner Schulter. Früher jedenfalls wäre das nicht geschehen, mein Kind.
Übrigens sind die Charaktere verschieden. Ich zum Beispiel hätte in der
Freude ganz sicher nicht gleich den Stolzen gespielt. Macht man doch,
meine Liebe, macht man doch oft genug einen ganz unnötigen Bückling,
macht ihn aus keinem anderen Grunde, als einzig aus überflüssiger
Weichheit oder in einer Anwandlung gar zu großer Gutherzigkeit ... Doch
handelt es sich hier nicht um mich –
„Ja,“ sagte Gorschkoff nach einer Weile, „auch das Geld ist gut. Gott
sei Dank ... Gott sei Dank ...“
Und dann wiederholte er noch mehrmals vor sich hin: „Gott sei Dank ...
Gott sei Dank ...“
Seine Frau bestellte ein etwas reichlicheres und besseres Mittagessen.
Unsere Wirtin kochte es selbst. Unsere Wirtin ist nämlich im Grunde eine
gute Frau.
Bis zum Essen konnte Gorschkoff keinen Augenblick stillsitzen. Er ging
zu allen in die Zimmer, gleichviel, ob man ihn aufgefordert hatte oder
nicht. Er trat ganz einfach ein, lächelte in seiner Weise, setzte sich
auf einen Stuhl, sagte irgend etwas, oder sagte auch nichts – und dann
ging er wieder. Bei unserem Seemann, bei dem man gerade spielte, nahm er
sogar Karten in die Hand und man ließ ihn auch als vierten mitspielen.
Er spielte, spielte, brachte aber nur Verwirrung ins Spiel und warf die
Karten nach drei oder vier Runden wieder hin.
„Nein, ich habe ja nur so ...“ soll er gesagt haben, „ich habe ja nur so
...“ und damit ist er wieder aus dem Zimmer gegangen.
Mir begegnete er im Korridor, ergriff meine beiden Hände und sah mir
lange in die Augen, aber mit einem ganz eigentümlichen Blick. Dann
drückte er meine Hände und ging fort, immer mit einem Lächeln auf den
Lippen, einem gleichfalls ganz eigentümlichen Lächeln, das so
unbeweglich, so bedrückend war, wie das Lächeln eines Toten. Seine Frau
weinte vor Freude. Es war bei ihnen heute wie ein rechter Feiertag. Das
Mittagessen war bald beendet. Dann, nach dem Essen, hat er plötzlich zu
seiner Frau gesagt:
„Ich will mich jetzt ein wenig hinlegen,“ – und damit hatte er sich auch
schon auf dem Bett ausgestreckt.
Gleich darauf rief er sein Töchterchen zu sich, legte die Hand auf das
Kinderköpfchen und streichelte es immer wieder. Dann wandte er sich von
neuem an seine Frau:
„Wo ist denn Petinka? Unser Petjä,“ fragte er, „unser Petinka? ...“
Die Frau bekreuzte sich und sagte, daß Petinka doch tot sei.
„Ja, ja, ich weiß, ich weiß schon, Petinka ist jetzt im Himmelreich.“
Die Frau merkte, daß er gar nicht so wie sonst war, daß die Erlebnisse
an diesem Tage ihn ganz erschüttert hatten, und sagte deshalb, er solle
doch versuchen, einzuschlafen und auszuruhen.
„Ja, gut ... ich werde gleich ... ich will nur ein wenig ...“ und damit
drehte er sich auf die Seite, lag ein Weilchen, dann wandte er sich
wieder zurück und wollte wohl noch etwas sagen. Die Frau hat ihn noch
gefragt: „Was ist, mein Freund?“ – aber er antwortete schon nicht mehr.
„Nun, er wird wohl eingeschlafen sein,“ sagte sie sich und ging aus dem
Zimmer, um mit der Wirtin Notwendiges zu besprechen. Nach etwa einer
Stunde kam sie zurück – der Mann, sah sie, war noch nicht aufgewacht, er
schlief noch ganz ruhig, ohne sich zu rühren. Sie dachte: mag er nur
schlafen und setzte sich wieder an ihre Arbeit.
Sie erzählt, daß sie wohl über eine halbe Stunde so gesessen habe, doch
könne sie nicht mehr sagen, an was sie eigentlich gedacht, obschon sie
in Nachdenken versunken gewesen sei, nur habe sie den Mann ganz
vergessen. Plötzlich aber sei sie wieder zu sich gekommen, und zwar habe
ein gewisses beunruhigendes Gefühl sie aus ihrer Traumverlorenheit
aufgeschreckt, und da sei ihr zunächst nur die Grabesstille im Zimmer
aufgefallen.
Sie blickte auf das Bett und sah, daß ihr Mann immer noch so lag, wie
vor anderthalb Stunden. Da trat sie denn zu ihm und berührte ihn – er
aber war schon kalt: ja, er war tot, Kind, Gorschkoff war tot, war ganz
plötzlich gestorben, wie vom Blitz getroffen. Woran er aber gestorben
ist, das mag Gott wissen!
Das ist’s, was mich so erschüttert hat, Warinka, daß ich noch immer
nicht recht zur Besinnung kommen kann. Ich kann es nicht glauben, daß
ein Mensch so einfach – stirbt! Dieser arme, unglückliche Mensch! Warum
mußte er denn gerade jetzt an seinem ersten Freudentage sterben! Ja, das
Schicksal, das Schicksal! Die Frau ist ganz aufgelöst in Tränen, noch
ganz verstört von dem furchtbaren Schreck. Das kleine Mädchen aber hat
sich verschüchtert in einen Winkel verkrochen. Bei ihnen ist jetzt nur
ein einziges Kommen und Gehen. Es soll noch eine ärztliche Untersuchung
stattfinden ... so heißt es, genau weiß ich das nicht. Leid tut es mir,
ach, so leid! Es ist doch traurig, wenn man bedenkt, daß man wirklich
weder Tag noch Stunde weiß ... Man stirbt so einfach mir nichts dir
nichts weg und aus ist es ...
Ihr
Makar Djewuschkin.
19. September.
Meine liebe Warwara Alexejewna!
Ich beeile mich, Ihnen mitzuteilen, mein Kind, daß Ratasäjeff mir Arbeit
verschafft hat, Arbeit für einen Schriftsteller. – Heute kam einer zu
ihm und brachte so ein dickes Manuskript – Gott sei Dank, viel Arbeit.
Nur ist es alles so unleserlich geschrieben, daß ich gar nicht weiß, wie
ich das entziffern soll, dabei wird die Arbeit so schnell verlangt.
Außerdem handelt es von so schweren Dingen, daß man es gar nicht mal
recht verstehen kann. Über den Preis sind wir auch schon einig geworden:
40 Kopeken pro Bogen. Ich schreibe Ihnen das alles nur deshalb, meine
Liebe, um Sie schneller wissen zu lassen, daß ich jetzt noch obendrein
einen Nebenverdienst haben werde. Und nun leben Sie wohl, Kind. Ich will
mich gleich an die Arbeit machen.
Ihr treuer
Makar Djewuschkin.
23. September.
Mein teurer Freund, Makar Alexejewitsch!
Ich habe Ihnen drei Tage lang nicht geschrieben, mein Freund, und doch
war es eine Zeit großer Sorge und Aufregung für mich.
Vor drei Tagen war Bükoff bei mir. Ich war allein, Fedora war
ausgegangen. Ich öffnete die Tür und erschrak dermaßen, als ich ihn
erblickte, daß ich mich nicht von der Stelle rühren konnte. Ich fühlte,
wie ich erbleichte. Er trat, wie das so seine Art ist, mit lautem Lachen
ins Zimmer, nahm ganz ungeniert einen Stuhl und setzte sich. Es dauerte
eine Weile, bis ich meine Fassung wiedergewann. Endlich setzte ich mich
wieder ans Fenster, an meine Arbeit! Er hörte übrigens bald auf, zu
lachen. Augenscheinlich hat ihn mein Aussehen doch überrascht. Ich habe
ja in der letzten Zeit so abgenommen, meine Wangen und Augen sind
eingefallen, und ich war so bleich wie eine Tote ... Ja, es muß
allerdings schwer sein für die, die mich vor einem Jahre gekannt haben,
mich jetzt wiederzusehen.
Er betrachtete mich lange und aufmerksam, endlich heiterte sich seine
Miene wieder auf. Er machte irgendeine Bemerkung – ich weiß nicht mehr,
was ich antwortete – und lachte wieder. Eine ganze Stunde saß er so bei
mir, fragte mich nach diesem und jenem und unterhielt sich mit mir ganz
ungezwungen. Endlich, bevor er aufbrach, erfaßte er meine Hand und sagte
(ich schreibe es Ihnen wortwörtlich):
„Warwara Alexejewna! Unter uns gesagt: Anna Fedorowna, Ihre Verwandte
und meine alte Bekannte und Freundin, ist ein höchst gemeines Weib.“ (Er
benannte sie außerdem noch mit einem ganz unanständigen Wort.) „Sie hat
jetzt auch Ihre Kusine vom rechten Wege abgelenkt, und auch Sie hat sie
dem Verderben zuführen wollen. Na, aber auch ich habe mich in diesem
Falle recht als Schuft gezeigt: doch schließlich, was soll man darüber
viel Worte verlieren, das ist so eine alltägliche Geschichte, wie das
Leben sie eben mit sich bringt.“ Wieder lachte er laut. Darauf bemerkte
er, daß er kein glänzender Redner sei, daß er das Wichtigste, was er zu
sagen hatte, ja, was zu verschweigen ihm seine Anständigkeit einfach
verboten hätte, bereits gesagt habe, und daß er daher das Übrige in
kurzen Worten zu erklären gedenke. Und so tat er es auch: er erklärte
mir, daß er um meine Hand anhalte, daß er es für seine Pflicht erachte,
mir meine Ehre wiederzugeben, daß er reich sei und mich nach der
Hochzeit auf sein Gut im Steppengebiet bringen werde. Dort gedenke er
Hasen zu jagen, nach Petersburg aber wolle er nie mehr zurückkehren,
denn das Großstadtleben sei ihm widerwärtig. Außerdem habe er hier einen
Neffen, einen hoffnungslosen Taugenichts, wie er ihn nannte, und er habe
sich geschworen, diesen um die erwartete Erbschaft zu bringen.
Hauptsächlich deshalb habe er sich entschlossen, zu heiraten, das heißt,
er wolle rechtmäßige Erben hinterlassen. Darauf äußerte er sich noch
über unsere Wohnung, meinte, es wäre schließlich kein Wunder, daß ich
krank geworden sei, wenn ich in einer so jämmerlichen Hintertreppenstube
wohne, und prophezeite mir meinen nahen Tod, wenn ich noch lange
hierbliebe. In Petersburg seien die Wohnungen überhaupt elend, sagte er,
und dann fragte er, ob ich nicht irgendeinen Wunsch habe.
Ich war so erschreckt durch seinen Antrag, daß ich plötzlich – ich weiß
selbst nicht, weshalb – in Tränen ausbrach. Er hielt sie natürlich für
Tränen der Dankbarkeit und sagte, er sei von jeher überzeugt gewesen,
daß ich ein gutes, gefühlvolles und gebildetes Mädchen sei, doch habe er
sich nicht früher zu seinem Antrag entschlossen, als nachdem er alles
Nähere über mich und meine Lebensführung erfahren. Hierauf erkundigte er
sich nach Ihnen, sagte, er wisse bereits alles, Sie seien ein
anständiger Mensch, und er wolle nicht in Ihrer Schuld stehen – ob Ihnen
500 Rubel genug wären für alles, was Sie für mich getan haben? Als ich
ihm darauf antwortete, daß Sie für mich das getan, was man mit Geld
nicht zu bezahlen vermöge, sagte er, das sei Unsinn; so etwas käme wohl
in Romanen vor, ich sei noch jung und beurteile das Leben nach Büchern:
Romane aber setzten jungen Mädchen bloß verschrobene Ideen in den Kopf,
und überhaupt möchte er von Büchern ohne weiteres behaupten, daß sie nur
die Sitten verdürben, weshalb er Bücher nicht leiden könne. Er riet mir,
erst sein Alter zu erreichen, dann könne ich von Menschen reden, „dann
erst,“ sagte er, „werden Sie die Menschen kennen gelernt haben.“
Darauf riet er mir, über seinen Antrag nachzudenken und mir alles
reiflich zu überlegen, denn es wäre ihm sehr unangenehm, wenn ich einen
so wichtigen Schritt unüberlegt tun würde, und er fügte noch hinzu, daß
Unbedachtsamkeit und stürmische Entschlüsse die unerfahrene Jugend stets
ins Verderben zu führen pflegten, doch sei es sein größter Wunsch, eine
zusagende Antwort von mir zu erhalten: andernfalls werde er sich
gezwungen sehen, in Moskau eine Kaufmannstochter zu heiraten, da er, wie
gesagt, nun einmal geschworen habe, seinen nichtsnutzigen Neffen um die
Erbschaft zu bringen. Darauf erhob er sich und legte fünfhundert Rubel
auf meinen Stickrahmen, für Naschwerk, wie er sagte, und er zwang mich
fast mit Gewalt, sie dort liegen zu lassen. Zum Schluß sagte er noch,
daß ich auf dem Gute wie ein Pfannkuchen aufgehen, dick, rosig und
gesund werden würde, ich könne dort essen, soviel ich nur wolle.
Augenblicklich habe er hier entsetzlich viel zu tun, die Geschäfte
hätten ihn schon den ganzen Tag in Anspruch genommen und er sei auch nur
auf kurze Zeit zu mir gekommen. Damit ging er ...
Ich habe lange nachgedacht, viel hin und her gegrübelt und mich recht
gequält, mein Freund, und endlich habe ich mich entschlossen. Ja: ich
werde ihn heiraten, ich muß seinen Antrag annehmen. Wenn mich jemand von
meiner Schande erlösen, mir meine Ehre wiedergeben und mich in Zukunft
vor Armut und Entbehrungen und Unglück bewahren kann, so ist er ganz
allein derjenige, der es vermag. Was soll ich denn sonst von der Zukunft
erwarten, was noch vom Schicksal verlangen? Fedora sagt, daß man sein
Glück nicht verscherzen dürfe, nur fragte sie gleich darauf seufzend,
was man denn in diesem Falle Glück nennen solle. Ich jedenfalls finde
keinen anderen Ausweg für mich, mein guter Freund. Was soll ich tun? Mit
der Arbeit habe ich ohnehin schon meine ganze Gesundheit untergraben.
Ununterbrochen arbeiten – das kann ich nicht. Bei fremden Menschen
dienen? – Ich käme um vor Leid, und überdies würde ich niemanden
zufriedenstellen. Ich bin von Natur kränklich, deshalb würde ich Fremden
immer nur zur Last fallen. Natürlich gehe ich ja auch jetzt nicht in ein
Paradies, aber was soll ich denn tun, mein Freund, was soll ich denn
tun? Was soll ich denn vorziehen?
Ich habe Sie nicht um Ihren Rat gebeten. Ich wollte ganz allein alles
überlegen. Mein Entschluß, den ich Ihnen jetzt mitgeteilt habe, steht
fest und ich werde ihn sogleich auch Bükoff mitteilen, da er schon
sowieso und mit Ungeduld meine endgültige Entscheidung erwartet. Er
sagte mir, daß seine Geschäfte keinen Aufschub dulden, er müsse
abreisen, und „wegen dieser Nichtigkeiten“ könne er die Abreise doch
nicht aufschieben. Nur Gott in seiner heiligen und unerforschlichen
Macht über mein Schicksal weiß, ob ich glücklich sein werde, aber mein
Entschluß ist gefaßt. Man sagt, Bükoff sei ein guter Mensch: er wird
mich achten, und vielleicht werde ich ihn gleichfalls achten. Was aber
sollte man wohl noch mehr von unserer Ehe erwarten?
Ich teile Ihnen alles mit, Makar Alexejewitsch, denn ich weiß, daß Sie
meinen ganzen Jammer verstehen werden. Versuchen Sie nicht, mich von
meinem Vorhaben abzubringen. Ihre Bemühungen wären zwecklos. Erwägen Sie
lieber in Ihrem eigenen Herzen alle Gründe, die mich zu diesem Schritt
veranlaßt haben. Anfangs regte es mich sehr auf, doch jetzt bin ich
ruhiger. Was mich erwartet – ich weiß es nicht. Was geschehen wird, das
wird geschehen, wie Gott es schickt! ...
Bükoff ist gekommen, ich kann den Brief nicht beenden. Ich wollte Ihnen
noch vieles sagen. Bükoff ist schon hier.
23. September.
Kind, Warwara Alexejewna!
Ich beeile mich, Kind, Ihnen zu antworten. Ich, Kind, ich beeile mich,
Ihnen zu erklären, daß ich – daß ich erstaunt bin. Alles das ist doch
ganz sicher irgendwie nicht so ... Gestern haben wir Gorschkoff
beerdigt. Ja, das ist so, Warinka, das ist so; Bükoff hat ehrenhaft
gehandelt; nur eines, sehen Sie, meine Liebe, Sie haben ihm also
wirklich zugesagt? Natürlich wirkt in allem Gottes Wille. Das ist so,
das muß unbedingt so sein, das heißt, hier – auch hier muß unbedingt
Gottes Wille wirken. Die Vorsehung des himmlischen Schöpfers hat
natürlich, obschon uns unerforschlich, immer nur das Wohl der Menschen
im Sinn, und das Schicksal ganz ebenso, ganz ebenso wie Gott.
Fedora nimmt auch Anteil an Ihnen. Natürlich, Sie werden jetzt glücklich
sein, Kind, Sie werden in Reichtum und Überfluß leben, mein Täubchen,
mein Sternchen, ich kann mich ja nicht sattsehen an Ihnen, mein
Engelchen, – nur eins, sehen Sie, Warinka, wie denn das, warum so
schnell? ... Ja, die Geschäfte – Herr Bükoff hat Geschäfte vor ...
natürlich – wer hat denn nicht Geschäfte, auch er kann sie haben. Ich
habe ihn gesehen, als er von Ihnen fortging. Ein imponierender Mann,
sogar ein sehr imponierender Mann, das heißt eine imposante Erscheinung,
eine sogar sehr imposante Erscheinung. Nur ist das alles ... nein, es
ist ja gar nicht das, um was es sich eigentlich handelt. Ich, sehen Sie,
ich bin schon jetzt gar nicht mehr ich selbst. Wie werden wir denn
künftig einander Briefe schreiben? Und ich, ja und ich – wie bleibe ich
denn hier so allein zurück? Ich, sehen Sie, mein Engelchen, ich erwäge,
wie Sie mir das da geschrieben haben, in meinem Herzen erwäge ich alles,
alle diese Gründe, meine ich, und so weiter. Ich hatte schon fast den
zwanzigsten Bogen abgeschrieben, da kam dann plötzlich dieses Ereignis!
Kind, Kind, wenn Sie jetzt wegreisen wollen, so müssen Sie doch noch
verschiedene Einkäufe machen, verschiedene Stiefelchen und Kleidchen,
und da, meine ich, kommt es denn sehr gelegen, daß ich gerade ein gutes
Magazin kenne, an der Gorochowaja – erinnern Sie sich noch, wie ich es
Ihnen einmal beschrieb? – Aber nein! Was rede ich, was fällt Ihnen ein,
mein Kind, was denken Sie! Sie dürfen doch nicht, es ist ganz unmöglich:
Sie können jetzt einfach nicht so ohne weiteres fortfahren! Sie müssen
doch große Einkäufe machen, Sie müssen einen Wagen mieten. Überdies ist
auch das Wetter jetzt so schlecht, sehen Sie doch nur, es regnet wie aus
Eimern, unaufhörlich regnet es, und überdies ... es wird doch noch kalt
werden, mein Engelchen, Ihr Herzchen wird es kalt haben, Sie werden
erfrieren! Und Sie fürchten doch jeden fremden Menschen: und nun wollen
Sie mit diesem da fortfahren! Wie soll ich denn hier so allein
zurückbleiben? Ja! Die Fedora sagt, daß ein großes Glück Sie erwarte ...
aber die Fedora ist doch eine harte Person und will mir mein Letztes
nehmen. Werden Sie heute zur Abendmesse in die Kirche gehen, mein Kind?
Ich würde dann auch hingehen, um Sie ein Weilchen zu sehen.
Es ist wahr, Kind, es ist richtig, daß Sie ein gebildetes, gutes,
gefühlvolles Mädchen sind, nur wissen Sie, – mag er doch lieber eine
Kaufmannstochter heiraten! Was meinen Sie, Kind? Mag er doch lieber eine
Kaufmannstochter heiraten! – Ich werde zu Ihnen kommen, Warinka, sobald
es dunkelt, werde ich auf ein Stündchen hinüberkommen. Jetzt wird es
doch schon früh dunkel, also dann komme ich. Ganz bestimmt auf ein
Stündchen! Jetzt erwarten Sie Bükoff, das weiß ich, aber wenn er
fortgegangen ist, dann ... Also warten Sie, Kindchen, ich komme
unbedingt ...
Ihr
Makar Djewuschkin.
27. September.
Mein Freund Makar Alexejewitsch!
Herr Bükoff sagt, ich müsse mindestens drei Dutzend Hemden von
holländischer Leinewand haben. Daher müssen wir so schnell wie möglich
Weißnäherinnen für zwei Dutzend suchen, denn wir haben entsetzlich wenig
Zeit. Herr Bükoff ärgert sich, weil er nicht geahnt hat, wie er sagt,
daß diese Lappen soviel Schererei verursachen können.
Unsere Hochzeit wird in fünf Tagen stattfinden, und am Tage darauf
reisen wir ab. Herr Bükoff hat Eile und sagt, für diese Dummheiten
brauche man nicht soviel Zeit zu vergeuden. Ich bin von all den
Scherereien schon so müde, daß ich mich kaum noch auf den Füßen halten
kann. Es gibt noch ganze Berge Arbeit, und doch, weiß Gott, wäre es
besser, wenn nichts von all diesen Sachen nötig wäre. Ja, und noch
etwas: wir kommen mit den Spitzen nicht aus, wir müssen noch welche
zukaufen, denn Herr Bükoff sagt, er wünsche nicht, daß seine Frau wie
eine Küchenmagd gekleidet gehe, ich müsse „alle Gutsbesitzersfrauen in
den Schatten stellen“ – das sind seine Worte.
Also bitte, lieber Makar Alexejewitsch, gehen Sie zu Madame Chiffon
(Gorochowaja, Sie wissen schon) und bitten Sie sie, uns schnell einige
Nähterinnen zu schicken, dies erstens, und zweitens, daß sie sich selbst
herbemühen möge: sie soll eine Droschke nehmen. Ich bin heute krank.
Hier in unserer neuen Wohnung ist es so kalt und alles ist in
schrecklicher Unordnung. Herrn Bükoffs Tante kann kaum noch atmen vor
Altersschwäche. Ich fürchte, daß sie vielleicht noch vor unserer Abreise
sterben könnte, doch Herr Bükoff sagt, das habe nichts auf sich, sie
würde sich schon wieder erholen.
Im Hause bei uns steht so ziemlich alles auf dem Kopf. Da Herr Bükoff
nicht hier wohnt, laufen die Leute nach allen Seiten fort und tun, was
sie gerade wollen. Oft ist Fedora die einzige, die wir zu unserer
Bedienung haben. Herrn Bükoffs Kammerdiener, der hier nach dem Rechten
sehen soll, ist schon seit drei Tagen verschwunden. Herr Bükoff kommt
jeden Morgen angefahren und ärgert sich, gestern aber hat er den
Hausknecht geprügelt, weshalb er dann mit der Polizei Unannehmlichkeiten
bekam ... Ich habe hier im Augenblick keinen Menschen, mit dem ich Ihnen
den Brief zusenden könnte. Ich schreibe Ihnen durch die Stadtpost. Ach,
natürlich, das Wichtigste hätte ich fast vergessen! Sagen Sie Madame
Chiffon, daß sie die Spitzen umtauschen und neue, zu dem gestern
gewählten Muster passende, aussuchen, und daß sie dann selbst zu mir
kommen soll, um mir die neue Auswahl zu zeigen. Und dann sagen Sie ihr
noch, daß ich mich in bezug auf die Garnitur anders bedacht habe: sie
muß gleichfalls gestickt werden. Ja und noch etwas: Die Buchstaben in
den Taschentüchern soll sie in Tamburinstickerei nähen, verstehen Sie? –
in Tamburinstickerei und nicht blank. Also vergessen Sie es nicht:
Tamburinstickerei! So, und da hätte ich doch noch etwas vergessen! Sagen
Sie ihr, um Gottes willen, daß die Blättchen auf der Pelerine erhaben
ausgenäht werden müssen, die Ranken in Kordonstich, oben aber, an den
Kragen muß sie dann noch eine Spitze nähen, oder eine breite Falbel.
Bitte, sagen Sie ihr das, Makar Alexejewitsch.
Ihre
W. D.
P. S. Ich schäme mich so, daß ich Sie wieder mit meinen Aufträgen
belästige. Vorgestern sind Sie ja schon den ganzen Nachmittag gelaufen.
Doch was soll ich tun! Bei uns im Hause gibt es überhaupt keine Ordnung
und ich selbst bin krank. Also ärgern Sie sich nicht gar zu sehr über
mich, Makar Alexejewitsch. Es ist ja solch ein Jammer! Ach, was wird das
noch werden, mein Freund, mein lieber, mein guter Makar Alexejewitsch!
Ich fürchte mich, an die Zukunft auch nur zu denken. Es ist mir, als
hätte ich tausend schlimme Vorahnungen und mein Kopf ist wie
eingenommen.
P. S. Um Gottes willen, mein Freund, vergessen Sie nur nichts von dem,
was Sie Madame Chiffon zu sagen haben. Ich fürchte, Sie verwechseln mir
alles. Also merken Sie es sich nochmals: Tamburinstickerei und _nicht_
blank!
W. D.
27. September.
Meine liebe Warwara Alexejewna!
Ihre Aufträge habe ich alle gewissenhaft ausgeführt. Madame Chiffon
sagte, daß sie auch schon an Tamburinstickerei gedacht habe: das sei
vornehmer, sagte sie, oder was sie da sagte – ich habe es nicht ganz
begriffen, aber es war so etwas. Ja und dann, Sie hatten dort etwas von
einer Falbel geschrieben, da sprach sie denn auch von dieser Falbel. Nur
habe ich, mein Kind, leider vergessen, was sie mir von der Falbel sagte.
Ich weiß nur noch, daß sie sehr viel über diese Falbel zu sagen hatte.
Solch ein schändliches Weib! Was war es doch? Nun, sie wird es Ihnen
heute noch alles selbst sagen. Ich bin nämlich, mein Kind, ich bin
nämlich ganz wirr im Kopfe. Heute bin ich auch nicht in den Dienst
gegangen. Nur ängstigen Sie sich, meine Liebe, ganz unnötigerweise. Für
Ihre Ruhe und Zufriedenheit bin ich bereit, in alle Läden Petersburgs zu
laufen. Sie schreiben, daß Sie sich fürchten, in die Zukunft zu blicken,
oder an sie auch nur zu denken. Aber heute um sieben werden Sie doch
alles erfahren. Madame Chiffon wird selbst zu Ihnen kommen. – Also
verzweifeln Sie deshalb nicht. Hoffen Sie, Kind, vielleicht wird sich
doch noch alles zum besten wenden. Nun ja, aber da ist nun wieder diese
verwünschte Falbel, die kommt mir nicht aus dem Sinn, das geht nur so –
Falbel, Falbel, Falbel! ...
Ich würde auf ein Augenblickchen zu Ihnen kommen, mein Engelchen, würde
unbedingt auf ein Weilchen vorsprechen, ich habe mich auch schon zweimal
Ihrer Tür genähert, aber Bükoff, das heißt, ich wollte sagen, Herr
Bükoff ist immer so böse, und da ist es wohl nicht gerade angebracht ...
Nicht wahr? ...
Ihr
Makar Djewuschkin.
28. September.
Mein lieber Makar Alexejewitsch!
Um Gottes willen, eilen Sie sogleich zum Juwelier! Sagen Sie ihm, daß er
die Ohrgehänge mit Perlen und Smaragden nicht arbeiten soll. Herr Bükoff
sagt, die seien zu teuer, das risse ein Loch in seinen Beutel. Er ärgert
sich. Er sagt, daß es ihm ohnehin schon ein Heidengeld koste und daß wir
ihn plündern. Und gestern sagte er, wenn er diese Ausgaben vorausgesehen
hätte, würde er sich die Sache noch sehr überlegt haben. Er sagt, daß
wir sogleich nach der Trauung abreisen werden, ich solle mir also keine
Illusionen machen: es kämen weder Gäste, noch werde nachher getanzt
werden, die Feste seien noch weit im Felde, ich solle mir nur nicht
einbilden, gleich tanzen zu können. So spricht er jetzt! Und Gott weiß
doch, ob ich das alles nötig habe, oder nicht! Herr Bükoff hat doch
selbst alles bestellt. Ich wage nicht, ihm zu widersprechen: er ist so
heftig. Was wird nur aus mir werden?!
W. D.
28. September.
Mein Täubchen, meine liebe Warwara Alexejewna!
Ich, das heißt der Juwelier sagt – gut. Von mir aber wollte ich nur
sagen, daß ich erkrankt bin und nicht aufstehen kann. Gerade jetzt, wo
so viel zu besorgen ist, wo Sie meiner Hilfe bedürfen, jetzt müssen die
Erkältungen kommen, ist das nicht ganz verkehrt! Auch habe ich Ihnen
noch mitzuteilen, daß zur Vollendung meines Unglücks Seine Exzellenz
heute geruht haben, sehr böse zu sein: sie haben sich über Jemeljan
Iwanowitsch geärgert, haben sehr gescholten und sahen zu guter Letzt
ganz erschöpft aus, so daß sie mir über alle Maßen leid getan haben. Sie
sehen, ich teile Ihnen alles mit.
Ich wollte Ihnen eigentlich noch einiges schreiben, aber ich fürchte,
Ihnen damit nur unnütz Zeit zu rauben. Ich bin ja doch, mein Kind, ein
dummer Mensch, bin ungebildet und unwissend, schreibe, wie es gerade
kommt und was mir einfällt, so daß Sie vielleicht dort irgendwie so
etwas ... ich kann ja nicht wissen was ... Ach, nun, was soll man da
reden!
Ihr
Makar Djewuschkin.
28. September.
Warwara Alexejewna, mein Herzchen!
Heute habe ich Fedora gesehen und gesprochen, mein Täubchen. Sie sagt,
Sie werden schon morgen getraut und übermorgen reisen Sie ab! Herr
Bükoff habe schon die Pferde bestellt.
Über Seine Exzellenz habe ich Ihnen bereits geschrieben, mein Kind. Ja
und dann: die Rechnungen der Madame Chiffon habe ich durchgesehen: es
stimmt alles, nur daß es sehr teuer ist. Aber warum ärgert sich denn
Herr Bükoff über Sie? Nun, so seien Sie glücklich, Kind! Ich freue mich.
Ja, ich werde mich immer freuen, wenn Sie glücklich sind, Kind! Ich
würde morgen in die Kirche kommen, Kind, aber ich kann nicht, mein Kreuz
schmerzt.
Doch wie wird es denn nun mit den Briefen – ich komme wieder darauf
zurück –, wie werden wir uns denn jetzt schreiben, wer wird sie uns
zustellen, Kind?
Ja, was ich noch sagen wollte: Sie haben Fedora so sehr beschenkt, meine
Gute! Damit haben Sie ein gutes Werk getan, das war schön von Ihnen. Für
jede gute Tat wird der Herr Sie segnen. Nichts bleibt unbelohnt und der
Tugend ist immer Gottes Lohn gewiß.
Kind, mein Kind! Ich würde Ihnen vieles schreiben, ich würde Ihnen jede
Stunde, jede Minute schreiben, immer nur schreiben! Ich habe hier noch
ein Büchlein von Ihnen, „Bjelkins Erzählungen“, das ist noch bei mir
geblieben. Aber wissen Sie, Kind, lassen Sie das bei mir, nehmen Sie mir
das nicht fort, schenken Sie es mir ganz, mein Täubchen! Nicht deshalb,
weil ich diese Geschichten etwa gar so gern nochmals lesen möchte. Aber
Sie wissen doch selbst, Kind, der Winter kommt, die Abende werden lang:
da wird man denn traurig – und da ist es dann gut, wenn man etwas zum
Lesen hat. Ich, mein Kind, ich werde aus meiner Wohnung in Ihre alte
Wohnung ziehen und werde als Mieter bei Fedora leben. Von dieser
ehrenwerten alten Frau werde ich mich jetzt für keinen Preis mehr
trennen. Zudem ist sie auch so arbeitsam. Gestern habe ich mir in Ihrer
verlassenen Wohnung alles genau angesehen. Dort ist noch Ihr kleiner
Stickrahmen mit der angefangenen Arbeit: es ist ja alles geblieben,
unangerührt, wie es war. Ich habe auch Ihre Stickerei betrachtet. Dann
sind da noch verschiedene kleine Flickchen geblieben. Auf ein Stückchen
von einem meiner Briefe haben Sie angefangen, Garn aufzuwickeln. In
Ihrem Tischchen fand ich noch einen Bogen Postpapier, auf dem Sie
geschrieben haben: „Mein lieber Makar Alexejewitsch! Ich beeile mich“ –
und nichts weiter. Offenbar hat Sie da jemand gleich zu Anfang
unterbrochen. In der Ecke hinter dem Schirm steht Ihr schmales Bettchen
... Mein Täubchen Sie!!!
Nun, schon gut, schon gut, leben Sie wohl. Antworten Sie mir nur um
Gottes willen etwas auf meinen Brief, und recht bald!
Makar Djewuschkin.
30. September.
Mein Freund, mein lieber Makar Alexejewitsch!
Nun ist es geschehen! Mein Los hat sich entschieden. Ich weiß nicht, was
die Zukunft mir bringen wird, aber ich füge mich in den Willen des
Herrn. Morgen reisen wir.
Zum letztenmal nehme ich jetzt Abschied von Ihnen, mein einziger, mein
treuer, lieber, guter Freund! Sind Sie doch mein einziger Verwandter,
der in der Not treu zu mir gehalten hat!
Grämen Sie sich nicht um mich, leben Sie glücklich, denken Sie zuweilen
an mich und möge Gott Sie segnen. Ich werde Ihrer oft gedenken und Sie
in meinem Gebet nicht vergessen. So ist denn jetzt auch diese Zeit
vorüber! Es sind wenig frohe Erinnerungen, die ich aus der Vergangenheit
ins neue Leben mitnehme, um so wertvoller und lieber wird mir daher Ihr
Andenken, um so teurer werden Sie selbst meinem Herzen sein. Sie sind
mein einziger Freund, nur Sie allein haben mich hier geliebt. Ich bin
doch nicht blind gewesen, ich habe es doch gesehen und gewußt, wie Sie
mich liebten! Mein Lächeln genügte, um Sie glücklich zu machen, eine
Zeile von mir söhnte Sie mit allem aus. Jetzt müssen Sie sich daran
gewöhnen, ohne mich auszukommen. Wie werden Sie nur so allein hier
weiterleben? Wer wird hier bei Ihnen sein, mein guter, unschätzbarer,
einziger Freund!
Ich überlasse Ihnen das Buch, den Stickrahmen, den angefangenen Brief.
Wenn Sie diese angefangenen Zeilen sehen, so lesen Sie in Gedanken
weiter: lesen Sie in Gedanken weiter, lesen Sie alles, was Sie von mir
gern gehört oder gelesen hätten, alles, was ich Ihnen hätte schreiben
können – was aber würde ich Ihnen jetzt nicht alles schreiben! Vergessen
Sie nicht Ihre arme Warinka, die Sie aufrichtig und von ganzem Herzen
geliebt hat. Ihre Briefe sind alle bei Fedora in der Kommode geblieben,
in der obersten Schublade.
Sie schreiben, daß Sie krank seien. Ich würde Sie besuchen, aber Herr
Bükoff läßt mich heute nicht fort. Ich werde Ihnen schreiben, mein
Freund, das verspreche ich Ihnen, aber nur Gott allein weiß, was alles
geschehen kann. Deshalb lassen Sie uns jetzt für immer Abschied
voneinander nehmen, mein Freund, mein Täubchen, wie Sie mich nennen,
mein Liebster! Auf immer! ... Ach, wie ich Sie jetzt umarmen würde, Sie!
Leben Sie wohl, mein Freund, leben Sie recht, recht, recht wohl! Seien
Sie glücklich! Bleiben Sie gesund. Nie werde ich vergessen, für Sie zu
beten. O! wenn Sie wüßten, wie schwer mir zumut ist, wie qualvoll
bedrückt meine Seele ist!
Herr Bükoff ruft mich.
Ihre Sie ewig liebende
W.
P. S. Meine Seele ist so voll, so voll von Tränen ... Sie drohen, mich
zu ersticken, zu zerreißen! Leben Sie wohl, Makar Alexejewitsch! Gott!
wie ist es traurig!
Vergessen Sie mich nicht, vergessen Sie nicht Ihre arme Warinka.
W.
Kind, Warinka, mein Täubchen, mein Liebling! Man bringt Sie fort, Sie
fahren. Ja, jetzt wäre es doch besser, man risse mir das Herz aus der
Brust, als daß man Sie so von mir fortbringt! Wie ist denn das nur
möglich! Wie können Sie nur? Sie weinen, und doch fahren Sie?! Da habe
ich soeben Ihren Brief erhalten, der stellenweise noch feucht ist von
Tränen. So wollen Sie im Herzen vielleicht gar nicht fortfahren?
Vielleicht will man Sie mit Gewalt fortbringen? Es tut Ihnen leid um
mich? Ja, aber – dann lieben Sie mich doch! Wie ist denn das? Was soll
jetzt geschehen? Ihr Herzchen wird es dort nicht aushalten, es ist dort
öde, häßlich und kalt. Die Sehnsucht wird Ihr Herzchen krank machen, die
Trauer wird es zerreißen. Sie werden dort sterben, man wird Sie dort in
die feuchte Erde betten, und es wird dort niemand sein, der Sie beweint!
Herr Bükoff wird immer Hasen jagen ... Ach, Kind, Kind, zu was haben Sie
sich da entschlossen? Wie konnten Sie denn nur so etwas tun? Was haben
Sie getan, was haben Sie getan, was haben Sie sich selbst angetan! Man
wird Sie doch dort ins Grab bringen, man wird Sie dort einfach
umbringen, mein Engelchen! Sie sind doch ein Kind, wie ein Federchen, so
zart und schwach! Und wo war ich denn eigentlich? Habe ich Dummkopf denn
hier mit offenen Augen geschlafen! Sah ich denn nicht, daß ein Kindskopf
sich etwas Unmögliches vornahm, wußte ich denn nicht, daß dem Kinde
einfach nur das Köpfchen versagte! Da hätte ich doch ganz einfach – aber
nein! Ich stehe da wie ein richtiger Tölpel, denke weder, noch sehe ich
etwas, als sei das gerade das Richtige, als ginge die ganze Sache mich
gar nichts an, und laufe sogar noch nach Falbeln! ... Nein, Warinka, ich
werde aufstehen, bis morgen werde ich vielleicht schon soweit sein, dann
stehe ich einfach auf! Und dann, dann werde ich mich einfach unter die
Räder werfen. Ich lasse Sie nicht fortfahren! Ja was, was ist denn das
eigentlich, wie geht denn das zu? Mit welchem Recht geschieht das denn
alles? Ich werde mit Ihnen fahren! Ich werde Ihrem Wagen nachlaufen,
wenn Sie mich nicht in den Wagen aufnehmen, und ich werde laufen,
solange ich noch kann, bis mir der Atem ausgeht, bis ich meinen Geist
aufgebe!
Wissen Sie denn überhaupt, was dort ist, was Sie erwartet, dort, wohin
Sie fahren, Kind? Wenn Sie das noch nicht wissen, dann fragen Sie mich,
ich weiß es! Dort ist nichts als die Steppe, meine Liebe, nichts als
flache, kahle, endlose Steppe: hier, wie meine Hand, so nackt! Dort
leben nur stumpfe, gefühllose Bauernweiber und rohe, betrunkene Kerle.
Jetzt ist dort auch schon das Laub von den Bäumen gefallen, dort regnet
es, dort ist es kalt – und dorthin fahren Sie!
Nun, Herr Bükoff hat eine Beschäftigung: er wird da seine Hasen jagen.
Aber was werden Sie dort anfangen? Sie wollen Gutsherrin sein, mein
Kind? Aber, mein Engelchen! – so sehen Sie sich doch nur an, sehen Sie
denn nach einer Gutsherrin aus?
Wie ist das nur alles möglich, Warinka? An wen werde ich denn jetzt noch
Briefe schreiben, Kind? Ja! so bedenken Sie und fragen Sie sich doch
bloß dies eine: an wen wird er denn jetzt noch Briefe schreiben können?
Und wen kann ich denn jetzt noch mein Kind, mein liebes Kind nennen, wem
gebe ich diesen zärtlichen Namen, zu wem sage ich dies liebe Wort? Wo
soll ich Sie denn noch finden, mein Engelchen? Ich werde sterben,
Warinka, ich werde bestimmt sterben. Nein, solchem Unglück ist mein Herz
nicht gewachsen!
Ich habe Sie wie das Sonnenlicht geliebt, wie mein leibliches
Töchterchen liebte ich Sie, ich liebte alles an Ihnen, mein Liebling!
Nur für Sie allein lebte ich! Ich habe ja auch gearbeitet und
geschrieben, bin spazieren gegangen und habe meine Beobachtungen in
meinen Briefen wiedergegeben, nur weil Sie, mein Kind, hier in meiner
Nähe lebten. Sie haben das vielleicht nicht gewußt, aber es war wirklich
so, es war wirklich so!
Doch hören Sie, Kind, so bedenken Sie und überlegen Sie doch, mein
Täubchen, wie ist denn das nur möglich, daß Sie uns verlassen? – Nein,
meine Liebe, das geht ja nicht, geht ganz und gar nicht! Das ist völlig
ausgeschlossen! Es regnet doch, Sie aber sind so kränklich – Sie werden
sich bestimmt erkälten. Ihre Reisekutsche wird durchnäßt werden, ein
Wagen ist kein Haus – sie wird bestimmt durchnäßt werden! Und kaum
werden Sie aus der Stadt hinausgefahren sein, da wird ein Rad brechen,
oder der ganze Wagen bricht. Hier in Petersburg werden doch die Wagen
schrecklich schlecht gebaut! Ich kenne doch alle diese Wagenbauer: denen
ist es nur um die Fasson zu tun, um irgend so ein Spielzeug
herzustellen, aber von Dauerhaftigkeit kann dabei keine Rede sein. Ich
schwöre es Ihnen, glauben Sie mir, diese Wagen taugen alle nichts!
Ich werde mich, Kind, vor Herrn Bükoff auf die Knie niederwerfen und ihm
alles sagen, alles! Und auch Sie, Kind, werden ihn zu überzeugen suchen!
Sie werden ihm alles vernünftig auseinandersetzen und ihn so überzeugen!
Sagen Sie ihm einfach, daß Sie hierbleiben, daß Sie nicht mit ihm fahren
können! ... Ach, warum hat er nicht in Moskau eine Kaufmannstochter
geheiratet? Hätte er sich doch dort eine Kaufmannstochter ausgesucht!
Das wäre für alle besser gewesen, die würde viel besser zu ihm passen,
ich weiß schon, warum! Ich aber würde Sie dann hier behalten. Was ist er
Ihnen denn, Kind, dieser Bükoff? Wodurch ist er Ihnen denn plötzlich so
lieb und wert geworden? Vielleicht ist er es Ihnen deshalb geworden,
weil er Ihnen Falbeln kauft und alles dieses – deshalb etwa? Wozu sind
denn diese Falbeln? Wozu hat man die nötig? Es ist doch, Kind, nur ein
Stück Zeug, solch ein Falbel! Hier aber handelt es sich um ein
Menschenleben, Falbeln aber sind doch, mein Kind, einfach nur Lappen,
wirklich – nichts anderes, als nichtsnutzige Lappen! Ich aber, ich kann
Ihnen doch gleichfalls solche Falbeln kaufen, ich muß nur auf mein
nächstes Gehalt warten, dann kaufe auch ich Ihnen diese Falbeln, mein
Kind, und ich weiß schon wo, ich kenne dort einen kleinen Laden, nur
müssen Sie noch etwas Geduld haben, wie gesagt, bis ich mein Gehalt
bekomme, mein Engelchen, Warinka!
Gott, Gott! So fahren Sie denn wirklich mit Herrn Bükoff fort in die
Steppe, auf immer fort! Ach, Kind! ... Nein, Sie müssen mir noch
schreiben, noch ein Briefchen schreiben Sie mir über alles, und wenn Sie
schon fort sind, dann schreiben Sie mir auch von dort einen Brief. Denn
sonst, mein Engelchen, wäre dies der letzte Brief, das aber kann doch
nicht sein, daß dies der letzte Brief sein soll! Denn wie, wie sollte
das, so plötzlich – der letzte, wirklich der letzte Brief sein? Aber
nein, ich werde doch schreiben, und auch Sie müssen mir schreiben ...
Fängt doch gerade jetzt mein Stil an, besser zu werden ... Ach, Kind,
aber was heißt Stil! Schreibe ich Ihnen doch jetzt so, ohne selbst zu
wissen, was ich schreibe, ich weiß nichts, gar nichts weiß ich und will
auch nichts durchlesen, nichts verbessern, nichts, nichts. Ich schreibe
nur, um zu schreiben, immer noch mehr zu schreiben ... Mein Täubchen,
mein Liebling, mein Kind Sie!
Der Doppelgänger
I.
Es war kurz vor acht Uhr morgens, als der Titularrat Jakoff Petrowitsch
Goljädkin nach langem Schlaf erwachte.
Er blinzelte zunächst nur ein wenig, gähnte verschlafen, streckte
langsam die Glieder, und erst nach und nach öffnete er die Augen
vollständig. Doch blieb er noch eine gute Weile regungslos in seinem
Bett liegen, wie eben ein Mensch, der sich selbst noch nicht ganz klar
darüber zu werden vermag, ob er nun wirklich schon erwacht und rings von
Wirklichkeit umgeben ist, oder ob er noch schläft und nur ein Traumbild
vor sich sieht. Bald jedoch klärten sich seine Sinne so weit, daß er mit
besserem Bewußtsein und regerer Vernunft die geschauten Eindrücke in
sich aufnehmen und in der Tat als bereits längst bekannte und ganz
alltägliche Wirklichkeit erkennen konnte. Wohl vertraut blickten ihn die
grünlichen, verräucherten und ewig bestaubten Wände seines kleinen
Zimmers an, wohl vertraut seine rotbraune Kommode und die Stühle von
derselben Farbe, wohlvertraut der rotbraune Tisch und der türkische
Diwan mit dem in der Grundfarbe rötlichen, doch grüngeblümten
Wachsleinwandbezug, und wohlvertraut schließlich auch die gestern abend
in der Eile abgeworfenen Kleider, die in einem Haufen auf eben diesem
Diwan lagen. Bei alledem sah auch noch der unfreundliche Herbsttag mit
seinem trüben, fast schmutzig trüben Licht so griesgrämig und so
mißvergnügt durch die grauen Fensterscheiben ins Zimmer, daß Herr
Goljädkin unmöglich daran zweifeln konnte, daß er sich in keinem
Wolkenkuckucksheim befand, sondern in Petersburg, in der Hauptstadt des
russischen Reiches, und zwar in seiner eigenen Wohnung, in einem großen,
vier Stockwerke hohen Hause, das an der Straße lag, die man die
Schestilawotschnaja nennt. Nachdem er zu dieser wichtigen Erkenntnis
gelangt war, schloß Herr Goljädkin, plötzlich vor Schreck
zusammenzuckend, zunächst blitzschnell wieder die Augen, um, wenn
möglich, weiterzuschlafen – ganz als wäre nichts geschehen. Doch hielt
er diesen Zustand nicht lange aus, denn plötzlich – es war noch keine
Minute vergangen – fuhr er von neuem auf und sprang diesmal sofort aus
dem Bett, ganz als seien seine Gedanken endlich auf denjenigen Punkt
gestoßen, um den sie bis dahin aus Mangel an jeglicher Ordnung in
blinder Reihenfolge ergebnislos gekreist hatten.
Kaum war er nun aus dem Bett gesprungen, so war das erste, was er tat,
daß er zu dem runden Spiegelchen stürzte, das auf der Kommode stand. Und
obwohl das verschlafene Gesicht mit den kurzsichtigen Augen und dem
ziemlich gelichteten Haupthaar, das ihm aus dem Spiegel entgegenschaute,
von so unbedeutender Art war, daß es ganz entschieden sonst keines
einzigen Menschen Aufmerksamkeit hätte fesseln können, schien der
Besitzer desselben doch mit dem Erblickten sehr zufrieden zu sein.
„Das wäre was Nettes,“ murmelte Herr Goljädkin halblaut vor sich hin,
„gerade was Nettes, wenn mir heute irgend etwas fehlen würde, wenn zum
Beispiel irgend so etwas ... sagen wir, ein Pustelchen aufgekeimt wäre,
oder eine ähnliche Unannehmlichkeit. Aber bis jetzt ist noch alles gut
gegangen ... jawohl: vorläufig ist alles gut!“
Und damit setzte Herr Goljädkin, sehr erfreut über diese Feststellung,
den Spiegel wieder auf die Kommode, worauf er selbst, obschon er noch
barfuß und nur mit einem Hemde bekleidet war, zum Fenster eilte, um mit
großer Neugier in den Hof hinabzuspähen. Offenbar wurde er durch das,
was er dort unten erblickte, vollkommen zufriedengestellt, denn ein
Lächeln erhellte sein Antlitz.
Dann – nachdem er zuvor noch einen Blick hinter die Scheidewand in die
Kammer Petruschkas, seines „Kammerdieners“, geworfen und sich überzeugt
hatte, daß Petruschka nicht anwesend war – schlich er leise zum Tisch,
schloß das Schubfach auf, suchte im verborgensten Winkel dieses
Schubfaches zwischen alten vergilbten Papieren und anderem Kram, bis er
schließlich eine abgenutzte grüne Brieftasche zutage förderte, die er
vorsichtig aufklappte, um ebenso vorsichtig und mit wonnevollem
Entzücken und offenbarem Genuß in das geheimste Täschchen
hineinzuspähen. Wahrscheinlich blickten auch die grünen und grauen und
blauen und roten Papierchen, die sich darin befanden, ebenso freundlich
und zustimmend Herrn Goljädkin an, wie er sie: wenigstens legte er die
offene Tasche mit geradezu strahlender Miene vor sich auf den Tisch,
worauf er sich zum Ausdruck seines Vergnügens kräftig die Hände rieb.
Endlich beugte er sich wieder über die Brieftasche und entnahm dem
letzten und verborgensten Täschchen das ganze, ihn so ungemein
erfreuende bunte Paketchen Papier, um zum hundertsten Male – bloß vom
letzten Abend gerechnet – die Geldscheine nachzuzählen, wobei er jeden
Schein gewissenhaft mit Daumen und Zeigefinger rieb, damit ihm nicht
etwa zwei für einen durchgingen.
„Siebenhundertfünfzig Rubel in Papiergeld!“ murmelte er dann vor sich
hin. „Siebenhundertfünfzig Rubel ... eine große Summe! Eine sehr
annehmbare Summe,“ fuhr er mit bebender, vor Wonne ganz weich klingender
Stimme in seinem Selbstgespräch fort, indem er das Paket mit den
Geldscheinen in der geschlossenen Hand wog und bedeutsam dazu lächelte:
„Sogar eine überaus annehmbare Summe! Sogar für einen jeden eine überaus
annehmbare Summe! Ich wollte den Menschen sehen, für den diese Summe
eine geringe Summe wäre! Eine solche Summe kann einen Menschen weit
bringen ...“
„Aber was ist denn das?“ fuhr Herr Goljädkin aus seinem fröhlichen
Gedankengang plötzlich auf, „wo ist denn mein Petruschka?“ Und er begab
sich, immer noch ohne weitere Bekleidung, zum zweiten Male zur
Scheidewand – doch Petruschka war auch diesmal in seiner Kammer nicht zu
erblicken. Statt seiner stand dort nur der Samowar auf der Diele und
brummte und ärgerte sich und kochte vor Wut, unter der unausgesetzten
Drohung, jeden Augenblick überzulaufen, indem er mit heißestem Eifer in
den Gutturallauten seiner sich überstürzenden und unverständlichen
Sprache brodelnd und zischend Herrn Goljädkin sagen zu wollen schien: So
nimm mich doch endlich, guter Mann, ich bin ja schon längst und
vollkommen fertig und mehr wie bereit!
„Das ist doch des Teufels!“ dachte Herr Goljädkin, „diese faule Bestie
kann einen Menschen ja um seine letzte Geduld bringen! Wo er sich nur
wieder herumtreibt?!“
Und in gerechtem Unwillen öffnete er die Tür zum Vorzimmer – einem
kleinen Korridor, aus dem eine Tür auf den Treppenflur führte – und
erblickte dort seinen Diener, den eine stattliche Anzahl dienstbarer
Geister, aus der Nachbarschaft und von der verschiedensten Art, eifrig
umringte. Petruschka erzählte und die anderen hörten zu. Augenscheinlich
mißfiel jedoch sowohl das Thema der Unterhaltung wie die Unterhaltung
selbst Herrn Goljädkin nicht wenig. Er rief sogleich seinen Petruschka
und kehrte nicht nur unzufrieden, sondern ordentlich aus dem
Gleichgewicht gebracht in sein Zimmer zurück.
„Diese Bestie ist ja wahrhaftig bereit, für weniger als eine Kopeke
einen Menschen zu verkaufen, um wieviel mehr noch seinen Brotherrn,“
dachte er bei sich, „und das hat er, oh, das hat er auch schon getan,
ich wette, daß er’s getan hat! – Nun, was?“ wandte er sich an den
eingetretenen Petruschka.
„Die Livree ist gebracht worden, Herr.“
„Dann zieh sie an und komm her.“
Petruschka tat, wie ihm befohlen, und erschien darauf mit einem dummen
Grinsen wieder im Zimmer seines Herrn, diesmal in einem unbeschreiblich
seltsamen Aufzuge.
Er trug einen grünen, bereits stark mitgenommenen Dienerfrack mit mehr
als schadhaften goldenen Tressen, eine Livree, die für einen Menschen
gemacht worden war, der mindestens um eine Elle länger sein mußte, als
Petruschka.
In der Hand hielt er einen gleichfalls mit Goldtressen und mit grünen
Federn garnierten Hut, und an der Seite hing ihm ein Dienerschwert in
einer ledernen Scheide.
Zur Vervollständigung des Bildes sei noch erwähnt, daß Petruschka, der
seiner ausgesprochenen Vorliebe für alles Bequeme zufolge fast nur im
Negligee zu gehen pflegte, auch jetzt, trotz Hut und Schwert und Frack,
barfuß erschienen war. Herr Goljädkin betrachtete seinen Petruschka von
allen Seiten, schien aber zufriedengestellt zu sein. Die Livree war
offenbar zu irgendeinem feierlichen Vorhaben gemietet worden. Auffallend
war an Petruschka noch, daß er während der Musterung, deren ihn sein
Herr unterzog, seltsam erwartungsvoll und mit größter Neugier jede
Bewegung dieses seines Herrn verfolgte, was Herrn Goljädkin, der es
merkte, geradezu befangen machte.
„Nun, und die Equipage?“
„Auch die Equipage ist gekommen.“
„Für den ganzen Tag?“
„Für den ganzen Tag. Fünfundzwanzig Rubel.“
„Und auch die Stiefel sind gebracht worden?“
„Auch die Stiefel sind gebracht worden.“
„Esel! Kannst du nicht einfach jawohl sagen? Gib sie her!“
Nachdem Herr Goljädkin dann seine Zufriedenheit mit der Leistung des
Schusters ausgedrückt hatte, wollte er Tee trinken, sich waschen und
rasieren. Letzteres tat er sehr gewissenhaft, auch beim Waschen legte er
viel Sorgfalt an den Tag, doch vom Tee trank er nur eilig im
Vorübergehen, und dann machte er sich sofort an die weitere Bekleidung
seiner Person. Zunächst zog er ein Paar fast nagelneuer Beinkleider an,
dann ein Plätthemd mit Knöpfen, die ganz so aussahen, als wären sie von
Gold, und eine Weste mit sehr grellen, aber netten Blümchen. Um den Hals
band er sich eine bunte, seidene Krawatte, und zu guter Letzt zog er
noch seinen Uniformrock an, der gleichfalls fast ganz neu und sorgfältig
gebürstet war. Während des Ankleidens schaute er mehrmals mit
liebevollen Blicken auf seine neuen Stiefel hinab, hob bald diesen, bald
jenen Fuß, betrachtete mit Wohlgefallen die Form, und murmelte etwas
Unverständliches vor sich hin, wobei sein beredtes Mienenspiel, das hier
und da entfernt an ein Gesichterschneiden gemahnte, seinen Gedanken
beifällig zustimmte. Übrigens war Herr Goljädkin an diesem Morgen sehr
zerstreut, weshalb ihm denn auch das sonderbare Spiel der Mundwinkel und
Augenbrauen Petruschkas, während ihm dieser beim Ankleiden behilflich
war, völlig entging.
Als endlich alles getan, was zu tun war, und Herr Goljädkin vollständig
angekleidet dastand, steckte er als Letztes noch seine Brieftasche in
die Brusttasche, weidete sich nochmals am Anblick Petruschkas, der
inzwischen Stiefel angezogen hatte und folglich gleichfalls vollständig
angekleidet war –, und als er sich dann sagen mußte, daß „somit alles
fertig“ sei und folglich kein Grund vorhanden, noch länger zu warten,
wandte er sich eilig und geschäftig und mit einer leisen Herzensunruhe
dem Ausgang zu und eilte die Treppe hinab. Eine hellblaue Mietsequipage
mit eigentümlichem Wappen fuhr donnernd vom Hof unter den Torbogen und
hielt vor der Treppe. Petruschka, der noch mit dem Kutscher und ein paar
anderen Maulaffen schnell ein Augenzwinkern austauschte, klappte den
Wagenschlag zu, rief mit einer ganz ungewohnten Stimme und kaum
zurückgehaltenem Lachen „fahr zu!“ zum Kutscher hinauf, sprang selbst
auf den Dienersitz hinten am Wagen – und dann rollte das Ganze donnernd
und knatternd, wackelnd und klirrend über das holperige Steinpflaster
unter dem Torbogen auf die Straße hinaus und weiter zum Newskij
Prospekt.
Kaum hatte die hellblaue Equipage den Torbogen verlassen, als Herr
Goljädkin sich auch schon geschwind die Hände rieb und sichtbar, doch
unhörbar vor sich hinlachte, wie eben ein Mensch von heiterer Gemütsart,
dem ein köstlicher Streich gelungen ist und der sich darüber selbst
königlich freut, zu lachen pflegt. Übrigens schlug dieser Anfall von
Lustigkeit sogleich in eine andere Stimmung um: das Lachen im Gesicht
Herrn Goljädkins wich plötzlich einem eigentümlich besorgten Ausdruck.
Obgleich das Wetter feucht und trübe war, ließ er beide Fenster herab
und begann vorsichtig nach den Vorübergehenden auszuschauen, um dann
blitzschnell wieder eine sozusagen vornehme Miene aufzusetzen, sobald er
bemerkte, daß jemand ihn ansah. An einer Straßenkreuzung – der Wagen bog
gerade von der Liteinaja auf den Newskij Prospekt – zuckte er mit einem
Male wie von einer höchst unangenehmen Empfindung zusammen, als wäre ihm
jemand versehentlich auf ein Hühnerauge getreten, und zog sich
schleunigst in den dunkelsten Winkel seiner Equipage zurück, in den er
sich fast mit einem Angstgefühl hineindrückte. Die Ursache seines
Schrecks war nichts anderes, als daß er plötzlich zwei junge Beamte
erblickt hatte, die seine Kollegen waren. Zum Unglück hatten diese auch
ihn erblickt und, wie es Herrn Goljädkin schien, in höchster
Verwunderung angestarrt: als trauten sie ihren Augen nicht, ihren
Kollegen in einem solchen Aufzuge zu sehen. Der eine von ihnen hatte
sogar mit dem Finger nach ihm gewiesen. Ja, es schien Herrn Goljädkin,
daß der andere ihn laut beim Namen angerufen habe, was doch auf der
Straße entschieden unzulässig war. Doch unser Held versteckte sich und
tat, als hätte er nichts gehört.
„Diese dummen Jungen!“ dachte er statt dessen bei sich selbst, „was ist
denn da für eine Veranlassung, sich zu wundern? Ein Mensch in einer
Equipage! Der Betreffende mußte eben einmal in einer Equipage fahren,
und da hat er sich eine gemietet! Weshalb sich da aufregen? Aber ich
kenne sie ja! – grüne Jungen, die noch versohlt werden müßten! Die haben
nichts als Tingeltangel im Kopf! Wie sie sich amüsieren können, das ist
ihr ganzer Lebensinhalt. Ich würde ihnen mal etwas sagen, etwas ...“
Herr Goljädkin stockte und erstarrte vor Schreck: rechts neben seiner
Equipage war ein ihm merkwürdig bekanntes Paar feuriger Kasaner Pferde
aufgetaucht, in blitzendem Geschirr vor einem eleganten offenen Wagen,
der seine Equipage alsbald überholte. Der Herr aber, der im Wagen saß,
und zufällig den gerade recht unvorsichtig zum Fenster hinausschauenden
Kopf Herrn Goljädkins erblickte, war allem Anscheine nach gleichfalls
höchlichst erstaunt über diese Begegnung, und indem er sich so weit als
möglich vorbeugte, blickte er mit dem größten Interesse gerade nach
jenem Winkel der Equipage, in den sich unser Held wieder schleunigst
zurückgezogen hatte.
Der Herr im offenen Wagen war Staatsrat Andrej Philippowitsch, der Chef
derselben Abteilung, der Herr Goljädkin angehörte. Herr Goljädkin sah
und begriff sehr wohl, daß sein hoher Vorgesetzter ihn erkannt hatte,
daß er ihm starr in die Augen sah, und ein Entrinnen oder Verstecken
vollkommen ausgeschlossen war, und er fühlte, wie er unter seinem Blick
bis über die Ohren errötete, doch –
„Soll ich grüßen, oder soll ich nicht?“ fragte sich unser Held trotzdem
unentschlossen und in unbeschreiblich qualvoller Beklemmung, „soll ich
ihn erkennen oder soll ich tun, als wäre ich gar nicht ich, sondern
irgendein anderer, der mir nur zum Verwechseln ähnlich sieht? – und soll
ich ihn ansehen, genau so, als läge gar nichts vor? – Jawohl, ich bin
einfach nicht ich – und damit basta!“ beschloß Herr Goljädkin mit
stockendem Herzschlag, ohne den Hut vor Andrej Philippowitsch zu ziehen
und ohne seinen Blick von ihm wegzuwenden. „Ich ... ich, ich bin eben
einfach gar nicht ich,“ dachte er unter Gefühlen, als müsse er auf der
Stelle vergehen, „gar nicht ich, ganz einfach, bin ein ganz anderer –
und nichts weiter!“
Bald jedoch hatte der Wagen die Equipage überholt und damit war der
Magnetismus, der in den Blicken des Gestrengen gelegen hatte, gebrochen.
Freilich, Herr Goljädkin war immer noch feuerrot und lächelte und
murmelte Unverständliches vor sich hin ...
„... Es war doch eine Dummheit von mir, nicht zu grüßen,“ sagte er sich
endlich in besserer Erkenntnis, „ich hätte ganz ruhig und dreist handeln
sollen, offen und anständig, – einfach: so und so, Andrej
Philippowitsch, bin eben gleichfalls zu einem Diner geladen, sehen Sie!“
Und da leuchtete es ihm erst so recht ein, wie groß der Fehler war, den
er begangen hatte: er wurde nochmals feuerrot, runzelte die Stirn und
warf einen fürchterlichen und zugleich herausfordernden Blick nach dem
Wagenwinkel ihm gegenüber, als wolle er mit diesem einen Blick auf der
Stelle seine sämtlichen Feinde niederschmettern. Plötzlich aber kam ihm
ein Gedanke – wie eine höhere Eingebung war es: er zog an der Schnur,
die an den linken Arm des Kutschers gebunden war, ließ anhalten und
befahl, nach der Liteinaja zurückzufahren. Herr Goljädkin empfand
nämlich das dringende Bedürfnis, zu seiner eigenen Beruhigung etwas sehr
Wichtiges seinem Arzt Krestjan Iwanowitsch mitzuteilen. Er war freilich
erst seit kurzer Zeit mit ihm bekannt – er hatte ihn erst in der
vergangenen Woche zum erstenmal besucht, um in irgendeiner Angelegenheit
seinen Rat einzuholen, aber ... der Arzt soll doch, wie man sagt, so
etwas wie ein Beichtiger des Menschen sein, dessen Pflicht es ist,
seinen Patienten zu kennen.
„Wird das nun auch das Richtige sein?“ fragte sich unser Held, von
gelinden Zweifeln erfaßt, indem er vor dem Portal eines fünf Stockwerke
hohen Hauses an der Liteinaja, vor dem er hatte halten lassen, ausstieg,
„wird das nun auch das Richtige sein? – und gut und wohl? und zur
rechten Zeit?“ fuhr er auf der Treppe beim Hinaufsteigen fort, und er
holte tief Atem, um das Herz, das die Angewohnheit hatte, auf fremden
Treppen regelmäßig stärker zu pochen, ein wenig ausruhen zu lassen.
„Aber – was? – was ist denn dabei? Ich komme doch nur in meiner eigenen
Angelegenheit, dabei ist nichts Anstößiges, nichts, das zu tadeln wäre
... Es würde dumm sein, sich zu verstecken. Gerade auf diese Weise tue
ich, als hätte ich nichts Besonderes ... als käme ich eben nur so im
Vorüberfahren ... Da wird er sich doch sagen müssen, daß es nun einmal
so ist und daß etwas anderes überhaupt nicht möglich war.“
Mit diesen Gedanken beschäftigt, stieg Herr Goljädkin zum zweiten
Stockwerk empor und blieb vor einer Tür stehen, an der ein kleines
Messingschild befestigt war, das die Aufschrift trug:
Krestjan Iwanowitsch Rutenspitz,
Doktor der Medizin und Chirurgie.
Als unser Held stehen geblieben war, bemühte er sich zunächst, seiner
Physiognomie einen anständigen, harmlos freundlichen und in etwa sogar
liebenswürdigen Ausdruck zu verleihen, worauf er sich anschickte, den
Klingelzug zu ziehen. Kaum aber war er im Begriff, dies zu tun, da fiel
ihm plötzlich noch rechtzeitig ein, daß es vielleicht doch besser wäre,
erst am nächsten Tage vorzusprechen, und daß es ja heute gar nicht so
notwendig sei. Doch in diesem Augenblick vernahm er Schritte auf der
Treppe, und das bewirkte wiederum, daß er sogleich seinen neuen
Entschluß aufgab und so, wie es kam und kommen sollte, doch mit der
entschlossensten Miene, an der Tür Krestjan Iwanowitschs die Klingel
zog.
II.
Der Doktor der Medizin und Chirurgie, Krestjan Iwanowitsch Rutenspitz,
ein überaus gesunder, obschon bejahrter Mann mit dichten, bereits
ergrauenden Augenbrauen und ebensolchem Backenbart, einem
ausdrucksvollen, funkelnden Blick, mit dem allein er dem Anscheine nach
schon Krankheiten zu vertreiben vermochte, und, nicht zu vergessen, mit
einem bedeutenden Orden, den er auch vormittags schon auf der Brust
trug, saß an diesem Morgen wie gewöhnlich in seinem Kabinett, bequem im
Stuhl zurückgelehnt, trank den Kaffee, den ihm seine Frau persönlich zu
bringen pflegte, rauchte eine Zigarre und schrieb von Zeit zu Zeit
Rezepte für seine Patienten. Nachdem er soeben ein solches für einen
leidenden alten Herrn aufgeschrieben und diesen zur Tür geleitet hatte,
setzte sich Krestjan Iwanowitsch wieder in seinen Sessel und erwartete
den nächsten Leidenden. Herr Goljädkin trat ein.
Ersichtlich hatte Krestjan Iwanowitsch gerade diesen Herrn nicht im
geringsten erwartet – und wie es schien, wünschte er auch gar nicht, ihn
vor sich zu sehen, denn in seinem Gesicht machte sich im ersten
Augenblick eine gewisse Unruhe bemerkbar, die aber schon im nächsten
Augenblick einem seltsamen, man kann wohl sagen, recht unzufriedenen
Ausdruck wich. Da nun Herr Goljädkin seinerseits fast immer den Mut und
gewissermaßen auch sich selbst verlor, sobald er jemanden in seinen
eigenen kleinen Angelegenheiten anreden mußte, so geriet er auch diesmal
beim ersten Satz, der bei ihm stets im wahren Sinn des Wortes der Stein
des Anstoßes war, in nicht geringe Verwirrung, murmelte irgend etwas,
das wohl so etwas wie eine Entschuldigung sein sollte, und da er nun
entschieden nicht mehr wußte, was weiter tun, nahm er einen Stuhl und –
setzte sich. Doch kaum war das geschehen, da fiel es ihm auch schon ein,
daß er unaufgefordert Platz genommen hatte, errötete ob seiner
Unhöflichkeit, und beeilte sich, um seinen Verstoß gegen den guten Ton
möglichst ungeschehen zu machen, sogleich wieder aufzustehen. Leider kam
er erst nach dieser „Tat“ zur Besinnung und begriff trotz seiner etwas
wirren Verfassung, daß er der ersten Dummheit nur eine zweite hatte
folgen lassen, weshalb er sich schnell zur dritten entschloß, indem er
irgend etwas wie zu seiner Rechtfertigung murmelte, dazu lächelte,
verwirrt errötete, vielsagend verstummte und sich schließlich wieder
hinsetzte, diesmal jedoch endgültig, worauf er sich auf alle Fälle mit
einem gewissen herausfordernden Blick gleichsam sicherstellte, der die
ungeheure Macht besaß, sämtliche Feinde Herrn Goljädkins im Geiste
niederzuschmettern und zu vernichten. Überdies drückte besagter Blick
die vollkommene Unabhängigkeit Herrn Goljädkins aus, d. h. er gab
deutlich zu verstehen, daß Herr Goljädkin niemanden etwas anzugehen
wünsche und daß er wie alle Menschen ein Mensch für sich sei.
Krestjan Iwanowitsch räusperte sich, hustete – beides offenbar zum
Zeichen seines Einverständnisses und des Beifalls, den er dem gewählten
Standpunkt zollte – und richtete seinen Inspektorenblick fragend auf
Herrn Goljädkin.
„Ich bin, wie Sie sehen, Krestjan Iwanowitsch,“ begann Herr Goljädkin
mit einem Lächeln, „bin gekommen, um Sie nochmals mit meinem Besuch zu
belästigen ... wage es, Sie nochmals um Ihre Nachsicht zu bitten ...“
Herrn Goljädkin fiel es offenbar schwer, sich kurz und bündig
auszudrücken.
„Hm ... ja!“ äußerte sich dazu Krestjan Iwanowitsch, indem er langsam
den Rauch ausstieß und die Zigarre auf den Tisch legte, „aber Sie müssen
die Vorschriften befolgen, anders geht es nicht! Ich habe Ihnen doch
erklärt, daß Ihre Behandlung in einer Veränderung der Lebensweise
bestehen muß ... Also etwa Zerstreuungen, sagen wir, etwa Besuche bei
Freunden ... außerdem dürfen Sie auch der Flasche nicht feind sein ...
fröhliche Gesellschaft sollten Sie nicht meiden ...“
Hier machte Herr Goljädkin, der immer noch lächelte, schnell die
Bemerkung, daß er, wie er annehme, ganz ebenso lebe, wie alle, daß er
seine eigene Wohnung habe und dieselben Zerstreuungen, wie die anderen
... daß er natürlich auch noch das Theater besuchen könne, zumal er ja
gleichfalls, ganz wie alle anderen, die Mittel dazu habe, daß er
tagsüber im Amte sei, abends aber bei sich zu Hause ... ja, er deutete
flüchtig an, daß es ihm, wie ihm scheine, nicht schlechter ginge als
anderen, daß er, wie gesagt, seine eigene Wohnung habe, und auch noch
den Petruschka. Hier stockte Herr Goljädkin plötzlich.
„Hm! nein, diese Lebensweise ist es nicht, aber ich wollte Sie etwas
anderes fragen. Ich möchte ganz im allgemeinen nur wissen, ob Sie gern
in munterer Gesellschaft sind, ob Sie die Zeit lustig verbringen ...
Nun, etwa, ob Sie jetzt ein melancholisches oder ein heiteres Leben
führen?“
„Ich ... Herr Doktor ...“
„Hm! ... ich sage Ihnen,“ unterbrach ihn der Doktor, „daß Sie ein von
Grund aus verändertes Leben führen und in gewissem Sinne auch Ihren
Charakter von Grund aus verändern müssen.“ – Krestjan Iwanowitsch
betonte das „von Grund aus“ ganz besonders, worauf er, um der größeren
Wirkung willen, eine kleine Pause folgen ließ, nach der er eindringlich
fortfuhr: „Sie dürfen der Geselligkeit nicht aus dem Wege gehen, Sie
müssen das Theater und den Klub besuchen, und vor allem geistigen
Getränken nicht abhold sein. Zu Hause zu sitzen, ist nicht ratsam ...
oder vielmehr – Sie dürfen überhaupt nicht zu Hause sitzen.“
„Aber, Krestjan Iwanowitsch – ich liebe doch die Stille,“ wandte Herr
Goljädkin ein, indem er den Doktor bedeutsam ansah und offenbar nach
Worten suchte, die seine Gedanken am besten hätten ausdrücken können,
„in meiner Wohnung sind nur ich und Petruschka ... das heißt, mein
Diener, Herr Doktor. Ich will damit sagen, Krestjan Iwanowitsch, daß ich
meinen eigenen Weg gehe, und ganz für mich lebe, Herr Doktor. Wirklich:
ich lebe ganz für mich, und wie mir scheint, bin ich von niemandem
abhängig. Gewiß: ich gehe zuweilen spazieren ...“
„Was? ... Ja, so! Nun, jetzt bereitet das Spazierengehen einem gerade
kein Vergnügen: das Wetter ist nicht danach.“
„Ja, das allerdings nicht, Herr Doktor. Aber sehen Sie, Krestjan
Iwanowitsch, ich bin ein stiller Mensch, wie ich Ihnen bereits
mitzuteilen, glaube ich, die Ehre hatte, und mein Weg führt mich nicht
mit anderen zusammen. Der allgemeine Lebensweg ist breit, Krestjan
Iwanowitsch ... Ich will ... ich will damit nur sagen ... Entschuldigen
Sie, ich bin kein Meister in der Redekunst, Krestjan Iwanowitsch ...“
„Hm! ... Sie sagen ...“
„Ich sage oder bitte vielmehr, mich zu entschuldigen, Krestjan
Iwanowitsch, da ich kein Meister in der Redekunst bin,“ versetzte Herr
Goljädkin in halbwegs gekränktem Tone, doch merklich verwirrt und
unsicher. „In dieser Beziehung bin ich ... bin ich, wie gesagt, nicht so
wie andere,“ fuhr er mit einem eigentümlichen Lächeln fort, „ich
verstehe nicht logisch zu reden ... ebensowenig wie der Rede Schönheit
zu verleihen ... das habe ich nicht gelernt. Dafür aber, Krestjan
Iwanowitsch, handle ich: ja, dafür handle ich, Krestjan Iwanowitsch.“
„Hm! ... Wie denn ... wie handeln Sie denn?“ forschte Krestjan
Iwanowitsch. Darauf folgte beiderseitiges Schweigen. Der Arzt blickte
etwas seltsam und mißtrauisch Herrn Goljädkin an, der auch seinerseits
heimlich einen recht mißtrauischen Blick auf ihn warf.
„Ich ... sehen Sie, Krestjan Iwanowitsch,“ fuhr Herr Goljädkin
schließlich im selben Tone fort, ein wenig gereizt und zugleich
verwundert über das Verhalten Krestjan Iwanowitschs, „ich liebe, wie
gesagt, die Ruhe und nicht die gesellschaftliche Unruhe und den Lärm und
alles das. Dort bei ihnen, sage ich, in der großen Gesellschaft, dort
muß man verstehen, das Parkett mit den Stiefeln zu polieren ...“ –
hierbei scharrte auch Herr Goljädkin leicht mit dem Fuß auf dem Fußboden
–, „dort wird das verlangt, und auch Geist und Witz wird dort verlangt
... duftige Komplimente muß man dort zu sagen verstehen ... sehen Sie,
so etwas wird dort verlangt! Ich aber habe das alles nicht gelernt,
sehen Sie, alle diese Kniffe sind mir fremd, ich habe keine Zeit gehabt,
so etwas zu lernen. Ich bin ein einfacher Mensch, bin nicht
erfinderisch, es ist auch nichts äußerlich Bestechendes an mir. Damit
strecke ich die Waffen, Krestjan Iwanowitsch; ich strecke sie einfach,
das heißt, ich lege sie hin ... indem ich in diesem Sinne rede.“
Alles dies brachte unser Held mit einer Miene vor, die deutlich zu
erkennen gab, daß er es nicht im geringsten bedauere, daß er „in diesem
Sinne“ die Waffen strecke und „jene Kniffe“ nicht gelernt habe, –
vielmehr ganz im Gegenteil!
Krestjan Iwanowitsch sah, während er zuhörte, mit einem sehr
unangenehmen Gesichtsausdruck zu Boden und schien schon einiges
vorauszusehen oder vielleicht auch nur zu ahnen.
Der langen Rede Herrn Goljädkins folgte ein ziemlich langes und
bedeutsames Schweigen.
„Sie sind, glaube ich, ein wenig vom Thema abgekommen,“ sagte
schließlich Krestjan Iwanowitsch halblaut, „ich habe Sie, offen gesagt,
nicht ganz verstanden.“
„Ich bin, wie gesagt, kein Meister in der Redekunst, Krestjan
Iwanowitsch ... ich hatte bereits die Ehre, Ihnen mitzuteilen, daß ich
im Schönreden kein Meister bin,“ versetzte Herr Goljädkin diesmal in
scharfem und energischem Tone.
„Hm! ...“
„Krestjan Iwanowitsch!“ fuhr darauf unser Held etwas stiller fort, doch
mit einer vielsagenden Klangfarbe in seiner Stimme, die etwas feierlich
anmutete, welchen Eindruck er dadurch noch verstärkte, daß er nach jedem
Satz eine kleine Kunstpause machte. „Krestjan Iwanowitsch! als ich hier
eintrat, begann ich mit Entschuldigungen. Jetzt wiederhole ich es und
bitte Sie nochmals um Nachsicht für eine kurze Zeit. Ich habe vor Ihnen,
Krestjan Iwanowitsch, nichts zu verbergen. Ich bin ein kleiner Mensch,
wie Sie wissen. Doch zu meinem Glück tut es mir nicht leid, daß ich ein
kleiner Mensch bin. Sogar im Gegenteil, Krestjan Iwanowitsch: ich bin
sogar stolz darauf, daß ich kein großer, sondern nur ein kleiner Mensch
bin. Ich bin kein Ränkeschmied, – und auch darauf bin ich stolz. Ich tue
nichts heimlich und hinterrücks, sondern offen und ohne alle Berechnung,
und obschon auch ich meinerseits jemandem schaden könnte, und das sogar
sehr, und obschon ich sogar weiß, wem und wie, das heißt, wem ich
schaden könnte und wie das anzustellen wäre, so will ich mich mit
solchen Sachen doch nicht befassen und wasche lieber in dieser Beziehung
meine Hände in Unschuld. Ja, in dieser Beziehung wasche ich sie,
Krestjan Iwanowitsch – in diesem Sinne!“
Herr Goljädkin verstummte für einen Augenblick sehr ausdrucksvoll. Er
hatte mit bescheidenem Stolz gesprochen.
„Ich pflege, wie ich Ihnen, Krestjan Iwanowitsch, bereits sagte,“ fuhr
er fort, „ich pflege offen, ohne Umschweife und Umwege vorzugehen: ich
verachte Umwege und überlasse sie anderen. Ich bemühe mich nicht, jene
zu erniedrigen, die vielleicht reiner sind als wir beide ... das heißt,
ich wollte sagen, als unsereiner, Krestjan Iwanowitsch, als unsereiner,
und nicht, als wir beide. Ich liebe keine halben Worte, elende Heuchelei
und Falschheit mag ich nicht, Verleumdung und Klatsch verachte ich. Eine
Maske trage ich nur, wenn ich mich maskiere, gehe aber nicht tagtäglich
mit einer solchen unter die Menschen. Jetzt frage ich Sie nur, Krestjan
Iwanowitsch, wie Sie sich an Ihrem Feinde rächen würden, an Ihrem
ärgsten Feinde – an dem, den Sie für einen solchen hielten?“ schloß Herr
Goljädkin plötzlich mit einem herausfordernden Blick auf Krestjan
Iwanowitsch.
Herr Goljädkin hatte zwar jedes Wort so deutlich ausgesprochen, wie man
es deutlicher nicht hätte aussprechen können: ruhig, klar, verständlich
und mit Überzeugung, indem er von vornherein des größten Eindrucks gewiß
war – doch blickte er jetzt nichtsdestoweniger mit Unruhe, mit großer
Unruhe, sogar mit äußerst großer Unruhe Krestjan Iwanowitsch an. Der
ganze Mensch war nur noch Blick und erwartete fast schüchtern in
peinigender Ungeduld die Antwort Krestjan Iwanowitschs. Doch wer
beschreibt die Verwunderung und Überraschung Herrn Goljädkins, als er
sehen mußte, daß Krestjan Iwanowitsch statt dessen nur etwas in den Bart
murmelte, dann seinen Stuhl näher an den Tisch rückte und endlich
ziemlich trocken, doch noch ganz höflich erklärte, daß seine Zeit sehr
knapp bemessen sei und er ihn nicht ganz verstehe: übrigens sei er ja
gern bereit, zu tun, was in seinen Kräften stünde, doch alles übrige,
was nicht zur Sache gehöre, gehe ihn nichts an. Damit griff er zur
Feder, nahm ein Blatt Papier, schnitt einen Zettel für das Rezept
zurecht und sagte, daß er sogleich aufschreiben werde, was nottue.
„Nein, es tut nichts not, Krestjan Iwanowitsch! Nein, wirklich, glauben
Sie mir, es tut hier gar nichts not!“ versicherte Herr Goljädkin, der
plötzlich vom Stuhl aufstand und Krestjan Iwanowitschs rechte Hand
ergriff. „Nein, Krestjan Iwanowitsch, hier tut gar nichts not ...“
Doch während er das noch sprach, ging bereits eine seltsame Veränderung
in ihm vor. Seine grauen Augen blitzten eigentümlich, seine Lippen
bebten und alle Muskeln seines Gesichts begannen zu zucken und sich zu
bewegen. Er erzitterte am ganzen Körper. Nachdem er im ersten Augenblick
Krestjan Iwanowitschs Hand erfaßt und festgehalten hatte, stand er jetzt
unbeweglich, als traue er sich selbst nicht und erwarte eine Eingebung,
die ihm sagte, was er nun weiter tun solle.
Doch da geschah etwas ganz Unerwartetes.
Krestjan Iwanowitsch saß zunächst etwas verdutzt auf seinem Platz und
sah Herrn Goljädkin sprachlos mit großen Augen an, ganz wie jener auch
ihn ansah. Dann stand er langsam auf und faßte Herrn Goljädkin am
Rockaufschlag. So standen sie eine ganze Weile regungslos, ohne einen
Blick voneinander abzuwenden. Goljädkins Lippen und Kinn begannen zu
zittern, und plötzlich brach unser Held in Tränen aus. Schluchzend,
schluckend nickte er mit dem Kopf, schlug sich mit der Hand vor die
Brust und erfaßte mit der linken Hand gleichfalls den Rockaufschlag
Krestjan Iwanowitschs: er wollte irgend etwas sprechen, erklären,
vermochte aber kein Wort hervorzubringen. Da besann sich Krestjan
Iwanowitsch, schüttelte seine Verwunderung ab und nahm sich zusammen.
„Beruhigen Sie sich, regen Sie sich nicht auf, setzen Sie sich!“ sagte
er, und versuchte, ihn auf den Stuhl zu drücken.
„Ich habe Feinde, Krestjan Iwanowitsch, ich habe Feinde ... ich habe
gehässige Feinde, die sich verschworen haben, mich zugrunde zu richten
...“ beteuerte Herr Goljädkin, ängstlich flüsternd.
„Oh, das wird nicht so schlimm sein mit Ihren Feinden! Denken Sie nicht
an so etwas! Das ist ganz überflüssig. Setzen Sie sich, setzen Sie sich
nur ruhig hin,“ fuhr Krestjan Iwanowitsch fort, und es gelang ihm auch,
Herrn Goljädkin zum Sitzen zu bringen: er setzte sich endlich, verwandte
aber keinen Blick von Krestjan Iwanowitsch. Diesem schien das jedoch
nicht zu behagen: er wandte sich bald von ihm fort und begann, in seinem
Kabinett auf und ab zu schreiten. Sie schwiegen beide eine lange Zeit.
„Ich danke Ihnen, Krestjan Iwanowitsch,“ brach endlich Herr Goljädkin
das Schweigen, indem er sich mit gekränkter Miene vom Stuhl erhob, „ich
bin Ihnen sehr dankbar und weiß es zu schätzen, was Sie für mich getan
haben. Ich werde Ihre Freundlichkeit bis zum Tode nicht vergessen.“
„Schon gut! Bleiben Sie nur sitzen!“ antwortete Krestjan Iwanowitsch in
ziemlich strengem Tone auf den Ausfall Herrn Goljädkins, den er
hierdurch zum zweitenmal zum Sitzen brachte.
„Nun, was haben Sie denn? Erzählen Sie mir doch, was Sie dort
Unangenehmes vorhaben,“ fuhr Krestjan Iwanowitsch fort, „und was sind
denn das für Feinde, von denen Sie sprachen? Um was handelt es sich
denn, erzählen Sie mir doch!“
„Nein, Krestjan Iwanowitsch, davon wollen wir jetzt lieber nicht reden,“
lenkte Herr Goljädkin gesenkten Blickes ab, „das wollen wir vorläufig
bleiben lassen ... bis zu einer gelegeneren Zeit ... bis zu einer
besseren Zeit, Krestjan Iwanowitsch, bis zu einer bequemeren Zeit, wenn
alles bereits zutage getreten, die Maske von gewissen Gesichtern
abgerissen und dann, wie gesagt, gar manches aufgedeckt sein wird. Jetzt
aber – das heißt vorläufig ... und nach dem, was hier vorgefallen ist
... werden Sie doch selbst zugeben, Krestjan Iwanowitsch ... Gestatten
Sie, Ihnen einen Guten Morgen zu wünschen.“ – Und damit griff Herr
Goljädkin plötzlich entschlossen nach seinem Hut.
„Tja, nun ... wie Sie wollen ... hm ...“
Es folgte ein kurzes Schweigen.
„Ich meinerseits, das wissen Sie, würde ja gern tun, was in meinen
Kräften steht ... und ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute ...“
„Ich verstehe Sie, Krestjan Iwanowitsch, ich verstehe Sie: ich verstehe
Sie jetzt vollkommen. Jedenfalls bitte ich um Entschuldigung, daß ich
Sie belästigt habe.“
„Hm ... nein, ich wollte Ihnen nicht das sagen. Übrigens – wie Sie
wollen. Was die Medikamente betrifft, so können Sie fortfahren,
dieselben zu nehmen ...“
„Das werde ich, wie Sie sagen, Krestjan Iwanowitsch, das werde ich, –
dieselben Medikamente und aus derselben Apotheke ... Heutzutage ist
Apotheker sein schon eine große Sache, Krestjan Iwanowitsch ...“
„Was? In welch einem Sinne wollen Sie das gesagt haben?“
„In einem ganz gewöhnlichen Sinne, Krestjan Iwanowitsch. Ich will nur
sagen, daß die Welt heutzutage so ist ...“
„Hm ...“
„Und daß jetzt ein jeder Bengel, nicht nur ein Apothekerbengel, vor
einem anständigen Menschen die Nase hoch trägt.“
„Hm! Wie meinen Sie denn das?“
„Ich rede von einem bestimmten Menschen, Krestjan Iwanowitsch ... von
unserem gemeinsamen Bekannten ... sagen wir zum Beispiel – nun,
meinetwegen von Wladimir Ssemjonowitsch ...“
„Ah! ...“
„Ja, Krestjan Iwanowitsch: auch ich kenne einige Menschen, denen an der
öffentlichen Meinung nicht gar so viel gelegen ist, um nicht mitunter
die Wahrheit zu sagen.“
„Ah! ... Und wie denn das?“
„Ja so. Doch das ist nebensächlich! Ich meine nur: sie verstehen
zuweilen, so ein Bonbon mit Füllung zu verabreichen.“
„Was? ... Was zu verabreichen?“
„Ein Bonbon mit Füllung, Krestjan Iwanowitsch: das ist so eine russische
Redensart. Sie verstehen zum Beispiel, zur rechten Zeit jemandem zu
gratulieren, – es gibt solche Leute, Krestjan Iwanowitsch.“
„Zu gratulieren, sagen Sie?“
„Zu gratulieren, Krestjan Iwanowitsch, wie es vor einigen Tagen einer
meiner näheren Bekannten tat! ...“
„Einer Ihrer näheren Bekannten ... hm! ja aber wie denn das?“ forschte
Krestjan Iwanowitsch, der Herrn Goljädkin jetzt aufmerksam beobachtete.
„Ja, einer meiner näheren Bekannten gratulierte einem anderen
gleichfalls sehr nahen Bekannten und sogar Freunde zum Assessor, zu dem
er neuerdings ernannt worden war. Und da sagte er denn wörtlich: ‚Freue
mich aufrichtig, Wladimir Ssemjonowitsch, Ihnen zum Assessor gratulieren
zu können, empfangen Sie meinen _aufrichtigen_ Glückwunsch. Ich freue
mich um so mehr über diesen Fall, als es heutzutage bekanntlich keine
Klatschbasen mehr gibt‘.“ – Und Herr Goljädkin nickte listig mit dem
Kopf und blickte blinzelnd zu Krestjan Iwanowitsch hinüber ...
„Hm. Gesagt hat das also ...“
„Gesagt, gewiß gesagt, Krestjan Iwanowitsch, und indem er es sagte,
blickte er noch zu Andrej Philippowitsch hinüber, der nämlich der Onkel
unseres Nesthäkchens Wladimir Ssemjonowitsch ist. Aber was geht das mich
an, daß er zum Assessor aufrückte? Was schert das mich? Nur – sehen Sie,
er will doch heiraten, er, dem die Lippen noch nicht trocken von der
Kindermilch geworden sind. Das sagte ich ihm denn auch. Ganz einfach
sagte ich es ihm. Doch – jetzt habe ich Ihnen wirklich alles erzählt.
Gestatten Sie daher, daß ich aufbreche und mich entferne.“
„Hm ...“
„Ja, Krestjan Iwanowitsch, erlauben Sie mir jetzt, wiederhole ich, mich
zu entfernen. Doch hier – um gleich zwei Sperlinge mit einem Stein zu
treffen – nachdem ich den Jüngling mit den Klatschbasen so aufs Trockene
gesetzt hatte, wandte ich mich an Klara Olssuphjewna – die ganze Sache
spielte sich vorgestern bei Olssuph Iwanowitsch ab –, sie aber hatte
gerade eine gefühlvolle Romanze gesungen, – da sagte ich ihr ungefähr:
‚Ja, eine gefühlvolle Romanze haben Sie gesungen, nur hört man Ihnen
nicht reinen Herzens zu.‘ Und damit spielte ich, verstehen Sie, spielte
ich deutlich darauf an, daß man eigentlich nicht – sie im Auge hat,
sondern weiter blickt ...“
„Ah! Nun und was tat er?“
„Er biß in die Zitrone, Krestjan Iwanowitsch, wie man zu sagen pflegt,
sogar ohne die Miene zu verziehen.“
„Hm ...“
„Ja, Krestjan Iwanowitsch. Auch dem Alten sagte ich ungefähr: ‚Olssuph
Iwanowitsch, ich weiß, was ich Ihnen schuldig bin,‘ sagte ich, ‚ich weiß
die Wohltaten, die Sie mir fast von Kindesbeinen an erwiesen haben, zu
schätzen. Aber öffnen Sie jetzt die Augen, Olssuph Iwanowitsch,‘ sagte
ich. ‚Schauen Sie mit offenen Augen um sich. Ich selbst gehe offen und
ehrlich vor, Olssuph Iwanowitsch.‘“
„Ah, also so!“
„Ja, Krestjan Iwanowitsch, so ist es ...“
„Nun, und er?“
„Ja, was sollte er, Krestjan Iwanowitsch? Brummte da etwas: dies und
jenes, ich kenne dich, Se. Exzellenz sei ein guter Mensch – und so
weiter, und so weiter – verbreitete sich ausführlich darüber ... Aber
was hilft das! Er ist eben, wie man sagt, schon etwas altersschwach
geworden.“
„Hm! Also so steht es jetzt!“
„Ja, Krestjan Iwanowitsch. Und alle sind wir doch so – was rede ich vom
Alten! – Der ist wohl schon mit einem Bein im Grabe, wie man zu sagen
pflegt. Es braucht da nur irgendeine Weiberklatschgeschichte in Umlauf
gebracht zu werden, so ist auch er gleich mit beiden Ohren dabei. Anders
geht es nicht ...“
„Klatschgeschichten, sagen Sie?“
„Ja, Krestjan Iwanowitsch, sie haben eine Klatschgeschichte in Umlauf
gebracht. Beteiligt haben sich daran außer anderen unser Bär und dessen
Neffe, unser Nesthäkchen: Erst haben sie sich mit alten Weibern
zusammengetan und dann die Sache ausgeheckt. Was glauben Sie wohl, was
sie ersonnen haben – um einen Menschen zu töten?“
„Zu töten?“
„Ja, Krestjan Iwanowitsch, um einen Menschen zu töten, um ihn moralisch
zu töten. Sie haben das Gerücht verbreitet ... ich rede immer von einem
nahen Bekannten ...“
Krestjan Iwanowitsch nickte mit dem Kopf.
„Sie haben über ihn das Gerücht verbreitet ... Offen gestanden, Krestjan
Iwanowitsch, ich schäme mich fast, so etwas nur auszusprechen!“
„Hm ...“
„Das Gerücht verbreitet, sage ich, daß er sich bereits schriftlich
verpflichtet habe, zu heiraten: daß er bereits der Bräutigam einer
anderen sei ... Und was glauben Sie wohl, Krestjan Iwanowitsch, der
Bräutigam wessen?“
„Nun?“
„Der Bräutigam einer Köchin, einer Deutschen, die ihn beköstigt: und
anstatt seine Schuld für das Essen zu bezahlen, habe er um ihre Hand
angehalten!“
„Das haben sie also verbreitet?“
„Können Sie es glauben, Krestjan Iwanowitsch? Eine Deutsche, eine
gemeine, schamlose, unverschämte Person, die Karolina Iwanowna heißt,
wenn Sie es wissen wollen ...“
„Ich gestehe, daß ich meinerseits ...“
„Ich verstehe, Krestjan Iwanowitsch, ich verstehe Sie, und fühle auch
meinerseits ...“
„Sagen Sie, bitte, wo wohnen Sie jetzt?“
„Wo ich jetzt wohne, fragen Sie?“
„Ja ... ich will ... Sie lebten doch früher, glaube ich ...“
„Gewiß, Krestjan Iwanowitsch, gewiß lebte ich, gewiß lebte ich auch
früher, wie sollte ich nicht!“ unterbrach ihn schnell Herr Goljädkin mit
einem leisen Lachen, nachdem er mit seiner Antwort Krestjan Iwanowitsch
ein wenig stutzig gemacht hatte.
„Nein, Sie haben mich falsch verstanden; ich wollte meinerseits ...“
„Ich wollte gleichfalls, Krestjan Iwanowitsch, ich wollte gleichfalls
meinerseits!“ fuhr Herr Goljädkin lachend fort. „Aber ich, verzeihen
Sie, Krestjan Iwanowitsch, ich halte Sie ja schon unverantwortlich lange
auf. Sie werden mir, hoffe ich, jetzt gestatten ... Ihnen einen Guten
Morgen zu wünschen ...“
„Hm ...“
„Ja, Krestjan Iwanowitsch, ich verstehe Sie, ich verstehe Sie jetzt
vollkommen,“ versetzte unser Held ein wenig geziert. „Also, wie gesagt,
gestatten Sie, Ihnen einen Guten Morgen zu wünschen ...“
Damit verbeugte sich unser Held und verließ das Zimmer, begleitet von
den Blicken Krestjan Iwanowitschs, der ihm in höchster Verwunderung
nachsah.
Während Herr Goljädkin die Treppe hinabstieg, schmunzelte er und rieb
sich froh die Hände. Draußen angelangt, atmete er tief die frische Luft
ein, und da er sich jetzt wieder frei fühlte, war er fast bereit, sich
für den glücklichsten Sterblichen zu halten, mit welchen Gefühlen er
schon den Weg zu seinem Departement einschlagen wollte, – als plötzlich
eine Equipage ratternd vorfuhr und vor dem Portal hielt: er starrte sie
zunächst unverständlich an, doch plötzlich fiel ihm alles wieder ein.
Petruschka riß bereits den Wagenschlag auf.
Ein seltsames und höchst unangenehmes Gefühl erfaßte den ganzen Herrn
Goljädkin. Für einen Augenblick schien er wieder zu erröten. Wie ein
Stich traf es ihn.
Im Begriff, den Fuß auf den Wagentritt zu setzen, wandte er sich
plötzlich um und sah hinauf zu den Fenstern Krestjan Iwanowitschs.
Richtig! Dort stand Krestjan Iwanowitsch am Fenster, strich sich mit der
Rechten seinen Backenbart und blickte neugierig und aufmerksam unserem
Helden nach.
„Dieser Doktor ist dumm,“ dachte Herr Goljädkin, indem er einstieg,
„äußerst dumm. Es ist ja möglich, daß er seine Kranken ganz gut kuriert,
aber immerhin ... er selbst ist unglaublich dumm.“
Herr Goljädkin setzte sich, Petruschka rief: „Fahr zu!“ und die Equipage
rollte davon, wieder geradeaus zum Newskij Prospekt.
III.
Als sie wieder auf dem Newskij Prospekt angelangt waren, ließ Herr
Goljädkin vor dem Gostinnyj Dworr[10] halten, stieg aus, trat in
Begleitung Petruschkas schnell unter die Arkaden und begab sich
unverzüglich zum Juwelierladen. Schon an der Miene Herrn Goljädkins
konnte man erkennen, daß er an diesem Morgen unendlich viele Gänge
vorhatte. Nachdem er bei dem Juwelier ein ganzes Teebesteck zum Preise
von tausendfünfhundert Rubeln, ein Zigarettenetui von sehr origineller
Form und ein vollständiges Rasierzeug in Silber, ferner noch dies und
jenes, kleine, nette und auch nützliche Sächelchen ausgesucht und von
allen diesen Dingen im Preise mehr oder weniger abgehandelt hatte,
schloß er seinen Kauf damit, daß er sich an den Juwelier wandte und
versprach, am nächsten Tage wiederzukommen oder vielleicht auch noch an
diesem selben Tage die Sachen abholen zu lassen. Er notierte sich die
Nummer des Juwelierladens, hörte höflich den Juwelier an, dem es sehr um
eine „kleine Anzahlung“ zu tun war, versprach auch eine solche,
verabschiedete sich von dem etwas betreten dreinschauenden Manne, als
wäre nichts geschehen, worauf er unter den Arkaden weiterging, begleitet
von einem ganzen Schwarm von Straßenhändlern, die alle etwas feilboten,
und begab sich, immer gefolgt von Petruschka, nach dem er sich übrigens
fortwährend umsah, in einen anderen Laden. Unterwegs trat er auch noch
in eine Wechselbude und wechselte seine sämtlichen größeren Geldscheine
gegen kleinere ein, obgleich er dabei verlor – doch wurde seine
Brieftasche dadurch bedeutend dicker, was Herrn Goljädkin
augenscheinlich sehr angenehm war. Dann suchte er einen anderen Laden
auf, in dem er, wieder für eine ansehnliche Summe, Damenstoffe
auswählte. Auch hier versprach er dem Kaufmann, am nächsten Tage
wiederzukommen, notierte sich die Nummer des Geschäfts, und auf die
Frage nach der Anzahlung versprach er, sie schon rechtzeitig zu leisten.
Darauf trat er noch in verschiedene andere Läden ein, wählte aus,
handelte, stritt oft lange mit den Verkäufern, ging sogar zwei- bis
dreimal fort, um dann doch zurückzukehren, – kurz, er entfaltete eine
ungeheure Tätigkeit. Vom Gostinnyj Dworr begab sich unser Held nach
einem bekannten Möbelmagazin, wo er Möbel für sechs Zimmer bestellte. Er
begutachtete auch noch verschiedene Modeartikel, versicherte dem
betreffenden Kaufmann, daß er unbedingt noch an diesem Tage nach den
Sachen schicken werde, und verließ das Geschäft wieder mit dem
Versprechen, einen Teil anzuzahlen. Und so besuchte er noch ein paar
andere Handlungen, in denen sich dasselbe wiederholte. Mit einem Wort,
das Ende seiner Besorgungen war gar nicht abzusehen. Endlich aber schien
diese Art von Beschäftigung Herrn Goljädkin selbst langweilig zu werden.
Ja, plötzlich stellten sich bei ihm, Gott weiß weshalb, Gewissensbisse
ein. Um keinen Preis würde er eingewilligt haben, wenn ihm jemand den
Vorschlag gemacht hätte, ihm jetzt z. B. Andrej Philippowitsch in den
Weg zu führen, oder auch nur Krestjan Iwanowitsch. Endlich schlug die
Uhr vom Rathausturm drei und nun setzte sich Herr Goljädkin endgültig in
seine Equipage, d. h. er gab alle weiteren Einkäufe auf. Aus denen, die
er bereits gemacht, befanden sich wirklich in seinem Besitz nur ein Paar
Handschuhe und ein Fläschchen Parfüm, das er für einen Rubel
fünfundfünfzig Kopeken erstanden hatte. Da drei Uhr nachmittags immerhin
noch ziemlich früh für ihn war, so ließ er sich zu einem bekannten
Restaurant am Newskij fahren, das er selbst freilich nur vom Hörensagen
kannte, stieg aus und trat ein, um einen kleinen Imbiß zu nehmen, sich
etwas zu erholen und so die Zeit bis zur bestimmten Stunde zu
verbringen.
Er aß nur ein belegtes Brötchen, also wie einer, dem ein reiches Diner
bevorsteht, d. h. er aß nur, um sich, wie man zu sagen pflegt, gegen
Magenknurren zu sichern, kippte auch nur ein einziges Gläschen dazu,
setzte sich dann in einen der bequemen Sessel und nahm nach einem etwas
unsicheren Blick auf seine Umgebung ein Zeitungsblatt zur Hand. Er las
zwei Zeilen, stand dann wieder auf, blickte in den Spiegel, rückte an
seinen Kleidern, strich sich über das Haar; trat darauf zum Fenster und
sah, daß seine Equipage noch dort stand ... kehrte dann wieder zu seinem
Sessel zurück, griff wieder nach der Zeitung ... Kurz, man sah es ihm
an, daß er aufgeregt und ungeduldig zugleich war. Er sah nach der Uhr,
sah, daß es erst ein Viertel nach drei war und daß er folglich noch
ziemlich lange zu warten habe, sagte sich gleichzeitig, daß es nicht
angehe, so lange hier zu sitzen, ohne etwas zu genießen, und bestellte
eine Tasse Schokolade, nach der er im Augenblick gar kein Verlangen
verspürte. Als er dann die Schokolade ausgetrunken und zugleich
festgestellt hatte, daß die Zeit ein wenig vorgerückt war, brach er auf,
ging zur Kasse und wollte bezahlen. Plötzlich schlug ihn jemand auf die
Schulter.
Er sah sich um und erblickte zwei seiner Kollegen – dieselben, denen er
am Morgen an der Straßenecke begegnet war, – zwei junge Leute, die ihm
sowohl an Jahren wie an Rang bedeutend nachstanden, und mit denen unser
Held weder besonders befreundet, noch offen verfeindet war.
Selbstverständlich wurde von beiden Seiten eine gewisse Stellung und
Haltung gewahrt, doch an ein Sichnähertreten hatte noch niemals jemand
von ihnen gedacht. Jedenfalls war diese überraschende Begegnung hier im
Restaurant Herrn Goljädkin äußerst unangenehm.
„Jakoff Petrowitsch, Jakoff Petrowitsch!“ riefen beide wie aus einem
Munde, „Sie hier? – aber was in aller Welt ...“
„Ah, Sie sind es, meine Herren!“ unterbrach sie Herr Goljädkin etwas
verwirrt und verletzt durch die Verwunderung der jungen, dem Range nach
unter ihm stehenden Beamten. Innerlich war er fast empört über ihren
ungenierten Ton, spielte aber äußerlich – übrigens notgedrungen – den
Harmlosen und bemühte sich tapfer, seinen Mann zu stellen. „Also
desertiert, meine Herren, hehehe! ...“ Und um seine Überlegenheit dieser
Kanzleijugend gegenüber zu bewahren, mit der er sich sonst nie
eingelassen hatte, wollte er einem von ihnen gönnerhaft auf die Schulter
klopfen; zum Unglück aber mißriet seine Herablassung gänzlich und aus
der jovial herablassend gedachten Geste wurde etwas ganz anderes.
„Nun, und was macht denn unser Bär, – der sitzt wohl noch? ...“
„Wer das? Wen meinen Sie?“
„Mit dem Bären? Als ob Sie nicht wüßten, wen wir den Bären nennen? ...“
Herr Goljädkin wandte sich lachend wieder zur Kasse, um das
zurückgegebene Geld in Empfang zu nehmen. „Ich rede von Andrej
Philippowitsch, meine Herren,“ fuhr er fort, sich wieder ihnen
zuwendend, doch jetzt mit sehr ernstem Gesicht. Die beiden jungen
Beamten tauschten untereinander einen Blick aus.
„Der sitzt natürlich noch, hat sich aber nach Ihnen erkundigt, Jakoff
Petrowitsch,“ antwortete einer von ihnen.
„Also er sitzt noch, ah! In dem Fall – lassen wir ihn sitzen, meine
Herren. Und er hat sich nach mir erkundigt, sagen Sie?“
„Ja, ausdrücklich, Jakoff Petrowitsch. Aber was ist denn heute mit Ihnen
los?! Parfümiert, geschniegelt und gestriegelt, – Sie sind ja ein ganzer
Stutzer geworden?! ...“
„Ja, meine Herren, wie Sie sehen.“ – Herr Goljädkin blickte zur Seite
und lächelte gezwungen. Als die anderen sein Lächeln bemerkten, brachen
sie in lautes Lachen aus. Herr Goljädkin fühlte sich gekränkt und setzte
eine hochmütige Miene auf.
„Ich will Ihnen etwas sagen, meine Herren,“ begann unser Held nach
kurzem Schweigen, als habe er sich entschlossen – „mochte es denn so
sein!“ – sie über etwas Wichtiges aufzuklären. „Sie, meine Herren,
kennen mich alle, doch bisher haben Sie mich nur von der einen Seite
gekannt. Einen Vorwurf kann man deshalb niemandem machen, zum Teil, das
gebe ich selbst zu, war es meine eigene Schuld.“
Herr Goljädkin preßte die Lippen zusammen und sah die beiden bedeutsam
an. Jene tauschten wieder einen Blick aus.
„Bisher, meine Herren, haben Sie mich nicht gekannt. Es ist hier weder
der richtige Ort noch die richtige Zeit zu ausführlichen Erklärungen.
Deshalb will ich Ihnen nur ein paar kurze Worte sagen. Es gibt Menschen,
meine Herren, die Umwege und Schliche nicht lieben, und die sich
wirklich nur zum Maskenball maskieren. Es gibt Menschen, die in der
Geschicklichkeit, das Parkett mit den Stiefeln zu polieren, nicht den
einzigen Lebenszweck und die Bestimmung der Menschheit sehen. Es gibt
auch solche Menschen, meine Herren, die sich nicht für restlos glücklich
und ihr Leben schon für ausgefüllt halten, wenn zum Beispiel das
Beinkleid ihnen gut sitzt. Und es gibt schließlich auch Menschen, die
sich nicht gern ohne jeden Grund ducken und müßigerweise scharwenzeln,
sich einschmeicheln und den Leuten um den Mund reden, und die, was die
Hauptsache ist, meine Herren, ihre Nase nicht dorthin stecken, wohin man
Sie die Nase zu stecken nicht gebeten hat ... So, meine Herren, jetzt
habe ich alles gesagt – erlauben Sie mir daher, mich Ihnen zu empfehlen
...“
Herr Goljädkin stockte. Da die beiden jungen Beamten in ihrer Wißbegier
jetzt vollkommen befriedigt waren, brachen sie höchst unhöflich in
schallendes Gelächter aus.
Herr Goljädkin wurde feuerrot vor Empörung.
„Lachen Sie nur, meine Herren, lachen Sie nur – vorläufig! Leben Sie
erst etwas länger in der Welt, dann werden Sie schon sehen!“ sagte er
mit gekränkter Würde, nahm seinen Hut und ging bereits zur Tür.
„Doch eins will ich Ihnen noch sagen, meine Herren,“ fuhr er fort, sich
zum letztenmal zu den beiden Herren zurückwendend, „wir sind jetzt hier
gewissermaßen unter vier Augen. Also vernehmen Sie meine Grundsätze,
meine Herren: mißlingt es, so werde ich mich trotzdem zusammennehmen –
gelingt es aber, so habe ich gesiegt, doch in keinem Fall will ich die
Stellung eines anderen untergraben. Ich bin kein Ränkeschmied, und bin
stolz darauf, daß ich es nicht bin. Zum Diplomaten würde ich nicht
taugen. Man sagt, meine Herren, daß der Vogel von selbst auf den Jäger
fliege. Das ist wahr, ich geb es zu: doch wer ist hier der Jäger, und
wer der Vogel? Das ist die Frage, meine Herren!“
Herr Goljädkin verstummte beredt und mit dem vielsagendsten
Gesichtsausdruck, d. h. indem er die Brauen hochzog und die Lippen
zusammenpreßte, beides bis zur äußersten Möglichkeit – verbeugte sich
und trat hinaus, die anderen in höchster Verwunderung zurücklassend.
„Wohin jetzt?“ fragte Petruschka ziemlich unwirsch, da es ihn offenbar
schon langweilte, in der Kälte zu warten und sich von Ort zu Ort
schleppen zu lassen. „Wohin befehlen?“ fragte er kleinlauter, als er den
fürchterlichen, alles vernichtenden Blick auffing, mit dem unser Held
sich an diesem Morgen schon zweimal versehen hatte und mit dem er sich
jetzt beim Verlassen des Restaurants zum drittenmal waffnete.
„Zur Ismailoffbrücke.“
„Zur Ismailoffbrücke!“ rief Petruschka dem Kutscher zu.
„Das Diner ist bei ihnen erst nach vier angesagt, oder sogar erst um
fünf,“ dachte Herr Goljädkin, „wird es jetzt nicht noch zu früh sein?
Übrigens kann ich ja ganz gut auch etwas früher erscheinen. Außerdem ist
es nur ein Familiendiner. Da kann man also ganz _sans façon_ ... wie
feine Leute zu sagen pflegen. – Weshalb sollte ich denn nicht _sans
façon_ erscheinen können? Unser Bär sagte ja auch, daß alles ganz _sans
façon_ sein werde, da kann doch auch ich ...“
So dachte Herr Goljädkin, doch dessen ungeachtet wuchs seine Aufregung
und wurde mit jedem Augenblick größer. Man merkte es ihm an, daß er sich
zu etwas äußerst Mühevollem – um nicht mehr zu sagen – vorbereitete: er
flüsterte leise vor sich hin, gestikulierte mit der rechten Hand,
blickte in einem fort zu den Fenstern hinaus, kurz, man hätte wahrlich
alles eher vermuten können, als daß er sich zu einer guten Mahlzeit
begab, die noch dazu „im Familienkreise“ eingenommen werden sollte, ganz
_sans façon_, wie feine Leute zu sagen pflegen. Kurz vor der
Ismailoffbrücke wies Herr Goljädkin dem Kutscher das Haus, zu dem er ihn
fahren sollte. Die Equipage rollte wieder mit ohrenbetäubendem Getöse
unter den Torbogen und weiter auf den Hof, wo sie vor dem Portal des
rechten Flügels hielt. Im selben Augenblick bemerkte Herr Goljädkin an
einem Fenster des zweiten Stockwerkes eine junge Dame, der er, kaum daß
er sie erblickt, eine Kußhand zuwarf. Übrigens wußte er selbst nicht,
was er tat, zumal er in dieser Minute entschieden mehr tot als lebendig
war. Beim Aussteigen war er bleich und unsicher. Er trat ein, nahm den
Hut ab, rückte mechanisch an seinen Kleidern und begann – mit einem
sonderbaren Schwächegefühl in den Knien: es war, als zitterten sie – die
Treppe hinaufzusteigen.
„Olssuph Iwanowitsch?“ fragte er den Bedienten, der ihm die Tür öffnete.
„Zu Haus ... das heißt nein, der Herr sind nicht zu Haus.“
„Wie? Was sagst du, mein Lieber? Ich – ich bin eingeladen, mein Bester.
Du kennst mich doch?“
„Wie denn nicht! Aber ich habe Befehl, den Herrn nicht zu empfangen.“
„Wie ... mein Bester ... du irrst dich gewiß. Ich bin es. Und ich bin
doch eingeladen, ich ... ich komme zum Diner, mein Bester,“ sagte Herr
Goljädkin und warf schnell seinen Paletot ab, in der deutlichen Absicht,
sogleich die Zimmer zu betreten.
„Verzeihen der Herr, das geht nicht. Ich habe Befehl, den Herrn nicht
eintreten zu lassen, man will den Herrn nicht empfangen. Ich habe
Befehl!“
Herr Goljädkin erbleichte. Da ging eine Tür auf und Gerassimowitsch, der
alte Diener Olssuph Iwanowitschs, erschien.
„Da sehen Sie, Jemeljan Gerassimowitsch, der Herr will eintreten, ich
aber ...“
„Sie aber sind ein Dummkopf, Alexejewitsch. Gehen Sie und schicken Sie
den Schuft Ssemjonytsch her. – Entschuldigen Sie,“ wandte er sich darauf
höflich, doch in sehr bestimmtem Tone an Herrn Goljädkin, „es geht
nicht. Es ist ganz unmöglich. Man läßt sich entschuldigen, man kann
nicht empfangen.“
„Ist Ihnen das gesagt worden, daß man nicht empfangen kann?“ fragte Herr
Goljädkin unentschlossen. „Verzeihen Sie, Gerassimowitsch, aber weshalb
kann man denn nicht?“
„Es geht nicht. Ich habe angemeldet; darauf wurde mir gesagt: bitte, zu
entschuldigen. Es ist unmöglich.“
„Aber weshalb denn? Wie ist denn das? Wie ...“
„Erlauben Sie, erlauben Sie ...“
„Aber weshalb, warum denn nicht? Das geht doch nicht so! Melden Sie ...
Was soll denn das heißen! Ich bin zum Diner ...“
„Erlauben Sie, erlauben Sie! ...“
„Nun ja, freilich, das ist eine andere Sache – wenn man zu entschuldigen
bittet. Aber wie ist denn das, Gerassimowitsch, das ... so erklären Sie
mir doch! ...“
„Erlauben Sie, erlauben Sie!“ unterbrach ihn wieder Gerassimowitsch,
indem er ihn recht nachdrücklich mit dem Arm zur Seite schob, um zwei
Herren eintreten zu lassen. Die Eintretenden waren: Andrej
Philippowitsch und sein Neffe Wladimir Ssemjonowitsch. Beide blickten
sehr verwundert Herrn Goljädkin an.
Andrej Philippowitsch machte bereits Miene, ihn anzureden, doch Herr
Goljädkin hatte seinen Entschluß schon gefaßt: er trat schnell aus dem
Vorzimmer und sagte gesenkten Blicks, rot und mit einem Lächeln in dem
verwirrten Gesicht:
„Ich komme später, Gerassimowitsch, ich werde ... ich hoffe, daß alles
sich bald aufklären wird,“ sagte er vom Treppenflur aus ...
„Jakoff Petrowitsch, Jakoff Petrowitsch ...“ ertönte die Stimme Andrej
Philippowitschs.
Herr Goljädkin hatte schon den ersten Treppenabsatz erreicht. Er wandte
sich schnell zurück und sah hinauf zu Andrej Philippowitsch.
„Was wünschen Sie, Andrej Philippowitsch?“ fragte er ziemlich scharf.
„Was ist das mit Ihnen, Jakoff Petrowitsch? Was ist hier ...“
„Nichts, Andrej Philippowitsch. Ich gehe hier niemanden etwas an. Das
ist meine Privatangelegenheit, Andrej Philippowitsch.“
„Wa–as?“
„Ich sage Ihnen, Andrej Philippowitsch, daß das mein Privatleben ist,
und daß man, wie mir scheint, hinsichtlich meiner offiziellen
Beziehungen hier, nichts Tadelnswertes finden kann.“
„Was! Was reden Sie da ... hinsichtlich Ihrer offiziellen ... Was ist
mit Ihnen geschehen, mein Herr?“
„Nichts, Andrej Philippowitsch, ganz und gar nichts ... ein verzogenes
Mädchen, nichts weiter ...“
„Was ... Was?“ Andrej Philippowitsch wußte nicht, was er vor lauter
Verwunderung denken sollte.
Herr Goljädkin, der, während er mit Andrej Philippowitsch sprach, auf
dem Treppenabsatz von unten nach oben blickte und so aussah, als wolle
er seinem Abteilungschef jeden Augenblick ins Gesicht springen, trat,
als er dessen Verwirrung gewahrte, eine Stufe höher. Andrej
Philippowitsch wich etwas zurück. Herr Goljädkin stieg wieder eine und
dann noch eine Stufe höher – Andrej Philippowitsch blickte sich unruhig
um. Da sprang Herr Goljädkin plötzlich schnell noch über die anderen
Stufen hinauf – doch noch schneller sprang Andrej Philippowitsch zurück
ins Vorzimmer und schlug die Tür hinter sich zu. Herr Goljädkin sah sich
allein im Treppenhaus. Es wurde ihm dunkel vor den Augen. Ohne einen
Gedanken im Kopf, stand er, scheinbar in Nachdenken versunken,
regungslos auf einem Fleck. Oder vielleicht dachte er doch an eine
ähnliche Situation, in der er sich vor kurzer Zeit befunden hatte?
Er flüsterte dann etwas vor sich hin, das halbwegs wie ein Seufzer
klang, und zwang sich zu einem schmerzlichen Lächeln. Da vernahm er
plötzlich Stimmen und Schritte, unten auf der Treppe – Gäste, die
Olssuph Iwanowitsch eingeladen hatte. Herr Goljädkin kam wieder zu sich,
klappte schnell den Waschbärkragen an seinem Herbstpaletot auf, um nicht
erkannt zu werden, und begann, stolpernd, unsicher, zitternd und bebend
die Treppe hinabzusteigen. Er fühlte eine große Schwäche in sich, eine
gewisse Abgetaubtheit in allen Gliedern. Er wäre nicht imstande gewesen,
ein lautes Wort zu sprechen. Als er hinaustrat, war er noch so verwirrt,
daß er nicht wartete, bis seine Equipage vorfuhr, sondern selbst über
den schmutzigen Hof zu ihr hin ging. Im Begriff, einzusteigen, empfand
Herr Goljädkin plötzlich den größten Wunsch, in die Erde zu versinken
oder mitsamt der Equipage in ein Mauseloch zu verschwinden, denn es
schien ihm, oder richtiger, er fühlte und wußte plötzlich mit tödlicher
Sicherheit, daß jetzt alles, was es an Lebewesen in der Wohnung Olssuph
Iwanowitschs gab, an den Fenstern stand und ihn mit den Blicken
verfolgte. Und er wußte auch, daß er auf der Stelle tot hinfallen würde,
wenn er sich jetzt nach diesen Fenstern umsehen würde.
„Was lachst du, Tölpel?“ fuhr er Petruschka an, der ihm beim Einsteigen
helfen wollte.
„Worüber soll ich denn lachen? Wohin jetzt?“
„Nach Hause, sofort ...“
„Zurück nach Hause!“ rief Petruschka dem Kutscher zu und kletterte auf
seinen Dienersitz.
„Wie der Kerl krähen kann!“ dachte Herr Goljädkin wütend.
Die Equipage hatte inzwischen schon die Ismailoffbrücke erreicht.
Plötzlich griff unser Held nach der Schnur, riß an ihr wie ein
Verzweifelter und schrie seinem Kutscher zu, daß er wieder umkehren
solle. Der Kutscher wendete die Pferde und nach kaum zwei Minuten fuhr
die Equipage wieder auf den Hof zu Olssuph Iwanowitsch.
„Nicht, nicht, zurück, Esel, zurück!“ schrie plötzlich Herr Goljädkin,
der Kutscher aber schien diesen Gegenbefehl schon vorausgesehen zu
haben: denn ohne ein Wort des Widerspruchs und ohne vor dem Portal
anzuhalten, fuhr er rund um den Hof und wieder hinaus auf die Straße.
Herr Goljädkin aber fuhr nicht nach Hause, sondern befahl, nicht weit
von der Ssemjonoffbrücke, in eine kleine Querstraße einzubiegen und vor
einem Restaurant von recht unansehnlichem Aussehen zu halten. Dort stieg
er aus, bezahlte den Kutscher und wurde auf diese Weise seine Equipage
los. Petruschka schickte er nach Hause, wo er ihn erwarten sollte. Dann
trat er ins Restaurant, wünschte ein Zimmer für sich und bestellte ein
Mittagessen. Er fühlte sich sehr schlecht. In seinem Kopf war ein
einziges Chaos. Lange ging er im Zimmer erregt auf und ab: endlich
setzte er sich auf einen Stuhl, stützte den Kopf in die Hände und nahm
sich mit aller Gewalt zusammen, um über seine gegenwärtige Situation
nachzudenken und irgendeinen Entschluß zu fassen.
IV.
Das Fest, das feierliche Fest, das zu Ehren des Geburtstages Klara
Olssuphjewnas, der einzigen Tochter des Staatsrats Berendejeff, der
seinerzeit Herrn Goljädkins Gönner gewesen war, stattfand und durch ein
glänzendes Diner eröffnet wurde, – ein Diner, wie es die Wände der
Beamtenwohnungen an der Ismailoffbrücke und im näheren Umkreise daselbst
noch nicht gesehen hatten, das eher an ein Krönungsmahl Belsazars als an
ein Diner zu Ehren eines einzelnen Geburtstagskindes erinnerte – zumal
ihm hinsichtlich des Glanzes, der Pracht und der Delikatessen, unter
denen sich Champagner, Austern und Früchte von Jekissejeff und
Miljutin[11] befanden, entschieden etwas Babylonisches anhaftete, –
dieses feierliche Fest, das durch ein so feierliches Diner eröffnet
wurde, sollte seinen Abschluß finden in einem glänzenden Ball, der nach
Zahl und Rang der Tanzenden zwar nur ein kleiner Familienball war, zu
dem man noch die nächsten Bekannten hinzugezogen hatte, der aber nach
dem Geschmack, der bei ihm entwickelt wurde, immerhin als glänzend
bezeichnet werden mußte.
Ich gebe natürlich ohne weiteres zu, daß solche Bälle auch anderweitig
gegeben werden, jedoch – selten. Solche Bälle, die eher einem
Familienfreudenfeste gleichen, als dem, was man so Bälle nennt, können
nur in solchen Häusern gegeben werden, wie es das Haus des Staatsrats
Berendejeff ist. Ja, ich bezweifle sogar sehr, daß alle Staatsräte sich
solche Bälle leisten können. O, wäre ich doch ein Dichter! – doch,
versteht sich, mindestens einer wie Homer oder Puschkin, denn mit einer
geringeren Begabung dürfte man sich an diese Aufgabe gar nicht
heranwagen – also: wäre ich ein Dichter, dann, meine verehrten Leser!
dann würde ich Ihnen in leuchtenden Farben mit kühnem Pinsel diesen
ganzen hochfeierlichen Tag zu schildern versuchen. Oder nein, ich würde
meine Schilderung mit dem Diner beginnen, und zwar gerade mit jenem
weihevollen Augenblick, in dem das erste Glas auf das Wohl der Königin
des Festes geleert wurde. Ich würde Ihnen diese Gäste schildern, die in
andächtigem Schweigen erwartungsvoll verharrten, in einem Schweigen, das
mehr der Beredsamkeit eines Demosthenes glich, als – nun, als einem
Schweigen. Ich würde Ihnen diesen Andrej Philippowitsch schildern, der
als ältester unter den Gästen ein gewisses Recht auf den Vorrang hatte,
wie er sich im Schmuck seines Silberhaares und der entsprechenden Orden
auf der Brust von seinem Platze erhob und zum Kelch mit dem funkelnden
Weine griff – mit dem Weine, der aus einem fernen Königreich
herbeigeschafft war, um so erhabenen Augenblicken erst die rechte Weihe
zu verleihen, – mit dem Weine, der eher dem Nektar der Götter gleicht,
als irdischem Rebensaft. Ich würde Ihnen die glücklichen Eltern der
Königin des Festes und die Schar ihrer Gäste schildern, die, dem
Beispiel Andrej Philippowitschs folgend, gleichfalls zu ihren Gläsern
griffen und die erwartungsvollen Blicke auf den Redner hefteten. Ich
würde Ihnen schildern, wie dieser oft genannte Andrej Philippowitsch mit
geradezu tränenfeuchten Augen toastete und auf das Wohl des
Geburtstagskindes trank ... Doch, wäre ich auch der größte Dichter, nie
würde meine Kunst ausreichen, um die ganze Weihe dieses Augenblicks zu
geben, als die Königin des Festes, Klara Olssuphjewna selbst, mit dem
Rosenhauch der Seligkeit und jungfräulichen Verschämtheit auf dem
lieblichen Antlitz, der Mutter im Überschwang der Gefühle in die Arme
sank, wie die zärtliche Mutter vor Rührung leise zu weinen begann und
wie bei der Gelegenheit dem Vater und Herrn des Hauses, dem ehrwürdigen
Greise und Staatsrat Olssuph Iwanowitsch, den der langjährige Dienst der
Gehfähigkeit beraubt und den dafür das Schicksal mit einem Vermögen,
einem großen Hause, mehreren Gütern und einer so schönen Tochter belohnt
hatte – wie diesem ehrwürdigen Greise, sage ich, vor lauter
Ergriffenheit die Tränen über die Wangen rollten, und wie er mit
zitternder Stimme stammelte, Seine Exzellenz sei ein guter Mensch. Ich
brächte es nicht fertig, Ihnen die diesem Anblick unverzüglich folgende
allgemeine Herzerhebung wahrheitsgetreu zu schildern, – diese
eigenartige Stimmung, die sich sogar in dem Benehmen eines jungen
Registrators äußerte, der – obschon er in diesem Augenblick mehr wie ein
Staatsrat als wie ein Registrator aussah – gleichfalls seine Rührung
nicht zu unterdrücken vermochte und seine Augen feucht werden fühlte.
Andrej Philippowitsch dagegen sah in seiner Ergriffenheit keineswegs
nach einem Staatsrat und Abteilungschef aus, sondern nach ganz etwas
anderem ... nur vermag ich nicht zu sagen, wonach eigentlich – aber
jedenfalls nicht nach einem Staatsrat. Er war etwas Höheres! Und dann
... O! Mir fehlen all die großen, feierlichen Worte, deren man in erster
Linie bedarf, um jene wundervollen erhebenden Augenblicke wiederzugeben,
die gleichsam zum Beweise dessen geschaffen sind, daß und wie mitunter
die Tugend über jede Art von Schlechtigkeit, Freidenkerei, Laster und
Neid den Sieg davonträgt! Ich will nichts weiter darüber sagen, und nur
schweigend – das sagt mehr, als es Worte vermöchten – auf jenen
glücklichen Jüngling hinweisen, der sechsundzwanzig Lenze zählt, auf
jenen Neffen Andrej Philippowitschs, den jungen Wladimir Ssemjonowitsch,
der sich nun gleichfalls erhob und gleichfalls toastete, während auf ihm
die tränenfeuchten Blicke der Eltern des Geburtstagskindes ruhten, die
stolzen Blicke Andrej Philippowitschs, die verschämten der Königin des
Festes, die begeisterten der Gäste und die noch in bescheidenen Grenzen
zurückgehalten neidischen Blicke einiger jungen Kollegen dieses
ausgezeichneten Jünglings. Ich will nichts weiter sagen, obwohl ich
nicht umhin kann, zu bemerken, daß in besagtem Jüngling, – der übrigens
eher an einen Greis erinnerte, als an einen Jüngling, wenn auch in einem
für ihn vorteilhaften Sinne des Wortes – in dieser feierlichen Minute
alles, von seinen blühenden Wangen bis zu seinem jüngst erworbenen
Assessortitel, förmlich vernehmbar sprach: seht, bis zu welch einer Höhe
Tüchtigkeit, Ordentlichkeit, Sittsamkeit einen Menschen emporheben
können! Ich will nicht weiter beschreiben, wie zu guter Letzt Anton
Antonowitsch Ssjetotschkin, ein Kollege Andrej Philippowitschs und einst
auch Olssuph Iwanowitschs, der außerdem ein alter Hausfreund und
Taufvater Klara Olssuphjewnas war, – ein Greis mit weichem Silberhaar –
nun auch seinerseits eine Rede halten wollte und mit einer Stimme wie
ein krähender Hahn fröhliche Knüttelverse vorbrachte; wie er dadurch,
daß er, wenn man sich so ausdrücken darf, anständiger Weise jeden
Anstand vergaß, die ganze Gesellschaft bis zu Tränen erheiterte, und wie
Klara Olssuphjewna ihn zum Dank für diesen liebenswürdigen Beitrag auf
Wunsch der Eltern einen Kuß gab. Ich begnüge mich damit, nur anzudeuten,
daß die Gäste, die sich nach einem solchen Mahle naturgemäß einander
nahestehend und verbrüdert fühlen mußten, zum Schluß doch vom Tisch
aufstanden, daß die älteren Jahrgänge und solideren Leute sich nach
kurzem Herumstehen in plaudernden Gruppen in ein anderes Zimmer
zurückzogen, wo sie, um die kostbare Zeit nicht zu verlieren, sogleich
an den Spieltischen Platz nahmen und würdevoll die Karten zu mischen
begannen; daß die Damen, die sich im Saal versammelt hatten, alle
ungeheuer liebenswürdig waren und sich alsbald lebhaft über die
verschiedensten Dinge unterhielten; daß endlich der hochverehrte
Gastgeber unter Zuhilfenahme von Krücken und auf Wladimir Ssemjonowitsch
und Klara Olssuphjewna gestützt, im Saal unter den Damen erschien, und,
da Liebenswürdigkeit ansteckend ist, gleichfalls sehr liebenswürdig
wurde und sich entschloß, einen bescheidenen, kleinen Ball zu
improvisieren, trotz der Unkosten, die ein solcher verursacht; daß zu
diesem Zweck ein gewandter Jüngling, nämlich derselbe Wladimir
Ssemjonowitsch, persönlich nach Musikanten geschickt wurde, und wie
dann, als diese – ganze elf an der Zahl – erschienen waren, um halb neun
Uhr abends die erste Aufforderung zum Tanz in den lockenden Tönen einer
französischen Quadrille erklang, der die weiteren Tänze folgten ... Es
versteht sich wohl von selbst, daß meine Feder zu schwach und zu stumpf
ist, um, wie es sich gehört, diesen durch die Liebenswürdigkeit des
greisen Gastgebers veranstalteten Ball zu schildern. Ja, und wie könnte
ich, frage ich, wie könnte ich, der bescheidene Erzähler der in ihrer
Art gewiß sehr beachtenswerten Erlebnisse Herrn Goljädkins, – wie könnte
ich diese außergewöhnliche Mischung von Schönheit, Vornehmheit und
Heiterkeit, von liebenswürdiger Solidität und solider Liebenswürdigkeit,
von Schelmerei und Freude, alle die Reize dieser Beamtendamen, die eher
Feen als Damen glichen – mit ihren rosa angehauchten Lilienschultern und
Gesichtchen, mit ihren himmlischen Gestalten und reizend hervorlugenden
Füßchen –: ja, wie könnte ich alles das schildern? Wie könnte ich diese
glänzenden Kavaliere schildern, wie sie heiter und wohlerzogen, gesetzt,
gutmütig, aufgeräumt und anstandsvoll, ein wenig benebelt dastanden, in
den Tanzpausen rauchten, oder auch nicht rauchten, und sich in ein
fernes grünes Zimmerchen zurückzogen, – wie diese Herren Beamten, die
alle, ausnahmslos, einen Rang und zumeist auch eine Familie besaßen, –
wie diese jungen Offiziere, die von den Begriffen der Eleganz und den
Gefühlen des Selbstbewußtseins tief durchdrungen waren, die mit ihren
Damen größtenteils nur Französisch sprachen, oder, falls es Russisch
war, dann doch nur in den höchsten Ausdrücken, so wie sich das bei
Komplimenten und tiefsinnigen gesellschaftlichen Phrasen von selbst
versteht, – wie diese Dandys, die sich nur im Rauchzimmer einige
liebenswürdige Abweichungen von besagtem hohen Tone erlaubten und sich
in freundschaftlicher Kürze ausdrückten, in Redewendungen, wie z. B.:
„Eh, du Petjka, hast ja den Walzer wie geschmiert getanzt!“ oder: „Na,
du, Wassjä, scheinst ja bei deiner Dame großartig abgeschnitten zu
haben!“ Alles das zu schildern, meine verehrten Leser, dazu reicht, wie
gesagt, meine Begabung nicht aus, und deshalb schweige ich lieber.
Wenden wir uns daher wieder Herrn Goljädkin zu, dem wirklichen und
einzigen Helden unserer durchaus wahrheitsgetreuen Erzählung.
Herr Goljädkin befand sich währenddessen in einer, sagen wir kurz, sehr
seltsamen Lage. Er hielt sich nämlich gleichfalls dort auf, d. h. er war
nicht gerade auf dem Ball, aber genau genommen doch so gut wie auf dem
Ball. Er war wie immer ein freier Mensch, ein Mensch für sich, und ging
niemanden etwas an. Nur stand er, während man dort oben tanzte, nicht –
wie soll ich sagen – nicht ganz gerade. Er stand nämlich – es ist etwas
peinlich, das zu sagen – er stand nämlich währenddessen im Flur der
Küchentreppe des Hauses. Es hatte das nichts weiter auf sich, daß er
dort stand: er war auch dort ein freier Mensch, ein Mensch für sich, wie
immer. Er stand, meine verehrten Leser, er stand in einem Winkel, in dem
es zwar nicht gerade wärmer, doch dafür etwas dunkler war, stand
halbwegs verborgen hinter einem großen Schrank und einem alten
Wandschirm, stand zwischen verschiedenem Gerümpel, Hausgerät und anderem
Kram, und wartete vorläufig nur die Zeit ab, gewissermaßen wie ein
müßiger Zuschauer, dem das Schauspiel selbst nicht sichtbar ist. Er
wartete und beobachtete – ja, meine verehrten Leser – er wartete und
beobachtete vorläufig nur. Übrigens konnte er jeden Augenblick
gleichfalls eintreten ... warum auch nicht? Er brauchte nur aus seinem
Versteck hervorzukommen und weiterzugehen: und er kam wie jeder andere
in den Saal, mit der größten Leichtigkeit. Indessen aber – während er
dort schon die dritte Stunde in der Kälte stand, eingekeilt zwischen der
Wand, dem Schrank und dem Schirm und neben verschiedenem Gerümpel,
Hausgerät und anderen Sachen – zitierte er in einem fort, wenn auch bloß
in Gedanken, sich zum Trost und zur Rechtfertigung seiner
Handlungsweise, einen Ausspruch des französischen Ministers Villèle
seligen Angedenkens, daß nämlich „alles zu seiner Zeit an die Reihe
komme, wenn man nur die Geduld zum Abwarten habe“. Diesen Ausspruch
hatte Herr Goljädkin einst in einem übrigens ganz belanglosen Buch
gelesen und sich gemerkt, weshalb er ihn sich denn jetzt, und zwar sehr
zur rechten Zeit, wieder ins Gedächtnis rufen konnte. Erstens paßte
dieser Ausspruch ganz vortrefflich zu seiner augenblicklichen Lage, und
zweitens, was kommt einem Menschen schließlich nicht in den Sinn, wenn
er in einem Treppenflur, in Dunkelheit und Kälte, drei Stunden lang auf
den glücklichen Ausgang seines Vorhabens wartet?
Während Herr Goljädkin, wie gesagt, sehr zur rechten Zeit den passenden
Ausspruch zitierte, fiel ihm gleichzeitig aus einem unbekannten Grunde
die Lebensgeschichte des einstigen türkischen Wesirs Marzimiris ein, und
gleich darauf diejenige der schönen Markgräfin Louise, deren Biographie
er gleichfalls einmal gelesen hatte. Dann fiel ihm auch noch ein, daß
die Jesuiten nach dem Grundsatz zu handeln pflegten, daß jedes Mittel
durch den Zweck geheiligt werde, daß man also jedes Mittel anwenden
könne, wenn man damit nur das Ziel erreiche. Diese historische Tatsache
flößte Herrn Goljädkin eine gewisse Hoffnung ein, doch schon im nächsten
Augenblick meinte er – „Ach was, Jesuiten!“ – die Jesuiten, die könne er
allesamt ins Bockshorn jagen, die seien dümmer als dumm. Wenn sich nur
das Büfettzimmer auf einen Augenblick leeren wollte (das Zimmer, von dem
aus eine kleine Tür unmittelbar nach dem Flur führte, in dem Herr
Goljädkin sich aufhielt), dann würde er ganz ohne alle Jesuiten, nämlich
ohne weiteres – dort eintreten und schnurstracks durch das Büfettzimmer
ins Teezimmer gehen und von dort durch das Zimmer, in dem man Karten
spielte, und von dort weiter in den Saal, in dem getanzt wurde. Und er
würde hindurch gehen, würde tatsächlich und ohne jede Rücksicht oder
irgendwelche Bedenken, ungeachtet aller Hindernisse, hindurchgehen –
würde einfach so durchschlüpfen, im Handumdrehen, und, noch eh’ ihn
jemand bemerkte, mitten im Saal stehen! Dort aber – o! was er dann dort
zu machen hatte, das wußte er selbst schon ganz genau.
Also in einem solchen Zustande befand sich unser Held, obschon es
übrigens schwer zu erklären wäre, was alles während des Wartens in ihm
vorging. Die Sache war nämlich die, daß er bis zum Hause und bis in den
Treppenflur den Weg glücklich gefunden hatte: weshalb, fragte er sich,
sollte er ihn auch nicht finden? – weshalb sollte er nicht eintreten,
wenn doch alle anderen eintraten? So kam er bis in den Flur, doch weiter
wagte er nicht vorzudringen, wagte es wenigstens nicht offen und allen
sichtbar ... aber das nicht etwa deshalb, weil er es nicht _wagte_,
sondern so, weil er es eben selbst nicht wollte, weil er lieber kein
Aufsehen erregte – nur das war der Grund. Und da wartete er eben,
wartete ganz mäuschenstill geschlagene drei Stunden. Weshalb sollte er
auch nicht warten? Hat doch auch Villèle gewartet!
„Ach was, Villèle!“ dachte Herr Goljädkin, „was hat Villèle damit zu
schaffen! Aber wie könnte ich jetzt ... einfach dort eintreten? ... Ach
du Eckensteher, du vermaledeiter!“ verwünschte er sich selbst, samt
seinem Kleinmut, und kniff sich vor Wut mit der steifgefrorenen Hand in
die steifgefrorene Wange, „du Narr, der du bist, du elender
Goljädka[12], da hat dich das Schicksal grad’ richtig benannt, indem es
dir einen solchen Namen gab! ...“
Übrigens waren diese Schmeicheleien, mit denen er sich plötzlich selbst
bedachte, nur so eine zeitweilige kleine Gedankenverirrung, ohne jeden
sichtbaren Zweck oder besonderen Grund.
Dann wagte er sich ein wenig aus seinem Versteck hervor und schlich zur
Tür: der Augenblick war günstig – im Büfettzimmer war kein Mensch. Herr
Goljädkin sah das alles durch das kleine Fenster der Tür. Schon legte er
die Hand auf die Klinke, um zu öffnen und schnell hineinzuschlüpfen –
doch plötzlich fragte er sich:
„Soll ich? ... Soll ich eintreten oder lieber nicht? ... Ach was, ich
trete ein! ... weshalb sollte ich denn nicht? Dem Mutigen gehört die
Welt!“
Doch als er sich damit schon angefeuert und ermuntert hatte – flüchtete
er plötzlich, für ihn selbst ganz unerwartet, wieder hinter den Schirm
zurück.
„Nein,“ dachte er, „wenn nun jemand in das Zimmer kommt? Da haben wir’s!
– da sind richtig welche eingetreten. Worauf wartete ich denn, als
niemand dort war? Warum trat ich nicht ein? Wenn man doch so ... ganz
einfach sich ein Herz fassen und ohne weiteres und geradezu
hineindringen könnte! ... Ja, schön gesagt, wenn der Mensch nun einmal
solch einen Charakter hat! Daß es doch solch eine Veranlagung geben muß!
Da ist dir das Herz wieder gleich in die Hühnerbeine gefallen! Ja, den
Mut verlieren, das ist eben alles, was unsereiner kann. Nichts
ausrichten oder alles verpfuschen – das einzig Mögliche! Das können wir!
Jetzt steh’ hier wie ein Tölpel und sieh zu, was aus dir wird! Zu Haus
könnte man jetzt ein Täßchen Tee trinken ... Das wäre eigentlich ganz
angenehm. So aber – spät zurückkehren? ... Petruschka würde brummen ...
Soll ich nicht einfach jetzt gleich nach Haus gehen? Der Teufel hole die
ganze Geschichte! Ich gehe nach Haus und damit basta!“
Doch kaum hatte Herr Goljädkin diesen Entschluß gefaßt, als er plötzlich
schon an der Tür stand, mit zwei Schritten in das Büfettzimmer
schlüpfte, Paletot und Hut abwarf und beides schnell irgendwohin in
einen Winkel stopfte, schnell an seinen Kleidern rückte und sich umsah:
dann ... dann schlich er leise in das Teezimmer, von dort schlüpfte er
fast unbemerkt durch das Spielzimmer – es gingen gerade ein paar andere
Herren an den Tischen vorüber, – und dann ... dann ... ja dann vergaß
Herr Goljädkin alles, was ringsum war oder geschah, und befand sich im
Saal.
Zum Unglück wurde in dem Augenblick gerade nicht getanzt. Die Damen
saßen oder gingen umher in malerischen Gruppen. Die Herren standen hier
und dort in leiser Unterhaltung beisammen oder forderten Damen zum
nächsten Tanz auf. Herr Goljädkin bemerkte jedoch nichts davon. Er sah
nur Klara Olssuphjewna, neben ihr Andrej Philippowitsch und Wladimir
Ssemjonowitsch, dann noch zwei oder drei Offiziere – und vielleicht ein
paar junge Beamte, die alle, wie man auf den ersten Blick erkennen
konnte, hinsichtlich ihrer Laufbahn zu den verschiedensten Hoffnungen
berechtigten ... Vielleicht sah er auch noch ein paar andere Gestalten.
Oder nein: er sah eigentlich nichts, oder doch so gut wie nichts,
wenigstens sah er niemanden an, und bewegte sich nicht aus eigener
Kraft, sondern gleichsam einer fremden folgend, die ihn, ohne nach
seinem Willen zu fragen, obschon er ganz entschieden keinen eigenen mehr
besaß, immer weiter schob, immer weiter, und durch die er, indem er ihr
folgte, auf diese Weise unaufgefordert in einem fremden Ballsaal
erschien. Da ihm aber alle Sinne zu vergehen drohten, oder vielleicht
auch schon mehr oder weniger vergangen waren, trat er versehentlich
einem Geheimrat auf den Fuß, trat auf die Schleppe einer ehrwürdigen
Matrone, verwickelte sich mit den Füßen in einer Spitzengarnitur, der er
etliche Risse beibrachte, stieß stolpernd an einen Diener, der mit einem
Präsentierteller an ihm vorüberging, stieß vielleicht noch jemanden,
ohne es selbst zu gewahren, oder richtiger, ohne alle die einzelnen
Unglücksfälle noch auseinanderhalten zu können, – bis er plötzlich nur
eines begriff: daß er vor Klara Olssuphjewna stand. Zweifellos wäre er
in diesem Augenblick mit der größten Bereitwilligkeit in den Boden
versunken: doch was nicht geht, das geht nun einmal nicht, ebensowenig
wie Geschehenes sich ungeschehen machen läßt. Was sollte er tun?
Mißlingt es, dann ... – Wo waren seine Grundsätze? Wie waren sie?
Jedenfalls war Herr Goljädkin – darin hatte er vollkommen recht – kein
Meister in der Kunst, das Parkett mit den Stiefelsohlen zu polieren ...
Möglich, daß er daran dachte ... vielleicht kamen ihm auch die Jesuiten
in den Sinn ...
Alles, was dort ringsum ging und stand und plauderte und lachte –
verstummte plötzlich wie durch einen Zauberschlag. Man sah sich um, man
fragte sich mit den Blicken, aller Augen richteten sich auf ihn, und
allmählich drängte man sich näher. Herr Goljädkin sah und hörte selbst
nichts davon – er stand und sah zu Boden und gab sich sein Ehrenwort,
daß er sich noch in dieser Nacht erschießen werde. Und nachdem er sich
sein Ehrenwort gegeben, dachte er: „Nun komme, was wolle!“ Doch
plötzlich vernahm er zu seiner eigenen größten Verwunderung, daß er zu
sprechen begann.
Er begann mit der üblichen Gratulation und dann folgten einige sogar
sehr geschickte und vernünftige Worte, mit denen er ihr Glück und alles
Gute wünschte. Die Gratulation ging tadellos vonstatten, doch bei den
Wünschen wurde er unsicher – wurde er unsicher und fühlte, daß er,
sobald er nur einmal stockte, dann überhaupt nicht weiter können würde,
und ... und so stockte er denn auch und konnte – konnte in der Tat nicht
mehr weiter ... und alles ging zum Teufel. Er stand ... und errötete!
Hochrot stand er da und wußte sich nicht zu helfen ... und in seiner
Hilflosigkeit sah er plötzlich auf und sah und – erstarrte ... Alles
stand, alles schwieg, alles wartete: unter den Fernerstehenden erhob
sich ein Geflüster, unter den Näherstehenden leises Gelächter. Herr
Goljädkin warf einen verlorenen Blick auf Andrej Philippowitsch, doch
der Blick, der ihn aus dessen Augen traf, war derart, daß er unseren
Helden, wenn er nicht ohnehin schon tot, vollkommen tot gewesen wäre,
auf der Stelle getötet hätte. Alles schwieg.
„Das ... das gehört zu meinen persönlichen Angelegenheiten und fällt in
mein Privatleben, Andrej Philippowitsch,“ brachte Herr Goljädkin kaum
hörbar hervor, „das ist kein dienstliches Erlebnis, Andrej
Philippowitsch ...“
„Schämen Sie sich, mein Herr, schämen Sie sich!“ sagte Andrej
Philippowitsch halblaut mit einem unbeschreiblichen Ausdruck des
Unwillens, – sagte es, reichte Klara Olssuphjewna den Arm und führte sie
fort von Herrn Goljädkin.
„Ich brauche mich nicht zu schämen, Andrej Philippowitsch,“ erwiderte
Herr Goljädkin leise, sah auf und ließ seinen unglücklichen Blick über
die Umgebung irren, als wolle er sich zunächst über seine eigentliche
Stellung inmitten dieser verwunderten Gesellschaft klar werden.
„Das ... das hat doch nichts zu sagen, meine Herren! Was ist denn dabei?
Nun was, das kann doch einem jeden zustoßen,“ murmelte Herr Goljädkin
kaum verständlich, schüchtern ein wenig zur Seite tretend, um sich der
ihn umringenden Schar zu entziehen.
Man trat vor ihm zurück und gab ihm den Weg frei. So schob sich unser
Held denn zwischen zwei Reihen neugieriger und verwunderter Beobachter
weiter. Das Verhängnis leitete ihn. Herr Goljädkin fühlte es selbst, daß
er dem Verhängnis preisgegeben war. Natürlich hätte er viel darum
gegeben, wenn er jetzt wieder im Flur hinter dem Schrank hätte stehen,
wenn er sich „ohne Verletzung des gesellschaftlichen Anstandes“
unbemerkt wieder dorthin hätte zurückziehen können! Doch da das leider
ausgeschlossen war, so sah er sich nach einer Möglichkeit um, sich
wenigstens im Saal irgendwo zu verstecken oder in einem möglichst
unbeachteten Winkel zu verbergen, um dann dort meinetwegen bis zum
Morgen auszuharren, bescheiden, anständig, ganz für sich, ohne die
geringste Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, ohne jemanden anzurühren,
um auf diese Weise gleichzeitig das Wohlwollen der Gäste wie die
Verzeihung des Hausherrn zu erwerben.
Er hatte übrigens die Empfindung, als untergrübe irgend etwas den Boden,
auf dem er stand, als wanke dieser Boden bereits, als müsse er selbst
sogleich fallen. Endlich erreichte er einen stillen Winkel, in den er
sich zurückzog, worauf er sich bemühte, wie ein fremder Zuschauer
auszusehen, der niemanden etwas anging und der selbst mit ziemlichem
Gleichmut dem Treiben zusah, indem er sich auf die Lehnen zweier Stühle
stützte, die er gewissermaßen wie eine schützende Barrikade festhielt,
während er sich ehrlich bemühte, mit möglichst heiterem Blick die ihn
immer noch anschauenden Gäste Olssuph Iwanowitschs zu betrachten. Von
allen am nächsten stand ihm ein junger, schlanker Offizier, vor dem Herr
Goljädkin sich wie ein richtiger Käfer vorkam.
„Diese beiden Stühle, Herr Leutnant, diese beiden Stühle sind für zwei
Damen bestimmt: der eine für Klara Olssuphjewna, der andere für die
Prinzessin Tschewtschechanowa, – ich stehe hier nur, damit sie nicht von
anderen fortgenommen werden,“ stammelte Herr Goljädkin unter
Herzklopfen, indem er seinen flehenden Blick auf den jungen Leutnant
richtete. Statt einer Antwort wandte sich dieser schweigend mit einem
wahrhaft vernichtenden Lächeln von ihm ab.
Nach dieser verletzenden Zurückweisung auf der einen Seite wollte Herr
Goljädkin auf der anderen Seite sein Glück versuchen, und wandte sich
mit irgendeiner Bemerkung an einen überaus würdevollen Rat, dessen Brust
einer unserer höchsten Orden schmückte. Doch der Herr Rat maß ihn mit
einem Blick, daß Herr Goljädkin glaubte, ihm sei eiskaltes Wasser über
den Rücken gegossen worden. Er verstummte und beschloß, lieber zu
schweigen, um kein weiteres Ärgernis hervorzurufen und mit seinem
Schweigen zu sagen, daß er ein Mensch für sich sei, ein Mensch wie alle
anderen, und daß er sich seiner Meinung nach nichts zuschulden kommen
lasse. Zu diesem Zweck, das heißt um diese Gedanken wortlos
auszudrücken, heftete er seine Blicke auf den Aufschlag seines
Uniformrockes, doch nach einiger Zeit sah er wieder auf und heftete sie
auf einen Herrn von überaus ehrwürdigem Äußeren.
„Dieser Herr trägt eine Perücke,“ dachte Herr Goljädkin, „und wenn man
ihm diese Perücke abnähme, würde man einen vollständig kahlen Kopf
sehen.“
Bei dieser Beobachtung erinnerte sich Herr Goljädkin alles dessen, was
er über die arabischen Emire gelesen hatte: daß sie zum Zeichen ihrer
Verwandtschaft mit Mohammed gleichfalls einen grünen Turban trügen,
unter dem auch nur ein nackter, das heißt haarloser Kopf sichtbar wurde.
Von den Köpfen der Emire sprangen seine Gedanken auf türkische
Pantoffeln über, und bei der Gelegenheit erinnerte er sich noch, daß
Andrej Philippowitsch gewöhnlich Stiefel trug, die mehr bequemen
Pantoffeln glichen, als Stiefeln. Doch allmählich wurde er mit seiner
Umgebung vertrauter und begann, weniger ängstlich, hierhin und dorthin
zu schauen.
„Wenn zum Beispiel dieser Kandelaber plötzlich herabfiele, gerade auf
die versammelte Gesellschaft, so würde ich sogleich zu Klara
Olssuphjewna stürzen und sie retten. Und wenn sie dann in Sicherheit
wäre, würde ich zu ihr sagen: ‚Beunruhigen Sie sich nicht, gnädiges
Fräulein, das hatte nichts auf sich, ich aber bin Ihr Retter.‘ Und dann
...“
Hier blickte Herr Goljädkin nach jener Richtung, in der er Klara
Olssuphjewna zuletzt gesehen hatte, und da erblickte er plötzlich
Gerassimowitsch, den alten Diener Olssuph Iwanowitschs. Gerassimowitsch
kam mit einer besorgten und gewissermaßen offiziell-feierlichen Miene
gerade auf ihn zu. Herr Goljädkin zuckte zusammen und runzelte die Stirn
unter dem jähen Eindruck einer unbestimmten und gleichzeitig sehr
unangenehmen Empfindung. Ganz mechanisch blickte er sich nach beiden
Seiten um: ihm kam nämlich plötzlich der Gedanke, daß es vielleicht sehr
gut und ratsam wäre, sich jetzt schnell und geschickt irgendwie – so ...
zu drücken, daß niemand es bemerkte, – ganz einfach zu verschwinden, als
hätte er nie hier gestanden. Doch noch bevor unser Held sich zu irgend
etwas entschließen oder gar etwas tun konnte, stand dieser
Gerassimowitsch schon vor ihm.
„Sehen Sie dort, Gerassimowitsch,“ wandte sich unser Held mit einem
Lächeln an den alten Diener, „sagen Sie einem von den Dienstboten –
sehen Sie dort die Kerze im Kandelaber? Sie wird sogleich fallen, sie
steht schon ganz schief. Sagen Sie nur schnell, daß man sie wieder
gerade einsetzt – sie wird wirklich sogleich fallen, Gerassimowitsch
...“
„Die Kerze? Nein, die Kerze steht ganz gerade, aber es ist dort jemand,
der Sie sprechen will.“
„Wer ist denn das, Gerassimowitsch?“
„Ja, das weiß ich nicht zu sagen, wer er ist. Ein Mensch, den irgend
jemand geschickt hat. Er fragte, ob Jakoff Petrowitsch Goljädkin hier
sei. So rufen Sie ihn, bat er mich, er müsse Sie in einer sehr wichtigen
und unaufschiebbaren Angelegenheit sprechen ... so sagte er ...“
„Nein, Gerassimowitsch, Sie täuschen sich. Sie werden sich verhört
haben, Gerassimowitsch.“
„Schwerlich ...“
„Nein, Gerassimowitsch, nicht ‚schwerlich‘, in diesem Falle kann es
nicht ‚schwerlich‘ der Fall sein, Gerassimowitsch. Niemand kann hier
nach mir fragen, Gerassimowitsch, niemand kann mich hier sprechen
wollen, ich bin hier ganz allein und für mich, das heißt, ich gehe hier
keinen Menschen etwas an, Gerassimowitsch.“
Herr Goljädkin holte tief Atem und sah sich um. Natürlich! Alles, was im
Saale war, alles hatte sich mit Augen und Ohren ihm zugewandt und
schwieg in nahezu feierlicher Erwartung. Die Herren standen etwas näher
und horchten gespannt, die Damen im Hintergrunde schienen erregt zu
tuscheln. Sogar der Hausherr erschien in Herrn Goljädkins nächster Nähe,
und obschon er äußerlich durch nichts verriet, daß er an den Erlebnissen
Herrn Goljädkins lebhaften und unmittelbaren Anteil nahm, zumal in
dieser Angelegenheit die äußerste Haltung gewahrt werden mußte, so
fühlte und sagte sich unser Held doch unverzüglich, daß der
entscheidende Augenblick für ihn herangekommen war. Herr Goljädkin sah
es deutlich, daß sich ihm jetzt oder nie die Gelegenheit zu einem kühnen
Handstreich bot, die Gelegenheit zur Beschämung und Vernichtung seiner
Feinde. Herr Goljädkin war erregt. Herr Goljädkin empfand plötzlich eine
gewisse Begeisterung und wandte sich wieder an den wartenden
Gerassimowitsch und begann mit zitternder, doch feierlicher Stimme:
„Nein, mein Freund, mich will niemand sprechen. Du irrst dich. Ja, ich
sage noch mehr: du hast dich auch heute vormittag geirrt, als du mir zu
versichern suchtest ... als du es wagtest, mir zu versichern, sage ich“
– Herr Goljädkin erhob die Stimme – „daß Olssuph Iwanowitsch, mein
Wohltäter seit undenklichen Zeiten, der mir in gewissem Sinne den Vater
ersetzt hat, mir in der Stunde der feierlichsten Freude seines
Vaterherzens die Tür habe weisen lassen.“ Herr Goljädkin sah sich
selbstzufrieden, doch mit tiefem Gefühl im Kreise um. In seinen Augen
erglänzten Tränen. „Ich wiederhole es, mein Freund, du hast dich geirrt,
hast dich grausam und unverzeihlich geirrt ...“
Der Augenblick war in der Tat feierlich. Herr Goljädkin fühlte es, daß
seine Rede einen Eindruck, einen großen Eindruck gemacht hatte. Herr
Goljädkin stand, bescheiden den Blick zu Boden gesenkt, und erwartete
die Umarmung Olssuph Iwanowitschs. Unter den Gästen machte sich eine
gewisse Aufregung und Verwunderung bemerkbar, und selbst der
unerschütterliche Gerassimowitsch, der im Begriff war, wieder
„schwerlich“ zu sagen, stockte, noch bevor er es aussprach, und blieb
stumm ... Da setzte plötzlich das Orchester ein und spielte eine
rauschende Polka. Alles zerstob! Herr Goljädkin zuckte zusammen,
Gerassimowitsch zog sich schleunigst zurück, und alles, was im Saal war,
geriet wie ein Meer ins Wogen: da schwebte bereits das erste Paar,
Wladimir Ssemjonowitsch mit Klara Olssuphjewna im Arm, und als zweites
der Leutnant mit Prinzeß Tschewtschechanowa. Die Zuschauer drängten sich
entzückt und begeistert herbei und lächelten vor Lust beim Anblick des
neuen Tanzes – der rauschenden und alle Köpfe verdrehenden Polka.
Herr Goljädkin war vollständig vergessen. Doch nach einiger Zeit geriet
wieder alles durcheinander, der Rhythmus der allgemeinen Bewegung setzte
aus, die Musik verstummte ... Klara Olssuphjewna war atemlos, mit
geröteten Wangen und ganz erschöpft auf einen Stuhl gesunken. Alle
Herzen flogen der bezaubernden Königin des Festes zu, alle eilten zu
ihr, um ihr Komplimente zu sagen und für das Vergnügen, das man beim
Anblick ihres Tanzes empfunden, zu danken, und – da stand auch schon
Herr Goljädkin vor ihr. Er war bleich und sah aus, als wisse er selbst
nicht, was er tat. Er lächelte aus irgendeinem Grunde und schob bittend
den Arm vor, sie zum Tanze auffordernd. Klara Olssuphjewna sah zwar sehr
verwundert zu ihm auf, erhob sich aber ganz mechanisch und legte ebenso
mechanisch die Hand auf seinen Arm. Herr Goljädkin beugte sich nach
vorn, zuerst einmal, dann zum zweiten Male, erhob gleichzeitig einen
Fuß, mit dem er irgendwie nach hinten ausschlug, dann stampfte er
plötzlich auf, und dann ... ja, dann stolperte er über seine eigenen
Beine ... Er hatte gleichfalls mit ihr tanzen wollen! Klara Olssuphjewna
kam plötzlich zu sich und schrie leise auf: im Nu stürzten alle herbei,
um sie von Herrn Goljädkin zu befreien, und im Augenblick sah sich unser
Held mindestens schon zehn Schritte weit von ihr fortgedrängt, sah sich
von einem empörten Kreise umgeben, vernahm das Gekreisch und die Klagen
von zwei alten Damen, die er während seines Rückzuges gestoßen oder
getreten hatte – er wußte es selbst nicht. Die Aufregung war
unbeschreiblich: alles rief, schrie, sprach durcheinander. Das Orchester
verstummte. Unser Held drehte sich im Kreise und lächelte und murmelte
halb bewußtlos allerlei vor sich hin: daß er doch gleichfalls ...
weshalb denn nicht ... die Polka sei ein neuer Tanz und er könne nichts
dafür ... ein Tanz, erfunden zur Unterhaltung und zur Zerstreuung der
Damen ... doch wenn es mit dem Tanzen nun einmal nicht ginge, so sei er
ja bereit, zurückzutreten ... Leider schien sich aber niemand um seine
Bereitwilligkeit zu kümmern. Unser Held fühlte nur, daß eine Hand sich
um seinen Oberarm legte und eine andere kräftig gegen seinen Rücken
drückte und daß man ihn in irgendeiner Richtung weiterschob. Und diese
Richtung war – das sah er plötzlich – die Tür. Herr Goljädkin wollte
irgend etwas sagen, irgend etwas tun ... oder nein, er wollte gar nichts
mehr. Er lächelte nur, lächelte unbewußt. Seine nächste Empfindung war
dann, daß man ihm den Mantel anzog und den Hut auf den Kopf drückte,
irgendwie schief auf die Stirn und in die Augen. Dann befand er sich,
wie ihm schien, einen Moment im Treppenflur, in der Dunkelheit und
Kälte, dann auf der Treppe. Plötzlich stolperte er und glaubte, in einen
Abgrund zu fallen: er wollte gerade aufschreien – doch da stand er schon
auf dem Hof. Die frische Nachtluft wehte ihn an, er stand und fühlte nur
ein Drehen im Kopf. Da vernahm er mit einem Male die gedämpften Klänge
der Musik, die wieder einsetzte. Er zuckte zusammen und plötzlich
erinnerte er sich an alles! Seine Kräfte, die ihn völlig verlassen
hatten, waren wie mit einem Schlage wieder da. Er fuhr auf, griff sich
an den Kopf und stürzte fort, gleichviel wohin, in die Luft, in die
Freiheit, geradeaus – wohin ihn nur die Füße trugen.
V.
Von den Türmen der Stadt schlug es gerade Mitternacht, als Herr
Goljädkin auf den Kai des Fontankakanals in der Nähe der Ismailoffbrücke
hinauslief, um sich vor seinen Feinden zu retten, vor seinen Feinden und
Verfolgern, dem Gekreisch der empörten alten und dem Ach und Weh der
jungen Damen, und vor den tötenden Blicken Andrej Philippowitschs.
Herr Goljädkin fühlte sich nicht bloß vernichtet, wie man das so zu
sagen pflegt, sondern vollständig und buchstäblich erschlagen –
erschlagen und tot, und wenn er im Augenblick doch noch die Fähigkeit
des Laufens behielt, so war das entschieden nur mit einem Wunder zu
erklären, einem Wunder, an das zu glauben er sich schließlich selber
weigerte. Das Wetter war grauenvoll – eine Petersburger Novembernacht:
naß, neblig, dunkel, mit jenem Regen und Schnee, die alle Gaben des
Petersburger Novemberwetters, wie Rheumatismus, Schnupfen, Influenza und
alle möglichen sonstigen Erkältungen und Entzündungen mit sich brachten
und in sich trugen. Der Wind heulte durch die menschenleeren Straßen und
über den Kanal, daß das schwarze Wasser in der Fontanka sich unheimlich
regte, rüttelte eilig an den spärlichen Laternen, die auf sein Pfeifen
mit leisem Kreischen und Knarren antworteten, was dann alles zusammen
wie eine weinerlich schrille, fernher schwirrende Musik klang, die jedem
Petersburger so gut bekannt ist. Die vom Winde zerrissenen Regenströme
samt dem nassen Schnee trafen – als kämen sie aus einer Feuerspritze –
den armen Herrn Goljädkin fast horizontal und schnitten und stachen ihn
ins Gesicht wie mit tausend Nadeln. Durch das nächtliche Schweigen, das
nur fernes Wagenrollen, das Heulen des Windes und das Knarren der
Laternen unterbrach, hörte man das trostlose Tropfen des Wassers von den
Dächern und Fenstervorsprüngen auf die Steine des Trottoirs, und das
leise gurgelnde murmelnde Rauschen in den Regenröhren und Rinnsteinen.
Keine Menschenseele war nah und fern zu sehen, und es konnte ja auch um
diese Zeit und bei diesem Wetter niemand zu sehen sein. So eilte denn
auf dem Trottoir an der Fontanka nur Herr Goljädkin, ganz allein mit
seiner Verzweiflung, durch die Dunkelheit und den Regen, eilte in seiner
eigentümlichen Gangart mit schnellen, kleinen, trippelnden Schritten wie
im Trab halb laufend, immer weiter, um so schnell wie möglich die
Schestilawotschnaja zu erreichen, unter den Torbogen zu schlüpfen und
dann die Treppe hinaufzueilen, bis er in seiner Wohnung in Sicherheit
war.
Doch obschon der Schnee und Regen und alles das, was sich kaum nennen
und schildern läßt, wenn die Novemberstürme Petersburg heimsuchen, von
allen Seiten zugleich auf Herrn Goljädkin niederging und ihn schonungs-
und erbarmungslos mitnahm, ihm bis auf die Knochen ging, die Augen
blendete und ihn fast vom Wege blies, als habe das Wetter sich mit
seinen Feinden verbündet und sich mit allen gegen ihn verschworen: so
konnte doch diese letzte Heimsuchung Herrn Goljädkin, der an diesem Tage
schon genugsam vom Unglück verfolgt worden war, merkwürdigerweise nicht
den Rest geben, ja sie kam ihm, kann man sagen, kaum ernsthaft und
wirklich zu Bewußtsein – so erschüttert war er durch das, was er vor
wenigen Minuten im Hause des Staatsrats Berendejeff hatte erleben
müssen! Selbst wenn ihn ein ganz Ahnungsloser in diesem Augenblick von
der Seite hätte beobachten können, wie er so, gleichsam blind und taub,
durch das Unwetter einhertrabte, – er hätte doch sogleich diese ganze
fürchterliche und unerträgliche Qual erraten und wohl gesagt, Herr
Goljädkin sehe aus, als wolle er sich vor sich selbst verstecken, als
wolle er am liebsten vor sich selbst fortlaufen. Und so war es auch
wirklich. Ja, wir können sogar sagen, daß Herr Goljädkin sich am
liebsten auf der Stelle vernichtet, in Staub und Nichts verwandelt
hätte. Er hörte weder, noch sah oder begriff er etwas von dem, was ihn
umgab: er sah aus, als spüre er nichts von Regen und Schnee, nichts vom
Winde und vom Unwetter. Die eine Galosche, die für den rechten Stiefel
etwas zu groß war, fiel ab, doch Herr Goljädkin eilte weiter, ohne es
überhaupt zu bemerken. Er war so verwirrt, daß er mehrmals jäh stehen
blieb, von nichts anderem erfüllt, als von dem Gedanken an eine
unfaßbare Schmach, und daß er dann unbeweglich, wie zu einer Bildsäule
erstarrt, mitten auf dem Trottoir stand: in diesen Augenblicken starb er
fast, verging er – bis er dann plötzlich zusammenfuhr und wie ein
Irrsinniger weiterlief, lief und lief, ohne sich umzusehen, als wolle er
sich vor Verfolgern retten oder als gelte es, irgendeinem furchtbaren
Unglück zu entrinnen. Sein Zustand war in der Tat beängstigend ...
Endlich blieb er vor Erschöpfung stehen, stützte sich auf das Geländer
am Kanal und starrte auf das schwarze Wasser der Fontanka. So stand er
eine lange Zeit. Was er dachte, läßt sich nicht genau sagen, aber
jedenfalls war seine Verzweiflung so groß, die Qual so ungeheuerlich und
sein Mut so erschöpft, daß er alles vergaß, alles, das Haus an der
Ismailoffbrücke und seine Wohnung an der Schestilawotschnaja, selbst
vergaß, wo er sich im Augenblick befand ... Und warum sollte er auch
nicht? Es war doch nichts mehr daran zu ändern, was ging es ihn im
Grunde noch an? ... Plötzlich aber ... plötzlich zuckte er am ganzen
Körper zusammen und sprang unwillkürlich ein paar Schritte zur Seite.
Mit einer unerklärlichen Unruhe sah er sich um: es war niemand zu sehen,
es konnte nichts Besonderes geschehen sein, und doch ... und doch schien
es ihm, daß im Augenblick jemand neben ihm, dicht neben ihm gestanden
hatte, gleichfalls auf das Geländer gestützt, und – seltsam! – es war,
als habe der Betreffende ihm sogar etwas gesagt, schnell und kurz und
nicht ganz deutlich, aber irgend etwas ihm Naheliegendes, etwas, das ihn
persönlich anging.
„Wie, oder sollte mir das ... nur so vorgekommen sein?“ fragte sich Herr
Goljädkin, indem er sich nochmals suchend umsah. „Aber wo bin ich denn?
... Oh!“ schloß er kopfschüttelnd, fuhr aber doch fort, unruhig, mit
einem beklemmenden Gefühl, ja sogar mit einer gewissen Angst, alle
Kräfte zusammenzunehmen, um mit seinen kurzsichtigen Blicken in die
trübe, feuchte Dunkelheit zu spähen. Es war aber nichts Verdächtiges zu
sehen: nichts Besonderes fiel ihm auf. Es schien alles ruhig zu sein,
alles wie es sein mußte, es schneite nur stärker als vorher und in
größeren Flocken: keine zwanzig Schritte weit konnte man sehen, so
stockfinster war es. Und der Wind heulte noch eintöniger, noch klagender
sein banges Lied, ganz wie ein Bettler, der nicht von einem läßt und
traurig um ein Almosen bittet, um sein Leben fristen zu können.
„E–eh! was ist denn das mit mir?“ fragte sich Herr Goljädkin, und er
setzte seinen Weg fort, blickte sich aber immer noch etwas unsicher um.
Inzwischen bemächtigte sich seiner eine neue Empfindung: es war wie eine
Beklemmung, und doch wieder nicht, es war wie Angst ... und doch anders
als Angst ... Ein fieberhaftes Zittern lief durch seinen ganzen Körper
und zerrte an allen Sehnen. Der Augenblick war unerträglich.
„Nun, was ist denn dabei,“ murmelte er endlich, um sich etwas zu
ermuntern, „was tut es denn? Vielleicht hat so etwas nichts auf sich und
geht niemandem an die Ehre. Vielleicht war das gerade nötig,“ fuhr er
fort, ohne selbst zu verstehen, was er sprach, „vielleicht wird das
gerade zum Guten führen, mir noch ein Glück eintragen, weshalb also
ungehalten sein, wenn ich ihnen allen einmal zu Dank verpflichtet sein
kann?“
Mit diesen beruhigenden und tröstenden Erwägungen beschäftigt,
schüttelte Herr Goljädkin den Schnee von sich ab, der schon mit einer
dicken Schicht seinen Hut und Kragen, die Schultern und Stiefel
bedeckte, – doch jene seltsame Empfindung, jene dunkle Beklemmung konnte
er nicht abschütteln. Irgendwo fern fiel ein Kanonenschuß[13].
Das ist aber ein Wetter, dachte unser Held, hu! wenn es nicht noch eine
Überschwemmung gibt? Das Wasser muß doch schon bedeutend gestiegen sein
...
Kaum hatte Herr Goljädkin das gedacht, als er nicht weit vor sich einen
Menschen erblickte, der ihm entgegenkam, – wohl ebenso wie er selbst ein
verspäteter Fußgänger. Es war offenbar eine ganz zufällige Begegnung,
die nichts weiter zu bedeuten hatte. Doch Herr Goljädkin wurde aus einem
unbekannten Grunde ängstlich und verlor sogar ein wenig den Kopf. Nicht,
daß er einen Mörder oder Dieb gefürchtet hätte, – nein, das nicht, aber
... „was kann man wissen, wer er ist,“ fuhr es ihm durch den Sinn,
„vielleicht ist auch er hier im Spiel, ja vielleicht ist er sogar die
Hauptperson und kommt mir jetzt nicht zufällig entgegen, sondern in
einer besonderen Absicht, um meinen Weg zu kreuzen und mich anzurempeln
...“
Möglicherweise dachte Herr Goljädkin dies auch nicht, sondern empfand
nur eine Sekunde lang etwas Ähnliches und äußerst Unangenehmes. Er hätte
auch gar nicht Zeit zum Denken gehabt: der Fremde war keine zwei
Schritte mehr von ihm entfernt. Herr Goljädkin beeilte sich seiner
Gewohnheit gemäß, eine Miene aufzusetzen, die deutlich zu erkennen gab,
daß er, Goljädkin, ein Mensch für sich sei und niemanden etwas angehe,
daß der Weg für alle breit genug, und er, Goljädkin selbst, niemanden
anrühre und ruhig vorübergehe. Plötzlich aber stand er wie vom Blitz
getroffen, und dann wandte er sich schnell zurück und sah dem anderen
nach, der kaum an ihm vorübergegangen war, – wandte sich zurück, als
habe ihn jemand an einer Schnur herumgerissen. Der Unbekannte entfernte
sich schnell im Schneetreiben. Er ging gleichfalls sehr eilig, war
gleichfalls ganz vermummt, hatte den Hut in die Stirn gezogen und den
Kragen aufgeschlagen, und ging ganz wie er, Herr Goljädkin, mit kleinen,
schnellen, trippelnden Schritten, ein wenig wie im Trab.
„Was ... was ist das?“ murmelte Herr Goljädkin mit einem ungläubigen
Lächeln, – schauderte aber doch am ganzen Körper zusammen. Es lief ihm
kalt über den Rücken. Inzwischen verschwand der Unbekannte vollends in
der Dunkelheit, auch seine Schritte waren nicht mehr zu hören, Herr
Goljädkin aber stand immer noch und sah ihm nach. Erst allmählich kam er
wieder zu sich.
„Was ist das mit mir,“ dachte er ärgerlich, „bin ich denn etwa rein von
Sinnen oder ... oder ganz verrückt?“ Und er ging wieder seines Weges,
beschleunigte aber immer mehr den Schritt und bemühte sich, an gar
nichts zu denken. Ja er schloß sogar die Augen, um nicht zu denken.
Plötzlich, durch das Heulen des Windes und das Geräusch des Unwetters,
vernahm er wieder schnelle Schritte in der Nähe. Er fuhr zusammen und
öffnete die Augen. Vor ihm, etwa zwanzig Schritte weit, tauchte von
neuem irgendein dunkles Menschlein auf, das ihm eilig entgegenkam. Die
Entfernung verringerte sich schnell. Herr Goljädkin konnte schon
deutlicher seinen neuen Schicksalsgenossen erkennen, – und plötzlich
schrie er auf vor Überraschung und Entsetzen. Seine Füße wurden schwach.
Es war das derselbe, ihm schon bekannte Passant, der vor etwa zehn
Minuten an ihm vorübergegangen war, und der ihm jetzt plötzlich wieder
entgegenkam. Das Erlebnis war seltsam und unheimlich. Herr Goljädkin war
so überrascht, daß er stehen blieb, zitterte, irgend etwas sagen wollte,
und – plötzlich dem Unbekannten nachlief, ja, er rief ihn sogar an,
wahrscheinlich, um ihn schneller zu erreichen. Der Unbekannte blieb auch
wirklich stehen, etwa zehn Schritte weit von Herrn Goljädkin, und zwar
gerade im Schein der nächsten Laterne, so daß man ihn deutlich erkennen
konnte, – blieb stehen, wandte sich nach Herrn Goljädkin um und wartete
mit ungeduldiger Miene darauf, was jener nun sagen werde.
„Verzeihen Sie, ich habe mich vielleicht nur getäuscht,“ stammelte unser
Held mit zitternder Stimme.
Der Unbekannte wandte sich schweigend und sichtlich ungehalten wieder
von ihm ab und ging schnell weiter, als wolle er sich beeilen, die
verlorenen zwei Sekunden einzuholen. Herr Goljädkin aber zitterte am
ganzen Körper und vermochte sich kaum auf den Füßen zu halten. Mit einem
Stöhnen sank er auf einen der Prellsteine am Trottoir. Er hatte wirklich
allen Grund, so die Fassung zu verlieren.
Dieser Unbekannte war ihm jetzt tatsächlich bekannt erschienen. Doch das
hätte allein noch nicht viel besagt. Aber er hatte ihn ja erkannt, hatte
ihn jetzt vollkommen erkannt, diesen Menschen! Er hatte ihn schon
gesehen, hatte ihn – ja, hatte ihn irgend einmal gesehen, sogar vor ganz
kurzer Zeit. Aber wo? – wo konnte das gewesen sein? – und wann? War es
nicht erst vor einem Tage gewesen? Übrigens war nicht das die
Hauptsache, daß Herr Goljädkin ihn schon gesehen hatte. Es war ja auch
fast gar nichts Besonderes an diesem Menschen – auf den ersten Blick
hätte dieser Mensch entschieden keines anderen Menschen Aufmerksamkeit
erregt. Er war eben ein Mensch, wie alle anderen, war natürlich auch
anständig, wie alle anständigen Menschen, und vielleicht besaß er sogar
irgendwelche Vorzüge – mit einem Wort: er war auch ein Mensch für sich.
Herr Goljädkin empfand weder Haß noch Feindschaft noch selbst eine
Abneigung gegen diesen Menschen, sogar im Gegenteil! Nur (und gerade in
diesem Umstande lag die Hauptbedeutung), nur hätte er für nichts in der
Welt eine zweite Begegnung mit ihm gewünscht, und nun noch gar eine, wie
jetzt in der Nacht. Wir können sogar noch mehr verraten! Herr Goljädkin
kannte diesen Menschen ganz genau, er wußte sogar, wie er hieß, mit dem
Familiennamen und mit dem Ruf- und Vatersnamen. Und doch hätte er ihn
selbst für alle Schätze der Welt nicht mit Namen genannt, – er wollte
ihn nicht nennen, wollte es nicht einmal zugeben, daß jener so und so
hieß.
Wie lange Herr Goljädkin auf dem Prellstein saß, was er dachte oder
empfand, das vermag ich nicht zu sagen, doch als er endlich wieder zu
sich kam, raffte er sich plötzlich auf und begann zu laufen – und er
lief, was er nur laufen konnte, ohne sich umzusehen. Der Atem ging ihm
aus, er stolperte zweimal, fiel fast hin – und bei der Gelegenheit
verlor er auch die andere Galosche. Endlich gab er das Laufen auf,
verlangsamte den Schritt, um Atem zu schöpfen, sah sich schnell um und
stellte fest, daß er, ohne es zu merken, schon eine ganze Wegstrecke
längs der Fontanka zurückgelegt hatte, ging dann über die
Anitschkoffbrücke, ging über den Newskij und stand schließlich an der
Straßenkreuzung des Newskij Prospekt und der Liteinaja. Dann bog er in
die Liteinaja ein. Er glich in diesem Augenblick einem Menschen, der am
Rande eines Abgrundes steht, unmittelbar vor einem Absturz, der den
Boden schon unter sich wanken fühlt und im nächsten Augenblick in die
Tiefe stürzen wird: einem, der all dies weiß und selbst sieht, und der
doch nicht die Kraft hat und auch nicht die Geistesgegenwart, auf den
noch feststehenden Boden zurückzuspringen, und nicht die Willensstärke,
den Blick von der gähnenden Tiefe abzuwenden: die Tiefe zieht ihn
vielmehr an, zieht ihn und läßt ihn nicht los, und so springt er denn
schließlich beinahe selbst hinab, nur um den unvermeidlichen Untergang
zu beschleunigen.
Herr Goljädkin wußte und fühlte es, er war überzeugt, daß ihm sogleich,
noch unterwegs, etwas Verhängnisvolles zustoßen, daß er z. B. wieder
jenem Unbekannten begegnen würde: doch – so seltsam es auch erscheinen
mag – er wünschte diese Begegnung jetzt beinahe selbst herbei, wünschte
sie schneller herbei, so schnell wie möglich. Da er sie doch für
unvermeidlich hielt, wollte er, daß dem Zustande je eher je lieber ein
Ende bereitet werde, gleichviel wie, aber nur rasch, rasch!
Währenddessen lief er immer noch, lief als bewege ihn eine fremde Macht,
denn von seinem eigenen Wesen fühlte er nichts als eine unendliche
Erschöpfung und Abgespanntheit: er konnte auch nichts mehr denken,
obwohl seine Gedanken sich im Vorübergehen wie Dornen an alles und jedes
hefteten. Ein verirrtes Hündchen, das vor Nässe und Kälte nur so
zitterte, schloß sich ihm an und lief neben ihm her, lief mit flinken
dünnen Beinchen, eingekniffener Rute und zurückgelegten Ohren, und von
Zeit zu Zeit sah es schüchtern und verständnisvoll zu ihm auf.
Ein ferner, längst schon vergessen gewesener Gedanke oder vielmehr die
Erinnerung an etwas vor langer Zeit einmal Geschehenes kam ihm jetzt in
den Sinn und begann in seinem Kopfe zu hämmern, und hämmerte und
hämmerte und ließ sich nicht abweisen.
„Dieses gemeine Hündchen!“ murmelte Herr Goljädkin vor sich hin, ohne
sich selbst zu verstehen. Endlich erblickte er den Unbekannten wieder,
gerade wie er um die Straßenecke bog. Nur kam er ihm jetzt nicht wieder
entgegen, sondern ging vor ihm her in derselben Richtung, ging wenige
Schritte vor ihm und eilte ebenso wie er in leichtem Trab. Bald hatten
sie die Schestilawotschnaja erreicht. Herrn Goljädkins Herzschlag setzte
aus: der Unbekannte blieb gerade vor dem Hause stehen, in dem Herr
Goljädkin wohnte. Man hörte die Klingel unter dem Torbogen und fast in
demselben Augenblick auch schon das Kreischen des eisernen Riegels. Das
Pförtchen wurde geöffnet, der Unbekannte beugte sich und verschwand. Im
nächsten Augenblick hatte auch Herr Goljädkin das Pförtchen erreicht und
schlüpfte am Hausknecht vorüber, der irgendetwas brummte; er lief auf
den Hof und erblickte wieder den Unbekannten, den er einen Moment aus
dem Auge verloren hatte. Er erblickte ihn gerade noch beim Eingang zu
der Treppe, die zu Herrn Goljädkins Wohnung hinaufführte. Herr Goljädkin
eilte ihm nach. Die Treppe war dunkel, feucht und schmutzig. Neben allen
Türen stand Hausgerät und alles mögliche andere, so daß ein Fremder, der
zum erstenmal und noch dazu im Dunkeln diese Treppe hinaufstieg,
mindestens eine halbe Stunde lang zum Erklimmen derselben bedurfte.
Trotzdem setzte man sich immer wieder dem aus, daß man sich Hals und
Beine brach, verwünschte immer wieder nicht nur die Treppe, sondern mit
dieser auch seine Bekannten, die sich in einer Wohnung niedergelassen,
zu der der Zugang soviel Mühe kostete. Doch jener Unbekannte, den Herr
Goljädkin verfolgte, schien mit den Eigenheiten der Treppe ganz vertraut
zu sein, als wohne er in demselben Hause: er eilte mit der größten
Leichtigkeit hinauf, ohne auch nur einmal zu zögern, als wäre ihm jede
Stufe bekannt. Herr Goljädkin hatte ihn fast eingeholt: ja, zwei- oder
dreimal schlug sogar der Mantelsaum des Unbekannten an seine Nase. Das
Herz stand ihm still. Der geheimnisvolle Fremde blieb gerade vor der Tür
der Wohnung des Herrn Goljädkin stehen. Und Petruschka – was zu einer
anderen Zeit Herrn Goljädkin sehr in Verwunderung gesetzt hätte, –
Petruschka, ganz als hätte er gewartet und sich noch nicht schlafen
gelegt, öffnete sofort die Tür und kam dem eintretenden Menschen mit dem
Licht in der Hand entgegen.
Ganz außer sich trat der Held unserer Erzählung in seine Wohnung. Ohne
Hut und Mantel im Vorraum abzulegen, blieb er, wie vom Donner gerührt,
auf der Schwelle seines Zimmers stehen.
Alle Vorahnungen Herrn Goljädkins erfüllten sich vollständig, alles, was
er gefürchtet hatte, trat jetzt in die Erscheinung. Der Atem ging ihm
aus, der Kopf schwindelte ihm. Der Unbekannte saß vor ihm auf seinem
Bett, gleichfalls im Hut und Mantel: er lächelte ein wenig, blinzelte
ihm zu und nickte freundschaftlich mit dem Kopfe. Herr Goljädkin wollte
schreien, konnte aber nicht – wollte irgendwie protestieren, doch die
Kräfte reichten nicht. Die Haare standen ihm zu Berge und er setzte sich
starr vor Schreck neben den anderen hin. Dazu hatte er freilich Ursache.
Herr Goljädkin erkannte sofort seinen nächtlichen Freund. – Sein
nächtlicher Freund aber war niemand anders als er selbst – ja: Herr
Goljädkin selbst, ein anderer Herr Goljädkin und doch Herr Goljädkin
selbst – mit einem Wort und in jeder Beziehung war er das, was man einen
Doppelgänger nennt.
* * * * *
VI.
Am anderen Morgen, genau um acht Uhr, erwachte Herr Goljädkin in seinem
Bett. Sofort erschienen mit erschreckender Deutlichkeit vor seinen
erregten Sinnen und in seinem Gedächtnis alle die außergewöhnlichen
Ereignisse, die er gestern gehabt, erschien die ganze wilde und
unwahrscheinliche Nacht mit ihren fast mysteriösen Ereignissen. Eine so
grausame, eine so höllische Bosheit von seiten seiner Feinde und
besonders dieser letzte Beweis ihrer Bosheit ließ Herrn Goljädkins Herz
zu Eis erstarren. Dazu schien alles das so sonderbar unverständlich und
wüst, schien so sinnlos und ganz und gar unglaubhaft, daß es ihm
wirklich schwer wurde, daran zu glauben. Herr Goljädkin wäre sogar sehr
geneigt gewesen, das alles einfach für einen Traum, für eine
augenblickliche Verwirrung seiner Phantasie, für eine vorübergehende
Umnachtung seines Geistes anzusehen, wenn er nicht zu seinem Glück und
aus seiner bitteren Lebenserfahrung heraus gewußt hätte, bis wohin die
Bosheit bereits manchen Menschen gebracht hat, wie weit die Grausamkeit
eines Feindes gehen kann, der sich für seine verletzte Ehre rächen
mochte. Obendrein legten die zerschlagenen Glieder Herrn Goljädkins,
sein schmerzender Kopf, sein verstauchtes Kreuz, sein bösartiger
Schnupfen um so fühlbarer Zeugnis ab und bestanden unabweislich auf der
Wirklichkeit des nächtlichen Spazierganges samt allen Abenteuern, die
mit ihm verbunden gewesen waren. Und schließlich wußte ja Herr Goljädkin
schon längst, daß sie da etwas gegen ihn vorbereiteten, daß noch etwas
anderes dahintersteckte!
Aber was denn? Nach reiflicher Überlegung beschloß Herr Goljädkin zu
schweigen, sich zu fügen und in der Sache fürs erste nichts zu tun.
„So haben sie mich vielleicht nur erschrecken wollen, und wenn sie
sehen, daß ich nichts tue, nicht protestiere und mich in alles füge,
dann werden sie vielleicht zurücktreten, von selbst zurücktreten, als
erste zurücktreten.“
Das waren die Gedanken, die im Kopfe Herrn Goljädkins umgingen, als er
sich im Bette ausstreckte, um seine zerschlagenen Glieder zu fühlen, und
auf das gewohnte Erscheinen Petruschkas im Zimmer wartete. Er wartete
bereits eine ganze Viertelstunde und hörte, wie der Faulpelz Petruschka
hinter dem Verschlag den Samowar anmachte, aber er konnte sich nicht
entschließen, ihn zu rufen. Sagen wir offen: Herr Goljädkin fürchtete
sich ein wenig, Petruschka Aug’ in Aug’ gegenüberzustehen.
„Denn, weiß Gott –,“ dachte er, „weiß Gott, wie der Schuft diese ganze
Sache ansieht. Er schweigt und schweigt und macht sich dabei seine
eigenen Gedanken.“
Endlich knarrte die Tür und Petruschka erschien mit dem Teebrett in
beiden Händen. Herr Goljädkin schielte schüchtern nach ihm hin und
wartete ungeduldig, was nun geschehen – wartete, ob er nicht endlich
über den Vorfall wenigstens etwas sagen würde. Doch Petruschka sagte
nichts, im Gegenteil, er war noch schweigsamer, finsterer und erboster
als gewöhnlich und warf unter seinen zusammengezogenen Brauen hervor nur
mürrische Blicke ins Zimmer. Man konnte daraus entnehmen, daß er äußerst
unzufrieden war. Nicht ein einziges Mal sah er seinen Herrn an, was,
nebenbei gesagt, Herrn Goljädkin sehr unangenehm berührte. Er stellte
alles, was er gebracht hatte, auf den Tisch, kehrte um und ging
schweigend hinter seinen Verschlag.
„Er weiß, er weiß alles, der Taugenichts!“ murmelte Herr Goljädkin,
während er seinen Tee einnahm. Unser Held jedoch richtete keine Frage an
seinen Diener, obgleich dieser noch einige Male, aus verschiedenen
Anlässen, ins Zimmer kam.
Herr Goljädkin war in einer sehr bewegten Gemütsverfassung. Peinlich war
es ihm vor allem, in die Kanzlei zu gehen. Er hatte ein starkes
Vorgefühl, daß dort irgend etwas nicht ganz richtig sein würde.
„Wenn du da hingehst,“ dachte er, „kannst du über irgend etwas stolpern!
Ist es nicht besser, hier noch etwas abzuwarten? Mögen sie da tun – was
sie wollen: ich werde heute hierbleiben und Kräfte sammeln, werde meine
Gedanken über die Sache in Ordnung bringen, um dann den günstigen
Augenblick zu erhaschen und, wie so ein Guß kalten Wassers über den
Kopf, ohne selbst mit der Wimper zu zucken, vor ihnen auftauchen.“
Während Herr Goljädkin so über die Sache nachdachte, rauchte er eine
Pfeife nach der anderen. Die Zeit verging indessen schnell – es war
bereits fast halb zehn geworden.
„Siehe da, es ist schon halb zehn Uhr,“ dachte Herr Goljädkin, „es ist
jetzt wirklich zu spät geworden. Dazu bin ich krank, versteht sich,
krank, durchaus krank – wer sagt, daß es nicht so ist? Was geht es mich
an! Und wenn man jemanden schickt, der hier nachsehen soll – ja, was
geht das mich an? Mir tut der Rücken weh, ich habe Husten, Schnupfen,
und schließlich darf ich bei diesem Wetter gar nicht ausgehen, ich kann
mich ernstlich erkälten und sogar sterben – die Sterblichkeit ist ja
zurzeit so groß ...“
Mit solchen Gründen beruhigte Herr Goljädkin schließlich sein Gewissen
vollkommen und rechtfertigte sich so im voraus vor dem Verweis, der ihm
von Andrej Philippowitsch bevorstand – „wegen Vernachlässigung des
Dienstes“. Überhaupt liebte es unser Held bei allen ähnlichen
Gelegenheiten, sich vor sich selbst durch die verschiedensten
Vernunftgründe zu verteidigen und auf diese Weise sein Gewissen
vollkommen zu beruhigen. So hatte er denn auch jetzt sein Gewissen
vollkommen beruhigt, griff nach der Pfeife, klopfte sie aus: doch kaum
hatte er ordentlich zu rauchen begonnen – als er plötzlich vom Diwan
sprang, seine Pfeife fortwarf, sich lebhaft wusch, rasierte und
frisierte, seine Uniform und alles Übrige anzog, einige Papiere ergriff
und in die Kanzlei davoneilte.
Herr Goljädkin trat schüchtern in seine Bureauabteilung ein, in
zitternder Erwartung von etwas sehr Unangenehmem, in einer Erwartung,
die unklar und dunkel und daher um so unangenehmer war. Schüchtern
setzte er sich auf seinen Platz neben seinem Bureauvorsteher Anton
Antonowitsch Ssjetotschkin. Ohne sich umzublicken oder sich durch etwas
ablenken zu lassen, vertiefte er sich in den Inhalt seiner vor ihm
liegenden Papiere. Er hatte beschlossen und sich das Wort gegeben, sich
so wenig wie möglich einer Herausforderung auszusetzen und sich vor
allem, was ihn kompromittieren könnte, vor unbescheidenen Fragen, vor
allerlei Scherzen und Anspielungen auf den gestrigen Abend möglichst
weit weg zu halten. Er beschloß sogar, von den gewöhnlichen
Höflichkeiten im Verkehr mit seinen Kollegen abzusehen, und zum Beispiel
Fragen nach dem Befinden usw. zu unterlassen.
Doch andererseits war es ganz unmöglich, daß es dabei bleiben konnte.
Unruhe und Ungewißheit über etwas ihm nahe Bevorstehendes waren für ihn
viel quälender, als das Bevorstehende selbst. Und daher, trotz des
Versprechens, das er sich gegeben hatte, auf nichts einzugehen, was es
auch sei, und sich von allem fernzuhalten, erhob Herr Goljädkin doch
zuweilen den Kopf und sah heimlich und verstohlen zur Seite nach rechts
und links, und beobachtete die Gesichter seiner Mitarbeiter, um aus
ihren Mienen zu schließen, ob etwas Neues und Besonderes bevorstehe und
aus irgendwelchen Absichten vor ihm verborgen werde. Er setzte ohne
weiteres voraus, daß eine Verbindung zwischen den gestrigen Vorfällen
und allem bestand, was um ihn her vorging. Aus diesen Nöten heraus
wünschte er schließlich, und Gott weiß wie er es wünschte, daß sich
alles nur so schnell wie möglich entscheiden möge, wenn es dabei auch
ein Unglück gäbe!
Doch wie schnell Herrn Goljädkin das Schicksal auch ereilte: kaum hatte
er dies zu wünschen gewagt, als seine Zweifel plötzlich gelöst wurden,
und zwar auf die allersonderbarste und unerwartetste Weise.
Die Tür aus dem anderen Zimmer knarrte plötzlich leise und schüchtern,
als wollte sie damit vorausschicken, daß die eintretende Person herzlich
unbedeutend sei, und eine Gestalt, die Herrn Goljädkin sehr bekannt
vorkam, tauchte auf und näherte sich schüchtern dem Tisch, an dem unser
Held saß. Unser Held wagte seinen Kopf nicht zu erheben, er streifte die
Gestalt nur flüchtig mit einem kurzen Blick, doch er erkannte alles,
begriff alles bis in die kleinsten Einzelheiten. Er entbrannte vor Scham
und steckte seinen armen Kopf in die Papiere mit der gleichen Absicht,
wie der Vogel Strauß seinen Kopf in den Sand steckt, wenn er vom Jäger
verfolgt wird.
Der Neuangekommene verneigte sich vor Andrej Philippowitsch und man
hörte darauf dessen förmliche, höfliche Stimme, mit der die Vorgesetzten
in allen Kanzleien die neueingetretenen Untergebenen empfangen.
„Setzen Sie sich hierher,“ wandte sich Andrej Philippowitsch an ihn und
wies den Neuling an den Tisch Anton Antonowitschs, „setzen Sie sich
Herrn Goljädkin gegenüber, Sie werden gleich beschäftigt werden.“
Andrej Philippowitsch schloß damit, daß er den Neuangekommenen mit einer
höflich einladenden Gebärde sich selbst überließ und sich sofort wieder
in seine Papiere vertiefte, die in ganzen Haufen vor ihm lagen.
Herr Goljädkin erhob endlich seine Augen, und wenn er nicht in Ohnmacht
fiel, so geschah es nur deshalb nicht, weil er schon vorher alles das
vorausgefühlt hatte, weil er schon im voraus von allem unterrichtet war
und die Ankunft des Neulings bereits in seiner Seele geahnt hatte. Die
erste Bewegung Herrn Goljädkins war, sich rasch umzublicken, ob sich
nicht ein Flüstern ringsum erhob, ob nicht irgendein Kanzleiwitz
vernehmbar wurde, oder sich ein Gesicht vor Erstaunen verzog und
schließlich nicht irgend jemand vor Schreck vom Stuhle fiel. Doch zur
größten Verwunderung Herrn Goljädkins ereignete sich nichts Ähnliches.
Das Benehmen der Herren Mitarbeiter und Kollegen setzte ihn in Erstaunen
und schien ihm vollständig unerklärlich. Herr Goljädkin erschrak fast
vor diesem ungewöhnlichen Schweigen. Die Tatsache sprach für sich
selbst. Die Sache war sonderbar, sinnlos, ohnegleichen. Es mußte einen
verwundern.
Alles das ging Herrn Goljädkin selbstverständlich durch den Kopf. Er
fühlte sich wie auf einem kleinen Feuer gebraten. Und wahrlich: es hatte
seinen Grund. Derjenige, welcher Herrn Goljädkin gegenüber saß, war –
der Schrecken Herrn Goljädkins, war – die Schande Herrn Goljädkins, war
– der gestrige Albdruck Herrn Goljädkins, kurz, war Herr Goljädkin
selbst. Doch nicht dieser Herr Goljädkin, der mit aufgerissenem Munde
und mit der Feder in der Hand auf dem Stuhle dasaß, nicht dieser, der
als Gehilfe seines Bureauvorstehers seinen Dienst ausübte, nicht dieser,
der sich in der Menge zu vergraben und zu verstecken liebte, nicht der
schließlich, dessen Verhalten deutlich aussprach: „Rühre mich nicht an
und auch ich werde dich nicht anrühren,“ oder: „Rührt mich nicht an,
denn ich rühre euch auch nicht an ...“ Nein, das war ein anderer Herr
Goljädkin, ein vollkommen anderer, und zugleich doch einer, der
vollkommen ähnlich dem ersteren war. Von gleichem Wuchs, derselben
Gestalt und Haltung, ebenso gekleidet, ebenso kahlköpfig – kurz, es war
nichts, aber auch nichts zur vollkommenen Ähnlichkeit vergessen worden,
so daß, wenn man die beiden nebeneinander aufgestellt hätte, niemand,
aber auch wirklich niemand hätte sagen können, wer der wirkliche Herr
Goljädkin und wer der nachgemachte sei, wer der alte und wer der neue,
wer das Original und wer die Kopie.
Unser Held war jetzt in der Lage eines Menschen, über den, wenn der
Vergleich möglich ist, jemand zum Spaß ein Brennglas hält.
„Ist es ein Traum oder ist es keiner,“ dachte er, „ist es die Gegenwart
oder die Fortsetzung von gestern. Wie kommt das, mit welchem Recht geht
das alles hier vor? Wer hat diesen Beamten hier hingesetzt, und wer gab
ihm das Recht, sich zu setzen? Schlafe ich? Träumt es mir?“
Herr Goljädkin betastete sich selbst, betastete auch noch einen anderen
... Nein, es war nicht nur ein Traum. Herr Goljädkin fühlte, wie ihm der
Schweiß in Strömen herunterrann, fühlte, daß sich mit ihm noch etwas nie
Dagewesenes und nie Gesehenes ereignete: und zur Vollendung des Unglücks
begriff und fühlte Herr Goljädkin selbst das Fatale, das darin lag, in
einer so verwickelten Sache das Urbild und Beispiel zu sein.
Er begann an seiner eigenen Existenz zu zweifeln, und obgleich er vorher
auf alles vorbereitet gewesen war und selbst gewünscht hatte, daß sich
seine Zweifel irgendwie lösen möchten, so war für ihn diese Tatsache
doch ganz unerwartet eingetreten.
Die Angst drückte ihn nieder und quälte ihn. Vorübergehend war er seiner
Gedanken und seines Gedächtnisses vollständig beraubt. Wenn er nach
solchen Augenblicken wieder zu sich kam, so bemerkte er, daß er ganz
mechanisch und unbewußt seine Feder über das Papier führte. Da er sich
selbst nicht mehr trauen konnte, fing er an, alles Geschriebene
nachzuprüfen, und siehe da, – er begriff nichts davon. Endlich stand der
andere Herr Goljädkin auf, der bis dahin ruhig und ehrbar dagesessen
hatte, und verschwand mit seiner Arbeit durch die Tür, in die andere
Abteilung. Herr Goljädkin blickte sich um, – nichts, alles war still: zu
hören war nur das Kratzen der Federn, das Geräusch beim Umwenden der
Blätter und das Geflüster in denjenigen Ecken, die am weitesten von dem
Platz Andrej Philippowitschs ablagen.
Herr Goljädkin sah Anton Antonowitsch, den Bureauvorsteher, an, und da
der Gesichtsausdruck unseres Helden durchaus mit seinen gegenwärtigen
Gedanken übereinstimmte, folglich in mancher Beziehung sehr auffallend
war, so legte der gute Anton Antonowitsch die Feder beiseite und
erkundigte sich mit außergewöhnlicher Teilnahme nach der Gesundheit
Herrn Goljädkins.
„Ich bin, Anton Antonowitsch ... ich bin ... Gott sei Dank,“ antwortete
stotternd Herr Goljädkin, „ich, Anton Antonowitsch ... bin vollkommen
gesund. Mir fehlt ... Anton Antonowitsch – gar nichts,“ fügte er
entschlossen hinzu, da er offenbar Anton Antonowitsch nicht ganz zu
überzeugen vermochte.
„Aber, aber mir scheint es, daß Sie doch nicht so ganz gesund sind:
übrigens, es wäre kein Wunder! Besonders jetzt bei diesem Wetter! Wissen
Sie ...“
„Ja, Anton Antonowitsch, ich weiß, daß das Wetter schlecht ist ... Ich,
Anton Antonowitsch, ich ... spreche nicht davon,“ fuhr Herr Goljädkin
fort, indem er Anton Antonowitsch durchdringend ansah. „Ich, sehen Sie,
Anton Antonowitsch, ich weiß eigentlich nicht, ... das heißt, ich möchte
sagen ... wie Sie die Sache auffassen, Anton Antonowitsch ...“
„Was? Ich habe Sie ... wissen Sie ... ich muß gestehen, nicht ganz
verstanden; Sie ... wissen Sie ... erklären Sie sich deutlicher, woran
Sie sich hierbei stoßen,“ sagte Anton Antonowitsch, der sich nicht wenig
betroffen fühlte, da er sah, daß Herrn Goljädkin die Tränen in die Augen
traten.
„Ich weiß wirklich nicht ... hier, Anton Antonowitsch ... hier ist – ein
Beamter, Anton Antonowitsch ...“
„Nun! Ich verstehe noch immer nichts.“
„Ich möchte sagen, Anton Antonowitsch, daß hier ein neueingetretener
Beamter ist.“
„Ja, stimmt; er heißt auch wie Sie.“
„Was?“ rief Herr Goljädkin aus.
„Ich sage: er trägt denselben Namen. Er heißt auch Goljädkin. Ist es
nicht Ihr Bruder?“
„Nein, Anton Antonowitsch, ich ...“
„Hm! sagen Sie bitte, – mir schien es, daß es sogar ein sehr naher
Verwandter von Ihnen sein müßte. Wissen Sie, es ist da eine
Familienähnlichkeit vorhanden.“
Herr Goljädkin erstarrte vor Verwunderung und die Zunge versagte ihm
zeitweise ihren Dienst. So einfach über eine so unerhörte, noch
nie dagewesene Sache zu sprechen, eine Sache, die jeden
interessierten Beobachter in Erstaunen versetzt hätte, und von einer
Familienähnlichkeit zu reden, wo es sich um ein Spiegelbild handelte!
„Ich, wissen Sie, was ich Ihnen raten möchte, Jakoff Petrowitsch,“ fuhr
Anton Antonowitsch fort. „Gehen Sie doch zum Doktor und sprechen Sie mit
ihm. Wissen Sie, Sie sehen durchaus krank aus. Ihre Augen sind so
sonderbar ... wissen Sie, so einen besonderen Ausdruck haben sie ...“
„Nein, Anton Antonowitsch, ich fühle freilich, das heißt, ich möchte
fragen, wie dieser Beamte? ...“
„Nun?“
„Das heißt, haben Sie nicht bemerkt, Anton Antonowitsch, haben Sie nicht
an ihm etwas Besonderes bemerkt ... etwas – Unverkennbares?“
„Das heißt?“
„Das heißt, ich möchte sagen, Anton Antonowitsch, eine erstaunliche
Ähnlichkeit mit irgend jemandem, das heißt zum Beispiel mit mir. Sie
sprachen soeben, Anton Antonowitsch, von einer Familienähnlichkeit, Sie
machten so eine beiläufige Bemerkung ... Wissen Sie, daß es Zwillinge
gibt, die sich wie zwei Tropfen Wasser gleichen, so daß man sie nicht
voneinander unterscheiden kann? Nun, sehen Sie, das meinte ich –“
„Ja,“ sagte Anton Antonowitsch, ein wenig nachdenklich – als ob er jetzt
zum erstenmal über die Sache wirklich erstaunt wäre. „Ja, Sie haben
recht, die Ähnlichkeit ist tatsächlich erstaunlich und man könnte
wirklich den einen für den andern nehmen,“ fügte er hinzu und riß die
Augen immer weiter auf. „Und, wissen Sie, Jakoff Petrowitsch, es ist
sogar eine ganz sonderbare phantastische Ähnlichkeit, wie man zu sagen
pflegt, das heißt, genau so wie Sie ... Haben Sie bemerkt, Jakoff
Petrowitsch? Ich wollte Sie sogar selbst danach fragen. Ja, ich gestehe,
anfangs habe ich zu wenig darauf geachtet. Ein Wunder, ein wirkliches
Wunder, das! Und wissen Sie, Jakoff Petrowitsch, Sie sind doch kein
Hiesiger? Ich meine nur ...“
„Nein.“
„Er ist auch kein Hiesiger. Vielleicht ist er aus demselben Orte, wo Sie
her sind. Ich wage nur zu fragen, wo hat sich Ihre Mutter zuletzt
dauernd aufgehalten?“
„Sie sagten ... Sie sagten, Anton Antonowitsch, daß er kein Hiesiger
ist?“
„Ja, er ist nicht von hier. Wirklich, wie das sonderbar ist,“ fuhr der
gesprächige Anton Antonowitsch fort, für den es ein rechter Feiertag
war, wenn er einmal tüchtig schwatzen konnte, „es kann wirklich Anteil
erregen! Wie oft geht man an so etwas vorüber, ohne es zu bemerken!
Übrigens, regen Sie sich nicht darüber auf. Das pflegt vorzukommen.
Wissen Sie – ich werde Ihnen was erzählen, dasselbe passierte meiner
Tante, mütterlicherseits; sie hat sich auch einmal, es war kurz vor dem
Tode, doppelt gesehen ...“
„Nein, ich ... entschuldigen Sie, daß ich Sie unterbreche, Anton
Antonowitsch, – ich, Anton Antonowitsch, wollte wissen, wie es mit
diesem Beamten steht, das heißt, welche Stellung er hier einnimmt.“
„Er kam an die Stelle des kürzlich verstorbenen Ssemjon Iwanowitsch.
Dessen Posten war frei geworden, und so wurde er angestellt. Nein,
wirklich, dieser gute Ssemjon Iwanowitsch, drei Kinder hat er
hinterlassen, sagt man, eines kleiner als das andere. Die Witwe ist
seiner Exzellenz zu Füßen gefallen. Man sagt übrigens, sie habe Geld,
sie verheimliche es nur.“
„Nein, Anton Antonowitsch, ich meine den Umstand ...“
„Das heißt, nun, ja! Warum beschäftigt Sie denn das so sehr? Ich sage
Ihnen doch: regen Sie sich nicht auf. Das ist schon so der Wille Gottes,
und es ist Sünde, gegen ihn zu murren. Darin sieht man Gottes Weisheit.
Und Sie, Jakoff Petrowitsch, sind doch nicht schuld daran. Als ob es
keine Wunder auf der Welt gäbe! Die Mutter Erde ist freigebig, und Sie
werden doch nicht dafür zur Verantwortung gezogen. Um Ihnen ein Beispiel
zu geben: ich denke, Sie haben doch gehört, wie die siamesischen
Zwillinge mit dem Rücken aneinander gewachsen sind, sie leben, essen und
schlafen zusammen und verdienen viel Geld, sagt man.“
„Erlauben Sie, Anton Antonowitsch ...“
„Ich verstehe Sie, ich verstehe! Ja! nun, ja, was? Tut nichts! Ich sage
Ihnen doch, nach meiner persönlichen Überzeugung haben Sie sich
keineswegs aufzuregen. Was ist denn darüber zu sagen? Er ist doch ein
Beamter wie sie alle, und als Beamter, offenbar, ein tüchtiger Mensch.
Er sagt, er heiße Goljädkin, sei nicht von hier und führe den Titel
Titularrat. Er hat selbst mit Seiner Exzellenz gesprochen.“
„Und was hat er gesagt?“
„Nichts Besonderes, sagt man, er habe genügende Erklärungen gegeben und
die Gründe dargelegt, sagt man, so und so: Ew. Exzellenz, ich habe kein
Vermögen, ich wünsche zu dienen, und besonders unter Ihrer
schmeichelhaften Leitung ... nun, und wie sich das so gehört ... er hat
sich, wissen Sie, sehr geschickt ausgedrückt. Ein kluger Mensch muß er
sein. Nun, versteht sich, er kam ja auch mit einer Empfehlung, ohne die
geht’s doch nicht ...“
„So!? von wem denn? ... Das heißt, ich wollte sagen, wer hat denn in
diese schmutzige Angelegenheit seine Hand gesteckt?“
„Ja! Es muß eine gute Empfehlung gewesen sein, Seine Exzellenz, sagt
man, und Andrej Philippowitsch hätten gelacht.“
„Gelacht, Exzellenz und Andrej Philippowitsch?“
„Ja, sie hätten gelacht und gesagt: nun gut! und sie hätten nichts
dagegen, wenn er nur seine Pflicht tue!“
„Nun, und weiter. Das belebt mich wieder, Anton Antonowitsch, ich flehe
Sie an – und weiter.“
„Erlauben Sie, nun, ja, nun, es hat doch nichts zu bedeuten, ich sage
Ihnen, regen Sie sich nicht auf, die Sache hat nichts Bedenkliches.“
„Nein? Ich, das heißt – ich wollte Sie fragen, Anton Antonowitsch, ob
Seine Exzellenz nichts mehr hinzugefügt hat ... über mich, zum
Beispiel?“
„Das heißt, wie denn? Ach so! Nein, nichts, nichts, Sie können ganz
ruhig sein. Wissen Sie, natürlich ist der Umstand sehr sonderbar ...
aber ich selbst – ich habe mir anfangs überhaupt nichts dabei gedacht.
Ich weiß wirklich nicht, warum ich mir nichts dabei dachte, bis Sie, Sie
selbst, mich darauf aufmerksam gemacht haben. Seine Exzellenz hat nichts
gesagt,“ fügte der gute Anton Antonowitsch hinzu und erhob sich vom
Stuhl.
„Sehen Sie, ich ... Anton Antonowitsch ...“
„Ach, Sie entschuldigen mich, bitte, ich schwatze hier von Nichtigkeiten
und da ist eine wichtige Sache zu erledigen. Ich muß mich beeilen.“
„Anton Antonowitsch,“ hörte man soeben die klangvolle Stimme Andrej
Philippowitschs, „Seine Exzellenz fragt nach Ihnen.“
„Sofort, sofort Andrej Philippowitsch, sofort, ich komme schon.“ Und
Anton Antonowitsch griff nach einem Pack Papiere, lief zuerst zu Andrej
Philippowitsch und darauf ins Kabinett Seiner Exzellenz.
„Wie ist denn das nun?“ dachte Herr Goljädkin bei sich. „So ist also das
Spiel jetzt bei uns? Von daher weht der Wind? ... Das ist nicht übel,
die Dinge haben so die beste Wendung genommen,“ sagte sich unser Held,
rieb sich die Hände und fühlte vor Freude kaum den Stuhl unter sich.
„Unsere Sache ist also eine gewöhnliche Sache und erweist sich als etwas
ganz Nichtiges. In der Tat, es kümmert sich niemand darum, sie sitzen
alle, diese Räuber, und arbeiten: das ist nett, wirklich nett! Einen
guten Menschen liebe ich, habe ich geliebt und werde ihn immer lieben
... Doch, wenn man denkt, diesem Anton Antonowitsch ist schwer ... zu
trauen! Er ist bereits sehr alt und vergißt den Zusammenhang. Eine
vorzügliche, eine großartige Sache ist es, daß Seine Exzellenz nichts
gesagt hat und ihn so zuließ. Das ist gut, das gefällt mir! Was hat nur
dieser Andrej Philippowitsch sich mit seinem Lachen da einzumischen? Was
geht es ihn an? Du alter Strick! Immer läufst du mir über den Weg, wie
eine schwarze Katze! Immer kommt er den Menschen in die Quere, immer den
Menschen in die Quere ...“
Herr Goljädkin blickte sich wieder um und wieder belebte sich seine
Hoffnung. Er fühlte sich aber doch noch von gewissen vagen Gedanken, und
von nicht gerade guten Gedanken, sehr beunruhigt. Es kam ihm sogar in
den Sinn, mit den Beamten anzubändeln, den Hasen sozusagen zu stellen,
vielleicht am Schluß der Kanzleistunde oder in Dienstangelegenheiten mit
ihnen anzubändeln und zwischendurch im Gespräche zu bemerken: „meine
Herren, so und so, ob da nicht eine erstaunliche Ähnlichkeit, ein
sonderbarer Umstand, eine witzige Komödie?“, – um auf diese Weise die
Tiefe der Gefahr zu sondieren. „Denn in einem tiefen Abgrund hausen die
Teufel,“ schloß in Gedanken unser Held. Übrigens war das nur ein
flüchtiger Gedanke von Herrn Goljädkin, denn er bedachte sich noch
beizeiten. Er begriff, daß es ihn zu weit führen konnte.
„So ist nun einmal deine Natur!“ sagte er zu sich selbst, und schlug
sich leicht mit der Hand vor die Stirn. „Gleich fängst du wieder an zu
phantasieren und dich zu freuen, du ehrliche Seele, du! Nein, besser,
wir warten noch ein wenig, Jakoff Petrowitsch, wir halten aus und
warten!“
Nichtsdestoweniger, und wie wir bereits erwähnten, war Herr Goljädkin
voll Hoffnung und wie von den Toten auferstanden.
„Tut nichts,“ dachte er, „mir ist es gerade zumut, als ob mir
fünfhundert Pud vom Herzen gefallen wären! Was ist das für eine Sache!
Er aber – er, – nun möge er nur dienen, möge er nur ruhig und zu seiner
Gesundheit dienen! Wenn er nur niemandem hinderlich wird, wenn er nur
niemanden stört, dann mag er dienen – ich habe nichts dagegen!“
Währenddessen vergingen die Stunden im Fluge und es schlug bereits vier
Uhr. Die Kanzlei wurde geschlossen. Andrej Philippowitsch griff nach
seinem Hut, und wie gewöhnlich folgten alle seinem Beispiel. Herr
Goljädkin verzögerte seinen Aufbruch und ging absichtlich später als die
anderen, er war der Letzte und trat hinaus, als die anderen sich bereits
in die verschiedenen Richtungen zerstreuten. Auf der Straße fühlte er
sich wie im Paradies, so daß in ihm der Wunsch aufstieg, einen Umweg zu
machen und über den Newskij zu gehen.
„Das nenne ich Schicksal!“ sagte unser Held, „diese unerwartete Wendung
der ganzen Sache. Und was für ein Wetterchen, mit Frost und
Schlittenbahn! Das ist was für den Russen, der Frost belebt ihn
ordentlich von neuem, den russischen Menschen. Ich liebe den russischen
Menschen, und Schnee liebe ich und Kälte liebe ich ...“
So äußerte sich bei Herrn Goljädkin das Entzücken, und doch fühlte er
etwas wie Unruhe in seinem Herzen nagen, so daß er nicht wußte, womit er
sich beschwichtigen sollte. „Nun ja, warten wir noch einen Tag – und
dann erst wollen wir uns freuen. Was mag das nur eigentlich sein, was
mich da so beunruhigt!? Nun, denken wir doch nach, sehen wir zu! Denke
nach, junger Freund, denke nach. Also erstens: ein Mensch, der genau so
wie du ist. Nun, was ist weiter dabei? Wenn es solch einen Menschen
gibt, muß ich denn gleich darüber weinen? Was geht’s mich an? Ich halte
mich fern von ihm: ich pfeife auf ihn, und das ist alles! Mag er dienen!
Nun, und was sie da von den siamesischen Zwillingen reden ... wozu
siamesisch? Nehmen wir an, es sind Zwillinge – auch große Menschen haben
ihre Wunderlichkeiten gehabt. Aus der Geschichte ist bekannt, daß der
berühmte Ssuworoff wie ein Hahn krähte ... Nun, das tat er wohl alles
nur aus Politik; und die großen Feldherren ... übrigens, was gehen mich
die Feldherren an? Ich lebe so für mich und will niemanden kennen und im
Gefühl meiner Unschuld verachte ich jeden Feind. Ich bin kein Intrigant
und ich bin stolz darauf. Nein, offenherzig, angenehm, liebenswürdig
...“
Plötzlich verstummte Herr Goljädkin, blieb stehen, zitterte wie ein
Blatt am Baum und schloß auf einen Augenblick seine Augen. In der
Hoffnung jedoch, daß der Gegenstand seines Schreckens nur eine Illusion
sei, öffnete er seine Augen wieder und schielte schüchtern nach rechts.
Nein, es war keine Illusion! ... Neben ihm trippelte sein Bekannter von
heute morgen, lächelte ihm zu, sah ihm ins Gesicht und schien auf die
Gelegenheit zu warten, um mit ihm ein Gespräch anzufangen. Es kam aber
nicht dazu. So gingen sie beide etwa fünfzig Schritte weiter. Das ganze
Bestreben Herrn Goljädkins ging nun dahin, sich immer mehr in seinen
Mantel einzuhüllen und seine Mütze so tief wie möglich über die Augen zu
ziehen. Es erhöhte noch die „Beleidigung“, daß Mantel und Hut seines
Freundes genau den seinen glichen.
„Geehrter Herr,“ sagte endlich unser Held, indem er sich mühte, fast
flüsternd zu sprechen, ohne dabei seinen Freund anzusehen, „mir scheint,
wir haben einen verschiedenen Weg ... Ich bin sogar fest davon
überzeugt,“ sagte er nach einigem Schweigen. „Und schließlich bin ich
auch fest davon überzeugt, daß Sie mich verstanden haben,“ fügte er
ziemlich streng zum Schluß hinzu.
„Ich hätte gewünscht,“ sagte endlich der Freund, „ich hätte gewünscht,
und Sie werden mir großmütig verzeihen ... ich weiß nicht, an wen ich
mich hier wenden soll ... meine Verhältnisse, – ich hoffe Sie verzeihen
mir meine Aufdringlichkeit, – es schien mir sogar, Sie hätten heute
morgen Anteil an mir genommen. Meinerseits fühlte ich auf den ersten
Blick Zuneigung für Sie, ich ...“ Hier wünschte Herr Goljädkin in
Gedanken seinen neuen Kollegen unter die Erde –
„Wenn ich gewagt hätte zu hoffen, daß Sie, Jakoff Petrowitsch, geneigt
wären, mich anzuhören ...“
„Wir ... wir ... wollen lieber zu mir gehen,“ antwortete ihm Herr
Goljädkin. „Wir wollen hinüber auf die andere Seite des Newskij gehen,
dort wird es bequemer für uns sein, und leichter, in die Nebengasse
einzubiegen ... Wir gehen lieber in eine Nebengasse.“
„Schön. Gehen wir in eine Nebengasse,“ sagte schüchtern und bescheiden
Herrn Goljädkins Begleiter, als ob er durch den Ton seiner Antwort
ausdrücken wollte, daß er in seiner Lage auch mit einer Nebengasse
zufrieden sei. Was nun Herrn Goljädkin anbelangt, so begriff er
überhaupt nicht mehr, was mit ihm vorging. Er traute sich selber nicht
und hatte sich von seinem Erstaunen noch nicht erholt.
VII.
Er kam erst wieder zu sich, als er sich bereits auf der Treppe zu seiner
Wohnung befand. „Ach ich Schafskopf, ich!“ schimpfte er sich selbst in
Gedanken, „wohin führe ich ihn jetzt? Ich lege ja selbst meinen Kopf in
die Schlinge. Was wird Petruschka sagen, wenn er uns beide zusammen
sieht. Was wird dieser Schuft zu denken wagen – und er ist sowieso schon
so mißtrauisch ...“
Doch zur Reue war es bereits zu spät. Herr Goljädkin klopfte, die Tür
wurde geöffnet und Petruschka nahm seinem Herrn sowie dem Gast die
Mäntel ab. Herr Goljädkin schielte mit einem Blick nach Petruschka hin,
um in seine Physiognomie einzudringen und womöglich hinter seine
Gedanken zu kommen. Doch zu seiner großen Verwunderung sah er, daß sein
Diener auch nicht daran dachte, sich zu wundern, sogar im Gegenteil,
etwas Derartiges, wie diesen seltsamen Besuch erwartet zu haben schien.
Freilich sah er auch jetzt noch recht wie ein Wolf aus, der sich
anschickte, jemanden zu fressen. „Sind sie heute nicht alle irgendwie
verhext,“ dachte unser Held, „ist es nicht ganz so, als wären sie alle
von Dämonen besessen! Etwas Besonderes muß vorgehen oder in der Luft
liegen. Zum Teufel, was ist das für eine Qual!“
Mit solchen Gedanken führte Herr Goljädkin seinen Gast ins Zimmer und
forderte ihn höflichst auf, sich zu setzen.
Der Gast befand sich offenbar in höchster Verwirrung, war sehr
schüchtern und folgte gehorsam allen Bewegungen seines Wirtes, fing
dessen Blicke auf und bemühte sich scheinbar, seine Gedanken zu erraten.
Etwas Gedrücktes, Erniedrigtes und Erschrockenes lag in all seinen
Gebärden, so daß er, wenn ein solcher Vergleich gestattet ist, in diesem
Augenblick einem Menschen ähnlich sah, der aus Mangel an eigenen
Kleidern sich fremder bedient. Die Ärmel sind zu kurz, die Taille sitzt
fast unter den Achseln und jeden Augenblick zieht er sich seine zu kurze
Weste zurecht: bald dreht er sich zur Seite und scheint sich verstecken
zu wollen, bald sieht er wieder allen in die Augen und horcht, ob die
Leute nicht über ihn sprechen, über ihn lachen, sich seiner schämen –
und der Arme errötet, windet sich in fürchterlichster Verlegenheit, und
Ehrgeiz und Selbstgefühl leiden maßlos.
Herr Goljädkin legte seinen Hut aufs Fenster – durch eine unvorsichtige
Bewegung fiel er auf den Boden. Der Gast stürzte sofort herbei, um ihn
aufzuheben, den Staub abzuwischen und ihn auf den früheren Platz zu
legen. Seinen eigenen Hut legte er aber neben sich auf den Fußboden und
selbst nahm er nur auf dem Rande des Stuhles Platz. Dieser kleine
Umstand öffnete Herrn Goljädkin sofort die Augen über ihn. Er begriff,
daß der andere großen Mangel litt, und nun wußte er mit einem Mal, wie
er das Gespräch mit ihm beginnen sollte.
Der Gast seinerseits schwieg immer noch, er wartete scheinbar, sei es
nun aus Schüchternheit oder Ehrfurcht, daß der Wirt den Anfang machte –
übrigens, mit Bestimmtheit ließ es sich nicht sagen, das war schwer zu
entscheiden.
In diesem Augenblick trat Petruschka ein, blieb an der Tür stehen, sah
aber weder seinen Herrn noch den Gast an, sondern blickte auf die
entgegengesetzte Seite.
„Befehlen Sie zwei Portionen Mittag zu bringen?“ fragte er nachlässig,
mit barscher Stimme.
„Ich, ich weiß nicht ... Sie – ja, mein Sohn, bringe zwei Portionen.“
Petruschka ging. Herr Goljädkin blickte seinen Gast an. Dieser errötete
bis über die Ohren. Herr Goljädkin war ein guter Mensch, und deshalb,
aus Seelengüte, stellte er folgende Theorie auf:
„Armer Mensch,“ dachte er, „in seiner Stellung ist er erst einen Tag.
Wahrscheinlich hat er in seinem Leben viel gelitten, vielleicht ist das
bißchen saubere Kleidung alles was er besitzt und zum Essen reicht es
nicht mehr. Wie erbärmlich er aussieht! Nun, tut nichts: das ist
einesteils sogar besser so ...“
„Entschuldigen Sie, daß ich ...“ begann Herr Goljädkin, „übrigens,
erlauben Sie, zu fragen, wie ich Sie nennen soll?“
„Mich? ... ich heiße ... Jakoff Petrowitsch,“ sagte fast flüsternd der
Gast, als hätte er ein schlechtes Gewissen, als schäme er sich, als bäte
er um Entschuldigung, daß auch _er_ Jakoff Petrowitsch heiße.
„Jakoff Petrowitsch,“ wiederholte unser Held, außerstande, seine
Erregung zu verbergen.
„Ja, genau so ist es ... Ich bin ein Namensvetter von Ihnen,“ antwortete
bescheiden der Gast und wagte schüchtern zu lächeln. Er wollte noch
etwas Scherzhaftes sagen, doch unterbrach er sich sofort, nahm eine
ernste und unterwürfige Miene an, als er bemerkte, daß sein Wirt nicht
zu Scherzen aufgelegt war.
„Sie ... erlauben Sie zu fragen, was verschafft mir die Ehre? ...“
„Da ich Ihre Großmütigkeit und Wohltätigkeit kenne,“ unterbrach ihn
eilig, doch mit schüchterner Stimme sein Gast und erhob sich ein wenig
vom Stuhl, „wagte ich mich an Sie zu wenden und um Ihre Bekanntschaft
und Gönnerschaft zu bitten ...“ Er suchte seine Worte stockend zusammen
und bemühte sich, nicht allzu schmeichelhafte Ausdrücke zu wählen, wohl
um sich vor seinem eigenen Ehrgefühl nicht herabzusetzen – aber auch, um
allzu kühne Worte, die eine Gleichstellung beansprucht hätten, zu
vermeiden. Überhaupt konnte man sagen, daß sich der Gast des Herrn
Goljädkin wie ein wohlanständiger Bettler mit geflicktem Frack und guten
Papieren in der Tasche benahm – gleich einem, der noch nicht geübt war,
die Hand so auszustrecken, wie es sich vielleicht empfahl.
„Sie setzen mich in Verwunderung,“ sagte Herr Goljädkin, sich umsehend,
betrachtete dann die Wände und schließlich wieder den Gast. „Worin
könnte ich Ihnen ... ich, das heißt ich wollte nur sagen, in welcher
Beziehung und womit könnte ich Ihnen nützlich sein?“
„Ich, Jakoff Petrowitsch, ich fühlte mich auf den ersten Blick zu Ihnen
hingezogen und: verzeihen Sie mir großmütig, ich hoffte auf Sie – ich
wagte zu hoffen, Jakoff Petrowitsch. Ich ... ich bin ein ganz hilfloser
Mensch, Jakoff Petrowitsch, ich habe viel durchgemacht, Jakoff
Petrowitsch, und will nun wieder von neuem ... Da ich aber erfahren
habe, daß Sie – nicht nur diese schönen Seeleneigenschaften besitzen,
sondern außerdem noch ein Namensvetter von mir sind ...“
Herr Goljädkin runzelte die Stirn.
„... Mein Namensvetter sind und aus derselben Stadt wie ich gebürtig, so
beschloß ich, mich an Sie zu wenden und Ihnen meine schwierige Lage
vorzustellen.“
„Schön, schön! Ich weiß nur wirklich nicht, was ich Ihnen sagen soll,“
antwortete etwas betroffen Herr Goljädkin. „Nach dem Essen wollen wir
sehen ...“
Der Gast verbeugte sich. Man brachte das Mittagessen. Petruschka deckte
den Tisch und trug auf. Gast und Wirt begannen es zu verzehren. Das
Essen dauerte nicht lange, denn beide beeilten sich. Der Wirt beeilte
sich, weil er nicht bei Laune war und obendrein fand, daß das Essen
schlecht sei – er fand es zum Teil deshalb, weil er seinen Gast gut
bewirten wollte, und zum Teil auch deshalb, weil er ihm zu zeigen
gedachte, daß er nicht wie ein Bettler lebte. Und der Gast wiederum
befand sich in großer Verlegenheit und Erregung. Nachdem er Brot
genommen und ein Stück Fleisch gegessen hatte, fürchtete er sich, die
Hand nach einem zweiten und besseren Stück auszustrecken. Er versicherte
darum unaufhörlich, daß er durchaus nicht hungrig und daß das Essen sehr
gut sei, und daß er sich bis zu seinem Tode daran erinnern werde. Nach
dem Essen zündete sich Herr Goljädkin eine Pfeife an und reichte seinem
Freunde und Gast eine andere. Beide setzten sich einander gegenüber und
der Gast begann seine Erzählung.
Die Erzählung des zweiten Herrn Goljädkin dauerte drei bis vier Stunden.
Es war die Geschichte seiner Wirrnisse, die sich aus den unbedeutendsten
und kläglichsten Umständen zusammensetzte. Es handelte sich um den
Dienst bei irgendeiner Behörde in einem Gouvernement, um Staatsanwälte
und Präsidenten, es handelte sich um Kanzleiintrigen, handelte von der
Verworfenheit eines der Beamten, von einem Revisor und dem plötzlichen
Wechsel des Vorgesetzten und davon, wie Herr Goljädkin der Jüngere unter
alledem ganz unschuldig zu leiden gehabt hätte. Ferner von seiner alten
Tante Pelageja Ssemjonowna, und wie er durch die Intrigen seiner Feinde
seine gute Stellung verlor und zu Fuß nach Petersburg kam, wie er hier
in Petersburg in Not geriet, lange Zeit hindurch vergeblich eine
Stellung suchte, immer mehr und mehr verarmte und zuletzt auf der Straße
lebte, hartes Brot aß, das er mit seinen Tränen aufweichte, und nachts
auf der Erde schlief. Wie dann endlich ein guter Mensch sich seiner
annahm, ihm eine Empfehlung gab und in großmütiger Weise zu der neuen
Stellung verhalf. Der Gast weinte bei dieser Erzählung und wischte sich
mit einem karierten Taschentuch, das wie ein Wachstuch aussah, in einem
fort die Tränen aus den Augen. Er schloß damit, daß er Herrn Goljädkin
alles offen mitgeteilt und sich ihm ganz anvertraut habe, weil er nichts
zum Leben besitze, noch um sich anständig einzurichten, und nicht einmal
eine Uniform anschaffen könne. Auf seine Stiefel dürfe er sich auch
nicht mehr verlassen. Die Uniform, die er trage, habe er nur auf Zeit
geliehen.
Herr Goljädkin war wirklich aufrichtig gerührt. Und obwohl die
Geschichte seines Gastes eine ganz gewöhnliche war, legten sich dessen
Worte doch wie himmlisches Manna auf seine Seele. Die Sache war nämlich
die: Herr Goljädkin verlor durch die Erzählung seine letzten Zweifel, er
gab seinem Herzen die Freiheit wieder und nannte sich selbst in Gedanken
einen Dummkopf.
Alles war ja so natürlich! Wozu hatte er sich so beunruhigt, sich so
aufgeregt! Zwar gab es da noch einen peinlichen Umstand, aber auch der
war nicht gar so schlimm: er konnte doch den Menschen nicht zugrunde
richten und seine Karriere zerstören, wenn der Mensch unschuldig war und
die Natur selbst sich hier eingemischt hatte! Außerdem bat ihn der Gast
um seinen Schutz, er weinte und klagte sein Schicksal an, er schien so
harmlos, ohne Bosheit und Hinterlist und war so erbärmlich und nichtig
vor ihm. Er machte sich vielleicht im geheimen selbst Vorwürfe über die
Ähnlichkeit seines Gesichtes mit dem seines Wirtes. Er führte sich so
vorzüglich auf und suchte seinem Wirte zu gefallen und sah ganz so drein
wie ein Mensch, der sich Gewissensbisse macht und sich vor dem anderen
schuldig fühlt. Kam die Rede zum Beispiel auf einen strittigen Punkt, so
stimmte der Gast sofort der Meinung Herrn Goljädkins bei. Wenn irgendwie
aus Versehen seine Meinung von der Meinung Herrn Goljädkins abwich und
er es bemerkte, so verbesserte er sich sofort und erklärte alsbald, daß
er ganz derselben Meinung sei wie sein Wirt, daß er ganz so denke wie
dieser und alles mit denselben Augen ansähe. Kurz, der Gast gab sich die
größte Mühe, Herrn Goljädkin zu gefallen, sozusagen in ihm aufzugehen,
und Herr Goljädkin wiederum überzeugte sich davon, daß sein Gast in
jeder Beziehung ein liebenswürdiger Mensch sei. Es wurde inzwischen Tee
gereicht. Es war neun Uhr. Herr Goljädkin war in sehr angenehmer
Stimmung, heiter und angeregt, und ließ sich nun in ein sehr lebhaftes
und bemerkenswertes Gespräch mit seinem Gast ein. Herr Goljädkin liebte
es manchmal, bei heiterer Stimmung etwas Interessantes zu erzählen. So
auch jetzt: er erzählte seinem Gast viel aus dem Petersburger Leben, von
dessen Schönheit und seinen Vergnügungen, vom Theater, von den Klubs und
den schönen Bildern, auch davon, wie zwei Engländer aus England nach
Petersburg gekommen seien, nur um sich das Gitter des Sommergartens
anzusehen und dann gleich wieder fortzufahren. Auch vom Dienst erzählte
er, von Olssuph Iwanowitsch und Andrej Philippowitsch, und davon, daß
Rußland von Stunde zu Stunde seiner Größe entgegengehe, daß „die Künste
in ihm blühten“; von einer Anekdote, die er neulich in der „Biene“
gelesen, und von den Schlangen Indiens, die außergewöhnliche Kraft
hätten; und noch von vielem anderen. Kurz Herr Goljädkin war vollkommen
zufrieden. Erstens, weil er jetzt vollkommen ruhig sein konnte; zweitens
weil er seine Feinde nun nicht mehr fürchtete, sondern sie am liebsten
gleich zum entscheidenden Zweikampf herausgefordert hätte; drittens,
weil er selbst als Gönner auftrat und endlich, weil er ein gutes Werk
tat.
Im Innersten gestand er sich übrigens ein, daß er in diesem Augenblick
doch noch nicht ganz glücklich sein konnte, daß in ihm immer noch ein
Würmchen steckte, wenn es auch nur ein ganz kleines war, das aber
nichtsdestoweniger noch an seinem Herzen nagte.
Es quälte ihn auch die Erinnerung an den gestrigen Abend bei Olssuph
Iwanowitsch. Er hätte jetzt viel darum gegeben, wenn – dieses Gestern
nicht gewesen wäre.
„Übrigens, es tut gar nichts!“ schloß endlich unser Held und gab sich
das feste Versprechen, sich in Zukunft immer gut aufzuführen und sich
nicht mehr selbst in solche Verlegenheiten zu bringen.
Da Herr Goljädkin jetzt ganz aus sich herausgegangen war und sich fast
glücklich fühlte, so stieg auch in ihm der Wunsch auf, sein Leben zu
genießen. Petruschka mußte also einen Rum bringen und Punsch bereiten.
Der Gast und der Wirt leerten darauf ein, zwei Gläschen. Der Gast wurde
jetzt noch liebenswürdiger als zuvor und zeigte seinerseits nicht nur
einen gefälligen und offenen Charakter, sondern ging ganz auf die
Stimmung des Herrn Goljädkin ein, freute sich über seine Freude und sah
auf ihn, wie auf seinen einzigen und aufrichtigen Wohltäter.
Er ergriff die Feder und ein Stück Papier und bat Herrn Goljädkin, nicht
zu sehen, was er schreiben werde, und als er darauf geendet hatte,
überreichte er dem Gastgeber feierlich das Geschriebene. Es war ein sehr
gefühlvoller Vierzeiler, mit schöner Handschrift geschrieben und, wie es
schien, vom Gast selbst verfaßt. Er lautete folgendermaßen:
Wenn auch du mich je vergißt,
Ich vergeß dich nicht;
Wechselvoll ist alles Leben,
Drum vergiß mich nicht!
Mit Tränen in den Augen umarmte Herr Goljädkin seinen Gast und voll von
Mitgefühl und Überschwang weihte er ihn in seine verschiedenen großen
und kleinen Geheimnisse ein, in denen besonders von Andrej
Philippowitsch und Klara Olssuphjewna die Rede war.
„Nun, wir beide, Jakoff Petrowitsch, werden uns schon gegenseitig
verstehen,“ beteuerte unser Held seinem Gast. „Wir werden miteinander,
Jakoff Petrowitsch, wie zwei leibliche Brüder leben, wie zwei Fische im
Wasser! Wir, Freundchen, wollen schon schlau sein und ihnen eine Intrige
drehen ... und sie ordentlich an der Nase herumführen. Sage aber
niemandem etwas davon. Ich kenne ja, Jakoff Petrowitsch, deinen
Charakter: du wirst natürlich sofort alles erzählen müssen, du
aufrichtige Seele, du! Doch, Brüderchen, halte dich lieber fern von
ihnen!“
Der Gast stimmte ihm in allem bei, dankte Herrn Goljädkin und zerfloß in
Tränen.
„Weißt du, Jascha,“ fuhr Herr Goljädkin mit schwacher, zitternder Stimme
fort, „du, Jascha, bleibe jetzt bei mir, wenn du willst – auf immer. Wir
werden uns zusammen einleben. Was meinst du, Bruder? Du brauchst dich
nicht zu beunruhigen, klage auch nicht, daß zwischen uns ein so
sonderbares Verhältnis besteht: zu murren, Freund, ist Sünde; die Natur
hat’s so gewollt! Die Mutter Natur ist weise, siehst du, so ist es,
Jascha! Ich liebe, ich liebe dich, liebe dich brüderlich, sage ich dir.
Aber zusammen, Jascha, da wollen wir ihnen einen Streich spielen.“
So waren sie beim dritten und vierten Glase Punsch und bei der
Brüderschaft angelangt, als Herr Goljädkin sich von zwei Empfindungen
beherrscht fühlte: die eine war, daß er außergewöhnlich glücklich sei,
und die andere – daß er schon nicht mehr auf den Beinen stehen konnte.
Der Gast wurde natürlich aufgefordert, bei ihm zu übernachten. Das Bett
wurde irgendwie aus zwei Reihen Stühlen hergestellt. Herr Goljädkin der
Jüngere erklärte, unter so freundschaftlichem Schutz sei auch auf dem
härtesten Lager weich zu schlafen; er befinde sich jetzt wie im
Paradiese, zumal er in seinem Leben schon viel Ungemach und Kummer
ertragen habe und man auch nicht wissen könne, was ihm noch in Zukunft
alles bevorstehe! ...
Herr Goljädkin der Ältere protestierte dagegen und fing an, ihm
darzulegen, wie man in Zukunft seine Hoffnung auf Gott setzen müsse. Der
Gast war natürlich vollkommen mit allem einverstanden: auch damit, daß
es nichts Höheres und Größeres gebe als Gott. Darauf bemerkte Goljädkin
der Ältere, daß die Türken in mancher Beziehung durchaus recht hätten,
mitten im Schlaf sogar den Namen Gottes anzurufen. Im übrigen
verteidigte er den türkischen Propheten Mohammed gegen die Verleumdungen
mancher Gelehrten und erkannte in ihm einen großen Politiker, bei
welcher Gelegenheit er auf einen algerischen Barbier zu sprechen kam,
eine Figur aus einem Witzblatt. Wirt und Gast lachten anhaltend über die
Gutmütigkeit dieses Türken und konnten sich andererseits nicht genug
über den vom Opium erzeugten Fanatismus der Türken wundern.
Endlich begann der Gast sich zu entkleiden und Herr Goljädkin begab sich
hinter den Verschlag, zum Teil aus Gutmütigkeit, um seinen Gast, diesen
vom Unglück verfolgten Menschen, nicht in Verlegenheit zu setzen, im
Falle er nicht im Besitze eines ordentlichen Hemdes sein sollte – zum
Teil auch, um mit Petruschka zu sprechen, ihn aufzumuntern und auch ihm
womöglich etwas von seinem Glück mitzuteilen.
Es muß gesagt werden, daß Petruschka ihn immer noch beunruhigte.
„Du, Pjotr, lege dich schlafen!“ sagte Herr Goljädkin milde, als er in
den Verschlag seines Dieners eintrat, „du lege dich jetzt schlafen,
morgen aber um acht Uhr mußt du mich wecken. Hast du verstanden,
Petruschka?“
Herr Goljädkin sprach ungemein zärtlich und milde zu ihm, aber
Petruschka schwieg. Er machte sich an seinem Bett zu schaffen und wandte
sich nicht einmal nach seinem Herrn um, wie es sich doch gehört hätte.
„Hast du gehört, Pjotr?“ fuhr Herr Goljädkin fort. „Du legst dich jetzt
zu Bett und morgen, Petruschka, wirst du mich um acht Uhr wecken; hast
du mich verstanden?“
„Schon gut, schon gut!“ antwortete Petruschka.
„Nun, nun, Petruschka, ich sage ja nur so, damit du ruhig und zufrieden
bist. Denn, sieh, wir sind jetzt alle miteinander glücklich und ich
wünsche, daß du es auch sein mögest. Ich wünsche dir jetzt eine gute
Nacht, schlafe wohl, Petruschka, schlafe wohl. Wir alle müssen arbeiten.
Du, Freund, denke nicht etwa, daß ich ...“
Herr Goljädkin brach plötzlich ab. „Bin ich nicht zu weit gegangen?“
dachte er. „So ist es immer, ich gehe immer zu weit.“
Unser Held verließ Petruschka sehr unzufrieden mit sich selbst. Die
Grobheit und Ungezogenheit Petruschkas hatten ihn beleidigt. „Dieser
Schelm, sein Herr erweist ihm solche Ehre und er empfindet das nicht
einmal,“ dachte Herr Goljädkin. „Übrigens ist das bei dieser Sorte immer
so!“
Er wankte ein wenig, als er ins Zimmer zurückkehrte, und da er sah, daß
der Gast sich bereits hingelegt hatte, setzte er sich auf einen
Augenblick zu ihm aufs Bett.
„Gestehe es doch ein, Jascha,“ begann er flüsternd mit wackelndem Kopf:
„Du bist doch ein Taugenichts! Du bist ein Namensdieb, weißt du das
auch? ... Das bist du mir schuldig!“ fuhr er in familiärem Tone fort,
sich mit seinem Gast zu unterhalten.
Schließlich verabschiedete er sich freundschaftlich von ihm, um selbst
auch schlafen zu gehen. Der Gast hatte mittlerweile bereits zu
schnarchen begonnen. Herr Goljädkin legte sich lächelnd ins Bett und
murmelte vor sich hin: „Nun, heute bist du betrunken, mein Täubchen,
Jakoff Petrowitsch, ein Taugenichts bist du, ein Hungerleider – dein
Name sagt es schon!! Worüber hast du dich denn so zu freuen? Morgen
wirst du dafür weinen, du Affe: was ist mit dir denn zu machen?“
Nun aber überkam ihn ein ganz sonderbares Gefühl, ähnlich wie Zweifel
und Bedauern. „Bist zu weit gegangen,“ dachte er, „jetzt brummt mir der
Kopf und ich bin betrunken ... und konntest nicht an dich halten, du
Dummkopf, und hast drei Körbe voll Blech geredet, und dabei willst du
noch feine Intrigen spinnen, du Esel! Freilich, Großmut und Vergeben ist
eine Tugend, doch immerhin: es steht schlimm mit dir! Da liegt er nun!“
Und Herr Goljädkin stand auf, nahm das Licht in die Hand und ging auf
den Fußspitzen noch einmal an das Bett, um seinen schlafenden Gast zu
betrachten. Lange stand er da, in tiefes Nachdenken versunken: „Ein
unangenehmes Bild das! Geradezu ein Pasquill! Ein leibhaftiges Pasquill!
Oh, die Sache hat einen Haken!“
Doch endlich legte sich auch Herr Goljädkin schlafen. In seinem Kopf
rumorte es. Seine Sinne schwanden ihm, er bemühte sich, noch an etwas
sehr Interessantes zu denken, etwas sehr Wichtiges zu entscheiden, über
eine sehr kitzliche Sache zu einem Urteil zu gelangen – aber er konnte
nicht mehr. Der Schlaf nahm sein Haupt, und so schlief er denn fest ein,
wie gewöhnlich Leute schlafen, die zu trinken nicht gewohnt sind und
plötzlich fünf Gläser Punsch in angenehmer Gesellschaft getrunken haben.
VIII.
Wie gewöhnlich, erwachte Herr Goljädkin am anderen Tage um acht Uhr.
Sofort erinnerte er sich aller Begebenheiten des vergangenen Abends –
erinnerte sich, und sein Gesicht wurde finster. „Habe ich mich aber
gestern wie ein Dummkopf benommen!“ dachte er, erhob sich ein wenig und
sah zu dem Bette seines Gastes hinüber. Doch wie groß war sein
Erstaunen, als er weder den Gast noch das Bett im Zimmer erblickte! „Was
hat denn das zu bedeuten?“ hätte Goljädkin beinahe laut aufgeschrien.
„Was soll denn das heißen? Was hat denn das wieder zu bedeuten?“
Während Herr Goljädkin, ohne etwas zu begreifen, mit offenem Munde auf
die leere Stelle starrte, öffnete sich die Tür und Petruschka trat mit
dem Teebrett ins Zimmer.
„Wo ist er, wo ist er?“ brachte unser Held mit kaum hörbarer Stimme
hervor und wies mit dem Finger auf die leere Stelle.
Zuerst antwortete ihm Petruschka gar nicht, er sah nicht einmal seinen
Herrn an, sondern wandte seine Augen nur stumm in die rechte Ecke des
Zimmers, so daß Herr Goljädkin auch gezwungen wurde, rechts in die Ecke
zu sehen. Erst nach einigem Schweigen erwiderte Petruschka mit rauher
und grober Stimme: „Der Herr ist nicht zu Haus.“
„Du Dummkopf, ich bin doch dein Herr, Petruschka!“ sagte Herr Goljädkin
ratlos und starrte seinen Diener mit großen Augen an.
Petruschka schwieg, doch blickte er Herrn Goljädkin in einer Weise an,
daß dieser bis über die Ohren errötete. In seinem Blick lag ein so
beleidigender Vorwurf, der Schimpfworten gleich war. Herr Goljädkin ließ
die Hände sinken und sagte kein Wort.
Endlich bemerkte Petruschka, der _andere_ sei vor anderthalb Stunden
bereits ausgegangen und habe nicht mehr warten wollen. Die Auskunft
klang sehr wahrscheinlich und glaubwürdig; offenbar belog ihn Petruschka
nicht, denn was seinen beleidigenden Blick und die Bezeichnung _der
andere_ anbetraf, so waren diese wohl durch einen unangenehmen Umstand
veranlaßt worden. Herr Goljädkin begriff denn auch, wenn auch nur
dunkel, daß hier etwas nicht in Ordnung war, und daß das Schicksal ihm
etwas vorzubehalten schien, das nicht angenehm war.
„Gut, wir werden sehen,“ dachte er bei sich, „wir werden sehen und
werden daran glauben müssen ... Ach, du grundgütiger Gott!“ stöhnte er
plötzlich mit ganz veränderter Stimme, „oh, warum habe ich ihn
aufgefordert, weshalb habe ich das alles getan? Ich habe selbst den Kopf
in die Schlinge gelegt, und habe mir dazu noch die Schlinge mit eigenen
Händen gedreht. Ach, du Dummkopf, du Dummkopf! Und du konntest auch
nichts anderes tun, als dich verplappern wie ein kleiner Junge, wie
irgend so ein Kanzlist, wie ein rangloser Lump, wie ein weicher Lappen,
ein verfaulter Lumpen, du Schwätzer, du! ...
Ach, ihr meine Heiligen! Gedichte hat der Schelm gemacht, von seiner
Liebe zu mir gesprochen! Wie ist das nur alles möglich gewesen ... Wie
kann ich diesem Lumpen nun auf anständige Weise die Tür weisen, wenn er
zurückkommen sollte? Versteht sich, es gibt ja verschiedene
Möglichkeiten: So und so, bei meinem geringen Gehalt ... oder, man kann
ihm auch Furcht einjagen, kann sagen, aus Rücksicht auf dieses und jenes
sei ich genötigt, ihm zu erklären ... das heißt, er solle die Hälfte für
Wohnung und Kost bezahlen und das Geld im voraus abgeben! Hm! Zum
Teufel, nein, das wäre gemein. Nicht zartfühlend genug! Oder, wäre es
nicht vielleicht besser, Petruschka auf ihn loszulassen, so daß der es
ihm einsalzte, ihn vernachlässigte und angrobte? um ihn auf diese Art
los zu werden?! Man müßte sie aufeinanderhetzen ... Nein, zum Teufel
auch, nein! Das wäre gefährlich, und dann auch, von dem Standpunkte aus
betrachtet ... nun, durchaus nicht schön! Durchaus, durchaus nicht
schön! Aber, wenn er jetzt nun gar nicht wiederkommt? Auch das wäre
nicht angenehm. Habe mich doch gestern abend so verplappert! ... Das ist
schlimm, wirklich schlimm! Ach, das ist eine schöne Geschichte, oh, ich
Dummkopf! Kannst du nicht endlich lernen, wie du dich zu benehmen hast,
kannst du dich nicht endlich beherrschen! Nun, wenn er jetzt kommt und
absagt? Gebe Gott, daß er kommt! Ich wäre ja selig, wenn er nur käme
...“
So philosophierte Herr Goljädkin, trank dabei seinen Tee und sah nach
der Wanduhr.
„Es ist bereits drei Viertel auf neun, ... es ist Zeit, zu gehen. Aber
was wird nun werden! Was wird geschehen? Ich würde gar zu gern wissen,
was wohl eigentlich dahintersteckt ... – wozu alle diese Ränke und
Intrigen dienen sollen? Es wäre gut, zu wissen, was eigentlich alle
diese Leute denken und welche Schritte sie tun wollen ...“
Herr Goljädkin konnte sich vor Ungeduld nicht mehr beherrschen, er warf
die Pfeife fort, zog sich an und begab sich in das Departement – mit dem
Wunsche, wenn möglich, die Gefahr selbst aufzusuchen und sich persönlich
zu vergewissern. Denn eine Gefahr gab es: das wußte er genau, eine
Gefahr gab es!!!
„Aber wir wollen sie sehen ... und unterkriegen,“ beschloß Herr
Goljädkin, während er im Vorraum Galoschen und Mantel ablegte. „Wir
werden diesen Dingen sofort auf den Grund kommen, sofort!“
Entschlossen, irgendwie zu handeln, nahm unser Held eine würdige Miene
an und war eben im Begriff, in das nächstliegende Zimmer einzutreten,
als er plötzlich noch an der Tür auf seinen Bekannten und Busenfreund
stieß.
Herr Goljädkin der Jüngere schien jedoch Herrn Goljädkin den Älteren gar
nicht zu bemerken, obgleich sie fast mit den Nasen aufeinander rannten.
Herr Goljädkin der Jüngere schien offenbar sehr beschäftigt zu sein, er
hatte es eilig, wurde ganz rot, nahm eine sehr geschäftige und
offizielle Miene an, so daß ihm jeder am Gesicht ablesen konnte: „scht,
ich bin kommandiert zu ganz besonderen Aufträgen ...“
„Ah, Sie sind’s, Jakoff Petrowitsch!“ sagte unser Held und griff nach
der Hand seines gestrigen Gastes.
„Nachher, nachher, entschuldigen Sie mich, nachher,“ rief Herr Goljädkin
der Jüngere, und wollte davoneilen.
„Aber, erlauben Sie, Sie wollten doch, Jakoff Petrowitsch ...“
„Was wollte ich? Erklären Sie sich schnell.“ Dabei blieb der gestrige
Gast des Herrn Goljädkin widerstrebend vor diesem stehen und neigte sein
Ohr zur Nase des anderen.
„Ich wollte Ihnen nur sagen, Jakoff Petrowitsch, daß ich sehr erstaunt
bin – über den Empfang ... einen Empfang, den ich durchaus nicht
erwartet habe.“
„Alles hat seinen Weg. Gehen Sie zum Sekretär Seiner Exzellenz, und
darauf begeben Sie sich, wie es sich gehört, zum Chef der Kanzlei. Sie
haben wohl eine Bittschrift? ...“
„Ich verstehe Sie nicht, Jakoff Petrowitsch! Sie setzen mich einfach in
Erstaunen, Jakoff Petrowitsch! Wahrscheinlich haben Sie mich nicht
wiedererkannt oder Sie belieben zu scherzen ... – bei der angeborenen
Heiterkeit Ihres Charakters.“
„Ach, das sind Sie!“ sagte Herr Goljädkin der Jüngere, als hätte er erst
jetzt Herrn Goljädkin den Älteren erkannt, – „ja so, Sie sinds? Nun, wie
haben Sie geruht?“
Herr Goljädkin der Jüngere lächelte ein wenig, ein wenig offiziell, und
zwar durchaus nicht, wie es sich gehörte (denn auf jeden Fall hätte er
Herrn Goljädkin dem Älteren seine Dankbarkeit beweisen sollen), er aber
lächelte nur sehr formell und offiziell und fügte dabei hinzu, daß er
seinerseits sehr froh darüber sei, daß Herr Goljädkin so gut geruht
habe. Dann verneigte er sich etwas, bewegte sich hin und her, sah nach
rechts, nach links, senkte die Augen zu Boden, wandte sich nach der
Seitentür, flüsterte ihm eilig zu, daß er einen „ganz besonderen
Auftrag“ habe, und schlüpfte ins nächste Zimmer. Kaum gesehen – war er
schon verschwunden.
„Da haben wir’s, das ist nicht übel! ...“ murmelte unser Held, einen
Augenblick starr vor Verwunderung, „da haben wir’s! Also so stehen die
Sachen! ...“ Herr Goljädkin fühlte, wie ihm ein Kribbeln über den Körper
lief. „Übrigens,“ fuhr er in seinem Selbstgespräch fort, „übrigens habe
ich das längst gewußt, ich habe es ja längst vorausgefühlt, daß er in
einem besonderen Auftrag ... nämlich, gestern sagte ich’s noch, daß
dieser Mensch in einem besonderen Auftrage ...“
„Haben Sie Ihre gestrigen Papiere fertiggestellt, Jakoff Petrowitsch?“
fragte ihn Anton Antonowitsch Ssjetotschkin, als Herr Goljädkin sich
neben ihn setzte, „haben Sie sie hier?“
„Hier,“ flüsterte Herr Goljädkin, der den Bureauvorsteher ganz verloren
anschaute.
„So, so! Ich fragte darum, weil Andrej Philippowitsch bereits zweimal
nach ihnen verlangte, und weil es möglich, daß Seine Exzellenz sie jeden
Augenblick einfordern werden ...“
„Sie sind fertig ...“
„Nun, gut, gut.“
„Ich, Anton Antonowitsch, habe doch immer meine Schuldigkeit getan, so
wie es sich gehört, und, erfreut über die mir anvertrauten Arbeiten, wie
ich zu sein pflege, beschäftige ich mich mit ihnen gewissenhaft.“
„Ja ... nun ... was wollen Sie denn damit sagen?“
„Ich? Nichts, Anton Antonowitsch. Ich wollte nur erklären, Anton
Antonowitsch, daß ich ... das heißt, ich wollte sagen, daß mitunter Neid
und Bosheit niemanden verschonen und sich ihre tägliche, abscheuliche
Beute suchen ...“
„Entschuldigen Sie, ich verstehe Sie nicht ganz. Das heißt, auf wen
wollen Sie anspielen?“
„Das heißt, ich wollte nur sagen, Anton Antonowitsch, daß ich meinen Weg
gerade gehe und einen krummen Weg verabscheue, daß ich kein Intrigant
bin, und daraus, wenn es erlaubt ist, sich so auszudrücken,
gerechterweise stolz sein kann ...“
„Ja–a. Das stimmt, wenigstens kann ich, so wie ich darüber denke, Ihrer
Meinung vollständig zustimmen: doch erlauben Sie mir, Jakoff
Petrowitsch, zu bemerken, daß es einem Menschen in guter Gesellschaft
nicht erlaubt ist, einem alles ins Gesicht zu sagen – wenn Sie das zu
tun wünschen, nun, so ist es Ihr freier Wille. Ich aber, mein Herr,
lasse mir keine Unverschämtheiten ins Gesicht sagen. Ich, mein Herr, bin
im kaiserlichen Dienst grau geworden und erlaube mir auf meine alten
Tage auch keine Frechheiten ... –“
„Ne–i–n, ich, Anton Antonowitsch, sehen Sie, Anton Antonowitsch, Sie
scheinen, Anton Antonowitsch, mich nicht ganz verstanden zu haben.
Erbarmen Sie sich, Anton Antonowitsch, ich kann meinerseits nur auf Ehre
versichern, daß ...“
„Ich muß, ebenfalls meinerseits, mich zu entschuldigen bitten. Ich bin
nach alter Art erzogen, und es ist für mich zu spät, nach Ihrer Art
umzulernen. Für den Dienst des Vaterlandes war mein Verständnis, wie es
scheint, bis jetzt genügend. Wie Sie selbst wissen, mein Herr, besitze
ich das Ehrenzeichen – für fünfundzwanzigjährige untadelhafte Dienstzeit
...“
„Ich verstehe, Anton Antonowitsch, ich verstehe das meinerseits
vollkommen. Aber nicht das habe ich gemeint, ich habe von der Maske
gesprochen, Anton Antonowitsch ...“
„Von der Maske?“
„Das heißt, Sie scheinen wieder ... ich fürchte, Anton Antonowitsch, daß
Sie auch hier meine Gedanken anders auffassen, den Sinn meiner Rede, wie
Sie selbst sagen, anders auffassen. Ich entwickele ja nur meine
Anschauung, habe die Idee, Anton Antonowitsch, daß es jetzt selten Leute
ohne Maske gibt, und daß es schwer ist, unter der Maske einen Menschen
zu erkennen ...“
„N–u–n, wissen Sie, das ist nicht immer so schwer. Manchmal ist es sogar
sehr leicht und man braucht nicht weit zu suchen.“
„Nein, wissen Sie, Anton Antonowitsch, ich behaupte ja nur für meine
Person, daß ich mich nie einer Maske bedienen würde, oder doch nur, wenn
es die Gelegenheit verlangte, zum Karneval oder sonst in heiterer
Gesellschaft, daß ich mich aber vor Leuten im täglichen Leben, im
übertragenen Sinne gesprochen, niemals maskieren würde. Das ist es, was
ich sagen wollte, Anton Antonowitsch.“
„Nun, lassen wir das jetzt, ich habe offen gestanden jetzt keine Zeit
dazu,“ sagte Anton Antonowitsch, der von seinem Stuhle aufstand und
einige Papiere zur Meldung bei Seiner Exzellenz zusammenlegte. „Ihre
Sache wird sich, wie ich voraussetze, ohne Verzögerung von selbst
aufklären. Sie werden selbst sehen, wen Sie anzuklagen und wen Sie zu
beschuldigen haben, mich aber bitte ich, mit weiteren privaten und den
Dienst beeinträchtigenden Unterhaltungen zu verschonen ...“
„Nein, ich ... Anton Antonowitsch,“ rief Herr Goljädkin, ein wenig
erbleichend, dem sich entfernenden Anton Antonowitsch noch nach, „ich,
Anton Antonowitsch, habe an dergleichen überhaupt nicht gedacht ...“
„Was hat denn das wieder zu bedeuten?“ sagte Herr Goljädkin zu sich
selbst, als er allein geblieben war. „Woher weht denn dieser Wind, und
was soll denn dieser neue Winkelzug wieder bringen?“
In demselben Augenblick, als unser verdutzter und halbtoter Held sich
vorbereitete, diese neue Frage zu beantworten, hörte man im Nebenzimmer
ein Geräusch und kurze Zeit darauf geschäftige Bewegung. Die Tür
wurde aufgerissen und Andrej Philippowitsch, der soeben in
Dienstangelegenheiten im Kabinett Seiner Exzellenz gewesen war, erschien
aufgeregt in der Tür und rief nach Herrn Goljädkin. Herr Goljädkin, der
wohl wußte, um was es sich handelte und der Andrej Philippowitsch nicht
warten lassen wollte, sprang von seinem Platz und bereitete sich vor, so
wie es sich gehörte, das verlangte Papier noch einmal schnell zu
überfliegen, um es dann selbst zu Andrej Philippowitsch und ins Kabinett
seiner Exzellenz zu tragen. Plötzlich aber schlüpfte, an Andrej
Philippowitsch vorüber, Herrn Goljädkin der Jüngere durch die Tür und
stürzte sich, kaum daß er im Zimmer war, mit wichtiger und sehr
geschäftiger Miene geradeaus auf Herrn Goljädkin den Älteren, der alles
eher erwartete, als einen solchen Überfall ...
„Die Papiere, Jakoff Petrowitsch, die Papiere ... Seine Exzellenz
geruht, Sie zu fragen, ob sie fertig sind?“ flüsterte eilig und kaum
hörbar der Freund Herrn Goljädkins des Älteren. „Andrej Philippowitsch
erwartet Sie ...“
„Ich weiß schon, daß er mich erwartet,“ entgegnete ihm Herr Goljädkin
der Ältere gleichfalls eilig und flüsternd.
„Nein, Jakoff Petrowitsch: ich bin nicht so, Jakoff Petrowitsch, ich bin
ganz anders, Jakoff Petrowitsch, und nehme herzlich Anteil ...“
„Womit ich Sie ergebenst bitte, mich zu verschonen. Erlauben Sie,
erlauben Sie, bitte ...“
„Sie müssen auf jeden Fall einen Umschlag herumlegen, Jakoff
Petrowitsch, und in die dritte Seite legen Sie ein Zeichen, Jakoff
Petrowitsch ...“
„Aber so erlauben Sie mir doch endlich ...“
„Hier ist doch ein Tintenfleck, Jakoff Petrowitsch! Haben Sie den
Tintenfleck bemerkt? ...“
Jetzt rief Andrej Philippowitsch schon zum zweitenmal nach Herrn
Goljädkin.
„Sofort, Andrej Philippowitsch, nur noch einen Augenblick, hier, gleich
... werter Herr, verstehen Sie kein Russisch?“
„Am besten wäre es, ihn mit dem Federmesser auszukratzen, Jakoff
Petrowitsch, überlassen Sie es lieber mir: rühren Sie selbst lieber gar
nicht daran, Jakoff Petrowitsch, verlassen Sie sich ganz auf mich, ich
werde mit dem Federmesser ...“
Andrej Philippowitsch rief zum dritten Male nach Herrn Goljädkin.
„Aber hören Sie, wo ist denn da ein Tintenfleck? Ich sehe hier überhaupt
nichts ...“
„Und sogar ein sehr großer Tintenfleck, hier, sehen Sie, hier! Erlauben
Sie, ich habe ihn soeben gesehen, hier, erlauben Sie ... Wenn Sie mir
nur erlauben wollten, Jakoff Petrowitsch, ich würde hier schon aus
Mitgefühl mit dem Federmesser, Jakoff Petrowitsch, mit dem Messer und
aus aufrichtigem Herzen ... sehen Sie, so, so muß man’s tun ...“
Plötzlich und ganz unerwartet vergewaltigte Herr Goljädkin der Jüngere
Herrn Goljädkin den Älteren in einem sekundenlangen Kampfe, der sich
zwischen ihnen entspann: und entschieden ganz gegen den Willen des
letzteren nahm er das vom Vorgesetzten verlangte Papier, und statt aus
aufrichtigem Herzen den Tintenfleck mit dem Messerchen zu entfernen, wie
er treulos Herrn Goljädkin dem Älteren versichert hatte – riß er
plötzlich die verlangten Papiere an sich, steckte sie unter den Arm, war
in zwei Sätzen neben Andrej Philippowitsch, der von alledem nichts
bemerkt hatte, und flog mit ihm ins Kabinett seines Chefs. Herr
Goljädkin der Ältere stand versteinert da an seinem Platz, in den Händen
das Federmesser, als ob er soeben etwas radieren wollte ...
Unser Held begriff diese neue Tatsache nicht sofort. Er konnte noch
nicht zu sich kommen. Er fühlte wohl den Schlag, konnte sich aber über
seine Folgen nicht klar werden. In schrecklicher und ganz
unbeschreiblicher Verzweiflung riß er sich endlich von der Stelle los
und stürzte gleichfalls geradeaus ins Kabinett seines Chefs, indem er
unterwegs den Himmel anflehte, es möge sich alles dort zum besten wenden
... Im letzten Zimmer vor dem Kabinett des Chefs stieß er mit Andrej
Philippowitsch und seinem Namensvetter fast mit der Nase zusammen. Beide
kehrten schon zurück. Herr Goljädkin trat zur Seite. Andrej
Philippowitsch sprach heiter und vergnügt. Der Namensvetter Herrn
Goljädkins des Älteren lächelte gleichfalls, lief in ehrfurchtsvoller
Entfernung neben ihm her und flüsterte mit seliger Miene Andrej
Philippowitsch etwas ins Ohr, worauf Andrej Philippowitsch wohlwollend
seinen Kopf hin und her wiegte.
Sofort begriff unser Held die Situation. Tatsache war, daß seine Arbeit,
wie er nachher erfuhr, die Erwartungen Seiner Exzellenz noch übertroffen
hatte und gerade zur rechten Zeit vorgelegt worden war. Seine Exzellenz
waren äußerst zufrieden damit, und man sagte sogar, er habe sich bei
Herrn Goljädkin dem Jüngeren dafür bedankt: man sagte, er würde bei
Gelegenheit nicht vergessen ... –
Natürlich, das erste, was Herr Goljädkin tun mußte, war – protestieren,
aus allen Kräften protestieren, bis zum äußersten protestieren. Ohne
sich zu besinnen, bleich wie der Tod, stürzte er sich auf Andrej
Philippowitsch. Doch nachdem Andrej Philippowitsch vernommen hatte, daß
die Angelegenheit eine Privatsache des Herrn Goljädkin sei, weigerte er
sich, ihm Gehör zu schenken, mit der entschiedenen Bemerkung, er habe
kaum für seine eigenen Angelegenheiten einen Augenblick Zeit übrig.
Die Trockenheit des Tones und die Entschiedenheit der Abweisung wirkten
auf Herrn Goljädkin niederschmetternd. „Besser, ich versuche es von
einer anderen Seite ... besser, ich gehe zu Anton Antonowitsch.“ Zum
Unglück für Herrn Goljädkin war jedoch auch Anton Antonowitsch nicht zu
sprechen: auch er war irgendwie beschäftigt! „Nicht ohne Absicht bat er
mich, ihn mit Erklärungen und Gesprächen zu verschonen,“ dachte unser
Held. „In dem Falle bleibt mir nichts anderes übrig, als Seine Exzellenz
selbst anzurufen.“
Immer noch ganz bleich und verwirrt, wobei ihm der Kopf rund ging, wußte
Herr Goljädkin nicht, wozu er sich entschließen sollte, und setzte sich
an seinen Tisch.
„Es wäre viel besser, wenn das alles nicht wäre,“ dachte er
ununterbrochen bei sich selbst. „In der Tat dürfte eine so verwickelte,
dunkle Geschichte gar nicht möglich sein. Erstens ist das alles Unsinn,
und zweitens ist so etwas überhaupt nicht möglich. Wahrscheinlich hat
mir alles nur so geschienen, oder es geschah in Wirklichkeit etwas ganz
anderes. Wahrscheinlich war ich es selbst, der hinging ... und habe mich
für den anderen gehalten ... kurz und gut – es ist eine ganz unmögliche
Geschichte.“
Kaum war Herr Goljädkin zu diesem Schluß gekommen, als Herr Goljädkin
der Jüngere, beladen mit Papieren, die er in beiden Händen und unter dem
Arme trug, ins Zimmer flog. Im Vorbeigehen machte er Andrej
Philippowitsch ein paar notwendige Bemerkungen, unterhielt sich mit noch
jemandem, sagte sogar einem dritten Liebenswürdigkeiten, und da Herr
Goljädkin der Jüngere offenbar keine Zeit zu verschwenden hatte, wollte
er aller Wahrscheinlichkeit nach das Zimmer sofort wieder verlassen, als
er zum Glück Herrn Goljädkins des Älteren an der Tür mit ein paar jungen
Beamten zusammenstieß und im Vorbeigehen auch mit ihnen zu sprechen
begann. Herr Goljädkin der Ältere stürzte geradewegs auf ihn zu. Als
Herr Goljädkin der Jüngere das Manöver des Herrn Goljädkin des Älteren
bemerkte, blickte er mit großer Unruhe um sich, suchte, wohin er sich am
schnellsten verkriechen könnte. Doch unser Held hatte seinen gestrigen
Freund bereits am Ärmel gepackt. Die Beamten drängten sich um die beiden
Titularräte und warteten gespannt, was nun kommen würde. Der Ältere
begriff sehr wohl, daß die Stimmung jetzt gegen ihn war, begriff, daß
sie alle gegen ihn intrigierten. Um so mehr mußte er sich selbst
beherrschen ... Der Augenblick war entscheidend.
„Nun?“ fragte Herr Goljädkin der Jüngere Herrn Goljädkin den Älteren,
ihn dreist anschauend.
Herr Goljädkin der Ältere wagte kaum zu atmen. „Ich weiß nicht, mein
Herr,“ begann er, „wie ich Ihr sonderbares Betragen zu mir erklären
soll.“
„Nun, fahren Sie fort, mein Herr.“ Herr Goljädkin der Jüngere sah dabei
im Kreise um sich und zwinkerte den anderen Beamten zu, als gäbe er
ihnen das Zeichen, daß jetzt die Komödie beginne.
„Die Unverschämtheit Ihres Benehmens, mein verehrter Herr, spricht im
vorliegenden Falle noch mehr gegen Sie ... als es meine Worte tun
könnten. Hoffen Sie nicht, Ihr Spiel zu gewinnen: es steht schlecht ...“
„Nun, Jakoff Petrowitsch, jetzt sagen Sie mir mal, wie Sie geschlafen
haben?“ antwortete Herr Goljädkin der Jüngere und sah Herrn Goljädkin
dem Älteren gerade in die Augen.
„Sie, verehrter Herr, vergessen sich vollständig,“ sagte der Ältere
vollständig fassungslos und fühlte dabei kaum mehr den Boden unter den
Füßen. „Ich hoffe, daß Sie Ihren Ton ändern werden ...“
„Mein Lieber!“ erwiderte Herr Goljädkin der Jüngere, schnitt Herrn
Goljädkin dem Älteren eine ziemlich unehrerbietige Grimasse und kniff
ihn plötzlich ganz unerwartet mit seinen beiden Fingern in seine
ziemlich dicke rechte Backe. Unser Held fuhr auf wie ein Feuerbrand.
Kaum hatte jedoch der Freund des Herrn Goljädkin bemerkt, daß sein
Gegner an allen Gliedern zitterte, dabei stumm vor Verwunderung und rot
wie ein Krebs war, und so, bis zum Äußersten gebracht, sich zu einem
Überfall auf ihn entschließen wollte – als er ihm auf die
allerunverschämteste Weise zuvorkam. Er klopfte Herrn Goljädkin noch
zweimal auf die Backe, kniff sie noch einmal, und spielte so mit ihm
sein Spiel, während der andere immer noch unbeweglich und sprachlos vor
Erstaunen dastand, zum nicht geringen Ergötzen der um sie herumstehenden
Beamtenschaft. Herr Goljädkin der Jüngere, mit seiner schamlosen Seele
ging noch weiter, er klopfte schließlich Herrn Goljädkin den Älteren auf
den vollen Magen und sagte dazu mit einem giftigen Lächeln:
„Mach’ keine dummen Streiche, mein Lieber, keine dummen Streiche, Jakoff
Petrowitsch! Wir wollten ja zusammen Intrigen spinnen, Jakoff
Petrowitsch, Intrigen.“
Noch bevor unser Held nach dieser letzten Attacke zu sich kommen konnte,
lächelte Herr Goljädkin der Jüngere den Umstehenden verständnisinnig zu,
setzte eine sehr geschäftige Miene auf, schlug die Augen zu Boden,
kugelte sich wie ein Igel zusammen, murmelte etwas über „einen
besonderen Auftrag“, trippelte mit seinen kurzen Füßen davon und
verschwand im Nebenzimmer. Unser Held traute seinen Augen nicht und
konnte vor Erstaunen noch immer nicht zu sich kommen ...
Endlich erst, als er dann zu sich kam, wurde ihm klar, daß er beleidigt
war, in gewissem Sinne verloren – daß sein Ruf beschmutzt und befleckt,
er selbst in Gegenwart von anderen lächerlich gemacht worden war,
beschimpft von demjenigen, von dem er gestern noch gehofft hatte, daß er
sein einziger, bester Freund werden würde, und er erkannte, daß er sich
vor der ganzen Welt blamiert hatte, und als ihm das so recht zum
Bewußtsein gekommen war, da besann er sich nicht lange, sondern –
stürzte seinem Feinde nach, ohne auch nur an die Zeugen seiner
Erniedrigung zu denken.
„Sie alle stecken miteinander unter einer Decke,“ dachte er bei sich,
„einer steht für den anderen und einer hetzt den anderen gegen mich
auf.“ Doch kaum hatte unser Held die ersten zehn Schritte gemacht, als
er einsah, daß jede Verfolgung umsonst war. Deshalb kehrte er um.
„Du wirst mir nicht entkommen,“ dachte er, „du kommst mir noch in die
Falle und wirst als Wolf Lämmertränen weinen!“ Mit wütender
Kaltblütigkeit und mit entschlossener Energie ging Herr Goljädkin zu
seinem Stuhl und setzte sich auf ihn nieder.
„Du wirst mir nicht entkommen,“ wiederholte er noch einmal.
Jetzt handelte es sich bei ihm nicht mehr um eine passive Verteidigung,
seine Haltung sah nach Entschlossenheit aus, und wer Herrn Goljädkin in
diesem Augenblick sah, wie er puterrot und kaum seiner Erregung mächtig
seine Feder ins Tintenfaß steckte, und mit welcher Wut er seine Zeilen
aufs Papier warf, der mußte wohl im voraus begreifen, daß diese Sache
nicht so einfach verlaufen würde. In der Tiefe seiner Seele faßte er
einen Entschluß und in der Tiefe seines Herzens schwor er sich, ihn auch
auszuführen. Dabei wußte er aber noch gar nicht so recht, wie er hier
vorgehen sollte, besser gesagt, er wußte überhaupt noch nichts
Bestimmtes – aber das Einzelne, meinte er, das war ja gleichgültig!
„Mit Anmaßung und Unverschämtheit, verehrter Herr, richten Sie in
unserer Zeit nichts aus. Anmaßung und Unverschämtheit, mein verehrter
Herr, führen nicht zum Guten, sondern zum Galgen. Nur Grischka
Otrepieff[14] allein, mein Herr, erdreistete sich, das blinde Volk durch
Anmaßung und Unverschämtheit zu betrügen, und auch das gelang ihm nur
auf sehr, sehr kurze Zeit.“
Ungeachtet des letzteren Umstandes beschloß Herr Goljädkin, zu warten,
bis die Maske von manchen Gesichtern fallen und alles aufgedeckt werden
würde. Dazu mußten aber die Kanzleistunden erst zu Ende gehen. Bis dahin
wollte unser Held nichts unternehmen. Dann aber würde er zu Maßregeln
greifen – dann würde er wissen, was er zu tun hatte. Dann würde er
wissen, welcher Plan zu entwerfen war, um den „Hochmut zu fällen“ und
die „kriechende Schlange ohnmächtig in den Staub zu treten“. Er konnte
es doch nicht erlauben, daß man ihn wie einen Lappen behandelte, mit dem
man schmutzige Stiefel reinigt! Das konnte er sich doch unmöglich
gefallen lassen, besonders in diesem Falle nicht! Wäre unserem Helden
nicht dieser letzte Schimpf angetan worden, vielleicht hätte er sich
doch noch entschließen können, sich zu überwinden und zu schweigen, oder
wenigstens nicht so erbittert zu handeln. Er hätte sich dann vielleicht
nur ein wenig herumgestritten und klar bewiesen, daß er in seinem Recht
sei, hätte schließlich, wenn auch zuerst nur ein wenig, nachgegeben, und
dann noch ein wenig nachgegeben, und sich am Ende überhaupt mit ihnen
ausgesöhnt – besonders wenn ihm seine Gegner feierlich zugestanden
hätten, daß er in seinem Recht sei. Daraufhin würde er sich ganz sicher
ausgesöhnt haben und vielleicht, wer konnte es wissen, vielleicht wäre
daraus eine neue Freundschaft entstanden, eine heiße, starke
Freundschaft, eine viel, viel größere Freundschaft, als die gestrige,
eine, durch die diese gestrige ganz verdunkelt worden wäre. So würde
denn zuletzt die Feindschaft zweier Menschen beseitigt gewesen sein, und
die beiden Titularräte konnten froh und glücklich miteinander leben –
hundert Jahre lang!
Um schließlich die Wahrheit zu sagen: Herr Goljädkin fing bereits an,
ein wenig zu bereuen, daß er für sich und sein Recht zu weit gegangen
sei und sich dafür nur Unannehmlichkeiten bereitet hatte. „Hätte er
nachgegeben,“ dachte Herr Goljädkin, „hätte er gesagt, daß alles das nur
Scherz sei“: Herr Goljädkin hätte ihm verziehen, ganz und gar verziehen,
zumal, wenn er es laut bekennen wollte! „Aber als einen Wischlappen
lasse ich mich nicht behandeln, besonders nicht von solchen Leuten. Oh,
und daß gerade ein so verworfener Mensch den Versuch mit mir macht! Ich
bin kein Lappen, nein, mein Herr, ich bin kein Lump!“ Kurz, unser Held
war zu allem entschlossen. „Sie selbst, mein Herr sind an allem schuld!“
Er beschloß also – zu protestieren, mit allen Kräften und bis zur
letzten Möglichkeit – zu protestieren.
Er war schon so ein Mensch! Er hätte es nie erlaubt, sich beleidigen und
noch viel weniger, sich „als Wischlappen“ benutzen zu lassen: „von einem
so verkommenen Menschen“! Darüber ließ sich nicht streiten, nein, nicht
streiten. Vielleicht, wenn es jemand gewollt hätte, Herrn Goljädkin „in
einen Lappen“ zu verwandeln, wäre es ihm ohne Widerspruch und ganz
ungestraft gelungen. (Herr Goljädkin fühlte das nämlich selbst
manchmal.) Doch wäre das dann gar nicht Herr Goljädkin gewesen, sondern
eben ... irgendein Lappen – wenn auch trotzdem kein so einfacher Lappen,
sondern einer voll von Ehrgeiz und voll von Gefühlen, allerdings ganz
unverantwortlichen Gefühlen, Gefühlen, die hinter den schmutzigen Falten
des Lappens steckten!
Die Stunden zogen sich unglaublich lange dahin. Endlich schlug es vier.
Bald darauf erhoben sich alle, um nach dem Vorgang des Chefs nach Hause
zu gehen. Herr Goljädkin mischte sich unter die Menge: es entging ihm
aber nichts, er verlor denjenigen, den er suchte, nicht aus den Augen.
Zuletzt sah unser Held, wie sein Freund zu den Kanzleidienern lief, die
die Mäntel ausgaben. In der Erwartung des Mantels schwänzelte er nach
seiner gemeinen Gewohnheit um sie herum. Der Augenblick war
entscheidend. Herr Goljädkin drängte sich irgendwie durch die Menge, da
er nicht zurückbleiben wollte, und bemühte sich auch um seinen Mantel.
Doch, natürlich: man gab seinem Freund zuerst den Mantel, weil es ihm
auch hier gelungen war, sich einzuschmeicheln.
Herr Goljädkin der Jüngere warf sich den Mantel um und blickte dabei
Herrn Goljädkin dem Älteren ironisch offen und frech ins Gesicht, um ihn
auf diese Weise zu ärgern. Dann sah er sich, seiner Gewohnheit gemäß,
rings um, bändelte mit allen Beamten an, wahrscheinlich, um auf sie
einen guten Eindruck zu machen, sagte dem einen ein Wort, flüsterte dem
andern etwas ins Ohr, schmeichelte einem dritten, lächelte einem vierten
zu, reichte dem fünften die Hand und schlüpfte vergnügt die Treppe
hinab. Herr Goljädkin der Ältere stürzte ihm nach, zu seiner
unbeschreiblichen Genugtuung erreichte er ihn auf der letzten Stufe und
packte ihn am Kragen seines Mantels.
Herr Goljädkin der Jüngere schien ein wenig überrascht zu sein und
blickte mit verstörtem Gesicht um sich.
„Wie soll ich das verstehen?“ flüsterte er endlich mit leiser Stimme
Herrn Goljädkin zu.
„Mein Herr, wenn Sie ein anständiger Mensch sind, so werden Sie sich
unserer freundschaftlichen Beziehungen von gestern erinnern,“ sagte
unser Held.
„Ach ja. Nun, wie steht’s? Haben Sie gut geschlafen?“
Die Wut raubte für einen Augenblick Herrn Goljädkin die Sprache.
„Ich habe – sehr gut geschlafen, mein Herr ... Doch erlauben Sie mir,
Ihnen zu sagen, daß Ihr Spiel sehr schlecht steht ...“
„Wer sagt das? Das sagen meine Feinde!“ antwortete hastig jener, der
sich auch Herr Goljädkin nannte, und befreite sich bei diesen Worten
ganz unerwartet aus den schwachen Händen des wirklichen Herrn Goljädkin.
Befreit stürzte er die Treppe hinunter, sah sich um und erblickte eine
Droschke – er lief auf sie zu, setzte sich hinein und war im Augenblick
den Augen des Herrn Goljädkin des Älteren verschwunden. Unser
verzweifelter und von allen verlassener Titularrat blickte sich zwar
auch um, fand aber keine Droschke mehr. Er wollte laufen, doch seine
Knie brachen zusammen. Mit verstörtem Gesicht und offenem Munde stützte
er sich kraftlos und gebrochen an eine Straßenlaterne und stand so
einige Augenblicke auf dem Trottoir. Herr Goljädkin schien wie
vernichtet zu sein, für ihn war wohl alles verloren ...
IX.
Alles, offenbar alles, sogar seine eigene Natur, hatte sich gegen Herrn
Goljädkin verschworen: doch war er noch auf den Füßen und unbesiegt! Ja
er fühlte es, noch war er unbesiegt und nach wie vor bereit zu kämpfen.
Er rieb sich mit solchem Gefühl und mit solcher Energie die Hände, als
er nach der ersten Betäubung zu sich kam, daß man schon beim bloßen
Anblick Herrn Goljädkins sofort darauf schließen konnte, daß er nicht
nachgeben würde. Übrigens, die Gefahr lag auf der Hand, war
offensichtlich; Herr Goljädkin fühlte das auch; doch wie sollte er ihr
entgegentreten, sie packen? – das war die Frage. Im Augenblick tauchte
sogar der Gedanke im Kopfe Herrn Goljädkins auf, „wie wenn er einfach
alles so ließe, auf alles verzichtete? Was wäre denn dabei? Nun, einfach
nichts! Ich werde für mich sein, als ob ich’s nicht wäre,“ dachte Herr
Goljädkin, „ich lasse alles so gehen, wie es geht; ich bin einfach nicht
ich, und das ist alles. Er ist auch für sich, mag er auch verzichten, er
schwänzelt herum und dreht sich, der Schelm – mag er doch nachgeben! Ja,
das ist es! Ich werde ihn mit Güte fangen. Und wo ist die Gefahr? Nun,
was für eine Gefahr denn? Ich wünschte, es zeigte mir jemand, worin denn
die Gefahr liegt? Eine einfache Sache! Eine ganz einfache Sache! ...“
Hier verstummte Herr Goljädkin. Die Worte erstarben ihm auf der Zunge;
er machte sich sogar Vorwürfe über diese Gedanken, er schalt sich feig
und niedrig; indessen, die Sache rührte sich nicht von der Stelle.
Er fühlte dabei, daß es für ihn von großer Notwendigkeit sei, sich für
etwas zu entschließen; ja, er hätte viel darum gegeben, wenn ihm jemand
gesagt, wozu er sich entschließen sollte. Wie sollte er das aber wissen!
Übrigens, da war ja auch gar nichts zu wissen! Auf jeden Fall und um
keine Zeit zu verlieren nahm er sich eine Droschke und fuhr so schnell
wie möglich nach Haus.
„Nun, wie fühlst du dich denn jetzt?“ dachte er bei sich, „wie erlauben
Sie sich jetzt zu fühlen, Jakoff Petrowitsch? Was tust du jetzt? Was
tust du jetzt, du Feigling, du Schurke, du! Hast dich selbst bis zum
letzten gebracht, jetzt heulst du und klagst du!“
So verspottete sich Herr Goljädkin selbst, als er in eine alte klapprige
Droschke stieg. Sich selbst zu verspotten und seine Wunde aufzureißen,
bereitete nämlich Herrn Goljädkin augenblicklich ein großes Vergnügen,
fast eine Genugtuung.
„Nun, wenn jetzt,“ dachte er, „irgendein Zauberer käme, oder wenn man
mir offiziell erklärte: gib, Goljädkin, einen Finger deiner rechten Hand
– und wir sind quitt; es wird keinen anderen Goljädkin geben und du
wirst wieder glücklich sein, nur deinen Finger wirst du nicht mehr haben
– so würde ich den Finger geben, würde ihn bestimmt geben, ohne auch nur
eine Miene zu verziehen. Zum Teufel mit alledem!“ schrie endlich der
Titularrat außer sich, „nun, wozu das alles? wozu ist das alles nötig
gewesen, warum mußte denn das gerade mir passieren und keinem anderen!
Und alles war so gut zu Anfang, alle waren zufrieden und glücklich: wozu
war denn gerade das jetzt nötig! Übrigens mit Worten wird hier nichts
erreicht, hier muß gehandelt werden.“
Und somit wäre Herr Goljädkin beinahe zu einem Entschluß gekommen, als
er in seine Wohnung trat. Er griff sofort nach der Pfeife, zog an ihr
aus allen Kräften und stieß nach rechts und links dicke Rauchwolken aus,
wobei er in außerordentlicher Erregung im Zimmer auf und ab lief.
Unterdessen begann Petruschka den Tisch zu decken. Endlich hatte Herr
Goljädkin seinen Entschluß gefaßt: er warf plötzlich seine Pfeife hin,
nahm den Mantel um, sagte, er werde nicht zu Hause speisen und lief
hinaus. Auf der Treppe holte ihn Petruschka keuchend ein und übergab ihm
den vergessenen Hut. Herr Goljädkin nahm den Hut und wollte sich noch
irgendwie, so nebenbei, vor den Augen Petruschkas rechtfertigen, damit
Petruschka sich nur nicht wegen dieses sonderbaren Umstandes, daß er den
Hut vergessen, seine Gedanken machte. Da Petruschka ihn aber nicht
einmal ansah und sofort zurückging, setzte auch Herr Goljädkin ohne
weitere Erklärungen seinen Hut auf, lief die Treppe hinunter und redete
sich Mut ein: daß sich alles vielleicht noch zum besten kehren werde und
die Sache sich noch beilegen ließe ... Doch Schüttelfrost packte ihn. Er
trat auf die Straße hinaus, nahm eine Droschke und fuhr zu Andrej
Philippowitsch.
„Übrigens, wäre es morgen nicht besser?“ dachte Herr Goljädkin, als er
die Klingel zur Wohnung Andrej Philippowitschs zog – „ja, und was hätte
ich ihm auch Besonderes zu sagen? Wirklich, nichts Besonderes. Die Sache
ist ja so erbärmlich, so miserabel, einfach zum Ausspeien! ... Was doch
nicht alles die Umstände machen ...“ und Herr Goljädkin zog plötzlich an
der Glocke; die Glocke ertönte, und von innen hörte man Schritte
nahen ... Jetzt verwünschte sich Herr Goljädkin selbst wegen
seiner Übereiltheit und Unverfrorenheit. Die jüngst erlebten
Unannehmlichkeiten, die Herr Goljädkin wohl kaum vergessen hatte, und
der Zusammenstoß mit Andrej Philippowitsch, – alles fiel ihm mit einem
Male wieder ein. Doch zum Fortlaufen war es nun bereits zu spät: die Tür
wurde geöffnet. Zum großen Glück des Herrn Goljädkin antwortete man ihm,
Andrej Philippowitsch sei von der Kanzlei nicht nach Hause zurückgekehrt
und werde auch außer dem Hause speisen.
„Ich weiß, wo er speist: bei der Ismailoffbrücke speist er,“ dachte bei
sich unser Held und war außer sich vor Freude. Auf die Anfrage des
Dieners, wen er melden solle, sagte er, Herr Goljädkin, schon gut, mein
Freund, schon gut, ich werde schon später wiederkommen, mein Freund, –
und er eilte darauf mit einer gewissen Freudigkeit und Behendigkeit die
Treppe hinab. Auf der Straße beschloß er, seine Droschke zu entlassen
und den Kutscher zu bezahlen. Als der Kutscher ihn noch um ein Trinkgeld
anging: „habe gewartet, Herr, lange gewartet, und meinen Gaul vorhin
nicht geschont ...“ da gab er ihm, und sogar mit großem Vergnügen, fünf
Kopeken Trinkgeld und ging zu Fuß weiter.
„Die Sache ist nämlich die,“ dachte Herr Goljädkin, „daß sie in
Wirklichkeit so nicht bleiben kann; wenn man’s sich aber überlegt, und
vernünftig überlegt – was ist denn eigentlich dabei zu machen? Man muß
sich unwillkürlich fragen, wozu sich quälen, wozu sich hier
herumschlagen? Die Sache ist nun einmal geschehen und nicht mehr
rückgängig zu machen! Überlegen wir uns einmal: es erscheint ein Mensch
– ein Mensch erscheint mit genügenden Empfehlungen, das heißt, ein
fähiger Beamter mit gutem Betragen, nur daß er arm ist und
Unannehmlichkeiten erlebt hat ... Aber, Armut ist kein Laster: ich muß
also abtreten. Nun, in der Tat, was ist das für ein Unsinn? Es hat sich
so gemacht, die Natur hat’s gewollt, daß ein Mensch dem andern, wie ein
Wassertropfen dem andern ähnlich sieht, der eine die vollendete Kopie
des anderen ist: sollte man ihn deshalb etwa _nicht_ anstellen, wenn das
Schicksal allein, wenn das blinde Glück allein daran schuld ist? Soll
man ihn deshalb wie einen Verworfenen behandeln und ihn nicht zum Dienst
zulassen? Wo bliebe denn da die Gerechtigkeit? So ein armer, verlorener
und geängstigter Mensch: da muß einem ja das Herz wehtun und das Mitleid
einen packen! Ja! Das wäre wohl eine schöne Obrigkeit, wenn sie so
gedacht hätte, wie ich es tue, ich Dummkopf! Nein, nein, und sie hat gut
getan, daß sie den armen Menschen versorgte ...“
„Nun, schön,“ fuhr Herr Goljädkin fort, „nehmen wir an, zum Beispiel,
wir seien Zwillinge, von der Natur so geschaffen, wie wir sind, nun ja,
und – das wäre einfach alles. Ja, das wäre alles! Nun, und was wäre denn
dabei? Einfach, nichts! Man könnte es ja allen Beamten mitteilen ...
und, wenn ein Fremder in unsere Abteilung käme, der würde auch sicher
nichts Unpassendes oder gar Beleidigendes in diesem Umstand sehen. Es
liegt darin sogar etwas Rührendes, der Gedanke, daß Gott dort zwei
Zwillinge geschaffen und die edle Obrigkeit, die das Gebot Gottes
achtet, sie beide versorgt hat. Freilich, freilich,“ und Herr Goljädkin
hielt den Atem an und senkte ein wenig seine Stimme, „freilich, freilich
wäre es besser, wenn all dies Rührende lieber nicht wäre und es lieber
überhaupt keine Zwillinge gäbe ... Der Teufel möge das alles holen! Wozu
war das alles nötig? Warum konnte es wenigstens nicht aufgeschoben
werden? Herr du meine Güte! Da hat der Teufel etwas Schönes eingebrockt!
Er hat einmal schon so einen Charakter, schlechte, verlogene Manieren, –
so ein Schuft, so ein Lump, so ein Schmeichler und Schmarotzer, so ein
Goljädkin! Er wird sich noch am Ende schlecht aufführen und meinen Namen
schänden, der Taugenichts, jetzt habe ich das Vergnügen, auf ihn
aufzupassen. Welch eine Strafe ist das! Übrigens, wozu habe ich das
nötig! Nun, er ist ein Taugenichts, ein Schuft ... mag er es sein, der
andere ist dafür ein – Ehrenmann. Er ist also der Schuft, ich aber bin
der Anständige! Nun, dann werden sie sagen: – dieser Goljädkin ist ein
Schuft, auf den achtet nicht und verwechselt ihn nicht mit dem anderen;
der andere aber ist ehrlich und tugendhaft, bescheiden und nicht
boshaft, sehr gut im Dienste und würdig einer Rangerhöhung: so ist’s!
Nun gut ... aber wie haben sie ihn denn da ... so verwechselt!
Ach, du mein Gott! Was für ein Unglück das ist! ...“
Mit diesen Gedanken beschäftigt und sich alles hin und her überlegend,
lief Herr Goljädkin immer weiter, ohne auf den Weg zu achten, und ohne
eigentlich zu wissen, wohin? Erst auf dem Newskij Prospekt kam er zu
sich und auch nur dank dem Zufall, daß er mit einem Vorübergehenden so
zusammenstieß, daß vor seinen Augen Funken sprühten. Herr Goljädkin
wagte kaum den Kopf zu erheben und murmelte nur eine Entschuldigung.
Erst als der andere schon in einer bedeutenden Entfernung von ihm war,
wagte er endlich seine Nase zu erheben und sich umzusehen: wie und wo er
sich eigentlich befand? Als er nun bemerkte, daß er gerade vor dem
Restaurant stand, in dem er sich damals erfrischt hatte, bevor er sich
zur Galatafel bei Olssuph Iwanowitsch aufmachte, fühlte unser Held
plötzlich ein mächtiges Kneifen und Rumoren im Magen. Er erinnerte sich,
daß er noch nichts genossen hatte, daß ihm auch kein ähnliches Diner
bevorstand, wie damals, und so lief er denn eilig die Treppe zum
Restaurant hinauf, um so schnell wie möglich und unbemerkt eine
Kleinigkeit zu sich zu nehmen. Obgleich das Restaurant ein wenig teuer
war, beschäftigte dieser kleine Umstand Herrn Goljädkin nicht im
geringsten: sich mit solchen Kleinigkeiten abzugeben, hatte Herr
Goljädkin jetzt keine Zeit. Im hell erleuchteten Raum auf dem Büfett lag
eine große Anzahl Delikatessen aller Art, die dem Geschmack eines
verwöhnten Großstädters entsprachen. Das Büfett war daher ständig von
einer Menge wartender Menschen belagert. Der Kellner konnte kaum mit dem
Eingießen, Geldempfangen und -zurückgeben fertig werden. Auch Herr
Goljädkin mußte seine Zeit abwarten und streckte endlich seine Hand
bescheiden nach einem Teller mit kleinen Pasteten aus. Dann ging er
damit in eine Ecke, wandte den Anwesenden den Rücken zu und aß mit
Appetit. Darauf ging er zum Büfett zurück, legte das Tellerchen auf den
Tisch und da er den Preis kannte, so legte er dafür 10 Kopeken daneben,
machte dem Kellner ein Zeichen, als wollte er sagen: „hier liegt das
Geld für eine Pastete usw.“
„Sie haben einen Rubel und zehn Kopeken zu bezahlen,“ sagte der Kellner.
Herr Goljädkin war nicht wenig erstaunt. „Wie meinen Sie das? – Ich ...
ich ... habe, glaube ich, nur eine Pastete genommen ...“
„Sie haben elf genommen,“ sagte mit der größten Bestimmtheit der
Kellner.
„Wie ... wie mir scheint ... irren Sie sich ... Ich habe, glaube ich,
wirklich nur eine Pastete genommen.“
„Ich habe nachgezählt: Sie nahmen elf Stück. Was Sie genommen haben,
müssen Sie auch bezahlen – bei uns wird nichts umsonst verabfolgt.“
Herr Goljädkin war einfach starr. „Welche Zaubereien gehen mit mir jetzt
wieder vor?“ dachte er. Der Kellner wartete gespannt auf Herrn
Goljädkins Entschluß. Herr Goljädkin lenkte bereits die Aufmerksamkeit
aller auf sich. Er griff daher so schnell wie möglich in die Tasche, um
den Silberrubel sofort zu bezahlen und von der Schuld loszukommen.
„Nun, wenn elf, dann elf,“ dachte er und wurde rot wie ein Krebs, „was
ist denn auch dabei, wenn man elf Pastetchen ißt? Nun, der Mensch war
eben hungrig, und darum aß er elf Pastetchen: nun, er aß sie zu seiner
Gesundheit – da ist doch nichts zu verwundern, dabei ist doch nichts
Lächerliches ...“
Plötzlich gab es Herrn Goljädkin innerlich einen Ruck, er blickte auf
und begriff sofort – das ganze Rätsel, die ganze Zauberei! In der Tür
zum Nebenzimmer, hinter dem Rücken des Kellners, mit dem Gesicht zu
Herrn Goljädkin gewandt, stand in derselben Tür, die unser Held vorhin
als Spiegelglas angesehen, stand ein Mensch, stand er, stand Herr
Goljädkin selbst – nicht der alte Herr Goljädkin, der Held unserer
Erzählung, sondern der andere Herr Goljädkin, der neue Herr Goljädkin.
Dieser andere Herr Goljädkin befand sich offenbar in der allerbesten
Laune. Er lächelte Herrn Goljädkin dem Älteren zu, nickte mit dem Kopf,
zwinkerte mit den Augen, trippelte ein wenig hin und her und sah ganz so
aus, als ob er, wenn man auf ihn zutreten wollte, sofort ins Nebenzimmer
verschwinden und dort durch die Hintertür entwischen würde ... – jede
Verfolgung wäre vergebens gewesen! In seinen Händen befand sich noch das
letzte Stück Pastete, welches er soeben vor den Augen des Herrn
Goljädkin vor Vergnügen schmatzend in seinen Mund steckte.
„Man hat mich mit dem Halunken verwechselt!“ dachte Herr Goljädkin und
fühlte, wie er sich schämte. „Er hat es gewagt mich öffentlich
bloßzustellen! Sieht ihn denn niemand? Nein, es scheint ihn wirklich
niemand zu bemerken ...“
Herr Goljädkin warf den Rubel auf den Tisch, als hätte er sich an ihm
alle Finger verbrannt, und schien das freche Lächeln des Kellners gar
nicht zu bemerken – dieses siegesbewußte Lächeln ruhiger Überlegenheit
und Macht. Er drängte sich durch die Menge und stürzte zur Tür hinaus.
„Gott sei gelobt, daß ich nicht noch ganz anders bloßgestellt wurde!“
dachte Herr Goljädkin der Ältere. „Dank ihm, dem Räuber, und Dank dem
Schicksal, daß diesmal noch alles so gut abging. Nur der Kellner wurde
frech, aber er war doch in seinem Recht! Es kostete doch einen Rubel und
zehn Kopeken, also war er doch im Recht – ... ohne Geld wird niemandem
etwas gegeben! Wenn er auch noch so höflich ...“
Alles das sagte sich Herr Goljädkin, als er die Treppe hinabging. Kaum
aber war er an der letzten Stufe angelangt, als er plötzlich wie
angewurzelt stehen blieb und über und über errötete, daß ihm die Tränen
in die Augen traten. So sehr fühlte er sich nun doch in seiner Eitelkeit
verletzt. Als er eine Minute in dieser Weise unbeweglich dagestanden
hatte, stampfte er plötzlich mit dem Fuße auf, sprang mit einem Satz von
der Treppe auf die Straße und ohne sich umzusehen, ohne seine Müdigkeit
zu fühlen, begab er sich nach Haus, in die Schestilawotschnaja-Straße.
Zu Hause angelangt, nahm er sich nicht einmal die Zeit, seinen Mantel
auszuziehen. Ganz gegen seine sonstige Gewohnheit, sich häuslich
niederzulassen und seine Pfeife zu rauchen, setzte er sich, so wie er
war, auf den Diwan, nahm Tinte und Feder und ein Stück Briefpapier und
begann mit vor innerer Erregung zitternden Händen folgenden Brief zu
schreiben:
„Mein geehrter Herr Jakoff Petrowitsch!
Ich würde nicht zur Feder greifen, wenn nicht die Umstände und Sie,
geehrter Herr, mich dazu nötigten. Glauben Sie mir, daß nur die
Notwendigkeit mich dazu zwingt, in solche Erörterungen mit Ihnen
einzutreten, darum bitte ich Sie im voraus, diese meine Handlung
nicht als eine Absicht zu betrachten, Sie, mein verehrter Herr zu
beleidigen, sondern – sondern als eine unumgängliche Folge der
Umstände, die uns zueinander in Beziehung gebracht haben.“
„So scheint es mir gut, anständig und höflich geschrieben zu sein,
wenn auch nicht ohne Kraft und Bestimmtheit ... Beleidigt kann er
sich dadurch nicht fühlen. Und außerdem, bin ich in meinem Recht,“
dachte Herr Goljädkin beim Durchlesen des Geschriebenen.
„Ihr unerwartetes und seltsames Erscheinen, mein geehrter Herr, in
der stürmischen Nacht, nach einem ausfallenden und rohen Benehmen
meiner Feinde gegen mich, deren Namen ich aus Verachtung derselben
verschweige, war die Ursache aller dieser Mißverständnisse, die in
gegenwärtiger Zeit zwischen uns bestehen. Ihr hartnäckiges
Bestreben, mein geehrter Herr, mit aller Gewalt in mein Sein und in
meinen Lebenskreis einzudringen, übersteigt alle Grenzen der
Höflichkeit und des einfachen Anstandes. Ich denke, es genügt, Sie
daran zu erinnern, mein verehrter Herr, daß Sie sich meiner Papiere
und meines Namens bedient haben, um sich bei der Regierung
einzuschmeicheln – um eine Auszeichnung zu erlangen, die Sie selbst
nicht verdient haben. Auch lohnt es sich nicht, Sie an Ihre
vorbedachte, beleidigende Absicht zu erinnern, der nötigen
Rechtfertigung mir gegenüber aus dem Wege zu gehen. Und zuletzt, um
nicht alles zu sagen, möchte ich noch Ihre sonderbare Handlungsweise
im Restaurant mir gegenüber erwähnen. Weit davon entfernt, etwa die
unnötige Ausgabe eines Rubels zu bedauern, fühle ich doch einen
heftigen Unwillen bei der Erinnerung an Ihre deutliche Absicht, mein
geehrter Herr, meiner Ehre zu schaden, und das noch dazu in
Gegenwart einiger Personen, die mir zwar unbekannt, aber offenbar
aus der guten Gesellschaft waren ...“
„Bin ich nicht zu weit gegangen?“ dachte Herr Goljädkin. „Wird das
nicht zu viel sein? Ist das nicht beleidigend – diese Anspielung auf
die gute Gesellschaft zum Beispiel? Nun, da ist nichts zu wollen!
Man muß ihm Charakter zeigen. Übrigens kann man ihm zur Besänftigung
zum Schluß ein wenig schmeicheln, ihm Butter aufs Brot schmieren.
Wir wollen sehen.“
„Doch ich hätte, verehrter Herr, Sie mit meinem Brief nicht
belästigt, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, daß Ihr edles Herz
und Ihr offener und gerader Charakter Ihnen selbst die Mittel zeigen
werden, um alles wieder so gut zu machen, wie es vordem gewesen ist.
In dieser Hoffnung wage ich davon überzeugt zu sein, daß Sie meinen
Brief nicht in beleidigendem Sinne auffassen werden, daß Sie aber
auch nicht verfehlen werden, mir schriftlich eine Erklärung, durch
die Vermittelung meines Dieners, zukommen zu lassen.
In dieser Erwartung habe ich die Ehre zu sein, geehrter Herr, Ihr
gehorsamster Diener.
J. Goljädkin.“
„Nun, das wäre jetzt alles sehr gut. Die Sache wäre also erledigt: die
Sache ging nun schon bis zu schriftlichen Erklärungen. Aber wer ist
schuld daran? Er selbst ist schuld daran: er bringt einen Menschen so
weit, eine schriftliche Erklärung zu verlangen. Und ich bin in meinem
Recht ...“
Nachdem Herr Goljädkin noch einmal den Brief durchgelesen hatte, faltete
er ihn zusammen, adressierte ihn und rief dann Petruschka. Petruschka
erschien wie immer mit verschlafenen Augen und bei sehr schlechter
Laune.
„Du, mein Lieber, nimm diesen Brief ... verstehst du?“
Petruschka schwieg.
„Du nimmst ihn und bringst ihn ins Departement, dort suchst du den
diensttuenden Beamten auf, den Verwaltungssekretär Wachramejeff.
Wachramejeff hat heute den Tagdienst. Verstehst du das?“
„Verstehe.“
„‚Verstehe!‘ kannst du das nicht höflicher sagen. Du fragst also nach
dem Beamten Wachramejeff und sagst ihm: so und so, der Herr hat
befohlen, Sie von ihm zu grüßen und bittet Sie gefälligst, im
Adressenregister unserer Behörde nachzuschlagen, wo der Titularrat
Goljädkin wohnt?“
Petruschka schwieg, und wie es Herrn Goljädkin schien, lächelte er.
„Nun also, Pjotr, du fragst ihn nach seiner Adresse und wo der
neueingetretene Beamte Goljädkin wohnt: verstehst du?“
„Ich verstehe.“
„Du fragst nach der Adresse und bringst nach dieser Adresse diesen
Brief: verstehst du?“
„Ich verstehe.“
„Wenn du dort bist ... dort, wohin du diesen Brief bringst, so wird
dieser Herr, dem du diesen Brief gibst, Herr Goljädkin also ... Was
lachst du, Schafskopf?“
„Warum soll ich lachen? Was geht’s mich an! Ich habe nichts ...
unsereins hat nichts zu lachen ...“
„Nun also ... wenn dann der Herr dich fragen sollte, wie es mit deinem
Herrn steht ... wenn er dich also irgendwie ausfragen möchte – so
schweigst du und antwortest nur: ‚Meinem Herrn geht es gut, er bittet um
eine schriftliche Antwort auf seinen Brief.‘ Verstehst du?“
„Verstehe.“
„Also, fort mit dir.“
„Da hat man seine Mühe mit solch einem Schafskopf! Er lacht. Warum lacht
er denn? Es wird von Tag zu Tag immer schlimmer mit ihm, wie wird das
schließlich ... Ach, vielleicht wird sich doch noch alles zum Guten
wenden ... Dieser Schuft wird sich sicher jetzt noch zwei Stunden
herumtreiben oder überhaupt nicht mehr zurückkommen ... Man kann ihn ja
nirgendwohin schicken. Welch ein Unglück das ist ... welch ein Unglück!
...“
Unser Held entschloß sich also im Vollgefühl seines ganzen Unglücks, zu
der passiven Rolle einer zweistündigen Erwartung Petruschkas. Eine
Stunde lang ging er im Zimmer auf und ab, rauchte, warf dann wieder
seine Pfeife weg und griff nach einem Buch. Darauf legte er sich auf den
Diwan, griff dann wieder zur Pfeife und lief dann wieder im Zimmer auf
und ab ... Er wollte sich’s überlegen, konnte aber seine Gedanken nicht
zusammenhalten. Endlich ertrug er diesen aufreibenden Zustand nicht
länger, und Herr Goljädkin beschloß bei sich, lieber wieder zu handeln.
„Petruschka wird vor einer Stunde nicht zurückkommen,“ dachte er, „ich
kann also den Schlüssel dem Hausknecht geben – und selbst werde ich
unterdessen ... der Sache auf die Spur kommen und meinerseits etwas für
sie tun.“
Ohne Zeit zu verlieren, griff Herr Goljädkin nach seinem Hut, verließ
das Zimmer, schloß seine Wohnung zu, ging zum Hausknecht, händigte dem
den Schlüssel ein, zusammen mit zehn Kopeken Trinkgeld – Herr Goljädkin
wurde in letzter Zeit ungeheuer freigebig – und ging – ging, wohin ihn
der Weg führte. Er ging zu Fuß in die Richtung der Ismailoffbrücke.
Der Gang dauerte eine halbe Stunde. Als er das Ziel seiner Wanderung
erreicht hatte, ging er geradeaus auf den Hof des ihm bekannten Hauses
und blickte zu den Fenstern der Wohnung des Staatsrats Berendejeff
hinauf. Mit Ausnahme von dreien, mit roten Vorhängen verhangenen
Fenstern waren die übrigen alle dunkel.
„Bei Olssuph Iwanowitsch gibt es heute keine Gäste,“ dachte Herr
Goljädkin, „sie werden wohl jetzt allein zu Hause sitzen.“
Nachdem unser Held einige Zeit auf dem Hof gestanden hatte, wollte er
sich augenscheinlich zu etwas entschließen. Aber es sollte anders
kommen. Herr Goljädkin winkte mit der Hand ab und kehrte zurück auf die
Straße.
„Nein, nicht hierher hatte ich zu gehen! Was soll ich denn hier machen?
... Ich werde besser tun ... selbst die Sache zu untersuchen.“ Mit
diesem Entschluß begab sich Herr Goljädkin in sein Departement. Der Weg
war nicht kurz, dazu war er furchtbar schmutzig und nasser Schnee fiel
in dichten Flocken, doch für unseren Helden schien es keine Hindernisse
mehr zu geben. Er war nicht wenig ermüdet und ganz und gar durchnäßt und
beschmutzt, „wenn schon, denn schon: das heißt, wenn man das Ziel
erreichen will!“ Und Herr Goljädkin näherte sich in der Tat bald seinem
Ziele. Die dunkle Masse eines großen, öffentlichen Gebäudes stieg in der
Ferne vor ihm auf.
„Halt!“ dachte er, „wohin gehe ich und was werde ich hier machen? Nehmen
wir an, ich erfahre, wo er wohnt; unterdessen wird Petruschka bereits
zurückgekehrt sein und mir die Antwort gebracht haben. Ich verliere nur
meine teure Zeit umsonst, ganz umsonst. Nun, tut nichts, man kann alles
wieder gut machen ... Ach, es war überhaupt nicht nötig, auszugehen!
Aber so bin ich nun einmal. Ob es nötig ist oder nicht, ich muß immer
vorauslaufen ... Hm! ... Wieviel Uhr ist es? Sicherlich schon neun Uhr.
Petruschka könnte kommen und mich nicht zu Hause antreffen. Ich habe
wirklich eine Dummheit begangen, daß ich ausging ... Ach, wirklich,
diese Konfusion!“
Nachdem unser Held auf diese Weise zur Überzeugung gekommen war, daß er
eine Dummheit begangen, lief er sofort zurück zu seiner
Schestilawotschnaja-Straße. Erschöpft und durchnäßt kam er dort an und
erfuhr schon vom Hausknecht, daß Petruschka nicht einmal daran gedacht
hatte, wieder auf der Bildfläche zu erscheinen.
„Nun ja, das habe ich ja geahnt –,“ dachte unser Held: „Und dabei ist es
schon neun Uhr! Solch ein Taugenichts! Immer muß er sich betrinken! Herr
du meine Güte! Zum Unglück habe ich ihm schon seinen Lohn bezahlt, damit
er Geld in den Händen hat.“
Mit diesen Gedanken schloß Herr Goljädkin seine Wohnung auf, machte
Licht, kleidete sich aus, steckte seine Pfeife an und müde, zerschlagen,
hungrig, wie er war, legte er sich in Erwartung Petruschkas auf den
Diwan. Düster brannte die Kerze und ihr Licht flackerte an den Wänden
... Herr Goljädkin starrte vor sich hin, dachte und dachte und schlief
endlich ein, wie tot.
Er erwachte sehr spät. Das Licht war ganz niedergebrannt und flammte
noch hin und wieder auf, um dann ganz zu erlöschen. Herr Goljädkin
sprang auf, ihn schauerte, und plötzlich erinnerte er sich an alles, mit
einem Male an alles! Hinter dem Verschlag hörte man Petruschka
schnarchen. Herr Goljädkin stürzte ans Fenster – nirgendwo ein Licht zu
sehen. Er öffnete das Fenster – alles war totenstill. Die Stadt schlief.
Es mußte zwei oder drei Uhr nachts sein ... richtig, die Uhr hinter dem
Verschlag schlug zwei. Herr Goljädkin stürzte in den Verschlag.
Irgendwie, nach langen Anstrengungen, gelang es ihm, Petruschka zu
wecken und ihn im Bett aufzurichten. In diesem Augenblick verlöschte das
Licht vollkommen. Es vergingen zehn Minuten, bis Herr Goljädkin ein
anderes Licht fand und es anzündete. In der Zeit war aber Petruschka von
neuem eingeschlafen.
„Ach, du Halunke, du Taugenichts!“ schimpfte ihn Herr Goljädkin und
rüttelte ihn wieder auf. „Wirst du wohl aufwachen, wirst du wohl
aufstehen!“ Nach halbstündiger Anstrengung gelang es Herrn Goljädkin,
seinen Diener vollständig aufzuwecken und ihn aus dem Verschlag
herauszuziehen. Da erst bemerkte unser Held, daß Petruschka vollkommen
betrunken war und sich kaum auf den Füßen halten konnte.
„Du Taugenichts!“ schrie Herr Goljädkin, „du Lump! Am liebsten würdest
du mir wohl, weiß der Himmel was antun! Gütiger Gott, wo hast du den
Brief gelassen? Ach, du meine Güte, was ist nur aus ihm geworden ... Und
warum habe ich ihn geschrieben? Da stehe ich nun mit meinem Ehrgeiz.
Wozu stecke ich meine Nase da hinein! Das habe ich davon ... Und du, du
Räuber, wohin hast du den Brief gesteckt? Wem hast du ihn abgegeben?
...“
„Ich habe niemandem einen Brief gegeben, und habe überhaupt keinen Brief
gehabt ... so ist’s!“
Herr Goljädkin rang seine Hände vor Verzweiflung.
„Höre, Pjotr ... höre ... höre mich an ...“
„Ich höre ...“
„Wohin bist du gegangen? Antworte ...“
„Wohin ich gegangen ... zu guten Menschen bin ich gegangen! Was ist denn
dabei?“
„Ach, du mein grundgütiger Gott! Wohin gingst du zuerst? Warst du in der
Kanzlei? ... Du, höre mich an, Pjotr: du bist vielleicht betrunken?“
„Ich betrunken? Da soll ich doch gleich auf der Stelle ...“
„Nein, nein, das tut ja nichts, daß du betrunken bist ... Ich fragte ja
nur so ... gut, gut, daß du betrunken bist: ich meinte ja nur,
Petruschka ... Du hast vielleicht vorhin alles vergessen und erinnerst
dich jetzt ... Nun, denke nach, du warst vielleicht bei Wachramejeff –
warst du oder warst du nicht?“
„Ich war nicht und solchen Beamten gibt es gar nicht. Und wenn man mich
auch sogleich ...“
„Nein, nein, Pjotr! Nein, Petruschka, ich sage ja nichts. Du siehst
doch, daß ich nichts ... Nun, was ist denn dabei? Nun, draußen war es
kalt, feucht und der Mensch trinkt ein wenig, nun, und was will denn das
besagen? Ich bin doch nicht böse deshalb. Ich selbst habe heute etwas
getrunken, mein Lieber. Gestehe es nur ein, denke nur nach, mein Lieber,
warst du heute beim Wachramejeff?“
„Nun, wenn es so ist, mein Wort darauf ... ich war da ... und wenn ich
auch sogleich ...“
„Nun, gut, gut, Petruschka, wenn du dagewesen bist. Siehst du, ich
ärgere mich doch nicht ... Nu, nu,“ fuhr unser Held fort, seinen Diener
aufzurütteln, schüttelte ihn an der Schulter, lächelte ihm zu ... „nun,
und da hast du ein Schlückchen getrunken, du Taugenichts, nur ein wenig
... für zehn Kopeken ein Schlückchen? Du Saufbold! Nun, tut nichts.
Siehst du, daß ich nicht böse bin ... Hörst du, ich bin gar nicht böse
darüber, mein Lieber ...“
„Nein, wie Sie wollen, ich bin aber doch kein Saufbold. Bei guten
Menschen bin ich gewesen, denn ich bin kein Säufer, bin niemals ein
Säufer gewesen ...“
„Nun, schön, Petruschka! Höre doch, Pjotr: ich will dich ja auch gar
nicht schimpfen, wenn ich dich einen Säufer nenne. Ich habe dir das nur
zur Beruhigung gesagt, in einem versöhnlichen Sinne habe ich es dir
gesagt. Wenn man einen Menschen in diesem Sinne schimpft, so fühlt er
sich geschmeichelt, Petruschka. Ein anderer liebt es sogar! ... Nun,
Petruschka, sage mir jetzt aufrichtig, wie einem Freunde ... warst du
beim Wachramejeff, und gab er dir die Adresse?“
„Und auch die Adresse gab er, auch die Adresse. Ein guter Beamter ist
er! ‚Und dein Herr,‘ sagte er, ‚auch dein Herr ist ein guter Mensch. Und
also sage ihm ... ich lasse deinen Herrn grüßen,‘ sagte er, ‚und sage
ihm, ich liebe und verehre deinen Herrn, weil dein Herr,‘ sagt er, ‚ein
guter Mensch ist, und du, Petruschka, bist auch ein guter Mensch, siehst
du‘ ...“
„Ach, du mein Gott! Und die Adresse, die Adresse! Judas du!“ Die letzten
Worte sprach Herr Goljädkin fast flüsternd.
„Und die Adresse ... auch die Adresse hat er gegeben.“
„Nun, wo wohnt er denn, der Beamte Goljädkin, der Titularrat Goljädkin?“
„‚Goljädkin wohnt,‘ sagt er, ‚in der Schestilawotschnaja-Straße. So wie
du in die Schestilawotschnaja eintrittst,‘ sagt er, ‚so wohnt er rechts
die Treppe hinauf, im vierten Stock. Dort,‘ sagt er, ‚wohnt Goljädkin
...‘“
„Bandit, du!“ schrie ihn unser Held an, der endlich die Geduld verlor:
„Du Taugenichts! Das bin doch ich, das bin ja ich, von dem du sprichst.
Da ist aber ein anderer Goljädkin, und von diesem anderen spreche ich,
du Räuber, du!“
„Nun, wie Sie wollen! Was geht’s mich an! Wie Sie wollen! ...“
„Aber der Brief, der Brief? ...“
„Welcher Brief? Es war ja gar kein Brief, ich habe keinen Brief
gesehen.“
„Wohin hast du ihn denn gelegt, du Halunke, du!?“
„Ich habe ihn abgegeben, den Brief habe ich abgegeben. ‚Grüße ihn,‘ sagt
er, ‚grüße und danke deinem Herrn. Grüße,‘ sagt er, ‚deinen Herrn ...‘“
„Wer hat denn das gesagt? Hat Goljädkin das gesagt?“
Petruschka schwieg ein wenig, dann grinste er übers ganze Gesicht und
sah seinem Herrn gerade in die Augen.
„Hörst du, du Räuber!“ begann Herr Goljädkin, schnaubend vor Wut, „was
hast du mit mir gemacht? Sage doch, sage, was hast du mit mir gemacht?
Du hast mich vernichtet, du Bösewicht! Hast mir meinen Kopf von den
Schultern gerissen. So ein Judas!“
„Nun, wie Sie wollen! Was geht das mich an?“ sagte in bestimmtem Tone
Petruschka und zog sich hinter seine Scheidewand zurück.
„Komm her, hierher, du Räuber! ...“
„Nun, ich komme jetzt nicht mehr zu Ihnen, überhaupt nicht mehr. Was
geht’s mich an! Ich gehe zu den guten Menschen ... Gute Menschen, die
ehrlich und ohne Falsch leben und niemals doppelt sind ...“ Herrn
Goljädkin erstarrten die Füße und Hände und der Atem ging ihm aus ...
„J–a–a,“ fuhr Petruschka fort, „die sind nicht doppelt und beleidigen
nicht Gott und die Menschen!“
„Du Taugenichts, du bist ja betrunken! Du gehe jetzt lieber schlafen, du
Räuber! Aber morgen werde ich dir schon zeigen! ...“ sagte Herr
Goljädkin mit kaum hörbarer Stimme. Petruschka murmelte auch noch etwas:
dann hörte man nur noch, wie er sich aufs Bett legte, daß es in allen
Fugen krachte, wie er laut gähnte und sich ausstreckte, und dann, wie
man sagt, den Schlaf des Gerechten schlief und mächtig schnarchte.
Herr Goljädkin war mehr tot als lebendig. Das Betragen Petruschkas,
seine sonderbaren, wenn auch sehr entfernten Anspielungen, über die man
sich „folglich nicht zu ärgern braucht“, um so weniger, da er betrunken
war, und schließlich die ganze bösartige Wendung, die die Sache nahm –
alles das erschütterte Herrn Goljädkin bis auf den Grund.
„Und was plagte mich, ihn mitten in der Nacht zu wecken?“ fragte sich
unser Held, am ganzen Körper vor krankhafter Erregung zitternd, „und was
plagte mich, mit einem betrunkenen Menschen anzubändeln! Und was kann
man denn von einem betrunkenen Menschen erwarten? Jedes Wort ist ja
gelogen! Worauf spielte er eigentlich an, dieser Räuber? Mein Gott, mein
Gott! Und wozu habe ich alle diese Briefe geschrieben, ich Selbstmörder,
ich Selbstmörder! Konnte ich denn nicht schweigen?! Mußte es denn
geschehen? Wozu denn? Mein Ehrgeiz wird mich noch umbringen. Wenn aber
meine Ehre leidet – seine Ehre muß man doch retten! Ach, ich
Selbstmörder, ich!“
So sprach Herr Goljädkin, auf seinem Diwan sitzend, und wagte sich vor
Furcht kaum zu bewegen. Plötzlich fielen seine Augen auf einen
Gegenstand, der seine Aufmerksamkeit im höchsten Grade erregte. In der
Furcht, es könnte eine Illusion, eine Täuschung seiner Phantasie sein,
wagte er kaum, vor Hoffnung, Angst und unbeschreiblicher Neugier, seine
Hand danach auszustrecken. Nein, es war keine Täuschung, es war
Wirklichkeit. Keine Illusion! Der Brief war ein Brief, ein wirklich an
ihn adressierter Brief. Herr Goljädkin griff nach dem Brief auf dem
Tisch. Sein Herz schlug heftig.
„Wahrscheinlich hat ihn dieser Schuft gebracht,“ dachte er, „hat ihn
dort hingelegt und ihn dann vergessen; so wird es wohl gewesen sein,
sicher wird es so gewesen sein ...“
Der Brief war von Wachramejeff, jenem Beamten und ehemaligen Freunde
Goljädkins.
„Das habe ich übrigens alles geahnt,“ dachte unser Held, „und alles, was
im Briefe hier stehen wird, habe ich ebenfalls geahnt ...“ Der Brief
lautete folgendermaßen:
„Sehr geehrter Herr Jakoff Petrowitsch!
Ihr Diener ist betrunken und es läßt sich nichts Gescheites aus ihm
herausbringen. Aus dem Grunde ziehe ich es vor, Ihnen schriftlich zu
antworten.
Ich beeile mich, Ihnen mitzuteilen, daß ich bereit bin, Ihren
Auftrag, den mir übergebenen Brief an eine gewisse Person zu
befördern, mit aller Gewissenhaftigkeit und Treue auszuführen. Diese
Person, die Ihnen sehr bekannt ist, und ein mir untreu gewordener
Freund, dessen Namen ich verschweigen will (denn ich möchte nicht
unnütz dem Ruf eines unschuldigen Menschen schaden!) wohnt mit uns
zusammen in der Wohnung Karolina Iwanownas, und zwar in demselben
Zimmer, in dem früher, als Sie noch bei uns waren, der
Infanterieoffizier aus Tamboff lebte. Diese Person gehört zu den
ehrlichen Leuten, zu denen, die ein aufrichtiges Herz haben, was man
bekanntlich nicht bei allen findet. Die Bekanntschaft mit Ihnen
beabsichtige ich von heute ab vollständig abzubrechen, in dem
freundschaftlichen Verhältnis, in dem wir früher miteinander
verkehrten, können wir nicht mehr zueinander stehen, und darum bitte
ich Sie, sehr geehrter Herr, beim Empfang dieses meines aufrichtigen
Briefes, mir unverzüglich die mir zukommenden zwei Rubel für das
Rasiermesser ausländischen Fabrikats, das ich Ihnen verschaffte, zu
schicken. Wie Sie sich erinnern werden, hatte ich es Ihnen bereits
vor sieben Monaten auf Abzahlung überlassen, und zwar noch zu der
Zeit, als Sie mit uns zusammen bei Karolina Iwanowna lebten, die ich
von ganzem Herzen achte und verehre. Ich tue es aus dem Grunde, da
Sie, nach der Behauptung kluger Leute, Ihre Selbstbeherrschung und
Ihren guten Ruf verloren haben und der Verkehr mit Ihnen für junge,
sittsame und unverdorbene Menschen daher sehr gefährlich geworden
ist. Denn manche Leute leben nicht in Ehrbarkeit und dazu sind ihre
Worte falsch und ihre wohlanständige Haltung ist verdächtig. Es wird
immer Leute geben, die sich der Verteidigung von Karolina Iwanowna
annehmen werden, die stets von gutem Betragen und eine ehrbare Dame
gewesen ist und die dazu ein Mädchen, wenn auch nicht von jungen
Jahren, so doch aus anständiger ausländischer Familie ist. Man hat
mich gebeten, Ihnen dieses von mir aus in meinem Briefe beiläufig in
Erinnerung zu bringen. Auf jeden Fall werden Sie schon alles zu
seiner Zeit erfahren, falls Sie es bis jetzt noch nicht erfahren
haben sollten, obgleich Sie nach Aussagen verständiger Leute an
allen Enden der Residenz in schlechtem Rufe stehen, und wenigstens
an vielen Stellen Auskunft über sich selbst, geehrter Herr, erhalten
können.
Zum Schluß teile ich Ihnen noch mit, sehr geehrter Herr, daß die
Ihnen bekannte Person, deren Namen ich aus wohlbegründeten Ursachen
hier nicht erwähnen möchte, von allen wohlgesinnten Menschen sehr
geachtet wird. Überdies ist sie von angenehmem, heiterem Charakter,
in ihrem Beruf wie unter den Menschen sehr beliebt, treu ihrem Wort
und jeder Freundschaft, wie sie denn niemals diejenigen beleidigt
und verleumdet, mit denen sie sich in freundschaftlicher Beziehung
befindet.
Immerhin verbleibe ich Ihr ergebenster Diener
N. Wachramejeff.
P. S. Ihren Diener jagen Sie fort: er ist ein Trinker und wird Ihnen
aller Wahrscheinlichkeit nach viel zu schaffen machen. Nehmen Sie
doch Eustachius, der früher hier bei mir diente und gegenwärtig
stellenlos ist. Ihr Diener ist ja nicht nur ein Trinker, er ist auch
ein Dieb, denn noch in der vorigen Woche hat er Karolina Iwanowna
ein Pfund Zucker zu billigerem Preise verkauft, das er, meiner
Meinung nach, nur in kleinen Portionen zu verschiedener Zeit von
Ihnen gestohlen haben kann. Ich schreibe es Ihnen, da ich Ihnen
Gutes wünsche, ungeachtet dessen, daß manche Personen nur zu
beleidigen und die Menschen zu betrügen verstehen, besonders
anständige Leute von gutem und ehrlichem Charakter. Außerdem
versuchen sie diese noch hinter dem Rücken schlecht zu machen, und
zwar nur aus Neid, weil sie sich selbst zu ihnen nicht rechnen
können.
W.“
Nachdem unser Held den Brief Wachramejeffs gelesen hatte, blieb er noch
lange unbeweglich auf seinem Diwan sitzen. Ein neues Licht schien den
dichten, rätselhaften Nebel zu durchdringen, der ihn seit zwei Tagen
umgab. Unser Held fing allmählich an, alles, alles zu begreifen ... Er
versuchte sich vom Diwan zu erheben und einige Male durch das Zimmer zu
gehen, um sich zu ermuntern und seine zerstreuten Gedanken zu sammeln
und sie auf einen bestimmten Gegenstand zu konzentrieren – um dann
reiflich seine Lage zu überlegen. Aber, als er nun aufstehen wollte,
fiel er kraftlos und ohnmächtig auf seinen Diwan zurück.
„Das habe ich ja alles vorausgefühlt! Aber was schreibt er denn und was
ist der Sinn seiner Worte? Den Sinn verstehe ich noch, aber wohin führt
das alles? Wenn er doch einfach sagte: so ist es und so, verlangt wird
das und das, ich würde es sofort tun! Der ganze Gang der Sache ist ein
so unangenehmer! Wenn es doch bereits Morgen wäre und ich mich der Sache
annehmen könnte! Denn jetzt weiß ich, was ich machen würde. So und so,
sage ich, ich bin bereit, zur Vernunft zu kommen, doch meine Ehre gebe
ich nicht preis, aber ... aber, die bekannte Person, diese unangenehme
Persönlichkeit, wie hat sie sich denn da hineingemischt? Und warum hat
sie sich da hineingemischt? Ach, wenn es doch schon Morgen wäre! Bis
dahin werden sie über mich lästern, gegen mich intrigieren! Die
Hauptsache – nur keine Zeit verlieren! Jetzt, zum Beispiel, sollte ich
da nicht einen Brief schreiben: so und so, und das und das, bin damit
und damit einverstanden. – Und morgen, wenn nur erst die Sonne aufgeht,
oder noch früher ... werde ich von der anderen Seite entgegenarbeiten
und den Burschen zuvorkommen ... Sie werden nur lästern über mich, ja,
und das ist alles!“
Herr Goljädkin griff nach dem Papier, nahm die Feder und schrieb
folgende Antwort auf den Brief des Gouvernements-Sekretärs Wachramejeff:
„Sehr geehrter Herr Nestor Ignatjewitsch!
Mit gekränktem Herzen und voll Verwunderung las ich Ihren für mich
so beleidigenden Brief, denn ich habe wohl verstanden, daß Sie mit
den nicht wohlanständigen, falschen und lügnerischen Personen mich
bezeichnen wollen. Mit aufrichtigem Bedauern sehe ich, wie schnell
und wie tief die Verleumdung Wurzeln gefaßt hat, zum Schaden meines
Wohlergehens, meiner Ehre und meines guten Namens. Und um so
beleidigender ist es, als sogar ehrliche und wirklich wohlmeinende
Leute und hauptsächlich die, welche mit einem offenen und geraden
Charakter begabt sind, sich von dem Leben anständiger Leute abwenden
und an einem anderen und tief verderbten teilnehmen, wie es Menschen
führen, welche in jener Sittenlosigkeit versunken sind, die zum
Unglück unserer Zeit unter uns so schädliche Früchte zeitigt.
Zum Schlusse teile ich Ihnen mit, daß ich es für meine heilige
Pflicht halte, Ihnen meine Schuld von zwei Rubeln unverzüglich
zurückzuerstatten.
Was Ihre Anspielung, sehr geehrter Herr, anbelangt, in bezug auf
eine sehr bekannte Person weiblichen Geschlechts und in bezug auf
die Absichten, Berechnungen und verschiedenen Ränke dieser Person,
so kann ich Ihnen nur sagen, sehr geehrter Herr, daß ich alle diese
Anspielungen bloß halbwegs verstanden habe. Erlauben Sie mir auch,
geehrter Herr, meine anständige Gesinnung und meinen ehrlichen Namen
unbefleckt zu erhalten. Auf jeden Fall bin ich bereit, auf
persönliche Erklärungen einzugehen, da ich die mündliche Erörterung
der schriftlichen vorziehe: Jedenfalls bin ich zu friedlicher,
gegenseitiger Verständigung bereit. Daher ersuche ich Sie, sehr
geehrter Herr, meine Bereitwilligkeit zur persönlichen Aussprache
dieser Person anzuzeigen und sie zu bitten, die Zeit und den Ort des
Zusammentreffens zu bestimmen. Es war mir schmerzlich, mein geehrter
Herr, Ihre Anspielungen zu lesen, als hätte ich Sie beleidigt, Ihre
frühere Freundschaft zu mir verraten, und mich im schlechten Sinne
über Sie ausgesprochen. Ich schreibe alle diese Mißverständnisse
schnöder Verleumdung, dem Neid mir gegenüber zu, und zwar
derjenigen, die ich mit Recht meine erbittertsten Feinde nennen
kann. Aber wahrscheinlich wissen diese nicht, daß die Unschuld durch
sich selbst stark ist, wissen nicht, daß die Unverschämtheit und
Frechheit früher oder später zu einer allgemeinen Verachtung führt,
die sie treffen wird, und daß solche Personen durch ihre eigenen
schlechten Absichten und die Verworfenheit ihres Herzens zugrunde
gehen müssen.
Zum Schluß bitte ich Sie noch, geehrter Herr, jenen Personen zu
sagen, daß ihre sonderbare Anmaßung und ihre unedlen phantastischen
Wünsche und Bestrebungen, andere aus der Stellung zu verdrängen, die
sie durch ihre Verdienste einnehmen, nur Erstaunen und Bedauern
erweckt und sie selbst für das Irrenhaus reif macht. Überdies sind
solche Bestrebungen durch das Gesetz strengstens verboten, was
meiner Meinung nach durchaus gerecht ist, da jeder mit seiner
eigenen Stellung zufrieden sein muß. Alles hat seine Grenzen, und
wenn das ein Scherz sein soll, so ist es ein unwürdiger Scherz, ich
sage mehr: ein unsittlicher Scherz, denn ich versichere Ihnen, mein
geehrter Herr, daß meine Anschauung über die Stellung eines jeden
hier auf Erden auf ethischen Voraussetzungen beruht.
In jedem Falle habe ich die Ehre, zu sein
Ihr gehorsamer Diener
J. Goljädkin.“
X.
Man kann sagen, daß die Erlebnisse des gestrigen Tages Herrn Goljädkin
bis auf den Grund seines Seins erschüttert hatten. Unser Held schlief
sehr schlecht, das heißt, er konnte nicht einmal auf fünf Minuten
wirklich einschlafen. Es war ihm, als hätte irgendein mutwilliger Schelm
ihm geschnittene Schweineborsten ins Bett gestreut. Die ganze Nacht
verbrachte er im Halbschlaf und drehte sich fortgesetzt von der einen
Seite auf die andere. Schlief er einmal – stöhnend, ächzend – auf einen
Augenblick ein, so erwachte er im nächsten sofort wieder, und alles das
war begleitet von einem seltsamen Gefühl der Trauer, unklaren
Erinnerungen und widerlichen Traumgesichtern, mit einem Wort von allem,
was es nur an Unangenehmem geben kann ... So erschien ihm in
rätselhaftem Halbdunkel die Gestalt Andrej Philippowitschs, eine
trockene Erscheinung, mit bösem Blick und gefühllos höflicher
Sprechweise ... Als aber Herr Goljädkin die Absicht zeigte, auf Andrej
Philippowitsch zuzugehen, um sich auf seine Weise zu rechtfertigen, „so
oder so,“ sich jedenfalls zu rechtfertigen und ihm zu beweisen, daß er
durchaus nicht so sei, wie seine Feinde ihn schilderten, daß er vielmehr
ein ganz anderer sei, und außer seinen gewöhnlichen ihm angeborenen
Fähigkeiten noch diese und jene besitze – da erschien plötzlich eine ihm
durch ihre übelwollende Gesinnung nur zu bekannte Person und durch ein
empörendes Mittel wurden auf einmal alle Bemühungen des Herrn Goljädkin
vereitelt, und Herr Goljädkin sah vor seinen eigenen Augen seine Würde
und seine Ansprüche auf Beachtung endgültig in den Schmutz gezogen,
während diese Person seine, jawohl, seine Stellung im Dienst wie in der
Gesellschaft einnahm. Dann wieder ging Herr Goljädkin die Empfindung
eines Nasenstübers durch den Kopf, den er vor kurzem erhalten und
demütig hingenommen hatte: war es nun im gewöhnlichen Leben oder in
dienstlicher Angelegenheit gewesen – jedenfalls war es unmöglich, gegen
diesen Nasenstüber sich zu wehren und ihn abzulehnen oder zu leugnen ...
Während aber Herr Goljädkin sich noch den Kopf darüber zerbrach, warum
es denn so unmöglich war, sich gegen diesen Nasenstüber zu wehren – ging
der Nasenstüber unmerklich in eine andere Form über – in die Form einer
ziemlich bekannten, kleinen, aber doch bedeutenden Nichtsnutzigkeit, die
er gesehen oder gehört oder selbst unlängst vollbracht hatte, und zwar
nicht etwa aus schlechter Absicht oder aus einem gemeinen Antrieb,
sondern so – nun, so – aus Zufall, aus Zartgefühl ... vielleicht auch
aus seiner vollkommenen Hilflosigkeit heraus, und schließlich, weil ...
weil, nun, Herr Goljädkin wußte sehr gut, warum!
Dabei errötete Herr Goljädkin sogar im Traum, und weil er sich
beherrschen wollte, murmelte er vor sich hin, daß man, zum Beispiel,
jetzt Charakterfestigkeit zeigen müsse ... Es kam nur darauf an, was
Charakterfestigkeit eigentlich sei ... und wie man sie auffassen solle.
Doch mehr als alles andere, reizte es Herrn Goljädkin und versetzte ihn
in Wut, daß gerade in diesem Augenblick, gerufen oder ungerufen, die
Person auftauchte, die ihm in ihrer fast karikaturenhaften
Abscheulichkeit nur zu bekannt war, und ihm, obwohl ihm damit gar nichts
Neues, sondern nur zu Bekanntes gesagt wurde, mit einem bösartigen
Lächeln zuflüsterte: „Wozu denn Charakterfestigkeit! Und welche
Charakterfestigkeit hätten wir beide, Jakoff Petrowitsch, wohl
aufzuweisen! ...“
Dann träumte Herrn Goljädkin wiederum, daß er sich in einer prächtigen
Gesellschaft befände, die sich durch Geist und den vornehmen Ton aller
anwesenden Personen auszeichnete: daß er, Goljädkin, sich seinerseits
durch Liebenswürdigkeit und Scharfsinn auszeichnete, daß alle ihn
liebten, sogar einige seiner Feinde, die zugegen waren, sich ihm zugetan
zeigten, was Herr Goljädkin sehr angenehm empfand, daß ihm alle den
Vorzug gaben und er selbst, Goljädkin, mit Vergnügen anhören durfte, wie
der Wirt einen seiner Gäste beiseite führte, um ihm Lobenswertes über
Herrn Goljädkin zu sagen ... Doch plötzlich, mir nichts dir nichts,
erschien wieder dasselbe mißvergnügte und mit wahrhaft tierischen Zügen
begabte Gesicht des Herrn Goljädkin _junior_ und zerstörte den ganzen
Triumph und den Ruhm des Herrn Goljädkin _senior_, verdunkelte seine
glänzende gesellschaftliche Erscheinung, trat ihn abermals in den
Schmutz und bewies allen klar, daß Herr Goljädkin der Ältere, daß der
wirkliche Goljädkin – gar nicht der wirkliche sei, sondern ein
nachgemachter, während er, er selbst, der wirkliche wäre ... Herr
Goljädkin der Ältere aber, der sei, sagte er, durchaus nicht derjenige,
als der er erscheine, sondern bald dieser, bald jener: und folglich habe
er auch gar nicht das Recht, zu der Gesellschaft so trefflicher Leute
von gutem Ton zu gehören!
Und alles das geschah so schnell, daß Herr Goljädkin der Ältere vor
Erstaunen nicht einmal den Mund zu öffnen vermochte – daß er nur noch
zusehen konnte, wie sich schon alle mit Leib und Seele dem abscheulichen
und falschen Herrn Goljädkin hingegeben hatten und sich mit der tiefsten
Verachtung von ihm, dem wahren und so unschuldigen Herrn Goljädkin,
abwandten. Es gab keine Person mehr, bis auf die unbedeutendste der
ganzen Gesellschaft, bei der sich nicht Herr Goljädkin, der falsche, mit
seinen süßen Manieren und auf seine geschmeidige Art eingeschmeichelt
hätte und vor denen er nicht, seiner Gewohnheit gemäß, Weihrauch
ausstreute, angenehmen und süßduftenden Weihrauch, so daß die auf diese
Weise angeräucherten Personen bis zu Tränen niesen mußten – zum Zeichen
ihres höchsten Vergnügens.
Und was die Hauptsache war – alles das geschah in einem Augenblick: die
Geschwindigkeit des Vorgangs war erstaunlich! Kaum gelang es dem
falschen Herrn Goljädkin, sich dem einen zu nähern, als es ihm auch
schon gelang, das Wohlwollen des andern zu gewinnen – und im selben
Augenblick stand er auch schon bei dem dritten. Er schmeichelte hin,
schmeichelte her, schmeichelte sich im stillen ein, entriß jedem ein
Lächeln des Wohlwollens und kratzte vor ihm mit seinen kurzen, runden,
übrigens recht steifen Beinchen – und siehe da, schon machte er einem
Neuen den Hof und schloß mit ihm Freundschaft. Den Mund konnte man kaum
öffnen, nicht aus dem Erstaunen heraus konnte man kommen, und er war
schon bei einem vierten, und mit diesem vierten in denselben
Beziehungen! Fabelhaft: einfach Zauberei schien es zu sein! Und alle
waren sie entzückt von ihm und alle liebten ihn und bemühten sich um
ihn. Alle wiederholten im Chor, daß seine Liebenswürdigkeit und sein
blitzender Humor unvergleichlich höher stände, als die Liebenswürdigkeit
und der Geist des anderen Herrn Goljädkin, und beschämten dadurch diesen
wirklichen und unschuldigen Herrn Goljädkin und wandten sich von dem
wahren Herrn Goljädkin ab, und jagten den wohlgesinnten Herrn Goljädkin,
den durch seine Nächstenliebe bekannten echten Herrn Goljädkin mit
Puffern und Nasenstübern einfach hinaus! ...
Außer sich, voll Schreck und Kummer, lief der bemitleidenswerte Herr
Goljädkin auf die Straße und wollte sich eine Droschke nehmen, um
geradewegs zu seiner Exzellenz zu fliehen, und wenn nicht zu ihm, dann
doch wenigstens zu Andrej Philippowitsch, aber o Schrecken! Der
Droschkenkutscher weigerte sich, Herrn Goljädkin aufzunehmen, „wie,
Herr, kann man einen Menschen doppelt fahren? Ew. Wohlgeboren, ein guter
Mensch bemüht sich, in Ehrbarkeit zu leben, aber nicht so wie Sie –
nicht ... irgendwie – doppelt!!“
Sprachlos vor Scham sah der doch so vollkommen ehrenwerte Herr Goljädkin
sich um, und konnte sich so selbst und mit seinen eigenen Augen
überzeugen, daß der Droschkenkutscher, so wie Petruschka, der offenbar
mit ihm unter einer Decke steckte, im Recht waren, denn der andere, der
nichtsnutzige Herr Goljädkin stand in der Tat in greifbarer Nähe neben
ihm und seinen schlechten Gewohnheiten gemäß, war er auch hier, in
diesem kritischen Augenblick, im Begriff, etwas sehr Gemeines zu tun,
etwas, das allerdings keinen edlen Charakter bewies, wie er ihn durch
Erziehung erhalten haben sollte – keinen Anstand, keine Form, keinen
Takt, mit denen der widerwärtige Herr Goljädkin der Zweite doch bei
jeder Gelegenheit zu prahlen pflegte.
Ohne sich zu besinnen, voll Scham und Verzweiflung floh der unglückliche
und ehrenwerte Herr Goljädkin von dannen, floh, lief, wohin ihn seine
Füße trugen, wohin das Schicksal ihn führen würde. Doch bei jedem
Schritt, den er machte, bei jedem Aufschlag seiner Füße auf das harte
Trottoir, sprang wie aus der Erde hervor, ein ebensolcher Herr
Goljädkin, jener andere Herr Goljädkin, jener verworfene, ruchlose,
abscheuliche Zweite. Und alle diese Ebenbilder begannen nun, kaum, daß
sie erschienen, einer dem anderen nachzulaufen. In einer langen Kette,
wie einer Reihe gespenstischer Wesen, zogen sie sich hinter Herrn
Goljädkin dem Älteren her, so daß es ganz unmöglich war, ihnen zu
entfliehen, so daß dem bedauernswerten Herrn Goljädkin der Atem stockte,
so daß zuletzt eine furchtbare Anzahl solcher Ebenbilder sich
ansammelte, so daß ganz Petersburg von ihnen überschwemmt war und ein
Polizist, der diese Störung der öffentlichen Ruhe schließlich bemerkte,
sich veranlaßt sah, alle diese Ebenbilder am Kragen zu packen, und sie
auf die Wache zu führen ...
Gebannt und erstarrt vor Schrecken erwachte unser Held und gebannt und
erstarrt vor Schrecken fühlte er sich auch noch im wachen Zustande nicht
besser. Schwer und quälend war ihm zumute ... Er hatte ein Gefühl, als
ob ihm jemand das Herz aus der Brust risse ...
Endlich konnte es Herr Goljädkin nicht länger aushalten. „Das darf nicht
sein!“ rief er mit Entschlossenheit aus, und erhob sich vom Bett,
woraufhin er vollständig wach wurde.
Der Tag hatte augenscheinlich längst begonnen. Im Zimmer war es ganz
außergewöhnlich hell. Die Sonnenstrahlen drangen durch die gefrorenen
Fensterscheiben und zerstreuten sich verschwenderisch im Zimmer, was
Herrn Goljädkin nicht wenig verwunderte. Denn nur zu Mittag konnte die
Sonne zu ihm hineinsehen, und zu anderer Stunde war so etwas, soweit
Herr Goljädkin sich erinnern konnte, nie vorgekommen. Während unser Held
noch ganz verwundert darüber nachdachte, begann die Wanduhr hinter dem
Vorschlag zu schnurren – was ankündigte, daß sie gleich darauf schlagen
werde.
„Nun, aufgepaßt!“ dachte Herr Goljädkin und horchte auf, in gespannter
Erwartung ... Doch zu seiner höchsten Verwunderung holte die Uhr aus und
schlug nur ein einziges Mal. „Was ist denn das für eine Geschichte?“
rief unser Held aus und sprang jetzt endgültig aus dem Bett. Wie es
schien, traute er seinen eigenen Ohren nicht und lief hinter den
Verschlag. Die Uhr zeigte wirklich „eins“. Herr Goljädkin blickte auf
Petruschkas Bett, doch im Zimmer war von Petruschka keine Spur zu sehen.
Sein Bett war augenscheinlich schon lange gemacht, und seine Stiefel
waren nirgends zu erblicken, ein unzweifelhaftes Zeichen, daß Petruschka
wirklich nicht zu Hause war. Herr Goljädkin stürzte zur Tür: die Tür war
verschlossen.
„Wo ist denn Petruschka?“ fuhr er flüsternd fort, in schrecklicher
Erregung, an allen Gliedern zitternd. Plötzlich kam ihm ein Gedanke ...
Herr Goljädkin stürzte an den Tisch, übersah ihn, suchte und – richtig:
sein gestriger Brief an Wachramejeff war nicht da ... Petruschka war
auch nicht im Verschlag ... die Uhr war eins ... und im gestrigen Brief
von Wachramejeff waren einige Punkte, übrigens, auf den ersten Blick
sehr unklare Punkte, die sich gleichwohl für ihn jetzt vollkommen
aufklärten ... Also auch Petruschka war erkauft worden! Das war es!
„So, jawohl, so wird alles zu einem Knoten von Ränken und Verrat!“ rief
Herr Goljädkin aus, schlug sich an die Stirn und riß immer noch mehr die
Augen auf. „Also im Nest dieser abscheulichen Deutschen verbirgt sich
die ganze Macht der bösen Kräfte! Sie hat mich nur höchst geschickt
ablenken wollen, indem sie mich auf die Ismailoffbrücke wies, die Augen
schlug sie nieder, diese nichtsnutzige Hexe, und hat auf mich in dieser
Weise geheime Anschläge gemacht!!! So ist es! Wenn man die Sache von
dieser Seite betrachtet, dann ist es eben so! Und die Erscheinung dieses
Taugenichts ist auch darauf zurückzuführen: so gehört eines zum anderen.
Sie hatten ihn schon lange vorbereitet und für den schwarzen Tag zurecht
gemacht. So also ist’s, wie sich jetzt alles aufklärt! Doch wie ist das
nur gekommen? Nun, tut nichts! Noch ist keine Zeit verloren! ...“
Hierbei erinnerte sich Herr Goljädkin mit Schrecken daran, daß es
bereits halb zwei Uhr nachmittags sei. „Wie, wenn es ihnen inzwischen
gelungen ...“ Ein Stöhnen entrang sich seiner Brust ... „Doch nein,
nein, sie lügen, es gelingt ihnen nicht, – wollen doch sehen ...“ Er
kleidete sich schnell irgendwie an, ergriff Papier und Feder und schrieb
folgenden Brief:
„Mein geehrter Herr Jakoff Petrowitsch!
Entweder Sie oder ich, aber wir beide – ganz unmöglich! Und darum
erkläre ich Ihnen, daß Ihr sonderbarer, lächerlicher und unsinniger
Wunsch, sich für meinen Zwillingsbruder auszugeben, zu nichts
anderem führen wird, als zu Ihrem vollständigen Ruin. Ich bitte Sie
daher, und um Ihres eigenen Vorteils willen, ehrenwerten Leuten mit
wohlgesinnten Absichten den Weg frei zu geben. Im anderen Fall bin
ich bereit, selbst zu den äußersten Maßregeln zu greifen. Ich lege
die Feder hin und warte ... Im übrigen stehe ich zu Ihrer Verfügung
– auch mit der Pistole.
J. Goljädkin.“
Unser Held rieb sich energisch die Hände, als er dieses Schreiben
beendet hatte. Dann zog er sich den Mantel an, setzte den Hut auf,
öffnete mit einem zweiten Schlüssel die Tür und begab sich in die
Kanzlei. Er ging auch bis zum Departementsgebäude, konnte sich aber
nicht entschließen hinein zu gehen, denn es war wirklich schon zu spät.
Die Uhr des Herrn Goljädkin zeigte halb drei. Plötzlich erregte ein
scheinbar sehr nebensächlicher Umstand einiges Bedenken bei Herrn
Goljädkin. Aus einer Ecke des Gebäudes tauchte nämlich mit einem Male
eine erhitzte und keuchende Figur auf, schlich sich verstohlen auf die
Treppe und von dort in den Vorraum. Es war der Schreiber Ostaffjeff, ein
Mensch, der Herrn Goljädkin genau bekannt, ein Mensch, der zuweilen für
einige zehn Kopekenstücke zu allem bereit war. Da Herr Goljädkin die
schwache Seite Ostaffjeffs kannte und richtig vermutete, daß er, der
offenbar gerade aus einer benachbarten Kneipe kam, wahrscheinlich mehr
denn je Verlangen nach Kopeken empfand, so entschloß sich unser Held,
diese nicht zu sparen. Er ging sofort auf die Treppe und folgte
Ostaffjeff in den Vorraum, rief ihn an und forderte ihn geheimnisvoll
auf, mit ihm zur Seite zu treten, in ein verstohlenes Winkelchen hinter
einem großen eisernen Ofen. Nachdem er ihn dahin geführt hatte, begann
unser Held ihn auszufragen.
„Nun, wie mein Freund, wie ist’s damit ... Du verstehst mich doch? ...“
„Ich höre, Ew. Wohlgeboren und wünsche Ew. Wohlgeboren Gesundheit.“
„Gut, mein Lieber, schon gut; ich danke dir, mein Lieber. Nun, aber, wie
steht es denn, mein Lieber?“
„Wonach geruhen Sie zu fragen?“ Ostaffjeff hielt dabei die Hand vor den
Mund.
„Nun sieh, mein Lieber, ich spreche davon ... Du brauchst aber nun nicht
etwa zu denken ... Sage, ist Andrej Philippowitsch hier? ...“
„Er ist hier.“
„Und die Beamten sind auch hier?“
„Und die Beamten auch, wie es sich gehört.“
„Und Seine Exzellenz gleichfalls?“
„Und auch Seine Exzellenz.“ Wieder legte der Schreiber seine Hand vor
den Mund und blickte neugierig und verwundert Herrn Goljädkin an.
Wenigstens schien es unserem Helden so.
„Und es ist nichts Besonderes vorgefallen, mein Lieber?“
„Nein, gar nichts, gar nichts.“
„Und von mir, mein Lieber, ist da nicht dort so ... irgendwas von mir zu
hören gewesen? ... Wie? Nur so, mein Freund, verstehst du?“
„Nein, es ist bis jetzt nichts zu hören gewesen,“ wieder legte der
Schreiber seine Hand vor den Mund und sah Herrn Goljädkin sehr sonderbar
an. Unser Held versuchte jetzt aus dem Gesicht Ostaffjeffs
herauszulesen, ob er etwas vor ihm verheimliche. Und wirklich schien in
ihm etwas vor sich zu gehen. Ostaffjeff wurde nämlich immer trockener,
fast unhöflich und zeigte für Herrn Goljädkin lange nicht mehr soviel
Teilnahme, wie zu Anfang des Gespräches. „Er ist auf gewisse Weise in
seinem Recht,“ dachte Herr Goljädkin, „was gehe ich ihn eigentlich an?
Vielleicht hat er auch schon von anderer Seite ein Geschenk empfangen?
Vielleicht kommt er gerade ... und ich treffe ihn, weil – Aber auch ich
werde ihm ...“ Herr Goljädkin begriff, daß die Zeit für das Trinkgeld
gekommen war.
„Hier, mein Lieber ...“
„Danke ergebenst, Ew. Wohlgeboren.“
„Ich werde dir noch mehr geben.“
„Schön, Ew. Wohlgeboren.“
„Jetzt, sofort werde ich dir noch mehr geben, und wenn die Sache
beendigt ist, gebe ich dir noch einmal soviel. Verstehst du?“
Der Schreiber schwieg, er stand kerzengerade vor Herrn Goljädkin und sah
ihn unbeweglich an.
„Nun, jetzt sprich: ist etwas über mich zu hören? ...“
„Es scheint, daß bis jetzt noch ... davon ... nichts, bis jetzt
wenigstens.“ Ostaffjeff antwortete in Pausen und ganz wie Herr
Goljädkin, nahm auch er eine geheimnisvolle Miene an, zog die
Augenbrauen hoch, sah zur Erde, versuchte den richtigen Ton zu treffen,
kurz, tat alles, um auch noch das Versprochene zu verdienen, denn das
Erhaltene sah er bereits für etwas endgültig von ihm Erworbenes an.
„Also, es ist noch nichts bekannt? ...“
„Bis jetzt noch nichts.“
„Doch höre, ... es wird vielleicht ... noch bekannt werden? ...“
„Versteht sich, späterhin wird es vielleicht bekannt werden.“
„Schlimm!“ dachte unser Held. „Höre: hier hast du noch, mein Freund.“
„Danke ergebenst, Ew. Wohlgeboren.“
„War Wachramejeff gestern hier? ...“
„Ja, er war hier.“
„War nicht sonst noch jemand hier? Denke mal nach, mein Lieber!“
Der Schreiber suchte einen Augenblick in seinen Erinnerungen: offenbar
fiel ihm nichts ein.
„Nein, es war sonst niemand hier.“
„Hm!“ Es folgte ein Schweigen.
„Höre, Lieber, noch eins: sage mir alles was du weißt.“
„Zu Befehl.“
„Sage mir, Lieber, wie ist er angeschrieben?“
„So ... gut ... –“ antwortete der Schreiber und sah mit großen Augen auf
Herrn Goljädkin.
„Wie das, ... gut –?“
„Das heißt, so ...“ Ostaffjeff zog die Augenbrauen noch bedeutend höher.
Er stand dumm da und wußte entschieden nicht, was er antworten sollte.
„Schlimm!“ dachte Herr Goljädkin. „Weiß man sonst etwas über
Wachramejeff?“
„Ja, alles ganz wie früher.“
„Denke mal nach.“
„Ja, man sagt ...“
„Nun, was denn? ...“
Ostaffjeff bedeckte mit der Hand seinen Mund.
„Ist nicht ein Brief von ihm da, an mich?“
„Ja, heute ging der Kanzleidiener Michejeff zu Wachramejeff in die
Wohnung, ging zu einer Deutschen – wenn es nötig ist, kann ich auch
hingehen und fragen?“
„Tu es, sei so gut, mein Lieber, um’s Himmels willen! Das heißt, ich
meine nur so ... Du, mein Lieber, denke dir nichts dabei ... wie gesagt,
ich meine nur so ... Ja, frage nach, mein Lieber, forsche, ob man da
etwas vorbereitet – auf meine Rechnung? Und was er tun wird? Das muß ich
wissen, versuche es zu erfahren, mein Lieber, ich werde dir dafür
danken, mein Lieber ...“
„Zu Befehl, Ew. Wohlgeboren. Ihren Platz nahm heute Iwan Ssemjonowitsch
ein.“
„Iwan Ssemjonowitsch? Ach! Ja! Wirklich!“
„Andrej Philippowitsch befahlen ihm, sich auf Ihren Platz zu begeben.“
„Wirklich? Aus welcher Veranlassung? Versuche es zu erfahren, mein
Lieber; versuche alles zu erfahren – und ich werde dir danken, mein
Lieber, das ist es ja, was ich nötig habe und wissen muß ... Du aber,
glaube nur ja nicht, mein Lieber ...“
„Verstehe, verstehe, ich gehe sogleich –. Und Sie, Ew. Wohlgeboren, Sie
gehen heute nicht hin?“
„Nein, mein Lieber, ich bin nur so ... ich bin nur so gekommen, um zu
sehn, mein Lieber – ich würde dir aber dankbar sein, mein Lieber ...“
„Zu Befehl.“ Der Schreiber lief schnell und eilig die Treppe hinauf und
Herr Goljädkin blieb allein.
„Schlimm!“ dachte er. „Ach, schlimm, schlimm! Ach, sehr schlimm steht
jetzt unsere Sache! Was hatte das alles zu bedeuten? Was bedeuteten
einige Anspielungen dieses Kerls, und von wem gehen sie aus? Ah! Jetzt
weiß ich’s. Sie haben die Sache erfahren und ihn infolgedessen
hingesetzt. Übrigens, was ... hingesetzt? Dieser Andrej Philippowitsch
hat Iwan Ssemjonowitsch befohlen, sich hinzusetzen, doch warum hat er
ihn hingesetzt, zu welchem Zweck hat er ihn hingesetzt? Wahrscheinlich
haben sie erfahren ... Dieser Wachramejeff intrigiert, das heißt, nicht
Wachramejeff, er ist so dumm, wie ein Stück Holz, dieser Wachramejeff!
Sie machen das alles für ihn und haben diesen Halunken nun hingesetzt.
Oh, die Deutsche hat sie bestochen, die Einäugige! Ich hatte immer den
Verdacht, daß diese Intrige nicht so einfach ist, und daß hinter diesem
Altweiberklatsch etwas steckt ... Dasselbe habe ich auch Krestjan
Iwanowitsch gesagt, daß sie sich geschworen haben, im moralischen Sinne
einen Menschen zu morden – und da bedienen sie sich denn Karolina
Iwanownas. Nein, hier sind Meister an der Arbeit, das sieht man! Hier,
mein Herr, erkennt man eine Meisterhand und nicht die Wachramejeffs. Wie
gesagt, dieser Wachramejeff ist dumm, doch ich weiß, wer für sie alle
jetzt arbeitet: dieser Schurke ist es, dieser Usurpator meines Namens
ist es! An ihm allein hängt alles, was ja auch zum Teil seine Erfolge in
der Gesellschaft bewiesen haben. Es wäre wirklich wünschenswert, zu
wissen, auf welchem Fuße er jetzt ... was er dort bei ihnen gilt?
Doch wozu haben sie diesen Iwan Ssemjonowitsch genommen? Zum Teufel,
wozu hatten sie denn den nötig? Ganz als ob sich kein anderer finden
ließe. Übrigens, wen sie auch dahin gesetzt hätten, es wäre doch immer
dasselbe gewesen! Das einzige, was ich weiß, ist, daß mir dieser Iwan
Ssemjonowitsch schon längst verdächtig vorkam: so ein alter widerlicher
Kerl! Man sagt, er leihe Geld aus und nehme Wucherzinsen. Doch das macht
ja alles der Bär, in alle diese Sachen hat sich der Bär eingemischt. Das
fing so an, bei der Ismailoffbrücke fing es an: so war es ...“
Hierbei verzog Herr Goljädkin gar schrecklich sein Gesicht, ganz, als
hätte er in eine Zitrone gebissen – jedenfalls dachte er an etwas für
ihn sehr Unangenehmes.
„Nun, tut nichts, und übrigens!“ dachte er, „ich werde schon für mich
stehen ... Warum kommt denn der Ostaffjeff nicht? Wahrscheinlich haben
sie ihn dort aufgehalten! Es ist zum Teil gut, daß ich so intrigiere und
auch meinerseits Schlingen lege. Ostaffjeff brauche ich nur ein
Trinkgeld zu geben und so habe ich ihn – auf meiner Seite. Vielleicht
tun sie das auch ihrerseits und intrigieren ihrerseits durch ihn gegen
mich? Denn der Schurke sieht aus wie ein Räuber, der reine Räuber! Er
verheimlicht alles, der Schuft! ‚Nein, nichts,‘ sagt er, ‚ich danke, Ew.
Wohlgeboren,‘ sagt er. Solch ein Räuber!“
Man hörte ein Geräusch ... Herr Goljädkin kroch ganz in sich zusammen
und sprang hinter den Ofen. Jemand kam die Treppe herunter und ging auf
die Straße.
„Wer kann da jetzt weggegangen sein?“ dachte Herr Goljädkin bei sich.
Nach einer Weile hörte man wieder Schritte ... Jetzt konnte es Herr
Goljädkin nicht mehr aushalten, er streckte ein wenig seine Nase aus dem
Versteck heraus, zog sie aber schnell wieder zurück, als wäre sie ihm
mit einer Nadel gestochen worden. Dieses Mal konnte man sich ja denken,
wer da kam, ... der Schuft, der Intrigant und Verderber selbst ... Er
ging vorüber, wie gewöhnlich, mit seinen gemeinen, kleinen Schrittchen,
und warf seine Beinchen aus, ganz als wolle er jemandem ein Bein
stellen.
„Schurke!“ murmelte unser Held vor sich hin. Übrigens konnte es Herrn
Goljädkin nicht entgehen, daß der Schurke unter dem Arm eine große grüne
Mappe trug, die Seiner Exzellenz gehörte.
„Also wieder in besonderen Aufträgen,“ dachte Herr Goljädkin, verkroch
sich noch mehr und wurde rot vor Ärger. Kaum war Herr Goljädkin der
Jüngere an Herrn Goljädkin dem Älteren vorübergegangen, ohne ihn zu
bemerken, als man zum dritten Male Schritte hörte: wie Herr Goljädkin
sich gedacht, waren es die Schritte eines Schreibers. Wirklich: es war
das glänzende Gesicht eines Schreibers, das zu ihm hinter den Ofen sah:
nur war es nicht das Gesicht Ostaffjeffs, sondern das eines anderen
Schreibers, Pissarenko genannt. Das setzte Herrn Goljädkin in Erstaunen.
„Warum hat er andere in das Geheimnis eingeweiht?“ dachte unser Held.
„Ach, diese Schurken – alle! Es gibt nichts Heiliges für sie!“
„Nun, mein Lieber?“ sagte er zu Pissarenko gewandt. „Von wem kommst du,
mein Lieber? ...“
„In Ihrer Sache gibt es noch nichts Neues, gar keine Nachrichten, wenn
was kommen sollte, so werde ich es Ihnen überbringen.“
„Und Ostaffjeff?“
„Der, Ew. Wohlgeboren, kann jetzt nicht abkommen. Seine Exzellenz ist
schon zweimal durch unsere Abteilung gekommen, und auch ich habe keine
Zeit.“
„Danke dir, mein Lieber, danke dir ... Aber du sagst mir doch ...“
„Bei Gott, ich habe keine Zeit ... Jeden Augenblick werden wir gerufen
... Aber belieben Sie hier noch stehen zu bleiben, wenn etwas in betreff
Ihrer Sache geschieht, so werden wir Sie benachrichtigen. –“
„Warte, warte, mein Lieber! Sofort mein Lieber! ... Hier, nimm diesen
Brief, mein Lieber, ich werde dir danken, mein Freund.“
„Gut!“
„Gib ihn ab, mein Lieber, gib ihn Herrn Goljädkin.“
„Goljädkin?“
„Ja, mein Lieber, Herrn Goljädkin.“
„Schön! Ich werde ihn geben, sobald ich Zeit finde. Sie aber bleiben
hier inzwischen stehen. Hier wird Sie niemand sehen ...“
„Nein, mein Lieber, du mußt nicht denken ... daß ich hier stehe, damit
mich niemand sieht. Ich, mein Freund, werde nicht mehr hier ... ich
werde dort in der Nebenstraße warten. Dort ist ein Kaffeehaus, dort
werde ich warten, und wenn etwas passiert, wirst du mich
benachrichtigen, verstehst du?“
„Schön. Gehen Sie nur, ich verstehe ...“
„Ich werde mich dir dankbar erweisen, mein Lieber!“ rief Herr Goljädkin
dem Schreiber nach, der sich endlich von ihm befreit hatte.
„Der Schuft wurde ordentlich grob zuletzt,“ dachte unser Held und
schlich sich hinter dem Ofen hervor. „Dort steckt noch ein Haken ... Das
ist klar ... Zuerst war er so, dann so ... Übrigens, vielleicht mußte er
sich auch wirklich beeilen. Vielleicht haben sie dort viel zu tun. Und
Seine Exzellenz ging zweimal durch ihre Abteilung ... Aus welcher
Veranlassung geschah das wohl? Ach! nun, einerlei! Übrigens, tut nichts
... vielleicht –; nun, wir werden ja sehen ...“
Herr Goljädkin hatte bereits die Tür geöffnet und wollte soeben auf die
Straße hinaustreten, als plötzlich, gerade in dem Augenblick, der Wagen
Seiner Exzellenz rasselnd vorfuhr. Herrn Goljädkin war das kaum erst
bewußt geworden, als auch schon die Tür der Equipage von innen geöffnet
wurde und der in ihr sitzende Herr auf die Treppe hinaussprang. Der
Betreffende aber war niemand anders, als jener Herr Goljädkin der
Jüngere, welcher, wie er selbst gesehen hatte, vor etwa zehn Minuten
weggegangen war. Doch Herr Goljädkin der Ältere erinnerte sich
gleichzeitig, daß die Wohnung der Exzellenz sich in der nächsten Nähe
befand.
„Er war in besonderem Auftrage ...“ dachte sich unser Held. Unterdessen
hatte Herr Goljädkin der Jüngere aus dem Wagen die dicke grüne
Aktenmappe und einige andere Papiere hervorgezogen, gab dem Kutscher
noch einen Befehl, öffnete die Tür, stieß mit ihr beinahe gegen Herrn
Goljädkin den Älteren und – als ob er ihn beleidigen und absichtlich
nicht bemerken wollte – eilte schnell die Treppe zur Kanzlei hinauf.
„Schlimm!“ dachte Herr Goljädkin. „Was hat die Sache doch jetzt für eine
Wendung genommen! Gott, mein Gott!“ Einen Augenblick stand unser Held
unbeweglich da, dann faßte er sich endlich. Ohne lange nachzudenken,
doch unter starkem Herzklopfen, an allen Gliedern zitternd, lief er
gleichfalls die Treppe hinauf, seinem Ebenbilde nach. „Mag es sein, wie
es ist, was geht’s mich an! Ich bin hier Nebensache!“ Im Vorraum nahm er
seinen Hut ab, zog Mantel und Galoschen aus.
Als Herr Goljädkin in das Bureau eintrat, war es bereits halbdunkel.
Weder Andrej Philippowitsch noch Anton Antonowitsch waren anwesend.
Beide befanden sich im Kabinett des Direktors, um Meldungen zu machen.
Der Direktor wiederum war, wie es hieß, von neuem zur Exzellenz geeilt.
Infolge dieser Umstände, und da es bereits, wie gesagt, zu dunkeln
begonnen hatte, auch die Bureauzeit sich ihrem Ende näherte, hatten
die Beamten, vorzugsweise die jüngeren, sich bereits süßer
Beschäftigungslosigkeit ergeben. Sie gingen auf und ab, unterhielten
sich miteinander, balgten sich und lachten. Und einige der
allerjüngsten, die ranglosesten unter den noch ranglosen Beamten, hatten
im stillen, begünstigt durch das allgemeine Geräusch, in einer Ecke am
Fenster, „Schrift oder Adler“ zu spielen begonnen.
Herr Goljädkin, der sich zu benehmen wußte und zudem das lebhafte
Bedürfnis fühlte, sich jemandem anzuschließen, ging auf einen Kollegen
zu, mit dem er sich sonst gut stand, wünschte ihm einen guten Tag usw.
Aber man erwiderte die Höflichkeit des Herrn Goljädkin auf eine seltsame
Weise. Er wurde unangenehm überrascht durch die allgemeine Kälte,
Trockenheit und man kann wohl sagen Strenge des Empfanges. Es reichte
ihm niemand die Hand. Einige sagten einfach „guten Tag“ und wandten sich
ab, andere nickten nur mit dem Kopf, irgend jemand wandte sich einfach
um, als hätte er ihn nicht bemerkt, und einige sogar – und was Herrn
Goljädkin am meisten beleidigte – einige aus der ranglosesten Jugend,
halbe Kinder, die, wie Herr Goljädkin sich ganz richtig ausdrückte, nur
erst „Adler oder Schrift“ zu spielen verstanden und sich im übrigen
umherzutreiben pflegten – umgaben Herrn Goljädkin und gruppierten sich
um ihn, so daß sie ihm beinahe den Durchgang versperrten. Alle blickten
sie ihn mit einer beleidigenden Neugier an.
Das war entschieden ein schlechtes Zeichen! Herr Goljädkin fühlte es und
bereitete sich vernünftigerweise vor, seinerseits nichts zu bemerken.
Plötzlich trat aber ein ganz unerwarteter Umstand ein, der, wie man
sagt, Herrn Goljädkin vollständig vernichtete.
In dem Kreis der jungen, ihn umgebenden Kollegen erschien plötzlich und
gerade für Herrn Goljädkin in dem allerpeinlichsten Augenblick –
erschien Herr Goljädkin der Jüngere, wie immer fröhlich, wie immer mit
einem Lächeln auf den Lippen, wie immer tänzelnd, kurz, wie immer als
der geborene Spaßmacher und Gesellschaftsmensch, der er war, mit
leichter Zunge und leichten Füßen, so wie er stets erschien, so wie er
schon früher, so wie er noch gestern erschienen war, als er so ungelegen
und verhängnisvoll wie nur möglich für Herrn Goljädkin auftauchte.
Schmunzelnd beweglich, mit einem Lächeln, das allen zu sagen schien:
„Guten Abend“, drehte er sich im Kreise der Beamten herum, reichte dem
die Hand, klopfte diesem auf die Schulter; umarmte schnell den dritten,
erklärte dem vierten, mit welchen Aufträgen er für Seine Exzellenz
beschäftigt gewesen sei, wohin er gefahren war, was er getan und was er
mit sich gebracht hatte; den fünften, offenbar seinen besten Freund,
küßte er auf den Mund – kurz, alles geschah genau so, wie es Herrn
Goljädkin dem Älteren geträumt hatte.
Nachdem er genug herumgesprungen war und alle auf seine Art begrüßt und
für sich eingenommen hatte, ob es nun nötig oder unnötig war, hatte er
nur Herrn Goljädkin den Älteren, wohl aus Versehen, noch gar nicht
bemerkt: erst jetzt reichte er ihm die Hand. Und wahrscheinlich –, und
auch nur aus Versehen –, weil er den betrügerischen Herrn Goljädkin den
Jüngeren jetzt erst bemerkte, ergriff unser Held sofort und gierig und
ganz unerwartet dessen Hand und drückte sie auf die allerkräftigste,
freundschaftlichste Weise, drückte sie mit ganz sonderbarer innerer
Bewegung und mit den rührendsten Gefühlen. Es ist schwer zu sagen, ob
unser Held dabei einem plötzlichen Antriebe folgte und durch die eine
Bewegung seines scheinheiligen Feindes verführt wurde – oder ob er in
seiner tiefsten Seele die ganze furchtbare Größe seiner Hilflosigkeit
spürte und erkannte. Denn Tatsache war, daß Herr Goljädkin der Ältere,
bei gesundem Verstande, aus freiem Willen und vor allen Zeugen feierlich
die Hand dessen drückte, den er doch seinen Todfeind nannte.
Aber wie groß war seine Verwunderung, das Entsetzen und die Wut, wie
groß war der Schreck und die Schande Herrn Goljädkin des Älteren, als
sein Verräter und Todfeind, der hinterlistige Herr Goljädkin der
Jüngere, den begangenen Fehler des unschuldigen und treulos verratenen
Menschen bemerkte und gefühllos, schamlos, mitleidslos, gewissenlos, mit
unerhörter Niedertracht und Grobheit, plötzlich seine Hand aus der Hand
Herrn Goljädkins des Älteren riß. Und nicht genug damit, daß er ihm
seine Hand entzog und sie abwischte, als hätte er sie durch etwas
Unreines beschmutzt – er spie auch noch zur Seite und begleitete das mit
einer höchst beleidigenden Gebärde. Und noch nicht genug damit, er zog
auch noch sein Taschentuch heraus und wischte sich auf die unerlaubteste
Weise die Finger ab, dies sich auf einen Augenblick in der Hand des
Herrn Goljädkin befunden hatten.
Nach diesem Verfahren sah sich Herr Goljädkin der Jüngere nach seiner
niederträchtigen Gewohnheit im Kreise um, tat es, damit alle sein
Benehmen bemerken sollten, blickte allen verständnisinnig in die Augen
und bemühte sich offenbar, bei allen einen ungünstigen Eindruck von
Herrn Goljädkin dem Älteren hervorzurufen.
Das Benehmen des widerwärtigen Herrn Goljädkins des Jüngeren schien
jedoch offenbar eher Unwillen bei den Anwesenden hervorzurufen. Sogar
die „Jugend“ bezeugte ihre Unzufriedenheit. Ringsum erhob sich Gespräch
und Murren. Die allgemeine Bewegung konnte Herrn Goljädkin dem Älteren
nicht entgehen. Doch plötzlich – ein rechtzeitiges Wort, ein gelungener
Witz von den Lippen Herrn Goljädkins des Jüngeren – und die letzte
Hoffnung unseres Helden wurde wieder zerstört und die Wage neigte sich
von neuem zugunsten seines Todfeindes.
„Das ist unser russischer Faublas, meine Herren! Erlauben Sie, Ihnen den
jungen Faublas vorzustellen,“ quiekte Herr Goljädkin der Jüngere mit der
ihm eigenen Frechheit – und wies dabei auf den ganz erstarrten echten
Herrn Goljädkin.
„Küssen wir uns, mein Herzchen!“ fuhr er in unerträglicher Familiarität
fort, indem er auf den von ihm verräterisch Betrogenen zutrat. Dieser
nichtswürdige Scherz Herrn Goljädkins des Jüngeren war es, der ein
williges Echo fand, um so mehr, als in ihm eine Anspielung auf einen
Umstand enthalten schien, der augenscheinlich allen bekannt war. Unser
Held fühlte die Arme seines Feindes auf seinen Schultern lasten. Doch er
hatte sich schon gefaßt. Mit glühenden Blicken, mit bleichem Gesicht und
einem starren Lächeln riß er sich aus der Menge los und mit unsicheren,
wankenden Schritten begab er sich geradewegs zum Kabinett Seiner
Exzellenz. Im Vorzimmer stieß er jedoch auf Andrej Philippowitsch, der
soeben das Kabinett Seiner Exzellenz verlassen hatte. Und obgleich auch
noch eine Menge anderer unbeteiligter Personen anwesend war, schenkte
unser Held diesen doch nicht die geringste Aufmerksamkeit. Entschlossen,
kühn, innerlich darüber selbst verwundert, doch seiner Kühnheit sich
rühmend, redete er vielmehr unumwunden Andrej Philippowitsch an, der
über diesen plötzlichen Überfall nicht wenig erstaunt war.
„Wie! ... Was wollen Sie ... was ist Ihnen gefällig?“ fragte der
Abteilungschef, ohne den auf ihn zustolpernden Herrn Goljädkin weiter
anzuhören.
„Andrej Philippowitsch, ich ... kann ich, Andrej Philippowitsch, kann
ich jetzt Aug’ in Aug’ eine Unterredung mit Seiner Exzellenz haben?“
sagte klar und deutlich unser Held und sah mit einem sehr entschlossenen
Blick auf Andrej Philippowitsch.
„Was? Natürlich: nicht.“ Andrej Philippowitsch maß Herrn Goljädkin vom
Kopf bis zu den Füßen.
„Ich, Andrej Philippowitsch – ich möchte nämlich meine Verwunderung
ausdrücken, daß hier niemand den Usurpator und Schurken erkennt.“
„W–a–a–s?“
„Den Schurken, Andrej Philippowitsch.“
„Von wem belieben Sie zu sprechen?“
„Von einer bekannten Person, Andrej Philippowitsch. Ja, Andrej
Philippowitsch, ich spiele auf eine bekannte Person an. Ich bin in
meinem Recht ... Ich denke, Andrej Philippowitsch, daß die Regierung
solch eine innere Regung, wie ich sie verspüre, unterstützen müßte,“
fügte Herr Goljädkin hinzu, offenbar ganz außer sich geraten. „Andrej
Philippowitsch ... Sie sehen doch selbst, Andrej Philippowitsch, daß
diese Regung in mir echt ist und meine wohlgesinnten Ansichten und
Absichten ausdrückt – den Chef als einen Vater anzusehen, die Regierung
als einen Vater anzusehen und sein Schicksal ihr blindlings
anzuvertrauen. So, so ist es ... also so ...“ Herrn Goljädkins Stimme
fing an zu zittern, sein Gesicht wurde dunkelrot und zwei Tränen hingen
an seinen Wimpern.
Als Andrej Philippowitsch Herrn Goljädkin in dieser Weise reden hörte,
war er so verwundert, daß er unwillkürlich einige Schritte zurücktrat.
Dann blickte er sich sehr unruhig um ... Es ist schwer zu sagen, wie die
Sache geendigt hätte ... Plötzlich öffnete sich die Tür zum Kabinett
Seiner Exzellenz und dieser selbst trat in Begleitung einiger Beamter
heraus. Alle, die im Zimmer waren, schlossen sich ihm an. Seine
Exzellenz rief Andrej Philippowitsch zu sich und ging, sich mit ihm
unterredend, weiter.
Als sich bereits alle aus dem Zimmer entfernt hatten, besann sich auch
Herr Goljädkin. Unterwürfig suchte er Schutz unter den Flügeln Anton
Antonowitsch Ssjetotschkins, der seinerseits hinter allen her hinkte,
mit einem, wie es Herrn Goljädkin schien, sehr strengen und
nachdenklichen Gesicht.
„Auch dort bin ich abgefallen, auch dort habe ich nur Unfug
angerichtet,“ dachte Herr Goljädkin bei sich, „nun, tut nichts. Ich
hoffe, wenigstens Sie, Anton Antonowitsch, werden geneigt sein, mich
anzuhören und sich für meine Sache zu verwenden,“ wandte er sich an
diesen mit leiser und noch vor Erregung zitternder Stimme. „Von allen
verlassen, wende ich mich an Sie. Ich verstehe nicht, was die Worte
Andrej Philippowitschs bedeuten, Anton Antonowitsch. Können Sie sie mir
erklären, wenn möglich ...“
„Zu seiner Zeit wird sich alles erklären,“ antwortete ihm nach einer
langen Pause streng Anton Antonowitsch, und, wie es Herrn Goljädkin
schien, mit einer Miene, die deutlich ausdrückte, daß Anton Antonowitsch
durchaus nicht wünschte, das Gespräch weiter fortzusetzen. „Sie werden
in kurzer Zeit alles erfahren, noch heute werden Sie formell von allem
unterrichtet werden.“
„Was heißt das, formell, Anton Antonowitsch? Warum denn gerade formell?“
fragte kleinlaut unser Held.
„Nicht uns kommt es zu, Jakoff Petrowitsch, darüber zu urteilen, wie die
Regierung entscheidet.“
„Warum denn die Regierung, Anton Antonowitsch,“ fragte Herr Goljädkin
noch kleinlauter, „warum denn die Regierung? Ich sehe keinen Grund,
warum man hier die Regierung beunruhigen sollte, Anton Antonowitsch ...
Sie wollen mir vielleicht etwas in bezug auf das Gestrige sagen, Anton
Antonowitsch?“
„Nein, nicht das Gestrige: dort hinkt noch etwas anderes bei Ihnen.“
„Was hinkt denn bei mir, Anton Antonowitsch? Mir scheint, Anton
Antonowitsch, daß nichts an mir hinkt ...“
„Schlaue Mätzchen wollten Sie machen!“ unterbrach Anton Antonowitsch den
völlig bestürzten Herrn Goljädkin in scharfem Ton. Herr Goljädkin zuckte
zusammen und wurde weiß wie ein Tuch.
„Freilich, Anton Antonowitsch,“ sagte er mit kaum hörbarer Stimme, „wenn
man nur die Stimme der Verleumdung und die unserer Feinde hört, ohne die
Rechtfertigung von der anderen Seite zuzulassen, dann, freilich ...
freilich, Anton Antonowitsch, dann muß man unschuldig leiden, Anton
Antonowitsch, unschuldig und um nichts leiden.“
„Ja – ja – ja, aber Ihr boshafter Angriff auf den Ruf eines
wohlgesitteten Mädchens aus einer ehrenwerten, achtenswerten und
bekannten Familie, die Ihnen Wohltaten erwiesen hat? ...“
„Welch ein Angriff, Anton Antonowitsch?“
„Ja – ja – ja. Und dann Ihr Betragen dem anderen Mädchen gegenüber, wenn
auch einem armen, doch von ehrlicher ausländischer Herkunft – davon
wissen Sie wohl auch nichts?“
„Erlauben Sie, Anton Antonowitsch ... belieben Sie mich, Anton
Antonowitsch, anzuhören ...“
„Und Ihr treuloses Verfahren gegen eine andere Person – und die
verleumderische Beschuldigung dieser anderen Person in Dingen, in denen
Sie selbst, gerade Sie, gesündigt haben? Wie nennt man denn das?“
„Ich, Anton Antonowitsch, ich habe ihn nicht hinausgeworfen,“ sprach
zitternd unser Held – „und Petruschka, das heißt, meinen Diener, habe
ich nicht dazu angehalten ... Er hat mein Brot gegessen, Anton
Antonowitsch, hat meine Gastfreundschaft genossen,“ fügte ausdrucksvoll
und mit tiefem Gefühl unser Held hinzu, so daß ihm das Kinn zu zittern
anfing und er schon wieder Tränen vergießen wollte.
„Das sagen Sie mir so, Jakoff Petrowitsch, daß er Ihr Brot gegessen,“
erwiderte Anton Antonowitsch und in seiner Stimme hörte man ordentlich
die Hinterlist, so daß sich das Herz Herrn Goljädkins schmerzhaft
zusammenzog.
„Erlauben Sie noch eines, Anton Antonowitsch, untertänigst zu fragen,
ist von alledem etwas Seiner Exzellenz bekannt?“
„Selbstverständlich! Doch entschuldigen Sie mich bitte jetzt, ich habe
keine Zeit, mit Ihnen ... Heute noch werden Sie alles erfahren, was Sie
zu erfahren nötig haben.“
„Erlauben Sie, um’s Himmels willen, noch einen Augenblick, Anton
Antonowitsch.“
„Später, später, erzählen Sie später ...“
„Nein, Anton Antonowitsch: ich, sehen Sie, hören Sie nur, Anton
Antonowitsch ... Ich liebe durchaus nicht die Freigeisterei, Anton
Antonowitsch: ich fliehe sie: ich bin durchaus bereit, und ich habe
sogar die Idee gehabt ...“
„Gut, gut. Ich habe schon gehört.“
„Nein, das haben Sie nicht gehört, Anton Antonowitsch. Das ist etwas
ganz anderes, Anton Antonowitsch, das ist gut, wirklich gut und angenehm
zu hören ... Ich gebe diese Idee zu, wie schon gesagt, Anton
Antonowitsch, daß durch die Fügung Gottes zwei ganz ähnliche Wesen
geschaffen wurden, und daß die Regierung, die diese Fügung Gottes sah,
diese beiden Zwillinge versorgt hat. Das ist gut, Anton Antonowitsch,
Sie sehen, daß das sehr gut ist, und daß ich weit entfernt von aller
Freidenkerei bin. Ich sehe die wohltätige Behörde als Vater an. Der
Staat – das heißt, die wohltätige Regierung, und Sie ... das heißt ...
ein junger Mensch muß seinen Dienst tun. Unterstützen Sie mich, Anton
Antonowitsch ... stehen Sie mir bei, Anton Antonowitsch ... Ich tue
nichts Böses, Anton Antonowitsch ... um Gottes willen, noch ein Wort ...
Anton Antonowitsch ...“
Aber Anton Antonowitsch war schon weit entfernt von Herrn Goljädkin ...
Unser Held wußte nicht mehr, wo er stand, was er hörte, was er tat und
was mit ihm geschah, so sehr erschütterte und verwirrte ihn alles
Gehörte und Geschehene.
Mit flehenden Blicken suchte er unter der Menge von Beamten nach Anton
Antonowitsch, um sich noch weiter vor dessen Augen zu rechtfertigen und
ihm irgend etwas Edles und Angenehmes von sich zu sagen ... Doch
zugleich begann, nach und nach, ein neues Licht durch die Verwirrung des
Herrn Goljädkin zu dringen, ein neues, schreckliches Licht, das ihm
plötzlich die Aussicht in bis jetzt vollkommen unbekannte, ganz
ungeahnte Umstände eröffnete ... In diesem Augenblick stieß jemand
unseren Helden in die Seite. Er blickte sich um. Vor ihm stand
Pissarenko.
„Den Brief, Ew. Wohlgeboren.“
„Ah! ... Du bist schon dort gewesen, mein Lieber?“
„Nein, den hat man schon morgens um zehn Uhr hierher gebracht. Ssergej
Michejeff brachte ihn aus der Wohnung des Gouvernements-Sekretärs
Wachramejeff.“
„Gut, mein Freund, gut, ich werde dir dafür erkenntlich sein, mein
Lieber.“
Mit diesen Worten steckte Herr Goljädkin den Brief in die Seitentasche
seines Uniformrockes und knöpfte den letzteren von oben bis unten zu,
dann blickte er sich um und bemerkte zu seiner Verwunderung, daß er sich
bereits in der Vorhalle des Departements befand, umgeben von Beamten,
die dem Ausgange zuströmten, da die Kanzleistunden ihr Ende hatten. Herr
Goljädkin hatte diesen letzteren Umstand nicht nur nicht bemerkt, er
konnte auch nicht begreifen, daß er sich plötzlich in Mantel und
Galoschen befand und seinen Hut in der Hand hielt. Jetzt standen die
Beamten alle unbeweglich in ehrfurchtsvoller Erwartung da. Die Ursache
war nämlich die: Exzellenz selbst wartete unten auf seine Equipage, die
sich aus irgendwelchen Gründen verspätet hatte, und führte mit zwei
Räten und Andrej Philippowitsch ein sehr interessantes Gespräch. Etwas
entfernt von ihnen stand Anton Antonowitsch Ssjetotschkin und noch
einige andere Beamte, die beflissen mitlachten, als sie sahen, daß Seine
Exzellenz zu scherzen und zu lachen beliebte. Die Beamten, die sich oben
auf der Treppe drängten, lachten gleichfalls, wohl in Erwartung, daß
Exzellenz wieder lachen würde. Und es lächelte auch der dicke
aufgeblasene Portier Fedossejitsch, der mit Ungeduld den Augenblick
seiner täglichen Genugtuung erwartete, die darin bestand, daß er mit
einem gewaltigen Ruck die eine Hälfte der großen Tür aufriß, um dann, zu
einem Bogen sich tief hinabbiegend, Seiner Exzellenz ehrerbietig den Weg
freizugeben. Doch mehr als alle freute sich offenbar der unwürdige,
unehrenwerte Feind Herrn Goljädkins. In diesem Augenblick vergaß er
sogar die um ihn stehenden Beamten, bei denen er sich sonst immer nach
seiner unangenehmen Manier so beliebt zu machen suchte, und ließ die
gute Gelegenheit unbenutzt, es auch jetzt zu tun. Er verwandelte sich
ganz in Augen und Ohren und beugte sich weit vor, wahrscheinlich um
Seine Exzellenz besser sehen und hören zu können, und hin und wieder
nur, an der krampfhaften Bewegung der Hände und Füße, bemerkte man die
Aufregung seiner Seele.
„Sieh, wie er sich Mühe gibt!“ dachte unser Held. „Tut, als wäre er ein
Günstling, der Schurke! Ich möchte gern wissen, wie er es nur macht, um
sich in der höheren Gesellschaft zu behaupten. Weder Geist, noch
Charakter, noch Bildung, noch Gefühl: aber es gelingt dem Schurken! Mein
Gott, wie schnell doch ein Mensch vorwärts kommen kann – wenn man das
bedenkt – und sich überall anfreundet! Ich will darauf schwören, daß
dieser Mensch noch weit kommen wird, Glück hat so ein Schuft! Ich möchte
nur wissen, was er ihnen da zusteckt? Welche Beziehungen und Geheimnisse
zwischen ihnen bestehen? Mein Gott! Wie, wenn auch ich mit ihm ein wenig
... – wenn ich ihn vielleicht fragen würde ... so und so ... ich werde
vom Kampf zurücktreten ... nehmen wir einfach an, ich sei der Schuldige
... ich weiß doch, Exzellenz, es muß auch neue Beamte geben ... über
alles aber, was mich angeht, über dieses Dunkle, Unerklärliche werde ich
mich nicht mehr aufregen ... Auch widersprechen werde ich nicht mehr und
alles in Geduld und Ergebung tragen – wie? Sollte ich nicht so handeln?
... Er ist sonst nicht zu fangen, der Halunke, und mit Worten nicht zu
schlagen. Vernunft kann man ihm auch nicht in den Kopf bringen! Also ...
wollen wir es versuchen. Sollte es sein, daß ich einen günstigen
Augenblick erwische, so werde ich es versuchen ...“
In seiner Unruhe, Sorge und Verwirrung fühlte er, daß es so nicht
bleiben könne, daß der entscheidende Augenblick gekommen sei, um sich
endlich mit jemandem auseinanderzusetzen. Unser Held bewegte sich daher
ein wenig auf die Stelle zu, wo sein abscheulicher und rätselhafter
Feind stand, doch in demselben Augenblick rollte die langerwartete
Equipage Seiner Exzellenz vor die Tür. Fedossejitsch riß die Tür auf,
machte drei Bogen nacheinander, während Seine Exzellenz an ihm
vorüberging. Die Wartenden stürzten alle auf einmal zum Ausgang und
drängten Herrn Goljädkin den Älteren von Herrn Goljädkin dem Jüngeren
ab.
„Du entgehst mir nicht!“ dachte unser Held, und schob sich durch die
Menge, ohne den anderen aus dem Auge zu verlieren. Die Menge hatte sich
endlich zerstreut, unser Held fühlte sich wieder befreit und stürzte
seinem Feinde nach.
XI.
Atemlos und wie auf Flügeln eilte Herr Goljädkin dem sich seinerseits
gleichfalls sehr beeilenden Ebenbilde nach. Er fühlte in sich eine
außerordentlich große Energie. Und doch, ungeachtet dieser Energie,
schien es Herrn Goljädkin, daß ihn eine kleine Mücke, wenn eine solche
zurzeit in Petersburg gelebt hätte, mit Leichtigkeit mit ihren Flügeln
überholen könnte. Er fühlte, daß er vor Schwäche förmlich zusammensank,
daß ihn nur eine ganz fremde Kraft weitertrug, daß er selbst nicht mehr
gehen konnte und seine Füße den Dienst versagten. Konnte sich alles das
überhaupt noch zum besten wenden? „Zum besten oder nicht zum besten,“
dachte Herr Goljädkin, atemlos vom Laufen, „daß die Sache ... doch
verspielt ist ... darüber besteht jetzt nicht mehr der kleinste Zweifel
... daß ich vollständig verloren bin, das ist ja bekannt ... beschlossen
... entschieden und unterschrieben!“
Aber ungeachtet dessen war unser Held doch wie von den Toten
auferstanden, es war, als hätte er eine Schlacht gewonnen und einen
großen Sieg erfochten, als es ihm endlich gelang, seinen Feind, der
soeben im Begriff war, seinen Fuß auf den Tritt eines Wagens zu setzen,
am Mantel zu packen.
„Geehrter Herr! Geehrter Herr!“ rief Herr Goljädkin dem Jüngeren zu,
froh, daß er ihn doch noch erwischt ... „Geehrter Herr, ich hoffe, daß
Sie ...“
Aber: „Nein, hoffen Sie schon bitte lieber nichts,“ antwortete ablehnend
der gefühllose Feind Herrn Goljädkins, während er sich zugleich aus
allen Kräften bemühte, mit dem anderen Fuß in den Wagen zu gelangen und
seinen Mantel aus den Händen Herrn Goljädkins zu befreien, – denselben
Mantel, an den sich Herr Goljädkin seinerseits mit allen ihm von Natur
zu Gebote stehenden Kräften geklammert hielt.
„Jakoff Petrowitsch! Nur zehn Minuten ...“
„Entschuldigen Sie, ich habe keine Zeit.“
„Sehen Sie doch selbst ein, Jakoff Petrowitsch ... bitte, Jakoff
Petrowitsch ... Um Christi willen, Jakoff Petrowitsch ... Sehen Sie doch
ein ... daß ich mich mit Ihnen aussprechen muß ... gleich auf dem Fuße
... in einer Sekunde, Jakoff Petrowitsch! ...“
„Mein Lieber, ich habe keine Zeit,“ erwiderte der lügnerische Feind
Herrn Goljädkins in einem unehrerbietig-familiären Tone und mit
erheuchelter Güte. „Zu einer anderen Zeit, glauben Sie mir, von ganzer
Seele und aus vollem Herzen; aber jetzt – jetzt ist es wirklich
unmöglich ...“
„Du Schurke!“ dachte unser Held ... Aber: „Jakoff Petrowitsch!“ rief er
kläglich, „Ihr Feind bin ich niemals gewesen. Böse Menschen haben mich
unbilligerweise verleumdet ... Meinerseits bin ich bereit ... Ist es
Ihnen gefällig, Jakoff Petrowitsch, so könnten wir beide zusammen ...
dort in dieses Café gehen und aus vollem Herzen, wie Sie soeben so schön
sagten, und in gerader, edler Offenheit – ... dann wird sich alles von
selbst aufklären. – Ja, Jakoff Petrowitsch! Dann wird sich alles von
selbst aufklären ...“
„Ins Café? Schön. Ich habe nichts dagegen, nur unter einer Bedingung, du
mein besseres Selbst ... unter einer Bedingung – daß sich dort alles von
selbst aufklärt. Das heißt in einer Weise, mein Lieber ...“ Herr
Goljädkin der Jüngere stieg aus dem Wagen und klopfte unserem Helden
unverschämt vertraulich auf die Schulter.
„Freund meiner Seele, für dich, Jakoff Petrowitsch, bin ich bereit,
überall hinzugehen! So ein Schelm, wirklich, er macht mit den Menschen,
was er will!“ fuhr der verlogene Freund Herrn Goljädkins fort, indem er
sich mit leichtem Lächeln tänzelnd um ihn herum drehte.
Das von der Hauptstraße ziemlich weit entfernte Café, wohin die beiden
Herren gingen, war in diesem Augenblicke vollkommen leer. Eine dicke
Deutsche erschien hinter dem Ladentisch, als beim Eintritt die Türglocke
ertönte. Herr Goljädkin ging mit seinem unwürdigen Freunde in das zweite
Zimmer, wo ein glattgekämmter Kellner sich eben bemühte, das erloschene
Feuer im Ofen wieder anzufachen. Auf Wunsch des Herrn Goljädkin des
Jüngeren wurde Schokolade gebracht.
„Ein unvergleichliches Weibchen!“ bemerkte Herr Goljädkin der Jüngere,
indem er Herrn Goljädkin dem Älteren schalkhaft zulächelte.
Unser Held errötete und schwieg.
„Ach, ja, ich habe vergessen, entschuldigen Sie, ich kenne Ihren
Geschmack. Wir, mein Herr, haben eine Vorliebe für schlanke Deutsche.
Wir, Jakoff Petrowitsch, redliche Seele, wir ziehen Schlanke vor, wenn
sie noch nicht aller Vorzüge bar sind. Wir nehmen bei ihnen unsere
Wohnung, verderben ihre Sittlichkeit, schenken ihnen ob der Bier- und
Milchsuppen, die sie kochen, unser Herz und geben ihnen schriftliche
Versprechen ... das ist’s, was wir tun, du Faublas, du Verführer!“
Auf diese Weise machte Herr Goljädkin eine sehr unnütze und boshaft
schlaue Anspielung auf eine bekannte Person weiblichen Geschlechts,
lächelte unserem Helden dabei unter dem Anschein der Liebenswürdigkeit
zu und trug eine erlogene Freude über das Zusammentreffen mit ihm zur
Schau. Als er aber bemerkte, daß Herr Goljädkin der Ältere durchaus
nicht so dumm und unerfahren war, um alles hinzunehmen, beschloß er,
seine Taktik zu ändern und sich noch rücksichtsloser zu geben.
Und nun zeigte sich die ganze Abscheulichkeit des falschen Herrn
Goljädkin, der mit wahrhaft empörender Unverschämtheit und
Vertraulichkeit dem biederen und wahren Herrn Goljädkin auf die Schulter
klopfte und, nicht genug damit, ihn auf eine unpassende, in anständiger
Gesellschaft ganz ungewohnte Weise und nur, um seine Abscheulichkeit
noch zu übertrumpfen, ohne auf den Widerstand des empörten Herrn
Goljädkin zu achten, einfach in die Backe kniff. Beim Anblick dieser
Verworfenheit verstummte, innerlich rasend, unser Held ... fürs erste
wenigstens.
„Das ist die Sprache meiner Feinde,“ sagte er schließlich, nachdem er
sich vernünftigerweise bezähmt hatte, mit zitternder Stimme. Im selben
Augenblick sah unser Held aber unruhig nach der Tür. Herr Goljädkin der
Jüngere war offenbar so vorzüglicher Laune und bereit zu allerlei
weiteren kleinen Scherzen, wie sie an öffentlichen Orten unerlaubt und
überhaupt in der höheren Gesellschaft nicht zum guten, sondern zum sehr
schlechten Ton gehören.
„Nun, in diesem Falle, wie Sie wollen,“ erwiderte Herr Goljädkin der
Jüngere ernsthaft Herrn Goljädkin dem Älteren und setzte seine mit
unanständiger Gier geleerte Tasse auf den Tisch. „Ich habe Sie lange
nicht mehr gesehen, übrigens ... wie leben Sie denn jetzt, Jakoff
Petrowitsch?“
„Ich kann Ihnen nur eines sagen, Jakoff Petrowitsch,“ antwortete ihm
kaltblütig und mit Würde unser Held, „Ihr Feind bin ich niemals
gewesen.“
„Hm ... nun, aber Petruschka? Petruschka heißt er doch ... nun ja, wie
geht es ihm? Gut? Ganz wie früher?“
„Ja, ganz wie früher, Jakoff Petrowitsch,“ antwortete ein wenig erstaunt
Herr Goljädkin der Ältere. „Ich verstehe Sie nicht, Jakoff Petrowitsch
... ich, meinerseits ... aufrichtig und anständig wie ich bin, Jakoff
Petrowitsch ... sagen Sie selbst, Jakoff Petrowitsch ...“
„Ja, aber Sie wissen doch, Jakoff Petrowitsch,“ antwortete mit leiser
und wehmütiger Stimme Herr Goljädkin der Jüngere, um auf diese Weise
Reue und Bedauern vorzutäuschen, „Sie wissen doch selbst, in unserer
Zeit ist es schwer ... Ich verlasse mich auf Sie, Jakoff Petrowitsch,
Sie sind ja ein kluger Mensch, urteilen Sie doch selbst,“ sagte Herr
Goljädkin der Jüngere, um unserem Helden in seiner gemeinen Art zu
schmeicheln. „Das Leben ist kein Spiel, das wissen Sie doch, Jakoff
Petrowitsch,“ schloß wieder vielsagend Herr Goljädkin der Jüngere und
stellte sich auf diese Weise als klugen und gelehrten Menschen hin, der
über hohe Dinge zu urteilen verstand.
„Meinerseits, Jakoff Petrowitsch,“ antwortete unser Held voll Bewegung,
„meinerseits verachte ich jeden Nebenweg und ich gestehe aufrichtig und
geradeaus ... und stelle die ganze Sache damit auf einen anständigen
Grund und Boden ... und kann offen und ehrlich behaupten, Jakoff
Petrowitsch ... daß mein Gewissen vollkommen rein ist! Sie wissen
selbst, Jakoff Petrowitsch, die gegenseitige Verirrung ... vielleicht
nur ein Mißverständnis ... alles ist möglich – das Urteil der Welt und
die Meinung der blinden Masse ... Ich sage es aufrichtig, Jakoff
Petrowitsch, alles ist möglich! Und ich sage noch mehr, Jakoff
Petrowitsch ... wenn man so urteilt, wenn man von einem edlen und hohen
Standpunkt aus auf diese Sache sieht, und ohne falsche Scham, Jakoff
Petrowitsch ... es ist mir sogar angenehm zu bekennen, daß ich auf
Irrwege geraten war, ja, es ist mir sogar angenehm, das einzugestehen.
Sie können sich das doch selbst sagen, Sie sind doch ein kluger Mann und
obendrein edel. Ohne Scham, ohne falsche Scham, bin ich bereit, dies
einzugestehen ...“ so schloß unser Held würdevoll.
„Das ist Schicksal, Verhängnis, Jakoff Petrowitsch ... doch lassen wir
das alles,“ sagte mit einem Seufzer Herr Goljädkin der Jüngere.
„Gebrauchen wir lieber die kurzen Minuten unseres Zusammenseins zu einem
nützlicheren und angenehmeren Gespräch, – wie es sich zwischen Kollegen
geziemt ... Es gelang mir in der Tat nicht, in dieser ganzen Zeit zwei
Worte mit Ihnen zu reden. Daran bin ich nicht schuld, Jakoff
Petrowitsch!“
„Ich auch nicht, Jakoff Petrowitsch,“ unterbrach ihn freudig unser Held
– „ich auch nicht. Mein Herz sagt mir, Jakoff Petrowitsch, daß ich in
allen diesen Dingen nicht schuld bin. In diesem Fall wollen wir das
Schicksal anklagen, Jakoff Petrowitsch,“ fügte Herr Goljädkin der Ältere
in versöhnlichem Tone hinzu. Seine Stimme wurde nach und nach schwächer
und zitterte.
„Nun, wie steht es denn im allgemeinen mit Ihrer Gesundheit?“ fragte der
Verworfene mit süßer Stimme.
„Ich huste ein wenig,“ antwortete noch süßer unser Held.
„Nehmen Sie sich in acht. Jetzt gibt es so böse Winde, man kann sich
sehr leicht eine Lungenentzündung holen, ich gestehe Ihnen, daß ich mich
allmählich daran gewöhne, unter allen meinen Kleidungsstücken noch
Flanell zu tragen.“
„Es ist wahr, Jakoff Petrowitsch, man sollte sich lieber keine
Lungenentzündung holen ... Jakoff Petrowitsch!“ stieß nach kurzem
Schweigen unser Held hervor, „Jakoff Petrowitsch! Ich sehe, daß ich mich
geirrt habe ... Ich denke mit Rührung an die glücklichen Augenblicke,
die uns vergönnt waren, zusammen zu verbringen, unter meinem armen, aber
ich kann wohl sagen, unter meinem gastfreundlichen Dach.“
„In Ihrem Brief haben Sie sich nicht so ausgedrückt,“ bemerkte halb
vorwurfsvoll, aber mit vollem Recht und der Wahrheit entsprechend (wenn
auch nur in diesem einen Fall) Herr Goljädkin der Jüngere.
„Jakoff Petrowitsch! Ich irrte mich ... Ich sehe es jetzt ganz deutlich,
daß ich mich in dem unglücklichen Brief geirrt habe. Jakoff Petrowitsch,
es ist mir peinlich, Sie anzusehen, Jakoff Petrowitsch, glauben Sie es
mir ... Geben Sie mir den Brief zurück, damit ich ihn vor Ihren Augen
zerreißen kann, Jakoff Petrowitsch, oder, wenn das nicht mehr möglich
ist, dann lesen Sie ihn umgekehrt – ich meine, ganz und gar im
umgekehrten Sinne, das heißt, in freundschaftlicher Absicht, indem Sie
allen Worten in meinem Brief den umgekehrten Sinn beilegen. Ich habe
mich geirrt ... Verzeihen Sie mir, Jakoff Petrowitsch, ich habe mich
ganz und gar geirrt, Jakoff Petrowitsch.“
„Was sagen Sie?“ fragte zerstreut und gleichgültig der treulose Freund
Herrn Goljädkins des Älteren.
„Ich sagte, daß ich mich ganz und gar geirrt habe, Jakoff Petrowitsch,
und daß ich meinerseits ganz ohne falsche Scham ...“
„Ah! Nun gut, das ist sehr gut, daß Sie sich geirrt haben,“ antwortete
ihm grob Herr Goljädkin der Jüngere.
„Ich hatte sogar, Jakoff Petrowitsch, die Idee,“ fügte unser Held in
seiner anständigen Weise offenherzig hinzu, ohne die Falschheit seines
verlogenen Freundes zu bemerken, „ich hatte sogar die Idee, daß hier
zwei ganz ähnliche ...“
„Ah, das ist Ihre Idee! ...“
Hier stand der durch seine Ruchlosigkeit bekannte Herr Goljädkin der
Jüngere auf und griff nach seinem Hut. Ohne die schlechte Absicht zu
bemerken, erhob sich auch Herr Goljädkin der Ältere, mit gutmütigem
Lächeln seinen Pseudofreund ansehend, und in seiner Unschuld bemühte er
sich noch weiter, ihm zu schmeicheln und ihn für die neue Freundschaft
zu gewinnen ...
„Leben Sie wohl, Ew. Exzellenz!“ rief plötzlich Herr Goljädkin der
Jüngere. Unser Freund zuckte zusammen und bemerkte im Gesicht seines
Freundes etwas Satanisches und nur um ihn los zu werden, legte er in die
ausgestreckte Hand des Verruchten zwei Finger seiner Hand. Nun aber ...
nun überstieg die Schamlosigkeit Herrn Goljädkins des Jüngeren alle
Grenzen und erschöpfte das Maß menschlicher Geduld, das man haben
konnte. Nachdem er die zwei Finger Herrn Goljädkins des Älteren gedrückt
hatte, wiederholte der Unwürdige –: wahrhaftig, er tat es – vor den
Augen des Herrn Goljädkin seinen schamlosen Scherz von heute morgen ...
Herr Goljädkin der Jüngere hatte bereits sein Taschentuch wieder
eingesteckt, mit dem er seine Finger abgewischt, als Herr Goljädkin der
Ältere erst zu sich kam und dem anderen ins Nebenzimmer nachstürzte,
wohin sich sein unversöhnlicher Feind nach seiner schändlichen
Gewohnheit verkrochen hatte. Als ob nichts geschehen wäre, stand er vor
dem Büfett und aß Kuchen, während er ganz ruhig, wie ein rechter
Lebemann der Dame am Büfett den Hof machte.
„In Gegenwart von Damen ist es nicht erlaubt,“ dachte unser Held und
ging gleichfalls ans Büfett, ganz besinnungslos vor Aufregung.
„Nicht wahr, das Weibchen ist nicht übel! Wie denken Sie darüber?“
begann von neuem Herr Goljädkin _junior_ mit seinen unpassenden
Bemerkungen, denn er rechnete offenbar mit der unendlichen Geduld Herrn
Goljädkins. Die dicke Deutsche ihrerseits sah auf ihre beiden Gäste mit
blöden Augen, da sie wohl die russische Sprache nicht verstand, und
lächelte nur zuvorkommend.
Bei den schamlosen Worten Herrn Goljädkins des Jüngeren sprang unser
Held auf, und unfähig, sich noch länger zu beherrschen, stürzte er sich
endlich auf ihn, um ihn zu zerreißen und um ein Ende mit ihm – mit allem
zu machen. Doch Herr Goljädkin der Jüngere war nach seiner üblen
Gewohnheit schon längst auf und davon und befand sich bereits auf der
Treppe. Aber auch Herr Goljädkin der Ältere raffte sich auf und folgte,
so schnell als möglich, seinem Beleidiger, der sich in eine Droschke
setzte, die offenbar auf ihn gewartet hatte, und deren Kutscher wohl mit
ihm in Einvernehmen stand. Als die Dame am Büfett die Flucht ihrer
beiden Gäste bemerkte, schrie sie auf und klingelte aus aller Kraft mit
der Glocke. Unser Held wandte sich rasch um, warf ihr Geld hin, für sich
und den schamlosen Menschen, der natürlich wieder nicht bezahlt hatte,
verlangte auch nichts zurück, raste nur hinaus, und ungeachtet dieser
Verzögerung gelang es ihm noch, seinen Feind zu ergreifen.
Unser Held klammerte sich mit allen ihm von Natur zur Gebote stehenden
Kräften an die Droschke und lief einige Straßen lang mit ihr, bis es ihm
schließlich gelang, in die Droschke hineinzuklettern, die Herr Goljädkin
der Jüngere freilich aus allen Kräften verteidigte. Der Kutscher
bearbeitete unterdessen seinen alten Gaul, der seiner schlechten
Gewohnheit nach sofort in einen Galopp verfiel und bei jedem dritten
Schritt mit den Hinterbeinen ausschlug, mit der Knute, mit den Zügeln,
und selbst mit den Füßen.
Endlich hatte sich unser Held die Droschke erobert. Er stemmte sich mit
dem Rücken an den Kutscher, war also mit dem Gesicht und Knie an Knie
seinem Feinde zugewandt. Mit der rechten Hand hielt er den schäbigen
Pelzkragen seines Feindes gepackt.
So fuhren die beiden Feinde eine Zeitlang schweigend dahin. Unser Held
wagte kaum zu atmen, der Weg war erbärmlich und bei jedem Schritt wankte
er hin und her und war in ständiger Gefahr, sich den Hals zu brechen.
Dazu wollte sein erbitterter Feind sich ihm immer noch nicht ergeben,
mühte sich vielmehr, seinen Gegner in den Schmutz hinauszuwerfen. Das
Wetter war, was zu allen Unannehmlichkeiten noch hinzukam, geradezu
entsetzlich. Der Schnee fiel in dicken nassen Flocken, die in den
offenen Mantel des wirklichen Herrn Goljädkin eindrangen. Ringsum war es
dunkel und man konnte kaum die Hand vor den Augen sehen. Es war daher
schwer zu erraten, wohin und durch welche Straßen sie fuhren ... Herrn
Goljädkin schien es dabei, als erlebte er etwas, das ihm bereits längst
bekannt war. Einen Augenblick suchte er sich zu vergewissern, und dachte
nach, ob er nicht gestern abend schon etwas Ähnliches – geahnt hatte –
... im Traum –? Endlich erreichte sein Zustand die äußerste Grenze.
Schreiend wollte er sich auf seinen Gegner stürzen. Doch der Schrei
erstarb auf seinen Lippen. Es gab einen Augenblick, in dem Herr
Goljädkin alles zu vergessen schien und überzeugt war, daß das ganze gar
nichts bedeute, sondern nur so, nur so irgendwie, auf unerklärliche
Weise geschehen sei, und daß es in dem Falle eine ganz verlorene Sache
wäre, dagegen anzukämpfen.
Doch plötzlich und fast im selben Augenblick, als unser Held zu diesem
Schluß kam, veränderte ein unvorsichtiger Stoß die Lage der Dinge. Herr
Goljädkin fiel wie ein Mehlsack aus der Droschke und erkannte während
des Falles ganz vernünftiger Weise, daß er sich wirklich ganz zur
unrechten Zeit erhitzt hatte. Als er wieder aufgesprungen war, sah er,
daß sie irgendwo angelangt waren: die Droschke stand auf einem Hof, und
Herr Goljädkin sah auf den ersten Blick, daß es der Hof des Hauses war,
in dem – Olssuph Iwanowitsch wohnte. In demselben Augenblick bemerkte
er, daß sich sein Freund bereits auf der Treppe zu Olssuph Iwanowitsch
befand.
In seiner Not und Verzweiflung wollte er schon seinem Feinde nachjagen,
doch zu seinem Glück bedachte er sich noch beizeiten. Er vergaß nicht,
den Kutscher zu bezahlen, trat auf die Straße hinaus und lief so schnell
er konnte und wohin ihn seine Füße trugen. Es schneite wie vorhin und es
war feucht und dunkel. Unser Held ging nicht, sondern flog, und warf
alle und alles auf seinem Wege um – Männer, Weiber und Kinder, und
stolperte selbst über die Männer, Weiber und Kinder, die er umgeworfen
hatte. Um ihn und hinter ihm her hörte man erschreckte Stimmen ... hörte
schreien, rufen ... Doch Herr Goljädkin, schien es, war nicht bei
Besinnung und schenkte alledem nicht die geringste Aufmerksamkeit ... Er
kam erst zu sich, als er sich bei der Ssemjonoffbrücke befand und da
auch nur dank dem Umstande, daß es ihm gelungen war, zwei Weiber, die
Eßwaren trugen, umzurennen und dabei selbst zu Fall zu kommen.
„Das tut nichts,“ dachte Herr Goljädkin, „alles das kann sich noch zum
besten wenden!“ Er griff in die Tasche, um die Weiber mit einem Rubel
für die rings verstreuten Kringel, Äpfel, Nüsse usw. zu entschädigen.
Plötzlich wurde Herr Goljädkin von einem neuen Licht erleuchtet: in der
Tasche fand er den Brief, den ihm der Schreiber am Morgen überreicht
hatte. Er erinnerte sich unter anderem, daß sich hier, nicht weit
entfernt, ein bekanntes Gasthaus befand, und so lief er denn, ohne Zeit
zu verlieren, sofort dahin, setzte sich an einen mit einem Talglicht
erleuchteten Tisch, schenkte niemandem und nichts seine Aufmerksamkeit,
hörte den Kellner nicht, der ihn nach seinen Wünschen fragte, zerbrach
das Siegel und begann den folgenden Brief zu lesen, der ihn nun
allerdings vollständig fassungslos machte:
„Edler, für mich leidender und auf ewig meinem Herzen teurer Mann!
Ich leide, ich gehe zugrunde – rette mich! Der Verleumder, der
Intrigant und durch seine Nichtswürdigkeit bekannte Mensch hat mich
mit seinen Netzen umstrickt und mich zugrunde gerichtet. Ich fiel! –
Doch er ist mir zuwider, aber du! ... Man hat uns voneinander
gerissen, meine Briefe an dich gestohlen – und alles das tat der
Unwürdige, indem er sich seiner besten Eigenschaft bediente – der
Ähnlichkeit mit dir. Jedenfalls kann man schlecht sein und dennoch
durch Geist, Gefühl und angenehme Manieren entzücken ...
Ich gehe zugrunde! Man wird mich mit Gewalt verheiraten, und am
meisten intrigiert dafür mein Vater und Wohltäter, Staatsrat Olssuph
Iwanowitsch, der die Rolle, die ich im Hause und in der höheren
Gesellschaft spiele, für sich in Anspruch nehmen will ...
Aber ich bin entschlossen und widersetze mich, mit allen mir von der
Natur geliehenen Mitteln. Erwarte mich heute im Wagen um neun Uhr
vor den Fenstern unserer Wohnung. Bei uns ist wieder Ball und der
schöne Leutnant wird da sein. Ich werde herauskommen und wir fliehen
dann. Gibt es doch auch noch andere Beamtenstellen, in denen man
seinem Vaterlande dienen kann. Jedenfalls, denke daran, mein Freund,
daß die Unschuld stark ist durch sich selbst!
Lebe wohl, erwarte mich im Wagen vor der Haustür. Ich flüchte mich
in den Schutz deiner Arme, punkt zwei Uhr nach Mitternacht. Dein bis
zum Grabe!
Klara Olssuphjewna.“
Nachdem unser Held den Brief gelesen hatte, war er einige Augenblicke
wie betäubt. In schrecklicher Angst, in schrecklicher Aufregung, bleich
wie ein Tuch, mit dem Brief in der Hand ging er im Zimmer auf und ab.
Zum Übermaß seines Mißgeschicks und seiner Lage, bemerkte unser Held
nicht, daß er der Gegenstand gespannter Aufmerksamkeit von seiten aller
Anwesenden war. Die Unordnung seiner Kleidung, seine heftige Aufregung,
sein Auf und Ab, das Gestikulieren mit beiden Händen, vielleicht einige
rätselhafte Worte, die er in Selbstvergessenheit laut gesprochen – alles
das machte wahrscheinlich auf die Anwesenden keinen gerade guten
Eindruck und namentlich dem Kellner schien er verdächtig.
Endlich bemerkte unser Held, der plötzlich zu sich kam, daß er mitten im
Zimmer stand und fast unhöflich einen Greis von ehrwürdigem Aussehen
anstarrte, der nach Beendigung seiner Mahlzeit vor dem Gottesbilde
gebetet hatte und jetzt seinen Blick von Herrn Goljädkin nicht abwandte.
Verwirrt blickte unser Held um sich und bemerkte nun, daß alle, wirklich
alle, ihn mit mißtrauischen und bösen Blicken betrachteten.
Plötzlich verlangte ein verabschiedeter Offizier mit rotem Kragen laut
die „Polizeinachrichten“. Herr Goljädkin fuhr zusammen und errötete:
dabei senkte er seine Augen zu Boden und bemerkte seine in Unordnung
geratene Kleidung. Die Stiefel, die Beinkleider und die ganze linke
Seite waren vollständig beschmutzt, die Schuhriemen offen, der Rock an
mehreren Stellen zerrissen. Tief bekümmert trat unser Held an einen
Tisch und sah, daß ein Angestellter ihn ununterbrochen und frech
beobachtete. Ganz verloren und niedergedrückt fing nun unser Held an,
den Tisch zu betrachten, vor dem er stand. Auf dem Tische standen
gebrauchte Teller, von einem beendeten Mittagessen, lagen schmutzige
Servietten und soeben gebrauchte Löffel, Gabeln und Messer.
„Wer hat denn hier gegessen?“ dachte unser Held. „Doch nicht etwa ich?
Alles ist ja möglich! Ich habe vielleicht gegessen und es nur nicht
bemerkt.“
Als Herr Goljädkin aufblickte, bemerkte er wieder den Kellner neben
sich, der im Begriff schien, ihm etwas zu sagen.
„Wieviel haben Sie von mir zu bekommen?“ fragte unser Held mit
zitternder Stimme.
Ein lautes Gelächter erschallte rings um Herrn Goljädkin. Auch der
Kellner lachte. Herr Goljädkin begriff, daß er wieder einmal eine
schreckliche Dummheit begangen hatte. Als er das einsah, wurde er so
verwirrt, daß er genötigt war, in die Tasche nach dem Taschentuch zu
greifen, wahrscheinlich nur, um irgend etwas zu tun und nicht so
dazustehen. Doch zu seiner und aller Anwesenden Verwunderung zog er mit
seinem Taschentuch zugleich ein Medizinfläschchen heraus, das ihm vor
vier Tagen Krestjan Iwanowitsch, der Doktor, verschrieben hatte.
„Das ist die Medizin aus jener Apotheke,“ ging es Herrn Goljädkin durch
den Kopf und plötzlich zuckte er zusammen und schrie auf vor Schreck.
Ein neues Licht ging ihm auf ... Die dunkle, widerlich rote Flüssigkeit
schimmerte mit ihrem bösen Glanz vor den Augen des Herrn Goljädkin ...
Das Fläschchen fiel zu Boden und zerbrach in Stücke. Unser Held schrie
nochmals auf und sprang ein paar Schritte vor der umherspritzenden
Flüssigkeit zurück ... er zitterte an allen Gliedern und der Schweiß
brach ihm aus Stirn und Schläfen.
„Der Mensch ist ja krank!“ rief man. Inzwischen erhob sich im Raum eine
Bewegung und ein Gedränge. Alle umringten Herrn Goljädkin. Alle redeten
auf ihn ein, einige faßten ihn sogar am Rock. Doch unser Held stand da,
unbeweglich, er sah nichts, er hörte nichts, er fühlte nichts ...
Endlich riß er sich los und stürzte davon. Er stieß zurück, die ihn
halten wollten, sprang fast ohne Besinnung in die erste beste Droschke
und floh nach Haus.
Im Vorzimmer seiner Wohnung begegnete er Michejeff, dem Kanzleidiener,
mit einem Schreiben in der Hand.
„Ich weiß, mein Freund, ich weiß alles!“ antwortete mit schwacher,
kläglicher Stimme unser Held. „Das ist ein offizieller ...“
Das Schreiben war an Herrn Goljädkin gerichtet, mit einer Unterschrift
von Andrej Philippowitsch versehen, und in ihm wurde er aufgefordert,
alle in seinen Händen befindlichen Akten dem Kanzleidiener zu übergeben.
Herr Goljädkin nahm das Schreiben und gab dem Diener ein
Zehnkopekenstück, trat in sein Zimmer und sah, wie Petruschka seine
Sachen in einen Haufen zusammenpackte, offenbar in der Absicht, Herrn
Goljädkin zu verlassen, und bei Karolina Iwanowna, die ihn seinem Herrn
abspenstig gemacht hatte, deren Eustaphia zu ersetzen.
XII.
Petruschka trat ein, sonderbar nachlässig, mit einer triumphierenden
Miene. Man sah ihm an, daß er sich irgend etwas dabei dachte und sich
vollkommen in seinem Recht fühlte. Auch sah er ganz so aus, wie jemand,
der keinen Dienst mehr ausübte, der bereits der Diener eines anderen
war, und nicht mehr der seines früheren Herrn.
„Nun, siehst du, mein Lieber,“ begann atemschöpfend unser Held. „Wieviel
Uhr ist es jetzt?“
Petruschka begab sich schweigend hinter den Verschlag, kehrte darauf
langsam zurück und meldete in ziemlich gleichgültigem Tone, daß es bald
halb acht Uhr sei!
„Nun gut, mein Lieber, gut. Siehst du, mein Lieber ... erlaube, daß ich
dir sage, mein Lieber, daß zwischen uns, scheinbar, jetzt alles zu Ende
ist.“
Petruschka schwieg.
„Nun, und jetzt, da zwischen uns alles zu Ende ist, sage mir aufrichtig,
wie ein Freund sage mir, wo du warst, mein Lieber?“
„Wo ich war? Bei guten Menschen war ich.“
„Ich weiß es, mein Freund, ich weiß es. Ich war mit dir immer zufrieden,
mein Lieber und werde dir ein gutes Zeugnis geben ... Nun, wirst du denn
jetzt bei ihnen dienen?“
„Herr, Sie belieben ja selbst zu wissen ... Ein guter Mensch kann einen
nichts Schlechtes lehren.“
„Ich weiß es, mein Lieber, ich weiß es. Gute Menschen gibt es jetzt
selten. Schätze sie hoch, mein Freund. Nun, wer sind sie denn?“
„Das ist doch bekannt, wer ... jedenfalls kann ich bei Ihnen, Herr,
nicht länger dienen. Sie belieben das selbst zu wissen.“
„Ich weiß es, mein Lieber, ich weiß es, ich kenne deinen Eifer, ich habe
alles gesehen, alles bemerkt. Ich, mein Freund, achte dich. Ich achte
jeden guten und ehrlichen Menschen, auch wenn er nur ein Diener ist.“
„Nun, das ist bekannt. Unsereiner muß dahin gehen, wo es besser ist. So
ist’s. Sie belieben zu wissen, Herr, ohne einen guten Menschen kann ich
nicht ... –“
„Schon gut, mein Lieber, schon gut. Ich weiß es ... Nun, hier hast du
dein Geld und ein Zeugnis. Jetzt umarmen wir uns, und verzeihen uns
gegenseitig ...“
Petruschka blickte ihn an.
„Nun, mein Lieber, bitte ich dich noch um einen Dienst, um einen letzten
Dienst,“ sagte Herr Goljädkin in feierlichem Tone. „Siehst du, mein
Lieber, alles ist möglich. Kummer, mein Freund, herrscht auch in
Palästen, und man kann ihm nirgends entgehen. Du weißt, mein Freund, ich
war gegen dich immer freundlich ...“
Petruschka schwieg.
„Ich war, dachte ich, immer freundlich gegen dich, mein Lieber ... Aber
sag, was haben wir denn jetzt noch an Wäsche, mein Lieber?“
„Alles was da ist! Leinene Hemden sechs, Socken drei Paar, vier
Vorhemden, eine Flanelljacke, Unterbeinkleider zwei. Sie wissen ja
selbst alles. Ich, Herr, rühre von dem Ihrigen nichts an ... Ich, Herr,
hüte Ihr Eigentum ... Ich, Herr, es ist Ihnen doch bekannt, habe mir nie
eine Sünde ... Herr, Sie wissen doch selbst, Herr ...“
„Ich glaube dir, mein Freund, ich glaube Dir. Nicht das meine ich, mein
Freund, nicht das, siehst du, mein Freund ...“
„Es ist bekannt, Herr, und wir wissen es ja! Als ich damals noch beim
General Stolbujäkoff diente, da entließen sie mich, als sie selbst nach
Saratoff reisten ... ein Gut haben sie dort ...“
„Nein, mein Freund, ich rede nicht davon, denke nicht etwa ... mein
lieber Freund ...“
„Das ist bekannt. Wie sollte wohl unsereins – Sie belieben das ja selbst
zu wissen –, Leute verleumden! Aber mit mir war man überall zufrieden.
Das waren Minister, Generäle, Senatoren, Grafen. Ich diente bei vielen,
beim Fürsten Swintschatkin, beim Hauptmann Pereborkin, beim General
Njedobaroff, sie fuhren alle auf ihre Güter ... Das ist doch bekannt
...“
„Gewiß, mein Freund, gewiß, gut, mein Freund, gut. Siehst du, mein
Freund, auch ich werde jetzt verreisen ... Jeder hat seinen Weg, mein
Lieber, und keiner weiß, wohin er verschlagen wird! ... Jetzt, mein
Freund, muß ich mich umkleiden. Gib mir die Uniform heraus, andere
Beinkleider, Tücher, Betten, Kissen ...“
„Soll ich alles in ein Bündel packen?“
„Ja, mein Freund, meinetwegen alles in ein Bündel! Wer weiß, was noch
alles mit mir geschehen wird! ... Nun, jetzt, mein Lieber, gehe und hole
mir einen Wagen ...“
„Einen Wagen?“
„Ja, mein Freund, einen Wagen, einen bequemen – miete einen auf längere
Zeit! Aber du, mein Freund, mußt nicht etwa denken ...“
„Wollen Sie weit fahren? ...“
„Ich weiß es nicht, mein Freund, das weiß ich selbst nicht. Ich denke,
ein Federbett muß man auch hineinlegen. Wie denkst du, mein Freund? Ich
verlasse mich ganz auf dich, mein Lieber ...“
„Wünschen Sie sofort abzufahren?“
„Ja, mein Freund, ja! Die Umstände verlangen es ... so steht es, mein
Lieber, so steht es ...“
„Ich verstehe, Herr! Damals, bei uns im Regiment, war das mit einem
Leutnant ebenso: von einem Gutsbesitzer weg ... entführte er sie ...“
„Entführte? ... Wie! Mein Lieber, du ...“
„Ja, entführte, und im nächsten Ort wurden sie getraut. Alles war schon
vorbereitet worden ... Es gab eine Verfolgung. Der jetzt verstorbene
Fürst jagte ihnen selbst nach, nun ... die Sache wurde beigelegt ...“
„Sie wurden getraut. Ja? ... Du, mein Lieber, wie weißt du denn das,
mein Lieber?“
„Nun, das ist doch bekannt! Die Erde trägt das Gerücht weiter, Herr! Wir
wissen doch alles, Herr. Natürlich, wer ist denn ohne Sünde? Aber, ich
sage Ihnen jetzt nur, Herr, einfach, geradeaus, Herr: wenn das jetzt so
ist, so sage ich Ihnen, Herr, daß Sie einen Feind haben, einen
Nebenbuhler, Herr, einen starken Nebenbuhler, so ist’s! ...“
„Ich weiß, mein Freund, ich weiß. Du weißt es also auch, mein Lieber ...
Nun, darin kann ich mich ganz auf dich verlassen! Was sollen wir also
tun, mein Freund, was kannst du mir raten?“
„Aber, Herr, wenn Sie sich auf solche Sachen gelegt haben, Herr, dann
müssen Sie noch etwas dazukaufen, wie Laken, Kissen, ein anderes
Federpfühl, ein zweischläfriges, eine gute Decke ... hier beim Nachbarn
unten ist eine Verkäuferin, Herr, die hat einen Fuchspelz zu verkaufen,
den könnte man sich ansehen, sofort hingehen, ansehen und kaufen. Sie
werden ihn nötig haben, Herr, ein schöner Fuchspelz mit Atlas bezogen
...“
„Schon gut, mein Freund, schon gut; ich bin ganz mit dir einverstanden;
ich verlasse mich ganz auf dich. Meinetwegen, also den Pelz ... Aber nur
schnell, schnell! Um Gottes willen, schnell! Ich werde auch den Pelz
kaufen, nur bitte – schnell! Es ist bald acht Uhr, schneller, um Gottes
willen, schneller, mein Freund! Beeile dich, mein Freund! ...“
Petruschka warf das Bündel Wäsche, Kissen, Decken, Laken und all den
anderen Kram zu Boden und stürzte aus dem Zimmer. Herr Goljädkin griff
unterdessen noch einmal zum Brief, doch lesen konnte er ihn nicht. Mit
beiden Händen griff er nach seinem armen Kopf und lehnte sich vor
Verwunderung an die Wand. Denken konnte er an nichts, tun konnte er auch
nichts, er wußte selbst nicht, was er beginnen sollte. Endlich, als er
bemerkte, daß die Zeit verstrich, und weder Petruschka noch der
Fuchspelz erschienen war, entschloß sich Herr Goljädkin, selbst zu
gehen. Als er die Tür zum Flur öffnete, hörte er unten auf der Treppe
lärmen, sprechen, zetern ... Einige Nachbarsleute schrien und stritten
sich – und Herr Goljädkin wußte sofort, worüber. Er hörte Petruschkas
Stimme und darauf Schritte nahen. „Gütiger Himmel! sie werden die ganze
Welt zusammenrufen!“ stöhnte Herr Goljädkin, rang die Hände vor
Verzweiflung und stürzte zurück in sein Zimmer. Dort warf er sich fast
besinnungslos auf den Diwan, mit dem Gesicht in die Kissen. Nachdem er
einen Augenblick so gelegen hatte, sprang er wieder auf und ohne
Petruschka zu erwarten, zog er seine Galoschen und seinen Mantel an,
setzte seinen Hut auf, griff nach seinen Papieren und stürzte auf die
Treppe hinaus.
„Es ist nichts nötig, mein Lieber! Ich werde selbst, ich werde alles
selbst besorgen. Laß nur vorläufig alles so stehen, unterdessen wird
sich vielleicht das Ganze zum besten wenden,“ flüsterte Herr Goljädkin
eilig Petruschka zu, dem er auf der Treppe begegnete. Darauf lief er die
Treppe hinunter und zum Hause hinaus. Sein Herz stand ihm still – er
konnte sich zu nichts entschließen ... Was sollte er beginnen, wie
sollte er in dieser kritischen Lage handeln ...
„Nun, wie soll ich handeln? Herr, du mein Gott, das mußte gerade noch
kommen!“ rief er endlich verzweifelt aus und strich ziellos die Straße
entlang, „das mußte gerade noch kommen! Wenn nur das nicht wäre, gerade
das, dann würde sich noch alles ordnen und beilegen lassen, mit einem
Schlage, mit einem gewandten und festen Schlage würde es sich machen
lassen. Ich lasse mir den Finger abschneiden, daß es sich machen ließe!
Und ich weiß sogar, auf welche Weise es zu machen ginge. Es würde so
gemacht werden: Ich würde also – ich würde das und das, das heißt würde
so und so sagen ... ‚mein Herr, mit Erlaubnis gesagt, solche Sachen tut
man nicht, mein sehr geehrter Herr, solche Sachen tut man nicht und mit
Betrug erreicht man gar nichts: ein Usurpator, mein Herr, ist ein
unnützer Mensch, das heißt ein Mensch, der seinem Vaterlande keinen
Nutzen bringt. Verstehen Sie das? Verstehen Sie das wohl, mein sehr
geehrter Herr?!‘ So, – ja so wäre es zu machen! ...“
„Doch übrigens, – nein: wie ist das ... Das wäre auch nicht das
Richtige, durchaus nicht das Richtige ... Was lüge ich, Dummkopf,
Erzdummkopf! Ich, Selbstmörder, ich ... Du verworfener Mensch, so wird
es nun kommen! ... Wohin soll ich mich jetzt verkriechen? Was werde ich
zum Beispiel jetzt mit mir anfangen? Wozu tauge ich jetzt noch? Wozu
taugst du jetzt noch, Goljädkin, du Unwürdiger! Was – nun?
Einen Wagen muß ich nehmen. Also nimm, bitte, einen Wagen für sie, sonst
macht sie sich die Füßchen naß, wenn es keinen Wagen gibt ... oh, wer
hätte das denken können? Ei, ei, meine Dame, ei, ei, mein
wohlanständiges Fräulein! Sie haben sich ausgezeichnet, meine Herrin,
ausgezeichnet ... Und das kommt alles von der schlechten Erziehung. Wie
ich das jetzt übersehe und es durchschaut habe – so ist alles
Sittenlosigkeit. Man hätte ihr von Jugend auf – die Rute, tüchtig die
Rute geben sollen, sie aber haben sie statt dessen mit Konfekt und allen
Süßigkeiten gefüttert und der Alte selbst heulte ihr die Ohren voll:
‚Ach, du meine Liebe, meine Gute, ich werde dich an einen Grafen
verheiraten! ...‘
Und was ist dabei herausgekommen? Sie hat uns jetzt ihre Karten gezeigt,
da – habt ihr es, das ist mein Spiel! Wenn sie sie doch zu Hause erzogen
hätten, statt sie in die Pension zu der französischen Madame zu geben,
irgend so einer Emigrantin! Da lernen sie wohl viel Gutes, bei der
Emigrantin ... und – da kommt dann so etwas heraus! Gehen Sie jetzt und
freuen Sie sich! ‚Seien Sie mit dem Wagen um so und so viel Uhr unter
meinem Fenster und singen Sie eine gefühlvolle spanische Romanze: ich
werde Sie erwarten, ich weiß, daß Sie mich lieben, fliehen wir zusammen,
um in einer Hütte zu leben!‘
Doch, am Ende geht das nicht an: wenn Sie schon so weit gehen, meine
Dame ... das geht nicht an! Die Gesetze verbieten es, ein ehrliches und
unschuldiges Mädchen ohne Einwilligung der Eltern aus dem Elternhause zu
entführen! Und schließlich auch: warum? Ich sehe gar keine
Notwendigkeit. Mag sie heiraten, wie es sich gehört, und wen das
Geschick ihr bestimmt hat, das wäre eine vernünftige Sache. Ich aber bin
ein Beamter und kann deshalb meine Stellung verlieren. Ich, meine Dame,
kann deshalb vor Gericht kommen! Sehen Sie, so ist’s, wenn Sie das noch
nicht gewußt haben! Diese Deutsche hat das alles eingebrockt, dieser
ganze Wirrwarr geht von ihr aus. Deshalb haben sie einen Menschen
verleumdet. Deshalb haben sie Weibergeschwätz über ihn ausgedacht, auf
den Rat Andrej Philippowitschs. Von dort kommt alles her. Denn sonst,
warum haben sie Petruschka hineingezogen? Was hat denn der mit der Sache
zu schaffen? Was hat der Schelm bei ihr zu tun?
‚Nein, es geht nicht, meine Dame, es geht wirklich nicht, ich kann nicht
... Für dieses Mal, meine Dame, müssen Sie mich schon entschuldigen. Das
kommt alles von Ihnen, meine Dame, nicht von der Deutschen, nicht von
der Hexe, sondern einfach von Ihnen selbst. Denn die Hexe ist eine gute
Frau, die Hexe ist an nichts schuld, sondern Sie, meine Dame, Sie sind
schuld – so ist es! Sie, meine Dame, bringen mich vors Gericht, – unter
falschen Anschuldigungen ...‘ Da muß der Mensch zugrunde gehen, da muß
der Mensch an sich selbst zugrunde gehen und kann sich selbst nicht
erhalten, – wie kann man denn da noch heiraten! Und wie wird denn das
alles enden? Und was soll daraus jetzt werden? Ich würde viel darum
geben, wenn ich das wissen könnte! ...“
So dachte unser Held in seiner Verzweiflung. Als er plötzlich zu sich
kam, bemerkte er, daß er irgendwo auf der Liteinaja stand. Das Wetter
war schauderhaft, es taute, vom Himmel fiel Regen und Schnee zusammen,
genau wie zu jener unvergeßlichen Stunde um Mitternacht, als das Unglück
Herrn Goljädkins seinen Anfang nahm.
„Was wäre das für eine Reise,“ dachte Herr Goljädkin, nach dem Wetter
sehend, „das wäre einfach Selbstmord ... Herr des Himmels, wo soll ich
denn hier einen Wagen finden? Dort in der Ecke scheint etwas Schwarzes
zu dämmern! Wir wollen sehen! ... Herr, du mein Gott,“ fuhr unser Held
fort und lenkte seine wankenden Schritte auf die Seite hin, wo so etwas
Ähnliches wie ein Wagen stand. „Nein, ich weiß, was ich tue! Ich gehe zu
ihm, falle ihm zu Füßen und werde ihn, wenn’s nötig ist, anflehen. So
und so: in Ihre Hände lege ich mein Schicksal, in die Hände der Behörde,
Ew. Exzellenz, beschützen Sie und begnadigen Sie einen Menschen. Es wäre
ein ungesetzliches Verfahren: richten Sie mich nicht zugrunde, ich flehe
Sie an, als meinen Vater flehe ich Sie an, verlassen Sie mich nicht ...
Retten Sie meine Ehre, meinen Namen, meine Familie ... Retten Sie mich
vor dem Bösewicht, vor dem verworfenen Menschen ... Er ist ein anderer
Mensch, Ew. Exzellenz, und auch ich bin ein anderer Mensch! Er ist einer
für sich und ich bin einer für mich, wirklich, ich bin ganz für mich,
Ew. Exzellenz, ich bin etwas ganz für mich. Ew. Exzellenz, so ist’s! Das
heißt, ich kann gar nicht Er sein! Ändern Sie das, befehlen Sie, das zu
ändern mit ihm und diesem ganzen Doppeltsein! ... Zum Beispiel für
andere, Ew. Exzellenz! Ich spreche zu Ihnen, wie zu meinem Vater! Die
Behörde, die wohltätige und ehrwürdige Behörde, sollte so etwas
unterstützen ... Es liegt meiner Bitte etwas Moralisches zugrunde. Das
heißt, wie gesagt, ich wende mich an die Behörde, wie an einen Vater,
und vertraue ihr mein Schicksal an. Ich werde nicht murren, ich selbst
werde mich von allen zurückziehen, so ist’s!“
„Nun, mein Lieber, bist du frei?“
„Ja, Herr.“
„Habe den Wagen für den Abend nötig ...“
„Belieben Sie weit zu fahren, Herr?“
„Den Abend, den Abend: wie es kommt, mein Lieber, wie es kommt.“
„Wünschen Sie außerhalb der Stadt zu fahren?“
„Ja, mein Freund, vielleicht auch das. Ich weiß es selbst noch nicht
genau, mein Lieber, ich kann es deshalb ganz bestimmt noch nicht sagen.
Siehst du, mein Lieber, es kann sich noch alles zum besten wenden. Es
ist ja bekannt, mein Freund ...“
„Ja, freilich, Herr, Gott gebe es!“
„Ja, mein Freund, ja ich danke dir, mein Lieber. Aber was nimmst du
dafür, mein Lieber? ...“
„Belieben Sie sofort zu fahren?“
„Ja, sofort, das heißt, nein, an einer Stelle wartest du ein wenig ...
so, nur ein wenig, nicht lange, mein Lieber ...“
„Ja, wenn Sie mich schon auf den ganzen Abend nehmen wollen, so kann ich
bei diesem Wetter nicht weniger als sechs Rubel ...“
„Nun gut, mein Lieber, schon gut, ich danke dir, mein Lieber. Und jetzt
kannst du mich gleich fahren, mein Lieber.“
„Steigen Sie ein: erlauben Sie, ich habe hier noch ein wenig
zurechtzumachen ... Steigen Sie nur ein. Wohin befehlen Sie zu fahren?“
„Zur Ismailoffbrücke, mein Freund.“
Der Droschkenkutscher kletterte auf den Bock und setzte seine beiden
Gäule, die er nur mit aller Gewalt vom Heusack wegreißen konnte, in der
Richtung auf die Ismailoffbrücke in Bewegung. Doch plötzlich zog Herr
Goljädkin an der Schnur, ließ den Wagen anhalten und bat mit flehender
Stimme den Kutscher, nicht zur Ismailoffbrücke, sondern in eine
bestimmte andere Straße zu fahren. Der Kutscher kehrte um und in zehn
Minuten stand die Equipage Herrn Goljädkins vor dem Hause, welches Seine
Exzellenz bewohnte. Herr Goljädkin stieg aus dem Wagen, bat seinen
Kutscher inständig, zu warten und lief selbst mit zitterndem und
zagendem Herzen die Treppe hinauf, in den zweiten Stock. Er klingelte,
die Tür wurde geöffnet und unser Held befand sich im Vorzimmer der
Exzellenz.
„Ist Ihre Exzellenz zu Hause?“ wandte sich Herr Goljädkin an den
Menschen, der ihm die Tür öffnete.
„Was wünschen Sie?“ fragte ihn der Lakai, der Herrn Goljädkin vom Kopf
bis zu den Füßen betrachtete.
„Ich, mein Freund, heiße Goljädkin, Titularrat Goljädkin. Ich wünsche –
Exzellenz zu sprechen ...“
„Warten Sie bis morgen.“
„Mein Freund, ich kann nicht warten: meine Sache ist zu wichtig ...
meine Sache duldet keinen Aufschub ...“
„Ja, von wem kommen Sie denn? Haben Sie eine Aufforderung?“
„Nein, mein Freund, ich komme nur so ... Melde mich, mein Freund, sage:
so und so, um zu erklären ... Und ich werde mich dir dankbar erweisen,
mein Lieber ...“
„Es ist nicht erlaubt. Mir ist streng befohlen, niemanden vorzulassen.
Es sind Gäste da. Kommen Sie morgen um zehn Uhr ...“
„Melden Sie mich an, mein Lieber, ich kann unmöglich warten! Sie, mein
Lieber, werden sonst die Verantwortung ...“
„So geh doch, melde ihn. Bist mir auch ein Fauler!“ sagte ein anderer
Lakai, der sich auf einer Bank rekelte und bis jetzt noch kein Wort
gesagt hatte.
„Ach was, faul! Es ist nun einmal befohlen, niemanden vorzulassen,
verstehst du? Die Empfangsstunden sind am Morgen.“
„Melde ihn trotzdem! Glaubst wohl, es könnte deiner Zunge schaden!“
„Na, ich kann ihn ja anmelden, meiner Zunge wird’s nicht schaden! Es ist
aber befohlen ... Treten Sie in dieses Zimmer.“
Herr Goljädkin trat in das nächste Zimmer. Auf dem Tisch stand eine Uhr,
er sah, daß es halb neun war. In seinem Innern tobte die Unruhe. Er
wollte schon wieder umkehren, doch im selben Augenblick rief der Diener,
der an der Schwelle zum nächsten Zimmer stand, laut seinen Namen.
„Das ist mal eine Stimme!“ dachte in unbeschreiblicher Verwirrung unser
Held. „Was werde ich nur sagen? Ich werde sagen: so und so ... so ist’s
... ich bin gekommen, demütig und untertänigst zu bitten ... geruhen
Sie, mich anzuhören – ... Doch nun ist die ganze Sache verdorben, alles
in den Wind zerstreut. Oder ... was tut’s ...“ Er hatte übrigens keine
Zeit, weiter nachzudenken. Der Lakai kehrte zurück und führte Herrn
Goljädkin ins Kabinett Seiner Exzellenz.
Als unser Held eintrat, fühlte er sich wie geblendet, er konnte
überhaupt nichts sehen ... Zwei – drei Gestalten tauchten undeutlich vor
seinen Augen auf: „Nun, das sind wohl die Gäste,“ ging es Herrn
Goljädkin durch den Kopf. Schließlich konnte unser Held den Stern auf
dem schwarzen Frack der Exzellenz deutlich erkennen. Damit kam er denn
zur Besinnung und erhielt wenigstens sein Unterscheidungsvermögen wieder
...
„Was gibt’s?“ fragte eine bekannte Stimme Herrn Goljädkin.
„Titularrat Goljädkin, Ew. Exzellenz.“
„Nun?“
„Ich bin gekommen, um zu erklären ...“
„Wie? Was?“
„Ja, so ist es. Das heißt, so und so, ich bin gekommen, um zu erklären,
Ew. Exzellenz ...“
„Sie ... ja, wer sind Sie denn eigentlich?“
„Ti–ti–tu–lar–rat ... Goljädkin, Ew. Exzellenz.“
„Nun, was wünschen Sie?“
„Das heißt, so und so, ich betrachte Sie als meinen Vater: ich selbst
halte mich ganz aus der Sache, und bitte Sie nur, mich vor meinem Feinde
zu beschützen, – das ist alles!“
„Was heißt das?“
„Es ist doch bekannt ...“
„Was ist bekannt?“
Herr Goljädkin verstummte: sein Kinn fing an zu zittern ...
„Nun?“
„Ich dachte, moralisch, – Ew. Exzellenz ... ich meinte, in moralischem
Sinne: Ew. Exzellenz als Vater anerkennen ... das heißt, so und so,
beschützen Sie mich, unter Trä–ä–nen bi–bi–tte ich, so etwas zu – zu –
un–ter–stützen ...“
Seine Exzellenz wandte sich ab. Unser Held konnte für einen Augenblick
wieder nichts mehr wahrnehmen. Seine Brust war wie zusammengepreßt. Der
Atem ging ihm aus. Er wußte nicht mehr, wie er sich auf den Beinen
halten sollte ... Er schämte sich und unsagbar traurig war ihm zumute.
Gott weiß, was ihn erwartete ...
Als unser Held wieder zu sich kam, bemerkte er, daß Seine Exzellenz mit
seinen Gästen sehr lebhaft sprach und sich mit ihnen zu beraten schien.
Einen der Gäste erkannte Herr Goljädkin. Es war Andrej Philippowitsch.
Den anderen dagegen erkannte er nicht, obgleich ihm das Gesicht sehr
bekannt schien: eine hohe volle Erscheinung, in älteren Jahren, mit
buschigen Brauen, mächtigem Backenbart und scharfem, ausdrucksvollem
Gesicht. Am Halse des Unbekannten hing ein Orden und eine Zigarre stak
zwischen den Zähnen. Der Unbekannte rauchte, und ohne die Zigarre aus
dem Munde zu nehmen; nickte er bedeutsam mit dem Kopfe, von Zeit zu Zeit
zu Herrn Goljädkin hinüberblickend.
Herr Goljädkin fühlte sich fürchterlich unbehaglich. Er wandte seinen
Blick zur Seite, und dabei bemerkte er – einen sehr sonderbaren Gast. In
der Tür, die unser Held bis jetzt für einen Spiegel angesehen hatte, wie
es ihm schon einmal passiert war – erschien er – wir wissen ja schon,
wer: der Bekannte und Freund Herrn Goljädkins. Herr Goljädkin der
Jüngere hatte sich bis dahin offenbar in einem kleinen Zimmer
aufgehalten, um schnell etwas niederzuschreiben. Jetzt hatte man ihn
wohl nötig und er war – erschienen. Mit Papieren unter dem Arm, ging er
auf Seine Exzellenz zu und in Erwartung, daß sich die allgemeine
Aufmerksamkeit auf ihn lenken werde, gelang es ihm auch, sich alsbald
sehr geschickt ins Gespräch und in die Beratung mit einzumischen. Er
nahm seinen Platz hinter dem Rücken Andrej Philippowitschs ein und wurde
teilweise verdeckt von dem Unbekannten, der die Zigarre rauchte.
Ohne weiteres nahm Herr Goljädkin der Jüngere Anteil am Gespräch, dem er
mit Eifer folgte, zu dem er mit dem Kopfe nickte, während er in einem
fort lächelte und jeden Augenblick Seine Exzellenz ansah, ganz als
flehte er mit seinen Blicken um die Erlaubnis, auch ein Wörtchen
einzuflechten.
„Schurke!“ dachte Herr Goljädkin und trat unwillkürlich einen Schritt
auf ihn zu. In diesem Augenblicke kehrte sich Seine Exzellenz um und
näherte sich selbst, etwas unentschieden, Herrn Goljädkin.
„Nun, gut, gut: gehen Sie mit Gott. Ich werde Ihre Sache nachprüfen, und
Sie werde ich begleiten lassen ...“ Seine Exzellenz blickte auf den
Unbekannten mit dem Backenbart. Dieser nickte zum Zeichen seiner
Einwilligung mit dem Kopf.
Herr Goljädkin empfand es und verstand nur zu genau, daß man ihn für
etwas anderes nahm und ihn durchaus nicht so behandelte, wie es sich
gehörte. „So oder so, aber erklären muß ich mich,“ dachte er, „das
heißt: so und so, Ew. Exzellenz!“ Hierbei richtete er in der Verwirrung
seine Augen zu Boden und zu seiner äußersten Verwunderung sah er auf den
Stiefeln Seiner Exzellenz einen großen weißen Fleck.
„Sind sie wirklich geplatzt?“ dachte Herr Goljädkin. Doch bald entdeckte
Herr Goljädkin, daß die Stiefel Seiner Exzellenz durchaus nicht geplatzt
waren, sondern nur stark funkelten, ein Phänomen, das sich daraus
erklärte, daß die Stiefel von Lack waren und stark glänzten. „Das nennt
man aber blank sein,“ dachte Herr Goljädkin, und als er seinen Blick
wieder erhob, erkannte er, daß es Zeit war, zu reden, weil die Sache
sich sonst zu einem schlechten Ende wenden konnte ... Unser Held trat
also einen Schritt nach vorn.
„Das heißt ... so und so ... Ew. Exzellenz,“ sagte er. „Ich meine doch,
einen falschen Namen zu tragen, ist in unserer Zeit doch wohl nicht
erlaubt.“
Seine Exzellenz antwortete ihm nichts mehr, sondern zog nur heftig an
der Glockenschnur. Unser Held trat noch einen Schritt vor.
„Er ist ein gemeiner und verdorbener Mensch, Ew. Exzellenz,“ sagte unser
Held, ohne sich zu besinnen, ersterbend vor Furcht, und wies trotz
alledem kühn und entschlossen auf seinen unwürdigen Doppelgänger, der
sich diesen Augenblick dicht bei Seiner Exzellenz zu schaffen machte.
„So und so ... das heißt ... ich spiele auf eine bestimmte Person an.“
Auf diese Worte Herrn Goljädkins folgte eine allgemeine Bewegung. Andrej
Philippowitsch und der Unbekannte nickten sich gegenseitig zu. Seine
Exzellenz riß noch einmal ungeduldig aus allen Kräften an der
Glockenschnur, um seine Leute herbeizurufen. In diesem Augenblick trat
Herr Goljädkin der Jüngere vor.
„Ew. Exzellenz,“ sagte er, „untertänigst bitte ich um die Erlaubnis,
sprechen zu dürfen.“ In der Stimme Herrn Goljädkins des Jüngeren lag
äußerste Entschlossenheit. Alles an ihm drückte aus, daß er sich
vollkommen in seinem Recht fühlte.
„Erlauben Sie zu fragen,“ begann er von neuem, eifrig einer Antwort
Seiner Exzellenz zuvorkommend, und wandte sich diesmal an Herrn
Goljädkin selbst. „Erlauben Sie zu fragen, in wessen Gegenwart Sie sich
so auszudrücken belieben? Wissen Sie, vor wem Sie stehen und in wessen
Kabinett Sie sich befinden? ...“ Herr Goljädkin der Jüngere war außer
sich vor Erregung und ganz rot vor Zorn und Unwillen: Tränen der
Empörung traten ihm in die Augen.
„Die Herren Bassawrjukoff!“ rief in diesem Augenblick der Lakai mit
lauter Stimme, indem er in der Tür des Kabinetts erschien.
„Eine berühmte adelige Familie aus Klein-Rußland,“ dachte Herr Goljädkin
und fühlte im selben Augenblick, wie eine Hand sich ihm in sehr
freundschaftlicher Weise auf den Rücken legte. Zugleich legte sich ihm
noch eine Hand auf den Rücken und das gemeine Ebenbild von Herrn
Goljädkin lief voran und zeigte nach der Tür, als wiese er ihm den Weg –
Herr Goljädkin fühlte es deutlich, wie er gewaltsam auf die große
Ausgangstür des Kabinetts hinbewegt wurde.
„Genau so wie bei Olssuph Iwanowitsch,“ dachte er, als er sich schon im
Vorzimmer befand, begleitet von zwei Lakaien Seiner Exzellenz und von
seinem unvermeidlichen Ebenbilde.
„Den Mantel, den Mantel, den Mantel meines Freundes! Den Mantel meines
besten Freundes!“ schrie der verworfene Mensch, riß den Mantel aus den
Händen des Dieners und warf zur allgemeinen Erheiterung den Mantel Herrn
Goljädkin über den Kopf. Während Herr Goljädkin unter seinem Mantel
wieder hervorkroch, hörte er deutlich das Gelächter der Diener. Doch er
achtete nicht darauf und kümmerte sich um nichts. Ruhig trat er aus dem
Vorzimmer auf die hellerleuchtete Treppe hinaus. Herr Goljädkin der
Jüngere folgte ihm.
„Leben Sie wohl, Ew. Exzellenz!“ rief dieser Herrn Goljädkin dem Älteren
nach.
„Schurke!“ sagte unser Held außer sich.
„Nun, meinetwegen ein Schurke ...“
„Verworfener Mensch! ...“
„Nun, meinetwegen auch ein verworfener Mensch ...“ antwortete dem
würdigen Herrn Goljädkin sein unwürdiger Feind mit der ihm eigenen
Gemeinheit und sah frech, oben von der Treppe hinunter und ohne die
Augen niederzuschlagen Herrn Goljädkin an, als forderte er ihn auf, so
weiter fortzufahren. Unser Held spie aus vor Empörung und stürzte zum
Hause hinaus. Er war so zerschlagen, daß er kaum wußte, wie er in den
Wagen gelangte. Als er endlich zu sich kam, sah er, daß er an der
Fontanka entlang fuhr. „Wahrscheinlich fährt er nach der
Ismailoffbrücke,“ dachte Herr Goljädkin. Hier wollte Herr Goljädkin noch
etwas denken, doch es gelang ihm nicht: es war etwas so Entsetzliches,
das zu erklären unmöglich schien ...
„Nun, tut nichts,“ schloß unser Held und fuhr weiter zur
Ismailoffbrücke.
XIII.
... Es schien, daß das Wetter sich bessern wollte. Der nasse Schnee, der
bis jetzt in großen Massen niederfiel, wurde allmählich dünner und immer
dünner, und hörte schließlich fast ganz auf. Der Himmel wurde klarer und
hin und wieder sah man Sterne blinken. Es war jedoch noch immer feucht,
schmutzig und schwül, besonders für Herrn Goljädkin, der ohnehin nur
mühsam atmen konnte. Sein durchnäßter und schwerer Mantel umhüllte mit
einer unangenehmen warmen Feuchtigkeit seine Glieder und lastete schwer
auf dem ganz ermüdeten und vor Müdigkeit fast erschöpften Herrn
Goljädkin. Ein Schüttelfrost überlief seinen Körper mit spitzen scharfen
Nadeln. Die Erschöpfung preßte ihm kalten Schweiß auf die Stirn. Herr
Goljädkin fühlte sich so elend, daß er sogar vergaß, wie bei sonstigen
Gelegenheiten, mit der ihm eigenen Charakterfestigkeit seine
Lieblingsphrase zu wiederholen: daß sich das alles ganz bestimmt noch
zum besten wenden würde.
„Übrigens, das hat alles noch nichts zu sagen,“ behauptete unser starker
und in seiner Tapferkeit unerschütterlicher Held nur, indem er sich vom
Gesicht das kalte Wasser wischte, das in Strömen vom Rande seines runden
Hutes tropfte, der, aufgeweicht und durchnäßt wie er war, das Wasser
nicht mehr aufnehmen konnte. Da unser Held, wie gesagt, der Meinung war,
daß das alles noch nichts zu sagen hätte, so versuchte er sich
wenigstens auf den dicken Holzklotz zu setzen, der sich auf dem Hofe von
Olssuph Iwanowitsch neben einem großen Holzstoß befand.
Natürlich war von der spanischen Serenade nicht die Rede: viel eher
mußte er an seinen, wenn auch nicht großen, so doch immerhin warmen,
gemütlichen und verborgenen Winkel zurückdenken. Nebenbei gesagt, sehnte
er sich jetzt geradezu nach dem Winkel auf dem Treppenflur der Wohnung
von Olssuph Iwanowitsch, in dem unser Held, früher, zu Anfang unserer
Geschichte, zwei Stunden lang hinter einem Schrank, zwischen alten
Schirmen und allerlei Gerümpel, gestanden hatte. Die Sache war nämlich
die, daß Herr Goljädkin auch jetzt bereits zwei Stunden auf dem Hofe
Olssuph Iwanowitschs stand. Doch mit dem verborgenen und gemütlichen
Winkel waren diesmal Hindernisse verbunden, die es früher nicht gegeben
hatte. Erstens war der Schlupfwinkel wahrscheinlich bemerkt und
infolgedessen waren seit der Geschichte auf dem Balle bei Olssuph
Iwanowitsch gewisse Maßregeln getroffen worden. Zweitens mußte er auf
das verabredete Zeichen von Klara Olssuphjewna warten, denn es war doch
sicher von einem solchen verabredeten Zeichen die Rede gewesen! So war
es immer, sagte er sich, und „nicht mit uns wird es anfangen, und nicht
mit uns wird es aufhören“.
Herr Goljädkin erinnerte sich übrigens eines Romans, den er schon vor
langer Zeit gelesen hatte, in dem die Heldin unter denselben Umständen
ihrem Alfred ein Zeichen gab: mit einem rosa Band, das sie ans Fenster
befestigte. Ein rosa Band aber, in der Nacht und beim Petersburger
Klima, das ja durch seine Feuchtigkeit bekannt ist, ging denn doch nicht
an, nein: das war einfach unmöglich!
„Hier kann von Serenaden nicht die Rede sein,“ dachte unser Held,
„besser ist sicher, ich verhalte mich still! Und suche mir einen anderen
Platz!“ Und richtig, er suchte sich einen Platz aus, gerade den Fenstern
gegenüber, bei seinem Holzstoß. Natürlich gingen über den Hof
verschiedene Leute, Stalljungen und Kutscher, die Wagen rasselten, die
Pferde wieherten usw. Immerhin war der Platz sehr bequem: ob man ihn nun
bemerkte oder nicht bemerkte – jedenfalls hatte der Platz den Vorteil,
daß die Sache im Schatten vor sich ging und Herrn Goljädkin niemand
sehen konnte, er selbst aber alles sah.
Die Fenster der Wohnung waren hell erleuchtet. Es schien wieder eine
feierliche Gesellschaft bei Olssuph Iwanowitsch versammelt zu sein.
Musik war übrigens noch nicht zu vernehmen.
„Es wird wohl kein Ball stattfinden, sondern nur so eine Gesellschaft
sein,“ dachte Herr Goljädkin. „Ja, ist es denn auch heute?“ ging es ihm
dann durch den Kopf, „habe ich mich nicht im Datum getäuscht? Es kann
sein, alles kann sein ... alles ist möglich! Vielleicht war der Brief
gestern geschrieben worden und hat mich nicht erreicht, weil Petruschka
ihn vergessen hatte. So ein Schurke! Oder er ist zu morgen bestimmt ...
so, daß ich ... erst morgen alles hätte vorbereiten sollen, das heißt,
mit dem Wagen hätte warten sollen ...“
Hier überlief es unseren Helden eiskalt, er griff nach dem Briefe in der
Tasche, um sich zu überzeugen. Doch zu seiner Verwunderung fand sich
kein Brief in der Tasche.
„Wie kommt denn das?“ flüsterte zu Tode erschrocken Herr Goljädkin: „Wo
kann er sein? Sollte ich ihn verloren haben? Das fehlte noch!“ stöhnte
er auf. „Wenn er jetzt in schlechte Hände kommt? Ja, vielleicht ist es
schon geschehen! Herrgott! Was kann sich daraus ergeben! Das wäre ja ...
Ach, du mein verfluchtes Schicksal!“
Herr Goljädkin zitterte wie ein Espenblatt bei dem Gedanken, daß
vielleicht sein übelwollender Doppelgänger, als er ihm den Mantel über
den Kopf geworfen, damit das Ziel verfolgt hatte, ihm den Brief zu
entwenden, von dem er vielleicht bei den Feinden Herrn Goljädkins etwas
erfahren hatte. „Da hätte er einen Beweis!“ dachte Herr Goljädkin,
„einen Beweis ... und was für einen Beweis! ...“
Nach dem ersten Anfall dieses kalten Entsetzens stieg Herrn Goljädkin
das Blut heiß in den Kopf. Stöhnend und zähneknirschend faßte er nach
seiner glühenden Stirn, setzte sich wieder auf den Holzklotz und fing an
nachzudenken ... Aber seine Gedanken hatten keinen Zusammenhang. Es
tauchten verschiedene Gesichter auf und er erinnerte sich plötzlich bald
undeutlich, bald wieder fest umrissen längst vergessener Vorgänge –
Motive dummer Lieder, die ihm durch den Kopf gingen ... Es war ein
Elend, ein Elend, ein übernatürliches Elend! „Gott, mein Gott!“ dachte
unser Held, sich mühsam fassend, zugleich mit dem Versuch, das dumpfe
Schluchzen in der Brust zu unterdrücken, „gib mir Festigkeit in der
unerschöpflichen Tiefe meines Mißgeschicks! Daß ich verloren bin,
vollständig verloren – darüber besteht kein Zweifel, das liegt in der
Ordnung der Dinge, denn es kann ja doch nicht anders sein! Erstens habe
ich meine Stellung verloren, ganz und gar verloren, wie sollte ich auch
nicht ... Zweitens – ... Oder sollte es doch noch eine Möglichkeit
geben? Mein Geld, nehmen wir an, reicht noch für die erste Zeit: ich
nehme mir irgendeine kleine Wohnung, einige Möbel sind nötig. Petruschka
wird zwar nicht mehr bei mir sein. Doch ich kann auch ohne den Schuft
auskommen ... nun schön, ich kann ausgehen und zurückkommen, wann es mir
paßt, und Petruschka wird nichts mehr zu brummen haben, wenn ich spät
nach Hause komme. Darum ist es auch besser ohne ihn ... Nun, nehmen wir
also an, daß das alles sehr gut ginge. Nur handelt es sich noch immer
nicht darum, noch immer nicht darum! ...“
Dabei tauchte wieder das Bewußtsein der Lage in Herrn Goljädkin auf, in
der er sich unmittelbar befand. Er blickte um sich. „Ach, du mein großer
Gott! Herr, du mein Gott! Was rede ich denn jetzt davon?“ dachte er, und
griff wieder ganz und gar verloren nach seinem brummenden Kopf.
„Belieben Sie nicht bald zu fahren, Herr?“ ertönte plötzlich eine Stimme
neben ihm. Herr Goljädkin fuhr zusammen, denn vor ihm stand sein
Kutscher, gleichfalls bis auf die Haut durchnäßt. Er war vom Warten
ungeduldig geworden und wollte nach seinem Herrn hinter dem Holzstoß
sehen.
„Ich, mein Lieber, tut nichts ... Ich, mein Freund, komme bald, sehr
bald, sehr bald – warte noch ein wenig ...“
Der Kutscher ging fort und brummte etwas in den Bart.
„Was mag er da brummen?“ dachte Herr Goljädkin unter Tränen, „ich habe
ihn doch für den ganzen Abend genommen, ich bin durchaus in meinem
Recht, so ist es! Für den Abend habe ich ihn genommen, und damit ist die
Sache erledigt. Mag er da stehen, einerlei! Das hängt von meinem Willen
ab. Willigt er ein, oder willigt er nicht ein. Und wenn ich hier hinter
dem Holz stehe, so ist das ganz gleich ... – er hat hier nichts zu
meinen: will der Herr hinter dem Holz stehen, so mag er es tun ...
seiner Ehre wird das nicht schaden! So ist’s!
So ist’s meine Dame, wenn Sie es wissen wollen. Und in einer Hütte,
meine Dame, das heißt, so und so, kann in unserer Zeit niemand mehr
leben. Und ohne gute Sitten geht es in unserer erwerbstätigen Zeit auch
nicht mehr, meine Dame, wofür Sie selbst jetzt ein bedauernswertes
Beispiel sind ... Das heißt, Titularrat soll man sein, und dabei am Ufer
des Meeres in einer Hütte leben! Erstens, meine Dame, braucht man an den
Ufern des Meeres keine Titularräte und zweitens hätten wir da überhaupt
nicht zum Titularrat aufrücken können. Nehmen wir an, ich sollte
beispielsweise eine Bittschrift einreichen: das heißt, so und so, möchte
Titularrat werden ... begünstigen Sie mich trotz meiner Feinde ... dann
wird man Ihnen sagen, meine Dame, daß es ... viele Titularräte gibt, und
daß Sie hier nicht bei der Emigrantin sind, wo Sie gute Sitten lernen
sollen, um als gutes Beispiel zu dienen. Sittsamkeit, meine Dame,
bedeutet, zu Hause bleiben, den Vater ehren und nicht vor der Zeit an
Freier denken. Die Freier, meine Dame, finden sich schon mit der Zeit
von selbst – so ist’s! Freilich muß man verschiedene Talente besitzen
wie: Klavierspielen, Französisch sprechen, in der Geschichte,
Geographie, Religion und Arithmetik bewandert sein, – so ist’s! Mehr ist
auch nicht nötig. Und dazu dann die Küche. Jedenfalls sollte jedes
sittsame Mädchen die Küche beherrschen! Aber so? Erstens wird man Sie,
meine Schöne, meine verehrte Dame, nicht sich selbst überlassen, man
wird Ihnen nachsetzen und wird Sie zwingen, in ein Kloster zu gehen. Und
was, meine Dame, was befehlen Sie denn, das ich tun soll? Befehlen Sie
mir dann vielleicht, meine Dame, daß ich wie in dummen Romanen mich auf
den nächsten Hügel setzen und in Tränen zerfließen soll, indem ich auf
die kalten Mauern sehe, die Sie umschließen? Oder soll ich etwa der
Vorschrift einiger schlechter deutscher Poeten und Romanschriftsteller
folgen und freiwillig sterben? Wollen Sie das, meine Dame?
Erlauben Sie mir, Ihnen in aller Freundschaft auszudrücken, daß die
Dinge so nicht gehen, und daß man Sie und Ihre Eltern ordentlich strafen
müßte, weil sie Ihnen französische Bücher zum Lesen gegeben haben. Denn
französische Bücher lehren einen nichts Gutes. Das ist Gift ... reines
Gift, meine Dame! Oder denken Sie etwa, erlauben Sie, daß ich Sie frage,
denken Sie etwa, wir entfliehen ungestraft und ... leben dann in einer
Hütte am Meer! Fangen an, von Gefühlen zu reden, miteinander wie die
Tauben zu girren und verbringen so unser Leben in Zufriedenheit und
Glück! Und wenn dann ein Kleines kommt, dann werden wir ... – dann sagen
wir so und so, lieber Vater und Staatsrat Olssuph Iwanowitsch, ein
Kleines ist da, also nehmen Sie bei der Gelegenheit Ihren Fluch zurück
und segnen Sie uns!
Nein, meine Dame, das geht wieder nicht an und auf das Girren hoffen Sie
nicht, denn von alledem wird’s nichts geben. Heute ist der Mann der
Herr, und eine gute wohlerzogene Frau muß ihm in allem gehorchen.
Zärtlichkeiten liebt man in unserer erwerbstätigen Zeit nicht, die
Zeiten Jean Jacques Rousseaus sind vorüber. Heutzutage kommt der Mann
zum Beispiel hungrig aus dem Dienst, und ‚Herzchen‘, fragt er seine
Frau, ‚hast du nicht etwas zu essen, einen Hering, ein Gläschen
Schnaps?‘ Also müssen Sie, meine Dame, Schnaps und Hering bereit halten.
Der Mann ißt mit Appetit, um Sie aber kümmert er sich gar nicht, er sagt
nur: ‚Geh in die Küche, mein Kätzchen, und sieh nach dem Mittagessen.‘
Er küßt Sie vielleicht nur einmal in der Woche, und auch das tut er sehr
gleichgültig! ...
So ist unsere Art, meine Dame, ja, und auch das tun wir nur
gleichgültig! ... So ist es, wenn man sich’s genau überlegt, wenn es
darauf ankommt ... Ja, und was soll ich dabei? Warum, meine Dame, haben
Sie denn gerade mich mit Ihren Launen bedacht? ‚Tugendhafter, für mich
leidender und meinem Herzen teurer Mann‘ usw. Ich passe ja gar nicht zu
Ihnen, meine Dame! Sie wissen ja selbst, daß ich im Komplimentemachen
kein Meister bin und es nicht liebe, Damen gefühlvollen Unsinn
vorzuschwatzen, meine Erscheinung ist auch nicht danach. Lügenhafte
Prahlerei und Falschheit werden Sie bei mir nicht finden, das sage ich
Ihnen jetzt in aller Aufrichtigkeit. Ich besitze einen offenen Charakter
und einen gesunden Verstand: mit Intrigen gebe ich mich nicht ab. Das
heißt: ich bin kein Intrigant und darauf bin ich stolz – so ist’s! ...
Guten Menschen gegenüber trage ich keine Maske, und um Ihnen alles zu
sagen ...“
Plötzlich fuhr Herr Goljädkin zusammen. Das rote Gesicht seines
Kutschers mit ganz durchnäßtem Bart blickte wieder nach ihm hinter den
Holzstoß ...
„Ich komme sofort, mein Freund! Ich komme sofort, mein Freund, weißt du.
Ich komme sofort, sofort ...“ wiederholte Herr Goljädkin wie beschwörend
mit zitternder und weinerlicher Stimme.
Der Kutscher kratzte sich hinter den Ohren, glättete seinen Bart, trat
einen Schritt zurück, blieb wieder stehen und blickte mißtrauisch Herrn
Goljädkin an.
„Ich komme sofort, mein Freund: Ich, siehst du ... mein Freund ... ich
werde nur ein wenig, nur eine Sekunde noch – hier ... Siehst du, mein
Freund ...“
„Wahrscheinlich werden Sie gar nicht fahren?“ sagte endlich der Kutscher
und trat entschlossen auf Herrn Goljädkin zu.
„Nein, mein Freund, ich werde sofort fahren. Ich, siehst du, mein
Freund, warte nur ...“
„Ja, Herr ...“
„Ich, siehst du, mein Freund ... Aus welchem Dorfe bist du, mein
Lieber?“
„Wir sind Leibeigene ...“
„Ist dein Herr gut? ...“
„Ziemlich.“
„Ja, mein Lieber, ja. Danke der Vorsehung, mein Freund! Suche gute
Menschen! Gute Menschen sind jetzt selten geworden, mein Lieber. Er gibt
dir Essen und Trinken, mein Lieber, also ist er ein guter Mensch. Denn
oft erlebst du, mein Freund, daß auch bei Reichen die Tränen fließen ...
Du siehst hier ein beklagenswertes Beispiel. So ist’s, mein Lieber ...“
Dem Kutscher schien Herr Goljädkin leid zu tun. „Nun, wie Sie wollen,
ich werde warten. Wird es noch lange dauern?“
„Nein, mein Freund, nein. Ich werde, weißt du, nicht mehr lange warten,
mein Lieber ... Wie denkst du darüber, mein Freund? Ich werde mich auf
dich verlassen. Ich werde hier nicht länger mehr warten ...“
„Dann werden Sie also fahren?“
„Nein, mein Lieber! Nein, ich danke dir ... hier ... wieviel hast du zu
bekommen, mein Lieber?“
„Was wir abgemacht, Herr: bezahlen Sie, bitte. Ich habe lange gewartet,
Herr, Sie werden mich armen Menschen nicht schädigen, Herr.“
„Nun, da, nimm, mein Lieber, da hast du’s!“ Dabei gab ihm Herr Goljädkin
sechs Rubel und beschloß ernstlich, keine Zeit mehr zu verlieren, das
heißt, einfach fortzugehen, um so mehr, da die Sache jetzt doch schon
entschieden und der Kutscher entlassen war. Folglich brauchte er hier
nicht mehr zu warten, er kletterte also hinter dem Holz hervor, ging zum
Hoftor hinaus, wandte sich nach links und begann, ohne sich umzusehen,
keuchend und doch fast freudig, davonzulaufen.
„Vielleicht wird sich noch alles zum besten wenden,“ dachte er, „und ich
bin auf diese Weise dem Unglück entronnen.“
Und wirklich wurde Herrn Goljädkin plötzlich ganz leicht ums Herz. „Ach,
wenn doch alles wieder gut würde!“ dachte unser Held, glaubte aber
selbst kaum daran. „Ich werde von dort ...“ dachte er. „Nein, besser,
von der Seite, das heißt, so ...“
Während er sich auf diese Weise mit Zweifeln quälte und den Schlüssel zu
ihrer Lösung suchte, war unser Held bis zur Ssemjonoffbrücke gerannt und
beschloß hier, nachdem er sich’s reiflich überlegt hatte, – wieder
umzukehren.
„So wird’s besser sein!“ dachte er. „Ich komme von der anderen Seite,
das heißt, so. Dann bin ich ein unbeteiligter Zuschauer und die Sache
hat ihr Ende. Ich bin also nur Zuschauer, eine Nebenperson, weiter
nichts, und was da auch vorgehen mag – daran bin ich nicht schuldig! So
ist’s! So wird es jetzt sein!“
Nachdem er einmal beschlossen hatte, umzukehren, kehrte unser Held auch
wirklich wieder um – sehr zufrieden darüber, daß er, dank seinem
glücklichen Einfall, jetzt nur eine ganz unbeteiligte Person vorstellen
würde. „So ist es besser: so hast du nichts zu verantworten, du siehst
nur zu – weiter nichts!“ Die Rechnung war richtig, und die Sache mochte
damit ihr Ende haben!
Durch diesen Gedanken beruhigt, begab er sich wieder in den friedlichen
Schatten des ihn beschützenden Holzstoßes und begann von neuem
aufmerksam nach den Fenstern zu blicken.
Dieses Mal hatte er nicht lange zu beobachten und zu warten. Es zeigte
sich plötzlich an allen Fenstern eine lebhafte Bewegung, Gestalten
tauchten auf, die Vorhänge wurden geöffnet, eine ganze Gruppe von Leuten
drängte sich an die Fenster Olssuph Iwanowitschs, alle sahen auf den Hof
hinaus und schienen etwas zu suchen. Geschützt durch seinen Holzstoß,
begann auch unser Held seinerseits neugierig der allgemeinen Bewegung zu
folgen, er wandte voll Teilnahme seinen Kopf nach links und nach rechts,
soweit es ihm der Schatten seines Holzstoßes, der ihn verbarg, erlaubte.
Plötzlich fuhr er zusammen und hätte sich beinahe vor Schreck
hingesetzt. Ihm schien es mit einem Male, und er war sofort vollkommen
davon überzeugt, daß man, wenn man jemanden suchte, niemand anderen
suchen konnte, als ihn selbst: als Herrn Goljädkin. Denn alle blickten
nach ihm hin. Davonzulaufen war unmöglich: man hätte ihn gesehen ... Der
entsetzte Herr Goljädkin preßte sich enger und enger, so nah als es
möglich war, an das Holz und bemerkte dabei erst jetzt, daß der Schatten
des Stoßes ihn nicht mehr ganz bedeckte. Wie gern wäre unser Held nun in
ein Mauseloch gekrochen! und hätte dort ruhig und friedlich gesessen!
wenn es nur gegangen wäre! Doch ging es nicht, entschieden ging es
nicht! In seiner Angst sprang er endlich auf und sah entschlossen nach
allen Fenstern zugleich hin. Das war noch das Beste! ... Und plötzlich
errötete er über und über. Alle hatten sie ihn bemerkt, alle winkten sie
ihm mit den Händen und nickten mit den Köpfen, alle riefen sie ihm zu.
Die Fenster wurden geöffnet, Viele Stimmen hörte man rufen ... „Ich
wundere mich, warum man diese Mädchen nicht von Kindheit an
durchgeprügelt hat,“ murmelte unser Held vor sich hin, ganz und gar
verwirrt.
Plötzlich kam _er_ (es ist bekannt _wer_) die Treppe herunter gelaufen,
im Uniformrock ohne Hut, kam atemlos auf ihn zugestürzt und heuchelte
äußerste Freude darüber, daß er endlich Herrn Goljädkin erblickt hatte.
„Jakoff Petrowitsch!“ lispelte der verworfene Mensch. „Jakoff
Petrowitsch, Sie hier? Sie werden sich erkälten. Hier ist es kalt,
Jakoff Petrowitsch. Kommen Sie doch hinein!“
„Nein, Jakoff Petrowitsch, es tut mir nichts, Jakoff Petrowitsch,“
murmelte unser Held mit schüchterner Stimme.
„Aber das geht nicht! Das geht nicht! Jakoff Petrowitsch, man bittet
Sie, gefälligst einzutreten, man erwartet Sie. Erweisen Sie uns doch die
Ehre und kommen Sie, bitte, Jakoff Petrowitsch, kommen Sie!“
„Nein, Jakoff Petrowitsch, ich, sehen Sie – es wäre besser ... wenn ich
nach Hause ginge. Jakoff Petrowitsch ...“ antwortete unser Held, und
verging zugleich vor Scham und vor Schreck.
„Nein, nein, nein!“ flüsterte der widerliche Mensch, „nein, nein, nein,
für nichts in der Welt! Gehen wir!“ sagte er entschlossen und zog Herrn
Goljädkin den Älteren mit sich zur Treppe. Herr Goljädkin wollte
durchaus nicht gehen, da aber alle nach ihm sahen und ein Widerstreben
dumm gewesen wäre, so ging unser Held – übrigens, man kann nicht sagen,
daß er ging, denn er wußte selbst nicht, was mit ihm geschah. Es war ja
doch alles gleichgültig!
Noch bevor sich unser Held recht besinnen und sein Äußeres etwas in
Ordnung bringen konnte, befand er sich schon im Saal. Er sah bleich,
zerstört und verwirrt aus, seine trüben Augen irrten über die ganze
Gesellschaft – Entsetzen! Der Saal, alle Zimmer – alles, alles war
überfüllt. Menschen gab es in Unmengen, Damen, ein ganzer Blumengarten:
sie alle drängten sich um Herrn Goljädkin, sie alle strebten auf ihn zu,
sie alle wollten Herrn Goljädkin auf ihre Schultern heben, wobei er das
Gefühl hatte, er schwebe in einer bestimmten Richtung. „Doch nicht etwa
zur Tür,“ ging es Herrn Goljädkin durch den Kopf. Und wirklich, sie
trugen ihn, zwar nicht nach der Tür – wohl aber gerade zum Lehnstuhl von
Olssuph Iwanowitsch.
Neben dem Lehnstuhl an der anderen Seite stand Klara Olssuphjewna,
bleich, düster und traurig, doch wundersam geschmückt. Besonders fielen
Herrn Goljädkin die kleinen weißen Blümchen auf, die in ihren schwarzen
Haaren eine prachtvolle Wirkung übten. Auf der anderen Seite des
Lehnstuhls stand Wladimir Ssemjonowitsch, im schwarzen Frack, mit seinen
neuen Ordensbändern im Knopfloch.
Herrn Goljädkin führte man, wie gesagt, an der Hand gerade aus Olssuph
Iwanowitsch zu. Auf der einen Seite führte ihn Herr Goljädkin der
Jüngere, der sich sehr anständig und ehrbar hielt, worüber Herr
Goljädkin der Ältere außer sich vor Freude war – und auf der anderen
Seite wurde er von Andrej Philippowitsch begleitet, der eine höchst
feierliche Miene zur Schau trug.
„Was soll das?“ dachte Herr Goljädkin. Als er aber bemerkte, daß man ihn
zu Olssuph Iwanowitsch brachte, wurde er plötzlich wie von einem Blitz
erleuchtet. Der Gedanke an den entwendeten Brief tauchte in seinem Kopfe
auf. In schrecklicher Angst stand unser Held vor dem Lehnstuhl Olssuph
Iwanowitschs.
„Was werden sie jetzt mit mir tun?“ dachte er bei sich. „Natürlich
werden sie mit Aufrichtigkeit, unerschütterlicher Ehrbarkeit ... das
heißt ... so und so, usw.“
Doch was unser Held befürchtet hatte, trat nicht ein. Olssuph
Iwanowitsch schien Herrn Goljädkin sehr wohlwollend zu empfangen, und
wenn er ihm auch nicht die Hand reichte, so wiegte er doch seinen
ehrfurchteinflößenden Graukopf, feierlich und zugleich traurig, mit
einem gütigen Ausdruck. So schien es wenigstens Herrn Goljädkin. Ihm kam
es sogar vor, als ob Tränen im Blick Olssuph Iwanowitschs lägen: er
schlug seine Augen auf und bemerkte, daß auch an den Wimpern Klara
Olssuphjewnas eine Träne blinkte – und mit den Augen Wladimir
Ssemjonowitschs schien es ihm nicht anders zu sein – sogar die
unerschütterliche ruhige Würde Andrej Philippowitschs war dem
allgemeinen tränenreichen Mitgefühle verfallen, – auch der Jüngling, der
dem alten Staatsrat Olssuph Iwanowitsch so ähnlich sah, weinte bereits
bittere Tränen ... Oder schien das vielleicht alles Herrn Goljädkin nur
so, da er selbst deutlich fühlte, wie ihm die heißen Tränen über die
kalten Backen rannen ...
Die Stimme voll Tränen, versöhnt mit den Menschen und seinem Schicksal
und im Augenblick voll Liebe, nicht nur zu Olssuph Iwanowitsch, sondern
zu allen Gästen, sogar zu seinem gefährlichen Doppelgänger, der durchaus
nicht mehr böse, der gar nicht mehr der Doppelgänger zu sein schien,
sondern ein ganz gleichgültiger und liebenswürdiger Mensch, – also
wandte sich unser Held an Olssuph Iwanowitsch. Aber er vermochte nicht
auszudrücken, was seine Seele erfüllte, in der sich so viel angesammelt
hatte, er konnte nichts sagen, nicht das geringste, und nur mit einer
beredten Handbewegung wies er schweigend auf sein Herz ...
Schließlich führte Andrej Philippowitsch – wohl um das Gefühl des
Greises zu schonen – Herrn Goljädkin ein wenig zur Seite. Leise lächelnd
und irgend etwas vor sich hinmurmelnd, vielleicht auch verwundert, doch
jedenfalls ganz versöhnt mit seinem Schicksal und den Menschen, begann
unser Held die dichte Masse der Gäste zu durchschneiden. Alle gaben ihm
den Weg frei, alle sahen ihn mit so sonderbarer Neugierde und mit
unerklärlicher, rätselhafter Teilnahme an. Unser Held ging ins zweite
Zimmer: überall die gleiche Aufmerksamkeit. Er hörte undeutlich, wie
alle ihm folgten, wie sie jeden seiner Schritte beobachteten, wie sie
sich heimlich gegenseitig anstießen und über etwas sehr Merkwürdiges
sprachen, urteilten, flüsterten und die Köpfe wiegten. Herr Goljädkin
hätte furchtbar gern erfahren, wovon sie sprachen!
Als er sich umblickte, bemerkte unser Held neben sich Herrn Goljädkin
den Jüngeren. Er fühlte die Notwendigkeit, seine Hand zu ergreifen und
ihn beiseite zu führen. Herr Goljädkin bat darauf „Jakoff Petrowitsch“
inständigst, ihn bei allen seinen Unternehmungen behilflich zu sein und
ihn im kritischen Augenblick nicht zu verlassen. Herr Goljädkin der
Jüngere nickte eifrig mit dem Kopf und drückte kräftig die Hand Herrn
Goljädkins des Älteren. Vor überströmenden Gefühlen zitterte das Herz in
der Brust unseres Helden. Er glaubte zu ersticken, er fühlte, wie ihn
irgend etwas mehr und mehr beengte, wie alle die Blicke, die auf ihn
gerichtet waren, ihn verfolgten und zu Boden drückten ... Herr Goljädkin
sah im Vorübergehen auch jenen Rat, der auf seinem Kopfe eine Perücke
trug. Der Herr Rat sah ihn mit strengem, fragendem Blick an, der durch
die allgemeine Teilnahme keineswegs gemildert wurde ... Unser Held
beschloß, gerade auf ihn zuzugehen, er wollte ihm zulächeln, sich ihm
erklären, doch gelang ihm seine Absicht nicht. In dem Augenblick, als er
es tun wollte, verlor Herr Goljädkin vollständig sein Gedächtnis ... Als
er wieder zu sich kam, bemerkte er, daß er sich, in einem weiten Kreise
von Gästen, um sich selber drehte. Plötzlich rief man aus dem anderen
Zimmer nach Herrn Goljädkin. Der Ruf verbreitete sich über die ganze
Menge. Alles regte sich auf, alles geriet in Bewegung, alles stürzte zur
Tür des ersten Saales. Unser Held wurde beinahe auf den Händen
hinausgetragen, wobei der Herr Rat mit der Perücke Seite an Seite mit
ihm zu stehen kam. Endlich ergriff er seine Hand und setzte sich dem
Lehnstuhl Olssuph Iwanowitschs gegenüber, übrigens, in einer ziemlich
weiten Entfernung von ihm. Alle, die im Zimmer waren, setzten sich in
einem großen Kreise um Olssuph Iwanowitsch und Herrn Goljädkin. Alles
wurde still und ruhig, alle beobachteten ein feierliches Schweigen, alle
richteten ihre Blicke auf Olssuph Iwanowitsch und schienen etwas
Besonderes zu erwarten. Herr Goljädkin bemerkte, wie sich neben dem
Lehnstuhl von Olssuph Iwanowitsch, gerade gegenüber dem Herrn Rat, der
andere Herr Goljädkin und Andrej Philippowitsch aufstellten. Das
Schweigen dauerte an: man erwartete also wirklich etwas. „Genau so, wie
wenn in irgendeiner Familie jemand im Begriff ist, eine lange Reise
anzutreten. Man müßte nur noch aufstehen und ein Gebet sprechen,“ dachte
unser Held. Plötzlich entstand eine ungewöhnliche Bewegung und
unterbrach Herrn Goljädkins Gedankengang. Endlich schien das
Langerwartete einzutreten.
„Er kommt, er kommt!“ ging es durch die Menge.
„Wer kommt?“ ging es Herrn Goljädkin durch den Kopf und er zuckte vor
einem sonderbaren Gefühl zusammen.
„Es ist Zeit!“ sagte der Rat und sah bedeutungsvoll Andrej
Philippowitsch an. Dieser sah darauf Olssuph Iwanowitsch an. Feierlich
nickte Olssuph Iwanowitsch mit seinem Kopfe.
„Erheben wir uns,“ wandte sich der Rat an Herrn Goljädkin. Alle erhoben
sich. Dann ergriff der Rat die Hand des Herrn Goljädkin des Älteren und
Andrej Philippowitsch die Hand Herrn Goljädkins des Jüngeren und führten
sie beide feierlich mitten durch die sie umgebende Menge. Unser Held sah
verwundert um sich, doch man wies ihn sofort auf Herrn Goljädkin den
Jüngeren, der ihm bereits die Hand entgegenstreckte.
„Man will uns wohl versöhnen,“ dachte unser Held, streckte ihm
gleichfalls freundschaftlich seine Hände entgegen, und reichte ihm sogar
seine Backe zum Kusse. Dasselbe tat auch der andere Herr Goljädkin ...
Da schien es aber Herrn Goljädkin dem Älteren, daß sein treuloser Freund
ein wenig lächelte: ganz so, als lächelte er schelmisch die sie
umgebende Menge an und als tauchte etwas Böses in dem unedlen Gesicht
Herrn Goljädkins des Jüngeren auf – die Grimasse des Judaskusses ...
Im Kopfe Herrn Goljädkins dröhnte es und vor seinen Augen wurde es
dunkel: ihm schien eine endlose Reihe Goljädkinscher Ebenbilder mit
großem Geräusch durch die Tür ins Zimmer zu strömen – doch es war schon
zu spät! Der Judaskuß war schon gegeben worden, und ...
Da geschah etwas ganz Unerwartetes ... Die Türen des Saales wurden
ausgerissen und auf der Schwelle erschien ein Mensch, bei dessen Anblick
Herr Goljädkin zu Eis erstarrte. Seine Füße klebten am Boden. Ein Schrei
erstarb auf den Lippen. Übrigens hatte Herr Goljädkin schon früher alles
gewußt und Ähnliches geahnt ... Der Unbekannte näherte sich selbstbewußt
und feierlich Herrn Goljädkin. Herr Goljädkin erkannte seine Gestalt nur
zu gut. Er hatte ihn gesehen, nur zu oft gesehen, kürzlich noch gesehen
... Der Unbekannte war ein hochgewachsener Mensch in schwarzem Frack mit
einem hohen Orden am Halse und trug einen schwarzen Backenbart. Es
fehlte ihm nur noch die Zigarre im Munde, um die Ähnlichkeit voll zu
machen. Der Blick des Unbekannten ließ, wie gesagt, Herrn Goljädkin vor
Schreck erstarren. Mit wichtiger und feierlicher Miene ging der
schreckliche Mensch auf unseren bedauernswerten Helden zu ... Unser Held
reichte ihm die Hand. Der Unbekannte ergriff sie und zog ihn an sich.
Mit verlorenem Ausdruck blickte unser Held um sich.
„Das ist ... das ist Krestjan Iwanowitsch Rutenspitz, Doktor der Medizin
und Chirurgie, Ihr alter Bekannter, Jakoff Petrowitsch!“ lispelte
irgendeine widerliche Stimme Herrn Goljädkin ins Ohr. Er blickte sich
um: er war es wieder, der abscheuliche, der in der Seele verderbte
Doppelgänger Herrn Goljädkins. Eine boshafte Freude glänzte auf seinem
Gesicht, triumphierend rieb er sich die Hände, triumphierend wandte er
seinen Kopf ringsum, triumphierend trippelte er zu allen und jedem, und
es schien beinahe, als wollte er vor Entzücken anfangen zu tanzen.
Schließlich sprang er vor, entriß einem Diener das Licht, um Herrn
Goljädkin und Krestjan Iwanowitsch zu leuchten. Herr Goljädkin hörte
deutlich, wie alle, die im Saale waren, ihm folgten, sich ihm
nachdrängten, sich gegenseitig stießen und einstimmig Herrn Goljädkin
nachriefen: „Das hätte nichts zu sagen! er, Jakoff Petrowitsch, brauche
sich nicht zu fürchten, da Krestjan Iwanowitsch Rutenspitz doch sein
alter Bekannter sei! ...“
Endlich traten sie auf die große hellerleuchtete Treppe hinaus. Auch
hier war eine Menge Volk versammelt. Geräuschvoll wurde die Tür
aufgerissen und Herr Goljädkin befand sich auf der Vortreppe mit
Krestjan Iwanowitsch. Vor ihr stand eine Equipage, bespannt mit vier
Pferden, die vor Ungeduld schnauften. Der schadenfrohe Herr Goljädkin
der Jüngere lief die drei Stufen hinab und öffnete selbst den Wagen.
Krestjan Iwanowitsch forderte mit einer Handbewegung Herrn Goljädkin
auf, Platz zu nehmen.
Starr vor Schrecken blickte Herr Goljädkin zurück: die ganze
hellerleuchtete Treppe war von Menschen besetzt: neugierige Augen
blickten ihn von allen Seiten an. Selbst Olssuph Iwanowitsch saß auf dem
obersten Treppenabsatz, saß ruhig in seinem Sessel und betrachtete voll
Anteil und Aufmerksamkeit alles, was vorging. Alle warteten. Ein
Gemurmel der Ungeduld lief durch die Menge, als Herr Goljädkin
zurückblickte.
„Ich hoffe, daß hier nichts Tadelnswertes ... nichts, was Veranlassung
zur Strenge geben, nichts, was sich auf meine dienstlichen Verhältnisse
beziehen könnte –?“ brachte unser Held verwirrt hervor. Gemurmel und
Geräusch erhob sich rings, alle schüttelten verneinend den Kopf. Tränen
stürzten Herrn Goljädkin aus den Augen.
„Ist dem Fall – bin ich bereit ... ich vertraue mich vollkommen ... ich
lege mein Geschick in die Hände Krestjan Iwanowitschs ...“
Kaum hatte Herr Goljädkin das gesagt, daß er sein Geschick in die Hände
Krestjan Iwanowitschs lege, als ein fürchterlicher, ein ohrenbetäubender
Freudenschrei dem ihn umringenden Kreise entfuhr und unheilverkündend
aus der ganzen wartenden Menge widerhallte. Da faßten Krestjan
Iwanowitsch und Andrej Philippowitsch, jeder von einer Seite, Herrn
Goljädkin unter den Arm und setzten ihn in den Wagen, der Doppelgänger
aber half, nach seiner verräterischen Angewohnheit, noch von
hinterrücks. Der arme Herr Goljädkin warf zum letzten Male einen Blick
auf alle und alles und stieg, zitternd wie ein Katzenjunges, das man mit
kaltem Wasser begossen hat – wenn der Vergleich erlaubt ist – mit Hilfe
der anderen in die Equipage. Sogleich nach ihm stieg auch Krestjan
Iwanowitsch ein. Der Wagenschlag wurde zugeklappt. Ein Peitschenknall –
und die Pferde zogen an ... alles lief in Scharen zu beiden Seiten mit
... alles geleitete Herrn Goljädkin. Gellende, ganz unbändige Schreie
seiner Feinde folgten ihm als Abschiedsgrüße auf den Weg. Eine Zeitlang
hielten noch mehrere Gestalten mit dem Gefährt gleichen Schritt und
sahen in den Wagen hinein. Allmählich jedoch wurden ihrer immer weniger,
bis sie schließlich verschwanden und nur noch der schamlose Doppelgänger
Herrn Goljädkins übrig blieb. Die Hände in den Taschen seiner grünen
Uniformbeinkleider, so lief er mit zufriedenem Gesicht bald links, bald
rechts neben dem Wagen einher: hin und wieder legte er die Hand auf den
Wagenschlag, steckte den Kopf fast durch das Fenster und warf Herrn
Goljädkin zum Abschied Kußhände zu. Doch auch er wurde schließlich des
Laufens müde und tauchte immer seltener auf – bis er endlich verschwand
und fortblieb ...
Dumpf fühlte Herr Goljädkin sein Herz klopfen. Das Blut pochte heiß in
seinem Kopf. Er empfand eine beklemmende Schwüle und glaubte, ersticken
zu müssen. Er wollte die Kleider aufreißen und seine Brust entblößen, um
sie mit Schnee zu kühlen. Dann kam endlich, wie ein großes Vergessen,
Bewußtlosigkeit über ihn ...
Als er wieder zu sich kam, sah er, daß der Wagen auf einem ihm
unbekannten Wege fuhr. Links und rechts zogen sich dunkle Wälder hin. Es
war öde und leer. Plötzlich erstarrte er vor Schreck: zwei flammende
Augen sahen ihn aus dem Dunkel an und in diesen zwei Augen funkelte
teuflische Freude.
„Das ist gar nicht Krestjan Iwanowitsch. Wer ist das? Oder ist er es
doch? Ja! Das ist Krestjan Iwanowitsch! Nur ist es nicht der frühere,
sondern ein anderer Krestjan Iwanowitsch! Ein entsetzlicher Krestjan
Iwanowitsch ist es! ...“
„Krestjan Iwanowitsch, ich ... ich bin, glaube ich, ein Mensch für mich
... und ein Nichts – Krestjan Iwanowitsch, ein Nichts von einem
Menschen,“ begann unser Held zaghaft und zitternd, wohl, um durch seine
Unterwürfigkeit und Demut den entsetzlichen Krestjan Iwanowitsch zum
Mitleid zu bewegen.
„Sie bekommen von der Krone freie Wohnung, Beheizung, Beleuchtung,
Bedienung, was wollen Sie denn noch?“ ertönte wie ein Todesurteil streng
und furchtbar die Antwort Krestjan Iwanowitschs.
Unser Held stieß einen Schrei aus und griff sich an den Kopf. Das war
es: und das hatte er schon lange geahnt!
Fußnoten
[1] Ein Stadtteil von Petersburg. E. K. R.
[2] Die Hauptstraßen auf Wassilij-Ostroff werden „Linien“ genannt. E. K.
R.
[3] Diminutiv von Pjotr. E. K. R.
[4] Größte Kaufhalle in Petersburg. E. K. R.
[5] Eine der Meistererzählungen Gogols. E. K. R.
[6] Abkürzung von Glafira. E. K. R.
[7] (sprich: Lichatschi) die beste und teuerste Art Droschken in den
größeren Städten. E. K. R.
[8] Der Vorwurf bezieht sich auf die Erzählung „Der Mantel“, die Warwara
Alexejewna ihm gesandt und auf die sie ihn noch ausdrücklich aufmerksam
gemacht hatte. Der Held der Erzählung – gleichfalls ein kleiner Beamter
– gleicht Makar Alexejewitsch so auffallend, daß dieser glaubt, Gogol
habe ihn, Makar Alexejewitsch, geschildert und damit bloßgestellt. –
Fedor Fedorowitsch ist der Name eines der Vorgesetzten jenes kleinen
Helden der Erzählung. E. K. R.
[9] Ein Stadtteil von St. Petersburg. E. K. R.
[10] Große Kaufhalle in Petersburg. E. K. R.
[11] Berühmte Kolonialwarenhandlungen in St. Petersburg. E. K. R.
[12] Armer Schlucker. E. K. R.
[13] Das Warnungszeichen von der Peter-Paulus-Festung, daß das Wasser
der Newa steigt und die niedriger gelegenen Stadtteile zu überschwemmen
droht. E. K. R.
[14] Der eigentliche Name des falschen Demetrius. E. K. R.
Anmerkungen zur Transkription
Die „Sämtlichen Werke“ erschienen in der hier verwendeten ursprünglichen
Fassung der Übersetzung von E. K. Rahsin in mehreren Auflagen und
Ausgaben 1906–1922 im Piper-Verlag. Dieses Buch wurde transkribiert
nach:
F. M. Dostojewski: Sämtliche Werke.
Zweite Abteilung: Vierzehnter Band
R. Piper & Co. Verlag, München, 1920.
Sechstes bis zehntes Tausend
Die Anordnung der Titelinformationen wurde innerhalb der „Sämtlichen
Werke“ vereinheitlicht und entspricht nicht der Anordnung in den
ursprünglichen Ausgaben. Alle editionsspezifischen Angaben wie Jahr,
Copyright, Auflage usw. sind aber erhalten und wurden gesammelt direkt
nach der Titelseite eingefügt.
Fußnoten wurden am Ende des Buches gesammelt.
Das Inhaltsverzeichnis wurde an den Anfang des Bandes verschoben.
Inhaltsverzeichnis und Überschriften im Text wurden harmonisiert.
Zu den Anführungszeichen: Gespräche wurden in doppelte Anführungszeichen
(„“) eingeschlossen. Die Wiedergabe von Äußerungen anderer innerhalb von
Gesprächen wurde in einfache Anführungszeichen (‚‘) eingeschlossen.
Besonderheiten der Transliteration russischer Begriffe und Namen: Der
Buchstabe „ä“ (oder auch „jä“) steht für den kyrillischen Buchstaben
„ja“. Die Schreibweise häufig vorkommender Namen wurde vereinheitlicht
(nicht verwendete Varianten in Klammern):
Ssjetotschkin (Ssetotschkin)
Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Weitere
Änderungen, teilweise unter Zuhilfenahme anderer Auflagen oder des
russischen Originaltextes, sind hier aufgeführt (vorher/nachher):
[S. 87]:
... Was wollen Sie denn noch von mir? Fedora sagt, das ...
... Was wollen sie denn noch von mir? Fedora sagt, das ...
[S. 98]:
... geschehen? Nun, sagen wird zum Beispiel, und nehmen ...
... geschehen? Nun, sagen wir zum Beispiel, und nehmen ...
[S. 124]:
... Ihr Gehalt, daß Sie sich noch dazu vorauszahlen ...
... Ihr Gehalt, das Sie sich noch dazu vorauszahlen ...
[S. 180]:
... weil Sie schutzlos sind, weil sie keinen starken ...
... weil Sie schutzlos sind, weil Sie keinen starken ...
[S. 261]:
... ihm auch, Herr Goljädkin zum Sitzen zu bringen: er ...
... ihm auch, Herrn Goljädkin zum Sitzen zu bringen: er ...
[S. 314]:
... der nächsten Laterne, so daß man ihm deutlich erkennen ...
... der nächsten Laterne, so daß man ihn deutlich erkennen ...
[S. 417]:
... etwas endgültig vor ihm Erworbenes an. ...
... etwas endgültig von ihm Erworbenes an. ...
[S. 418]:
... „Ja, heute ging der Kanzleidiener Micheleff zu ...
... „Ja, heute ging der Kanzleidiener Michejeff zu ...
[S. 431]:
... trat in Begleitung einiger Beamten heraus. Alle, die ...
... trat in Begleitung einiger Beamter heraus. Alle, die ...
[S. 465]:
... auf dem Liteinij Prospekt stand. Das Wetter war ...
... auf der Liteinaja stand. Das Wetter war ...
*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 35339 ***
Excerpt
Unter Mitarbeiterschaft von Dmitri Mereschkowski,
herausgegeben von Moeller van den Bruck
Arme Leute
Der Doppelgänger
R. Piper & Co. Verlag, München, 1920
Sechstes bis zehntes Tausend
Copyright 1920 by R. Piper & Co., G. m. b. H.
Verlag in München
Vorbemerkung V
Arme Leute 1
Der Doppelgänger 237
Der Band bringt die ersten...
Read the Full Text
— End of Arme Leute —
Book Information
- Title
- Arme Leute
- Author(s)
- Dostoyevsky, Fyodor
- Language
- German
- Type
- Text
- Release Date
- February 20, 2011
- Word Count
- 125,642 words
- Library of Congress Classification
- PG
- Bookshelves
- DE Prosa, Browsing: Culture/Civilization/Society, Browsing: Literature, Browsing: Fiction
- Rights
- Public domain in the USA.
Related Books

Isänmaattomat
by Bang, Herman
Finnish
1246h 1m read
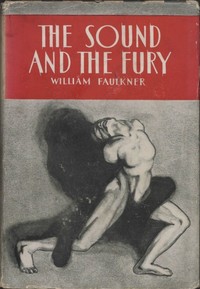
The sound and the fury
by Faulkner, William
English
1651h 56m read
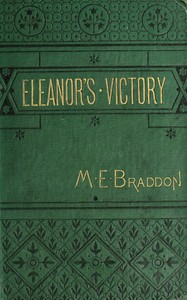
Eleanor's victory
by Braddon, M. E. (Mary Elizabeth)
English
3083h 47m read

Pán
by Hamsun, Knut
Hungarian
749h 20m read

Elämänhurman häipyessä
by Lehmann, Rosamond
Finnish
1763h 9m read
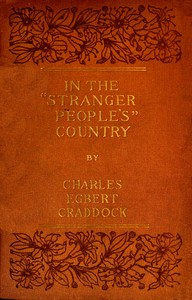
In the "Stranger People's" country
by Craddock, Charles Egbert
English
1663h 23m read
